Einführung in die hieroglyphisch-ägyptische Schrift und Sprache
Skriptum zur Einführung in Hegels Wissenschaft der Logik (1995)
Transcript of Skriptum zur Einführung in Hegels Wissenschaft der Logik (1995)
Zur Einführung inHegels Wissenschaft der Logik
Seminarunterlage zum Seminar"Hegels Wissenschaft der Logik"
Leiter der LV: Doz. Friedrich Grimm1ingerVerfasser: Thomas AuingerLayout: Ursu1a Kam1eithnergeschrieben im Sept.1995
I N H ALT :
Vom Grund zur Existenz •.•.•.•.......••.•.•.•...•.........••..•............ 28
Stellungen des Logischen: Formale, transzendentale, dialektische Logik ....•lLogik und Metaphysik bei Hegel ....•.•••.•...•....•.....•...........••.•.... 4Sein - Wesen - Begriff •••••.•..•.••...••.•••.•.........•.•....••••.•••..... 5Der Hegel'sche Begriff .••.•..•.•.•.....•.••...•...•........•.•••......•.... 7Die Kategorie des Andersseins ••••.•.•.•••...•.•....•..•...•.••.•.....•....• 9Differenzierungen des Ansichseins •.•.•••.•..•.••..••.•••.•............•... llDer Übergang vom Sein zum Wesen- Die absolute Indifferenz ...••.•••.••.•.•• 12Die Anfänge des Wesens- Schein und Ref1exion .••••..•..••...••••••••••••.•• 14Die Ref1exionsbestimmungen .••.•.•••.••••.•...•...•••.....••..••.•.•.•.•••. 19Auflösung des Widerspruchs 25
- 1 -
Formale LogikA4\A K,2Jih IlieJi gUj'!eich R ,,.,l !vdt-/1. Se,"
Ftw.zs ist el'iiwf:l':~~A (Je/er Nie!.,i -Aj~!. gibt ):ÜI Drdtesqihil Se'hf.! "."diO'he.
ANMERKUNGEN
Stellungen des Logischen:FormaleJ transzendentaleJ dialektische Logik
Die FORMALE LOGIK ist derjenige Standpunkt, der jeglicheBestimmungen als bloß AUßERE Formen ansieht. D.h.,daß dadurch immer schon etwas Zugrundeliegendes,ein Substrat, vorausgesetzt werden muß, an welchemBestimmungen vorgenommen werden. Dieses Bestimmenist dabei eine SUBJEKTIVE Tätigkeit, die nach Regelnund GESETZEN ab1äuft~ deren oberste die sogenanntenAxiome des Denkens .bi1den. Dies sind der Satz derIdentität~ der Satz vom Widerspruch, der Satz vomausgeschlossenen Dritten und der Satz vom zureichendenGrund. Alle diese unumstößlichen Prinzipien sollengleichermaßen Gültigkeit haben, woraus sich ergibt,daß sie nicht miteinander konfrontiert werden dürfen.Im zweiten Teil der "Wissenschaft der Logik" zeigtHege1 explizit deren Widersprüchlichkeit und notwendigesGelten und Nicht-gelten auf.Darüber hinaus bildet die LEHRE VOM BEGRIFF. URTEILund SCHLUß das Zentrum der klassischen formalen Logik.Dabei werden die Begriffe über die Momente vonABSTRAKTION, KOMPARATION und REFLEXION gebildet undnach allerlei Gesichtspunkten eingeteilt, wie z.B.dem Inhalt und dem Umfang nach oder der Unterscheidungnach engen und weiten Begriffen, deutlichen und un-deutlichen usf.Im Zuge dessen werden diese ARTEN der Begriffe neben-einander ohne Ableitung aufgezählt, obwohl geradeeine solche die Forderung der formalen Logik wäre.Der weitere Fortgang zu Urteilen und Schlüssen stehtunter der Ägide der ZUSAMMENSETZUNG. So soll dasUrteil bloß die Verbindung zweier Begriffe durchdie Kopula sein und der Schluß wiederum nur aus dreiUrteilen bestehen.-
Die TRANSZENDENT~LE ~OGIK destrui:rt nu~ die von I Tra~szendentaleder· formalen LOglk (bel KANT a11gemelne LOglk genannt) LOglkgesetzte Getrenntheit von FORM und INHALT. Denn dietranszendenta 1e Logik abstrahiert nicht von allem '\''/{ant:. hat:. l.IJ7.1 JU den:"Inha1t der Erkenntnis", sondern behandelt gerade Ci.rlAi..chi:..rt.ei.f.~die FRAGE DES GEGENSTANDSBEZUGS selbst. daß die. ftym:Jk La;;ikDie logischen Bestimmungen betreffen nun diejenigen ~~~Begriffe des Verstandes, "daduach. uü:« ~er;.en.A.tän.d.e v~iAt tnd.vö~ a {J/Uo/Li.. denheri:" (K.I1.VA57/ ß81) l.IJ7.1 dani;t in: det. SandEs stellt sich nicht mehr die Frage nach der Einordnung ~ JU ~ obschon gegebener Erkenntnisse in einen Kanon von Regeln e1 üI:XYz. diese Vewn. _und Gesetzen, sondern vie1mehr die Frage nach dem ~ hinai« noch.Erkennen selbst. oo eiI.tx:M uiie. &k.etII1ir1iA
gäbe. "(aJ.J4:Liebauch», Spiache.u.~,ßi.6/1
5.15i
i;« D8n,L~"s V~rS~5J
,,"5- 6::!"!'~-z~~;:.:~i?
''DeIz. eMtJz. 5cfIIli.ft. awz.~~eines. DiA~ d.h..awz. ~ diese:DiA~ duad: einet:KaI.kiU. (Zei.chRnApi..eJJ,beAtehi:. dann.daain; daßarn: ei.r1i.gIz den: JU ihs:~ /3ehnuptLtngRnan. die. 5~ dßUtal» lIx.i.an2. iai Sinne Kn
~aJ.J4denen: d.ch. dann.alkwei.iwtRn. ~/3ehnuptLtngRn bkJ3 duad:
~~dunch: cW Zi.RMrl. vcn.SdUiJMen. ~~"(aJ.J4:fltbi.May,Def1ni;tkn
5.$)
Der entscheidende Schritt besteht nun noch darin,das reine PRINZIP der Einheit herauszustellen, welchesKant die URSPRÜNGLICH-SYNTHETISCHE EINHEIT DERAPPERZEPTION nennt. Es ist dies das "Ich denke",das alle meine Vorstellungen begleiten können muß,die logische Form aller Formen.Es ist der Garant dafür, nicht nur von Gefühlen,Anschauungen und Vorstellungen, sondern von OBJEKTENzu reden.Mit dieser Fassung der Einheit des Selbstbewußtseinsbefinden wir uns aber bereits auf demjenigen Standpunkt,von welchem aus die DIALEKTISCHE LOGIK, im Gegensatzzur formalen Logik vom Begriff sprlcht. Denn derfür sich existierende Begriff ist nichts anderesals das ICH oder das reine Selbstbewußtsein.Der Begriff in dieser Konkretion (als reines Selbst-bewußtsein, als Ich) gedacht, bleibt nicht mehr diebloß abstrakte und tote Form der Zusammenfassung,sondern ist vielmehr als IN SICH SELBST TÄTIG der."einfache Lebenspuls" alles Logischen überhaupt. IDer Aufweis dieses Begriffs 1äßt sich frei1ich nicht ''fli.e Denkfo;men.I7ÜMmmehr über das b1inde Aufzäh1en von gar noch zäh1baren at und. fii;t. 4i.J:h. be-Kategorien bewerkste11igen, sondern fordert deren :tIuJt:hi:R;tlJJI2J1!kn.. oie:immanente Deduktion, die nur dann zum Vorschein -sind.dea. ~ u:kommt, wenn die reinen Denkbestimmungen der Logik die T~ei.;t de«AN IHNEN SELBST betrachtet werden, d.h. im Gange ~ &1bd;ihrer Darstellung "nicht von Ihnen: ab~en. und -sie:&1bd. ~nach UfM:täru:i.en, Exempeln: und VeIl.~ei..c.fwn.f),en. JU f)/l-ei..f.en., 4i.ch., rri.iMI?J7.. at ihnen:-sondenn: 4.i..e a),le.i..n VOIZ. dch JU haben. und, WM in &J.iJd:. 4i.J:h.ihse. ~ge.Ihnen: immaneru: .i..4-t, pun Bewuß~e.i..n JU b/Li..n.g.en.." lxMti.umRnund. Ihnen:(Hefl-el., W.i..44enAchaf.-t:. des: Lof}i..k. JJ, 5uJvz.k.amp 5. 557) ~ OJ.J/wei&n."
(Heg;d,&VZ.§41 ~,5u!vzk.anp 5. 114)
- 2 -
Diese Logik kann insofern als eine Logik des Erkennensbetrachtet werden, als sie nicht wie die allgemeineLogik "vecsdüedene VOMt:.~en U N T c <R. einen:BerJAl-f.f." subsumiert, sondern "di:e neine 5yn;th<ML-jdell. VOMt:.~en AUF BerJAl-f.f.e" bringt,(KrVA78/B104}d.h. die Mannigfaltigkeit gegebener Vorstellungensynthetisiert und deren Einheit als Erkenntnis re-sultieren läßt. Die einheitsstiftenden Momente indiesem Prozeß sind nun die REINEN VERSTANDESBEGRIFFEoder KATEGORIEN, die als deren zwölf unter vier Titelzusammengefaßt sind:
flJt1!:lI Jtr-~Ne;;aJim.
/..imi.;I:a;tü:
(JJt1IVf5[){(&nhRi;tV~AlllW.;t
fflt[[2f)VJr7hfiIwW5ub4iAtRn3-1<aw.nJ.i.tiii:~
~~Jtr
~eii:/~ei.;tIJ:MeWN.i.chi:&Wz.
~eii:/~ei.;t
ANMERKUNGEN
F{,,-,Jd;~'oW3'Jd(lf::L tle~' I.JrtedcQ.ti'iJtJJ?rff(~fil1fj-:e;".eJ;'Q.~Bes(Jndtt-eG,nt:elne
ReL.~t(cy:=--~ki{a-'r/;;(t,~Hff~ theü~heVis$'wdd(V-c...
G.vooTliT-- B!'S"T..;;J<
VeY'Q~''te'F.cleU.",.,dl'd.< HoJaiiDfT-p;:;rk...:."-toM."
I1ssertnr,srk-Ap04Zktt;schC
2:.(,.i ~.t-rdil$a01Jenia!e /:-:;""I,df C'/tfS 5e1kstb~\!(ii(f)t_tt:äl"J!1(916)s;hQ.,.· tlb'~e: Form I'~", S";'f;tlC cl('f; ~/,hth:;;..t:{~1'e'(er:
DialektischeLogik
'7- :> -
Werden aber die Denkbestimmungen in ihrer Anundfürsich-betrachtung nur verständig fixiert und deren Unter-schiedenheit voneinander starr festgehalten, so istdies erst ein Moment jedes Logisch-Reellen.So ist das Setzen der IDENTITÄT und das Insistierenauf der einfachen Beziehung auf sich das einseitigePRINZIP DES VERSTANDES. Darin setzt er DAS ABSTRAKTALLGEMEINE DEM BESONDEREN GEGENUBER, wodurch dieses I'
Allgemeine wiederum nur Besonderes bleibt. .Soll aber zu einer konkreten Allgemeinheit fortge- Ischritten werden, müssen sich diese Fixationen ver- Iflüssigen, und zwar nicht als subjektives Gegenargument, Isondern als das eigene SICH-AUFHEBEN der endlichen 1Bestimmungen und ihr ÜBERGEHEN IN IHRE ENTGEGEN- IGESETZTEN. IDie Dialektik ist das immanente Hinausgehen überdie Einseitigkeit und Beschränktheit der Verstandes-bestimmungen, deren IMMANENTE NEGATION. Insofernist es das Prinzip aller Bewegung, wodurch äußerlicheAneinanderfügungen überwunden und der notwendige IFortgang.der Sache selbst verbürgt wird. 1
Das zweite Moment wird von Hegel auch das NEGATIV I•• IVERNUNFTIGE genannt. i
Indem nun aber die aufgezeigten Entgegensetzungen Iin ihrer Einheit gefaßt werden, so sehen wir darin Idie Leistungen der POSITIVEN VERNUNFT. IDenn die Negationen der Dialektik sind niemals nur 1
1das leere Nichts, sondern erzeugen darin ebensosehrdas Affirmative, d.h. die Identität Entgegengesetzter. iDas Positiv-Vernünftige ist ein KONKRETES, weil es Inicht einfache, formelle Einheit, sondern EINHEITUNTERSCHIEDENER BESTIMMUNGEN ist.-
"DM Ci.n..~e, UM DCNWJ55CN5CHAFTL.:JCHCNF(JRT9W~ZU ~CWJNNDI - und um dessen: gmLJ. ESNFACHet.i..rzA.i...ch;t 4i..ch.. We.1ent1.i..ch.. p..l bemühen: iAt:. -iAt:. die &z.k~ deo ../...og,iAch..en.5a:t.1-e.1,daß da-s Ner;.a;tive eben-so-sehe po/.!i.tiv Ls«: odeadaß da» -sich: Wi.d.etl./.lp;z.ech..eruie4i..ch.. rüchi: In:Nu.1.l.., in: das ab/.!:bz.ak.t:.eN.i..c.h:t4autlöd, -sondean:We.1ent1.i..ch..nun. in: die Ner;.ati..on -seine» BESO'VOC'RCNJ~, oden: daß eine -so.lche: Ner;.ati..on nLch;t<Lil.e Ner;.a;tion, .sondenn: DJe Ne91TJON OC'RßC-5TJfrltJTCN SACHe, die -ü.ch: autlö/.!t:., /.!om.i..t.be-/.!:ti.Jnm;te N~ati..on iAt:.; •• "(Her;.e../...,WiA/.!en./.lch..af.;tden: LogJ..k.J, 5uJvz.k.amp5.49 )
.~-,~~~~~.. ,"'--~"~I
ANMERKUNGEN3 Momente desLogischen1.Moment
2.Moment''IJi..e UXJ!WIaIi:e /1uf..-~ abea..iAt diese;daß dar.J Lebei. al»~ de: Keim. dRATcrkA in. 4i..ch bzii;;t. 'u;daß übeMaupt dar.JfndI.i.cfI2. 4i..ch in. &..eh&JiY.d:. wi.dRM{Y1kh;t 11.
cla::!wu:h 4i..ch au/h2bt. II(H~ENZ. §81 2u&t:.p~S.173)
3.~10ment
---------_ .•.~~ ..._.-. _.~' ...~.
- 4 -
Logik und Metaphysik bei Hegel:
Die Entwicklungsgeschichte der Wissenschaft der Logikzeigt eindeutig, daß Hegels Auffassung vornStellenwertder Logik im Verlaufe seiner Beschäftigung mit diesemGebiet keineswegs gleich geblieben ist. Der wichtigstePunkt betraf dabei das Verhältnis von Logik und Meta-physik. Die unterschiedlichen Antworten, die sichfür Hegel auf diese Frage ergaben, können keinen.exakten Zeitpunkten zugeordnet· werden. Fest stehtnur, daß arnAnfang seiner Jenaer Lehrtätigkeit (1801/2)seine Vorlesungen zu diesem Thema eine KLARE TRENNUNGVON LOGIK UND METAPHYSIK erkennen lassen. Näherhinhatte die Logik hier noch den Rang einer "Einleitungzur Wissenschaft der Idee". Als in diesem Sinn nochvorbereitende Disziplin sollte sie die Aufhebungder Formen der Endlichkeit zur Darstellung bringen,um dadurch der adäquaten Behandlung der klassischenThemen der Metaphysik (Seele/Welt/Gott) Platz zugeben.Wann genau Hegel diese Konzeption nun aufgegebenhat, ist wiederum nicht eindeutig zu erweisen. Wichtigist jedoch, daß sich allmählich die INTEGRATION DERMETAPHYSIK IN DIE LOGIK vollzog, bis Hegel schließlichvon ihrem ZUSAMMENFALLEN sprechen konnte:
"Dc« !JY;JK f.äLU. dahen. mi...:t den: ftJcTA7WY5JKpMammen, den: DJNg:, iIL g:;DANKCN fJ-ef.aJ3:t, uielche:dal1Vt. fJ-cUten, di:e. WESCNHE:JTCN OCr<DJNt;c ClJ.L.;j-
~ck.en. "(Heg.e.l., CNZ. §24, Suhnkamp 5.81 )
Diese Einsicht trägt nun wesentlich zum Verständnisder Wissenschaft der Logik in ihrer ausgearbeitetenForm bei. Denn die Logik bildet hier nicht einfachhinden alleinigen Titel,worunter dann die Themen derLogik und Metaphysik nebeneinander abgehandelt würden,sondern das Metaphysische scheint auf den erstenBlick ganz und gar verschwunden zu sein.Ist also die Metaphysik als solche aus der eigentlichenWissenschaft verbannt?Bei genauerem Hinsehen wird uns, im Zuge dieser Frage-stellung die eigentümliche "Verfahrensweise" derLogik klar werden. Denn indern sie die Zielsetzunghat, ALLE Denkbestimmungen an und für sich selbstzu betrachten, muß sie darauf verzichten, in un-kritischer Weise fertig gegebene Inhalte einfachaufzunehmen. Vielmehr wird sich zeigen müssen, wasan diesen Denkbestimmungen unabhängig von ihren
Substraten (wie Seele/Welt/Gott) liegt, und inwelchem Maße sie überhaupt noch als der Wissenschaftangehörig ausgewiesen werden können. Die Beurteilungdieser Frage kann aber nicht vorweggenommen werden,sondern wird sich allein im interpretierenden Nachvoll-zug der W.d.L. herausstellen. Im vorhinein kann nurgesagt werden, daß es im wesentlichen die "OBJEKTIVELOGIK" ist, welche an die Stelle der vormaligen Meta-physik getreten ist.--
ANMERKUNGEN
- 5 - ., ANMERKUNGEN
Zur OBJEKTIVEN Logik:Die SEINSLOGIK enthält~ verglichen mit der kantischenKategorientafel, die mathematischen Kategorien derQUALITÄT und QUANTITÄT und als die Vereinigung beider,die Kategorie des MASSES.(Auf eine nähere Darstellung dieser Abschnitte wirdhier verzichtet, dennoch findet sich im Kapitel überdie Kategorie des Andersseins das zentrale Paar vonEtwas und Anderem behandelt).Das Seinsspezifische kennzeichnet sich durch dieBewegung des ÜBERGEHENS: Und zwar ist der Übergangins Wesen kein punktueller Umbruch, sondern der Wegdes allmählichen Zurücknehmens seinsspezifischerAspekte mit gleichzeitigem Hervortreten dessen, wasdas Wesen ausmacht (nämlich Relationalität u. Relations-logik s.u.). Dies zeichnet sich bereits im Kapitelder Kategorie des Maßes ab.-Die WESENSLOGIK behandelt in ihrem dritten Abschnittdie dynamischen Kategorien der MODALITÄT und RELATIONund im ersten Abschnitt die REFLEXIONSBESTIMMUNGEN(oder Wesenheiten), die bei Kant noch unter dem Titelder Amphibolie der Reflexionsbegriffe auftraten.Der mittlere Abschnitt endlich ist der ERSCHEINUNGgewidmet, die wiederum die Existenz~ die Erscheinungim engeren Sinn und das wesentliche Verhältnisbeinhaltet.(Das Skriptum soll im folgenden den ersten Abschnittder Wesenslogik etwas näher vorstellen).Der Fortgang des Wesens heißt SCHEINEN-lN-ANDERES:Die Bestimmungen des Wesens sind durch derenRelationalität gekennzeichnet; sie gehen NICHT inandere(s} über, sondern haben das Andere schon jeweilsAN IHNEN selbst.Der Anfang des Wesens hatte sich alleine über dasErnstnehmen der NICHTIGKEIT DES SEINS konstituiert.Das Wesen bedeutet also keineswegs einen schon voraus-gesetzten Gehalt, auf welchen in der Seinslogik (un~bewußt hingearbeitet worden wäre, sondern das Wesenbesteht nur in der Aufhebung des Seins.Im Behandeln dessen aber, was das Wesensmäßige ausmacht,INTENSIVIERT sich wieder das SEINSmäßige Moment.Das Wesen ist zu Beginn der Darstellung im Statusdes Ansichseins (es ist das Ansichsein des Anundfürsich-seins; vgl.Kapitel: Differenzierungen des Ansichseins),weil sich das Wesen erst im Fortschreiten Daseinzu geben hat.
Sein - Wesen - BegriffDie gesamte Wissenschaft der Logik wird in OBJEKTIVEund SUBJEKTIVE Logik unterschieden. Die objektiveLogik besteht aus den Abschnitten SEIN und WESEN,die subjektive Logik fällt mit der Lehre vom BEGRIFFzusammen.
- 6 -
In diesem Durchgang haben sich Sein und Wesen vollkommenvermittelt. Die daraus resultierende Einheit istder Begriff.Zur SUBJEKTIVEN Logik:Die Gliederung der subjektiven Logik, der BEGRIFFSLOGIK.in die drei Abschnitte Subjektivität-Objektivität-Idee mag vorerst seltsam anmuten, da die gesamteLogik bereits in subjektive und objektive Logik geteilt"ist und nun wieder, INNERHALB der subjektiven Logik,das Paar Subjektivität-Objektivität auftritt. ZurErklärung sei folgendes ausgeführt:Da die OBJEKTIVE Logik im Substantialitätsverhältniskulminiert, dessen Verhältnisweise die Notwendigkeitist, und sich gerade dieses Substantialitätsverhältnisauflöst, so resultiert daraus eine neue Verhältnisweise,nämlich jene der Freiheit-und also: SUBJEKTIVITÄT.Der SUBJEKTIVE Begriff aber ist erst der FORMELLE,er hat sich die ihm angemessene Realität (Objektivität)zu geben. Diese Bewegung des Begriffs heißt ENTWICKLUNG:Der Begriff hat sich zu Beginn als das zu setzen,was er selbst ist,nämlich (s.o.) als die Einheitvon Sein und Wesen. Da gerade Sein und Wesen(s.o.-objektive Logik) die Objektivität verkörpern,so wird in der Sphäre des Begriffs die ihm eigeneObjektivität hervortreten müssen: Der Begriff wird ..sich zu seiner eigenen immanenten Objektivität be-stimmen.Also: Subjektivität-Objektivität- und als die Einheitdes Begriffs mit seiner Realität, die Idee.Insofern zeigt· sich, was für Hegel überhaupt derGegenstand der Logik ist, die reine Idee.-
ANMERKUNGEN
- 7 - ANMERKUNGEN
Demgegenüber ist der Hegel'sche Begriff der sichan ihm selbst- BESONDERNDE, weil die Bestimmtheitnicht von außen gesetzt wird, sondern vielmehr alssein eigenes Erzeugen resultiert. Dabei bleibt erin seiner Bestimmtheit noch ebensosehr Allgemeines.Beispiel: Der Begriff IIMensch" bedeutet nicht dieabstrakte Allgemeinheit im Sinne einer allen Individuengemeinsamen Pseudoeigenschaft, sondern ist die konkreteAllgemeinheit, die jeder Einzelne in seiner BesonderheitIST.Daß der Begriff als FORM betrachtet werden muß, giltebensosehr für den Hegel'schen Begriff. Man mißverstehtsich aber, wenn man dabei an die Unabhängigkeit vonForm und Inhalt denkt, die nur dann zustande kommt,wenn die Form der ruhende Behälter sein soll, derfür eine mögliche Auffüllung mit Inhalt bereitgehaltenwird.Die Konsequenz daraus ist das gänzliche Verkommendes- Begriffs zu einem bloßen Namen oder einem Etikett,welches keinerlei Bestimmtheit an ihm selbst trägt.In Wahrheit ist die Form stets TÄTIGE Form, die alsPrinzip des Unterschieds jene Bestimmtheiten hervor-bringt, die als Inhalt angesprochen werden.
KonventionelleAuffassung desBegriffs
Der Hegel 'sehe BegriffGewöhnlicherweise wird der Begriff als Allgemeinbegriffgenommen, d.h. der Begriff hat bereits die Konnotation,eine Allgemeinheit auszudrücken. Diese Allgemeinheitrekrutiert sich aus einem Abstraktionsprozeß, dereinfach das Weglassen verschiedener MERKMALE bedeutet,die den Zusammenzunehmenden zukommen.Beispiel: Sieht man von der spezifischen Unterschieden-heit von Fichte, Birke, Ahorn usf. ab und achtetzugleich auf deren Gemeinsamkeiten, wie "hölzern",11haben Äste und Stamm 11 usf., so erreicht man denBegriff des Baumes.Bedingt durch diesen Weg der sogenannten BILDUNGder Begriffe, geht diesen die Konkretion ab, siekommen dadurch in den Verruf, bloß als leere Schematazu fungieren, die _erst wieder inhaltlich werden müssen.Dieser Inhalt kann wieder willkürlich in diese Formengebracht werden.Weiters entsteht dadurch die Auffassung, daß dieBegriffe rein SUBJEKTIVE FORMEN seien, die nichtan ihnen selbst schon Bedeutung haben, sondern eine,die ihnen erst verliehen werden muß.Als Verfahrens~eise fungiert einzig und allein dasSUBSUMTIONSVERHALTNIS, wodurch es eine Fülle vonallgemeineren und weniger allgemeinen Begriffshülsengibt. Den Begriffen kommt hiermit lediglich ÄUSSERLICHEBestimmtheit zu.
ß Nr, ,/et "'["';J'"
;;"b;'ekt,ve
f"« bSU-I1,t','"",-
Abhebung zumHegel'schenBegriff
- 8 -
Daher ist der Hegel'sche Begriff "schöpferische Tätig-keit", in seiner einfachen Einheit ebensosehr sichbesondernd und differenzierend.Die Differenzierungen destruieren aber nicht dieEinheit, sondern weisen ihn dadurch als KONKRET aus.(Damit bleibt der Begriff nicht die bestimmungsloseVorstellung, als die er herkömmlich verstanden wird).-Daß sich der Begriff also in der Gleichheit mit sichselbst befindet, macht das Moment der ALLGEMEINHEITaus; das Moment der BESONDERHEIT (Bestimmtheit desBegriffs) macht alle Unterschiede aus, und drittensbedeutet das Moment der EINZELHEIT nichts anderesals das Sich-auf-sich-Beziehen dieser Bestimmtheit.Die Sphäre des Begriffs wird von Hegel als diejenigeder FREIHEIT gekennzeichnet, gerade deshalb, weiles allein der Begriff ist, sich in den Unterschiedzu setzen und dabei ebenso bei sich selbst zu bleiben,so wie z.B. der Mensch im Handeln aus sich selbstin die Differenz tritt, sich darin.aber selbst bestimmt~
.ANMERKUNGEN
3 Momente desBegriffs:
- Allgemeinheit- Besonderheit- Einzelheit
- 9 -
Die Kategorie des AndersseinsDie Bestimmung des Andersseins ist zunächst einmalfür den ganzen Verlauf der Wissenschaft der Logikvon Bedeutung. Explizit thematisiert findet sie sichaber im Abschnitt "ETWAS UND EIN ANDERES" in derSphäre des Daseins der Seinslogik.Hier tritt die erste Schwierigkeit schon beim schlichtenVersuch des Auseinanderhaltens von Etwas und demAnderen auf. Denn das Andere ist ebensosehr ein Etwas,wie das Etwas auch Anderes ist. Beide scheinen aufdiese Weise von vornherein dasselbe zu sein. Dennochmuß zugegeben werden, daß sie sich unterscheiden,wenn es sich bei dieser Differenzierung nicht umsinnlose Namen ein und derselben Sache handeln soll.Das subjektive MEINEN verfällt jetzt auf die Möglich-keit, eine Trennung über das· AUFZEIGEN DES "DIESEN"zu bewerkstelligen. Indem vom Etwas ausgesagt wird,daß es eben nur DIESES ETWAS sei, glaubt man sichdadurch seiner Einzigartigkeit versichern zu können.Das Resultat dieser Bemühung besteht aber lediglichdarin, daß von jedem Etwas ausgesagt werden kann,es sei ein Dieses und somit für die Bestimmung, wasdas Etwas und das Andere an ihnen selbst sind, nichtsgewonnen ist.Verläßt man jedoch den Standpunkt bloß äußerlicherVergleichung, so wird man die Natur des Anderen alssolchen, d.h. isoliert vom Etwas, angeben müssen.Es folgt, daß das Andere wesentlich als "D45 ANDC~~5E:lN~~ 5E.Lß5T" genommen werden muß.Damit ist es gegen sich selbst gerichtet, es istSICH NEGIEREND, IN SICH SELBST UNGLEICH und daher"das -üch. V~MNDCYWDC"(H~e1., W.d. L. J, 5u.fvtkampS. 127J
Es kann sich aber nur in Anderes verändern und " f~dahen: in: dem-selben: NU~ fr1JT 5JCH ZU5Afr1fr1CN."i ebd; 5. 127J
Dieser Prozeß stellt hiermit die Affirmation wiederher, wir erreichen wieder das Etwas, aber so, daßes nun nicht mehr rein dem Anderssein gegenübersteht,sondern dieses in ihm selbst enthält.Wir haben so zwar immer noch das Paar Etwas-Anderesvor uns, aber zugleich ist das Anderssein Momentdes Etwas selbst geworden. Als solches heißt esSEIN-FÜR-ANDERES, also Sein für das Anderssein, d.i.die Veränderung. Es ist die Seite des Etwas, dieder Veränderung preisgegeben ist.Jene Seite aber, welche sich darin erhält, das ruhigeMoment des Seins ist das ANSICHSEIN. Nach dieserRichtung stemmt sich das Etwas gegen alle Ungleichheit,gegen alles Sein-für-Anderes, das aber als sein eigenesMoment ebensosehr konstitutiv für es ist.Wir haben zwei Paare:
ETWAS--ANDERES(beziehungslos)ANSICHSEIN--SEIN-FÜR-ANDERES(Beziehung)
ANMERKUNGEN l
Dies wird nun terminologisch BESTIMMUNG genannt,insofern das Sein-für-Anderes in das Ansichsein aufge-nommen wurde.Insofern Ansichsein und Sein-für-Anderes eigentlicherst Verdoppelungen der ersten Negation waren, sostellt sich der Bestimmung wiederum das ihr gemäßeMoment des Seins-für-Anderes, die BESCHAFFENHEIT,gegenüber.-Und ebenso wie sich die Identität vonAnsichsein und Sein-für-Anderes erwiesen hatte, gehtdie Bestimmung für sich selbst in Beschaffenheitund diese in jene über.Hiermit kann allererst in adäquater Weise von zweiEtwas gesprochen werden, weil ihr Unterschied nichtmehr in die Vergleichung fällt, sondern sie sichim gegenseitigen Aufheben des Anderen als Etwas er-weisen. Ihr immanentes Aufhören aneinander heißt! Kategorie derGRENZE, eine Grenze, die nicht zwischen ihnen liegt, GRENZEsondern völlig ihre Bestimmtheit ausmacht.-
- 10 -
Es ergibt sich die grundlegende Einsicht über dasAnderssein, daß es aufgrund seiner Selbstbezüglichkeitdas sich Verändernde ist, welches im ersten Schrittdas Aufbrechen und Destruieren ruhiger Einheit bedeutet.Im zweiten Schritt ist es als Ubergehen des Anderenin Anderes das Ankommen bei sich selbst und stelltauf diese Weise das Moment des Identischen wiederher. Das Resultierende ist dadurch wesentlich einVermitteltes, weil es sein Nichtsein in ihm enthält,es ist durch Aufhebung eine neue Bestimmung erwachsen,die sich im weiteren wieder über sich hinaustreibenwird. Letztlich sind die Schritte der Logik stetsauch ein Aufrütteln aus der Selbstgenügsamkeit.So muß nun auch die Beziehung von Ansichsein undSein-für-Anderes hinterfragt werden.Worin besteht das Ansichsein?Es kann nicht das leere sich auf sich Beziehen sein,sondern ist durch die Bestimmtheit notwendigerweiseA M Etwas vorhanden. Was das Etwas an sich ist,das ist auch AN IHM.Was aber an ihm ist, ist dadurch ÄUSSERLICH, fälltalso mit dem Sein-für-Anderes zusammen. Wir erkennendie "Jd~ des ~cMei..nA und de-s Sei..n.4-f-iiA.-
AndeA.eA 11 Lebd; S. 129 J
ANMERKUNGEN
Ausblick auf dasfolgende Kapitel:Kategorie derBESTIMMUNG
Kategorie derBESCHAFFENHEIT
- 11 -
Differenzierungen des Ansichseins,Dem Ansichsein wird nicht nur das SEIN-FÜR-ANbERESgegenübergestellt, sondern auch beispielsweise dasGESETZTSEIN. Dabei können wir und zunächst einmalan das griechische Paar DYNAMIS und ENERGEIA erinnern.Denn wie die dynamis haben sich auch die ansichseiendenBestimmungen allererst zu verwirklichen, d.h. sichals energeia zu erweisen.Dasjenige, was also erst implizit vorhanden ist,befindet sich im Status des Ansichseins. DessenExplikation und Entwicklung bringt das Gesetztseinhervor: ..•in diesem Ausdruck liegt zwar auch das"Sein-fi,iA.-An.d.eIl.eA, abea. eil. en.t:hiU.,t beA:tiJnrn:t di:e bell.ei..-tAf)eAch.eh.ene ZwUi.ckb~ dessen, Wa-1 rü.ciu: an. -11..ch.i..-1t:., In: das, Wa-1 -sein: Af7A1..ch.-1ein, taoain: eA 'POSJTJV1..-1t:.." (Heg.el,W1..-1-1en-1ch.af;t den: Log)..k. J, SuhMam.p5.130)
Insofern sich das Gesetztsein dem· Setzen verdankt,gehört es der Sphäre des Wesens an.(vg1.:Wesens 1ogik:.Gesetztsein--Reflexion-in-sich)Weiters wird vom Ansichsein auch in Abhebung zumFÜRSICHSEIN gesprochen. Am verständlichsten wirddas, wenn man sich vergegenwärtigt, daß in der Sphäredes Begriffs das FÜRSICHSEIN der SUBJEKTIVITÄT unddas ANSICHSEIN der OBJEKTIVITAT zugeordnet ist.Der Begriff als solcher ist, wie dargestellt, zunächstsubjektiver oder formeller. Weiters wird von ihmdas ABSOLUTE BESTIMMTSEIN ausgesagt. Sein Bestimmtseinfolgt aus der Selbstbestimmung des Begriffs. Bezugzur Seinslogik: Bereits im Kapitel des Fürsichseins(Qualität) kommt das absolute Bestimmtsein vor. Jedocherfolgt hier dieses aus der Negation der Negation,aber als daseiende."DM SE.LßSTf38J.IUSSTSCJN dag.~'.9-en 1..-1t:. das FlJRSJCH-1eincd» VOL.l.15RACHT und ~ESE.TZT,· jene Seis:e. den: ße~efw.n.r;aut ein: ANfJE:RES, einen äußeaen: ~ef)enAmn.d. 1..-1t:.en:tte/Ul..t:.."febd.S.175)Würde man aber zum Verständnis des Fürsichseins sofortdie Assoziation zum Selbstbewußtsein heranziehen,wäre dies zu weit gegriffen, da das Selbstbewußtseineben schon vollbrachtes Fürsichsein ist.Darüber hinaus hat im Begriff das Fürsichsein dieBedeutung, "in: den: ße~efw.n.r; aui: Andene» ~e1..ch.
ße~efw.n.r; aui: -si.ch: -1elb-1t:. JU -sein: "Der· Subjektivität des Begriffs, seinem Fürsichsein,steht die Objektivität, sein Ansichsein gegenüber.Dies erweckt zunächst die Konnotation, daß dieObjektivität der Subjektivität als "gegebene Weltllgegenübertritt. Insofern aber etwas für sich ist,hat es sich das ihm scheinbar nur Negative, das,was es nicht ist, auf gewisse Weise schon einverleibt.D.h., daß das Subjekt nie bloß dem Objekt rein entgegenist, sondern daß es schon Subjekt-Ob.iekt-Einheitist. Diese Einheit ist die Idee, das ANUNDFÜRSICHSEIN.-
ANMERKUNGEN/Sein-rtir-Anderes
11 ° _ Gesetztseinft.seln_ RO ich °\ ursl selnAnundfLir'sichsein
Ansichsein-Gesetztsein
Ansichsein-Fürsichsein'Wei.te!z. iAt nun. cIruFiiMich&in. of!beRhauptaIA J!FAL:J[AT CJU/Ju -/aMRn, ~ cIruIaoein: /.difwz. aIA~be~uunde: 7M5TAT und:JffAL:l[itr tOeIlf:iRn hi:iuf4J.aIA ein. 'PW'Lmi.;tgki..cfc-e/Z.~ei;tein:-azWt.~~~·und tan: ~ ckrnpiiß,daß e1 CJl.II3eIZ.dea. ~llLfI eine Jcka.ü.iiii:. gilbe.Nl4t aIxYz. iAt die. :JdeJ::dWii:.ni.ch:t eiua», cIru e1 CJl.II3eIZ.und nebe: de!z. Y?et:dUiit~ -srdean: de!z. &t;;;U.It-dea. Jcka.ü.iiii:. l:xMWli:.ou&luicAli..ch danin; die.~ de!z. Y?et:dUiit JU-sein; d: h: die. f<ealiiit.aM cIru ~ lJXUj -sie.an.~.iAt, ~ -sid:&lb4t aM :Jckt::di.i:äi:.."(H(?[JId.&IZ.§96, 2JM:J.ta.,SuhJzkanp S.2Yf.)DasAnundftirsichsein istdie EinheitdesA.seinsunddesF.seins,insoferndasA.selndie völligeAufhebungder zuvorauf-getretenenBestimrungenverkörpert,und dasF.seinzugleichderen negativeEinheit garantiert.-
- 12 -
Der Übergang vom Sein zum WesenDie absolute IndifferenzZunächst könnte es so aussehen, das Sein als solchesals Indifferenz auzufassen, insofern es z.B. alsdas von allem Aussagbare genommen wird. Damit wärees indifferent gegen alle Bestimmtheit überhaupt.Diese Ansicht birgt aber den Nachteil in sich, daßdie Bestimmtheit schon als Gegebene vorausgesetztwird und man über das Abstrahieren allmählich zueben diesem Seinsverständnis kommt. Oder mit anderenWorten: Aus dieser schon ursprünglich vorausgesetztenBestimmtheit wird letztlich über einen Abstraktions-prozeß diese Auffassung "herausdestilliert".Umgekehrt wird in der Hegelschen Logik gezeigt, wiesich das Sein selbst zur Indifferenz bestimmt, wodurcheben über den Weg der Konkretisierung und NICHT derAbstraktion sich diese Indifferenz hervortut. Esresultiert nicht die leere, willkürliche Gleich-gültigkeit, sondern letztlich eine gewordene.Damit ist es diejenige Indifferenz, die durch dieNegation aller Bestimmtheiten des Seins,- der Qualität,der Quantität und dann auch des Maßes,- erreichtwird.Vorerst erscheint diese Indifferenz als das bloßeSUBSTRAT dieser Bestimmtheit, die auf diese Weisenur an der Indifferenz hervortritt, jedoch nichtdurch dieselbe hervorgebracht und gesetzt ist. Weilsich aber die -seiendenBestimmungen aufgehoben haben,so ist diese Indifferenz keine Gleichgültigkeit gegenein festes und vorhandenes Konglomerat, sondern"di:e. fLElCH9jLTJfKCJT i.WUVl. -1eJ..b-1:t.fC9iN 5JCH"
(w.Cl L J.Süh/ik.. s.4487Es ist dies die ABSOLUTE INDIFFERENZ, die hiermitnicht mehr nur indifferent gegen anderes, sondernindifferent gegen sich selbst ist.-Die Indifferenz ist damit BEZIEHUNG AUF SICH SELBST,wodurch die Bestimmtheiten nicht mehr bloß alsineinander übergehende, sondern wesentlich als bezogeneund durcheinander gesetzte gedacht werden müssen.Dies ist die RELATIONALITÄT des Wesens.-"fe-1e:1:.§:t. hJ...e/lI1'1LtW das, UJa/.Jdi:e Jn.di..f-f-eA.en~ In:den: Tat. Ls«, Ls«: -1i..e eirdache. und. unend.Liche: neg.ati..veße~eh.un.fJ- auf- -üch, di:e UnveA.:t./l.~cM.eU:. Ihae« mis:Lh»: -1eJ..b-1:t.,Ab-1:t.oßenLhae»: von -sich: -1el...b-1:t.." (efxi.5.456J
Darin ist die Grundcharakteristik des Wesens, aberals noch in der Seinssphäre befindlich, angelegt.Es ist an sich die sich auf sich beziehende Negation,die ABSOLUTE NEGATIVITÄT DES WESENS.-
""
ANMERKUNGEN
- 13 -
Mit der Kategorie der absoluten Indifferenz ist wohlauch an Schelling angespielt, der die Subjekt-ObjektEinheit in dieser Weise realisiert glaubte.Die Indifferenz aber, als höchsten Punkt genommen,bedeutet das Absorbieren allen Unterschieds, derin ihr nur verschwindet und sich nicht erhält.Hegel stellt einem solchen Standpunkt nicht einfacheinen anderen entgegen, sondern will zeigen, daßdabei nicht stehengeblieben werden kann. Denn dieWidersprüchlichkeit der abs. Indifferenz bezeugtfür Hegel allererst den Anfang des "SETZENS" desUnterschieds."DM /tJa.n..g..e.lA7..tte.i.JLden: Sch~chen 'PhJ..,lo.wphi...eLs«, daß den. 'Pun.k.t den: Jn.dLf-f-e;z.en~ des Subj.ektivenund Obj.ektiven VOIUl.. fWtg.eAte.U;t, di.e-se Jden.:i:.i:tä:tab-scdiu: au.4feAte.U;t uiiad, ohne daß eA beaiie-sen:uünd,daß die» das Wafvz.ei.At. "(Het;)Rl.. V~ i1IxYz. die ~ ckJz.'P~;:hi.e)
ANMERKUNGEN
Durch die Sphäre des Wesens haben wir das UNMITTELBAREALS SOLCHES, welches für die Seinssphäre kennzeichnend _war, verlassen. Im SEIN versuchten wir die Kategorien 'DieGrundpositioneinerfestzuhalten, in diesem Versuch zeigte sich aber naivenOntologiehatihr ÜBERGEHEN IN ANDERES. Im Gegensatz dazu werden sichdestruiert.wir im WESEN von einem SCHEINEN IM ENTGEGENGESETZTENsprechen können, das noch näher zu erläutern seinwird. Äußerlich kann bemerkt werden, daß die Kategorienim Wesen paarweise auftreten, bzw. als relative ,Entscheidend ist, daß sich die Einheit von untrennbarUnterschiedenen durchhält. Damit scheint hier dieStufe der BESTÄNDIGKEIT erreicht zu sein, jenes Be-stehen, das sich in der Seinslogik auf der Suchenach einer seienden Substanz als Illusion erwiesenhat.-Zunächst steht jedoch der Zusammenhang von Sein undWesen selbst zur Diskussion. Hegel erwähnt hier dieSprache, die im Zeitwort "sein" das Wesen in dervergangenen Zeit, nämlich als "gewesen" behaltenhat. Damit ist das Wesen das "VEJ<r;AN~C, ABC:R ZE:JrLJJS
VEJ<r;AN~C SE:JN." (Hef)-e1.,W.d.L.33,Suh4kampS.13J
Wichtig ist der Unterschied von Vergangenem und Ver-gangenheit, denn Vergangenes ist vergangen, die Ver-gangenheit selbst aber vergeht nicht.Zunächst erschöpft sich aber die Charakterisierungdes Seins vom Wesen aus in der bloßen Etikettierungderselben durch das Prädikat NICHTIGKEIT. Das Seinscheint ein 11NUR-ÜBERWUNDENES 11 darzustellen. Hiermitresultierte aber ein einfaches NEBENEINANDER, wobeidas Sein das UNWESENTLICHE, das Wesen aber WESENTLICHist. So verbleibt man aber im Status der BESTIMMTENNEGATION, und Sein und Wesen verhalten sich wiederumals SEIEND oder als ANDERE gegeneinander,- über dieSeinssphäre wäre man nicht hinausgekommen.Die Trennung muß sich radikaler vollziehen, und Hegelsagt, da~.das Sein gefaßt werden müsse als "da-s ANUND FlfR S3CH ni..c.h.:ü.r;.e UflJTl.i..ft.e1.bCLl1.e;M iA:t nun:ein: UNfJJESCN,den: SCHE:JN." ( ebd. S. 19 J
- 14 -
Die Anfänge des WesensSchein und Reflexion
Alltagssprachlich verwenden wir dieses Wort einerseitsmit einer abwertenden Konnotation, wie bei scheinheiligoder Schein im Sinne von Täuschung, und mit eineraufwertenden, wie bei Sonnenschein. Auch im logischenSinn werden wir 2 Momente des Scheins bemerken.Erstlieh besteht das Sein des Scheins allein in derAUFGEHOBENHEIT DES SEINS. Es gibt kein Sein des Seinsneben dem Schein, sondern nur die Negation des Seins.Diese Nichtigkeit hat das Sein im Wesen. Somit istdas Negative gesetzt als Negatives, es findet keinÜbergehen mehr statt.
.ANMERKUNGEN
'DieseTrerrungistaberein äLßerlichesSetzen,\\elchesin ein Drittesfallt,eineiiussERLIa-EReflexion,dieuns auch\\eiterhinin ihrenMlrentenbegleitenwird.Es sindkeine Seins-kategorien,sordem esistdas sichselbstalsdie einfache Negationdes Seinsmißinter-pretierende Wesen.
rstesfvbrentdes:eins
- 15 - ANMERKUNGENDieses eigentümliche Nichtdasein ist aber nichtsdesto-trotz etwas, das Dasein hat, es bedeutet kein bloßesVerschwundensein. Es ist ein Unselbständiges, dasnur in seiner Negation ist. Hegel sagt: "61 b.1.R.J..b:t ihmwo nun: di:e. neine. BeA.tl.mmth.ei..:t. den: UN/YJJTTeL!3A'RI<CJT,.ff
(ebd.5.20), die nicht mit der Unmittelbarkeit imSein zu verwechseln ist. Von nun an müssen wir voneiner VERMITTELTEN oder REFLEKTIERTEN UNMITTELBARKEIT Izweitesfvbrentdessprechen. Statt Unmittelbarkeit könnten wir auch Scheins"Gleichheit mit sich" einsetzen, hier ist es dieGLEICHHEIT DES NEGATIVEN MIT SICH.In dem Ausdruck "UN/YJJTTeL!3A'RI<CJTDES NJCIfT5CJN5" habenwir nun die beiden Momente des Scheins näher voruns. Akzentuieren wir das Nichtsein, so bedeutetdies den platonischen CHORISMOS, die absolute Negation.Es ist dies aber nichts anderes als die Negativitätdes Wesens an ihm selbst. Denn das Wesen kann nichtals Ding oder als Substanz vorgestellt werden, diedas Sein negiert, sondern es besteht in nichts anderemals in dieser Negation, es ist diese selbst.Legen wir den Akzent auf die Unmittelbarkeit, welchesdieses Nichtsein enthält, so ist sie "das eJ..r;.ene ab~AM.i..chAelJt des WeAeM" t ebd. 5.21).Diese Formulierung betont nun den ASPEKT DES SEINSzwar nicht in dessen Unmittelbarkeit, aber ALS MOMENT." •••• die. .f..den.:t1./.Jche Ci.n.heJ..;t den: ab-so-iuxen: NeJ)-a:ti...vi...:tätund den: Uf1fTI.Lt;te1.ha.A.k.e.i..;f:."Lebd, 5.22) ist aber das Wesenselbst, eine Einheit, die nun keineswegs starr ist,sondern vielmehr ein SICH ZU SICH SELBST VERHALTEN.
Mit der Nichtigkeit des Seins als Schein waren wirbereits zu Beginn der Wesenslogik bei der Negationangelangt. Diese Negation bestimmt sich; dies Bestimmenselbst ist aber nichts anderes als die TÄTIGKEITDES NEGIERENS.(Bezug zur Seinslogik: Im Sein besteht die Bestimmtheiteigentlich in der Grenze; es war also Sein, aberein Sein mit Negation, das die Bestimmtheit darstellt.Jetzt im Wesen ergibt sich daraus, daß wir schonbei der Negation sind, aber der Negation der Negation.Die Bestimmtheit des Wesens besteht also in der NEGATIONALS NEGATION.)Diese Bewegung des Negierens stellt selbst die Unmittel-barkeit dar, es ist eine Gleichheit mit sich, diesich von der in der Seinslogik unterscheidet, nämlicheine Gleichheit des Negativen mit sich. Diese Unmittel-barkeit kann nicht als Statisches angesehen werden,sondern die Unmittelbarkeit wird selbst negiert.Aber im Negieren der Unmittelbarkeit stellt sichdiese wieder:.her. Hegel nennt dies die 11 AB50LUTeNeyATJVJTAT" i eb d: 5.24)Die Unmittelbarkeit ist nur diese Bewegung selbst.
- 16 -Der Schein hatte sich notwendigerweise als eine Be-·wegung, d.h. als SCHEINEN gezeigt, welches mit demNamen REFLEXION versehen wird.Als "di.e ß8J)c9JN(; VON N:JCHT5 ZU N:JCHT5 UND DA[)(J'RCH
ZU 5:JCH sassr ZU'RDCK" ( ebd,5.24)erhält sie auch den Titel "Aß50LllTc 'REFLCXJON". (5.25)
In der absoluten Reflexion scheint es so, als wärediese Bewegung von Nichts zu Nichts und damit zusich selbst zurück ein infiniter Progreß, der nichtsergibt. Die Selbstaufhebung der Einseitigkeit deseleatischen Grundsatzes, daß das Sein ist und dasNichtsein nicht ist,- dieser Satz gilt und gilt nicht.In diesem Satz, richtig verstanden, ist schon beidesausgedrückt, nämlich daß das Nichts ein Sein ist:Man könnte versucht sein zu glauben, daß der infiniteProgreß, so wie die "schlechten Unendlichkeit, irgendwoanlangen sollte, um erst im Erreichen des Ziels aufdie Unmittelbarkeit zu stoßen. Aber dieser infiniteProgreß ist selbst das Setzen, ist selbst das Sein.In der Bewegung liegt also schon immer auch dasZusanunengega~gensein. Sieist ..zwar eine Bewegungoder ein Ubergehen, aber im Ubergehen selbst istdas Übergehen auch aufgehoben.Hegel ..nennt diesen gesamten Prozeß der Beziehungeine RUCKKEHR. Eine Rückkehr, die NICHT von einemSubstrat ihren Anfang nimmt, an ihr Ziel gelangtund von daher wieder zurückkehrt. (Das Substrat könntehier nur die Nichtigkeit des Seins selbst sein; dadurchist es aber nichts Seiendes, sondern nur die Negation).Die Rückkehr ist eigentlich nur dadurch Rückkehr,daß sie einesteils in ihrem Schein des Anfangs bereitsdie Rückkehr vorausgesetzt hatte und andernteilsin der Rückkehr den Anfang voraussetzen mußte. Dasscheinbar sich allmählich volziehende Zugehen istals solches aber schon das Ankommen. Es herrschtkeine Polarität zwischen einem rein Anfangenden undeinem Ende.Dadurch ergibt sich, daß die Rückkehr nicht ein Punktist, bei dem angelangt wird, sondern die Rückkehrstellt sich ALS BEWEGUNG dar, sie ist wesentlichein "'RÜCKKcH'RcN" • t eb d, 5.26 )Dieses Rückkehren macht SELBST die UNMITTELBARKEITaus und nichts daneben. Die Unmittelbarkeit, dieKonstituens des Seins war, zeigt sich als GESETZTSEIN.(vgl.Seinslogik: Dem Gesetztsein des Wesens entsprichtdas Dasein im Sein. Dort macht für das Dasein dasSein den Boden für die Bestimmtheit aus; jetzt istder Boden für die Bestimmtheit selbst nur das Negative).
ANMERKUNGEN
DieabsoluteReflexionbestinmtsichselbst\\eiterzur setzeOOen,äußerenu. bestimrendenReflexion.Letzteresindnichtals drei ver-schiedeneReflexionen,sondernvielmehr alsAspekteder Reflexionselbstzu verstehen.DiesetzendeR. ist dieFortentwicklungundWeiterführung derabsolutenR. , diebestilTtlEl1d.ewiederistdieEinheit vonsetzenderund äußererRef1exion.-
Auf'\..eisdersetzendenReflexion
- 17 - ANMERKUNGENDie SETZENDE REFLEXION erkennt also, daß das Negierendes Nichts ein Setzen ist, näm1ich das _SJJf~~J~.~~I f'1lTelt desSetzensUNMITTELBAREN.Das--efne-Moment ist, daß diese Unmittelbarkeit gesetztwird; nur, wenn wir sagen ngesetzt wird", so erweistsich dieser Ausdruck schon als falsch, weil das Ge-setztsein selbst die Unmittelbarkeit als die Bewegungdes Rückkehrens ist, nichts außerhalb dessen. Ent-scheidend ist nur, daß dieses Rückkehren, diese Un-mittelbarkeit, die Gleichheit des Negativen mit sichist und damit diese seine Unmittelbarkeit negiert.Aus diesem Negieren der Unmittelbarkeit ergibt sichdas andere Moment,·das des VORAUSSETZENS DER UNMITTEL-1f'1lTelt desVoraussetzensßßfSKEJ1. - - - - - - - - - - - - - - - - :- - - - -Indem überhaupt auf die Unmittelbarkeit Bezug genommenwird, ist die Unmittelbarkeit als solche vorausgesetzte.In der setzenden Reflexion wird aufgezeigt, was inder Beziehung des Negativen auf sich das Moment desSetzens und was das Moment des Voraussetzens ist;es gibt kein Setzen ohne Gesetztsein, also stoßenwir hier zum ersten Mal auf das Gesetztseih, dasstets die Reflexion als seinen Gegenpart in sichhat.
Der Übergang zur ÄUSSEREN REFLEXION besteht nun darin,IÄußere Reflexiondaß in diesem Prozeß die Unmittelbarkeit überhauptals das Negative gegenüber der Reflexion selbst bestimmtwird: Das Unmittelbare wird als ein 11DAGEGEN" zurReflexion angesehen. Beide Momente driften auseinander.In dem Bestimmen des Unmittelbaren als des Negativengegenüber der Reflexion, stellt dieses Unmittelbareein SEIN dar.Die äußere Reflexion glaubt, von diesem Sein anfangen DieReflexionistinzu können. Dieses Sein ist aber ihr eigenes PRODUKT, diesenStatus diedas sie in der reflektierenden Bewegung vergessen hypostasierendeTätig-hat. Deswegen scheint es für die äußere Reflexion keitselbst,nichteineso, als hätte sie eine UNMITTELBARE VORAUSSETZUNG. KategorieoderBestinmt-So wie etwa die Ontologie meint, sich unmittelbar heit,die twostasiertauf das Sein beziehen zu können, so glaubt die äußere wird,sonderndieReflexion, .slch unmittelbar auf etwas GEGEBENES zu Reflexionist dasbeziehen, da sie nicht weiß, daß dieses Gegebene Verse1bständigenselbst.selbst ihr Produkt ist.In dem Aufzeigen aber, daß diese Unmittelbarkeitnicht das Gegebene, sondern das ERGEBNIS der äußerenReflexion darstellt,-das nicht ein von ihr selbstVerschiedenes ist, sondern daß diese Unmittelbarkeitsie selbst ist, darin liegt auf vermittelte Weisewieder das Zusammengehen mit sich. Oder die Unmittel-barkeit geht in der Selbstaufklärung der äußerenReflexion mit sich zusammen. Hegel nennt dies die" WE.5E.NTLJCHE. UNIrJJTTE.LBA7<.KE.JT ". (ebd.530J
- 18 - .\ANMERKUNGENIn der BESTIMMENDEN REFLEXION wird noch Bezug genommen IBestimmendeauf den Ausdruck des GESETZTSEINS. Das Gesetztsein Reflexionwird einerseits genommen gegen das Dasein und anderer-seits gegen das Wesen. Zunächst würde man annehmen,daß das Dasein das Höhere sei gegen das Gesetztsein;wie sich aber aus dem Gang der Logik zeigt, ist dasGesetztsein höher als das Dasein. NUR auf das Wesenbezogen kann man von einem NUR GESETZTEN sprechen.Aus diesem Gesetzten wird sich jetzt weiters die" 7?ULCXJON5ßCSTJ/fJ/tJUNr; " (ebd.5.33J ableiten.Die Reflexion bestimmt sich selbst und HAT Bestimmungen.Dies sind die Reflexionsbestimmungen oder -bestimmt-heiten, die in den weiteren Abschnitten durchgegangenwerden. Es sind dies Identität, Unterschied (Ver-schiedenheit, Gegensatz) und Widerspruch.Wie bereits festgehalten, müssen die Momente derReflexion als bloße Aspekte betrachtet werden, dieKEINE Eigenschaften oder SEITEN dieser Reflexionsind. Sondern die Reflexion ist, wie Hegel späterimmer wieder betonen wird, EINE Reflexion.Der Hauptpunkt der bestimmenden Reflexion bestehtdarin, daß gezeigt wird, inwiefern das GesetztseinReflexionsbestimmung ist, nämlich Refl.best. alsBestimmung der Reflexion selbst, die dann näherrealisiert wird. Dies ergibt sich dadurch, daß diebestimmende Reflexion die Charaktere der setzendenund äußeren Reflexion in sich selbst aufgehoben hat.Den ersten wesentlichen Schritt hatte die äußereReflexion getan, indem sie sich diese Unmittelbarkeitvoraussetzt, die sie bestimmt, die sie glaubt, alsein von sich Unabhängiges, bestimmen zu können.In der bestimmenden Reflexion wird nun aufgezeigt,daß es ein Vorurteil war, daß das, was sie bestimmthatte, ein von ihr Unabhängiges ist:ES WIRD ERSICHTLICH, DASS DAS, WAS SIE BESTIMMT,SIE SELBST IST.Dadurch wird das Gesetztsein Reflexionsbestimmung-das, was sie setzt, setzt sie selbst und damit sichselbst. Sie bestimmt SICH.Darin ist sie wiederum in der GLEICHHEIT MIT SICH.Und diese Gleichheit mit sich, ausgedrückt in derReflexionsbestimmung, macht die IDENTITÄT aus. D.h.,der eine Aspekt, der der Unmittelbarkeit oder derGleichheit mit sich, realisiert sich als Reflexions-bestimmung in der Identität.
- 19 -
Die ReflexionsbestimmungenInsofern das Gesetztsein Reflexionsbestimmung ist,ist der Aspekt der Gleichheit ALS Reflexionsbestimmunggleichzeitig Aspekt der Unmittelbarkeit oder: dieIDENTITÄT.Diese Sich-selbst-Gleichheit ist demnach also nochdasselbe als das ganze Wesen.Es wird immer wieder darauf abgehoben, daß die Identitätnicht aus dem Abstrahierungsverfahren entsteht, sodaßvon Unterschieden ausgegangen wird, von denen mandann auf lauter Identische schließt, sondern dasUnterscheiden selbst IST die Identität. Hege1 nenntdies ein HERSTELLEN. Es ist das reine Herstellenaus sich selbst, nicht ein Wiederherstellen aus einemanderen. Das Andere wäre irgendetwas Vorausgesetztes,aus dem dann die Identität resultieren soll. DieIdentität aber ist selbst nur das ganze Wesen alsBewegung. D.h. die Identität ist insofern nur dieganze Reflexion.Die Identität besteht wesentlich in ihrem UNTERSCHEIDEN,aber es ist ein Unterscheiden, wodurch nichts unter-schieden wird, sondern das sofort zugleich bei sichselbst ist. D.h. aber, daß der Unterschied nichtneben der Identität liegt, sondern, daß die Identitätselbst, indem sie das Unterscheiden ist, den UnterschiedAN IHR hat. Dies wird paradigmatisch als die Identitätvon Identität und Unterschied ausgedrückt. D.h.,die Identität hat die IDENTITÄT UND den UNTERSCHIEDzu ihren MOMENTEN. Insofern bestimmt sich die Identitätselbst zum Unterschied.
Der UNTERSCHIED wird von Hegel zunächst als der ABSOLUTEUNTERSCHIED eingeführt. Der absolute Unterschiedist derjenige, der zwischen Identität und Unterschiedbesteht.- Und er besteht nur darin, daß die IdentitätNICHT der Unterschied ist. Diese "Nicht" macht denabsoluten Unterschied aus und nichts anderes. Deshalbbetont Hegel, daß der absolute Unterschied wesentlichEINFACH ist.Der Unterschied ist NICHT die Unterschiedenen, sonderndas, WORIN die Unterschiedenen unterschieden sind.Dieses "WORIN", ausgedrückt in dem "nicht", ist einEINFACHES. Dies führt aber dazu, daß der UNTERSCHIEDals dieses Einfache SELBST IDENTISCH MIT SICH ist.Wäre er das nicht, so hätten wir auch keine Unter-schiedenen. D.h. der Unterschied hat selbst wiederumdie MOMENTE an ihm, also die der Identität und desUnterschieds.
Der Übergang zur VERSCHIEDENHEIT besteht darin, daßdiese Momente im Unterschied nur GESETZTE sind. Soist es zunächst der absolute Unterschied. Aber indem
ANMERKUNGEN
- 20 -
man überhaupt von Momenten sprechen kann, so sinddie Momente auch auf sich selbst bezogen. Sie re-flektieren sich in sich selbst. Diese Reflexion-in-sich der Momente macht sie zu Unterschiedenen, bzw.es entsteht dadurch IHRE ~LEICHGÜ1TI~~I-GEGENEINANDER.Diese Gleichgültigkeit gegeneinander ist die Haupt-charakteristik der Verschiedenheit.-Die Kategorien der Verschiedenheit sind .§.L~rr:t!.H~IJund UNGLEICHHEIT.Die - Gleichheit- ist äußerliche Identität sowie dieUngleichheit äußerliche Unterschiedenheit ist. Diesesind weder Identität noch Unterschiedenheit AN IHNENselbst, sondern es geht wesentlich um ein GLEICH-bzw. UNGLEICHSETZEN. Diese Setzen fällt dabei inein Drittes; dieses Dritte macht wiederum innerhalbder Verschiedenheit die Identität aus.Das Dritte ist also gegenüber dem Gleich,-und Ungleich-setzen wiederum das Identische. Das ist die REFLEXIONAN SICH oder die Verschiedenheit als dieses Substantivder Reflektiva, die VerschiedenHEITEN sind.Die Verschiedenheit ist damit so einfach wie dereinfache Unterschied. Nur hat die Verschiedenheiteben zu ihrem anderen Momente die Verschiedenheitselbst. Dies ist eben das MOMENT DER ÄUSSEREN REFLEXIONin der Verschiedenheit.Wichtig ist, daß durch diese Gleichgültigkeit dieReflexion SICH SELBST ÄUSSERLICH wird. Die Reflexionist gleichsam aus sich heraus, weil ihr die Bestimmtheitder Unterschiedenen gegenübertritt. Sie war aberursprünglich nichts anderes als diese Unterschiedenenselbst. Sie ist sozusagen außer sich gekommen. (Sowie in der äußeren Reflexion eben auch die Reflexiongegen sich bestimmt ist und gegenüber dem Unmittelbaren,das sie voraussetzte.)Sie versteht sich als ein VERGLEICHEN; und diesesVergleichen besteht eben im Aufweisen von RÜCKSICHTEN.Man muß eben, um Gleichheit oder Ungleichheit fest-stellen zu können, in gewisse Rücksichten treten,als etwas, das man gegenüber der Gleichheit und Un-gleichheit festhält als das Identische.Wird aber die Gleichheit auf einer Seite fixiertund die Ungleichheit auf der anderen, so ZERSTÖRENSICH DIE BESTIMMUNGEN von Gleichheit und Ungleichheitselbst:Die GLEICHHEIT muß, als in sich reflektiert, dieUngleichheit an ihr selbst haben (ansonsten könntesie nicht mit sich selbst gleich sein), um dieseVergleichung anstellen zu können. Sie stellt quasiinnerhalb ihrer diese Vergleichung an. Die Ver-gleichung besteht also in ihrer Gleichheit selbst.Sie kann nur Gleichheit mit sich selbst sein, wennsie sich mit sich selbst vergleicht. Tut sie diesaber, so STELLT SIE innerhalb ihrer ebenso EINE UN-GLEICHHEIT HER, weil eine Vergleichung nur über anderes
ANMERKUNGEN
- -~--"""""·'~~'·'··.~.,w .___ .__~, ~._ _'__',_,.,__._",
- 21 -
möglich ist. Dies and~re ist aber nur sie selbst,um bei dieser Gleichheit bleiben zu können. Es zeigtsich also, daß sie ebensosehr die Ungleichheit ist.Die UNGLEICHHEIT, die nicht die Gleichheit wäre,muß sich genauso ihre Legitimation des Ungleichseinsholen. Und sie muß an ihr selbst bestimmen, daß sieungleich ist. Daß sie ungleich ist, kann sie an sichselbst nur dadurch bestimmen, daß sie sich,- wiedie Gleichheit-, mit sich selbst vergleicht. Dieskann sie nur, indem sie die GLEICHHEIT IN IHRVORAUSSETZT. Ansonsten könnte sie nicht vergleichenoder käme nicht auf den Gedanken, daß sie an sichselbst ungleich sei.-So haben BEIDE DAS ANDERE MOMENT AN IHNEN SELBST.--Es schien zuvor so, daß jenes Dritte, die Einheitvon Gleichheit und Ungleichheit, außerhalb beidersei. Nun zeigt sich aber, daß diese Einheit AM GleichenUND Ungleichen selbst gesetzt ist,- die Gleichheithat an sich selbst die Ungleichheit bzw. dieUngleichheit an sich selbst die Gleichheit.Die an-sich-seiende Reflexion, die zuvor erwähntwurde, als das Identische (zuvor als außerhalb derBestimmungen veranschlagt), verlegt das Vergleichenin die Bestimmungen selbst,-sie zieht sich gleichsamin die Kategorien selbst hinein. Es bleibt nichtsdaneben. Hegel nennt dies DIE NEGATIVE REFLEXIONDER BLOß VERSCHIEDENEN.Dies führt letztlich dahin, daß, indem das Gleicheebenso ungleich und das Ungleiche ebenso gleich ist,der GEGENSATZ erreicht wird.-Beide Momente, Gleichheit wie Ungleichheit, sindnun jedes an ihm selbst schon das Ganze. Jedes enthältin ihm die Beziehung auf das andere, auf sein Nichtsein.Die in sich reflektierte Gleichheit, die das Vergleichenin sich selbst vollzieht, und darin die Beziehungauf die Ungleichheit an ihr selbst hat, ist dasPOSITIVE.Die Ungleichheit aber, die die Beziehung auf dieGleichheit hat, ist das NEGATIVE.Das Positive ist das Gesetztsein als in die Gleichheitmit sich reflektiert, das Negative das Gesetztseinals in die Ungleichheit mit sich reflektiert.Positives und Negatives zusammen machen immer auchdie Seite des GESETZTSEINS aus. Beide sind dasGesetztsein. Beide haben aber auch das REFLEKTIERENIN SICH. Dies drückt die Metapher aus: Sie vergleichensich in sich.Positives und Negatives sind als in Beziehung aufden Gegensatz selbst MOMENTE. Dies deswegen, weilder Gegensatz als solcher die Identität verkörpertGEGENUBER den Bestimmungen von P. und N.In diesem Status verliert sich die Reflexion als"EINE" nicht. Positives und Negatives sind gleichsamzu Momenten "herabgesetzt".
1ANMERKUNGEN
- - ...--.- •• ------ -.--- .'- •• --_. n.__
- 22 -Es handelt sich um eine ähnliche Denkfigur wie imAbschnitt über die Verschiedenheit. Dort wird erkannt,daß das Dritte, das Vergleichen, an den Bestimmungenvon Gleichem und Ungleichem selbst gesetzt ist. DiesesVergleichen findet nicht außerhalb von ihnen statt,sondern ist in sie selbst verlegt. Dieses Vergleichende,die Seite der Identität, konstituiert überhaupt derenbeider Einheit. Ebenso wird sich der Gegensatz alssolcher als die Einheit von Pos. und Negativem erweisen.Weil nun Positives und Negatives schon jeweilsVereinigungen der Gleichheit und Ungleichheit dar-stellen, sind sie beide das Ganze und verhalten sichgegeneinander als SELBSTÄNDIG. Ihre Selbständigkeitmacht eben aus, daß sie beide die Reflexion des Ganzenin sich sind. Hegel versieht sie insofern mit demAusdruck SEITEN•Eine wichtige Station im weiteren Verlauf geht nunüber die mittelbare Unmittelbarkeit der beiden Be-stimmungen, d.h. es gilt zu erkennen, daß sich Positivesund Negatives zu diesem Zeitpunkt NUR ÜBERHAUPT NEGATIVgegeneinander verhalten und ihre eigentümlicheCharakteristik an ihnen selbst noch nicht haben.Damit ist der GEGENSATZ AN SICH formuliert, und zwarso, daß lediglich ihre Entgegensetzung, nicht aberdas ihnen Spezifische, ausgedrückt ist.Aus dieser Entgegensetzung resultiert, daß Pos. undNeg. in diesem Status GLEICHGÜLTIG gegeneinandersind, daß sie sich nicht. selbst zu Positivem undNegativem bestimmen, sondern daß sie schlicht vertauschtwerden können. .Ihre VERTAUSCHBARKElT würde ihre Bezeichnung aberzu bloßen Namen degradieren.Das Positive ist also noch nicht positiv als solches,ebensowenig wie das Negative. Sie sind beide dasGanze, nur wird jeweils auf einer Seite die Gleichheitoder die Ungleichheit betont. Es wäre eben ein Ver-kennen, daß beide KEINEN EIGENTÜMLICHEN CHARAKTERhätten, genauso wie es sich in der Verschiedenheitals Trugschluß herausstellte, die Gleichheit NURals Gleichheit und die Ungleichheit NUR als Ungleichheitzu nehmen.- Dieses Verkennen besteht vor allem darin,daß Pos. und Neg. DER EINHEIT, die der Gegensatzals solcher ist, NOCH ÄUSSERLICH sind, wie Gleichesund Ungleiches dem Vergleichen zunächst äußerlichwaren.Die Tilgung des logischen Defizits besteht nun indem Schritt, daß erkannt wird, daß Positives undNegatives SELBST DER GEGENSATZ IN SICH sind. Damit,daß diese Einheit am Pos. und Neg. selbst gesetztist, wird sie in die Bestimmungen .zurückgenommen.Es wird an diesem Punkt bei einer weiteren Verschärfungangelangt:Wir haben das AN IHM SELBST POSITIVE und das AN IHMSELBST NEGATIVE vor uns.-
ANMERKUNGEN
..
.. _.,._-"._- -:;=::::.:...::::=:.- ..:........:::..:-==.::."~~....:==.::: ..::.:.:.::.:..". ....,_.".__.
- 23 -
Überleitung in den WIDERSPRUCH:Es zeigt sich, daß Positives und Negatives, um überhauptihre Charakteristik aufrecht erhalten zu können,ihren Antagonismus, der zunächst im Gegensatzsituiert ist, selbst in sich tragen müssen. Diesmeint die Einheit mit sich, die in der Vertauschbarkeitnoch nicht gegeben ist. D.h. der Antagonismus wirktin den jeweiligen Bestimmungen selbst. Damit erreichensie ihre SELBSTÄNDIGKEIT.Sie beziehen sich nur auf sich selbst und könnendie Selbständigkeit für sich reklamieren, weil siedas ihnen Andere schon an ihnen selbst enthalten.Sie affirmieren ihre eigene Bestimmung so sehr, alssie das ihnen Gegensätzliche ausschließen. Es bestehtdamit ein AUSSCHLIESSUNGSVERHÄLTNIS von Pos. undNegativem.Die unerläßliche Einsicht, die in den Widerspruchführt, besteht demnach in der Tatsache, daß die Selb-ständigkeit der beiden Seiten daraus resultiert,daß sie ganze sind. Sie bedürfen des anderen nichtnur nicht, sie schließen es aus. Nur haben sie ihreSelbständigkeit dadurch erlangt, daß sie die Beziehungauf das Andere an ihnen selbst haben, d.h. sie habendas, was sie aus sich ausschließen, an ihnen selbst,und SIE SCHLIESSEN DAMIT SICH VON SICH SELBST AUS.Die Bestimmungen schließen ihre eigene Selbständigkeitaus sich aus, weil ihre Selbständigkeit daher kommt,daß sie die Beziehung auf Anderes an ihnen selbsthaben. Es ist der WIDERSPRUCH, im sich selbständigSetzen die eigene Selbständigkeit aus sich auszu-schließen. Dies-er zeigt sich als ANSICHSEIENDERWiderspruch des Positiven und als GESETZTER desNegativen.Für das POSITIVE ist jegliches Gesetztsein, nämlichDAß es Gesetztsein ist, aus ihm selbst ausgeschlossen.Indem aber das Positive sein Gesetztsein aus sichausschließt, macht es sich selbst zu einem "Gesetzten":Es bezeichnet sich als das "nicht Negative". DiesesNegieren des Negativen durch das "nicht" ist abergerade der CHARAKTER DES NEGATIVEN selbst.Somit ÜBERSETZT sich das Positive in das Negative.Im Ausschließen des Negativen vollführt das Positivenichts anderes als das Negieren, das das Negativeausmacht.Das NEGATIVE (im Rückgriff auf Aspekte der absolutenReflexion) ist selbst als die Negation der Negationnur die Bewegung des Negierens. Wenn das Positiveaus dem Negieren ausgeschlossen ist und der Charakterdes Negativen darin besteht, Negation zu sein, undes aber nichts außerhalb seiner negieren kann, sobezieht sie sich nur auf sich selbst, dies ist dieNegation der Negation. Aber dieser Selbstbezug istzugleich die Gleichheit des Negativen mit sich, undeben in diesem Selbstbezug hat es keinen anderen
ANMERKUNGEN
- 24 - ANMERKUNGENCharakter als -indem es sich auf sich selbst bezieht-POSITIV zu sein.Das Negative ÜBERSETZT sich also ebensosehr insPositive, indem es die Identität mit sich ausschließt(-was der Charakter des Positiven wäre). Aber imAusschließen der Identität ist das Negative selbstmit sich identisch!
- 25.- . ANMERKUNGEN
Auflösung des WiderspruchsDen expliziten Ausgangspunkt der Auflösung des Wider-spruchs stellt die "Für-sich-Betrachtung" des Positivenund Negativen dar. Dabei erscheint die "Übersetzungs-bewegung 11 am Positiven einsichtig und unkontroversiell.Diese Positive der Positivisten hat die Intentionund zugleich Fiktion, gegen den Unterschied mit sichidentisch sein zu wollen. Es ist der Versuch desBeharrens auf einer scheinbaren Unmittelbarkeit,deren Unwahrheit schon längst entlarvt wurde. Ebendiese Hartnäckigkeit ist aber der Verlust jenervermeintlichen Solidität. Das Positive ist aber nurder ansichseiende Widerspruch.Wodurch unterscheidet sich nun der gesetzte Widerspruchdes Negativen ?Beide, Positives und Negatives sind so sehr Gesetztseinals auch Reflexion-in-sich. Beim Positiven, welchesgegen sein Gesetztsein bloß mit sich identisch zusein trachtet, überninuntdas IISich-in-sich-reflektieren"die Funktion eben jene Identität erst herzustellen.Dieser Se1bstbezug ist aber "AUSSCHLIESSLICW (!) BeidieserVervarlJngd.durch das Negative getragen. Im Herstellen der Identität Wortes"ausschliE:ßlich'~geht-<-dieselbe zugleich verloren. Das Negative hingegen mit der Konnotationdeshat dieses IIVerlorensein" der Identität schon zu "nurl~wirdersichtlich,seiner Bestinunung. Dadurch ist es aber der verschärfte daßjeglichesIlNur-sein-Widerspruch , nämlich in sich reflektiert zu sein, v.ol1en"ebendas, v.o-eine Gleichheit (bzw. auch Selbständigkeit) mit sich gegenes sichfixiert,zu behaupten, gegen die eigene Negativität oder schon irrpliziert.Ungleichheit.Das Positive ist also der Widerspruch, trotz derbeanspruchten Identität unterschieden (oder: NEGATIV)zu sein, das Negative aber der Widerspruch, trotzder beanspruchten Nichtidentität identisch (oder:POSITIV) zu sein. Damit ist also "ciaA 4Lch. (Jbe/lAe:t~en4eUUVl. Ln: -sein: ~eg.en.:tei..1." t ebd. 5.67 J schon exp1izit ge-worden.-Auch in einem Aufsatz von Urs Richli heißt es: "Da ciaANeg.ati..ve, g.eIl.ade .i.n.40/..eA.J7.und wei.l.. e4 -seine: Jden.:tJ.;tätrrU..,t 4Lch. (].JM4ch.lJ...eßt:., rrU..,t -si.ch: Lden.:tJ...4ch. J...4t:.,kOnA:ti..i:.ui..eA.t:.e4 nach. den: AU/../..a44Ul7..[J-Heg.w die Jden.:tJ.;tätru.chi: bloß GM Jmp-l.iJ<.at:.·.aeine»: Iruieanen: VeIl./..a44Ul7..[J-,40ndeA.J7. J...4t:. 4W4t:. di:e Jden.:tJ.;tät, di.e e4 ~ch.lJ...eßt:.."(&chh.., DLaJ.ek.tik Im Sinn: den: ße:lAach.t:.Ul7..[J-dea. Den.k.-beoximnunaen: an. und fi.iA. 4Lch.JIm Text der Wissenschaft der Logik wird diese "Über-setzungsbewegung" dann als das "/l..a4:u"04e Ve/lAc.hwLndendea. Cn.:trJefJen.g.e4e:t~en Ln: Ihnen: 4W4t:." (W.d, L. JJ, S. 67Jbeschrieben. Es tritt also jene Rastlosigkeit wiederauf, die schon für das WERDEN kennzeichnend war."Da4 WeA.den en,thw nämLi..ch. In: -si.ch: das Sein: undda-s NLch.t:.4, und 3WG/Z. 40, daß die-se beiden. -scideciuiün:ineinanden: UfTl,,1c.M.a.g,enund -si.ch: einanden. fJeg.en4e.U:i..g..auiheben, HLeA.JTU..;te/UJ)eWt:. -ü.ch. da» WeIl.den GM dasduachau-s 'PAST LOSE., toeiche» -sLch: abell..in.. dce-se»:ab4«ak.t:.en 7<.a4t:.lo4~eU nLch.t:. ~ e!7..h.aUen venmaq, •• " I (&\e. §8t,~
- 26 -
Im Widerspruch haben wir es aber nicht mehr nur mitSein und Nichts zu tun, sondern mit dem " f}eAe:t.p:.en.,/l..etLektivz.i:.en. Sein" {W.d.LJ,51Jfvzkanp,5.86Jals d. Positiven,und dem "f}eAe:t.p:.en., /l..etLektivz.i:.en. N.i..c:.h.:t:4"Lebd, J alsdem Negativen. Im Zusatz zum §89 der Enzyklopädieheißt es weiter, daß "da-s 'ReAu.L:t.a:taben: di.eoeo tp/l..O~eA-deA
ru.ciu: da» Leeee: Ni...cht-d" ist,"sondean: da-s mis: den: N~on Ldenxcacne. Sein, ioeIche»w.i.A.Da-sein: nennen. ••• " {CNZ.§89 , ZU4a;t~J•Im Widerspruch resultiert uns ebensosehr nicht dasleere Nichts, sondern der Grund, welcher /I d.tM.NJCHT5,aben: auch 'REFLEXJON-JN-5JCH i...-d-t. " (W.d.L JJ,SuhM..5.219)
Zunächst wird aber als nächste Einheit, die aus der11Ubersetzungsbewegung11 resultiert, die NULL angegeben.Sie ist die verstandesmäßige Fixierung der Negativitätüberhaupt, an welcher die Prozessualität übersehenwird. Wenn das "Sich-Übersetzen" als das ständigeUberspringen einer Grenze' begriffen wird, so istletztlich sie selbst das einzig "Festhaltbare", demaber kein Ort zugebilligt werden darf. Somit kanndieses "Dazwischen" nur mit dem Leeren identifiziertwerden, oder mathematisch mit der Null.Hegel sagt nun aber weiters: "De/l.. Wi..de/l..-dp/l..Uchenthältabea. ru.chs: b..loß das N~ve, -sondean: auch: da»tpo-d.i..tive,." {Wod. L. JJ, Suhrd«, 5.6; JDas Negative meint hier die Bewegungscharakteristikdes "Sich-Übersetzens" selbst, ein infiniter ProgreB(in sich) ohne Resultat. Bei dieser abstrakten Be-stimmung kann aber nicht stehengeblieben werden,diese "nur-Negativitätll wäre das inhaltslose, achsen-drehende Kreisen sich gegeneinander aufhebenderElemente. Es wäre jene unbestimmbare Ausdruckslosigkeitdes "Ich lüge", ein bloßes Setzen ohne Satz.Inwieweit ist aber nun das Resultat des Widerspruchsnicht nur Null?Positives und Negatives mußten zu ihrer Verselb-ständigung nicht nur einander gegenseitig ausschließen,sondern auch ihr Gesetztsein. Bzw. galt bei beidenReflexionsbestimmungen das Gesetztsein nur alsaufgehobenes. (Gegensatz:Absatz 9u.10)Mit dem Aufweis der Unbeständigkeit der Extremataist aber ihr Gesetztsein offen zu Tage getreten,oder ihr Gesetztsein ist nun gesetzt. Damit ist erkannt,was der Ausdruck IIGesetztsein der Selbständigkeitllje schon besagt hat, nämlich Aufgehobensein des Gesetzt-seins der Selbständigkeit. Oder: "DM ~eAe:t.~einden. 5w-d-tän.r:Ü[}k.eil fJ-eh:t dadunch. aufJ-/l..un.de, daß die/lJode..l..le -d.i..cA cd» nun. f}eAe:t.p:.e' ~ei.g.en." (Liebnuck»,Spnache. u, ßewuß-t.-dein ßd. 6/2,5.149)Dieses "Zugrunde-gehen" wird nur in das wahre Resultatdes Widerspruchs münden. Das vermag nur durch dieaufhebende Beziehung der ausschließenden Reflexionauf sich klar zu werden.
ANMERKUNGEN
-------_ ...._ .._--_ ..--_ .._- --.------ ..-..- - ~-----"'----~~_.._- .._---.--_.~-------------~._----~--
- 27 -
Diese aufhebende Beziehung wird folgendermaßencharakterisiert:"Sie (dieausschliEßendeReflexion;EinrUgung:T.A.) heb«: daain:c'R5TD/5 da-s Neg..a:t.Lve auf.., und. ZWc:JTD/5 -1e:t~ de-üch. a.L1 N~ve-1, und. dce» Mt:.eAAt:.· dMj..erU.ri-eNe{)-a:ti..ve, dGA -1i..e au/..hebt:.;•• rt rW.d.L.JJ, 5uM.k.5.68J
Das erste Aufheben des Negativen bedeutet nichtsanderes, als daß durch die ausschließende ReflexionPositives und Negatives zu fürsichseienden, selb-ständigen Einheiten werden, welche in sich reflektiertsind und das ihnen Negative des Gesetztseins aus-schließen. Dieses Negieren ihres Gesetztseins istihr "Entgegnungsversuch", den sie nur durch das uGegen"und "Nicht", auf welche sie sich dabei beziehen,praktizieren können. Dises Praktizieren ist aberdie Bemühung, sich durch das "Nicht" als ungesetztzu setzen. Sie setzen sich also mit Hilfe des "Nicht"al~ ungesetzt und dadurch zeigt sich, daß ihr "Nicht-gesetztsein" nur Behauptung war, und eben das "Nicht"sie erst-recht zu Gesetztsein(en) macht.Die ausschließende Reflexion verhält sich also selbstnegativ, das meint die Wendung "...setzt sie sichals Negatives,•.".Das setzende Element DIESES Gesetztseins ist abernun dem Gesetztsein selbst kein Äußerliches mehr.Durch das "SICH als Gesetztsein setzen" bestimmtes sich selbst nicht als das Negative eines Anderen,sondern als das Negative seiner selbst. Es geht mitsich selbst zusammen, oder dieses Gesetztsein istebensosehr Nichtgesetztsein und damit GRUND.-
,.~> j)rdl~~i
A
-;> 5c~iiP '?:),~, ~.4-1;""i''''''<li I
c'::t
1I
ANMERKUNGEN
- 28 -
Vom Grund zur EXistenzDie Genesis der Erscheinung mag uns, werfen wir einenBlick auf das Inhaltsverzeichnis, par.adox anmuten.Denn im Vorhergehenden wurde die SPHARE DES GRUNDESbehandelt, welche als ihren Kulminationspunkt dieBedingung ausweist. Weiterhin sollte uns also dasResultat der Analyse der Bedingung zum Begriff derErscheinung geführt haben. Wer aber hätte es wohlgewagt, vor Kenntnis der Hegelschen Logik, die Bedingungals eine sich erst aus dem Grunde ergebende Kategorieanzusetzen, und deren immanenten Zusammenhang mitder Erscheinung zu behaupten. Eben dies tut nun Hegel.Sehen wir zunächst auf das Phänomen des Grundes alssolchen, wie es uns in "A.DER ABSOLUTE GRUND" vorge-stellt wird. Dort begegnen wir zweier notwendigerAspekte von Grundsein, die zweifelsohne als unerläßlicheMinimalforderung an jede Auseinandersetzung mit demThema Grund ergehen. Freilich zeigen sie sich uns,schlagen wir dieses Kapitel auf, innerhalb des Kontextesder ausgeführten Interpretation der Wesenslogik undbilden demnach keine nur postulierten anfänglichen§egebenheiten, welche aus dem berühmt, berüchtigtenArme1schütteln hervorgegangen wären. Dennoch könnendiese Bestimmungen, auch ohne Bezugnahme auf denschon beschrittenen Gang der Logik, einigen Anspruchauf Einverständnis erheben.Es wird also, wenn vom Grund gehandelt wird, erstensdie Natur der UNBESTIMMTHEIT mit ihm in Verbindunggebracht werden müssen. Dabei ist es höchst wichtig,darauf zu achten, daß der Grund NIEMALS ALS REINEUNBESTIMMTHEIT QUA ARCHIMEDISCHEN PUNKT betrachtetwerden kann, sondern als eine ZUR UNBESTIMMTHEITBESTIMMTE Kategorie. Erstere Ansicht hätte nämlichden absoluten Mangel, daß durch sie die Negativitätnicht am Grunde selbst gedacht wäre und damit derzweite unabdingbare Aspekt nicht in Einklang mitihr stünde. Es ist das die Beziehung von GRUND undBEGRÜNDETEM als notwendig konstitutive Bestimmtheitdes Grundes. Abstrakter genommen, können wir beideAspekte mit Identität und Unterschied identifizieren.EINERSEITS handelt es sich nun um DAS EINFACHEIDENTISCHE WESEN, das sich als unbestimmt bestimmte,ANDERERSEITS um DIE DOPPELUNG VON GRUND UND BEGRUNDETEM,welche gegeneinander als bestimmte Identitäten er-scheinen. Beide Aussagen vom Grund sind gleichwesentlich, ihre Legitimation haben sie jeweils anihrem anderen Moment. Nichtsdestotrotz können undmüssen sie auch unterschieden werden. Grund und Be-gründetes machen überhaupt die Seite der Vermittlungaus, unterschieden vom Wesen als gleichsam (1)identischer Identität. - ALLE BESTIMMUNGEN NUN GEHÖRENin das "Reich der Bezogenheit" oder, um erst jetztden Hegelschen Terminus einzusetzen, zur FORM, welchezunächst nur durch den zweiten Aspekt repräsentiertscheint..
ANMERKUNGENl
- 29 -
Aber offensichtlichermaßen kann das Zueinander derAspekte wohl ebensosehr als Beziehung angesprochenwerden~ wodurch letztlich das Ganze zur Form zählt.An dieser Stelle könnte man dem Mißverständnis unter-liegen~ daß durch diese Erkenntnis die Grundbeziehung~welche die Form als Form verkörpert~ der einzig hin-reichende Aspekt zur Analyse des Grundes wäre. ImGegenteil wird erst jetzt die Gegenüberstellung vonForm und Wesen~ welche zunächst als logisches Geschehenauftrat~ als solches bestimmt gesetzt. Denn geradedie Zuspitzung in Richtung reine Förmigkeit trans-formiert die Form in das Feld leerer Haltlosigkeit~wodurch sie sich in ihrer Unterschiedenheit aufhebtund zur unterschiedslosen Identität reduziert. DieserVerlust ihres Charakters schlägt aber unmittelbarin das Gegenteil um, weil die Form in ihrem Zurückfallenauf den Boden der Identität dadurch ihr eigenes Bestehenwiedererlangt.Somit zeigt sich eine spezifische Ausprägung desersten Aspekts, welcher nun zu einer rein form- undunterschiedslosen Identität gestempelt ist. EinSCHLECHTHIN ABSTRAKTES~ welches von Hegel als DIE
MATERIE ausgewiesen wird.In den nächsten Schritten wird gezeigt~ inwieferneine versuchte Trennung von Form und Materie nurihre EINHEIT zu Tage fördert, die letztlich immerschon als bestimmte Grundlage den Ermöglichungsgrundfür jene Abstraktionen abgab. Diese formierte Materieoder materialisierte Form ist der INHALT, der seiner-seits aufgrund seines Hervorgangs und seiner Bestimmt-heit wiederum als Bestimmung der Form auftritt. Nocheinmal tritt dfe Form dem Aspekte des Identischengegenüber. Es entsteht die Situation, daß der Inhalt,indem er aus Form und Materie resultiert, selbstDAS GANZE DER FORM ist und seinem Charakter nachdieselben Aspekte an ihm hat, wie der Grund selbst,von dem wir ausgegangen sind. Er ist selbst dieIDENTITÄT DES GRUNDES und hat also den anderen Aspekt,d.i. die Grundbeziehung, an sich (l) an ihm. Zugleichaber erscheint die Form, welche durch die Identitätdes Grundes Grundbeziehung ist, dem Inhalt äußerlichgegenüber. Die Wahrheit ist nur, daß die Grundbeziehungnicht zweimal vorkommen kann, nur eine einzige ist,und deshalb den Inhalt an ihr selbst haben muß. Wirerreichen hiermit eine inhaltliche Grundbeziehungoder den GRUND ALS BESTIMMTEN.Die beiden Aspekte des Beginns~ welche den Abschnittüber den absoluten Grund durchherrschen, müssen er-weitert werden.Es kommt der Umstand hinzu, daß vom Grunde nur dannwahrhaft gesprochen wird, wenn er sich als Grundmit einem Inhalt erweist.Dadurch werden wir aber in neuartige Schwierigkeitengestürzt.
ANMERKUNGEN
l
- 30 - ., ANr~ERKUNGEN
Inhaltliches Begründen sieht sich nämlich grundsätzlichvor eine zweifache Prob1ematik geste11t.Einerseits muß die Äquivalenz von Grund und Begründetemgegeben sein oder "ru.du» im ~lZ.1..lIUi.e, WeM nicht i..mßei;A.ünde:ten., -10 uu:« ru.clu» im ßegAiln.de:ten., WeM nichtim ~lZ.1..lIUi.e".(Heg.el.., W.i-1-1e17..-1chaf.,tden. Log.i.fl. JJ, Suhakomp5.97) Ohne Gewährleistung dieser Forderung wird nichtbegründet.Dies führt aber nur zur bloßen Reproduktion des Inhalts,der einmal in unmittelbarer Weise, das andere Malin der Form der Wesentlichkeit ausgedrückt wird.Es ist das FORMELLE BEGRÜNDEN, welches stets nurin der Tautologie endigt. (Dabei eignet es sich be-sonders gut, eine Kraft für das Zustandekommen einesPhänomens verantwortlich zu machen.)Daraus leitet sich die zweite Forderung ab, daß imBegründen auch REALE VERSCHIEDENHEIT statthaben muß,wobei sich wieder zeigt, daß nun die erste Forderungnicht mehr aufrechterhalten werden kann. D.h. derREALE GRUND begründet sowenig wie der formelle.Einen Ausweg aus diesem Dilemma sucht nun derVOLLSTÄNDIGE GRUND, in welchen reale und formelleSeite aufgehoben sein sollen. Das heißt nun, daßdie reale Grundbeziehung ihrerseits begründet werdenmüßte, um mit Hilfe dieses Umwegs die Äquivalenz-forderung durch einen neuen Grund zu gewährleisten.Weil nun die reale Grundbeziehung schon die Verbindungzweier Inhaltsbestimmungen ist, muß auch der siebegründen sollende neue Grund diese zwei Inhalts-bestimmungen enthalten. Denken wir an "Nichts imGrunde, was ntcht im Begründeten usf.11 Um aber nichtin die Tautologie zurückzufallen, muß wenigstensdie Art der Verbindung der Inhaltsbestimmungen eineunterschiedene sein. Nur so bleibt die reale Seitepräsent. Auf der Seite des Grundes kann diese Ver-knüpfung nur UNMITTELBAR sein, weil sie eben NICHTGrundbeziehung ist. Auf der anderen Seite muß dieVerbindung eine gesetzte sein, weil dort die Grund-beziehung allererst klappen soll.Jetzt aber geschieht das Verblüffende, daß, indemalle Vorbereitungen zum Funktionieren der Grundbeziehungin Stand gesetzt sind, sich dieselbe eben deshalbDESTRUIERT. Warum? Weil das nun hervorgetretene Gefügesich allein von der Bezugnahme auf jene Inhalts-bestimmung ableitet, welche auf der Seite des Grundesmit der anderen Inhaltsbestimmung unmittelbar verknüpftist. Es wird damit jene Stelle bezeichnet, die imBegründungsnetz nicht aufgefangen werden kann unddadurch die versuchte Begründung überhaupt zum Scheiternbringt. Die angegebene Stelle bedeutet für den Grundnun insgesamt eine unmittelbare Voraussetzung oderdas Unmittelbare als solches, die BEDINGUNG.
- 31 -Der Wunsch nach Vollständigkeit treibt den Grundüber sich hinaus. Es ist die Unmöglichkeit erfaßt,das unmittelbare Moment als nur innerhalb seinerselbst aufgelöst zu wissen. Er hat es anzuerkennen,sein Anderssein aus sich herauszusetzen und sichvon sich selbst abzustoßen. Noch ist es nicht klar,daß das Gezwungensein, sich eine Voraussetzung zugeben, eigentlich den Grund vor seinem Verschwindenbewahrt. Weil es nämlich sein eigenes ihm inwohnendesTun ist, opfert er sich keiner fremden Jenseitigkeit,sondern wird ERST IN SEINEM ZUSAMMENGEHEN MIT DERBEDINGUNG seine wahre Bedeutung erlangen.Das Weitere ist nun, daß uns die Bedingung zunächstals unmittelbar mannigfaltiges Dasein entgegentritt.Um aber überhaupt Bedingung zu sein, ist sie vonsich aus auf den Grund bezogen, bliebe ansonstenim Status eines bloß Seienden. Beharren wir auf demVersuch, die Bestimmung der Bedingung für sich fest-zuhalten, so ergibt sich aus ihrem eigenen Begriffder notwendige Bezug auf den Grund. Wäre sie nichtdurch den Grund selbst vermittelt, gerönne sie zumbloß Daseienden.Nach dieser Seite ist also die Bedingung selbst bedingt.Von der Perspektive des Grundes aber gestaltete sichdas Moment der Unmittelbarkeit als das seinem Einfluß-bereich entzogene und erhält gerade durch ihn selbsteine Selbständigkeit, die die Bedingung als das gegenihn UNBEDINGTE formiert. Die Bedingung ist hiermitder Widerspruch, zugleich bedingt und unbedingt zusein. Der Grund seinerseits steht aber in derselbenWidersprüch1ichkeit. Daß auch er durch die Bedingungbedingt wird, braucht kaum erwähnt zu werden. Warumaber sollte der Grund nun eben darin auch selbständigsein? Dies ist weniger offensichtlich.Aufgrund des Scheiterns einer vollständigen Begründungverlagerte der Grund seine Identität und damit seinBestehen in die Bedingung. Diese Identische ist derInhalt, welcher in der Bedingung durch das Zugrundegehender Grundbeziehung oder Formbeziehung, eben von dieserForm befreit erscheint und als Inhalt so unmittelbarist, wie die Bedingung selbst. Die Form, welche alsonicht an diesem Inhalte sein soll, kann daher nurrein auf die Seite des Grundes fallen. Wie wir aberaus dem Vorhergehenden schon wissen, reduziert sichsolch reine Förmigkeit an ihr selbst zum Identischen,bekommt also den Charakter der Selbständigkeit anihr selbst.So ist es verständlich, daß auch der Grund so sehrselbständig und unselbständig ist wie die Bedingung.Beide stellen, wie schon gesagt, jeweils denselbenWiderspruch dar. Die Auflösung dieses Widerspruchswird uns erst zum wahrhaft Unbedingten fUhren. Dererste Schritt dazu liegt im Aufweis, daß die Momenteder Unmittelbarkeit und der Vermittlung nicht nurdurch die Relation von Bedingung und Grund zustande-kommen, sondern daß sie als Momente an diesen beidenKategorien selbst vorkommen.
ANMERKUNGEN
- 32 -Der Kreis ihres Außereinanderseins wird geschlossenwerden und ihre Einheit ans Licht treten. Hinsichtlichder Bedingung ist es nämlich so, daß die Vermittlungnicht nur durch den Grund an sie herangetragen wird.Vielmehr vermittelt sich die Bedingung mit sich selbst,weil sie als Dasein gesetzt wurde, welches durchaus,jetzt mit dem Blick auf die ganze Logik, eine Bewegungvollführt, die es zunächst zum Wesen, dann zum Grundewerden läßt. Über den Grund hinaus kehrt sie dannzu sich selbst zurück. Sie bildet sich selbst zumGanzen aus und hat Form und Inhalt an ihr selbst.Ebenso ist der Grund diese Ganzheit selbst, weiler sich auf sich beziehendes Setzen ist und darinsich als voraussetzend setzt. D.h. aufgrund derTatsache, daß, wie ich schon einmal betonte, auchnoch sein sich zur Bedingung machen, eigenstes Tundes Grundes ist, liegt sein Anderssein noch in seinereigenen Totalität.Was jetzt noch zu geschehen hat, ist die Einsicht,daß "beide Sei.xen: des ~an.J-en.., ß~ und ~Il.UI7.Ii.,t:lNE, weAenUi.cAe &i.nh.e.U:., /.fowolU al.4 Jn.h.aU uu:e: a1.AFOIUn -sind:" (Heg.e1.., WM/.fen../.fch.a?tden: Logj.k. JJ, Suhnkomp5.117)"Oi...eAe den: eine. J'nha.Is: und Fonmeinheis: beiden, .i.A;f:.DA5 WAI-fRfIAFT UN/3E,DJN~TE,;DJE, 5ACHE, AN 5JCH 5E,Lß5T. "Lebd, ,5.118)
Weil nun die beiden Seiten von Bedingung und Grundjeweils an ihnen selbst wesentlich sich als voraus-setzend zeigten, so ist bezüglich ihrer Einheit auchnur ein einziges Voraussetzen vorhanden. Die Einheitals die Sache an sich selbst wird also vorausgesetzt,zugleich aber so, daß sich das Vorausgesetzte alsdas Setzende ihrer erweist und Bedingung und Grundals Momente in ihrer Einheit aufgehoben sind. Dieunbedingte Sache ist in Wahrheit ihr GRUND, und dasVerhältnis von Grund und Bedingung wird zu einembloßen Scheine herabgesetzt. Kein statischer Schein,sondern Bewegung, sprich ein Scheinen in sich selbst,welches letzlich als reine Bewegung der Sache zusich selbst eben diese Sache hervortreten läßt, welchesein Sich-Herausstellen der EXISTENZ;st.
ANMERKUNGEN


































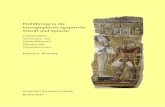




![Helvetia literarisch. Eine Anthologie der Texte Schweizer Autoren mit Aufgaben. Mit einer Einführung von Prof. Dr. Joanna Jabłkowska [Co-editor: Alina Kowalczyk]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63134b745cba183dbf0708bf/helvetia-literarisch-eine-anthologie-der-texte-schweizer-autoren-mit-aufgaben.jpg)















