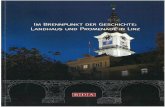Die Rache des Materials. Eine andere Geschichte des Japonismus, diaphanes: Zürich/Berlin spring 2015
Einführung in die Osteuropäische Geschichte
Transcript of Einführung in die Osteuropäische Geschichte
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag · Köln · Weimar · WienVerlag Barbara Budrich · Opladen · Farmington Hillsfacultas.wuv · WienWilhelm Fink · MünchenA. Francke Verlag · Tübingen und BaselHaupt Verlag · Bern · Stuttgart · WienJulius Klinkhardt Verlagsbuchhandlung · Bad HeilbrunnLucius & Lucius Verlagsgesellschaft · StuttgartMohr Siebeck · TübingenC. F. Müller Verlag · HeidelbergOrell Füssli Verlag · ZürichVerlag Recht und Wirtschaft · Frankfurt am MainErnst Reinhardt Verlag · München · BaselFerdinand Schöningh · Paderborn · München · Wien · ZürichEugen Ulmer Verlag · StuttgartUVK Verlagsgesellschaft · KonstanzVandenhoeck & Ruprecht · Göttingenvdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
UTB 8389
Ekaterina Emeliantseva, M.A. (Abt. für Osteuropäische Geschichte, Universität Zürich): Einleitung, Religionen und Konfessionen, Russland und die Sowjetunion
Arié Malz, M.A. (Abt. für Osteuropäische Geschichte, Universität Zürich): Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Südosteuropa
Daniel Ursprung, M.A. (Abt. für Osteuropäische Geschichte, Universität Zürich): Ethnogenese und Nationsbildung, Politische Geschichte Osteuropas, Ostmitteleuropa
© 2008 Orell Füssli Verlag AG, Zürichwww.ofv.chAlle Rechte vorbehalten
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Dadurch begründete Rechte, insbesondere der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Vervielfältigungen des Werkes oder von Teilen des Werkes sind auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie sind grundsätzlich vergütungspflichtig.
Karten S. 368/69, 370/71, 372/73 © 2003 Euroatlas-Nüssli, www.euratlas.net, Liz-Nr. 07osk0905148Karten S. 374, 375, 376/77, 378/79 aus: Putzger, Historischer Weltatlas© 2001 Cornelsen Verlag, Berlin Best.-Nr. 1784 Satz: Orell Füssli Verlag / Daniel UrsprungUmschlaggestaltung: Atelier Reichert, StuttgartDruck: fgb • freiburger graphische betriebe, Freiburg
ISBN 978-3-8252-8389-6
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet http://dnb.ddb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
5
INHALTSVERZEICHNIS Vorwort………………………………………………………..........……11
TEIL A: EINLEITUNG .................................................................. 13
1. Das Fach Osteuropäische Geschichte ................................. 13
1.1 Gegenstand des Faches ............................................................ 13
1.2 Zum Begriff «Osteuropa» ........................................................ 13
1.3 Zur Abgrenzung Osteuropas .................................................... 15
1.4 Strukturraum und historische Region Osteuropa ..................... 16
1.5 Innere Aufgliederung «Osteuropa im weiteren Sinne»............ 18
Literatur zum Abschnitt 1: Das Fach Osteuropäische Geschichte ..... 19
2. Geschichte des Fachs ........................................................... 20
2.1 Osteuropäische Geschichte im deutschsprachigen Raum ........ 20
2.2 Russian and East European Studies ......................................... 23
Literatur zum Abschnitt 2: Geschichte des Faches ............................ 25
3. Historiografie, Methoden und Theorien ............................... 26
3.1 Geschichtsschreibung in Osteuropa ......................................... 26 3.1.1 Russland und die Sowjetunion ................................................ 26 3.1.2 Ostmittel- und Südosteuropa ................................................... 32
3.2 Aktuelle Entwicklungen: Kulturgeschichte Osteuropas .......... 35 3.2.1 Themen, Fragen und Schulen der Kulturgeschichte ................ 35 3.2.2 Forschung zur Kulturgeschichte Osteuropas ........................... 37
Literatur zum Abschnitt 3: Historiografie, Methoden, Theorien ....... 39
4. Nachschlagewerke und Einführungen in westeuropäischen Sprachen ................................................ 42
4.1 Osteuropa allgemein ................................................................ 42
4.2 Russland und die Sowjetunion ................................................. 42
4.3 Ostmittel- und Südosteuropa ................................................... 43
4.4 Zeitschriften ............................................................................. 43
4.5 Online-Ressourcen ................................................................... 44
Inhaltsverzeichnis
6
TEIL B: SYSTEMATISCHER TEIL ................................................... 45
1. Ethnogenese und Nationsbildung ........................................ 45
1.1 Einleitung: Themen und Fragen............................................... 45
1.2 Kollektive Identitäten und ihre Entstehung ............................. 47 1.2.1 Ethnizität ................................................................................. 47 1.2.2 Ethnogenese ............................................................................ 48
1.3 Vertiefender Exkurs: Die Entstehung ethnischer Gruppen in Osteuropa ................................................................................. 51 1.3.1 Die Slawen .............................................................................. 51 1.3.2 Romanen: Vlachen und Rumänen ........................................... 64 1.3.3 Albaner .................................................................................... 67 1.3.4 Finno-Ugrier: Ungarn, Esten, Finnen ...................................... 69 1.3.5 Balten: Litauer und Letten ....................................................... 72 1.3.6 Zigeuner (Roma) ..................................................................... 73
1.4 Nationsbildung und Nationalismus .......................................... 75 1.4.1 Zum Konzept Nationalismus ................................................... 75 1.4.2 Nationsbildung in Osteuropa ................................................... 77
1.5 Forschungskontroversen .......................................................... 86
Literatur zum Abschnitt B.1: Ethnogenese und Nationsbildung ........ 87
2. Religionen und Konfessionen .............................................. 92
2.1 Themen und Fragen ................................................................. 92
2.2 Religionen und Konfessionen bis 1917 (Russland) bzw. 1945/48 (Ostmittel- und Südosteuropa) ................................... 93 2.2.1 Überblick über religiöse Gemeinschaften und Kirchen ........... 93 2.2.2 Christianisierung: Unterschiede zwischen Ost- und
Westkirche ............................................................................... 95 2.2.3 Konfessionelle Grenze zwischen Ost- und Westkirche ........... 99 2.2.4 Reformation und Konfessionalisierung ................................... 99 2.2.5 Kirchenunionen ..................................................................... 101 2.2.6 Die orthodoxe Ökumene ....................................................... 102 2.2.7 Der Islam ............................................................................... 103 2.2.8 Judentum ............................................................................... 104
Inhaltsverzeichnis
7
2.3 Vertiefender Exkurs I: Die orthodoxe Kirche in Russland .... 105 2.3.1 Herrscher und Kirche ............................................................ 105 2.3.2 Institution Kirche: Strukturen und Entwicklung ................... 106 2.3.3 Weiße und schwarze orthodoxe Geistlichkeit ....................... 107 2.3.4 Volksreligiosität im Russländischen Reich ........................... 108 2.3.5 Religiöser Dissens im Russländischen Reich:
Altgläubige ............................................................................ 110
2.4 Vertiefender Exkurs II: Religiöse Vielfalt in Südosteuropa .. 111 2.4.1 Volksreligiosität in Südosteuropa ......................................... 111 2.4.2 Religiöser Dissens auf dem Balkan: Bogomilen ................... 112
2.5 Religion und Kirche seit 1917 (Russland) bzw. 1945/48 (Ostmittel- und Südosteuropa) ............................................... 114 2.5.1 Sowjetunion ........................................................................... 114 2.5.2 Ostmittel- und Südosteuropa ................................................. 116
2.6 Vertiefender Exkurs III: Religion und Nationalismus in Südosteuropa .......................................................................... 118
2.7 Religiöse Minderheiten in den Vielvölkerreichen Osteuropas ............................................................................................... 120
2.8 Forschungskontroversen ........................................................ 121
Literatur zum Abschnitt B.2: Religionen und Konfessionen ........... 122
3. Politische Geschichte Osteuropas ..................................... 127
3.1 Einleitung: Themen und Fragen............................................. 127
3.2 Frühe Herrschaftsbildungen ................................................... 130 3.2.1 Voraussetzungen und Einflüsse ............................................. 130 3.2.2 Grundlagen der Herrschaftsbildung ...................................... 133
3.3 Vertiefender Exkurs I: Politische Geschichte des ostslawischen Raumes im Mittelalter .................................... 135 3.3.1 Frühe Herrschaftsbildung: Die Kiever Rus’ .......................... 135 3.3.2 Vorherrschaft der Goldenen Horde und Bildung des
Moskauer Reiches ................................................................. 138
3.4 Vertiefender Exkurs II: Die russische Autokratie .................. 140
3.5 Vertiefender Exkurs III: Adelsherrschaft in Ostmitteleuropa .................................................................. 144
Inhaltsverzeichnis
8
3.6 Vertiefender Exkurs IV: Die Osmanische Herrschaftsordnung ................................................................ 148
3.7 Vertiefender Exkurs V: Sozialismus ...................................... 151
3.8 Forschungskontroversen ........................................................ 156
Literatur zum Abschnitt B.3: Politische Geschichte ........................ 158
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ..................................... 163
4.1 Theoretische Ansätze ............................................................. 163 4.1.1 Einleitung .............................................................................. 163 4.1.2 Deduktive Ansätze ................................................................ 164 4.1.3 Induktive Ansätze .................................................................. 164
4.2 Grundlagen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte bis zum 15. Jahrhundert ......................................................... 165 4.2.1 Allgemeine Voraussetzungen ................................................ 165 4.2.2 Spezifische regionale und thematische
Entwicklungen vor 1500 ....................................................... 168 4.2.3 Spezifische Grundlagen der sozialen Systeme bis ins
15. Jahrhundert ...................................................................... 174
4.3 Grundlagen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vom 15. bis zum 18. Jahrhundert ........................................... 186 4.3.1 Die sogenannte «Zweite Leibeigenschaft» ............................ 186 4.3.2 Die protoindustrielle Periode in Böhmen, Russland und
im Osmanischen Reich .......................................................... 190
4.4 Grundlagen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von 1800 bis zur sozialistischen Revolution 1917/1945 ........ 195 4.4.1 Die industrielle Revolution und ihre Grundlagen .................. 196 4.4.2 Russland ................................................................................ 198 4.4.3 Südosteuropa ......................................................................... 201 4.4.4 Südliches Ostmitteleuropa ..................................................... 206 4.4.5 Nördliches Ostmitteleuropa ................................................... 209
4.5 Grundlagen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte im Sozialismus (1917/1945 bis 1990) ......................................... 211 4.5.1 Vom Marxismus-Leninismus zum Stalinismus: Die
ideologischen Grundlagen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Osteuropas ......................................... 211
4.5.2 NĖP- und Stalinzeit ............................................................... 212
Inhaltsverzeichnis
9
4.5.3 Die Wirtschaftsreformen unter Nikita Chruščev, Leonid Brežnev und Michail Gorbačev ................................ 215
4.5.4 Die Wirtschaftsentwicklung in den sozialistischen Staaten Osteuropas ................................................................ 217
4.6 Forschungskontroversen ........................................................ 221
Literatur zum Abschnitt B.4: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte .... 223
TEIL C: REGIONALE SCHWERPUNKTE ...................................... 229
1. Russland und die Sowjetunion ........................................... 229
1.1 Epochen und ihre Namen: Periodisierung ............................. 229
1.2 Von der Kiever Rus’ bis zur Mongolenherrschaft ................. 230 1.2.1 Kiever Rus’ (9.–13. Jahrhundert) .......................................... 230 1.2.2 Mongolen-Oberherrschaft und Aufstieg Moskaus
(13.–15. Jahrhundert) ............................................................ 234
1.3 Moskauer Reich (15.–17. Jahrhundert) .................................. 236
1.4 Russländisches Imperium (1700–1917) ................................. 239 1.4.1 Peter der Große (1682/89–1725) ........................................... 239 1.4.2 Katharina II. (1762–1796) ..................................................... 240 1.4.3 Petersburger Imperium im langen 19. Jahrhundert................ 241
1.5 Sowjetische Ära (1917–1991) ............................................... 248 1.5.1 Revolution und Bürgerkrieg (1917–1921) ............................ 248 1.5.2 Sowjetunion (1922–1991) ..................................................... 251
1.6 Perestrojka und postsowjetische Entwicklungen ................... 261 1.6.1 Perestrojka und die Auflösung der Sowjetunion ................... 261 1.6.2 Russländische Föderation nach 1991 ....................................... 262
1.7 Vertiefender Exkurs I: Staat und Gesellschaft ....................... 264
1.8 Vertiefender Exkurs II: Russland der Nichtrussen: Nationalitätenpolitik und Kolonialismus ............................... 267
Literatur zum Abschnitt C.1: Russland und die Sowjetunion .......... 272
2. Ostmitteleuropa .................................................................... 277
2.1 Einleitung: Themen und Fragen............................................. 277
2.2 Herrschaftsbildungen und regionale Entwicklung ................. 282 2.2.1 Ostalpenraum und westslawische Herrschaftsbildungen ....... 282
Inhaltsverzeichnis
10
2.2.2 Ungarn und Kroatien ............................................................. 290 2.2.3 Habsburger Reich .................................................................. 297 2.2.4 Baltikum ................................................................................ 300 2.2.5 Ausblick: Ostmitteleuropa seit 1989 ..................................... 305
2.3 Vertiefender Exkurs I: Landesbewusstsein und Adelskultur . 306
2.4 Vertiefender Exkurs II: Mittelalterliche Ostsiedlung............. 311
2.5 Vertiefender Exkurs III: Juden in Ostmitteleuropa ................ 313
Literatur zum Abschnitt C.2: Ostmitteleuropa ................................. 317
3. Südosteuropa ....................................................................... 321
3.1 Epochen ................................................................................. 321 3.1.1 Von der Spätantike bis zur osmanischen Landnahme ........... 321 3.1.2 Südosteuropa zwischen habsburgischser und
osmanischer Herrschaft ......................................................... 325 3.1.3 Der Niedergang des Osmanischen Reiches und das
lange 19. Jahrhundert ............................................................ 329 3.1.4 Die Zwischenkriegszeit (1918–1939) .................................... 333 3.1.5 Vom Zweiten Weltkrieg bis zum Zusammenbruch der
kommunistischen Systeme 1939–1989/1991 ........................ 337
3.2 Vertiefender Exkurs I: Traditionelle Sozialformen in Südosteuropa .......................................................................... 341
3.3 Vertiefender Exkurs II: Nationalismus und die Entstehung von Nationen in Südosteuropa ............................................... 345
Literatur zum Abschnitt C.3: Südosteuropa ..................................... 351
GLOSSAR ....................................................................................... 355
KARTEN ......................................................................................... 355
REGISTER ...................................................................................... 355
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
11
VORWORT VORWORT Die vorliegende Einführung in die osteuropäische Geschichte ist als Begleit-lektüre für das universitäre Studium der historischen Osteuropawissenschaft konzipiert, soll darüber hinaus aber auch einen breiteren Kreis von Interes-senten ansprechen, die sich in kompakter Form über die wichtigsten Grund-züge der Geschichte des östlichen Europa informieren wollen. Ziel dieses Buches ist es, in Zeiten zunehmender Spezialisierung des Faches in Form einer sowohl chronologisch als auch geografisch breit angelegten Übersicht Basiswissen zu vermitteln, Zusammenhänge aufzuzeigen und über den neu-esten Stand der Forschung zu informieren. Der Einstieg in die gleichermaßen faszinierende wie komplexe Osteuropahistoriografie, die allenfalls am Rand zum Allgemeinwissen zählt, soll damit erleichtert werden. Dieses Buch hat eine längere Vorgeschichte. Es basiert auf der Lehrerfah-rung mehrerer Generationen der Mitarbeitenden der Zürcher Abteilung für Osteuropäische Geschichte. Das Konzept der Lehrveranstaltung, auf dem im Wesentlichen auch die vorliegende Einführung aufbaut, geht auf den lang-jährigen Zürcher Lehrstuhlinhaber, Prof. Dr. Carsten Goehrke, zurück. Es beruht auf thematischen Längsschnitten, welche die vielfältigen historischen Prozesse, Ereignisse und Personen zu Strukturen und Grundlinien verdichtet. Als Dozierende mit den Vorteilen einer Fokussierung auf größere Zusam-menhänge insbesondere bei Studienanfängern bestens vertraut, nahmen die Autoren die Anregung des Verlags dankbar entgegen, eine Einführung in die Osteuropäische Geschichte zu verfassen. Die Schwierigkeit jedes vergleichbaren Werkes liegt darin, Komplexität zu reduzieren und zugespitzt zu formulieren, ohne dabei das von der Spezialfor-schung erarbeitete differenzierte Bild allzu stark zu verzerren. Zugleich galt es, mit diversen ungelösten Fragen und Forschungskontroversen umzugehen. Da Wissenschaft immer auf der Auseinandersetzung unterschiedlicher Standpunkte basiert, werden eine Reihe wichtiger Forschungskontroversen im Text explizit angesprochen. Der Aufbau des Buches besteht aus drei gro-ßen Einheiten. Im ersten, einführenden Block wird eine Übersicht über Ost-europa als Gegenstand historischer Wissenschaft sowie die unterschiedlichen methodischen und theoretischen Ansätze seiner Erforschung gegeben. Im zweiten, systematischen Teil stehen thematische Längsschnitte im Zentrum, die sich vertiefend mit Fragen der Ethnogenese und Nationsbildung, Religi-on und Konfession, der politischen sowie der Sozial- und Wirtschaftsge-schichte auseinandersetzen. Der letzte, regionale Abschnitt präsentiert schließlich die drei großen historischen Regionen des östlichen Europa: das auch als Osteuropa im engeren Sinne bezeichnete Gebiet Russlands, das westlich daran anschließende Ostmitteleuropa und das im Wesentlichen der
Vorwort
12
Balkanhalbinsel entsprechende Südosteuropa. Dabei sind thematische Über-schneidungen nicht nur unvermeidlich, sondern im Sinne der Selbstständig-keit jedes einzelnen Kapitels auch beabsichtigt. Die Literaturangaben be-schränken sich auf eine kleine Auswahl an Titeln in deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei vor allem neuere Publikationen berück-sichtigt wurden, die einfach zugänglich sind und den aktuellen Forschungs-stand repräsentieren – ältere Werke lassen sich davon ausgehend leicht er-schließen. Obschon viele Titel an mehreren Stellen eine Erwähnung verdient hätten, wurde auf Mehrfachnennungen konsequent verzichtet; die Literatur-hinweise zu den einzelnen Kapiteln sind daher immer auch mit den übrigen Kapiteln abzugleichen. Historische Karten aus unterschiedlichen Epochen sowie ein Glossar zur Erklärung von Fachbegriffen ergänzen das Buch. Einige Bemerkungen zur Schreibweise der Eigennamen: Die geografischen Namen sind im Text in der wissenschaftlichen Transliteration angegeben. Ausnahmen bilden international geläufige Namen wie Warschau und Mos-kau. Hier fand die eingedeutschte Variante Verwendung. Beim Kartenmate-rial wurde die deutsche Schreibweise der Originalvorlagen belassen. Perso-nennamen sind in wissenschaftlicher Transliteration notiert (Trockij statt Trotzki), prominente eingedeutschte Varianten ebenfalls ausgenommen, vor allem von Herrschergestalten vor dem 20. Jahrhundert (so Zarennamen: Pe-ter, Katharina, Alexander). Ähnlich wurde mit fremdsprachigen Begriffen verfahren; so wird die politische Gruppierung um Lenin als Bol’ševiki be-zeichnet, das dazugehörige Adjektiv hingegen lautet bolschewistisch. Den Autoren bleibt es, den Personen ihren Dank auszusprechen, die mit der Durchsicht des Manuskriptes und kritischen Hinweisen zum Zustandekom-men dieser Einführung beigetragen haben. In alphabetischer Reihenfolge sind dies: Meinolf Arens (München), Nada Boškovska, Peter Collmer, Cars-ten Goehrke (alle Zürich), Jörn Happel (Basel), Heiko Haumann (Basel), Daniel Jetel (Zürich), Christian Koller (Bangor), Julia Obertreis (Freiburg i. Br.), Judit Solt (Zürich) sowie Christophe von Werdt (Bern). Für Auskünf-te danken wir Felix Philipp Ingold (St. Gallen), Astrid Meier (Zürich), De-sanka Schwara (Bern) sowie Daniel Weiss (Zürich). Alle im Werk enthalte-nen Unzulänglichkeiten sind selbstverständlich den Autoren zuzuschreiben. Ganz herzlicher Dank geht an die Zürcher Studierenden, die im Herbstse-mester 2007 das Proseminar «Einführung in die Osteuropäische Geschichte» absolviert und einige Kapitel dieses Buches kritisch gelesen haben. Dank gebührt nicht zuletzt dem Verlag in der Person von Heinrich Zweifel, der die Entstehung dieses Buches mit großer Flexibilität begleitet hat. VORWORT Zürich, im August 2008
1. Das Fach Osteuropäische Geschichte
13
TEIL A: EINLEITUNG
1. DAS FACH OSTEUROPÄISCHE GESCHICHTE
1.1 Gegenstand des Faches Osteuropäische Geschichte beschäftigt sich mit jenen historischen Räumen, die seit dem späten 18. und beginnenden 19. Jahrhundert im westlichen Eu-ropa als «Osteuropa» bezeichnet werden. Dabei lässt sich die Kategorie «his-torischer Raum» unterschiedlich verstehen – einer essentialistischen Sicht, die Geografie und Geschichte als bestimmende Elemente einer «historischen Strukturregion» ansieht, steht eine konstruktivistische Sicht gegenüber, die historische Räume als Produkte menschlichen Denkens betrachtet. Aus der Spannung zwischen diesen Ansichten gewinnt die Betrachtung Osteuropas besondere Sensibilität für eine Unterscheidung zwischen geografisch-historischen Räumen und ihrer Wahrnehmung in unterschiedlichen Kontexten. Welche geografischen und historischen Räume Osteuropa umfasst, war be-reits seit der Entstehung des Begriffs Gegenstand einer kontroversen Diskus-sion und ist es bis heute geblieben. Denn die geografische Verortung Osteu-ropas auf der mentalen Karte Europas, das heißt in den Vorstellungen von Europas Geografie in den Köpfen der Menschen, sowie die Bedeutung des Begriffs «Osteuropa» unterlagen einem mehrmaligen Bedeutungswandel. Im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts wurde dieser Raum als historische Ein-heit erfunden, politisch instrumentalisiert und schließlich hinterfragt.
1.2 Zum Begriff «Osteuropa» Das Denken in Dichotomien prägt die Vorstellungen von Europa seit der Antike bis in die Gegenwart. Dieser Tradition ist auch das Nachdenken über Osteuropa verpflichtet. Der Begriff «Osteuropa» ist ein relationaler und komplementärer Begriff zum Europa-Begriff. Was unter Osteuropa verstan-den wurde und wird, hängt vordergründig davon ab, wie Europa imaginiert und beschrieben wird. Das Europa der Antike, als geografische Einheit in Abgrenzung von Asien und Afrika, war viel weiter gedacht als das spätere «Abendland». Im weiteren Europa-Begriff verbindet sich das Erbe der anti-ken Tradition mit der christlichen sowie den Kulturen einzelner romanischer, germanischer und slawischer Völker. Hingegen grenzt sich das Abendland im engeren Europa-Begriff seit der Spaltung der christlichen Kirche im Mit-telalter in die katholische und orthodoxe von der «morgenländischen» Tradi-tion ab, das heißt der orthodox-byzantinischen, sowie von der islamischen
Teil A: Einleitung
14
Kultur. Mit der Eroberung größerer Gebiete Osteuropas im Mittelalter durch die Mongolen (Rus’) und später durch die Osmanen (Südosteuropa) ver-stärkte sich die Vorstellung von der «kulturellen Fremdheit» dieser Gebiete, die keinen Platz im Europa des Abendlandes hatten. Zugleich legten die Vorstellungen von kulturellen Hierarchien innerhalb Europas das Fundament für die Herausbildung des Osteuropa-Begriffs. Die Himmelsrichtungen trugen hierfür seit der Antike kulturelle Charakteristiken Europas: Die Nord-Süd-Achse kennzeichnete dabei im Altertum und erneut in der Renaissance die kulturelle Überlegenheit des Südens oder des Mittel-meerraumes gegenüber dem «barbarischen» Norden, dem bis ins 19. Jahr-hundert auch Russland und Polen zugerechnet wurden. Erst das Aufklä-rungszeitalter schuf die Idee von «Osteuropa» – als einem «rückständigen», nur «oberflächlich zivilisierten», «exotischen» Gebiet zwischen Europa und Asien. Dies gilt auch für den Begriff «Südosteuropa». Im frühen 19. Jahr-hundert ersetzte er die Bezeichnungen «europäische Türkei» oder «europäi-scher Orient», die seit der Eroberung der Balkanhalbinsel durch die Osma-nen im westeuropäischen Gebrauch üblich waren. Die Konfrontation zwischen dem «demokratischen Westen» und dem «kommunistischen Osten» nach dem Zweiten Weltkrieg belebte diese Ste-reotype und definierte Osteuropa politisch als den Einflussbereich der Sow-jetunion. Einen erneuten Wandel erfuhr die Konzeption Osteuropas nach der Wende von 1989–1991, als die politische Bestimmung als «Ostblock» nicht mehr gültig war. Dabei rückte vor allem der Begriff «Ostmitteleuropa» in den Vordergrund. Dieser Begriff kam nach 1918 auf, mit der Entstehung neuer Staaten in zentralen Regionen Europas, die zuvor dem Deutschen, Habsburger oder Russländischen Reich angehörten. Die Vorstellung von Ostmitteleuropa als einer spezifischen Region ging allerdings nach 1945 verloren, als diese Gebiete in erster Linie als Ostblockstaaten betrachtet wurden. Nach der Wende von 1989–1991 etablierte sich dieser Begriff nun endgültig auch in der deutschsprachigen Osteuropaforschung. In den betref-fenden Ländern wird allerdings die Bezeichnung «östliches Mitteleuropa» bevorzugt, die die historisch-kulturelle Nähe zum übrigen Europa hervor-hebt. Der Begriff «Mitteleuropa» ist im deutschsprachigen Raum jedoch nicht unumstritten: Er erinnert zu sehr an die imperiale Sprache Deutsch-lands im 19. und frühen 20. Jahrhundert, als Konzeptionen von Mitteleuropa unter Führung Deutschlands zur Disposition standen. In der Wissenschaft galt Osteuropa zunächst als slawischer Teil Europas, in Abgrenzung zum romanisch-germanischen Europa. Denn die wissenschaftli-che Beschäftigung mit Osteuropa geht im deutschsprachigen Raum auf das universitäre Fach «Slawenkunde» zurück und die im 19. Jahrhundert vor-herrschende Gliederung Europas nach «Völkerfamilien» oder philologischen
1. Das Fach Osteuropäische Geschichte
15
Gruppenbildungen. Allerdings kann die Bevölkerung jener Regionen, die zu Osteuropa gezählt werden, nicht auf die Slawen reduziert werden. Wenn die sprachlich-ethnischen Faktoren dennoch als entscheidend angesehen werden sollten, dann lässt sich die Gesamtregion Osteuropa oder «Osteuropa im weiteren Sinne» am ehesten als der östlich des deutschen und italienischen Sprachraums gelegene Teil Europas definieren.
1.3 Zur Abgrenzung Osteuropas Die wissenschaftliche Abgrenzung der Gesamtregion Osteuropa wurde aus unterschiedlichen Perspektiven versucht und bleibt umstritten: Eine auf ei-nem einzigen Kriterium beruhende eindeutige Abgrenzung dieser Region ist nicht möglich. 1. Geografisch bieten natürliche Grenzen lediglich die Küsten der Rand-meere im Norden (Nordpolarmeer und die Ostsee) und Süden (Adria, Ioni-sches Meer, Ägäis und Schwarzes Meer). Hingegen ist die Abgrenzung nach Westen und Osten schwer festzulegen: Osteuropas westliche Grenze lässt sich geografisch nicht bestimmen. Nach Osten hin wird teilweise der Ural als Grenze nach Asien gesehen. Historisch bildete dieses gut passierbare Mittelgebirge jedoch nie eine Grenzbarriere. Auch unterschied sich der sibi-rische Teil Russlands in kultureller wie struktureller Hinsicht (Sprache, Kul-tur, Wirtschaft usw.) nach der Inkorporierung ins Reich immer weniger vom europäischen und bildete mit diesem zusammen ein sogenanntes «eurasi-sches Staatsgebilde». Heute bieten Geografen zwei Lösungen für die Ab-grenzung Osteuropas von Asien an: Entweder wird auch Südsibirien nach dem Kriterium der Bevölkerungsdichte und der ökonomischen Struktur noch Europa zugerechnet, oder die Gebiete der ehemaligen Sowjetunion werden als eigener Subkontinent zwischen Europa und Asien angesehen. 2. Sprachlich ist die Gesamtregion Osteuropa viel zu heterogen, als dass sie sich als ein «slawisches Gebiet» definieren ließe. Lediglich die Abgrenzung nach Westen bietet hier eine Möglichkeit – als eine östlich des italienischen und deutschen Sprachraums gelegene Region. Dennoch trägt dieses Kriteri-um der historischen Entwicklung keine Rechnung, unterlag doch die sla-wisch-germanische Sprachgrenze starken historischen Verschiebungen. Die «Ostkolonisation» des 12. und 13. Jahrhunderts und die folgende Auswei-tung des deutschen Sprachraums nach Osten bis in die baltischen Gebiete sowie die Rückverschiebung dieser Grenze nach 1945 an die Oder markieren dabei die Eckpunkte dieser Entwicklung. 3. Historisch-kulturell lässt sich Osteuropa nicht als eine Region definieren, die durch eine historisch gewachsene kulturelle Verbundenheit geprägt wäre. Denn in diesem Raum waren unterschiedliche kulturelle Traditionen wirk-
Teil A: Einleitung
16
sam: römisch-byzantinisch-osmanisch (in chronologischer Abfolge) gepräg-ter kultureller Raum auf dem Balkan; abendländische Prägung zwischen Ostsee und Donau; byzantinisch-orthodoxe Tradition mit stärkeren Einflüs-sen von Asien zwischen unterer Donau und Ural. 4. Staatlich-politisch wurde Osteuropa erst nach dem Zweiten Weltkrieg als eine Region bestimmt, ausgehend von den Bündnissystemen des Nach-kriegseuropa, dem Ost- und Westblock. Diese Abgrenzung Osteuropas um-fasste die von Kommunisten regierten sozialistischen Staaten des Warschau-er Paktes (> Glossar). Allerdings löst auch dieses Kriterium das Problem nicht, diese Region als eine Einheit zu bestimmen: Jugoslawien und Alba-nien waren zwar sozialistisch, jedoch war Jugoslawien kein Paktmitglied und Albanien lediglich bis 1968. Dagegen war die DDR beides, aber ein deutschsprachiger und damit kein osteuropäischer Staat. Griechenland fiel aus dem Ostblock heraus, war jedoch ein südosteuropäischer Staat. Grie-chenland und Finnland, obschon sie aus historischer Sicht zu Osteuropa zäh-len können, wurden als Teil des westlichen politischen Systems verstanden und daher nicht zu Osteuropa gerechnet.
1.4 Strukturraum und historische Region Osteuropa Seit dem Fall des «Eisernen Vorhangs» ist die Schwierigkeit einer Abgren-zung des als «Osteuropa im weiteren Sinne» bezeichneten Teils Europas, welcher Untersuchungsgegenstand der Fachrichtung Osteuropäische Ge-schichte ist, nach einem einzigen Kriterium noch deutlicher geworden. Den-noch lassen sich übergreifende Gemeinsamkeiten in der historischen Ent-wicklung dieses Raumes im Unterschied zum übrigen Teil Europas heraus-arbeiten, die seine gesonderte Behandlung rechtfertigen (A. Kappeler): 1. Die die westeuropäischen Entwicklungswege prägenden Prozesse (als Prozesse der Modernisierung oder der Zivilisation bezeichnet) – der mittelal-terlichen Agrarrevolution, der Entfaltung des Städtewesens und des Kapita-lismus, der Entwicklung des humanistischen Gedankenguts, der Konfessio-nalisierung und Bürokratisierung im Zuge der modernen Staats- und Nati-onsbildung – vollzogen sich in weiten Teilen Osteuropas nicht, deutlich «später» oder weniger intensiv. Verlässt man jedoch diese auf «Westeuropa» zentrierte Perspektive, können diese Prozesse jedoch auch als eine weltweite Ausnahmeerscheinung betrachtet werden, die lediglich einige westliche Re-gionen Europas und in der Neuzeit in vieler Hinsicht vor allem Großbritan-nien betraf. Ein längeres Bewahren vormoderner Zustände in Osteuropa erlaubt es somit, nicht nur «Defizite», sondern auch «Vorteile» in den Ent-wicklungen Osteuropas festzustellen und diese als eine «Alternative» zu den historischen Entwicklungswegen westeuropäischer Prägung gelten zu lassen:
1. Das Fach Osteuropäische Geschichte
17
• In den Vielvölkerstaaten Osteuropas war die rechtliche und soziale Situation religiöser und ethnischer Minderheiten sowie von Rand-gruppen (beispielsweise der Juden, Roma oder Muslime) seit dem Mittelalter bis ins 18./19. Jahrhundert besser als im Westen Europas. Durch eine größere Duldsamkeit gegenüber Andersgläubigen zeichne-te sich auch die orthodoxe Kirche aus: Kreuzzüge, Schwertmissionen, Inquisition und Hexenverfolgung fehlen in der historischen Entwick-lung orthodox geprägter Regionen. Darüber hinaus war die soziale Lage der Frau seit der Frühen Neuzeit zumindest in Russland besser als in Mittel- und Westeuropa.
• Die ständischen Verfassungen Ungarns, Böhmens, Polens und Kroa-tiens mit ihren Adelsnationen können als potenzielle Zellen einer par-lamentarisch-demokratischen Entwicklung verstanden werden, die den westeuropäischen Umweg über den Absolutismus vermied. Die Stadt-republiken Novgorod und Pskov können als städtische Kommunen be-trachtet werden, die durchaus Ähnlichkeiten mit den westeuropäischen mittelalterlichen Kommunen in ihrer Funktion als Träger demokrati-scher und protoparlamentarischer Institutionen aufweisen. Insofern bildeten sie eine Alternative zu den rein vertikal ausgerichteten Machtstrukturen im Moskauer Reich.
• Vorkapitalistische Gemeinschaftsformen wurden in Osteuropa – be-sonders auf dem Balkan und in Russland – länger bewahrt, etwa in bäuerlichen Gemeinden mit Solidarität und Gemeinschaftsbesitz.
2. Die besondere sprachliche, religiöse und kulturelle Aufgliederung, Durchmischung und Durchschichtung als Folge der historischen Entwick-lung in diesem Raum führte zur Entstehung ethnischer, konfessionell-religiöser und kultureller Überlappungszonen, die im Zeitalter des Nationa-lismus zu Konfliktherden wurden (z. B. Ausbruch des Ersten Weltkrieges). 3. Die Völker und Staaten dieses historischen Raumes waren gegenüber Druckversuchen von Seiten der Nachbarn besonders exponiert, da er den kontinentalen Kernraum Europas bildet (Angriffe der Steppenvölker, Osma-nen, Expansionsversuche Deutschlands und Schwedens usw.). 4. Über lange historische Zeiträume hinweg waren verschiedenste Sprach-völker Osteuropas in Großreichen zusammengefasst (Byzantinisches Reich, Kiever Rus’/Moskauer Reich/Russländisches Imperium/Sowjetunion, Os-manisches Reich, Habsburger Reich, Polnisch-Litauische Adelsrepublik).
Teil A: Einleitung
18
1.5 Innere Aufgliederung «Osteuropa im weiteren Sinne» «Osteuropa im weiteren Sinne» lässt sich in Teilregionen untergliedern, die jeweils mehrere Völker und Staaten umfassen, sofern sie untereinander in ihrer historischen Entwicklung mehr Gemeinsamkeiten aufweisen als gegen-über ihren Nachbarn: 1. Osteuropa im engeren Sinne: Russland (das europäische Russland sowie Sibirien und Ferner Osten), die Ukraine und Weißrussland. Das zentrale Stukturmerkmal dieser Region ist nicht durch ethnische oder sprachliche Einheit definiert, sondern durch die spezifischen Strukturen des Russländi-schen Staates. Inwiefern die Staaten Transkaukasiens (Georgien, Armenien und Aserbaidschan) sowie die fünf Staaten Zentralasiens (Kasachstan, Usbe-kistan, Turkmenistan, Kirgistan und Tadschikistan), die im 19. und 20. Jahr-hundert Bestandteile des Russländischen Imperiums und der Sowjetunion waren, aus diesem Grunde dem historischen Raum Osteuropa angehören, ist umstritten. Als Gegenstand der russländischen und sowjetischen Geschichte werden diese Regionen auch von Osteuropahistorikerinnen und -historikern erforscht. 2. Ostmitteleuropa: das Baltikum (Estland, Lettland, Litauen), Polen, die Länder der böhmischen (Böhmen, Mähren, Teile Schlesiens) und ungari-schen Krone (Ungarn, Slowakei, Siebenbürgen, Kroatien), ferner das heutige Slowenien. Das wichtigste strukturbildende Element dieser Region innerhalb des Großraums Osteuropa stellt ihre Zugehörigkeit zu der «abendländisch» (katholisch-protestantisch) geprägten kulturellen Tradition dar. Als eigener Raum und zugleich als Übergangsraum zwischen Skandinavien und Osteu-ropa wird in der Forschung manchmal (Zernack, Tuchtenhagen) Nordosteu-ropa herausgegliedert, das im Wesentlichen die mit Osteuropa historisch verbundenen nordöstlichen Ostseeanrainer umfasst: das heutige Finnland (bis 1809 Bestandteil Schwedens, bis 1918 ein autonomer Bestandteil des Russländischen Reiches und erst seit 1918 selbstständig) sowie Teile des Baltikums (Estland, Lettland). 3. Südosteuropa/Balkan: die heutigen Staaten Serbien, Bosnien-Herzego-wina, Montenegro, Makedonien, Kosovo, Albanien, Griechenland, Bulga-rien, die südlichen und östlichen Gebiete Rumäniens (Walachei und Moldau) sowie die europäische Türkei. Im Wesentlichen ist es der Teil Europas, der über eine längere Periode unter der Herrschaft der Osmanen stand. Der enge-re und vielfach umgedeutete, häufig pejorative Begriff «Balkan» umfasst dabei die Gebirgsregion im Süden (südlich der Flüsse Save und Donau). Die Prägungen durch die byzantinisch-orthodoxe und osmanische kulturelle Tra-dition bilden das Spezifikum dieser historischen Region. Diese Aufteilung ist vor allem im deutschsprachigen Raum üblich: An den angelsächsischen Universitäten wird unter Eastern Europe nicht selten nur
1. Das Fach Osteuropäische Geschichte
19
Ostmittel- und Südosteuropa verstanden, während die ehemalige Sowjetuni-on eine eigene Region bildet. Grundsätzlich sind diese Abgrenzungen in der Wissenschaft weder unumstrit-ten, noch sind sie immer eindeutig möglich: Einerseits verlaufen die histori-schen Grenzen häufig quer durch die Staaten des 20. Jahrhunderts (ehem. Ju-goslawien, Rumänien, Ukraine), andererseits gibt es Übergangsgebiete, die mit gutem Grund verschiedenen Teilregionen zugeordnet werden können (Baltikum, Ukraine, Weißrussland, Kroatien, Siebenbürgen, Ungarn). So darf bei aller Konzentration auf die spezifischen Aspekte in der Ge-schichte Osteuropas und seiner Teilregionen nicht vergessen werden, dass je nach Thema und Fragestellung die Existenz und Abgrenzung der jeweiligen Räume in Frage gestellt werden muss. Der Osteuropa-Begriff sowie die Ab-grenzung der einzelnen Teilregionen sollte dabei nicht zur Zwangsjacke werden, die fließende Übergänge, Überlappungen und kulturelle Transfers zwischen dem östlichen und dem übrigen Europa und Asien sowie innerhalb des Großraums Osteuropa außer Acht lässt.
Literatur zum Abschnitt 1: Das Fach Osteuropäische Geschichte Beyrau, Dietrich u.a.: Russland in Europa. Neuer Wein in alten Schläuchen? Fragen an die Historie, in: Osteuropa 53/9–10 (2003), S. 1245–1261.
Halecki, Oskar. The Limits and Divisions of European History, London u.a. 1950.
Kappeler, Andreas: Die Bedeutung der Geschichte Osteuropas für ein gesamteuropäisches Geschichtsverständnis, in: Stourzh, G. u.a. (Hrsg.): Annäherungen an eine europäische Ge-schichtsschreibung, Wien 2002, S. 43–55.
Kaser, Karl; Gramshammer-Hohl, Dagmar; Pilcher, Robert (Hrsg.): Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Band 11: Europa und die Grenzen im Kopf, Klagenfurt u.a. 2003.
Lemberg, Hans: Zur Entstehung des Osteuropabegriffs im 19. Jahrhundert. Vom «Norden» zum «Osten» Europas, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 33 (1985), S. 48–91.
Neumann, Iver B.: Uses of the Other: «The East» in European Identity Formation, Minneapo-lis 1999.
Schenk, Frithjof Benjamin: Mental Maps. Die Konstruktion von geographischen Räumen in Europa seit der Aufklärung, in: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), S. 493–514.
Segert, Dieter: Die Grenzen Osteuropas: 1918, 1945, 1989 – drei Versuche, im Westen anzu-kommen, Frankfurt/M. 2002.
Sundhaussen, Holm: Die Wiederentdeckung des Raums: Über Nutzen und Nachteil von Ge-schichtsregionen, in: Clewing, K. u.a. (Hrsg.): Südosteuropa. Von vormoderner Vielfalt und nationalstaatlicher Vereinheitlichung. Festschrift für Edgar Hösch, München 2005, S. 13–33.
Troebst, Stefan: Nordosteuropa: Begriff – Traditionen – Strukturen, in: Kommune. Forum für Politik, Ökonomie, Kultur 15/5 (1997), S. 36–42 http://www.oeko-net.de/kommune/kommune5-97/ATROEBST.html.
Teil A: Einleitung
20
Troebst, Stefan: «Intermarium» und «Vermehlung mit dem Meer»: Kognitive Karten und Geschichtspolitik in Ostmitteleuropa, in: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), S. 435–469.
Troebst, Stefan (Hrsg.): Zur Europäizität des östlichen Europa, in Forum H-Soz-u-Kult http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/index.asp?id=744&pn=texte.
Wolff, Larry: Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enligh-tenment, Stanford 1994.
Zernack, Klaus. Grundfragen der Geschichte Nordosteuropas, in: Ders.: Nordosteuropa: Skizzen und Beiträge zu einer Geschichte der Ostseeländer, Lüneburg 1993.
2. GESCHICHTE DES FACHS
2.1 Osteuropäische Geschichte im deutschsprachigen Raum Die Geschichte des Fachs Osteuropäische Geschichte im deutschsprachigen Raum reicht in das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zurück. Das erste Seminar für Osteuropäische Geschichte und Landeskunde wurde 1902 an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität (seit 1949 Humboldt-Universität zu Berlin) begründet. 1907 folgte das Wiener Seminar. Erst 1971 erhielt auch die Schweiz eine Abteilung für Osteuropäische Geschichte am Historischen Seminar der Universität Zürich. Die Anfänge des Faches in Deutschland, Österreich und der Schweiz waren unterschiedlich motiviert: In Berlin bestimmte in erster Linie die Politik die Begründung dieser Disziplin. Denn mit der Berufung des politisch engagier-ten Deutschbalten Theodor Schiemann (1847–1921) zum Ordinarius für Osteuropäische Geschichte und der Einrichtung eines speziellen Seminars für diese Region gab das Deutsche Kaiserreich «Feindforschung» in Auftrag, die sich im Wesentlichen auf das Russländische Reich konzentrierte. Die Notwendigkeit einer institutionalisierten Erforschung Osteuropas entwuchs aus deutscher Sicht der wachsenden diplomatischen Spannung zwischen Russland und Deutschland im Zeitalter des Imperialismus im ausgehenden 19. Jahrhundert. Hingegen verstand sich der erste Wiener Ordinarius für «Slavische Philolo-gie und Altertumskunde», der tschechische Spezialist für Bulgarien und Ser-bien, Constantin Jireček (1854–1918), in erster Linie als ein Wissenschaftler. Die Gründung des Wiener Seminars wurde vom Fürsten Franz von und zu Liechtenstein initiiert und war viel weniger als in Deutschland politisch mo-tiviert. Ebenfalls anders als in Deutschland war die Osteuropäische Ge-schichte in Wien bereits seit den Anfängen nicht auf Russlandforschung ausgerichtet.
2. Geschichte des Fachs
21
Die Osteuropaforschung an den deutschen Universitäten der Zwischen-kriegszeit (1918–1939), die weiterhin vornehmlich Russland als den haupt-sächlichen Gegenstand ihrer Untersuchungen betrachtete, setzte diese Ten-denz fort. Dabei genoss die wichtigste Organisation der deutschen Osteuro-pahistoriker in dieser Zeit, die Deutsche Gesellschaft zum Studium Osteuro-pas (DGO, gegr. 1913 als Deutsche Gesellschaft zum Studium Russlands), die Unterstützung politischer und wirtschaftlicher Kreise Deutschlands, na-mentlich des Auswärtigen Amtes. Außer in Bezug auf Polen stand allerdings das Feindbild Osteuropa hier nicht immer im Vordergrund. Einige Exponen-ten der deutschen Osteuropaforschung sahen gerade ob der Nähe zur Politik ihre Aufgabe darin begründet, eine Annäherung zwischen Deutschland und der Sowjetunion zu bewirken. Dies war beispielsweise der Fall bei der zent-ralen Figur unter den Osteuropahistorikern der Zwischenkriegszeit, dem Gelehrtenpolitiker und Berliner Professor für Osteuropäische Geschichte Otto Hoetzsch (1876–1946). Er war zugleich der Herausgeber der zwei wichtigsten Fachzeitschriften – der Zeitschrift für osteuropäische Geschichte (gegr. 1910) und des Organs der DGO, der Zeitschrift Osteuropa. Dies än-derte sich radikal nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten: 1935 wurde Hoetzsch zwangspensioniert und die DGO gleichgeschaltet. Noch entscheidender war die Politik für die wissenschaftliche Doktrin der sogenannten «Ostforschung», die sich nach 1919 aus der Erforschung der Geschichte und Kultur der Deutschen in Ostmitteleuropa entwickelte und sich später gänzlich in die Dienste des Nationalsozialismus stellte. Die neu konzipierte «Ostforschung», die parallel zur Osteuropaforschung an den Universitäten existierte, war im Wesentlichen außeruniversitär organisiert. Seit 1935 bestanden regionale NS-Forschungsstellen in Berlin, Königsberg und Breslau, die ihrem Forschungsverbund unterstanden. Auch die Vertrie-benenverbände bildeten dabei eine wichtige Stütze. Unter der Führung des Berliner Mediävisten und Archivars Albert Brackmann (1871–1952) vertrat die «Ostforschung» das Programm einer neuen Synthese von Volksgeschich-te und Geopolitik: Im Interesse der nationalsozialistischen «Lebensraumpoli-tik» rückte sie nun verstärkt die Geschichte Polens und des Baltikums, also Ostmitteleuropas, in den Vordergrund. Die Revision der Ostgrenze Deutsch-lands, wie sie nach dem Ersten Weltkrieg im Versailler Vertrag festgelegt worden war, und die Ablehnung des zur gleichen Zeit entstandenen polni-schen Staates (Zweite Republik Polen, 1918–1939) waren die politisch-ideologischen Grundlagen der «Ostforschung» in Bezug auf Polen. Nicht nur neugeschichtliche, sondern auch mediävistische Themen sollten hier Argu-mente für die Politik liefern. Lediglich die russlandbezogene Mittelalterfor-schung blieb von solch radikaler Politisierung einigermaßen verschont. Die renommierten deutschen Historiker der Nachkriegszeit – der Ostmitteleuro-paspezialist und Sozialhistoriker Werner Conze (1910–1986) sowie der Na-
Teil A: Einleitung
22
tionalismusforscher und Polenkenner Theodor Schieder (1908–1984) – wa-ren im Rahmen der Ostforschung neben anderen Historikern an der Vorbe-reitung der nationalsozialistischen Politik in Osteuropa aktiv beteiligt. Die Entwicklung und der Neuanfang des Fachs Osteuropäische Geschichte in Deutschland nach 1945 waren ebenfalls nicht frei von politischen Motiva-tionen: Im Zeichen des Kalten Krieges (> Glossar) gewann die Erforschung Osteuropas erneut an politischer Relevanz. In den Folgejahren wurden Lehr-stühle für Osteuropäische Geschichte an fast allen westdeutschen Universitä-ten eingerichtet – mit einem «ostkundlichen Bildungsauftrag». Personelle Kontinuitäten von der «Ostforschung» der NS-Zeit ließen sich bei den Beru-fungen auf diese Lehrstühle angesichts des Mangels an qualifizierten For-schern nicht vermeiden, wobei Russland-Historiker in der Regel weniger in die «Ostforschung» der NS-Zeit involviert waren als die Ostmitteleuropa-Spezialisten. Weit stärker an den Zielen der bundesdeutschen Politik und Wirtschaft waren Einrichtungen wie das Bundesinstitut für ostwissenschaft-liche und internationale Studien (BIOst) in Köln oder das Münchner (heute: Regensburger) Südost-Institut (SOI) orientiert. Die Beschäftigung vieler alter «Ostforscher» mit Ostmitteleuropa ging unter anderem im 1950 ge-gründeten Herder-Institut in Marburg weiter, wobei die kritische Distanz zum Erbe der «Ostforschung» sich hier erst allmählich durchsetzen konnte: Die seit 1952 vom Herder-Institut herausgegebene Zeitschrift für Ostfor-schung wurde erst 1994 in Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung umbe-nannt. Zum wissenschaftlichen Netzwerk des Marburger Instituts gehörte auch das 1959 in München gegründete Collegium Carolinum mit dem For-schungsschwerpunkt auf den böhmischen Ländern und dem Schicksal der als Folge des Zweiten Weltkrieges vertriebenen Sudetendeutschen. Thematisch dominierte an den deutschen Universitäten auch nach 1945 im Bereich der Osteuropakunde die Geschichte Russlands und der Sowjetunion. Waren in den 1950er-Jahren die politikfernen Themen der vorpetrinischen Zeit (9.–17. Jhd.) vorherrschend, so änderte sich dies seit den 1960er-Jahren mit einer neuen Generation deutscher Russlandexperten: Die Vorgeschichte der Revolutionen von 1917 (> Glossar Februar-/Oktoberrevolution), die frühe Sowjetzeit und das Aufkommen des Stalinismus – also die Epochen zwischen 1861 (Aufhebung der Leibeigenschaft > Glossar) und 1941 (deut-scher Überfall auf die Sowjetunion) – avancierten rasch zu Hauptthemen der deutschsprachigen Russlandforschung. Erst seit den 1970er-Jahren vollzog sich in Deutschland eine allmähliche Entpolitisierung der Osteuropäischen Geschichte, die zur stärkeren Professionalisierung beitrug. Die Entwicklung des Fachs Osteuropäische Geschichte in der Schweiz war in geringerem Ausmaß vom politischen Auftrag des Kalten Krieges beein-flusst. Als Pendant der deutschen «Feindforschung» der unmittelbaren
2. Geschichte des Fachs
23
Nachkriegszeit wurde 1958 in Bern vom liberalkonservativen Politiker Peter Sager (1925–2006) das Ost-Institut gegründet. Hingegen erhielt die Schweiz mit der Eröffnung des Fribourger Osteuropa-Institus ein Jahr zuvor (1957) die erste auf Osteuropa spezialisierte Institution mit hauptsächlich wissen-schaftlichen Zielsetzungen. Unter Leitung des polnischen Philosophen Jo-seph Bocheński (1902–1995) konzentrierte sich die Forschungsagenda des Instituts auf die sowjetische Philosophie. Der Ausbau bzw. die Einführung slawischer Philologien an den Schweizer Universitäten seit den 1960er-Jahren schuf eine Grundlage für den späteren Aufbau des Fachs Osteuropäi-sche Geschichte. In der Schweiz wurde sie im Vergleich zu Deutschland und Österreich relativ spät begründet – 1971 in Zürich und erst 1991 in Basel. Der 1971 eingerichtete Lehrstuhl für russische Sprache und Literatur in St. Gallen wurde 1975 in einen Lehrstuhl für Kultur- und Sozialgeschichte Russlands und der Sowjetunion (seit 2007: Kultur und Gesellschaft Russ-lands) umgewidmet. Die späte Etablierung des Faches in der Schweiz hängt nicht zuletzt mit dem politischen Klima in der Schweiz der Nachkriegszeit zusammen – die «Geschichte des Ostblocks» sollte nicht die Reihen der Sympathisierenden vermehren. Die neuere Entwicklung des Fachs Osteuropäische Geschichte an den deutschsprachigen Universitäten ist durch die Einführung interdisziplinärer Studiengänge kennzeichnet, die in erster Linie Slawistik und Osteuropäische Geschichte in einem Fach Osteuropastudien zusammenführen mit Beteili-gung – je nach Angebot der jeweiligen Universitäten – von Kultur- und Kommunikationswissenschaften, Ethnologie, Soziologie, Politik-, Wirt-schafts- und Rechts- oder Verwaltungswissenschaften.
2.2 Russian and East European Studies In den Vereinigten Staaten findet sich Osteuropäische Geschichte als Russ-ian History, Eastern European History oder als Programme im Sinne der Area Studies wie etwa der Armenian History oder der Ukrainian Studies. Anders als im deutschsprachigen Raum prägten die Anfänge des Fachs Russian and East European Studies in den USA russische Emigranten, die ihre Ausbildung noch im zarischen Russland (bis 1917) absolviert hatten, wie etwa George Vernadsky (1887–1973). Die zweite Generation der ameri-kanischen Russlandforscherinnen und -forscher wandte sich, dem Geiste des Kalten Krieges verpflichtet, explizit den Fragen nach den Ursachen und Fol-gen des «roten Oktobers» (Oktoberrevolution von 1917) zu. Seit den 1960er-Jahren wurde die amerikanische Russland- und Sowjetuni-onforschung auch für die Forscher in Europa tonangebend. Die amerikani-sche Russland- und Osteuropaforschung wurde in weit größerem Umfang
Teil A: Einleitung
24
unterstützt als die deutschsprachige, weshalb ihr Output auch wesentlich umfangreicher war. Aufgrund mangelnder Kenntnisse der westeuropäischen Sprachen wiederum wurden manche wichtigen Arbeiten zur Osteuropäi-schen Geschichte, die beispielsweise auf Deutsch erschienen, von der ameri-kanischer Forschung nicht rezipiert. Die breite institutionelle und personelle Basis der Russlandforschung in den USA führte schon bald zur Ausbildung von sich bekämpfenden Lagern und Schulen, wie etwa zwischen Cambridge und New York und später Harvard und Chicago um die grundlegenden Fra-gen der Geschichte Russlands – die Gründe und Ursprünge der Revolution von 1917 und des Stalinismus. Politisch-weltanschauliche Grundlagen der jeweiligen Schule waren dabei aufs Engste mit den methodischen Vorlieben und Gewohnheiten verbunden. Sovietology oder Soviet Studies als ein gesonderter und stärker politologisch ausgerichteter Zweig der Beschäftigung mit der Sowjetunion und dem Ost-block seit 1945 war ein Produkt des Kalten Krieges. Sie gab auch den An-stoß für die Etablierung der sogenannten Area Studies, die als Aufgabe in erster Linie Politik- und Wirtschaftsberatung hatten. Nach dem Zusammen-bruch des Ostblocks zwischen 1989 und 1991 und der Auflösung der Sow-jetunion (31. Dezember 1991) stürzte die amerikanische Sovietology in eine tiefe Krise, da ihr vorgeworfen wurde, das Ende des kommunistischen Blocks nicht vorausgesehen zu haben. Ideologische Grabenkämpfe zwischen erklärten Antikommunisten und Sympathisanten der Sowjetunion aus den Reihen der Sovietology und Russian and East European Studies wurden wieder schärfer. Die Befürworter der Totalitarismustheorie (> Glossar) fühl-ten sich durch die Ereignisse im östlichen Europa zwischen 1989 und 1991 bestätigt und warfen den «blauäugigen» Sowjetologen vor, sich mit einer falschen Frage beschäftig zu haben, nämlich: Was macht dieses System funktionsfähig? Ihres Erachtens hätte sich die Forschung auf die Fragen konzentrieren sollen, ob und wann dieses System zu existieren aufhört. Heute beschäftigt sich ein Teil der ehemaligen Sowjetologen mit den Ent-wicklungen in den über zwei Dutzend postkommunistischen Ländern Osteu-ropas und Zentralasiens im Rahmen der vergleichenden Politik- und Gesell-schaftswissenschaften (Political and Social Studies). Die Totalitarismustheo-rie gewann in diesen Kreisen an Popularität, um damit das Spezifische der postkommunistischen Gesellschaften und des Übergangs zur Demokratie im Vergleich zu neuen Demokratien etwa in Lateinamerika hervorzuheben. Die größeren finanziellen und personellen Kapazitäten an einigen der staatli-chen und privaten Universitäten Nordamerikas führten zur Ausbildung spe-zialisierter Zentren für Osteuropa und Eurasien, wie beispielsweise das Insti-tute of Slavic, East European, and Eurasian Studies an der University of California, Berkeley oder das Davis Centre for Russian and Eurasian Stu-
2. Geschichte des Fachs
25
dies an der Harvard University. Neben den auch im deutschsprachigen Raum üblichen Bereichen der Osteuropäischen Geschichte bestehen an diesen Zentren Möglichkeiten für Spezialisierung auch auf Zentralasien. Auch in der britischen historischen Osteuropaforschung, die sich seit den 1960er-Jahren entwickelte, liegt der Schwerpunkt auf Russland und der Sowjetunion. Die britischen Osteuropaforschenden profilierten sich insbe-sondere mit Werken zu Russland in der vorpetrinischen Periode, zum 18. Jahrhundert, der Geschichte Sibiriens sowie zur Wirtschaftsgeschichte. Das Spezifikum der engeren institutionellen Anbindung der osteuropäischen Geschichte in Großbritannien an die Slawistik im Rahmen interdisziplinärer Russian and East European Studies förderte die Entstehung zahlreicher kul-turwissenschaftlicher Studien auch aus der Feder von Slawistinnen und Sla-wisten. In weit geringerem Umfang konnte sich das Fach Osteuropäische Geschichte im Rahmen der slawistischen Abteilungen in Frankreich (vor allem an den Pariser Hochschulen) und Italien etablieren.
Literatur zum Abschnitt 2: Geschichte des Faches Burleigh, Michael: Germany Turns Eastward. A Study of Ostforschung in the Third Reich, Cambridge 1988.
Byrnes, Robert F.: A History of Russian and East European Studies in the United States. Selected Essays, Lanham u.a. 1994.
Creuzberger, Stefan u.a. (Hrsg.): Wohin steuert die Osteuropaforschung? Eine Diskussion, Köln 2000.
Goehrke, Carsten; Haumann, Heiko: Osteuropa und Osteuropäische Geschichte: Konstruktio-nen – Geschichtsbilder – Aufgaben. Ein Beitrag aus Schweizer Sicht, in: Jahrbücher für Ge-schichte Osteuropas 52/4 (2004), S. 585–596.
Dahlmann, Dittmar (Hrsg.): Hundert Jahre Osteuropäische Geschichte. Vergangenheit, Ge-genwart und Zukunft, Stuttgart 2005.
Haar, Ingo: Historiker im Nationalsozialismus: Deutsche Geschichtswissenschaft und der «Volkstumskampf» im Osten, Göttingen 22002.
Kappeler, Andreas: Osteuropäische Geschichte, in: Maurer, M. (Hrsg.): Aufriß der Histori-schen Wissenschaften, Bd. 2: Räume, Stuttgart 2001, S. 198–265.
Manning, Clarence Augustus: A History of Slavic Studies in the United States, Milwaukee 1957.
Mühle, Eduard: Für Volk und deutschen Osten. Der Historiker Herman Aubin und die deut-sche Ostforschung, Düsseldorf 2005.
Oberländer, Erwin (Hrsg.): Geschichte Osteuropas. Zur Entwicklung einer historischen Dis-ziplin in Deutschland, Österreich und der Schweiz 1945–1990, Stuttgart 1992.
Teil A: Einleitung
26
Piskorski, Jan M.; Hackmann, Jörg; Jaworski, Rudolf (Hrgs.): Deutsche Ostforschung und politische Westforschung im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Disziplinen im Vergleich, Osnabrück 2002.
Plamper, Jan: Zwischen dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten und dem Land der unbe-grenzten Unmöglichkeiten: Die deutsche Osteuropaforschung, in: Zeitschrift für Geschichts-wissenschaft 52/10 (2004), S. 894–902.
3. HISTORIOGRAFIE, METHODEN UND THEORIEN
3.1 Geschichtsschreibung in Osteuropa
3.1.1 Russland und die Sowjetunion
Die Entstehung der historischen Forschung und des Fachs Geschichte im Russländischen Reich des 19. Jahrhunderts stand in theoretischer und me-thodischer Hinsicht unter dem Einfluss westeuropäischer – vornehmlich deutscher – Vorbilder. Später gingen die russländische und sowjetische Ge-schichtswissenschaft eigene Wege, wobei der Vergleich mit den historischen Entwicklungen in Westeuropa wie auch das Verhältnis zur westlichen Histo-riografie weiterhin von zentraler Bedeutung blieben.
Russländische Historiografie bis 1917 In der Entwicklung der russländischen Historiografie (bis 1917) lassen sich zwei Phasen unterscheiden – die vorprofessionelle Aufklärungshistorie des 18. und frühen 19. Jahrhunderts und die moderne historische Wissenschaft seit der zweiten Hälfe des 19. Jahrhunderts, die zum einen durch den Histo-rismus (> Glossar) der sogenannten «Staatlichen Schule» und durch die So-zialgeschichte der «Moskauer Schule» geprägt wurde. Die vorprofessionelle Aufklärungshistorie erhielt wichtige Impulse von westeuropäischen Vorbildern und wurde zu Beginn vornehmlich von den in Russland tätigen deutschen Wissenschaftlern betrieben. Mit der Gründung der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften 1725 wurden zahlreiche Gelehrte aus dem Ausland dorthin als Professoren berufen, unter ihnen Gott-lieb Siegfried Bayer (1694–1738), Gerhard Friedrich Müller (1705–1783) und später August Ludwig Schlötzer (1735–1809). Ihre Tätigkeit ging in die Annalen als die «Periode der Sammler» ein: Sie konzentrierten sich auf die Bearbeitung und Publikation von Quellen und legten den Grundstein für die kritische Lektüre altrussischer Chroniken. Mit der These über die Ursprünge der Herrschaft in der Alten Rus’ lieferten sie zugleich Stoff für die erste
3. Historiografie, Methoden und Theorien
27
historische Kontroverse in der russländischen Historiografie, den sogenann-ten Normannismusstreit: Bayer, Müller und Schlötzer wiesen zum ersten Mal auf die skandinavischen Wurzeln der Rjurikiden hin. Daraus resultierte für sie auch die kulturelle Überlegenheit der Skandinavier über die Slawen. Dies rief Reaktionen hervor, die den eigenständigen, slawischen Ursprung der Dynastie nachzuweisen suchten, namentlich des Universalgelehrten Mi-chail Lomonosov (1711–1765). Abgesehen von dieser Auseinandersetzung gingen die maßgeblichen Darstellungen der Russischen Geschichte in jener Periode nicht weiter, als die altrussischen Chroniken nachzuerzählen: die vierbändige «Russische Geschichte» (mit einem später publizierten fünften Band) des Staatsmannes und Privatgelehrten Vasilij Tatiščev (1686–1750) aus den Jahren 1768–1784 sowie die siebenbändige «Geschichte Russlands seit den ältesten Zeiten» des aufklärerisch gesinnten Enzyklopädisten Mi-chail Ščerbatov (1733–1790) von 1770–1790. Hingegen war die zwölfbän-dige «Geschichte des russländischen Reiches» aus der Feder des Hofhistori-kers Nikolaj Karamzin (1766–1826) bereits ein Produkt des romantischen Nationalismus und der nationalstaatlichen Geschichtsschreibung. Damit ebnete Karamzin den Weg von der rationalistischen Aufklärung zum idealis-tischen Historismus und zur Professionalisierung der russländischen Ge-schichtsschreibung. Mit der Etablierung des Fachs Geschichte an den Universitäten 1835 entwi-ckelte sich die russländische Geschichtsschreibung, ähnlich wie etwa im Deutschland des frühen 19. Jahrhunderts, von der Domäne einiger Privatge-lehrter zum modernen wissenschaftlichen Lehr- und Forschungsbetrieb. An-ders jedoch als in den Ländern des westlichen Europa blieb die Tätigkeit stark von der staatlichen Zensur abhängig: Zar und Kirche waren unantastbar und kein Gegenstand offener wissenschaftlicher Diskussion. Zeitgenössische politische Strömungen – etwa der Frühsozialismus – wurden von staatlichen Kontrollinstanzen verfolgt, hingegen großrussischer Reichspatriotismus fa-vorisiert. Die Geschichtsschreibung anderer Nationalitäten und Kulturen konnte sich nur schwer ihren Weg freikämpfen. Die professionelle Historiografie nahm in Russland ihren Anfang mit den Werken des Historikers Sergej Solov’ev (1820–1879), der Juristen Konstan-tin Kavelin (1818–1885) und Boris Čičerin (1828–1904) sowie weiteren Anhängern einer neuerer politischen Richtung der russländischen Ge-schichtsschreibung, die den Staat und seine Institutionen ins Zentrum ihrer Forschung stellte und später als die «Staatliche Schule» (oder «Rechtsschu-le») bezeichnet wurde. Ihre Grundannahme über die Ursprünge der russi-schen Autokratie bestand darin, dass diese Herrschaftsform auf die patriar-chalische Organisation des Stammesverbandes zurückgehe. In den zentralen Fragen – etwa nach der Entstehungszeit des russischen Staates, nach den rechtlichen Grundlagen seiner Entwicklung sowie dem Verhältnis zwischen
Teil A: Einleitung
28
Staat und Gesellschaft – vertraten diese Historiker insgesamt indessen recht unterschiedliche Ansichten. Neue Maßstäbe setzte dabei Solov’evs 29-bändige «Geschichte Russlands seit den ältesten Zeiten» (1851–1879), die im Wesentlichen dem deutschen Historismus verpflichtet war. Im Unter-schied zu den Werken Rankes und seiner Schüler spielte jedoch die Ideen-lehre, die Vorstellung von den geistigen Triebkräften der Geschichte, im russischen Historismus eine deutlich geringere Rolle. Ihren Platz nahmen vielmehr «Gesetzmäßigkeiten» als Untersuchungsgegenstand des Historikers ein. Das Erbe der Reformtätigkeit Peters I. war einer der Hauptinhalte dieser Schule und prägte auch die gesellschaftlich-politischen Anliegen ihrer Ver-treter: eine Fortsetzung der angesetzten Modernisierung durch die staatlichen Reformen. Gegen die «Staatliche Schule» traten im späten 19. Jahrhundert Historiker an, die stärkere Akzente auf die Wirtschafts- und Sozialgeschichte legten, die sogenannte «Moskauer Schule» um Vasilij Ključevskij (1841–1911) und Pavel Miljukov (1859–1943). Während etwa in Deutschland die Hauptexponenten weiterhin auf eine individualisierte Politik- und Ideenge-schichte historistischer Manier setzten, wandten sich die Vertreter der neuen Richtung in Russland der Analyse der Gesellschaft zu und traten für eine neue Sozialgeschichte ein. Den Antrieb zu dieser Schwerpunktsetzung gaben die liberalisierenden Reformen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und die im Zuge der Industrialisierung Russlands im späten 19. Jahrhundert wie-der aufgeflammten Debatten um die Rückständigkeit Russlands. Die Vertre-ter der «Moskauer Schule» sahen die Zukunft Russlands in der Demokrati-sierung des politischen Systems und der nachholenden Modernisierung und waren in ihrer Forschung dem Positivismus (> Glossar) verpflichtet. Das zentrale Anliegen dieser Schule war dabei, die Gründe für die Herausbildung und Entwicklung sozioökonomischer Strukturen und das Wirken historischer Gesetze zu erschließen. Demografie, Geografie und Statistik nutzten die Vertreter der «Moskauer Schule» hierfür als Hilfswissenschaften. Das sozi-alpolitische Engagement dieser Richtung bestand in der Überwindung der sozialen Kluft zwischen der westlich orientierten intelligencija (> Glossar) und den Bauern für eine Überwindung der Autokratie. Moderne nichtrussische Geschichtsschreibung konnte sich im Russländi-schen Imperium fast ausschließlich außerhalb professioneller Kreise der Universitäten und Akademien entwickeln – wie etwa die russisch-jüdische mit ihrem Hauptprotagonisten Simon Dubnow (1860–1941), dem Advokaten einer jüdischen Nationalgeschichtsschreibung. Die rechtliche Diskriminie-rung der Juden im zarischen Russland und die Diskussionen über die Wege der jüdischen Emanzipation zwischen Assimilation und Autonomie bildeten den politisch-sozialen Hintergrund der russisch-jüdischen Historiografie, die die Haupttendenzen der zeitgenössischen deutsch-jüdischen Geschichts-schreibung aufnahm und die Debatten zwischen den Westlern und Slawophi-
3. Historiografie, Methoden und Theorien
29
len über die Rückständigkeit Russlands auf die Situation der russischen Ju-den übertrug. Institutionell war die russisch-jüdische Geschichtsschreibung auf Selbstorganisation angewiesen: Mehrere jüdische Zeitschriften und Ge-sellschaften zur Förderung von historischer Arbeit und Quelleneditionen entfalteten im beginnenden 20. Jahrhundert eine rege Tätigkeit. In dieser Hinsicht entwickelte sich die russisch-jüdische Geschichtsschreibung paral-lel zur russischen, jedoch gänzlich von jener getrennt. In den zentralasiatischen Gebieten, die seit den 1860/70er-Jahren zum Russ-ländischen Reich gehörten, setzte sich die traditionelle dynastische und sak-rale Geschichtsschreibung parallel zur Entwicklung einer neuen Historiogra-fie fort, die entscheidende Impulse von der islamischen Reformbewegung bei den Krim- und Wolgatataren sowie den Usbeken Zentralasiens, dem Dschadidismus, erhielt und unter dem Einfluss der russischen Orientalisten stand. Auch in diesem Fall wurde die neue Historiografie von Amateuren betrieben, die zwar mit der Loslösung von den Höfen in Buchara und Chiva Unabhängigkeit erlangten, jedoch zugleich ihre Absicherung verloren. Denn die neue Historiografie verfügte über keine eigenen professionellen Instituti-onen. Die einzige institutionelle Basis bildeten die Gesellschaften russischer Orientalisten. Die einzige Herausforderung des großrussischen Paradigmas innerhalb des akademischen Etablissements stellte die ukrainische Geschichtsschreibung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts dar mit ihrem Hauptvertreter, dem Lem-berger Professor für allgemeine Geschichte mit dem Schwerpunkt auf Osteu-ropa Mychajlo Hruševs’kyj (1866–1934). Faktisch lehrte Hruševs’kyj die Geschichte der Ukraine und legte eine zehnbändige «Geschichte der Ukrai-ne-Rus’» (1898–1936) vor. Darin stellte er den alleinigen Anspruch der rus-sischen Staatlichkeit auf das Erbe der Kiever Rus’ in Frage und trat für eine Neubewertung der Rolle der ukrainischen und weißrussischen Nationen ein.
Sowjetische Historiografie Nach 1917 ging die Geschichtsschreibung in Russland und der Sowjetunion neue Wege und wurde durch die theoretische Basis des Historischen Mate-rialismus bestimmt. Der Historische Materialismus wurzelt in Karl Marx’ Lehre von den gesellschaftlichen Formationen und ihrer Abfolge und stellt die Anwendung des dialektischen Materialismus auf die Geschichte mensch-licher Gesellschaft dar. Marx betrachtet jede Gesellschaft als ein Gebäude, das aus einer ökonomische Basis (Produktionsverhältnisse, die einer be-stimmten Entwicklungsstufe der Produktivkräfte entsprechen) und einem ideologischen Überbau (politische und juristische Grundlagen) besteht, die in einem Wechselverhältnis zueinander stehen. Den historischen Prozess sieht Marx als eine Abfolge von gesellschaftlichen Formationen, die durch
Teil A: Einleitung
30
eine bestimmte Entwicklungsstufe der Produktivkräfte (Arbeitskräfte, Pro-duktionsmittel, Technologie) und dieser Stufe entsprechende Produktions-verhältnissen (Verteilung von Eigentumsrechten auf Produktionsmittel) cha-rakterisiert sind: Urgesellschaft (auch Urkommunismus), Sklavenhalterge-sellschaft, Feudalismus, Kapitalismus und Sozialismus/Kommunismus (> Glossar Kommunismus, Sozialismus). Der Übergang von einer Formation zur nächsten entsteht durch eine schnellere Entwicklung von Produktivkräf-ten, die in Konflikt mit den Produktionsverhältnissen geraten. Daraus entste-hen Klassengegensätze und -kämpfe, die zu Revolutionen führen und in deren Folge zu einer neuen Formation. Im Historischen Materialismus sow-jetischer Prägung erfuhr die Marxsche Lehre eine starke Vereinfachung: Die Basis bestimmte nun eindeutig den Überbau. Das theoretische Gebäude des Historischen Materialismus wurde in der sow-jetischen Geschichtsschreibung verstärkt seit der Mitte der 1920er-Jahre durchgesetzt, 1925 mit der Gründung der «Gesellschaft für marxistische Historiker» und 1926 der Zeitschrift «Marxistischer Historiker». Zuvor wa-ren die personellen und methodisch-theoretischen Kontinuitäten zur vorrevo-lutionären russländischen Historiografie weitgehend erhalten geblieben, trotz Flucht und Ausweisung zahlreicher namhafter Historiker. Erst im Zuge der Stalinschen «Revolution von oben» wurden die sowjetische Geschichts-schreibung radikal uniformiert und die «bürgerlichen» Historiker ihrer Ar-beitsmöglichkeiten infolge Verhaftungen und Verbannungen weitgehend beraubt (vgl. Stalins «Revolution von oben», S. 253). Selbst die Werke des führenden sowjetischen Historikers der 1920er-Jahre, Nikolaj Pokrovskij (1868–1932), der die Tradition der «Moskauer Schule» mit dem Marxismus verband, gerieten in die Kritik. Die generelle patriotische und wertkonserva-tive Wende wirkte sich auch auf die Geschichtswissenschaft aus: Seit 1934 sollte sich die Historikerzunft der Propaganda des Sowjetpatriotismus ver-pflichten und die glorifizierende Historie der Sowjetmacht schreiben. Die marxistischen Grundlagen der sowjetischen Geschichtsschreibung wurden formalisiert durch den starren Marxismus-Leninismus (sowie zeitweise Sta-linismus), der im Grunde nichts anderes als vulgärer Positivismus war. Die Publikation des Stalinschen «Kurzen Lehrgangs der Geschichte der kommu-nistischen Allunionspartei der Bol’ševiki» markierte 1938 den Höhepunkt dieser Entwicklung. Der verstärkte Patriotismus auf Kosten des marxisti-schen Vokabulars entsprach nun der russozentrischen Geschichte des Rei-ches, dessen nichtrussische Gebiete zur bloßen Projektionsfläche einer groß-russisch-imperialen Perspektive verkamen. Die Organisation des For-schungsbetriebs wurde zentralisiert, mit den Kontroll- und Steuerungsinstan-zen in Moskau. Die Geschichte der KPdSU genoss dabei eine Sonderstellung innerhalb der Geschichte Russlands und der Sowjetunion.
3. Historiografie, Methoden und Theorien
31
Die relative Lockerung des Systems während des Tauwetters der 1960er-Jahre betraf auch die Geschichtswissenschaft: Nach dem letzten Höhepunkt der Geschichtsverfälschung und des stalinistischen Dogmatismus der späten 1940er- und frühen 1950er-Jahre, als jegliche nicht in vollem Pathos glorifi-zierende Schilderung der Sowjetmacht in der historischen Forschung mit dem Bann belegt wurde, nutzten einige Historikerinnen und Historiker die Gelegenheit, sich aus dem starren marxistisch-leninistischen Korsett zu be-freien: die einen in der Suche nach dem «wahren» Sinn der Schriften von Marx und Lenin ohne die Dogmatik Stalins, die anderen unter vollständiger Absage an den Marxismus und dem Anschluss an die historiografischen Traditionen außerhalb der Sowjetunion – etwa die französische Annales-Schule (> Glossar). Denn in der gänzlichen Isolation sowjetischer Historike-rinnen und Historiker von ihren westlichen Kollegen in den vorangegange-nen Jahrzehnten war dies nicht möglich gewesen. Beiden Richtungen war die Abkehr vom starren Dogmatismus der Gesetzmäßigkeiten und Formatio-nentheorie eigen: Sie sahen in den gesellschaftlichen Epochen, sei es des Mittelalters oder des späten Zarenreiches, eine Vielschichtigkeit (russ. mno-goukladnost’) sozioökonomischer Organisation der jeweiligen Gesellschaf-ten und werteten das Bewusstsein (Vorstellungen, Ansichten, Emotionen) der Menschen auf. Die «Neo-Leninisten» um die Revolutions- und Agrarhistoriker Viktor Dani-lov (1925–2004) und Michail Gefter (1918–1995) suchten neue Wege aus dem starren Determinismus in der marxistischen Sozialpsychologie, die die Emotionen der Individuen und Kollektive in der sowjetischen Geschichte gegen die reine Ökonomie aufwertete. Die enthusiastischen Anfänge dieser Richtung erstickten jedoch im Laufe der 1970er-Jahre, als die konservative Wende unter Brežnev die Forschungsagenda zu bestimmen begann. Die andere, kulturgeschichtliche Richtung methodisch-theoretischer Innova-tionen während der 1960er-Jahre ist eng und fast ausschließlich mit dem Namen des Erforschers des skandinavischen Mittelalters Aron Gurevič (1924–2006) verbunden. Unter dem Einfluss der französischen Mediävistik und Wiederaufnahme russischer kulturgeschichtlicher Traditionen des frü-hen 20. Jahrhunderts gelang ihm der Anschluss an die Methoden und Theo-rien der zeitgenössischen westeuropäischen Forschung. Nicht zufällig wur-den die Werke Gurevičs zunächst vor allem im Ausland anerkannt und als ein wesentlicher Beitrag für die Konstituierung der Historischen Anthropo-logie gewürdigt. In seiner Heimat kam die breite Anerkennung nach der offiziellen Kritik während der 1970er-Jahre erst mit der Perestrojka (> Glos-sar). Seine Arbeiten bedeuteten einen entschiedenen Bruch mit der sowjeti-schen marxistisch-leninistischen Mediävistik: die Abkehr von den marxisti-schen Gesetzmäßigkeiten in Bezug auf den Feudalismus, den er nur im mit-telalterlichen Westeuropa als gegeben ansah und aus der spezifischen Ent-
Teil A: Einleitung
32
wicklung dieses Raumes ableitete – im Gegensatz zu den sowjetischen Me-diävisten, die an der marxistischen Notwendigkeit des feudalen Stadiums als Gesetzmäßigkeit für alle Gesellschaften festhielten. Gurevič hingegen plä-dierte für die Erforschung der Mentalitäten der Menschen – mentaler Ein-stellungen, Denkweisen und Orientierungen – und war Pionier der späteren Historischen Anthropologie in Russland. Einen wichtigen Beitrag zur Kul-turgeschichte Russlands leistete in den 1960er-Jahren die weniger dem poli-tischen Druck ausgesetzte Sprach- und Literaturwissenschaft der semioti-schen Tartu/Moskau-Schule um Jurij Lotman (1922–1993) und Boris Uspenskij (geb. 1937). Sie verstanden Kultur als kommunikatives System, das die Beziehungen der Menschen reguliert, und sahen die historisch-kulturelle Entwicklung Russlands getragen von «dualen» Oppositionen von «Reaktion – Progress, alt – neu, russisch – westlich, Christentum – Paganis-mus, Unterschicht – Oberschicht». Die rein kulturalistischen Interpretationen der Tartu-Schule wurden in der Forschung als verkürzt und pauschal kriti-siert, sie leisteten jedoch einen wichtigen Gegenpol zur starren Konformität sowjetischer Geisteswissenschaften im Spätsozialismus. Mit der Perestrojka und der teilweisen Öffnung bis dahin verschlossener Archive der Sowjetzeit geriet die professionelle sowjetische Geschichts-schreibung in eine Krise, die zugleich Möglichkeiten für einen Neuanfang bot. Die zögerliche Reaktion der Fachhistorikerinnen und -historiker auf den gesellschaftlichen Druck in der Aufarbeitung der «weißen Flecken» in der sowjetischen Geschichte führte dazu, dass das Feld dem Enthüllungsjourna-lismus überlassen wurde und die Fachleute von den Medien überrollt wur-den. Seit dem Ende der Sowjetunion wurde die Isolation der sowjetischen Geschichtsschreibung endgültig überwunden, und sie geht in methodisch-theoretischer Hinsicht gleiche Wege wie die Geschichtsschreibung außerhalb Russlands. Eine erneute gänzliche Vereinnahmung der Historikerinnen und Historiker für politische Zwecke ist nicht mehr gegeben, wenn auch eine neue großrussische Nationalgeschichtsschreibung, die je nach Lager die sowjetische Geschichte oder das Zarenreich verklärt, sich parallel zur Spit-zenforschung entwickelt.
3.1.2 Ostmittel- und Südosteuropa
Historiografische Traditionen in den jeweiligen Ländern Ostmittel- und Südosteuropas weisen sehr unterschiedliche Entwicklungen auf. So werden hier nur die allgemeinen Tendenzen skizziert. Stärker und bewusster als im Russländischen Reich sahen die Pioniere der modernen Geschichtsschreibung Ostmittel- und Südosteuropas im 19. und frühen 20. Jahrhundert ihren Auftrag in einem spezifischen Beitrag zur Nati-
3. Historiografie, Methoden und Theorien
33
onswerdung der jeweiligen Völker des östlichen Europa durch die National-geschichtsschreibung. Mit der Entstehung neuer Staaten und der Verände-rung der Grenzen infolge des Ersten Weltkrieges fiel den Historikern die Aufgabe zu, die neuen Nationalstaaten nach außen und nach innen zu legiti-mieren. Spezifisch für Ostmittel- und Südosteuropa war dabei, dass bedeu-tende Historiker jener Zeit zugleich zur politischen Elite und Führung gehör-ten, wie etwa Bálint Hóman (1885–1951), ungarischer Mediävist und Kul-tusminister (1932–1938, 1939–1942), oder Nicolae Iorga (1871–1940), ru-mänischer Historiker, Begründer der Nationaldemokratischen Partei (1910) und Ministerpräsident Rumäniens (1931–1932). Die Frage der politischen Instrumentalisierung der Geschichtsschreibung stellte sich für sie nicht, denn der politische Auftrag fiel hier mit dem wis-senschaftlichen zusammen. Thematisch befassten sie sich mit den Voraus-setzungen der Nationswerdung: der Ethnogenese, den Gründungsmythen und Herrschaftsformen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Die nationa-listische Geschichtsschreibung erreichte ihren Höhepunkt in den rechts-konservativen und autoritären Regimen Ostmittel- und Südosteuropas im zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts. Mit dem kommunistischen Machtwechsel nach dem Zweiten Weltkrieg war nun auch hier die Geschichtsschreibung aufgefordert, die Prinzipien des Historischen Materialismus zur methodisch-theoretischen Basis der For-schung zu machen und die Glorie des Sozialismus in den jeweiligen Ländern zu dokumentieren. Die Vergangenheit sollte im marxistisch-leninistischen Sinne umgeschrieben werden. Der Wissenschaftsbetrieb wurde ebenso nach dem sowjetischen Vorbild reorganisiert – die Akademien der Wissenschaf-ten erhielten eine viel stärkere Stellung gegenüber den Universitäten. Die als «bürgerlich» etikettierten Historiker wurden – ähnlich wie in der Sowjetuni-on der 1930er-Jahre – verfolgt, verbannt, an der Arbeit gehindert oder von den neuen Machthabern kooptiert. Die Phase der rigiden Ideologisierung und «Sowjetisierung» bei der Themenwahl war jedoch von relativ kurzer Dauer. Für die Forschung in Ostmitteleuropa erwiesen sich insbesondere die re-gimekonformen Projekte der 1950er-Jahre später als wissenschaftlich un-tragbar. Die Ambivalenzen von Kontinuität zu nationalen historiografischen Traditionen und neuem sowjetischem Paradigma bestanden seit der frühen Nachkriegszeit. Die Wende nach dem Tod Stalins 1953 und die darauf fol-gende Lockerung der Regime stellte erneut die nationalen Aspekte der Ge-schichtsschreibung in den Staaten des Ostblocks in den Vordergrund. Die Ausprägung und Verwurzelung des «Nationalkommunismus» war dennoch je nach Land unterschiedlich. Der wissenschaftliche Anschluss an die For-schung außerhalb der sozialistischen Staaten wurde seit den 1960er-Jahren in unterschiedlichem Umfang möglich: In Polen konnten die Kontakte unter anderem auf den Netzwerken mit der polnischen Diaspora aufbauen, hinge-
Teil A: Einleitung
34
gen gestaltete sich die Situation für die tschechoslowakischen Kollegen in dieser Hinsicht schwieriger. Generell ging die Geschichtsschreibung im so-zialistischen Polen und Ungarn viel liberalere und innovativere Wege. Frü-her als im übrigen Ostblock entwickelten sich hier nationale Historiografien eigenständiger, dissidente Haltungen wurden viel offener gepflegt, ja teil-weise institutionell verankert. Ähnlich wie in Polen war die tschechoslowa-kische Geschichtsschreibung in der unmittelbaren Nachkriegszeit zunächst durch antideutsche Stimmungen und im tschechischen Fall gar durch eine generelle Skepsis gegenüber dem europäischen Westen geprägt. In den 1970/80er-Jahren, als das sozialistische Paradigma ausgehöhlt wurde, ver-hinderten allerdings die starren offiziellen Institutionen der Geschichtswis-senschaft hier in viel höherem Maße Erneuerung und Anschluss an die west-liche Forschung. Einzelleistungen waren hingegen auch im Regime der all-gemeinen Starrheit möglich: Einen wichtigen Beitrag zur grundlegenden Nationalismusforschung leistete etwa der tschechische Historiker Miroslav Hroch (geb. 1932) mit seinem 3-Phasen-Modell für das «Erwachen» «klei-ner» (sozial und politisch entrechteter) Nationen, das bis heute Einfluss auf die Nationalismusforschung ausübt. Die historische Forschung in Südosteu-ropa (Rumänien, Bulgarien oder Albanien) zeichnete sich durch eine viel stärkere Fixierung auf nationale Mythenbildung in recht konventioneller Manier aus. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 und dem Ende des Sozia-lismus in Ostmittel- und Südosteuropa durchlief die professionelle Ge-schichtsschreibung eine ähnliche Krise wie in der Sowjetunion der Perest-rojka und im postsowjetischen Russland. Die Aufarbeitung der sozialisti-schen Vergangenheit und die Schließung der «weißen Flecken» übernahmen auch hier zunächst Journalisten und Intellektuelle außerhalb der Historiker-zunft. Die Bearbeitung der neu zugänglichen Dokumente der Staatssicher-heitsorgane und die Bildung von Historikerkommissionen brauchte Zeit. Ähnlich wie im postsowjetischen Raum förderte die Öffnung der Archive zunächst eine stärker auf Deskription und Akkumulation bedachte histori-sche Arbeit, weniger methodisch unterstützte Analysen. Zudem führte das Ende des Sozialismus in Ostmittel- und Südosteuropa zur erneuten Verstär-kung des nationalstaatlichen Paradigmas und zur Verklärung der Zwischen-kriegszeit. Negative Aspekte wie der weitverbreitete Antisemitismus und die forcierte nationale Homogenisierungspolitik in den meisten Ländern des östlichen Europa werden dabei ausgeblendet. Die sowjetische Periode wurde hingegen vielfach auch bis heute als «Fremdherrschaft» betrachtet, der Tota-litarismusbegriff häufig ohne theoretische Reflektion gebraucht, um die Emanzipation von der sozialistischen Vergangenheit festzuhalten. In der jüngsten Forschung hingegen werden die Mythen der nationalen Geschichts-schreibung vermehrt in Frage gestellt. Allerdings geschieht dies – je nach
3. Historiografie, Methoden und Theorien
35
Land – in unterschiedlichem Tempo. In Rumänien etwa begann dieser Pro-zess in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre, in Bulgarien erst zehn Jahre später, in allerjüngster Zeit. Hingegen hat in der albanischen Geschichts-schreibung eine kritische Betrachtung nationaler Mythenbildung noch kaum begonnen.
3.2 Aktuelle Entwicklungen: Kulturgeschichte Osteuropas
3.2.1 Themen, Fragen und Schulen der Kulturgeschichte
Die aktuelle historische Forschung geht kulturgeschichtliche Wege, auch im Bereich Osteuropa. Die neuere Kulturgeschichte entwickelte sich in den einzelnen Ländern Europas sowie in den USA unterschiedlich – je nach na-tionalgeschichtlichen Traditionen, die sie jeweils zu überwinden suchte. In Frankreich waren es Historiker um die Schule der Annales (Marc Bloch, 1886–1944; Lucien Febvre, 1878–1956), die in den 1930er-Jahren Grundla-gen für die französische Mentalitätsgeschichte legten und damit die weitere Entwicklung der kulturhistorischen Forschung in Frankreich wesentlich mit-beeinflussten. In England gaben seit den 1960er-Jahren Historiker mit mar-xistischem Hintergrund (Eric J. Hobsbawm, geb. 1917; Peter Burke, geb. 1937) wichtige Anstöße für die Kulturgeschichte der Unterschichten. Diese Thematik war programmatisch für ihre Abgrenzung zur traditionellen politi-schen Geschichte, die die Staaten und Staatsmänner als historische Akteure im Blick hatte. Die italienische Mikrogeschichte (Carlo Ginzburg, geb. 1939; Giovanni Levi, geb. 1939) der 1970er-Jahre verfolgte diese Richtung noch konsequenter, als sie auf kleine Räume wie etwa ein Dorf oder auf einzelne Menschen fokussierte, um generelle Fragen an die jeweilige Gesell-schaft aus der Dichte eines Falls zu erhellen. In der deutschsprachigen Ge-schichtswissenschaft kam die neuere Kulturgeschichte erst ab den 1980er-Jahren zum Durchbruch. Sie löste die bis dahin als Hauptströmung geltende Gesellschaftsgeschichte ab, die sich auf die Analyse gesellschaftlicher Struk-turen und Prozesse (etwa der Modernisierung) konzentrierte. Der einzelne Mensch veschwand dabei hinter «gesellschaftlichen Entwicklungen» und war irrelevant. Für die Gesellschaftsgeschichte traten einzelne Menschen lediglich als anonyme Daten für Statistiken auf, um Aussagen über die Durchschnittswerte in einer Gesellschaft zu ermöglichen. Historikerinnen und Historiker der neueren Kulturgeschichte traten gegen diese Vernachläs-sigung an: Ihre Forschungspraxis verstanden sie als Gegengewicht zum Vor-gehen, das «dazu neigt, die Menschen wie Mäuse zu behandeln» (Friedhelm Neidhardt, zitiert nach Ute Daniel: «Kultur» und «Gesellschaft», S. 72). Es waren in erster Linie die Alltagsgeschichte und die Historische Anthropolo-
Teil A: Einleitung
36
gie (Alf Lüdtke, geb. 1943; Hans Medick, geb. 1939), die in der deutsch-sprachigen Geschichtswissenschaft eine stärkere Hinwendung zum Men-schen forderten. Die aus Frankreich stammende Diskursanalyse (> Glossar) oder die amerikanische New Cultural History (> Glossar) sind nur zwei wei-tere Zugänge innerhalb der breiten Palette des methodisch-theoretischen Repertoirs der Kulturgeschichte. All diese Schulen wurden von Entwicklungen in der Philosophie, Soziologie, Anthropologie, Ethnologie sowie der Literaturwissenschaften beeinflusst. Die methodisch-theoretischen Grundlagen der neueren Kulturgeschichte sind daher weder einheitlich, noch streben sie eine Einheit an. Gemeinsam ist ihnen dennoch eine verstärkte Hinwendung zur Analyse der Sprache: der Ausdrucksweisen historischer Akteure wie auch der Forschenden selbst, der Darstellungsmodi in historischen Werken. Dieses Interesse an Sprache als kultureller Matrix, die seit den 1970er-Jahren unter sprachphilosophischen Einflüssen aufkam, markierte in der Geschichtswissenschaft eine Wende, den sogenannten linguistic turn. Dass alles Wissen und Handeln sprachlich codiert (durch Sprache vermittelt und mit bestimmten Bedeutungen verbun-den) ist und diese Codierungen von den Forschenden in jeweiligen histori-schen Kontexten entschlüsselt werden müssen, ist seitdem programmatisch für die kulturhistorische Forschung. Die neuere Kulturgeschichte versteht Kultur als «Medium historischer Pra-xis» (Historische Anthropologie 1,1993, Editorial) und stellt den Menschen in seinem historischen Kontext ins Zentrum der Analyse: Wahrnehmungen und Erfahrungen einzelner Menschen und Kollektive, kulturelle Bedeu-tungssysteme von Gesellschaften, Milieus, sozialer/ethnischer/religiöser oder anders definierter Gruppen und die Aneignung dieser Bedeutungssysteme durch Einzelne und Gruppen. Welche Bedeutung legten die Menschen ver-gangener Epochen in ihr Handeln hinein? Was bedeutete ihnen die umge-bende Welt? Wie haben sie diese Bedeutungen ihren Zeitgenossen und mög-licherweise den Nachkommen mitgeteilt und für sich selbst festgehalten? Dies sind einige der zentralen Fragen, die die neuere kulturgeschichtliche Forschung an die Vergangenheiten stellt. Die Vielfalt dieser generellen Richtung kulturgeschichtlicher Forschung spiegelt sich in ihrer Praxis. Die neuere Kulturgeschichte lässt sich weder thematisch noch methodisch auf einen Nenner bringen: Sie differenzierte sich in unterschiedliche Forschungsfelder aus und greift dabei auf unter-schiedliche, teilweise gegensätzliche theoretische Grundlagen zurück: Histo-rische Anthropologie mit Alltags- und Mikrogeschichte, Gender Studies, die aus der Frauengeschichte hervorgegangen sind, Begriffsgeschichte und Dis-kursanalyse, Wissenschaftsgeschichte, Bild- und Medienanalyse, Erinne-rungskultur. Die traditionellen Felder etwa der Politik- und Diplomatiege-
3. Historiografie, Methoden und Theorien
37
schichte, der Arbeiter- und Parteigeschichte werden in der jüngsten For-schung verstärkt mit dem analytischen Instrumentarium der Kulturgeschichte angegangen. Die «großen Erzählungen» der nationalen und imperialen Ge-schichtsschreibung werden durch die Analyse transnationaler Verflechtun-gen und Transfers, des kulturellen Kontakts und der Abgrenzung ersetzt.
3.2.2 Forschung zur Kulturgeschichte Osteuropas
Die kulturwissenschaftliche Erforschung Osteuropas folgt im Wesentlichen den oben dargestellten Tendenzen und Ausrichtungen. Im Folgenden werden hier die Forschungsfelder der Historischen Anthropologie, der lebenswelt-lich orientierten Geschichtsschreibung, der Post-Colonial Studies sowie ei-nige weitere Felder exemplarisch skizziert. 1. Im Bereich der historischen Anthropologie Südosteuropas hat vor allem die Grazer Schule Pionierarbeit geleistet. Prominent sind hier die Arbeiten von Karl Kaser, Ulf Brunnbauer oder Hannes Grandits über die traditionel-len Familienstrukturen auf dem Balkan sowie die ethnischen und nationalen Identitäten. In jüngster Zeit wird zudem vermehrt der sozialistische Alltag in Südosteuropa untersucht. In den historisch-anthropologischen Arbeiten zu Ostmitteleuropa liegt der Schwerpunkt auf der Alltagsgeschichte und den interethnischen Kontakten, etwa in der Studie der Anthropologin Margit Feischmidt zu den vielschichti-gen Identitäten von Rumänen und Ungarn in den späten 1980er-Jahren im siebenbürgischen Cluj oder den Arbeiten zur Alltagskultur im deutsch-polnischen, tschechisch-deutschen oder bayerisch-böhmischen Grenzraum. Das traditionelle Thema der osteuropäischen Geschichte – der Nationalismus – wird somit vertiefter auf der Ebene des Alltags, individueller Wahrneh-mungen und kultureller Praxis abgehandelt. Hier knüpft die Erforschung des städtischen Alltags an die allgemeine Stadtgeschichtsforschung an. Einen prominenten Platz in der Erforschung interkultureller Kontakte nehmen die zahlreichen Studien zur jüdischen Geschichte in Ostmitteleuropa ein – etwa von Gershon Hundert über die Jüdinnen und Juden im Polen des 18. Jahr-hunderts oder von Heiko Haumann über jüdisch-nichtjüdische Kontakte im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Historisch-anthropologische und alltagsgeschichtliche Arbeiten zu russi-schen und sowjetischen Themen dominieren quantitativ die Osteuropa-Forschung auf diesem Gebiet. Der Schwerpunkt liegt auf der spätzarischen, noch stärker auf der frühsowjetischen Periode und besonders auf dem Stali-nismus. Die methodische Vielfalt spiegelt hier diejenige der allgemeinen Geschichte.
Teil A: Einleitung
38
Die Hinwendung zum historischen Akteur betrifft dabei immer mehr The-men, die zuvor kaum aus kulturgeschichtlicher Sicht untersucht wurden, wie etwa die Diplomatiegeschichte. Haben die Historikerinnen und Historiker bis vor Kurzem in der Geschichte der internationalen Beziehungen nur das In-teragieren von Staaten und Institutionen analysiert, wie dies in der älteren Politikgeschichte üblich war, so sind es heute die Diplomaten selbst mit ih-ren individuellen und sozialen Prägungen, Launen und Ambitionen, die die Forschung interessieren – wie etwa im Forschungsprojekt von Susanne Schattenberg über die Kulturgeschichte der Diplomatie im späten Zaren-reich. Ebenso wird in der neueren Forschung die bis vor Kurzem primär strukturgeschichtlich betriebene Verwaltungsgeschichte als Alltag der Be-amten untersucht. Verstärkt werden in der neuesten Forschung Quellen persönlichen oder au-tobiografischen Charakters (Selbstzeugnisse) einbezogen und Fragen nach dem Selbstverständnis ihrer Autorinnen und Autoren aufgeworfen. Ältere Annahmen – etwa von der amorphen russischen Bauernmasse oder dem sowjetischen kollektiven Menschen – werden dabei in Frage gestellt und zugleich neue Facetten des Alltags erschlossen (Herzberg/Schmidt). Hier schließen die Methoden der Oral-History an und ermöglichen die Erfor-schung bis vor Kurzem vernachlässigter Bereiche wie etwa der Geschichte der Kindheit (Kelly: Children’s World). 2. Einen spezifischen Zugang bildet die lebensweltlich orientierte Ge-schichtsschreibung. Sie schließt an die Ansätze der Mikrogeschichte an, die sich auf kleine Räume (Dorf, Haus), soziale Gruppen oder einzelne Men-schen konzentriert, um vom Fall aus Aussagen über die Gesellschaft zu er-möglichen. Der lebensweltliche Ansatz fokussiert noch konsequenter auf die Lebenswelten einzelner Menschen – auf ihr Denken und Handeln, das indi-viduell und sozial zugleich ist. Exemplarisch werden dabei die gesellschaft-lichen Strukturen und Prozesse analysiert, wie etwa in der Arbeit von Susan-ne Schattenberg über die sowjetischen Ingenieure der Stalin-Zeit oder in der Untersuchung von Daniela Tschudi, die anhand der Schicksale einzelner Jugendlicher die Gewalt im frühen Sowjetstaat analysiert. 3. Im Anschluss an die Post-Colonial Studies des angelsächsischen Raums, die asymmetrische Machtverhältnisse in der alltäglichen Praxis und in den symbolischen Repräsentationen untersuchen und nach der kulturellen Fremdheit sowie interkulturellen Kontakten fragen, untersuchten Osteuropa-historikerinnen und -historiker diese Fragen für das östliche Europa an Bei-spielen aus dem Habsburger Reich, dem Osmanischen und dem Russländi-schen Imperium. In diesem Umfeld entstand die neue Imperiumsforschung um die Zeitschrift Ab Imperio, die sich in erster Linie auf das Russländische Reich konzentriert.
3. Historiografie, Methoden und Theorien
39
4. Zu einem zentralen Forschungsgegenstand entwickelten sich in der neues-ten Zeit Geschichtspolitik und Erinnerungskulturen in Osteuropa. Diese höchst politisierten Themen erhielten einen Aufschwung seit der Auflösung der Sowjetunion und der Gründung neuer Staaten sowie im Zusammenhang mit der Erforschung des Zweiten Weltkrieges und der Erinnerung an diesen Krieg. 5. Die Wiederentdeckung der Kategorie Raum für die kulturhistorische For-schung, der spatial turn, fand auch in der Geschichte Osteuropas statt. Men-tale Karten, soziale und kulturelle Räume fanden Eingang in die neueren Arbeiten, wie etwa die Studien über das spätzarische St. Petersburg von Karl Schlögel und über das Leningrad der 1920er-Jahre von Julia Obertreis oder die Untersuchung über die öffentlichen und privaten Räume im sowjetischen Moskau und deren Überlappungen von Monica Rüthers. 6. Die visuelle Kultur – Manifestation sozialer und kultureller Identifikatio-nen und Orientierungen in Bildern und Plakaten oder in der Architektur und Gestaltung der Wohnräume, öffentlicher Plätze, in Kunstgegenständen – ist seit Neuestem ebenso auf der Agenda der Osteuropahistorikerinnen- und historiker, etwa mit Publikationen von Valerie A. Kivelson und Joan Neu-berger oder Victoria Bonnell. 7. Die weiteren aktuellen Trends der Forschung liegen in der spezifisch ost-europäischen Technik- und Umweltgeschichte; die kulturgeschichtlich informierte Geschichte des Sports sowie die Geschichte der Emotionen in Osteuropa gehören ebenfalls zu den erst vor Kurzem entdeckten Feldern des Faches. Größere Projekte zur Begriffsgeschichte werden zurzeit in Angriff genommen.
Literatur zum Abschnitt 3: Historiografie, Methoden, Theorien Geschichtsschreibung in Osteuropa Bohn, Thomas M.: Russische Geschichtswissenschaft von 1880 bis 1905. Pavel N. Miljukov und die Moskauer Schule, Köln u.a. 1998.
Brenner, Christiane u.a. (Hrsg.): Geschichtsschreibung zu den böhmischen Ländern im 20. Jahrhundert, München 2006.
Davies, Robert W.: Perestroika und Geschichte. Die Wende in der sowjetischen Historiogra-phie, München 1991 (orig.: Soviet History in the Gorbachev Revolution. Studies in Soviet History and Society, London 1989).
Deletant, Dennis; Hanak, Harry (Hrsg.): Historians as Nation-Builders. Central and South-East Europe, London 1988.
Geyer, Dietrich: Klio in Moskau und die sowjetische Geschichte, Heidelberg 1985.
Hilbrenner, Anke: Diaspora-Nationalismus. Zur Geschichtskonstruktion Simon Dubnows, Göttingen 2007.
Teil A: Einleitung
40
Hösler, Joachim: Die sowjetische Geschichtswissenschaft 1953–1991. Studien zur Methodo-logie- und Organisationsgeschichte, München 1995.
Lehmann, Hartmut; Van Horn Melton, James (Hrsg.): Paths of Continuity. Central European Historiography from the 1930s to the 1950s, Cambridge 1994.
Krasnodębski, Zdzisław; Garsztecki, Stefan; Ritter, Rüdiger (Hrsg.): Last der Geschichte? Kollektive Identität und Geschichte in Ostmitteleuropa. Belarus, Polen, Litauen, Ukraine, Hamburg 2008.
Markwick, Roger: Cultural History under Khrushchev and Brezhnev: From Social Phycholo-gy to Mentalités, in: Russian Review 65 (2006), S. 283–301.
Markwick, Roger: Rewriting Soviet History in Soviet Russia. The Politics of Revisionist Historiography, 1956–1974, London 2000.
Sanders, Thomas (Hrsg.): Historiography of Imperial Russia. The Profession and Writing of History in a Multinational State, Armonk 1999.
Timmermann, Heiner (Hrsg.): Geschichtsschreibung zwischen Wissenschaft und Politik: Deutschland, Frankreich, Polen im 19. und 20. Jahrhundert, Saarbrücken 1987.
Wulff, Dietmar: Wissenschaftskultur in Russland am Beispiel der Geschichtswissenschaften, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 52/10 (2004), S. 886–893.
Aktuelle Entwicklungen: Kulturgeschichte Osteuropas Daniel, Ute: Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter, Frankfurt/M. 42004.
Daniel, Ute: «Kultur» und «Gesellschaft». Überlegungen zum Gegenstandsbereich der Sozi-algeschichte, in: Geschichte und Gesellschaft 19 (1993), S. 69–99.
Eibach, Joachim; Lottes, Günther (Hrsg.): Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Hand-buch, Göttingen 2002.
Emeliantseva, Ekaterina: Osteuropa und die Historische Anthropologie. Impulse, Dimensio-nen, Perspektiven, in: Osteuropa 3 (2008), S. 125–140.
Feichtinger, Johannes; Prutsch, Ursula; Csáky, Moritz (Hrsg.): Habsburg postcolonial. Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis, Innsbruck 2003.
Feischmidt, Margit: Ethnizität als Konstruktion und Erfahrung. Symbolstreit und Alltagskul-tur im siebenbürgischen Cluj, Münster 2003.
Goehrke, Carsten: Russland in der historischen Alltagsforschung, in: Digitales Handbuch zur Geschichte und Kultur Russlands und Osteuropas, VifaOst 2005 http://www.vifaost.de/texte-materialien/digitale-reihen/handbuch.
Grandits, Hannes: Familie und sozialer Wandel im ländlichen Kroatien (18.–20. Jahrhundert), Wien 2002.
Haumann, Heiko: Kommunikation im Schtetl. Eine Annäherung an jüdisches Leben in Osteu-ropa zwischen 1850 und 1930, in: Boškovska, Nada u.a. (Hrsg.): Wege der Kommunikation in der Geschichte Osteuropas, Zürich 2002, S. 323–348.
Haumann, Heiko: Geschichte. Lebenswelt, Sinn. Über die Interpretation von Selbstzeugnis-sen, in: Hilmer, Brigitte; Lohmann, Georg; Wesche, Tilo (Hrsg.): Anfang und Grenzen des Sinns. Für Emil Angehrn, Göttingen 2006, S. 42–54.
3. Historiografie, Methoden und Theorien
41
Herzberg, Julia; Schmidt, Christoph (Hrsg.): Vom Wir zum Ich. Individuum und Autobiogra-phik im Zarenreich, Köln u.a. 2007.
Historische Anthropologie: Kultur, Gesellschaft, Alltag, Köln u.a. 1 (1993)–.
Ivanišević, Alojz (Hrsg.): Klio ohne Fesseln? Historiographie im östlichen Europa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. Wien u.a. 2003.
Jobst, Kerstin S.; Obertreis, Julia; Vulpius, Ricarda: Neuere Imperiumsforschung in der Ost-europäischen Geschichte: die Habsburgermonarchie, das Russländische Reich und die Sow-jetunion, in: Comparativ 18/2 (2008), S. 27–56.
Kaser, Karl u.a. (Hrsg.): Historische Anthropologie im südöstlichen Europa. Eine Einführung, Wien u.a. 2003.
Lindner, Rainer: Osteuropäische Geschichte als Kulturgeschichte, in: Digitales Handbuch zur Geschichte und Kultur Russlands und Osteuropas, VifaOst 2004 http://www.vifaost.de/texte-materialien/digitale-reihen/handbuch.
Kelly, Catriona; Shepherd, David (Hrsg.): Russian Cultural Studies: An Introduction, Oxford u.a. 1998.
Kelly, Catriona; Shepherd, David (Hrsg.): Constructing Russian Culture in the Age of Revolu-tion: 1881–1940, Oxford u.a. 1998.
Kelly, Catriona: Children’s World. Growing Up in Russia, 1890–1991, New Haven 2007.
Kivelson, Valerie A.; Neuberger, Joan (Hrsg.): Picturing Russia. Explorations in Visual Cultu-re, New Haven u.a. 2008.
Pietrow-Ennker, Bianka (Hrsg.): Kultur in der Geschichte Russlands. Räume, Medien, Identi-täten, Lebenswelten, Göttingen 2007.
Roth, Klaus (Hrsg.): Sozialismus: Realitäten und Illusionen. Ethnologische Aspekte der sozia-listischen Alltagskultur, Wien 2005.
Scheide, Carmen; Stegmann, Natali: Themen und Methoden der Frauen- und Geschlechterge-schichte, in: Digitales Handbuch zur Geschichte und Kultur Russlands und Osteuropas, Vifa-Ost 2004, http://www.vifaost.de/texte-materialien/digitale-reihen/handbuch.
Schattenberg, Susanne: Die Sprache der Diplomatie oder das Wunder von Portsmouth. Über-legungen zu einer Kulturgeschichte der Außenpolitik, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuro-pas 56/1 (2008), S. 3–26.
Schenk, Fritjof Benjamin: Aleksandr Nevskij. Heiliger – Fürst – Nationalheld: Eine Erinne-rungsfigur im russischen kulturellen Gedächtnis (1263–2000), Köln 2004.
Schulze Wessel, Martin (Hrsg.): Eine Standortbestimmung der Osteuropäischen Geschichte, in: Zeitenblicke 6/2 (2007) http://www.zeitenblicke.de/2007/2.
Troebst, Stefan: Kulturstudien Ostmitteleuropas. Aufsätze und Essays, Frankfurt/M. 2006.
Tschudi, Daniela: Auf Biegen und Brechen. Sieben Fallstudien zur Gewalt im Leben junger Menschen im Gouvernement Smolensk 1917–1926, Zürich 2004.
Teil A: Einleitung
42
4. NACHSCHLAGEWERKE UND EINFÜHRUNGEN IN WESTEUROPÄISCHEN SPRACHEN
Der Umfang an Grundlagenforschung für Osteuropa variiert stark von Regi-on zu Region. Dementsprechend gibt es nicht zu jedem Gebiet spezialisierte Handbücher oder auch Nachschlagewerke in westeuropäischen Sprachen. Die folgende Übersicht bietet einen ersten Einstieg und sollte zusammen mit den Literaturlisten zu anderen Kapiteln dieser Einführung konsultiert wer-den.
4.1 Osteuropa allgemein Bideleux, Robert ; Jeffries, Ian: A History of Eastern Europe. Crisis and Change, London u.a. 22007.
Crampton, Richard J.: Eastern Europe in the Twentieth Century – and after, London 21997.
Longworth, Philip: The Making of Eastern Europe, Basingstoke 1992.
Niederhauser, Emil: A History of Eastern Europe Since the Middle Ages, Boulder 2003.
Tornow, Siegfried: Was ist Osteuropa? Handbuch zur osteuropäischen Text- und Sozialge-schichte von der Spätantike bis zum Nationalstaat, Wiesbaden 2005.
Turnock, David: The Making of Eastern Europe. From the Earliest Times to 1815, London 1988.
Digitales Handbuch zur Geschichte und Kultur Russlands und Osteuropas, in: VifaOst http://www.vifaost.de/texte-materialien/digitale-reihen/handbuch.
Wieser Enzyklopädie des Europäischen Ostens, hrsg. v. Feliks J. Bister, Karl Kaser, Lojze Wieser u.a., Klagenfurt u.a. 2002–.
Zernack, Klaus: Osteuropa. Eine Einführung in seine Geschichte, München 1977.
Serie: European Historical Dictionaries, Lanhan [enhält historische Lexika zu den meisten Ländern Osteuropas].
4.2 Russland und die Sowjetunion Beyrau, Dietrich; Lindner, Rainer (Hrsg.): Handbuch der Geschichte Weißrußlands, Göttin-gen 2001.
Brown, Archie u.a. (Hrsg.): The Cambridge Encyclopedia of Russia and the Soviet Union, Cambridge u.a. 1982.
Langer, Lawrence N.: Historical Dictionary of Medieval Russia, Lanham 2002.
Neutatz, Dietmar; Bohn Thomas M. (Hrsg.): Studienhandbuch Östliches Europa, Bd. 2: Ge-schichte des Russischen Reiches und der Sowjetunion, Köln u.a. 2002.
Torke, Hans-Joachim (Hrsg.): Die Russischen Zaren, 1547–1917, München 32005.
Torke, Hans-Joachim (Hrsg.): Historisches Lexikon der Sowjetunion, 1917/22 bis 1991, München 1993.
4. Nachschlagewerke und Einführungen in westeuropäischen Sprachen
43
Torke, Hans-Joachim (Hrsg.): Lexikon der Geschichte Russlands. Von den Anfängen bis zur Oktober-Revolution, München 1985.
Wieczynski, Joseph L. (Hrsg.): The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History, Gulf Breeze 1976–1990 (Supplement 1995–).
4.3 Ostmittel- und Südosteuropa Bernath, Mathias; Nehring, Karl (Hrsg.): Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteu-ropas. München 1974–1981.
Lerski, George Jan: Historical Dictionary of Poland, 966–1945, Westport 1996.
Roth, Harald (Hrsg.): Studienhandbuch östliches Europa. Bd. 1: Geschichte Ostmittel- und Südosteuropas, Köln u.a. 1999.
Wróbel, Piotr: Historical Dictionary of Poland, 1945–1996, Westport 1998.
4.4 Zeitschriften Ab Imperio. Theory and History of Nationalism and Empire in the Post-Soviet Space, [engl./russ.], Kasan 2000–.
Acta Poloniae Historica, Warszawa 1958–.
Balkan studies. A Biannual Publication of the Institute for Balkan Studies. Thessaloniki 1960–.
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, München 1960–.
Cahier du monde russe [früher: et soviétique], Paris 1959/60–.
Central European History. Cambridge 1968–.
East European quarterly. Boulder 1967–.
Europe-Asia Studies [früher: Soviet Studies]. A Quarterly Journal on the USSR and Eastern Europe, Abington 1948/1950–.
Forschungen zur baltischen Geschichte. Tartu 2006–.
Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Berlin 1954–.
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge [ab 1953], Wiesbaden [früher: München] 1953–.
Journal of Baltic Studies. Mahwah 1972–.
Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, Bloomington 2000–.
Nationalities Papers, NY 1972–.
Nordost-Archiv. Neue Folge [ab 1992]: Zeitschrift für Regionalgeschichte, Lüneburg [früher: Darmstadt] 1968–.
Österreichische Osthefte. Zeitschrift für Mittel-, Ost-, und Südosteuropaforschung, Wien 1959–2006.
Osteuropa. Interdisziplinäre Monatszeitschrift zur Analyse von Politik, Wirtschaft, Gesell-schaft, Kultur und Zeitgeschichte in Osteuropa, Ostmitteleuropa und Südosteuropa [früher
Teil A: Einleitung
44
Untertitel: Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens], Berlin [früher: Königsberg, Stutt-gart] 1925–.
Russian History, Salt Lake City, 1974–.
The Russian Review. An American Quarterly devoted to Russia. Past and Present, Malden [früher: Stanford] 1941–.
Slavic Review. An American Quarterly of Soviet and East European Studies [bis vol. 30: The American Slavic and East European Review], Cambridge [früher: Stanford] 1941–.
The Slavonic and East European Review, London 1922–.
Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas [bis Bd. 4: Südostdeutsche Forschungen], München 1936–.
Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete, Müchen 1969–.
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung [bis 1994: Zeitschrift für Ostforschung], Marburg 1952–.
4.5 Online-Ressourcen Links zu zahlreichen Online-Ressourcen aus dem Fachbereich Geschichte und Osteuropa-Wissenschaften (Volltext-Archive, Online-Zeitschriften, bibliografische Datenbanken etc.) sind im Internet zu finden unter http://www.hist.uzh.ch/oeg/elektronische-recherche.htm.
1. Ethnogenese und Nationsbildung
45
TEIL B: SYSTEMATISCHER TEIL
1. ETHNOGENESE UND NATIONSBILDUNG
1.1 Einleitung: Themen und Fragen Bei der Erforschung von Gruppenidentitäten ethnischen und nationalen Cha-rakters im östlichen Europa stehen vor allem drei Fragenkomplexe im Vor-dergrund: • Kulturelle Merkmale und ihre Bedeutung für die Identität von Men-
schen: Dabei werden die Beziehung zwischen kulturellen Merkmalen wie Sprache, religiösen Praktiken, Brauchtum etc. auf der einen Seite und dem Zusammenschluss größerer Gruppen von Menschen zu Ver-bänden mit gemeinsamer Identität untersucht. Kernfrage ist hierbei, inwiefern empirisch beobachtbare kulturelle Prägungen einerseits und subjektiv empfundene Zusammengehörigkeit andererseits zusammen-hängen und einander beeinflussen.
• Einfluss von Eliten: Bei der Erforschung von Gruppenidentitäten stellt sich die grundsätzliche Frage, inwiefern das jeweilige Zusammenge-hörigkeitsgefühl gleichmäßig für größere Gruppen von Bedeutung ist. In der neueren Forschung wird insbesondere auf die zentrale Rolle von Eliten bei der Bildung und Verbreitung von Identitäten verwiesen. Zentrale Frage dieses Themenkomplexes stellt daher die Durchdrin-gungstiefe von Gruppen-Identifikationen bei verschiedenen sozialen Schichten dar.
• Situativität von Identität: Ethnische bzw. nationale Gruppenidentitäten werden dabei als eine von vielen Formen verschiedenartigster Identi-täten verstanden. Die Intensität der Identifikation mit der Gruppe wird nicht als statisch verstanden, sondern als dynamischer Prozess begrif-fen, der je nach Kontext und Situation unterschiedlich ausgeprägt ist. Andere Formen von Identität, etwa religiöser, beruflich-ständischer, sozialer, geschlechtlicher, regionaler Art, werden dabei als prinzipiell gleichrangige Ausformungen von Zusammengehörigkeit stiftenden Gefühlen verstanden. Aufgabe der historischen Forschung ist es, das dynamische, kontextabhängige Zusammenwirken der verschiedenen Identitätsformen zu untersuchen.
Die jüngere Forschung hat sich insbesondere mit den Auswirkungen konkur-rierender oder alternativer Identitätsentwürfe intensiv auseinandergesetzt. Sie hat dabei teils bewusst auf eine Dekonstruktion nationaler Mythen ge-zielt. Der von der Historiografie seit dem 19. Jahrhundert gepflegten Vor-stellung von Völkern und Nationen als kulturell weitgehend einheitlichen,
Teil B: Systematischer Teil
46
geschlossenen Großgruppen wird eine Sichtweise entgegengesetzt, welche die Prozesse der Schaffung und Entstehung von Identitäten hervorhebt. Die Forschung zeigt dabei die Mechanismen auf, mit denen Identität erzeugt und durchgesetzt, wie auch die Bedingungen, unter denen Identität wirksam wird. Diese Perspektive erlaubt auch eine stärkere Berücksichtigung spezifi-scher Formen von Identitäten etwa von Minderheiten oder einzelnen Indivi-duen. Mit Blick auf das östliche Europa lassen sich folgende charakteristischen Merkmale in Bezug auf die ethnische bzw. nationale Identität festhalten: • Die beinahe flächendeckende Verbreitung von Slawen über den gan-
zen osteuropäischen Raum. Historisch oder aktuell lassen sich sla-wischsprachige Bewohner in praktisch allen Landschaften und Regio-nen Osteuropas belegen.
• Nebeneinanderbestehen zahlreicher unterschiedlicher Sprachgruppen und kultureller Traditionen auf relativ engem Raum. Das östliche Eu-ropa blieb lange Zeit ein Einwanderungs- und Ansiedlungsgebiet bzw. ein Zufluchtsraum für Glaubens- und andere Flüchtlinge. Die lange Verfasstheit in kulturell heterogenen Großreichen und die relativ späte Durchsetzung nationaler Homogenisierungsbestrebungen trugen dazu bei, kulturelle Vielfalt und teilweise vormoderne Identitätsformen in größerem Ausmaß als in den Kernregionen Westeuropas zu bewahren.
• Konflikthafte Nationsbildung. Die Bildung moderner Nationen verlief in Osteuropa häufig konfliktreich. Während sich zumindest die großen Nationalstaaten des westlichen Europa im 19. Jahrhundert im Rahmen bestehender Herrschaftsstrukturen bildeten (England, Frankreich, Spanien, teilweise skandinavische Länder) oder aus dem Zusammen-schluss kleinräumiger Herrschaftsbereiche entstanden (Deutschland, Italien), vollzog sich die Nationalstaatenbildung in Osteuropa durch die Abspaltung von Großreichen. In diesem Zusammenhang stellten sich Fragen nach der Ausdehnung und der gegenseitigen geografi-schen wie kulturellen Abgrenzung der neuen Nationalstaaten und ihrer Titularnationen. Da die Nationalstaaten Osteuropas als Neugründun-gen sich in der Regel auf keine direkte staatsrechtliche Traditionslinie berufen konnten, wurden oft chronologisch weit zurückliegende Rei-che als Vorläufer der modernen Staatlichkeit in Anspruch genommen. Nationale Eliten forderten eine Wiederherstellung vormoderner Reichsbildungen, nun allerdings als Nationalstaaten mit hegemonia-lem Anspruch der Titularnation über Gruppen anderer Identität. Die daraus erwachsenden Spannungen und Konflikte wirkten sich verstär-kend auf die Nationsbildungsprozesse im Sinne einer zunehmenden Polarisierung und Verabsolutierung nationaler Kategorien aus. Das
1. Ethnogenese und Nationsbildung
47
19. und insbesondere das 20. Jahrhundert waren geprägt von den Be-mühungen, die Fiktion ethnisch homogener Nationalstaaten durchzu-setzen.
1.2 Kollektive Identitäten und ihre Entstehung
1.2.1 Ethnizität
Das Verständnis von Ethnizität ist in der Forschung keineswegs einheitlich. Einer älteren, essentialistischen Sichtweise steht eine neuere, konstruktivisti-sche Auffassung von ethnischer Identität gegenüber. Das essentialistische (auch: primordiale) Verständnis von Ethnien macht die ethnische Zugehö-rigkeit an von außen «objektiv» beobachtbaren «Essenzen», an Merkmalen wie Sprache, Brauchtum oder genealogischer Herkunft fest. Ethnizität ist demnach ein mehr oder weniger konstanter Zustand. Gemäß dieser Perspek-tive genügt es etwa, slawischsprachig zu sein bzw. von slawischsprachigen Eltern abzustammen, um Slawe zu sein. Diese in den Nationalhistoriografien Osteuropas wie auch im Alltagsverständnis noch immer sehr populäre Sichtweise hält jedoch neueren Erkenntnissen nicht stand. Im konstruktivistischen (auch: kulturanthropologischen) Verständnis von Ethnizität gründet sich eine Ethnie daher nicht auf die tatsächliche Abstam-mung oder kulturelle Merkmale wie Sprache. Entscheidendes Kriterium für ethnische Identität ist ein zumindest minimales Gefühl der betreffenden Per-son, einem größeren Verband von Menschen anzugehören, der den Kreis der eigenen face-to-face-group übersteigt und nicht auf Verwandtschaft beruht. Aus dieser Perspektive kann jemand also slawischsprachig sein, ohne allein deswegen schon Slawe zu sein. Slawe ist nur, wer sich bewusst als Angehöri-ger des Personenverbandes der Slawen fühlt und sich entsprechend verhält. Demgemäß versteht die konstruktivistische Position Ethnizität stärker als Pro-zess, da ethnisches Bewusstsein nur in dem Maße existiert, in dem es erwor-ben und ständig aktualisiert wird: «Ethnische Identität war für [die Menschen] nicht Schicksal, sondern ihre Leistung» (Walter Pohl: Völker, S. 22). Diese Leistung bestand vor allem darin, Merkmale der Unterscheidung und Abgrenzung von anderen Gruppen zu schaffen und aufrecht zu erhalten. Ein solches Merkmal konnte Sprache sein. Zugespitzt formuliert schaffen eher ethnische Gruppen ihre Sprachen als dass umgekehrt Sprachen Ethnien kon-stituieren. Zumindest ist sprachliche Differenzierung von anderen Gruppen ein wirkungsvolles Element, um dem eigenen Verband eine Identität zu ver-schaffen. Die Unterscheidung von Völkern anhand sprachlicher Kriterien ist denn auch im vormodernen Osteuropa immer wieder anzutreffen.
Teil B: Systematischer Teil
48
1.2.2 Ethnogenese
Als Ethnogenese wird der Prozess der Bildung einer neuen Ethnie, eines «Volkes», bezeichnet. Dieser darf nicht als ein einmaliges, zeitlich be-schränktes und zielgerichtetes Ereignis verstanden werden. Es handelte sich vielmehr um komplexe, lang andauernde und kaum je geradlinig verlaufende Prozesse der Verschmelzung von Gruppen verschiedenster Abstammung zu einer neuen Gemeinschaft. Neben sprachlichen, kulturellen und religiösen spielten dabei vor allem politische Faktoren (Föderationen, Allianzen, Herr-schaftsbildungen) eine wichtige Rolle. Politische Organisation war der Kris-tallisationskern, um den sich ethnische Identitäten durch Akkulturation von Menschen verfestigen konnten. Die neuere Forschung geht davon aus, dass sich größere Verbände (Völker) herauskristallisieren, indem sich Personen unterschiedlicher Herkunft um sogenannte Traditionskerne herum gruppieren, so einen Personenverband bilden und für diesen einen eigenen Namen annehmen. Bei den Traditions-kernen handelt es sich um eine kleine Elite, welche durch die Vorstellungen über eine (fiktive oder reale) gemeinsame Abstammung respektive Schicksal eine ideologische Grundlage schuf zur Legitimation einer Herrschaft. Mit symbolischen Praktiken und kulturellen Merkmalen versuchte diese Elite Sozialprestige und damit Mittel des Zusammenhaltes und der gemeinsamen Identifikation zu schaffen. Inwiefern größere Bevölkerungsgruppen von einem derartigen Zugehörigkeitsgefühl erfasst wurden, ist aufgrund der Quellenlage oft nur schwer zu bestimmen. Entscheidend war, welche Anzie-hungskraft eine bestimmte Identität vermittelte, welche Vorteile die Zugehö-rigkeit zur entsprechenden Gruppe versprach. Eine wichtige Voraussetzung für die Konsolidierung ethnischer Identität stellten stabile Reichsbildungen dar. Sie stellten den Rahmen dar, in dem Eliten aufgrund gemeinsamer Inte-ressen kooperierten und durch den Erfolg der Herrschaftsbildung ihrer Iden-tität Attraktivität verleihen konnten. Sie entwickelten dabei ein Solidaritäts-gefühl und begannen sich von anderen Gruppen abzugrenzen. Ethnizität erfüllte so im Frühmittelalter die Aufgabe der sozialen Mobilisierung, um durch den geschaffenen Zusammenhalt politische Ziele zu erreichen. Früh-mittelalterliche Herrschaftsbildung und Ethnogenese verliefen daher oft pa-rallel. Für den langfristigen Fortbestand der so begründeten ethnischen Gemein-schaften war jedoch die Integration in die römisch-christliche Tradition ent-scheidend. Dies zeigt ein Vergleich mit den diversen reiternomadischen Ethnogenesen des osteuropäischen Raumes. Völker wie die Hunnen, Awaren (> Glossar), Chazaren, Petschenegen (> Glossar) oder Kumanen (> Glossar) waren polyethnische Verbände, die diverse Stämme unter einer gemeinsa-men Oberherrschaft an sich binden konnten. In Krisensituationen erodierte
1. Ethnogenese und Nationsbildung
49
der innere Zusammenhalt ihrer als Stammesföderationen organisierten Reichsbildungen zum Teil sehr rasch. Wenn es sich abzeichnete, dass der Herrscher nicht mehr in der Lage war, weiterhin Schutz oder Beutegelegen-heiten zu bieten, sagten sich unterworfene Stämme vom Verband los. Sehr rasch konnte dies zum Zerfall großer Reiche führen. Es kam zu einer Neu-gruppierung der Führungseliten, neuen Allianzen und damit auch neuen Loyalitäten. Gewöhnlich verschwanden damit auch die auf das Reich bezo-genen Identitäten der Führungsschichten innert kürzester Zeit. Das plötzliche Verschwinden ganzer Völker und das ebenso unvermittelte Auftauchen neu-er Völker, insbesondere in den großen Steppengebieten Osteuropas bis Ende des Mittelalters, lässt sich so vor dem Hintergrund der ständigen Neugrup-pierung der Loyalitäten der einzelnen Stämme und Sippen zu neuen Konfö-derationen verstehen, die den Namen des jeweils führenden Stammes an-nahmen. Das Verschwinden eines Namens markiert dabei eher das Aus-wechseln der namengebenden Führungsschicht, den Verlust der dominieren-den Stellung über andere Stämme als das physische Verschwinden der betreffenden Gruppe, die unter einer neuen Herrschaft weiterlebte, sich durch den Verlust des inneren Zusammenhaltes aber oft neu gruppierte und so ihrer Identität verlustig ging. Im Gegensatz dazu vermittelte die christliche Lehre und die römisch-byzantinische Tradition ein ideologisches Fundament der Kategorisierung von Menschen in verschiedene Gruppen. Die Kriterien dieser Kategorisie-rung waren nicht scharf und beruhten nur allzu oft auf fragmentarischem Wissen, Stereotypen, Missverständnissen oder politischen Erwägungen wie die Unterscheidung von Verbündeten und Gegnern. Die Kategorisierung der Menschen, die in den Gesichtskreis der antiken Ethnografie kamen, die Be-nennung von Stämmen und Völkern diente dazu, Ordnung in die unüber-sichtliche Welt der «Barbaren» zu bringen, Grundlagen für Allianzen und das gegenseitige Ausspielen verschiedener Gruppen zu legen. Politische und militärstrategische Motive bildeten eine wichtige Basis der römisch-griechischen Fremdwahrnehmung der gentes, der barbarischen Völker jen-seits der Reichsgrenzen. In nicht wenigen Fällen sind die Fremdwahrnehmungen von den Betroffenen später übernommen worden, um so gegenüber den Römern bzw. Byzanti-nern oder den eigenen Leuten Status und Prestige zu markieren. In verschie-denen Kontexten konnte es von Vorteil sein, gegenüber dem Imperium unter der Identität eines der vielen Völker- oder Stammesnamen aufzutreten, um etwa als ethnisch definierter Heeresverband in Dienst genommen zu werden oder um Erlaubnis für die Ansiedlung auf Reichsgebiet zu erhalten. Die an-tik-frühmittelalterliche Ethnografie fungierte dabei als Katalysator der Ethnogenese. Die ethnografischen Vorstellungen der Römer stellten ein ord-nendes Raster bereit, das die unüberschaubare Vielfalt durch ein stark ver-
Teil B: Systematischer Teil
50
einfachendes Ordnungsprinzip reduzierte. Die Betroffenen konnten sich darin verorten und damit eine gegenüber den Römern wohldefinierte Identi-tät annehmen. Oftmals gab es dabei die jeweiligen Völker in der Vorstellung der römischen Ethnografen, bevor eine Gruppe mit einer entsprechenden Identität existierte. Die Einteilung der Menschen in unterschiedliche Völker fand dabei Rückhalt im Christentum. Aufgrund biblischer Vorbilder konnte auch eine heilsge-schichtlich legitimierte Begründung für die Existenz klar voneinander zu unterscheidender Großverbände hergeleitet werden. Insbesondere der Bezug auf die drei Söhne Noahs als Stammväter der verschiedenen Völker ist dabei von Bedeutung. So wird Japhet in der «Erzählung von den vergangenen Jah-ren» (Nestorchronik > Glossar) als Stammvater der nördlichen Völker und damit auch der Slawen explizit angesprochen. Auch die Erzählung vom Turmbau zu Babel und der Verwirrung der Sprachen bildet eine biblisch begründete Erklärung für die Existenz unterschiedlicher Völker. Christiani-sierung, Herrschaftsbildung und Ethnogenese sind daher in einem komple-xen Wechselspiel aufs Engste miteinander verbunden. Vor diesem Hintergrund wird klar, dass ethnische Gruppen entgegen ihrer Selbstwahrnehmung keine kontinuierlich existierenden Gebilde darstellen, sondern unter bestimmten Bedingungen entstanden sind. Die besonders in den Nationalhistoriografien Osteuropas immer noch anzutreffenden Ansich-ten einer geradlinigen, kontinuierlichen Entwicklung aus einer Urbevölke-rung mit bestimmten grundlegenden Gemeinsamkeiten wie Sprache oder Blutsverwandtschaft sind demnach konstruierte Vorstellungen. Ethnien sind dabei weniger Abstammungs- als vielmehr Schicksalsverbände. Gemeinsa-me kulturelle Merkmale sind weniger eine Ursache für die Bildung von Ethnien als vielmehr die Folge einer erfolgreichen Ethnogenese, das Ergeb-nis eines Akkulturationsprozesses. Die Vorstellung einer linearen Entwicklung von ethnischen Gruppen aus sich immer weiter aufspaltenden «Urvölkern» (wie den sogenannten Ursla-wen oder den Germanen) geht auf die im 18. Jahrhundert aufkommende vergleichende Linguistik zurück. Die dort festgestellten Verwandtschaftsbe-ziehungen zwischen den Sprachen wurden auf ethnische Gruppen übertra-gen. Die im 20. Jahrhundert zur Leitdisziplin der Ethnogeneseforschung aufsteigende Archäologie hat im Wesentlichen auf diesen Vorannahmen aufgebaut und mit der Idee der «materiellen Kultur» ergänzt. Übereinstim-mende kulturelle Merkmale bei Fundgegenständen wie Verzierungsmuster, Fertigungstechnik oder Begräbnissitten wurden zu Clustern zusammenge-fasst. Die solcherart bestimmten Kulturen wurden als ethnische Gruppen interpretiert. Im Zuge der Rückprojektion aktueller nationalpolitischer For-derungen bemühten sich die Nationalstaaten zudem, auf ihrem Territorium
1. Ethnogenese und Nationsbildung
51
Spuren von vermeintlichen Vorfahren der jeweiligen Staatsnation zu bele-gen. In der neueren Forschung beginnt sich jedoch die Vorstellung immer mehr durchzusetzen, wonach weder Sprachgruppen noch durch archäologi-sche Funde rekonstruierte Kulturen ethnischen Gruppen entsprochen haben. Wichtig ist es daher, zwischen Sprachgemeinschaften und ethnischen Grup-pen klar zu unterscheiden. Erst ein Ethnogenese-Prozess machte aus Perso-nen slawischer Sprache Slawen im ethnischen Sinne. Wenn im Folgenden doch gelegentlich stärker auf die Herkunft von Sprachgruppen und weniger auf die Bildung von Identitäten eingegangen wird, ist dies auf die Dominanz dieser Thematik in der einschlägigen Forschung zurückzuführen. Gerade im osteuropäischen Bereich hat sie sich in vielen Fällen dem Problem der Bil-dung von ethnischer Identität noch kaum zugewandt und reduziert nur zu oft die Frage der Ethnogenese auf die Herkunft und Entstehung von Sprachen.
1.3 Vertiefender Exkurs: Die Entstehung ethnischer Gruppen in Osteuropa
1.3.1 Die Slawen
Die Frage nach der Herkunft der Slawen war lange Zeit von der vielfach leidenschaftlich diskutierten Frage nach deren «Urheimat» bestimmt. Analog zur linguistisch rekonstruierten urslawischen Sprache (die in der Linguistik für die Zeit vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis etwa gegen Ende des 1. Jahrtausends n. Chr. datiert wird) wurde als Urahn aller slawischen Völker ein «urslawisches Volk» postuliert. Dessen ursprüngliches Siedlungsgebiet wurde je nach nationalpolitischer Interessenlage unterschiedlich lokalisiert. Dabei wurden sowohl in Bezug auf Größe und Ausdehnung, Kompaktheit der Siedlung wie auch auf die genaue Lage abweichende Hypothesen vorge-bracht. Die meisten neueren Ansätze verorten die Urheimat irgendwo zwi-schen den Pripjat-Sümpfen im Norden und den Karpaten im Süden und Südwesten, also nach den heutigen Staatsgrenzen im Süden Weißrusslands, der Westukraine und im Südosten Polens. Als maximale Ausdehnung der slawischen Urheimat werden oft der Oberlauf des Bug bzw. der Weichsel im Westen und der Mittellauf des Dnjepr im Osten angeführt. Vereinzelt wird auch von einer bedeutend weiter nach Westen, bis zur Oder, bzw. weiter nach Osten, bis an den Don, reichenden Lage der slawischen Urheimat aus-gegangen. In jüngerer Zeit hat sich jedoch die Einsicht durchgesetzt, dass die Suche der Urheimat der Slawen obsolet ist, da sie von einer anachronistischen Prämisse ausgeht. Diese besteht darin, dass von einem einheitlichen Großverband ausgegangen wird, der sich von der Urheimat aus in alle Himmelsrichtungen
Teil B: Systematischer Teil
52
verteilt und so in verschiedene Teilgruppen aufgespalten hat. Die Erkennt-nisse der Ethnogeneseforschung weisen jedoch immer deutlicher darauf hin, dass sich slawische Ethnogenesen an unterschiedlichen Orten vollzogen haben und vor diesem Zeitpunkt nicht von einer wie auch immer gearteten Großgruppe ausgegangen werden kann. Die Suche nach der Urheimat ist daher müßig, da im Zuge der Bildung slawischer Ethnien seit etwa dem 6. Jahrhundert n. Chr. Personen unterschiedlicher Herkunft zu Slawen wur-den. Dabei vollzogen sich die slawischen Ethnogenesen anders als im Falle der germanischen oder reiternomadischen Völker nicht im Rahmen einer eigenen Herrschaftsformation. Es war vielmehr ein Charakteristikum der slawischen Siedlungsgemeinschaften, in nur lokal organisierten Gruppen zu leben. Diese sich von der Lebensweise der Römer wie auch der reichsbil-denden gentes scharf abhebende Lebensweise wurde konstitutiv für die frü-hen Slawen. Frühslawische Identität machte sich also weniger an der noch im späten 1. Jahrtausend n. Chr. erstaunlich einheitlichen sprachlichen Situa-tion der verschiedenen slawischen Gruppen fest als vielmehr in der Lebens-form. Jede Person nichtslawischer Herkunft konnte durch deren Annahme relativ leicht zum Slawen werden: «Es setzte sich durch, Slawe zu sein» (Walter Pohl: Die Awaren, S. 95). Diese neue Sichtweise auf die Frage der Herkunft der Slawen geht einher mit einer Kritik an dem die Forschung lange Zeit dominierenden «Migrati-onsparadigma». Dieses brachte die weite räumliche Verbreitung der Slawen seit dem 6. Jahrhundert mit wie auch immer gearteten Wanderungsbewe-gungen in Verbindung. Der in Bezug auf germanische Verbände der Über-gangszeit zwischen Antike und Frühmittelalter populär gewordene Ausdruck «Völkerwanderung» ist hier jedoch genauso problematisch wie in anderen Kontexten. Als wichtigste Kritikpunkte an der Vorstellung von «wandernden Völkern» wird angeführt, dass sich die Mobilität über größere Distanzen hinweg in der Regel auf einen relativ kleinen Elitenverband beschränkte. Wanderungen geschlossener Großgruppen (Völker) über weite Distanzen wären schon allein aus logistischen Gründen, etwa zur Versorgung mit Nah-rungsmitteln, kaum möglich gewesen. Eine zahlenmäßig kleine Kerngruppe, etwa ein Heeresverband, konnte sich aber als Identitätsträger über weite Strecken fortbewegen und an einem neuen Ort eine Ethnogenese anstoßen. Neben solchen spektakulären Wanderungen, die naturgemäß mehr Nieder-schlag in den Quellen gefunden haben, ist jedoch von einem nicht unbedeu-tenden Bevölkerungsanteil auszugehen, der bestenfalls in viel kleinräumige-rem Radius mobil war. Anstatt von Völkerwanderung könnte daher ange-messener von einer Überschichtung sesshafter oder in kleinem Umkreis no-madisierender Bevölkerungen durch vergleichsweise kleine, mobile Perso-nenverbände gesprochen werden. Dass die Impulse zur Ethnogenese häufig von solchen mobilen Eliten ausgegangen sind, liegt in deren Bedürfnis be-
1. Ethnogenese und Nationsbildung
53
gründet, einen festen Zusammenhalt zu schaffen. Die militärischen und lo-gistischen Anforderungen von Wanderungs-, Kriegs- oder Plünderzügen konnten durch klare Abgrenzung nach außen und Integration nach innen besser gemeistert werden. Auch hinsichtlich der diversen slawischen Ethnogenesen ist der Bezug auf Wanderungsbewegungen allein keinesfalls ausreichend, um die langfristig erfolgreiche großräumige Verteilung der Slawen zu erklären. Zwar ist die Forschung aufgrund des weitgehenden Fehlens von Quellen, welche slawi-sche Wanderungsbewegungen dokumentieren würden, von anderen Formen der Migration ausgegangen als im Falle der Germanen. Die Ausbreitung der Slawen wurde als Infiltration oder Einsickern beschrieben, als ein weitge-hend unspektakulärer, über längere Zeit andauernder, in Kleinverbänden vonstatten gehender Prozess. Wohl haben sich slawische Gruppen ähnlich wie später bei den Awaren vereinzelt auch Wanderungen anderer Stammes-verbände wie den Goten oder den Hunnen angeschlossen und traten daher nicht gesondert in Erscheinung. Doch ist inzwischen klar, dass Migration lediglich einen unter vielen Aspekten darstellt, der dazu beigetragen hat, dass die Slawen zur zahlenmäßig dominierenden Gruppe in weiten Teilen des östlichen Europa wurden. Bei diesem Prozess waren diverse weitere Faktoren von Bedeutung: • Bei der relativ dünnen Besiedlung vieler Gebiete Osteuropas konnte
auch eine vergleichsweise kleine Zahl von Neuansiedlern eine bedeu-tende Stellung erlangen. Auf der Balkanhalbinsel kam es durch An-siedler zu Beginn des Frühmittelalters zur Ablösung der weitgehend verwüsteten antik-römischen, vom Städtewesen wesentlich mitgepräg-ten Kulturlandschaft durch die gänzlich anders geartete Kultur der Neuankömmlinge. Dank ihrer bäuerlichen Lebensweise waren die Slawen gut geeignet, die verheerten Landstriche der Balkanhalbinsel zu besiedeln. Auch in Ostmitteleuropa besiedelten Slawen vielerorts weitgehend menschenleere Gebiete. So kann eine Siedlungskontinuität westlich der Oder seit der Spätantike bis zum Eintreffen von Slawen weitgehend ausgeschlossen werden. Auch in späteren Jahrhunderten kam es immer wieder zur Ausbreitung von Slawen durch Ansiedlung in von Kriegen verheerten Landstrichen. So geht etwa die serbische Besiedlung der späteren Vojvodina nördlich der Donau entlang dem Unterlauf der Theiß im Wesentlichen auf Ansiedlung serbischer Flüchtlinge aus dem Osmanischen Reich an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert zurück. Die Steppenzonen nördlich des Schwarzen Meeres und an der unteren Wolga (südliche Ukraine und Südrussland) wurden durch umfangreiche Fluchtbewegungen leibeigener (> Glossar Leibeigenschaft) Bauern aus den Kerngebieten des Moskauer Reiches beginnend mit dem 16. Jahrhundert und seit dem Ende des 18. Jahr-
Teil B: Systematischer Teil
54
hunderts durch zentral gesteuerte Kolonisation von Ostslawen besie-delt, ähnlich wie auch Teile Sibiriens.
• Die geografische Weite der großen Landmasse im Osten Europas er-leichterte im Zusammenhang mit der geringen herrschaftlichen Durchdringung die Ausbreitung slawischer Identität. In den mit Aus-nahme Südosteuropas keiner Zentralherrschaft unterworfenen Gebie-ten Osteuropas dürften die slawischen Einwanderer üblicherweise auf wenig organisierten Widerstand gestoßen sein. Für die Entstehung und Behauptung einer eigenen Identität blieb daher genug Raum.
• Slawen siedelten verstreut in Kleinverbänden ohne straffe Hierarchie. Es gab daher kein Herrschaftszentrum, das von Angreifern hätte ge-schwächt werden können. Dank der dezentralen Verfassung der Sla-wen in Kleingruppen war die Identität anders als bei reichsbildenden Verbänden wie den Hunnen, Awaren oder den wohl überwiegend turksprachigen Bulgaren (> Glossar) nicht an einen Herrschaftsver-band gebunden, mit dessen Untergang auch ein Abbrechen der jewei-ligen Identitätstradition drohte. In den unruhigen Zeiten des Frühmit-telalters erwies sich die slawische Lebensweise als viel anpassungsfä-higer: «Der Verzicht auf bleibende militärische Konzentration, auf überregionale Herrschaft, das Verharren in lokalen Ackerbaugemein-schaften machte das slawische Modell ebenso verwundbar wie erfolg-reich» (Walter Pohl: Die Awaren, S. 329).
• Slawische Identität ergab sich aus dem Lebensmodell freier Bauern, das sich von demjenigen der Reiternomaden wie den in antiker Staat-lichkeit verfassten Römern grundsätzlich unterschied. Das Fehlen ei-ner ausgeprägten Sozialhierarchie machte ein Leben als Slawe vor al-lem für die zahlenmäßig bedeutenden Unterschichtenangehörigen nichtslawischer Herkunft attraktiv. Die Annahme slawischer Lebens-gewohnheiten konnte dabei mit der Annahme einer slawischen Identi-tät einhergehen. «Slawe» zu sein hatte damit anfänglich eine stark so-ziale Komponente, in Abgrenzung von den hierarchisch strukturierten umgebenden Gesellschaften. Auch für übergeordnete Herrschaftsver-bände war eine landwirtschaftliche Bevölkerung prinzipiell als öko-nomische Grundlage der Herrschaft willkommen.
• Eine Anpassung an slawische Lebensgewohnheiten ist auch innerhalb der von Steppennomaden begründeten Reiche festzustellen. Im Reich der Awaren manifestierte sich dies im 7. Jahrhundert vor allem an den Peripherien des awarischen Herrschaftsbereiches, wo kurzfristig erst-malig in schriftlichen Quellen fassbare slawisch geprägte Herrschafts-bildungen existierten. Auch im Reichszentrum kam es zu einer all-mählichen Slawisierung der Lebensgewohnheiten, doch blieb auf poli-
1. Ethnogenese und Nationsbildung
55
tischer Ebene die Steppentradition bestimmend. In dem von einem Bulgarenverband Ende des 7. Jahrhunderts südlich der unteren Donau errichteten Reich erfolgte in den folgenden Jahrhunderten eine weit-gehende sprachliche Slawisierung der turksprachigen (> Glossar) Eli-te. Dies im Unterschied zu den Magyaren (Ungarn), die nach ihrer Landnahme Ende des 9. Jahrhunderts in der pannonischen Tiefebene die relativ dünne slawische Bevölkerung kulturell assimilierten.
• Der slawischen Sprache kam möglicherweise die Funktion einer lin-gua franca im Einzugsbereich der awarischen Herrschaft und darüber hinaus zu. Das vom 6. bis zu Beginn des 9. Jahrhunderts mit Zentrum in der pannonischen Tiefebene existierende Großreich der Awaren umfasste weite Teile Ostmitteleuropas. Die Verbreitung slawischer Sprache könnte dadurch gefördert worden sein.
• Eine quellenmäßig kaum mehr zu rekonstruierende, sondern nur zu vermutende Vermischung über Heiraten zwischen Angehörigen der slawischen Neuansiedler und Ansässigen kann genauso wie eine höhe-re Fruchtbarkeitsrate slawischen Gruppen ebenfalls in nicht unerhebli-chem Maße dazu beigetragen haben, innerhalb von ein bis zwei Gene-rationen die Identität der Neuankömmlinge weit über ihre anfängliche anteilsmäßige Bedeutung hinaus zu verbreiten.
• In vielen Regionen waren slawische Siedlungen auf bestimmte Zonen konzentriert, die für ihre landwirtschaftliche Lebensweise besonders geeignet waren. Häufig in Tälern, entlang von Flussläufen oder in Sumpfgebieten gelegen, siedelten dazwischen teils noch lange kom-pakte Gruppen von Nichtslawen. Teils kam es aber zu einer allmähli-chen Verdrängung nichtslawischer Bevölkerungsgruppen in Reliktge-biete (Gebirge, Inseln, periphere Regionen). Beispiele hierfür wären etwa die romanisierten Bewohner der dalmatinischen Küste, die vor-romanischen und romanisierten Bewohner der Balkanhalbinsel, be-sonders Albaner und Vlachen (> Glossar), Griechen auf den Inseln der Ägäis oder diverse baltische, finno-ugrische (> Glossar) und andere Bevölkerungsgruppen im Zentrum und Norden des heutigen Russland. Die Slawisierung erfasste also nicht flächendeckend das gesamte Ter-ritorium der maximalen slawischen Ausdehnung, sondern oft vorerst nur bestimmte Kernbereiche. Diese waren Ausgangspunkte für die weitere Slawisierung der umliegenden Regionen.
• Slawische Ansiedler haben sich besonders auf der Balkanhalbinsel schon früh dem vorgefundenen Umfeld angepasst und Elemente der römisch-byzantinischen Kultur übernommen. Mit dieser Anpassung verkleinerte sich die Differenz zwischen Neuansiedlern und Ansässi-
Teil B: Systematischer Teil
56
gen und damit auch die Hürde für eine Akkulturation zwischen den verschiedenen Gruppen.
• Die Slawisierung war ein langwieriger Prozess, der auch lange nach Ansiedlung der Slawen nicht abgeschlossen war. In manchen Regio-nen Osteuropas, beispielsweise in der Slowakei, hält er praktisch bis in die Gegenwart an. Die von den Nationalstaaten dieses Raumes ge-prägte Sichtweise ethnisch weitgehend homogener Regionen, in denen die Staatsnation schon seit Jahrhunderten wenn nicht die einzige, so doch die deutlich dominierende Gruppe dargestellt hätte, ist in vielen Fällen ein Mythos. Hingegen ist das Zusammenleben verschiedener ethnischer Gruppen auf kleinem Raum ein Charakteristikum Osteuro-pas, das erst in jüngster Zeit abgeschwächt worden ist. Insbesondere im 20. Jahrhundert kam es zu forcierten Vereinheitlichungsmaßnah-men, die manchmal bis zu massenhaften Umsiedlungen oder gar Ver-treibungen reichten, sich häufig jedoch in mehr oder weniger subtilem staatlichem Druck (zum Beispiel über das Schulwesen) manifestierten. Dennoch verfügen auch heute einige von einer modernen slawisch-sprachigen Nation getragene Staaten über substanzielle nichtslawische Minderheiten (so Russland, die Slowakei oder Makedonien).
Die Bezeichnung «Slawe» taucht in griechischer Form als Sklavinoi, Sklavoi etc. ab der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts auf. Ob es sich dabei um eine Selbstbezeichnung gehandelt hat, ist immer noch umstritten, wenn auch nicht unwahrscheinlich. Die etymologische Herkunft des Namens bleibt jedoch ungeklärt. Die häufig angeführte Deutung der slawischen Eigenbe-zeichnung «slověne» im Sinne von «des Wortes mächtig» (von slovo = Wort) ist wohl eher in einer später entstandenen volksetymologischen Inter-pretation des Namens als wahrscheinlich zu erachten. Verschiedentlich wird der Name der Slawen auf einen Flussnamen zurückgeführt. Doch hat die Frage letztlich immer noch als ungelöst zu gelten. Die Einteilung der Slawen in Ost-, West- und Südslawen beruht nicht auf entsprechenden Selbstwahr-nehmungen von Gruppen, sondern auf einer Kategorisierung der slawischen Sprachen nach linguistischen Kriterien. Im ethnischen Sinne sind diese Be-griffe daher nicht von Bedeutung, sondern werden höchstens als zusammen-fassende Bezeichnung für diejenigen slawischen Völker mit einer Reihe übereinstimmender sprachlicher Merkmale verwendet. Neben den in Natio-nalstaaten verfassten Slawen existieren jedoch diverse weitere slawischspra-chige Gruppen, die über eine spezifische Gruppenidentität verfügen und sich keiner dieser modernen Nation zurechnen wie etwa die westslawischen Ka-schuben an der polnischen Ostseeküste oder die Sorben in der Lausitz, die südslawischen Pomaken (> Glossar) im Südwesten Bulgariens und im thra-kischen Teil Griechenlands, die makedonischsprachigen Slawen Nordgrie-chenlands oder die Goranen in Kosovo, ähnlich wie die kleine Gruppe der
1. Ethnogenese und Nationsbildung
57
ostslawischen Russinen (die einst ungarländischen Ruthenen > Glossar) in der Karpatoukraine und den umliegenden Staaten (Rumänien, Ungarn, Slo-wakei, Polen). Slawen treten erstmals an der unteren Donau ins Gesichtfeld der Byzantiner, wo slawische Verbände Raubzüge auf Reichsgebiet unternahmen. Gemäß einer neueren, in dieser Form sicher zu stark zugespitzten These handelt es sich bei den Slawen gar um eine byzantinische Erfindung (Florin Curta). Der Slawenname wäre demnach ein von den Byzantinern verwendeter, wenn auch wahrscheinlich von einer Selbstbezeichnung hergeleiteter Oberbegriff für verschiedenste nördlich der Donau siedelnde Gruppen gewesen. Sein Zweck hätte in der politisch und militärstrategisch motivierten Unterschei-dung von Feinden und eigenen Verbündeten gelegen. Bei den an der Donau-grenze des Reiches siedelnden Gruppen fand zugleich ein Prozess der Identi-tätsbildung statt. Die Konfrontation mit dem starken Gegner Byzanz und die Versuche, auf Raubzügen dessen Befestigungsanlagen zu überwinden, erfor-derten eine Mobilisierung und einen festen Zusammenhalt. Auf dieser Grundlage konnte ein Prozess der Bildung einer eigenen Identität beginnen. Doch war diese Identität anscheinend nicht gesamtslawisch, sondern auf eine kleine Gruppe bezogen. Der Slawenname taucht auch nach dem 6. Jahrhun-dert noch lange nur als Fremdbezeichnung auf. Erst in der zu Beginn des 12. Jahrhunderts in Kiev entstandenen sogenannten Nestorchronik findet sich ein expliziter Beleg für ein Bewusstsein einer gemeinsamen slawischen Herkunft. Die Betrachtung der Slawen als einheitliche Großgruppe wäre demnach ein langfristig äußerst wirkmächtiges Stereotyp der Byzantiner, eine von außen kreierte vereinfachte Ordnungsvorstellung wesentlich kom-plexerer Verhältnisse – vergleichbar den Vorstellungen antiker Autoren wie Cäsar oder Tacitus über die Germanen und Gallier. In den Quellen tauchten slawische Gruppen im Frühmittelalter nämlich unter zahlreichen Stammes-namen auf: so die Severjanen, Drevljanen, Krivičen oder Poljanen im Be-reich des späteren Kiever Reiches, die Polanen, Pomoranen, Wilzen oder Wislanen in Ostmitteleuropa sowie die Drugoviten, Karantanier oder Ti-močanen in Südosteuropa, wo jedoch aus den Quellen nicht immer klar her-vorgeht, ob es sich um Stammesnamen oder administrativ-geografische Be-zeichnungen handelte. Die Eigenbezeichnung als «Slawen» hat sich vor al-lem an der Peripherie ihres Verbreitungsgebietes durchgesetzt, wo diese in Kontakt mit anderen Gruppen standen. Dies war etwa der Fall bei den Slo-wenen, den Slovinzen, einer westslawischen Gruppe in Hinterpommern, oder den Slovenen im Nordwesten der Rus’ in der Gegend von Novgorod. Neben der Bezeichnung als Slawen tauchen in den Quellen einige andere Namen auf, die mit slawischer Bevölkerung in Verbindung stehen. «Anten», ein gegen Ende der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts erwähnter Name, bezog sich auf eine nördlich des Schwarzen Meeres siedelnde, anscheinend über-
Teil B: Systematischer Teil
58
wiegend slawische Gruppe. Bei den seit der Mitte des 6. bis zum Beginn des 7. Jahrhunderts in den Quellen erwähnten Anten handelte es sich womöglich um eine von Slawen geformte Ethnogenese, wahrscheinlich unter Einfluss oder Beteiligung nichtslawischer Steppennomaden iranisch-sarmatischer Herkunft. Eine dritte Bezeichnung, die sich auf die Slawen bezog, war «Wenden» (Venedi, Windische etc.). Als Fremdbezeichnung hatte er sich in der Antike auf die südlich der Ostsee siedelnden, nichtslawischen Veneter bezogen, wurde jetzt aber auf die Slawen übertragen. Nach ihrem Erscheinen an der unteren Donau werden Slawen in rascher Folge in verschiedenen Regionen Osteuropas fassbar. Jedoch ist eine genaue Datierung der slawischen Einwanderung in den meisten Fällen kaum mög-lich. Auf der Balkanhalbinsel und damit auf dem Territorium des Byzantini-schen Reiches ließen sich als Slawen identifizierte Gruppen wohl ab der zweiten Hälfte des 6., vielleicht auch erst im frühen 7. Jahrhundert nieder. In den Jahrzehnten zuvor waren immer wieder slawische Verbände meist im Verbund mit Gruppen nichtslawischer Herkunft wie den Awaren auf Kriegs- und Plünderzügen auf Reichsgebiet vorgedrungen, hatten sich aber jeweils wieder über die Donau zurückgezogen. Eine präzise zeitliche Eingrenzung der slawischen Ansiedlung auf byzantinischem Gebiet ist jedoch auch daher kaum möglich, da die Grenzen des Reiches durchlässig waren und schon wesentlich früher mit der Ansiedlung oder Indienstnahme vereinzelter «sla-wischer» Kleingruppen zu rechnen ist. Im 7. Jahrhundert jedenfalls siedelten Slawen in größerer Zahl in ganz Südosteuropa bis zur Peloponnes im Süden. In dieses Jahrhundert fällt allem Anschein nach auch die Einwanderung der Kroaten und Serben in Teile ihrer späteren Siedlungsgebiete bis zur Adria. Auch nach der Ansiedlung kommt es lange nicht zur Bildung organisierter slawischer Großverbände. Die verschiedenen Gruppen lebten in lokal be-grenzten Gemeinschaften, wobei teilweise geografisch bestimmte Namen solcher Gruppen quellenmäßig in Erscheinung treten. Ab dem späten 8. Jahrhundert taucht in den Quellen der Begriff der Sklavinien (Sklaviniai) auf, der sich auf slawische Herrschaftsbezirke oder überwiegend slawisch besiedelte Landschaften vor allem innerhalb des Byzantinischen Reiches bezog. Größere und über ein gewisses Maß an Eigenständigkeit verfügende slawische Herrschaftsbildungen kristallisierten sich auf der Balkanhalbinsel jedoch erst nach der Jahrtausendwende heraus. Eine Ausnahme stellt in ge-wisser Hinsicht das Erste Bulgarische Reich (ca. 681–971/1018) dar. Dabei handelte es sich um eine Reichsgründung durch einen von turkstämmigen Gruppen dominierten Stammesverband, der den Namen Bulgaren trug. In der Forschung wurden diese nichtslawischen Bulgaren zur Unterscheidung von den späteren slawischen Bulgaren auch als «Protobulgaren» (> Glossar Bulgaren) bezeichnet. Der älteren Darstellung, die von einer relativ klar da-tierbaren Landnahme der Bulgaren zwischen unterer Donau und Haemus
1. Ethnogenese und Nationsbildung
59
ausgeht, liegt vermutlich eine zu stark vereinfachte Sichtweise zugrunde. Wahrscheinlich kamen bulgarische und andere Gruppen schon wesentlich vor der traditionellerweise um 681 datierten Reichsbildung in mehreren Wel-len in das Gebiet der unteren Donau. Auch werden schon intensive Kultur-kontakte zwischen Slawen und Bulgaren bestanden haben. Die in der histori-schen Überlieferung ereignishaft auf das Jahr 681 reduzierte Herrschaftsbil-dung war ein längerer Prozess. Bis Ende des 7. Jahrhunderts entstand jedoch ein anfänglich wohl bulgarisch dominierter gemischter bulgarisch-slawischer Herrschaftsverband. Die Unterscheidung zwischen den zahlenmäßig domi-nierenden Slawen und den Bulgaren verlor mit der Zeit an Bedeutung – wann dies geschah, lässt sich nicht mehr genau feststellen. Bis ins 10. Jahr-hundert scheint sich die slawische Sprache weitgehend durchgesetzt haben. Die Identität als «Bulgaren» war auf die aus der bulgarisch-slawischen Sym-biose entstandene slawischsprachige Gruppe übergegangen. Nur zum Teil vergleichbar verlief die Ethnogenese der Kroaten. Auch hier ist von einer nicht näher spezifizierten slawischen Einwanderung im Hinter-land der Adriaostküste ab dem 6. Jahrhundert auszugehen. Diese Slawen wurden später, im 7. oder 8. Jahrhundert von einer anderen, als «Kroaten» bezeichneten Gruppe überschichtet. Dabei handelte es sich um einen eventu-ell schon vollständig oder weitgehend slawisierten Stammesverband oder eine soziale Gruppe, an der zumindest ursprünglich iranische und eventuell turkische Elemente einen wesentlichen Anteil gehabt hatten. Die spätere Hervorhebung der «iranischen Herkunft» von kroatisch-nationalistischer Seite beruht auf einem unzureichenden Verständnis frühmittelalterlicher Ethnizität. So war der iranische Anteil nur einer unter vielen Bestandteilen des frühen kroatischen Verbandes und zudem bei der Einwanderung wohl kulturell schon weitgehend im Slawentum aufgegangen. Polyethnische Gruppen waren als Ausgangspunkt einer Ethnogenese nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Der erst im 9. Jahrhundert belegte Name der Kroaten wurde zur Bezeichnung des von ihnen begründeten Herrschaftsverbandes. Doch zeigt sich, dass die Bezeichnung Kroate in der Vormoderne eine recht enge Bedeutung hatte und sich nur auf Teile der heutigen kroatischen Gebie-te bezog. Zudem hatte der Name auch eine soziale Konnotation, indem nur die Elite bzw. führende Adelsfamilien die Bezeichnung Kroaten führten, während die einfache Bevölkerung schlicht «Slawen» genannt wurde. Die Bezeichnung Kroate blieb damit bestenfalls eine unter verschiedenen Kate-gorien, mit denen sich Personen identifizierten, die erst rückblickend in einer von modernen nationalen Kategorien geleiteten Perspektive als ethnische Kroaten verstanden werden. Divergierende Identitäten wie das seit der Frü-hen Neuzeit aufkommende Konzept der Illyrer (das oft die Südslawen insge-samt umfasste) waren nicht weniger weit verbreitet. Die Durchsetzung einer allgemein als «kroatisch» akzeptierten Identität setzte hingegen erst im
Teil B: Systematischer Teil
60
19. Jahrhundert ein. In ähnlicher Weise vollzog sich weiter südlich die Ethnogenese der Serben durch die Überschichtung der bereits ansässigen Slawen durch einen neu zugewanderten Stammesverband, was die ethnische Trennung der dieselbe südslawische Sprache sprechenden Kroaten und Ser-ben einleitete. Größere und über ein gewisses Maß an Eigenständigkeit verfügende slawi-sche Herrschaftsbildungen kristallisierten sich auf der Balkanhalbinsel, mit Ausnahme des von den turkstämmigen Bulgaren errichteten Reiches zwi-schen unterer Donau und Haemus (Balkangebirge), jedoch erst nach der Jahrtausendwende heraus. Im 11. und 12. Jahrhundert bildeten sich Herr-schaftszentren in Duklja (Zeta, späteres Montenegro) und in Raška (beim heutigen Novi Pazar). Letzteres bildete den Kern des mittelalterlichen serbi-schen Reiches, das in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts den Höhepunkt seiner Machtenfaltung erlebte. Im Hinterland der Adriaostküste entstanden weitere slawische Herrschaftsbildungen, so Travunien (Trebinije) nördlich der Bucht von Kotor und Zahumlje (Hum) nördlich daran anschließend bis zur Neretva. Diese beiden im 10. Jahrhundert erwähnten Fürstentümer gerie-ten später in Abhängigkeit des serbischen Reiches der Nemanjiden und wur-den danach Teil Bosniens. In Ostmitteleuropa setzte die Präsenz slawischer Gruppen ebenfalls im 6. Jahrhundert ein, wobei die geografische und chronologische Rekonstruk-tion der Ausbreitung nicht weniger schwierig zu bestimmen ist als im Falle Südosteuropas. Entlang der nördlichen Karpaten verbreiteten sich die Sla-wen bis an die Ostsee. Schon relativ früh, eventuell vor der Mitte des 6. Jahrhunderts, kann auf dem Gebiet der heutigen Slowakei von der Ankunft vereinzelter slawischer Verbände ausgegangen werden. Nicht viel später dürften Slawen sich im Raum des heutigen Tschechien niedergelassen ha-ben. Im Ostalpenraum ist für das späte 6. Jahrhundert mit der Ankunft slawi-scher Verbände zu rechnen. Für das Gebiet des heutigen Polen (besonders der Norden und der Westen) gehen die Meinungen nach dem frühesten Zeit-punkt slawischer Präsenz auseinander, je nachdem, ob in dieser Region die slawische Urheimat gesehen wird oder, wahrscheinlicher, von einer Einwan-derung ab dem 7., eventuell schon dem späten 6. Jahrhundert ausgegangen wird. Im 7., spätestens im frühen 8. Jahrhundert dürften Slawen im Westen bereits bis an die Elbe gesiedelt haben. Einen wesentlichen Faktor bei der Ausbreitung slawischer Gruppen über Ostmittel- und Südosteuropa stellte das von der zweiten Hälfte des 6. bis ins frühe 9. Jahrhundert existierende Großreich der Awaren dar. Dieses vom polyethnischen, steppennomadischen Stammesverband der Awaren begrün-dete Reich hatte sein Zentrum in der pannonischen Tiefebene (ungefähr dem heutigen Ungarn entsprechend). Der Einzugsbereich der awarischen Herr-
1. Ethnogenese und Nationsbildung
61
schaft umfasste den größten Teil Ostmitteleuropas. Awarische Kriegszüge reichten bis tief in die Balkanhalbinsel; im Jahr 626 kam es zusammen mit den Persern sogar zur erfolglosen Belagerung Konstantinopels, des byzanti-nischen Reichszentrums. Die slawischen Gruppen waren von der awarischen Reichsbildung in wesentlichem Ausmaß betroffen. Das neuerliche Vordrin-gen von Reiternomaden aus den eurasischen Steppen veranlasste umfangrei-che Ausweich- und Fluchtbewegungen. Der Ausbreitungsprozess slawischer Verbände, der allenfalls schon zuvor begonnen hatte, kam nun richtig in Gang. Andererseits waren es in nicht unbeträchtlichem Ausmaß slawische Verbän-de, die im Bündnis mit den Awaren bzw. als deren Hilfstruppen an Kriegs-zügen auf den Balkan beteiligt waren. Auch das slawische Vordringen nach Westen, in den Ostalpenraum und ins spätere Böhmen, ist im Kontext der awarischen Herrschaftsbildung zu sehen. Slawen erfüllten hier wohl weniger die Rolle von awarischen Außenposten zur Absicherung des Reichszent-rums. Vielmehr war es im Interesse der awarischen Eliten, unter dem Schutz ihrer Militärmacht eine bäuerliche Grundbevölkerung als Stütze der eigenen Herrschaft anzusiedeln. Denn die awarische Lebensweise als Steppenkrieger auf der Grundlage von Beuteerwerb oder Tributzahlungen und die bäuerliche slawische Lebensweise waren in gewisser Hinsicht aufeinander angewiesen. Die Expeditionen der organisierten awarischen Kriegsmacht auf den byzan-tinischen Balkan ebneten slawischen Gruppen den Weg zur Ansiedlung auf Reichsgebiet. Andererseits schufen ansässige, Landwirtschaft betreibende Slawen eine Grundlage zur Konsolidierung der awarischen Vormachtstel-lung. Deren auf einer Beuteökonomie basierende Lebensweise war auf eine Ergänzung der Versorgungsgrundlage angewiesen. Bei der Frage nach der Identität von «Slawen» oder «Awaren» spielte auch hier die Lebensweise eine wichtigere Rolle als die Herkunft oder Sprache – wer als Steppenkrieger lebte, Teil der Reichselite war, galt als Aware, wohingegen als Slawe identi-fiziert wurde, wer Ackerbau betrieb. Awaren und Slawen lebten so in enger Symbiose, wobei es auch zu einer allmählichen «Slawisierung», zu einer Verbäuerlichung der Awaren kam. Die Bedeutung des Awarenreiches für die slawische Ausdehnung vor allem im 6. und 7. Jahrhundert zeigt sich primär daran, dass die Hauptansiedlungs-gebiete slawischer Verbände kranzförmig um den Kernbereich der awari-schen Herrschaft herum gruppiert waren. So finden sich allerdings erst später bezeugte ähnliche Stammesnamen an weit entfernten Orten, an gegenüber-liegenden Außengrenzen des awarischen Herrschaftsbereiches. Neben den im Hinterland der nördlichen Adriaostküste niedergelassenen Kroaten findet sich der Kroatenname noch in diversen anderen Randregionen des Awaren-reiches bis in die nördlichen Karpaten. Ähnlich wie im Falle der Serben und der Sorben oder der sowohl an der mittleren Donau wie an der Ostsee er-
Teil B: Systematischer Teil
62
wähnten Abodriten ist der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Gruppen ähnlichen Namens jedoch alles andere als klar. Ob es sich dabei um in verschiedene Untergruppen aufgespaltene Stämme handelt, ist bisher un-gewiss und unter gewissen Gesichtspunkten auch unwahrscheinlich. So deu-tet einiges darauf hin, dass es sich auch um awarische Bezeichnungen für bestimmte Funktionsgruppen oder Ranghierarchien gehandelt haben könnte. Ähnlich wie die slawischen Gruppen Südosteuropas verharrten auch die Slawen Ostmitteleuropas lange Zeit in kleinräumig organisierten Gemein-schaften. Stammesnamen tauchen in den Quellen erst in den Jahrhunderten nach der Ansiedlung auf. Die kurzfristige, fränkisch beeinflusste Herr-schaftsbildung des Samo während einer Schwächephase der awarischen Herrschaft in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts an der westlichen Peri-pherie blieb eine Episode. Das von den Slawen des Ostalpenraumes gebilde-te Fürstentum Karantanien konnte sich etwas länger behaupten, wurde je-doch schließlich ins Frankenreich eingegliedert. Erst mit der weiteren Schwächung der Awaren gegen Ende des 8. und dem Untergang ihres Rei-ches im frühen 9. Jahrhundert und dem gleichzeitigen Vordringen des Fran-kenreiches nach Osten begannen sich lokale slawische Herrschaftszentren herauszukristallisieren und mit der Zeit zu größeren Herrschaftsgebilden zu verdichten. Im 10. Jahrhundert beginnen sich dann in Ostmitteleuropa ei-gentliche Reiche mit slawischer Führungsschicht zu bilden. Im Unterschied zu Ostmittel- und Südosteuropa verlief die Ausbreitung sla-wischer Gruppen nach Osten und Nordosten nicht unter dem direkten Ein-fluss des Awarenreiches. Über die slawischen Wanderungsbewegungen in dem Gebiet nordöstlich der Karpaten, entlang des Dnjepr und im Norden bis an den Ladogasee sind noch viel weniger gesicherte Informationen zugäng-lich als im Falle der zuvor behandelten Regionen. Auch hier ist von einem seit dem 6. Jahrhundert andauernden Ausbreitungsprozess auszugehen, wo-bei slawische Verbände im Norden vor allem mit baltischen und finno-ugrischen Gruppen und im Süden und Osten mit polyethnischen Steppenno-maden meist turkischer oder iranischer Herkunft in Kontakt kamen. Aus der Zeit ab dem 9. Jahrhundert sind die Namen diverser slawischer Stämme und Stammesverbände überliefert. Zumindest teilweise befanden sich diese in Abhängigkeit vom Reich der Chazaren. Chazarische Traditionen, lokale slawische Stammesverfassungen und warägische (> Glossar Waräger) Er-oberung werden in unterschiedlichem Ausmaß zur Herausbildung der slawi-schen Fürstentümer beigetragen haben, die später mit der zusammenfassen-den Bezeichnung «Kiever Rus’» benannt wurden. In der Nestorchronik aus dem frühen 12. Jahrhundert lässt sich die auf verschiedene Traditionen auf-bauende Ethnogenese der Rus’, der Ostslawen, gut nachvollziehen. Drei unterschiedliche Traditionsstränge werden dabei zusammengeführt: die sla-wische Verbundenheit aufgrund der gemeinsamen Sprache, der christliche
1. Ethnogenese und Nationsbildung
63
Glaube und die Legende von der Berufung der Waräger (vgl. Kiever Rus’ 9.–13. Jahrhundert, S. 231). Aus der Synthese dieser drei Einflussfaktoren leitete der Autor die Identität der als Rus’ bezeichneten Bevölkerung des Kiever Reiches ab und entwickelte dabei eine Idee weiter, die schon in der Mitte des 11. Jahrhunderts formuliert worden war. Bis ins 12. Jahrhundert waren auch die verschiedenen Stammesidentitäten durch Akkulturation, die Integrationsleistung der Kiever Rus’ und Binnenmigration verschwunden und eine kulturell zumindest einigermaßen geeinte, wenn auch nicht völlig homogene ostslawische Ethnie entstanden. Rus’ wurde damit zu einer Bezeichnung für die ostslawische Bevölkerung des Kiever Reiches. Die seit dem 19. Jahrhundert oft hitzig geführten Debat-ten darüber, ob diese Gruppe eher als Vorfahren der Russen, der Ukrainer oder gar der Weißrussen angesehen werden könne oder ob nicht vielmehr alle drei als Nachfolger der Rus’ anzusehen seien, geht von einem essenzia-listischen Verständnis ethnischer und nationaler Zugehörigkeit aus. Zudem werden Vorstellungen moderner Nationen auf frühere Zeiten übertragen. Es zeigt sich jedoch, dass die Identität als Rus’ im Kiever Reich primär auf die Eliten, auf die Dynastie der Rjurikiden und ihr Umfeld, die Geistlichkeit und Gelehrten beschränkt blieb. Weder setzte sich der christliche Glaube flä-chendeckend durch, noch waren alle Bewohner des multiethnischen Reiches ostslawischer Sprache. Eine Identifizierung als Rus’ dürfte daher auf einen vergleichsweise kleinen Personenverband beschränkt geblieben sein. Der Name Rus’ wurde nach dem Untergang des Kiever Reiches von den Eliten der Teilfürstentümer weitergeführt. Es handelte sich dabei jedoch um keine statische Identität, sondern um einen fortlaufenden Prozess der Neu-formulierung ostslawischer Identität in verschiedenen historischen Kontex-ten. Die Regionen im Osten und Norden der alten Rus’ standen unter mon-golischer Vorherrschaft und bildeten später den Kern des Moskauer Reiches (vgl. Mongolen-Oberherrschaft, S. 234), während der Westen im Verlauf des 14. und 15. Jahrhunderts Teil Polen-Litauens wurde. Dies hatte auch auf die jeweiligen Identitätskonzeptionen Auswirkungen. Das Moskauer Reich und Polen-Litauen standen sich seit dem 16. Jahrhundert als Kontrahenten ge-genüber, was die Abgrenzung zwischen den Regionen der alten Rus’ vertief-te. Denn in den einzelnen Territorien entwickelte sich die Identifizierung mit der Rus’ in unterschiedlicher Art fort. In dieser Zeit kristallisierte sich eine spezifische moskovitische Identität heraus, die sich auf die Institutionen des Moskauer Reiches (Zar, Kirche) und die Grenzen seines Herrschaftsberei-ches gründete. Auf diesem Fundament konnte sich später die moderne russi-sche Identität entwickeln, die jedoch nicht bruchlos an die moskovitische Reichsidentität anknüpfte. In Abgrenzung von dieser entstand im polnisch-litauischen Bereich der alten Rus’ eine ruthenische Form ostslawischer Iden-
Teil B: Systematischer Teil
64
tität. Sie beruhte vor allem auf der Distanzierung von polnischer und litaui-scher Identität und der Ablehnung der Kirchenunion mit Rom. Die Entwick-lung «ukrainischer» und «weißrussischer» Identität war jedoch eine spätere Entwicklung.
1.3.2 Romanen: Vlachen und Rumänen
Die lange Zugehörigkeit der Balkanhalbinsel zum römischen Reich brachte eine teilweise Romanisierung dieser Region mit sich. Sprachlich intensiv latinisiert wurden jedoch nur die nördlichen Teile des Balkans, da dessen südlicher Teil unter dem Einfluss der alten griechischen Kultursprache stand. Die Romanisierung betraf in erster Linie städtische Siedlungen und ihr Um-land. In ländlichen Regionen und vor allem in Berggebieten konnten sich teilweise vorromanische, altbalkanische Idiome (illyrisch im Westen, thra-kisch im Osten) halten. Die Romanisierung war zumindest so nachhaltig, dass romanisierte Gruppen auch nach der Ankunft der Slawen seit dem 6. Jahrhundert ihre aus dem Vulgärlatein hergeleitete romanische Sprache bei-behielten. Allerdings kam es jetzt zu einem Verdrängungsprozess. Während sich romanischsprachige Gruppen in den Städten an der Adriaostküste bis ins 20. Jahrhundert halten konnten, verschwand im Binnenbalkan die antike Städtelandschaft und mit ihr die städtische romanische Tradition. Romanischsprachige Gruppen, mit einem Sammelbegriff als «Vlachen» (Selbstbezeichnung «Armăni» – Aromunen) bezeichnet, fanden sich nun primär in den Gebirgsregionen der Balkanhalbinsel. In den Quellen sind sie seit dem 10. Jahrhundert belegt. Sie schufen sich in den Bergregionen vor allem als Transhumanz (> Glossar) betreibende Herdenzüchter und Hirten eine Nische, betrieben aber neben Handwerk auch Fernhandel und waren als Karawanenführer aktiv. Es ist davon auszugehen, dass sich die Unterschei-dung zwischen «Slawen» und «Vlachen» vor allem an ihrer Lebensweise festmachte. Vlache entwickelte sich in gewissen Regionen zu einem Syn-onym für Hirten und umfasste so auch sprachlich slawisierte Personen. In anderen Regionen konnte Vlache schlicht eine Person orthodoxer Konfessi-on bezeichnen. Dies zeigt, wie eng ethnische, soziale und konfessionelle Identitäten in der Vormoderne miteinander verbunden waren. Heftig umstritten ist die Frage nach der Herkunft der Rumänen, der zahlen-mäßig größten romanischsprachigen Gruppe Südosteuropas. Nicht in Frage gestellt wird zwar, dass das Rumänische eine romanische Sprache ist, die letztlich auf die Romanisierung weiter Teile Südosteuropa in der Antike zurückgeht. Doch in Bezug auf den Ort der rumänischen Frühgeschichte stehen sich zwei grundsätzlich verschiedene Thesen gegenüber:
1. Ethnogenese und Nationsbildung
65
• Die von der intellektuellen Elite der siebenbürgischen Rumänen (so-genannte siebenbürgische Schule) im 18. Jahrhundert von Humanisten übernommene und in der Folge primär von Rumänen vertretene Kon-tinuitätsthese geht von einer kontinuierlichen Präsenz romanischer Bevölkerung auf dem Territorium des heutigen Rumänien und insbe-sondere Siebenbürgens seit der Antike aus. Die Zugehörigkeit der Provinz Dacia zum römischen Reich von 106–271 n. Chr. und die in dieser Zeit erfolgte Romanisierung bildete demnach den Ausgangs-punkt der rumänischen Ethnogenese. Je nach Standpunkt werden eher lateinischsprachige Ansiedler (vor allem Heeresangehörige) bzw. sprachlich und kulturell romanisierte Angehörige der Daker, der loka-len vorrömischen Bevölkerung, als Vorfahren der modernen Rumänen identifiziert.
• Die in der ungarischen und immer wieder auch in der internationalen Historiografie bevorzugt vertretene Migrations- oder Einwanderungs-these geht davon aus, dass die romanische Besiedlung des Gebietes nördlich der unteren Donau und im Karpatenbogen nach dem Rückzug der Römer aus der Provinz Dacia im 3. Jahrhundert n. Chr. zu Ende gegangen sei. Der Zeitpunkt für das Ende der romanischen Präsenz wird unterschiedlich angesetzt. Teils wird von einem sofortigen, orga-nisierten Abzug aller romanischsprachigen Personen in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts ausgegangen. Nach anderen Auffassungen kam es unter den diversen, diese Region durchziehenden oder besie-delnden Stammesverbänden (darunter Goten, Gepiden, Hunnen, Awa-ren, Slawen) zu einer allmählichen Verdrängung und Assimilierung allenfalls noch zurückgebliebener romanischsprachiger Gruppen bis spätestens ins 7. Jahrhundert. Die Präsenz romanischsprachiger Perso-nen nördlich der unteren Donau und im Karpatenbecken wird dabei auf spätere Einwanderung vlachischer Wanderhirten von der Balkan-halbinsel zurückgeführt, wobei für den Zeitpunkt dieser Ansiedlung ebenfalls unterschiedliche Angaben gemacht werden, die zwischen dem 9. und der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert schwanken.
Seit dem 19. Jahrhundert entwickelte sich die Frage der Herkunft der Rumä-nen immer mehr in Richtung einer historischen Legitimierung von Gebiets-ansprüchen auf Siebenbürgen durch Rumänien und Ungarn. Bei unvoreinge-nommener Betrachtung der Problematik muss zuerst einmal festgehalten werden, dass aufgrund des praktisch kompletten Mangels zeitgenössischer schriftlicher Quellen und der nur indirekten Aussagekraft nichtschriftlicher Quellen (vor allem Archäologie sowie Ortsnamen- und Sprachwissenschaft) diese Fragen wohl nie abschließend wird geklärt werden können. Darüber hinaus muss hier erneut darauf hingewiesen werden, dass der Streit um die Kontinuität mittelalterlicher ethnischer Gruppen von modernen Vorstellun-
Teil B: Systematischer Teil
66
gen ausgeht und dem Charakter vormoderner Identitätskategorien nicht ge-recht wird. Völker entstehen nicht als genealogische Abstammungsgemein-schaften, sondern aus der Gruppierung von Personenverbänden. Sinnvollere Fragestellungen als die nach der Urheimat der Rumänen sind daher, seit wann im heutigen Verbreitungsgebiet der rumänischen Sprache von einer romanischsprachigen Bevölkerung ausgegangen werden kann und wie sich die rumänische Sprache in diesem Gebiet hat durchsetzen können. Vor allem sprachwissenschaftliche Befunde lassen die begründete Vermu-tung zu, dass sich die Sprachgeschichte des Rumänischen im Frühmittelalter in den zentralen Gebirgsregionen der Balkanhalbinsel abgespielt hat. Eine ganze Reihe von Merkmalen weisen darauf hin, dass die Sprecher der Vor-form des heutigen Rumänischen in engem Kontakt mit albanischsprachigen Personen gestanden haben müssen. Außerdem lassen sich im Rumänischen kaum auf das Frühmittelalter zurückgehende germanische Beeinflussungen nachweisen. Angesichts der unbestrittenen Präsenz germanischsprachiger Stammesverbände wie der Goten und Gepiden im frühmittelalterlichen Sie-benbürgen ist das Fehlen solcher Merkmale ein Hinweis darauf, dass eine romanische Sprachkontinuität in diesem Raum eher unwahrscheinlich ist. Noch viel grundlegender sind aber die Einwände, die eine umfassendere Romanisierung auf dem Gebiet der Provinz Dacia in Zweifel ziehen. Die relativ kurze Phase der Zugehörigkeit zum römischen Reich von knapp 170 Jahren wäre kaum ausreichend gewesen für eine tief greifende Romani-sierung der Bevölkerung. Darüber hinaus erscheint es unwahrscheinlich, dass sich eine romanisierte Bevölkerung ausgerechnet in dieser exponierten Region halten konnte, die wie kaum eine andere Gegend Ostmittel- oder Südosteuropas bis ins Hochmittelalter immer neuen Stammesverbänden und Steppennomaden als Durchzugs- und Ansiedlungsgebiet diente. Zwar ist das von Vertretern der Kontinuitätsthese vorgebrachte Argument einer bestehend bleibenden romanischen Bevölkerung in Reliktgebieten nördlich der Donau, vor allem im Gebirge, nicht mit letzter Sicherheit zu widerlegen. Doch gibt es auf der anderen Seite auch keine konkreten Hinweise, die eine solche These stützen würden. Vielmehr zeigen auch die Befunde der Toponomastik (Ortsnamenforschung) keine eindeutigen Hinweise bezüglich einer romanischen Präsenz im Früh-mittelalter. Weder haben sich antike Siedlungsnamen in dem Verbreitungs-gebiet des Rumänischen erhalten noch können die überlieferten Flussnamen auf eine von romanischen Sprechern tradierte Form zurückgeführt werden. Bei den als Argumente für die Kontinuitätsthese angeführten Namensbei-spielen ist eine romanische Überlieferung nicht zwingend bzw. können diese Fälle oft sogar nur mithilfe einer slawischen Vermittlung erklärt werden. Aufgrund all dieser Hinweise scheint es eher wahrscheinlich, dass bei der
1. Ethnogenese und Nationsbildung
67
Ansiedlung der Ungarn ab dem späten 9. Jahrhundert insbesondere in Sie-benbürgen keine vorslawische Siedlungstradition mehr bestanden hat. Ab wann mit der Präsenz vlachischer bzw. rumänischer Verbände zu rechnen ist, ist aber gleichfalls umstritten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass schon im 9. Jahrhundert vlachische Hirten über die Donau nach Norden gezogen sind, zur Zeit, als das erste Bulgarische Reich seinen Herrschaftsbereich bis über die Südkarpaten hinaus ausgedehnt hatte. Jedoch stammen eindeutige schriftliche Belege über vlachische/rumänische Gruppen nördlich der Donau erst aus dem frühen 13. Jahrhundert. Angesichts der großen Schwierigkeiten in Bezug auf die Frühgeschichte der Rumänen und die alles dominierende Frage nach «Kontinuität» oder «Migration» ist das Problem der rumänischen Ethnogenese als Prozess der Bewusstseinsbildung von Zusammengehörig-keit in der Forschung kaum beachtet worden. Vermutlich waren die Vlachen bzw. die Rumänen bis ins Spätmittelalter nicht als ethnischer Großverband konstituiert. Erst im Rahmen der im 14. Jahrhundert entstandenen Fürsten-tümer Walachei und Moldau bzw. im spätmittelalterlichen, zum Königreich Ungarn gehörenden Siebenbürgen werden die Grundlagen gelegt worden sein, auf denen sich die Rumänen als ethnische Gruppe konstituierten.
1.3.3 Albaner
Die Herkunft der Albaner ist nicht definitiv geklärt. Ähnlich wie im Falle der Rumänen herrschen grundsätzlich unterschiedliche Ansichten über den Ort der albanischen Frühgeschichte vor. Unbestritten ist, dass die albanische Sprache auf eine altbalkanische Sprache zurückgeht, die jedoch teilweise romanisiert worden ist. Nähere Sprachverwandte hat das Albanische nicht, es stellt inner-halb der indoeuropäischen Sprachfamilie einen eigenen Zweig dar. Verschie-dene Ansichten bestehen aber in Hinsicht auf die altbalkanische Vorgänger-sprache, aus der heraus sich das Albanische entwickelt hat, und damit eng verknüpft über den Ort, an dem deren Sprecher im Frühmittelalter gesiedelt haben. Insbesondere von albanischer Seite werden die in der Antike auf dem westlichen Balkan, ungefähr im heutigen Siedlungsgebiet der Albaner, veror-teten Illyrer als Vorfahren betrachtet. Auf der anderen Seite leitet etwa die serbische Historiografie die Herkunft der Albaner von den Thrakern ab, die im Altertum den östlichen Teil der Balkanhalbinsel bewohnten. Die Albaner wä-ren demnach in ihr heutiges Siedlungsgebiet, insbesondere Kosovo, einge-wandert. Die albanische Bevölkerungsmehrheit in dieser Region wird auf demografische Umwälzungen ab der Frühen Neuzeit zurückgeführt. So kam es vor allem seit der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert zu einer bedeuten-den Einwanderung von Albanern in die Ebenen Kosovos. Auch die bis in die Gegenwart signifikant höhere Geburtenrate der Albaner führte zur Zunahme des albanischen Bevölkerungsanteils in Kosovo.
Teil B: Systematischer Teil
68
In der internationalen Historiografie wird die These von einem den gesamten heutigen albanischen Siedlungsraum umfassenden Entstehungsgebiet der albanischen Sprache in der Regel nicht geteilt. Hier wird eher von einem oder mehreren Rückzugsgebieten ausgegangen, etwa dem Berggebiet von Mati in Nordalbanien. In diesen Reliktgebieten, welche von der Romanisie-rung nicht oder nur teilweise erfasst worden sind, hätten sich altbalkanische Idiome erhalten und zur albanischen Sprache weiterentwickeln können. In der internationalen Forschung ist neben der illyrischen These jedoch auch diejenige von einer thrakischen Herkunft und damit einer Einwanderung der Albaner in ihre späteren Siedlungsgebiete anzutreffen. Jüngst hat Gottfried Schramm die, allerdings stark umstrittene, Hypothese vertreten, wonach der thrakische Stamm der Bessen in den Bergen des heutigen südlichen und westlichen Bulgarien die Vorfahren der Albaner seien. Im frühen 9. Jahr-hundert seien sie ins heutige Nordalbanien eingewandert, um der Verfolgung von Christen im ersten Bulgarischen Reich zu entgehen. Es scheint jedenfalls so, als seien die Berggebiete Nordalbaniens und der umliegenden Regionen ein Kernraum gewesen, von dem aus sich albanisch-sprachige Gruppen seit dem Hochmittelalter verbreitet hätten, vor allem nach Süden. Ob das Albanische erst durch Einwanderer gegen Ende des ersten Jahrtausends dorthin gelangt ist oder dort originär entstanden ist, kann jedoch nicht mehr mit Sicherheit festgestellt werden. Unter Berücksichti-gung der frühen albanisch-rumänischen Sprachkontakte ist jedoch davon auszugehen, dass im Frühmittelalter albanischsprachige Gruppen nicht aus-schließlich im Westen der Balkanhalbinsel gelebt haben können. Zum Teil wird auf antike Städtenamen verwiesen, die sich zu ihrer heutigen Lautung nur über albanische Vermittlung entwickelt haben können, so etwa im Falle des heutigen Niš oder Štip. Zudem zeigt der geringe griechische und der bedeutende lateinische Einfluss auf das Albanische, dass der Entstehungs-raum der Sprache wohl nicht zu weit südlich verortet werden kann. Das nördliche Makedonien und die angrenzenden Regionen kämen dafür in Be-tracht. Es ist aber, davon abgesehen, nicht auszuschließen, dass das Albani-sche auf unterschiedliche altbalkanische Sprachen zurückgeht, die sich über die Spätantike hinaus an verschiedenen Orten erhalten haben und erst gegen Ende des Frühmittelalters durch Migration ihrer Sprecher überlagert und so zur Ausformung der albanischen Sprache geführt haben. Somit wäre theore-tisch eine sowohl illyrische wie auch thrakische Herkunft durch Überlage-rung und Assimilation zumindest denkbar. Unter Berücksichtigung aller Indizien aus verschiedenen Fachdisziplinen, vor allem der Linguistik, scheint jedenfalls die These einer illyrischen wahrscheinlicher als diejenige einer ausschließlich thrakischen Herkunft. Unabhängig davon ist jedoch die Frage nach einer albanischen Identität zu behandeln. Schriftlich erstmals erwähnt werden Albaner im 11. Jahrhundert
1. Ethnogenese und Nationsbildung
69
unter dem Namen Arvanitai. Ende des 12. Jahrhunderts entstanden erste größere Herrschaftsbereiche. Der Ausbildung eines gesamtalbanischen Be-wusstseins stand jedoch die bis ins 20. Jahrhundert in Stämmen gegliederte Gesellschaftsordnung des nördlichen Siedlungsgebietes der albanischspra-chigen Bevölkerung entgegen. Auch kulturell gab und gibt es erhebliche Unterschiede. Die dialektalen Unterschiede der albanischen Sprache sind zum Teil wesentlich größer als diejenige zwischen den einzelnen südslawi-schen Sprachen. Religiös sind unter den Albanern sowohl der Islam als auch die Orthodoxie wie der Katholizismus verbreitet. Andererseits gab es zwi-schen den slawischen Stämmen Montenegros und Nordalbaniens und den albanischen Stämmen dieser Region die Vorstellung einer gemeinsamen Herkunft von einem Stammvater und es zirkulierte sogar die Vorstellung von einer slawischen Abstammung bei albanischen und einer albanischen Abstammung bei montenegrischen Stämmen. Das auf Abstammung beru-hende Bewusstsein der Zusammengehörigkeit blieb also auf Stammes- und Klanloyalitäten beschränkt. Einzig im Kontakt mit Fremden manifestierte sich manchmal eine beschränkte, stammesübergreifende Solidarität. Die Ausdifferenzierung der Albaner in die sich auch dialektal unterscheidenden Großgruppen der Gegen im Norden und der Tosken im Süden entstand erst während der Osmanischen Herrschaft. In osmanischer Perspektive konnte die Bezeichnung «Arnavud» (Arnaut) für Albaner verschiedene Konnotatio-nen annehmen und neben ethnischer auch die geografische oder soziale Her-kunft bezeichnen. Die heutige Selbstbezeichnung der Albaner als «Shqipta-rë» (die Deutung dieses Begriffes als «Adlersöhne» beruht auf einer nach-träglichen volksetymologischen Interpretation) ist eine relativ junge Erschei-nung, die im Spätmittelalter unbekannt war. Erst die im 19. Jahrhundert ein-setzende Nationalbewegung propagierte ein einheitliches albanisches Volk. Von einem allgemein verbreiteten Bewusstsein einer solchen, nun national verstandenen Einheit kann aber vor der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht ausgegangen werden.
1.3.4 Finno-Ugrier: Ungarn, Esten, Finnen
Die Ungarn (Eigenbezeichnung: magyar) ließen sich im letzten Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts (gemäß historischer Tradition Landnahme im Jahr 896) in der pannonischen Tiefebene nieder. Bei den Ungarn handelte es sich um eine heterogen zusammengesetzte Stammeskonföderation von Steppenno-maden. Sprachlich sollte sich schließlich das Magyarische durchsetzen, das dem ugrischen Zweig der finno-ugrischen Sprachen zugerechnet wird, wel-che wiederum zusammen mit den samojedischen Sprachen die uralische Sprachfamilie bilden. Die nächsten Sprachverwandten der Ungarn sind die heute im Nordwesten Sibiriens zwischen Ural und Jenissei entlang des Ob
Teil B: Systematischer Teil
70
beheimateten Kleinvölker der Chanten und Mansen (in alter Bezeichnung Ostjaken und Wogulen). Das ursprüngliche Herkunftsgebiet der uralischen Sprachen wird in der Gegend beidseits des mittleren und südlichen Urals bzw. an der mittleren Wolga lokalisiert, teilweise auch weit darüber hinaus bis an die Ostsee. Die Aufspaltung in eine samojedische und eine finno-ugrische Sprachgruppe wird sich bis etwa 3000 v. Chr. vollzogen haben. Im Verlauf des folgenden Jahrtausends kam es zu einer weiteren Ausdifferen-zierung in einen finnischen und einen ugrischen Zweig. Die ugrische Gruppe wanderte dabei nach Süden und kam so in Kontakt mit iranischen Stämmen der Steppenzone. Dies ging mit einer veränderten Lebensweise einher. Die Magyaren wurden zu Steppennomaden, während andere ugrische Stämme (aus denen später Chanten und Mansen hervorgingen) wieder nach Norden abwanderten. Im 1. Jahrtausend v. Chr. hatten sich die Magyaren so aus der ugrischen Gruppe herausgebildet und siedelten in der Gegend des Ural-Flusses. Wann die Westwanderung der magyarischen Stämme einsetzte, ist nicht klar. Möglicherweise siedelten sie sich Ende des 6. Jahrhunderts im nördli-chen Kaukasusvorland zwischen Don und Kuban an, im späten 7. Jahrhun-dert dann in der Steppenzone westlich des Dnjepr bis zur unteren Donau. Klar ist hingegen, dass die Magyaren im Frühmittelalter stark durch irani-sche und Turkvölker beeinflusst wurden, in deren Herrschaftsbereich (Reich der Chazaren) sie integriert waren. Im frühen 9. Jahrhundert hatten die Magyaren einen Herrschaftsverband in den Steppen nördlich des Schwarzen Meeres gebildet. Durch Angriffe der Petschenegen von Osten aus diesem Raum vertrieben, zogen die Magyaren nach Westen, wo es zur bereits erwähnten Landnahme in der pannonischen Tiefebene kam. Noch jahrzehntelang zogen die Ungarn von hier aus in ver-heerenden Kriegs- und Plünderzügen durch ganz West- und Südeuropa. Erst die militärische Niederlage auf dem Lechfeld bei Augsburg (955), die Etab-lierung einer Zentralherrschaft und die Annahme des (lateinischen) Christen-tums ab dem späten 10. Jahrhundert führten schließlich zur Integration in die mittelalterliche Ländergemeinschaft Europas. Das ethnische Bewusstsein der gemeinsamen Abstammung manifestierte sich etwa in dem um 1200 verfass-ten Werk des Anonymus «Gesta Hungarorum». Die größtenteils sagenhaften Erzählungen von der Abstammung der Ungarn und ihrer Ansiedlung in der pannonischen Tiefebene dienten als Gründungsmythos und zur Legitimation der Königsherrschaft, trugen durch die Herkunftssage aber auch zu einem gemeinsamen Bewusstsein zumindest der Eliten bei. Die sprachlich nahe verwandten Finnen und Esten weisen eine nur sehr ent-fernte Sprachverwandtschaft mit den Ungarn auf. Das durch linguistische Forschungen erschlossene Zusammenleben finnischer und ugrischer Grup-
1. Ethnogenese und Nationsbildung
71
pen kam schon im 3. Jahrtausend v. Chr. zu einem Ende. Verschiedene fin-nische Gruppen lebten über große Gebiete zwischen Ural und Skandinavien verstreut. Im Mittelalter kam es hier zu einem fortschreitenden Slawisie-rungsprozess durch die aus Süden zuwandernden Ostslawen (Russen). Über die frühe Entwicklung der finnischen Gruppen ist jedoch nur sehr wenig bekannt. Viele kleine Gemeinschaften lebten praktisch bis in die Gegenwart in herrschaftlich kaum organisierten Gruppen von Fischfang, Tierzucht und der Jagd, weiter südlich auch als Bauern. Anstöße zu einem Zusammen-schluss unter ethnischen Kriterien kamen hier oft von außen durch den Kon-takt mit Russen seit dem späten Mittelalter, zum Teil aber auch wesentlich später, manchmal erst im Rahmen der sowjetischen Nationalitätenpolitik. Diese führte jedoch meist zu einer folkloristischen Vereinnahmung der loka-len Kulturen für die Zwecke des Regimes. Eventuell schon im 4. Jahrtausend v. Chr. siedelten Angehörige einer von der Wissenschaft als «Ostseefinnen» bezeichneten Untergruppe der finni-schen Sprachgemeinschaft an der Ostsee. Das moderne Finnische und das Estnische gehen darauf zurück, ebenso das im nordwestlichen Russland be-heimatete Karelische, während andere ostseefinnische Sprachen wie das Livische, Wotische oder das Wepsische praktisch ausgestorben sind oder nur noch von wenigen Personen gesprochen werden. Von der anfänglichen An-siedlung südlich des Finnischen Meerbusens wanderten einige Gruppen spä-ter nach Norden in das heutige Finnland weiter. Finnische und estnische Stämme bildeten im Hochmittelalter kleinere Stammesherrschaften aus, die sich jedoch gegen die Eroberungsversuche der westlichen Ostseeanrainer (Schweden, Dänemark, deutscher Orden) nicht halten konnten. Der seit der Antike belegte Begriff der Esten (im 1. Jhd. n. Chr. bei Tacitus als Aestii, bezog sich vermutlich aber auf germanische oder baltische Stämme) kam erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei den ostseefinnischen Be-wohnern des heutigen Estlands als Selbstbezeichnung auf. Zuvor hatten sie sich schlicht als maarahvas (Landleute) bezeichnet, was auf die primär sozial und weniger ethnisch geprägte Identität hindeutet. Sozial und wirtschaftlich dominierte im Gebiet des einstigen Livlands bis zum Ersten Weltkrieg die baltendeutsche Oberschicht, so dass sich sprachlich-kulturelle und sozial-politische Abgrenzungen hier, wie auch an vielen anderen Orten Osteuropas, überlagerten. Als Mittel der nationalen Mobilisierung breiter Bevölkerungs-schichten und damit der Entstehung eines gesamtestnischen Zusammengehö-rigkeitsgefühls spielten die erstmals 1869 abgehaltenen Gesangsfeste eine wichtige Rolle.
Teil B: Systematischer Teil
72
1.3.5 Balten: Litauer und Letten
Als Balten im sprachlich-ethnischen Sinne werden die Litauer und die Letten bezeichnet, deren Sprache der indoeuropäischen Sprachfamilie zugerechnet wird. Das Litauische wird sogar als die archaischste indoeuropäische Spra-che betrachtet, als die Sprache die am meisten Gemeinsamkeiten mit der hypothetischen indoeuropäischen Ursprache aufweist. Die Esten, die geogra-fisch ebenfalls im Baltikum ansässig sind, zählen aufgrund ihrer ostseefinni-schen Sprache nicht zu den baltischen Völkern. Wann sich die Ansiedlung indogermanisch-baltischsprachiger Gruppen im Hinterland der östlichen Ostseeküste, auf dem Territorium des heutigen Litauen und Lettland, voll-zog, kann nicht mehr rekonstruiert werden. Die Vermutungen dazu schwan-ken vom 3. vorchristlichen bis zur zweiten Hälfte des 1. nachchristlichen Jahrtausends. Über die Herkunft der baltischen Stämme und eine allfällige gemeinsame baltisch-slawische Urgemeinschaft sind die Meinungen in der Forschung ebenfalls geteilt. Baltische Gewässernamen lassen sich jedoch in einem großen Gebiet der zentralen Waldzone Osteuropas bis etwa in die Region des heutigen Moskau im Osten und die nördliche Ukraine im Süden finden. Bis weit ins Mittelalter sind kaum nähere Einzelheiten zum Leben der baltischsprachigen Gruppen bekannt. Seit dem späten ersten nachchrist-lichen Jahrtausend werden in den Quellen verschiedene baltische Stämme erwähnt. Die erste längerfristig erfolgreiche Ethnogenese vollzog sich im Hinterland der Südostecke der Ostsee, wo dank des Schutzes durch Urwald-gürtel die baltische Bevölkerung ihre sprachliche Eigenständigkeit gegen-über der Ausbreitung der Slawen oder Eroberungsversuchen über die Ostsee bewahren konnte. In dieser Gegend kam es ab dem 10. Jahrhundert zum Zusammenschluss diverser Stämme, woraus die Litauer hervorgingen. Sie begründeten ein Reich, das im Spätmittelalter weit in den ostslawischen Siedlungsraum hinein reichte und weite Teile der westlichen Kiever Rus’ umfasste. Innerhalb Litauens konnte so ein Landesbewusstsein entstehen, das jedoch nicht ethnisch-sprachlich begründet war. Die Letten entstanden aus dem Zusammenschluss diverser baltischer Stäm-me auf dem Territorium Livlands. Dieser Prozess dauerte bis in die Frühe Neuzeit. Namengebend wurde der Stamm der Lettgaller, an die übrigen Stämme (Kuren, Semgaller, Selen) erinnern heute noch Landschaftsnamen. Die an der Dünamündung siedelnden Liven gehören sprachlich der ostsee-finnischen Gruppe an und sind heute weitestgehend an das lettische Umfeld assimiliert. Die baltischen und ostseefinnischen Bewohner Livlands wurden zum Teil bis ins frühe 20. Jahrhundert zusammenfassend als «Undeutsche» bezeichnet, um sie von der Baltendeutschen Oberschicht zu unterscheiden. Die Unterscheidung zwischen deutsch und undeutsch hatte damit eine stark soziale Konnotation. Da sich sprachliche und soziale Kategorien überlager-
1. Ethnogenese und Nationsbildung
73
ten, kam es in Livland zu keiner Assimilation der baltischen Bevölkerung an die Deutschen. Der östlich der Weichselmündung entlang der Ostseeküste lebende baltische Stamm der Prussen hingegen, der namengebend für das Land Preußen wurde, wurde schon in der Frühen Neuzeit sprachlich und kulturell germanisiert bzw. polonisiert. Dies hing damit zusammen, dass in Preußen anders als in Livland auch ein deutschsprachiges Bauerntum exis-tierte und damit keine derart scharfe soziale Trennlinie Baltisch- und Deutschsprachige trennte. Prussen und deutschsprachige Bauern teilten das soziale Umfeld, was eine allmähliche Akkulturation und letztlich das Aufge-hen der baltischen Prussen in der deutschsprachigen Bevölkerung wesentlich erleichterte. In Livland hingegen konnten sich Letten und Esten unter der vergleichsweise dünnen deutschbaltischen Herrenschicht als Volk herausbil-den, da das soziale Milieu unfreier Bauern keine Deutschsprachigen umfass-te. Die soziale konstituierte Gruppe der «Undeutschen» wurde dann im 19. Jahrhundert im Zuge der Nationsbildung zunehmend unter ethnisch-nationalen Gesichtspunkten gedeutet, womit sich Letten und Esten als Nati-on konstituierten.
1.3.6 Zigeuner (Roma)
Im 11. oder 12. Jahrhundert tauchten im Byzantinischen Reich Personen-gruppen auf, die unter verschiedensten Namen wie Athiganoi (daraus Zigeu-ner) oder Aigyptioi (Ägypter) in den Quellen erwähnt wurden. Obwohl der Begriff Zigeuner bzw. Ableitungen davon in diversen Sprachen als Oberbe-griff die weiteste Verbreitung fand, finden sich daneben zahllose weitere Ei-gen- und Fremdbezeichnungen. Das auf eine Selbstbezeichnung als «Rrom» (Mensch) zurückgehende «Roma» begann sich erst gegen Ende des 20. Jahr-hunderts als zusammenfassende Bezeichnung zu etablieren. Seine Verwen-dung für die Zeit davor ist deshalb problematisch, zumal er auch heute noch nicht von allen Gruppen als Selbstbezeichnung akzeptiert wird. Der manch-mal begleitend verwendete Name «Sinti» hingegen bezieht sich lediglich auf eine Untergruppe, die nicht in Osteuropa, sondern primär im deutschen Sprachraum beheimatet ist. Aufgrund der ausgeprägten Heterogenität und des weitgehenden Fehlens eines übergreifenden Gemeinschaftsgefühls der einzelnen Gruppen ist grundsätzlich jede Sammelbezeichnung schwierig. Die Gemeinsamkeit all der unter dem Begriff Zigeuner subsumierten Grup-pen besteht in der Herkunft aus Indien, über die inzwischen weitgehender Konsens besteht. Umstritten ist hingegen, ob die Vorfahren der Zigeuner als geschlossene Gruppe oder in mehreren, voneinander unabhängigen Wellen und zu verschiedenen Zeitpunkten aus Indien nach Europa gelangt sind. Da schriftliche Quellen fehlen, beruht die Rekonstruktion der Herkunfts- und Wanderungsgeschichte vor allem auf sprachwissenschaftlichen Erkenntnis-
Teil B: Systematischer Teil
74
sen. Nach der Abwanderung aus dem Nordwesten Indiens zu einem nicht näher eingrenzbaren Zeitpunkt im Frühmittelalter hielten sich die Zigeuner einige Zeit in Persien und im armenischen Siedlungsgebiet auf, bevor sie im Byzantinischen Reich auftauchten. Quellenmäßig lassen sie sich hier mit Sicherheit seit dem 12. Jahrhundert belegen, eine frühere Anwesenheit, eventuell gar vor der Jahrtausendwende, ist unklar. Die frühesten Siedlungs-gebiete von Zigeunern in Europa lagen auf der südlichen Balkanhalbinsel, in Thrakien und Griechenland. Im 14. und 15. Jahrhundert werden Zigeuner dann in verschiedenen Regionen Südosteuropas und Ostmitteleuropas er-wähnt. Dieser Raum, insbesondere die heutigen Staaten Bulgarien, Makedo-nien, Serbien, Rumänien, Ungarn und die Slowakei, weisen auch heute den größten Bevölkerungsanteil von Roma-Gruppen auf. In diesen Regionen konnten die Zigeuner aufgrund des schwach entwickelten Städtewesens und der damit verbundenen rudimentären Arbeitsteilung eine Nische etwa als spezialisierte Handwerker besetzen oder übten Berufe aus, die als unehren-haft galten. Vielerorts waren die Zigeuner daher willkommene Arbeitskräfte und erhielten, hierin den Juden oder den Ansiedlern nach deutschem Recht vergleichbar, Privilegien, so im Königreich Ungarn. Im dichter besiedelten und sozial stärker differenzierten Westeuropa hingegen, wohin Zigeuner ebenfalls schon im Spätmittelalter gelangten, bestand kein Bedarf an ihren Tätigkeitsfeldern, die überwiegend schon anderweitig abgedeckt waren. Hier waren die Einwandernden daher schon früh als unwillkommene Konkurrenz und exotische Fremde Verfolgungen ausgesetzt. Ein übergreifendes Bewusstsein der Zusammengehörigkeit entwickelte sich bei den auf verschiedene regionale Gruppen verteilten Zigeunern nicht. Bis in die Gegenwart dominieren auf Berufsgruppen (wie Kupferschmiede, Goldwäscher, Spielleute, Bärenführer, Pferdehändler), Wohnregionen oder auf vermeintliche Herkunft (etwa Ägypter) bezogene Loyalitäten mit teils ausgeprägter Abgrenzung gegenüber anderen Zigeuner-Gruppen. Weder sprachlich noch konfessionell stellen die Roma eine Einheit dar. Nicht alle sprechen das Romanes, die aus Indien mitgebrachte Sprache, sondern haben sich sprachlich genauso wie konfessionell an die umgebende Bevölkerung angepasst. Vielfach bekennen sich Roma zumindest gegenüber Außenste-henden auch nicht als solche, nicht zuletzt aus Furcht vor Diskriminierung und Verfolgung. Genauso wenig ist traditionellerweise das Bewusstsein der indischen Herkunft unter den Zigeunern verbreitet, sondern wurde erst in jüngerer Zeit durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse unter Roma be-kannt. Ein klares Bekenntnis zu einer länderübergreifenden Roma-Identität wird erst seit wenigen Jahrzehnten von einer bislang recht schmalen Elite vertre-ten. Es ist daher zumindest fraglich, ob Zigeuner bzw. Roma als ethnische Gruppe im engeren Sinne bezeichnet werden können. Diverse andere For-
1. Ethnogenese und Nationsbildung
75
men von Identitäten (regional, lokal, konfessionell, sozial, klanbezogen) überlagern sich und vermitteln so einen beispielhaften Einblick in die viel-fältigen Formen von Gruppenidentitäten jenseits des modernen Nationalis-mus.
1.4 Nationsbildung und Nationalismus
1.4.1 Zum Konzept Nationalismus
Das Konzept der nationalen Identität ist zu unterscheiden von ethnischer Identität. Oft werden Ethnizität und Nationszugehörigkeit quasi als Synony-me verwendet. Anders als Formen ethnischer Identität ist der Nationalismus gemäß überwiegender Auffassung der neueren Forschung jedoch ein spezi-fisch modernes Phänomen. Zwar lässt sich die Begrifflichkeit der Nation besonders in Ostmitteleuropa auch für die Vormoderne belegen, doch han-delte es sich dabei um gänzlich anders gelagerte Phänomene. Nation be-zeichnete im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit die politisch privilegier-ten Schichten. Die Mitgliedschaft in einer solchen ständischen Nation, wie sie besonders in Ungarn, Kroatien, Polen und Böhmen existierte, war strikt auf den Adel und Funktionseliten beschränkt. Die enge Verschränkung von Standesbewusstsein und Nationszugehörigkeit unterscheidet diese Form der Nation grundlegend von dem im 19. Jahrhundert aufkommenden Nations-verständnis. Der moderne Nationsbegriff gründet sich auf eine zumeist kulturell definier-te Bevölkerung und umfasst Angehörige quer durch alle sozialen Schichten. Gegenüber dieser modernen Konzeption, wonach die Menschheit in vertika-le Segmente gegliedert ist, basierte das vormoderne Verständnis der Nation auf einer horizontalen Schichtung der Gesellschaft. Trotz der identischen Begriffe sind daher vormoderne klar von modernen Nationen zu unterschei-den. Diese Unterscheidung vermag auch die fundamentalen Umwälzungen der Gesellschaftsstruktur seit dem 19. Jahrhundert zu erhellen. Die einstmals hierarchisch strukturierte Gesellschaft formte sich unter dem Einfluss egali-tärer Ideale in eine klassenübergreifende Solidaritätsgemeinschaft um, ver-bunden mit der Idee der Volkssouveränität. Allerdings war der Preis dieser Integration die Entstehung neuer Abgrenzungen quer durch soziale Milieus hindurch. Historisch gewachsene Zusammenhänge zerrissen damit entlang nationaler Trennlinien. Die horizontale Solidarität unter Personen gleicher sozialer Zugehörigkeit, von Leuten, die dasselbe Milieu teilten, ging verlo-ren zugunsten eines vertikalen Gemeinschaftsgefühls zwischen Eliten und unteren Schichten. Eine Auswirkung davon war, dass auf die Ebene der Eli-ten beschränkte Interessengegensätze sich nun schnell auf die gesamte Ge-
Teil B: Systematischer Teil
76
sellschaft auswirkten. Im Rahmen der nationalen Solidarität konnte die Elite an die Solidarität der Nation appellieren und damit die gesamte Gesell-schaftshierarchie, etwa im Rahmen des Kriegsdienstes, für ihre Partikularin-teressen mobilisieren. Der Beginn der modernen Nationsbildung ist wie auch anderswo nicht vor das 19. Jahrhundert zu datieren. Der Nationalismus zeichnet sich durch sei-nen Massencharakter aus, der auf eine flächendeckende Mobilisierung aller Angehörigen einer bestimmten geografisch oder kulturell definierten Gruppe zielt. Er versteht sich als eindeutige Kategorie, die Unentschiedenheit und multiple Identitäten nicht gelten lässt. Er verlangt nach einer klaren Stel-lungnahme für oder gegen die Nation im Sinne der Einhaltung bestimmter «nationaler» Konventionen. Diese können etwa den Gebrauch der jeweiligen Nationalsprache, das Bekenntnis zum Nationalstaat oder die Identifizierung mit den entsprechenden Gründungsmythen umfassen. Im Gegenzug bietet die Nation allen ihren Angehörigen die politische und rechtliche Gleichstel-lung an sowie die Fiktion, in einer größeren Schicksalsgemeinschaft aufge-hoben zu sein. Während Ethnizität sich auf ein oftmals nur diffus ausgepräg-tes Zusammengehörigkeitsgefühl und daraus hervorgehende Alltagsprakti-ken beschränkt, geht der der Nationalismus weiter und betrachtet nationale Gruppen als die eigentlichen Akteure des politischen und historischen Ge-schehens. Das Bestreben von Nationalbewegungen ist es demnach, die eige-ne Gruppe innerhalb eines Nationalstaates (oder zumindest weitgehender Selbstverwaltung) zu organisieren. Der Titularnation wird dabei gegenüber Angehörigen anderer Nationen, die als «Minderheiten» mehr geduldet als akzeptiert werden, die führende Rolle zugeschrieben. Während sich ethnische Identität vor allem als ein Phänomen der alltägli-chen Praxis darstellt und daher ständig im Fluss ist, zeichnet sich Nationa-lismus durch ein höheres Maß an Verbindlichkeit und Explizitheit aus. Der Nationalismus verfügt über eine Reihe von kanonisierten Symbolen, Ritua-len und Mythen sowie ein relativ klar umrissenes Inventar von Vorstellun-gen über die eigene Gruppe. Nationalbewegungen, die sich auf eine ethni-sche Grundlage berufen, bergen gerade in Osteuropa häufig Konfliktpotenzi-al. Dieses manchmal als «Ethnonationalismus» bezeichnete Phänomen war für die Geschichte Osteuropas seit der Mitte des 19. Jahrhunderts von be-sonderer Bedeutung, mit den Höhepunkten in den zwei Phasen vom ausge-henden 19. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges sowie seit den späten 1980er-Jahren.
1. Ethnogenese und Nationsbildung
77
1.4.2 Nationsbildung in Osteuropa
Der Nationsbildungsprozess setzte in Osteuropa, je nach Region zu unter-schiedlichen Zeitpunkten, im 19. Jahrhundert ein und führte vor allem in Folge des Ersten Weltkrieges und nach dem Ende der sozialistischen Ära um 1989/91 zur Bildung von Nationalstaaten. Gerade die im Zusammenhang mit der Entstehung neuer Nationalstaaten seit den 1990er-Jahren auftretenden Konflikte sowie das vielerorts gespannte Verhältnis zwischen Mehrheitsna-tion und nationalen Minderheiten hat den Eindruck entstehen lassen, in Ost-europa sei der Nationalismus besonders tief in der Geschichte verankert. Aus historischer Sicht zeigt sich jedoch, dass die Konflikte zumeist jüngeren Datums sind und in dieser Form vor 150 Jahren noch nicht existiert hatten. Es ist vielmehr dem durchschlagenden Erfolg des Nationskonzeptes im Eu-ropa des 20. Jahrhunderts zuzuschreiben, dass heute solche Zusammenhänge oft ignoriert werden. In vielen Regionen Osteuropas herrschten noch im späten 19. Jahrhundert und in manchen Fällen weit darüber hinaus grund-sätzlich anders strukturierte Identitäten vor. Nationale Identität war nur eine unter vielen Formen der Gruppenzugehörigkeit. Die Zugehörigkeit zu einer Region oder einer Stadt, zu einem Reich oder einer Dynastie, zu einer be-stimmten sozioprofessionellen Gruppe, zu einem Klan- oder Familienver-band, zu einer Konfession oder Religionsgruppe, zu einer ethnischen oder einer Sprachgruppe, zu einer sozialen Schicht, einer Klasse oder einem Mi-lieu waren verschiedene Arten von Identitäten, die im Prinzip gleichwertig nebeneinander bestanden. Die Gewichtung der verschiedenen Loyalitäten ergab sich aus dem Kontext und konnte sich im Laufe eines Lebens in Ab-hängigkeit von Ort, Tätigkeit oder Gesprächspartner ändern und fließend ineinander übergehen. Der Nationalismus hingegen verstand sich als Substi-tut, der all diese Identitäten überlagerte und sie, wenn schon nicht komplett verdrängte, sich zumindest hierarchisch unterordnete. Er strebte dazu eine Nivellierung kultureller Unterschiede und die Etablierung einer vorherr-schenden «nationalen» Kultur an. Die Entstehung eines nationalen Bewusstseins wird oft als ein nach Miroslav Hroch grob in drei Stufen verlaufender Prozess betrachtet. In einer ersten Phase begann sich ein kleiner Kreis von Intellektuellen oder Geistlichen mit kulturellen Fragen einer benachteiligten Gruppe auseinanderzusetzen. Durch die Feststellung kultureller Gemeinsamkeiten sollte so das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit geschärft werden, ohne dass aber bereits konkrete politische Ziele verfolgt wurden. In einem zweiten Schritt mündete eine solche Beschäftigung in die Erhebung politischer Forderungen, etwa nach mehr Rechten für die jeweilige Gruppe. In der dritten Stufe schließlich wur-de die anfänglich von einer kleinen Elite getragene Bewegung zu einem Massenphänomen, welche die Mehrheit der jeweiligen Bevölkerung umfass-
Teil B: Systematischer Teil
78
te. Je nach Kontext waren unterschiedliche Gruppen die Träger der Natio-nalbewegung. In Ungarn war es besonders der Adel, der seit dem ausgehen-den 18. Jahrhundert aktiv die Umwandlung der ständischen Adelsnation in eine moderne Nation betrieb. Bei den Slowaken hingegen fehlte eine eigene Adelsnation, weshalb es hier Gelehrte und Geistliche waren, die als Erste nationale Forderungen erhoben. Der kirchliche Bereich spielte vor allem in Südosteuropa die Hauptrolle bei der Entstehung von Nationalbewegungen (vgl. Religion und Nationalismus in Südosteuropa, S. 118). Das Osmanische Reich teilte im 19. Jahrhundert seine Untertanen gemäß ihrer religiösen Zu-gehörigkeit in nationale Gruppen ein. Die christliche Bevölkerung des Bal-kans verfügte außer den Kirchen über keine anderen Institutionen, die als Träger eines eigenen Bewusstsein zu Vordenkern der Nationalbewegungen hätten werden können. Die während der osmanischen Herrschaft aufrechter-haltene Schrifttradition in den «Volkssprachen» oder die Verehrung «natio-naler» Heiliger (etwa Sava in Serbien) waren Ansatzpunkte für die Entwick-lung nationaler Identitäten. Teilweise damit vergleichbar trugen auch die mit Rom unierten (> Glossar) Kirchen nach orthodoxem Ritus bei den sieben-bürgischen Rumänen und bei den Ruthenen wesentlich zur Entstehung der rumänischen bzw. ukrainischen Nationalbewegung bei. Die Nationalstaaten Osteuropas waren so Errungenschaften einer ver-gleichsweise kleinen, national gesinnten Elite und entstanden meist, bevor eine Massenbasis der jeweiligen Nationalbewegung existierte. Die Eliten verstanden die nationale «Erweckung» breiter Bevölkerungsschichten als Mission. Sie legitimierten die Existenz des Nationalstaates oft mit dem Ver-weis auf vormoderne Reiche, in denen die jeweilige nationale Gruppe über eine später abhanden gekommene Selbstbestimmung verfügt habe. In dieser Hinsicht war die Schaffung von Nationen keine Innovation, sondern sollte die Handlungsfähigkeit nationaler Gruppen wiederherstellen. Dementspre-chend betrieben die Eliten der jungen Nationalstaaten eine forcierte Nationa-lisierungspolitik der Bevölkerung, um die Fiktion einer homogenen Nation zu verwirklichen. Insofern wäre es zutreffender, anstelle von Nationalstaaten von «nationalisierenden Staaten» zu sprechen. Die nationalisierenden Staaten griffen dabei auf verschiedene Mittel zurück, um in der Bevölkerung ein flächendeckendes Bewusstsein der Nationszuge-hörigkeit zu schaffen. Von hoher Bedeutung war die allgemeine Schul-pflicht, die teilweise schon im 18. Jahrhundert festgeschrieben wurde (Preu-ßen, Habsburger Reich) und sich seit dem 19. Jahrhundert allmählich in ganz Osteuropa zu verbreiten begann. Die staatliche Elementarbildung setzte sich die patriotische Erziehung und die staatsbürgerliche Integration zum Ziel, indem bereits Kinder zur Identifikation mit nationalen Werten angehalten wurden. Männer erhielten überdies im Militärdienst nicht nur eine stark nati-onal aufgeladene Instruktion, sondern erlebten in der soldatischen Gemein-
1. Ethnogenese und Nationsbildung
79
schaft eine überlokale Zusammengehörigkeit jenseits traditioneller Identi-tätsformen. Die zunehmende Identifizierung breiter Bevölkerungsschichten mit nationalen Werten zeigt sich etwa in der im 19. Jahrhundert einsetzenden «Nationalisierung» der Namen, die zwar manchmal mit Zwang von oben durchgesetzt wurde, viel häufiger aber freiwillig erfolgte. Dabei waren nicht nur Nachnamen betroffen, die etwa durch das Anhängen einer entsprechen-den Endung an verbreitete Muster der Namensbildung in der jeweiligen Na-tionalsprache angepasst wurden. Auch bei der Taufe von Kindern orientier-ten sich die Eltern oder staatliche Behörden nun vermehrt daran, Namen zu verwenden, die nationale Zugehörigkeit markierten. In Rumänien etwa, das sich auf das antike römische Erbe berief, wurden antikisierende Namen wie Ovidiu, Traian oder Cezar populär, bei den Ungarn dementsprechend Namen wie Attila, Magor und Árpád, die auf die reiternomadische Herkunft der Magyaren anspielen, während bei den Bulgaren Namen mittelalterlicher Herrscher wie Asen, Krum oder Ivajlo in Mode kamen. Das Ausmaß der nationalen Homogenisierung im Laufe des 20. Jahrhunderts soll stellvertretend anhand weniger Beispiele demonstriert werden. In der heutigen slowakischen Hauptstadt Pressburg (Bratislava) deklarierten sich 1910 in der damals zum ungarischen Teil der Habsburger Monarchie gehö-renden Stadt 15 % der Bewohner als Slowaken, je gut über 40 % als Ungarn und Deutsche. Am Anfang des 21. Jahrhunderts bezeichneten sich 92 % der Stadtbewohner als Slowaken und 4 % als Ungarn; die Zahl der Deutschen lag deutlich unter 1 %. Noch deutlicher sind die Veränderungen im Falle der heutigen litauischen Hauptstadt Vilnius. Ende des 19. Jahrhunderts lag der Bevölkerungsanteil in der damals zum Zarenreich gehörenden Stadt gemäß Volkszählungsresultaten bei den Juden bei etwas unter 50 %, erreichte bei den Polen gut 30 %, bei den Russen rund 20 % und bei den Litauern nur etwa 2 %. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ergab eine Volkszählung etwas weniger als 60 % Litauer, knapp 20 % Polen, knapp 15 % Russen und deut-lich weniger als 1 % Juden. Im makedonischen Ohrid schließlich wohnten gemäß einer Erhebung in der damals noch osmanischen Stadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts 54 % Makedonier (in damaliger Terminologie Bulgaren), 34 % Türken und neben einer Zahl kleinerer Minderheiten etwas mehr als 5 % Albaner. Während der Anteil Letzterer konstant blieb, stellten die Ma-kedonier 2002 85 % der Bevölkerung, als Türken deklarierten sich nur noch 4 %. Vergleichbare demografische Umwälzungen waren im Osteuropa des 20. Jahrhunderts vielerorts die Regel, auch wenn sie gewiss in den Städten als Brennpunkten der nationalen Auseinandersetzungen und dem Ziel aus-wärtiger Arbeitsmigranten in der Regel radikaler ausfielen als in ländlichen Regionen. Dennoch verdeutlichen die Beispiele die Resultate der Homogeni-sierungsbemühungen der jeweiligen Nationalstaaten. Neben Vertreibungen
Teil B: Systematischer Teil
80
und Ermordungen in Kriegszeiten spielten dabei auch Wanderungsbewegun-gen wie die massive Ansiedlung von Angehörigen der Titularnation eine zentrale Rolle. Doch auch die Erhebungen dieser Zahlen selbst, die Metho-dologie und Interpretation der Zählungen sowie der Druck, sich dabei als Angehöriger der Staatsnation zu deklarieren, trugen häufig zu massiven Ver-schiebungen der Mehrheitsverhältnisse zugunsten der Titularnation bei, zu-mindest auf dem Papier. Die nationale Zugehörigkeit wurde dabei oft an der Sprache festgemacht, die praktisch überall in Osteuropa in Anknüpfung an romantische Nationskon-zepte insbesondere aus dem deutschen Sprachraum (Herder) zum Kern-merkmal nationaler Zugehörigkeit erhoben wurden. Die Nationalbewegun-gen dieses Raumes gingen daher durchwegs von einer «Kulturnation» aus, die im Gegensatz zur «Staatsnation», wie sie besonders deutlich im französi-schen Fall hervortritt, nicht durch die Staatsbürgerschaft begründet wird. Denn angesichts der dominierenden Großreiche hätte in Osteuropa das Kon-zept der Staatsnation nur einen auf das gesamte Imperium bezogenen Reichspatriotismus bedeuten können, der jedoch immer mehr von einer auf kleinere, sich häufig sprachlich definierende Gruppen bezogene Identität abgelöst wurde. Doch ein Blick auf die auch Ende des 19. Jahrhunderts vielfach noch vor-herrschenden eher diffusen als expliziten Formen vormoderner Identitäten zeigt, dass es meist gerade nicht sprachliche oder andere kulturelle Merkma-le waren, die zur Identifizierung mit einer bestimmten Nation führten, son-dern dass umgekehrt die Wahl der Nationszugehörigkeit über die Sprache entschied. Mehrsprachigkeit war vielerorts die Regel. So konnten ein Identi-tätswandel und damit ein Sprachwechsel auch bei sprachlich derart unter-schiedlichen Gruppen wie Deutschen und Ungarn in großem Ausmaß statt-finden. Insbesondere die noch bis weit ins 19. Jahrhundert zahlenmäßig do-minierende deutschsprachige Bevölkerung der Städte im zentralen und süd-lichen Teil Ungarns nahm besonders seit dem letzten Viertel des 19. Jahr-hunderts magyarische Identität und Sprache an. Deutlich weniger ausgeprägt war dieser Prozess bei der national vielfach noch indifferenten ländlichen Bevölkerung deutscher Sprache in den südlichen Landesteilen. Es zeigt sich, dass entgegen der Sicht von Nationen als kulturellen Gruppen oft soziale Gründe weitaus wichtiger waren bei der Wahl der Nationszugehörigkeit als kulturelle Faktoren wie Sprache. Vielmehr wurden Nationalsprachen kodifi-ziert bzw. geschaffen, um nachträglich die Entstehung von Nationalstaaten zu rechtfertigen. So sagten sich die Kroaten in den 1990er-Jahren bewusst von der gemeinsamen serbokroatischen Sprache los und propagieren seither die kroatische Sprache in bewusster und vielfach gezwungener Abgrenzung vom Serbischen, obwohl die dialektalen Unterschiede zwischen beiden Vari-
1. Ethnogenese und Nationsbildung
81
anten geringer sind als zwischen den Dialekten innerhalb des deutschen Sprachraumes. Beispiele für einen Ausdifferenzierungsprozess, der zur Verdrängung multip-ler Identitäten und zur Reduktion auf das Bewusstsein der exklusiven Zugehö-rigkeit zu einer Nation führte, lassen sich für praktisch alle Regionen Osteuro-pas identifizieren. So förderte beispielsweise der zwischen Deutsch- und Tschechischsprachigen in Mähren realisierte «Mährischen Ausgleich» von 1905, der die Entspannung der Nationalitätenfrage anstrebte, gerade die Pola-risierung unter nationalen Vorzeichen. Die gesetzlichen Vorgaben zielten auf eine Trennung des Schulwesens, politischer und administrativer Institutionen zwischen Deutschen und Tschechen. Die Konsequenz war, dass jede Person sich zu einer der beiden Gruppen bekennen musste. Nationale Indifferenz, ein primär auf die gesamte Monarchie bezogener Habsburgischer Reichspatrio-tismus, auf die Herkunftsregion (Mähren), die Heimatstadt oder die Konfessi-on gründende Identitäten wurden so überlagert und vom alles durchdringenden Nationskonzept abgelöst: Spätestens jetzt musste sich jede Person entscheiden, ob sie als Deutscher oder als Tscheche gelten wollte. Vor ähnlichen Fragen standen auch die Bewohner Makedoniens, das bis 1912 Teil des Osmanischen Reiches war. Griechenland, Bulgarien und Ser-bien erhoben Anspruch auf die Region, Rumänien versuchte gleichermaßen seinen Einfluss geltend zu machen. Alle diese Staaten strebten danach, die Bevölkerung Makedoniens oder doch zumindest Teile davon für die eigene Nation zu reklamieren. Erst die Aufteilung Makedoniens zwischen Grie-chenland, Serbien und Bulgarien in den Balkankriegen 1912/13 ermöglich-ten es diesen Staaten, in der Folge das eigene Nationskonzept verstärkt vo-ranzutreiben. Administrative und kulturelle Vereinheitlichungsmaßnahmen, Einschüchterungen und Unterdrückung von Personen, die sich nicht zur Ti-tularnation bekannten, bis hin zu Vertreibungen bezweckten, eine homogene nationale Identität herbeizuführen. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildete lediglich die jugoslawische Nationaliätenpolitik nach dem Zweiten Welt-krieg, die von den serbischen Vereinnahmungsversuchen der Vorkriegszeit abrückte und eine eigenständige makedonische Nation propagierte. Die sla-wische Bevölkerung nahm das makedonische Identitätsangebot als Alterna-tive zum Bekenntnis zur serbischen oder bulgarischen Nation an. Durch die gezielte Förderung von Seiten des jugoslawischen Staates entstand so die neue Nation. Dieses Beispiel der erst 1945 richtig einsetzenden Nationsbildung zeigt, wie der Erfolg solcher Prozesse von äußeren Umständen wesentlich mitbedingt war. Viele Nationsbildungen können daher zugespitzt als Zufallsprodukt bezeichnet werden. Gerade in der Frühphase nationaler Entwicklungen kam es regelmäßig zu Auseinandersetzungen um die Frage, wie die eigene Nation
Teil B: Systematischer Teil
82
zu konzipieren sei. Dass die Slowaken schließlich eine von den Tschechen getrennte, wenn auch erst später Massencharakter annehmende Nationsbil-dung durchliefen, war noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unklar. Ähnlich bestand auch in Kroatien in dieser Zeit die Vorstellung einer alle Südslawen umfassenden Nation der «Illyrer». Die aufgrund der Zugehörig-keit zu unterschiedlichen Staaten bzw. Reichshälften gemachten Erfahrun-gen von Tschechen und Slowaken wie auch von Kroaten und Serben waren einer unter diversen Gründen für die Entwicklung separater Identitäten. Ähnlich beruht auch die Ausdifferenzierung einer moskovitischen bzw. rus-sischen auf der einen und einer ruthenischen bzw. ukrainischen sowie weiß-russischen Identität auf der anderen Seite wesentlich auf der unterschiedli-chen Reichszugehörigkeit der einst in der Kiever Rus’ vereinten Ostslawen. Die Entstehung eines Nationszugehörigkeitsgefühls ist daher keineswegs selbstverständlich, sondern in jedem Fall erklärungsbedürftig. Nur ein inten-siver Nationsbildungsprozess führt zu nationaler Identität; wo dieser fehlt, können manchmal auch engste sprachlich-kulturelle Gemeinsamkeiten die Entstehung unterschiedlicher Identitäten nicht verhindern. Die Bildung einer eigenen moldauischen Nationalidentität in Bessarabien, der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau, illustriert dies beispielhaft. Die Entstehung einer moldauischen Nation innerhalb der UdSSR geht auf die 1812 erfolgte Ab-trennung Bessarabiens vom historischen Fürstentum Moldau zurück, das 1859 im rumänischen Staat aufging. Während der rumänische Teil von ei-nem Nationsbildungsprozess erfasst wurde, blieb das zum Zarenreich gehö-rende Bessarabien davon ausgeschlossen. Eine Integration in die rumänische Nation fand auch in den gut zwei Jahrzehnten der Zugehörigkeit zu Rumä-nien während der Zwischenkriegszeit nicht statt. Mit der Eingliederung in die Sowjetunion 1944 konnte daher die sowjetische Nationalitätenpolitik, der makedonischen Nationsbildung nicht unähnlich, eine eigene moldauische Nationalidentität schaffen. Diese hat auch mit der Unabhängigkeit der Repu-blik Moldau und trotz der mit Rumänien geteilten Sprache Bestand. Ver-gleichbar der Entstehung zweier deutschsprachiger Nationalstaaten (Deutschland und Österreich) waren hier politische und nicht sprachlich-kulturelle Gründe ausschlaggebend für die separate Nationsbildung. Es war ein Charakteristikum der sowjetischen Nationalitätenpolitik, ver-schiedenen sprachlich-kulturell definierten Gruppen eine eigenständige Exis-tenz zu gewähren. Grundlage bildete der ideologische Internationalismus der sozialistischen Bewegung und die Ablehnung der Russifizierungspolitik des späten Zarenreiches, das als «Völkerkerker» geschmäht wurde. Als Inspira-tionsquelle für den Umgang mit Nationalitäten dienten den Bol’ševiki (> Glossar) die Verhältnisse im Habsburger Reich. Darauf aufbauend entwi-ckelte sich seit den frühen 1920er-Jahren, wesentlich mitgeprägt durch Sta-lin, die spezifisch sowjetische Form des Umgangs mit der Nationalitätenfra-
1. Ethnogenese und Nationsbildung
83
ge. Gemäß einer häufig zitierten Formel sollten die sowjetischen Nationalitä-ten national in der Form, aber sozialistisch im Inhalt sein. Die Vermittlung der ideologischen Basis des sozialistischen Systems hatte Vorrang, das Zu-geständnis ethnisch-nationaler Unterschiede war bloß ein Mittel zum Zweck, um die großteils noch analphabetische Masse der Bevölkerung anzusprechen und zu mobilisieren. Die Eliten der jungen Sowjetunion versprachen sich von einem Abrücken von der forcierten Russifizierung eine verstärkte Integ-rationskraft der im Aufbau begriffenen sozialistischen Gesellschaft und eine Festigung ihrer Herrschaft. Zentrales Element dieser Politik war es, territorial-administrative Einheiten zu schaffen, die jeweils einer Titularnation zugeordnet waren. Auf der obers-ten Ebene handelte es sich dabei um die Sowjetrepubliken, innerhalb derer auf einer untergeordneten Ebene weitere Gebietskörperschaften mit unter-schiedlicher Bezeichnung bestanden. Im Rahmen der als korenizacija (> Glossar) bezeichnete Politik der 1920er- und frühen 1930er-Jahre baute das sowjetische Zentrum gezielt lokale, der jeweiligen Titularnation zuge-rechnete Eliten auf und trieb die Etablierung der jeweiligen Sprachen in Verwaltung, Bildungswesen und Publizistik voran. In manchen Fällen stieß die sowjetische Politik damit von außen den Entstehungsprozess einer natio-nalen Identität an, die erst nach und nach von den betreffenden Eliten und breiten Bevölkerungsschichten übernommen wurde. Insbesondere bei vielen kleinen Völkern des russischen Nordens und Sibiriens, aber auch weiter Teile Zentralasiens konnte man dabei nicht einmal auf ein zumindest rudi-mentäres nationales Bewusstsein einer Elite zurückgreifen. Vielmehr war es hier die meist russophone sowjetische Elite, die nach ethnografisch-linguistischen Kriterien Nationalitäten definierte. Auch im europäischen Teil der UdSSR ging in manchen Fällen die Initiative, die einen Nationsbil-dungsprozess erst in Gang brachte, von der sowjetischen Führung aus, so im Falle der Weißrussen, die zuvor keine eigentliche Nationalbewegung entwi-ckelt hatten. Indem es entsprechende Territorialeinheiten und Schriftsprachen schuf, gab das Zentrum damit die ethnisch-nationalen Kategorien vor, zu denen sich die Menschen bekennen konnten. Dabei stützte sich die Gruppeneinteilung viel-fach auf ältere Vorgaben wie etwa die Unterscheidung zwischen Nomaden und Sesshaften. Die Vorstellung von national verfassten Völkern auf kultu-rell-sprachlicher Grundlage wurde damit flächendeckend über die gesamte Sowjetunion verbreitet. Die von außen an die Menschen herangetragenen Kategorisierungen verfestigten sich mit der Zeit und wurden allmählich auch in der Selbstwahrnehmung der Betroffenen akzeptiert. Das Bekenntnis zu den von oben vorgegebenen Kategorien eröffneten etwa neuen Karrieremög-lichkeiten in den Institutionen der national definierten Verwaltungseinheiten. Eine allgemeine, forcierte Russifizierung fand innerhalb der Sowjetunion
Teil B: Systematischer Teil
84
genauso wenig statt wie in der Zeit des Zarenreiches. Zwar war Russifizie-rung dem Russländischen Imperium wie der UdSSR nicht völlig fremd, sie war jedoch auf gewisse Phasen und bestimmte Regionen begrenzt. Auch wenn russisch die unbestrittene lingua franca innerhalb der Sowjetunion darstellte und die Eliten auch außerhalb des russischen Kerngebietes oft aus zugewanderten Personen russischer Herkunft bestanden, erstarkten doch gerade während der Sowjetzeit in vielen Fällen nichtrussische Identitäten. Der unter Stalin in den 1930er-Jahren aufkommende Sowjetpatriotismus, der im Zweiten Weltkrieg einen Höhepunkt erreichte, bediente sich zwar aus dem Repertoire des chauvinistischen russischen Nationalismus, führte je-doch nicht zu einer Verdrängung nichtrussischer Identitäten. Aufgrund der zwar kulturell definierten, aber territorial institutionalisierten Nationalitäten war die sowjetische Nationalitätenpolitik allerdings nicht frei von Widersprüchen. In nicht wenigen Fällen stellte die Titularnation in der Territorialeinheit keine absolute Mehrheit dar oder war gar deutlich in der Minderheit. Auch lebten oft große Teile der Titularnation außerhalb «ihrer» Republik oder des ihr zugesprochenen Territoriums. Dies lag nicht nur an der zu Sowjetzeiten deutlich erhöhten Mobilität der Bevölkerung, als primär in den Städten der nichtrussischen Territorien der Anteil der Russen durch Zuwanderung deutlich anstieg. Auch die praktische Unmöglichkeit, in der multiethnischen Sowjetunion ethnisch homogene Territorien auszusondern und die oft willkürlichen bzw. politischen Überlegungen gehorchenden Grenzziehungen führten zu einer einerseits territorial, andererseits kulturell definierten Doppeldeutigkeit der sowjetischen Nationalitäten. In dieser Konstellation wurzeln die seit den späten 1980er-Jahren ausbrechenden Konflikte auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Eigenstaatlichkeit erlangten ausschließlich die 15 als Unionsrepubliken innerhalb der UdSSR konstituierten Gebilde, wobei die sowjetischen Grenzen ausnahmslos beibe-halten wurden. Die Bevölkerung der neuen Staaten ist daher nicht deckungs-gleich mit den kulturell definierten nationalen Gruppen. Die weitgehend friedlich und überraschend schnell verlaufende Desintegra-tion der Sowjetunion ergab sich wesentlich aus der föderalen Struktur der Unionsrepubliken. Deren formalrechtlich gewährleistete autonome Stellung innerhalb der Union bis hin zum verfassungsmäßig zugesichertem Recht auf Austritt aus der UdSSR stand zwar ein faktischer Zentralismus gegenüber, der die Republiken bis Ende der 1980er-Jahre zu rein administrativen Ein-heiten degradierte. Dennoch gelang es den regionalen Eliten während der Perestrojka (> Glossar), den rechtlich festgeschriebenen Status faktisch mit Leben zu füllen. Die Unionsrepubliken verfügten bereits über viele Attribute von Nationalstaaten wie eigene Elite und Administration, Nationalsprache und -kultur oder Symbole wie Flaggen und Hymnen. Auf all diese Vorleis-
1. Ethnogenese und Nationsbildung
85
tungen konnten die institutionell von der Zentrale ermächtigten Eliten in den einzelnen Republiken zurückgreifen. Ihren Kampf um die Gewährung von mehr Kompetenzen durch die Zentrale entsprach in erster Linie den Interes-sen dieser Eliten, die sich größeren Entscheidungsspielraum wünschten. Zur Legitimation solcher Forderungen wurde auf die nationalen Gruppen rekur-riert. Nicht überall teilte die Bevölkerungsmehrheit solche Absichten. Mas-senzulauf erhielten Nationalbewegungen, die auf die Abspaltung von der Sowjetunion zielten, vor allem in den westlichen Regionen: in den baltischen Staaten, teilweise in der Westukraine, der Moldau und Georgien. Die Unab-hängigkeit der 15 Nachfolgestaaten der Sowjetunion war jedoch in erster Linie ein Produkt der einzelnen Republikseliten. In dieser Hinsicht ähnelt der Zerfall der Tschechoslowakei und Jugoslawiens der Auflösung der UdSSR – hier wie dort waren es Teile der politischen Eliten, die den gemeinsamen Staat, gegebenenfalls sogar ohne eine explizite Mehrheit dafür in der Bevölkerung zu finden, eigenen Interessen opferten. Dass die Auflösung des Bundesstaates einzig im jugoslawischen Fall zu einem Krieg führte, lag vor allem an der Haltung der Republiksführungen in Serbien und Kroatien, die Machtambitionen auch mit gewaltsamen Mitteln durchzu-setzen trachteten. Die Kriegshandlungen trugen daher weniger den Charakter spontaner Hassausbrüche in der Bevölkerung, sondern von gezielten Provoka-tionen und Angriffen regulärer Verbände und irregulärer Milizen, die in der Regel in zumindest loser Abhängigkeit von der serbischen und kroatischen Republiksführung agierten. Die Kriege wurden von den Eliten gezielt in Gang gebracht und von oben in die Bevölkerung getragen. Insofern war gerade in Bosnien ethnischer Hass eher eine Folge denn eine Ursache des Krieges, hatte doch das Zusammenleben der verschiedenen slawischen Gruppen bis kurz vor Kriegsbeginn relativ gut funktioniert. Die Menschen wurden erst durch den Krieg gezwungen, ihre oft fließenden Identitäten zugunsten eines eindeutigen Bekenntnisses zu einer Nation abzulegen. Dieser Befund stimmt mit Erkenntnissen neuerer Feldforschungen aus ver-schiedenen Gegenden Osteuropas überein. Sie zeigen, dass nationale Grup-pen kaum je die von außen wahrgenommene und von den jeweiligen Natio-nalbewegungen behauptete Geschlossenheit aufweisen. Selbst in nationalis-tisch stark aufgeladenen Kontexten erweisen sich nationale Antagonismen jenseits der politischen Ebene häufig nicht als unüberwindbare Barrieren zwischen den Menschen. Alternative Formen von Identität in Form von Lo-kalpatriotismus, den Stolz auf die Herkunft aus einer bestimmten Region oder Stadt, existieren auch heute, werden jedoch häufig durch die auf politi-scher Ebene dominierenden nationalen Diskurse verdeckt.
Teil B: Systematischer Teil
86
1.5 Forschungskontroversen • Die Frage nach der Identität und Kontinuität zwischen mittelalterli-
chen ethnischen Gruppen und modernen Nationen ist zwar insbeson-dere von der außerhalb Osteuropas betriebenen Forschung klar ver-worfen worden. Dennoch halten sich entsprechende Vorstellungen ge-rade in den Nationalhistoriografien dieses Raumes äußerst zäh. Impli-zit leiten sich daraus die vielfachen, oft schon über hundert Jahre alten Kontroversen zwischen benachbarten Nationen um das historische «Anrecht» auf bestimmte Regionen oder die ideelle Nachfolge vor-moderner Reiche. Der Ursprung der heutigen Nationen wird so oft bis ins Frühmittelalter oder gar darüber hinaus verlegt.
• Inwiefern Ethnizität und Nationalismus zusammenhängen, insbeson-dere auch im Falle Osteuropas, ist in der Forschung umstritten. Wäh-rend eine Seite davon ausgeht, dass der moderne Nationalismus eine mehr oder weniger kontinuierliche Weiterentwicklung vormoderner ethnischer Identitäten darstellt, betont eine andere Richtung stärker den Konstruktions- und Innovationscharakter des Nationalismus. Na-tionale Identität beruht demnach nicht auf Ethnizität, sondern stellt ei-ne davon unabhängige Entwicklung der Moderne dar.
• Zwar wird der Konstruktionscharakter ethnischer und nationaler Iden-titäten zumindest auf theoretischer Ebene heute kaum noch ernsthaft bestritten. In der historiografischen Praxis jedoch ist es immer noch üblich, von relativ fest gefügten nationalen Gruppen als historischen Akteuren auszugehen. Die Bedeutung ethnischer oder nationaler Ka-tegorien in einem konkreten Kontext wird nur selten problematisiert. Neuere Ansätze plädieren daher dafür, nicht Gruppen als kollektive Akteure in den Fokus der Forschung zu nehmen, sondern vor allem die alltäglichen Mechanismen und Prozesse in Betracht zu ziehen, die einen Bezug auf ethnische oder nationale Kategorien aufweisen (siehe etwa Brubaker: Nationalist politics). Nur aus Alltagshandlungen lasse sich, so die Überzeugung, die Relevanz und Wirkmächtigkeit ethni-scher bzw. nationaler Identität erkennen.
• Die in den 1990er-Jahren ausbrechenden Konflikte und Spannungen zwischen verschiedenen sich national definierenden Gruppen wird häufig mit zum Teil historisch weit zurückreichenden Auseinanderset-zungen erklärt. «Alter Hass» (ancient hatred) sei demnach während des Sozialismus (> Glossar) von den Regimen unterdrückt worden, um unmittelbar danach in alter Schärfe wieder zutage zu treten. Viel-fach werden dabei zwar die vorsozialistischen und die aktuellen Kon-flikte miteinander verglichen, die mehrere Jahrzehnte dauernde sozia-listische Phase jedoch ausgeblendet. Damit bleibt unklar, wie sich die-
1. Ethnogenese und Nationsbildung
87
se Konflikte unter den Bedingungen des Sozialismus konservieren und an nachkommende Generationen weitergegeben werden konnten. Ei-nige Autoren gehen daher davon aus, dass auch das sozialistische Ge-sellschaftssystem wesentlich dazu beigetragen hat, nationale Trennli-nien zu erhalten oder gar neu auszubilden. Der Kampf um knappe Ressourcen in einer Mangelwirtschaft könnte so die Menschen dazu bewegt haben, sich in eingespielten Loyalitätsverbänden zu gruppie-ren, um auf informellem Weg Zugang zu den benötigten Produkten und Dienstleistungen zu erhalten. Verknappung gewisser Güter konnte andererseits als Schuld einer bestimmten Gruppe interpretiert werden. Genauso sind auch institutionalisierte Formen der Einbeziehung ver-schiedener ethnischer oder nationaler Gruppen in den politisch-administrativen Bereich als Ausgangspunkte möglicher Konflikte ge-deutet worden.
Literatur zum Abschnitt B.1: Ethnogenese und Nationsbildung Ethnogenese, ethnische Gruppen
Barford, Paul M.: The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe, London 2001.
Brather, Sebastian: Archäologie der westlichen Slawen. Siedlung, Wirtschaft und Gesell-schaft im früh- und hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa, Berlin 2001.
Brather, Sebastian: Ethnische Interpretationen in der frühgeschichtlichen Archäologie. Ge-schichte, Grundlagen und Alternativen, Berlin 2004.
Čerenkov, Lev; Laederich, Stéphane: The Rroma, Otherwise Known as Gypsies, Gitanos, Gýftoi, Tsiganes, Ţigani, Çingene, Zigeuner, Bohémiens, Travellers, Fahrende, etc., 2 Bde, Basel 2004.
Clewing, Konrad: An den Grenzen der Geschichtswissenschaft: Albaner, Thraker und Illyrer, in: Genesin, Monica; Matzinger, Joachim (Hrsg.): Albanologische und balkanologische Stu-dien. Festschrift für Wilfried Fiedler, Hamburg 2005, S. 215–225.
Conte, Francis: Les Slaves: aux origines des civilisations d’Europe centrale et orientale (VIe–XIIIe siècles), Paris 1996.
Curta, Florin: The Making of the Slavs. History and Archeology of the Lower Danube Re-gion, c. 500–700, Cambridge 2001.
Dolukhanov, Pavel M: The Early Slavs. Eastern Europe From the Initial Settlement to the Kievan Rus, London u.a. 1996.
Du Nay, André: The Origins of the Rumanians. The Early History of the Rumanian Language, Toronto 21996.
Teil B: Systematischer Teil
88
Fodor, István: In Search for a New Homeland. The Prehistory of the Hungarian People and the Conquest, Budapest 1982.
Franklin, Simon; Jonathan Shepard: The Emergence of Rus 750–1200, London, New York 1996.
Friedrich, Karin: The Other Prussia. Royal Prussia, Poland and Liberty, 1596–1772, Cam-bridge 2000.
Golden, Peter B.: Nomads and Their Neighbours in the Russian Steppe. Turks, Khazars and Qipchaqs, Aldershot u.a. 2003.
Geary, Patrick J.: Europäische Völker im frühen Mittelalter. Zur Legende vom Werden der Nationen, Frankfurt/M. 2002.
Gimbutas, Marija: Die Balten. Urgeschichte eines Volkes im Ostseeraum, Frankfurt/M. u.a. 21991.
Goehrke, Carsten: Frühzeit des Ostslaventums, Darmstadt 1992.
Hänsel, Bernhard (Hrsg.): Die Völker Südosteuropas im 6. bis 8. Jahrhundert. München 1987.
Hermann, Joachim (Hrsg.): Welt der Slawen. Geschichte, Gesellschaft, Kultur. München 1986.
Illyés, Elemér: Ethnic continuity in the Carpatho-Danubian area, Boulder 1988.
Kazanski, Michel: Les Slaves: les origines (Ier–VIIe siècle après J.-C.), Paris 1999.
Lübke, Christian: Fremde im östlichen Europa. Von Gesellschaften ohne Staat zu verstaatlich-ten Gesellschaften (9.-11. Jahrhundert), Köln u.a. 2001.
Namsons, Andras: Die Völker des Baltikums und ihre Herkunft, in: Acta Baltica 23 (1983), S. 9–46.
Panzer, Baldur: Quellen zur slavischen Ethnogenese. Fakten, Mythen, Legenden. Frank-furt/M, 2002.
Pohl, Walter: Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa, 567–822 n. Chr., München 22002.
Pohl, Walter: «Völker» – ethnische Prozesse und Identitäten am Ende der Antike, in: Ders.: Die Völkerwanderung. Eroberung und Integration, Stuttgart 2002, S. 13–23.
Róna-Tas, András: Hungarians and Europe in the early Middle Ages. An introduction to early Hungarian history, Budapest 1999.
Ruzé, Alain: Ces Latins des Carpathes. Preuves de la continuité roumaine au nord du Danube, Berne u.a. 1989.
Schorkowitz, Dittmar: Die Herkunft der Ostslaven und die Anfänge des Kiever Reiches in der postsowjetischen Revision, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 48/4 (2000), S. 569–601.
1. Ethnogenese und Nationsbildung
89
Schramm, Gottfried: Altrusslands Anfang. Historische Schlüsse aus Namen, Wörtern und Texten zum 9. und 10. Jahrhundert, Freiburg im Breisgau 2002.
Schramm, Gottfried: Anfänge des albanischen Christentums. Die frühe Bekehrung der Bessen und ihre langen Folgen, Freiburg im Breisgau 1994.
Schramm, Gottfried: Ein Damm bricht. Die römische Donaugrenze und die Invasionen des 5.–7. Jahrhunderts im Lichte von Namen und Wörtern, München 1997.
Wolfram, Herwig (Hrsg.): Die Völker an der mittleren und unteren Donau im fünften und sechsten Jahrhundert, Wien 1980.
Ziemann, Daniel: Vom Wandervolk zur Großmacht. Die Entstehung Bulgariens im frühen Mittelalter (7.–9. Jahrhundert), Köln u.a. 2007.
Nationsbildung, Nationalismus
Brubaker, Rogers: Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe, Cambridge 1996.
Brubaker, Rogers; Feischmidt, Margit; Fox, Jon et al.: Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town, Princeton, Oxford 2006.
Brunnbauer, Ulf (Hrsg.): Umstrittene Identitäten. Ethnizität und Nationalität in Südosteuropa, Frankfurt/M. 2001.
Brunnbauer, Ulf: Vom Selbst und den Eigenen. Kollektive Identitäten, in: Kaser, Karl; Gru-ber, Siegfried; Pichler, Robert (Hrsg.): Historische Anthropologie im südöstlichen Europa. Eine Einführung, Wien u.a. 2003.
Clayer, Nathalie: Aux origins du nationalisme albanais. La naissance d’une nation ma-joritairement musulmane en Europe, Paris 2007.
Crowe, David M.: A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia, New York 2007.
Dogo, Marco; Franzinetti, Guido (Hrsg.): Disrupting and Reshaping. Early Stages of Nation-Building in the Balkans, Ravenna 2002.
Faensen, Johannes: Die albanische Nationalbewegung, Berlin 1980.
Freifeld, Alice: Nationalism and the Crowd in Liberal Hungary, 1848–1914, Washington 2000.
Gagnon, V. P., Jr.: The Myth of Ethnic War. Serbia and Croatia in the 1990s, Ithaca u.a. 2004.
Glassheim, Eagle: Noble nationalists. The transformation of the Bohemian aristocracy, Cam-bridge 2005.
Hirsch, Francine: Empire of Nations. Ethnographic knowledge & the Making of the Soviet Union, London u.a. 2005.
Hirschhausen, Ulrike von; Leonhard, Jörn (Hrsg.): Nationalismen in Europa. West- und Osteuropa im Vergleich, Göttingen 2001.
Teil B: Systematischer Teil
90
Hroch, Miroslav: Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Euro-pas. Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Schichtung der patriotischen Gruppen, Prag 1968.
Hroch, Miroslav: Das Europa der Nationen. Die moderne Nationsbildung im europäischen Vergleich, Göttingen 2005.
Judson, Pieter M.; Rozenblit, Marsha L. (Hrsg.): Construction Nationalities in East Central Europe, New York u.a. 2005.
Kappeler, Andreas: Der schwierige Weg zur Nation. Beiträge zur neueren Geschichte der Ukraine, Wien u.a. 2003.
King, Jeremy: Budweisers into Czechs and Germans. A Local History of Bohemian Politics, 1848–1948, Princeton 2002.
Kitromilides, Paschalis M.: «Imagined Communities» and the Origins of the National Ques-tion in the Balkans, in: European History Quarterly 19/2 (1989), S. 149–192.
Lampe, John; Mazower, Mark (Hrsg.): Ideologies and National Identities. The Case of Twen-tieth-Century Southeastern Europe, Budapest u.a. 2004.
Müller, Dietmar: Staatsbürger auf Widerruf. Juden und Muslime als Alteritätspartner im rumänischen und serbischen Nationscode. Ethnonationale Staatsbürgerschaftskonzepte 1878–1941, Wiesbaden 2005.
Olson, James S. et al. (Hrsg.): An Ethnohistorical dictionary of the Russian and Soviet empi-res, Westport 1994.
Petersen, Roger D.: Understanding Ethnic Violence. Fear, Hatred, and Resentment in Twenti-eth-Century Eastern Europe. Cambridge 2002.
Porter, Brian: When Nationalism Began to Hate. Imagining Modern Politics in Nineteenth-Century Poland. New York u.a. 2000.
Puttkamer, Joachim von: Schulalltag und nationale Integration in Ungarn. Slowaken, Rumä-nen und Siebenbürger Sachsen in der Auseinandersetzung mit der ungarischen Staatsidee, 1867–1914, München 2003.
Puttkamer, Joachim von: Nationalismus in Ostmitteleuropa – Eine Übersicht, in: Zeitenblicke 6/2 (2007) http://www.zeitenblicke.de/2007/2/puttkamer/index_html
Stauter-Halsted, Keely: The Nation in the Village. The Genesis of Peasant National Identity in Austrian Poland, 1848–1914, Ithaca 2001.
Simon, Gerhard: Nationalismus und Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion. Von der totali-tären Diktatur zur nachstalinistischen Gesellschaft, Baden-Baden 1986.
Snyder, Timothy: The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus 1569–1999, New Haven u.a. 2003.
Struve, Kai: Bauern und Nation in Galizien. Über Zugehörigkeit und soziale Emanzipation im 19. Jahrhundert, Göttingen 2005.
1. Ethnogenese und Nationsbildung
91
Suny, Ronald Grigor; Martin, Terry (Hrsg.): A State of Nations. Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin, Oxford 2001.
Thaler, Peter: Fluid Identities in Central European Borderlands, in: European History Quar-terly 31/4 (2001), S. 519–548.
Ther, Philipp; Sundhaussen, Holm (Hrsg.): Regionale Bewegungen und Regionalismen in europäischen Zwischenräumen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Marburg 2003.
Wingfield, Nancy M. (Hrsg.): Creating the Other. Ethnic Conflict and Nationalism in Habs-burg Central Europe, New York u.a. 2003.
Wingfield, Nancy Merriwether: Flag wars and stone saints. How the Bohemian lands became Czech, Cambridge 2007.
Weichlein, Siegfried: Nationalbewegungen und Nationalismus in Europa, Darmstadt 2006.
Wixman, Ronald: The Peoples of the USSR. An Ethnographic Handbook, Armonk 1984.
Zinkevičius, Zigmas; Luchtanas, Aleksiejus; Česnys, Gintautas: Woher wir stammen. Der Ursprung des litauischen Volkes, Vilnius 2005.
Teil B: Systematischer Teil
92
2. RELIGIONEN UND KONFESSIONEN
2.1 Themen und Fragen Für die Geschichte des östlichen Europa ist der Themenkomplex Religion ebenso konstitutiv wie für die übrigen Regionen Europas. Christianisierung, Reformation, Konfessionalisierung, Säkularisierung und religiöse Begrün-dung des Nationalismus bestimmten die historische Entwicklung Europas generell. In seinen östlichen Teilen verliefen diese Prozesse in vieler Hin-sicht anders oder fanden zum Teil gar nicht statt. Die grundlegenden Unter-schiede zu den Entwicklungen im Westen Europas ergaben sich aus zwei Umständen: 1. Der starke Anteil der Orthodoxie, die weder die Kreuzzüge des Mittelal-ters noch die Reformation (mit Einschränkung für die Grenzgebiete zwi-schen Orthodoxie und Katholizismus, etwa die orthodoxen Gebiete der Westukraine oder die westlichen Gebiete Weißrusslands, die von der Refor-mation beeinflusst wurden) und die Glaubenskriege oder die Hexenverfol-gungen der Frühen Neuzeit kannte. 2. Eine längere Einbindung in Vielvölkerreiche, die zum einen stärkere reli-giöse Vielfalt gewährte (längere Präsenz von Juden und Muslimen seit dem Mittelalter bis ins 19. Jhd.) und zum anderen das Spezifische im Verhältnis zwischen Religion und Nation begründete: Stärker als im übrigen Europa war die religiöse Aufladung der Nationalismen im östlichen Europa seit dem 19. Jahrhundert mit den imperialen Ordnungen verschränkt (Martin Schulze Wessel) – der des Russländischen Reiches in Osteuropa im engeren Sinne und einigen Teilen Ostmitteleuropas (Polen, Baltikum), der des Habsburger-reiches in Ostmitteleuropa und der des Osmanischen Reiches in Südosteuro-pa. Die Religion galt als Legitimationsressource für beide, für die Imperien wie für auch die Nationalbewegungen. Denn Imperien konnten weniger als Nationalstaaten auf kulturelle Homogenität setzen, Nationsentwürfe ohne staatliche Struktur bedurften verstärkt auch religiöser Integration. Als Gegenstand historischer Forschung lässt sich das Thema Religionen und Konfessionen in Osteuropa grob in drei Problemfelder aufteilen: • Religiöse Institutionen und ihre Träger: Die Beziehungen von Kirche
(als Institution), Klerus (als soziale Gruppe) und Staat stehen hier im Zentrum der Betrachtung. Die ältere Geschichtsschreibung räumt ins-besondere diesem Fragenkomplex einen gewichtigen Platz ein: Her-ausragende Persönlichkeiten der Kirchengeschichte, kirchliche Struk-turen und ihr Verhältnis zum Staat sowie die Bedeutung der Kirche für die Herausbildung des nationalen Selbstbewusstseins bilden das Hauptinteresse der Forschung in den jeweiligen nationalen Historio-grafien.
2. Religionen und Konfessionen
93
• Verhältnis von Kirche und Laiengemeinschaft: Die Fragen nach der Volksreligiosität und ihrem Verhältnis zur kirchlichen Dogmatik, Un-tersuchungen über Magie und Zauberglauben, nichtkirchliche Religi-onsgemeinschaften, religiöse Bewegungen und Abspaltungen sind zent-ral für dieses Themenfeld. In der neueren Forschung widmet man sich dieser Thematik stärker auf der Ebene der alltäglichen sozialen Praxis, während in der älteren Literatur in der Regel die kanonischen Lehrin-halte der jeweiligen Religionsgemeinschaften im Vordergrund standen.
• Zusammenleben von unterschiedlichen Religionen: In diesem Prob-lemfeld befasst sich die Forschung mit interkonfessionellen bzw. in-terkulturellen Kontakten und Konflikten. Für die Neuzeit bildet hier der Zusammenhang zwischen religiösen und nationalen Zugehörigkei-ten einen wesentlichen Problemkreis. Für die Osteuropäische Ge-schichte ist diese Thematik von besonderer Bedeutung, war doch die religiöse Vielfalt seit dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert und teil-weise darüber hinaus in den Vielvölkerreichen des östlichen Europa stärker ausgeprägt als im europäischen Westen.
Die neueren, kulturgeschichtlich orientierten Arbeiten aus dem Bereich Re-ligionen und Konfessionen in Osteuropa befassen sich stärker als bisher mit der Religiosität der Menschen – mit der Analyse der religiösen Alltagspraxis (Wahrnehmung und Bedeutung der Religion im Alltag, ihre Überlagerung mit anderen Zugehörigkeitskategorien wie Gender, Ethnizität/Nationalität, lokale Identifikation) und der interkonfessionellen bzw. interkulturellen Kontakte, statt ausschließlich von der dogmatischen Seite der Religion und den kirchlichen Strukturen auszugehen, wie dies in der älteren Historiografie häufig der Fall war. Die generellen Prozesse der Christianisierung, Konfes-sionalisierung und Säkularisierung, die das religiöse Leben im Osten und Westen Europas vom Mittelalter bis in die Neuzeit in großen Narrativen beschreiben, werden damit viel differenzierter gesehen.
2.2 Religionen und Konfessionen bis 1917 (Russland) bzw. 1945/48 (Ostmittel- und Südosteuropa)
2.2.1 Überblick über religiöse Gemeinschaften und Kirchen
Christentum
Orthodoxe Kirche (Orthodox = altgr. rechtgläubig): Zur orthodoxen Kirche gehören alle Ostslawen (außer den Rom angegliederten – unierten (> Glos-sar) – Minderheiten bei den Ukrainern und Weißrussen, die weiterhin den orthodoxen Ritus praktizieren), Serben, Bulgaren, Makedonier, Montenegri-ner, Rumänen, Griechen, Wolgafinnen, Permier, Chakassen, Tschuwaschen,
Teil B: Systematischer Teil
94
Karelier und Georgier sowie eine bedeutende Minderheit der Albaner (ca. 20 % 1967). Römisch-katholische Kirche (Katholisch = altgr. allgemein, allumfassend): Der römisch-katholischen Kirche gehören alle Westslawen (z. T. Minderhei-ten) außer teilweise den Sorben, ferner Kroaten, Slowenen, Litauer, Ungarn (mit prot. Minderheit) an. Protestantische Kirchen: Die protestantischen Kirchen bilden in den östli-chen Teilen Europas Finnen, Esten, Letten, die Hälfte der Sorben; Minder-heiten vor allem in Ungarn (ca. 25%), bei den Tschechen (ca. 10%) und Slowaken, historisch auch bei den diversen deutschen Gruppen in verschie-denen Regionen Osteuropas. Armenische apostolische Kirche: Der armenischen apostolischen Kirche gehören die Armenier an.
Islam
Im östlichen Europa sind Muslime fast ausschließlich Sunniten (> Glossar). Dieser religiösen Gemeinschaft gehören Albaner (über 60%), Bosnier (ca. 40%), alle turkotatarischen Völker (außer den Tschuwaschen), Pomaken (> Glossar) sowie türkische (in Bulgarien ca. 10% der Bevölkerung) und diverse andere Minderheiten auf dem Balkan wie etwa gewisse Roma-Gruppen an.
Judentum
Die europäische jüdische Kultur untergliedert sich in zwei Traditionen: die aschkenasische (> Glossar) und die sephardische (> Glossar). Als aschkena-sisch (v. hebr. Aschkenas – Deutschland) bezeichnen sich Jüdinnen und Ju-den, die ihre kulturelle Tradition im jüdischen Leben im mittelalterlichen Deutschland verwurzelt ansehen und das Jiddische als verbindende Sprache pflegen. Sephardisch (v. hebr. Sepharad – Spanien) nennen sich jene Jüdin-nen und Juden, die ihre spezifische kulturelle Prägung im mittelalterlichen spanischen und portugiesischen Judentum sehen. Sie betrachten sich als Nachkommen der 1492 aus Spanien und Portugal vertriebenen Juden, die Ladino als gemeinsame Sprache ansehen. Die aschkenasim lebten vor 1939 größtenteils in den Gebieten der ehemaligen polnisch-litauischen Adelsrepu-blik (Polen, Litauen, Weißrussland und der Ukraine) sowie in Böhmen und Mähren. Sie bildeten die Mehrheit des osteuropäischen Judentums. Sephar-dische Gemeinden ließen sich vor allem in den Gebieten des Osmanischen Reiches (Serbien, Bulgarien) nieder.
2. Religionen und Konfessionen
95
Buddhismus
Dem Buddhismus gehören Burjäten (Sibirien), Tuwiner (Altaj-Sajan-Gebiet, Südsibirien) und Kalmücken (Südrussische Steppe) an.
Animismus
Elemente animistischer (> Glossar) Traditionen sind in der religiösen Praxis aller späteren Glaubensrichtungen erhalten, die wenigen Animisten im östli-chen Europa, die ihrem traditionellen Glauben treu geblieben sind, bilden die indigenen Ethnien Sibiriens: Evenken (Tungusen), Ewenen, Chanten (Ostja-ken) in Westsibirien, Udegen im Südosten Sibiriens und andere. Die Christi-anisierung dieser Völker im 18. und 19. Jahrhundert konnte den traditionel-len Glauben nur oberflächlich zurückdrängen und führte zu synkretistischen Mischformen der Glaubenspraxis. Die spirituelle Führung übernehmen hier die Schamanen, die zwischen Jenseits und Diesseits vermitteln und als Me-dizinmänner und Zauberer fungieren. Zahlreiche Bewegungen der sogenann-ten Neuheiden knüpfen an das vorchristliche Erbe an – etwa in Litauen, wo die neuheidnische Bewegung stark mit der Neuformung des nationalen Selbstbewusstseins nach dem Zerfall der Sowjetunion verbunden ist.
2.2.2 Christianisierung: Unterschiede zwischen Ost- und Westkirche
Die Bekehrung der osteuropäischen Völker zum Christentum bedeutete eine wesentliche Erweiterung des kulturellen Raumes für die gesamteuropäische Welt der mittelalterlichen Herrschaftsverbände. Die Annahme des christlichen Glaubens sowie die Entstehung kirchlicher Strukturen im östlichen Europa erfolgten im Spannungsfeld der machtpolitischen Auseinandersetzungen zwischen West- und Ostrom (Byzanz) sowie im Kontext der Emanzipationsbestrebungen und der inneren Konsolidierung der neu entstehenden Herrschaftsverbände Osteuropas. Politische und kirchliche Bündnisse standen dabei in einem sehr engen Zusammenhang. Im 9. und 10. Jahrhundert wetteiferten die beiden kirchlichen Zentren – Rom und Konstantinopel – um die Missionierung der osteuropäischen Völker, so dass die heutigen Konfessionsgrenzen nicht von Anfang an feststanden. Die Herrscher des großmährischen Reiches (ca. 830–906) ließen ursprünglich Missionare aus Byzanz kommen – die Mönche Kyrill und Method, die als «Slawenapostel» in die Geschichte eingingen. Auch die ungarischen Herrscher gingen Bündnisse mit Byzanz ein, bevor sie sich allmählich stärker Rom zuwandten: Seit dem frühen 11. Jahrhundert begann der Ausbau der Kirchenorganisation nach dem lateinischen Ritus. Der Herrscher des
Teil B: Systematischer Teil
96
bulgarischen Reiches, Khan (> Glossar) Boris I. (852–889), suchte zunächst den Anschluss an die westliche Christenheit (Bündnisse mit Ludwig dem Deutschen gegen Mähren), ließ sich jedoch 865 auf Druck von Byzanz nach dem griechisch-orthodoxen Ritus taufen. Zwischen Rom und Konstantinopel schwankte auch die Kiever Rus’, bevor sie 988 unter Fürst Vladimir (980–1015) den griechisch-orthodoxen Glauben annahm, und Serbien (christiani-siert durch Byzanz im 8./9. Jhd., spätere Bündnisse mit Rom). Das Christentum diente als Legitimation für die neu entstandenen Herrschafts-gebiete und war außenpolitisches Mittel zum Zweck, sich bei den umliegen-den christlichen Herrschern als vertragstreuer Bündnispartner zu empfehlen. Die Wahl zwischen Ost- und Westrom entschieden bei den Herrschern Osteuropas vor allem die machtpolitischen Überlegungen: Allianzbildungen und Defensivbündnisse, um einseitige Abhängigkeiten zu vermeiden. Mit Ausnahme der späteren Litauer Großfürsten (erst 1386) sowie diverser Herrscher der Turkvölker (> Glossar, etwa der Wolgabulgaren > Glossar Bulgaren) oder der späteren Khane der Mongolen) waren die osteuropäischen Herrscherhäuser um das Jahr 1000 christianisiert. Die im 8. und 9. Jahrhundert noch fließenden Grenzen zwischen der weströmischen und der oströmischen Missionierung begannen sich seit dem Ende des 10. Jahrhunderts zu verfestigen. Die Auseinanderentwicklung der beiden Kirchen setzte mit dem Niedergang des weströmischen Reichs im 5. Jahrhundert ein: Bereits durch die Verle-gung der Hauptstadt des römischen Reichs von Rom nach Konstantinopel (330) und insbesondere nach dem Ende des weströmischen Kaisertums (476) kam es zu sehr unterschiedlichen politischen Konstellationen: Im Osten fun-gierte der Kaiser als politisches Machtzentrum, und die Kirche führte vier gleichrangige Patriarchen (> Glossar), von denen keiner Autorität über die anderen besaß (insgesamt wurde die christliche Kirche um diese Zeit nach dem Prinzip der Pentarchie von fünf Patriarchen geführt, zu denen bis ins 10. Jahrhundert auch jener von Rom gehörte). Im Westen wurde die Kontinuität einer zentralen politischen Macht gebrochen. An ihre Stelle traten zerstrittene Herrscher sowie der eine kirchliche Patriarch – der Bischof von Rom, der spätere römische Papst. Bald wurde der Papst zum einzig stabilisierenden Faktor der Westkirche und dadurch zu einer zentralen Autorität, die sich auch gegenüber den weltlichen Herrschern politisch engagierte. Das politische Element im Amtsverständnis verstärkte sich, als der Papst durch den karolingischen Herrscher Pippin III. (751–768) zum weltlichen Grundherrn des Kirchenstaats gemacht wurde und sich dadurch vermehrt auch in der Rolle eines weltlichen Monarchen sah. Die folgenden Streitigkeiten zwischen dem Papst und Byzanz über die Jurisdiktion und Besteuerung einzelner Gebiete Italiens wurden zum zusätzlichen Faktor bei der Entfremdung der beiden Kirchen. Nachdem Pippins Sohn, der
2. Religionen und Konfessionen
97
Frankenkönig Karl der Große (768–814), 800 von Papst Leo III. (gest. 816) ohne Rücksicht auf Konstantinopel zum Römischen Kaiser gekrönt worden war, vertiefte sich die Kluft zwischen Rom und Konstantinopel noch deutlicher. Als Datum für die Trennung zwischen der östlich-orthodoxen und der römisch-katholischen Kirche – auch «Morgenländisches Schisma» (Schis-ma – altgr. Spaltung) oder «Griechisches Schisma» genannt – gilt das Jahr 1054: Zwischen dem Papst und dem Patriarchen von Konstantinopel kam es zum Eklat und sie exkommunizierten sich gegenseitig. Die Ereignisse von 1054 wurden allerdings erst später zum Höhepunkt in der Auseinander-entwicklung zwischen Ost- und Westkirche erhoben. Dabei zog sich dieser Prozess vom 5. bis ins 15. Jahrhundert hin und war keineswegs geradlinig. Die Trennung zwischen Ost- und Westkirche erfolgte aufgrund einer fortschreitenden Entfremdung, die mit dem progressiven Wachstum der päpstlichen Autorität zusammenfiel. Kirchenpolitische Faktoren waren dabei ebenso entscheidend wie die allmähliche Entfremdung aufgrund unterschiedlicher politischer Entwicklungen und soziokultureller Besonderheiten (etwa der sprachlichen) in den jeweiligen Gebieten. Auch die Theologie hatte auf beiden Seiten unterschiedliche Schwerpunkte entwickelt, die sich zuerst gegenseitig befruchteten, dann aber durch den mangelnden Austausch zu einer Auseinanderentwicklung führten. Die wesentlichen Unterschiede betrafen die Auslegung der Dreifaltigkeit, den filioque-Zusatz (lat. und vom Sohn) im Glaubensbekenntnis (nach dem neuen Bekenntnis der fränkischen Kirche erging der Hl. Geist nicht nur vom Vater, sondern von Vater und Sohn), das Dogma der Erbsünde und die Bedeutung des Bischofsamts. Später (im 13. Jhd.) kam das katholische Dogma des Fegefeuers als ein weiterer Gegenstand des Streits dazu. Daneben war es auch bei weniger wesentlichen Fragen zu unterschiedlichen Entwicklungen gekommen: Im Osten konnten Priester heiraten, der Westen ging zum Zölibat über, es gab unterschiedliche Regelungen bezüglich des Fastens, im Westen wurde ungesäuertes Brot (Hostien) für die Eucharistie verwendet, im Osten normales, gesäuertes Brot. Die fundamentale Zweiteilung der mächtigsten religiösen Institution Europas beeinflusste stark die weitere kulturelle, geistesgeschichtliche und histori-sche Entwicklung des katholisch-abendländischen Teils Osteuropas auf der einen Seite und des orthodoxen auf der anderen. Wichtiger als theologische Unterschiede in Bezug auf den Ritus waren hierfür die theologischen Kon-zepte über das Verhältnis von Kirche und Staat. Prägend für Byzanz war die Lehre von der Harmonie (symphonia) zwischen der Kirche (sacerdotium) und der weltlichen Macht (imperium), entwickelt vom Hoftheologen des Kaisers Konstantin (306–337) und dem ersten Kir-
Teil B: Systematischer Teil
98
chenhistoriker, Eusebios von Caesareia (ca. 260–340). Historisch ließe sich diese Vorstellung unter anderem auf die Kontinuität von Kirche und Staat seit der Antike zurückführen. Dabei erkennt die Kirche den Kaiser als ihren Beschützer und als Garanten für die Einheit des Glaubens an. Ihren eigenen Einfluss beschränkt sie auf rein spirituelle Fragen, was etwa den Erhalt des orthodoxen Glaubens und der kirchlichen Ordnung betrifft. Diese Fragen können indessen auch politische Relevanz erhalten, wenn etwa der Kaiser gegen den Glauben verstößt. Denn der Kaiser unterstand der spirituellen Führung der Kirche, insofern er als Sohn der Kirche betrachtet wurde. Die byzantinische Konstellation im Verhältnis zwischen Staat und Kirche wurde in der älteren Literatur auch als Cäsaropapismus, Gottkaisertum, bezeichnet, was jedoch die komplizierte Beziehung zwischen Kaiser und Patriarch zu sehr vereinfacht. Zwar übte der Kaiser Aufsicht über die Kirche als Instituti-on, die ein Teil des Staates war, aus, doch kam ihm nie liturgische Kompe-tenz zu. Für die römisch-katholische Begründung der Beziehung zwischen Kirche und Staat war die Lehre des Augustinus (354–430) von den zwei unabhängi-gen Machtinstanzen – der Kirche und des Staates – von entscheidender Be-deutung. Der Einfall der Westgoten in Rom und dessen Zerstörung 410 be-wirkte einen tiefen Bruch in der Vorstellung von der Kontinuität des römi-schen Staates. Sie erschütterte die Gleichsetzung des christianisierten Rö-merreichs mit jener Gottesherrschaft, die dem christlichen Herrscher zu-stand: «Im Zeichen des Kreuzes wirst du siegen» (Kreuzeserscheinung bei der Schlacht des Kaisers Konstantin an der Milvischen Brücke 312). In der Folge wuchs das Papsttum allmählich zu einem unabhängigen Machtfaktor heran. Auf diese historische Konstellation geht die Lehre Augustinus’ von der Trennung zwischen Kirche und Staat zurück, die er um 420 in seinem Spätwerk «De civitate Dei» (lat. Über den Gottesstaat) begründete. Dabei interpretiert er die Geschichte der Menschheit als Kampf zwischen dem irdi-schen Staat (lat. civitas terrena) und dem Gottesstaat (lat. civitas dei), wie-derum in dualistischer Ausrichtung. Dieser wesentliche Unterschied in der theologischen Begründung der Bezie-hung zwischen Kirche und Staat in der Ost- und in der Westkirche darf je-doch nicht absolut gesetzt werden. Die «idealtypischen» Konzepte von Au-gustinus und Eusebios entsprachen nicht immer der machtpolitischen Reali-tät, weder in West- noch in Osteuropa. Dennoch prägten die unterschiedlichen Wege beider Kirchen wesentlich die weitere historische Entwicklung der Reiche und Herrschaftsverbände im östlichen Europa – entweder als Teil der katholisch-lateinischen oder der griechisch-slawisch-orthodoxen kulturellen Tradition.
2. Religionen und Konfessionen
99
2.2.3 Konfessionelle Grenze zwischen Ost- und Westkirche
Für die Entwicklung Europas generell und seiner östlichen Teile insbesondere bildete die historische konfessionelle Grenze zwischen der Ost- und Westkirche (der Orthodoxie auf der einen und dem römisch-katholischen Glauben, später auch den reformatorischen Bekenntnissen auf der anderen Seite) einen der grundlegenden Faktoren. Diese Grenze legte im östlichen Europa seit der Christianisierung je spezifische, nach der jeweiligen Sakralsprache – entweder kirchenslawisch oder griechisch auf der einen bzw. lateinisch auf der anderen Seite – geprägte kulturelle Fundamente. Von der Ostsee östlich der baltischen Völker verläuft diese Grenze entlang der westlichen Grenzgebiete der Ostslawen (Weißrussen und Ukrainer), folgt den Karpaten und der Grenze zwischen Serben/Montenegrinern und Kroaten bis an die Adriaküste. Die konfessionelle Grenze fällt somit im Wesentlichen mit der Grenze zwischen Ostmitteleuropa auf der einen und Südost- und Osteuropa im engeren Sinne auf der anderen Seite zusammen. Es ist jedoch keine starre Grenze. Vielmehr stellt das Gebiet, das sie durch-läuft, eine Kontakt- und Überlappungszone der west- und ostkirchlichen Traditionen dar. In Kroatien etwa – vor allem an der Küste – waren die glagolitische Schrift (die älteste slawische Schrift aus dem 9. Jhd.) und die kirchenslawische Gottesdienstordnung für die katholische Liturgie neben der römisch-lateinischen lokal bis ins 19. Jahrhundert in Gebrauch. Das Nebeneinander des Lateinischen und des Kirchenslawischen führte hier zur Entstehung einer heterogenen Schrift- und Textkultur in drei Alphabeten – dem lateinischen, dem glagolitischen und dem kyrillischen (die zweitälteste slawische Schrift aus dem 9./10. Jhd.). Die im 16./17. Jahrhundert entstan-denen unierten Kirchen Osteuropas – in Polen-Litauen und Ungarn (auf dem Gebiet der heutigen Ukraine), in Kroatien und Siebenbürgen – liefern ein weiteres Beispiel dafür, dass die konfessionelle Grenze zwischen Ost- und Westkirche auch Kompromisslösungen zuließ (vgl. Kirchenunionen, S. 101).
2.2.4 Reformation und Konfessionalisierung
Die Reformation sowie die anschließenden Prozesse der Konfessionalisie-rung betrafen vornehmlich Ostmitteleuropa. Auf das Großfürstentum Mos-kau sowie das orthodoxe Südosteuropa, das sich zu jenem Zeitpunkt unter direkter Herrschaft oder Oberhoheit (die Fürstentümer Moldau und Wala-chei) der Osmanen befand, wirkten sich die Spaltungen innerhalb der katho-lischen Kirche indirekt ebenso aus, als Folge von Migrationen oder wenn diese Entwicklungen Einfluss auf die Beziehungen zu den westlich gelege-nen Nachbarländern nahmen. Nicht unwesentlich war zudem die kulturelle Ausstrahlung der Reformation, etwa als Katalysator bei der Entstehung und
Teil B: Systematischer Teil
100
Verbreitung der rumänischen Schriftsprache oder bei der Konsolidierung und dem Ausbau der Orthodoxie an der Kiever Akademie, die der Metropo-lit von Kiev, Petro Mohyla (1596–1647), gegründet hatte. Auch die russisch-orthodoxe Kirche wurde um die Mitte des 17. Jahrhun-derts durch eine Spaltung im Zuge der liturgischen Reform des Patriarchen Nikon und der Herausbildung des Altgläubigentums erschüttert. Diese Ent-wicklung ist in einigen Aspekten – etwa in den Zielen, die Herrschaft mithil-fe der Vereinheitlichung religiöser Praxis zu festigen, und in den darauf fol-genden Protesten der Unterschichten – mit der Reformation vergleichbar, unterscheidet sich jedoch von der Spaltung der katholischen Kirche in inhalt-lichen Punkten wesentlich (vgl. Religiöser Dissens im Russländischen Reich: Altgläubige, S 110). In Nordost- und Ostmitteleuropa war die Reformation, abgesehen von den deutschen Bevölkerungsteilen, die dem Luthertum zuneigten, eine Angele-genheit der Adelsgesellschaften Böhmens (Hussiten > Glossar, Böhmische Brüder > Glossar), Livlands und Estlands (Lutheraner) sowie Polen-Litauens und Ungarns (Böhmische Brüder, Lutheraner, Calvinisten und Unitarier > Glossar). Mit Ausnahme von Ungarn (nur teilweise), Livland und Estland machte die Gegenreformation die Entwicklungen der Reformation größten-teils wieder rückgängig. Für die Habsburger Herrscher war die Stärkung des katholischen Glaubens ein politisches Mittel gegen den weitgehend refor-mierten Adel. Bereits vor der Lutherischen Reformation des 16. Jahrhunderts schlugen reformatorische Tendenzen in Böhmen und Mähren im Zuge der Bewegung um den Prager Magister Jan Hus (Hussiten) im 15. Jahrhundert tiefe Wur-zeln. Die aus dieser Bewegung hervorgegangenen «hussitischen Konfessio-nen» – die radikaleren Böhmischen Brüder (Ablehnung der katholischen Sakramente und des Priestertums, Pazifismus) und die gemäßigten Utra-quisten (> Glossar) – strahlten auf die Nachbarländer umso stärker aus, als die tschechischen Reformatoren während der Verfolgungen des 17. Jahrhunderts in noch größerer Zahl als zuvor fliehen mussten. In Ungarn wurde der Protestantismus zu einem identitätsstiftenden Element in der Abwehr des Machtanspruches der katholischen Habsburger durch die «natio hungarica» (= Adel). In Polen verbreitete sich die Reformation vorerst rasch, wenn auch die Lehren Roms im Zuge der Gegenreformation ihre einstige Vorherrschaft wieder zurückgewannen und die katholische Kirche später gar ein essenzieller Bestandteil des polnischen Nationalbewusstseins werden konnte. Insbesondere der Calvinismus, der in den 1550er-Jahren Polen erreichte, gewann einen großen Teil des polnischen Adels und der litauischen Magnaten (> Glossar) für sich. 1572 besaßen die Protestanten unter den weltlichen Mitgliedern des Senats die absolute Mehrheit. Einige
2. Religionen und Konfessionen
101
Jahre zuvor waren aus den polnischen Anhängern des Calvinismus die «Polnischen Brüder» hervorgegangen – auch als Unitarier, Antitrinitarier, Rakowianer, Sozinianer oder Arianer bekannt. Die «Brester Bibel» der Calvinisten von 1563 war ein Meilenstein auf dem Gebiet der verbreiteten volkssprachlichen Publikationen. Die Reformation und in der Folge auch die Gegenreformation schufen durch ihre Bildungsanstrengungen direkt oder indirekt (wie etwa bei Rumänen) die Grundlagen für die Entwicklung der ostmitteleuropäischen Volkssprachen zu Schriftsprachen (Esten, Letten, Litauer, Prussen, Kaschuben, Slowaken, Slowenen). Ebenso bewirkten sie eine vertiefte Integration des Raumes in die vom westlichen Europa ausstrahlenden Kulturströmungen von Renais-sance, Humanismus und Barock.
2.2.5 Kirchenunionen
Als Folge von Reformation, Gegenreformation, als die katholische Kirche sich der Herausforderung der Erneuerung stellte, sowie der Konfessionalisie-rung (Herausbildung von Landeskirchen sowie Festigung konfessioneller Gruppen) entstanden an der Berührungslinie des katholischen und des ortho-doxen Christentums im 16./17. Jahrhundert unierte Kirchen: Die Landesher-ren strebten eine Vereinheitlichung der religiösen Praxis und insbesondere der kirchlichen Jurisdiktion in ihren Gebieten an. War es nicht möglich, den katholischen Ritus durchzusetzen, schlossen die kirchlichen und weltlichen Eliten Kompromisse. Unter der Anerkennung des päpstlichen Primats und der katholischen Lehre konnten die unierten Gläubigengemeinden weiterhin orthodoxen Ritus und orthodoxes Kirchenrecht (vor allem Ehe für die weltliche Geistlichkeit) pflegen. Denn seit dem «Morgenländischen Schisma» zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche kam es zwar zu mehreren Versuchen, die Kirchenein-heit wiederherzustellen. Erreicht wurde sie nie. Die Union von Ferrara/Florenz (1438/39) war dabei der letzte Vorstoß, zur Einheit mit Teilen der orthodoxen Kirche zurückzukehren. Die Bedrohung Konstantinopels durch die Osmanen war dabei der ausschlagende Grund. Neben den machtpolitischen Interessen der jeweiligen Herrscher im östlichen und übrigen Europa war es die stän-disch-soziale Lage der Kirche und des Klerus in Ost- und Westkirche, die sich bis dahin zu stark auseinanderentwickelt hatte und die Vereinigung der Kir-chen unmöglich machte. Lediglich Teilunionen zwischen der katholischen und orthodoxen Kirche konnten später erreicht werden. Auf der Seite der Katholiken waren es vor allem die Landesherren, die eine konfessionelle Vereinheitlichung ihrer Untertanen anstrebten. Der orthodoxe Klerus der mehrheitlich katholischen Herrschaftsgebiete erhoffte von einer
Teil B: Systematischer Teil
102
Union mit Rom eine bessere rechtliche Stellung – etwa in Polen-Litauen. In stärker protestantisch oder calvinistisch beherrschten Gebieten konnte die katholische Seite durch solche Unionen ihre Position stärken (Siebenbürgen), die orthodoxe Bevölkerung sich wiederum dem konfessionellen Druck der protestantischen oder calvinistischen Grundherren entziehen (im ungarischen Transkarpatien bzw. der Karpato-Ukraine). Die orthodoxe Bevölkerung stand jedoch nur teilweise hinter den Unionsbestrebungen des Klerus. Vor allem jene orthodoxen Städter Litauens und Galiziens, die in den Laienbruderschaf-ten unter der direkten Jurisdiktion des Patriarchen von Konstantinopel organisiert waren, lehnten eine Union mit Rom ab. Als historisch am wichtigsten erwiesen sich die Unionen von Brest (Polen-Litauen 1595/96) und Siebenbürgen (1697/98–1700). Die daraus entstande-nen unierten Kirchen der Ukrainer Galiziens sowie der Rumänen Siebenbür-gens spielten als integrative kulturelle Institutionen bei der Herausbildung des modernen Nationalbewusstseins dieser Völker eine wichtige Rolle. Wei-tere Unionen kamen 1611 in Kroatien und 1646 bzw. 1701 im ungarischen Transkarpatien (Ungvár/Užgorod) zustande.
2.2.6 Die orthodoxe Ökumene
Die Stärkung bereits seit dem Mittelalter existierender oder in der Neuzeit errichteter autokephaler (> Glossar Autokephalie) Reichskirchen, den späteren nationalen Kirchen, ging im orthodoxen Teil des östlichen Europa mit der Festigung und Repräsentation nationaler Einheit einher. Denn der moderne Nationalismus war nicht zuletzt religiös begründet. So umfasst die orthodoxe Ökumene über ein Dutzend autokephaler Kirchen, die über eine autonome Verwaltungsstruktur verfügen, jedoch alle durch das ökumenische Konzil, das gemeinsame Dogma und die gemeinsame Tradition vereint sind. Sie reichen von der orthodoxen Kirche Russlands (1448 für unabhängig von Konstantinopel erklärt, 1589 vom ökum. Patriarchat anerkannt) bis zu den Kirchen Ostmittel- und Südosteuropas. Im mittelalterlichen Südosteuropa bestanden bis zur Expansion der Osmanen mehrere autokephale Reichskirchen nach byzantinischem Vorbild: in Bulgarien (927–1018 und 1235–1396) und in Serbien (1219–1459). Das autokephale Erzbistum von Ohrid bestand zwischen 1019/20 und 1767. Die Entstehung der autokephalen Kirchen Ostmittel- und Südosteuropas im 19. Jahrhundert ging mit dem Erstarken der nationalen Bewegungen innerhalb des Habsburgerreiches und der Herauslösung der jeweiligen Gebiete aus dem Osmanischen Reich und der Formierung von Nationalstaaten einher – in Griechenland (1833, 1850 vom ökum. Patriarchat anerkannt), Rumänien (1864, 1885 vom ökum. Patriarchat anerkannt), Bulgarien (1870, erst 1945
2. Religionen und Konfessionen
103
von Konstantinopel anerkannt) und Serbien (1879). Einige Kirchen erhielten ihren unabhängigen Status erst später: Polen (1924), Albanien (1922, 1937 vom ökum. Patriarchat anerkannt) und Makedonien (1967, bis heute von keiner anderen orthodoxen Kirche anerkannt). Mit ähnlichen Problemen wie in Makedonien werden heute auch Moldau, Montenegro und teilweise Weiß-russland konfrontiert. Im Anschluss an die kurze Zeit der unabhängigen Ukrainischen Volksrepublik (1918–1919) begründete die ukrainische orthodoxe Kirchenbewegung 1921 die ukrainische autokephale orthodoxe Kirche, die bis 1930 existierte. In der vorkommunistischen Zeit (bis 1917 für Russland bzw. 1945 für Ostmittel- und Südosteuropa) war die orthodoxe Kirche, wenn sie nicht Staatskirche war, häufig die dominierende, sie umfasste eine bedeutende Zahl von Gläubigen: 1897 zählte sie in Russland 87,1 Mio. Gläubige (67% der Gesamtbevölkerung) und umfasste die Mehrheit der Bevölkerung in Rumänien (17 Mio.), Griechenland (9 Mio.), Serbien (8 Mio.), Bulgarien (8 Mio.) und Georgien (5 Mio.).
2.2.7 Der Islam
Muslimische Bevölkerungsgruppen bestanden auf dem Balkan und Südosteuropa bereits im Hochmittelalter, wurden aber in der Folgezeit christianisiert. Von ihrer Herkunft her sind sie in den meisten Fällen den Turkvölkern zuzurechnen. Die gegenwärtigen islamischen Religions-gemeinschaften in diesem Raum gehen auf die Eroberung dieser Regionen durch das Osmanische Reich seit der Mitte des 14. Jahrhunderts zurück. Die Expansion der Osmanen führte dazu, dass sich nicht nur neue türkisch spre-chende Bevölkerungsgruppen aus Anatolien sowie andere Muslime aus den osmanischen und nichtosmanischen Teilen der islamischen Welt im südosteu-ropäischen Raum niederließen, sondern teilweise auch die einheimische christ-liche Bevölkerung zum Islam übertrat. Nach der Eroberung des Balkans durch die Osmanen konvertierten vor allem in zwei Regionen größere christliche Bevölkerungsgruppen zum Islam, näm-lich in Bosnien und den albanischen Siedlungsgebieten. Die Islamisierung Bosniens war ein komplexer Prozess und ist auf eine Reihe von Gründen zurückzuführen. Bedeutend war hier das Eintreten der Bosnier in die osma-nische Verwaltung oder in den Militärdienst sowie die Möglichkeit, die rechtlichen Privilegien eines Muslims zu erlangen. Einen gewichtigen Anteil an der islamisierten Bevölkerung Bosniens machten auch jene Sklaven aus, die aufgrund des Übertritts freigelassen wurden und sich in den bosnischen Städten niederließen. Ausschlaggebend für den Glaubenswechsel war jedoch in erster Linie die fehlende kirchliche Struktur. Zudem spielte dabei die Möglichkeit eines christlich-islamischen Synkretismus, der über Jahrhunder-te fortdauerte, eine wesentliche Rolle. Dies äußerte sich in der Verbreitung
Teil B: Systematischer Teil
104
des sogenannten «Volksislams», in dem sich vorislamische lokale kulturelle Elemente mit den islamischen vermischten. Dieses Phänomen geht zurück auf die Vermittlung des Islam in dieser Region durch die in Bruderschaften organisierten islamischen Mystiker, die mehrfache Zugehörigkeiten ihrer Anhänger und Sympathisanten tolerieren, und insbesondere den Derwisch-Orden. Im nahe am Reichszentrum gelegenen Rumelien (Bulgarien) siedel-ten die Osmanen Türken an, so sind noch heute ca. 10 % der Bevölkerung Bulgariens Muslime. Die muslimischen Gemeinden des Balkans und Südosteuropas gehören zum sunnitischen Islam. Außerhalb Südosteuropas bilden die Überreste der Tata-renkhanate muslimische Inseln innerhalb Russlands und in den Nachfolge-gebieten des Großfürstentums Litauen.
2.2.8 Judentum
Als Folge der spätmittelalterlichen Judenverfolgungen in Westeuropa wan-derte ein bedeutender Teil des aschkenasischen Judentums nach Polen-Litauen aus. Die jüdischen Gemeinden Polens genossen ein hohes Maß an Autonomie und waren zumindest im wirtschaftlichen Bereich den Nichtju-den häufig gleichgestellt. Dies ermöglichte ein Aufblühen jüdischer Gelehr-samkeit und ökonomische Prosperität der Gemeinden, die im 16. und 17. Jahr-hundert ihren Höhepunkt erreichten. Im 18. Jahrhundert dürften im weltweiten Vergleich zwischen 50 bis 80 % der jüdischen Bevölkerung hier gelebt haben. Krakau und Lublin, Wilno/Vilnius wie auch Prag konnten sich dabei zu den bedeutendsten kulturellen Zentren des Judentums in Osteuropa entwickeln. Im südosteuropäischen Raum wurde die Gemeinde von Saloniki/Thessaloniki zum geistigen Zentrum sephardischer Kultur. Die Verbundenheit mit der jü-dischen Tradition und Gelehrsamkeit sowie die tiefe Religiosität polnischer Jüdinnen und Juden diente später den «aufgeklärten» und stärker akkulturier-ten Juden des westlichen Europa, den sogenannten Westjuden, als Argument für die Postulierung kultureller Distanz und Hierarchie gegenüber den «Ost-juden». Diese pejorative Bezeichnung sollte analog der mentalen Karte Eu-ropas im 19. Jahrhundert die Distanz zwischen dem «zivilisierten» Westen und dem «rückständigen» Osten verdeutlichen. Die Kultur und religiöse Praxis der Jüdinnen und Juden im östlichen Europa war weder einheitlich noch gänzlich von ihrer nichtjüdischen sozialen Umgebung abgeschlossen. Religiöse Bewegungen und Abspaltungen erschütterten die Grundfesten des traditionellen rabbinischen oder seit der jüdischen Aufklärung des orthodoxen Judentums immer wieder. Eine der bedeutendsten Strömungen innerhalb des osteuropäischen Juden-tums war der Chassidismus (v. hebr. hassid – Fromme). Diese Bewegung
2. Religionen und Konfessionen
105
entstand um die Mitte des 18. Jahrhunderts im multikulturellen Raum Ost-mitteleuropas, in Podolien. Ihr Begründer, der legendäre Israel ben Elieser (1700–1760), genannt Bescht, lehrte eine Erneuerung traditioneller Fröm-migkeit durch mystische persönliche Erfahrungen. Statt der rabbinischen folgten die Chassiden der Autorität ihrer geistigen Lehrer, der Zaddiks (dt. Gerechte). Die neue Frömmigkeit der Chassiden verbreitete sich schnell in zahlreichen Gemeinden Podoliens, Galiziens, Kleinpolens, später der Ukrai-ne und Weißrusslands. Die Gegner reagierten mit heftigen Protesten, die viele Gemeinden entzweiten. Weit radikaler gingen mit der jüdischen Tradi-tion Mystiker im Umfeld von Jakub Frank (ca. 1726–1791) um. Ihre Ableh-nung einiger Grundfesten des traditionellen Judentums in messianischer Erwartung der Erlösung in Polen (statt im Gelobten Land) führte zu heftigen Konflikten mit ihren Kontrahenten: Sie wurden mit dem Bann belegt und traten mehrheitlich zum katholischen Glauben über. Sie praktizierten aller-dings weiterhin ihre spezifischen Riten und integrierten Elemente des Juden-tums und des Katholizismus in ihre Glaubenspraxis. Ältere Abspaltungen wie die Karaim (auch Karäer, Karaiten v. hebr. die Schriftkundigen) kamen bereits im Mittelalter aus dem orientalischen Raum (Persien, Mesopotamien) nach Byzanz (11. Jhd.) und später in das Großfürs-tentum Litauen (14. Jhd.). Auch in den pontischen Steppen und auf der Krim sind sie aus dem 12. und. 13. Jahrhundert bekannt. Im Gegensatz zum rabbini-schen Judentum lehnten sie den Talmud ab und ehrten nur die Heilige Schrift, hatten einen anderen Festkalender, andere Ehegesetze und Speisevorschriften. In Polen-Litauen und dem Russländischen Reich genossen sie weitgehende Privilegien. Die für die übrige jüdische Bevölkerung geltenden Restriktionen betrafen sie in der Regel nicht. Der Holocaust (> Glossar) hat die jüdischen Gemeinden und Kulturen in Ostmittel- sowie in Südosteuropa weitgehend ausgelöscht.
2.3 Vertiefender Exkurs I: Die orthodoxe Kirche in Russland
2.3.1 Herrscher und Kirche
Die byzantinische Tradition der Symphonia zwischen der weltlichen und der kirchlichen Macht bedeutete in der Moskauer Rus’ (1462–1689) ein Zusammenspiel beider Instanzen mit abgegrenzten Machtbereichen. Nicht umsonst fällt die zwischen 1448 und 1459 vollzogene Loslösung der russisch-orthodoxen Kirche von Byzanz mit der Konsolidierung Moskoviens als Reich zusammen. Als der neue Herrscher, Ivan III. (1462–1505), 1472 die Nichte des letzten byzantinischen Kaisers Konstantin XI. heiratete, sah er sich in der Nachfolge Byzanz’. Gestützt wurde dieser Anspruch zudem
Teil B: Systematischer Teil
106
durch die Theorie des «Dritten Roms» des Pskover Mönches Filofej aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Angesichts der Osmanischen Expansion auf dem byzantinischen Territorium fasste Filofej die Abfolge der christlichen Reiche so zusammen, dass Moskau nach Rom und Byzanz als zweitem Rom die Rolle des dritten Roms zukomme und damit die Verantwortung für die gesamte Christenheit. Die Verantwortung trage folglich der Moskauer Herrscher als «Zar aller Christen». Wenn auch Filofej diese Lehre nicht in erster Linie machtpolitisch dachte, konnte ein Selbstherrscher sie als religiöse Begründung eines umfassenden Machtanspruchs nutzen, auch für die Oberhoheit über die Kirche. Einzelne russische Herrscher der vorpetrinischen Periode (vor Peter I., bis 1682/89) verletzten die Grenzen des kirchlichen Machtbereiches, dennoch waren diese Eingriffe nicht regulär und gingen häufig auf persönliche Auseinandersetzungen zurück. Im Russländischen Reich der Periode nach Peter I. (1682/89–1917) verstärkte sich der Einfluss der weltlichen Macht auf die Kirche bedeutend. Zu den Hauptaufgaben der Kirche sollten dabei die Legitimation der weltlichen Herrschaft, die Seelsorge und zugleich die soziale Kontrolle über die orthodoxe Bevölkerung sowie die Volksbildung werden. Den Auftakt zu dieser Entwicklung bildete die Herrschaft des Zaren Peter I. (Peter der Große, 1682–1725; Alleinherrscher 1689–1725). 1721 hielt er die Umstrukturierung der Kirche nach dem Vorbild der protestantischen Kirchen Westeuropas im «Geistlichen Reglement» fest. Die Einschränkung der bischöflichen Macht sowie eine stärkere Einbindung der Geistlichkeit in den Verwaltungsapparat des Herrschers standen hier im Vordergrund. Anstelle eines Patriarchen schuf Peter I. den «Heiligsten Regierenden Synod» und stellte dieses Kollegialorgan unter die Aufsicht eines weltlichen Beamten, des Oberprokurors. Allerdings gewann der weltliche Oberprokuror des Hl. Synods erst im 19. Jahrhundert eine einflussreiche Position in der kirchlichen Administration. Die verstärkte Einmischung des Staates in die kirchlichen Angelegenheiten führte gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu Spannungen, so dass selbst die erzkonservative Geistlichkeit radikale Reformen bezüglich des Status und der Rechte der Kirche forderte. Nicht unbedeutend war der Einfluss der Orthodoxie auf die Herausbildung des nationalen Selbstbewusstseins der Russen.
2.3.2 Institution Kirche: Strukturen und Entwicklung
Die orthodoxe Kirche der Kiever und Moskauer Rus’ vermochte die Glau-benspraxis der Laienbevölkerung nur minimal zu kontrollieren. Selbst der eigene Klerus war weitgehend auf sich gestellt. Die wenigen Bischöfe waren hauptsächlich mit der administrativen Verwaltung von Kirchengütern in ihren in der Regel sehr ausgedehnten Diözesen beschäftigt. Erst auf dem Hundertkapitel-Konzil (russ. stoglav) 1551 kam es zu einem ersten Anstoß
2. Religionen und Konfessionen
107
zur Vereinheitlichung von Normen und Regeln. Mit der Errichtung des Pat-riarchats 1589 setzten die zentralisierenden Tendenzen der russisch-orthodoxen Kirche ein. Allerdings begann die Kirche erst im 17. Jahrhundert, ihre Verwaltung weiter auszubauen und das religiöse Leben der Laien stärker zu kontrollieren. Es war ein paralleler Prozess zum Ausbau der staatlichen Strukturen und der Bindung der Bauern an die Scholle. Im Zuge der Reformen Peters I. erhielt die Kirche eine neue Verwaltungs-struktur: Anstelle des Patriarchen wurde ein neues Organ eingesetzt, der regierende Hl. Synod mit dem weltlichen Oberprokuror an der Spitze. Diese Reform, bereits von den Zeitgenossen als Bürokratisierung kritisiert, be-schleunigte die Aufteilung von Diözesen in kleinere Einheiten und verstärkte den Einfluss der Kirche in den ländlichen Regionen sowie die Entfaltung einer kirchlichen Presse. Auch auf das Leben der Gemeinde wirkten sich diese Reformen aus: Bis ins 18. Jahrhundert führten die einzelnen Gemeinden ein relativ autonomes Le-ben. Eine stärkere Kontrolle über die Finanzen des Gemeindepfarrers sowie die Ernennung durch die Bischöfe waren einige der Neuerungen. Die territoriale Größe des Landes, die geringe Bevölkerungsdichte in vielen Regionen sowie der Mangel an Klerikern und Mitteln stellten die Kirche weiterhin vor Probleme der Verwaltung und Erfassung der Gläubigen.
2.3.3 Weiße und schwarze orthodoxe Geistlichkeit
Die orthodoxe Geistlichkeit teilt sich grundsätzlich in zwei Gruppen auf – die weiße weltliche und die schwarze Mönchsgeistlichkeit. Für die Letztere gilt das Zölibat. Bischöfe werden ausschließlich aus der schwarzen Geistlichkeit ernannt. Die weltliche Geistlichkeit der vorpetrinischen Zeit war vornehmlich von ihrer Gemeinde abhängig: Die Pfarrer lebten von den Gaben der lokalen Bevölke-rung und unterschieden sich in ihrer Lebensweise wenig von den Bauern oder den Städtern. Dabei rekrutierte sich die weltliche Geistlichkeit nicht nur aus den Pfarrerssöhnen, wie es auch für die Söhne der Kleriker möglich war, ande-re Berufe zu wählen. Mit den Reformen Peters I. – der Einführung einer Kopfsteuer und der Fixie-rung von Status und Aufenthaltsort nicht privilegierter Gruppen – wurde es für die einfache ländliche und städtische Bevölkerung schwieriger, in die Reihen der Geistlichkeit einzusteigen. Darüber hinaus erhöhte sich im Laufe des 18. Jahrhunderts auch der Bildungszensus für die Geistlichkeit, und in die Seminare wurden ausschließlich Pfarrerssöhne aufgenommen, so dass sich die weiße Geistlichkeit seitdem hauptsächlich aus den eigenen Reihen rekrutierte. Im westlichen Europa hingegen stammten protestantische Pfarrer
Teil B: Systematischer Teil
108
häufiger nicht aus Pfarrersfamilien, katholische Priester häufiger aus weniger privilegierten Schichten. Die Folgen dieser Abschottung der weltlichen Geistlichkeit waren zum einen die Übersättigung der Seminare mit Kandidaten, die häufig lediglich aus fami-liären Zwängen diesen Weg wählten. Zum anderen grenzte sich die Geistlich-keit dadurch stark von der Laiengemeinschaft ab; fromme Laien suchten Er-füllung in religiösen Bewegungen außerhalb der Kirche. Während der Reformära Alexanders II. (1855–1881) wurden mehrere Ver-suche unternommen, den Stand der weltlichen Geistlichkeit zu «öffnen». Dies bewirkte jedoch lediglich einen Massenexodus der Pfarrerssöhne in die weltlichen Berufe, jedoch nicht den Zufluss von Kandidaten aus anderen Bevölkerungsschichten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts führte dies zu einem akuten Mangel an ausgebildeten Gemeindepfarrern. Die orthodoxe Mönchsgeistlichkeit war traditionell die tragende Kraft der Kirche, die über bedeutende finanzielle Mittel und Macht verfügte. In der Moskauer Rus’ war ungefähr ein Drittel des Landes zur Zeit der Einrichtung des Patriarchats 1589 im Kirchenbesitz. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Kirche der Rus’ auf dem Höhepunkt ihrer expansiven Machtpolitik, der neue Patriarch führte ein Netz von Verwaltungs- und Finanzorganen nach staatli-chem Vorbild ein. Seitdem versuchte der russländische Staat immer wieder, seinen Mangel an Mitteln für den Unterhalt von Armee und Dienstleuten durch die Beschneidung des Kirchenbesitzes auszugleichen. Den Schlusspunkt in diesem Prozess setzte Katharina II. (1762–1796) mit der Säkularisierung des kirchlichen Grundbesitzes und dessen leibeigener (> Glossar Leibeigen-schaft) Bauern 1764. Diese Maßnahme reduzierte die Anzahl der Klöster von 1201 zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf 400 nach der Säkularisierung, wie auch die Zahl von Mönchen und Nonnen von 25.000 im Jahr 1724 auf 5.861 im Jahr 1796 zurückging. Denn das vom Staat garantierte jährliche Budget für den Unterhalt der Klöster war bei Weitem nicht ausreichend. Dieser Rückgang schlug jedoch im 19. Jahrhundert in eine Wiederbelebung der monastischen Tradition um: Insbesondere die Anzahl der Nonnen nahm zu. Ähnlich wie in den katholischen Ländern Westeuropas, lässt sich von einer «Feminisierung» des Klosterlebens auch für das Russland dieser Zeit spre-chen.
2.3.4 Volksreligiosität im Russländischen Reich
Die religiöse Praxis der orthodoxen Bevölkerungsgruppen im Russländi-schen Reich blieb stets lokal geprägt und beeinflusst durch unterschiedliche Bräuche paganer Herkunft. Dieses Phänomen, das nicht nur für die Religio-sität der Laien in Russland seit der Christianisierung charakteristisch war,
2. Religionen und Konfessionen
109
bezeichnete die russische Forschung seit dem 19. Jahrhundert als «Doppel-glauben» (russ. dvoeverie), in der neueren Forschung wird es eher «Vielglau-be» (russ. mnogoverie) genannt (vgl. Forschungskontroversen, S. 122). Als das Fürstenhaus der Kiever Rus’ 988 den christlichen Glauben annahm und das ganze Land nominell christianisiert wurde, bedeutete das noch kei-neswegs eine tatsächliche Christianisierung der Bevölkerung. Im Zuge der Errichtung neuer Klöster gewann die Kirche zwar immer mehr Gläubige, die Bräuche und Riten unterschieden sich jedoch von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Erst mit dem Konzil von 1551 setzten sich die Tendenzen zur Verein-heitlichung der rituellen Praxis und zur systematischeren Ausschließung paga-ner Bräuche aus dem kirchlichen Leben an. Einen radikalen Wandel im Verhältnis von Kirche und Laiengemeinschaft vollzog 1653 jedoch erst die liturgische Reform des Patriarchen Nikon (1605–1681), die auch zum großen Schisma (russ. raskol) der orthodoxen Kirche führte und das Entstehen von Altgläubigen bzw. Altritualisten verur-sachte, welche die Reformen ablehnten. Allerdings blieb das religiöse Leben der ländlichen Gesellschaft insbesondere in den entlegenen Regionen des Reiches immer noch weitgehend von unterschiedlichen lokalen Riten ge-prägt, die häufig mit volkstümlichen Vorstellungen von Magie und Zauber und paganen Elementen verbunden waren. Einen weiteren Versuch der Kir-che und des Staates, die Volksreligiosität der Bevölkerung stärker an den orthodoxen Ritus zu binden, stellte das «Geistliche Reglement» von 1721 dar, es war primär gegen den «Aberglauben» der Laien gerichtet. Dabei er-wies sich die Katechisierung (Unterweisung in den Glaubensinhalten) der Landbevölkerung angesichts des Analphabetentums als sehr schwierig. Mehr Erfolg hatte die Kirche damit in den städtischen Gemeinden, vor allem durch die Errichtung von Kirchenschulen. Die Haltung der kirchlichen Hierarchen der lokalen Laienfrömmigkeit ge-genüber änderte sich im 19. Jahrhundert mit der starken Entfaltung außer-kirchlicher religiöser Bewegungen sowie der einsetzenden generellen Skep-sis in Bezug auf die Religion. Eine ähnliche Entwicklung erfasste die Kir-chen im Westen Europas ebenso. Die Kirche versuchte nun, die Volksfröm-mig-keit für sich zu gewinnen. Laienumzüge mit Ikonen gestattete sie viel häufiger als früher und gab der lokalen Heiligenverehrung viel stärker nach. Vor allem Frauen spielten in der intensivierten Frömmigkeitsbewegung der Laien im 19. Jahrhundert eine aktive Rolle. Dies machte sich die Kirche zunutze und öffnete 1918 einige Ämter in ihrer Administration auch für Frauen – als Küsterinnen oder Gemeindeälteste.
Teil B: Systematischer Teil
110
2.3.5 Religiöser Dissens im Russländischen Reich: Altgläubige
In Russland traten vom 15. Jahrhundert an verschiedene Abweichungen vom orthodoxen Glauben auf. So etwa die «Judaisierenden», die eine Mischung aus frühchristlichem und jüdisch-rationalistischem Gedankengut pflegten, mit Anklängen an humanistisches Denken. 1490 verurteilte die Landessynode von Moskau die «Ketzerei» und schloss deren Anhänger aus der Kirche aus. Die wichtigste Abspaltung von der russischen Kirche bilden seit dem raskol des 17. Jahrhunderts die Altgläubigen (russ. starovery) bzw. Altritualisten (russ. staroobrjadcy). Sie wandten sich gegen die Reformen des Patriarchen Nikon, der die gängigen liturgischen Texte überarbeiten ließ, da sich in der Überlieferung viele lokale Unterschiede herausgebildet hatten. Denn für den erstmaligen Druck brauchte die Kirche eine einheitliche Version. Breite Teile des Kirchenvolkes witterten Verrat, da sich Nikon stark am griechischen Vorbild orientierte. In einigen Gemeinden setzte die Abkehr von der Kirche unter dem Einfluss des Mönchs Kapiton bereits vor den Re-formen Nikons ein. Die Aktivitäten Nikons verschärften allerdings massiv die bereits bestehenden Spaltungsstimmungen in der Bevölkerung. Denn gleichzeitig protestierten die Altgläubigen auch gegen die «Verwestlichung» unter Zar Aleksej Michajlovič (1645–1676) und dann vor allem unter Pe-ter I. Zur symbolischen Leitfigur der Altgläubigen avancierte dabei der Erz-priester (russ. protopope) Avvakum Petrov (ca. 1621–1682), der wegen sei-ner radikalen Ablehnung der Neuerungen mehrmals verbannt und 1682 schließlich verbrannt wurde. Die liturgischen Fragen und der Ritus besaßen in der orthodoxen Kirche einen viel stärkeren Symbolcharakter, da es keine Predigt gab. Nur so lässt sich erklären, wie sich an der Frage, ob das Kreuzzeichen mit zwei (bzw. fünf) oder drei Fingern ausgeführt werden soll, die russisch-orthodoxe Kir-che spaltete. Synoden sprachen 1656 den Kirchenbann über die Oppositions-führer aus. Dann gerieten aber der Zar und sein machthungriger Patriarch aneinander. Bis zur endgültigen Absetzung Nikons (1666) breitete sich die altgläubige Opposition stark aus. Nun wurden die raskol’niki (Schismatiker) als Ketzer verurteilt und verfolgt. Doch sie waren schon stark im Volk ver-wurzelt. Das Martyrium Avvakums und vieler Glaubensgenossen, die sich selbst verbrannten, um die Reform nicht annehmen zu müssen, trugen das ihre dazu bei, den Widerstandswillen des Volkes anzufachen. Ihre gewohnte Frömmigkeitspraxis und Lebensart wollten die Altgläubigen unter keinen Umständen preisgeben. Dabei vermischte sich der religiöse Protest der brei-ten Bevölkerung mit dem sozialen. Denn gerade um die Mitte des 17. Jahr-hunderts begann der russische Staat im Zuge der einsetzenden Modernisie-
2. Religionen und Konfessionen
111
rung unter Aleksej Michajlovič (Kodifizierung des Rechts 1649, Heeresre-form), das private Leben jedes Einzelnen stärker zu kontrollieren und zu normieren. Viele der Altgläubigen entzogen sich jedoch der Staatsgewalt durch Flucht in entlegene Gebiete. Dabei entstanden zahlreiche Gruppierungen innerhalb des Altgläubigentums. Die wichtigste ging auf das Problem zurück, dass es nach der Spaltung keinen altgläubigen Bischof gab und damit keine neuen altgläubigen Priester geweiht werden konnten. So entstanden die Richtungen der priesterlosen Altgläubigen sowie der priesterlichen, die ihre Priester aus den Reihen der neu geweihten Kleriker rekrutierten. Peter I. erließ 1716 ein Gesetz, das ihnen gegen doppelte Besteuerung das Existenzrecht gab. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts konnten sich nennenswerte Gemeinden auch im Zentrum des Reiches – vor allem in Moskau – etablieren. Das 19. Jahrhun-dert brachte für die Altgläubigen insbesondere unter dem Zaren Nikolaus I. (1825–1855) erneut Verfolgungen mit sich. Erst als Zar Nikolaus II. (1894–1917) im April 1905 unter dem Druck der Ereignisse um die erste russische Revolution von 1905 bis 1907 seinen Untertanen Glaubensfreiheit gewährte, konnten auch die Altgläubigen – wenn auch mit Einschränkungen – davon profitieren. Die russisch-orthodoxe Kirche hob ihren Bann von 1666/1667 erst 1971 auf.
2.4 Vertiefender Exkurs II: Religiöse Vielfalt in Südosteuropa
2.4.1 Volksreligiosität in Südosteuropa
Südosteuropa ist eine der Regionen, die stark durch ein vielfältiges Nebeneinander von Religionen geprägt ist. Bis in die Gegenwart hat sich dieses Spezifikum der Religions-Topografie erhalten. Alle drei monotheisti-schen Weltreligionen (Judentum, Christentum und Islam) waren hier durch zahlenmäßig bedeutsame Gruppierungen vertreten, alle drei in unterschiedli-chen Observanzen und Konfessionen. Die Besonderheit der Volksfrömmigkeit im südosteuropäischen Raum besteht nicht nur in der Begegnung vieler Kulturen und Religionen, sondern auch in einer tief verwurzelten Verbindung zwischen dem Ritus der Hochreligionen und den vorchristlichen oder vorislamischen Bräuchen. Der Glaube an übernatürliche Wesen, die Verehrung der Natur, Weissagung und Magie haben sich hier länger erhalten können als im übrigen Europa. Vor allem gilt dies für den in allen drei Religionen ausgeprägten Ahnenkult. Al-lerdings weist die neuere Forschung darauf hin, dass die gelebte Religiosität auch im Westen bis heute magische Praktiken und volkstümliche Bräuche in sich trägt: Die in New York nachgebauten Orte der Marienerscheinung – wie
Teil B: Systematischer Teil
112
beispielsweise an der Quelle nahe dem südfranzösischen Lourdes – und die Verwendung von Quellwasser zum Schutz beim Autofahren geben davon ein eindrückliches Zeugnis. Im Bereich des Islam waren es vor allem die «Bruderschaften» islamischer Mystiker, die den «Volksislam» auf dem Balkan prägten: Diese Bruderschaften und insbesondere der Bektaschi-Orden (> Glossar) waren offen für die Aufnahme religiöser Formen anderer Kulturen. Zudem fand die Bekämpfung vorislamischer religiöser Praktiken und der Abweichungen vom kodifizierten Ritus in dieser Region in viel geringerem Ausmaß statt als etwa im arabischen Raum. Religiöse Vielfalt und Heterogenität führten auch dazu, dass religiöse Grenzen nicht immer festgelegt waren und unterschiedliche Glaubensgemeinschaften sich auch beim Ausüben des Ritus an gemeinsamen Orten trafen: So war es nicht außergewöhnlich, dass Muslime und Christen die gleichen Kultstätten besuchten und die Gräber der Heiligen der jeweils anderen Religionsgemein-schaft verehrten. Soziale Aufgaben des Klerus wie etwa die Bekämpfung der Krankheiten und bösen Geister wurden ebenso geteilt. Eine andere Folge religiöser Vielfalt sowie einer spezifischen Situation auf dem Balkan (relativ pragmatischer Umgang der Osmanen mit Andersgläubigen sowie schwache Kontrollinstanzen der Herrschaft in einzelnen Regionen) führten auch dazu, dass sich zahlreiche sogenannte Kryptogruppen bilden konnten: Sie kombinierten ein offizielles Bekenntnis zum Islam mit einem im privaten Raum gepflegten Glauben, der im Christentum oder Judentum wurzelte. Kryptochristen gab es vor allem in Albanien, wobei diese Bezeichnung sowie die Herausbildung des Bewusstseins bei diesen Gruppen, «eigentlich christlich» zu sein, erst mit der verstärkten Mission und Unterstützung Roms im 19. Jahrhundert aufkamen. Von ihrer Umgebung in Nordalbanien und Kosovo wurden sie als laramanen (v. alb. Larmë – buntgescheckt) bezeichnet, was ihre Heterogenität betont und eine eindeutige Zuordnung meidet. Ebenso bestanden im Balkanraum auch kryptojüdische Gruppen, die neben ihrer offiziellen Zugehörigkeit zur islamischen Glaubensgemeinschaft ihre eigenen jüdischen oder auch mystisch-synkretistischen Riten praktizierten wie die Sabbatianer (> Glossar) und Dönme (> Glossar). In dieser Hinsicht ähnelten sie den polnischen Mitstreitern Jakub Franks, mit denen sie vielfach verbunden waren.
2.4.2 Religiöser Dissens auf dem Balkan: Bogomilen
Der multikulturelle Raum des Balkans bot einen fruchtbaren Nährboden für religiöse Bewegungen und Gruppierungen, die sich im Umfeld der drei Haupt-
2. Religionen und Konfessionen
113
religionen entwickelten. Darüber hinaus waren auch die landschaftlichen Gegebenheiten, die den rebellischen Gruppen Rückzugsgebiete gewährten, hier günstig. Aus der Begegnung zweier Traditionen – der byzantinischen Reichskirche und den dualistischen Lehren des vorderasiatischen Raums – entstand in diesem Raum eine der bedeutendsten religiösen Bewegungen, die einen starken Einfluss auf das ganze mittelalterliche Europa ausübte. Die Bewegung der Bogomilen (auch Bogumilen) entstand im 9./10. Jahrhundert in Bulgarien und führt ihren Namen auf einen – möglicherweise legendären – bulgarischen Dorfpriester Bogomil oder Bogumil (der Gott liebende) zurück, der eine dualistische Auffassung von der Welt predigte: Diese basiere auf zwei sich bekämpfenden Prinzipien des Guten (Göttliches und Spirituelles) und des Bösen (Teuflisches und Materielles). Obschon die Ursprünge dieser Häresie und sozialen Bewegung nicht gänzlich geklärt sind, steht sie in der Tradition früherer dualistischer Lehren der Manichäer, einer vom Perser Mani im 3. Jahrhundert gestifteten dualistischen persisch-hellenistisch-christlichen Mischreligion, und der Paulikianer, einer dualistischen religiösen Gruppe, die im 7. Jahrhundert in Armenien begründet wurde und später ihre Ausbreitung in Thrakien fand. Die Paulikianer lehnten Teile des Alten und des Neuen Testaments sowie einiger Sakramente (Taufe, Ehe und Eucharistie) ab. Diese antiklerikale Tendenz setzte sich bei den Bogomilen fort, wobei sich seit dem 11. Jahrhundert radikale und gemäßigtere Richtungen herausbildeten: Sie lehnten die «böse» materielle Welt ihrer dualistischen Auffassung folgend ab und richteten ihre Kritik gegen den Klerus. Einer hierarchisch aufgebauten Kirche und ihrem Ritus stellten die Bogomilen (zumindest für die engsten Eingeweihten) das Ideal eines reinen apostolischen Lebens in Beten, Fasten und Pilgern gegenüber – ohne Ehe und physische Arbeit, ohne die üblichen Gottesdienste und Sakramente der Kirche sowie ohne Fleisch- und Weingenuss. Zwischen dem 9. und 15. Jahrhundert flackerte die Bewegung immer wieder auf der Balkanhalbinsel auf und übte starken Einfluss auf das religiöse Leben dieser Region aus. Irrtümlicherweise wurde allerdings längere Zeit angenommen, dass die mittelalterliche bosnische Kirche auf die Bewegung der Bogomilen zurückzuführen sei. Diese Kirche existierte in Bosnien zwi-schen dem Niedergang der Großmacht Byzanz und der osmanischen Erobe-rung (12.–15. Jhd.) und entstand in Reaktion auf die Einflussnahmen der rivalisierenden christlichen Kirchen im «Hohlraum» zwischen dem Katholi-zismus und der Orthodoxie. Die Nachrichten über diese Kirche sind spärlich und lassen viel Raum für Interpretationen, die in der jüngsten Geschichte Bosniens auch für politische Zwecke eingesetzt wurden – wie etwa die Le-gende darüber, dass die «bosnischen Bogomilen» die osmanischen Eroberer
Teil B: Systematischer Teil
114
als Befreier empfangen hätten und bald darauf geschlossen zum Islam über-getreten seien. Auf dieser Grundlage sollte sich eine «bosnische» Identität konstituiert und bis heute erhalten haben. Am ehesten lässt sich die bosnische Kirche als archaische Mönchskirche, eine Mönchsgemeinde, deuten. Unum-stritten ist dagegen, dass die Bogomilen westeuropäische Häresien von den norditalienischen Patarenern bis zu den südfranzösischen Katharern (auch Albigenser) stark beeinflusst haben. Aufgrund einer äußerst mangelhaften Quellenlage lassen sich diese Einflüsse bis jetzt allerdings nur schwer näher bestimmen. Für die christlichen Kirchen stellte die «Irrlehre» der Bogomilen eine Gefahr dar, und sie wurde aufs Härteste bekämpft: Der vierte Kreuzzug, der sich spä-ter gegen Byzanz richten sollte, ging zuvor (1202) an die dalmatinische Küste, Zadar, mit dem Ziel, die dortigen «bogomilischen Ketzer» zu bekämpfen. Auch in den folgenden Jahrhunderten waren die Bogomilen grausamer Ver-folgung seitens von Byzanz wie auch der katholischen Kirche ausgesetzt.
2.5 Religion und Kirche seit 1917 (Russland) bzw. 1945/48 (Ostmittel- und Südosteuropa)
2.5.1 Sowjetunion
Die nach der sozialistischen Revolution in Russland (1917) Anfang 1918 proklamierte Trennung von Staat und Kirche war nicht die erste ihrer Art und setzte eine Reihe von ähnlichen Bestimmungen – in den Vereinigten Staaten (1789) und Frankreich (1905) – fort. Allerdings leitete diese Proklamation im sowjetischen Russland eine bislang beispiellose Entwicklung ein, die nach dem Zweiten Weltkrieg den ganzen Ostblock und darüber hinaus einbezog, nämlich eine von staatlicher Seite propagierte atheistische Lebensweise. Wie diese Politik in den jeweiligen Staaten Osteuropas in die Praxis umgesetzt wurde, unterschied sich von Region zu Region stark. Insbesondere in der jungen Sowjetunion erlitten die Gläubigen, der Klerus und die Kirche Repressionen und systematische Verfolgungen, während bei der Durchsetzung des Atheismus in Ostmittel- und Südosteuropa der Staat und die Aktivisten in der Regel bei Weitem nicht so rigide vorgingen. Das sowjetische Dekret über die Trennung von Staat und Kirche beinhaltete auch die Trennung der Schule von der Kirche. Dies führte dazu, dass die kirchlichen Grundschulen verstaatlicht wurden. Der Klerus wurde nicht länger vom Staat bezahlt. Zwar war das Trennungsdekret von 1918 kein Verbotsdekret, dennoch waren zahlreiche Gläubige und Angehörige des Klerus insbesondere in den ersten Jahren nach der Revolution Attacken des kommunistischen Jugendverbandes Komsomol (> Glossar) ausgesetzt. Mit
2. Religionen und Konfessionen
115
der Gründung des parteinahen «Bundes der Gottlosen» im Jahre 1925 (ab 1929 «Bund der militanten Gottlosen») entstand ein Organ, das die systematische und geordnete antireligiöse Propaganda zu fördern gedachte. Doch die religiöse Agitation unterschiedlicher Gemeinschaften blühte ebenso auf, nachdem die sowjetische Regierung die Dominanz der russisch-orthodoxen Kirche abgeschafft hatte. So zeitigten die Bemühungen der schlecht organisierten «Gottlosen» während der 1920er-Jahre wenig Erfolg. Erst mit der Wende von 1928/29, dem Beginn von Kollektivierung der Land-wirtschaft und forcierter Industrialisierung, radikalisierte sich auch die antireligiöse Propaganda und die staatliche Politik gegenüber den Kirchen und Gläubigen: Religiöse Propaganda wurde verboten und unorganisiertes Vorgehen militanter Jugendlicher gegen den Klerus und die Gläubigen gewann wieder an Gewicht. Schließlich richteten sich die Säuberungen von 1937/38 auch gegen orthodoxe Priester. Diese galten im Kampf gegen die «Überbleibsel des zaristischen Regimes» als «Klassenfeinde». Es half auch nicht, dass der Patriarch Tichon (1865–1925) nach einjährigem Hausarrest 1923 eine Loyalitätserklärung gegenüber der Sowjetmacht abgab. Zudem spaltete die sowjetische Politik auch den Klerus selbst und unterstützte die Bewegung der reformerischen Priester, der soge-nannten Erneuerer (russ. obnovlency). Die Absicht der Regierung, mit dieser Priesterschaft eine neue Gegenkirche zu gründen, schlug allerdings fehl. Erst während des Zweiten Weltkrieges, als die mobilisierende Kraft der Kirche für den Sowjetpatriotismus im Kampf gegen die Invasoren notwendig wurde, ging Stalin einige Kompromisse im Verhältnis zur Kirche ein: Publikationstätigkeit und Ausbildung des Klerus ließ der Staat in bescheidenem Umfang zu. Die aggressive atheistische Propaganda wurde ebenso gemildert. Der «Bund der militanten Gottlosen» stellte seine Aktivitäten bereits während des Zweiten Weltkrieges ein, und er wurde 1947 offiziell von der «Allunionsgesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher und politischer Kenntnisse» (ab 1963 «Allunionsgesellschaft Wissen») abgelöst. Nach dem Zweiten Weltkrieg wechselte die Politik des Staates gegenüber der Kirche mehrfach – von einer Einschränkung unter Nikita Chruščev (1953–1964) über eine Lockerung zu einer erneuten Einschränkung unter Leonid Brežnev (1964–1982). Zwar konnte der verordnete Atheismus in der sowjetischen Gesellschaft seine Wirkung entfalten, es gelang ihm allerdings nicht, alle Bürger der Sowjetunion zu erfassen. In den Kreisen der städtischen Intelligenz wurden seit den 1960er-Jahren – nicht anders als in Westeuropa – Esoterik und Heilkunde immer populärer. In den ländlichen Gegenden blieben die volkstümlich-orthodoxen Traditionen zum Teil erhalten.
Teil B: Systematischer Teil
116
Nichtchristliche Religionen betraf die Verfolgung der Religion in der Sowjetunion ebenso. Sie hatte allerdings teilweise weniger Erfolg, wie etwa die versuchte Unterdrückung des Islam in den nichtrussisch geprägten Republiken in Mittelasien und im Kaukasus zeigt. Trotz Schließung von Moscheen und Verhaftung von Gemeindevorstehern und Predigern lebte der Islam hier jenseits der offiziellen Struktur weiter. Juden wurden zwar nach der Revolution von 1917 offiziell nicht mehr als «fremde Konfession» unterprivilegiert, wie es zuvor im Zarenreich der Fall gewesen war. Doch neu galten sie als «Nationalität» und bekamen Ende der 1920er-Jahre ein «Autonomes Jüdisches Gebiet» im wenig attraktiven fernöstlichen Birobidschan. Doch zugleich wurden sie zunehmend dem staatlich gelenkten Antisemitismus ausgesetzt, der in den Verfolgungskam-pagnen gegen die jüdischen Intellektuellen, «Kosmopoliten» und Ärzte nach dem Zweiten Weltkrieg (1948–1953) gipfelte. Zwar anerkannte die Sowjet-union 1948 den Staat Israel, die Politik der sowjetischen Führung wurde zunehmend proarabisch und antizionistisch. Eine verstärkte Emigration von Juden aus der Sowjetunion seit den 1970er-Jahren nach Israel und in die USA wurzelte im erstarkten Gefühl jüdischer Identität nach dem Sechs-Tage-Krieg von 1967 sowie den antisemitischen Stimmungen in der Bevölkerung. Die tradierten antisemitischen Stereotype blieben bestehen und fungierten wie schon zuvor als Ventil für die Unzufrie-denheit, wenn auch der staatlich dirigierte Antisemitismus nicht mehr offen artikuliert wurde.
2.5.2 Ostmittel- und Südosteuropa
Spezifische Wege der religiösen Aufladung der Nationalismen im östlichen Europa seit dem 19. Jahrhundert (etwa durch die Integration von Heiligen-kulten in die nationale Mythologie) entfalteten ihre volle Wirkung in den neu gegründeten Staaten Südost- und Ostmitteleuropas nach 1918. Nicht zuletzt auf diese Konstellation ist der Umstand zurückzuführen, dass viele Repräsentanten vor allem des katholischen Klerus in Ostmittel- und Südosteuropa mit den jeweiligen Regimen kollaborierten: im Unabhängigen Staat Kroatien (kroat. Nezavisna država Hrvatska 1941–1945, NDH), in der 1. Slowakischen Republik (slow. 1. Slovenská Republika 1939–1945) und im Königreich Ungarn von 1920 bis 1944. Die orthodoxe Kirche Rumäniens unterstützte das Regime Antonescu (1940–1944). Das sowjetische Modell des staatlich propagierten Atheismus und der Ver-folgung von Religionen und Kirchen erreichte die Länder Ostmittel- und Südosteuropas mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als in diesen Staaten ein sozialistisches System nach sowjetischem Vorbild eingeführt wurde.
2. Religionen und Konfessionen
117
Allerdings variierte das Ausmaß an Repressionen gegenüber den Gläubigen und dem Klerus stark je nach lokalen Begebenheiten: Die orthodoxe Kirche in der Volksrepublik (1947–1965) und der sozialistischen Republik (1965–1989) Rumänien blieb beispielsweise von größeren Repressionen seitens des Staates weitgehend verschont. Als Gegenleistung für ihre Unterstützung des sozialistischen Regimes gewährte der Staat der rumänischen Orthodoxie mit dem neuen Statut von 1949 eine Vorzugsbehandlung. Die unierte Kirche wurde hingegen verstärkter Verfolgung ausgesetzt und verboten. Im sozialis-tischen Albanien nahm die Regierung zunächst starken Einfluss auf die Be-setzung des hohen Klerus, bis die albanische orthodoxe Kirche 1967 im Zu-ge der antireligiösen Kampagne gegen alle Religionsgemeinschaften zer-schlagen wurde. Mit dem Verbot jeglicher Religionen wurde Albanien zum einzigen gänzlich atheistischen Staat. Erst nach der Wiederherstellung der Religionsfreiheit (1990) wurde die autokephale orthodoxe Kirche Albaniens 1998 wieder in ihren Rechten bestätigt. Im sozialistischen Jugoslawien (1945–1991/92) unter Josef Broz Tito (1892–1980) wurden die kirchlichen Strukturen zunächst der staatlichen Kontrolle unterstellt, und der Klerus war Verfolgungen ausgesetzt. Denn als Sammelbecken für nationalistische Ambitionen einzelner Nationalitäten der jungen Föderation und aufgrund ihrer Unterstützung des faschistischen Regimes während des NDH galten die Kirchen dem jugoslawischen Staat als verdächtig. Die entsprechende staatliche Behörde war in der Bundes-kommission für religiöse Angelegenheiten in Belgrad zusammengefasst. Dieser unterstanden Republikskommissionen, die im Gegensatz zur Sowjetunion mit Experten (ehemaligen Theologen und kirchlich gebundenen Spezialisten) besetzt waren. Ebenfalls anders als in der Sowjetunion, wo Entscheide und Initiativen meistens von Moskau in die Regionen kamen, waren die regionalen Kommissionen in Jugoslawien stärker lokal verankert, besaßen mehr Handlungsspielraum und konnten die Bundeskommission durchaus in ihrem Sinne beeinflussen, wenn es regimekonform war. Dies war beispielsweise der Fall bei der Proklamierung der Autokephalie der orthodoxen Kirche Makedoniens 1967. Die Regierung in Belgrad erhoffte sich von der Spaltung des serbischen Patriarchats eine bessere Kontrolle über diese Kirchenstruktur. Das Prinzip divide et impera leitete die staatliche Kirchenpolitik in Jugoslawien genauso wie in der Sowjetunion. Die vom Staat unterstützten orthodoxen und katholischen Priestervereinigungen sollten den Klerus spalten und die Autorität der kirchlichen Eliten untergraben. Die Spaltungspolitik des Staates betraf auch die muslimische Religions-gemeinschaft. Die staatlichen Behörden unterstützten die «orthodoxe» muslimische Geistlichkeit Bosnien-Herzegowinas, die stärker volksreligiös und national (albanisch) orientierten Muslime Kosovos wurden dadurch in ihrer Glaubenspraxis unterdrückt. Die stärkere Kooperation der serbischen
Teil B: Systematischer Teil
118
orthodoxen Kirche mit dem Staat verschaffte ihr eine privilegierte Stellung, führte aber zugleich zu ihrer stärkeren Gebundenheit an die staatlichen Strukturen. Auch die muslimische Geistlichkeit – trotz Verfolgungen in den ersten Jahren der Föderation – stand mehrheitlich loyal zum Staat. Stärkere Resistenz gegenüber dem Staat zeigte die katholische Kirche, die weder eine Landeskirche wie die Serbisch-Orthodoxe Kirche war noch in sich so heterogen wie die muslimische Religionsgemeinschaft Jugoslawiens. Die repressive Kirchenpolitik des Staates ging auf der anderen Seite mit gewissem Pragmatismus einher. Bestimmte kirchliche Feste wurden als Mittel sozialer Befriedung in einer Umbruchszeit toleriert – wie etwa die jährliche Wallfahrt am 8. Juli zum Marienheiligtum von Marija Bistrica in der Nähe von Zagreb. Insbesondere nach 1953 ging Tito zu einem flexibleren Kurs in Bezug auf die Religion über. Ihm gelang es auch deswegen, die Kirchen stärker als in der Sowjetunion politisch zu instrumentalisieren. Im Gegensatz zur zeitgleichen Politik Stalins gegenüber der sowjetischen jüdischen Bevölkerung wurden die wenigen überlebenden jugoslawischen Juden (ein Fünftel der Vorkriegsbevölkerung) unter Tito in keiner Weise diskriminiert. Die Beteiligung der jüdischen Kämpfer bei den Partisanen wurde zudem offiziell betont, während dies für die Rote Armee (> Glossar) ein Tabuthema war. Als politische oppositionelle Kraft während der sozialistischen Zeit konnte sich insbesondere die katholische Kirche in der Volksrepublik Polen positionieren. Diese Funktion und Stellung des Klerus knüpfte an das 19. Jahrhundert an, als Polen auf der politischen Karte Europas nicht existierte, jedoch als Kulturnation in wesentlichem Maße auch vom Klerus getragen wurde.
2.6 Vertiefender Exkurs III: Religion und Nationalismus in Südosteuropa Das Verhältnis zwischen Nation und Religion war und ist auf dem Balkan sehr komplex. Anders als die frühere Säkularisierungsthese postulierte, wurden die konfessionellen und religiösen Identitäten seit dem 19. Jahrhundert auch im übrigen Europa nicht einfach durch die nationalen «ersetzt», sondern gingen eine wechselseitige Beziehung ein – je nach spezi-fischem historischen Kontext. Gerade der Zerfall Jugoslawiens und die Ge-schichte seiner Nachfolgestaaten zeugen davon, dass überkonfessionelle Nationskonzepte (Jugoslawismus) von an Konfessionen gebundenen Nati-onsentwürfen (etwa der orthodoxen Serben, katholischen Kroaten und isla-mischen Bosniaken) verdrängt werden können. Unterschiedliche religiöse Ethiken sowie Organisationsstrukturen einzelner Religionsgemeinschaften (Landeskirche der Orthodoxen, transnationale
2. Religionen und Konfessionen
119
Kirchengemeinschaft der Katholiken, nichtkirchlich verfasste transnationale Gläubigengemeinde der Muslime) bildeten unterschiedliche Voraussetzungen für die Gestaltung religiöser Prägungen der jeweiligen Nationalismen in diesem historischen Raum. In Kombination mit der Problematik, welchen Platz die Angehörigen der jeweiligen Religionsgemeinschaften innerhalb der imperialen Ordnungen einnahmen, konnte Religion für oder gegen die imperiale Ordnung mobilisieren. Eine wichtige Funktion hatten dabei – ähnlich wie im übrigen Europa – national oder dynastisch-imperial umgedeutete Heiligenkulte. Bereits in der osmanischen Zeit (1393–1878) trug etwa das bulgarische Mönchtum zur Formung und Bewahrung kultureller Identitäten sowie der Entstehung nationaler Zugehörigkeitsgefühle bei. Die «Slawobulgarische Geschiche» (bulg. Slavjanobolgarska istorija) des Mönchs Paisij Chilendarski von 1762 zählt dabei zu den wichtigsten Zeugnissen. Mit der zunehmenden Identifizierung von Konfession und Nation im 19. Jahrhundert verstärkte sich im südosteuropäischen Raum der Einfluss der Kirchen und religiösen Gemeinschaften auf die nationale Identitätsbildung: So erhielten beispielsweise der orthodoxe Glaube und Klerus wesentliche Bedeutung für das Erwachen der nationalen Bewegungen der Griechen, Ser-ben, Rumänen (hier auch die unierte Kirche) und Bulgaren im Osmanischen Reich des 19. Jahrhunderts. Denn die Kirche war die einzige Institution der südosteuropäischen Christen im Ostmanischen Reich. Auch während der sozialistischen Zeit und insbesondere nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens wurde Religion zur wesentlichen Komponente nationaler Identifikationen. Die Frontenstellung in den Jugoslawienkriegen von 1991–1995 und 1999 (Kosovo-Krieg) – insbesondere bei den Auseinandersetzungen in Kroatien und Bosnien-Herzegowina – fiel mit den konfessionellen und religiösen Zugehörigkeiten zusammen. Für die Kroaten stellte der Katholizismus eines der zentralen Distinktionsmerkmale gegenüber den Muslimen und Serben gerade dort dar, wo Kroaten eine bedeutende Minderheit bilden wie beispielsweise in Bosnien-Herzegowina. Bei der nationalistischen Mythenbildung über die Ethnogenese und Nationsbildung von Kroaten, Serben und bosnischen Muslimen hat die religiöse Zugehörigkeit unter anderem auch deswegen eine große Bedeutung, weil alle drei Nationen faktisch die gleiche Sprache sprechen. So genießt heute die katholische Kirche in Kroatien neben Polen sowie mit Einschränkung in Ungarn, Slowenien, Tschechien und der Slowakei als Mehrheitskirche einen wichtigen gesellschaftlichen Stellenwert und geht Allianzen mit den staatlichen Behörden für die politische Konsolidierung dieser Staaten nach dem Ende des Sozialismus (> Glossar) ein.
Teil B: Systematischer Teil
120
2.7 Religiöse Minderheiten in den Vielvölkerreichen Osteuropas Die religiöse Vielfalt in den östlichen Regionen Europas geht nicht zuletzt auf die besondere rechtliche und soziale Situation religiöser und ethnischer Minderheiten in den Vielvölkerreichen Osteuropas zurück, die seit dem Mit-telalter bis ins 19. Jahrhundert zumeist besser war als in den Staaten Westeu-ropas: • In den westlichen Regionen Europas wurde eine stärkere religiöse
Homogenisierung bereits durch die Vertreibung der Juden seit den Kreuzzügen eingeleitet und nach der Reformation mit dem Prinzip cu-ius regio, eius religio angestrebt. Die Wellen der frühneuzeitlichen Hexenverfolgung stärkten ebenso die konfessionelle Einheitlichkeit.
• Im Russländischen Reich bestimmte grundsätzlich die Pragmatik unter dem Prinzip Status quo die Politik gegenüber Andersgläubigen, wobei davon in erster Linie die Muslime profitierten: Sie wurden geduldet und ihre Eliten gar in den russländischen Adel kooptiert. Zudem zeichnete sich die Orthodoxie durch eine eher defensive Haltung gegenüber An-dersgläubigen aus, im Gegensatz zum Katholizismus oder Protestantis-mus: Kreuzzüge, Inquisition sowie Hexenverfolgung fehlten nicht nur in Russland, sondern weitgehend in sämtlichen orthodoxen Ländern. Denn die Mission fehlte in der orthodoxen Kirche weitgehend.
• Religiöse Toleranz prägte das Zusammenleben unterschiedlicher reli-giöser Gruppen (Juden, muslimischer Tataren, armenischer Christen, Katholiken u.a.) in Polen-Litauen bereits seit dem Spätmittelalter, als die meisten mitteleuropäischen Juden dort Zuflucht fanden. Unter Beibehaltung ihrer eigenen inneren Ordnung konnten die Juden Polen-Litauens ihre Kultur entfalten und sich in die ökonomischen Struktu-ren der Adelsrepublik erfolgreich integrieren. Wenn auch die zuneh-mende Intoleranz diese Vielfalt ab dem 17. Jahrhundert bedrohte.
• In Südosteuropa genossen religiöse Minderheiten weitgehende Auto-nomie als einzelne millets (> Glossar) innerhalb des Osmanischen Reiches. Zwar waren die Muslime gegenüber allen Nichtmuslimen (arab. dhimmi oder zimmi) grundsätzlich privilegiert, doch konnten die Nichtmuslime relativ ungehindert ihren Ritus ausüben und sich selbst als soziale Einheiten organisieren. Christen, Juden sowie zahl-reiche heterodoxe Strömungen und Gemeinschaften profitierten vom pragmatischen Umgang der Osmanen mit Andersgläubigen. Diese Praxis geht zurück auf Zusicherungen gewisser Rechte für die Bevöl-kerung der eroberten Territorien durch die osmanischen Herrscher. Wurde der Sonderstatus einzelner religiöser Gruppen (zum Teil auch beruflich definiert wie etwa bei einigen Christen) seit der osmanischen
2. Religionen und Konfessionen
121
Expansion auf dem Balkan jeweils ad hoc geregelt, gewann diese Be-zeichnung im 19. Jahrhundert an Bedeutung für die Verwaltung und Administration: Für diese Zeitspanne lässt sich von einem Millet-System als einer Verwaltungsstruktur für Nichtmuslime sprechen. Zu-vor überlappte sich die Kategorisierung der einzelnen Gruppen als Millet mit anderen Kollektivbezeichnungen, und in der Verwaltungs-sprache fehlte diese Bezeichnung noch gänzlich. Erst im 19. Jahrhun-dert gewann die Bezeichnung Millet auch an politischer Relevanz und kam in die Nähe der Begriffe «Nation» und «Volk».
2.8 Forschungskontroversen • Die Frage, inwiefern die russisch-orthodoxe Kirche nur stets im
Dienste des russischen Herrschers und Staates stand, wird in der For-schung nicht einheitlich beantwortet. Vor allem Gregory Freeze ver-tritt die These, dass die russisch-orthodoxe Kirche weder rechtlich noch von ihrem Selbstverständnis her lediglich ein staatliches Ministe-rium für geistliche Angelegenheiten war – im Gegensatz zur mehrheit-lichen Meinung der bisherigen Forschung.
• Für die Analyse der Volksfrömmigkeit in Altrussland und dem Russ-ländischen Reich wurde seit dem 19. Jahrhundert das Konzept dvoe-verie (Doppelglauben) verwendet. Dieser Ausdruck stammt aus den Predigten gegen die paganen Praktiken aus der Zeit der Kiever Rus’, als viele Ostslawen noch nicht getauft waren. In der Forschung des späten Zarenreichs und in den sowjetischen Arbeiten zu dieser Thema-tik wurde dvoeverie zum Charakteristikum der bäuerlichen Glaubens-welt bis in die Neuzeit. Dabei betonte dieses Konzept, dass die «genu-ine» «pagane» Glaubenspraxis der bäuerlichen Bevölkerung immer im Konflikt zu der «formalen» «gelehrten» Orthodoxie der Oberschichten stand. Die Forschung des 19. Jahrhunderts stand dabei unter dem Ein-fluss exotisierender Ethnografie und der Ideen der populistischen in-telligencija (> Glossar), die ein idealisiertes Konstrukt bäuerlicher Le-bensweise schuf. Für die sowjetische marxistisch orientierte For-schung fügte sich das Konzept des dvoeverie in die Verurteilung der Kirche als Institution der Unterdrückung des Volkes. Das hauptsächli-che Problem bei der Erforschung der Volksfrömmigkeit insbesondere der früheren Epochen besteht in der mangelnden Quellenbasis. So dienten die ethnografischen Daten des 19. und 20. Jahrhunderts nicht selten für die Argumentationen zu Altrussland und konstruierten eine unveränderliche bäuerliche Glaubenswelt in Russland. Heute wird das Konzept des dvoeverie sehr vorsichtig benutzt und die Dichotomie zwischen dem «Paganismus» und der «Orthodoxie» als ein viel kom-
Teil B: Systematischer Teil
122
plexeres Beziehungsgeflecht gesehen: Der gelebte Glauben sowohl der Ober- wie auch der Unterschichten in Altrussland und im Russ-ländischen Reich setzte sich aus unterschiedlichen Komponenten zu-sammen – den lokalen Bräuchen christlich-orthodoxen und paganen Ursprungs sowie dem kodifizierten Ritus der Ostkirche. Die Bezie-hung zwischen diesen Elementen gestaltete sich in jedem konkreten Fall unterschiedlich und kann nicht alleine auf soziale Unterschiede zurückgeführt werden. So betont der neuere Begriff mnogoverie eher die Vielfalt sakraler Bezüge und betrachtet diese als verschmolzen in einem Glaubenssystem. An diesen Fragenkomplex schließt auch die jüngste Debatte darüber an, wie sich die Haltung der orthodoxen bäu-erlichen Bevölkerung zur Kirche im späten Zarenreich gestaltete: in-wiefern die lokalen Traditionen der ländlichen Bevölkerung Distanz (Chris J. Chulos) bzw. Nähe (Vera Shevzov) zu kirchlichen Strukturen bedeuteten.
• Die Fragen der Zusammenarbeit der Kirchen mit den Diktaturen in Ostmittel- und Südosteuropa während des Zweiten Weltkrieges, ihre Verwicklung in die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung sowie an-derer religiöser und ethnischer Gruppen in den jeweiligen Ländern sowie die Kollaboration des Klerus in Osteuropa mit den sozialisti-schen Regierungen nach dem Krieg wurden bis vor Kurzem ausge-blendet. Die kritische Aufarbeitung dieser Thematik wird erst in der jüngsten Zeit in Angriff genommen.
Literatur zum Abschnitt B.2: Religionen und Konfessionen Osteuropa allgemein
Bryner, Erich: Die orthodoxen Kirchen von 1274 bis 1700, Leipzig 2004.
Halem, Friedrich von: Rechtshistorische Aspekte des Ost-West-Problems, in: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte 2/1 (1998), S. 29–69.
Haumann, Heiko: Geschichte der Ostjuden, München 51999.
Hundert, Gershon D.: (Hrsg.) The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, New Ha-ven 2008.
Ivánka, Endre von: Rhomärreich und Gottesvolk. Das Glaubens-, Staats- und Volksbewusst-sein der Byzantiner und seine Auswirkung auf die ostkirchlich-osteuropäische Geisteshaltung, Freiburg u.a. 1968.
Kappeler, Andreas; Simon Gerhard; Brunner, Georg (Hrsg.): Die Muslime in der Sowjetunion und in Jugoslawien. Identität, Politik, Widerstand, Köln 1989.
Listl, Joseph: Staat und Kirche in der lateinisch geprägten westkirchlichen Tradition des Christentums, in: Koslowski, Peter; Fjodorow, Wladimir F. (Hrsg.): Religionspolitik zwi-
2. Religionen und Konfessionen
123
schen Cäsaropapismus und Atheismus. Staat und Kirche in Rußland von 1825 bis zum Ende der Sowjetunion, München 1999, S. 151–173.
Ware, Timothy (Kallistos, Bishop of Diokleia): The Orthodox Church, London u.a. 31993.
Russland und die Sowjetunion
Batalden, Stephen K. (Hrsg.): Seeking God. The Recovery of Religious Identiy in Orthodox Russia, Ukraine, and Georgia, DeKalb 1993.
Breyfogle, Nicholas B.: Heretics and Colonizers. Forging Russia’s Empire in the South Cau-casus, Ithaca u.a. 2005.
Chulos, Chris, J.: Converging worlds. Religion and community in peasant Russia, 1861–1917, DeKalb 2003.
Crummey, Robert O. The Old Believers and the World of Antichrist. The Vyg Community and the Russian State 1694–1855. Madison u.a. 1970.
Crews, Robert D.: For Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia, Cam-bridge 2006.
Deutsch Kornblatt, Judith: Doubly Choosen: Jewish Identity, the Soviet Intelligentsia, and the Russian Orthodox Church, Madison 2004.
Engelstein, Laura: Castration and the Heavenly Kingdom. A Russian Folktale, Ithaca 1999.
Freeze, Gregory L. Institutionalizing Piety: The Church and Popular Religion, 1750–1850, in: Burbank, Jane; Ransel, David L. (Hrsg.): Imperial Russia. New Histories for the Empire, Bloomington u.a. 1998, S. 210–249.
Freeze, Gregory L.: Handmaiden of the State? The Church in Imperial Russia Reconsidered, in: Journal of Ecclesiastical History 36/1(1985), S. 82–102.
Freeze, Gregory L.: The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia. Crisis, Reform, Coun-ter-Reform, Princeton 1983.
Gassenschmidt, Christoph; Tuchtenhagen, Ralf (Hrsg.): Politik und Religion in der Sowjet-union 1917–1941, Wiesbaden 2001.
Geraci, Robert P.; and Michael Khodarkovsky, Michael (Hrsg.): Of Religion and Identity: Missions, Conversion, and Tolerance in the Russian Empire, Ithaca 1999.
Hildermeier, Manfred: Alter Glaube und neue Welt: Zur Sozialgeschichte des Raskol im 18. und im 19. Jahrhundert, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 38 (1990), S. 372–398; 504–525.
Hildermeier, Manfred: Alter Glaube und Mobilität. Bemerkungen zur Verbreitung und sozia-ler Struktur des Raskol im frühindustriellen Russland, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuro-pas 39 (1991), S. 321–338.
Hösch, Edgar: Orthodoxie und Häresie im alten Russland, Wiesbaden 1975.
Husband, William B.: «Godless Communists». Atheism and Society in Soviet Russia, 1917–1932, DeKalb 2000.
Kappeler, Andreas: Russland als Vielvölkerreich. Entstehung, Geschichte, Zerfall, München 1992.
Teil B: Systematischer Teil
124
Kappeler, Andreas: Die «vergessenen Muslime». Russland und die islamischen Völker seines Imperiums, in: Saeculum 55/1 (2004), S. 19–47.
Kivelson, Valerie A., Robert H. Greene (Hrsg.): Orthodox Russia. Belief and Practice Under the Tsars, Pennsylvania 2003.
Kizenko, Nadieszda: A Prodigal Saint: Father John of Kronstadt and the Russian People, University Park 2000.
Miner, Steven Merrit: Stalin’s Holy War. Religion, Nationalism, and Alliance Politics, 1941–1945, Chapel Hill u.a. 2003.
Nolte, Hans-Heinrich: Religiöse Toleranz in Russland 1600–1725, Göttingen 1967.
Noack, Christian: Muslimischer Nationalismus im russischen Reich: Nationsbildung und Nationalbewegung bei Tataren und Baschkiren, 1861–1917, Stuttgart 2000.
Paert, Irina: Old Believers, Religious Dissent and Gender in Russia, 1760–1850, Manchester 2003.
Plaggenborg, Stefan: Volksreligiosität und antireligiöse Propaganda in der frühen Sowjetuni-on, in: Archiv für Sozialgeschichte 32 (1992), S. 95–130.
Scheidegger, Gabriele: Endzeit. Russland am Ende des 17. Jahrhunderts, Bern 1999.
Schulze Wessel, Martin: Religion und Politik. Überlegungen zur modernen Religionsgeschich-te Russlands als Teil einer Religionsgeschichte Europas, in: Graf, Friedrich Wilhelm; Große Kracht, Klaus (Hrsg.): Religion und Gesellschaft. Europa im 20. Jahrhundert, Köln u.a. 2007, S. 125–150.
Shevzov, Vera: Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution, New York 2004.
Stanislawski, Michael: Tsar Nicholas I and the Jews. The Transformation of Jewish Society in Russia, 1825–1855, Philadelphia 1983.
Steinberg, Mark D.; Coleman, Heather J. (Hrsg.): Sacred Stories: Religion and Spirituality in Modern Russia, Bloomington 2007.
Vulpius, Ricarda: Nationalisierung der Religion: Russifizierungspolitik und ukrainische Nati-onsbildung 1860–1920, Wiesbaden 2005.
Werth, Paul W.: At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance, and Confessional Poli-tics in Russia’s Volga-Kama Region, 1827–1905, Ithaca 2002.
Worobec, Christine: Possessed: Women, Witches and Demons in Imperial Russia, DeKalb 2001.
Zhuk, Sergei I.: Russia’s Lost Reformation: Peasants, Millennialism, and Radical Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830–1917, Baltimore u.a. 2004.
Zipperstein, Steven J.: The Jews of Odessa: A Cultural History, 1794–1881, Stanford 22001.
Ostmitteleuropa
Bahlke, Joachim; Strohmeyer, Arno (Hrsg.): Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wir-kungen des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur, Stuttgart 1999.
Bendel, Rainer (Hrsg.): Kirchen- und Kulturgeschichtsschreibung in Nordost- und Ostmittel-europa. Initiativen, Methoden, Theorien, Berlin 2006.
2. Religionen und Konfessionen
125
Brünning, Alfons: Unio non est unitas. Polen-Litauens Weg im konfessionellen Zeitalter (1569–1648), Wiesbaden 2008.
Hausleitner, Mariana; Katz, Monika (Hrsg.): Juden und Antisemitismus im östlichen Europa, Berlin 1995.
Hundert, David Gershon: Jews in Poland-Lithuania in the Eighteenth Century: A Genealogy of Modernity, Berkeley 2004.
Konfession und Nationalismus in Ostmitteleuropa. Kirchen und Glaubensgemeinschaften im 19. und 20. Jahrhundert, in: Nordost-Archiv 2 (1998) [Themenheft].
Levine, Hillel: Economic Origins of Antisemitism. Poland and Its Jews in the Early Modern Period, New Haven 1991.
Manthey, Franz: Polnische Kirchengeschichte, Hildesheim 1965.
Mendelsohn, Ezra: The Jews of East Central Europe Between the World Wars, Bloomington 1983.
Ramet, Pedro (Hrsg.): Catholicism and Politics in Communist Societies, London 1990.
Rosman, Murray J.: The Lords’ Jews: Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth During the Eighteenth Century, Cambridge 1990.
Schmidt, Christoph: Auf Felsen gesät. Die Reformation in Polen und Livland, Göttingen 2000.
Schulze Wessel, Martin (Hrsg.): Nationalisierung der Religion und Sakralisierung der Nation im östlichen Europa, Stuttgart 2006.
Schramm, Gottfried: Der polnische Adel und die Reformation 1548–1607, Wiesbaden 1965.
Stanislawski, Michael: A Murder in Lemberg: Politics, Religion, and Violence in Modern Jewish History, Princeton 2007.
Teter, Magda: Jews and Heretics in Catholic Poland: A Beleaguered Church in the Post-Reformation Era, Cambridge u.a. 2006.
Wäntig, Wulf: Rekatholisierung, Alltag und Migration in der Frühen Neuzeit. Exulanten im böhmisch-sächsischen Grenzraum des 17. Jahrhunderts, Chemnitz 2003.
Wünsch, Thomas (Hrsg.): Reformation und Gegenreformation in Oberschlesien: Die Auswir-kungen auf Politik, Kunst und Kultur im ostmitteleuropäischen Kontext, Berlin 1994.
Wünsch, Thomas (Hrsg.): Religion und Magie in Ostmitteleuropa: Spielräume theologischer Normierungsprozesse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Berlin u.a. 2006.
Südosteuropa
Benbassa, Esther, Rodrigue, Aron: The Jews of the Balkans: The Judeo-Spanish Community, 15th to 20th Centuries, Oxford u.a. 1995.
Binswanger, Karl: Untersuchungen zum Status der Nichtmuslime im Osmanischen Reich des 16. Jahrhunderts, mit einer Neudefinition des Begriffes «Dimma», München 1977.
Bougarel, Xavier, Clayer, Nathalie (Hrsg.): Le nouvel islam balkanique: les musulmans, acteurs du post-communisme, 1990–2000, Paris 2001.
Bremer, Thomas: Kleine Geschichte der Religionen in Jugoslawien. Königreich – Kommu-nismus – Krieg, Freiburg u.a. 2003.
Teil B: Systematischer Teil
126
Buchenau, Klaus: Orthodoxie und Katholizismus in Jugoslawien 1945–1991. Ein serbisch-kroatischer Vergleich, Wiesbaden 2004.
Döpmann, Hans-Dieter (Hrsg.): Religion und Gesellschaft in Südosteuropa, München 1997.
Duijzings, Ger: Religion and the Politics of Identity in Kosovo, London 2000.
Karpat, H. Kemal: The Politicization of Islam. Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State, Oxford 2001.
Mitterauer, Michael: Religionen, in: Kaser, K., Gruber, S., Pilcher, R. (Hrsg.): Historische Anthropologie im südöstlichen Europa. Eine Einführung, Wien u.a. 2003, S. 345–377.
Popovic, Alexandre: L’Islam balkanique: les musulmans du sud-est européeen dans la période post-ottomane, Wiesbaden 1986.
Poulton, Hugh; Taji-Farouki, Suha (Hrsg.): Muslim Identity and the Balkan State, New York 1997.
3. Politische Geschichte Osteuropas
127
3. POLITISCHE GESCHICHTE OSTEUROPAS
3.1 Einleitung: Themen und Fragen Die politische Geschichte Osteuropas lässt sich in ihren Grundzügen im Rah-men einer gesamteuropäischen Entwicklung verstehen. Die Monarchen der Herrschaftsformationen, die sich im Hochmittelalter im östlichen Europa her-ausbildeten, integrierten ihre Länder mit der Annahme des Christentums in die Familie europäischer Herrschaftsverbände. Sie stellten sich damit in eine ge-meinsame Tradition mit den bereits früher im südlichen und westlichen Euro-pa entstandenen Herrschaftsbildungen. Auf dieser Basis konnte sich ein je nach Raum und Epoche stärker oder schwächer ausgeprägter Kulturaustausch zwischen den Regionen des östlichen und des westlichen Europa ausbilden. Bei aller Verschiedenheit waren so die christlichen Länder Europas doch auch durch viele Berührungspunkte miteinander verbunden. Als vielleicht wesent-lichster Unterschied der osteuropäischen Entwicklung gegenüber Westeuropa kann auf die lange Zeit weniger gefestigte Basis der Herrschaft verwiesen werden. Prägender noch als für die politische Geschichte Westeuropas sind für das östliche Europa Brüche und Diskontinuitäten. In vielen Nationalhistoriografien Osteuropas ist das Bild der politischen Geschichte noch stark von einer traditionellen Sichtweise geprägt, die den Fokus auf allgemeine Grundprinzipien und die großen Linien längerfristiger Entwicklungen legt. Erst seit relativ kurzer Zeit wird im Rahmen neuer An-sätze einer Kulturgeschichte des Politischen verstärkt nach Aushandlungs-mechanismen und der konkreten Ausgestaltung von Herrschaftsbeziehungen gefragt und dabei auch den Handlungsspielräumen der Bevölkerung mehr Beachtung geschenkt. In der bisherigen, vor allem vom Historismus (> Glos-sar) und strukturgeschichtlichen Ansätzen gekennzeichneten Geschichts-schreibung standen vor allem folgende Problemfelder im Vordergrund: • Reiche und Staaten: Hierbei liegt der Fokus auf der Entstehung und
Entwicklung von Herrschaftsgebieten, insbesondere auf großen Ereig-nissen und herausragenden Persönlichkeiten. Als Legitimationswis-senschaft hat die Geschichte so im Rahmen nationaler «Meistererzäh-lungen» oft sinnstiftend zur Nations- und Staatsbildung beigetragen, indem moderne Nationen in Rückprojektion zu historischen Akteuren auch früherer Epochen erklärt wurden.
• Institutionen- und Rechtsgeschichte: Die Geschichte politischer Zu-sammenschlüsse ist lange Zeit primär aus administrativ-normativer Perspektive geschrieben worden. Dabei sind Institutionen wie etwa das Herrschertum, ständische Versammlungen oder der Verwaltungs-apparat bzw. abstrakte Grundsätze wie Gesetzes- und Verfassungstex-te als solche untersucht worden, da ihnen eine relativ autonome Be-
Teil B: Systematischer Teil
128
deutung unabhängig von kontextuellen Einflüssen zugestanden wor-den ist.
• Ideengeschichte: Ein dritter großer Bereich der Geschichtsschreibung hat sich mit Herrschaftsvorstellungen auf einer theoretisch-abstrakten Ebene auseinandergesetzt. So versuchte man, idealtypische Herr-schaftsverfassungen aus der politischen Praxis zu rekonstruieren, oder es wurden zu Legitimationszwecken entworfene Herrschaftsideolo-gien oder politische Projekte untersucht, die in einem philosophischen Sinne Vorstellungen für zukünftige politische Ordnungen entwarfen.
Mit Blick auf das westliche Europa, mit dem Osteuropa im Laufe der Ge-schichte immer enger in Kontakt gekommen ist, lassen sich einige spezifi-sche Voraussetzungen und Merkmale des östlichen Europa in Bezug auf die politische Geschichte feststellen: • Spätere Herrschaftsbildung: Die politische Geschichte Osteuropas
setzte später als im westlichen Europa ein. Überlokale, dauerhafte Herrschaftsgebilde entstanden, von Ausnahmen abgesehen, erst gegen Ende des ersten Jahrtausends nach Christus. In einem ähnlichen zeitli-chen Rahmen vollzog sich die Formierung von Herrschaftsbereichen jedoch in Skandinavien.
• Große Distanz zu den Zentren antiker Staatsbildung: Aufgrund der Distanz großer Teile des östlichen Europas zu den Zentren der antiken Staatsbildungen im Mittelmeerraum mit ihrem ausgereiften administ-rativen Apparat (Ausnahme: Südosteuropa) konnten die entsprechen-den, vor allem über das Römische Reich vermittelten Traditionen (Schriftlichkeit, Christentum, Städtewesen, seit dem Hochmittelalter römisches Recht etc.) in den östlichen und nördlichen Regionen Euro-pas nicht im selben Ausmaß wie weiter westlich und südlich zur Bil-dung neuer Reiche beitragen.
• Exponierte Lage, Landmasse: Große Teile des östlichen Europa blieben bis ins Spätmittelalter hinein im Einzugsbereich von Feldzügen und Herrschaftsformationen, die ihren Ausgangspunkt in den zentralen Tei-len der großen eurasischen Landmasse, insbesondere im Steppengürtel zwischen unterer Donau, der pannonischen Tiefebene und Zentralasien, hatten. Die nach Osten offene und ungeschützte osteuropäische Land-masse befand sich damit gegenüber den Reiternomaden in einer stark exponierten Lage. Sie verfügte nur über wenige Zugänge zum Meer, was die Kontakte zu den stark maritim geprägten, ausdifferenzierten Kulturen der Mittelmeerwelt erschwerte, welche die politischen Organi-sationsformen Westeuropas wesentlich mitprägten. Besonders die östli-chen Regionen Osteuropas standen daher bis ins Hochmittelalter weit stärker im Einzugsbereich nordwest- und zentralasiatischer Kulturtradi-
3. Politische Geschichte Osteuropas
129
tionen als im Einflussbereich der sich aus der griechisch-römischen An-tike entwickelnden christlich-europäischen Völkerfamilie.
• Geringe herrschaftliche Durchdringung: Ein teils bis in die Gegen-wart durchgehend zu beobachtendes Charakteristikum Osteuropas ist die im Vergleich zu den Kerngebieten Westeuropas geringere Intensi-tät herrschaftlicher Durchdringung. Aufgrund der niedrigeren Bevöl-kerungsdichte im Osten entwickelte sich die gesellschaftliche Ausdif-ferenzierung meist nicht mit derselben Dynamik wie weiter westlich. Auch die weniger stark ausgeprägte Verrechtlichung in vielen Berei-chen kann hier angeführt werden, so etwa in Bezug auf die Kommu-nenbildung (Stadtrecht), die für die Entwicklung nicht derart prägend wurde wie im westlichen Teil des Kontinents.
• Großreiche und Imperien, Nationalismus: Etwa seit dem 15. Jahrhun-dert und bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren weite Gebiete Ost-europas Teil multiethnischer Großreiche und Imperien (Osmanisches Reich, Polen-Litauen, Russländisches Reich, Habsburger Reich, Preu-ßen). Die Zentren dieser Imperien lagen damit aus osteuropäischer Perspektive peripher, die Reichseliten waren weniger von regionalem Landesbewusstsein als von einer überregionalen Reichsidentität ge-prägt und die kulturelle Vereinheitlichung in den multiethnischen Im-perien blieb relativ gering. Vielfach später als im Westen und als Re-aktion auf entsprechende Konzepte aus Frankreich kam es daher zur Bildung von Nationalbewegungen. Die Bildung und Konsolidierung von Nationalstaaten war seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, teilweise mit Auswirkungen bis in die Gegenwart, mit einer Reihe von Krisen und Brüchen (Revolutionen, Kriege, Vertreibungen, Bevölkerungsaus-tausch, forcierte ethnische Homogenisierung) verbunden. Unter ge-wissen Aspekten lassen sich für das 20. Jahrhundert auch die Sowjet-union und Jugoslawien in dieses Deutungsmuster einbeziehen.
• Diktatur und Repression, Fremdherrschaft: Im «kurzen 20. Jahrhun-dert» (1914–1989/91) stand für die durchwegs jungen, seit dem 19. Jahrhundert aus Großreichen hervorgegangenen Staaten Osteuro-pas die innere Konsolidierung ihrer Herrschaft und die außenpoliti-sche Absicherung der Grenzen oder sogar der Selbstständigkeit im Vordergrund. Die Miteinbeziehung der großen Masse der (männli-chen) Staatsbürger in den politischen Entscheidungsprozess führte je-doch aufgrund ungefestigter Institutionen, schwach ausgebildeter bür-gerlicher Traditionen, ungenügender Bildung und ausländischer Be-einflussung in der Regel nicht zu demokratischen politischen Syste-men. Rechtsautoritäre Regimes, wie sie sich im Laufe der Zwischen-kriegszeit in fast allen Staaten Ostmittel- und Südosteuropa entwickel-
Teil B: Systematischer Teil
130
ten, bzw. unter gänzlich anderen Vorzeichen der Sozialismus (> Glos-sar) sowjetischer Prägung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges (in der Sowjetunion schon vorher) setzten zur Konsolidierung ihrer Herr-schaft oft auf Repression, teilweise bis hin zu massenhaftem Terror. Häufig ging die Etablierung einer Diktatur mit äußerer Einflussnahme einher, die von wirtschaftlicher Abhängigkeit bis zu militärischer Beset-zung und Annexion reichen konnte. Vor und während des Zweiten Weltkrieges war es das nationalsozialistische Deutschland, das mit einer aggressiven Politik die meisten Länder Osteuropas unter direkte oder indirekte Kontrolle brachte. Nach dem Zweiten Weltkrieg dehnte sich die sowjetische Hegemonie über den größten Teil Osteuropas aus. Der wechselhafte Verlauf zwischen «nationaler Selbstbestimmung» und «Fremdherrschaft» gehört so für praktisch alle osteuropäischen Länder zu den zentralen Grundlinien des eigenen Geschichtsbildes. Verbunden damit, oft jedoch aus der auf die Opferperspektive eingeengten Betrach-tungsweise ist die Frage nach dem Ausmaß der Kollaboration einheimi-scher Eliten und der Bevölkerung mit den entsprechenden Regimes.
3.2 Frühe Herrschaftsbildungen 3.2.1 Voraussetzungen und Einflüsse
Bei der Bildung von Herrschaftsverbänden in Osteuropa spielten neben inne-ren Faktoren auch äußere Impulse aus verschiedenen Richtungen eine Rolle, die durch Kontakte die Entstehung überlokaler Herrschaften angeregt oder auch direkt beeinflusst haben. Im Wesentlichen lassen sich vier Kulturräume identifizieren, die sich grob den vier Himmelsrichtungen zuordnen lassen und die in Bezug auf die Herrschaftsbildung im östlichen Europa die Rolle von Katalysatoren gespielt haben (in absteigender Reihenfolge nach zeitli-cher Länge dieses Einflusses auf Osteuropa): • Eurasischer Steppengürtel: Seit vorgeschichtlicher Zeit war der Step-
pengürtel zwischen unterer Donau und Zentralasien, nördlich des Schwarzen und des Kaspischen Meeres (mit einer Fortsetzung in der ungarischen Tiefebene) ein Raum, den eine Vielzahl von Stämmen und Stammesverbänden als Siedelungsgebiet oder für ihre nomadische Le-bensweise nutzten und wo sie teilweise auch großräumige Herrschafts-bereiche errichteten. Beispiele dafür sind etwa das Reich der Chazaren von der ersten Hälfte des 7. bis Anfang des 11. Jahrhunderts (mit einer um die Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert zum Judentum übergetrete-nen Führungsschicht), das Reich der Wolgabulgaren (> Glossar Bulga-ren) vom frühen 10. bis Mitte des 13. Jahrhunderts an mittlerer Wolga und Unterlauf der Kama (mit um 922 zum Islam übergetretener Füh-
3. Politische Geschichte Osteuropas
131
rungsschicht) oder das Reich der Mongolen (Tataren) ab der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.
• Mittelmeer: Große Teile Osteuropas kamen bedeutend später mit der Mittelmeerwelt in engeren Kontakt als die Regionen des westlichen Eu-ropa. Die kulturellen und staatlichen Traditionen der Antike wie auch das sich vom Mittelmeer über Europa verbreitende Christentum wurden daher lange Zeit im östlichen Teil des Kontinentes kaum rezipiert und konnten daher im Osten anders als im Westen keine bedeutende Wir-kung auf frühmittelalterliche Reichsbildungen ausüben. Während große Teile Westeuropas mit der Zugehörigkeit zum Römischen Reich bereits in der Antike eine feste, territorial gebundene Herrschaft gekannt hatten, so wurde in Osteuropa einzig die Balkanhalbinsel bis zur Donau im Norden für mehrere Jahrhunderte ins Römische Reich einbezogen. Süd-osteuropa verblieb auch während des gesamten Mittelalters stark von der byzantinischen Kultur geprägt, während sich byzantinischer Ein-fluss auf andere Regionen Osteuropas (Kiever Rus’) erst gegen Ende des ersten Jahrtausends in größerem Maße bemerkbar zu machen be-gann. Seit dem Hochmittelalter spielte auch Venedig und in geringerem Maße Genua für die Küsten- und Inselregionen Südosteuropas und des Schwarzen Meeres als Hegemonial- und Handelsmacht eine wichtige Rolle.
• Mitteleuropa: Einflüsse aus Westen betrafen besonders die Gebiete Ostmitteleuropas von der Ostsee bis zur Adria, die seit dem ausgehen-den 8. Jahrhundert mit dem Niedergang des Awarenreiches (> Glossar Awaren) und dem Erstarken des (ost-)fränkischen, später deutschen bzw. Heiligen Römischen Reiches (deutscher Nation) immer mehr in den Einflussbereich dieser neuen mitteleuropäischen Großmacht ge-rieten. Über Handel, Missionierung und Eroberung drangen mitteleu-ropäische Einflüsse und damit per indirekter Vermittlung auch antike Kulturtraditionen nach Ostmitteleuropa vor. Die entstehenden Reiche dieses Raumes (Polen, Böhmen, Ungarn, Kroatien) adaptierten teilwei-se politische und soziale Organisationsformen, wobei vom fränkisch-deutschen Lehenswesen nur einzelne Elemente übernommen wurden. Im Verlauf des Hochmittelalters verstärkte sich der mitteleuropäische Einfluss auf Ostmittel- und Teile Südosteuropas insbesondere durch die Deutsche Ostsiedlung (vgl. Mittelalterliche Ostsiedlung, S. 311) und die damit verbundene Übernahme von Rechtsformen wie dem Stadtrecht. Im östlichen Ostseeraum wurden mitteleuropäische Ein-flüsse erst seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert mit der Missionie-rung und der späteren Unterwerfung der paganen (heidnischen) balti-schen und ostseefinnischen Stämme in größerem Umfange wirksam.
Teil B: Systematischer Teil
132
• Skandinavien: Impulse zur Herrschaftsbildung aus dem skandinavi-schen Raum gehen insbesondere auf die Waräger (> Glossar) zurück. Dabei handelte es sich um kriegerische Männerbünde, die von Skandi-navien aus Raub- und Handelszüge unternahmen. Als Händler waren sie im Gebiet zwischen Ostsee, Schwarzem und Kaspischem Meer un-terwegs, wo warägische Traditionen zur Entstehung der Kiever Rus’ beitrugen. Im Rahmen der Missionierung der paganen Stämme im Hin-terland der östlichen Ostseeküste beteiligten sich auch die skandinavi-schen Reiche an der Eroberung dieser Gebiete.
Die äußeren Einflüsse wirkten sich in sehr unterschiedlicher Weise auf die Herausbildung herrschaftlicher Organisation in Osteuropa aus. So konnte etwa die Einbeziehung von Stämmen in größere Reichsverbände zur Arbeits-teilung und sozialen Differenzierung der unterworfenen Gruppen beitragen, etwa durch Beteiligung am Fernhandel oder Delegation bestimmter Aufga-ben wie Tributeinzug durch die Oberherrschaft an lokale Vertreter. Klein-räumige, auf lokale Angelegenheiten beschränkte Herrschaftsorganisationen konnten sich im geschützten Rahmen der Zugehörigkeit zu einem größeren Reichsverband bilden und so die Grundlage legen für spätere Herrschafts-formationen. Die genaue Datierung der Anfänge eines bestimmten Herr-schaftsgebildes ist daher kaum möglich und im Prinzip auch irrelevant; vielmehr ist die Herrschaftsbildung als komplexer, lang andauernder und keineswegs linear verlaufender Prozess anzusehen. Zur Entstehung überlo-kaler Herrschaften trugen je nach Kontext verschiedene Faktoren in wech-selnder Konstellation bei: • Soziale Differenzierung, etwa durch Vermögen, Erfordernisse der
Kriegsführung oder Betrauung mit administrativen Funktionen für ei-ne übergeordnete Herrschaft
• Zunehmende Komplexität anstehender Aufgaben (etwa Handel, Bergbau, Tributeinhebung) erfordern stärkere Koordination und Organisation
• Ausdehnung des Einzugsbereiches benachbarter Herrschaftsformatio-nen veranlasst straffere Organisation
• Äußere Bedrohung: Zusammenschluss zur gemeinsamen Abwehr eines Feindes
• Eroberung eines herrschaftlich schwach organisierten Gebietes von außen
• Verselbstständigung lokaler Herrschaftsbereiche bei Schwächung einer übergeordneten Herrschaft
Von zentraler Bedeutung bei der Entstehung von Herrschaft war die Identi-tätsbildung, die Schaffung eines Gefühls der Zusammengehörigkeit zumin-dest der Führungsschichten, um der Übernahme koordinierter Aufgaben
3. Politische Geschichte Osteuropas
133
einen ideellen Rahmen zu geben. Identitäts- und Herrschaftsbildung stehen daher besonders in einem engen gegenseitigen Verhältnis.
3.2.2 Grundlagen der Herrschaftsbildung
Da Osteuropa größtenteils keinen Anteil an der griechisch-römischen Antike gehabt hatte, waren für diese Region andere Traditionen konstitutiv. An die Stelle der zentralisierten Staatsmacht römisch-hellenistischer Prägung trat die gänzlich anders strukturierte reiternomadisch geprägte Kultur wechseln-der Steppenvölker und Stammesverbände. Diese dominierten während Jahr-hunderten insbesondere den eurasischen Steppengürtel, der sich von der unteren Donau bzw. Pannonien nördlich des Schwarzen und Kaspischen Meeres bis nach Zentralasien erstreckt. Erst ein regerer Austausch mit euro-päischen Herrschaftsverbänden über Handel, christliche Missionierung oder militärische Konflikte etwa seit dem 9. Jahrhundert setzte Impulse frei, die zu diversen christlichen Herrschaftsbildungen im östlichen Europa beitru-gen. Im Verlauf des Frühmittelalters geriet das östliche Europa sukzessive von Süden und Westen her in den Einzugsbereich des christlichen Europa, was nach längerfristigen Prozessen zur Entstehung von Herrschaftsformatio-nen führte, die sich etwa über die Kirchenorganisation oder dynastische Ver-bindungen in die (west-)europäische Tradition eingliederten. Von diesem Zeitpunkt an treten die östlichen Teile des Kontinents als Teil in die gemein-same Geschichte Europas ein. In Osteuropa war nur die Balkanhalbinsel mit der Donau als Nordgrenze in das Römische Reich einbezogen gewesen. Seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. hatte sich das Römische Reich über die Adriaostküste hinaus zuerst im Sü-den der Balkanhalbinsel (Griechenland, Makedonien) festzusetzen begon-nen. Die sukzessive Eroberung Südosteuropas dauerte bis ins 1. Jahrhundert n. Chr. an, womit die Donaulinie für mehrere Jahrhunderte (im Wesentlichen bis zu den Awareneinfällen zu Beginn des 7. Jahrhunderts) zur Trennscheide wurde, welche die «barbarische» Welt der gentes, der Stammesverbände, vom römischen Weltreich trennte. Einzig mit der Provinz Dacia im heutigen Rumänien existierte eine vergleichsweise kurze römische Herrschaft nörd-lich der Donau (107–271 n. Chr.). Die Zugehörigkeit Südosteuropas zum Römischen Reich ging in der Spätan-tike nahtlos in die byzantinische Herrschaft über, wobei die Unterscheidung zwischen einem «römischen» (antiken, von Rom aus regierten, lateinisch-sprachigen und paganen) und einem «byzantinischen» (mittelalterlichen, von Byzanz/Konstantinopel aus regierten, griechisch-hellenistischen und christ-lich-orthodoxen) Reich eine von späteren Generationen vorgenommene Un-terteilung ist, um das fortbestehende Oströmische Reich vom (gesamt-) Rö-
Teil B: Systematischer Teil
134
mischen Reich der Antike zu unterscheiden und den gewandelten Charakter des Reiches zu betonen. In der Selbstwahrnehmung sahen sich die Byzanti-ner bis zum definitiven Untergang des Reiches (1453 Eroberung Konstanti-nopels durch die Osmanen) schlicht als «Rhomaioi» («Rhomäer», Römer). Als einer der nachhaltigsten Einflüsse der byzantinischen Herrschaft auf die Geschichte Südosteuropas ist die frühe, vor allem seit dem 4. Jahrhundert einsetzende Christianisierung dieses Raumes anzusehen, die teilweise auch auf jenseits der Reichsgrenzen siedelnde Stammesverbände ausstrahlte. Süd-osteuropa kam damit früher als alle anderen Regionen des östlichen Europa in Kontakt mit dem Christentum, das später auch von Eroberern angenom-men wurde, etwa den turkischen (> Glossar) Bulgaren bzw. Protobulgaren (> Glossar Bulgaren). Die Annahme des Christentums legte die Grundlage für eine kirchlich legitimierte Herrschaftsordnung mit einer territorial orga-nisierten Reichbildung und einem die einzelnen Herrschaftsbereiche über-wölbenden gemeinsamen kulturellen Referenzpunkt. Das Christentum bilde-te eine ideelle Grundlage der gegenseitigen Anerkennung verschiedener Herrschaftsverbände. Besiegelt wurde diese Anerkennung etwa durch Heira-ten innerhalb der Führungsschichten. Damit war die Basis gelegt für eine mehr oder weniger friedliche Koexistenz verschiedener Herrschaftsbildun-gen nebeneinander. Die Christianisierung zumindest einer dünnen Herr-schaftselite spielte daher eine zentrale Rolle bei der Etablierung von Herr-schaftsverbänden als relativ dauerhafte Gebilde. Die stark personenbezogene Grundlage der Herrschaft wurde damit durch eine institutionalisierte Kir-chenhierarchie ergänzt, die in verschiedenen Kontexten als Katalysator auf die Herrschaftsstrukturen rückwirken sollte. Eine christlich legitimierte Herrschaftsordnung war geeignet, die Identifikation mit dem Herrschaftsge-bilde auch in Krisenzeiten zumindest bei einer Elite aufrecht zu erhalten. Darin ist ein wesentlicher Grund zu sehen für die vergleichsweise lange Be-ständigkeit der an christliche Herrschaftsformationen geknüpften Traditio-nen und Identitäten. Diverse frühmittelalterliche Reichsbildungen im osteu-ropäischen Raum, vor allem solche von Stammesverbänden aus dem eurasi-schen Steppengürtel, konnten den Einzugsbereich ihrer Herrschaft zwar manchmal innert kürzester Zeit auf riesige Gebiete ausdehnen. Doch brachte es die stark personenbezogene und wenig institutionalisierte Herrschafts-struktur mit sich, dass im Falle von Misserfolgen und Krisen das Ansehen des Herrschers und damit seine charismatische Fähigkeit, andere Stämme an sich zu binden, oft schnell erodierte (so etwa im Falle des Hunnenreiches Mitte des 5. Jhd. n. Chr. oder des Awarenreiches Ende des 8. Jhd.). Die Steppenreiche sind daher als Konglomerat unterschiedlichster Herr-schaftsformen zu verstehen, die durch die gemeinsame Oberhoheit meist nur locker zusammengehalten wurden. Vereinheitlichungstendenzen in religiös-
3. Politische Geschichte Osteuropas
135
konfessioneller, ethnischer oder sozialer Hinsicht ließen sich allenfalls bei einer schmalen Oberschicht feststellen. Eine der Christianisierung der europäi-schen Herrschaftsbildungen vergleichbare, längerfristig die gesamte Unterta-nenschaft erfassende Nivellierung oder Identitätsbildung breiterer Bevölke-rungsschichten blieb hingegen aus. Dies erklärt das weitgehend spurlose Ver-schwinden einer entsprechenden Identität selbst im Falle bedeutender, lange bestehender Reichsbildungen wie etwa der Awaren oder der Chazaren nach dem Untergang der jeweiligen Reiche. In der nicht zuletzt in der christlichen Missionierung begründeten stärkeren herrschaftlichen Durchdringung und Vereinheitlichung des Territoriums und der aus der Antike hergeleiteten Ver-waltungstradition (Schriftlichkeit, Territorialorganisation etwa im kirchlichen Bereich) liegen die Gründe für die Bildung dauerhafter Herrschaftsformatio-nen in Osteuropa, deren Tradition anders als im Falle reiternomadischer Reichsbildungen auch beim Untergang des entsprechenden Reiches nicht ab-brach.
3.3 Vertiefender Exkurs I: Politische Geschichte des ostslawischen Raumes im Mittelalter 3.3.1 Frühe Herrschaftsbildung: Die Kiever Rus’
Die in der Forschung viel diskutierten Anfänge der Kiever Rus’ gehen auf das 9. Jahrhundert zurück, die genauen Umstände sind jedoch nicht bekannt. Die erst Anfang des 12. Jahrhunderts verfasste und daher kritisch auszuwer-tende Erzählung von den vergangenen Jahren, oft als Nestorchronik (> Glos-sar) bezeichnet, welche die Anfänge der Rus’ in einer Art Gründungsmythos beschreibt, datiert deren Entstehung auf die zweite Hälfte des 9. Jahrhun-derts. Die Rede ist von lokalen Stämmen, die sich aufgrund ständiger Fehden auswärtige Herrscher bei den Warägern suchten. Auf die Dynastie des er-wähnten legendären «Reichsgründers» Rjurik führten sich die Herrscher der Kiever Rus’ und später des Moskauer Reiches bis 1598 zurück. Die Waräger, aus Skandinavien stammende normannische Schwurbrüder-schaften, waren primär als Raubhändler auf den Flüssen (Wolga, Dnjepr, Don) zwischen der Ostsee, dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer un-terwegs. In der Historiografie seit dem 18. Jahrhundert ist ihr Beitrag zur Reichsbildung der Kiever Rus’ äußerst kontrovers diskutiert worden (soge-nannter Normannismusstreit, Warägerfrage). Die Betonung einer überwie-gend warägischen Initiative lässt jedoch genauso wie die Hypothese einer vornehmlich slawischen Herrschaftsbildung (wie sie vor allem die national-russische und sowjetische Geschichtsschreibung vertreten hat) die komple-xen Prozesse der Entstehung von Herrschaft außer Acht. Der Disput darüber orientiert sich an anachronistischen Prämissen und ist letztlich angesichts
Teil B: Systematischer Teil
136
frühmittelalterlicher Identitätskategorien für das Verständnis der Herr-schaftsbildung wenig relevant. Unergiebig ist auch die seit dem Zerfall der Sowjetunion aktuell gewordene Diskussion darüber, welcher der drei ostsla-wischen Staaten (Russland, Ukraine, Belarus’) berechtigen Anspruch auf das historische Erbe der Kiever Rus’ stellen kann. In dieser Weise gestellt ist die Frage anachronistisch, da sie von modernen Kriterien der Staatlichkeit und nationaler Zugehörigkeit ausgeht. Die Vorstellung einer linearen Entwick-lung und Kontinuität von der Kiever Rus’ zu modernen Staaten lässt den vielschichtigen historischen Verlauf, die diversen Reichsbildungen, die auch den (heutigen) ostslawischen Raum erfassten (Goldene Horde > Glossar, Polen-Litauen, Krimkhanat > Glossar Khan, Habsburger Reich), den Charak-ter der Kiever Rus’ als lockerer Verband diverser Teilfürstentümer und nicht zuletzt die polyethnische Zusammensetzung des Kiever Reiches außer Acht. Die Entstehung der Kiever Rus’ lässt sich wohl am ehesten als ein Zusam-menwirken unter anderem von warägischen Krieger-Händlern und diversen slawischen, finno-ugrischen (> Glossar) und baltischen Stämmen vor dem Hintergrund eines durch das geschwächte Chazarenreich verursachten Macht-vakuums verstehen, an dessen Stelle die Rus’ trat. Die frühesten Herrschafts-zentren lagen im Norden, der Süden um Kiev geriet erst seit dem ausgehen-den 9. Jahrhundert in den Einzugsbereich warägischer Herrschaft. Waräger und Slawen standen in engem Kontakt, so zur Sicherung von Handelswegen und -aktivitäten oder in Form einer Tributabhängigkeit. Aus der Symbiose entwickelte sich schließlich im 10. Jahrhundert eine großräumige Reichsbil-dung, die in mancherlei Hinsicht auch an Traditionen des Chazarenreiches anknüpfen konnte, dessen Tributhoheit durch diejenige der Waräger abgelöst wurde. Die Waräger, die sich in verschiedenen Wellen seit der zweiten Hälf-te des 8. bis in die erste Hälfte des 11. Jahrhunderts primär entlang der Fluss-läufe niederließen, stellen eine relativ geringe Zahl dar und akkulturierten sich sprachlich und kulturell schnell an das slawische Umfeld. Der vermut-lich von einer Bezeichnung der Waräger abgeleitete Begriff Rus’ wurde so schließlich zur Benennung des neuen Reiches und damit auch der Ostslawen, wenn auch der Name Rus’ in einem engeren Sinne lange auf ein kleines Gebiet im Süden um Kiev, Černigov und Perejaslavl’ beschränkt blieb. Der Begriff Kiever Rus’ ist rückblickend zur Kennzeichnung der Phase ostslawi-scher Geschichte bis zum Mongolensturm Mitte des 13. Jahrhunderts und zur Abgrenzung von der Moskauer Periode «russischer» Geschichte einge-führt worden. Das Kiever Reich war eher ein lockerer Herrschaftsverband als ein einheitli-ches Reich. Es umfasste mehrere unter rjurikidischer Herrschaft stehende Teilfürstentümer in einem großen Gebiet zwischen Ladogasee, nördlichen Karpaten und oberer Wolga, jedoch ohne die Steppengebiete nördlich des Schwarzen und des Kaspischen Meeres, die der Herrschaft wechselnder
3. Politische Geschichte Osteuropas
137
Stammesverbände unterstanden. Neben den frühesten Herrschaftszentren im Nordwesten zwischen Ladogasee, oberer Wolga und oberem Dnjepr bildete sich im Süden, wo aufgrund kultureller und Handelskontakte der byzantini-sche Einfluss besonders stark war, im frühen 10. Jahrhundert mit Kiev am mittleren Dnjepr ein bedeutendes Herrschaftszentrum heraus. Der jeweilige Fürst von Kiev wurde gewohnheitsrechtlich als «primus inter pares» der Rjurikidischen Fürsten angesehen, der Titel eines Großfürsten fand aber erst seit dem späten 12. Jahrhundert regelmäßig Verwendung, als diese Würde bereits auf die Herrscher von Vladimir-Suzdal’ übergegangen war. Der Zusammenhalt des Reiches war relativ lose und beruhte vor allem auf den dynastischen Beziehungen der Rjurikiden, während die herrschaftliche Durchdringung und administrative Vereinheitlichung des Territoriums nur schrittweise vonstatten ging. Neben den Fürsten aus der Dynastie der Rjuri-kiden und ihrer Gefolgschaft (družina > Glossar) waren vor allem im 12. und 13. Jahrhundert auch städtische Volksversammlungen (veče > Glossar), an der Herrschaft beteiligt. Die Bedeutung dieser seit dem 11. Jahrhundert be-legten Versammlungen und ihr Einfluss auf den politischen Entscheidungs-prozess ist in der Forschung umstritten. Am stärksten ausgeprägt waren die veče im Nordwesten der Rus’ (Novgorod, Pskov), wo sie sich bis Ende des 15. Jahrhunderts halten konnten. In mehreren Etappen erfolgte seit dem zwei-ten Drittel des 11. Jahrhunderts eine Kodifizierung des Rechts in Gesetzes-sammlungen, die zusammenfassend als «russkaja pravda» bezeichnet werden, aber erst aus späteren Abschriften überliefert sind. Ein einigendes Band des Kiever Reiches stellte vor allem die orthodoxe Kirche dar. In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts nahmen die Rjurikiden den christlichen Glauben nach griechischem Ritus an (Taufe des Kiever Herrschers Vladimir um 988). Den Höhepunkt seiner machtpolitischen Stellung und inneren Konsolidie-rung erreichte das Kiever Reich im 11. und frühen 12. Jahrhundert. Danach setzte ein Zerfallsprozess ein, der phasenweise schon zuvor den Zusammen-halt des Reiches durch zunehmende Verselbstständigung der diversen Teil-fürstentümer der Rus’ geschwächt hatte. Größere Herrschaftszentren began-nen sich an der Peripherie der Kiever Rus’ zu bilden, so etwa seit dem frü-hen 11. Jahrhundert die Handelsstadt Novgorod im Nordwesten, die in der Folge ein Territorium kontrollierte, das weit nach Norden und Nordosten bis zum Eismeer und in den nördlichen Ural reichte. Im Südwesten stellten die Fürstentümer Galizien (Halič) und Wolhynien (seit dem späten 11. Jhd. bis 1340), im Nordosten das Fürstentum Vladimir-Suzdal’ (12. und 13. Jhd.) an westlichen Nebenflüssen der oberen Wolga bedeutende Herrschaftszentren dar. In einem langfristigen Prozess verlagerte sich der demografische und damit auch der politische und kulturelle Schwerpunkt der Rus’ von den süd-lichen Gebieten um Kiev in die weiter nördlich gelegenen Wald- und
Teil B: Systematischer Teil
138
Sumpfgebiete, die besser vor den Einfällen aus den Steppen geschützt wa-ren.
3.3.2 Vorherrschaft der Goldenen Horde und Bildung des Moskauer Reiches
In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts begann der Aufstieg des mongoli-schen Reiches, das innerhalb weniger Jahrzehnte große Teile Eurasiens von China bis weit nach Ostmitteleuropa hinein umfasste. Die Unterwerfung weiter Teile Osteuropas unter mongolische Vorherrschaft erfolgte ab 1236 unter einem Enkel Dschingis Khans, Khan Batu, der über die westlichen Gebiete des Mongolenreiches herrschte. Nach der Eroberung der russischen Fürstentümer (Novgorod im äußersten Nordwesten blieb verschont) drangen seine Truppen 1241 bis nach Ungarn, Polen, Mähren, Dalmatien und die Balkanhalbinsel vor, zogen sich aber schon im Folgejahr wieder zurück. Von Dauer sollte die mongolische Herrschaft bzw. Oberhoheit jedoch für das Steppengebiet zwischen unterer Donau und Westsibirien, das Gebiet entlang der Wolga und Kama sowie für die russischen Fürstentümer des einstigen Kiever Reiches, inklusive Novgorods, sein. Mit dem Zentrum am Unterlauf der Wolga etablierte sich hier das von Batu begründete und als «Goldene Horde» bezeichnete Reich, das den westlichsten Teilbereich des mongolischen Großreiches darstellte, von dem es aber in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts weitgehende Selbstständigkeit erlangte. Bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts setzte sich der Islam als Reichsreligion durch. Die rus-sischen Teilfürsten wurden, sofern sie sich der tatarischen (mongolischen) Oberhoheit unterwarfen und Tribute ablieferten, in ihrer Funktion anerkannt. Sie gerieten jedoch in Abhängigkeit vom Khan, der über ihre Ein- und Ab-setzung eine indirekte Form der Herrschaft über die russischen Fürstentümer ausübte. Den Tataren loyal ergebene Fürsten konnten so faktisch als lokale Bevoll-mächtigte des Khans wirken. Der Einfluss, den die Tataren beim raschen Machtzuwachs Moskaus im frühen 14. Jahrhundert ausübten, ist in der His-toriografie kontrovers diskutiert worden; dass die geschickte Politik der Moskauer Fürsten gegenüber der Horde wesentlich zum Aufstieg Moskaus zur führenden Macht in der Rus’ beigetragen hat, ist inzwischen jedoch weitgehend unstrittig. Die Goldene Horde als eine reine «Fremdherrschaft», als ein «Tatarenjoch», über die ostslawischen Gebiete zu bezeichnen, wie dies die russische Histo-riografie oft getan hat, stellt eine grobe Vereinfachung dar – zumal sich zu dieser Zeit Herrschaft grundsätzlich nicht an ethnisch-nationalen Kriterien orientierte und die Rus’ selber ethnisch komplexe Verhältnisse aufwies.
3. Politische Geschichte Osteuropas
139
Treffender lässt sich das Herrschaftssystem der Goldenen Horde als ein von beidseitigen Interessen getragenes Unterordnungsverhältnis einzelner Vertre-tern der Führungsschichten der russischen Teilfürstentümer unter die tatari-sche Oberhoheit charakterisieren. Als Gegenleistung für die freiwillige Un-terwerfung unter den Khan konnten sie bei der Durchsetzung ihrer Herr-schaftsansprüche gegen äußere und innere Feinde auf tatarische Unterstüt-zung hoffen. Die Goldene Horde integrierte damit die vorgefundenen herr-schaftlichen und administrativen Strukturen in ihren Reichsverband. Ein völliger Bruch mit den Traditionen der Kiever Rus’ fand nicht statt. In reli-giösen Belangen verblieb der orthodoxen Kirche ein weitgehender Freiraum, der es ihr ermöglichte, als Traditionsträgerin die politisch zersplitterten Herrschaftsbereiche zu überwölben und eine gemeinsame, gesamt-ostlawische Verbundenheit zu verkörpern. Daher war es für die Herrscher bedeutsam, die Kirche als Verbündete zu gewinnen. Die Verlagerung des demografischen, kulturellen und auch politi-schen Schwerpunktes der Rus’ führte dazu, dass der Metropolit als höchster Repräsentant der Kirche Ende des 13. Jahrhunderts (ca. 1300) von Kiev nach Vladimir übersiedelte, um schon um 1325 seinen Sitz nach Moskau zu ver-legen. Dieses stieg im 14. Jahrhundert schnell zur führenden Macht in der unter tatarischer Oberhoheit stehenden Rus’ auf. Seit dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts konnte sich schließlich Moskau die Großfürstenwürde endgültig sichern. Damit war nicht nur eine ideelle Vorrangstellung unter den Fürsten der Rus’ verbunden, sondern durch die damit verbundene Auf-gabe der Tributeinhebung im Namen der Tataren konnten die Moskauer Großfürsten auch erhebliche Reichtümer ansammeln, die sie zur Konsolidie-rung ihrer Position nutzten. In der Folge gelang es den Großfürsten, den Moskauer Herrschaftsbereich schrittweise auszuweiten, zuerst nach Norden und Osten, seit Mitte des 15. Jahrhunderts verstärkt auch nach Süden und Westen (1477/78 Eroberung von Novgorod). Bis zum frühen 16. Jahrhundert stand ein Großteil der eins-tigen Kiever Rus’ unter Moskauer Herrschaft, die sich schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts definitiv von der tatarischen Oberhoheit lösen konnte. Von nun an begannen die Großfürsten unter dem Einfluss der Kir-che, zuerst vereinzelt, den Zarentitel zu verwenden, der definitiv seit 1547 zur Titulatur der Moskauer Herrscher wurde (ab 1721 Imperator). Um die Mitte des 15. Jahrhunderts löste sich die Kirche weitestgehend von der Un-terstellung unter den Patriarchen (> Glossar) in Konstantinopel. Mit der Schaffung eines russischen Patriarchates 1589 war die Selbstständigkeit des Moskauer Reiches nun auch kirchenpolitisch abgesichert. Seit dem 16. Jahrhundert vergrößerte das Moskauer Reich seinen Machtbe-reich weit über die Gebiete der einstigen Kiever Rus’ hinaus. Die rasche
Teil B: Systematischer Teil
140
Expansion führte jedoch auch zu einer Überdehnung der menschlichen und materiellen Ressourcen. Allein die militärische Sicherung des riesigen Rau-mes, der in der Mitte des 17. Jahrhunderts bereits bis zum Pazifik reichte (> Karte 6, S. 376/77), war eine logistische und administrative Herausforde-rung sondergleichen. Die Entwicklung und Modernisierung der Verwaltung blieb unter diesen Umständen für die Zaren von nachgeordneter Bedeutung.
3.4 Vertiefender Exkurs II: Die russische Autokratie Eines der prägendsten Merkmale der politischen Geschichte des Russländi-schen Reiches ist die in der Historiografie vielfach thematisierte und oft überbetonte autokratische Form der Zarenmacht. Die vom griechischen Wort Autokrator abgeleitete, gleichbedeutende russische Lehnübersetzung samo-deržec (Selbstherrscher, als Titel seit 1589) bezeichnet die Stellung des Herrschers, der allein, aus eigener Machtvollkommenheit die Herrschaft ausübt und keiner menschlichen Instanz Rechenschaft schuldig ist. Zwar waren auch die russischen Herrscher im Prinzip auf die Bewahrung des «rechten Glaubens» verpflichtet und Widerstand gegen einen von diesem abgefallenen Zaren galt als legitim. Doch faktisch gelang es den Zaren, die Kirche in eine enge Symbiose mit und letztlich auch eine administrative Unterordnung unter den Herrscher zu bringen – stärker jedenfalls, als dies in Byzanz der Fall gewesen war, das oft als historisches Vorbild für das Ver-hältnis von Herrscher und Kirche, ja der Autokratie insgesamt angeführt wird. Neben den byzantinischen Einflüssen wurden häufig Einflüsse der Herrschaftsordnung der Goldenen Horde als Keimzelle der russländischen Autokratie angeführt. Wenn auch die kulturellen Übernahmen aus Byzanz (etwa in der Herrscherti-tulatur) offensichtlich sind, so können sie doch für sich allein die Entstehung der russischen Autokratie nicht begründen. Vielmehr spielten bei der Idee, Moskau als politischen Erben von Byzanz zu sehen, auch westeuropäische Einflüsse mit. Erst im Verlauf des 16. Jahrhunderts, lange nachdem die Ent-wicklung hin zur Autokratie eingesetzt hatte, wurde diese Vorstellung von den russischen Herrschern zu Legitimationszwecken übernommen. Die by-zantinischen Formen sind daher eher eine Folge als die Ursache der zuneh-menden Machtbündelung in der Hand des Herrschers, um so die Autokratie nachträglich zu legitimieren. Im Unterschied zu Byzanz, das bis zuletzt zu-mindest theoretisch eine Wahlmonarchie blieb, galten schon in der Kiever Rus’ nur Abkömmlinge der Rjurikiden-Dynastie als legitime Herrscher, wobei die Thronfolge nach dem Prinzip des Seniorats (> Glossar) erfolgte. Im 15. und 16. Jahrhundert setzten sich das Recht des Herrschers, seinen Nachfolger zu bestimmen, und schließlich die Primogenitur (> Glossar) durch. Auch in Bezug auf die Tatarenherrschaft lassen sich Einflüsse auf die
3. Politische Geschichte Osteuropas
141
Herrschaftsorganisation des Moskauer Reiches identifizieren, so im Zoll- oder Postwesen. Jedoch hatte die Goldene Horde niemals eine derartige Zentralisierung und Vereinheitlichung der unterworfenen Territorien ange-strebt wie dies im Moskauer Reich spätestens seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts der Fall war, wo regionale Partikularismen in der Herr-schaftsverfassung gezielt und mit Gewalt beseitigt wurden. Die Ursachen für die Entstehung der Autokratie werden in der neueren Forschung daher in erster Linie in inneren Entwicklungen der Rus’ und insbesondere des Mos-kauer Großfürstentums vom 14. bis 16. Jahrhundert gesehen. Denn wenn es trotz der engen Symbiose zwischen Herrscher und Kirche und der theologisch legitimierten Selbstherrschaft vereinzelt Opposition aus den Reihen des Klerus gab, wurde diese jeweils mit Gewalt gebrochen. Hiermit konnten die Zaren ihren Anspruch auf Alleinherrschaft auch über das ihnen religiös legitimierte Maß hinaus durchsetzen. Dennoch stellte die Legitima-tion des Zaren als Stellvertreter Christi auf Erden durch die Kirche einen wichtigen Pfeiler seiner Herrschaft dar. Widerstand gegen den Herrscher konnte so zur Gotteslästerung erklärt und verfolgt werden. Das Widerstands-recht blieb in den von der orthodoxen Kirche stark geprägten theoretischen Überlegungen zur Herrschaft auf den Abfall vom rechten Glauben beschränkt. Andere Denktraditionen, wie sie sich etwa in Ostmitteleuropa mit einem stark ausgeprägten Widerstandsrecht der Stände gegen tyrannische Herrschaft durchsetzen konnten, fanden in Russland keinen Widerhall. Ideelle Anknüp-fungspunkte für die Opposition gegen den Herrscher existierten so kaum. Dass keine organisierte Form des Widerstandes die Machtentfaltung der Moskauer Großfürsten eingeschränkt hätte, lag auch an der spezifischen Stellung der sozial höher gestellten Schicht. Die Gefolgschaft (družina) der Fürsten beruhte seit der Zeit der Kiever Rus’ auf der freiwilligen Unterstel-lung unter einen Herrn. Dieser war dazu verpflichtet, seine Gefolgsleute zu versorgen. Im Gegenzug leisteten die Gefolgsleute ihrem Herrn Dienst. Die prinzipielle Freiwilligkeit des Dienstverhältnisses, verbunden mit dem Recht des Abzugs (Kündigung des Dienstes), begründete ein enges, auf gegenseiti-gen Interessen beruhendes Verhältnis zwischen Herrscher und Bojaren (> Glossar). Eine vergrößerte Machtstellung des Herrn war damit im Interesse seiner Gefolgschaft, die so gleichfalls mit einer Erhöhung ihrer Position und der Vermehrung fürstlichen Schenkungen rechnen durfte. Die erfolgreichsten Fürsten konnten daher besonders viele Gefolgsleute verpflichten, was seit dem 14. Jahrhundert insbesondere den Moskauer Großfürsten gelang. Das Bojarentum entwickelte sich deshalb anders als der westeuropäische Adel nicht zu einer vom Herrscher getrennten, eigenen Säule der Herr-schaftsorganisation, sondern blieb eng an den Zaren gebunden. Ausschlag-gebend für die Stellung des einzelnen Bojaren war seine Nähe zum Zaren.
Teil B: Systematischer Teil
142
Der Status eines Bojaren beruhte daher nicht so sehr auf seiner Zugehörig-keit zur Gruppe der Privilegierten, sondern auf dem Rang, den er innerhalb der Hierarchie der Adligen einnahm. Seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert hatte sich das Mestničestvo (> Glossar, Rangplatz-Ordnung) auszubilden begonnen, das die Einteilung der Bojaren in Ränge regelte. Die geringe regi-onale Verankerung der Bojaren trug gleichfalls wenig dazu bei, eine korpo-rativ organisierte Interessengemeinschaft in Abgrenzung vom Herrscher ent-stehen zu lassen. Das Bojarentum (der Begriff bezog sich in einem engeren Sinne nur auf die Mitglieder ersten Ranges des großfürstlichen Rates, der Bo-jarenduma) war daher kein Stand mit kollektiven Rechten, sondern eine Grup-pe von individuell nach Rängen abgestuften Vornehmen, die sich weniger in Bezug auf ihre Gruppenzugehörigkeit als durch ihre Position gegenüber dem Herrscher definierten. Dennoch bildeten sich informelle Netzwerke als Inte-ressenvertretungen des Adels, die zumindest in beschränktem Rahmen ein Gegengewicht zur absoluten Zarenmacht darstellten. Das Recht des freien Abzugs der Gefolgsleute wurde schon im 15. Jahrhun-dert faktisch immer weiter eingeschränkt und verlor im 16. Jahrhundert prak-tisch an Bedeutung, da der Moskauer Großfürst nach der sukzessiven Erobe-rung der Teilfürstentümer der Rus’ als einziger orthodoxer Herrscher der Rus’ verblieben war. Damit ging eine erhöhte Abhängigkeit der Bojaren vom Herrscher einher. Die Abhängigkeit war jedoch keineswegs einseitig. Vielmehr war auch der Zar auf seine Dienst leistenden Bojaren angewiesen, die im Militär und der Verwaltung des Reiches aktiv waren und im Namen des Zaren die Herrschaft ausübten. Daneben begann sich im 16. Jahrhundert ein breiterer Dienstadel auszubilden, der ganz auf den Herrscher ausgerichtet war. Alternative Entwicklungen wie etwa im Fall der Stadtrepublik Novgo-rod, wo die Volksversammlungen (veče) bis zur Eroberung durch Moskau bedeutenden Einfluss hatten, wurden von den Moskauer Herrschern mit Ge-walt unterbunden. Wenn das russische Bojarentum auch durch eine starke Abhängigkeit vom Zaren geprägt war, so verfügte es doch auf lokaler Ebene über weitgehende administrative Kompetenzen und konnte auch im Rahmen von Beratergre-mien gewissen Einfluss auf den Herrscher ausüben. In Ermangelung eines effizienten Beamtenapparates, der das riesige Reich in all seinen Winkeln hätte verwalten können, war die Übertragung der Herrschaft vor Ort an Dienstleute des Zaren eine Voraussetzung, um die eroberten Territorien überhaupt beherrschen zu können. Eine wichtige Rolle spielten dabei die seit dem Ende des 15. Jahrhunderts in größerem Ausmaß ausgegebenen Dienstgüter (pomest’e), die den Dienstleu-ten ein Auskommen ermöglichen sollten. Aufgrund des Fehlens einer flä-chendeckenden obrigkeitlichen Lokalverwaltung, die die auf den Dienstgü-
3. Politische Geschichte Osteuropas
143
tern ansässige Bevölkerung zum Unterhalt der Dienstgutinhaber hätte zwin-gen können, wurde den Dienstleuten die Verfügungsgewalt auf ihren Gütern weitgehend übertragen. Obrigkeitliche Rechte wie die Gerichtsbarkeit gin-gen so in die Hände der Dienstleute über. Damit vereinten sie die Zwangs-mittel in ihrer Hand, die ihnen eine effektive Disziplinierung ihrer Bauern ermöglichte. Der Zar verzichtete damit in letzter Konsequenz (definitiv erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter Katharina II.) zugunsten des Adels auf seine obrigkeitlichen Befugnisse auf den Adelsgütern, um beson-ders den ärmeren Dienstleuten eine Existenzgrundlage zu schaffen und sich so deren Dienstfähigkeit zu sichern. In diesen Kontext gehört auch die weit-gehende Entrechtung der Bauern, die in den Stand der Leibeigenschaft (> Glossar) gedrückt und, vom Zugang zum Herrscher abgeschottet, der Willkür ihrer Herren unterworfen wurden. Letztlich wurde so zugunsten einer expansiven Machtpolitik des Reiches die innere Entwicklung der Gesellschaft gehemmt, so dass das System zur Er-starrung tendierte. Dennoch darf die Autokratie nicht verabsolutiert werden, gab es doch auch gegenläufige Tendenzen. Elemente lokaler Selbstverwal-tung spielten in Dorfgemeinschaften oder in den 1864 geschaffenen Selbst-verwaltungsorganen (zemstvo > Glossar) eine wichtige Rolle. Daran zeigt sich, wie wenig die Autokratie auch noch im späten 19. Jahrhundert in der Lage war, das Territorium herrschaftlich und administrativ zu durchdringen. Der Wirkungsgrad der autokratischen Zarenmacht, deren umfassende All-macht in vielerlei Hinsicht eher Anspruch als Realität blieb, nahm mit zu-nehmender Entfernung von den Reichszentren ab. In den Regionen verblieb daher noch genügend Spielraum für lokale Regelungen. Entgegen der Theorie von der absoluten Eigenständigkeit der Autokratie war diese nicht unbedingt den Interessen der Bojaren entgegengesetzt, vielmehr waren beide so stark ineinander verflochten, dass die Kooperation ein bei-derseitiges Bedürfnis war. Dies zeigt sich etwa darin, dass die Bojaren und die niederen Adligen nach der Zeit der Wirren (ausgelöst durch das Ausster-ben der Rjurikiden 1598) zu Beginn des 17. Jahrhunderts schließlich eine gefestigte Autokratie unter der Dynastie der Romanov (1613–1917) einer Adelsherrschaft nach polnischem Vorbild vorzogen. Neben der starken Posi-tion des Herrschers führte die russische Autokratie aber auch dazu, dass der Adel seine dominierende soziale Stellung bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts behalten konnte, da ein breiteres Bürgertum nicht entstand. Vielmehr war es der Adel selbst, der in großem Stil als Unternehmer auftrat und auch im Rahmen der entstehenden Bürokratie ein Betätigungsfeld fand. Ein weiteres stützendes Element der Autokratie war der Zarenmythos. Quer durch alle sozialen Schichten entwickelte sich parallel zur kirchlich propa-gierten Idee des Gottesgnadentums im Volksglauben die Vorstellung vom
Teil B: Systematischer Teil
144
guten und gerechten Zaren. Besonders in Krisen- und Umbruchszeiten wur-de der Herrscher im Gegensatz zu den Eigeninteressen verfolgenden Bojaren zum Hoffnungsträger, da man in ihm den Garanten für die Ausübung einer strengen, aber gerechten Herrschaft erblickte. Der bis ins frühe 20. Jahrhun-dert nachwirkende Zarenmythos war so stark, dass etwa die Anführer der großen Bauernaufstände von Razin (1670/71) und Pugačev (1773–1775) sich auf ein angebliches Mandat des Zaren beriefen oder sich sogar selbst als rechtmäßigen Zaren ausgaben. Die Vorstellung, dass der Zar eigentlich auf der Seite der Aufständischen stehen müsse und allenfalls von den Bojaren in täuschender Absicht über die wahren Zustände im Unklaren gelassen werde, verdeutlichen den hohen Stellenwert, den der Herrscher selbst angesichts der drückenden Leibeigenschaft genoss. Die lange Kontinuität der russischen Autokratie, die erst in der Krisensitua-tion des Ersten Weltkrieges mit der Februarrevolution (> Glossar) von 1917 ein abruptes Ende fand, lag neben den erwähnten Faktoren auch in der Furcht der Herrscher und weiter Teile der Aristokratie vor tief greifenden Veränderungen, welche die Alleinherrschaft hätten gefährden können, be-gründet. Zwar kam es durchaus zu Neuerungen und Ansätzen zur Einschrän-kung der Zarenmacht und der Ausbildung einer Beamtenschaft. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurden diverse Reformen umgesetzt, die jedoch schon bald wieder eingeschränkt wurden oder von Anfang an nur beschränk-te Wirkung entfalteten. Das System erstarrte zwar nicht, doch die entfaltete Dynamik war zu gering, um für alle Bevölkerungsschichten befriedigende Lösungen für die vielfältigen gesellschaftlichen Probleme zu finden. Die Autokratie war den immer komplexer werdenden Anforderungen nicht mehr gewachsen, fürchtete sich zugleich aber vor einem Machtverlust und schreckte daher vor grundlegenden Reformen zurück. Die enge Verbindung, die Aristokratie und Zar als Träger des Staates eingegangen waren, brachte es mit sich, dass nur ein radikaler Bruch mit dem System grundlegende Ver-änderungen ermöglichte.
3.5 Vertiefender Exkurs III: Adelsherrschaft in Ostmitteleuropa In Ostmitteleuropa bildete sich während des Spätmittelalters eine Form der Herrschaftsverfassung heraus, bei der dem Adel eine in anderen Regionen Europas unerreichte Machtposition gegenüber dem Königtum zukam. Vor der Herausbildung der Adelsherrschaften in Ungarn, Polen und Böhmen während des Spätmittelalters verfügten die jeweiligen Monarchen über eine starke Stellung. Die in den drei Ländern parallel, im Wesentlichen vom 12. bis zum 15. Jahrhundert, jedoch keineswegs gleichförmig verlaufende Entwicklung ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen:
3. Politische Geschichte Osteuropas
145
• Veränderung der Kriterien für die Zugehörigkeit zum Adel: Abstam-mung wird anstelle von Kriegsdienst oder Erhebung durch den König zum zentralen Merkmal des Adels: Der Adel ist damit weniger stark an den Herrscher gebunden und gewinnt ein höheres Maß an Unab-hängigkeit von diesem.
• Schwach ausgebildetes Städtewesen und Bürgertum stellten in den meisten Regionen keine Konkurrenz des Adels dar; der Klerus rekru-tierte sich weitgehend aus dem Adel, so dass in den Land- und Reichstagen praktisch nur adlige Interessen vertreten wurden.
• Zusammenschluss des Adels in rechtlich einheitlichen, korporativ organisierten Ständen ermöglichte es, dem König als geschlossene Gruppe entgegenzutreten und geeint Forderungen zu erheben, die im gemeinsamen Interesse lagen.
• Entwicklung einer transpersonalen Staatsvorstellung, wonach die Stände sich als eigentliche Inhaber der Herrschaft verstanden, die bloß vorübergehend an einen Monarchen übertragen wird.
• Theoretisch begründetes Widerstandsrecht gegen eine tyrannische Herrschaft: Das Verhältnis der Landesvertreter zum Monarchen wurde als gegenseitiges Vertragsverhältnis aufgefasst, womit eine Verletzung der Vertragsbestimmungen durch den König auch den Adel nicht mehr an eingegangene Verpflichtungen (Treue) band und ein Recht oder sogar die Pflicht zum Widerstand gegen den Herrscher bis hin zu dessen Absetzung begründete.
• Schriftliche Fixierung gewährter Rechte garantiert, dass in einer Schwächephase des Königtums errungene Vorrechte auch später aner-kannt werden und zu nur mehr schwer abänderbaren Grundsätzen der Herrschaftsverfassung werden.
• Ausnützung konjunktureller Schwächen des Königtums durch den Adel, der sich etwa anlässlich der Einberufung des Adelsaufgebotes für den Kriegsdienst Zugeständnisse wie Steuerbefreiung aushandeln konnte.
• Mehrfach eintretender Tod des Königs ohne legitimen Nachfolger, der es dem Adel ermöglichte, die Wahl eines neuen Königs von Zuge-ständnissen an die Wahlgremien (Stände) abhängig zu machen; fak-tisch entwickelte sich die Herrschaftsverfassung in die Richtung einer freien Königswahl durch den Adel (konstitutiv in Polen nach dem Aussterben der Jagiellonen-Dynastie 1572).
Der Adel als führende soziale Schicht begann sich erst im Hochmittelalter herauszubilden. Er stellte ein Sammelbecken dar, in dem unterschiedlichste Gruppen aufgingen, so Stammesfürsten mit ihrer Gefolgschaft, Krieger, von
Teil B: Systematischer Teil
146
auswärts zugewanderte Edelleute und Fachkräfte, Bedienstete des Königs oder Angehörige des Klerus. Das Zusammenwachsen dieser heterogenen Personengruppen zu einem einheitlichen, rechtlich klar definierten und auf Abstammung beruhenden Adelsstand vollzog sich vor allem im 13. Jahrhun-dert. Zentrale Merkmale der Zugehörigkeit waren Landbesitz, persönliche Freiheit, zumindest teilweise Befreiung von Steuern und Abgaben sowie Herkunft von einem adligen Geschlecht (daher die polnische Bezeichnung szlachta > Glossar für Adel, vom deutschen «Geschlecht»). Die schrittweise Akkumulierung von Privilegien und Immunitäten durch die Adligen des Landes und ihre Zusammenfassung zu Rechten, die dem Adel kollektiv zustanden, war ein lang andauernder Prozess, der im Spätmittealter zu einer ausgeprägten, explizit festgelegten Machtposition des Adels führte. Teilweise ist die bedeutende Stellung dieser Schicht zumindest für Polen und Ungarn auf die anhaltende militärische Bedrohung besonders der Ostgrenzen zurückzuführen: vor allem durch Litauer und Mongolen, im Falle Polens seit dem 16. Jahrhundert durch das Moskauer Reich, im Falle Ungarns seit Ende des 14. Jahrhunderts durch die Osmanen. Das Adelsaufgebot (in Polen noch bis ins 18. Jhd.) war der zentrale Bestandteil des Heeres, auf den die Könige nicht verzichten konnten. Die anfänglich bedeutenden Krongüter gelangten so unter anderem durch Verleihung in die Hände des Adels. Die für beide Länder charakteristische große Anzahl von oft in einfachsten Verhältnissen lebenden Kleinadligen im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit (je nach Epoche zwischen 5 und 10 % der Gesamtbevölkerung, mit regional großen Abweichungen) ging auf die Erhebung in den Adelsstand im Zusammenhang mit Kriegsdienstleistun-gen und Grenzbewachung, besonders in den exponierten Grenzregionen, zurück. In Polen wies beispielsweise das nordöstliche Grenzgebiet Maso-wien am Ende des Mittelalters einen Adelsanteil von über 20 % auf, prak-tisch durchgehend Klein- und Kleinstadlige. In Ungarn verfügten etwa die bäuerlichen Szekler (> Glossar) im Osten Siebenbürgens als Grenzwächter kollektiv über adelsähnliche Freiheiten und konstituierten sich als eigener Landstand. Auch die im Rahmen der Union von Lublin (> Glossar) 1569 zwischen Polen und Litauen zustande gekommene Ausdehnung der Adels-freiheiten auf den litauischen Kleinadel ließ sich nur deshalb gegen den Wil-len des Hochadels durchsetzen, weil die Kleinadligen die Hauptlast des to-benden Krieges gegen das Moskauer Reich trugen. Viele der so in den Adelsstand erhobenen Personen unterschieden sich je-doch in ihrer Lebensweise und materiellen Lage kaum von einfachen Bau-ern, ja wohlhabendere Bauern führten manchmal ein besseres Leben als ein armer Adliger. Viele Kleinadlige hoben sich daher ausschließlich durch ihr Adelspatent von ihrer Umgebung ab. Doch unbesehen von der sozialen Lage
3. Politische Geschichte Osteuropas
147
umfasste der Adel Kleinadlige wie Magnaten (> Glossar) gleichermaßen, die als Angehörige des Standes rechtlich gleich gestellt waren und damit berech-tigt waren, im Rahmen regionaler Landtage (in Polen seit dem 15. Jhd.) oder gar der Reichstage am politischen Prozess aktiv teilzunehmen. Die Fiktion eines formal-rechtlich einheitlichen Adelsstandes entwickelte sich, am aus-geprägtesten in Polen, zu einem identitätsstiftenden Faktor, unbesehen des deutlich ausgeprägten Machtgefälles innerhalb des Adels. Die formale Gleichstellung des niederen Adels mit den Magnaten war auch im Interesse des Königtums, da diesem andere gewichtige Verbündete gegen den Vormachtsanspruch der Magnaten fehlten. Insbesondere die Städte als potenzielle Bündnispartner des Monarchen waren aufgrund ihrer geringen Anzahl nicht in der Lage, ein wirksames politisches Gegengewicht gegen den Hochadel zu bilden. Am Übergang vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit erreichte der niedere und mittlere Adel den Höhepunkt seiner Machtstellung. Doch auch damals blieb der Hochadel entscheidend. Er konnte seine Position gegenüber den niedri-geren Adligen in der Folge wesentlich ausbauen. Im 17. Jahrhundert kon-zentrierte sich die adlige Macht in den Händen einiger weniger Magnaten-Familien. Einen Wendepunkt brachte allerdings der 1526 erfolgte Übergang der böhmischen und der ungarischen Krone an die Habsburger. Als frühab-solutistisch ausgerichtete Herrscher versuchten diese, die Rechte des Adels sukzessive einzuschränken, was jedoch nur im Falle Böhmens und seiner Nebenländer nach der Schlacht am Weißen Berg (1620) partiell gelang. Der ungarische Adel konnte seine Rechte aufgrund der osmanischen Bedrohung des Habsburger Reiches besser gegenüber dem Herrscher behaupten. Aller-dings blieb das Verhältnis zwischen dem Teil des ungarischem Adels, der nicht an den Wiener Hof bzw. in die Ämterhierarchie des Reiches eingebun-den werden konnte, bis zum österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 äußerst konfliktreich. So konnte sich die Adelsherrschaft in der Frühen Neuzeit primär in Polen, das im 16. Jahrhundert sein «goldenes Zeitalter» erlebte, relativ ungestört weiterentwickeln. Die Entfaltung adliger und vor allem magnatischer Macht, welche schon die Zeitgenossen beeindruckte, ist vor allem in Kontrast zum absolutistischen Frankreich und der russischen Autokratie zu sehen. Im Ver-gleich dazu verfügte der polnische Adel tatsächlich über weitgehende politi-sche Rechte, konnte sich doch eine gefestigte königliche Zentralgewalt in Polen nicht in demselben Ausmaß herausbilden. Dennoch blieb das König-tum eine zentrale Einrichtung mit durchaus eigenständigen Handlungsspiel-räumen, etwa bei der Besetzung hoher Ämter. Der König blieb auch die Ein-zelperson mit der größten Machtfülle und den bedeutendsten Ressourcen sowie bestimmten Vorrechten. Die königliche Macht war zwar deutlich be-
Teil B: Systematischer Teil
148
schnitten, aber ihre Inhaber keineswegs einfach ein Spielball der Adelsinte-ressen. So waren es vor allem die Interregna, während denen sich die Adels-herrschaft für eine Zeit lang voll entfalten und mit der Wahl eines neuen Monarchen eines der wichtigsten Rechte ausüben konnte. Allerdings stellten längere Interregna auch die Gefahr der Destabilisierung des Landes dar, ein Problem, dessen sich auch der Adel immer mehr bewusst wurde. Dazu kam, dass selbst die Magnaten, die im 17. Jahrhundert die politische Entscheidungsfindung dominierten, keine geschlossene Gruppe darstellten, sondern die Zugehörigkeit durch Aufstieg und Fall von Familien gekenn-zeichnet war. Die Interessen und politischen Standpunkte variierten selbst innerhalb des hohen Adels derart, dass von einer geschlossenen Front gegen den König keine Rede sein konnte, vielmehr war Fraktionsbildung chronisch und typisch. Im 17. Jahrhundert wurden Entscheidungsfindungen aufgrund divergierender Interessen und des Prinzips der einstimmigen Beschlussfas-sung daher zunehmend schwieriger. Die These, eine bereits im 17. Jahrhun-dert einsetzende Anarchie sei Ursache für den Untergang Polens in den drei Teilungen von 1772, 1793 und 1795 lässt sich so jedoch nicht halten. Viel-mehr erwiesen sich die zentralistisch verwalteten Teilungsmächte Russland, Preußen und das Habsburger Reich im militärischen und administrativen Bereich als effizienter. Die umständlichen politischen Entscheidungsfindun-gen und die Furcht weiter Teile des Adels vor einem zu starken Königtum etwa durch die Aufstellung eines stehenden Heeres schwächten gerade die außenpolitische und militärische Position des Landes erheblich. Die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eingeleiteten Reformen der polnischen Adelsrepublik (1791 erste Verfassung Europas) vermochten die diesbezügli-chen Schwächen angesichts der Bedrohung durch gleich drei benachbarte Großmächte nicht mehr aufzuheben.
3.6 Vertiefender Exkurs IV: Die Osmanische Herrschaftsordnung In seiner Struktur und den Herrschaftsinstitutionen unterschied sich das Os-manische Reich wesentlich von den europäischen Reichen. Der augenfälligs-te Unterschied liegt in der islamischen Religionszugehörigkeit der Reichseli-ten. Das Reich mit seiner teils reiternomadischen Herkunft war stark vom persischen und arabisch-gemeinislamischen Kulturkreis beeinflusst, wies aber auch zahlreiche reiternomadische und byzantinische Beziehungsfelder auf. Die beiden Kernregionen des Reiches, Anatolien und der Balkan, blick-ten auf eine sehr lange byzantinische Reichszugehörigkeit zurück. Die Sul-tane (> Glossar) betrachteten sich denn auch als Nachfolger der byzantini-schen Kaiser. Zentrale Ämter des Reiches wurden häufig mit islamisierten Personen christlicher Herkunft von der Balkanhalbinsel besetzt, gewohnheits-
3. Politische Geschichte Osteuropas
149
rechtliche Regelungen der unterworfenen Gebiete explizit anerkannt. Auch in religiöser Hinsicht strebte das Osmanische Reich nur bedingt eine Vereinheit-lichung an. Insofern vereinigte die osmanische Herrschaft unterschiedlichste Traditionen in einem strukturell und kulturell sehr heterogenen Reich. Nichtislamische Konfessionen, für Südosteuropa insbesondere die Orthodo-xie, waren unter gewissen Einschränkungen toleriert. Entgegen einer früher verbreiteten Ansicht kann jedoch von einem eigentlichen System der Selbst-verwaltung konfessioneller Gruppen (Millet-System > Glossar Millet) allen-falls im 19. Jahrhundert geredet werden. Vielmehr schwankte die faktische Stellung der Nichtmuslime je nach zeitlichem und örtlichem Kontext erheb-lich. Nicht allein Glaubensgemeinschaften verfügten über Selbstverwal-tungselemente, sondern etwa auch berufsständische Gruppen mit gemischt-konfessioneller Mitgliedschaft. Erst im Zuge der Reformen des 19. Jahrhun-derts wurden die Millets zu eigentlichen administrativen Einheiten der jewei-ligen Glaubensgemeinschaften. Gemäß dem islamischen Recht (Scharia) vertrat der Sultan den Anspruch auf die Herrschaft über die gesamte islamische Welt (dâr al-Islam, wörtlich «Haus des Islam»). Die nichtislamischen Gebiete (dâr al-harb, wörtlich «Haus des Krieges») galt es mithilfe des djihâd (wörtlich «Bemühung», «Anstrengung», auch: «Heiliger Krieg») für den Islam zu gewinnen. Daneben existierte eine Zwischenform (dâr al-’ahd, wörtlich «Haus des Pak-tes»), worunter Gebiete fielen, welche die Oberhoheit des Sultans anerkann-ten, aber ihr nichtislamisches Gesellschaftssystem beibehielten (in Südosteu-ropa vor allem die Fürstentümer Walachei und Moldau, die Stadtrepublik Ragusa sowie im 16. und 17. Jhd. das Fürstentum Siebenbürgen). Das Krimkhanat nahm aufgrund seiner islamischen Führungsschicht unter den von der Hohen Pforte (> Glossar) abhängigen Gebieten einen hervorgehobe-nen Platz ein. Die osmanische Auffassung der Beziehungen zu benachbarten Mächten bestand lange Zeit im Wesentlichen darin, dass mit Ländern des dâr al-harb keine dauerhafte Koexistenz bestehen konnte. Zumindest in der The-orie blieb das Ziel immer die Gewinnung dieser Gebiete für den Islam. Da-her schlossen die Sultane sehr lange keine Friedens-, sondern immer nur zeitlich befristete Waffenstillstandsverträge ab. Die wichtigste Klammer für den Zusammenhalt des Reiches bildeten die Sultane, die seit der Entstehung des Reiches um 1300 bis zu seiner Auflö-sung der Dynastie der Osmanen entstammten. Sie verfügten über umfassen-de Vollmachten, die in der Praxis aber durch die Beratung mit hohen Würde-trägern gemildert wurden. Die Thronfolge war anfänglich nicht genau gere-gelt. Gewohnheitsrechtlich wurde derjenige Nachkomme des verstorbenen Sultans als Nachfolger anerkannt, dem es gelang, die Herrschaft an sich zu reißen. Dies ging häufig mit Brudermord einher, stellte aber auch sicher,
Teil B: Systematischer Teil
150
dass nur militärisch durchsetzungsfähige Personen, die im Heer und dem Beamtenapparat auf Unterstützung zählen konnten, an die Herrschaft gelang-ten. Erst im 17. Jahrhundert, nachdem das Reich den Zenit seiner Macht erreicht hatte, setzte sich eine geregelte Thronfolge durch. Die eigentliche Herrschaft ging jedoch faktisch immer mehr an informelle Machtgruppen aus dem hohen Beamtenapparat und aus dem Umfeld des Palastes über, die im Namen des Sultans die Herrschaft übernahmen. Der Stellung des Sultans wandelte sich dabei in Richtung einer von den aktuellen Tagesgeschäften abgehobenen Symbolfigur. Vertreter der Dynastie wurden teils sogar in den Mauern des Palastes gefangen gehalten, um sie bei Bedarf als Nachfolger eines gestürzten Herrschers einsetzen zu können. In diesem Zusammenhang begannen seit dem 16. Jahrhundert auch Frauen eine nicht unbedeutende Rolle bei den dynastischen Kämpfen zu spielen. Insbesondere das Harem im Palast und die Sultansmütter versuchten hier in wechselnden Koalitionen, ihre Interessen durchzusetzen. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gelang es den Großwesiren (> Glossar) vorübergehend, ihre Machtstellung gegen die Interessengruppen am Hof zu festigen. Das Herrschaftssystem des Osmanischen Reiches erschien auswärtigen Be-obachtern wegen der rivalisierenden Machtgruppen und Patronageverhält-nisse daher oft als undurchsichtig, chaotisch und korrupt. Lange Zeit galt in der Forschung daher die Meinung, nach einer klassischen Epoche im 15. und 16. Jahrhundert habe sich das Reich seit dem späten 16. Jahrhundert in ei-nem Zustand des Niederganges befunden. Bloß die Uneinigkeit der europäi-schen Großmächte über die Aufteilung des Reiches habe dessen Untergang schließlich bis ins frühe 20. Jahrhundert verzögert. Neuere Arbeiten argu-mentieren differenzierter und betonen, dass es nach dem Ende des territoria-len Wachstums zu einem grundlegenden Wandel der bisher ganz auf die Expansion hin ausgerichteten osmanischen Institutionen gekommen sei. Ende des 18. und im frühen 19. Jahrhundert erlitt die Osmanische Zentral-macht eine bedeutende Schwächung. In zahlreichen Provinzen begannen selbstherrliche Würdenträger, quasi-unabhängige Herrschaften zu errichten – einer der bekanntesten dürfte sicherlich Ali Paşa von Janina (Ioannina) sein, der seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert bis 1822 Teile des heutigen Süd-albaniens, Nordgriechenlands und Makedoniens beherrschte. In das frühe 19. Jahrhundert fällt auch der Beginn der Nationalbewegungen der Balkan-völker. Infolge verschiedener Aufstände gegen die osmanische Herrschaft begann ein Prozess, der schließlich zur Bildung von Nationalstaaten auf dem europäischen Gebiet des Osmanischen Reiches führte. Die nun aufkommen-de, das ganze 19. Jahrhundert über aktuell bleibende «Orientalische Frage» drehte sich darum, wie die europäischen Großmächte mit dem machtpoliti-schen Niedergang des Osmanischen Reiches umgehen sollten. Es galt, ange-sichts des zunehmenden Einfluss einzelner europäischer Mächte auf einst
3. Politische Geschichte Osteuropas
151
osmanische Gebiete das gegenseitige Gleichgewicht der Kräfte aufrecht zu erhalten. Argwöhnisch wurde etwa das Vordringen Russlands betrachtet, das im Rahmen des Panslawismus (> Glossar) in den neu entstandenen, autono-men Gebieten Montenegro, Serbien und Bulgarien Verbündete fand. In die-sem Kontext ist die Zurückweisung bulgarischer Ansprüche auf Makedonien und einen Zugang zur Ägäis auf dem Berliner Kongress 1878 genauso wie die Schaffung eines unabhängigen Albanien gegen eine serbische Vorherr-schaft auf dem westlichen Balkan zu sehen. Endgültig zerbrach des Osmanische Reich aber als Folge der 1908 erfolgten Revolution der Jungtürken (> Glossar), der Balkankriege von 1912/13 und schließlich des Ersten Weltkrieges. Die gesamtosmanisch-islamische Reichs-identität wurde nun definitiv zugunsten eines türkisch-laizistischen Nationa-lismus aufgegeben. Nach der osmanischen Niederlage in den Balkankriegen verblieb dem neuen türkischen «Nationalstaat» nur noch ein kleiner Restbe-standteil seiner Besitzungen in Europa. Die Entstehung neuer Staaten und die stark umstrittene Frage der Grenzziehung gingen mit massenhaften Ver-treibungen (im Falle der Armenier gar Völkermord) und erzwungenen Be-völkerungsverschiebungen einher – ein Vorgehen, das in Südosteuropas seit 1878 bis zu den Kriegen der 1990er-Jahre zu wiederholten Malen angewandt wurde, um ethnisch möglichst homogene Staaten zu schaffen.
3.7 Vertiefender Exkurs V: Sozialismus Die Bol’ševiki (> Glossar), die in Russland durch die Oktoberrevolution (> Glossar) von 1917 an die Macht gelangten waren, schufen auf den Trüm-mern des zarischen Russland und unter rücksichtslosem Einsatz von Gewalt den ersten sozialistischen Staat der Welt: die Sowjetunion (UdSSR). Ideolo-gisches Ziel der Bol’ševiki, das in den Jahrzehnten der Existenz der UdSSR gegenüber pragmatischen Erfordernissen der Tages- und der Machtpolitik faktisch immer mehr in den Hintergrund trat, war die Schaffung des Kom-munismus (> Glossar). Dieser stellte das utopische Fernziel der Bol’seviki dar, eine klassenlose Gesellschaft, die ohne Staat funktionieren sollte. Der Sozialismus (> Glossar) wurde als Übergangsphase des verstärkten Klassen-kampfes und des Aufbaus einer neuen Gesellschaftsordnung betrachtet. Der Sozialismus sollte so die Grundlagen legen, auf denen der Staat später ab-sterben und damit der Kommunismus realisiert werden könnte. Daher ist es korrekt, die Sowjetunion und später die anderen von kommunistischen Par-teien regierten Staaten als «sozialistisch» zu bezeichnen. Den Kommunismus erreichte auch in der Selbstwahrnehmung der Regimes keines dieser Länder. Die bolschewistische Ideologie ging auf sozialistische Ideen zurück, die im Laufe des 19. Jahrhunderts in Westeuropa entstanden waren (besonders die Klassiker Marx und Engels), aber auch in Russland rezipiert wurden. Die
Teil B: Systematischer Teil
152
Bol’ševiki konnten mit ihren ideologisch begründeten radikalen Forderungen nach einer grundlegenden Umwälzung der gesamten Gesellschaft bei den weitgehend analphabetischen Bauern und der noch stark an die bäuerliche Lebensweise gebundenen Arbeiterschicht keine Massenbasis mobilisieren. Sie verstanden sich denn auch als Avantgardepartei, die im Namen der Arbei-ter und Bauern agierte. Dass sie die Macht erringen konnten, war Folge des Ersten Weltkrieges, der die Schwäche der Zarenherrschaft und deren Unterle-genheit auf militärischem Gebiet deutlich machte. Die hohen menschlichen Verluste insbesondere unter den Bauern, die die Hauptlast des Krieges trugen, führten zu einer weit verbreiteten Kriegsmüdigkeit, die sich die von Lenin geführten Bol’ševiki geschickt zu nutze machten. Ihr Versprechen einer ge-rechten Landumverteilung weckte bei den Bauern Erwartungen und trug zum Erfolg der Bol’ševiki bei. Die nach der Februarrevolution 1917 an die Macht gekommene provisorische, «bürgerliche» Regierung legte wenig Geschick an den Tag und missachtete die dringendsten Wünsche der kriegsgeplagten Be-völkerung, die einen Ausstieg aus dem Krieg herbeisehnte. Darauf konnten die Anhänger Lenins bauen. Ihre Entschlossenheit, Widerstand auch in den eige-nen Reihen mit brutaler Gewalt zu unterdrücken, führte in den von den hetero-genen gegnerischen Gruppierungen nicht minder blutig geführten Bürgerkrieg (1918–1921), aus dem die Bol’ševiki siegreich hervorgingen. Die 1922 errichtete Sowjetunion war zwar formal föderal aufgebaut, in der Praxis jedoch ein stark zentralisierter Staat unter der Führung der Kommu-nistischen Partei. Die strikte Trennung zwischen Staat und Partei wurde the-oretisch aufrechterhalten, de facto jedoch überlappten sich die beiden Struk-turen. Dabei kam die Führungsrolle der Partei zu, während der Staat eher administrative Funktionen wahrnahm. Die Partei war strikt hierarchisch auf-gebaut, was im Prinzip des «demokratischen Zentralismus» (> Glossar) Ausdruck fand. Offene Debatten waren zunächst auf den engsten Führungs-zirkel begrenzt, Entscheidungen sollten jedoch kollektiv getroffen werden, um die Einheit der Partei nach Außen zu wahren. Wenn es in der frühsowje-tischen Phase durchaus so etwas wie eine funktionierende «kollektive Füh-rung» innerhalb des engsten Führungszirkels gegeben hatte, wurde diese nach Lenins Tod (1924) im Verlauf der 1920er-Jahre ausgehöhlt. Stalin, der nach Ausschaltung der wichtigsten Gegner gegen Ende des Jahrzehnts seine Führungsrolle in der Partei definitiv konsolidiert hatte, gelang es, eine per-sönliche Diktatur zu errichten. Dem die 1930er-Jahre kennzeichnenden mas-senhaften Terror gegen echte oder vermeintliche Gegner des Sozialismus bzw. Stalins fielen selbst hochrangige Parteivertreter zum Opfer. Bevorzugte Opfer des Terrors, der sich primär in Form von Todesurteilen, Deportationen oder Einweisung in Arbeitslager (GULAG > Glossar) äußerte, waren neben altgedienten Parteiveteranen, die als potenzielle Widersacher Stalins galten, ganze Gruppen, die kollektiv in den Verdacht regimefeindlicher Aktivitäten
3. Politische Geschichte Osteuropas
153
gerieten. Dies betraf etwa pauschal als Kulaken (> Glossar) bezeichnete wohlhabende Bauern, wobei sich die Begriffsverwendung zunehmend auch auf weniger begüterte ländliche Bewohner und schließlich auf Regimegegner generell bezog. Der Terror wurde teilweise durch die Festlegung von Quoten in Gang gehalten, so dass die Opfer von untergeordneten Stellen ohne erkenn-bares Konzept wahllos aus der Bevölkerung herausgegriffen wurden. Die Gründe für die Entstehung und das Ausmaß des Terrors sind in der For-schung oft kontrovers diskutiert worden. Dank Archivfunden der 1990er-Jahre kann inzwischen als sicher gelten, dass Stalin höchstpersönlich den Terror nicht nur guthieß, sondern als dessen hauptsächlicher Organisator betrachtet werden kann. Dies steht im Gegensatz zu zeitgenössischen Ge-rüchten, der Terror gehe vom Umfeld Stalins und selbstherrlichen Partei-funktionären aus, die Stalin über die wahren Vorgänge im Lande bewusst in Unkenntnis ließen. Davon unabhängig ist jedoch in Betracht zu ziehen, dass der Terror nicht die massenhafte Dynamik hätte entwickeln können ohne die mannigfaltigen Formen von Unterstützung, Kollaboration und Eigeninitiative von unten. Dabei spielten unterschiedlichste Motivationen eine Rolle, warum Angehörige aller sozialen Schichten durch Denunziation, als Vollstrecker von Befehlen oder in vorauseilendem Gehorsam ihren Teil zum Terror beitrugen. Anpassung aus Angst, unkritische Autoritätsgläubigkeit, Denunziation von persönlichen Feinden oder zwecks Erringung materieller Vorteile, ideologi-sche Überzeugung, Neid auf höhergestellte Personen oder das Ausleben von Aggressionen trugen alle ihren Anteil zum Terror bei, genauso wie die Initia-tive von oben. Der Parteiführung und damit insbesondere Stalin sollte es je-doch vorbehalten sein, Opfergruppen zu benennen, den Terror zu koordinieren und ihm staatliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Nach Stalins Tod 1953 hörte der massenhafte Terror auf. Die 1956 mit einer Geheimrede des neuen Generalsekretärs der Kommunistischen Partei, Chruščev, eingeleitete Entstalinisierung brach mit der allgegenwärtigen Ge-walt, die den Stalinismus ausgezeichnet hatte. Repressionsmaßnahmen kennzeichneten zwar auch in der Folge das sowjetische Herrschaftssystem, jedoch wurden Gewalt und Zwang nun viel selektiver und zielgerichteter gegen Personen ausgeübt, die sich aktiv gegen das Regime stellten. Wer sich hingegen anpasste, hatte in der Regel wenig zu befürchten. Die vermehrte Berücksichtigung von Konsumwünschen der Bevölkerung ab den 1960er-Jahren trug ihrerseits dazu bei, das System zu stabilisieren. Insofern funktio-nierte ein informeller Gesellschaftspakt, der politisches Wohlverhalten ge-gen einen zwar bescheidenen, aber gesicherten und gegenüber früheren Pha-sen doch wesentlich gesteigerten Wohlstand garantierte. Außenpolitisch war die Sowjetunion im Rahmen des Kalten Krieges (> Glossar) darauf bedacht, den Status quo und insbesondere die Kontrolle
Teil B: Systematischer Teil
154
über die nach dem Zweiten Weltkrieg sozialistisch gewordenen Staaten Ost-europas (mit Ausnahme Jugoslawiens und ab den 1960er-Jahren Albaniens) beizubehalten. Entgegen vielfacher Befürchtungen im Westen bestand keine ernsthafte Absicht, einen Angriffskrieg in Europa zu führen, um den eigenen Einflussbereich über Staaten des Warschauer Paktes (> Glossar) hinaus aus-zudehnen. Vielmehr war die sowjetische Führung darauf bedacht, keine mili-tärische Eskalation mit dem Westen zu riskieren und sich stattdessen auf indirekte, regional beschränkte Stellvertreterkriege in den Staaten Asiens, Lateinamerikas und Afrikas zu beschränken. Dem Warschauer Pakt fehlte die innere Geschlossenheit, die während der Jahre seiner Existenz (1955–1991) von außen wahrgenommen wurde. Vielmehr handelte es sich um ein als Reaktion auf die westliche Militärallianz NATO gegründetes Bündnis, dessen Zielsetzung sich im Laufe der Jahre vom politischen in den militäri-schen Bereich verschob. Als sowjetisches Disziplinierungsinstrument ge-genüber den Mitgliedsstaaten taugte der Pakt jedoch wenig – der Beteiligung von Paktmitgliedern an der sowjetischen Invasion in der Tschechoslowakei 1968 etwa kam eher symbolischer Charakter zu. Die unterschiedlichen Inte-ressen der verbündeten Länder verhinderten auch gegen außen die Entste-hung eines schlagkräftigen Bündnisses. Vielmehr blieb der Nutzen des Pak-tes für die Sowjetunion im Kriegsfall stets zweifelhaft. Nach dem ersten Jahrzehnt seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges begann sich die direkte sowjetische Kontrolle der sozialistischen Regimes in Osteu-ropa zu lockern. Gewaltsam unterdrückt wurden allenfalls Versuche von Staaten, sich dem sowjetischen Einfluss zu entziehen, was 1956 in Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei (sogenannter Prager Frühling) mit einer militärischen Intervention verhindert wurde. Im Falle Polens, das 1980/81 von massenhaften Protesten der Gewerkschaft Solidarność gegen die Dikta-tur der kommunistischen Partei erschüttert wurde, drängte die sowjetische Führung die polnische kommunistische Partei jedoch, das Problem selbst zu lösen. Diese verhängte 1981 das Kriegsrecht über das Land und unterdrückte damit die Protestwelle. Die sowjetische Hegemonie über die Staaten des Warschauer Paktes wäh-rend des Kalten Krieges ließ jedoch den einzelnen Ländern durchaus in be-schränktem Rahmen Handlungsspielraum. Das Bild eines monolithischen «Ostblocks» bedarf in manchen Einzelheiten der Korrektur. Vor allem seit die Entstalinisierung in der Sowjetunion einsetzte (1956), wurde den «Satel-litenstaaten» allmählich mehr Handlungsspielraum gegeben. Die Aufrecht-erhaltung des sozialistischen Gesellschaftsmodells nach sowjetischem Vor-bild und eine pro-sowjetische Außenpolitik blieben jedoch Mindestanforde-rungen an die jeweiligen Regimes. Die oft als Brežnev-Doktrin (> Glossar) bezeichnete sowjetische Haltung gestand den Staaten des Warschauer Paktes nationale Sonderentwicklungen zu, solange diese Bedingungen eingehalten
3. Politische Geschichte Osteuropas
155
wurden und behielt sich andernfalls das Recht vor, militärisch zu intervenie-ren. So entwickelten sich die sozialistischen Länder ab den 1960er-Jahren teils in unterschiedlicher Richtung. Als eine Art informeller Gesellschaftspakt prak-tizierten die ungarischen Kommunisten eine oft als «Gulaschkommunismus» bezeichnete Politik. Dabei forderte die Partei als Gegenleistung für die Ge-währung beschränkter wirtschaftlicher Freiheiten und die Befriedigung von Konsumwünschen den Verzicht auf politische Betätigung außerhalb der vom Regime gezogenen Grenzen. Im Gegensatz dazu verfolgte Rumänien ein anderes Modell zur Sicherung der Einparteienherrschaft. Hier versuchte die politische Führung, den Verzicht auf politische Freiheiten und die zuneh-mend katastrophalere Versorgungslage mit der Befriedigung nationalisti-scher und sogar antisowjetischer Impulse auszugleichen. Trotz all dieser Sonderentwicklungen stellte jedoch die Unterstützung durch die Sowjetuni-on den zentralen Rückhalt der sozialistischen Regimes des Warschauer Pak-tes dar. Als diese Ende der 1980er-Jahre entzogen wurde, kam die kommu-nistische Herrschaft überall rasch zu einem Ende. Das sozialistische Gesellschaftssystem in der Sowjetunion und den Staaten unter sowjetischem Einfluss war von einem Nebeneinander formaler Garan-tien von Bürgerrechten wie etwa der Meinungs- oder Religionsfreiheit und der faktisch systematischen Verletzung oder weitgehenden Einschränkung ebendieser Rechte gekennzeichnet. Ebenso charakteristisch waren die aktive Miteinbeziehung der Bevölkerung in Legitimierungsrituale des Regimes und die rigide Überwachung des gesellschaftlichen Lebens. Eine wichtige Rolle spielten neben den Institutionen der Partei und des Staates informelle Netz-werke und Patronagebeziehungen. Diese erleichterten etwa den Zugang zu Ressourcen des täglichen Bedarfs, die aufgrund von Mangelwirtschaft häufig nur schwer erhältlich waren. Nicht zuletzt war auch Korruption verbreitet, da die Institutionen oft nicht auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet waren oder mangelhaft funktionierten. Dienstleistungen wie etwa medizinische Versorgung oder Zuteilung von Wohnraum, die auf dem formellen Weg nur umständlich, in mangelhafter Qualität oder erst nach langem Warten bereitgestellt wurden, konnten so auf informellem Weg unter Umgehung existierender Beschränkungen mit Geld, häufiger mit Waren oder Gegenleistungen erkauft werden. Unter Ausnutzung dieser Gegebenheiten öffneten sich für die einzelnen Menschen in beschränktem Ausmaß durchaus kleinere Handlungsspielräume. Dem kam zugute, dass die Organe des Re-gimes keinen völlig geschlossenen, einheitlichen Apparat darstellten, son-dern dass sie sich nicht selten durch widersprechende Interessen, mangelnde Koordination und Überbürokratisierung gegenseitig lähmten.
Teil B: Systematischer Teil
156
Die weitgehend fehlende Transparenz und die nur sehr eingeschränkt mögli-che öffentliche Debatte über Unzulänglichkeiten erschwerten es auch den Führungsgremien der Partei, den Überblick über die Entwicklung zu behal-ten. Der strikt hierarchische Aufbau der Gesellschaft stellte sich immer mehr als Problem heraus, da die Führungsgremien nicht in der Lage waren, alle anstehenden Aufgaben in nützlicher Frist zu behandeln und da Initiativen von unten als unerwünscht galten. Daher zeichneten sich die sozialistischen Regimes nach Anfangserfolgen etwa in Bezug auf den Lebensstandard oder die Alphabetisierung spätestens seit den ausgehenden 1970er-Jahren durch zunehmende Erstarrung aus. Der qualitative Rückstand im militärtechnologi-schen Bereich gegenüber den westlichen Staaten ging nicht nur mit der relati-ven Vernachlässigung der Konsumgüterindustrie einher, sondern führte auch zu einer forcierten quantitativen Aufrüstung. Die auch durch Wirtschaftshilfe erkaufte Aufrechterhaltung der hegemonialen Stellung unter anderem im östli-chen Europa überdehnte letztlich die Ressourcen der UdSSR. Daraus erwuchs die Einsicht, dass grundlegende Reformen unumgänglich waren. Unter den Schlagworten Perestrojka (> Glossar) und Glasnost’ (> Glossar) setzte Mitte der 1980er-Jahre ein anfangs noch sehr begrenzter Wandel ein, der jedoch bald eine unkontrollierbare Eigendynamik annahm. Rufe nach einer stärke-ren Demokratisierung und nationalistische Forderungen nach Eigenständig-keit innerhalb der sowjetischen Einflusszone und in der Sowjetunion führten in den Jahren 1989 bis 1991 zum schnellen und weitgehend friedlichen Ende der sozialistischen Diktatur. Dazu trugen wesentlich regionale Eliten des Parteiapparates bei, die unter den neuen Umständen die Chance sahen, durch größere Unabhängigkeit vom Zentrum mehr Entscheidungsgewalt und Ver-fügungsmacht über Ressourcen zu gewinnen. Insbesondere auf personeller Ebene zeichnen sich die postsozialistischen Gesellschaften daher durch ein bedeutendes Maß an Kontinuität zur sozialistischen Zeit aus.
3.8 Forschungskontroversen • Einer der umstrittensten Themenbereiche der politischen Geschichte
Osteuropas dreht sich um die Frage, inwiefern sich Konstanten in der politischen Kultur über größere Zeiträume hinweg feststellen lassen. Für Russland etwa steht die Frage im Zentrum, ob das Sowjetregime in der Tradition der russischen Autokratie stand. Insbesondere Thesen wie diejenige von Hans-Joachim Torke, der die russländische Herr-schaftsverfassung seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts als «staatsbedingte Gesellschaft» bezeichnet hat oder die Charakterisie-rung der «Gesellschaft als staatliche Veranstaltung» durch Dietrich Geyer in Hinblick auf den Behördenstaat des 18. Jahrhunderts, impli-zieren eine autoritäre Haltung als Grundkonstante der russischen Ge-
3. Politische Geschichte Osteuropas
157
schichte seit dem 16. Jahrhundert. Vor allem neuere Arbeiten, die das sowjetische Herrschaftssystem aus einer alltagsgeschichtlichen Per-spektive her in den Blick nehmen, stehen diesem Ansatz kritisch ge-genüber. Sie sehen die spezifischen Ausprägungen des jeweiligen po-litischen Systems eher im zeitgebundenen, situativen Kontext begrün-det. Ähnlich stellt sich auch die Frage, ob die Konkurrenz verschiede-ner Machtzentren in Ostmitteleuropa (Königtum, Adel) langfristig ei-nen Einfluss auf die politische Kultur der entsprechenden Länder hat-te, ob also beispielsweise die massenhaft antikommunistische Grund-haltung in Polen als Erbe der frühneuzeitlichen Adelsrepublik aufge-fasst werden kann.
• Lange Zeit lag der Fokus der politischen Geschichtsschreibung prak-tisch ausschließlich auf der Ebene der Institutionen und führender Per-sönlichkeiten. Dieser Sichtweise «von oben» wird heute vermehrt eine Sichtweise «von unten» entgegengestellt, die davon ausgeht, dass auch die einfache Bevölkerung nicht einfach der Herrschaft passiv ausgeliefertes Objekt ist, sondern die Herrschaftsbeziehungen aktiv mitgestaltet. Insbesondere im Bereich der Zeitgeschichte sind diesbe-zügliche Forschungen durchgeführt worden. Sie zeigen etwa in Bezug auf die Kollaboration mit den rechtsgerichteten Regimes der Staaten Ostmittel- und Südosteuropas in der Zwischenkriegszeit bzw. mit der nationalsozialistischen Besatzungsmacht, dass die Vorgaben von oben immer auch durch Eigeninitiative von unten ergänzt wurden. Erst die Rückkopplung der verschiedenen Hierarchiestufen ermöglichte eine effiziente Herrschaftsausübung und die Durchführung etwa des Holo-causts (> Glossar), dem in Osteuropa insbesondere Juden und Roma zum Opfer fielen. Ähnlich ist für den Sozialismus die Bedeutung un-terschiedlicher Formen von Unterstützung für das Regime durch weite Teile der Bevölkerung als tragende Säule des politischen Systems identifiziert worden. Nach wie vor umstritten bleibt jedoch die Ge-wichtung der unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die konkrete Ausprägung des politischen Systems.
• Lange Zeit hat sich die Historiografie darauf konzentriert, die Groß-reiche, welche weite Teile Osteuropas beherrschten, von den Reichs-zentren aus zu betrachten. Aufgrund der Herrschaftsstruktur der Zent-ralmacht, des jeweiligen Herrschaftsapparates und der Bürokratie wurden Schlüsse auch für periphere, eroberte Gebiete gezogen. Stark von der post-kolonialen Wissenschaftstradition beeinflusst ist in den letzten Jahren eine Geschichtsschreibung entstanden, die sich den ein-zelnen Regionen und ihren Bewohnern zuwendet und das Herrschafts-system von der Peripherie aus verstehen will. Die Sichtweise der Herrschaftsunterworfenen wird in die Erforschung asymmetrischer
Teil B: Systematischer Teil
158
Herrschaftsbeziehungen mit einbezogen. Im Vordergrund steht dabei weniger die Machthierarchie zwischen Zentrum und Peripherie, son-dern die aus der kulturellen Begegnung der Reichseliten und der loka-len Bevölkerungsgruppen entstehenden Machtstrukturen. In dieser Hinsicht zeigt sich etwa, dass es nicht nur das Reichszentrum war, das den Peripherien eine hegemoniale (politische) Kultur auferlegte, son-dern vielmehr auch die Peripherien wesentlich auf die politische Kul-tur des Zentrums rückwirkten.
Literatur zum Abschnitt B.3: Politische Geschichte Allgemein
Bak, János M.: Nobilities in Central and Eastern Europe. Kinship, Property and Privilege, Budapest 1994.
Banac, Ivo: The Nobility in Russia and Eastern Europe, New Haven 1983.
Bartlett, Robert: Die Geburt Europas aus dem Geist der Gewalt. Eroberung, Kolonisierung und kultureller Wandel von 950 bis 1350, München 1996.
Dieckmann, Christoph; Quinkert, Babette; Tönsmeyer, Tatjana (Hrsg.): Kooperation und Verbrechen. Formen der «Kollaboration» im östlichen Europa, 1939–1945, Göttingen 2003.
Ismayr, Wolfgang (Hrsg.): Die politischen Systeme Osteuropas, Opladen 2002.
Mastny, Vojtech; Byrne, Malcolm (Hrsg.): A Cardboard Castle? An Inside History of the Warsaw Pact, 1955–1991, New York 2005.
Satjukow, Silke; Gries, Rainer: (Hrsg.): Unsere Feinde. Konstruktionen des Anderen im Sozi-alismus, Leipzig 2004.
Subtelny, Orest: Domination of Eastern Europe. Native Nobilities and Foreign Absolutism, 1500–1715, Montreal u.a. 1986.
Zernack, Klaus: Polen und Russland: zwei Wege in der europäischen Geschichte, Berlin 1994.
Russland/Sowjetunion
Burbank, Jane; von Hagen, Mark; Remnev, Anatolyi (Hrsg.): Russian Empire. Space, people, power, 1700–1930, Bloomington u.a. 2007.
Geyer, Dietrich: «Gesellschaft» als staatliche Veranstaltung. Sozialgeschichtliche Aspekte des russischen Behördenstaats im 18. Jahrhundert, in: Ders. (Hrsg.): Wirtschaft und Gesellschaft im vorrevolutionären Russland, Köln 1975, S. 20–52.
Kappeler, Andreas (Hrsg.): Die Geschichte Russlands im 16. und 17. Jahrhundert aus der Perspektive seiner Regionen, Wiesbaden 2004.
3. Politische Geschichte Osteuropas
159
Klug, Ekkehard: Wie entstand und was war die Moskauer Autokratie? In: Hübner, Eckhard; Klug, Ekkehard; Kusber, Jan: Zwischen Christianisierung und Europäisierung. Beiträge zur Geschichte Osteuropas in Mittelalter und früher Neuzeit, Stuttgart 1998, S. 91–113.
LeDonne, John P.: Absolutism and Ruling Class. The Formation of the Russian Political Order, 1700–1825, New York 1991.
Lincoln, William Bruce: The Great Reforms: Autocracy, Bureaucracy, and the Politics of Change in Imperial Russia, DeKalb 1990.
Neubauer, Helmut: Car und Selbstherrscher. Beiträge zur Geschichte der Autokratie in Russ-land, Wiesbaden 1964.
Perrie, Maureen: Pretenders and Popular Monarchism in Early Modern Russia. the False Tsars of the Time of Troubles, Cambridge 1995.
Schmidt, Christoph: Sozialkontrolle in Moskau: Justiz, Kriminalität und Leibeigenschaft, 1649–1785, Stuttgart 1996.
Simon, Gerhard und Nadia: Verfall und Untergang des sowjetischen Imperiums, München 1992.
Stökl, Günther: Der russische Staat in Mittelalter und Früher Neuzeit. Ausgewählte Aufsätze, Wiesbaden 1981.
Stökl, Günter: Gab es im Moskauer Staat «Stände»? In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 11 (1963), S. 321–342.
Studer, Brigitte; Haumann, Heiko (Hrsg.): Stalinistische Subjekte: Individuum und System in der Sowjetunion und der Komintern, 1929–1953. Sujets staliniens: l’individu et le système en Union soviétique et dans le Comintern, 1929–1953, Zürich 2006.
Torke, Hans-Joachim: Die staatsbedingte Gesellschaft im Moskauer Reich. Zar und Zemlja in der altrussischen Herrschaftsverfassung 1613–1689, Leiden 1974.
Tucker, Robert C.: Political Culture and Leadership in Soviet Russia: from Lenin to Gorba-chev, New York u.a. 1987.
Waldron, Peter: Governing Tsarist Russia, New York u.a. 2007.
Ostmitteleuropa
Bahlcke, Joachim: Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der Böh-mischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526–1619), Freiburg (Breisgau), 1993.
Bahlcke, Joachim; Bömelburg, Hans-Jürgen; Kersken, Norbert (Hrsg.): Ständefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa. Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kul-tur vom 16.–18. Jahrhundert, Leipzig 1996.
Bak, János M.: Königtum und Stände in Ungarn im 14.–16. Jahrhundert, Wiesbaden 1973.
Bardach, Juliusz: L’union de Lublin: ses origines et son rôle historique, in: Acta Poloniae Historica 21 (1970) S. 69–92.
Teil B: Systematischer Teil
160
Butterwick, Richard (Hrsg.): The Polish-Lithuanian Monarchy in European Context, c. 1500–1795, New York u.a. 2001.
Dembkowski, Harry E.: The Union of Lublin: Polish Federalism in the Golden Age, New York 1982.
Eliason, Leslie C.; Bøgh Sørensen (Hrsg.): Fascism, Liberalism, and Social Democracy in Central Europe: Past and Present, Aarhus 2002.
Evans, Robert J. W.; Thomas, Trevor v: Crown, Church, and Estates Central European Poli-tics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Houndmills 21994.
Fedorowicz, J. K.: A Republic of Nobles. Studies in polish history to 1864, Cambridge 1984.
Fügedi, Erik: Castle and Society in Medieval Hungary (1000–1437), Budapest 1986.
Fügedi, Erik: Kings, Bishops, Nobles and Burghers in Medieval Hungary, London 1986.
Grodziski, Stanislaw: Les devoirs et les droits politiques de la noblesse polonaise, in: Acta Poloniae Historica 36 (1977), S. 163–176.
Haselsteiner, Horst: Das Widerstandsrecht der Stände in Ungarn, in: Österreichische Osthefte 16/1974, S. 123–136.
Hellmann, Manfred: Corona regni. Studien über die Krone als Symbol des Staates im späteren Mittelalter, Darmstadt 1961.
Kejř, Jiří: Aus Böhmens Verfassungsgeschichte. Staat, Städtewesen, Hussitentum, Prag 2006.
Klaniczay, Gábor: Holy Rulers and Blessed Princesses. Dynastic Cults in Medieval Central Europe, Cambridge u.a. 2002.
Krom, Michail: Die Konstituierung der Szlachta als Stand und das Problem staatlicher Einheit im Großfürstentum Litauen (15.–16. Jahrhundert), in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 42 (1994) S. 481–492.
Lemberg, Hans (Hrsg.): Ostmitteleuropa zwischen den beiden Weltkriegen (1919–1939). Stärke und Schwäche der neuen Staaten, nationale Minderheiten, Marburg 1997.
Mączak, Antoni; Weber, Wolfgang E. J.: Der frühmoderne Staat in Ostzentraleuropa. 2 Bde., Augsburg 1999.
Manikowska, Halina; Pánek, Jaroslav (Hrsg.): Political Culture in Central Europe (10th–20th Century), Prague 2005 [2 Bände].
Oberländer, Erwin: Autoritäre Regime in Ostmittel- und Südosteuropa 1919–1944, Paderborn 2001.
Olszewski, Henryk: Der polnische Reichstag der frühen Neuzeit in komparativer Sicht, in: Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte 1 (1996), S. 147–162.
Puttkamer, Ellinor von: Grundlinien des Widerstandsrechtes in der Verfassungsgeschichte Osteuropas, in: Spiegel der Geschichte. Festgabe für M. Braubach, Münster 1964, S. 198–219.
3. Politische Geschichte Osteuropas
161
Rhode, Gotthold: Staatenunion und Adelsstaat. Zur Entwicklung von Staatsdenken und Staatsgestaltung in Osteuropa, vor allem Polen-Litauen im 16. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Ostforschung 9 (1960), S. 185–215.
Rothschild, Joseph: Return to Diversity. A Political History of East Central Europe Since World War II. New York u.a. 1989.
Schramm, G.: Polen–Böhmen–Ungarn. Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, in: Bahlcke, Joachim; Bömelburg, Hans-Jürgen; Kersken, Norbert (Hrsg.): Ständefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuro-pa. Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur vom 16.–18. Jahrhundert, Leip-zig 1996, S. 13–38.
Scott, H. M. (Hrsg.): The European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Volume two: Northern, Central and Eastern Europe, London u.a. 1995.
Sugar, Peter F. (Hrsg.): Native Fascism in the Successor States, 1918–1945, Santa Barbara 1971.
Volkmann, Hans-Erich (Hrsg.): Die Krise des Parlamentarismus in Ostmitteleuropa zwischen den beiden Weltkriegen, Marburg/L. 1967.
Weczerka, Hugo (Hrsg.): Stände und Landesherrschaft in Ostmitteleuropa in der frühen Neu-zeit, Marburg 1995.
Südosteuropa
Boeckh, Katrin: Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg: Kleinstaatenpolitik und ethni-sche Selbstbestimmung auf dem Balkan, München 1996.
Braude, Benjamin; Lewis, Bernard (Hrsg.): Christians and Jews in the Ottoman Empire: the Functioning of a Plural Society. 2 Bde, New York u.a. 1982.
Findley, Carter V.: Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire. The Sublime Porte, 1789–1922, Princeton 1980.
Jelavich, Charles und Barbara: The Establishment of the Balkan National States, 1804–1920, Seattle 2000.
Kaser, Karl: Typologie der politischen Parteien Südosteuropas im 19. Jahrhundert, in Öster-reichische Osthefte 27 (1985), S. 331–365.
Kunt, Metin: The Sultan’s Servants. The Transformation of Ottoman Provincial Government, 1550–1650, New York 1983.
Lauer, Reinhard; Majer, Hans Georg (Hrsg.): Höfische Kultur in Südosteuropa, Göttingen 1994.
Lowry, Heath W.: The Nature of the Early Ottoman State, Albany 2003.
Melčić, Dunja (Hrsg.): Der Jugoslawien-Krieg. Handbuch zu Vorgeschichte, Verlauf und Konsequenzen, Wiesbaden 22007.
Teil B: Systematischer Teil
162
Panaite, Viorel: The Ottoman Law of War and Peace: the Ottoman Empire and Tribute Pay-ers, Boulder 2000.
Papalekas, Johannes Chr. (Hrsg.): Institutionen und institutioneller Wandel in Südosteuropa, München 1994.
Reinkowski, Maurus: Die Dinge der Ordnung. Eine vergleichende Untersuchung über die osmanische Reformpolitik im 19. Jahrhundert, 2005.
Vatin, Nicolas; Veinstein, Gilles: Le Sérail ébranlé. Essais sur les morts, dépositions et avè-nements des sultans ottomans (XIVe–XIXe siècle), Paris 2003.
Verdery, Katherine: What Was Socialism, and What Comes Next?, Princeton 1996.
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
163
4. SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE
4.1 Theoretische Ansätze
4.1.1 Einleitung
Die sozioökonomische Entwicklung in ganz Osteuropa zeigt ähnliche Struk-turmerkmale. Bei aller Verallgemeinerung ist aber stets zu berücksichtigen, dass die idealtypischen Merkmale in den drei Großräumen Osteuropas ver-schiedene Ausformungen aufweisen: In Russland und Südosteuropa sind sie auf unterschiedliche sozioökonomische Hintergründe zurückzuführen, und die sogenannten Übergangszonen im nördlichen und südlichen Ostmitteleu-ropa zeigen die bezeichnenden Merkmale nur graduell auf. Um die allgemeinen idealtypischen Besonderheiten der Entwicklung Osteu-ropas herauszuarbeiten, wird oft ein Vergleich mit derjenigen Westeuropas-westlich der durch Elbe, Leitha und Westpannonien markierten Grenze durchgeführt. Die dabei verwendeten Modernisierungstheorien (> Glossar) bieten ein breit abgestütztes Vergleichsinstrumentarium, das eine Vielzahl sozioökonomischer Aspekte abdeckt: Bevölkerungsdichte, Arbeitskraftpo-tenzial, Urbanisierungsrate, Bildungsstand, Häufigkeit von Wüstungsperio-den (> Glossar Wüstung), Arbeitsteilung, Rechtssicherheit, Agrarproduktivi-tät, Stand der Protoindustrialisierung, Industrialisierungstempo, Kapitelver-fügbarkeit und Stand der Vernetzung zwischen Stadt und Land. Dieses kom-paratistische Vorgehen, das Gesellschaften und Kollektive aus einer makro-historischen Sicht betrachtet, gehört zur klassischen Sozial- und Wirtschafts-geschichte. Neuere Ansätze der Forschung ergänzen diese Sicht, indem sie auf das einzelne Individuum «zoomen» und versuchen, dessen Lebenswelt als wirtschaftliche und soziale Praxis des Alltags zu greifen. Diese Einfüh-rung konzentriert sich auf die makro-strukturgeschichtliche Perspektive. Bei den jüngsten Modernisierungstheorien geht es nicht darum, in den ent-wickelten westlichen Ländern eine Norm zu erkennen, an der eine Rück-ständigkeit der anderen Regionen festgestellt werden kann – zudem ist die westeuropäische Entwicklung weltgeschichtlich gesehen nicht die Normali-tät, sondern die Ausnahme. Die heutige Modernisierungstheorie geht auch nicht mehr davon aus, dass sie den einzig möglichen Weg in die Moderne aufzeigen kann. Ziel des hier verwendeten Ansatzes ist es, mit der Kontrast-folie Westeuropa andersartige Entwicklungen in der Wirtschafts- und Sozi-algeschichte Osteuropas aufzuzeigen und regional zu differenzieren. Damit lassen sich Prozesse, Strukturen und deren Zusammenspiel herausschälen. Generell kann man zwei theoretische Vorgehensweisen unterscheiden: die deduktiven und die induktiven Ansätze.
Teil B: Systematischer Teil
164
4.1.2 Deduktive Ansätze
Deduktive (vom Allgemeinen auf das Besondere schließende) Ansätze ge-hen davon aus, dass sich erst mit Intensivierung des Überseehandels seit dem 16. Jahrhundert die vormals lokalen Wirtschaften zu einem umfassenden Weltwirtschaftssystem vernetzten. Regionen Westeuropas wie Norditalien, die Niederlande, Nordfrankreich und später England wurden zu dominieren-den Wirtschaftszentren, während andere Gebiete peripherisiert und zu Liefe-ranten von Rohstoffen und Nahrungsmitteln degradiert wurden – man spricht von einem durch exogene Faktoren verursachten Peripherisierungsdruck. Zwar hatte es auch schon zuvor große Entwicklungsunterschiede gegeben, doch wegen der fehlenden wirtschaftlichen Vernetzung hatten sie nur gerin-ge sozioökonomische Auswirkungen. Diese auch «Dependenz-» oder «Sog-theorien» genannten Konzepte beruhen auf der Untersuchung regionaler und interregionaler Entwicklungsstränge und derer Austauschbeziehungen. Dar-aus wird als neues Kriterium eine interregionale Arbeitsteilung mit wirt-schaftspolitischer Abhängigkeit abgeleitet. Zusammenfassend zeigt die Forschung, dass ein Peripherisierungsdruck in Osteuropa seit dem Hochmittealter erkennbar ist, sich in der frühen Neuzeit beschleunigte und während der Industrialisierung seit dem 19. Jahrhundert seinen Höhepunkt fand. Differenziertere Konzepte haben deutliche regionale Unterschiede für Osteuropa herausgearbeitet. Die Entwicklungsabläufe sind dabei nicht linear zu verstehen: Immer wieder ist für einzelne Entwicklungs-stränge und Zeitfenster eine beschleunigte nachholende Entwicklung auszu-machen.
4.1.3 Induktive Ansätze
Die induktiven (vom Einzelnen auf das Allgemeine schließenden) Ansätze gehen davon aus, dass die Entwicklungsunterschiede zwischen Ost- und Westeuropa überwiegend endogene Ursachen haben. Dabei wird von einem Faktorenkomplex – etwa der niedrigen Bevölkerungsdichte, dem damit zu-sammenhängenden niedrigen Urbanisierungsgrad und der starken Stellung des Adels – das Phänomen der sogenannten «Zweiten Leibeigenschaft» (> Glossar) abgeleitet. Sie gilt in weiten Teilen Osteuropas als wichtige Ursa-che für die blockierte Modernisierung. Als weitere endogene Faktoren lassen sich zum Beispiel die autokratisch gelenkte Wirtschaft im zarischen Russland, der Zentralismus des Osmanischen Reiches bis zum 17. Jahrhundert oder das Fehlen eines religiös begründeten wirtschaftlichen Motivators aufzählen. Da-bei wird der religionssoziologische Ansatz von Max Weber aufgegriffen. Die-ser gründet auf der These, dass die Reformation und vor allem der Calvinis-mus eine auf religiöse Werte sich beziehende Arbeits- und Wirtschaftsethik
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
165
hervorgebracht haben, die wesentlich zum Wirtschaftserfolg im atlantischen Europa beigetragen hat. Wüstungserscheinungen aufgrund permanenter Grenzkonflikte wie in Südosteuropa oder innerer Unruhen wie im Russland des 17. Jahrhunderts sind ein typischer endogener Faktor. Die neusten indukti-ven Ansätze gehen dazu über, die Einzelfaktoren zu kausalen Clustern zu bün-deln und mit den deduktiven Ansätzen zu kombinieren.
4.2 Grundlagen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte bis zum 15. Jahrhundert Tendenzen der Gesamtentwicklung • Für den Zeitraum vom 10. bis zum 14. Jahrhundert bewirkten die Ost-
kolonisation und die wirtschaftliche Anbindung näher liegender osteu-ropäischer Gebiete eine beschleunigte wirtschaftliche Entwicklung. Der Rückstand zu Westeuropa, der auf die perpetuierte Völkerwande-rung zurückzuführen ist, konnte zum Teil wettgemacht werden.
• Das Vordringen der Osmanen in Südosteuropa und der Mongolen-sturm in der Kiever Rus’ verzögerten diese Entwicklung bzw. führten zu einer neuen Stagnation.
• Im Norden profitierten die Städte der Ostsee von Danzig, über die livländischen Städte bis hin nach Novgorod vom Fern- und insbeson-dere vom Seehandel. In Böhmen, Mähren, Kleinpolen, Ungarn, Sie-benbürgen, Bosnien und Serbien stützte sich die wirtschaftliche Dy-namik auf den Metall- und Salzbergbau: einen wesentlichen Beitrag leistete hier die gezielte Ansiedlung von Spezialisten aus Westeuropa.
• Diese beschleunigte nachholende sozioökonomische Entwicklung erreichte Großpolen, Masowien und Binnensüdosteuropa im späten 14. und im 15. Jahrhundert. Die Dynamik erfasste schließlich auch das Moskauer Reich im ausgehenden 15. und frühen 16. Jahrhundert.
• Die aufgezeigten endogenen Strukturmängel der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Osteuropa konnten bis zur frühen Neuzeit nur in Ansätzen überwunden werden. Als die wirtschaftlichen Kontakte mit Westeuropa sich weiter verdichteten, zeigten die exoge-nen Faktoren einer sich anbahnenden Weltwirtschaft verstärkt Wir-kung.
4.2.1 Allgemeine Voraussetzungen
Im Vergleich zu Westeuropa kam die Völkerwanderung in Osteuropa deut-lich später zu einem Abschluss. Größere Bevölkerungsverschiebungen durch Reiternomadenverbände fanden bis ins 10. Jahrhundert hinein statt. So etab-
Teil B: Systematischer Teil
166
lierten sich erst spät stabile, zu einer Intensivierung der Wirtschaftsformen führende Herrschaftssysteme. Das russische Tiefland und die pannonische Tiefebene waren immer wieder den Vorstößen von Reiternomadenvölkern aus den eurasischen Steppengürteln ausgesetzt. In Russland gipfelten die Durchzüge der Petschenegen (> Glossar) und Kumanen (> Glossar) schließ-lich im Mongolensturm und einer nachfolgenden Tributherrschaft des Tata-renkhanats (> Glossar Khan) bis 1480. In Südosteuropa zogen Goten, Hun-nen, Westgoten, Awaren (> Glossar), Protobulgaren (> Glossar Bulgaren) und die Ungarn aus dem eurasischen Steppengürtel nach Zentraleuropa. Die Ackerbau treibende romanisierte Bevölkerung wurde aus den Beckenland-schaften in die Gebirgslandschaften des Südwestbalkans vertrieben, wo sie sich angesichts der ungünstigen Bedingungen der Weide- und Kleinvieh-wirtschaft zuwandte – archaische auf Selbstversorgung ausgerichtete Wirt-schaftsmuster breiteten sich wieder aus. So dauerte die Phase der Völker-wanderung im östlichen Europa mindestens 500 Jahre länger als in Westeu-ropa, wo sich bereits im 6. Jahrhundert Königreiche etablieren konnten. Die-se bildeten die Basis für die Genese des fränkischen Reiches im frühen 8. Jahrhundert; bereits vor 700 kam es zu einer lehensrechtlichen Durchdrin-gung des Territoriums und zu einer erfolgreichen Ausbreitung der Dreifel-derwirtschaft. In Osteuropa dagegen führten die perpetuierte Völkerwanderung und die späte Sesshaftwerdung zu einer geringen Bevölkerungsdichte und einem niedrigen Urbanisierungsgrad. Die von West nach Ost abnehmende Bevölke-rungsdichte auf dem europäischen Kontinent ist charakteristisch: In den dicht bevölkerten Gebieten Westeuropas wie den Niederlanden und der Po-ebene lebten im 16. Jahrhundert rund sieben bis zehn Mal mehr Menschen pro Quadratkilometer als in Russland; einer Bevölkerungsdichte von 30 bis 40 Einwohnern pro Quadratkilometer stand eine solche von vier Einwohnern pro Quadratkilometern gegenüber. In Polen und Ungarn betrug die Bevölke-rungsdichte mit neun bzw. acht Einwohnern pro Quadratkilometer geringfü-gig mehr, während Böhmen mit 28 Einwohnern pro Quadratkilometer seine charakteristischen Eigenschaften als Übergangszone zwischen Ost und West zeigt. Das Verhältnis der Bevölkerungsdichte Russlands und Ostmitteleuropas zu derjenigen Westeuropas dürfte vom Hochmittelalter bis zum ausgehenden 15. Jahrhundert konstant gewesen sein. Es änderte sich erst wieder im 16. Jahrhundert: Die drei «Geißeln» des Mittelalters – Seuchen, Missernten und zunehmende Kriegsaktivitäten – trafen seit dem 14. Jahrhundert die westeuropäische Bevölkerung in absoluten Zahlen schwerer als die osteuro-päische. Allerdings rissen Hungersnöte, Pestseuchen und der markant ab-flauende Strom von Siedlern aus Westeuropa, die im Zuge der Ostkolonisa-tion sich in Osteuropa angesiedelt hatten, erhebliche Löcher in die ohnehin
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
167
dünne Bevölkerungsdecke östlich der Elbe. In West- und Osteuropa führte der Bevölkerungsrückgang zu grundsätzlich verschiedenen Entwicklungen. In Westeuropa mit seiner relativen Überbevölkerung im Verhältnis zur Pro-duktivität konnten nun schlechte Böden aufgegeben werden, in Landwirt-schaft und Gewerbe suchte man eine qualitative Produktivitätssteigerung. Im unterbevölkerten Osteuropa dagegen gerieten der gegenüber Westeuropa verspätete Landesausbau und die nur in Ansätzen vorhandene Arbeitsdiffe-renzierung weiter ins Hintertreffen. Für Südosteuropa tut sich wiederum ein anderes Bild auf. Ostrom vermochte während der Völkerwanderung seine Bevölkerung zumindest in den Kern-gebieten vor feindlichen Invasoren besser zu schützen als Westeuropa. By-zanz war bis Ende des 12. Jahrhunderts der wirtschaftlich mächtigste und bevölkerungsreichste Staat in Europa. Doch der hohe Anteil der südosteuro-päischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung Europas sank zwischen 1200 und 1450 von über 20 % auf unter 10 % und kletterte erst Anfangs des 20. Jahrhunderts wieder auf 11 %. Der Niedergang von Byzanz, die Periphe-risierung der Balkanhalbinsel und die osmanische Landnahme seit dem spä-ten 14. Jahrhundert mit ihren Wüstungserscheinungen hatten maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen. Eine hohe Bevölkerungsdichte ist nicht nur ein wichtiger demografischer Faktor, sondern auch eine unerlässliche Voraussetzung für eine differenzier-te Arbeitsteilung und die Bildung von Märkten. Auch die Intensivierung landwirtschaftlicher Nutzungsformen hängt entscheidend davon ab: Vieh- und Schafzucht als extensive Formen brauchen weitaus weniger Arbeitskraft als Ackerbau. Das hohe Potenzial an Arbeitskraft ermöglichte bzw. bedingte in Westeuropa die Ablösung der Feld-Gras-Wirtschaft durch eine organisier-te Dreifelderwirtschaft. Der Anteil der Stadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung in Osteuropa widerspiegelt das obige Bild, obwohl zuverlässiges Zahlenmaterial vor dem 18. Jahrhundert nur in Ausnahmefällen vorliegt. Im 15. Jahrhundert betrug der Urbanisierungsgrad in Westeuropa 12–16 % und erreichte in den stark verstädterten Gebieten des Brabant sogar einen Drittel der Bevölkerung. In Osteuropa dürfte der durchschnittliche Urbanisierungsgrad trotz großer regi-onaler Unterschiede auch im 18. Jahrhundert kaum 6 % überschritten haben. Obwohl der osteuropäische Bevölkerungsanteil an der Gesamtbevölkerung Europas zwischen 1500 und 1800 angestiegen war, nahm der Anteil der städtischen Bevölkerung in Osteuropa ab: Grund dafür sind Deurbanisie-rungstendenzen in Polen-Litauen und in ganz Südosteuropa. Spielte die Stadt in Westeuropa seit dem 11. Jahrhundert stets die Rolle eines Wirtschaftsmo-tors, konnte sie in Osteuropa dieser Rolle nur schon in demografischer Hin-sicht kaum gerecht werden: Nur 12 der 50 größten europäischen Städte des
Teil B: Systematischer Teil
168
15. Jahrhunderts lagen in Osteuropa. Bis ins 18. Jahrhundert war die Ten-denz weiter sinkend. Extensive Wirtschaftsformen – etwa die Brandrodewirtschaft (> Glossar) und die Feld – Gras-Wirtschaft in Russland oder rein pastorale Wirtschafts-weisen in weiten Gebieten Südosteuropas – blieben vorherrschend. Nur im westlichen Ostmitteleuropa und in den Gebieten der Ostkolonisation wurden seit dem frühen 13. Jahrhundert moderne Agrartechnologien wie die Drei-felderwirtschaft, Trockenlegungen und der schwere Pflug übernommen bzw. durch Neusiedler aus Westeuropa eingeführt. Damit waren die wirtschaftli-chen Grundlagen für eine verstärkte Urbanisierung gegeben. Allerdings setz-te der ständige Arbeitskräftemangel dieser Entwicklung enge Grenzen. Nachteilig sollte sich zudem auswirken, dass die Intensivierung des Getrei-deanbaus, welche ab dem späten 15. Jahrhundert vom ostelbischen Mittel-deutschland bis weit in den russischen Osten eingesetzt ausstrahlte, unter Vernachlässigung der Viehwirtschaft stattfand: Diese seit dem 16. Jahrhun-dert stark gestiegene westeuropäische Nachfrage nach Weizen schränkte Gras- und Naturweiden ein, eine intensive und mit einer protoindustrialisier-ten Ackerwirtschaft verflochtene Weide- und Viehwirtschaft konnte in Ost-europa nicht Fuß fassen. Damit fehlten die Voraussetzungen für die Einfüh-rung von Düngetechniken, wie sie etwa in der Poebene und in den Nieder-landen bereits verbreitet waren. Die Dreifelderwirtschaft setzte sich in Russland seit dem 15. Jahrhundert-allmählich durch und blieb bis 1930 vorherrschend – im Vergleich dazu hatte sich im westlichen Europa die Dreifelderwirtschaft bereits im Hochmit-telalter etabliert. Mit abnehmender Tendenz von West nach Ost überschritt in Osteuropa der Koeffizient zwischen Aussaat und Ernte beim Weizen im 16. Jahrhundert kaum jemals das Verhältnis von eins zu drei, während in Westeuropa das Verhältnis bereits im 14. Jahrhundert über eins zu vier stieg.
4.2.2 Spezifische regionale und thematische Entwicklungen vor 1500
Strukturen der Landwirtschaftsentwicklung Der Mongolensturm in der Kiever Rus’ 1236 bis 1240, und die lang anhal-tenden Abwehrkriege in Südosteuropa gegen die vordringenden Osmanen nach 1350 führten zu lang anhaltenden Wüstungserscheinungen. Dies kon-servierte bzw. brachte wieder extensive Wirtschaftsformen hervor, die in den vorangehenden Jahrhunderten zurückgedrängt worden waren. In der Kiever Rus’ hatten seit dem 11./12. Jahrhundert Vorstöße von Noma-denvölkern aus der Steppe die slawischen Siedler aus dem fruchtbaren Schwarzerdegebiet in die Nordost-Rus’, das Becken zwischen Wolga und
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
169
Oka, zurückweichen lassen. Das Vordringen der Mongolen brachte bedeu-tende Bevölkerungsverluste mit sich und verstärkte die Fluchtbewegung in die Waldgebiete nördlich des Schwarzerdegürtels: Im Gegensatz zu den offenen Waldsteppengebieten boten die neu besiedelten Laub-, Mischwald-, und noch weiter nördlich gelegenen Nadelwaldzonen (Taiga) Schutz vor den Vorstößen der Nomadenstämme. In der Folge verödeten die südlich gelege-nen ehemaligen Kerngebiete der Rus’, vor allem Kiev und Rjazan’. Die neu-en, bis anhin von finno-ugrischen (> Glossar) Stämmen dünn besiedelten Gebiete kannten nur eine Feldgras- und Brandrodewirtschaft. Diese Urbarmachung behinderte das ostslawische Bauerntum im Ausbau seiner Ackerbaukultur. Die ohnehin auf Deckung des Eigenbedarfs ausgeleg-te Feldwirtschaft blieb extensiv. In den Weiten der Taiga verstreuten sich die Neuzuwanderer, die extensive Kolonisation ließ keine Siedlungsverdichtung zu. Die im 12. Jahrhundert ansatzweise entstehende Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land wurde stark beeinträchtigt. Im Gegensatz zu Westeuropa, wo die Binnenkolonisation – zum Beispiel im alpinen Raum – durch demografi-schen und wirtschaftlichen Druck zügig vorangetrieben wurde, ist die nor-dostwärts gerichtete Binnenkolonisation in der Spätphase der Kiever Rus’ und nach dem Mongolensturm vor allem auf politische und geografische Ursachen zurückzuführen. Kleinsiedlungen und wirtschaftliche Autarkie prägten die russische Landwirtschaft, während im atlantischen Europa Han-del und die Ausrichtung auf eine Marktwirtschaft spätestens seit dem 13. Jahrhundert die meisten Gebiete des flachen Landes erreicht hatten. Die Entwicklung Südosteuropas gestaltete sich mit der byzantinischen Vor-herrschaft in den südosteuropäischen Reichen Bulgarien, Serbien und Bos-nien mit dem osmanischen Vordringen und der venezianischen Herrschafts-präsenz entlang der Küsten unter eigenen Vorzeichen. Bis zum 10. Jahrhun-dert profitierten die neuen südosteuropäischen Königreiche und Fürstentü-mer von der unmittelbaren Nähe der Wirtschafts- und Herrschaftsmetropole Konstantinopel. Über 700 Jahre (zwischen 500 und 1200) bewies Byzanz eine erstaunliche Widerstands- und Anpassungsfähigkeit gegenüber immer neue Krisen, obwohl die Kontinuität gesellschaftlicher, staatlicher und ideo-logischer Strukturen seit der Spätantike zu einer allgemeinen Erstarrung geführt hatte: Das wirtschaftliche Erneuerungspotenzial war durch religiös bedingtes konservatives Denken und staatlichen Wirtschaftsdirigismus er-schöpft. Seit dem späten 11. Jahrhundert zeigte sich Byzanz der neuen wirt-schaftlichen Konkurrenz aus dem Abendland immer weniger gewachsen. Italienische Seestädte, in erster Linie Genua und Venedig, verdrängten die vormals dominierende Macht aus dem Binnen- und Fernhandel. Die Einführung des Pronoia-Systems (umfangreiche Vergabe von Landgü-tern als Lohn für Militärdienst) zersetzte das alte sozioökonomisch relativ
Teil B: Systematischer Teil
170
stabile Stratiotensystem (> Glossar) in Byzanz. Die seit dem 10. Jahrhundert neu geschaffene Militäraristokratie der Pronoiaren wurde die machtpolitisch und wirtschaftlich dominante Schicht, die ihren Erfolg hauptsächlich auf Landbesitz gründete. Viel später als in Westeuropa setzten sich Ende des 12. Jahrhunderts auch in Byzanz dem westeuropäischen Feudalismus vergleich-bare Strukturen durch: Das ursprünglich nur auf Lebenszeit verliehene Lehen wurde zum vererbbaren Gut, das immer umfassendere Immunitäten (Steuer-hoheit und Gerichtsbarkeit) beinhaltete. Insofern lässt sich im 13. Jahrhundert eine Angleichung der Pronoia an das westliche System erkennen. Die osmanische Landnahme Ende des 14. Jahrhunderts führte in ganz Süd-osteuropa zu einem Bevölkerungsrückgang und zu einem Niedergang der städtischen Netzwerke. Bedeutende Bevölkerungsteile zogen sich auf der Flucht vor den Osmanen in die kargen Gebirgsgegenden des Balkans und an die ostadriatische Küste zurück. Ganze Landstriche in den Beckenlandschaf-ten verödeten. Hatte die herrschaftliche Durchdringung durch die mittelalter-lichen serbischen, bulgarischen und bosnischen Königreiche eine gewisse Feudalisierung (> Glossar) – hauptsächlich durch die Übernahme des byzan-tinischen Pronoia-Systems – erreicht, breiteten sich im späten 15. Jahrhun-dert wieder pastorale Wirtschaftsformen aus und stießen bis in die Becken-landschaften der Donau und der Morava vor. Diese Formen alpiner und me-diterraner Almwirtschaft und Transhumanz (> Glossar) setzten sich in ver-schiedenen Regionen Südosteuropas durch. Anders aber als in den Alpen, wo im 14. und 15. Jahrhundert die Weide- und Viehwirtschaft ebenfalls an Bedeutung gewonnen hatte, war dieses pastorale Wirtschaften im Osten nicht auf städtische- und marktwirtschaftliche Bedürfnisse, sondern nur auf Subsistenzwirtschaft ausgerichtet. Hand in Hand mit der Deagrarisierung verlief auch eine Defeudalisierung: Weite Teile der Bevölkerung entzogen sich dem Zugriff einer zentralörtlich gesteuerten und vernetzten Wirtschaft. Strukturen der wirtschaftlichen Netzwerke Durch das Fehlen städtischer Netzwerke blieben in Osteuropa die Marktbe-ziehungen schwach entwickelt. Anders als in Westeuropa wurde die Natu-ralwirtschaft nur zum Teil vom geldwirtschaftlichen Verkehr abgelöst. Erst seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts prägten die Großfürsten von Moskau eigenes Silbergeld; in Südosteuropa dominierte der byzantinische Nomisma, der «Dollar» des früh- und hochmittelalterlichen Mittelmeer-raums. Dies verhinderte in den frühen südslawischen mittelalterlichen Kö-nigreichen die wirtschaftliche Emanzipation. Eine Feudalisierung der Grundverhältnisse auf der Basis einer Geldrente setzte sich in Osteuropa nicht durch. In Westeuropa hatten bereits im 12. Jahrhundert Geldabgaben die Lieferung von Naturalien und Arbeitsleis-
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
171
tungen abgelöst – der Bauer sah sich so gezwungen, seine Produktion auf dem immer dichter werdenden Netz von städtischen Märkten zu verkaufen. Es kamen erste Zwischenhändler auf. Die Städte profitierten von dieser Ent-wicklung als Umschlagplatz des Fern- und Nahhandels, aber auch als Ort einer gewerblichen Produktion, mit deren qualitativ hoch stehenden Erzeug-nissen sich die ländliche Gesellschaft eindeckte. Dieser Kreislauf lief in Ost-europa mit der Ausnahme Böhmens, der ostadriatischen Küste und dem Süd-saum der Ostsee nur zaghaft und sehr spät an. Die osteuropäische Stadt lebte auch weit über das 15. Jahrhundert hinaus vornehmlich von ihren agrarwirt-schaftlichen Erzeugnissen. In Westeuropa dagegen hatte sich in der gleichen Zeit eine durchschnittlich große Stadt von rund 3000 Bewohnern als Gewer-be- und Nahhandelszentrum etablieren können. Dieser späte Übergang zur arbeitsteiligen gewerblichen Produktion benach-teiligte bereits seit dem Hochmittelalter die osteuropäischen Handwerkser-zeugnisse gegenüber den westeuropäischen. Das Gewerbe, das sich in der Kiever Rus’ entwickelt hatte, blieb auf die fürstlichen Höfe in den Burgstäd-ten ausgerichtet. Zudem warf es der Mongolensturm qualitativ und quantita-tiv noch einmal zurück. In den Weiten des russischen Waldgürtels überwo-gen zerstreute Kleinsiedlungen. Der Bauer war auf sich gestellt und produ-zierte seine Werkzeuge und die Dinge des häuslichen Bedarfs selbst; er war zugleich Kolonist, Landwirt, Jäger und Handwerker. Einen Zugang zu den wenigen Zentren gewerblicher Produktion hatte er in nur sehr beschränktem Umfange. Bereits im Spätmittelalter war der russische Außenhandel asymmetrisch, was eine ausgeglichene Handelsbilanz zunehmend erschwerte: Russland lieferte Rohstoffe wie Pelze, Hanf, Leinen, Holz und Teer; Westeuropa hingegen Fertigwaren vor allem Tuche. Die Präsenz der Mongolen im Südwesten kappte die ehemals funktionierenden Handelsverbindungen nach Byzanz im Süden. Die hohen Tributforderungen der Tataren in Russland schöpften die dünne Kapitaldecke an Silber zusätzlich ab. Die geringe wirtschaftliche Akkumulation verhinderte lange den Auf-schwung kapitalintensiver Wirtschaftszweige, zum Beispiel des Bergbaus. Die Edelmetallvorkommen in Byzanz waren entweder gar nicht erschlossen oder wurden von fremdem Kapital ausgebeutet. Vor der Erschließung des Urals fehlten in Russland größere Bodenschätze. Zwar griff der neu aufge-nommene und intensivierte Abbau von Erzen, der im Westeuropa des 10. Jahrhunderts begonnen hatte, auch nach Osteuropa über: In Böhmen, der Slowakei, Siebenbürgen und dem südwestlichen Binnenbalkan wurden rei-che Erzvorkommen erschlossen, was für einige wirtschaftliche Dynamik sorgte. So entstand in Siebenbürgen, Bosnien und Serbien durch den Zuzug spezialisierter Siedler ein ganzes Netz von Bergbaustädten, die ihre Produk-
Teil B: Systematischer Teil
172
tion erfolgreich nach Westeuropa vermarkteten. Augenfällig ist jedoch, dass erst der Zufluss ausländischen Kapitals dieses investitionsreiche Gewerbe ermöglichte und in der Folge auch dominierte. So kontrollierten vornehmlich italienische Städte über die Stadtrepublik Ragusa (Dubrovnik) den Erzabbau in Bosnien und Serbien. Im Königreich Ungarn waren die Fugger, das ein-flussreichste und mächtigste Kaufmannsgeschlecht dieser Zeit, federführend. Die hohen Kosten des Abwehrkampfes der serbischen und bosnischen Herr-scher gegen die Osmanen behinderten die Reinvestition in Gewerbe, Handel und Bergbau. Die Binnenkaufkraft der Bevölkerung blieb schwach. Das vorhandene Kapital und die Gewinne flossen durch den von Italienern, Ra-gusanern und Deutschen kontrollierten Handel nach Westeuropa ab. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch für Siebenbürgen. In der Adria und im Balkanbinnenraum setzte die Stadtrepublik Venedig ab dem 12. Jahrhundert auf Kosten von Byzanz eine halbkoloniale Wirtschafts-struktur durch. In Russland wiederum dominierten seit dem späten 16. Jahr-hundert holländische und englische Seekaufleute von den Randmeeren aus den russischen Außenhandel und versuchten zudem, den Binnenmarkt zu erobern, so dass russische Kaufleute nicht einmal auf diesem Gebiet der westeuropäischen Konkurrenz gewachsen waren. Als Russland im 17. Jahr-hundert ausländische Kaufleute aus dem Binnenhandel auszuschließen ver-suchte, war deren dominante Stellung nicht mehr zu brechen. Weil Geld-überschüsse des lukrativen Fernhandels hauptsächlich ins Ausland abflossen, blieb an der Schwelle zur frühen Neuzeit anhaltender Kapitalmangel vor allem in Russland und in Südosteuropa eine Belastung für die weitere Wirt-schaftsentwicklung. Strukturen der Stadtentwicklung Bei der Entwicklung des Städtewesens zeigen sich folgende Unterschiede: Im Westeuropa des 9. und 10. Jahrhunderts trug die verbesserte Landwirt-schaft wesentlich zur Urbanisierung bei. Einerseits standen die für eine städ-tische Bevölkerung nötigen Überschüsse bereit, andererseits nahm die Stadt seit dem frühen 10. Jahrhundert die Rolle eines nichtagrarischen Wirt-schaftszentrums wahr. Im nördlichen Ostmitteleuropa und in der Rus’ fehlte dabei – im Gegensatz zu weiten Teilen Alteuropas – der Anknüpfungspunkt an antike städtische Vorbilder. In Osteuropa entstanden autogene städtische Frühformen, meist Handelsplätze und Märkte; allerdings verlief deren Ent-wicklung zum multifunktionalen Handels- und Gewerbezentrum eher zag-haft. Vielmehr muss der befestigte Burg- und Residenzort als Motor der Stadtentwicklung in weiten Teilen Osteuropas betont werden. Die Rolle des Königs, des Bischofs, des Fürsten bzw. des Statthalters blieb dominant, wäh-rend kommunale Verfassungsformen, die sich in Westeuropa bereits Mitte
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
173
des 11. Jahrhunderts herauszubilden begannen, sich nur schwer durchsetzen konnten. Auch die byzantinische Stadt entwickelte sich nicht zu einer selbstständigen, kommunal organisierten Gemeinschaft. Angesichts des rigiden staatlichen Zwang- und Kontrollsystems sowie des Machtanstiegs der landbesitzenden Pronoiaren wurden städtisches Gewerbe und Handel in Byzanz als Wirt-schaftsfaktoren marginalisiert. Als die byzantinische Dynastie der Palaiolo-gen im 13. Jahrhundert begann, die Städte mit Sonderprivilegien auszustat-ten, um ein Gegengewicht zur Militäraristokratie zu schaffen, war der Vor-stoß zu zaghaft und angesichts des osmanischen Vormarsches nicht mehr nachhaltig genug. Den Südslawen, den neuen Herrschern des Binnenbalkans, blieb städtisches Hausen lange Zeit fremd. Eine Übernahme urbaner Reste aus der Spätantike wie in Frankreich oder im Rheinland fand in Südosteuro-pa nicht statt. In ganz Kontinentalsüdosteuropa war die Zäsur im Städtewe-sen spätestens nach dem Awarensturm des 7. Jahrhunderts vollständig, da die letzten byzantinischen Stadtzentren vernichtet und verlassen wurden – in der Regel ist, wenn überhaupt, eine städtische Kontinuität nur topografisch, nicht jedoch auf sozialem Strukturen greifbar. Nur an der ostadriatischen Küste bildeten sich in Anlehnung an antike und byzantinische Vorbilder Städtelandschaften mit ausgeprägtem kommunalen Charakter heraus. Deren Ausstrahlung blieb jedoch lokal. Die rechtliche Struktur und die Entwicklung einer «Stadtverfassung» sind entscheidend für das wirtschaftliche Potenzial einer Stadt: Inwiefern konnte eine eigenständige Kaufmannsschicht das politische und wirtschaftliche Geschick ihrer Stadt unabhängig vom Stadtherrn in die Hand nehmen? In welchem Maß konnten Statuten und gesatztes Recht den Handel und das Gewerbe von obrigkeitlicher Gesetzeswillkür und Unsicherheit befreien? Inwiefern gab es überhaupt einen rechtlichen Unterschied zwischen Stadtter-ritorium und dem flachen Land? Im Zuge der deutschen Ostkolonisation fanden das Magdeburger und das Lübecker Stadtrecht weite Verbreitung: ab dem 13. Jahrhundert im König-reich Polen, im 15./16. Jahrhundert im Gebiet des heutigen Litauen, Weiß-russland und Ukraine. Das Magdeburger Recht wurde von gegen 100 Städ-ten – von Tondern in Schleswig bis Narva in Livland und Kiev in der heuti-gen Ukraine – übernommen. Allerdings muss gerade in Litauen von einer partiellen Übernahme gesprochen werden, da nicht die gesamte Stadtbevöl-kerung in den Genuss der Privilegien kam. Im Baltikum wurde das Magde-burger Recht von den deutschen Landesherren den bestehenden Verhältnis-sen aufgepfropft, was ebenfalls nur eine unvollständige Adaption zuließ. Eine gezielte Siedlungspolitik der Dynastie der Arpaden führte seit 1000 im ganzen ungarischen Reich zu zahlreichen Neugründungen: Handelte es sich
Teil B: Systematischer Teil
174
am Anfang vor allem um französische Neusiedler, überwogen später deut-sche Kaufleute und Bergbauspezialisten. So wurden im frühen 13. Jahrhun-dert in Oberungarn und vor allem in Siebenbürgen gezielt Städte mit einem «sächsischen Stadtrecht» (ius teutonicum) gegründet. Oft bildeten auch Marktflecken und Bergbauorte die Kerne dieser privilegierten Städte. Deren spezielles Stadtrecht beinhaltete das Recht auf kooperative Zusammen-schlüsse, feste Abgaben, persönliche Freiheit und die Wahl oder Bestätigung eigener Vögte oder Schulzen. Das Bürgerrecht beschränkte sich allerdings auf ausgewählte Schichten der zumeist deutschstämmigen Siedler: Die Stadt als einheitlicher Rechtskörper setzte sich auch hier nicht großflächig durch. In weiten Teilen Osteuropas wurde die Stadt ein Flickenteppich verschie-denster Jurisdiktionen. Der Grundsatz «Stadtluft macht frei» galt mit weni-gen Ausnahmen nicht. In Russland, Ungarn und Byzanz blieben die Städte von Landes- oder Grundherren abhängig. Es entwickelten sich keine kom-munalen Selbstverwaltungen – außer in Böhmen und Dalmatien und, jedoch weniger ausgeprägt, in Polen und Ungarn. In Dalmatien, Istrien und Küste-nalbanien beschränkte ab 1400 Venedig eine weitere kommunale Entwick-lung. In Polen-Litauen ließ der Machtzuwachs des städtefeindlichen Adels nur Ansätze einer städtischen Selbstverwaltung zu. In Ungarn setzt die kö-nigliche Krone der selbst eingeleiteten Privilegierung der Städte ein Ende, indem sie im 15. Jahrhundert begann, Städte an einflussreiche Magnaten (> Glossar) zu verpfänden. In Russland wurden die peripher gelegenen Stadtrepubliken Novgorod und Pskov vom Großfürstentum Moskau Ende des 15. Jahrhunderts und Anfangs des 16. Jahrhunderts erobert. Die Stadt als autarker Wirtschaftsraum mit besonderen Privilegien und einer eigenen Kaufmannschaft, die zugleich die politisch führende Elite stellte, konnte sich in Osteuropa nur in Ausnahmefällen als Alternative zu fürstlichen bzw. adli-gen Herrschafts- und Wirtschaftskonzepten etablieren. Generell wurde das Stadtgebiet nur bedingt zu einem Raum, das sich durch ein eigenes speziel-les Recht vom umliegenden flachen Land abhob und den Bewohnern dank verliehenen Privilegien besonderen Schutz und Freiheiten zukommen ließ – wichtige Voraussetzungen für eine florierende kommunale Stadtentwick-lung, die an der Wende zur Neuzeit die Grundlagen für eine bürgerliche Gesellschaft legten.
4.2.3 Spezifische Grundlagen der sozialen Systeme bis ins 15. Jahrhundert
Strukturelle Grundlagen des bäuerlichen Lebens In Westeuropa hatte die Fronarbeit im Rahmen der Feudalisierung bereits im 10. Jahrhundert ihren Höhepunkt überschritten, war aber noch im 11. Jahr-
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
175
hundert mit bis vier Frontagen pro Woche bedeutend. Der Übergang zur Geldrente und die Einführung neuer monetärer Abgaben im 12. Jahrhundert verwischten die Unterschiede zwischen Hörigen/Leibeigenen (> Glossar Leibeigenschaft) und kleinen Grundbesitzern. Nach 1100 wandte sich die grundbesitzende Schicht vermehrt von ihren Landgütern ab, da Hof- und Stadtleben attraktiv geworden waren. Durch die Übertragung der Bewirt-schaftung an Dritte (gegen Pacht- oder Mietzins bzw. Geld oder Naturalab-gaben) verwandelte sich die Gutswirtschaft in eine Grundherrschaft: Ab dem 12. Jahrhundert wurde die Bindung des Bauern an das Land und seinen Herrn zunehmend ökonomisiert und die leib- und grundherrliche Abhängig-keit zurückgedrängt. Die Schollenbindung (die Aufhebung der bäuerlichen Freiheit/Freizügigkeit > Glossar, vom Land seines Herrn abzuziehen und sich einen neuen Grundherrn zu suchen), die persönlich-rechtliche Abhän-gigkeit der Bauern vom Grundherrn sowie dessen hoheitliche Rechte wie die Erhebung von Steuern und die Justizdiktion schwanden. Der Bauer gewann dadurch an Selbstständigkeit und an ökonomischer Mobilität. Gleichzeitig mit der sozialen Differenzierung innerhalb der Bauernschaft fand eine Zer-splitterung der Zugriffsrechte (Steuer-, Kirchen-, Leibrecht usw.) auf die Bauernschaft statt – ein Phänomen, das im westeuropäischen Altsiedelland durch eine historisch gewachsene Verteilung der Rechte an verschiedene Personen zustande gekommen war. Die herrschaftliche Kontrolle über den Bauern nahm ab. Der rapide Bevölkerungsrückgang und die Depression der Agrarwirtschaft im 14. Jahrhundert beschleunigten diese Tendenz; Hunger, Seuchen, Krieg, Klimaverschlechterung und eine Überstrapazierung des Kulturbodens sind als Hauptursachen zu nennen. Der verschärfte Arbeitskräftemangel und der politische und wirtschaftliche Machtrückgang des kleinen und mittleren Adels zugunsten der Krone und der Städte erlaubten es, nun den Bauern die Bedingungen (Abgabenhöhe und Anzahl der Diensttage) zu diktieren – die Grundherren reagierten mit Abgabenreduktionen. Im 15. Jahrhundert setzte eine Entwicklung ein, die im 16. Jahrhundert südwestlich der Elbe die alte feudale Herrschaft auflöste und eine neue Mobilität von Grundeigentum brachte. Immer weniger waren Landes- und Grundherrschaft im atlantischen Europa identisch. Weil in Osteuropa die lehensrechtliche Überformung und die Mediatisierung der Hintersassen (die Aufhebung der unmittelbaren Gerichts-, Steuer- und Wehrhoheit des Fürsten) verspätet oder gar nicht einsetzte, vermochte sich – mit großen regionalen Unterschieden – eine weitaus breitere Schicht von freien Bauern und Pächtern bis weit ins 15. Jahrhundert zu halten. Grund-herrliche Abhängigkeiten entstanden erst im Zug der Christianisierung und der Bildung erster Herrschaftsorganisationen; insbesondere die Kirche spiel-te als Großgrundbesitzerin bei der Bindung der ehemals freien Bauern an die
Teil B: Systematischer Teil
176
Grundherrschaft eine entscheidende Rolle. So überwog im Früh- und Hoch-mittelalter von Litauen bis zur pannonischen Tiefebene – im Unterschied zu Westeuropa – eine rechtlich wenig geordnete und sozial stark zersplitterte ländliche Bevölkerung: Die Grenzen zwischen herrschaftlich gebundenen Bauern, freien Bauern und niederem Adel verliefen fließend. Eine in Ge-meinschaften organisierte, freie Bauernschaft konnte sich in Polen bis ins 12. Jahrhundert, im Baltikum bis ins 13. Jahrhundert und in Litauen gar bis ins 14. Jahrhundert hinein halten, wozu die dünne Besiedlung dieser Gebiete wesentlich beitrug. In den böhmischen Ländern fand relativ früh eine Bevölkerungsverdichtung statt. Gestützt auf die vergleichsweise frühe Herrschaftsbildung der böhmi-schen Dynastie der Přemysliden im 10. Jahrhundert – gerieten die Bauern in feudale Abhängigkeiten, doch nicht in dem Maß wie in Westeuropa. In der pannonischen Tiefebene vollzogen sich der Übergang vom halbnomadischen Leben zur Sesshaftigkeit und die soziale Differenzierung auf dem Land sehr langsam. Die ungarische Landnahme verzögerte die Entwicklung. Bodenei-gentum und Abhängigkeiten setzten sich erst im späten 11. Jahrhundert durch. Insgesamt gestaltete sich das Bild regional recht unterschiedlich, bis die Ostkolonisation die Stellung der Bauernschaft maßgeblich veränderte. Die von Krone und Aristokratie seit dem 13. Jahrhundert initiierte, gezielte Ansiedlung von Kolonisten in ganz Ostmitteleuropa führte kurzzeitig de iure zu einer besseren rechtlichen Stellung der Siedler. Mit Privilegien, garantier-ten persönlichen Freiheiten und Gütern zu festgesetztem Zins waren sie von Grundherren zur Kolonialisierung des dünnbesiedelten Gebietes östlich der Elbe angeworben worden. So führte der Landesausbau vorerst zu einer Ver-besserung der bäuerlichen Lebensbedingungen: Der Bauer konnte rechtlich und sozial aufsteigen. Allerdings verschärfte sich bald sein Abhängigkeits-verhältnis vom adligen Grundeigentümer, der zusehends Rechte über seine Pächter in seinen Händen zu bündeln vermochte. Der Landbesitzer war an-ders als in Westeuropa nicht nur Grundherr, sondern er riss im neu koloniali-sierten Land auch richterliche Funktionen über den Bauer an sich. Mit der fehlenden Verschriftlichung der Privilegien war der Bauer bald der Willkür des adligen Gutsherrn ausgeliefert. Bereits im 15. Jahrhundert setzte eine Entwicklung ein, die in die Einschrän-kung der bäuerlichen Freizügigkeit, die Auferlegung von Fronarbeit und die Eingrenzung der persönlichen Rechte im 16. Jahrhundert mündete. Das Ver-hältnis zwischen Altsiedlerland und kolonialisiertem Land sowie der Zeit-punkt der Besiedlung wurden zu entscheidenden Faktoren. In den böhmi-schen Ländern, die eine relativ hohe Bevölkerungsdichte sowie ein rechtlich und sozial differenziertes Verhältnis zwischen Bauer und Landbesitzer auf-wiesen, schlug die Entwicklung einen anderen Weg ein. Mit ein Grund dafür
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
177
ist auch die Tatsache, dass dem Bauern angesichts eines dichten Städtenetzes die Möglichkeit blieb, bei allzu großem grundherrlichem Druck in die Stadt zu flüchten und dort ein neues Auskommen zu finden. Wie in Westeuropa wurde die Herrschaft des adligen Grundbesitzers verdinglicht – die Herr-schaftsrechte bezogen sich also nicht mehr auf die Person des untergebenen Bauern, sondern nur noch auf den Grund und Boden. Dies erleichterte es dem Bauern, sich aus der Leibherrschaft zu befreien. In Polen und Litauen hingegen setzte sich die Leibeigenschaft der Bauern im 16. Jahrhundert durch. Anders als in Ostmitteleuropa und in Teilen Südosteuropas erreichte die Ostkolonisation Russland nicht: Der Landesausbau war hier eine Leistung der Binnenkolonisation. In der Kiever Rus’ und in der frühen Moskauer Zeit bildeten bis ins 15. Jahrhundert hinein vor allem «freie», sogenannte «schwarze Bauern» – das heißt solche, die grundherrschaftlich nicht erfasst waren und Steuern zu entrichten hatten – die Mehrheit der ländlichen Bevöl-kerung. Diese organisierten sich als Dorfgemeinden auf Selbstverwaltungs-basis: in der Kiever Zeit in der sogenannten verv’, in der Moskauer Zeit im sogenannten mir. Beide beinhalteten kollektive Haftungs- und Selbstverwal-tungsfunktionen, wobei Letztere kontinuierlich abnahmen. Mir und verv’ waren unmittelbar dem Fürsten unterstellt. Daneben gab es die sogenannten «weißen» steuerfreien Bauern, die grundherrschaftlich – etwa auf fürstlichen Hof-, Kloster- und Kirchenbesitzungen sowie auf Erbgütern des Adels – eingebunden waren. Für die fehlende Verbreitung von Fronwirtschaft und Leibeigenschaft wäh-rend der Kiever Rus’ und der frühen Moskauer Periode sind zwei Ursachen ausschlaggebend. Erstens: Gerade in der frühen Kiever Rus’ zogen die Fürs-ten mit ihren Gefolgschaften (russ. družina > Glossar) im Land umher, um die Versorgung und Entlohnung dieser Kriegerkaste zu gewährleisten; eine Vergabe von Gütern gab es bis Ende des 11. Jahrhunderts noch nicht. Und auch nach der Sesshaftwerdung verfolgten die Fürsten und die Bojaren (> Glossar) keine geld- und marktwirtschaftlich orientierte Landwirtschaft: Der Luxusbedarf und der Lebensstandard des Adels waren noch wenig ent-wickelt und konnten aus der Eigenwirtschaft (Herrenhof) befriedigt werden. Zweitens: Die Flucht der bäuerlichen Bevölkerung in die Nord- und Ostrus’ vor den Steppenvölkern ließ die Bedeutung der Ackerbaukultur noch stärker zurückgehen. Erst im späten 15. Jahrhundert bildeten die sogenannten wei-ßen Bauern allmählich die Mehrheit, die gegenüber dem Grundherrn lasten-pflichtig waren. Die Massenvergabe von Dienstgütern an Dienstleute zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes sog die zuvor nur dem Großfürsten unter-stellte «schwarze Erde» auf. Die Weichen für die Entwicklung der Leibei-genschaft und sich stetig verschlechternde Lebensbedingungen der Bauern-schaft waren gestellt.
Teil B: Systematischer Teil
178
In Südosteuropa bietet die Situation der bäuerlichen Bevölkerung ein unein-heitliches Bild. Die schwierige Quellenlage und die Zugehörigkeit zu ver-schiedenen Reichen ermöglichen erst für das Spätmittelalter eine differen-zierte Übersicht. Generell hat die slawische Landnahme in Südosteuropa die bäuerliche Siedlung, vor allem bei der romanisierten Urbevölkerung, zu-rückgedrängt. Ein lang anhaltender Verweidungsprozess setzte ein. In den zerkammerten Gebirgslandschaften bildeten sich Wanderhirtengesellschaf-ten, die nur langsam zu Sesshaftigkeit und Ackerbau übergingen. Stammes- und Sippengesellschaften mit einem komplexen Familienaufbau blieben konserviert. Da eine herrschaftliche Überformung ausblieb, konnte sich auch in agrarischen Gebieten die sogenannte «Zadruga» (Hausgemeinschaft) hal-ten. Der Begriff selber ist eine Neuschöpfung des 19. Jahrhunderts, in den Quellen des Mittelalters und der frühen Neuzeit ist er nirgends zu finden. Er bezeichnet eine spezielle Form des Gemeinschaftslebens in Südosteuropa – und ist Ausdruck einer fragwürdigen Mythisierung und Verklärung dieser Lebensweise als einer vorgeblich urslawischen Gemeinschaftsform mit Ge-nossenschaftscharakter. Die Zadruga ist eine patriarchalische Großfamilie, die aus mindestens zwei bis drei Kernfamilien mit zehn bis zwanzig und weniger häufig bis zu 60 Mitgliedern besteht. Diese leben in einer ungeteilten Wirt-schaft mit Kollektivbesitz. Die Entstehung der Zadruga, die durch das Leben in einer Großgruppe besseren Schutz und durch weitgehende Naturalwirtschaft ökonomische Autarkie bot, war eine Folge der sozialen Anpassung an extensi-ve Wirtschaftsformen. Diese Lebensform findet sich vor allem im ehemals osmanisch geprägten Teil Südosteuropas: Serbien, Makedonien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, weniger verbreitet auch in Kroatien. Im Landesinneren, insbesondere im Bereich des serbischen Königreichs, ist seit dem 13. Jahrhundert durch die Übernahme des byzantinischen Pronoia-Systems eine feudale Durchdringung des bäuerlichen Lebens festzustellen. Ein Großgrundbesitzertum mit Fronarbeit und Naturalabgaben sowie einer Mediatisierung des Bauerntums setzten sich allmählich durch. Die osmani-sche Eroberung unterbrach diese Entwicklung. Das osmanische Timâr-System – die Verleihung von nicht vererbbaren Staatsgütern an Dienstleute – schützte die Bauernschaft vor Übergriffen des Adels. Der Bauer blieb wäh-rend der Blütezeit des Osmanischen Reiches zwischen 1450 und 1550 unter dem Schutz einer zentral organisierten «Staatsstruktur». Strukturelle Grundlagen des städtischen Lebens Eine kurze Beschreibung der westeuropäischen Städtewelt soll als Kontrast-folie zur osteuropäischen Städtewelt dienen. In einer Entwicklung, die im 11. Jahrhundert einsetzte und bereits im 13. Jahrhundert im Wesentlichen voll ausgeprägt ist, wurde die Stadt im atlantischen Europa zu einem Ort
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
179
besonderen Friedens, besonderer Freiheit und einer gemeindlich-genossen-schaftlicher Verfassung. Im nordalpinen Raum prägte vor allem die Rolle der Stadt als Kaufmanns- und Gewerbestadt die weitere Entwicklung. Gemeindli-che Strukturen der bereits früh privilegierten Kaufmannsschicht bildeten dabei den Kern einer Kommune, die ihre Privilegien über die ganze Stadtbevölke-rung ausdehnte. Aus der gemeindlich und genossenschaftlich organisierten Kaufmanns- und Gewerbeschicht entstand eine rein städtische Führungs-schicht, die sich in Recht und Funktion vom ländlichen Adel abgrenzte. Im südalpinen Raum saugte das ausgeprägte und wirtschaftlich florierende Städtenetz den ländlichen Lehensadel in sich auf. Hier entstand aus Adel und urbaner Führungsschicht ein neues Patriziat, das in Anlehnung an antike Vorbilder ein kollektives Herrschaftsverständnis entwickelte. Die Mauern der mittelalterlichen Idealstadt umschlossen schließlich einen Ort höheren Friedens und gegenseitigen Vertrauens. Die Eingrenzung hoheitlicher Will-kür – zum Beispiel der des Stadtbischofs oder Stadtgrafen – durch rechtliche Normen setzte sich durch. Kaufmanns- und Gewerbezünfte, Gilden und Bruderschaften bestimmten nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die politi-schen Interessen in Abgrenzung zum stadtfremden Adel und feudalen Stadt-herren. Diese städtische Schicht wurde zu einem politischen und später auch administrativen Bündnispartner des Königs und des sich anbahnenden Terri-torialstaates gegen die hohe Aristokratie. Bei beiden Modellen sollte die Stadt in ihr Hinterland ausgreifen und ihm wirtschaftlich, politisch und rechtlich ihren Stempel aufdrücken. So sicherte sich die Stadt durch den Gewinn von ansehnlichen Stadtterritorien jene demo-grafischen und wirtschaftlichen Ressourcen, die sie für ihr Überleben brauch-te. Gleichzeitig wurden die feudalen Strukturen zurückgedrängt oder absor-biert. In der westeuropäischen Stadt entstand eine neue soziale Schicht, die eine Alternative zu den adligen bzw. autokratisch-königlichen Strukturen bot. Max Webers Modell der idealtypisch beschriebenen okzidentalen Stadt setzt fünf Eigenschaften für die oben beschriebene Entwicklung im atlantischen Europa voraus: Befestigung, mindestens teilweise eigenes Recht und eigenes Gericht, Markt, Verbandscharakter der Stadtbevölkerung und mindestens teilweise Autonomie. Diese fünf Eigenschaften bildeten sich in Osteuropa nur partiell und von Westen nach Osten abnehmend heraus. Generell war die Unterscheidung zwischen ländlicher und städtischer Siedlung in Osteuropa weniger ausgeprägt. Die Stadt wurde nur in Ansätzen ein Ort, der eine von ländlichen Sozialformen klar zu unterscheidende, spezifisch städtische Ge-sellschaft hervorbrachte. Erst im 10. bis 12. Jahrhundert, gegenüber Westeuropa phasenverspätet, entwickelten sich die Burg- und Burgwallstädte der Ost- und Westslawen zu Städten mit typischen zentralörtlichen Funktionen als «interregionale Han-
Teil B: Systematischer Teil
180
delsstützpunkte» und «militärische, administrative und religiöse Zentren». Allerdings sind in der Kiever Rus’ nur wenige voll entwickelte Städte wie Novgorod, Kiev und Černigov feststellbar. Jenseits ihrer zentralörtlichen Funktion konnte die osteuropäische Stadt eine rechtliche Privilegierung nie oder nur teilweise erringen. Ihre Bewohner brachten keine schwurgemeinschaftliche horizontale Vernetzung als Eigenleis-tung hervor, die als Gegenmodell zur vertikalen Stadtherrschaft hätte dienen können. Der Stadtbewohner blieb erstens wie der Bauer seinem Landesherrn verpflichtet, und zweitens verfügte er über kein spezielles rechtlich verbindli-ches gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis zu seinen städtischen Mitbewoh-nern. Erst die Verleihung von Stadtrechten durch die Landesherren Ostmit-teleuropas, um Siedler aus Westeuropa anzulocken, brachte den Städten eine rechtliche Differenzierung gegenüber dem flachen Land. Dieses «Stadtrecht» kommunalen oder kaufmännischen Zuschnitts erreichte Russland indes nie. Die verschiedenen Begriffe für «Stadt» im Ost- und Westslawischen zeigen, wie unterschiedlich die Entwicklung eines städtischen Bewusstseins in Ost-mitteleuropa und in Russland verlief. Im Westslawischen wurde «mesto» (Ort, Platz) zum Begriff für die Stadt, im Ostslawischen blieb «gorod» die übliche Bezeichnung für Burg bzw. Burgstadt. In Russland blieb der um-mauerte Ort als Fürstensitz ohne jegliche kommunale Vorrechte vorherr-schend. Das Magdeburger und das Lübecker Stadtrecht fanden im Zuge der Ostkolo-nisation rasche Verbreitung in ganz Ostmitteleuropa. Das ius teutonicum wurde vom Baltikum über die mittelungarischen Städte bis nach Siebenbür-gen verwendet. In der Regel wurden die Siedler neben der Burgstadt in ei-nem neuen Suburbium angesiedelt – meist handelte es sich um Kaufleute oder Handwerker; in Bosnien, Siebenbürgen, Serbien, Böhmen, Mähren und der Slowakei waren es vor allem Bergleute. Gemessen an Bedeutung und Größe, wurden die alten Siedlungskerne bald von den neuen Suburbien über-flügelt: Die Beispiele Pressburg oder Danzig zeigen, wie frühere Suburbien zum Mittelpunkt der Stadt heranwuchsen. Hier bildete sich der Keim für eigenständige Verwaltungs- und Gerichtsorgane: Was die Entfaltungsmög-lichkeiten angeht, galten die Städte Siebenbürgens als Spiegelbild der mittel-europäischen Städte. Die Stadt und ihre Bevölkerung wurden zu einer wich-tigen Wehr- und Finanzstütze des Königs. Nach vergleichbaren Anfängen im 13. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt im östlicheren Ostmitteleuropa anders: Typischerweise erfasste das städti-sche Recht hier nicht alle Stadtbewohner. So kamen nur bestimmte ethnisch bzw. religiös definierte Bevölkerungsgruppen, in Kiev zum Beispiel die Katholiken, zu diesen Vorrechten, während die Orthodoxen weiter dem Stadtherrn unterstellt blieben. Oft verlieh auch der Landesherr nur einzelne
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
181
Privilegien aus dem Magdeburger Stadtrecht. Das städtische Gebiet blieb ein Flickenteppich adliger, geistlicher, landesherrschaftlicher und städtisch-kommunaler Jurisdiktionen. Dadurch waren große Teile der Stadt vom privi-legierten kommunalen Gebiet, wo die Zunftmonopole nicht galten, in rechtli-cher, wirtschaftlicher und steuerlicher Hinsicht abgekoppelt. Dies schwächte den städtischen Handel und das Gewebe gegenüber dem Adel. Wegen des Steuerdrucks übersiedelten viele Städter in Polen und Litauen in Gebiete, die der Jurisdiktion von Adligen und Klöstern unterstanden, da dort bessere Steuerbedingungen herrschten. In Polen-Litauen bildete sich kein einheitliches Rechtsbewusstsein aus, das allen Bewohnern eines ummauerten Gebietes ein spezielles Gemeinschaftsge-fühl mit wirtschaftlichen und rechtlichen Vorrechten vermittelt hätte. Religiö-se, ethnische und rechtliche Unterschiede im Zuge der Konfessionalisierung spalteten die Einwohnerschaft der Stadt zusätzlich. Als im frühen 16. Jahrhundert der Adel in Polen-Litauen, aber auch in Ungarn erstarkte, wurde der Kreis der dem Stadtrecht unterstehenden Bevölkerung weiter einge-engt. Viele Kleinstädte und stadtähnliche Siedlungen blieben grundherrschaft-lich gebunden oder wurden wieder vom Grundherrn eingezogen. In Polen und Litauen entstanden «Privatstädte», die Großgrundbesitzer gehörten. Auch im russischen Gebiet kam es ausnahmsweise vor, dass die Stadt sich als Raum einer speziellen sozialen Ordnung entfalten konnte. Beispiele dafür sind Novgorod und Pskov. In diesen peripher gelegenen Städten konnten die städtischen Volksversammlungen, die sogenannten veče (> Glossar) der Kiever Rus’, den Mongolensturm überdauern. Die soziale Differenzierung in Novgorod brachte ein eigenständiges städtisches Bojarentum hervor, das religiös, wirtschaftlich und politisch die Stadt führte und sich auch ein riesi-ges Territorium untertan machte. Allerdings blieb die horizontale Vernet-zung der Stadtbevölkerung unverschriftlicht. Bis Ende des 13. Jahrhunderts blieben die städtischen Volksversammlungen ad hoc Versammlungen ohne eine feste veče-Ordnung: Zeitpunkt, Ort und die Tagesordnung wurden nach Bedarf bestimmt. Trotzdem spielten die veče bei allen wichtigen politischen Entscheiden eine entscheidende Rolle. Nach 1300 erhielten die Volksver-sammlungen einen festen Rahmen, in dem die höchsten Amtsträger, die ei-gentliche exekutive Gewalt, gewählt wurden. Ebenfalls wurden in Novgorod und Pskov die Rechtsordnungen fixiert. Insofern hatten sich diese Stadtge-meinden ähnlich wie im okzidentalen Europa ein autonomes Recht gesetzt. Hingegen spielten Zünfte wie etwa die Johanneshundertschaft in Novogorod keine wesentliche Rolle in der Herrschaftsausübung. Ging die gängige Lehrmeinung lange davon aus, dass der städtische Raum in Russland keinen Ort einer gesonderten soziopolitischen Entwicklung hervorgebracht hat, muss diese Meinung heute revidiert werden (vgl. Forschungskontroversen, S. 221). Es entstanden durchaus kommunenähnliche Strukturen. Die Erobe-
Teil B: Systematischer Teil
182
rung der Stadtstaaten Novgorod und Pskov 1478 bzw. 1510 durch das auf-strebende Großfürstentum Moskau setzte diesen Alternativen der russischen Stadtentwicklung ein Ende. Gesondert und differenziert gestalten sich die städtischen Räume in Südost-europa. Entlang der ostadriatischen Küste entstand in Städten wie Pula, Za-dar, Dubrovnik und Skutari ein Seitenast der italienischen Kommune. By-zantinische Ursprünge, eine romanische Bevölkerung und die Nähe zur ita-lienischen Stadtentwicklung trugen entscheidend dazu bei, die Stadt zu ei-nem in sich abgeschlossenen Ort besonderen Rechts werden zu lassen. Ein autonomes städtisches Patriziat lenkte das Geschick dieser Kommunen. Die Ausstrahlung dieses städtisch geprägten engen Küstengürtels auf den Bin-nenbalkan blieb jedoch erstaunlich gering. Bei den Südslawen bildeten die Siedlungen sehr spät und nur partiell zentralörtliche Funktionen aus; als reli-giöse Zentren und als Orte eines sich vom flachen Land abhebenden sozialen Musters fungierten nicht Städte, sondern Klöster. In den moldauischen, wala-chischen, bosnischen und serbischen Städten fanden sich lediglich Rechtsen-klaven auswärtiger Kauf- und Bergleute. Die osmanische Stadt schließlich setzte die Strukturen der byzantinischen Stadt insofern fort, als sie über keine besondere Rechtsstellung in Form eines Stadtrechts verfügte. Die Stadt war im osmanischen Verständnis gleichsam der Transmissionsriemen der zentralen Herrschaft. Es gab zwar Bruderschaften, doch diese standen unter einer stren-gen Kontrolle des staatlichen Dirigismus. Obwohl sich die osmanische Stadt daher nicht wie die okzidentale Stadt entfalten konnte, bot sie als administrati-ves und religiöses Zentrum Raum für verdichtete soziale Entwicklungen. Strukturelle Grundlagen des adligen Lebens Ursprünglich lässt sich der Adel auf eine Führungsschicht der altslawischen Stammesgesellschaften sowie auf die von den Fürsten für ihre Militärdienste belohnten Gefolgsleute zurückführen. Die lange Zeit der Völkerwanderung und die späte Christianisierung ließen die osteuropäischen Gesellschaften sich nur langsam formieren. Grundbesitz und politische Macht aus der Stammesperiode mussten erst in feste Formen überführt werden. Gerade Landbesitz war in Sippengesellschaften kollektiv organisiert, das Land durf-te vom ganzen Stamm mitbenutzt werden. In den Gebirgsgegenden des Kau-kasus und des Südwestbalkans überlebte diese archaische Form bis ins 20. Jahrhundert, was relativ homogene Gesellschaften ohne ausgeprägte Elite konservierte. Es dauerte Jahrhunderte, bis sich aus der Mitte dieser Stammes-gesellschaften begrifflich, machtpolitisch und juristisch greifbare adlige Schichten herauskristallisierten. Großfürstliche und königliche Dienstleute sowie der Amtsadel vervollständigten später diesen alten Adel, der seine Wur-zeln auf die landnehmenden Gefolgschaften zurückführte.
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
183
Der Prozess der wirtschaftlichen und sozialen Differenzierung dauerte länger als in Westeuropa mit der Folge, dass sich die herrschenden Eliten nur all-mählich herauszubilden begannen – in Italien waren der sozialen Mobilität bereits im frühen 11. Jahrhundert enge Grenzen gesetzt, in Osteuropa hinge-gen stellte der Adel bis ins 13. Jahrhundert hinein keine in sich abgeschlos-sene Schicht dar. Besonders in Kroatien, Russland, Moldau, der Walachei und im Baltikum war der Anteil von «Gemeinfreien» noch recht hoch und die Abgrenzung zu privilegierten Freien fließend. In Bulgarien dagegen ent-stand relativ früh eine Herrenschicht, da die eindringenden bulgarischen Stämme innerhalb der Masse der slawischen Bevölkerung von Anfang an eine schmale Elite mit politischen und herrschaftlichen Vorrechten bildeten. In Ungarn verlief die Entwicklung ähnlich: Hier entstammte der Adel den Angehörigen der landnehmenden Stammesführer. Generell blieb der König im 11. und 12. Jahrhundert in ganz Osteuropa der größte Landbesitzer, der einer stark ausgeweiteten Militärschicht Güter als Lohn für geleistete Militärdienste verteilte; diese Güter waren allerdings nicht vererbbar. Ein eigentliches Lehenswesen mit einem festgelegten Treueverhältnis lässt sich erst im 13. Jahrhundert in Böhmen und Mähren greifen – die Anlehnung an deutsche Vorbilder war sicherlich wegweisend. In Bosnien, Kroatien und Serbien setzte sich ein Lehenswesen westeuropäi-schen Zuschnitts trotz einigen Ansätzen nie wirklich durch. So blieb der Amtsträger im Früh- und Hochmittelalter gefolgschaftlich an den König gebunden, ohne gegenüber der Krone einen einheitlichen Stand zu bilden. Im ungarischen Raum waren im Hochmittelalter die königliche Macht und das Übergewicht der königlichen Güter so ausgeprägt, dass eine Mediatisie-rung der Macht – die Abtretung der Steuer- und der Steuerhoheit an den adligen Grundherrn – nicht stattfand. Allerdings setzte sich im Zuge einer starken sozialen Differenzierung innerhalb des Adels allmählich ein unbe-schränktes erbliches Eigentums- und Herrschaftsrecht durch. Mit der Formu-lierung und Verleihung von festen Privilegien und erblichem Grundbesitz als Gegenleistung für die Militärdienstpflicht, dem sogenannten ius militare, setzte sich im späten 13. Jahrhundert eine feste Adelsschicht von den übri-gen Freien ab. Hohe Aristokratie und neue Ritterschaft bildeten von nun an den Adel, der zunehmend ein ständisches Bewusstsein entwickelte. Häufige Dynastiewechsel, das Aussterben der ersten Königsdynastien, (Pře-mysliden) und – vor allem im Königreich Polen-Litauen der frühen Neuzeit – die Einführung des Wahlkönigtums nach dem Aussterben der polnisch-litauischen Dynastie der Jagiellonen stärkten den Adel gegenüber der Krone. In Polen, Böhmen-Mähren und Ungarn entstanden sogenannte politische nationes – Adelsstände, deren Widerstandsrecht gegenüber der Krone stän-dig wuchs. In Böhmen und Mähren gab es bereits Ende des 13. Jahrhunderts
Teil B: Systematischer Teil
184
Landtage. In Polen kamen nach 1400 Reichstage (poln. Sejm) zusammen, wobei hier der ganze Adel (poln. Szlachta > Glossar) teilnahmeberechtigt war. Anders als sonst in Europa waren alle Adligen, egal welcher Stellung, de iure gleichberechtigt – eine Folge der fehlenden Mediatisierung und Feudali-sierung bei der Genese des Adels, der im Bezug auf seine formal-politischen Rechte keine hierarchische Zersplitterung erfahren hatte. Die unteren Adels-ränge hatten sich an den Reichstagen Mitentscheidungsrechte gegenüber dem hohen Adel, den sogenannten Magnaten, erkämpft. Später als in Ungarn und in Bulgarien bildete sich in den südslawischen Ge-sellschaften der Adel aus den Spitzen der in der Gauverfassung zusammen-geschlossenen Sippensiedlungen heraus. Ursprünglich wurden die Stammes-führer, sogenannte župane, gewählt. Das Wahlprinzip wurde spätestens mit der Ausformung größerer Herrschaftsgebilde durch die gewohnheitsrechtli-che Vererbung des Titels abgelöst. Diese Župen waren die Keimzelle der mittelalterlichen südosteuropäisichen Reiche. Durch die im Unterschied zu Westeuropa sehr spät einsetzende soziale Differenzierung konnte sich ein Lehenswesen nicht durchsetzen. Der Adlige blieb in einer personalisierten, nicht verschriftlichten Abhängigkeit vom Herrscher, in welcher Gefolg-schaftsverhältnisse und der Dienstgedanke dominierten. Unter diesen Vor-aussetzungen konnte sich keine fest gefügte Vasallenstruktur durchsetzen. Mit der Zeit erkämpfte sich der Adel ein unbeschränktes erbliches Eigen-tums- und Herrschaftsrecht über die Ländereien und die Hintersassen. So verlor das Königtum gegenüber den Adligen an Boden. In Serbien und Bos-nien gewannen Magnaten und lokale Despoten die Oberhand. Die osmanische Expansion setzte schließlich dieser herrschaftlichen Zer-splitterung und grundherrschaftlichen Segmentierung ein Ende. Der lokale Hochadel wurde vertrieben oder kam um. Der übrige Adel trat in den osma-nischen Dienst ein und wurde rasch islamisiert. Das osmanische Dienstsys-tem (Timâr) lehnte sich an die byzantinische Pronoia an: Das Gut samt Ein-künften wurde nur zeitlich begrenzt dem Dienstmann (Sipahi) zugewiesen und war nicht erblich. Auch übte der Sipahi keine richterlichen Funktionen über die Bauern aus. Erst im 16. Jahrhundert wurde das Gut mit der Einfüh-rung des Çiftlik-Systems allmählich ein faktisch vererbbares Lehensgut, auf das die Zentralmacht immer weniger Zugriff hatte. Eine Mediatisierung der Çiftlik-Güter fand hingegen nicht statt: Dem osmanischen Staat verblieb zumindest in formalrechtlicher Hinsicht die Gerichts- und teilweise auch die Steuerhoheit. Ein eigentlicher Adelsstand mit einem kooperativen Gemein-schaftsgefühl ging daraus nicht hervor. Der russische Adel entstand aus der Gefolgschaft des Fürsten (družina). Die Bojaren (Hochadel) bildeten die oberste Schicht von adligen Würdenträgern: Sie stellten Statthalter, Heerführer und wahrscheinlich auch Verwalter fürst-
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
185
licher Domänen. Ein Wechsel von einem Herrn zu einem anderen war ur-sprünglich möglich. Seit dem 15. Jahrhundert wurde mit dem Erstarken des Großfürstentums Moskau die grundsätzlich «freie Wahl des Dienstverhältnis-ses» als Verrat geächtet. Es setzte sich eine allgemeine Dienstpflicht des ge-samten Adels gegenüber dem Moskauer Großfürsten durch. Anders als in Westeuropa trat der Großfürst in Russland selbst der bojarischen Oberschicht keine hoheitlichen Rechte in Rahmen lehensrechtlich verschriftlichter Rechts-strukturen ab. Obwohl die Grundherren sich die Gerichtsbarkeit außer bei Mord, Raub und Diebstahl angeeignet hatten, blieb die Unmittelbarkeit der zarischen Gewalt erhalten. Somit kam es auch zu keiner Mediatisierung der Herrschaft: Die Bojarengüter blieben in die fürstliche Gerichts- und Verwal-tungsorganisation eingebettet, obwohl de facto die Moskauer Herrscher das Flache Land nie zu durchdringen vermochten. Die Stellung jedes Adligen, auch die der Bojaren, war vom Großfürsten und später dem Zaren abhängig. Im sozialen Netzwerk blieb jeder einzelne dem Großfürsten respektive dem Zaren zugeordnet; jede adlige Familie hatte ihren durch Abstammung bestimmten Platz in einer festen Rang- und Platz-ordnung (russ. mestničestvo) (> Glossar). Vassalitätsstrukturen innerhalb des Adels gab es nicht. Die Heterogenität des Adels, das Fehlen einer Mediati-sierung der Macht und der Großfürst als alleiniger Garant der privilegierten Stellung ließen keinen Zusammenhalt innerhalb des hohen Adels entstehen, womit horizontale Netzwerke nicht greifen konnten. Die Aristokratie suchte stets die Nähe der Autokratie und war bald nur noch in Moskau ansässig. Zwar gab es seit dem späten 16. Jahrhundert Ansätze von Reichstagen (russ. zemskij sobor) mit einigem Gewicht des Adels, doch diese Institution war eine kurzlebige Folge der Krisenjahre der smuta (> Glossar) 1598 bis 1620: Kaum war die Notstandssituation überwunden, verloren die Reichstage als ständisches Herrschaftsinstrument und adliges Gegengewicht zum Zarentum an Bedeutung und verschwanden schließlich. Entscheidend dazu beigetragen hatte der im Laufe des 16. Jahrhunderts neu geschaffene Dienstadel (russ. pomeščiki), der für zivile Aufgaben des größer werdenden Reiches und als militärisches Reservoir für die Expansionspolitik unabdingbar war. Erb- und Dienstadel wurden mit Steuerprivilegien und Landvergaben (pomest’e) auf Kosten der Bauern ausgestattet; denn die Geld-mittel für ein Söldnerheer waren nicht vorhanden. Anders als im westeuropäi-schen Absolutismus konnte das Zarentum nicht auf autonom gewachsene städ-tische Strukturen und deren Verwaltungspotenzial zurückgreifen. Der Dienstadel war die wichtigste Stütze des Thrones: Direkt vom Zaren ernannt, war er ganz auf die Autokratie ausgerichtet. Im 16. Jahrhundert setzten die Moskauer Herrscher schließlich auch durch, dass der Landbesitz auch bei den Bojaren prinzipiell der Dienstpflicht unterstellt wurde.
Teil B: Systematischer Teil
186
4.3 Grundlagen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vom - 15. bis zum 18. Jahrhundert • Die heutige Forschung ist sich grundsätzlich darin einig, dass sich nach
1500 das Tempo der Wirtschaftsentwicklung in Westeuropa beschleu-nigte und die Entwicklungsschere gegenüber Osteuropa größer wurde.
• Die Forschung spricht häufig von einer Zeit der Konvergenz der ost- und westeuropäischen Wirtschaftsentwicklung bis 1500 und einer Zeit der Divergenz nach 1500.
• Als sozioökonomische Grenzen werden die Elbe, die Saale, der Böh-merwald, die Leitha und der westliche Rand der pannonischen Tief-ebene genannt.
• Die wirtschaftliche Rückständigkeit Osteuropas gegenüber den westli-chen Produktionszentren wurde durch die engere Einbindung in das frühneuzeitliche Wirtschaftssystem Europas verstärkt.
• Müssen bis Ende des 15. Jahrhunderts hauptsächlich endogene Ursa-chen für die wirtschaftliche Entwicklung berücksichtigt werden, wur-den ab der frühen Neuzeit den Wechselbeziehung zwischen exogenen und endogenen Faktoren immer wichtiger.
4.3.1 Die sogenannte «Zweite Leibeigenschaft»
In ganz Osteuropa spielten weiterhin endogene Faktoren – niedrige Bevölke-rungsdichte, schwach ausgeprägte Verstädterung und die zunehmende Recht-losigkeit der Bauern gegenüber dem adligen Gutsherrn – eine wichtige Rolle. Doch im 16. Jahrhundert gerieten Ostmitteleuropa sowie die ostadriatische Küste unter den Einfluss der beschleunigt sich entwickelnden westeuropäi-schen Wirtschaft. Zu den endogenen Faktoren kam nun ein exogener Faktor hinzu: Aus dem ungleichen wirtschaftlichen Entwicklungstand in West- und Osteuropa ergab sich eine spezifische Arbeitsteilung, bei der Rohstoffe und Nahrungsmittel billig aus Osteuropa importiert wurden, während die Wirt-schaft im westlichen Europa sich auf den Export von gewerblichen Produk-ten und Luxuswaren spezialisierte. Der Werteverlust bei diesem ungleichen Waren- und Know-how-Transfer führte schließlich zu einer verzögerten proto-industriellen Entwicklung in Osteuropa. Exemplarisch für diese osteuropäi-sche Regression steht die Entwicklung der Agrarverfassung, die strukturbe-stimmend wurde. Die Krise der westeuropäischen Wirtschaft im 15. Jahrhundert und inflatio-näre Tendenzen durch das Einströmen amerikanischen Edelmetalls führten dazu, dass sich das Gewerbe, insbesondere die Tuchproduktion, auf die Fer-tigung von Massenware spezialisierte. Man setzte auf die Kaufkraft breiter
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
187
Massen. Osteuropa wurde als neuer Absatzmarkt für Fertigwaren und Kapi-talinvestitionen entdeckt. Gleichzeitig stieg in Westeuropa der Bedarf nach Agrarprodukten und Rohstoffen stark an. In Polen und im Ostseeraum, östlich der Elbe, waren die Transportbedingungen für Agrarprodukte und Rohstoffe durch die guten Wasserwege zur Ostsee hin günstig. Der niedrige Urbanisie-rungsgrad machte Überschussgetreide bei geringen Lohnkosten frei. Polen wurde zum Weizen-, Ungarn zum Fleischlieferanten für große Teile Westeu-ropas. Nutznießer dieser Entwicklung waren adlige Großgrundbesitzer. Der Adel, der Ende des 15. Jahrhunderts durch den fixierten Grundzins der zu «deutschem Recht» ansässigen Bauern immer weniger einnahm, förderte wieder den Agrarsektor. Da in Polen-Litauen und bis zur osmanischen Er-oberung 1526 auch in Ungarn die politische Macht der Landesherren und der Städte am Schwinden war, konnten die Adligen ungehindert ihre Hintersas-sen in die Erbuntertänigkeit (> Glossar) zwingen: Die Grundherren erlangten dabei obrigkeitliche Verfügungsrechte über die Bauern. Früher hatte die Krone die Bauern, die ihre Steuerzahler waren, vor dem Zugriff des Adels geschützt. In Polen-Litauen dominierte hingegen zunehmend der Adel das politische und wirtschaftliche Leben. Diese Elite umfasste knapp 10 % der Bevölkerung, was ihr im Vergleich mit Gesamteuropa, wo der Adel weniger als 1 % der Bevölkerung ausmachte, eine breite Machtbasis schuf. Mit gro-ßen regionalen Unterschieden wurde die Landwirtschaft im Interesse dieses Adelskreises auf billige bäuerliche Fronarbeit umgestellt, ohne aber die Zinswirtschaft völlig zu verdrängen. Mit dem 15. Jahrhundert versiegte der Strom der Siedler der Ostkolonisati-on. Zusammen mit der geringen Bevölkerungsdichte führte dies zu einem ständigen Arbeitskräftemangel. Der vorherrschende Adel benützte seine politischen Vorrechte, um den Abzug seiner Arbeitskräfte zu verhindern: Die Bauern wurden an die Scholle gebunden, und sie verloren ihre personen-rechtliche Freiheit. Die Grundherrschaft mit nur niederer Gerichtsbarkeit über die Bauern erreichte die Qualität einer Gutsherrschaft (> Glossar), weil der Besitzer sich beinahe unbegrenzte landesherrliche Vorrechte über seine Hintersassen aneignen konnte – ein Prozess, der im 16. Jahrhundert zum Abschluss kam. Die marxistische Historiografie sprach in diesem Zusam-menhang von der «zweiten Leibeigenschaft». Im atlantischen Europa hinge-gen hatten sich seit dem späten Mittelalter die Rechtsverhältnisse zu Gunsten der Bauern entwickelt. Kooperationsbewegungen der Bauern wie Landge-meinden und Genossenschaften bildeten ein Gegengewicht zum landbesit-zenden Adel. Eine Leibeigenschaft, die einen ganzen Komplex herrschaftli-cher Rechte wie Leib- und Grundherrschaft sowie Gerichtsbarkeit über eine Person umfasste, war nicht mehr durchzusetzen, das Prinzip der Leibherr-schaft ausgehöhlt.
Teil B: Systematischer Teil
188
Dank seiner dominanten wirtschaftlichen und politischen Stellung konnte der polnisch-litauische Adel mit Eigenhandel, Zollfreiheit und Zusammenar-beit mit ausländischen Kaufleuten die Städte wirtschaftlich marginalisieren. Die Gutsherren und Magnaten vertrieben die städtischen Zwischenhändler aus dem Getreidehandel und dem lukrativem Handel mit Importgütern; zu diesem Zweck engagierten sie meist jüdische Handelsvertreter. Gleichzeitig verfiel das heimische Gewerbe durch die Importe von Massenware aus dem Westen, durch die Verarmung der lokalen Konsumenten und das Fehlen von Rohstof-fen durch den intensiven Export. Ein eigentliches Manufakturwesen konnte sich in den Städten nicht herausbilden, da die Gutsherrschaften zu in sich geschlossenen Wirtschafts- und Herrschaftsbezirken wurden. Der ohnehin verarmte Bauer war gezwungen, Grundgüter und Gewerbeerzeugnisse auf dem Gutshof von seinem Grundherrn zu beziehen. Die Bauern fielen als Mas-senabnehmer von Gewerbeerzeugnissen der Stadt aus. So verloren die Städte ihre Bevölkerung an Kleinstädte, die dem Großadel gehörten und keine Orte besonderen Rechts waren: Eine urbane zentralörtliche und gewerblich überlo-kale Funktion nahmen diese agrarisch geprägten Kleinstädte nicht mehr wahr. Die Adligen reinvestierten den erzielten Gewinn nur marginal in die Produktivität und bezogen komplexe Gewerbegüter, insbesondere Luxuswa-ren, aus dem Ausland. Zum Teil entstanden auf den Magnatengütern Manu-fakturen, die sich ebenfalls auf die Arbeitskraft von Leibeigenen stützten und aufgrund fehlender Konkurrenz kaum gezwungen waren, ihre Produktivität zu verbessern. Ähnlich verlief die Entwicklung in Litauen und in einem geringeren Maß in Livland: Die starken schwedischen Könige vermochten hier das Bauerntum relativ gut zu schützen, und dank ihrem regen Handelsaustausch mit der Hanse (> Glossar) konnten die Städte vom Adel nicht ins wirtschaftliche Ab-seits verdrängt werden. Die Bauern blieben für die Städte eine wichtige Ab-nehmerschaft für Konsumgüter des Gewerbes, was den Wirtschaftskreislauf am Leben erhielt. Eine Reagrarisierung wie in Polen-Litauen blieb in Livland daher aus, obwohl der Anteil der Stadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung zurückging. In Ungarn und in Kroatien besaß der Adel eine ähnliche Vor-machtstellung wie in Polen-Litauen. Allerdings waren hier die Transportmög-lichkeiten von Massengütern nach Westeuropa weitaus begrenzter als im nörd-lichen Ostmitteleuropa, was zusammen mit den Folgen der osmanischen Ex-pansion das Phänomen der «zweiten Leibeigenschaft» für diese Gebiete weni-ger ausgeprägt gestaltete. Die häufig auch als «Refeudalisierung» bezeichnete Strukturveränderung in der Landwirtschaft hatte weitreichende Folgen für das ganze Wirtschaftsge-füge in Polen-Litauen und wenn auch nicht in diesem Ausmaß in Ungarn.
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
189
• Die adlige Gutsherrschaft förderte die Reagrarisierung und die wirt-schaftliche Marginalisierung der Städte als Zentren der gewerblichen Produktion und Knotenpunkte des Handels. Der Adel und seine «Han-delsbeauftragten» schalteten die Stadt als Träger des Handels und des Gewerbes aus. Durch den allgemeinen Bedeutungsverlust entglitt den Städten die Kontrolle über ihr natürliches Hinterland. Somit verloren sie das Potenzial für eine demografische Erneuerung, was sinkende Bevölkerungszahlen zu Folge hatte; bis ins 18. Jahrhundert hinein konnten die Städte nur durch Zusiedlung von außen wachsen bzw. ihre Bevölkerungszahl halten. Die meisten Städte – bis auf einige Aus-nahmen wie die Handelszentren Danzig, Vilnius, Reval und Riga – verloren an Bedeutung. Die Voraussetzungen für das Entstehen eines Bürgertums waren damit ungünstig.
• Die Fronarbeit drängte die Geldrente, die sich im Spätmittealter in Ost-mitteleuropa bereits durchgesetzt hatte, wieder zurück. Dies hemmte das Aufkommen einer breiten Geldwirtschaft, was die Kapitalbildung behinderte. So ist in Osteuropa der Mangel an Kapital am Vorabend der industriellen Revolution eine vorherrschende Strukturschwäche. Die neueste Forschung zeichnet allerdings ein differenzierteres Bild, in-wieweit sich die Fronarbeit wirklich ausbreiten konnte. So ist davon auszugehen, dass in Westpolen die Fronarbeit weitaus weniger sich hat durchsetzen können als in Ostpolen, wo große Gutsgüter das Bild bestimmten.
• Da der Bauer an die Scholle gebunden war, konnte sich kein flexibler Arbeitsmarkt zwischen Stadt und Land entwickeln. Im 17. und 18. Jahrhundert fehlten diese Arbeitskräfte für den Aufbau einer protoin-dustriellen Wirtschaft. Die wirtschaftliche Macht des Adels stieg, da er über die Netzwerke und die Arbeitsressourcen verfügte. Anders als zum Beispiel in England investierte der Adel aufgrund seines konser-vativ-traditionellen Wirtschaftsverhaltens – er sah sich hauptsächlich als rentier de sol – nur sehr zögerlich in Manufakturen oder in den Handel. Es fehlten entsprechende Vorbilder aus dem Bürgertum wie auch der wirtschaftliche Druck der Städte.
• Die adlige Gutswirtschaft (> Glossar Gutsherrschaft) sah sich auf-grund der politischen Monopolstellung des Adels keiner Konkurrenz ausgesetzt, neue Erwerbsfelder erschließen zu müssen. Niedrige Ar-beitsproduktivität und extensives Wirtschaften – insbesondere in der Landwirtschaft, aber auch in den einfachen Manufakturen der Guts-herren – schufen ungünstige Startbedingungen für Ostmittel- und Nordosteuropa, als es in die Modernisierungs- und Industrialisie-rungsphase des 19. Jahrhunderts eintrat.
Teil B: Systematischer Teil
190
• Im frühen 18. Jahrhundert begann die westliche Nachfrage nach Ge-treide und Rohstoffen abzunehmen, da sie allmählich durch die eigene Produktivitätssteigerung gedeckt wurde. Zudem waren die Böden durch Monokulturen und das Fehlen von Düngetechniken erschöpft, das Land durch den Nordischen Krieg arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Beides führte zu sinkenden Einnahmen. Der Gutsadel begeg-nete dieser Entwicklung mit der Erhöhung der Abgabeleistungen mit dem Resultat, dass der Herrschaftsdruck statt wirtschaftliche Innovati-on den Niedergang beschleunigten.
4.3.2 Die protoindustrielle Periode in Böhmen, Russland und im Osmanischen Reich
Böhmen Durch ihre Nähe zu westeuropäischen Kerngebieten zeigen Böhmen und zum Teil auch Mähren in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung ihr charakteris-tisches Doppelgesicht als Übergangszone zwischen Ost und West. Auch hier versuchte der Adel im Spätmittelalter dank seiner politischen Dominanz, gutsherrschaftliche Strukturen durchzusetzen, doch der hohe Urbanisierungs-grad und die daraus resultierende breite Konsumentenschicht machten den Binnenmarkt für eine eigene Veredelungswirtschaft von Nahrungsmitteln und gewerblichen Erzeugnissen attraktiv – vor allem für Bierbrauerei und Teich-wirtschaft. Die städtischen Handelsnetze und ein funktionierender Geldumlauf verhinderten, dass der Adel die Wirtschaft an sich riss und einseitig als Guts-wirtschaft monopolisierte. Der Adel selbst spielte bei dieser Entwicklung eine Vorreiterrolle, indem er dazu überging, seine landwirtschaftlichen Produkte zu verarbeiten. Der Typus Fronarbeit konnte sich gegenüber der Lohnarbeit nicht durchsetzen, da die Städte den entlaufenen Bauern ein Auskommen und Schutz vor dem Adel anbieten konnten. Erst im späten 17. Jahrhundert ent-wickelte sich die Leibeigenschaft in Böhmen ausgeprägter, erreichte aber mit zwei bis drei Tagen Fronarbeit pro Woche nie ein solches Ausmaß wie in Polen-Litauen oder Russland, wo neben dem Ackerfron, der Geldzins und vor allem zusätzliche Arbeitsleistungen (Fuhr- und Baudienste) auf den Gutsbauern lasteten. Diese gewerbliche Entwicklung verlief so intensiv, dass Böhmen, Mähren und auch Schlesien gegenüber den östlichen Nachbarländern als Exporteure von Endgütern auftraten. Der Adel reinvestierte zunehmend Kapital in den Aufbau eines umfangreichen Manufakturwesens. Günstige Absatzmöglich-keiten innerhalb der Donaumonarchie bzw. Richtung Preußisch-Polen und die Erschließung eigener Rohstoffvorkommen – man denke an den Erzabbau
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
191
in Böhmen – boten günstige Ausgangsbedingungen für eine beschleunigte Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Russland In Russland vollzog sich der Wandel zur Gutswirtschaft mit einer ausgepräg-ten Leibeigenschaft, allerdings aus anderen Gründen als in Polen-Litauen und Ungarn. Die zarische Autokratie begünstigte das Absinken der Bauern in die Leibeigenschaft, da sie den Dienstadel für ihre ambitiöse Expansions-politik und die herrschaftliche Durchdringung des flachen Landes benötigte. Die Städte und die direkt besteuerten freien Stadtbewohner gerieten in den Sog immer höherer Steuerabgaben. Die Flucht in den unfreien Status unter dem Schutz eines geistlichen oder adligen Gutsherrn – in der Stadt oder auf dem Land – schien der einzige Ausweg, da man als Unfreier keine Steuern mehr zu entrichten hatte. Durch die Umverteilung des Steuerausfalls stieg der Druck auf die freie Stadtbevölkerung weiter an. Die katastrophalen Fol-gen des Livländischen Krieges (1558–1583), der Terror während der Herr-schaft Ivans IV. (russ. opričnina > Glossar) und die Thronwirren zu Beginn des 17. Jahrhunderts (vgl. Moskauer Reich, S. 238) verstärkten diese Ten-denz. Hinzu kam die vor allem aufgrund der Truppenversorgung steigende Binnennachfrage nach Weizen: Der Preis für Weizen stieg markant an, was die allgemeine schwere Wirtschaftskrise in der zweiten Hälfte des 16. Jahr-hunderts weiter verschlimmerte. Verheerend sollte sich auswirken, dass die Eroberung der Tatarenkhanate am Wolgalauf und in Westsibirien die Weiten des Schwarzerdegürtels für Läuflinge (geflüchtete an die Scholle gebundene Bauern) und Neusiedler öffnete. Zusammen mit den Folgen der Smuta führte dies zu großen Wüs-tungserscheinungen (1560–1630) in den bisherigen Kerngebieten Russlands, die stellenweise bis zu 90 % und durchschnittlich die Hälfte der Höfe erfass-ten. Die Expansion in den Osten und Südosten dünnte die ohnehin begrenz-ten Arbeitskräfte aus, was die Entwicklung der Leibeigenschaft beschleunig-te. Wurde das Abzugsrecht des Bauern seit Mitte des 16. Jahrhunderts immer weiter eingeschränkt, war er Mitte des 17. Jahrhunderts endgültig an die Scholle gebunden. Die letzten freien Bauern sanken aufgrund des steigenden Steuerdrucks in die Leibeigenschaft ab. Die Autokratie kontrollierte als Monopolistin zusammen mit westeuropäi-schen Kaufleuten den Handel. Modernisierungsschübe im Gewerbe und später im Manufakturwesen wurden von der Autokratie initiiert, vom Adel getragen und betrafen hauptsächlich die Rüstungsindustrie – mit einigem Erfolg: Ende des 18. Jahrhunderts war Russland der größte Eisenerzeuger Europas. Die großen Anstrengungen vor allem Peters des Großen, Russland nach europäischem Vorbild zu modernisieren und die Wirtschaft anzukur-
Teil B: Systematischer Teil
192
beln, waren vom Willen geprägt, sich mit den westlichen Mächten militä-risch messen zu können; ein revolutionärer Schritt Richtung Protoindustriali-sierung lässt sich darin nicht erkennen. Es fehlte an Spezialisten und an einer gewerblich ausgebildeten Arbeiterschaft, die Erfahrung in der Produktion von Gütern hätte sammeln können – wie jene, die in Europa im Verlagswe-sen bereits tätig war. Russlands erste Schritte hin zu einer gewerblichen Mo-dernisierung stützten sich auf eine fortschreitende Leibeigenschaft. Den Städten fehlte weiterhin eine kommunale Physiognomie. Abgesehen von der Militärindustrie, die hauptsächlich auf der Eisengewinnung in den neu er-schlossenen Gebieten des Urals beruhte, und der Produktion von Brandtwein und Tuchware, lässt sich bis weit ins 19. Jahrhundert keine industrielle Re-volution feststellen. Eine freie Wirtschaft konnte sich unter den Bedingungen der Autokratie nicht entfalten – die Forschung sprach in diesem Zusammenhang von einer «staatsbedingten Gesellschaft» (vgl. Staat und Gesellschaft, S. 265). Der Verwaltungsapparat wurde schon im 17. Jahrhundert mit seiner Schwerfällig-keit den Bedürfnissen des russischen Reiches und seiner Wirtschaft nicht mehr gerecht. Die auf politische Privilegien gestützte wirtschaftliche Vormacht der Geistlichkeit, des Adels und deren hauptsächlich auf die Erhaltung des Agrar-charakters der Gesellschaft ausgerichtete Interessen blockierten ökonomische Initiativen anderer Bevölkerungsteile. Russlands Gesellschaftsordnung be-stand aus zwei Schichten. Die erste setzte sich aus der Geistlichkeit und dem dienstpflichtigen Adel zusammen und war abgabefrei. Alle anderen freien Gemeinen, die sogenannten schwarzen Bauern, die Stadtbewohner, die Handwerker und die Händler, stellten das Gros der steuerpflichtigen Bevöl-kerung. Der lokale Kaufmann gehörte ebenfalls zur Stadtgemeinde, besaß keinerlei Privilegien und bildete keinen in sich abgeschlossenen geschützten Stand, der seine wirtschaftlichen Interessen politisch hätte vertreten können; denn jeder Bauer oder Handwerker durfte ebenfalls Handel treiben. Die Grenzen zwischen Bauer, Handwerker und Kleinkaufmann oder Händler verliefen fließend. Anders verhielt es sich bei der dünnen Schicht von Fern- und Großkaufleu-ten. Zwar konnten sie aus ihrer privilegierten Stellung einigen materiellen Nutzen ziehen, gleichzeitig waren sie aber der Autokratie und dem Adel ausgeliefert. Die Willkür der Bürokratie und der Rechtsprechung sorgten dafür, dass kaum eine reich gewordene Kaufmannsfamilie ihr Kapital und ihr Handelsnetzwerk über mehr als drei Generationen erhalten konnte. Fami-lien wie die Kaufmannsdynastie der Datini in Italien oder später die Fugger in Deutschland waren in Russland undenkbar – reiche russische Kaufmanns-familien wie die Demidovs oder Stroganovs, die bald in die Adelsränge auf-stiegen, waren Ausnahmen. Die russischen Großkaufleute wurden in obrig-keitlich kontrollierte Gilden gezwungen, wo sie ihre Kenntnis über kommer-
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
193
zielle Geschäftsmethoden dem Zaren zur Verfügung stellen mussten. Dabei hafteten sie bei der Bewältigung der fiskalischen und administrativen Auf-gaben mit ihrem Privatvermögen. Zwar erhielten sie dafür Steuerprivilegien und waren anders als die städtische Bevölkerung von der Lastenpflichtigkeit befreit, in Tat und Wahrheit war aber auch diese dünne protokapitalistische Schicht vom Dienst für den Zaren abhängig. Die zeitraubende Einbindung in den Dienst und staatliche Konfiskationen ruinierten nicht wenige Großkauf-leute oder zwangen sie, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Das Fehlen großer Kapitalanhäufungen ließ dem erfolgreichen Kaufmann keine Möglichkeit, ins Lagergeschäft, ins Bankenwesen oder ins Exportge-werbe zu investieren. Hinzu kam die Konkurrenz der überlegenen Manufak-turwaren aus Westeuropa und China. Der Pelzhandel war mehr oder weniger die einzige gewinnbringende Wirtschaftssparte Russlands. Zusätzlich fehlte eine protektionistische Handelspolitik, da der Zar von Importen und auslän-dischen Kaufleuten abhängig war. Ein aktiver Außenhandel wurde dadurch erschwert; dieses lukrative Geschäft blieb von westeuropäischen später auch von chinesischen Kaufleuten beherrscht. Der russische Binnenmarkt stützte sich nach wie vor auf einen begrenzten Tauschhandel. Die Leibeigenschaft ließ weder bei den Bauern noch bei der städtischen Bevölkerung die Entste-hung einer breiten und kaufkräftigen Konsumentenschicht zu, da eine marktorientierte Produktion nach wie vor die Ausnahme und nicht die Regel war. So konnte sich auch keine feste Ware-Geld-Beziehung entwickeln, was eine Umstellung der Arbeitsbeziehungen auf Lohbasis erschwerte. Zwar reagierten die Zaren nach 1700 auf die allmähliche Einbindung Russ-lands in die sich herausbildende Weltwirtschaft. Diese Bemühungen waren jedoch von oben initiiert und eher ein Reagieren als ein aktives wirtschaftli-ches Agieren. Nichtadligen war der Erwerb von Leibeigenen für den Aufbau arbeitsintensiver Manufakturen verboten: Nach dem Tod Peters des Großen war dieses Vorrecht de iure wieder allein dem Adel vorbehalten, nachdem es kurzzeitig gelockert worden war. Alle diese Faktoren erwiesen sich als ge-wichtige Strukturmängel, die an der Wende ins 19. Jahrhundert eine be-schleunigte Entwicklung hemmten. Zusammenfassend lässt sich für Russland feststellen, dass die Expansion des Reiches wirtschaftlich und administrativ die Kräfte überspannte und durch überhöhte Steuern die Kapitalbildung verhinderte. Die späte Erschließung von Edelmetallvorkommen kam hinzu. Statt einer Binnenkolonialisierung, wie sie im 16. und 17. Jahrhundert in weiten Teilen Europas stattfand, ver-schärfte sich der Arbeitskräftemangel durch das Läuflingswesen und das koloniale Ausgreifen in dünn besiedelte Räume bis über den Ural hinaus. Statt intensiver nahmen extensive Wirtschaftsformen zu. Expansion, unpro-
Teil B: Systematischer Teil
194
duktive Wirtschaftsweisen sowie Arbeitskräfte- und Kapitalmangel blieben ein Grundproblem der russischen Wirtschaft um 1800. Das Osmanische Reich Zog die osmanische Eroberung im 15. und frühen 16. Jahrhundert vorerst längere Wüstungsperioden nach sich, führte die Machtkonsolidierung der Hohen Pforte (> Glossar) im späten 16. Jahrhundert zu einem wirtschaftli-chen Aufschwung. Dieser lässt sich auf Bodenreformen, die Entmachtung traditioneller Großgrundherren, die pax ottomanica und die permanente mili-tärische Expansion zurückführen. Die Städte prosperierten als regionale Verwaltungs- und Wirtschaftszentren einer zentralistischen Herrschaftsord-nung. Die Produktivität der Landwirtschaft blieb aber durch die vorherr-schende Subsistenzwirtschaft und Naturalwirtschaft gering. Im beginnenden 17. Jahrhundert offenbarten sich die wirtschaftlichen Struk-turschwächen im Osmanischen Reich. Die neuen Handelswege auf dem At-lantik und dem Indischen Ozean peripherisierten das Mittelmeer. Das Osma-nische Reich überspannte seine wirtschaftlichen Möglichkeiten durch ständige militärische Expansion, ohne dass wie früher die Kriegsbeute oder nennens-werte Landgewinne die Ausgaben hätten kompensieren können. Das erfolgrei-che Timâr-System mit nicht vererbbaren Dienstgütern wurde nach 1600 zu-nehmend vom Çiftlik-System ersetzt. Die nun vererbbaren grundherrlichen Güter der Sipahi (Angehörige der schweren osmanischen Reiterei) prägten das Bild auf dem Land, ohne jedoch die grundherrliche Qualität wie im nördlichen Ostmitteleuropa oder Russland zu erreichen. In den peripheren Gebieten des Osmanischen Reiches konnten sich grundherrliche Merkmale aufgrund der labilen Macht des Adels noch weniger durchsetzen. Der steigende staatliche Abgabendruck ließ die Bauernschaft verarmen, womit die ehemals relativ breite Konsumentenschicht für die gewerblichen Güter der Städte wegfiel. Als die Staatskontrolle und die Verwaltung wegen Korruption und Machtzuwachs lokaler Machtträger allmählich zerfielen, wirkte sich die rigide Kontrolle des Staates über das Gewerbe und den Han-del verheerend aus. Das Fehlen einer städtischen Selbstverwaltung verhin-derte das Aufkommen einer eigenen Gewerbe- und Kaufmannselite. Ein eigentlicher «dritter Stand» konnte sich nicht ausbilden, was an der Schwelle zum industriellen Zeitalter eine unüberwindbare Entwicklungsbremse dar-stellte. Die eigene gewerbliche Produktion zeigte sich gegenüber den Im-portwaren aus Westeuropa immer weniger konkurrenzfähig. Im europäi-schen Handelsnetzwerk wurde das Osmanische Reich zum Rohstoffexpor-teur zurückgestuft, der seinerseits Gewerbe- aber vor allem Luxusgüter im-portierte. Allerdings war dieser Austausch gering; man darf eher von einer Isolierung der osmanischen Wirtschaft ausgehen. Eine nicht geringe Rolle
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
195
für das Zurückbleiben des Osmanischen Reiches spielte auch die Scharia (islamische Gesetzordnung) in ihrer Funktion als wichtigstes Gesetzbuch, da sie die Organisation von modernen Kapital-, Bank- und Versicherungsge-sellschaften sowie die Übergabe von Kapitalien von einer Generation auf die andere erschwerte respektive verunmöglichte.
4.4 Grundlagen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von 1800 bis zur sozialistischen Revolution 1917/1945 Die Schwierigkeiten der Regionen Osteuropas, wirtschaftlich an der indus-triellen Revolution von 1800 bis 1939 teilzuhaben, lassen sich durch folgen-de Grundprobleme charakterisieren. • In Russland schränkte die autoritäre Staatsform – die Forschung
spricht von einer «staatsbedingten Gesellschaft» – unternehmerische und modernisierende Initiativen von unten ein, um das traditionelle Gesellschaftsgefüge zu konservieren. Die Lockerung des staatlichen Dirigismus erfolgte zu spät und zu zaghaft, um wirtschaftlichen Spiel-raum für die Bauern wie auch alle anderen Bevölkerungsschichten zur Verfügung zu stellen. Impulse von oben verfolgten eher strategische Interessen, als dass sie eine forcierte Modernisierung der Gesellschaft bezweckt hätten. Erfolgreiche Ansätze, um aus dieser sozioökonomi-schen Sackgasse herauszufinden, wurden durch den Ersten Weltkrieg zu früh unterbrochen.
• Mit Ausnahme Böhmens und Schlesiens fehlte in den meisten Gebie-ten eine protoindustrielle Basis. Die Erblast der Leibeigenschaft und der Großgrundbesitz hatten die Entstehung einer freien und mobilen Bauernschicht verhindert.
• Die Befreiung der bäuerlichen Bevölkerung von der Leibeigenschaft und die Möglichkeit, grundherrliches Land zu erwerben, waren kaum von stützenden Maßnahmen des Staates begleitet. Hohe Ablösungs-zahlungen an den Grundherren, das Fehlen von günstigem Kapital sowie die durch Erbteilungen und Bevölkerungsexplosion fortschrei-tende Parzellenzersplitterung ließen weite Teile der bäuerlichen Be-völkerung im Laufe des 19. Jahrhunderts verarmen.
• In den meisten Regionen explodierten die Bevölkerungszahlen, ohne dass das Wachstum durch die verzögerte Industrialisierung oder einen Produktivitätssprung in der Agrarwirtschaft aufgefangen worden wäre. Dadurch sank das Pro-Kopf-Einkommen, und das Fehlen eines Bin-nenkonsums erschwerte eine endogen getragene Industrialisierung.
• Agrarreformen kamen zu spät und scheiterten am Widerstand der Eli-ten wie auch am chronischen Kapitalmangel. Soziopolitische Überle-
Teil B: Systematischer Teil
196
gungen zwecks Sicherung der sozialen Ordnung hatten in der Regel Vorrang gegenüber sozioökonomischen Erfordernissen.
• Die unternehmerisch tätige Bevölkerungsschicht war oft schmal und konnte sich gegen die herrschenden Traditionalisten nur bedingt poli-tische Mitspracherechte erkämpfen.
• Die Herauslösung aus den Vielvölkerreichen zerstörte bestehende Märkte und Handelsnetzwerke. Die jungen Nationalökonomien sahen sich vor die Herausforderung gestellt, eine forcierte Industrialisierung voranzutreiben und sich gleichzeitig auf neue Märkte auszurichten.
• Die Kosten der Eigenstaatlichkeit, überhöhte Militärbudgets und auf-geblähte Verwaltungsstrukturen überforderten die Kapitalmöglichkei-ten der Staaten.
• Die Staaten waren überdurchschnittlich vom ausländischen Kapitalzu-fluss abhängig, was ihre Nationalökonomien im Bezug auf Zollbe-stimmungen wenig Spielraum ließ.
• Die Weltwirtschaftskrise nach 1929 traf die Staaten in Ostmittel-, und Südosteuropa in der Aufbauphase. Ihre hohe Abhängigkeit von Roh-stoff- und Nahrungsmittelexporten wie auch der mangelnde Binnen-konsum machten die jungen Ökonomien besonders krisenanfällig.
4.4.1 Die industrielle Revolution und ihre Grundlagen
Der Durchbruch der Industrialisierung in England und kurz darauf in den Kerngebieten des atlantischen Europas beschleunigte die Entwicklung im kommerziellen, landwirtschaftlichen und industriellen Bereich. Die bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln, eine allgemeine Klimaerwärmung seit 1700 und der medizinische Fortschritt führten zu einem bis dahin unbekann-ten Bevölkerungswachstum. Wohnten in Europa um 1700 etwa 120 Millio-nen Menschen, waren es 1914 bereits 450 Millionen. Die Bevölkerung Großbritanniens hatte sich mehr als vervierfacht, jene Russlands mehr als verdreifacht, von rund 45 auf über 150 Millionen Menschen. Während der industriellen Revolution konnte durch den Arbeitssog der Städte die Überbe-völkerung auf dem Land abgebaut werden, was den Urbanisierungsgrad steil ansteigen ließ. Was früher in eine Massenverelendung geführt hätte, brachte im 19. Jahrhundert ein steigendes Pro-Kopf-Einkommen. Dank Bevölke-rungsdichte, technischer Revolution und idealen Verhältnissen hatte die Pro-duktivität einen Anstieg des Sozialproduktes bewirkt, der die Bevölkerungs-zunahme überflügelte – ein Phänomen, das in Osteuropa aber größtenteils ausblieb. Der Motor dieser Entwicklung war seit dem 18. Jahrhundert die Landwirt-schaft: Durch den Wechsel von der Dreifelderwirtschaft zur Fruchtwechsel-
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
197
wirtschaft, den Kunstdüngereinsatz und den Einsatz neuer Maschinen, vor allem schwerere und größere Pflüge aus Eisen, konnten die Erträge massiv gesteigert werden. Diese Revolution der Agrartechnologie war es, welche die Massenproduktion von Eisen ankurbelte und den Weg ins Jahrhundert der Hochöfen ebnete. Das andere Standbein in der Frühphase der industriellen Revolution war die Produktion von Baumwolltuch. Auch diese wurde erst dadurch ermöglicht, dass die Landwirtschaft in den Kolonien den rasant stei-genden Bedarf nach Baumwolle befriedigen konnte. Die Agrarrevolution eb-nete den Weg zur industriellen Revolution, und bis Ende des 19. Jahrhunderts standen beide in einem engen Abhängigkeitsverhältnis. Kann für England – den Vorreiter der industriellen Revolution – bereits im 17. Jahrhundert von einer Agrarrevolution gesprochen werden, setzte diese in Russland allmählich erst Ende des 19. Jahrhunderts ein. In Südosteuropa war sie selbst in der Zwi-schenkriegszeit des 20. Jahrhunderts kaum auszumachen. In den westeuropäischen Ländern konnte das flache Land nach der Agrarre-volution aufgrund der höheren Produktivität das Gros der nötigen Arbeitskräf-te stellen. Selbst viele Unternehmer rekrutierten sich aus reicheren bäuerlich-ländlichen Kreisen, die das angesammelte Wissen aus der protoindustriellen Hausproduktion in die industrielle Massenproduktion überführten. So trugen in den Vorreiterländern der Adel, die urbane «bürgerliche» Bevölkerung, Handwerker und Kaufleute, sowie die Großbauern durch die enge wirtschaftli-che Verzahnung aller Bevölkerungsschichten entscheidend zur «Revolution» bei. Flexible Kapitalanhäufungen, leistungsfähige Bürokratien und ein hoher und breiter Bildungsstand vervollständigen die Reihe der Voraussetzungen. Diese sozioökonomischen Kennzeichen bilden eine wichtige Vergleichsfolie für das Verständnis der Wirtschaftsentwicklung in Osteuropa. Im Gesamteuropa des 19. Jahrhunderts lassen sich zwei Modernisierungs-szenarien greifen. Zum einen erfasste die industrielle Revolution um die Mitte des Jahrhunderts auch peripher gelegene Teile des atlantischen Euro-pas. Gute Beispiele dafür sind die skandinavischen Länder, die durch eine nachholende beschleunigte Modernisierung den Abstand zu den Kerngebie-ten wettmachen konnten. Durch die Konzentrierung der Gutshöfe gelang hier eine Leistungssteigerung der Agrarsektors, was den Warenkreislauf zwischen Stadt und Land sicherte und in einer Binnenmarkterschließung mündete; gestützt auf diese und dank großer Fortschritte im Bildungswesen anfangs des 19. Jahrhunderts setzte eine industrielle Entwicklung ein. Zum anderen gerieten die Länder an der östlichen und südöstlichen Peripherie des atlantischen Europas, wo die industrielle Revolution ausblieb, noch weiter ins wirtschaftliche Hintertreffen. Mehr denn je seit der Herausbildung einer Weltwirtschaft im 16. Jahrhundert erfasste das Tempo des neuen Wirtschaf-tens das ökonomische Gefüge dieser Länder. Die Dependenz verschärfte sich und damit die Herabstufung vieler osteuropäischer Länder zu reinen
Teil B: Systematischer Teil
198
Rohstofflieferanten und Abnehmern von Endgütern. Viele Nationalstaaten fanden erst im Laufe dieser Epoche ihren Weg aus den Vielvölkerreichen zu ihrer Eigenstaatlichkeit. Die finanziellen Kosten der eigenen Staatlichkeit und die sozialpolitischen Altlasten der Vielvölkerreiche im Bereich zögerli-cher Agrarreformen stellten eine Doppelbelastung dar, die eine nachholende Modernisierung erschwerte.
4.4.2 Russland
In Russland blieb der Adel die staatstragende Klasse, für die der Gutsbesitz bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts die Existenzbasis bildete. Auch nach der allgemeinen Befreiung von der Dienstpflicht 1762 gab der Adlige sein Leben als rentier de sol nicht auf. Nur die angesichts fallender Nahrungs-mittelpreise auf dem internationalen Markt sinkenden Einnahmen aus der Landwirtschaft und die steigenden Kosten für den verwestlichten Lebensstil ließen ihn neue Einkommensquellen suchen. Dank seiner Stellung und der Fürsorge des Zarentums, das ihn mit Privilegien und Monopolen ausgestattet hatte, verdrängte der Adel in der Folge seine größten Konkurrenten – Kauf-leute und Manufakturunternehmer – aus den lukrativsten Märkten. Bald kon-trollierte er die kommerzielle Alkoholherstellung, das ertragreichste Ge-schäft der protoindustriellen Zeit. Er verhinderte Nichtadligen den Erwerb von Leibeigenen und setzte seine leibeigenen Bauern als Händler ein, was den Handlungsspielraum der nichtadligen freien Kaufleute einschränkte. Der Adel investierte nur dort, wo ihm der Zar geschützte Wirtschaftsfelder zur Verfügung stellte. So wurde er trotz günstiger Voraussetzungen nie der Mo-tor der industriellen Revolution. Die wirtschaftliche Passivität des Staates und des Adels verursachte die wirtschaftliche Trägheit in den Anfängen der industriellen Revolution. Auch wenn nach der Aufhebung der Leibeigenschaft 1861 mehr Adlige in Handel und Industrie investierten, blieben sie in ihrem Denken konservativ und wenig wirtschaftlich orientiert. Der Topos des phlegmatischen, hilflos untätigen, aber höchst gebildeten Adligen ist in der zeitgenössischen russischen Literatur öfters anzutreffen – wohl am eindrück-lichsten in Gončarovs Roman «Oblomov». In Čechovs Drama «Der Kirsch-garten» ist nachzulesen, wie der Adel sich im 19. Jahrhundert zusehends genötigt sah, seine überschuldeten Ländereien an eine neue Industriellen-schicht zu verkaufen. Allerdings muss das Klischee vom wirtschaftlich trä-gen Adligen differenziert werden: Auch innerhalb des Adels fanden sich durchaus tatkräftige Unternehmer. Dank der Initiative Peters des Großen war Russland noch Anfangs des 19. Jahrhunderts rein quantitativ gesehen eine der fünf großen Industrienati-onen in Europa; nur war die Produktion auf den Staat als Hauptabnehmer und nicht auf eine breite Konsumentenschicht ausgerichtet. Im Vergleich zur
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
199
beschleunigten Industrialisierung in den Vorreiterstaaten Westeuropas war die Periode von 1800–1860 eine Zeit verhältnismäßiger Stagnation. Zwi-schen 1860 und 1913 folgte ein außerordentliches Wirtschaftswachstum. Bereits vor der Abschaffung der Leibeigenschaft 1861 ließ die rapid zuneh-mende Bevölkerung die Konsumgüterproduktion, insbesondere die Zucker- und Textilproduktion, anziehen. In der Baumwollindustrie machte sich früh ein technischer Fortschritt bemerkbar. Träger dieser Entwicklung waren Aus-länder und Leibeigene-Unternehmer im Auftrag ihrer adligen Herren. So wur-den besonders fähige und gut ausgebildete Leibeigene von ihren Herren mit der Führung der Geschäfte beauftragt. Mit ihrem Wissen und ihren wirt-schaftlichen Verbindungen gelangten einzelne zu Vermögen, das es ihnen ermöglichte, sich aus der Leibeigenschaft freizukaufen. Eine besondere Stel-lung ist den Altgläubigen (vgl. Altgläubige, S. 110) einzuräumen, die durch ihre Kapitalstärke und Vernetzung die erste bedeutende Schicht von indus-triellen Unternehmern im 19. Jahrhundert bildeten. Die Initialzündung für das rasante Wachstum nach 1861 und 1880 ging ein-mal mehr vom Staat aus, dem die Katastrophe des Krimkriegs (1853–1856) die technologische Rückständigkeit Russlands deutlich vor Augen geführt hatte. Zollprotektionismus und gezielte Förderung der Industrien sollten die Bedürfnisse des Staates in den Bereichen Eisenbahn, Transport und Militärwe-sen decken. Federführend dabei war der Finanzminister Sergej Jul’evič Vitte (1849–1915). Die Initiative von oben verschob die Schwerpunkte der Indust-rialisierung weiter von der Konsumgüterproduktion zur Schwerindustrie. Kohlebergbau, Stahlgewinnung und die Maschinenindustrie im Transport-wesen wuchsen rasant. Der außerordentlich große Kapitalbedarf wurde im Ausland gedeckt, womit die Verschuldung und die Abhängigkeit vom Aus-land wuchsen. Immerhin konnten Finanzinstitute und Versicherungsgesell-schaften – 1860 wurde die Staatsbank gegründet – Fuß fassen. Aber auch hier war der Staat der Motor der Entwicklung, da Privatiers, Unternehmer und Banken wirtschaftlich nicht in der Lage waren, den Kapitalbedarf zu decken. In Russland konnte nur der Absatz landwirtschaftlicher Produkte auf dem Weltmarkt die Industrialisierung finanzieren. Die Angst der Autokratie und des Adels vor wirtschaftlichen und sozialen Reformen führte zu einer sozialökonomischen «Gleichzeitigkeit des Un-gleichzeitigen»: Mittelalterliche Dorfstrukturen und Leibeigenschaft existier-ten gleichzeitig neben den Bemühungen, das Land – vor allem in den Städ-ten – so schnell wie möglich in die industrielle Moderne nach westeuropäi-schem Vorbild zu überführen. Immerhin gewährleistete die Stadtreform von 1870 die Grundlagen für eine moderne Stadtentwicklung: Der Selbstverwal-tung der Städte wurden mehr Freiheiten eingeräumt, und das starre Gerüst einer berufsständischen Ordnung, die während der Reformen im 18. Jahr-hunderts eingeführt worden war, wurde gelockert, was eine sozioökonomi-
Teil B: Systematischer Teil
200
sche Bevölkerungsverschiebung vom Land in die Stadt ermöglichte. Eine relativ rasche, von oben initiierte und mit hohem Wirtschaftswachstum ein-her gehende Industrialisierung war jedoch von Rückschritten in der Landwirt-schaft begleitet und geschah auf Kosten der bäuerlichen und einfachen Bevöl-kerung, die mit einem im westeuropäischen Vergleich nur langsam steigenden Lebensstandard für den zumeist urbanen Fortschritt aufzukommen hatte. Die landwirtschaftliche Produktivität nahm in Russland zwischen 1840 und 1900 um 30 % zu, im Habsburgerreich waren es 45 %, in Schweden 75 %, in der Schweiz 90 % und in Deutschland gar 190 %. Trotzdem waren noch 1914 80 % der russischen Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Da der Produktionssprung in der russischen Landwirtschaft ausblieb, wurde das steigende Bruttosozialprodukt durch das im europäischen Vergleich über-proportionale Bevölkerungswachstum wieder mehr als wettgemacht – ein Phänomen, dem wir im Südosteuropa noch einmal begegnen werden. Die Abwanderung in die Industrie blieb zu schwach, um die Überbesetzung im Agrarsektor abzubauen. Bis 1914 konnte die Masse der Bauern für Konsum-güter nur eine bescheidene Kaufkraft entwickeln. Der Produzent von Konsum- und Industriegütern sah sich gezwungen, seine nicht staatlichen Absatzmärkte im westlichen Ausland zu suchen, wo seine Güter nur beschränkt konkurrenz-fähig waren. So waren dem Binnenkapitalmarkt enge Grenzen gesetzt. Die Bauernbefreiung von 1861 war schließlich nicht, wie es zunächst er-scheinen mag, eine Maßnahme zur Belebung der Landwirtschaft; vielmehr hatte sie zum Ziel, einer Revolution von unten durch eine Evolution von oben zuvorzukommen. Allerdings war das zarische Regime nicht bereit, das sozioökonomische Gefüge soweit zu verändern, dass seine Grundlagen ge-fährdet gewesen wären. Hohe Ablösungszahlungen an den Grundherren und beträchtliche Gütersteuern belasteten die Bauern; sie waren in der Regel weit davon entfernt, in technischen Fortschritt investieren zu können. Zudem wurden nicht einzelne Bauern Besitzer des Landes, sondern die Dorfgemein-schaft (mir), die das Land nach Familiengröße verteilte – eine Maßnahme des Staates, um die Macht- und Steuerhoheit über die neuen Freiheiten der Bauern mittels kollektiver Haftung sicherzustellen. Die gemeinschaftliche periodische Umverteilung des Ackerflächen hemmte die Privatinitiative, und der Mir konservierte den wenig produktiven Flurzwang mit seiner Dreifel-derwirtschaft. Eine qualitative Erneuerung der Agrarwirtschaft durch eine Zusammenlegung der Ackerflächen blieb aus. Die Landwirtschaft konnte die rasch wachsende Bevölkerung kaum noch ernähren. Konsumverzicht und der Zuerwerb in den industrienahen Regionen verhinderten einen Zusam-menbruch des ländlichen Wirtschaftssystems. Die Umstellung von Fron- auf Lohnarbeit verursachte in der Industrie einen Schock, von dem sie sich nur langsam erholte. Erst in den 1880er-Jahren war
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
201
sie auf das alte Niveau angestiegen. Das Potenzial der ländlichen Überbe-völkerung blieb für einen flexiblen Arbeitsmarkt zu wenig genutzt, weil die Industrie nicht genug Arbeitsplätze bereitstellte. Zwischen 1850 und 1914 verdoppelte sich die Bevölkerungszahl, während in Landwirtschaft und In-dustrie nur ca. vier Millionen Arbeitsplätze neu entstanden. Die Masse der Bevölkerung wurde weder zu einer breiten Konsumenteschicht, welche die Produktion von Konsumgütern im Binnenmarkt angekurbelt hätte, noch verbesserte sich das Arbeitskräfteangebot. Diese strukturelle Sackgasse der sozioökonomischen Entwicklung und der Eindruck des verlorenen Krieges gegen Japan führten zur Revolution von 1905. Zwar hatten die Reformen des Innenministers P.A. Stolypin (1862–1911), welche den Mir aufheben und eine Schicht von einkommensstarken Bauern bilden sollten, einigen Erfolg: Der Teufelskreis von ländlicher Überbevölke-rung und kleinbäuerlicher Stagnation aufgrund der immer stärkeren Zerstü-ckelung der Parzellen und der fehlenden Industrialisierung konnte zumindest ansatzweise durchbrochen werden, auf der Suche nach neuen Einkünften entwickelte die Bauernschaft Heimindustrie und Hausgewerbe. Doch der Erste Weltkrieg verhinderte eine Entfaltung dieses Potenzials. 1913 besaß Russland das fünftgrößte Industriepotenzial der Welt, die Pro-Kopf-Wertschöpfung betrug aber nur einen Zehntel der Vorreiternationen. Auf Kosten einer landwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Evolution hatten Modernisierung und Industrialisierung in den drei Jahrzehnten vor dem Ers-ten Weltkrieg einen eindrücklichen Boom erlebt und die sozioökonomischen Strukturen grundlegend verändert. Eine Stabilisierung der Verhältnisse war aber nicht eingetreten. So war Russlands wirtschaftliche Struktur für einen Weltkrieg kaum gerüstet und am Vorabend der bolschewistischen Revoluti-on auf einem morschen gesellschaftlichen Fundament erbaut.
4.4.3 Südosteuropa
Anfang des 19. Jahrhunderts befand sich die Wirtschaft des Osmanischen Reiches auf einem Tiefpunkt: Infolge der napoleonischen Kriege und inner-balkanischen Unruhen waren die zaghaften Anfänge einer Protoindustriali-sierung wieder zunichte gemacht worden, die Aufhebung der jahrhundert-langen wirtschaftlichen Isolation und die neue Konkurrenz durch übermäch-tige ausländische Wirtschaften trugen ebenfalls dazu bei. Die nach 1839 eingeleiteten Reformen in der sogenannten Periode des Tanzimat (> Glossar) brachten zwar Durchbrüche bei der institutionellen Erneuerung, aber keine nachhaltigen sozioökonomischen Reformen. Innere Widerstände etablierter Schichten, Unfähigkeit der Beamten und Korruption verschleppten die Transformationen. Die Reform des überkommenen Feudalsystems, das noch im 19. Jahrhundert auf Selbstversorgung und Wirtschaftsmonopole des Staa-
Teil B: Systematischer Teil
202
tes ausgerichtet war, blieb aus. Um 1800 verhinderten Auflösungserschei-nungen des Osmanischen Reiches an der südosteuropäischen Peripherie und die Flucht der Bevölkerung in die Bergregionen vor der Willkür der Pro-vinzgouverneure und der Malaria in den Beckenlandschaften des Balkans eine Bevölkerungsverdichtung. In der wichtigen Phase der Protoindustriali-sierung herrschte ein akuter Arbeitskräftemangel. Die äußeren und inneren Faktoren für eine Agrarrevolution und eine Kommerzialisierung der Ge-samtwirtschaft erwiesen sich als ungünstig. Die schlechte Wirtschaftslage und das Fehlen einer Bodenreform wurden zu einer drückenden Altlast für die neu entstandenen Nationalstaaten (vgl. Der Niedergang des Osmanischen Reiches und das lange 19. Jahrhundert, S. 329): Deren Bevölkerung setzte die hart erkämpfte Eigenstaatlichkeit mit der Hoffnung auf eine Verbesserung der ökonomischen Lebensumstände gleich. Bodenreformen wurden dort konsequent umgesetzt, wo die Osmanen als Großgrundbesitzer enteignet werden konnten und die neue Herrschaft da-nach strebte, eine breite freie Bauernschaft als loyale Stütze zu gewinnen. In Gesellschaften, in denen bis zu 90 % der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig waren, hätten unzufriedene Bauern ein entscheidendes politisches Un-ruhepotenzial bedeutet. Nur in Rumänien verhinderte eine mächtige nicht-osmanische Bojarenschicht, die selbst Großgrundbesitzerin war, eine ver-gleichbare Entwicklung. In Serbien, Griechenland und Bulgarien entstand eine breite Schicht von Zwergbauern mit weniger als fünf Hektar Besitz. Die neuen, zumeist aus Armeekreisen bestehenden Herrschereliten verhinderten gezielt die Bildung einer neuen, eigenen Schicht von Großgrundbesitzern, um das Mächtegleichgewicht und ihren Führungsanspruch nicht zu gefähr-den. So schützten rechtliche Maßnahmen die Zwergbauernbetriebe vor der Pauperisierung zusätzlich, um die soziale Stabilität zu sichern. Das Zwerg- und Kleinbauerntum produzierte indes kaum Marktüberschüsse. Fehlendes Kapital, ein extrem tiefes Bildungs- und Informationsniveau so-wie eine von Generation zu Generation fortschreitende Parzellenzersplitte-rung verhinderten eine Agrarrevolution in Richtung einer marktorientierten Landwirtschaft. Patriarchale Strukturen und die Vorherrschaft komplexer Großhaushalte – vor allem in Serbien in Form der Zadruga – wirkten als unüberwindbare Entwicklungshürden. Zusammen mit Russland befanden sich Serbien und Bulgarien in Bezug auf die Ackerlandproduktivität an letz-ter Stelle in Europa. War die geringe Bevölkerungsdichte Ende des 18. Jahrhunderts noch ein Entwicklungshemmnis, war es nun die plötzliche Bevölkerungszunahme, die vor allem in Serbien und Griechenland die sozioökonomische Lage ver-schlechterte. Die Bevölkerung Serbiens explodierte 1800–1914 von einer halben auf rund zwei Millionen Einwohner. Doch nur ein Teil dieser Zu-
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
203
nahme lässt sicht mit dem beträchtlichen territorialen Zuwachs Serbiens 1878 und 1913 erklären. Das demografische Wachstum überstieg die Zuwachsraten in der Landwirtschaft um ein Vielfaches: Die missliche ländliche Wirtschafts-lage mit einer hohen verdeckten Arbeitslosigkeit und hoher Unproduktivität konnte die Kapitalmittel für die Industrialisierung nicht aufbringen. So fehlte der Industriesektor, welcher die überschüssige Arbeitskraft auf dem Land hätte absorbieren können. Die Massenauswanderung nach Übersee, der aufgrund schlechter Verkehrsverhältnisse ebenfalls enge Grenzen gesetzt waren, brachte kaum Erleichterung. So war eine nachholende Industrialisierung wegen eines eigentlichen Negativwachstums in sich selber blockiert. Bis 1945 blieb Südosteuropa – mit regionalen Unterschieden – hauptsächlich agrarisch geprägt. Landwirtschaftsprodukte stellten 90 % der Exportgüter, wobei die Volkswirtschaften den stark schwankenden Weltmarktpreisen und ausländischen Finanzströmen ausgesetzt waren. Die Aufrechterhaltung der neu gewonnenen Eigenstaatlichkeit führte zu einer hohen entwicklungs-hemmenden Steuerlast. Die ohnehin dünne Kapitaldecke und die geringen Staatseinnahmen vermochten die aufgeblähten Staatsapparate kaum zu fi-nanzieren. In Serbien zum Beispiel setzten sich die jungen städtischen Eliten aus einer neuen Aristokratie, die sich in den Befreiungskämpfen hervorgetan hatte, und aus einer dünnen Verwaltungsschicht zusammen. Die wenigen gut ausgebildeten Rückwanderer der Diaspora gingen in der bürokratisch-militärischen Elite auf, eine Klasse von Unternehmern fehlte aber in dieser neuen intelligencija (> Glossar). Traditionell rekrutierten sich die Kaufleute aus Griechen, Armeniern und Juden. In Bulgarien, Serbien und Montenegro bestimmte der Wunsch nach einer mythisch verklärten Rückeroberung der noch unter osmanischer Herrschaft stehenden Gebiete das Handeln der neuen Nationalstaaten. Kriege und hohe Militärbudgets belasteten den Staatshaushalt übermäßig. So wuchs die Aus-landsverschuldung, ohne dass nennenswerte Investitionen in die Infrastruk-tur getätigt worden wären – ein Großteil der Einkünfte musste für die Schul-dentilgung aufgewendet werden. Die zunehmende finanzielle Abhängigkeit verhinderte den Schutz der einheimischen Produktion durch Einfuhrzölle: Für Habsburg und für Frankreich, den größten Gläubiger in der Region, blieb Südosteuropa ein Rohstoff- und Agrarlieferant, wobei kaum Kapital für den Aufbau einer Industrie zurückfloss. Die ausländischen Kapitalgeber waren am Abbau der Rohstoffe und nicht an Verarbeitungsanlagen vor Ort interessiert. Überschüsse aus der südosteuropäischen Agrarproduktion führ-ten zwar zu einem erhöhten Bedarf an Produktions- und Konsumgütern, doch diese wurden durch Importe gedeckt, die von der heimischen Produkti-on nicht konkurrenziert werden konnten.
Teil B: Systematischer Teil
204
Die Frage, ob die Ablösung vom Osmanischen Reich die Wirtschaft negativ oder positiv beeinflusst habe, wurde in der modernen Forschung rege disku-tiert. In Serbien und Montenegro lässt sich allgemein eine Vertiefung der ökonomischen Rückständigkeit in den erst 50 Jahren ihrer Selbstständigkeit feststellen, während in Bosnien-Herzegowina die Herrschaft Habsburgs der Modernisierung Aufschwung verlieh. Bulgarien entwickelte sich aufgrund einer starken Textilproduktion zur am weitesten entwickelten Provinz des osmanischen Europa, um nach 1878 an wirtschaftlichem Schwung zu verlie-ren. Allgemein lässt sich feststellen, dass die jungen Nationalstaaten aus Angst um ihre fragile sozioökonomische Stabilität entwicklungshemmende Strukturen des Osmanischen Reiches übernommen und konserviert hatten. So hob Serbien erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg die anachronistische Zunftordnung auf, während das Osmanische Reich die Gilden bereits 1826 trotz starker innerer Widerstände aufgelöst hatte. Eine eigentliche Industrialisierung setzte in Südosteuropa erst nach 1900 ein. Trotz eindrücklicher Zuwachsraten in allen Ländern zeugt der Anteil der Großindustrie am Bruttosozialprodukt vom tiefen Ausgangsniveau: Mit knapp 20 % befanden sich Rumänien und Griechenland an der Spitze. In Rumänien kam es in den Händen der Großgrundbesitzer zu einer erfolgrei-chen Kapitalbildung, welche die Basis für eine Konsumgüterindustrie legte. Reiche Ölvorkommen trugen ebenfalls dazu bei. Anders als in den neuen Staaten des westlichen Balkans wurde ein Großteil des Staatsbudgets nicht in Militär- und Kriegsausgaben, sondern in die Infrastruktur investiert, was die Industrialisierung nachhaltig stützte. Rumänien bemühte sich von An-fang an um einen ausgeglichenen Staatshaushalt, was seine Finanzabhängig-keit vom Ausland milderte; auf diese Weise konnte es schon früh eine pro-tektionistische Zollpolitik durchsetzen, um die heimische Industrialisierung vor Importgütern zu schützen. In Griechenland wiederum übernahmen er-folgreiche Reeder und Handelsunternehmer die Rolle einheimischer Kapital-bildner und gründeten Industrieunternehmen. Der Erste Weltkrieg unter-brach allerdings diese positive Entwicklung. In Westeuropa hatte der Erste Weltkrieg nur einzelne Landstriche verwüstet und vor allem bei den Soldaten zu hohen Verlusten an Menschenleben ge-führt. In Südosteuropa dagegen verheerte der Krieg ganze Regionen und erfasste auch die zivile Bevölkerung. Serbien und Montenegro büßten mehr als einen Viertel ihrer Bevölkerung ein, in Bulgarien waren die Verluste kaum geringer. Die wenigen Produktionsanlagen waren zerstört oder demon-tiert; viele landwirtschaftliche Gebiete konnten sich bis zum Zweiten Welt-krieg nicht erholen. Diese Kriegsverheerungen in den jungen Nationalstaaten vertieften die Strukturprobleme, die schon vor dem Krieg bestanden hatten. Als erschwe-
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
205
render Umstand kam hinzu, dass die Grenzziehungen des Versailler Vertra-ges die ohnehin dürftigen Netzwerke von Wirtschaft und Transportsystem zerschlugen: Die nationalen und sicherheitspolitischen Bedürfnisse der Alli-ierten hatten sozioökonomische Gegebenheiten bei den Grenzziehungen kaum berücksichtigt. Erschwerend kam hinzu, dass Rumänien und insbeson-dere Serbien, in Gestalt des neu geschaffenen Jugoslawien, bis zum Dreifa-chen ihres ursprünglichen Territoriums hinzugewonnen hatten, was viel Ka-pital beim Aufbau einer tragfähigen Administration band. In ganz Südosteuropa zwang die Drohkulisse der russischen Oktoberrevolu-tion (> Glossar) die herrschenden Eliten zu weitreichenden Bodenreformen, um das Unruhepotenzial der breiten Bauernschaft mit Maßnahmen von oben zu entschärfen. Auch als Motivation für die Teilnahme am Ersten Weltkrieg war der bäuerlichen Bevölkerung eine Bodenreform versprochen worden. Ohnehin hatte das 19. Jahrhundert den sozialen Zusammenhalt zwischen einer dünnen, nach Westeuropa ausgerichteten städtischen Elite und einer in Traditionen verhafteten Landbevölkerung stark erodieren lassen. Nun erhiel-ten vor allem in Rumänien, Jugoslawien und Griechenland Millionen von Bauern Land; lediglich Albanien blieb in Südosteuropa von großen Bodenre-formen unberührt. Zwischen 1918 und 1937 führten ein explosionsartiger Bevölkerungszuwachs von 10 bis 30 %, ein ständig wachsender Überhang arbeitsloser Landbevölkerung und soziopolitische Erwägungen zu einer wei-teren Parzellierung auf dem Land. Angesichts des herrschenden Kapitalman-gels konnte die Agrarproduktivität kaum zunehmen, die Schere zwischen Bevölkerungswachstum und allgemeiner Landesproduktivität öffnete sich immer mehr; denn die Bewirtschaftungsmethoden hatten sich seit den Unab-hängigkeitskriegen gegen die Osmanen kaum verändert. Eine beschleunigte Industrialisierung sollte hier Abhilfe schaffen: Doch der Wille zur wirtschaftlichen und damit auch politischen Unabhängigkeit be-schränkte die Anleihemöglichkeiten im Ausland. Die rekordträchtige Nach-kriegsinflation hatte einen Großteil des Volkskapitals zerstört. Auf mangeln-de Erfahrung zurückzuführende Fehlinvestitionen, hohe Schutzzölle und nicht zuletzt Korruption innerhalb der nicht marktwirtschaftlich orientierten Eliten begrenzten den Erfolg dieser Bemühungen. Die Last der Industriali-sierung blieb auf den Schultern der Bauern. Ein Großteil des einfließenden Kapitals musste für die Schuldentilgung bei den westeuropäischen Partnern aufgewendet werden, die an einer Industrialisierung ihrer Rohstofflieferan-ten ohnehin nicht interessiert waren. Die Weltwirtschaftkrise nach dem Börsencrash von 1929 und der darauf folgende Einbruch der Preise für Landwirtschaftsprodukte und Rohstoffe – die Weltmarktpreise hatten sich halbiert – traf diese Nationalwirtschaften mit äußerster Härte. In Bulgarien und Jugoslawien arbeiteten immer noch vier
Teil B: Systematischer Teil
206
Fünftel der Bevölkerung in der Landwirtschaft, in Jugoslawien betrug der Anteil der Landwirtschaft an den Exportwerten 69 %, in Bulgarien 86 %. Hinzu kam, dass die Landwirtschaft nach wie vor die Kosten der Industriali-sierung zu tragen hatte: Unter der steigenden Steuerlast und aufgrund der sinkenden Erträge verarmten die Bauern. Da die Urbanisierungsrate auf tie-fem Niveau verharrte und eine Kompensation für den zusammenbrechenden internationalen Handel durch den Binnenkonsum ausblieb, war der Export der Rohstoffe trotz sinkender Gewinnmargen die einzige Möglichkeit der Kapitalbeschaffung. Bis zum Zweiten Weltkrieg blieben die Volkswirtschaf-ten in einem Kreislauf mangelnder Binnennachfrage, fehlenden Kapitals, schrumpfender Produktivität, hohen Arbeitskräfteüberschusses und niedriger Industrialisierungsrate gefangen. Ebenfalls gerieten die Länder Südosteuro-pas in den 1930er-Jahren in die zunehmende Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft, die diesen Raum als Absatzmarkt und Rohstofflieferanten verstand. So vermochten sich die jungen Nationalökonomien aus ihrer tradi-tionellen Rolle des Zulieferers nicht zu lösen. Einzig in Rumänien konnte ein gewisser Fortschritt erzielt werden.
4.4.4 Südliches Ostmitteleuropa
In Südosteuropa hatte die Ablösung vom Osmanischen Imperium die Wirt-schaftsentwicklung maßgeblich beeinflusst. Im südlichen Ostmitteleuropa bestimmte größtenteils die Habsburgermonarchie die Rahmenbedingungen der Industrialisierung. Eine innere Einheit war im Habsburgerreich weder in verkehrstechnischer noch wirtschaftlicher Hinsicht gegeben. Die geografisch bedingte Fragmentierung erschwerte die Vernetzung auch noch im Zeitalter der Eisenbahnen. Wirtschaftskulturelle Brüche zwischen historisch unter-schiedlich gewachsenen Zonen ließen die Regionen kaum zusammenfinden. Die Handels- und Wirtschaftszentren lagen in den Alpenländern, im Wiener Becken sowie in Böhmen und Mähren. In den östlichen Gebieten und in Ungarn – befanden sich die Landwirtschaftszonen, wo die Protoindustriali-sierung kaum Fuß gefasst hatte. Auch alle um 1800 getätigten Reformen hatten darauf abgezielt, diese Arbeitsteilung zu konservieren. So verhinderte ein Binnenmerkantilismus eine Angleichung der Regionen. Die Zollpolitik der Krone sicherte den Erblanden wohl nicht zuletzt aus wirtschaftspoliti-schen Gründen den industriellen Vorsprung: Der Westen sollte der Absatz-markt für die vom Großgrundbesitzenden und staatstragenden Adel domi-nierte Rohstoff- und Nahrungsmittelproduktion der östlichen Länder bleiben, während der Osten Industriegüter aus den westlichen Erblanden importierte. Der Binnenzoll blieb bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts erhalten, bis die Industrialisierungspolitik der emanzipierten ungarischen Teilherr-schaft Veränderungen durchzusetzen vermochte. Eine konservative Reform-
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
207
politik wie etwa die zögerliche Aufhebung der Leibeigenschaft und zaghafte Industrialisierungsvorstöße blieben ein Hauptmerkmal des Habsburgerreiches in seinen Ostgebieten: Willens, das bisherige sozioökonomische Gleichge-wicht zu bewahren, war der Status quo Fortschritt genug. Die ganze Wirt-schaftspolitik Habsburgs war nach innen gerichtet und verharrte in einer merkantilistischen Mentalität, die das Reich noch über weite Strecken des 19. Jahrhunderts nach außen abschottete. Anders als Ungarn konnte Böhmen von seinen günstigen Ausgangsbedin-gungen – einer früh einsetzenden, hohen Bevölkerungsverdichtung, entwi-ckelten Manufakturen und reichen Rohstoffvorkommen – nachhaltig profi-tieren. Diese stützten sich auf eine Landwirtschaftsproduktivität, deren Ni-veau kaum noch von jenem Westeuropas abwich. Die nahe gelegenen deut-schen Gebiete wie auch die östlichen Länder der Monarchie boten beste Absatzmöglichkeiten für eine sich schnell entwickelnde Leicht- und später Schwerindustrie. Die ohnehin hohe Urbanitätsrate nahm weiter zu und diffe-renzierte sich durch den Zustrom von Arbeitern in die Industriebetriebe. Die Beschäftigungsquoten in den verschiedenen Wirtschaftssektoren sprechen für sich: Vor dem Ersten Weltkrieg arbeiteten in Böhmen knapp gut 30 % der Menschen noch in der Landwirtschaft, in den ungarischen Ländern war diese Zahl mehr als doppelt so hoch. Die Wirtschafts- und Zollpolitik Habsburgs und die Interessen der Grundbe-sitzer in der ungarischen Reichshälfte hatten die Landstrukturen konserviert. Vor allem Großgrundbesitz prägte das flache Land, daran hatten weder die Landreformen in der josephinischen Zeit (1781) noch die große Bauernbe-freiung von 1848 wirklich etwas geändert. Noch um 1900 war der Boden extrem ungleich verteilt: Mehr als die Hälfte der Bauern mussten mit kaum 6 % der gesamten Nutzfläche auskommen. Weitere Parzellenzersplitterung durch Erbteilungen, fehlende Flurbereinigungen und die politische Vormacht der Großgrundbesitzer verhinderten Innovationen in der Landwirtschaft. Weite Teile der Bauernschaft verarmten und blieben als arbeitsloser Bevöl-kerungsüberhang auf dem Land, was zu großen Auswanderungswellen nach Übersee führte. Zwischen 1850 und 1910 hat sich die Bevölkerung Ungarns mehr als verdoppelt. Die Landreformen hatten lediglich die Rechtsstellung der Bauern verbessert, sie wurden aber nicht durch eine groß angelegte Landumverteilung abgestützt. Weil die breite Bauernschaft als Konsumen-tenschicht nach wie vor ausblieb, konnte die Binnennachfrage nach Gütern kaum ansteigen und die Industrialisierung ankurbeln. Auch wenn sich in den ungarischen Ländern im Laufe des 19. Jahrhunderts eine namhafte Lebensmittelindustrie herausbilden konnte, blieb der kom-plementäre und politisch gewollte Charakter der verschiedenen Wirtschaften in der Doppelmonarchie erhalten. Erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg, als
Teil B: Systematischer Teil
208
die nach dem ungarisch-österreichischen Ausgleich gezielt eingesetzten In-vestitionen in die Textil- und Schwerindustrie allmählich zu greifen began-nen, näherten die Industrialisierungsniveaus sich einander an. In Ungarn fehlte es aber an einer breiten wirtschaftlich ausgerichteten städtischen Mit-telschicht, die sich historisch aus einem Kaufmanns- oder Gewerbestand hätte herausbilden können. Die städtische Schicht rekrutierte sich neben Juden aus Teilen des verarmten Adels, der – gestützt auf Herkunftsrecht und Privilegien – Verwaltungs- und Offiziersstellen besetzte und kaum unter-nehmerisch wirkte. Der Zerfall des habsburgischen Wirtschaftsnetzwerkes nach dem Ersten Weltkrieg traf die ungarische und die tschechoslowakische Nationalwirt-schaft hart. Hohe Schutzzölle der Nachfolgestaaten erzwangen eine Neuaus-richtung der Wirtschaft, da der gemeinsame komplementäre Binnenmarkt nicht mehr existierte. Die Wirren der Nachkriegszeit mit Hyperinflation und labilen Regierungen sowie die Kosten der Eigenstaatlichkeit erschwerten den Neuanfang zusätzlich: Der Binnenkonsum stagnierte und machte die Wirtschaften in hohem Maß vom Export abgängig. Immerhin verzeichnete die Tschechoslowakei einige Erfolge: Die stabile parlamentarische Demo-kratie machte das Land für ausländische Kapitalgeber relativ attraktiv. Eine erfolgreiche Bodenreform trug ebenfalls zu einem anfänglich günstigen wirt-schaftlichen Umfeld bei. Allerdings zeigten sich vor allem im Bereich der prestigeträchtigen Schwerindustrie bald einmal die Grenzen der Industriali-sierungsbemühungen: Einerseits mussten sich die Güter nun auf einem ge-samteuropäischen Markt bewähren, dessen Niveau sie kaum zu befriedigen vermochten, andererseits erschöpfte das Streben nach industrieller Autarkie das vorhandene Kapital. In Ungarn führten die gleichen Industrialisierungsbestrebungen zu einer hohen Kapitalabhängigkeit vom Ausland und zu einer schweren Belastung der Landwirtschaft. Wie auf dem Balkan hatte diese die Hauptlast der be-schleunigten Modernisierung zu tragen. Das Fehlen einer Landreform, eine Erblast der Donaumonarchie, belastete das sozioökonomische Gefüge. Der Beamtenstand, der sich vornehmlich aus verarmten Adligen zusammensetzte und auf seine Privilegien als staatstragende Klasse pochte, wusste alle Ver-änderungen auf dem flachen Land zu verhindern. Verheerend wirkte sich die Weltwirtschaftskrise nach 1929 aus: Überdurch-schnittlich abhängig vom Exportmarkt (Tschechoslowakei), von ausländi-schem Kapitalzufluss und von den erodierenden Weltmarkpreisen für Nah-rungsmittel (Ungarn), vermochten sich die jungen Nationalwirtschaften bis Anfang des Zweiten Weltkriegs nicht zu erholen. Das Nationaleinkommen lag nach 20 Jahren Selbstständigkeit unterhalb desjenigen der Vorkriegszeit.
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
209
4.4.5 Nördliches Ostmitteleuropa
Die Teilungen Polens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts akzentuier-ten den Zerfall des nördlichen Ostmitteleuropa in fünf Wirtschaftszonen. Diese lagen in den peripheren Gebieten der umliegenden Teilungsmächte – Russland, Habsburg und Preußen. Aufgrund der beschleunigten Wirtschafts-entwicklung im 19. Jahrhundert verlief die Entwicklung dieser Zonen sehr unterschiedlich. Übergreifend gesehen zerstörten die Teilungen historisch gewachsene Handelsnetzwerke: Zollschranken zwischen den Großmächten erschwerten die internationale Anbindung des nördlichen Ostmitteleuropa an den internationalen Handel. Früher wichtige Handelsumschlagplätze und urban gewachsene Zentren wie Krakau verloren an Bedeutung und konnten ihre Funktion als Wirtschaftsmotor nicht mehr wahrnehmen. Preußisch-Polen Die Bauernbefreiung von 1823 in Preußisch-Polen – Posen und Westpreu-ßen – führte zu einer Agrarrevolution auf der Grundlage eines breiten mittel-ständischen Bauernstandes. Großgrundbesitz war hier historisch bedingt nie so ausgeprägt gewesen wie in den Kerngebieten Polen-Litauens. Die deut-schen Gebiete, insbesondere Berlin, boten einen großen Absatzmarkt für eine florierende Landwirtschaft, die durch die Hochzollpolitik Preußens zusätzlich vor ausländischer Konkurrenz geschützt war. Der ländliche Be-völkerungsüberhang wurde durch die erhöhte Produktivität und die Auswan-derungsmöglichkeit in die boomende Wirtschaft Preußens erfolgreich aufge-fangen. Zudem wurde das Gebiet durch ein dichtes Eisenbahnnetz mit den westlichen Gebieten verbunden. Aufgrund der übermächtigen Wirtschafts-konkurrenz im Westen entwickelte sich jedoch nur eine Leichtindustrie, die sich auf die Veredelung landwirtschaftlicher Güter spezialisierte. Österreich-Galizien und die Ostgebiete Österreich-Galizien und die Ostgebiete der ehemaligen Adelsrepublik Polen, die Russland erhielt, waren die am wenigsten entwickelten und ärmsten Ge-biete – allerdings mit unterschiedlichen Strukturproblemen. Die Ostgebiete blieben dünn besiedelt, die Landwirtschaft war auf eine reine Sub-sistenzwirtschaft ausgerichtet, und Industrialisierungstendenzen waren mit der Ausnahme der Textilhochburg Białystok kaum vorhanden. Galiziens Bevölkerung verdoppelte sich, ohne dass eine Agrarrevolution stattgefunden hätte. Da gleichzeitig eine Industrialisierung ausblieb, verarmte die Landbe-völkerung, was zu großen Emigrationswellen nach Übersee führte.
Teil B: Systematischer Teil
210
Kongresspolen Einzig in Kongresspolen (> Glossar), das unter russischer Oberhoheit stand, konnte als Folge staatlicher Maßnahmen eine erfolgreiche Protoindustriali-sierung Fuß fassen. Auf deren Basis und aufgrund breiter Absatzmöglichkei-ten in Russland wurde Kongresspolen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zur am weitesten entwickelten Region im ganzen Zarenreich. Allerdings be-schränkte sich die Industrialisierung auf einzelne städtische Inseln wie War-schau und Łódź, ohne das flache Land zu erfassen. Vor allem aber wurde die-ser wirtschaftliche Erfolg von äußeren Faktoren getragen und gründete nicht auf einer Revolution der eigenen Landwirtschaft. Im Gegenteil: Die extensi-ven Landwirtschaftsmethoden ließen die Erträge nach der Bauernbefreiung und der Entstehung eines hohen Anteils von Kleinbetrieben weiter stagnie-ren. Die unternehmerische, zumeist von Nichtpolen dominierte bürgerliche Elite blieb sehr schmal und wirtschaftlich vom Staat und ausländischen Geldgebern abhängig. So waren auch die Ressourcen nicht vorhanden, das Land mit den einzelnen aufstrebenden Städten zu vernetzen. Der große Ent-wicklungsgraben zwischen Stadt und Land vertiefte sich im 19. Jahrhundert. Damals entstand ein Strukturmangel, den Polens Wirtschaft heute noch nicht überwunden hat. Nach dem Ersten Weltkrieg wies Polen die gleichen Strukturengpässe auf wie die anderen neu geschaffenen Nationalstaaten in Ostmittel- und Südosteu-ropa. Traditionelle Kräfte verhinderten eine tief greifende Agrarreform und damit auch eine Besserstellung der Bauern und die Ankurbelung des Binnen-marktes. Polen war in großem Maß auf ausländische Finanzgeber angewiesen, da der Binnenmarkt kaum Kapital für eine Industrialisierung bereitstellen konnte; noch weniger Geld floss in die Überwindung der Rückständigkeit der Landwirtschaft. Schließlich beschleunigte die Weltwirtschaftskrise den nega-tiven Wirtschaftstrend, da der Kapitalzufluss versiegte und die wichtigen aus-ländischen Absatzmärkte sich drastisch zurückbildeten. Zu all diesen struktu-rellen Hindernissen hatte die junge polnische Wirtschaft das zusätzliche Problem, verschiedenste Wirtschaftsregionen zu einem einheitlichen Wirt-schaftsraum vereinen zu müssen. Über 100 Jahre hatten die einzelnen Teile Polens die wirtschaftliche Peripherie der umliegenden Großreiche gebildet, das ganze wirtschaftliche Netzwerk musste neu ausgerichtet werden – ein Prozess, der beim Einsetzen der Weltwirtschaftskrise noch kaum abge-schlossen war. Erst kurz vor dem Zweiten Weltkrieg setzte auf tiefem Ni-veau wieder ein Aufschwung ein. Litauen und baltische Provinzen Auch die Wirtschaftsentwicklung der neu entstandenen Staaten im Baltikum wies große regionale Unterschiede auf. Litauen hatte gegen die gleichen
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
211
Strukturprobleme anzukämpfen wie Polen. Anders verlief die Entwicklung in Lettland und Estland: Dank tief greifenden Landwirtschaftsreformen ent-stand in den ehemals russischen Provinzen Anfang des 19. Jahrhunderts ein stabiler und erfolgreich wirtschaftender mittlerer Bauernstand. Zudem setzte eine gewisse Industrialisierung ein, die durch den Ausbau von Riga und Re-val zu wichtigen Exporthäfen des zarischen Russlands maßgeblich gestützt wurde. Der Machtverlust der deutschstämmigen Großgrundbesitzer in den unabhängigen baltischen Staaten ermöglichte in der Zwischenkriegszeit noch grundlegendere Agrarreformen. Die Industrialisierung setzte sich auch in der Zwischenkriegszeit erfolgreich fort. Der Anteil der im sekundären Sektor arbeitenden Bevölkerung stieg kontinuierlich und nahm für Nordosteuropa den Spitzenwert ein.
4.5 Grundlagen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte im Sozialismus (1917/1945 bis 1990)
4.5.1 Vom Marxismus-Leninismus zum Stalinismus: Die ideologischen Grundlagen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Osteuropas
Die bolschewistische Revolution von 1917 beeinflusste die Wirtschaftsge-schichte ganz Osteuropas für das 20. Jahrhundert maßgeblich. In der Zwi-schenkriegszeit durchlief das sowjetische Russland einschneidende Verände-rungen. Was Umfang und Tempo betrifft, stellten die Ereignisse alle bisheri-gen Reformen und gesellschaftlichen Veränderungen in den Schatten. Nach-dem Gesellschaft und Wirtschaft während mehr als einem halben Jahrtau-send durch die zarische Autokratie geprägt worden waren, erschuf die kom-munistische Partei nach 1917 – innerhalb von 20 Jahren – eine neue, auf einem alternativen sozioökonomischen Fundament ruhende Gesellschaft. Die Folgen der Oktoberrevolution waren für die ganze Wirtschaftsentwick-lung wegbestimmend: Nach dem Zweiten Weltkrieg zwang die Sowjetunion dank ihrer hegemonialen Stellung allen Staaten Osteuropas ihr Gesell-schaftskonzept auf – Griechenland, Finnland und auch Jugoslawien blieben Ausnahmen. Ziel war es, die sozialistischen Satellitenstaaten durch Gleich-schaltung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Strukturen besser zu kontrollie-ren und die kommunistische Revolution zu verbreiten. Der Marxismus-Leninismus stalinistischer Prägung ist als Gesamtentwurf zu verstehen, der die absolute Kontrolle über die Produktivkräfte durch die der Bevölkerung vorausschreitende kommunistische Partei, die sogenannte Avantgarde des Proletariats, voraussetzt. Dies mit dem Ziel, das kommunis-tische Gesellschaftsmodell zu verwirklichen. Demgegenüber postuliert der
Teil B: Systematischer Teil
212
klassische Entwurf des Kommunismus (> Glossar) das Ideal einer klassenlo-sen Gesellschaft, in der alle den gleichen Zugang zu allen Gütern haben und der Staat und jede andere herrschaftliche Struktur zugunsten eines freiwilli-gen Zusammenlebens im Kollektiv verschwunden sind. Die Produktivkräfte sind insofern entscheidend, als sie gemäß marxistischer Gesellschaftstheorie in ihrer Gesamtheit die Produktionsverhältnisse prägen, auf denen die politi-schen, rechtlichen und kulturellen Strukturen aufbauen. Unter diesem Ge-sichtspunkt kam der Wirtschaft und ihrer Entwicklung im Leninismus-Stalinismus eine ernorme Bedeutung zu. Das Gesamtkonzept war aufgrund der deterministischen marxistischen Geschichtstheorie auch in seiner zeitli-chen Abfolge absolut. Marx hatte die Machtübernahme durch das Proletariat in den führenden Industrieländern und nicht im landwirtschaftlich geprägten Russland vorausgesehen. Die Bol’ševiki (> Glossar) sahen sich daher ge-zwungen, ihre schmale Machtbasis durch eine beschleunigte Industrialisie-rung und eine rasch wachsende Arbeiterschaft zu stärken. Schnell wurde auch klar, dass die erwartete Weltrevolution nicht stattfinden würde. Stalins Ideologie vom «Sozialismus in einem Land» (> Glossar Sozialismus) ent-hielt die Überlebensstrategie, die UdSSR ohne fremde Hilfe rasch zu indust-rialisieren und gegen die Feinde aus der kapitalistischen Welt konkurrenz- und widerstandsfähig zu machen. Insofern ergänzte der Leninismus-Stalinismus den Marxismus um die Komponente einer beschleunigten In-dustrialisierung und Modernisierung.
4.5.2 NĖP- und Stalinzeit
Angesichts der katastrophalen, durch Revolution und Bürgerkrieg verursach-ten Versorgungslage nach dem Ersten Weltkrieg wurde 1921 die Abliefe-rungspflicht der Kriegswirtschaft aufgehoben und ein freier Waren- und Geldverkehr erlaubt. Für die Wirtschaft setzte unter der sogenannten «Neuen ökonomischen Politik» (NĖP > Glossar) eine Erholungsphase ein. Der Ver-staatlichungsdruck wurde gelockert. Mit Erfolg: 1926 hatten Industrie und Landwirtschaft in etwa das Vorkriegsniveau erreicht. Allerdings fehlte nach wie vor das Kapital, um die Industrialisierung voranzutreiben: Trotz Bemü-hungen erhielt die Sowjetunion keine Investitionen aus dem Ausland und musste daher auf eine Kapitalakkumulation aus Eigenmitteln zurückgreifen. Die Vorbereitungen für den ersten Fünfjahresplan 1927/1928 zur Erreichung der Industrialisierung legten schnell die Schwierigkeiten offen. Die Bauern weigerten sich zusehends, ihre für die Versorgung der Städte lebensnotwen-digen Überschüsse auf dem Markt zu verkaufen, da Konsumgüter nicht er-hältlich waren. Spätestens seit 1925 förderte die Partei vor allem die Schwer-industrie, um auf diese Weise, wie sie glaubte, dem Land die wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit zu sichern. Die Preisschere zwischen Land-
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
213
wirtschaftsprodukten und Konsumgütern öffnete sich immer mehr, bis die landwirtschaftliche Produktion wegen der Verweigerungshaltung der Bauern zusammenbrach. Die Bauern fingen an, den Weizen, das wichtigste Produkt für die Lebensmittelversorgung, zu horten. Unter diesen Umständen sah sich die Partei gezwungen, den NĖP-Prozess abzubrechen und wieder zum Sys-tem der Zwangsablieferungen zurückzukehren. Dies mündete in einer flä-chendeckenden Zwangskollektivierung aller Bauernbetriebe nach 1929. Aus Sicht der Partei mussten die Bauern als Unsicherheitsfaktor und nicht zu kontrollierende Gesellschaftsschicht ein für alle Mal ausgeschaltet und ans Kollektiv gebunden werden. Die isolierte und stabile Welt des russischen Dorfes sollte aufgebrochen und dem unmittelbaren Zugriff der Partei zu-gänglich gemacht worden. Die chaotisch und brutal durchgeführte Kollektivierung, die Umschichtung des ganzen Bauernstandes und immer weiter gehende Zwangseintreibungen führten 1932/1933 zu einer beispiellosen Hungerkatastrophe, die Millionen von Menschenleben kostete. Die Bevölkerungsverluste variieren gemäß heu-tigem Forschungsstand zwischen 7,2 und 8,8. Millionen. Das Tributverhält-nis der Landwirtschaft gegenüber der Industrie bestand darin, dass die Bau-ern ihre Produkte zu Niedrigstpreisen abzugeben hatten, die Städter hinge-gen Lebensmittel zu hohen Preisen erwerben mussten. Die Differenz erlaub-te dem Staat die Akkumulation von Kapital für die angestrebte Industrialisie-rung aus eigener Kraft. Mit Zwang war die Gesamtarbeitsleistung der Land-wirtschaft von einer rigiden Befehlswirtschaft erfasst und in den Dienst der Fünfjahrespläne gestellt worden. 1933 hatte die sowjetische Landwirtschaft der NĖP-Zeit ihr Gesicht völlig verändert: Rund 250000 Kollektivwirtschaf-ten (Sovchosen > Glossar und Kolchosen > Glossar) hatten mehr als 25 Millionen bäuerliche Kleinbetriebe ersetzt. Weit mehr als die Kollektivierung der Landwirtschaft trug das Abschöpfen der Arbeitskraft des Proletariats, das über so gut wie keine Konsummöglich-keiten verfügte, zur Finanzierung der Industrialisierung bei. Die nach 1929 eingeschlagene beschleunigte Industrialisierungspolitik rückte von der bis dahin vorherrschenden Idee einer ausgeglichenen Wirtschaftsentwicklung zwischen Schwerindustrie, Leichtindustrie und Agrarwirtschaft endgültig ab, wie sie in der NĖP verfolgt worden war. Die Verstaatlichung erfasste nun ohne Ausnahme alle Wirtschaftssparten. Die Partei – nunmehr unter der abso-luten Führung Stalins – setzte auf Schlüsselsektoren in der Schwerindustrie, um dort mit allen zu Verfügung stehenden Mitteln den Anschluss an die fort-schrittlichen Länder zu erreichen. Diese einseitige Industrialisierung geschah auf Kosten des Massenkonsums, was ein Charakteristikum der gesamten sow-jetischen Wirtschaftsepoche werden sollte. Zwischen 1928 und den frühen 1960er-Jahren blieb die Reinvestitionsquote mit über 30 % enorm hoch – in
Teil B: Systematischer Teil
214
keinem westlichen Land wurde jemals eine so hohe Rate erreicht. Allerdings schlug sich diese Quote in einem sinkenden Lebensstandard nieder. Die aufgrund überholter Produktionsmethoden tiefe Arbeitsproduktivität und die fehlende Qualifikation der aus dem Bauernstand rekrutierten Arbeiter mussten durch eine forcierte Arbeitsleistung kompensiert werden. Die Sta-chanov-Bewegung (> Glossar) sollte zu Höchstleistungen animieren, um die Produktionsnormen steil ansteigen zu lassen. Die Vergesellschaftung des Individuums – die Einbindung jedes Einzelnen in die Leistungsmechanismen des stalinistischen Staatsapparates – mittels Durchsetzung totalitärer Herr-schaftsverhältnisse ermöglichte eine Art von permanenter Kriegswirtschaft. Das Lohnniveau blieb weit unter dem europäischen Schnitt. In den USA betrug die Kaufkraft das Siebeneinhalbfache der Kaufkraft in der Sowjetuni-on. So sank der Lebensstandard des durchschnittlichen Arbeiters aufgrund sinkender Reallöhne – in der Landwirtschaft noch weit mehr als in der In-dustrie. Während der Stalinzeit wurde die Arbeitspflicht durch strengste Arbeitsdisziplinierungsmaßnahmen gesichert. Das Überleben für den Arbei-ter war seit 1913 kaum einfacher geworden, obwohl der Parteiapparat in den wirtschaftlichen Statistiken Jahr für Jahr großartige Erfolge auswies. In einem gewissen Sinn gelang die forcierte Industrialisierung. Ende der 1930er-Jahre hatte die Sowjetunion im Bereich der Schwerindustrie und rein quantitativ betrachtet alle Staaten Westeuropas überholt und befand sich hinter den USA auf Platz zwei. Die Wachstumsraten betrugen zwischen 1928 und 1937 weit über 10 %. Durch die wirtschaftliche Isolation war die Sowjetunion von den Folgen der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren kaum betroffen. Auch in der Pro-Kopf-Produktion hatte man gewaltig auf-geholt. Das ständige Problem der ländlichen Überbevölkerung wurde durch die Rekrutierung für die Industrialisierung gelöst; selbst die ernormen Ver-wüstungen des Zweiten Weltkriegs konnten erstaunlich schnell und aus ei-gener Kraft beseitigt werden. Das rein quantitative Wachstum hatte jedoch zu immer größeren Dispropor-tionen innerhalb der zentral gelenkten Wirtschaft geführt. Nicht nur wurde der Konsumsektor vernachlässigt, auch die verschiedenen Sektoren der ge-förderten Industriezweige wurden schlecht aufeinander abgestimmt. Hinzu kam, dass die Industrienetzwerke auch in geografischer Hinsicht nicht orga-nisch gewachsen waren, sondern nach strategischen und politischen Ge-sichtspunkten angelegt wurden, was zu hohen, die Rentabilität gefährdenden Transportkosten führte. Und nicht zuletzt war die Transformation der Sow-jetunion von einem Agrar- in ein Industrieland derart schnell vollzogen wor-den, dass die sozialen Strukturen und der einzelne Mensch diesen Änderun-gen kaum zu folgen vermochten – mit dem Ergebnis, dass die Möglichkeiten
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
215
des Maschinenparks mangels qualifizierter Fach- und Arbeitskräfte nie im vollen Unfang genutzt werden konnten. Enorme Schwierigkeiten brachten die demografischen Umwälzungen mit sich. Die Verstädterung nahm durch die Abwanderung vom Land massiv zu. Bereits in der Zeit der ersten beiden Fünfjahrespläne 1928–1938 stieg die städtische Bevölkerung um 14 % an. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich die Entwicklung fort. 1929 lebten 19 % der Gesamtbevölkerung in Städ-ten, 1985 waren es bereits 65,6 %. Gleichzeitig nahm der Anteil der im Ag-rarsektor arbeitenden Bevölkerung von über 80 % in 1917 auf rund 50 % in 1940 ab und sankt bis 1970 schließlich auf 20 %. Da der Wohnungsbau an-gesichts des Primats der Schwerindustrie und der Kriegszeit sträflich ver-nachlässig worden war, entstand in den Städten eine akute Wohnungsnot, die sich erst in den 1960er-Jahren etwas entspannte. Sie sorgte in den überfüllten Gemeinschaftswohnungen der Großstädte zu erschwerten Lebensumständen.
4.5.3 Die Wirtschaftsreformen unter Nikita Chruščev, Leonid Brežnev und Michail Gorbačev
Aufgrund der sozioökonomischen Veränderungen waren bereits Mitte der 1950er-Jahre die Umrisse einer neuen Gesellschaft entstanden. Aus einer wissenschaftlich-technischen Intelligenz, Bürokraten und einer differenzier-ten Arbeiterschaft bildete sich eine Mittelschicht, deren zivilisatorische An-sprüche nicht mehr quantitativ, sondern zunehmend auch qualitativ befrie-digt werden mussten. Die Planwirtschaft stalinistischen Zuschnitts war ledig-lich auf hohe Zuwachsraten ausgelegt. Die einfachen Vorkriegsmodelle konnten der komplexer werdenden Wirtschaft und der Ausrichtung auf Kon-sumansprüche nicht mehr gerecht werden. In der Folge sanken die Zuwachs-raten des Nationaleinkommens Ende der 1950er-Jahre von 14 % auf 6 %. Chruščevs (1894–1971) Programm der Entstalinisierung schlug sich kaum in greifbaren wirtschaftlichen Veränderungen nieder. Die Reformen von 1957 blieben in Tat und Wahrheit ein Dezentralisierungsversuch von oben, wobei lediglich die zentrale bürokratische Kontrolle in die Provinz umgelagert wurde. Daneben führten gigantische Investitionen vor allem im Bereich der stagnierenden Landwirtschaft kaum zu brauchbaren Resultaten, obschon sie – zusammen mit dem ambitiösen Rüstungs- und Raumfahrtprogramm – das Investitionskapital aufbrauchten. Chruščevs mangelnde Bereitschaft, die alten Wirtschaftsmuster zu verlassen, setzte enge Entfaltungsmöglichkeiten bis Anfang der 1960er-Jahre. Unter Leonid Brežnev (1907–1981) und dem Premierminister Aleksej Ko-sygin (1904–1980) ausgearbeitete Reformpläne sahen drei Maßnahmen vor, um die Planungs- und Strukturmängel zu beheben. Unter den Stichworten
Teil B: Systematischer Teil
216
Plan, Profit, Prämie sollte das bisherige Prinzip der reinen Planerfüllung flexibel und mit «marktwirtschaftlichen» Ansätzen reformiert werden. Eine erneut zentralisierte Wirtschaftsverwaltung sollte nur noch Rahmenpläne vorschreiben. Weitere Plandaten wie Kapitalinvestitionen sollten dezentral auf Betriebsebene entschieden werden. Ein Prämiensystem sollte Anreize schaffen und die strikte Durchsetzung der Planerfüllung ersetzen. Nach ers-ten Erfolgen versandeten die Reformen, weil die KPdSU und der bürokrati-sche Administrationsapparat sich scheuten, die ökonomische Kontrolle, ein Grundkonzept der stalinistischen Machterhaltung, abzugeben. Die Unver-einbarkeit zwischen Reformtheorie und der zunehmenden Verwaltungs-macht von Politadministratoren ließen die Wirtschaft weiter stagnieren. Doch die tiefer liegenden Strukturprobleme kamen nur allmählich zum Vor-schein. Daher können die Jahre zwischen 1966 und 1975 als die erfolg-reichsten der sowjetischen Wirtschaft gesehen werden: Nie waren die sozio-ökonomischen Lebensumstände des Sowjetbürgers besser gewesen. Ab Mitte der 1970er-Jahre traten die vorher verdeckten Mängel immer deut-licher zutage. Die Wachstumsraten sanken unter 3 %, die Versorgungslage wurde immer schwieriger, und das System des Anreizes für die Produktivi-tätssicherung funktionierte nicht mehr. Das lange doch tragfähige Verhältnis zwischen Proletariat und Partei zeigte immer größere Brüche. Der Aus-spruch «Ihr gebt vor, uns zu bezahlen, und wir geben vor zu arbeiten» wider-spiegelt die Krux einer Planwirtschaft, die Mitte der 1970er-Jahre anfing zu stagnieren. Parallel dazu wurde die Kluft zum Westen zunehmend größer, der Ende der 1970er daran war, den Schritt zur Dienstleistungs- und Techno-logiegesellschaft zu vollziehen. Dringende Wirtschaftsreformen waren ein Leitthema aller Reden Gorbačevs, nachdem er 1985 zum Generalsekretär der KPdSU ernannt worden war. Doch auch seine Bemühungen blieben in der Quadratur des Kreises – zwi-schen dem Credo des sozialistischen Eigentums an allen Produktionsmitteln und der Abkehr von planwirtschaftlichen Verhältnissen – stecken. Pläne einer kontrollierten Marktwirtschaft wurden skizziert, ohne dass jemals ein Gesamtreformplan vorgelegt worden wäre. Eine Inflation von Teilreformen und Nachreformen blockierte eine umfassende Erneuerung. Die ökonomi-sche Stagnation und Orientierungslosigkeit hatte den sowjetischen Staats- und Parteiapparat längst zerrüttet. Die letzten Bemühungen mündeten in den sogenannten «Šatalin-Plan» von 1990, der in Form einer Schocktherapie die Planwirtschaft innerhalb von 500 Tagen in eine Marktwirtschaft überführen sollte. Was als sozialistischer Reformplan unter Gorbačev seinen Anfang genommen hatte, führte in ein Jahrzehnt chaotischer Transformation in Rich-tung liberale Marktwirtschaft und demokratische Rechtssicherheit – ein Pro-zess, der noch nicht abgeschlossen und in den letzten Jahren unter Vladimir Putin ins Stocken geraten ist. Die Verzahnung zwischen der politischen
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
217
Vormachtstellung der Partei und den sozioökonomischen Strukturen in der Sowjetunion zeigte sich zwischen 1985 und 1991 deutlich. In dem Masse, wie die sozialistische Plan- und Kommandowirtschaft die absolute Kontrolle verlor, zersetzten sich die politischen Strukturen.
4.5.4 Die Wirtschaftsentwicklung in den sozialistischen Staaten Osteuropas
Nach dem Zweiten Weltkrieg durchliefen die meisten Satellitenstaaten der UdSSR eine ähnliche wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung wie die Sow-jetunion. Die Gleichschaltung der gesellschaftlichen Strukturen und der Poli-tik mit dem sowjetischen Modell setzte eine Verstaatlichung aller Wirt-schaftszweige voraus. Banken, Industrie, Handel und das Versicherungswe-sen waren ebenso betroffen wie der Boden, der kollektiviert wurde. Mehr als in allen anderen Sektoren war allerdings gerade in der Agrarwirtschaft die Übernahme des sowjetischen Modells nur mit Verzögerungen respektive nie durchzusetzen. Kurzzeitigen Industrialisierungserfolgen folgte sehr rasch die wirtschaftliche Stagnation. Einen eigenen Weg schlugen im osteuropäischen Raum aufgrund anderer politischer Rahmenbedingungen Jugoslawien, Alba-nien sowie Griechenland und Finnland ein. Die aufgezwungene Planwirtschaft brachte vor allem in Polen, Rumänien und Bulgarien einen Ausbau der Schwerindustrie und eine Beseitigung der Kriegsfolgen. Die gleichen Ansätze, die schon in der Sowjetunion erfolg-reich bei der Überwindung struktureller Hemmnisse zur Anwendung gelangt waren, trugen auch hier zum partiellen Erfolg bei. Das fehlende Kapital wurde durch eine hohe Reinvestitionsquote des Nationaleinkommens kumu-liert. Diese betrug teilweise bis zu 50 %, was dazu führte, dass der Lebens-standard – wie in der Sowjetunion – kaum wuchs, obwohl das statistische Bruttoinlandprodukt in gewissen Ländern in den ersten zwei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg auf das Fünffache stieg. Ebenfalls wie in der Sowjetunion wurde gleichzeitig die gesamte Konsumgüterproduktion ver-nachlässigt, was die Schere zwischen von oben diktierter Forcierung der Energie- und Schwerindustrie einerseits und der steigenden Nachfrage des Binnenkonsums andererseits immer weiter öffnete. Immerhin konnte dank der Industrialisierung – gerade in den südosteuropäischen Ländern – die agrarische Überbevölkerung als Strukturproblem der Wirtschaftsentwicklung abgebaut werden. Insofern brachte das sowjetische Prinzip anfänglich auch positive Resultate mit sich. Nach Erreichung eines gewissen Industrialisie-rungsniveaus in den späten 1950er-Jahren war das Potenzial der reinen, un-flexiblen Planwirtschaft jedoch ausgeschöpft, was zu einer Stagnation der Gesamtwirtschaft führte.
Teil B: Systematischer Teil
218
Der von Stalin um die Sowjetunion gelegte Sicherheitsgürtel von Staaten durfte am amerikanischen Marshall-Wirtschaftshilfeplan (> Glossar) nicht partizipieren – der Ausbruch des Kalten Krieges (> Glossar) ließ es opportun erscheinen, eine mögliche Einflussnahme der USA in der eigenen Hegemo-niezone unter allen Umständen zu verhindern. Als Gegengewicht gründete die Sowjetunion den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) (> Glos-sar). Allerdings besaß die Sowjetunion weder die finanziellen Mittel noch die Wirtschaftskraft, um die Bündnisländer nachhaltig zu unterstützen. Im Gegenteil: Im RGW, der zumindest auf dem Papier Synergien zwischen den einzelnen Planwirtschaften und eine arbeitsteilige Spezialisierung sicherstel-len sollte, standen in Tat und Wahrheit vor allem die Wirtschaftsinteressen der UdSSR im Vordergrund. Politische und ideologische Überlegungen tru-gen auch maßgeblich zur Forcierung der Schwerindustrie bei. Diese war vergleichsweise leicht zu kontrollieren und in die Mechanismen einer sozia-listischen Planwirtschaft einzubinden. Durch diese einseitige Ausrichtung des wirtschaftlichen Ausbaus entstanden Parallelstrukturen statt Synergien. Mangelwaren, insbesondere Konsumgüter, konnten auch bei den sozialisti-schen Partnern nicht bezogen werden. Die Planwirtschaft sowjetischen Zuschnitts zeigte sich außerstande, in den Satellitenstaaten mit weiterentwickelten Nationalökonomien komplexe Wirt-schaftsmechanismen mit einzubeziehen. In Ungarn und der Tschechoslowa-kei kam es infolge der planwirtschaftlichen Vorgaben sogar zu einem Abbau der Konsum- und Leichtgüterindustrie aus der Vorkriegszeit. Der Mangel an Effizienz und Produktivität ließ die Versorgungslage – bei zunehmender Kritik der Bevölkerung – immer schlechter werden. Reformversuche in Richtung einer sozialistischen Marktwirtschaft, wie sie unter anderem in der Ära Ale-xander Dubček (1921–1992) in der Tschechoslowakei unternommen wurden, unterband die UdSSR 1968 mit Gewalt. Die enge Verzahnung zwischen so-zioökonomischer Ideologie und politischem Monopolanspruch der herrschen-den kommunistischen Partei führte dazu, dass diese jeder Art von Reformsozi-alismus mit der Angst begegnete, die absolute Kontrolle zu verlieren. Als Kompromiss gegenüber der Bevölkerung wurde nach den Aufständen und Unruhen von 1956 in Ungarn, 1968 in der Tschechoslowakei und 1971 in Polen eine Anhebung des Lebensstandards angestrebt. Diese Strategie, die ein Stillhalteabkommen mit der aufbegehrenden Bevölkerung gewährleisten sollte, bestimmte vor allem in Polen und Ungarn die weitere Entwicklung der sozialistischen Wirtschaft. Eine beschränkte Öffnung gegen Westen bot die Möglichkeit, Auslandskredite zu erhalten. Im Unterschied zur zögerlichen Reformpolitik der übrigen RGW-Teilnehmer wagte sich Ungarns Wirtschaftspolitik nach 1958 unter János Kádár weit vor, um die Lebensumstände der desillusionierten Bevölkerung zu verbes-
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
219
sern. Tatsächlich konnten hier Ansätze einer sozialistischen Marktwirtschaft wie Dezentralisierung, intensivierte Konsumgüterproduktion, Wirtschaftsaus-tausch mit dem Westen und gar Teilprivatisierungen in beschränktem Um-fang Fuß fassen. Die intensivierten Reformen seit 1965 gingen unter der Bezeichnung «Neuer ökonomischer Mechanismus» viel weiter als die Re-forminitiativen Kosygins in der Sowjetunion. Produktionsvorgaben und die feste Vergabe von Produktionsgütern wurden durch vertragliche Vereinba-rungen zwischen Lieferanten und Abnehmern ersetzt. Als Anreiz für die Pro-duktivitätssteigerung diente nicht mehr ein Prämiensystem, sondern eine Teilhabe der Arbeitnehmer am Nettogewinn – wobei allerdings komplexe Bandbreiten durch staatliche Makrointeressen festgelegt wurden. Dennoch gelang es auch in Ungarn nicht, den Spagat zwischen Flexibilisierung und der weiterhin bestehenden zentralen Verwaltungswirtschaft zu vollbringen. Trotzdem hieß es im Volksmund, Ungarn sei die fröhlichste Baracke im sozia-listischen Lager. Die Auslandsverschuldung wuchs massiv an, während das reale Wirtschaftswachstum gegen null tendierte. Seit den 1980er-Jahren verlief sich die ungarische Wirtschaft in einer verdeckten Stagnation: Weil die Trägheit der staatsgelenkten Wirtschaft nie ernsthaft in Frage gestellt worden war, hatte der Weg auch hier – wenn auch über den Umweg von Reformen – wieder in die gleiche Sackgasse geführt. In Polen versuchte die Parteiführung, die Industrialisierung weiter zu be-schleunigen, um aus eigener Kraft die Versorgungslage zu verbessern und den Lebensstandard anzuheben. Gleichzeitig sollte das nötige Kapital nicht wie bisher durch Konsumverzicht, sondern durch Auslandskredite sicherge-stellt werden; auf diese Weise konnten Versorgungsengpässe durch Importe aus dem Westen kaschiert werden. Nach einigen Erfolgen zeichnete sich aber ab, dass der spürbare Anstieg des Lebensstandards wie in Ungarn nur durch eine massive Auslandsverschuldung erkauft worden war. Die plan-wirtschaftlich statt marktwirtschaftlich geleiteten Investitionen hatten zu einem noch größeren Ungleichgewicht zwischen Konsum- und Schwerin-dustrie geführt. Im schwierigen Weltwirtschaftsumfeld der 1970er-Jahre, während der durch die Ölkrise hervorgerufenen Rezession in den Industrie-ländern, konnte sich die neu aufgebaute Industrie Polens nicht behaupten und sah sich außerstande, den Schuldenberg abzubauen: Polen musste die Importe immer weiter zurücknehmen, so dass Anfang der 1980er-Jahre die strukturellen Probleme der Planwirtschaft und entsprechende Versorgungs-engpässe immer drastischer zum Vorschein kamen. In allen RGW-Staaten erwies sich die Landwirtschaft – neben der Konsum-güterproduktion – als Leidtragende der politisch bedingten Prioritätenset-zung. Weil die Landwirtschaft zugunsten der Schwerindustrie vernachlässigt wurde, konnte wegen fehlender Investitionen keine eigentliche Agrarrevolu-tion stattfinden. Lediglich in Ungarn verzeichnete die Lebensmittelprodukti-
Teil B: Systematischer Teil
220
on dank einer Liberalisierung der Agrarwirtschaft einigen Erfolg. Besonders schwierig gestaltete sich die Situation in Polen und im blockfreien (> Glos-sar) Jugoslawien. Hier stießen die Kollektivierungsmaßnahmen auf den er-bitterten Widerstand der ländlichen Bevölkerung. Der polnische Sozialismus und der Titoismus in Jugoslawien konservierten eine kleinbäuerliche Wirt-schaftswelt, die keine grundlegende Modernisierung und Rationalisierung der Landwirtschaft erlaubte. Die Überbevölkerung auf dem flachen Land belastete die Wirtschaft in den jugoslawischen Teilrepubliken Serbien, Bos-nien-Herzegowina und Makedonien. Die Entstehung eines Sonderfalls Jugoslawien wurde durch den Bruch, den J. B. Tito (1892–1980) bereits 1948 mit Stalin vollzogen hatte, überhaupt erst ermöglicht. Daraus entstand ein ideologischer Freiraum, in dem ein ei-genständiger sozioökonomischer Weg gesucht werden konnte. Einen Irrtum des stalinschen Sozialismus sah die Kommunistische Partei Jugoslawiens darin, dass die Produktionsmittel der UdSSR in die Hände des Staates statt in die der Gesellschaft gelangt seien. In der Folge versuchte die Partei in Jugos-lawien früh, eine Wirtschaftsstruktur aufzubauen, welche die leninsche Lo-sung vom Absterben des Staates ermöglichen sollte. Der Bund der Kommu-nisten Jugoslawiens (offizielle Bezeichnung nach 1952) setzt sich eine sozia-listische Marktwirtschaft zum Ziel, die alle Reformen in den Satellitenstaa-ten der UdSSR an Radikalität übertraf. Angestrebt wurde eine Arbeiter-selbstverwaltung, in deren Rahmen die Betriebe Eigenverantwortung in Form von Verlust- und Erfolgsrechnung zu führen hatten, während die zent-ralen Befugnisstellen kontinuierlich abgebaut wurden. Die Föderalisierung Jugoslawiens förderte diese allgemeine Dezentralistisierung zusätzlich. Doch auch hier mündete das Prinzip einer weitgehenden sozialistischen Markt-wirtschaft im Lauf der 1970er-Jahre in eine Sackgasse. Neben dem großen Wirtschaftsgefälle zwischen den einzelnen Republiken waren der Geld- und Zeitaufwand der Selbstverwaltungsorgane in den Betrieben enorm und be-triebswirtschaftlich nicht tragbar. Die frühe Öffnung gegen den Westen und die Liberalisierung führten zu einem ausgeprägten Konsumverhalten, das die Pro-Kopf-Produktivität seit den späten 1960er-Jahren bei Weitem überstieg. Die Folge waren eine enorme Auslandsverschuldung und Inflationsraten, die in den 1980er-Jahren völlig außer Kontrolle gerieten. Wegen den geringen wirtschaftlichen Möglichkeiten wanderten viele qualifizierte Arbeitskräfte in den Westen aus. Ende der 1970er-Jahre war auch Jugoslawiens Konzept eines eigenständigen Sozialismus, jenseits der Theorie einer funktionieren-den sozialistischen Marktwirtschaft, zwischen Marx und Markt gefangen und nicht mehr ausbaufähig. Schließlich war der Kampf um Ressourcen und die fehlende Bereitschaft der wirtschaftsstärkeren Republiken, die anderen Republiken weiter querzufinanzieren, ein ausschlaggebender Grund für das gewaltsame Auseinanderbrechen Jugoslawiens 1991.
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
221
4.6 Forschungskontroversen Gab es in Russland neben der Autokratie alternative Herrschaftstradi-tionen? Früher vertrat die gängige Lehrmeinung die These, dass die Städte des Kie-ver und Moskauer Reiches kein eigenständiges Stadtrecht und keine Auto-nomie hervorgebracht hätten. Zu übermächtig sei die Stellung der Fürsten gewesen, welche die Städte als Residenz benutzten; daher seien die Städte – anders als in Westeuropa – nicht zur Keimzelle jener alternativen Herr-schaftsauffassung geworden, die anstelle der vertikalen die horizontale Ver-netzung innerhalb einer Gemeinschaft betonte. Insofern habe an der Wende zur Neuzeit eine kommunale und partizipative Verfassungstradition gefehlt, die den Weg zu einem republikanisch-bürgerlichen Staatswesen hätte weisen können: Zu absolut und konkurrenzlos sei der Machtanspruch der zarischen Autokratie gewesen. Neuere Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass gerade die nordrussi-schen Stadtrepubliken Novgorod und Pskov durchaus als Übergangszone zwischen Westeuropa und Russland verstanden werden können. In beiden Städten wurde ein schriftliches Stadtrecht fixiert, das die Kompetenzen der einzelnen Gerichte und die Verfahrensweisen regelte; beide Stadtgemeinden setzten sich ein autonomes Recht, wählten Stadtmagistrate und hatten wie die Kommunen in Westeuropa schwurrechtlich organisierte Volksversamm-lungen. Allerdings kann man davon ausgehen, dass diese Volksversammlun-gen sich nicht nur aus Stadtbürgern, sondern aus allen Freien der Stadtrepu-blik zusammensetzten. So gesehen gab es kein auf das Stadtterritorium be-grenztes Bürgerrecht wie etwa in der deutschen Stadt, vielmehr zeigen sich Parallelen zum italienischen Stadtstaat. In Novgorod und Pskov rekrutierte sich die sozioökonomische Elite aus der städtischen Bevölkerung und nicht aus der Gefolgschaft der Fürsten. So zeugt bereits die Selbstbezeichnung «gospodin Pskov» (Herrschaft Pskov) vom Selbstbewusstsein des dortigen Stadtadels, nicht auf die fürstliche Legitimation angewiesen zu sein. Vor allem in der frühen Zeit bildeten neben dem Großgrundbesitz auch Handel und Gewerbe die Grundlagen des wirtschaftlichen Erfolgs dieser Städte und ihres Patriziats – und nicht das sonst gültige Prinzip Land gegen Dienst ge-genüber dem Fürsten. Zusammenfassend gesehen stellten Novgorod und Pskov durchaus alternative Herrschafts- und Wirtschaftskonzepte innerhalb der Rus’ dar. Die Eroberung Novgorods und Pskovs durch das autokratische Moskau Ende des 15. bzw. Anfang des 16. Jahrhunderts verhinderte aller-dings die weitere Entwicklung dieses Modells.
Teil B: Systematischer Teil
222
Wie waren die Entwicklungschancen der dörflichen Gesellschaft im Russland des 19. Jahrhunderts? Sehr lange ging die Geschichtsschreibung, insbesondere die sowjetische, da-von aus, dass die Bauern im Laufe des 19. Jahrhunderts zusehends verarmt und verelendet gewesen seien. Als Ursachen wurden die explosionsartige Be-völkerungszunahme und die Überbesetzung in der Landwirtschaft, steigende Steuerlasten, sinkende Marktpreise für den Weizen und zu hohe Ablösungs-zahlungen nach der Bauernbefreiung genannt. Der Staat habe mit der Verar-mung der bäuerlichen Schicht die forcierte Industrialisierung finanziert; erst nach 1900 seien die Lebensbedingungen wieder deutlich besser geworden. Dieses negative Bild wurde in jüngster Zeit durch zahlreiche Untersuchun-gen revidiert. Erstens gelang es den Bauern ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, die Produktivität erheblich zu steigern. Zudem wur-den die letzten Freiflächen unter den Pflug genommen, um die Saatfläche zu erhöhen. Die fortschreitende Urbanisierung bot dem Bauern insbesondere in den nordwestrussischen Gebieten gute Absatzmöglichkeiten für Gemüse- und Milchprodukte. Immer wichtiger wurde auch der Nebenerwerb: Vor allem die Wanderarbeit verbesserte das Einkommen der Bauern beträchtlich, denn gerade in den Industriegebieten ergaben sich neue Verdienstmöglich-keiten. Auffällig ist, dass die Wanderarbeiter aufgrund der Agrarverfassung und staatlicher Verordnungen – und vor allem deswegen, weil sie an ihrer Tradition und Erfahrung festhielten – nicht in die städtische Bevölkerung integriert wurden. Trotz erhöhten wirtschaftlichen Drucks verstanden es die Bauern, sehr flexi-bel auf die Einkommensverluste zu reagieren und neue Einkommensquellen zu erschließen. Trotz widriger Verhältnisse erhöhte sich – wenn auch mit großen regionalen Unterschieden – der Lebensstandart auf dem flachen Land; insofern kann die These einer allgemeinen Verelendung der Bauern nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Situation veränderte sich aber nicht in dem Masse wie in Westeuropa, wo die Betriebsgröße zunahm und sich der Bauer allmählich zum wirtschaftlich denkenden Lebensmittelproduzenten wandelte. Auch nach den Reformen Stolypins blieb ein Großteil der Bauern in der Mir verankert, wobei sich die Größe der Höfe kaum änderte. Der Balkan als Analysekategorie? Komparatistisch-strukturgeschichtliche Ansätze in Verbindung mit der Mo-dernisierungstheorie setzen sich der Gefahr aus, Stereotype zu verstärken, indem sie mit Begriffen wie «Backwardness» und «nachholender Entwick-lung» operieren. Gerade für den südosteuropäischen Raum wurde die Frage rege und äußerst kontrovers diskutiert, inwiefern der Balkan als Analyseka-tegorie anwendbar sei. Dabei wurde kritisiert, dass gerade der oft negativ
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
223
konnotierte Begriff «Balkan» nur das Anderssein dieser Region betone und einer eurozentrischen Perspektive Vorschub leiste – der Balkan also letztlich nur eine Fiktion und ein alter Ego des Westens sei, der sich im Anderssein des Balkans selbst definiere. Bei der Vergleichskategorie Industrialisierung wurde insbesondere festgehalten, dass gerade solch langfristig angelegte Modelle Gefahr liefen, teleologisch und deterministisch zu sein (siehe Lite-raturliste Todorova). Als Alternative wird postuliert, von einer grundlegen-den Allgemeinheit der Menschheit auszugehen und detaillierte geografische Studien zu erstellen. Auf der anderen Seite wurde argumentiert, dass Klassifizierungen zwar eine Simplifizierung bedeuten, aber ein nötiges Hilfsmittel bei der Konstruktion von Analyseräumen darstellen. Dabei werden für den Balkanraum folgende Unterscheidungsmerkmale zur westeuropäischen Entwicklung zitiert: 1. Die Instabilität der Siedlungsverhältnisse und ethnische Gemengelagen auf kleinstem Raum; 2. Verlust und späte Rezeption des antiken Erbes; 3. das byzantinische-orthodoxe Erbe; 4. das osmanisch-islamische Erbe und 5. die gesellschaftliche und ökonomische «Rückständigkeit» in der Neuzeit. Damit wird postuliert, dass es «jenseits der affektiven Stereotype» Merkmale gebe, die es erlaubten, «den Balkan als Raum sui generis zu verstehen» (siehe Literaturliste Sundhaussen).
Literatur zum Abschnitt B.4: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Allgemeine Übersichtswerke
Bairoch, Paul; Batou, Jean; Chèvre, Pierre: La population des villes européennes de 800 à 1850, Genève 1988.
Borchardt, K. (Hrsg.): Europäische Wirtschaftsgeschichte in 5 Bänden, Stuttgart 1979.
Chirot, Daniel (Hrsg.): The Origins of Backwardness in Eastern Europe. Berkeley, Los An-geles, London 1989, S.15–52.
Gerschenkron, Alexander: Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge 1962.
Goehrke, Carsten: Die Anfänge des mittelalterlichen Städtewesens in eurasischer Perspektive, in: Saeculum 31 (1980), S. 194–239.
Goehrke, Carsten: Transformationschancen und historisches Erbe. Versuch einer vergleichen-den Erklärung auf dem Hintergrund europäischer Geschichtslandschaften, in: Ders. (Hrsg.): Transformation und historisches Erbe in den Staaten des europäischen Ostens, Bern 2000, S. 651–741.
Teil B: Systematischer Teil
224
Goehrke, Carsten; Pietrow-Ennker, Bianka (Hrsg.): Städte im östlichen Europa. Zur Proble-matik von Modernisierung und Raum vom Spätmittelalter bis zum 20. Jahrhundert, Zürich 2006.
Hroch, Miroslaw; Klusáková, Luda (Hrsg.): Criteria and Indicators of Backwardnes, Prague 1996.
Kaser, M. C.; Radice, E.A. (Hrsg.): The Economic History of Eastern Europe, 1919–1975. 3 vols., Oxford 1985–1986.
Kellenbenz, Hermann (Hrsg.): Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 6 Bde., Stuttgart 1980–1993.
Mumenthaler, Rudolf: Spätmittelalterliche Städte West- und Osteuropas im Vergleich: Ver-such einer Verfassungsgeschichtlichen Typologie, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 46 (1998), S. 39–68.
Nolte, Hans-Heinrich: Zur Stellung Osteuropas im internationalen System der frühen Neuzeit. Aussenhandel und Sozialgeschichte bei der Bestimmung der Regionen, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 28 (1980), S. 161–197.
Senghaas, Dieter: Von Europa lernen. Entwicklungsgeschichtliche Betrachtungen, Frank-furt/M. 1982.
Sundhaussen, Holm: Die Ursprünge der osteuropäischen Produktionsweise in der Frühen Neuzeit, in: Boškovska, Nada (Hrsg.): Die frühe Neuzeit in der Geschichtswissenschaft. Forschungstendenzen und Forschungserträge, Zürich 1997, S. 145–162.
Sundhaussen, Holm: Zur Wechselbeziehung zwischen frühneuzeitlichem Aussenhandel und ökonomischer Rückständigkeit in Osteuropa. Eine Auseinandersetzung mit der «Kolonialthe-se», in: Geschichte und Gesellschaft 9 (1983), S. 544–563.
Wallerstein, Immanuel: Das moderne Weltsystem. Die Anfänge kapitalistischer Landwirt-schaft und die europäische Weltökonomie im 16. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1986.
Russland
Altrichter, Helmut: Die Bauern von Tver. Vom Leben auf dem russischen Dorfe zwischen Revolution und Kollektivierung, München 1984.
Andrle, Vladimir: A Social History of Twentieth Century Russia, London 1994.
Bushkovitch, Paul: The Merchants of Moscow 1580–1650, London u.a. 1980.
Blackwell, William L.: The Industrialization of Russia. A Historical Perspective, New York 1970.
Fenster, Aristide: Adel und Ökonomie im vorindustriellen Russland. Die unternehmerische Tätigkeit der Gutsbesitzer in der grossgewerblichen Wirtschaft, Wiesbaden 1983.
Geyer, Dietrich (Hrsg.): Wirtschaft und Gesellschaft im vorrevolutionären Russland, Köln 1975.
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
225
Goehrke, Carsten; Hellmann, Manfred; Lorenz, Richard; Scheibert, Peter: Russland, Frank-furt/M. 1973.
Gregory, Paul. R: Before Command. An Economic History of Russia from Emancipation to the First Five-Year-Plan, Princeton 1994.
Hartley, Janet Margaret: A Social History of the Russian Empire, 1650–1825, London 1999.
Haumann, Heiko: Die russische Stadt in der Geschichte, in: Jahrbücher für Geschichte Osteu-ropas 27 (1979), S. 481–497.
Haumann, Heiko: Plaggenborg, Stefan (Hrsg.): Aufbruch der Gesellschaft im verordneten Staat. Russland in der Spätphase des Zarenreichs, Frankfurt/M. 1994.
Heller, Klaus: Russische Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. l: Die Kiever und die Mos-kauer Periode (9.–17. Jahrhundert), Darmstadt 1987.
Heller, Klaus: Die Stellung des russischen Kaufmanns im Aussenhandel Russlands während des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Mathis, Franz; Riedmann, Josef: Exportgewerbe und Aus-senhandel vor der industriellen Revolution, Innsbruck 1984, S. 186–197.
Heller, Klaus: Geschichte des modernen Unternehmertums in Russland bis 1917, in: Digitales Handbuch zur Geschichte und Kultur Russlands und Osteuropas, VifaOst 2005 http://www.vifaost.de/texte-materialien/digitale-reihen/handbuch.
Hildermeier, Manfred: Bürgertum und Stadt in Russland 1760–1870. Rechtliche Lage und soziale Struktur, Köln u.a. 1986.
Jarmo, Kotilaine: Russia’s Foreign and Economic Expansion in the Seventeenth Century. Windows on the World, Leiden 2005.
Kahan, Arcadius: Russian Economic History. The Nineteenth Century, Chicago 1989.
Kischtymau, Andrey: Rückständigkeit und Industrialisierung im 20. Jahrhundert, in: Beyrau, Dietrich; Lindner, Rainer (Hrsg.): Handbuch der Geschichte Weissrusslands, Göttingen 2001.
Kusber, Jan: Krieg und Revolution in Rußland. Das Militär im Verhältnis zu Wirtschaft, Autokratie und Gesellschaft. Stuttgart 1997.
Lotman, Jurij M.: Russlands Adel. Eine Kulturgeschichte von Peter I. bis Nikolaus I, Köln 1997.
Rüss, Hartmut: Herren und Diener. Die soziale und politische Mentalität des russischen Adels. 9.-17. Jahrhundert, Köln 1994.
Steinberg, Dmitri: The Soviet Economy, 1970–1990. A Statistical Analysis, San Francisco 1990.
Uhlig, Christiane; Büscher, Martin: Systemtransformation und Homo oeconomicus. Instituti-onelle Voraussetzungen der Marktwirtschaft am Beispiel der Wirtschaftsgesinnung im russi-schen Kulturraum, St. Gallen 1994.
Teil B: Systematischer Teil
226
Ostmitteleuropa
Baczkowski, Krzysztof: Die Städte in den Ständevertretungen Ostmitteleuropas gegen Ende des Mittelalters, in: Bohemia 30 (1989), S. 1–17.
Berend, Iván T.; Ránki, György: The Hungarian Economy in the Twentieth Century, London 1985.
Biskup, Marian; Zernack, Klaus (Hrsg.): Schichtung und Entwicklung der Gesellschaft in Polen und Deutschland im 16. und 17. Jahrhundert. Parallelen, Verknüpfungen Vergleiche, Wiesbaden 1983.
Bömelburg, Hans-Jürgen: Zwischen polnischer Ständegesellschaft und preußischem Obrig-keitsstaat. Vom Königlichen Preußen zu Westpreußen (1756–1806), München 1995.
Cerman, Markus; Luft, Robert: Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im«alten Reich». Sozialgeschichtliche Studien zur frühen Neuzeit. München 2005.
Conze, Werner; Piesowicz, W.: Sozialgeschichte Polens. Die Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 1990.
Fink, Krisztina Maria: Die österreichisch-ungarische Monarchie als Wirtschaftsgemeinschaft, München 1968.
Good, David F.: The Economic Rise of the Habsburg Empire, 1750–1914, Berkeley 1984.
Kochanowicz, Jacek: Backwardness and Modernization. Poland and Eastern Europe in the 16th–20th Centuries, Hampshire 2006.
Korbonski, Andrzej: The Politics of Economic Reforms in Eastern Europe. The Last Thirty Years, in: Soviet Studies 41 (1989), S. 1–19.
Krzemieńska, Barbara; Třeštik, Dušan: Wirtschaftliche Grundlagen des frühmittelalterlichen Staates in Mitteleuropa, in: Acta Poloniae Historica 40 (1979), S. 5–31.
Mączak, Antoni; Samsonowicz, Henryk; Burke, Peter (Hrsg.): East-Central Europe in Transi-tion. From the Fourtheenth to the Seventeenth Century, Cambridge 1985.
Schmidt, Christoph: Leibeigenschaft im Ostseeraum. Versuch einer Typologie, Köln 1997.
Staszewski, Jacek: Die Polnische Adelsrepublik im 18. Jahrhundert im Licht neuerer For-schungen, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 52/4 (2003), S. 572–583.
Teichova, Alice (Hrsg.): Central Europe in the Twentieth Century. An Economic History Perspective, Aldershot 1997.
Teichova, Alice: Wirtschaftsgeschichte der Tschechoslowakei 1918–1980, Wien u.a. 1988.
Zimányi, Vera: Economy and Society in Sixtheenth and Seventeenth Century Hungary (1526–1650), Budapest 1987.
4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
227
Südosteuropa
Brunnbauer, Ulf; Höpken, Wolfgang (Hrsg.): Transformationsprobleme Bulgariens im 19. und 20. Jahrhundert. Historische und ethnologische Perspektiven, München 2007.
Höpken, Wolfgang; Sundhaussen, Holm (Hrsg.): Eliten in Südosteuropa. Rolle, Kontinuitäten, Brüche in Geschichte und Gegenwart, München 1998.
Jelavich, B.; Jelavich, C. (Hrsg.): The Balkans in Transition, Los Angeles 1963.
Kaser, Karl: Das Abdriften Südosteuropas vom dominierenden europäischen Entwicklungs-weg seit dem 11. Jhd., in: Balkan Studies 29/2 (1988), S. 239–364.
Lampe, John R.: Jackson, Marvin R: Balkan Economic History 1550–1950. From Imperial Borderlands to Developing Nations, Bloomington 1982.
Inalcik, Halil: Quataert, Donald: An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914, Cambridge 1994.
Laiou, Angeliki E.; Morrisson, Cécile: The Byzantine Economy, Cambridge 2007.
Lampe, John R.: The Bulgarian Economy in the Twentieth Century, London 1986.
Lydall, Harold: Yugoslavia in Crisis, Oxford 1989.
McGowan, Bruce: Economic Life in Ottoman Europe. Taxation, Trade and the Struggle for Land 1600–1800, Cambridge 1981.
Melville, Ralph; Schröder, Hans-Jürgen: Der Berliner Kongress von 1878. Die Politik der Grossmächte und die Probleme der Modernisierung in Südosteuropa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Wiesbaden 1982.
Palairet, Michael: The Balkan Economies, 1800–1914. Evolution Without Development, Cambridge 1997.
Schönfeld, Roland (Hrsg.): Industrialisierung und gesellschaftlicher Wandel in Südosteuropa, München 1989.
Sundhaussen, Holm: Der Balkan als historischer Raum Europas, in: Geschichte und Gesell-schaft 25 (1999), S. 626–653.
Teichova, Alice: Kleinstaaten im Spannungsfeld der Grossmächte. Wirtschaft und Politik in Mittel- und Südosteuropa in der Zwischenkriegszeit, München 1988.
Todorov, Nikolai: The Balkan City 1400–1900, Seattle u.a. 1983.
Todorova, Maria: Der Balkan als Analysekategorie: Grenzen, Raum, Zeit, in: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), S. 470–492.
Todorova, Maria: The Trap of Backwardness. Modernity, Temporality, and the Study of Eastern European Nationalism, in: Slavic Review 64/1 (2005), S. 140–164.
Turnock, David: The Romanian Economy in the Twentieth Century, London 1986.
1. Russland und die Sowjetunion
229
TEIL C: REGIONALE SCHWERPUNKTE
1. RUSSLAND UND DIE SOWJETUNION
1.1 Epochen und ihre Namen: Periodisierung Historische Epochen lassen sich nur schwer eindeutig eingrenzen: Einzelne Merkmale (Entwicklungen, Prozesse, Strukturen, Ereignisse) können dabei je nach Perspektive unterschiedlich gewichtet sein. Die gängigen Periodisie-rungen orientieren sich in der Regel an der politischen Geschichte und ihren Umbrüchen und vernachlässigen nicht selten sozial- und kulturgeschichtli-che Kontinuitäten. Die übliche – wenn auch nicht unumstrittene – Aufteilung der historischen Entwicklung des westlichen Europa vom Mittelalter (5./6.–15. Jhd.) bis in die Neuzeit, die in die Frühe Neuzeit (16.–18. Jhd.) und die Moderne (ab 19. Jhd.) unterteilt wird, lässt sich nur schwer auf die Geschichte Russlands übertragen. Die Entwicklung in Russland bestimmten eigene Dynamiken, so entsprechen die Epochengrenzen der russischen Geschichte nicht den übli-chen des westlichen Europa und bleiben in der historischen Forschung wei-terhin Gegenstand von Kontroversen. Die Geschichte Russlands bis zur Herrschaft Peters I. (1682/1689–1725) wird nicht selten als «vorpetrinische» Epoche bezeichnet. Denn die Herr-schaft Peters I. galt lange Zeit als absolute Wasserscheide zwischen der alten Rus’ und dem modernen Russland. Die seit Peter I. verstärkten kulturellen Einflüsse aus dem westlichen Europa dienen hier als wesentliches Merkmal für die Epochengrenze. Diese Zweiteilung der russischen Geschichte bis 1917 in ein «vorpetrinisches Russland» und ein «Russland nach Peter I.» geht auf die Debatten um das Verhältnis von Russland und Westeuropa, um die Europäisierung und die «kulturelle Rückständigkeit» Russlands zurück, die seit den 1830er-Jahren zwischen den Befürwortern eines «europäischen Weges» Russlands (Westler) und den Advokaten einer eigenständigen Ent-wicklung (Slawophile) geführt wurden. Für die Westler bedeutete die «vor-petrinische» Periode Rückständigkeit, die Slawophilen beschworen hingegen die harmonische Welt altrussischer Traditionen vor Peter, ähnlich den Neo-Slawophilen der post-sowjetischen Zeit. Diese starke Orientierung am Ver-hältnis zum westlichen Europa bei der Periodisierung der Geschichte Russ-lands übernahm auch die Forschung: Für einige Forscher entspricht das «vorpetrinische Russland» dem Mittelalter und die Periode seit Peter I. der Neuzeit. Die spezifische Epoche des Übergangs zur modernen Staatlichkeit, Frühe Neuzeit, die im westlichen Europa ungefähr die Zeitspanne vom 16. bis 18. Jahrhundert markiert, wird dabei für die Geschichte Russlands
Teil C: Regionale Schwerpunkte
230
zum Teil als nicht vorhanden oder als eine kurze Periode des späten Mos-kauer Reiches in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts betrachtet. Andere Autoren identifizieren neuzeitliche Entwicklungen im Moskovien des frühen 16. Jahrhunderts und setzen die Frühe Neuzeit in dieser Zeitspanne an. Die Neuzeit in der Geschichte des Zarenreiches (18./19. Jhd.) wird auch als Epoche des «Petersburger Imperiums» bezeichnet, mit der Betonung der Zentralstellung der neuen Hauptstadt, und umschreibt die Herrschaftsform seit Peter I. bis zur Abdankung der russischen Zaren 1917. Die sowjetische Epoche wird in der Regel durch die Revolution von 1917 und die Auflösung der Sowjetunion 1991 markiert. Als eigene Übergangs-epoche wird manchmal auch der Umbruch zwischen 1917 und 1920/21 – die Revolution und der Bürgerkrieg – gesehen.
1.2 Von der Kiever Rus’ bis zur Mongolenherrschaft Die frühe Geschichte Russlands lässt sich in drei Epochen aufteilen: die Periode der Kiever Rus’ vom 9. Jahrhundert bis zum Einfall der Mongolen um 1237–1240; die Oberherrschaft der Mongolen über die Territorien der Rus’ von 1240 bis ca. 1340 sowie die anschließende Zeitspanne bis zum Aufstieg Moskaus.
1.2.1 Kiever Rus’ (9.–13. Jahrhundert)
Die slawischen und finnischen Stämme, die das Territorium des späteren Kiever Reiches in der Waldzone entlang der Flüsse Dnjepr, westliche Dvina, Volchov und Wolga bewohnten, waren auch Jäger und Sammler. Doch vor allem ernährten sie sich vom Ackerbau. Sie trieben zudem Handel (mit Pelzwaren oder auch Sklaven unter anderem gegen Silber) mit den Bulgaren (> Glossar) und Chazaren an der Wolga sowie dem byzantinischen Außenposten in Cherson auf der Halbinsel Krim. Wie aus dem losen Netz jener Stämme im 9. Jahrhundert das Herrschaftsgebilde erwuchs, das den Namen der Kiever Rus’ erhielt, bleibt weiterhin in vieler Hinsicht unklar. Aufgrund der später entstandenen Chroniken, archäologischer Funde sowie ausländischer Reiseberichte lässt sich Folgendes rekonstruieren: Im frühen 9. Jahrhundert kamen in diese Gebiete skandinavische Krieger und Händler (bekannt als «Waräger» (> Glossar) oder «Rus’»), die am Handel an der Route nach Byzanz interessiert waren und die lokalen Slawenstämme regelmäßig ausplünderten, um ihre Beute im Ostseeraum zu verkaufen. Im Laufe des 9. Jahrhunderts wurden die Kontakte der Skandinavier und Slawen häufiger und enger – die Skandinavier übernahmen die Kontrolle über zentrale Handelsumschlagplät-
1. Russland und die Sowjetunion
231
ze der Slawen und etablierten dort Herrschaftszentren. Mit der Zeit erhielten sie den Status slawischer Fürsten. Die älteste ostslawische Chronik aus dem 11. und frühen 12. Jahrhundert, die «Erzählung der vergangenen Jahre», auch nach dem vermeintlichen Verfasser die «Nestorchronik» (> Glossar) genannt, berichtet über die «Berufung» des Warägers Rjurik und seiner Brüder, die sich Rus’ nannten, zur Herrschaft und Befriedung zerstrittener Slawenstämme im Jahre 862. Diese Berufungslegende führte seit dem 18. Jahrhundert zu historiografischen und ideologischen Debatten über den normannischen bzw. autochthonen Ursprung der «russischen Staatlichkeit». Vor allem die Herkunft des Namens Rus’ sorgte dabei für heftige Kontroversen: Verschiedene Theorien sollten den jeweiligen Standpunkt stärken – den autochthonen etwa mit der Ableitung des Namens Rus’ von einem Nebenfluss des Dnjepr, von einem alten russischen Volksnamen, von einem Stammesnamen oder einem nordrussischen Fluss. Die heutige Forschung führt den Namen Rus’ auf die schwedische Bezeichnung für Rudermänner – rothsmenn – zurück. Die extremen Positionen sowohl der «Normannisten» als auch der Verfechter einer rein autochthonen Gründung des Kiever Reiches erwiesen sich als irreführend, waren doch die wechselseitigen Einflüsse und Prozesse der Herrschaftsbildung und Konsolidierung der einzelnen Stammeseliten zu einem politischen Gebilde viel komplexer. Die erste Herrscherdynastie auf dem Gebiet des Kiever Reiches, die Rjurikiden, die sich auf diese Ursprünge beriefen, waren zwar in der Tat normannischer Herkunft, haben sich allerdings schnell an die Gewohnheiten der Slawen angepasst. Trugen die ersten bekannten Rjurikiden noch germanische Namen, Helgi/Oleg und Ingvar/Igor, so hießen ihre Nachfolger Svjatoslav und Vladimir. Rasch ver-schmolzen die Normannen mit den lokalen Eliten der Slawen und verbanden sich zum Herrschaftsgebilde namens Rus’ mit dem Hauptsitz in Kiev. Dieses Reich zeichnete sich durch ethnische und religiöse Vielfalt aus (vgl. Die Slawen, S. 62; Frühe Herrschaftsbildung: die Kiever Rus’, S. 135). Die Sicherung des Herrschaftsgebietes und die innere politische Konsolidie-rung der Kiever Rus’ sowie die Etablierung ihrer Machtansprüche im euro-päischen Kontext gelang den Rjurikiden nicht zuletzt durch die Annnahme des Christentums 988 (vgl. Christianisierung: Unterschiede zwischen Ost- und Westkirche, S. 96). Über die Taufe des Fürsten Vladimir des Heiligen (980–1015) berichtet die Chronik, er habe sich nach dem Gespräch mit den Vertretern der monotheistischen Religionen für den christlichen Glauben byzantinischer Prägung entschieden, weil der Ritus der griechisch-orthodoxen Kirche am «schönsten» sei, im Vergleich zu den Juden, römi-schen Katholiken und Muslimen. Beim Islam hätten ihn zudem der Verzicht auf Alkohol sowie die Beschneidung abgeschreckt. Erst zum Schluss des
Teil C: Regionale Schwerpunkte
232
stilisierten Berichts benennt die Chronik den ausschlaggebenden Grund für die Annahme des byzantinischen Glaubens: die Verehelichung Vladimirs mit Anna, der Schwester des byzantinischen Kaisers – eine außerordentliche Ehre für den Rus’-Fürsten, die selbst den Ottonen nie gewährt wurde, und von der sich die Kiever Eliten die innere Konsolidierung sowie äußere Anerkennung erhofften. Dabei war dies keine Unterordnung, denn Vladimirs Truppen waren für Byzanz eine willkommene militärische Hilfe. Die Erwartungen des Kiever Fürsten an diese Verbindung und die Taufe erfüllten sich: Die Beziehungen zu den Reichen im westlichen Europa intensivierten sich. Zudem öffnete die prestigereiche Allianz der jungen Kiever Dynastie bald die Türen vieler Herrscherhäuser Europas – Kaiser Heinrich IV. und der französische König Heinrich I. nahmen sich Prinzessinnen der Rus’ als Frau. Innenpolitisch stützte die Kirche den Herrscher und legitimierte die Kiever Rjurikiden als «Gesalbte des Herren». Zwar verlief die Christianisierung außerhalb der Oberschicht zaghaft, das angestrebte Zusammenwachsen unterschiedlicher Stämme der Rus’ sowie deren territoriale Ausweitung konnte jedoch durch die Einbindung der Eliten in den Verband der griechisch-orthodoxen Kirche gefördert werden. Die Kirche prägte das geistig-kulturelle Leben, das mit der Einführung kirchlicher Schriftlichkeit in slawischer Sprache durch die südslawischen und griechischen Mönche, mit dem Aufblühen der sakralen Baukunst und dem Beginn der monastischen Tradition in der alten Rus’ eine neue Qualität erhielt: Die Sakralbauten Kievs – insbesondere das zu Beginn des 12. Jahrhunderts gegründete Höhlenkloster – bildeten den religiösen Bezugspunkt des Reiches. Ihre Blütezeit erreichte die Kiever Rus’ im 11. Jahrhundert unter dem Fürsten Jaroslav dem Weisen (1019 bzw. 1036–1054): die prosperierenden Städte wie Kiev und Novgorod, der florierende Fernhandel, die kulturellen Einflüsse von Byzanz und Bulgarien kennzeichneten den Aufschwung. Ein eindrückliches Zeugnis von der Schriftkundigkeit der Bevölkerung – zumindest im Nordwesten der Rus’ – liefern die Birkenrindeschriften von Novgorod. Ab dem 11. bis ins 15. Jahrhundert gebrauchten (laut den bisherigen Befunden) die Novgoroder aller Schichten vom Adligen bis zum einfachen Bauern, auch Frauen und Kinder, Birkenrinde, die wesentlich billiger als Pergamentpapier war, um darauf alltägliche Notizen festzuhalten: Schreibübungen, Heiratsversprechen, Aufzeichnungen über den Geldverleih und die Ernte, über Geschäfte und Steuern. Gar Kochrezepte tauschten die Novgoroderinnen aus. Die Rus’ erstreckte sich in jener Periode im Norden bis zu den Gebieten der zweitbedeutendsten Stadt des Reiches, Novgorod, die im Ostseeraum als Handelspartner auftrat, im Westen bis Polock und bis zu den an die Karpaten
1. Russland und die Sowjetunion
233
angrenzenden Fürstentümern Galizien und Wolhynien. Im Süden mit dem Reichszentrum Kiev bildete die ans Schwarze Meer anschließende Steppe eine unscharfe Grenze. Im Osten grenzte die Rus’ an die Waldgebiete der Oberen Wolga östlich der Fürstentümer Vladimir und Suzdal’ (> Karte 1, S. 368/69). Im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts umfasste dieses Territorium ca. 1,9 Millionen Quadratkilometer, auf denen etwa 8 Millionen Menschen lebten. Das Kiever Reich war kein straff organisiertes Gebilde und bestand aus einer losen Föderation von Teilfürstentümern, an deren Spitze der Großfürst von Kiev als primus inter pares stand. Die Erbfolgeregelung des Seniorats (> Glossar), bei der dem jeweils genealogisch ältesten Rjurikiden der An-spruch auf den Großfürstenthron von Kiev zustand, umging das Problem der minderjährigen Herrscher, gestaltete aber die Erbansprüche kompliziert. Die übrige Auftei-lung des Herrschaftsgebiets erfolgte ebenso nach dem Alter – die nach Kiev nächstbedeutenden Gebiete gingen an die nächstältesten Ver-wandten des Großfürsten: Um die Mitte des 13. Jahrhunderts bestand die Rus’ aus etwa 45 Fürstentümern. Das Rotieren der Fürsten und ihres Gefol-ges verhinderte dabei die Festigung der Grund- und Territorialherrschaft, allerdings ebenso die Ausbreitung der Leibeigenschaft (> Glossar). Nach der Zerstörung des Chazarenreiches (7.–10. Jhd.) durch die Kiever Truppen wurden die Handelswege in den Süden und Osten zunehmend unsi-cher – es fehlte eine ordnende Macht in diesen Regionen. Die einzelnen Fürsten der Kiever Rus’ sahen sich nun stärker auf eine dauerhafte Veranke-rung ihrer Macht in den Teilfürstentümern und die Durchsetzung ihrer Parti-kularinteressen angewiesen und unterhöhlten zunehmend die Regelung des Seniorats: War Jaroslav der Weise noch Alleinherrscher der Kiever Rus’, wurden 1097 die jeweiligen Teilfürstentümer zum «Vatererbe» (russ. votči-na) erklärt, wobei das Prinzip der Anciennität in den blutigen Kämpfen um die Vormacht Kievs noch mehrmals zum Tragen kam. Die letzte Anstrengung, das Reich zu einigen und das Senioratsprinzip mit politischer Macht zu füllen, unternahm mit Erfolg der Kiever Großfürst Vladimir Monomach (1113–1125). Erst danach – seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts – gewannen die zentrifugalen Kräfte immer mehr an Gewicht: Die einzelnen Fürsten konnten sich als neue Machtzentren etablieren, die Kiev seine Führungsrolle streitig machten: Černigov, Wolhynien und Galizien im Südwesten, Smolensk und Polock im Westen, die Stadtrepubliken Novgorod und Pskov im Norden sowie Vladimir-Suzdal’ im Osten. Auf die seit dem 12. Jahrhundert zunehmende administrativ-politische Trennung der einzelnen Regionen geht die spätere sprachliche Ausdifferenzierung des Ostslawischen und die Herausbildung von drei kulturellen Traditionen zurück, in denen sich die drei ostslawischen Völker der Großrussen, der Weißrussen und der Ukrainer konstituierten.
Teil C: Regionale Schwerpunkte
234
Zum Mittelpunkt des späteren Moskauer Reiches sollte das Gebiet des Fürstentums Vladimir-Suzdal’ werden. Im Laufe des 12. Jahrhunderts errangen die Fürsten Jurij Dolgorukij (1149–1151, 1155–1157) und Andrej Bogoljubskij (1169–1174) die Vorrangstellung des Fürstentums, in dem sich auch die bereits 1147 gegründete, noch unbedeutende Festung Moskau befand. Die Macht des Herrschers in diesem vergleichsweise spät von der ostslawischen Bevölkerung besiedelten Waldgebiet erfuhr geringere Schranken durch den hohen Adel (russ. bojar > Glossar) und die städtische Volksversammlung (russ. veče > Glossar) als dies in den nördlichen, westlichen und südlichen Teilfürstentümern der Rus’ der Fall war. Während sich der Nordwesten des Reiches gegen die Angriffe des Deutschen Ritterordens und die schwedischen Truppen behaupten musste, stand der Westen und Südwesten zunehmend unter dem Einfluss Polens und Litauens: Nach dem Einfall der Mongolen in die Rus’ unterstanden diese Gebiete den polnischen und litauischen Herrschern. Der Süden des Reiches war stärker durch die Kämpfe und Kontakte zu den Reiternomaden der angrenzenden Steppe (Petschenegen > Glossar und Kumanen > Glossar, die Letzteren in den russischen Quellen auch Polovcy genannt) beeinflusst und fiel als Erster den Raubzügen des mongolischen Heeres zum Opfer, das zwischen 1237 und 1240 die Rus’ unterwarf. In der Folge fügte sich der Osten und Norden der Rus’ für mehr als 200 Jahre der mongolisch-tatarischer Oberherrschaft.
1.2.2 Mongolen-Oberherrschaft und Aufstieg Moskaus (13.–15. Jahrhundert)
Bereits 1223 schlugen die Mongolen nördlich des Azovschen Meeres in einer Racheaktion das vereinte Heer der Kumanen und der Rus’, doch zogen sich die Sieger wieder zurück. Erst ab 1237 überrollten die Reiterverbände der Goldenen Horde (> Glossar), des westlichen Teilreiches des Mongolenimperiums, die ganze Rus’ und eroberten bis 1241 sämtliche Fürstentümer. 1240 fiel Kiev. Die nördlichen und nordwestlichen Gebiete blieben von Verwüstungen verschont, so unterwarf sich Novgorod freiwillig. Vor allem die Bevölkerung der südlichen Rus’ trug die Last der Zerstörungen. Die Städte der Rus’ erlebten den Angriff unvorbereitet: Partikularinteressen einzelner Fürsten und die militärische Überlegenheit der Mongolen sind die hauptsächlichen Gründe dafür, dass es keinen Gegenschlag gab. Zahlreiche Städte waren verwüstet, die Bevölkerung häufig gänzlich vernichtet: Etwa ein Drittel der Siedlungen verschwand für immer.
1. Russland und die Sowjetunion
235
Die in der nationalen Geschichtsschreibung favorisierte Sicht dieser Periode als einer regressiven Zeit des dunklen «Mongolenjochs», das die Entwicklung der Rus’ in den folgenden Jahrzehnten wesentlich hemmte, negierte den Umstand, dass die Mongolen auf ein zersplittertes Reich trafen, das seinen ökonomischen und politischen Höhepunkt hinter sich hatte. Der Eingriff der Mongolen beschleunigte eine Neuformierung des Reiches, die bereits vor dem «Mongolensturm» eingesetzt hatte. Zwar erlitt das ökonomische und kulturelle Leben vor allem zu Beginn der mongolischen Oberherrschaft einen Einschnitt: Einige Künste des städtischen Handwerks gingen verloren (Glasschmuck), zahlreiche Sakralbauten waren zerstört. Jedoch blieb das soziopolitische Gefüge der Fürstentümer bestehen: Abgesehen von den Beauftragten des Khans (> Glossar), den baskaki, die die Tributeintreibung kontrollierten, bauten die Mongolen in der Rus’ keine eigene Verwaltung auf. Diese Funktionen nahmen die Fürsten der Rus’ wahr, die dem Khan der Goldenen Horde gegenüber lediglich tribut- und dienstpflichtig waren. Ansonsten behielten sie ihre Stellung. Die orthodoxe Kirche wurde toleriert, musste keine Abgaben leisten und konnte sich weiterhin entfalten, selbst nachdem zu Beginn des 14. Jahrhunderts der Islam zur herrschenden Religion der Goldenen Horde wurde. Die Fürstentümer der Rus’ profitierten zudem von der entwickelten Infrastruktur der Mongolen (Postwesen) und dem Militärwesen (Dezimalsystem bei der Gliederung der Truppen). Auch der Fernhandel der Rus’ wurde durch die Mongolen – entgegen älterer Inter-pretationen – nicht zerstört. Im pragmatischen modus vivendi fanden die Fürsten der Rus’ ihren Weg nicht nur zur Beibehaltung der herkömmlichen Strukturen und Machthierarchien, sondern sie suchten mit der Unterstützung der Mongolen ihre Ansprüche auf den großfürstlichen Thron geltend zu machen: Besonders erfolgreich waren dabei seit dem frühen 14. Jahrhundert die noch unbedeutenden Fürsten von Moskau. Aus der Auseinandersetzung mit ihrem stärksten Rivalen, den Fürsten von Tver’, gingen sie nämlich als Sieger hervor – mit der Unterstützung des mongolischen Khans: Von ihm erhielten die Moskauer die Einsetzungsurkunde (russ. jarlyk, vom turkspr.) für die Würde der Großfürsten von Vladimir-Suzdal’, die ihnen das Ringen um die Beherrschung der ganzen Rus’ ermöglichte. Die Unterstützung der orthodoxen Kirche war für den Aufstieg Moskaus ebenso bedeutend: Der Metropolit wechselte seinen Sitz nach dem Fall Kievs zunächst nach Vladimir und 1325 nach Moskau. Dass sich die äußeren Konkurrenten Moskaus um das Erbe der Kiever Rus’, die Großfürsten von Litauen, die im 14. Jahrhundert den Süden und Westen der Rus’ mit Kiev beherrschten, dem katholischen Polen zuwandten und damit ihre Ansprüche auf das Kiever Erbe schwächten, trug ebenfalls wesentlich zur Sicherung der Vormachtstellung Moskaus bei: 1386 nahm der litauische Großfürst Jagiełło
Teil C: Regionale Schwerpunkte
236
(lit. Jogaila) den römisch-katholischen Glauben an und wurde zum König von Polen. Die zeitgleiche Schwächung der Goldenen Horde fügte sich in diese für Moskau günstige Konstellation ein: Ein erstes Zeichen setzte hier Dmitrij Donskoj mit dem Sieg über ein tatarisches Heer im Jahre 1380. Trotz eines blutigen dynastischen Kieges im zweiten Viertel des 15. Jahrhundets gelang es den Moskauer Fürsten, sich gegen die Litauer, Mongolen sowie die übrigen Fürsten der Rus’ durchzusetzen und ihre Macht auszuweiten: Die aus der Rückschau durch die Chronisten als «Sammeln der Länder der Rus’» legitimierte Expansion der Moskauer unter Ivan III. (1462–1505) ebnete den Weg zum Moskauer Reich. Inkorporiert wurden Tver’, Ja-roslavl’, Rostov und schließlich Novgorod, dessen eigenständige Entwick-lung mit starken Selbstverwaltungsorganen und mächtiger Kaufmanns-schicht gewaltsam abgebrochen wurde (vgl. Strukturelle Grundlagen des städtischen Lebens, S. 181): Die Entfernung der Glocke, die für die Volks-versammlung läutete, sollte das Ende der freien Stadtrepublik und ihre Un-terwerfung unter die Herrschaft von Moskau symbolisieren. Der weiteren Konsolidierung des Reiches kam der allmähliche Zerfall der Goldenen Horde zugute. Nach dem «Stehen an der Ugra» im Herbst 1480, bei dem weder das mongolische Heer noch dasjenige Ivans III. die Gegenseite angriff, bekam die Kräftebalance zwischen den Mongolen und der Rus’ eine neue Qualität, die häufig auch als das Ende der mongolischen Oberherrschaft angesehen wurde. In der Folge konnten die Moskauer Fürsten die Mongolen viel stärker für ihre politischen Ziele einsetzen, etwa in den Auseinandersetzungen mit Polen-Litauen.
1.3 Moskauer Reich (15.–17. Jahrhundert) Die bereits unter Ivan III. einsetzende territoriale Konsolidierung der Rus’ unter Führung der Moskauer Fürsten verstärkte sich in der Folge. Ivan setzte das Prinzip der Primogenitur (> Glossar) bei der Erbfolge endgültig durch und beschnitt die Rechte anderer dynastischer Konkurrenten sowie des Erbadels. Neue Verwaltungsstrukturen, die Kodifizierung des Rechts (1497 und 1550) sowie die Einführung eines einheitlichen Zahlungsmittels, der Moskauer Silberkopeke, trugen zur angestrebten Zentralisierung des Moskauer Reiches wesentlich bei. Die Ausweitung der Macht des Großfürsten erwuchs aus der immer stärkeren Einbindung aller sozialen Schichten in den Dienst des Herrschers. Die russisch-orthodoxe Kirche betraf dies zwar noch weniger gravierend als in den späteren Jahrhunderten. Die Bestrebungen des Herrschers, sie stärker in die Belange des Reiches einzubinden, waren jedoch bereits im 15. Jahrhundert zu erkennen, vor allem bei den Versuchen, Kirchengüter für den Dienstadel zu entfremden. Denn dieser sollte die hauptsächliche Basis der großfürstlichen Macht bilden: Die Moskauer
1. Russland und die Sowjetunion
237
Dienstleute bekamen Dienstgüter in den eroberten Fürstentümern auf Kosten des Erbadels, der Bojaren und Fürsten. Zugleich stärkte der Großfürst die Bindung der abhängigen Bauern an das Herrenland (ab 1497 durften die abhängigen Bauern nur während zwei Wochen im Herbst den Herrn verlassen). Den Aufstieg des Moskauer Großfürsten zum «Selbstherrscher» vollendete Ivan IV. (1533–1584). 1547 ließ er sich zum Zaren krönen und sah sich und sein Reich in der politischen Nachfolge Ostroms und der Goldenen Horde. Die spezifische Herrschaftsform der Alleinherrschaft, wie sie in der Moskauer Autokratie ihre Ausformung fand, wurzelte in byzantinischen, ostslawischen und tatarischen Traditionen. Der Herrscher war nur Gott ver-antwortlich, er vereinte alle Funktionen (die Vorformen der modernen Exe-kutive, Legislative und Judikative) in einer Person und war weder an Recht noch an Institutionen gebunden (wie etwa die Stände im westlichen Europa). Während die Nachfolge des byzantinischen Kaisers eher symbolischer Natur war, verband der Moskauer Fürst mit dem Anspruch, die Autorität des Khans der Goldener Horde zu besitzen, tatsächliche Expansionspläne: 1552 eroberte Ivan IV. das Khanat Kazan’ an der Mittleren Wolga und 1556 Astrachan’ – beide Nachfolgereiche mit islamischer Hochkultur und eigener Herrschaftsorganisation. Mit diesen Eroberungen veränderte sich der Cha-rakter des Moskauer Reiches grundlegend: War die Rus’ bis dahin durch zahlreiche kulturelle Einflüsse geprägt, so waren ihre Organisationsstruktu-ren doch relativ einheitlich. Mit der Annexion von islamischen Territorien wurde Moskovien zu einem multireligiösen Imperium in der Nachfolge des eurasischen Großreiches der Goldenen Horde. Die Eroberung Sibiriens seit dem späten 16. Jahrhundert markierte den zweiten Schritt in dieser Entwicklung (> Karten 5, 6, S. 375-377). Der erfolgreiche Aufstieg Moskoviens wurde ab 1560 durch eine tiefe gesellschaftliche Krise überschattet, den die Überforderung des Landes im Livländischen Krieg (1558–1583) gegen Schweden und Polen-Litauen auslöste. Die anfänglichen Erfolge Moskaus bei der Eroberung nordwestlicher Gebiete (Ostseehafen Narva, Fürstentum Polock) endeten in einer schweren Niederlage. Die Hauptlast des langwierigen Krieges trugen letztendlich die ländlichen und städtischen Unterschichten, deren erhöhte Abgaben und Fronleistungen den Finanzbedarf des Zaren und des Adels decken sollten. Zudem zerrüttete der zunehmend willkürlich-terroristische Herrschaftsstil Ivan IV. die gesellschaftliche Struktur. Ivans Beiname Groznyj (eig. «der Gestrenge» oder «Ehrfurchtgebietende») wurde in der Folge in den westlichen Quellen ungenau als «der Schreckliche» wiedergegeben und hat sich seitdem für die Charakterisierung seiner Herrschaft etabliert. Nach anfänglichen
Teil C: Regionale Schwerpunkte
238
reformerischen Ansätzen fand sie in der Opričnina-Politik (> Glossar) Ivans IV. von 1565 bis 1572 einen grausamen Höhepunkt, der einen Einschnitt in der Entwicklung des Moskauer Reiches bedeutete. Tatsächliche und vermeintliche Gegner des Zaren aus allen Schichten (Hochadel, höchste kirchliche Würdenträger, städtische Bevölkerung etwa Novgorods) wurden dabei massenweise umgebracht. Die Bauernflucht aus den zentralen und nordwestlichen Regionen in den Osten und Südosten wurde zu einem der wesentlichen Probleme in der sozioökonomischen Entwicklung des Landes und führte schrittweise (über Abzugsverbote im 16. Jhd.) schließlich zur endgültigen Bindung der Bauern an die Scholle 1649. Dies sollte die ökono-mische Basis der militärischen Dienstleute des Zaren aufrecht erhalten. Ihren Höhepunkt erreichte die Krise Moskoviens zu Beginn des 17. Jahrhunderts in der Zeit der «Wirren» (russ. smuta > Glossar). Sie begann mit dem Tod des letzten Rjurikiden auf dem Moskauer Thron im Jahre 1598. Dessen umstrittener Nachfolger, der bisherige Regent und nun zum Zaren gewählte Boris Godunov (ca. 1552–1605) vermochte keine stabile Herrschaft zu etablieren; nach seinem Tod 1605 brach die bestehende Ordnung völlig auseinander. Missernten und Hungerkatastrophen in der Situation politischer Instabilität führten zu Massenflucht und sozialen Unruhen, die in die Bauernaufstände unter Ivan Bolotnikov mündeten. Die Thronnachfolge wurde von Abenteurern beansprucht, die sich für den verstorbenen Sohn Ivan IV. Dmitrij ausgaben (Pseudodemetrien) und Interventionen von Polen-Litauen und Schweden mit sich brachten. Zugleich war es auch die Zeit eines Neubeginns für das Reich: Nachdem eine territoriale und dynastische Vereinigung mit Polen gescheitert war, be-endete eine Bewegung des Volkes, die ihren Anfang in den östlichen Rand-gebieten des Reiches nahm, die chaotischen Zustände erstaunlich rasch. Sie vertrieb die fremden Truppen, allerdings mit territorialen Verlusten für Moskau (Smolensk und der Zugang zur Ostsee) und ebnete 1613 den Weg zu einer Landesversammlung (russ. zemskij sobor), die den neuen Zaren wählte – Michail Romanov (1613–1645), einen Großneffen der ersten Frau Ivans IV. In der darauf folgenden Periode sollte sich das Reich wieder konsolidieren, einen ökonomischen Aufschwung und intensivere Kontakte zum westlichen Europa erleben. Die soziopolitische Ordnung der Autokratie wurde dabei ausgebaut und gefestigt. Die militärischen Reformen (die Adelsreiterei wurde durch stehende Infanterietruppen «neuer Ordnung» ergänzt) leiteten diese Entwicklung ein und ermöglichten die Expansion des Moskauer Reiches in den Westen: 1654 (endgültig 1667) gab Polen-Litauen Smolensk und die östliche Ukraine mit Kiev ab, die als Hetmanat der Dnjepr-Kosaken (> Glossar Kosaken) mit weitgehender Autonomie eingegliedert wurde. Von
1. Russland und die Sowjetunion
239
diesen Gebieten an der konfessionellen Grenze zwischen den orthodoxen und katholischen Einflusszonen aus drangen kulturelle Einflüsse des westlichen Europa ins Moskauer Reich ein. Insbesondere die Kiever Akademie ermöglichte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts diesen kulturellen Transfer. Zentralisierende Bestrebungen des Zaren und Reformbestrebungen kirchlicher Hierarchen sowie «lateinische» Einflüsse Kievs führten 1667 zur Abspaltung der Altgläubigen von der russisch-orthodoxen Kirche. Verfolgt durch Staat und Kirche, flohen sie an die Peripherie des Reiches und konnten dort ihre eigene Frömmigkeit weiter praktizieren (vgl. Religiöser Dissens im Russländischen Reich: Altgläubige, S. 110). Die epochale Verortung des Moskauer Reiches im 17. Jahrhundert fällt in der Forschung unterschiedlich aus: Markieren für einige HistorikerInnen die verstärkten säkularen Einflüsse des Westens und die Kirchenspaltung das Ende des «russischen Mittelalters» (Nancy Shields Kollmann, Carsten Goehrke), so sehen andere Forschende bereits im beginnenden 16. Jahrhundert den Anbruch der Moderne im Moskauer Reich (Edgar Hösch) oder gar erst im 17. Jahrhundert (Valerie A. Kivelson). Kollmann etwa sieht im Moskovien des 16. und 17. Jahrhunderts eine typische «patrimoniale» mittelalterliche soziopolitische Formation, die sich wesentlich von den frühneuzeitlichen Monarchien des westlichen Europa unterscheidet und eher mit dem Frankenreich der Karolinger vergleichbar sei. Für sie zeichnet sich Moskovien stark durch Archaik und Trägheit aus. Kivelson dagegen bewertet den im 17. Jahrhundert eingetretenen Wandel und die Ansätze der neuzeitlichen Bürokratie in der patriarchalen Ordnung viel stärker und betrachtet das Moskauer Reich des 17. Jahrhunderts als einen frühneuzeitlichen Staat, durchaus mit den westeuropäischen politischen Einheiten vergleichbar, wenn auch mit kulturellen und politischen Eigenheiten.
1.4 Russländisches Imperium (1700–1917)
1.4.1 Peter der Große (1682/89–1725)
Eine neue Epoche in der Geschichte Russlands brach mit Peter I. («dem Großen») an: Der energische Zar, der bereits in seiner Jugend in Moskau unter Fremdländern verkehrte und als erster Herrscher Russlands Westeuropa bereiste, führte mit Gewalt zahlreiche Neuerungen nach westeuropäischen Vorbildern ein und erklärte die herkömmliche Lebensweise Moskoviens für rückständig: Die Bojaren sollten keine Bärte mehr tragen und sich westlich kleiden, der Lebensrhythmus sollte sich nach dem Julianischen Kalender richten, wie es zu jenem Zeitpunkt in den protestantischen Ländern üblich war (zuvor lebte Moskovien nach der byzantinischen Zeitrechnung seit der
Teil C: Regionale Schwerpunkte
240
Erschaffung der Welt, bei der das Jahr am 1. September begann). So feierte das neue Russland am 1. Januar des Jahres 7208 seit Erschaffung der Welt den Beginn des Jahres 1700 n. Ch. Die Hauptstadt verlegte Peter 1711 nach St. Petersburg. Die 1703 von westlichen Architekten erschaffene Metropole an der Ostsee sollte zum Symbol für Russlands Öffnung zum Westen werden. Ein mächtiges und modernes Russländisches Imperium zu schaffen, dies war Peters Ziel. Er suchte es durch Kriege und Reformen zu erreichen. Die beabsichtigte Expansion in den Süden gelang Peter I. nicht: Seine Erfolge in den Kriegen gegen das Osmanische Reich blieben längerfristig ohne Wirkung. Im Westen und Norden konnte Russland unter Peter I. dagegen neue Territorien gewinnen und sich dauerhaft im Ostseeraum etablieren: 1710 erlangte Russland im Großen Nordischen Krieg (1700–1721) die schwedischen Ostseeprovinzen Estland und Livland (> Karte 5, S. 375). Das Reformwerk Peters I. umfasste alle Lebensbereiche seiner Untertanen: das Militärwesen, die Verwaltung, das Steuerwesen, die Wirtschaft und schließlich die Kirche. Die Einflüsse der europäischen Frühaufklärung sollten Peter in seinem Fortschrittsdenken und dem Bestreben bestärken, das Russländische Imperium rational regulieren zu können. Infolge der sprunghaften Reformen wurden die Untertanen in den Dienst des Staates gestellt – die Adligen als Offiziere und Beamte, die Lastenpflichtigen als Rekruten oder Manufakturarbeiter. Die größten Wirkungen zeigten die Eingriffe Peters in den Lebensstil des Adels, während die Lage der städtischen und ländlichen Unterschichten viel weniger davon berührt wurde. Die sozialen und politischen Strukturen wurden dabei nicht wesentlich verändert. Die Einschätzung der Herrschaft und Person Peters I. ist nicht einheitlich, brachte er doch bei seinen Modernisierungsversuchen die Kräfte der Unterschichten an den Rand der Erschöpfung. Seine lange Zeit hervorgehobene Pionierrolle bei der «Europäisierung» Russlands wurde relativiert: Viele seiner Reformen wurzelten in den Vorstößen seiner Vorgänger des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Peters I. Nachfolger setzten die von ihm intensivierte «Europäisierung» Russlands grundsätzlich fort, wenn auch viele seiner Reformen zunächst rückgängig gemacht wurden.
1.4.2 Katharina II. (1762–1796)
Vor allem Kaiserin Katharina II. («die Große»), gebürtige deutsche Prinzessin Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst, knüpfte an die petrinischen Reformen an und setzte zugleich die ambivalenten Tendenzen von Peters I. Herrschaft fort: Sie gab sich als aufgeklärte Herrscherin, stand mit Voltaire und Diderot im Briefwechsel und strebte die Modernisierung
1. Russland und die Sowjetunion
241
ihres Reiches an. An ihrem autokratischen Herrschaftsmodus änderte dies nichts und die rechtliche Lage der leibeigenen Bauern erreichte unter Katharina II. ihren Tiefststand. Das Reformwerk Katharinas II. betraf in erster Linie die Verwaltung: Dem Adel und der Stadtbevölkerung wurden ständische Selbstorganisationen zugestanden, die in die lokale Verwaltung und Rechtsprechung eingebunden sein sollten. Der Adel war der größte Gewinner der Reformen Katharinas. Bereits ihr Ehemann, Peter III. (1762), gebürtiger Herzog Karl P.U. von Holstein-Gottorp, großer Verehrer Preußens, befreite den Adel von der Dienstpflicht. Nun wurden dem Adel zum ersten Mal Rechte und Privilegien wie etwa das Monopol auf Grundbesitz zugesichert. Faktisch blieb der Adel jedoch weiterhin an den Herrscherdienst gebunden, bekam dafür weite Verfügungsmacht über die leibeigenen Bauern: Für den Gutsherrn (> Glos-sar Gutsherschaft) wurde der Bauer zum persönlichen Eigentum, er konnte ihn ohne Land verkaufen, züchtigen und verbannen. Erneut führten die sozialen Spannungen 1773 und 1775 zu einem Bauern- und Kosakenaufstand unter der Führung des Donkosaken Emel’jan Pugačev (1742–1775). Die halbherzigen Stadtreformen Katharinas II. erreichten ihr Ziel nicht: Unter permanentem fiskalischem Druck konnte sich ein starkes städtisches Bürgertum nur schwer etablieren. Die Förderung der weltlichen Bildung seit Peter I. zeitigte hingegen Erfolge. Bereits 1725 wurde eine Akademie der Wissenschaften nach westeuropäischem Vorbild gegründet, 1755 eine erste Universität (Moskau) sowie städtische Schulen. In der Außenpolitik setzte Katharina II. ebenso die Bestrebungen Peters I. fort, das Reich zu erweitern. Insbesondere im Süden erzielte sie mehr Erfolge als ihr Vorgänger: Im Krieg gegen das Osmanische Reich gewann das Russländische Imperium 1770–1774 die Steppengebiete nördlich des Schwarzen Meeres sowie 1783 die Halbinsel Krim. Infolge der Teilungen Polens zwischen Russland, Preußen und den Habsburgern gewann Russland zudem 1772, 1793 und 1795 den gesamten östlichen Teil der Adelsrepublik Polen. Neben Polen stellten hier Ukrainer, Litauer, Weißrussen und Juden einen großen Anteil an Bevölkerung (> Karten 5, 6, S. 375-377).
1.4.3 Petersburger Imperium im langen 19. Jahrhundert
Die Expansion des Imperiums in den Westen und Osten setzte sich im 19. Jahrhundert fort: Alexander I. (1801–1825), der «Retter Europas» in den Napoleonischen Kriegen, erreichte die Eingliederung Finnlands (1809) und des sogenannten Königreichs Polen bzw. 1815 Kongresspolens (> Glossar) sowie Bessarabiens (1812). Die Expansion Russlands in den Westen wurde damit beendet. Der «Gendarm Europas», Zar Nikolaus I. (1825–1855), ein
Teil C: Regionale Schwerpunkte
242
starker Mitspieler in der europäischen Politik, unterstützte den Erhalt des Status quo. Weitere Eroberungen verfolgte Russland in Transkaukasien, in den kasachischen Steppengebieten, Mittelasien und dem Fernen Osten.
Reformen und Repressionen Die soziopolitische Entwicklung zeichnete sich zum einen durch das Auf und Ab im reformerischen Eifer der Herrscher aus, der die Modernisierung der staatlichen Verwaltung zum Ziel hatte, das bestehende System in seinem Kern aber nicht anrühren sollte. In unterschiedlichen Bevölkerungsschichten reifte zum anderen die Einsicht, dass das autokratische System grundlegend reformiert und die Wirtschaft modernisiert werden sollte. Der rapide ökonomische Aufstieg einiger Länder des westlichen Europa (vor allem Englands), der Russland auf einen hinteren Platz zu rücken drohte, gab Anlass dazu. Das Reformwerk Alexanders I. war zunächst durch den liberalen Geist beeinflusst, rührte allerdings nicht an den Grundfesten der Autokratie und der Leibeigenschaft. Der erste russische Verfassungsentwurf mit strikter Gewaltentrennung und Gewährung bürgerlicher Freiheiten des Staatssekretärs Michail Speranskij (1772–1839) von 1809 zeigte kurzfristig keine Wirkung. Alexanders I. Nachfolger Nikolaus I. konservierte das autokratische System noch stärker. Auf drei Säulen – der Autokratie, der Orthodoxie und des volkstümlichen Reichspatriotismus (samoderžavie, pravoslavie, narodnost’) – sollte das Gebäude des Russländischen Imperiums gedeihen, wie Niko-laus’ Minister für Volksaufklärung Fürst Sergej Uvarov (1785–1855) verkündete. Den Anlass zur restaurativen Politik gab zunächst der gescheiterte Putschversuch liberal gesinnter Offiziere bei der Thronbesteigung Nikolaus’ im Dezember 1825 (später Dekabristen genannt nach dem Monat des Aufstandes). Die europäischen Revolutionen von 1830 und 1848 verstärkten die konservative Linie des Zaren: Stärkere Kontrolle, Militarisierung und Bürokratisierung sollten dabei möglichen Erhebungen der Untertanen vorbeugen. Die erfolgreiche Sanierung der Staatsfinanzen war nur von kurzer Dauer. Trotz einiger wichtigen Impulse wie der Eröffnung der ersten russi-schen Eisenbahnlinie im Oktober 1837 förderte der Staat die Wirtschaft zu wenig, ja behinderte zum Teil einen ökonomischen Aufschwung. Erst die Reformen Alexanders II. (1855–1881), auch «die großen Reformen» genannt, kündeten eine grundlegende Revision der herkömmlichen Ordnung an. Sie wurden veranlasst durch die schmerzliche Niederlage im Krimkrieg gegen das Osmanische Reich und dessen Verbündete (1853–1856), die die Notwendigkeit von Reformen im inneren Gefüge des Imperiums offenlegte. Die erste und wichtigste war dabei die Befreiung der Bauern aus der Leibeigenschaft 1861. Die über die Jahrhunderte erhaltene Allianz des
1. Russland und die Sowjetunion
243
Herrschers mit dem Adel und zugleich das Fundament der Autokratie war gebrochen, trotz der Bemühung um ein für die Adligen möglichst schmerzloses Prozedere. Für die Bauern waren die Bedingungen der Ablösung höchst ungünstig: Die Grundstücke, die sie erhielten, waren in der Regel kleiner als jene, die sie zuvor bearbeitet hatten; zudem mussten sie ihren ehemaligen Herren bedeutende Ablösesummen zahlen. Die Umvertei-lungsgemeinde (mir) blieb als soziale Institution auf dem Dorf bestehen und regulierte weiterhin die Mobilität der Bauern sowie die Umverteilung des Gemeindelandes. Dabei hemmte sie keineswegs die Bewegungsfreiheit der Bauern in dem Masse wie die frühere Forschung dies angenommen hatte, sie erwies sich als flexibel und stand der Intensivierung des Ackerbaus kaum im Wege. Die weiteren Reformen betrafen die Beteiligung unterschiedlicher sozialer Schichten an der Organisation des Gemeinwesens, die in den Reformver-suchen des 18. Jahrhunderts wurzelten: 1864 wurden in den zentralen Regionen zemstva (Landschaften) als – mehrheitlich aus dem Landadel – gewählte Selbstverwaltungsorgane geschaffen, die sich der Sozialfürsorge, der Infrastruktur, medizinischer Versorgung und Elementarbildung auf dem Land widmen sollten. 1870 folgten die städtischen Körperschaften, in denen die kommerzielle Oberschicht tonangebend war. Die Justizreform von 1864, die das Gerichtswesen auf die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit stellte (Münd-lichkeit und Öffentlichkeit der Verfahren, Unabhängigkeit der Richter, Advokatur, Geschworenengerichte für Kriminalfälle), die Militärreform von 1874 (allgemeine Wehrpflicht) sowie das neue Universitätsstatut von 1864 (größere Autonomierechte) ergänzten das Gesamtpaket der realisierten Reformen, die alle Lebensbereiche der russländischen Untertanen betreffen sollten. Wie erfolgreich die Umsetzung dieser bereits im Plan als halbherzig gedachten Reformen war, wird unterschiedlich beurteilt. Sie brachten mit Sicherheit keine aktive politische Mitwirkung am politischen System Russlands und stießen überall mit den herkömmlichen Lebensstilen und Handlungsmodi zusammen. Dennoch begünstigten sie die Politisierung der intelligencija (> Glossar), die den Systemwandel anstrebte. Aus der Bewegung der narodniki (Volkstümler), der Volkssozialisten, gingen im Laufe der 1860/70er-Jahre zahlreiche Gruppierungen hervor, die mit unterschiedlicher Radikalität ihre Ziele verfolgten. Ihren Höhepunkt erreichten diese Aktivitäten in den Terrorakten der Gruppe Narodnaja volja (Volkswille) und der Ermordung Alexanders II. 1881. Zugleich markierte dieses Ereignis den Niedergang der Bewegung. In der darauf folgenden Zeit des Zaren Alexander III. (1881–1894) wurde der liberale Geist der Politik wieder zurückgenommen: Einige Reformen wurden rückgängig gemacht. Antijüdische Gesetze, denen die erste neuzeitliche Pogromwelle in Russland
Teil C: Regionale Schwerpunkte
244
voranging, sowie eine aggressive Russifizierung westlicher Gouvernements als Maßnahme gegen die sich stärker formierenden Nationalbewegungen sollten das Russländische Imperium stabilisieren und Erhebungen der Untertanen verhindern. Die Regierung Alexanders III. war zugleich eine Zeit des rapiden industriellen Aufschwungs und der relativen Verbesserung der sozialen Lage der Bauern. Sein Finanzminister Nikolaj v. Bunge (1881–1886) führte die ersten Arbeiterschutzgesetze ein, die allerdings später wieder zurückgenommen wurden, und strebte an, die Lasten der Bauern zu reduzieren. Sein Nachfolger Sergej Vitte (1892–1903) setzte stärker auf die staatlich geförderte Industrialisierung, die weniger die Kaufkraft der Mittel- und Unterschichten berücksichtigte, sondern die Budgetkonsolidierung und Stabilisierung der Währung im Auge hatte. Dieser Strategie entsprachen jene Getreideexporte, die Devisen für die Industrialisierung einbringen sollten. Mit der Förderung der Eisenbahn, des Bankwesens, der protektionistischen Außenhandelspolitik und dem Einwerben von Auslandskapital gab der Staat der Industrialisierung Russlands entscheidende Impulse. Schwerindustrie und Bergbau zeigten die höchsten Zuwachsraten im Europa der 1890er-Jahre. Das Pro-Kopf-Einkommen im Russländischen Reich blieb jedoch deutlich hinter dem Durchschnitt in Westeuropa zurück. Dennoch ging es – entgegen früherer Annahmen – materiell selbst den Bauern wesentlich besser als zuvor. Ingesamt wurde das Reich höchst unterschiedlich von der Industrialisierung erfasst und blieb bis in die 1930er-Jahre ein Agrarland. Die sprunghaften Reformen der Herrscher und das rapide Tempo der ökonomischen Entwicklung spitzten die Widersprüche der spätzarischen Gesellschaft zu – zwischen gebildeten Eliten und den Unterschichten, zwischen Stadt und Land, der sich nun formierenden Öffentlichkeit und Autokratie, dem imperialen Zentrum und nationalen Peripherien. Die durch die Neuerungen ausgelöste gesellschaftliche Dynamik offenbarte die Starrheit der politischen Ordnung und vergrößerte die Kluft zwischen den nach Systemwechsel strebenden Schichten und der Autokratie verpflichteten Kräften und führte in die Revolution von 1905 bis 1907.
Revolution von 1905 bis 1907 Nach dem Scheitern der agrarsozialistischen Bewegung der narodniki, die das Bauernleben in der Umverteilungsgemeinde idealisierten und den Weg Russlands in den Sozialismus (> Glossar) ohne die kapitalistische Etappe als möglich ansahen, setzten ihre Gegenspieler – die marxistischen Sozialdemokraten – auf das städtische Industrieproletariat. Sie formierten sich seit den späten 1890er-Jahren und spalteten sich 1903 auf dem Parteitag in London in die Fraktion der Men’ševiki (> Glossar) unter der Führung Julij Martovs (eig. Cederbaum, 1873–1923) und der Bol’ševiki (> Glossar) unter
1. Russland und die Sowjetunion
245
der Führung Vladimir Lenins (eig. Ul’janov, 1870–1924). Die liberalen Kräfte reiften in den zemstva und organisierten sich zusammen mit der radikalen intelligencija 1904 in einem illegalen «Bund der Befreiung», der eine Volksvertretung auf der Basis freier, geheimer, gleicher und direkter Wahlen forderte. Deutlich wurden am Vorabend der Revolution auch die Stimmen der nichtrussischen Eliten, die sich für die kulturellen, politischen und sozialen Forderungen der nichtrussischen Völker einsetzten – der Mehrheit der Bevölkerung im Russländischen Imperium. Ging der Anstoß zur Revolution zu Beginn vom Zentrum aus, als am 9. Januar 1905, dem sogenannten Blutsonntag, eine friedliche Arbeiter-demonstration gewaltsam niedergeschlagen wurde, so entfalteten gerade die nationalen Peripherien des Imperiums in der Folge eine geradezu explosive Dynamik – etwa in Polen, den Ostseeprovinzen und Transkaukasien. Den zahlreichen Arbeiterstreiks schlossen sich auch andere soziale Gruppen an, sogar die Priesterseminare blieben von der allgemeinen Erhebung nicht unberührt, die im Herbst 1905 in den Generalstreik mündete. Inwiefern die Ausbreitung marxistischer Gruppen zur Streikbewegung wesentlich beitrug – diesen Einfluss hob insbesondere die sowjetische Historiografie hervor –, bleibt umstritten. Der Misserfolg des Moskauer Aufstandes im Dezember 1905 nahm dem Arbeiterprotest die Kraft. Die Aufstände auf dem Land, in denen die bäuerlichen Massen mit Wucht ihrem Protest Ausdruck gaben und zahlreiche Gutshöfe zerstörten, folgten erst später und dauerten bis in das Jahr 1906. Der Bauernprotest war in jenen Regionen stärker, in denen nicht nur soziale, sondern auch nationale Forderungen im Spiel waren: wie etwa im Kaukasus, wo gar die Staatsvertreter vertrieben und zeitweilig eine revolutionäre Selbstverwaltung errichtet wurde. Die Autokratie, geschwächt durch die Niederlagen im russisch-japanischen Krieg 1904–1905, reagierte zögerlich auf die revolutionären Ereignisse und räumte schlussendlich mit dem Oktobermanifest des Zaren Nikolaus II. (1894–1917) weitgehende Konzessionen ein (Gewährung bürgerlicher Freiheiten und der Duma, einer gewählten Volksvertretung). In der Folge legalisierte der Autokrat mit den «Reichsgrundgesetzen» von 1906 die politischen Parteien und kodifizierte die bürgerlichen Grundrechte. Die politische Öffentlichkeit konnte sich nun im legalen Rahmen formieren. Das gesetzgebende Organ bestand aus zwei Kammern – dem Reichsrat und der Reichsduma. Dennoch waren die Konzessionen des Zaren halbherzig: Der Reichsrat wurde zur Hälfte vom Zaren ernannt, die Abgeordneten der Reichsduma in allgemeiner, aber indirekter und nicht gleicher Wahl bestimmt. Zudem behielt sich der Autokrat das Vetorecht gegen alle Beschlüsse der Duma, entschied alleine über das Heer und die Außenpolitik, ernannte die Regierung und berief das Parlament ein. Als wie stark die Eingriffe des Zaren in das neu geschaffene politische System zu bewerten
Teil C: Regionale Schwerpunkte
246
sind, wird in der Forschung nicht einheitlich beurteilt: ob nun Russland eine konstitutionelle repräsentative Monarchie war oder mit einem «Scheinkonstitutionalismus» (Max Weber) weiterhin die eigentliche Autokratie verschleierte. Das starke Verdikt Webers spitzte nur die eine Seite einer soziopolitischen Formation Russlands zu, in der sich die Neuerungen mit dem alten Establishment paarten. In dieser Hinsicht war Russlands Verfas-sung durchaus mit der des Deutschen Kaiserreiches von 1871 vergleichbar. Die Entwicklung des neuen Systems war durch Brüche und Stockungen gekennzeichnet: Die ersten beiden Dumen (1906–1907) dominierten radikale Sozialisten und Linksliberale, die im ständigen Konflikt mit der Regierung standen. Sie wurden aufgelöst und mithilfe eines geänderten Wahlrechts durch die konservative 3. und 4. Duma (1907–1917) ersetzt. Die von der Regierung Petr Stolypins (1862–1911) 1906 eingeleiteten Agrarreformen setzten auf einen staatstragenden bäuerlichen Mittelstand und hoben die obligatorische Bindung der Bauern an die Dorfgemeinde auf. Der Erfolg und die Lebensfähigkeit dieser Reformen sowie die Richtung der möglichen Entwicklung Russlands werden in der Forschung sehr unterschiedlich betrachtet. Die optimistischeren Interpretationen sehen in der Entwicklung Russlands vor 1917 bedeutende Schritte auf dem Weg zu einer Zivil-gesellschaft des industriellen Zeitalters mit parlamentarisch-demokratischer Regierungsform, die durch den Ersten Weltkrieg und das Machtstreben der radikalen Kräfte abgebrochen wurden (etwa Gottfried Schramm, Boris Mironov, Manfred Hildermeier). Hingegen sprechen die skeptischeren Interpretationen Russland vor 1917 jegliche Chance auf eine konstitutionelle Demokratie ab (etwa Theodore H. von Laue, Dietrich Geyer: Imperialismus, Martin Malia): In dieser Einschätzung hatte Russland lediglich Defizite zu verzeichnen – an einer bürgerlichen Schicht, am Parlamentarismus, an Rechtsstaatlichkeit, der ökonomischen Entwicklung bzw. einem zu schnellen und unausgewogenen Industrialisierungsschub im späten Zarenreich sowie an als misslungen betrachteten Reformen jener Periode. Die russländische Gesellschaft vor 1917 war in doppelter Hinsicht polarisiert, so Leopold Haimson: Die liberale Schicht habe sich von der Autokratie entfremdet und zugleich von den Massen der Arbeiter. In dieser Konstellation war das zarische Russland zum Untergang verurteilt. Dieser Sicht schließen sich zahlreiche sozialgeschichtliche Studien über die Arbeiterschaft an (etwa Victoria Bonnell, Robert McKean). Die Arbeiten über die Bauernschaft und die ökonomische Entwicklung ha-ben in den letzten Jahrzehnten eher die optimistischeren Interpretationen gestützt. Relativiert bis zurückgewiesen wurden Alexander Gerschenkrons Thesen von der relativen ökonomischen Rückständigkeit Russlands – für die strukturelle Entwicklung der Industrie (Paul R. Gregory) wie auch für die Landwirtschaft (Peter Gatrell, Heinz-Dietrich Löwe). Der Profit, den auch
1. Russland und die Sowjetunion
247
die unteren Schichten, etwa die Bauern, aus der rapiden Industrialisierung schlagen konnten, wird höher als zuvor angenommen eingeschätzt. Insgesamt gibt die ökonomische Entwicklung Russlands vor 1917 durchaus den «Optimisten» recht. Andererseits ist eine eindeutige Wahl zwischen Op-timismus und Pessimismus unangemessen und müsste differenziert werden: Trotz aller Fortschritte blockierte sich das System immer wieder selbst, in-dem zukunftsweisende Konzepte durch Richtungskämpfe zwischen den Flü-geln der Unternehmer selbst, zwischen Unternehmern und Agrariern und zwischen den Exponenten der einzelnen Positionen im Staatsapparat verwäs-sert wurden. Die strukturelle Vielschichtigkeit Russlands führte zu einem «verkrüppelten Kapitalismus» (Heiko Haumann: Kapitalismus). Die jüngere Forschung diskutiert weniger darüber, ob und wie ein liberaler Zustand im Russland vor 1917 zu erreichen gewesen wäre, betont allerdings stärker die Eigenheiten in der Entwicklung und der Konzepte, mit denen die Geschichte Russlands beschrieben werden sollte, und schätzt die Erfolge der reformerischen Ansätze viel höher ein. Die allmähliche Herausbildung einer spezifischen russischen Öffentlichkeit – vor allem an den Beispielen aus der Provinz – stärkte die Formel von der «Gesellschaft als lokaler Veranstal-tung» (Guido Hausmann, Lutz Häfner), die die älteren Paradigmen einer vom Staat dominierten Gesellschaft («Gesellschaft als staatliche Veranstaltung», Dietrich Geyer, noch zuvor für das Moskauer Reich «staatsbedingte Gesellschaft», Hans-Joachim Torke) in Frage stellen. Auf dieser Interpretationslinie sind auch einige frühere sowie die neueren Arbeiten über die Entwicklungen des Marktes zu verorten, die die Stärke und Flexibilität der bäuerlichen Mittelschicht würdigen (Heinz-Dietrich Löwe, Stephen G. Wheatcroft, Boris Mironov). Die Formierung der bürger-lichen Schichten beobachtet zudem die neuere Forschung nicht nur am Beispiel der erfolgreichen Unternehmerdynastien oder an ihrem Mäzenaten-tum, sondern nicht zuletzt an ihrem Beitrag zur Herausbildung einer städtischen Freizeitkultur mit Vereinswesen und Unterhaltung, die für die Industriegesellschaften des übrigen Europa charakteristisch war (Louise McReynolds). Damit befand sich Russland durchaus auf dem Wege in die europäische Moderne. Der Erste Weltkrieg unterbrach viele dieser Tendenzen und gilt als eine zentrale Ursache für die Revolutionen von 1917 und das Ende des Russländischen Imperiums.
Teil C: Regionale Schwerpunkte
248
1.5 Sowjetische Ära (1917–1991)
1.5.1 Revolution und Bürgerkrieg (1917–1921)
Nicht nur für die Geschichte Russlands bedeutete die russische Revolution einen Einschnitt und Beginn einer neuen Epoche, wenn es auch Argumente für Kontinuitäten zur spätzarischen Ära gibt (Peter Holquist, Joshua A. Sandborn). Sie wurde zum Ereignis der Weltgeschichte im 20. Jahrhundert. Bis heute streiten die Historiker über ihre Ursachen, Folgen und Bedeutung.
Die Februarrevolution von 1917 Noch deutlicher als die Revolution von 1905 stellte der Erste Weltkrieg die Kräfte des Russländischen Imperiums auf die Probe. Niederlagen und territoriale Verluste an das Deutsche Reich, soziale Spannungen aufgrund von Versorgungsengpässen in den Städten, offensichtliche Inkompetenz des Zaren und seiner Umgebung – dies alles schwächte die Autorität der Autokratie. Im Februar 1917 gab das Ancien Régime sein Zepter praktisch ohne Kampf ab. Mit der spontanen Bewegung des Volkes, die mit den Massendemonstrationen zum Gedenken an den «Blutsonntag» von 1905 ihren Anfang nahm und in der letzten Woche des Februars (nach Julianischem Kalender) im Petrograder – so hieß Petersburg ab August 1914 – Generalstreik kulminierte, hatte Nikolaus II. nicht gerechnet. Als sich den Streikenden am 26./27. Februar auch die Soldaten der Petrograder Garnison anschlossen, verlor der Zar die Kontrolle über die Situation gänzlich: Am 2. März dankte er schließlich ab, einen Tag danach auch sein Bruder Michail – es war das Ende der seit 1613 in Russland herrschenden Romanov-Dynastie und bedeutete den Sieg der Volkserhebung, die als Februarrevolution (> Glossar) von 1917 in die Annalen der Geschichte einging. Das anfängliche Machtva-kuum füllten vor allem der Petrograder Sowjet (Rat) der Arbeiter- und Sol-datendeputierten, eine bereits 1905 erprobte Form einer von unten gewählten Organisationsstruktur, sowie die aus der letzten Duma hervorgegangene Provisorische Regierung, die aus gemäßigt-liberalen Grundbesitzern, Unter-nehmern und intelligencija bestand, die den Kadetten (konstitutionellen De-mokraten) oder den gemäßigt-konservativen Oktobristen (> Glossar) nahe standen. Der einzige «Linke» war der Justizminister, spätere Kriegsminister und ab Juli 1917 Vorsitzende der Provisorischen Regierung Aleksandr Kerenskij (1883–1970), der den Trudoviki (> Glossar) angehörte. Die beiden Gremien einigten sich auf die Proklamation bürgerlicher Grundrechte und der Gleichberechtigung aller Nationen und Religionen. Russland wurde damit zur demokratischen Republik. Alle übrigen drängenden Probleme – die Frage nach Krieg und Frieden, die Agrarfrage, die Arbeiter-
1. Russland und die Sowjetunion
249
und Nationalitätenfrage – sollte die Verfassungsgebende Versammlung entscheiden, die später einberufen werden sollte. Die Verschiebung dieser Probleme auf die Einberufung der Konstituante stürzte die instabile Doppelherrschaft von Provisorischer Regierung und Sowjet in eine immer tiefere Krise. Die Kluft zwischen der bürgerlichen Regierung und der «Gesellschaft» auf der einen und den Arbeitern, städtischen Unterschichten und Bauern auf der anderen Seite wurde immer größer: Die Arbeiter organisierten sich in Gewerkschaften, Fabrikkomitees und Arbeitermilizen und wurden von den Räten (Sowjets) unterstützt, die nun eine energische Tätigkeit entfalteten und bald einen Großteil der Städte Russlands erfassten. Eine spontane Agrarrevolution fand im Sommer und Herbst 1917 auf dem Land statt: In gewalttätigen Aktionen brachten Bauern zahlreiche Adelsgüter in ihren Besitz. Meutereien und Desertionen schwächten die Armee. Die Forderungen nach politischer Autonomie nationaler Organisationen, etwa der Ukrainer, brachen die imperiale Struktur des Staates auf.
Die Oktoberrevolution von 1917 Die gleichzeitigen Strukturkrisen kulminierten im Herbst 1917. Die straff organisierte Partei der Bol’ševiki unter der Führung Lenins nutzte im entstandenen Machtvakuum die Gunst der Stunde. Bereits im April 1917, als Lenin aus dem schweizerischen Exil nach Petrograd zurückkehrte und die Lösung der drängendsten Fragen unter der Bedingung «Alle Macht den Räten!» verkündete, traten die Bol’ševiki als tatkräftige Alternative zu der zögernden Provisorischen Regierung in der Öffentlichkeit auf. Da die Popularität aller sonstigen Parteien durch ihre Mitwirkung an der Regierung geschwächt war, gewannen die Bol’ševiki immer mehr Anhang und erreichten im Herbst die Mehrheit in den wichtigsten Räten. Lenins Idee des politischen Umsturzes sorgte zwar für heftige Kontroversen auch in den eigenen Reihen, wurde aber schließlich am 10. Oktober angenommen. In der Nacht zum 25. Oktober (7. November) besetzten sowjettreue Truppen und die Roten Garden (den Bol’ševiki nahe stehenden bewaffneten Arbeitermilizen) die wichtigsten Gebäude, auch die Stadtresidenz des Zaren, den Winterpalast, und verhafteten die Provisorische Regierung: Ohne nennenswerten Widerstand kamen nun die Bol’ševiki in der Oktoberrevolution (> Glossar) von 1917 an die Macht. Ihre ersten Beschlüsse – Dekrete über den Frieden, über «Grund und Boden» (die Legalisierung der Bodenaufteilung ohne Entschädigung), über die «Arbeiterkontrolle» sowie die Deklaration des Selbstbestimmungsrechts aller Völker Russlands – trafen zwar die Interessen der Arbeiter und Bauern, brachten den Bol’ševiki indessen zunächst keine mehrheitliche Unterstützung. Um die Machtfrage endgültig für sich zu entscheiden, lösten
Teil C: Regionale Schwerpunkte
250
sie am 6. Januar 1918 die Verfassunggebende Versammlung auf, in der die Sozialrevolutionäre die Mehrheit hatten. Der Weg zu einer klassenlosen kommunistischen Gesellschaft stand nun offen, allerdings war es noch nicht entschieden, ob die beginnende Übergangsphase der Diktatur des Proletariats eine Rätedemokratie oder eine Parteidiktatur sein würde. In welchem Masse die Oktoberrevolution von 1917 ein illegitimer Putsch einer radikalen Minderheitenpartei (etwa Richard Pipes, Martin Malia) war, ein Umsturz auf breiter sozialer Basis (Heiko Haumann: Revolution) oder als Aufstand zumindest durch eine zeitweise Unterstützung der politisch aktiven Mehrheit in den Hauptstädten gerechtfertigt (etwa Ronald G. Suny, Manfred Hildermeier), darüber streiten die Historiker bis heute. Auch die Bewertung der Folgen dieses Auftakts zu sozialen Umwälzungen, die sich ebenfalls auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts jenseits der Grenzen Russlands auswirkten, fällt sehr unterschiedlich aus: als Katastrophe, die das Land in den Abgrund von Gewalt und Terror stürzte (etwa Richard Pipes, Jörg Baberowski) oder als eine Verweigerung der Moderne (Boris Mironov). Die kardinale und stark politisierte Forschungsfrage, inwiefern der Stalinsche Terror im Vorgehen der Bol’ševiki während der Oktoberrevolution und des Bürgerkrieges bereits als Programm angelegt war oder die Gewalttaten der Bol’ševiki der Tagespolitik geschuldet waren, wird ebenso konträr beantwortet. Der Kriegszustand an den Grenzen und im Inneren des Landes zwang die noch nicht gefestigte Sowjetmacht zu entschiedenen Handlungen: Im Friedensschluss mit Deutschland am 3. März 1918 in Brest-Litovsk und in den folgenden Verträgen verlor das sowjetische Russland zwar weite Gebiete im Westen und Süden (Baltikum und die Ukraine), es konnte jedoch Petrograd vom deutschen Angriff retten. Die Hauptstadt wurde allerdings am 12. März 1918 nach Moskau verlegt. Nun mussten Kräfte für die Abwehr der inneren Kontrahenten mobilisiert werden. Denn in den Randgebieten formierte sich die Bewegung jener russischen Kräfte, die die Oktoberrevolution und ihr Programm ablehnten, die «Weißen», zu militärischen Einheiten, die sich mit der Unterstützung von alliierten Interventionstruppen einen erbitterten Kampf gegen die «Roten» lieferten. Die von Lev Trockij (eig. Bronštejn, 1879–1940) rasch zusammengestellte Rote Armee (> Glossar) konnte bereits 1920 den Bürgerkrieg gegen die zersplitterten und politisch uneinheitlich orientierten «Weißen» für sich entscheiden. Dieser Sieg wurzelte in der or-ganisatorischen Stärke Trockijs, in der wesentlichen Unterstützung der Ro-ten Armee durch ehemalige zarische Offiziere, im Terror der neuen politi-schen Polizei (ČK > Glossar) sowie in den bolschewistischen Versprechun-gen an die Bauern und nichtrussischen Nationalitäten, die viel weiter gingen, als jene der sozialkonservativen und russisch-nationalen «Weißen».
1. Russland und die Sowjetunion
251
Der Aufbau des jungen Sowjetstaates, der sozialistischen Wirtschaft und Gesellschaft wurde durch die Kriegshandlungen überschattet und geprägt: Die Verteilung und Produktion übernahm im «Kriegskommunismus» der Staat; die großen Betriebe wurden verstaatlicht und an die Bedürfnisse des Krieges angepasst. Gewaltsame Getreiderequirierungen und Ablieferungs-pflicht für die Bauern sollten die Versorgungsprobleme lösen. Die gesellschaftliche Struktur änderte sich grundlegend: Die alten Eliten (Adlige, bürgerliche Unternehmer, Beamte, Intellektuelle) fielen dem Terror der Revolutions- und Bürgerkriegsjahre zum Opfer, wurden zur Emigration gezwungen oder verheimlichten, auch in der Folgezeit, ihre Herkunft. Die nun nivellierten Bauern organisierten sich erneut in Dorfgemeinden. Trotz mehrerer Versuche, wieder demokratischere Formen in das politische Leben einzuführen, trotz einer Aufbruchstimmung am Ende des Bürgerkrieges, die zu erstaunlichen Zukunftsprojekten führte, setzte sich schließlich eine andere Entwicklung durch: Das politische System wurde zunehmend durch die kommunistische Partei dominiert, militarisiert, bürokratisiert und zentrali-siert. Die Räte verloren dabei an Bedeutung und die übrigen Parteien wurden verboten. Auf dem 10. Parteitag der kommunistischen Partei im März 1921 wurde schließlich im Duktus des «demokratischen Zentralismus» (> Glossar) auch die Fraktionsbildung innerhalb der kommunistischen Partei verboten. Der Aufbau des Landes nach dem Bürgerkrieg gestaltete sich schwierig: Industrie und Landwirtschaft waren am Boden zerstört, die Hungersnot ergriff weite Teile des Landes und erreichte im Winter 1921/22 ihren Höhepunkt. Widerstand der Bauern, Arbeiter und Soldaten (Aufstand der Kronstädter Matrosen) kündigte sich an. Die sowjetische Führung war gezwungen, Kompromisse mit der Bevölkerung einzugehen und beschloss eine Lockerung des Kurses im Rahmen der «Neuen Ökonomischen Politik».
1.5.2 Sowjetunion (1922–1991)
Die am 27. Dezember 1922 gegründete Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken setzte die territoriale Einheit des Russländischen Reiches fort (mit Ausnahme Finnlands, des Baltikums, Polens, Bessarabiens sowie westlicher Teile Weißrusslands und der Ukraine), nachdem die Rote Armee die weißen Kräfte hinter die ehemaligen Grenzen des Reiches vertrieben hatte. Zu Beginn bestand die Union aus vier Unionsrepubliken, 1936 waren es aufgrund administrativer Umstrukturierungen bereits elf und nach der Eroberung der westlichen Territorien im Zuge des Zweiten Weltkrieges 15 (> Karte 7, S. 378/79). Sie wurden politisch von Moskau aus geführt. Die Möglichkeiten einer eigenständigen kulturellen Entfaltung waren zumindest während der 1920er-Jahre durchaus gegeben. Dabei suchte die sowjetische Führung die nationalen Eliten durch gezielte Förderung im Rahmen der
Teil C: Regionale Schwerpunkte
252
sogenannten korenizacija (> Glossar) in den staatlichen Apparat zu integrieren, so wie das Zarenreich zuvor nichtrussische Eliten (etwa die tatarischen, georgischen oder armenischen) in den russländischen Adel integriert hatte. Zwar wurden die Zugeständnisse an nationale Kulturen in der Folge zeitweise ausgehöhlt oder zurückgenommen, die grundsätzliche föderative Struktur des Staates hatte aber ihre Geltung bis zur Auflösung der Sowjetunion und die korenizacija zeigte langfristige Wirkungen bei der Entstehung von «nationalen» Eliten in den einzelnen Sowjetrepubliken.
Die «Neue Ökonomische Politik» und Stalins Aufstieg zur Macht Der relativ flexiblen Nationalitätenpolitik entsprach die begrenzte Zulassung der Markwirtschaft und des Privatbesitzes in Kleinhandel, -industrie und Landwirtschaft – das Programm, das als Neue Ökonomische Politik (NĖP > Glossar) auf dem 10. Parteitag 1921 angenommen und bis zum erneuten Kurswechsel 1928/29 umgesetzt wurde. Ihre Ziele konnte die NĖP erreichen: Die Wirtschaft erreichte um 1925/26 das Produktionsniveau von 1913, städtisches Leben konnte wieder aufblühen, und die stärkere Berücksichtigung der Konsumwünsche der städtischen und ländlichen Bevölkerung stabilisierte die Sowjetmacht. Der Aufschwung in Kunst, Kultur und Wissenschaft, der vom visionären Optimismus des Aufbaus einer neuen Gesellschaft und der Schaffung des «Neuen Menschen» getragen wurde, widerspiegelte die in das Projekt gesetzten Hoffnungen und von unten ausgelösten Dynamiken. Die Entwicklung der politischen Strukturen ging nach einer zu Beginn durchaus möglichen Debattierkultur in eine entgegengesetzte Richtung: Die formale Föderation wurde von der kommunistischen Partei dominiert, und die Namen gebenden basisdemokratischen Prinzipien des Rätesystems verlo-ren zunehmend an Bedeutung. Richtungsdebatten innerhalb der Partei waren zwar noch möglich, das bereits geltende Fraktionsverbot zementierte aber den Weg für die spätere Ausschaltung politischer Gegner, als die zunehmende wirtschaftliche Krise offensichtlich wurde und die Bauernfrage sowie die Zukunft des Landes neu verhandelt werden mussten. Der prosperierende Kleinhändler der NĖP-Zeit war eher in den Städten anzutreffen. Das beabsichtigte neue Bündnis mit den Bauern, smyčka (> Glossar), weckte Hoffnungen, blieb jedoch weitgehend ein nicht eingelöstes Versprechen, angesichts schwerer Strukturkrisen der jungen sowjetischen Wirtschaft. Basis und Substanz der Industrie stammten aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und das Auseinanderklaffen der Preise für Industrie- und Agrarerzeugnisse, die sogenannte «Scherenkrise», führte zu erneuten Konflikten mit der Bauernschaft. Die Bauern konnten immer weniger Konsumgüter für ihre Produkte kaufen und brachten immer weniger
1. Russland und die Sowjetunion
253
Getreide auf den Markt. Die Versorgung der Städte wurde erneut zum akuten Problem, und die Verankerung der Sowjetmacht auf dem Lande stand erneut zur Disposition. Dass zugleich die Führung der kommunistischen Partei 1924 durch den Tod Lenins ihre absolute Autorität verlor und der Generalsekretär der Partei Iosif Stalin (eig. Džugašvili, 1879–1953) die internen Machtkämpfe um die Nachfolge Lenins für sich entscheiden konnte, führte zur verschärften Hierarchisierung und Zentralisierung der Partei: Im Laufe der 1920er-Jahre gelang es Stalin, den Parteiapparat durch neue Mitglieder auszubauen, die er als seine Machtbasis gegen die alten Bol’ševiki und seine Rivalen – Lev Trockij, Grigorij Zinov’ev (eig. Ovsej-Geršen Radomyšel’skij-Apfel’baum, 1883–1936) und Lev Kamenev (eig. Rosenfel’d, 1883–1936) – dienen sollten. Stalins Manöver, mit denen er seine Gegner ausschaltete, entschieden schließlich die Richtung, die die Bauernfrage und die zukünftige Entwicklung des Landes nehmen sollten: Als auf dem 14. Parteitag 1925 im Rahmen der Debatte um das Tempo und den Weg der Industrialisierung (Industrialisierungsdebatte) die später als «linke» Opposition verurteilte Gruppe um Trockij, Zinov’ev und Kamenev ein Ende der NĖP forderte und für eine radikale Industrialisierung ohne Rücksicht auf die Bauern eintrat, verteidigte Stalin die NĖP, um später selber diesen «linken» Kurs eines forcierten Aufbaus der Schwerindustrie auf Kosten der Bauern einzuschlagen und die Befürworter einer langsameren und bauernfreundlicheren Gangart der Industrialisierung als «rechte» Opposition zu verurteilen. Getreidekrisen von 1927 bis 1929 dienten Stalin dabei als Argument, die NĖP abzubrechen und eine gewaltsame Kollektivierung der Landwirtschaft in Angriff zu nehmen, die die Industrialisierung finanzieren sollte. Als die Hoffnung auf eine Weltrevolution immer mehr schwand, verkündete das isolationistische Programm Stalins, die forcierte Erschaffung der materiellen Basis sollte den Durchbruch zum «Sozialismus in einem Land» beschleunigen.
Stalins «Revolution von oben» Stalins «Revolution von oben», wie die Periode zwischen dem Beginn von Zwangskollektivierung der Landwirtschaft und forcierter Industrialisierung um 1929 und den späten 1930er-Jahren bezeichnet wird, veränderte die im Aufbau begriffene frühsowjetische Gesellschaft erneut grundlegend – in ökonomischer, sozialer und politischer Hinsicht. Aus einem Agrarland wurde die Sowjetunion in kürzester Zeit zu einem Industriestaat: Während der ersten Fünfjahrespläne (1929–1932 und 1933–1937) erreichte die Sowjetunion im Produktionsvolumen die westeuropäischen Industrienationen und sicherte sich gegen Ende der 1930er-Jahre den zweiten Platz hinter den USA. Ein hoher Verschleiß an menschlicher Kraft und
Teil C: Regionale Schwerpunkte
254
natürlichen Ressourcen war der Preis dafür. Die Produktivität blieb dabei niedrig, die Schwer- und Rüstungsindustrie wurde auf Kosten der Leichtindustrie und Infrastruktur gefördert. Dass die Bevölkerung auf Konsum weitgehend verzichten musste, wurde in Kauf genommen. Das Bildungswesen wurde hingegen auf allen Stufen ausgebaut, um eine neue, in erster Linie technisch geschulte Kadergeneration für den Aufbau des Sozialismus zu züchten. Soziale und räumliche Mobilität prägten die gesellschaftliche Struktur der Sowjetunion in den 1930er-Jahren wesentlich: Massen von Bauern strömten in die Städte, was häufig zu einer Überforderung städtischer Politik und Infrastruktur führte. Die Bauern fanden in der Stadt vielfach sozialen Aufstieg, gleichzeitig entstanden bäuerlich geprägte Lebensbereiche am Rande der großen Städte. Einige Forscher sehen in dieser Entwicklung gar eine Ruralisierung städtischer Lebensformen (Thomas M. Bohn). Denn die herkömmliche Wirtschaftsweise auf dem Dorf sollte den Kollektivwirtschaften (Kolchosen > Glossar und Sovchosen > Glossar) Platz machen, die den Privatbesitz an Grund und Boden aufhoben. Der gewaltsamen Durchsetzung dieser Politik fielen während der Kampagne gegen relativ wohlhabende Bauern, die in der von Stalin ausgerufenen «Liquidierung der Kulaken als Klasse» (> Glossar Kulak) gipfelte, sowie im Zuge der Sesshaftmachung der Nomaden in Zentralasien Hunderttausende zum Opfer. Bäuerlicher Widerstand und erneute Getreiderequirierungen für die Städte und den Export führten 1932/33 zu einer schweren Hungerkrise: Über fünf Millionen Menschen, vor allem in der Ukraine, aber auch in Kasachstan, starben dabei. Inwiefern der Hunger von der sowjetischen Führung in Kauf genommen wurde (etwa Nikolaus Katzer) oder gezielt als Waffe etwa gegen die aufsässigen Ukrainer eingesetzt wurde (etwa Gerhard Simon), diese Frage wird in der Forschung unterschiedlich beantwortet. Für das neue ukrainische Selbstbewusstsein ist die Erinnerung an die Hungersnot von 1932/33 – holodomor («Hunger-Genozid») – zu einem der wichtigsten identitätsstiftenden Elemente geworden. Die gewaltsame Zusammenführung bäuerlicher Höfe in Kollektivwirtschaften war ein Misserfolg in jeder Hinsicht: Insbesondere der Widerstand der Bäuerinnen zwang die Führung zu Konzessionen und Zulassung individuell genutzten Hoflandes in begrenztem Umfang, das den Bauern und teilweise den Städten das Überleben ermöglichte. Die noch stärkere Zentralisierung des politischen Systems gipfelte in einer faktischen Alleinherrschaft Stalins. Sein diktatorischer Führungsstil und der willkürliche Terror, von dem keine Bevölkerungsschicht der Sowjetunion verschont blieb, hielten die Massen in permanentem Kampf gegen die möglichen und vemeintlichen inneren und äußeren Feinde: Die «großen
1. Russland und die Sowjetunion
255
Säuberungen» des Parteiapparates mit ihrem Höhepunkt in den Schauprozessen der Jahre 1936 bis 1938 zunächst gegen die alte Garde der Partei und später gegen die Armeespitze zogen die Auslöschung der intellektuellen Avantgarde und nichtrussischen Eliten nach sich, die als Sündenböcke in den nicht immer nachvollziehbaren Strategien Stalins fungieren sollten. Doch grundsätzlich konnte jede und jeder zum «Volksfeind» erklärt werden und in den Mühlen des NKVD (> Glossar ČK) oder im Zwangsarbeitslager enden. Millionen von Sowjetbürgern erlitten dieses Schicksal. Ausbau und Stärkung der Staatssicherheit und des Lagersystems GULAG (> Glossar), Aufrufe zu Denunziation und ein ständiges Auswechseln von Eliten waren die wesentlichen Einschüchterungs-mechanismen, die die Stalinsche Herrschaftsmaschine am Leben erhielten. Die Ursachen für den Terror der 1930er-Jahre sind in mehreren Faktoren zu suchen, wobei die bisherige Forschung hier keine abschließende Antwort gibt: Die zentralistische Struktur des Machtapparates mit Stalin an der Spit-ze, die zunehmende Machtentfaltung der Geheimpolizei mit Tendenz zur Verselbstständigung ermöglichten die Durchführung des Terrors. Stalins gezieltes gegenseitiges Ausspielen einzelner Organe steigerte zudem die Dynamik des Terrors ebenso wie die Rivalitäten innerhalb der Apparate und das Denunziationswesen. Eine durchdachte und konsequente Linie verfolgte der Terror nicht, er erfüllte jedoch zugleich mehrere Funktionen: Als Präven-tivmaßnahme gegen jegliche Opposition sowie gegen Bevölkerungsgruppen, die als im Kriegsfall unzuverlässig galten, als Rotationsinstrument für die Schaffung loyaler Eliten und Mobilisierungsmechanismus für die Stalinsche Politik, schließlich als Instrument, um von den Fehlern der Führung abzu-lenken. Das Festhalten der Kommunisten an der Einheit der Partei, die Ver-drängung der Angst vor dem Terror, der Gewalt und Ungerechtigkeit ange-sichts der relativen Verbesserung von Aufstiegs- und Verdienstmöglichkei-ten bei vielen Städtern sowie ein naiver Glaube an Stalins Unwissenheit über die Machenschaften seines Apparats verhinderten eine breite Kritik am Re-gime von unten. Der Stalinismus erschöpfte sich allerdings nicht nur in Terror, Zwang und Drohung. Integrative Funktionen, die dem System Stalins nicht nur Loyalität, sondern auch die Begeisterung der Massen brachten, erfüllten nicht zuletzt der Kult um die Person Stalins, die Rückkehr zu konservativen Werten sowie die optimistischen Zukunftsvisionen, die vor allem bei der jüngeren Generation ihre Wirkung zeigten. Der Stalinkult knüpfte an den Zarenmythos an und wurzelte im Leninkult, der von Stalin gezielt ausgebaut und instrumentalisiert wurde. Der «große Umbruch», wie Stalin die von ihm eingeleitete Wende von 1928/29 bezeichnet hat, ersetzte die Ideale der Oktoberrevolution in allen Bereichen durch konservative Werte und machte viele Entwicklungen der frühen Sowjetzeit rückgängig: Der proletarische
Teil C: Regionale Schwerpunkte
256
Internationalismus wurde im Zuge des Aufbaus des «Sozialismus in einem Land» zunehmend durch den Sowjetpatriotismus ersetzt, der immer deutlicher russisch-nationale und populistische Züge annahm. Ebenso zurückgenommen wurde die revolutionäre Absage an traditionelle Frauenbilder. Zwar war die Praxis hinter der fortschrittlichen rechtlichen Gleichstellung von Frau und Mann nach 1917 hinterher gehinkt, die Frauenbewegung unter den Bol’ševikinnen Inessa Armand (eig. Inès Armand, 1874–1920) und Aleksandra Kollontaj (1872–1952) hatte aber versucht, die politische Bildung und aktive Beteiligung der Frauen am öffentlichen Leben auf dem Land und in der Stadt zu heben. Im Laufe der 1920er- und noch stärker in den 1930er-Jahren wurden die politischen Aktivistinnen auf die traditionellen weiblichen Bereiche zurückverwiesen (Gesundheits- und Sozialfürsorge), die Rechte der Frauen wurden beschnitten: Abtreibungen aus nichtmedizinischen Gründen durften ab 1936 nicht mehr vorgenommen werden, eine Ehescheidung gestaltete sich rechtlich wieder schwierig. Die Mutter- und Ehefrauenrolle wurde hingegen aufgewertet und als Staatsauftrag instrumentalisiert. Diese Neuerungen sprachen vor allem jene Frauen an, für die das Umdenken der Geschlechterverhältnisse noch fremd war. Die Kultur und Kunst wurden ebenso auf ein traditionell-konservatives Wertekorsett eingeschworen: Die «Nähe zum Volk», Loyalität zur Partei und Realismus waren die Prinzipien der seit 1932 einzig zugelassenen Stilrichtung des «Sozialistischen Realismus» (> Glossar). Die avantgardistische Experimentierfreudigkeit der frühen Sowjetzeit und zahlreiche Künstlergruppen und -vereine wurden verboten und verfolgt. Angepasste Profiteure, wie etwa der populäre Komponist Isaak Dunaevskij (1900–1955), «Sänger des Volkes» (Matthias Stadelmann), arrangierten sich mit dem Regime und feierten Erfolge. Aber auch das Regime arrangierte sich mit den Künstlern, wenn sie für die Propagandazwecke instrumentalisiert werden konnten. Die Einschätzung des Stalinismus ist mittlerweile zur zentralen Kontroverse der Forschung avanciert: Wie stark wurden die Säuberungen und der Mas-senterror von Stalin selbst dirigiert (Robert Tucker; Ronald G. Suny: Stalin and His Stalinism, in: Hoffmann; Oleg Chlevnjuk)? War die Entwicklung von der Oktoberrevolution zum System Stalins bereits in der straffen und undemokratischen Organisation der Partei unter Lenin und in der Gewalt-bereitschaft der jungen Sowjetmacht während der Revolution und des Bürgerkrieges vorgezeichnet (Jörg Baberowski), oder war diese Entwicklung eine Abkehr von den Ideen und Idealen von Marx und Lenin (Heiko Haumann: Geschichte)? War die Machtgier und spätere Paranoia Stalins bei der Entwicklung zu den Säuberungen und zum Großen Terror entscheidend oder war es eine Verdichtung überstürzter Notmassnahmen, die dazu geführt hat (Andreas Kappeler: Russische Geschichte)? Wie stark ist dabei die ange-nommene und tatsächliche Bedrohung durch den Westen zu gewichten (Oleg
1. Russland und die Sowjetunion
257
Chlevnjuk)? Waren die Menschen unter dem Stalin-Regime bloße Marionetten, ihrer Persönlichkeiten beraubt (Richard Pipes, Martin Malia), oder waren bestimmte Gruppen aktive Träger des Systems (Moshe Levin, Sheila Fitzpatrick)? Wie gestaltete sich ihr Selbstverständnis zwischen dem Kollektiven und dem Individuellen, dem Sowjetischen und Nationalen (Oleg Kharkhordin, Igal Halfin, Jochen Hellbeck, Brigitte Studer/Heiko Haumann)? Lassen sich die westlichen Vorstellungen vom Individuum auf die sowjetischen Menschen übertragen (Anna Krylova, Jochen Hellbeck)? All diese Fragen beschäftigen die aktuelle Forschung (vgl. Staat und Gesellschaft, S. 264).
Der «Große Vaterländische Krieg» Zur Zerreißprobe für den Stalinismus und die sowjetische Gesellschaft wurde der Zweite Weltkrieg, in dem die Sowjetunion ab 1941 eigenes Territorium verteidigte. Zuvor ging Stalin 1939 ein unerwartetes Bündnis mit Hitler (Hitler-Stalin-Pakt) ein, in dem ein Verzicht auf gegenseitigen Angriff und die Aufteilung der «Pufferzone» zwischen Deutschland und der Sowjetunion vereinbart wurde: Die Sowjetunion besetzte daraufhin Estland, Lettland, Litauen, Teile Polens und der West-Ukraine sowie Bessarabien. Der Pakt verhinderte jedoch den Überfall des nationalsozialistischen Deutschlands und seiner Verbündeten auf die Sowjetunion nicht, und die Auslöschung eines Großteils der sowjetischen militärischen Elite durch Terror während der 1930er-Jahre führte zu enormen menschlichen und territorialen Verlusten der Sowjetunion zu Beginn des Krieges. Die Mobilisierung der Bevölkerung für die Verteidigung der Sowjetunion war weniger ein Erfolg der Stalinschen Propagandamaschine als die Reaktion auf den brutalen Vernichtungskrieg Nazi-Deutschlands. Denn die Appelle der sowjetischen Führung an die patriotischen Gefühle im zum «Großen Vaterländischen Krieg» erklärten Kampf gegen Deutschland und einige Konzessionen gegenüber der Bevölkerung etwa in Sachen Religion gingen mit weiterhin drastischen Einschüchterungsmaßnahmen in den Betrieben der Heimatfront und in der Armee einher. Die angestrebte Symbiose von Machtapparat und Gesellschaft wurde nur punktuell und zeitweise erreicht. Erst der Sieg verschaffte dem Regime einen Rückhalt, den es vor und während des Krieges nicht erreichen konnte. Der Sieg in diesem verlustreichen Krieg – ca. 27 Millionen Sowjet-bürger verloren dabei ihr Leben – trug zur Integration der sowjetischen Gesell-schaft und zur Legitimation der Sowjetmacht trotz erneuter Verfolgungen bei, auch an den nichtrussischen südlichen Peripherien. Das Prestige des Regimes steigerte zudem die Ausdehnung der sowjetischen Einflusszone auf die Staaten Ostmittel- und Südosteuropas (Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, die DDR, Rumänien und Bulgarien sowie bis in
Teil C: Regionale Schwerpunkte
258
die 1960er-Jahre Albanien), die die Sowjetunion auf den Podest der zweiten Supermacht in der Welt hob. Der 1947 einsetzende Kalte Krieg (> Glossar) und die verstärkte Konfrontation mit den USA rückten die Außenpolitik in den Vordergrund, auf Kosten der inneren Probleme der sowjetischen Nachkriegsgesellschaft. Die Rüstungsausgaben wurden weiterhin erhöht, die Bedürfnisse der Bevölkerung ignoriert. Stalin selbst befand sich auf dem Höhepunkt seiner Macht, der Personenkult erreichte seinen Gipfelpunkt in der Zuschreibung des Sieges als sein persönliches Verdienst.
Die Entstalinisierung und «Tauwetter» unter Chruščev Erst der Tod Stalins am 5. März 1953 setzte eine Dynamik frei, die einen allmählichen Wandel ermöglichte: die Entstalinisierung der sowjetischen Gesellschaft. Der Machtkampf um die Nachfolge Stalins brachte zunächt eine kollektive Führung mit dem Ministerpräsidenten Georgij Malenkov (1901–1988), Außenminister Vjačeslav Molotov (eig. Skrjabin, 1890–1986) und Innenminister Lavrentij Berija (1899–1953), dem gefürchteten Chef der Stalinschen Geheimpolizei, hervor. Nach der Ausschaltung Berijas noch im gleichen Jahr (1953) gelang es schließlich Nikita Chruščev (1894–1971), die Nachfolge Stalins für sich zu entscheiden. Ab März 1958 führte er Partei und Staat zugleich. Bereits zuvor, auf dem 20. Parteitag 1956, kündigte er in seiner berühmten «Geheimrede» eine Wende in der politischen Entwicklung der Sowjetunion an, die sich allerdings als halbherzig erwies: Zwar rechnete Chruščev mit dem Personenkult Stalins ab, allerdings stellte er die Fehler Stalins lediglich als ein Abweichen von einer grundsätzlich richtigen Entwicklung dar. Seine Kritik richtete sich keineswegs gegen die Grundlagen des soziopolitischen Systems, das von Lenin und Stalin geschaffen worden war. Das politische Monopol der kommunistischen Partei blieb unangetastet und wurde gar verstärkt. Dennoch standen Massenterror, Deportationen und Lagerhaft – die wesentlichen Stalinschen Mechanismen der Machterhaltung – nicht mehr auf der Agenda der Partei- und Staatsführung. Millionen politischer Häftlinge wurden aus den Lagern und Gefängnissen entlassen, Deportierte konnten in ihre Heimat zurückkehren. Selbst der Austausch der obersten Führungsschicht erfolgte nun zum ersten Mal seit Lenins Tod weitgehend ohne Blutvergießen. Die relative Lockerung des politischen Kurses zog einen anderen Umgang mit den Bedürfnissen der Sowjetmenschen nach sich: Landwirtschaft und Konsumgüterindustrie wurden gefördert, sozialpolitische Maßnahmen ergriffen, um den Lebensstandard der Sowjetbürger zu heben. Das Lebensgefühl vieler Zeitgenossen umschrieb der sowjetische Schriftsteller und Publizist Ilja Ėrenburg (1891–1967) in seinem gleichnamigen Roman von 1954 als «Tauwetter» und gab diesen Namen zugleich der ganzen Epoche.
1. Russland und die Sowjetunion
259
Die flexiblere Kultur- und Wissenschaftspolitik löste den stalinistischen Dogmatismus ab und ermöglichte eine neue – wenn auch deutlich begrenzte – stilistische und methodische Vielfalt in Kultur, Kunst und Wissenschaft. Kulturelle Einflüsse aus dem Westen drangen in die Sowjetunion nun stärker als zuvor ein. Ein neues Lebensgefühl – Kosmos-Fieber – ergriff die sowjetischen Menschen, als 1957 die Signale des ersten sowjetischen Satelliten aus dem All in der ganzen Welt empfangen wurden und Jurij Gagarin (1934–1968) 1961 als erster Mensch im Weltall die Erde in 108 Minuten umrundete. Die Erfolge in der Raumfahrt waren Garanten des Fortschritts und der hellen Zukunft für die Menschen in der Sowjetunion. Die Raumfahrt entwickelte sich neben der Erinnerung an den «Großen Vaterländischen Krieg» zu einem der wichtigsten integrativen Faktoren der sowjetischen Gesellschaft und nimmt auch heute noch im neuen Russland einen prominenten Platz im patriotischen Repertoire ein. Den Westen versetzten die Erfolge der Sowjetunion auf diesem Gebiet in Staunen und Angst. In der Außenpolitik ersetzte Chruščev den Stalinschen Isolationismus und die Konfrontation mit dem Westen durch den Kurs auf eine «friedliche Koexistenz» mit dem Westen. Hinter grund war die Bedrohung der Welt durch einen Atomkrieg zwischen den Supermächten, seit die Sowjetunion in der Kernwaffentechnik mit den USA gleichgezogen hatte. Allerdings bescherte die Inkonsequenz und Sprunghaftigkeit der Chruščevschen Politik in allen Bereichen neue Probleme: Die relative Annäherung an den Westen führte 1959 zum Konflikt mit dem seit 1949 unter kommunistischer Führung stehenden China. Für die ostmitteleuropäischen Länder des Ostblocks hingegen gingen die liberalisierenden Tendenzen der Sowjetunion nicht weit genug, die entstandenen Hoffnungen entluden sich in Aufständen gegen die sowjetische Dominanz, die mit Gewalt niedergeschlagen wurden: in Ostberlin (1953), Ungarn (1956) und später in der Tschechoslowakei (1968). Die Reformen Chruščevs lösten ähnliche Dynamiken im Inneren des Landes aus. Es formierten sich Oppositionsbewegungen, die in den späten 1960er-Jahren an Bedeutung gewannen: die Menschenrechtsbewegung um den Physiker Andrej Sacharov (1921–1989) und den Schriftsteller Aleksandr Solženicyn (1918–2008), nationale Bewegungen etwa der Krimtataren oder Litauer. Übereilte Experimente in der Wirtschaft, wie etwa die Gewinnung von landwirtschaftlichem Nutzland in unwirtlichen Steppen Kasachstans und der unteren Wolga (Neulandkampagne) oder die Einführung von klimatisch ungeeigneten Kulturen (Mais), erreichten ihre Ziele nach anfänglichen Erfolgen nicht oder endeten im Fiasko. Die utopischen Versprechungen, die USA bis 1970 einzuholen und bis 1980 die kommunistische Gesellschaft errichtet zu haben, verloren immer mehr an Mobilisierungskraft. Außenpolitisch paarte sich der Chruščevsche Kurs der «friedlichen
Teil C: Regionale Schwerpunkte
260
Koexistenz» mit Unberechenbarkeit und risikoreichen Unternehmungen und führte zu erneuten Konfrontationen, vor allem 1962 während der Kuba-Krise. Unpopuläre Reformen in Parteiapparat und Militär sowie die von Chruščevs Umgebung als Misserfolg wahrgenommenen Ergebnisse seines außenpolitischen Manövrierens führten schließlich 1964 zu seiner Absetzung, unter dem Vorwurf sprunghafter und inkompetenter Politik.
Die «Stagnation» unter Brežnev Chruščevs Nachfolger Leonid Brežnev (1906–1982) setzte hingegen auf eine Stabilisierung der sowjetischen Gesellschaft und des Machtapparats, die zunächst Erfolge zeitigte, jedoch zunehmend das politische System erstarren ließ: Dieser Entwicklung ist die spätere Bezeichnung dieser Phase als Stagnation zu verdanken. Das Prinzip der kollektiven Führung setzte Brežnev fort und sicherte dabei die Machtstellung der Nomenklatura (> Glossar), der politischen Elite und des Parteiapparats. Die unter Chruščev eingeführten Rotationsfristen wurden abgeschafft, eine Überalterung und Verkrustung der Führung war die Folge. Innenpolitisch verzichtete die Führung um Brežnev auf waghalsige Versprechungen und Unternehmungen. Die Mobilisierung der Massen durch Großprojekte, wie etwa den Bau der Bajkal-Amur-Eisenbahnlinie (BAM), setzte sich zwar fort, allerdings nicht mehr im Duktus der stalinistischen Selbstaufopferung und Einschüchterung. Das Vorgehen gegen die oppositionellen Gruppen verschärfte sich im Vergleich zum «Tauwetter», bedeutete aber keine Rückkehr zu den Methoden des NKVD unter Stalin. Das Verhältnis zwischen der politischen Führung und den breiten Bevölkerungsmassen beruhte zunehmend auf formalisierter Loyalität, die zugleich Freiräume für eine aufkeimende Selbstorganisation der Gesellschaft gewährte – sei es in der Entstehung illegaler privater Betriebe (Schattenwirtschaft), nationaler Folklorebewegungen oder studentischer Umweltgruppen. Grundlage für diese Entwicklung bildeten einerseits das zunehmende Schwinden der Integrationskraft der kommunistischen Ideologie, das mit der Erstarrung des politischen Systems einherging. Auf der anderen Seite bewirkte der anfängliche wirtschaftliche Aufschwung unter Brežnev die Verbesserung der materiellen Grundlage und der sozialen Absicherung der Bevölkerung und ermöglichte die Hebung des Bildungsniveaus. Auch in der Außenpolitik brachten die 1970er-Jahre zunächst Entspannung und relative Stabilität, vor allem mit den USA und der BRD. Der Einmarsch der sowjeti-schen Truppen 1979 in Afghanistan setzte dieser Entwicklung ein Ende, und auch im Lager der Ostblockstaaten zeigten sich erneut Abspaltungstendenzen, als die polnische Volksbewegung, die Solidarność, 1980 offen ihre politischen Forderungen zu artikulieren begann. Die sich zunehmend deutlicher abzeich-nende Systemkrise war zudem in der Wirtschaft immer offensichlicher: Die
1. Russland und die Sowjetunion
261
Überspannung der Ressourcen im Wettrüsten mit den USA sowie bei der Un-terstützung kommunistischer Führungen auf der ganzen Welt (Stefan Plaggen-borg: Sowjetische Geschichte nach Stalin) führten zu Engpässen in der Ver-sorgung und zu strukturellen Problemen in der Wirtschaft. Wie tief die öko-nomische Stagnation der Sowjetunion war und welche Faktoren sie verursachten, wird allerdings erst die zukünftige Forschung differenzierter bewerten können.
1.6 Perestrojka und postsowjetische Entwicklungen
1.6.1 Perestrojka und die Auflösung der Sowjetunion
Bereits der verlustreiche und letztlich verlorene Krieg in Afghanistan untergrub den Mythos von der unbesiegbaren Roten Armee und die Autorität ihrer politischen Führung. Die Nachfolger Brežnevs – der mit 68 Jahren zum Generalsekretär gewählte Jurij Andropov (1982–1984) und der ihn mit 73 Jahren lediglich um ein Jahr überlebende Konstantin Černenko (1984–1985) – demonstrierten nur allzu deutlich die bürokratische Verkrustung, Überalterung und den Abgesang des Staats- und Parteiapparats. Die letzte Anstrengung, das politische System und die gesellschaftlichen Strukturen der Sowjetunion zu erneuern, unternahm Michail Gorbačev (geb. 1931), ein deutlich jüngerer und dynamischer Funktionär, der 1985 zum Generalsekretär der KPdSU gewählt wurde. Sein umfassendes Reformprojekt, benannt Perestrojka (> Glossar), begann Gorbačev mit der Wirtschaft. Die Schritte, die das sowjetische Wirtschaftssystem lediglich modernisieren sollten, zogen Entwicklungen nach sich, die zum Systemwechsel führten: Die Förderung der Eigenverantwortung der Betriebe, Marktbeziehungen und Konkurrenz rückten jedoch nicht von den Grundfesten der Planwirtschaft ab. Aufgrund dieser Halbherzigkeit konnte sich weder ein neues marktwirtschaftliches Wirtschaftssystem entwickeln noch die Planwirtschaft weiterhin funktionieren, vielmehr blockierten sie sich gegenseitig. Im zweiten Schritt ging es Gorbačev um die Ankurbelung des gesellschaftlichen Engagements für die Reformen durch die Liberalisierung der Medien und der öffentlichen Meinungsbildung unter dem Schlagwort Glasnost’ (> Glossar). Die dadurch ausgelöste Dynamik überforderte die politische Führung ebenso wie die Wirtschaftsreformen: Hitzige Diskussionen über den Stalinismus weiteten sich bald auf die Einschätzung Lenins und der Oktoberrevolution aus. Damit standen die Grundlagen des sowjetischen politischen Systems zur Disposition. Die weitere Kettenreaktion auf die Pluralisierung der Öffentlichkeit war nicht mehr zu stoppen: 1989 wurden die ersten halbfreien
Teil C: Regionale Schwerpunkte
262
Parlamentswahlen abgehalten, 1990 die Führungsrolle der KPdSU aus der Verfassung gestrichen. Zugleich wirkte sich der neue außenpolitische Kurs Gorbačevs auf die inneren Verhältnisse der multinationalen Sowjetunion aus: Das Ende der sowjetisch-amerikanischen Konfrontation und der Rückzug aus dem Afghanistankrieg 1988, der Verzicht auf eine militärische Verteidigung des seit 1989 auseinanderfallenden Ostblocks und die Zustimmung zur Vereinigung der DDR und der BRD gaben den nationalen Bewegungen in den Unions-republiken neue Impulse. Nationale Eliten erklärten zwischen 1988 und 1990 alle Unionsrepubliken für souverän und forderten von Moskau eine neue Form des Unionsvertrages mit Austrittsrecht. Insbesondere im Baltikum und im Kaukasus spitzte sich die Lage zu, als die stärker gewordenen konservativen Kräfte um Gorbačev ihre Macht in Litauen und Georgien spielen ließen und die Republiken 1991 daraufhin ihre Unabhängigkeit und den Austritt aus der Sowjetunion erklärten. Die übrige Bevölkerung der Sowjetunion schwankte noch in der Frage über die Zukunft der Union: Im Referendum vom März 1991 stimmten 76,8 % einer erneuerten Föderation zu, wobei Estland, Lettland, Litauen, Georgien, Armenien und die Moldau an der Abstimmung nicht mehr teilnahmen. Die Unterschätzung der nationalen Frage während der Perestrojka, unangemessene Reaktionen Moskaus auf die Forderungen der Unionsrepubliken und schließlich die versuchte Rückkehr zum alten System konservativer Kräfte aus Militär, Staatssicherheit und Apparat während des Putsches im August 1991 sowie die darauf folgenden Machtkämpfe in der Moskauer Führung verunmöglichten nun den Zusammenhalt der Sowjetunion in alter Form, verhinderten aber zugleich die mögliche Reform dieser Struktur durch einen neuen Unionsvertrag: Nach dem eindeutigen Ja der ukrainischen Bevölkerung zur Unabhängigkeit ihrer Republik besiegelte Boris El’cin (1931–2007), der am 12. Juni 1991 gewählte Präsident der Russländischen Föderation, die Auflösung der Sowjetunion am 31. Dezember 1991. Der 1990 gewählte sowjetische Staatspräsident Gorbačev trat daraufhin zurück.
1.6.2 Russländische Föderation nach 1991
Aus den internen Machtkämpfen innerhalb der reformfreudigen Kräfte Moskaus formierte sich eine neue Führung Russlands unter Boris El’cin, dem ehemaligen Parteichef von Moskau und ersten Präsidenten einer Russländischen Föderation (1991–1999), die sich nun auch aktiv an der Auflösung der Sowjetunion beteiligte. Als radikaler Reformer stand er dem gemäßigten Gorbačev gegenüber. Insbesondere während des Augustputsches konnte er sich als Verteidiger des neuen demokratischen Weges profilieren und bestimmte die Politik seit der Auflösung der Sowjetunion: Der neue
1. Russland und die Sowjetunion
263
Staat trat die Rechtsnachfolge der Sowjetunion an und übernahm ihre zentralen Institutionen; die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) sollte die Unionsstruktur in einer neuen Form tragen. Die erste Regierung der neuen Russländischen Föderation, die Regierung Egor Gajdars (1991–1993), verfolgte eine Politik radikaler wirtschaftlicher Liberalisierung: Durch eine Schocktherapie sollten der ökonomische Rückgang gestoppt und der Markt gefördert werden. Diese Pläne berücksichtigten allerdings die sozialen Kosten nicht und führten zu erheblichen Spannungen. Ihre Ziele verfehlten diese Reformen gänzlich und provozierten einen Konflikt zwischen dem Präsidenten und dem konservativen Parlament, aus dem El’cin 1993 durch einen Staatsstreich zunächst als Sieger hervorging: Mit Waffengewalt löste er den Obersten Sowjet auf. Doch blieben auch im nächsten Parlament, der Duma, die reformfreudigen Kräfte schwach. El’cin selbst regierte immer autoritärer und setzte nun viel stärker auf Nationalismus und populistisches Gebaren. Die GUS-Staaten spürten erneut die Macht Moskaus und den Druck, sich enger an Russland zu binden. Der Reformkurs trat zunehmend in den Hintergrund und die Frage der Machterhaltung erhielt für die politische Führung der Föderation erste Priorität angesichts der Finanzmanipulationen und Skandale um die sogenannten Oligarchen. Nun stand auch der Zusammenhalt der multiethnischen Russländischen Föderation zur Disposition: Einige Konflikte mit aufstrebenden Republiken wie etwa Tatarstan konnten auf friedlichem Wege beigelegt werden, nicht so in Tschetschenien, das sich 1991 für unabhängig erklärt hatte: 1994 begann Russland einen langwierigen und blutigen Krieg, der 1996 vorläufig endete, als Moskau Tschetschenien eine faktische Selbstständigkeit gewährt hatte. Terroristische Attentate im Herbst 1999 in Moskau gaben Anlass zu erneuten Kriegshandlungen auf tschetschenischem Territorium: Russländische Truppen verwüsteten das Land, den Widerstand tschetschenischer Partisaneneinheiten konnten sie aber nicht brechen. Der zweite Tschetschenien-Krieg bedeutete auch für die Entwicklungen im Inneren Russlands einen Einschnitt. El’cin trat im Dezember 1999 zurück und im darauf folgenden Jahr wurde Vladimir Putin (geb. 1952), ehemaliger Mitarbeiter des Geheimdienstes und letzter Ministerpräsident unter El’cin, zum Präsidenten der Russländischen Föderation gewählt. Er blieb bis Frühjahr 2008 im Amt. Die Ära Putin setzte die sich bereits unter El’cin abzeichnenden Tendenzen zur erneuten Zentralisierung der Macht fort – im Rahmen der «gelenkten Demokratie»: Die Medienfreiheit wurde zunehmend eingeschränkt, allerdings nicht in dem Maße wie zu sowjetischen Zeiten. Zugleich erholte sich die russländische Wirtschaft und nach Jahren der Umbrüche und Krise konnte eine relative politische, wirtschaftliche und soziale Stabilität erreicht werden.
Teil C: Regionale Schwerpunkte
264
1.7 Vertiefender Exkurs I: Staat und Gesellschaft Die Ambivalenz zwischen der Dominanz des Staates bzw. der Herrschafts-strukturen über die Gesellschaft in der Vormoderne und einer geringen Prä-senz der zentralen Macht auf der lokalen Ebene, die sich unter anderem in der Selbstverwaltung der Bauern und ihrer für längere Perioden geltenden Freiheit von der Leibeigenschaft beobachten lässt, bildet eine Grundstruktur der Ge-schichte Russlands und führte nicht selten zu heftigen Kontroversen in der Forschung und überspitzten Klischees in der Wahrnehmung Russlands durch den Westen. Die Grundfrage nach dem Verhältnis zwischen Herrschaftssys-tem und Gesellschaft stellte bereits der habsburgische Diplomat Sigismund von Herberstein, als er um die Mitte des 16. Jahrhunderts schrieb: «Es ist un-klar, ob ein solch wildes Volk eine so tyrannische Herrschaft haben muss, oder ob die tyrannische Herrschaft es so wild und grausam macht.»
Selbstherrschaft Mit der Tyrannei beschrieb Herberstein den spezifischen Herrschaftstypus der Moskauer Autokratie, die sich von den zeitgenössischen Herrschaftsorgani-sationen in Europa durch die Konzentration der Macht beim Herrscher erheblich unterschied. Der Selbstherrscher war an kein verbrieftes weltliches Recht gebunden, dennoch war er kein unumschränkter Tyrann: Dynastische Erbfolge, Tradition (starina) und göttliches Recht setzten ihm grundsätzlich Grenzen, allerdings nicht Institutionen. Über die Wurzeln der Autokratie herrscht in der Forschung kein Konsens. Drei Traditionen werden benannt, jedoch fällt ihre Gewichtung unterschiedlich aus. Sieht Gustave Alef stärker Byzanz als Vorbild für die Moskauer Herrscher, wenn auch mit Eigenarten, betont Christoph Schmidt in Anlehnung an Daniel Ostrowski die Bedeutung der Herrschaftstradition der Goldenen Horde. Andreas Kappeler betrachtet hingegen die Einflüsse von Byzanz und der Goldenen Horde auf die Herausbildung der Moskauer Autokratie als indirekte und misst den eigenen Traditionen der Rus’ eine viel größere Bedeutung zu: dem Prinzip patrimonialer Herrschaft des Moskauer Großfürsten über sein Erbgut (russ. votčina), das sich allmählich zum Herrschaftsprinzip über das ganze Reich entwickelte. Dies bedingte auch den Umstand, dass es in Russland sehr lange keine Trennung zwischen privatem Eigentum und öffentlicher Sphäre gab, wie sie im westlichen Europa durch das Römische Recht verankert war. Anders als im Westen bildeten auch die in weltlichen Belangen weniger starke Kirche und der korporativ kaum organisierte Adel keinen Gegenpol zur Macht des Herrschers. Dabei beruhte die Unterordnung und Dienstbereitschaft des Adels nicht primär auf Zwang, sondern auf gegenseitigem Nutzen: Privilegien und Grundbesitz banden die Adligen an den Herrscher; der Herrscher war wiederum auf den adligen Dienst ebenso angewiesen.
1. Russland und die Sowjetunion
265
Vergleichbar gestalteten sich die Beziehungen zwischen der Kirche und dem Herrscher. Mit einigen Modifikationen blieb der autokratische Herrschaftsmodus im Russländischen Reich bis ins 20. Jahrhundert erhalten. Zu einer zaghaften und halbherzigen Reform ließ sich der Zar erst dann bewegen, als die Erhebung des Volkes in der Revolution von 1905 das Land erschütterte. Die Herrschaftsinstrumente auf regionaler und lokaler Ebene haben allerdings schon zuvor eine gewisse Partizipation des regionalen Adels zugelassen. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts machte nun auch Russland deutliche Schritte zur Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit. Das Übergewicht des Staates wurde in der Forschung häufig hervorgehoben – von Hans-Joachim Torke für die Gesellschaftsstruktur des Moskauer Reiches im 17. Jahrhundert in der Formel der «staatsbedingten Gesellschaft» oder von Dietrich Geyer für das 18. Jahrhundert als «Gesellschaft als staatliche Veranstaltung». In den jüngeren Arbeiten wurden diese Thesen von einer in die Passivität getriebenen Gesellschaft Russlands relativiert. In der Praxis waren die Herrschaftsmechanismen der Autokratie auf der regionalen und lokalen Ebene längst nicht so wirksam, dass sie der Bevölkerung keinen Freiraum gelassen hätten. Das Zarenreich blieb aufgrund seiner territorialen Größe für die ganze Dauer seiner Existenz grundsätzlich viel weniger durch die administrativen Instanzen des Zentrums durchdrungen als etwa die westeuropäischen Staaten. Die Ausführung der Erlasse auf regionaler und lokaler Ebene konnte vom Zentrum aus kaum kontrolliert werden. Zudem war die zentrale Verwaltung auf die Selbstorganisation der Bauern in der traditionellen Gemeinde angewiesen genauso wie auf die Dienste des Adels, der im Rahmen des Systems der Leibeigenschaft die Rechte der Obrigkeit übernahm. Die jüngere Forschung schlug eine neue Konzeptualisierung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft in der Formel von der «Gesellschaft als lokale Veranstaltung» (Guido Hausmann, Lutz Häfner) vor: Die lokale Selbstorganisation als eigenständige Kraft steht dabei viel stärker als zuvor im Zentrum. Bis zu den Reichsgrundgesetzen von 1906 war die russische Selbstherrschaft theoretisch uneingeschränkt, in der Praxis stützte sie sich auf bürokratische, militärische und klerikale Strukturen. Dies erlaubte es einzelnen Persönlichkeiten aus dem hohen Beamtenapparat, einen relativ großen Einfluss auf den Herrscher auszuüben und sich informell an der Herrschaft zu beteiligen. Diese informelle Partizipation beruhte auf Klientelbeziehungen, nicht auf institutioneller Grundlage. Die allmähliche Konstituierung politischer Öffentlichkeit und einer legalisierten Zivilgesellschaft wurde erst mit der Zulassung von Parteien und der Garantie der bürgerlichen Grundrechte im Zuge der Revolution von 1905 möglich. Diese Zivilgesellschaft war jedoch offenbar zu jung und zu instabil, um die
Teil C: Regionale Schwerpunkte
266
Autokratie zu größeren Konzessionen zu zwingen und den radikalen Kräften den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Stalinismus Trotz vieler wesentlicher Unterschiede weist das Verhältnis von Staat und Gesellschaft in der sowjetischen Ära einige Kontinuitäten zum zarischen Russland auf, die häufig im Machtmonopol eines Herrschaftsträgers, dem starken Zentrum, einer personalisierten Herrschaft sowie einer «passiven» Gesellschaft gesehen werden. In diesem Zusammenhang hat insbesondere der Stalinismus eine heftige Forschungskontroverse ausgelöst. Abgesehen von der Frage nach den Kontinuitäten (eine direkte Entwicklungslinie von der Autokratie zum Stalinismus sieht etwa Robert Tucker) war sich insbesondere die angelsächsische Forschung seit den 1970er-Jahren darüber uneinig, inwiefern die stalinistische Herrschaft in der Sowjetunion totalitär und die Menschen ihre passiven Marionetten waren und inwiefern das Konzept des Totalitarismus (> Glossar Totalitarismustheorie) grundsätzlich tragfähig ist. Für die Vertreter der sogenannten Totalitarismustheorie (Zbignew Brzeziński, Richard Pipes, Martin Malia), die sich seit den 1950er-Jahren zunächst in der amerikanischen Sowjetologie etablierte und nach den Merkmalen der Stalinschen Herrschaft fragte, standen dabei Stalin selbst und die politische Führung im Zentrum der Betrachtung. Die sowjetische Gesellschaft betrachteten sie als eine atomisierte passive Masse, die sich unter permanentem Zwang befand. Die Totalitarismustheorie trug zwar zur Erklärung von Herrschaftsmechanismen des Stalinismus bei, konnte jedoch weder den Wandel des Systems nach Stalin erklären noch die Abgrenzung von der vorhergehenden Periode und ließ letztlich gesellschaftliche Prozesse außer Acht. Gegen diese Richtung traten in den 1960/70er-Jahren die sogenannten Revisionisten an: Sie nahmen die Gesellschaft in den Blick und betrachteten vor allem die Bauern (Moshe Levin) und die neue technische Elite (Sheila Fitzpatrick) unter Stalin als aktive Mitgestalter des soziopolitischen Systems, die auf ihre Art und Weise Macht auf die Herrschaftsträger ausübten, diese zur Kooperation zwangen und vom stalinistischen System profitierten. Für einige Kritiker gingen die Revisionisten zu weit in ihrer Betonung der positiven Integration des Stalinschen Regimes. Die Post-Revisionisten (Stephen Kotkin) betonen hingegen erneut die totalitären Züge der stalinistischen Gesellschaft im Rahmen eines «partizipatorischen Totalitarismus» als einer spezifischen Zivilisation, die sich als überlegene Modernität versteht. Die Deutungsparadigmen haben sich inzwischen ausdifferenziert, so dass heute von keinen geschlossenen Schulen oder Lagern innerhalb der Stalinismus-forschung mehr gesprochen werden kann. Die neueren kulturgeschichtlich
1. Russland und die Sowjetunion
267
orientierten Studien zum Stalinismus nehmen häufig Individuen in den Blick und gehen, zum Teil anhand von Selbstzeugnissen, differenzierten Fragen nach der Selbstwahrnehmung der Menschen im Stalinismus, ihren Werthaltungen und Denkweisen, ihrem Alltag nach. In welchem Verhältnis die positive Integration des Stalinschen Regimes zu den Einschüchterungs-mechanismen stand und wie stark sein Rückhalt unter der Bevölkerung war, wird weiterhin Gegenstand der Forschung bleiben. Zudem wird die Frage diskutiert, wie das hohe Maß an Gewalt in der stalinistischen Sowjetunion zu erklären und zu bewerten ist und wie sich das Verhältnis von traditionellen Herrschaftselementen und modernen Zügen gestaltet.
1.8 Vertiefender Exkurs II: Russland der Nichtrussen: Nationalitätenpolitik und Kolonialismus Das Russländische Reich war kein Nationalstaat und die Geschichte Russlands und der Sowjetunion ist keine Geschichte der Russen: Der multiethnische Charakter der Herrschaftsgebilde und Staaten auf diesem Territorium spiegelt sich auch in deren Namen – «russländisch» oder «allrussländisch» steht für ein multiethnisches Imperium, im Unterschied zum «russischen», dem Ethnonym für das russische Volk. Bereits die Kiever Rus’ war ein multiethnisches Gebilde, im 14. Jahrhundert prägten die kulturellen Einflüsse der Mongolen die Rus’ wesentlich. Mit den Eroberungen von Territorien im Süden, Osten und Westen wurde das Moskauer Reich ein Vielvölkerstaat. Mit der weiteren Expansion nach Asien verwandelte sich das Russländische Reich in ein polyethnisches Imperium. Die Eroberung des Kazaner Khanats um die Mitte des 16. Jahrhunderts war ein erster Anstoß in dieser Entwicklung und bedeutete für das Moskauer Reich die Inkorporierung eines eigenständigen islamischen Herrschaftsgebildes. Mit der Expansion in den Westen im 17. bis 18. Jahrhundert wurden kulturell durchmischte Gebiete Ostmitteleuropas mit ständisch organisierter Gesellschaftsstruktur – die Westukraine, Ostseeprovinzen, östliche Teile Polens und Finnland – dem Moskauer bzw. Russländischen Reich angegliedert. Deutlich koloniale Züge wiesen die Eroberung Sibiriens seit dem 16. Jahrhundert und Mittelasiens im 19. Jahrhundert auf. Der Anteil der Großrussen an der Gesamtbevölkerung des Reiches ging mit der Expansion entsprechend zurück: Im frühen 16. Jahrhundert stellten sie noch fast ausschließlich die Bevölkerung, zu Beginn des 18. Jahrhunderts nur noch etwa Dreiviertel, im 19. Jahrhundert knapp die Hälfte der Gesamtbevölkerung des Reiches. Unter den Nichtrussen bildeten andere slawische Völker, Ukrainer und Weißrussen die Mehrheit – etwa einen Sechstel im 18. und einen Viertel der gesamten Reichsbevölkerung im
Teil C: Regionale Schwerpunkte
268
19. Jahrhundert. Die turk- und finno-ugrischen (> Glossar Turkvölker, Fin-no-Ugrier) Völker an der Wolga und im Ural waren mit ca. 5 % im 18. Jahrhundert vertreten; Finnen, Esten, Letten und Deutschbalten mit etwa 4 %. Im 19. Jahrhundert nahm die nichtrussische Bevölkerung des Reiches vor allem durch die Polen (7 %), Juden (4 %) und Muslime im Kaukasus und Mittelasien zu, die zusammen mit den Muslimen an der Wolga und im Ural etwa 12 % der Bevölkerung ausmachten. Der Anteil der Großrussen in der Sowjetunion stieg zunächst bis 1939 auf 58 % an. Dies war auf die Loslösung der Gebiete im Westen zurückzuführen sowie auf hohe Bevölkerungsverluste bei den Nichtrussen infolge der Stalinschen Kollektivierung und der folgenden Hungersnot von 1932/33, deren Opfer größtenteils Ukrainer und Kasachen waren. Territoriale Gewinne im Westen nach dem Zweiten Weltkrieg und die sinkenden Geburtenraten in der russischen Bevölkerung der Sowjetunion wirkten sich auf den Rückgang des prozentualen Anteils der Russen aus: 1989 bildeten die Russen 51 % der Gesamtbevölkerung, Muslime (19 %) und Ukrainer (15,5 %) waren die beiden größten Gruppen der Nichtrussen.
Nichtrussische Untertanen und das Zarenreich Die imperiale Politik Russlands gegenüber den Nichtrussen zeichnete sich durch ein ambivalentes Schwanken zwischen zwei Traditionen aus, die je nach Kontext wirksam werden konnten: Die eine Tradition beruhte auf pragmatischer Toleranz, die andere auf aggressiver Unterdrückung und Russifizierung. Die Tradition der pragmatischen Duldung und Integration wurzelte bereits in der multiethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung in der Kiever Rus’ sowie in den Beziehungen zwischen den Fürstentümern der Rus’ und der Goldenen Horde. Als Ivan IV. mit dem Anspruch auf das Erbe der Goldenen Horde das Khanat Kasan eroberte und muslimischer Widerstand gebrochen wurde, entschied sich der Moskauer Zar gegen eine aggressive Mission und weitere Unterdrückung und für eine Kooperation mit den muslimischen Eliten: Sie wurden in den russländischen Adel aufgenommen und sollten die Stützen der Zentralmacht in den jeweiligen Gebieten werden. Das Moskauer Reich legitimierte sich dynastisch; ethnisch-sprachliche wie auch religiöse Kriterien waren in diesem Zusammenhang zweitrangig. So kooptierte die russländische Zentralmacht die loyalen Eliten, wenn sie bereit waren, dem Vorbild des russischen Adels zu entsprechen. Die Oberschichten der orthodoxen Ukrainer (seit dem 17. Jhd.) und Georgier (seit dem frühen 19. Jhd.), der lutherischen Deutschbalten und Finnen (nach dem Großen Nordischen Krieg, 1700–1721), der katholischen Polen (seit den Teilungen Polens 1772, 1793 und 1795) und schließlich der muslimischen Wolgatataren
1. Russland und die Sowjetunion
269
(seit dem 16. Jhd.) und Krimtataren (seit dem späten 18. Jhd.) wie auch der Aserbaidschaner (seit dem frühen 19. Jhd.) konnten zunächst ihren sozialen Status und ihr Bekenntnis behalten und hatten sich wie der russische Adel in den Dienst des Zaren zu stellen. Einige Gebiete erhielten zeitweise sogar größere Autonomie als die russischen Gebiete – das Hetmanat der Kosaken (1654–1764), das Königreich Polen (1815–1832) sowie das Großfürstentum Finnland (1809–1899). Die übernationale Pragmatik in der zarischen Politik gegenüber Nichtrussen wich mit dem verstärkten westeuropäischen Einfluss unter Peter I. einer stärkeren kulturellen Anbindung an das Zentrum des Reiches. Der neuen aggressiven Politik war zunächst die animistische (> Glossar) indigene Bevölkerung Sibiriens ausgesetzt, später wurden auch die adligen Wolgatataren vor die Wahl gestellt, entweder Orthodoxe zu werden oder auf ihre Güter mit orthodoxen Bauern zu verzichten. Unter den Zarinnen Anna (1730–1740) und Elisabeth (1741–1761) kam die von Peter I. eingeleitete Zivilisierungsmission gegenüber den als «rückständig» angesehenen Völ-kern noch deutlicher zum Tragen. Passiver und aktiver Widerstand gegen die Zwangschristianisierung sowie die Einflüsse der Aufklärung führten dazu, dass Katharina II. in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einer relativ flexiblen Politik gegenüber den Muslimen zurückkehrte. Viel wichtiger als die religiösen Angelegenheiten wurde dabei das Kriterium der Sesshaftigkeit. Eine erneute Wende zur rigiden Unterwerfung betraf zu Beginn des 19. Jahrhunderts vor allem die muslimischen Bergvölker im Kaukasus. Im Westen des Reiches gab es ähnliche Schwankungen, insgesamt dominierte jedoch die pragmatische Tradition in der Politik gegenüber Nichtrussen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Die erwachten nationalen Bewegungen (etwa der Polen, Ukrainer, Weißrus-sen, der Balten, Esten, Finnen, der Wolga- und Krimtataren, der Völker im Kaukasus und in Zentralasien) sowie der erneute Schub modernisierender Maßnahmen, die auf Vereinheitlichung und Systematisierung des bürokrati-schen Apparats sowie Homogenisierung der Reichsbevölkerung abzielten, waren jene Faktoren, die je nach Region eine pragmatischere Politik admi-nistrativer Russifizierung oder eine repressive Politik kultureller Russifizie-rung hervorbrachten: Diese betraf zunächst Nichtrussen in den westlichen und südlichen Gouvernements. Auf die polnischen Aufstände von 1830 und 1863/64 reagierte das imperiale Zentrum mit Repressionen, die in erster Linie gegen den polnischen Adel gerichtet waren, sie hatten jedoch auch Verbote der unierten (> Glossar) Kirche (1839), des Weißrussischen (1839), des Litauischen in lateinischer Schrift (1864) sowie des Ukrainischen (1876) zur Folge. Zugleich erfasste der Nationalismus auch die Großrussen und übte starken Einfluss auf die zunehmend restriktive Politik gegenüber den Juden aus, die 1881 der ersten neuzeitlichen Pogromwelle ausgeliefert waren und
Teil C: Regionale Schwerpunkte
270
im Anschluss noch schärfere Diskriminierungen erfuhren. Die forcierte Russifizierung und Unterdrückung von nationalen Bewegungen trug aber wenig zur angestrebten Verstärkung imperialer Loyalitäten bei. Sie stärkte im Gegenteil die nationalen Gefühle und spitzte die Konflikte zu, die sich in der Revolution von 1905 bis 1907 entluden. In Zentralasien gipfelte die Un-zufriedenheit mit der russländischen Herrschaft 1916 in einem offenen Auf-stand, der blutig niedergeschlagen wurde. Die Frage, inwiefern Russland ein Kolonialreich war, beantwortet die Forschung unterschiedlich, je nach Epoche und regionalem Fokus. Für Andreas Kappeler lassen sich vor allem die Verhältnisse in Zentralasien seit der Mitte des 19. Jahrhunderts mit den Kategorien des Kolonialismus beschreiben. Michael Khodarkovsky sieht starke koloniale Elemente der Herrschaft auch in den Regionen der südlichen Steppe. Der Kaukasus und Sibirien werden teilweise auch als Kolonien betrachtet, wobei hier vor allem das Vorgehen bei der Eroberung dieser Territorien stärker in den Blick genommen wird. Die neuere Forschung befasst sich vermehrt mit dem Phänomen des Imperialen selbst und der Herausbildung supranationaler Identitäten im Zarenreich, jenseits der scharfen Dichotomien eines «russifizierenden Zentrums» und «nationaler Peripherien».
Nichtrussen und der Sowjetstaat Die sowjetische Nationalitätenpolitik setzte jene Ambivalenzen fort, die bereits das Zarenreich prägten: Die Bol’ševiki anerkannten zwar das Recht der Völker auf Selbstbestimmung, doch blieb dies in der Praxis Makulatur, die Interessen des Proletariats erklärten die Machthaber für prioritär, falls sie in Konflikt mit der nationalen Bourgeoisie geraten würden. Dies legitimierte die zweischneidige Politik der jungen Sowjetmacht: Die außenpolitische Anerkennung der souveränen Ansprüche der Nationen ging Hand in Hand mit der Unterstützung revolutionärer Bewegungen in anderen Ländern, die in der Folge zunehmend von der Sowjetmacht instrumentalisiert wurden. Nach der Rückeroberung der im Zuge der Revolution von 1917 vom Reich abgefallenen Gebiete während des Bürgerkrieges suchte die politische Führung des jungen Sowjetstaates Nichtrussen durch Kompromisse für die Sowjetmacht zu gewinnen. Dies betraf in erster Linie die kulturelle Autono-mie: Die nationalen Sprachen und kulturelle Einrichtungen wurden geför-dert, im Zuge des Programms der korenizacija sollten die nationalen Kultu-ren und ihre Eliten allmählich in die Struktur der Sowjetunion hineinwach-sen, ohne ihre kulturelle Eigenständigkeit aufgeben zu müssen, und zugleich den Sowjetsozialismus in den nationalen Kulturen verwurzeln. Die junge Sowjetmacht verstand sich als eine antikoloniale Kraft, im Gegensatz zum «zaristischen Völkergefängnis». In dieser Hinsicht lässt sich die erste Phase
1. Russland und die Sowjetunion
271
der sowjetischen Nationalitätenpolitik als die «goldenen Zwanziger» be-zeichnen, wenn auch die Praxis nicht selten stark von den Zielsetzungen abwich und die Vertreter der Sowjetmacht durchaus als Kolonialherren etwa den Turkvölkern Zentralasiens gegenüber auftraten und sich in deren auto-nomen Angelegenheiten einmischten. Dennoch zeitigte die Politik der kore-nizacija Erfolge (auch langfristig) und die Prozesse der Nationsbildung in den einzelnen Republiken machten große Fortschritte. Die Titularnationen der einzelnen Sowjetrepubliken wurden vor anderen ethnischen Minderhei-ten bevorzugt, und jede Republik erhielt bestimmte symbolträchtige Institu-tionen wie ein Opernhaus oder eine Akademie der Wissenschaften. In Fra-gen der Politik und Ideologie behielt Moskau aber weiterhin die Kontrolle. Mit dem Aufstieg Stalins und noch mehr während der gewaltsamen sozial-ökonomischen Vereinheitlichung des Landes während der 1930er-Jahre ver-stärkte sich der Druck auf die Nationalitäten. Statt der zunächst angestrebten Vielfalt rückte die Propagierung eines einheitlichen sowjetischen Vaterlan-des in den Vordergrund: Die Kaderpositionen in Politik, Wirtschaft, Militär und Kultur wurden zunehmend durch Russen und Vertraute des Zentrums besetzt, die nationalen Eliten wurden im Zuge der Säuberungen ausgelöscht, die Sesshaftmachung der Nomaden und die Kollektivierung zerstörten die ökonomische und soziale Basis nichtrussischer gesellschaftlicher Gruppen und eine aggressive Russifizierung setzte erneut ein. Die Widerstände in Zentralasien waren zu Beginn der 1930er-Jahre umso heftiger, als die vorhe-rige Stärkung muslimischer Traditionen während der korenizacija bereits ihre Früchte trug. Zugleich konnte das Regime jedoch auch bei Nichtrussen im Zuge der Industrialisierung, Urbanisierung und des Ausbaus der Bil-dungseinrichtungen junge Kräfte mobilisieren, die zu neuen loyalen Eliten heranwuchsen. Zusätzliche Opfer sollten jene Nationalitäten tragen, die wäh-rend des Zweiten Weltkrieges als «unzuverlässige» Völker unter dem Gene-ralverdacht der Kollaboration mit den Deutschen aus ihren Gebieten depor-tiert wurden (Wolgadeutsche, Krimtataren, Tschetschenen, Inguschen, Bal-karen, Kalmücken, Karatschaer und weitere ethnische Gruppen). Die russophile Rhetorik des Sowjetpatriotismus prägte die sowjetische Nati-onalitätenpolitik nach 1945 umso mehr, als die integrative Kraft des Sieges im Zweiten Weltkrieg die sowjetische Gesellschaft konstituieren sollte. Die praktische Politik gegenüber Nichtrussen nahm jedoch nach dem Tod Stalins deutlich liberalere Züge an: Die deportierten Nationalitäten wurden rehabili-tiert und konnten teilweise in ihre Gebiete zurückkehren. Doch gerade die Frage «nationaler Territorien» – ein zentrales Kriterium für die Stalinsche Auffassung von Nation, die die sowjetische Nationalitätenpolitik wesentlich prägte – birgt bis heute ungelöste Probleme. Allerdings haben die Langzeit-wirkungen der korenizacija, die nun wieder zum Tragen kam, zur Entste-
Teil C: Regionale Schwerpunkte
272
hung nationaler bzw. regionaler Eliten geführt, die in den ehemaligen Sow-jetrepubliken 1991 die Macht übernahmen. Wenn auch die Russländische Föderation seit 1991 mit 81 % Russen bei der Gesamtbevölkerung eher einem «Nationalstaat» entspricht, bleibt auch die-ser Staat ein Vielvölkerreich, das sich mit den gleichen Problemen der Nati-onalitätenpolitik konfrontiert sieht wie das Russländische Imperium und die Sowjetunion. Ein russisches Nationalbewusstsein hat sich immer im Ver-bund mit imperialem Bewusstsein ausgebildet, so dass der Verlust des Impe-riums 1991 Identitätsprobleme mit sich brachte.
Literatur zum Abschnitt C.1: Russland und die Sowjetunion Gesamtdarstellungen Fragner, Bert; Kappeler, Andreas (Hrsg.): Zentralasien, 13. bis 20. Jahrhundert. Geschichte und Gesellschaft, Wien 2006.
Freeze, Gregory (Hrsg.): Russia. A History, Oxford 22002.
Goehrke, Carsten: Russischer Alltag. Eine Geschichte in neun Zeitbildern vom Frühmittelal-ter bis zur Gegenwart, 3 Bde., Zürich 2003–2005.
Haumann, Heiko: Geschichte Russlands, Zürich 22003.
Hellmann, Manfred; Schramm, Gottfried; Zernack, Klaus u.a. (Hrsg.): Handbuch der Ge-schichte Russlands, Bd. 1–6, Stuttgart 1981–2004.
Hösch, Edgar: Geschichte Russlands. Vom Kiever Reich bis zum Zerfall des Sowjetimperi-ums, Stuttgart 1996.
Kappeler, Andreas: Russische Geschichte, München 42005.
Kappeler, A.: Kleine Geschichte der Ukraine, München 1994.
Kappeler, Andreas: Russland als Vielvölkerreich. Entstehung, Geschichte, Zerfall, München 32001.
Magocsi, Paul R.: A History of Ukraine, Toronto u.a. 1996.
Perrie, Maureen; Lieven, Dominic; Suny, Ronald G. (Hrsg.): The Cambridge History of Russia, Bd. 1–3, Cambridge 2006.
Pushkareva, Natalia: Women in Russian History. From the Tenth to the Twentieth Century, London 1997.
Stökl, Günther: Russische Geschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 61997.
Russländisches Reich Alef, Gustave: The Origins of Muscovite Autocracy.The Age of Ivan III, Wiesbaden 1986.
Bonnell, Victoria E.: Roots of Rebellion. Workers’ Politics and Organisations in St. Peters-burg and Moscow, 1900–1914, Berkeley 1983.
Brower, Daniel; Lazzerini, Edward (Hrsg.): Russia’s Orient. Imperial Borderlands and Peoples, Bloomington 1998.
Boškovska, Nada: Die russische Frau im 17. Jahrhundert, Köln u.a. 1998.
1. Russland und die Sowjetunion
273
Dahlmann, Dittmar: Die Provinz wählt. Russlands konstitutionell-demokratische Partei und die Dumawahlen 1906–1912, Köln u.a. 1996.
Fieseler, Beate: Frauen auf dem Weg in die russische Sozialdemokratie, 1890–1917. Eine kollektive Biographie, Stuttgart 1995.
Gatrell, Peter: The Tsarist Economy 1850–1917, London 1986.
Geyer, Dietrich: «Gesellschaft» als staatliche Veranstaltung. Bemerkungen zur Sozialge-schichte der russischen Staatsverfassung im 18. Jahrhundert, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 14 (1966), S. 21–50.
Geyer, Dietrich: Der russische Imperialismus. Studien über den Zusammenhang von innerer und auswärtiger Politik 1860–1914, Göttingen 1977.
Haimson, Leopold H.: The Problem of Political and Social Stability in Urban Russia on the Eve of the War and Revolution. Revisited, in: Slavic Review 59 (2000), S. 848–875.
Häfner, Lutz: Gesellschaft als lokale Veranstaltung. Die Wolgastädte Kazan’ und Saratov (1870–1914), Köln u.a. 2004.
Haumann, Heiko: Kapitalismus im zaristischen Staat 1906–1917. Organisationsformen, Machtverhältnisse und Leistungsbilanz im Industrialisierungsprozess, Königstein 1980.
Hausmann, Guido (Hrsg.): Gesellschaft als lokale Veranstaltung. Selbstverwaltung, Assoziie-rung und Geselligkeit in den Städten des ausgehenden Zarenreiches, Göttingen 2002.
Holquist: Making War, Forging Revolution. Russia’s Continuum of Crisis, 1914–1921, Cam-bridge 2002.
Hosking, Geoffrey: Russland. Nation und Imperium, 1552–1917, Berlin 2000.
Jersild, Austin: Orientalism and Empire. North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier, 1845–1917, Montreal 2002.
Kivelson, Valerie: Autocracy in the Provinces. The Muscovite Gentry and Political Culture in the Seventeenth Century, Stanford 1996.
Kharkhordin, Oleg: The Collective and the Individual in Russia. A Study of Practices, Berke-ley 1999.
Khodarkovsky, Michael: Russia’s Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire, 1500–1800, Bloomington 2002.
Kollmann, Nancy Shields: By Honour Bound. State and Society in Early Modern Russia, Ithaca 1999.
Laue, Theodore H. v.: The Chances for Liberal Constitutionalism, in: Slavic Review 24 (1965), S. 34–46.
Löwe, Heinz-Dietrich: Die Lage der Bauern in Russland 1880–1905. Wirtschaftliche und soziale Veränderungen in der ländlichen Gesellschaft des Zarenreiches, St. Katharinen 1987.
McKean, Robert B.: St Petersburg Between the Revolutions. Workers and Revolutionaries, June 1907 – February 1917, New Haven 1990.
McReynolds, Louise: Russia at Play. Leisure Activities at the End of the Tsarist Era, Ithaca, London 2003.
Mironov, Boris N.; with Eklof, Ben: The Social History of Imperial Russia, 1700–1917, 2 Bde., Boulder 2000.
Teil C: Regionale Schwerpunkte
274
Nathans, Benjamin: Beyond the Pale. The Jewish Encounter with Late Imperial Russia, Berkeley 2002.
Ostrowski, Donald: Muscovy and the Mongols. Cross-Cultural Influences on the Steppe Frontier, 1304–1589, Cambridge 1998.
Schmidt, Christoph: Russische Geschichte, 1547–1917, München 22008.
Pickhan, Gertrud: Gospodin Pskov. Entstehung und Entwicklung eines städtischen Herr-schaftszentrums in Altrussland, Wiesbaden 1992.
Sandborn, Joshua A.: Drafting the Russian Nation. Military Conscription, Total War, and Mass Politics 1905–1925, DeKalb 2003.
Scheidegger, Gabriele: Perverses Abendland – barbarisches Russland. Begegnungen des 16. und 17. Jahrhunderts im Schatten kultureller Missverständnisse, Zürich 1993.
Schlögel, Karl: Jenseits des Grossen Oktober. Das Laboratorium der Moderne. Petersburg 1909–1921, Berlin 1988.
Staliunas, Darius: Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863, Amsterdam 2007.
Sunderland, Williard: Taming the Wild Field. Colonization and Empire on the Russian Steppe, Ithaca 2004.
Thaden, Edward S. (Hrsg.): Russification in the Baltic Provinces and Finland 1855–1914, Princeton 1981.
Torke, Hans-Joachim: Die staatsbedingte Gesellschaft im Moskauer Reich. Zar und Zemlja in der altrussischen Herrschaftsverfassung 1613–1689, Leiden 1974.
Wheatcroft, Stephen G.: Crisis and Condition of the Peasantry in Late Imperial Russia, in: E. Kingston-Mann; T. Mixter (Hrsg.): Peasant Economy, Culture and Politics of European Rus-sia 1800–1921, Princeton 1991, S. 128–174.
Witzenrath, Christoph: Cossacks and the Russian Empire, 1598–1725. Manipulation, Rebel-lion and Expansion into Siberia, London 2007.
Wortman, Richard: Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy, 2 Bde., Princeton 1995–2000.
Zelnik, Reginald: Labor and Society in Tsarist Russia. The Factory Workers of St. Petersburg 1855–1870, Stanford 1971.
Sowjetunion Altrichter, Helmut: Kleine Geschichte der Sowjetunion 1917 – 1991. München 22001.
Applebaum, Anne: Der GULAG, Berlin 2003.
Baberowski, Jörg: Der Feind ist überall. Stalinismus im Kaukasus, München 2003.
Baberowski, Jörg: Der rote Terror. Die Geschichte des Stalinismus, München 2003.
Bohn, Thomas M.: «Sozialistische Stadt» versus «Europäische Stadt» –Urbanisierung und Ruralisierung im östlichen Europa, in: Comparativ 2 (2008), S. 71–86.
Brzeziński, Zbigniew K.: The Permanent Purge. Politics in Soviet Totalitarianism, Cambridge 1956.
1. Russland und die Sowjetunion
275
Chlevnjuk, Oleg: Das Politbüro. Mechanismen der politischen Macht in der Sowjetunion der dreissiger Jahre, Hamburg 1998.
Fitzpatrick, Sheila: Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s, Oxford 1999.
Ganzenmüller, Jörg: Das belagerte Leningrad, 1941–1944. Die Stadt in den Strategien von Angreifern und Verteidigern, Paderborn u.a. 22007.
Halfin, Igal: Terror in My Soul. Communist Autobiographies on Trial, Cambridge 2003.
Haumann, Heiko (Hrsg.): Die russische Revolution 1917, Köln u.a. 2007.
Haumann, Heiko: Beginn der Planwirtschaft. Elektrifizierung, Wirtschaftsplanung und gesell-schaftliche Entwicklung Sowjetrußlands 1917–1921, Düsseldorf 1974.
Hellbeck, Jochen: Revolution on My Mind. Writing a Diary under Stalin, Cambrigde 2006.
Hildermeier, Manfred: Die russische Revolution 1905–1921, Frankfurt/M. 1989.
Hildermeier, Manfred: Geschichte der Sowjetunion 1917–1991. Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates, München 1998.
Hoffmann, David (Hrsg.): Stalinism. The Essential Readings, Oxford 2003.
Katzer, Nikolaus: Brot und Herrschaft. Die Hungersnot in der RSFSR, in: Osteuropa 54/12 (2004), S. 90–111.
Khlevniuk, Oleg: The History of the GULAG. From Collectivization to the Great Terror, New Haven 2004.
Kotkin, Stephen: Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization, Berkeley 1997.
Krylova, Anna: The Tenacious Liberal Subject in Soviet Studies, in: Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 1/1 (2000), S. 119–146.
Levin, Moshe: The Making of the Soviet System. Essays in the Social History of Interwar Russia, London 1985.
Malia, Martin: The Soviet Tragedy. A History of Socialism in Russia, 1917–1991, New York 1994.
Martin, Terry: The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939, Ithaca 2001.
Merridale, Catherine: Ivan’s War. Life and Death in the Red Army, 1939–1945, New York 2006.
Neutatz, Dietmar: Die Moskauer Metro. Von den ersten Plänen bis zur Grossbaustelle des Stalinismus (1897–1935), Köln u.a. 2001.
Northrop, Douglas: Veiled Empire. Gender and Power in Stalinist Central Asia, Ithaca 2004.
Obertreis, Julia: Tränen des Sozialismus. Wohnen in Leningrad zwischen Alltag und Utopie, 1917–1937, Köln u.a. 2004.
Pipes, Richard: The Russian Revolution 1899–1919, London 1992.
Plaggenborg, Stefan: Menschenbilder und kulturelle Praxis in Sowjetrussland zwischen Ok-toberrevolution und Stalinismus, Köln u.a. 1996.
Plaggenborg, Stefan (Hrsg.): Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte, Berlin 1998.
Plaggenborg, Stefan: Experiment Moderne. Der Sowjetische Weg, Frankfurt/M. 2006.
Teil C: Regionale Schwerpunkte
276
Plaggenborg, Stefan: Sowjetische Geschichte nach Stalin, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 1/2 (2005), S. 26–32.
Rüthers, Monica: Moskau bauen von Lenin bis Chruščev. Öffentliche Räume zwischen Uto-pie, Terror und Alltag, Wien u.a. 2007.
Schattenberg, Susanne: Stalins Ingenieure. Lebenswelten zwischen Technik und Terror in den 1930er-Jahren, München 2002.
Scheide, Carmen: Kinder, Küche, Kommunismus. Das Wechselverhältnis zwischen sowjeti-schem Frauenalltag und Frauenpolitik von 1921 bis 1930 am Beispiel Moskauer Arbeiterin-nen, Zürich 2002.
Simon, Gerard: Holodomor als Waffe. Stalinismus, Hunger und der ukrainische Nationalis-mus, in: Osteurpa 54/12 (2004), S. 37–56.
Stadelmann, Matthias: Isaak Dunaevskij – Sänger des Volkes. Eine Karriere unter Stalin, Köln u.a. 2003.
Studer, Brigitte; Haumann, Heiko (Hrsg.): Stalinistische Subjekte. Individuum und System in der Sowjetunion und der Komintern 1929–1953, Zürich 2006.
Suny, Ronald G.: Toward a Social History of the October Revolution, in: American Historical Review 88 (1983), S. 31–52.
Tucker, Robert C.: Stalin in Power. The Revolution from Above, 1928–1941, NY 1992.
Tschudi, Daniela: Auf Biegen und Brechen : sieben Fallstudien zur Gewalt im Leben junger Menschen im Gouvernement Smolensk 1917–1926, Zürich 2004.
Yurchak, Alexei: Everything Was Forever, Until It Was No More. The Last Soviet Genera-tion, Princeton 2006.
2. Ostmitteleuropa
277
2. OSTMITTELEUROPA
2.1 Einleitung: Themen und Fragen Der nicht unumstrittene Begriff Ostmitteleuropa bezeichnet einen Raum, der in der Fremd- wie auch in der Selbstwahrnehmung verschiedentlich als ei-genständige historische Region innerhalb Europas betrachtet wird. Alternati-ve Konzepte, die eine ähnliche Raumeinteilung vornehmen, zum Teil unter Einschluss der deutschsprachigen Länder, figurieren unter verschiedenen Namen (so Mittel- bzw. Zentraleuropa, östliches Mitteleuropa). Eine geschlossene Darstellung fällt jedoch schwerer als im Falle der beiden anderen großen Geschichtslandschaften Osteuropas, da die Länder des östli-chen Mitteleuropa nie eine politische Einheit bildeten und auch in der Histo-riografie von wenigen Ausnahmen abgesehen separat abgehandelt werden. Daher wird sich auch im Folgenden der geschichtliche Abriss auf die einzel-nen, historisch gewachsenen Länder und Länderkomplexe konzentrieren. Wenn Ostmitteleuropa dennoch als distinktive Geschichtslandschaft betrach-tet wird, können dafür folgende, die Region als Ganzes kennzeichnende Merkmale vorgebracht werden: • Prägung durch den abendländischen Kulturkreis: Im Gegensatz zu den
anderen historischen Großregionen des östlichen Europa war in Ost-mitteleuropa seit dem ausgehenden 1. Jahrtausend das Christentum nach lateinischem Ritus (Katholizismus, ab dem 15./16. Jhd. daneben auch reformatorische Bekenntnisse) die dominierende Glaubensge-meinschaft. Die damit verbundene kulturelle Prägung führte zu einer bedeutend stärkeren kulturellen Verbundenheit mit dem Westen Euro-pas als im Falle des ostslawischen Raumes (Osteuropa im engeren Sinne) oder Südosteuropas. Die Verwendung des Lateins als Sakral- und Verwaltungssprache, Renaissance, Humanismus, Reformation, Barock oder Liberalismus waren in Ostmitteleuropa von ähnlich kon-stitutiver Bedeutung wie im westlichen Europa.
• Angleichungsprozess an Westeuropa: Im Hoch- und Spätmittelalter kam es im östlichen Mitteleuropa zur Angleichung politischer und so-zialer Strukturen an westeuropäische Vorbilder. Hierbei ist etwa an Übernahmen in Herrschaftsstruktur und Verwaltung oder an das Stadt-recht zu denken, das sich in diesem Raum auszubreiten begann. Auch Elemente des fränkisch-deutschen Lehenswesens wurden adaptiert. Es fanden jedoch keine kompletten Übernahmen statt, vielmehr entstan-den spezifische Ausprägungen dieser Phänomene, die sich in qualita-tiver und quantitativer Weise von ihren westlichen Vorbildern unter-schieden. In der Frühen Neuzeit lässt sich dann eine Auseinanderent-
Teil C: Regionale Schwerpunkte
278
wicklung zwischen West- und Ostmitteleuropa beobachten. Während etwa Formen bäuerlicher Unfreiheit im Westen tendenziell immer mehr an Bedeutung verloren, verschlechterte sich der Rechtsstatus der Bauern in Ostmitteleuropa, teils vergleichbar mit Russland, seit dem ausgehenden Mittelalter bis hin zu Erbuntertänigkeit (> Glossar) und Leibeigenschaft (> Glossar).
• Zuwanderung aus Westeuropa: Nicht zuletzt aufgrund der gegenüber den Kernregionen Westeuropas dünneren Besiedlung blieb Ostmittel-europa auch nach der Entstehung von Reichen ein Einwanderungsge-biet. Die Landesherren warben immer wieder gezielt Ansiedler an. Im 11. Jahrhundert setzte ein bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts andau-ernder Prozess ein, der zusammenfassend als mittelalterliche deutsche Ostsiedlung oder treffender Kolonisation nach deutschem Recht be-zeichnet wird. Vor allem im Hochmittelalter ließen sich in den neu entstehenden Herrschaftsbildungen Ostmitteleuropas Kolonisten nie-der. Das Auslaufen der Ostsiedlung im Zusammenhang mit den gro-ßen Pestepidemien der Mitte des 14. Jahrhunderts fiel mit der Zunah-me der jüdischen Ansiedlung zusammen. Im Spätmittelalter kamen Juden, die aus Westeuropa vertrieben wurden, in bedeutender Zahl nach Polen. Später wanderten viele in die Nachbarländer weiter. Die ostmitteleuropäischen Juden bildeten vielerorts, ähnlich wie die Deut-schen, bis zum Zweiten Weltkrieg eine kulturell und wirtschaftlich bedeutende Gruppe.
• Sprachliche und konfessionelle Heterogenität: Eines der charakteris-tischsten Merkmale Ostmitteleuropas besteht in der komplexen Ge-mengelage unterschiedlicher sprachlicher, konfessioneller bzw. ethni-scher Gruppen. Diese kam nicht nur durch die erwähnte Einwande-rung von Deutschen und Juden im Mittelalter zustande, sondern auch durch spätere Migrationsbewegungen. Besonders die weitgehend ent-völkerten Gebiete Zentral- und Südungarns wurden nach der Osma-nenzeit seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert von Gruppen unter-schiedlicher Herkunft wiederbesiedelt. Doch auch die soziale Ord-nung, die in ständischen Strukturen verharrte, zementierte die Segre-gation in verschiedene Bevölkerungsgruppen. Soziale und sprachlich-ethnische Abgrenzungen verliefen dabei häufig deckungsgleich. Zu dieser Vielfalt gesellten sich auch wegen der relativen religiösen Tole-ranz konfessionelle Unterschiede. Neben dem Katholizismus als do-minierender Konfession fanden die reformatorischen Bekenntnisse vornehmlich beim Adel und den deutschsprachigen Gemeinschaften Anhänger, während vielerorts Juden in den Städten und Orthodoxe in den östlichen Regionen Ostmitteleuropas einen hohen Bevölkerungs-
2. Ostmitteleuropa
279
anteil stellten. Die verschiedenen unierten (> Glossar) Kirchen ergän-zen das Bild einer konfessionell vielgestaltigen Region.
• Gemeinsame politische Kultur: Die drei zentralen Herrschaftsbildun-gen des ostmitteleuropäischen Raumes, Polen, Ungarn und Böhmen wiesen eine Reihe von Gemeinsamkeiten ihrer politischen Kultur auf. Alle drei entstanden an der Peripherie des Einflussbereiches des frän-kisch-deutschen Reiches. Die Abgrenzung von diesem sowie die kir-chenpolitisch abgesicherte Eigenständigkeit trugen zur Entstehung ei-nes auf das jeweilige Reich bezogenen Landesbewusstseins bei den Eliten bei. Neben wiederholten Personalunionen zwischen zweien die-ser Länder bildete sich als weitere Gemeinsamkeit im Spätmittelalter eine Adelskultur heraus, die vor allem in Ungarn und Polen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts nachwirkte.
• Habsburgische und preußische Herrschaft: Seit 1526 bildeten Ungarn (bis Ende des 17. Jhd. zumindest nominell, danach auch faktisch) und die Länder der böhmischen Krone einen Teil der Habsburger Monar-chie. Mit den drei Teilungen Polens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde auch ein Teil Polens habsburgisch, während sich die beiden anderen Teilungsmächte Preußen und Russland den großen Rest einverleibten. Wenn die russische Herrschaft über die östliche Hälfte Polens eine allmähliche Angleichung dieser Region an die Ver-hältnisse im Zarenreich mit sich brachte, stellte die habsburgische bzw. preußische Herrschaft eine engere Verbindung mit dem westli-chen Europa her.
• Zwischenlage: Insbesondere im 20. Jahrhundert erwies sich die geo-grafische Lage Ostmitteleuropas als schicksalhaft für die Region. Nach dem Ersten Weltkrieg waren die neu entstandenen Nationalstaa-ten als «cordon sanitaire» von zwei revisionistischen bzw. expansio-nistischen Nachbarn (Deutsches Reich, Sowjetunion) eingekeilt. Auf-grund ihrer schwachen wirtschaftlichen und politischen Situation ge-rieten die neuen Staaten schon bald in den Sog von Konflikten, die ih-re Ursache außerhalb der Region hatten. Letztlich war auch die Einbe-ziehung in den sowjetisch dominierten Machtbereich eine Folge der geografischen Zwischenlage, die in der Binnen- wie in der Fremd-wahrnehmung von Ostmitteleuropa immer wieder als prägendes Merkmal dieses Raumes verstanden wird.
• Ostmitteleuropäisches Regionalbewusstsein: Das Gefühl, über eine gemeinsame Geschichte und kulturelle Werte zu verfügen, ist nicht zuletzt in der Region selber verbreitet und war immer wieder Gegens-tand gelehrter Selbstreflexion. Wenn auch in vielerlei Hinsicht als Mythos zu betrachten, übte diese Vorstellung dennoch Wirkmächtig-
Teil C: Regionale Schwerpunkte
280
keit aus. Wesentlicher Bestandteil ist eine deutliche Abgrenzung ge-gen Osten und Südosten. Historisch-politisch wird vor allem der Kon-trast zum Russländischen und Osmanischen Reich betont, kulturell die Distanzierung von der Orthodoxie bzw. dem südosteuropäischen Is-lam. Ausdruck findet dieser Gedanke etwa in Vorstellungen, als «an-temurale christianitatis» (Vormauer der Christenheit) zur Verteidigung des Abendlandes beigetragen zu haben. Im weiteren Sinne verbindet sich damit die manchmal rassistisch konnotierte Vorstellung, als öst-lichster Vorposten des Abendlandes in einer je nach Kontext heid-nisch, orthodox oder islamischen Umgebung (bzw. im 20. Jhd. gegen-über der bolschewistischen Sowjetunion) den Nachbarn im Osten und Südosten kulturell-zivilisatorisch überlegen zu sein.
Der Raum, der durch diese Merkmale charakterisiert ist, lässt sich jedoch vor allem gegen Osten nur schwer abgrenzen. Während im Norden durch die Ostsee bis zum Finnischen Meerbusen eine vergleichsweise klare Grenze vorgegeben ist, geht Ostmitteleuropa an seinen übrigen Rändern fließend in benachbarte historische Großregionen über. Verschiedene Randgebiete wa-ren im Laufe der Geschichte phasenweise in unterschiedlicher Intensität auf andere politische und kulturelle Räume ausgerichtet. Ihre Zuordnung zu Ostmitteleuropa ist so je nach Epoche oder Fragestellung nicht eindeutig. Selbst die erwähnte Ostseeküste als Nordgrenze verliert in dieser Hinsicht ihre scharfe Trennfunktion. Vielmehr hatte sie immer wieder auch verbin-dende Eigenschaften und war eine Drehscheibe, über die schon im Frühmit-telalter Kontakte zwischen den verschiedenen Ufern angebahnt wurden. Aufgrund der Zugehörigkeit zu diesem maritim geprägten Kommunikations-raum standen die Küstengebiete Ostmitteleuropas meist in engerem Kontakt mit den Ostseeanrainern im skandinavischen und norddeutschen Raum, etwa im Rahmen der Hanse (> Glossar), als mit den binnenländischen Regionen Ostmitteleuropas entlang der mittleren Donau. Diese war ihrerseits eine Kommunikationsader mitten durch den europäischen Kontinent, entlang der sich mannigfaltige Austauschbeziehungen abspielten. Nicht zufällig wurde der Begriff «Donaumonarchie» zu einem Synonym für das Habsburger Reich. In diesem Sinne ist auch die Grenze Ostmitteleuropas im Süden zu verste-hen. Sie wird üblicherweise mit einer imaginären Linie angegeben, die von der nördlichen Ostküste der Adria entlang den Flüssen Save und Donau bis zum Donaudurchbruch am Eisernen Tor und von dort auf dem Kamm der Südkarpaten verläuft. Nach Westen gilt der geschlossene deutsche bzw. ita-lienische Sprachraum als Außengrenze Ostmitteleuropas. Auch dies kann nur ein sehr grobes Abgrenzungskriterium sein, da besonders das Verbrei-tungsgebiet der deutschen Sprache in historischer Zeit nicht konstant war und deutschsprachige Gemeinschaften verstreut bis weit nach Osten mit anderssprachigen Gruppen zusammen lebten. Daher wird häufig die politi-
2. Ostmitteleuropa
281
sche Zugehörigkeit herangezogen. Die Gebiete, die den Kronen von Polen, Böhmen und Ungarn zugehörten, werden allgemein zu Ostmitteleuropa ge-rechnet, das Gebiet des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation wird mit Ausnahme des heutigen Slowenien und den Ländern der böhmischen Krone nicht dazu gezählt. Dennoch ist auch diese Trennlinie zwischen dem Alten Reich und den Ländern Ostmitteleuropas abgesehen von Grenzände-rungen nicht scharf. Sowohl die Habsburger Monarchie seit dem 16. als auch Preußen seit dem 18. Jahrhundert umfassten Territorien beiderseits dieser Trennscheide und waren damit Teil Ostmittel- und des westlichen Europa zugleich (> Karte 3, S. 372/73). Bloß im Falle Böhmens und Ungarns lässt sich eine seit dem Hochmittelalter relativ stabile Westgrenze Ostmitteleuro-pas angeben. Diese hatte auch innerhalb des habsburgischen Länderkomple-xes und mit geringen Änderungen sogar bis heute Bestand. Gegen Osten lässt sich Ostmitteleuropa noch viel weniger deutlich abgren-zen als in den anderen Himmelsrichtungen. Ein häufiges Kriterium geht von der konfessionellen Zugehörigkeit aus und stellt dem vom lateinisch-abendländischen Christentum (Katholizismus, reformatorische Bekenntnis-se) geprägten Gebiet Ostmitteleuropas die orthodoxen Regionen Osteuropas im engeren Sinne entgegen. Doch auch hier verunmöglichen breite Überlap-pungszonen mit gemischt-konfessioneller Bevölkerung eine scharfe Tren-nung. Sprachlich stimmt im nördlichen Bereich die Grenze zwischen ostsee-finnischem und baltischem Sprachgebiet einerseits und hauptsächlich von Ostslawen besiedelten Regionen andererseits grob mit der Unterteilung in Ostmittel- und Osteuropa im engeren Sinne überein. Finnland und der nörd-liche Teil des Baltikums werden dabei unter dem Begriff Nordosteuropa manchmal als eigene historische Region von Ostmitteleuropa getrennt be-trachtet. An der südöstlichen Flanke bilden die Ostkarpaten zwischen den historischen Landschaften Siebenbürgen und Moldau die Außengrenze Ost-mitteleuropas. Zwischen Baltikum und Ostkarpaten bestanden mit Polen und Litauen seit dem Hochmittelalter die beiden großen, seit 1386/1569 verein-ten Herrschaftsgebilde, die zu Ostmitteleuropa gezählt werden. Ihre Ausdeh-nung nach Osten veränderte sich jedoch mehrfach. Die starke kulturelle Be-einflussung durch Polen und Litauen weit nach Osten bis in die Kernregio-nen der einstigen Kiever Rus’ im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit ließen breite Übergangsregionen zwischen Ostmittel- und Osteuropa im en-geren Sinne im heutigen Weißrussland und der Ukraine entstehen. Erst mit der stufenweisen Eingliederung dieser Territorien ins Russländische Reich seit dem 17. Jahrhundert sind sie wieder verstärkt dem osteuropäischen Ge-schichtsraum im engeren Sinne zuzuordnen.
Teil C: Regionale Schwerpunkte
282
2.2 Herrschaftsbildungen und regionale Entwicklung Wenn mit Bulgarien die erste langfristig erfolgreiche Reichsbildung in Süd-osteuropa auch dank der kulturellen Ausstrahlung von Byzanz bereits im 7. Jahrhundert stattgefunden hatte, dauerte es in den meisten anderen Regionen Osteuropas noch einige Jahrhunderte bis zur Bildung fester Herrschaftsbe-reiche. Die seit dem 7. Jahrhundert praktisch über ganz Ostmittel- und Süd-osteuropa verteilten Slawen verfügten in aller Regel über keine überregiona-le Herrschaftsstruktur, sondern waren nur kleinräumig organisiert. Vom spä-ten 6. bis ins frühe 9. Jahrhundert dominierte das awarische Reich (> Glossar Awaren) von der pannonischen Tiefebene aus weite Teile des östlichen Mit-teleuropa. Der Niedergang dieses Reiches Ende des 8. Jahrhunderts und das damit einhergehende Machtvakuum schufen in Ostmitteleuropa die Voraus-setzungen für die Entstehung größerer Herrschaftsgebilde. Der im 8. Jahr-hundert einsetzende Vorstoß des Frankenreiches nach Osten und Südosten wirkte hierbei als Katalysator. Durch sein Vorbild bei der Herrschaftsorgani-sation, als regionale Hegemonialmacht und im Rahmen der christlichen Mis-sion erfüllte das Ostfränkische bzw. Deutsche Reich hierbei eine ähnliche Funktion wie das Byzantinische Reich bei den Reichsbildungen in Südosteu-ropa. Die kulturelle Anbindung der Region zwischen Adria und Ostsee an den mitteleuropäischen Raum kam hier erstmals zum Ausdruck. Welch be-deutenden Einfluss das fränkische Reich in diesem Raum spielte zeigt sich etwa daran, dass in vielen osteuropäischen Sprachen das Wort für »König« vom Namen Karls des Großen abgeleitet ist (tschech. král, poln. król, ung. király, serbokroat. kralj, russ. korol’). Im 9. und 10. Jahrhundert formten sich entlang des Ostsaums des fränkisch-deutschen Reiches eine Reihe von Herrschaftsgebilden. Um das Jahr 1000 zeichnete sich daher in groben Umrissen eine politische Ordnung ab, die in ihren Grundzügen für die kommenden Jahrhunderte Bestand haben würde. Mit Böhmen und Polen waren zwei Reiche entstanden, die unter starkem ostfränkischem bzw. deutschem Einfluss standen, während im Falle Ungarns und Kroatiens auch byzantinische Beeinflussung eine nicht unbedeutende Rolle spielte.
2.2.1 Ostalpenraum und westslawische Herrschaftsbildungen
Eine der frühesten Herrschaftsbildungen im ostmitteleuropäischen Bereich war das kurzlebige Reich des Samo (vermutlich ein Kaufmann aus dem fränkischen Reich), der zwischen ca. 623 und ca. 659 die awarische Oberho-heit über einige slawische Stämme in Böhmen und angrenzenden Gebieten abgeschüttelt hatte. Seine Herrschaft konnte sich an der westlichen Periphe-rie des Awarenreiches bilden, als dieses eine Schwächephase durchlief, blieb
2. Ostmitteleuropa
283
aber eine Episode. Im slawisch besiedelten Ostalpenraum nordöstlich von Istrien und südlich der Donau, wo sich die Einflussgebiete umliegender Herrschaftsformationen überlappten (Awaren, Baiern, Reich des Samo), begann sich im 7. Jahrhundert ein weiteres Herrschaftszentrum herauszukris-tallisieren. Die allmähliche Verselbstständigung des Fürstentums Karanta-nien vom Awarenreich ging mit einer Hinwendung zu den Baiern einher, unter deren Oberhoheit das im heutigen Kärnten gelegene Gebiet bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts geriet. Damit setzte die Christianisierung der slawischen Bevölkerung nach lateinischem Ritus ein. Bis zur Wende vom 8. zum 9. Jahr-hundert ging Karantanien wie auch andere slawisch geprägte Stammesherr-schaften des Ostalpenraumes im fränkischen Reich Karls des Großen auf. Die ansässige slawische Bevölkerung wurde von einer fränkischen Führungs-schicht überlagert und gegen Ende des 10. Jahrhunderts setzte die Einwande-rung deutschsprachiger Siedler ein. Fortan sollte die Region als Teil innerhalb des ostfränkischen bzw. deutschen und später des Habsburger Reiches beste-hen. Der südliche Teil des hochmittelalterlichen Herzogtums Karantanien, das wesentlich größer war als das frühmittelalterliche Fürstentum, wurde unter dem Namen Slowenien 1918 Teil Jugoslawiens. Ähnlich wie in analog gela-gerten Fällen ist die besonders in der älteren slowenischen Historiografie ver-tretene Sichtweise, Karantanien als eine frühe «slowenische Staatsbildung» zu betrachten, eine national-romantische Verklärung. Gleichfalls keine direkte Kontinuitätslinie zu späteren Staaten (wie etwa von der slowakischen Nationalhistoriografie teilweise behauptet) lässt sich vom sogenannten Großmährischen Reich ziehen. Die genaue Lage und Ausdeh-nung dieses nach dem Untergang des Awarenreiches um 830 entstandenen, über die christliche Mission unter fränkischem und byzantinischem Einfluss stehenden Reiches ist ungewiss. Es umfasste jedoch diverse slawische Stämme im Bereich der heutigen Westslowakei und des östlichen Tsche-chiens und konnte sich bis zur Zerstörung durch die Ungarn zu Beginn des 10. Jahrhunderts behaupten. In der als Böhmen (vom keltischen Stamm der Boier) bezeichneten Land-schaft gelang es zwischen dem ausgehenden 9. und der Mitte des 10. Jahr-hunderts der bereits christianisierten Dynastie der Přemysliden vom Zentrum in Prag aus kleinräumige Herrschaftsbezirke zum Teil gewaltsam unter ihrer Führung zusammenzufassen und damit die Grundlage für das Königreich Böhmen zu legen. Allfällige Bezüge zum Großmährischen Reich, etwa hin-sichtlich der Christianisierung, sind unklar. Die Selbstbezeichnung der böh-mischen Slawen als Tschechen (češi) geht auf den Stamm in Mittelböhmen zurück, der sich gegen die übrigen Stammesherrschaften durchsetzte und aus dem die Přemysliden hervorgingen. Die erbliche Königswürde errangen die Herrscher Böhmens nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen seit dem spä-ten 11. Jahrhundert definitiv erst 1198. Seit etwa 1020 unterstand auch Mäh-
Teil C: Regionale Schwerpunkte
284
ren als Nebenland endgültig der böhmischen Krone, seit dem 14. Jahrhun-dert auch Schlesien (im Wesentlichen bis 1742) und die (Ober- und Nieder-) Lausitz (bis 1635). Böhmen befand sich zwar in einem Abhängigkeits- und seit dem 11. Jahrhun-dert in einem Lehensverhältnis zum deutschen König, doch blieben die Ver-bindungen zu diesem vergleichsweise locker. Das Land war zwar Teil des Heiligen Römischen Reiches, verfügte aber in kirchenrechtlicher Hinsicht über ein bedeutendes Maß an Eigenständigkeit und der Adel begann im Hochmit-telalter ein eigenes Landesbewusstsein zu entwickeln. Die besonders in der älteren tschechischen und deutschen Historiografie emotional diskutierte Frage des Abhängigkeitsgrades Böhmens vom Reich orientiert sich demgegenüber an modernen Kriterien staatlicher Souveränität, die für das Mittelalter keine Relevanz hatten. Böhmen blieb während des ganzen Mittelalters unter wechselnden Dynastien Teil des Heiligen Römischen Reiches. 1526 gelangte es zusammen mit Un-garn, mit dem es in Personalunion verbunden war, erbrechtlich unter die Herr-schaft der Habsburger. Anders als in Ungarn gelang es den Habsburgern ins-besondere nach der Schlacht am Weißen Berg 1620 gegen die böhmischen Stände, deren Mitbestimmung einzuschränken und dem Land eine zentralisti-sche Verwaltung aufzuzwingen. In der erneuerten Landesverordnung von 1627, die bis ins 19. Jahrhundert das Verhältnis der Habsburger zu Böhmen bestimmte, wurden der Katholizismus als einzige Konfession anerkannt und die Ständeprivilegien deutlich beschnitten. Allerdings ist das von der natio-naltschechischen Historiografie gezeichnete Bild der Frühen Neuzeit als einer finsteren Epoche (temno) der nationalen Unterdrückung zu einseitig und lässt die mannigfaltigen Entwicklungsmöglichkeiten unter Habsburger Herrschaft außer Acht. Böhmische Hochadlige etwa übten in habsburgischen Diensten auch außerhalb Böhmens hohe Ämter aus. Aufgrund ihrer Loyalität zum Wiener Hof und dem Gesamtreich entfremdete sich im 19. Jahrhundert der Adel zunehmend von der nun einsetzenden tschechischen Nationalbewe-gung. Diese wurde in weit größerem Ausmaß als im Falle Ungarns von nichtadligen Schichten (Intelligenz, Bürgertum) getragen. Dabei spielte al-lerdings auch eine Rolle, dass Böhmen weiter entwickelt war: Die Industria-lisierung hatte hier schon an der Wende zum 19. Jahrhundert eingesetzt und der Analphabetismus war weit gehend beseitigt. Böhmen war daher, gleich-sam einer schon für das Mittelalter beobachtbaren Konstante der böhmischen Geschichte folgend, diejenige Region des östlichen Europa, die sich am ehesten mit der Entwicklung in den Kerngebieten Westeuropas vergleichen lässt. Die tschechische Nationalbewegung hatte ihre Wurzeln in den Bemühungen einer kleinen Schicht von Gelehrten, die Stellung der tschechischen Sprache
2. Ostmitteleuropa
285
zu fördern. Dieser kam gegenüber dem Deutschen insbesondere bei den ad-ligen und administrativen Eliten, im städtischen Bürgertum und im Bil-dungswesen eine nachgeordnete Rolle zu. Damit verbunden hatte die natio-nale Frage auch eine soziale Komponente, war das Tschechische doch vor allem bei der ländlichen Bevölkerung verbreitet. Von diesem Ausgangspunkt erhielt die Nationalbewegung schon in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr-hunderts eine exklusiv auf die slawischsprachigen Bewohner Böhmens zielen-de Stoßrichtung. Eine noch zu Beginn des Jahrhunderts möglich scheinende integrative gesamtböhmische Nationskonzeption unter Einschluss der deutsch-sprachigen Bewohner fand wenig Zuspruch. Spätestens seit dem Revolutions-jahr 1848, als die Tschechen ihre nationalpolitischen Forderungen vergeblich eingefordert hatten, zeichnete es sich ab, dass die Standpunkte der beiden Sei-ten unvereinbar waren. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurde der Nationalitätenkampf zum bestimmenden Thema des öffentlichen Lebens. Anders als etwa in Ungarn war der Beitrag des böhmischen Adels zur Natio-nalbewegung von nachgeordneter Bedeutung, da die Adligen Böhmens sich durch eine ausgesprochene Loyalität gegenüber den Habsburgern auszeichne-ten und häufig besser deutsch als tschechisch sprachen. Die Forderung nach Loslösung der böhmischen Länder aus dem Habsburger Reich wurde aber erst im Laufe des Ersten Weltkrieges zu einer ernsthaft erwogenen Option. Tschechische Exilpolitiker hatten maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung der Entente, Böhmen und Mähren mit der Slowakei, die bisher unter dem Begriff «Oberungarn» Teil Transleithaniens (> Glossar) gewesen war, zu einem unabhängigen Staat zu vereinen. Der Einbezug der Slowakei hatte neben nationalen und kulturellen Überlegungen, die beiden sprachlich nahe verwandten Völker zu vereinen, auch politische Gründe. Für die tschechische Seite hatte dies den Vorteil, den hohen deutschen Bevölke-rungsanteil Böhmens und Mährens (nun als Sudetendeutsche bezeichnet) im neuen Staat zu reduzieren, dessen Grundlage die propagierte tschechoslowa-kische Nation wurde. Von slowakischer Seite wurde der Zusammenschluss mit den Tschechen, die anteilsmäßig, politisch und kulturell dominierten, kritischer gesehen. Gesamthaft war der Anteil der nationalen Minderheiten, die sich nicht zur tschechoslowakischen Titularnation zählten, in der Zwi-schenkriegszeit mit rund 35 % der Gesamtbevölkerung höher als in jedem anderen Staat Ostmitteleuropas. Der Tschechoslowakei gelang es in der Zwischenkriegszeit aber im Vergleich mit den übrigen Nachfolgestaaten der Habsburger Monarchie vor allem wegen der starken Wirtschaft erstaunlich gut, sich zu konsolidieren. Im ostmittel- und südosteuropäischen Vergleich blieb der Staat der Tschechen und Slowaken der demokratischste, aber selbst hier waren intransparente Absprachen und informelle Gruppierungen we-sentlicher Bestandteil der politischen Praxis.
Teil C: Regionale Schwerpunkte
286
Die größte Bedrohung erwuchs der Tschechoslowakei in den Autonomie- und Sezessionsbestrebungen insbesondere der Sudetendeutschen, deneben auch der Slowaken. Das nationalsozialistische Deutschland nutzte diese Lage in den 1930er-Jahren zu eigenen Gunsten aus und zerschlug die Tschechoslo-wakei 1938 und 1939. Böhmen und Mähren standen während des Zweiten Weltkrieges unter deutscher Besetzung, während die Slowakei erstmals in ihrer Geschichte formell unabhängig wurde, allerdings in enger Anlehnung an Deutschland. Mit dem Sieg der Alliierten 1945 geriet die wiederhergestellte Tschechoslowakei, nun allerdings ohne die Karpato-Ukraine, in den sowjeti-schen Einflussbereich. Schon kurz nach Kriegsende wurde der Großteil der Deutschen vertrieben, womit das jahrhundertealte deutsch-slawische Zusam-menleben in Böhmen und der Slowakei ein Ende fand. Ähnlich wie in den übrigen von der Roten Armee (> Glossar) besetzten Staa-ten Osteuropas steuerte die Besatzungsmacht die Errichtung einer sozialisti-schen Diktatur nach sowjetischem Vorbild. Der Widerstand gegen dieses Regime äußerte sich, ähnlich wie in den beiden anderen sozialistischen Staa-ten Ostmitteleuropas, mehrfach in prominenter Weise. Er gipfelte in den Ereignissen des Sommers 1968, die unter dem Namen «Prager Frühling» bekannt geworden sind. Eine reformorientierte Gruppe an der Parteispitze versuchte, in Abweichung von den Grundsätzen sowjetischer Vorgaben ei-nen «Sozialismus mit menschlichem Antlitz» (> Glossar Sozialismus) zu realisieren. Da sich eine Lösung der Tschechoslowakei aus dem sowjetisch dominierten Lager abzeichnete, intervenierten Truppen des Warschauer Pak-tes (> Glossar). Unter dem gewaltsam installierten sowjetfreundlichen Re-gime verstummten die Proteste zwar nicht, sie blieben aber anders als in Polen auf einen relativ kleinen Kreis von hauptsächlich Intellektuellen be-schränkt. Massenproteste gegen die konservative, Reformen ablehnende Führung erlebte das Land erst im Herbst 1989, als sich der Zerfall der sozia-listischen Ordnung in Osteuropa bereits deutlich abzeichnete. Nach kurzer Zeit willigte die kommunistische Partei in einen geordneten Übergang zu einem pluralistischen politischen System ein. Die Anfänge der Herrschaftsbildung Polens sind im Detail wenig bekannt. Beginnend im 9. Jahrhundert hatte sich bis in die zweite Hälfte des 10. Jahr-hunderts ausgehend von den Zentren Gnesen (Gniezno, Großpolen) und Krakau (Kraków, Kleinpolen) unter der Dynastie der Piasten eine Herrschaft gebildet, welche lokale Stammesgebiete unter einer gemeinsamen Kontrolle zusammenführte. Namengebend wurde der am Mittellauf der Warthe um Gnesen siedelnde Stamm der Polanen (von pole=Feld). Der Übertritt zum Christentum erfolgte um 966, womit die polnischen Fürsten ihre Herr-schaftsbildung konsolidieren konnten und sich in den folgenden Jahrzehnten nun auch im Namen der Missionierung weitere Territorien unterstellten. Eine zeitweise Lehensabhängigkeit gegenüber dem Deutschen Reich bestand
2. Ostmitteleuropa
287
seit dem frühen 11. Jahrhundert. Die politische Einigung erlitt teilweise schon im 11., vor allem dann aber ab dem 12. Jahrhundert Rückschläge, als Polen in Teilfürstentümer zerfiel. Die Zersplitterung konnte erst im frühen 14. Jahrhundert überwunden werden, als die Einheit des Landes, diesmal als Kö-nigreich (Königstitel erstmals im frühen 11. Jhd., definitiv aber erst seit 1295) wiederhergestellt wurde. Bei der stufenweisen Einigung des Landes war auch ein bereits existierendes Landesbewusstsein des Adels sowie die direkt dem Papst unterstellte Kirchenorganisation von Bedeutung gewesen. Der Schwerpunkt Polens verschob sich von nun an immer stärker Richtung Osten, vor allem nach dem Aussterben der Piasten 1370. Der polnische Thron ging 1386 an den litauischen Großfürsten Jagiello (lit. Jogaila) über, der sich dafür taufen ließ und die bis 1572 regierende Dynastie der Jagiello-nen begründete. Die Verbindung Polens mit Litauen in einer später erneuer-ten Personalunion 1386 und der 1569 realisierten Realunion (> Glossar) der beiden Länder (unter Beibehalten gewisser Besonderheiten) machte Polen zu einer der führenden Mächte im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa. Anders als in den zeitgenössischen «absolutistischen» Monarchien konnte sich in Polen kein starkes Königtum durchsetzen. Vielmehr gelang es dem Adel, eine in Europa außergewöhnliche Machtposition gegenüber dem König zu erringen, was im Begriff der «Adelsrepublik» zum Ausdruck kommt. Die polnische Adelskultur übte ebenfalls eine große Anziehungs-kraft auf die Eliten der östlichen Reichsteile aus, was die Ausbildung einer die verschiedenen Adelsschichten verbindenden kulturell-politischen Identi-tät auch bei den Ostslawen förderte. Dies begünstigte die Konsolidierung des Reiches durch die Führungsschicht, stellte zugleich aber ein Hindernis dar für die Entstehung regionaler, ostslawisch-orthodoxer Eliten im Raum Weiß-russlands und der westlichen Ukraine. Die Adelsherrschaft hemmte jedoch seit der Mitte des 17. Jahrhunderts zu-nehmend die Entwicklung durch häufige Blockaden des Entscheidungspro-zesses und erleichterte es auswärtigen Mächten, Einfluss auf innere Angele-genheiten zu nehmen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unterwar-fen sich die benachbarten Großmächte Preußen, Russland und das Habsbur-ger Reich Polen in drei Teilungen (1772, 1793 und 1795), womit der polni-sche Staat zu existieren aufgehört hatte. Über die Hälfte des polnischen Ter-ritoriums geriet unter russische Herrschaft. In dem überwiegend von Ostsla-wen und Balten besiedelten Gebiet blieben vorerst Autonomierechte beste-hen, die dem polnischen Adel sogar eine Konsolidierung seiner sozial domi-nierenden Stellung erlaubten. Das vom Wiener Kongress 1815 geschaffene Königreich Polen in Personalunion mit Russland (sogenanntes Kongresspo-len > Glossar) erweiterte den russischen Einfluss nochmals nach Westen. Nach dem wesentlich von Adligen und Stadtbürgern getragenen November-aufstand von 1830/31 wurde allerdings die Verfassung Kongresspolens auf-
Teil C: Regionale Schwerpunkte
288
gehoben und das Gebiet verstärkt in die zentralistischen Strukturen des Za-renreiches einbezogen. Ein erneut fehlgeschlagener polnisch-nationaler Auf-stand im Russländischen Reich (Januaraufstand 1863/64) hatte weitere Ein-schränkungen im kulturellen und Bildungsbereich und eine verstärkte Russi-fizierung zur Folge. In den an Preußen gelangten Gebieten der untergegangenen Adelsrepublik waren die Polen besonders seit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 mit der Tendenz zur Germanisierung konfrontiert, die sich im Schulwesen und der Verwaltung sowie durch Ansiedlung von Deutschen bemerkbar machte. Doch trotz der zunehmenden Polarisierung zwischen Polen und Deutschen und der Verachtung der preußisch-deutschen Eliten gegenüber den polnischen Bewohnern wurde die Zugehörigkeit zum Deutschen Reich nie ernsthaft in Frage gestellt. Dazu trugen nicht zuletzt das gegenüber den russischen Teilungsgebieten doch recht liberale politische System und die relativ guten wirtschaftlichen Verhältnisse bei. Im habsburgischen Teil des einstigen Polen spielten vorerst weniger die na-tionalen als vielmehr die sozialen Unterschiede eine bestimmende Rolle. Der begüterte polnische Adel besonders in den östlichen Regionen Galiziens verfolgte hauptsächlich Standesinteressen. Für die polnischen und rutheni-schen (> Glossar) Bauern hingegen stand als Folge der Revolution von 1848 die Befreiung von der Erbuntertänigkeit und von den damit verbundenen Lasten im Vordergrund, die vom Wiener Hof und nicht vom Adel gewährt worden war. Gegenüber dem russländischen und preußischen Teil genoss die polnische Kultur und Sprache im Habsburger Reich weitreichende Entfal-tungsmöglichkeiten auch im Bildungswesen, was zu Lasten der Ruthenen ging. Polnische Adlige erfüllten in der Verwaltung vor Ort wichtige Funkti-onen, so dass eine Beamtenschicht heranwachsen konnte, die beim Aufbau der neu entstandenen Republik Polen nach 1918 eine wichtige Rolle spielte. In der Folge des Ersten Weltkriegs, als das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn zu den Verlierern zählten und Russland in revolutionärem Chaos und Bürgerkrieg versank, gelang es durch intensive Lobbyarbeit bei den Siegermächten, einen polnischen Staat zu errichten. Dessen Grenzziehung blieb jedoch noch lange umstritten und bot Anlass zu mehreren Kriegen. Im Osten wurde in einem Krieg gegen die im Entstehen begriffene Sowjetunion 1920/21 das Territorium Polens weit in die ostslawischen Gebiete ausge-dehnt, die einst zur Adelsrepublik gehört hatten (> Karte 4, S. 374). Der neu entstandene Staat umfasste daher nichtpolnische Minderheiten in bedeutender Zahl (weit über 30 %), die sich einem massiv nationalistischen politischen Klima ausgesetzt sahen. Die politische Instabilität wurde mit einem Staats-streich 1926 beendet, mit dem Polen faktisch zu einer autoritären regierten Militärdiktatur wurde. Das Lager der sogenannten Sanacja (> Glossar) be-
2. Ostmitteleuropa
289
stimmte die Geschicke des Landes bis 1939. In diesem Jahr wurde Polen ge-mäß dem geheimen Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Paktes militärisch be-setzt und zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der Sowjet-union aufgeteilt. Die Jahre des Zweiten Weltkrieges forderten von der Bevöl-kerung Polens einen außerordentlich hohen Blutzoll. Der rassistisch begründe-ten Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten fielen insbesondere Personen jüdischer Herkunft zum Opfer. Damit kam die jahrhundertealte, für die histori-schen Landschaften der alten Adelsrepublik so charakteristische Präsenz jüdi-scher Gemeinschaften weitestgehend zu einem Ende. Nach Kriegsende wurde der polnische Staat wiederhergestellt, allerdings blieben die Gebiete östlich des Bug sowjetisch, während Polen nun mit Ge-bietskompensationen im Westen (Schlesien, Pommern) bis an die Oder-Neiße-Linie sowie dem südlichen Teil Ostpreußens für die Territorialverlus-te im Osten entschädigt wurde. Polen profitierte von dieser Westverschie-bung besonders in wirtschaftlicher Hinsicht, waren doch die von Deutsch-land hinzugewonnenen Gebiete ökonomisch deutlich besser entwickelt als die an die UdSSR verlorenen Regionen im Osten. Eine nicht minder bedeut-same Folge des Zweiten Weltkrieges waren jedoch die umfangreichen eth-nisch-demografischen Veränderungen. Gegen Kriegsende und in der unmit-telbaren Nachkriegszeit wurden die deutschen Bewohner Polens evakuiert, flüchteten oder wurden schließlich vertrieben. An ihrer Stelle siedelten sich Polen an, die ihrerseits die nun sowjetischen Gebiete im Osten hatten verlas-sen müssen. Zusammen mit den massiven Menschenverlusten der Kriegszeit bedeutete dies eine radikale Umgestaltung der bislang multiethnisch gepräg-ten Bevölkerungsstruktur und die Entwurzelung von Millionen von Men-schen, die ein neues Leben aufbauen mussten. In vielen Gebieten Polens wie auch in der Ukraine und Weißrussland gingen so historisch gewachsene Strukturen und Traditionen zu Ende. Die Umgestaltung Polens in eine sozialistische Diktatur sowjetischen Zu-schnitts verlief nicht ohne Widerstand. Wohl in keinem anderen Land des sowjetischen Machtbereiches kam es zu derart häufigem und derart intensi-vem Widerstand gegen das politische System wie in Polen. Eine Rolle spiel-te wohl die historische Erfahrung des 19. und 20. Jahrhunderts, in der jede Generation mindestens einen Aufstand unter nationalem Vorzeichen miter-lebt hatte. Dem Widerstand gegen eine Herrschaft, die als fremde Besat-zungsmacht empfunden wurde, kam daher im polnischen Nationalbewusst-sein eine hervorragende Bedeutung zu. So musste bereits 1956 die geplante Zwangskollektivierung der Landwirtschaft ausgesetzt werden, die massiven Widerstand der Bauern hervorgerufen hatte. Weitere Massenproteste und Streiks, die oft auch den schlechten Lebensstandard und die problematische Versorgungslage zum Ausgangspunkt hatten, brachten das Regime mehrfach in Bedrängnis. Angesichts der Widerstandsbewegung um die freie Gewerk-
Teil C: Regionale Schwerpunkte
290
schaft Solidarność von 1980 schien sogar ein Ausscheren Polens aus dem sozialistischen Lager möglich, zumal die sowjetische Führung zögerte, mili-tärisch zu intervenieren. Sie überließ die Unterdrückung der Protestwelle 1981 der polnischen Führung, die sich militärische Unterstützung durch die UdSSR erhofft hatte. Als die Sowjetunion in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre die Bereitschaft signalisierte, den osteuropäischen Staaten mehr Frei-heiten zuzugestehen, lenkte die polnische Parteileitung bereits 1988 ein und suchte den Dialog mit den Oppositionskräften. Der Übergang zu einem de-mokratischen und markwirtschaftlichen Gesellschaftssystem verlief so in ausgehandelten Bahnen.
2.2.2 Ungarn und Kroatien
Im Falle Ungarns lassen sich die Umstände der Herrschaftsbildung ver-gleichsweise genau angeben. Der zumindest teilweise noch reiternomadische Stammesverband der Ungarn ließ sich im letzten Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts (wahrscheinlich ab 894; historische Tradition: Landnahme 896) von den nord-pontischen Steppen her kommend im Karpatenbecken nieder. Zu Beginn des 10. Jahrhunderts zerstörten die Ungarn das Großmährische Reich, wobei sla-wisch besiedelte Gebiete östlich der March/Morava (das spätere Oberungarn, die heutige Slowakei) unter ungarische Herrschaft kamen. Nach einer Phase verheerender Plünderzüge der Ungarn durch weite Teile Westeuropas in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts konsolidierte sich das Reich im Innern nach der Niederlage in der Schlacht auf dem Lechfeld (955). Im Prozess der Errichtung einer einheitliche Zentralgewalt über die um 900 möglicherweise in diversen Stammesherrschaften ohne näheren Zusammen-halt organisierten Ungarn setzte sich in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhun-derts schließlich die Dynastie der Arpaden gegen andere Stammesführer durch. Wichtig waren dabei die in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts einsetzende Christianisierung und die Aufnahme friedlicher Beziehungen zu den Nachbarreichen, insbesondere dem ostfränkischen (deutschen) Reich und Byzanz. Um die Jahreswende 1000/1001 ließ sich der Arpade Stephan, der Begründer der Zentralgewalt, zum König von Ungarn krönen. Durch weitreichende dynastische Verbindungen, die Orientierung an westeuropäi-schen Herrschaftsordnungen, die Aufnahme einer bedeutenden Zahl von Beratern und Fachleuten aus dem westlichen Europa und den Aufbau der Kirchenorganisation nach lateinischem Ritus entfernte sich die Herrschafts-organisation Ungarns immer stärker von der Steppentradition und das Kö-nigreich wurde Teil der Gemeinschaft christlicher Reiche in Europa. Bis Ende des 12. Jahrhunderts umfasste das Herrschaftsgebiet der ungarischen Könige das gesamte Karpatenbecken, wozu neben dem heutigen Ungarn die Slowakei, der westlichste Teil der Ukraine und Siebenbürgen (die zentralen
2. Ostmitteleuropa
291
und westlichen Landesteile Rumäniens) gehören. Im Süden erstreckte sich Ungarn bis zur Donau-Save-Linie und reichte aufgrund des seit 1102 in einer Personalunion mit der ungarischen Krone verbundenen Kroatiens, bis an die Adria. An der südlichen Flanke dehnte sich der ungarische Einflussbereich mit Grenzmarken, den sogenannten Banschaften (oder Banate > Glossar) bis ins heutige Bosnien und Serbien, zeitweise auch über die Karpaten in die Walachei und die Moldau aus. Im Hoch- und Spätmittelalter trat Ungarn daher als führende Regionalmacht auf, deren Einfluss phasenweise bis weit nach Südosteuropa reichte. Abgesi-chert wurde die Vormachtsstellung durch den hohen Ertrag, den die ungari-schen Bergwerke des Spätmittelalters abwarfen. Einer inneren Krise mit dem Verfall der Königsmacht und der vorübergehenden Desintegration des Lan-des im 13. Jahrhundert folgte das Aussterben der Arpaden 1301. Unter der Dynastie der Anjou (1310–1382/87) wurde die Königsherrschaft wieder konsolidiert, doch gegen Ende des 14. Jahrhunderts zeichnete sich mit dem Vordringen der Osmanen die nächste ernsthafte Bedrohung ab. Das gesamte 15. und frühe 16. Jahrhunderte sollte vom Abwehrkampf gegen das aufstre-bende Osmanische Reich gekennzeichnet sein, der letztlich zur Erosion der wirtschaftlichen Möglichkeiten des Landes und zur Verwüstung weiter Landstriche im Süden führte. Die vernichtende Niederlage gegen ein osmanisches Heer in der Schlacht von Mohács (1526) brachte nach einem Erbvertrag die Habsburger auf den ungarischen Thron, die diesen bis 1918 innehaben sollten. Doch der An-spruch der Habsburger auf Ungarn blieb zunächst nominell und musste erst mit Waffengewalt gegen den von Teilen des Adels eingesetzten Gegenkönig durchgesetzt werden. In den Jahrzehnten nach der Schlacht von Mohács begann das Land aufgrund lang anhaltender Machtkämpfe in drei Teile zu zerfallen. Bis Mitte des 16. Jahrhundert wurden so Zentral- und Südungarn ins Osmanische Reich eingegliedert, während sich im Osten ein autonomes, unter loser osmanischer Oberhoheit stehendes Fürstentum Siebenbürgen auszubilden begann. Hier dominierten der ungarische Adel sowie die Stände der Szekler (> Glossar) und der Siebenbürger Sachsen das politische Leben. Den Habsburgern gelang es nur in einem Gebietsstreifen, der sich von Kroa-tien über Westungarn westlich des Plattensees und das Burgenland bis in die heutige Slowakei zog, ihren Herrschaftsanspruch durchzusetzen. Dieses von den österreichischen Erzherzögen in Personalunion regierte Königreich Un-garn mit Pressburg (Bratislava) als Krönungsort war der Ausgangspunkt, von dem aus die Habsburger ihr Anrecht auf die Herrschaft ganz Ungarns zu verwirklichen trachteten. Der ungarische Adel hatte ein äußerst zwiespältiges Verhältnis zu den Habs-burgern, bedrohten diese doch mit frühabsolutistischen Zentralisierungsver-
Teil C: Regionale Schwerpunkte
292
suchen und mit rigorosen gegenreformatorischen Maßnahmen die Machtpo-sition des widerstandsgewöhnten und überwiegend reformierten Adels. Viele Adlige sahen daher nicht im habsburgischen Königreich, sondern im auto-nomen, unter lockerer osmanischer Oberhoheit stehenden Siebenbürgen ein Modell für die Einigung Ungarns. Im zentralen, direkt ins Osmanische Reich integrierten Teil Ungarns blieb die osmanische Verwaltung vergleichsweise schwach und orientierte sich an ungarischen Gepflogenheiten. Osmanischer Verwaltungsapparat und ungarische Ansprüche überlagerten sich gegensei-tig, so dass vielerorts auch im osmanischen Teil des Landes ungarische Grundherren und Beamte Abgaben, Steuern und Zehnten einziehen konnten. Ohnehin waren die Grenzen zwischen den drei Teilen Ungarns fließend und änderten sich aufgrund häufiger Kriegszüge immer wieder. Eine Wende brach-te erst die zweite Belagerung Wiens durch ein osmanisches Heer 1683. Im einer gemeinsamen Anstrengung der christlichen Herrscher, die in der «Heili-gen Allianz» verbündet waren, konnten die Osmanen aus Ungarn vertrieben und zum Verzicht darauf bewegt werden (1699). Die definitive Eingliederung Ungarns in das Habsburger Reich wurde jedoch erst nach der Niederschlagung eines antihabsburgischen Aufstandes 1711 erreicht. Da weite Landstriche Süd-ungarns im Laufe der Osmanenzeit verödet waren, begannen die Habsburger dieser Regionen gezielt zu besiedeln, um sie wirtschaftlich nutzbar zu machen. Neben Flüchtlingen aus dem Osmanischen Reich wurden auch gezielt katholi-sche Kolonisten zumeist aus den deutschsprachigen Ländern angeworben. Binnenmigrationen von höher gelegenen Regionen in die nun wieder sicherer gewordenen Täler und Ebenen ergänzten diese umfangreichen demografischen Veränderungen. Gegenüber der vorosmanischen Zeit verschoben sich damit die ethnischen Verhältnisse vielerorts zuungunsten der magyarischsprachigen Bevölkerung, die so die absolute Bevölkerungsmehrheit im Karpatenbecken verlor. Die Polarisierung zwischen Magyaren, die nur eine relative Mehrheit von etwas weniger als 40 % der Gesamtbevölkerung Ungarns stellten, und einem Teil der übrigen Nationalitäten brachte die Revolution von 1848/49. Unter dem Eindruck der revolutionären Ereignisse in Europa gelang es den Refor-mern, im März 1848 in Ungarn ein konstitutionelles Regime innerhalb der Donaumonarchie zu errichten und die politischen, sozialen und nationalen Forderungen der magyarischen Nationalbewegung umzusetzen. Dagegen formte sich jedoch der Widerstand der Nationalitäten, die sich gegen den Einbezug in einen ungarischen Nationalstaat wehrten. Rumänen, Serben, Kroaten, Slowaken und Ruthenen traten mit eigenen Forderungen und Pro-grammen gegen die ungarische Revolutionsregierung auf. Sie konnten dabei auf die Unterstützung des Wiener Hofes zählen, für den die Nationalitäten im Moment willkommene Verbündete darstellten. Der sich zuspitzende Kon-flikt gipfelte schließlich in der Absetzung der Habsburger als Könige Un-
2. Ostmitteleuropa
293
garns durch die revolutionäre Führung. Da nun aber russländische Truppen auf der Seite der Habsburger eingriffen, konnte die Revolution im Sommer 1849 niedergeworfen werden. Es folgte eine Phase der Vergeltung und der zentralistischen Restauration, wobei die Autonomie Ungarns aufgehoben wurde. Doch schon bald sah sich der Wiener Hof gezwungen, angesichts der militärischen Niederlage gegen Preußen 1866 das Reich innerlich zu reformieren und dazu die Beziehungen mit der ungarischen Seite zu regeln. Dies führte zum österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867, in dem Ungarn in seinen historischen Gren-zen unter Einschluss Oberungarns (Slowakei), Siebenbürgens und Kroatiens (dieses erlangte seinerseits in einem separaten Ausgleich 1868 Autonomie-rechte) eine eigene Regierung mit weitgehender Selbstständigkeit erhielt. Es war nur noch über den Habsburger Herrscher und die gemeinsamen Angele-genheiten (Außenpolitik, Kriegswesen und die diesbezüglichen Finanzen) der Gesamtmonarchie verbunden. In der so entstandenen Doppelmonarchie war Ungarn (Transleithanien) zu einem weitgehend selbstständigen Natio-nalstaat geworden. Die Interessen der nichtmagyarischen Nationalitäten in den ungarischen Ländern waren der Erhaltung der Habsburger Monarchie geopfert worden. Die ungarischen Eliten betrieben eine zunehmend aggressivere Magyarisie-rungspolitik, die mittels kulturell-sprachlicher Vereinheitlichung die Schaf-fung einer homogenen ungarischen Nation zum Ziel hatte. Ihren Höhepunkt erreichte die Magyarisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, stieß aber auf den zunehmenden Widerstand der nichtmagyarischen Mehrheit der trans-leithanischen Reichshälfte (darunter Serben, Kroaten, Slowaken, Ruthenen, Rumänen, Deutsche). An der Nationalitätenfrage zerbrach schließlich im Ersten Weltkrieg die Habsburger Monarchie. Die Siegermächte besiegelten im Friedensvertrag von Trianon (1920) die Territorialverluste Ungarns an die Nachfolgestaaten: Oberungarn (Slowakei) und die Karpato-Ukraine an die Tschechoslowakei, Siebenbürgen und der größte Teil des Banats an Ru-mänien, Kroatien-Slawonien, die Vojvodina (Teile der Batschka und des Banats) an das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (ab 1929 Ju-goslawien) sowie das Burgenland an Österreich. Ungarn verlor dabei zwei Drittel seines Vorkriegsterritoriums. Der 1919 kurzzeitig erfolgreich unternommene Versuch, Ungarn in Anleh-nung an die russischen Bol’ševiki (> Glossar) in eine sozialistische Rätere-publik umzuwandeln, scheiterte schon nach kurzer Zeit. Das labile politische Gleichgewicht der Zwischenkriegszeit unter konservativer Führung und zunehmendem Einfluss der radikalen Rechten verhinderte die Konsolidie-rung einer liberalen Demokratie. In den 1930er-Jahren näherte sich Ungarn an das nationalsozialistische Deutschland an, von dem sich die politischen
Teil C: Regionale Schwerpunkte
294
Eliten eine Befriedigung des latenten Revisionismus erhofften. Während des Zweiten Weltkrieges gelang es tatsächlich, als Verbündeter Deutschlands kurzfristig einige der 1918 verloren gegangenen Gebiete zurückgewinnen. 1944 besetzten deutsche Truppen das Land, worauf mit aktiver Unterstützung der ungarischen Behörden die massenhafte Deportation der jüdischen Bevöl-kerung in die nationalsozialistischen Vernichtungslager einsetzte. In der End-phase des Krieges erlangten im Herbst 1944 für wenige Monate die faschisti-schen Pfeilkreuzler die Herrschaft. Die Niederlage gegen die vorrückenden Truppen der Roten Armee konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Mit der europäischen Nachkriegsordnung wurden die bis heute gültigen Grenzen auf der Grundlage des Trianoner Vertrages wiederhergestellt. In Ungarn steuerte Moskau, wie in den anderen sowjetisch besetzten Ländern, nach einer kurzen Übergangszeit die Umwandlung in eine sozialistische Einparteienherrschaft. Die repressive Politik der Kommunisten ließ Wider-stand aufkeimen, als 1956 in der Sowjetunion die Entstalinisierung eingelei-tet wurde. Im Herbst ergriff ein antikommunistischer Aufstand weite Teile des Landes und führte zu Massendemonstrationen. Die Proteste wurden je-doch von sowjetischen Truppen blutig niedergeschlagen, was eine große Zahl von Ungarn zur Flucht veranlasste. Die Folgen des Aufbegehrens be-standen vorerst in der Restauration der sozialistischen Diktatur nach sowjeti-schem Vorbild. Mittelfristig setzte sich in der ungarischen Führung jedoch die Einsicht durch, dass eine beschränkte Lockerung der politischen Repres-sion das wirksamste Mittel sei, um neuen Protesten zuvorzukommen. Seit den 1960er-Jahren gestattete Ungarn unter Beibehaltung aller zentralen Cha-rakteristika des sowjetischen Einparteiensystems seinen Bürgern kleine Frei-heiten etwa auf wirtschaftlichem Gebiet oder in Bezug auf Reisefreiheit. Der Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern wurde ebenfalls mehr Be-achtung geschenkt als in anderen sozialistischen Ländern – daher die Be-zeichnung «Gulasch-Kommunismus» für die ungarische Variante des Sozia-lismus. Diese Maßnahmen trugen in der Tat dazu bei, das Regime zu stabili-sieren – Massenproteste wie in Polen blieben fortan aus. Gegen Ende der 1980er-Jahre machte sich in der Partei eine reformorientierte Fraktion be-merkbar. Der Systemwechsel hin zu einem demokratischen Mehrparteien-system wurde zwischen Vertretern des alten Regimes und der Opposition ausgehandelt und verlief friedlich. Auch hier markiert das Epochenjahr 1989 den Beginn der Systemtransformation. Mit der früh eingeleiteten Reformpo-litik spielte Ungarn die Rolle eines Katalysators für den Systemwechsel in anderen Ländern des sowjetischen Einflussbereiches. Kroatien entstand zwischen der Halbinsel Istrien und Mitteldalmatien im gebirgigen Hinterland der dalmatinischen Küstenstädte, die bis ins 11. Jahr-hundert zumindest nominell byzantinischer Herrschaft unterstanden. Als im späten 8. und frühen 9. Jahrhundert das fränkische Reich in diesen zuvor
2. Ostmitteleuropa
295
unter awarischem Einfluss stehenden Raum vorzudringen begann, kam es zu ersten überlokalen Herrschaftsbildungen unter fränkischer Oberhoheit. Bei der kroatischen Herrschaftsbildung konnten so Impulse aus Byzanz und dem fränkischen Reich aufgenommen werden. Die Mitte des 9. Jahrhunderts sah eine erste Erstarkung der Herrschaft unter der bereits christianisierten Dy-nastie der Trpimiriden, die ihr Herrschaftsgebiet weiter ins Landesinnere ausdehnten, die fränkische Oberhoheit abschütteln konnten und den Aufbau einer eigenen Kirchenorganisation nach lateinischem Ritus an die Hand nahmen. Seit dem späten 10. Jahrhundert nannten sich die kroatischen Herr-scher Könige. Doch erst in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts kam es zur Konsolidierung des kroatischen Herrschaftsgebietes, das nun auch Teile Dalmatiens sowie das nordöstlich an das kroatische Kerngebiet angrenzende, unter ungarischem Einfluss stehende Slawonien zwischen den Flüssen Drava und Save um Zagreb erfasste. 1102 fiel die kroatische Königswürde nach dem Aussterben der Trpimiriden an die ungarischen Arpaden, so dass Kroatien infolgedessen über diese Per-sonalunion als Nebenland mit Sonderstellung bis 1918 mit Ungarn (seit 1526 gemeinsam unter habsburgischer Herrschaft) verbunden blieb. Kroatien be-hielt jedoch innerhalb Ungarns eine Sonderstellung. Als königlicher Bevoll-mächtigter amtierte ein Ban, das Land behielt Autonomie und einen eigenen Landtag. Vor allem das eigentliche Kroatien im Hinterland der Küste blieb unter der Verwaltung kroatischer Adliger weitgehend selbstständig, während Slawonien, das Gebiet im Landesinnern zwischen Drava und Save, stärker an die ungarischen Verhältnisse angepasst wurde. Als Ungarn 1526 erbrecht-lich an die Habsburger fiel, wurde auch Kroatien habsburgisch. Es war je-doch zugleich Frontgebiet gegen die vorrückenden Osmanen. Auf habsbur-gischer Seite begann daher schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die sogenannte Militärgrenze zu entstehen. In diesem nach und nach erwei-terten Grenzstreifen wurden gezielt Wehrbauern angesiedelt, die gegen Landzuteilung und Privilegien als Grenzwächter Kriegsdienste zu leisten hatten. Eine bedeutende Zahl orthodoxer Christen aus dem Osmanischen Reich (Serben, Vlachen > Glossar) ließen sich auf dem Gebiet der Militär-grenze nieder und schufen so eine ethnisch und konfessionell durchmischte Zone. Nach der Eroberung ganz Ungarns durch die Habsburger entstanden im 18. Jahrhundert auch weiter östlich Militärgrenzen: 1702 in Slawonien, 1742 im Banat und 1764 in Siebenbürgen. Die Militärgrenze reichte damit von der Adria bis zu den Ostkarpaten und war ein der zivilen Verwaltung entzogenes Territorium eigener Rechtsstellung. Zwischen 1851 und 1881 wurde die Militärgrenze stufenweise aufgelöst und in die umliegenden Terri-torialeinheiten eingegliedert. Die Städte an der dalmatinischen Küste unterstanden in ihrer wechselhaften Geschichte verschiedensten Herrschaften. Beginnend mit dem 11., besonders
Teil C: Regionale Schwerpunkte
296
aber seit dem frühen 13. Jahrhundert trat Venedig an die Stelle des byzantini-schen Reiches als dominierende Macht an der Adriaostküste. Der veneziani-sche Einfluss auf weite Teile Dalmatiens und Istriens blieb trotz Rückschlägen während der Frühen Neuzeit bis 1797 bestehen. Zugleich begann im 12. Jahr-hundert ein Prozess, der in diversen Städten zu einer weitgehenden kommuna-len Selbstverwaltung führte; am deutlichsten ausgeprägt im Falle der Handels-stadt Dubrovnik (Ragusa), die sich auch unter osmanischer Oberhoheit als weitgehend eigenständige Stadtrepublik bis 1808/15 behaupten konnte. Nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 erhielt Kroatien im ungarisch-kroatischen Ausgleich von 1868 eine Autonomie innerhalb Ungarns zugestanden, die jedoch weniger weit ging als der österreichisch-ungarische Ausgleich. Ungarn behielt weitgehende Kompetenzen, so etwa die Einsetzung eines Bans als lokaler Statthalter. Auf Seiten der Kroaten gab es verschiedene Bestrebungen, den Status des Landes aufzuwerten. Die Niederlage der Habs-burger Monarchie im Ersten Weltkrieg ermöglichte es Kroatien 1918, sich von Ungarn loszusagen und damit die seit 1102 bestehende Verbindung der beiden Länder zu lösen. Angesichts der in Istrien vormarschierenden italienischen Truppen wurde eine Vereinigung mit Serbien beschlossen. Das so unter Einbezug des von der österreichischen Reichshälfte losgelösten Slowenien überstürzt proklamierte Königreich der Serben, Kroaten und Slo-wenen (abgekürzt SHS), das 1929 in Jugoslawien umbenannt wurde, stand unter der serbischen Dynastie der Karadjordjevići. Ohne einen Konsens in grundlegenden Verfassungsfragen erzielt zu haben, hielten Spannungen zwi-schen Kroaten und Serben während der ganzen Zwischenkriegszeit an. Wäh-rend des Zweiten Weltkrieges entstand ein sogenannter «unabhängiger Staat Kroatien» unter Führung der faschistischen Ustaša und der Protektion Deutschlands und Italiens. In diese Zeit fallen massive Kriegsverbrechen und die Verfolgung von Personen vor allem serbischer und jüdischer Her-kunft. Nach dem Krieg wurde Kroatien als eine von sechs Republiken Teil des sozialistischen Jugoslawien. In den späten 1980er-Jahren war es eine der treibenden Kräfte, die zum Zerfall des Bundesstaates führten. Die 1991 er-rungene Unabhängigkeit war begleitet von Kriegshandlungen, in die neben der jugoslawischen Armee auch informelle serbische Milizen verwickelt waren. Serbisch besiedelte Regionen Kroatiens (Krajina, Ostslawonien) sag-ten sich vom neuen Staat los. Erst 1995 wurden diese Territorien in einer Militäraktion erobert und damit die Grenzen aus jugoslawischer Zeit wieder-hergestellt.
2. Ostmitteleuropa
297
2.2.3 Habsburger Reich
Das Habsburger Reich als heterogener Länderkomplex, dessen Identität vor allem auf der Dynastie der Habsburger gründete, begann sich im Spätmittel-alter auszubilden. Der Schwerpunkt des Herrschaftsgebietes dieser ursprüng-lich im Südwesten des deutschen Sprachraumes beheimateten Adelsfamilie verschob sich im 14. Jahrhundert aus dem nördlichen Teil der heutigen Schweiz nach Österreich. Letzteres war aus einer Grenzmark des 10. Jahrhunderts im heute österreichischen Donautal hervorgegangen, und wurde bis Mitte des 13. Jahrhunderts vom Adelsgeschlecht der Babenberger geführt. Vom späten 12. bis ins ausgehende 14. Jahrhundert dehnten die Her-zöge von Österreich ihren Herrschaftsbereicht nach Süden und Westen aus, womit langsam ein zusammenhängender Länderverband entstand. 1278 nutzte der Habsburger Rudolf II. seine Stellung als deutscher König, um das nach dem Aussterben der Babenberger heimgefallene Reichslehen gegen die Ansprüche des böhmischen Königs für die eigene Familie zu sichern. Er konsolidierte damit seine Hausmacht und führte eine Rangerhöhung der Habs-burger in den Reichsfürstenstand herbei, begründete aber zugleich die Bin-dung der Habsburger an Österreich. Der Name dieses Landes wurde fortan immer häufiger synonym für das Haus Habsburg und dessen Herrschaftsbe-reich verwendet. Dieser dehnte sich allmählich neben dem eigentlichen Öster-reich auch auf die damit verbundenen Länder des Alpenraumes (Steiermark, Tirol, Kärnten, Krain, Vorarlberg) aus. Als habsburgische Erblande oder Herr-schaft zu Österreich (dominium Austriae) bezeichnet, erlitten die Tendenzen, diese unterschiedlich strukturierten Gebiete zu einem Gesamtreich zu integrie-ren, im Verlauf des 15. Jahrhunderts diverse Rückschläge durch familiäre Besitzteilungen. Erst an der Wende zum 16. Jahrhundert war die Herrschaft über die Erblande wieder vereint, doch dauerte es bis zur definitiven administ-rativen Vereinigung noch bis ins 18. Jahrhundert. Seit 1438 trugen die Habs-burger die Königs- bzw. Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches Deut-scher Nation praktisch ununterbrochen. Mit dessen Auflösung 1806 erloschen die staatsrechtlichen Beziehungen zwischen dem fortan nur noch als geografi-sche Bezeichnung existierenden Deutschland und Österreich. Bereits 1804 hatten die Habsburger aber den Titel des Kaisers von Österreich angenommen, den sie bis zum Untergang ihres Reiches 1918 führten. Die unter Herrschaft der Habsburger stehenden Länder und Territorien bilde-ten also zu Beginn der Neuzeit keine Einheit, als nach dem Tod des ungari-schen und in Personalunion auch böhmischen Königs 1526 in der Schlacht von Mohács die Kronen dieser Länder aufgrund eines Erbvertrages an die Habsburger fielen. Der Zusammenschluss Österreichs mit Ungarn und Böh-men, inklusive ihrer Nebenländer (Kroatien, Schlesien, Lausitzen), zu einem Großreich erfolgte auch unter dem Eindruck des osmanischen Vorstoßes
Teil C: Regionale Schwerpunkte
298
nach Mitteleuropa. Allerdings blieb der habsburgische Anspruch auf Un-garn, anders als im Falle Böhmens, in Bezug auf zwei Drittel des Landes nominell und konnte erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts auch tatsächlich durchgesetzt werden. Mit den neu erworbenen Territorien trugen die Habs-burger nun aber auch die Hauptlast der Osmanenabwehr. 1522 erfolgte eine Aufteilung der habsburgischen Besitzungen in eine österreichische und eine spanische Linie. Letztere umfasste die im späten 15. und frühen 16. Jahr-hundert erbrechtlich erworbenen umfangreichen Besitzungen in Westeuropa. Damit verschob sich der Interessenschwerpunkt habsburgischer Politik für rund zwei Jahrhunderte nach Westen, vor allem nach Spanien mit seinem Kolonialreich. Die mitteleuropäische Länderverbindung der österreichischen Habsburger war so im Rahmen der Familienpolitik oft von Konflikten ab-sorbiert, die außerhalb des eigenen Machtbereiches lagen. Erst mit der Ver-drängung der Osmanen aus Ungarn Ende des 17. Jahrhunderts und dem gleichzeitige Aussterben der spanischen Linie des Hauses 1700 rückten die ostmitteleuropäischen Besitzungen zu Kernbestandteilen des Habsburger Reiches auf. Im weiteren Verlauf gelang hier der Erwerb oder die Eroberung weiterer Territorien, so in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Galiziens im Zuge der polnischen Teilungen sowie der Bukowina. Nach dem Wiener Kongress wurde auch Dalmatien Teil der Donaumonarchie, schließlich er-folgte 1878 mit der Besetzung und 1908 der Annexion von Bosnien eine letzte bedeutende Territorialerweiterung. Die administrative Vereinheitlichung und Zentralisierung des Reiches, das sich aus unterschiedlichsten Besitzungen mit je eigenen politischen Verfas-sungen zusammensetzte, war ein kontinuierliches Anliegen der absolutisti-schen Landesherrn während der gesamten Frühen Neuzeit. Die Verdichtung der Herrschaft in den einzelnen Territorien und die Schaffung von län-derübergreifenden Zentralbehörden (Hofkanzlei) musste gegen den Wider-stand der Stände durchgesetzt werden. Die Staatsbildung des als «monarchi-sche Union von Ständestaaten» charakterisierten Habsburger Reiches kam so nur langsam voran, machte jedoch vor allem unter Maria Theresia (1740–1780) und ihrem Sohn Joseph II. (1765/80–1790) Fortschritte. Am schwie-rigsten erwies sich die Integration Ungarns, des weitaus größten und im Rahmen der Türkenabwehr wichtigsten Länderverbandes der Monarchie. Der zahlenmäßig starke und selbstbewusste ungarische Adel setzte den Zent-ralisierungsbemühungen der Habsburger immer wieder massiven Wider-stand entgegen. Mehrmals gipfelte die antihabsburgische Opposition in Auf-ständen, so etwa im sogenannten Kuruzzenaufstand an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert oder der Unabhängigkeitserklärung Ungarns in der Revolution von 1848/49. Dabei überlagerten sich ständisch-nationale Forde-rungen des Adels und der Kampf für konfessionelle Freiheit der überwie-gend reformierten ungarischen Stände. Erst im Rahmen des österreichisch-
2. Ostmitteleuropa
299
ungarischen Ausgleichs von 1867 wurde eine definitive Lösung für die In-tegration Ungarns in die Gesamtmonarchie gefunden, allerdings zum Preis der weitgehenden inneren Selbstständigkeit der ungarischen Reichshälfte. Die kaiserlich-königliche (k. k.) Monarchie wurde damit zur kaiserlich und königlichen (k. u. k.) Monarchie. Die große Herausforderung stellten seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert die als Nationalitätenfrage bezeichneten Forderungen der diversen ethni-schen Gruppen des Reiches nach politischen Rechten und Mitbestimmung bis hin zu Autonomie dar. Besonders in Ungarn zeigte sich dabei ein nicht überbrückbarer Gegensatz. Auf der einen Seite standen national-ungarische Kräfte, welche die Länder der ungarischen Krone in den mittelalterlichen Grenzen als magyarischen Nationalstaat betrachteten. Auf der anderen Seite befanden sich die Vertreter der nichtmagyarischen Nationalitäten, vor allem der Rumänen und der slawischen Nationalitäten (Slowaken, Ruthenen, Kroa-ten, Serben). Diese übertrafen zusammen die Ungarn zahlenmäßig und wehr-ten sich gegen eine ungarische Vorherrschaft. Aufgrund der politischen Kräf-teverhältnisse war die Bevorzugung der magyarischen Seite durch den Wiener Hof zwar nahe liegend. Doch führte dies zur Entfremdung der nichtmagyari-schen Nationalitäten vom Gesamtreich, was im Verlauf des Ersten Weltkrie-ges zur Aufkündigung der Loyalität ans Habsburger Reich gipfelte. Doch auch in der österreichischen Reichshälfte entwickelte sich die Nationalitätenfrage bis ins frühe 20. Jahrhundert zu einem desintegrierenden Faktor. Die nationa-len Ansprüche insbesondere der Tschechen und Polen, aber auch anderer Na-tionalitäten, führten hier gleichfalls zur Proklamation von Nationalstaaten nach der habsburgischen Niederlage im Ersten Weltkrieg. Damit ging ein Großreich unter, das später auch in den Nachfolgestaaten zum Objekt nostalgischer Erinnerungen avancierte. Die im Gegensatz zum Russländischen Zarenreich und dem Osmanischen Reich auffallend positive Wertung ist teilweise auf die Ausbildung einer Reichskultur zurückzuführen, welche die ethnisch-nationalen Gegensätze überwölbte. Sie manifestierte sich etwa in der Person des langjährigen Regenten Kaiser Franz Josephs I. (1848–1916), in den architektonisch-städtebaulichen Ähnlichkeiten zahlrei-cher über die ganze Monarchie verstreuter Bahnhofs- oder Theatergebäude wie auch in literarischen Traditionen. Doch greift eine allein darauf abge-stellte Erklärung schon deshalb zu kurz, da eine vergleichbare auf das Ge-samtreich bezogene Kultur ein Charakteristikum von Imperien schlechthin ist und in analoger Form auch im Russländischen und Osmanischen Reich existierte. Viel eher widerspiegelt die Habsburgnostalgie wohl auch die ne-gativen Erfahrungen vieler Nachfolgestaaten, deren innenpolitisches Leben nicht selten von Instabilität und Konflikten gezeichnet war und die außenpo-litisch schon bald in neue Abhängigkeiten gerieten. Insbesondere aber die Teilung Europas durch den Eisernen Vorhang nach 1945 dürfte die Erinne-
Teil C: Regionale Schwerpunkte
300
rung an die Zugehörigkeit zu einem mitteleuropäischen Kulturkreis aktuali-siert haben. Es wurde an eine mythisch überhöhte Identität angeknüpft, die sich während Jahrhunderten aus der Abwehr der Osmanen und der Distan-zierung vom orthodoxen Kulturkreis hergeleitet hat. In demonstrativer Ab-grenzung von der sowjetischen Bevormundung wurde dem repressiven poli-tischen System des Sozialismus das verklärte Bild der vergleichsweise libe-ralen Ordnung der 1918 untergegangenen mitteleuropäischen Großmacht gegenübergestellt.
2.2.4 Baltikum
In dem später zusammenfassend als Baltikum bezeichneten Gebiet, dem Ein-zugsgebiet der Zuflüsse in die östliche Ostsee und deren Hinterland, entstan-den erst relativ spät bedeutendere Herrschaftszentren. Das primär von diversen baltischen (im Süden) und ostseefinnischen Stämmen (im Norden) bewohnte Gebiet blieb nicht zuletzt dank geografischer Gegebenheiten (schwer zugäng-liche Küste, Schutz durch Sümpfe und Wälder) lange Zeit vor Expansionsbe-strebungen und Missionsbemühungen benachbarter Mächte (Dänemark, Schweden, Kiever Rus’, Polen, Heiliges Römisches Reich) geschützt, die bes-tenfalls eine lockere Oberhoheit ausüben konnten. Daher und aufgrund der Zwischenlage zwischen dem katholischen Polen und der orthodoxen Rus’ hielten sich pagane Glaubensvorstellungen in dieser Region länger als sonst irgendwo in Europa. Diverse lokale und regionale Stammesherrschaften und Burgbezirke sind seit dem 11. Jahrhundert belegt, doch ein Zusammenschluss zu einem Reich fand erst seit der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts statt, als sich im Süden mit Litauen im Binnenland ein mehrere Stämme umfassendes Herrschaftsgebiet bildete. Über Vermittlung des Deutschen Ordens wurde es zu Beginn der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts sogar vorübergehend zum Königreich erhoben, das jedoch nur kurz Bestand hatte und danach wieder zerfiel. Erst im ausgehenden 13. Jahrhundert entstand ein innerlich konsolidiertes Reich mit den Zentren in Trakai und Vilnius in Hochlitauen (litauisch Aukštaitija; nordöstlich des Mittellaufes der Memel, litauisch Nemunas). Dieser litaui-sche Herrschaftsverband begann nun vor allem nach Osten und Süden zu expandieren. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts nahm so unter der Dynastie der Gediminiden ein Großreich Form an, das weite Teile der west-lichen und südlichen Gebiete der einstigen Kiever Rus’ umfasste und im frühen 15. Jahrhundert seinen Einflussbereich punktuell bis zur Schwarz-meerküste ausdehnen konnte (> Karte 2, S. 370/71). Zwar übten sowohl das katholische wie das orthodoxe Christentum bedeutenden Einfluss auf Litau-en aus. Trotz Missionsbestrebungen und der Eingliederung christianisierter Bevölkerungsgruppen, besonders von orthodoxen Ostslawen, in den litaui-
2. Ostmitteleuropa
301
schen Herrschaftsverband zögerten die Großfürsten die Annahme des Chris-tentums lange Zeit hinaus. Litauen gehört damit europaweit zu den am spä-testen missionierten Gebieten. Die Konvertierung der Herrscherdynastie und der noch paganen Litauer erfolgte erst ab Ende des 14. Jahrhunderts. Anlass für die 1386 vollzogene Taufe des litauischen Großfürsten Jagiello aus dem Geschlecht der Gediminiden war seine Vermählung mit der polnischen Thron-erbin Jadwiga. Die Christianisierung stellte die Bedingung dar für das Zustan-dekommen der polnisch-litauischen Personalunion unter Jagiello, dem Stammvater der in Polen bis 1572 regierenden Dynastie der Jagiellonen. Fortan bildeten Polen und Litauen ein Doppelreich, verbunden in Personal-union durch die jagiellonischen Monarchen. Gefestigt wurde der Zusam-menhalt durch die 1569 zustande gekommene Realunion von Lublin (> Glossar), die zur Vereinigung beider Länder führte, wenn auch administ-rativen Besonderheiten bestehen blieben. Faktsich verstärkten sich aber der allmähliche Bedeutungsverlust und die Angleichung Litauens an die Ver-hältnisse in Polen. Besonders die Adelskultur Polens entfaltete eine mächtige Vorbildwirkung auf den litauischen Adel, dem an einer möglichst weitge-henden Teilhabe an den Vorrechten seiner polnischen Standesgenossen ge-legen war. Die Position Litauens im Gesamtreich war auch darum ge-schwächt, weil mit dem Moskauer Reich seit dem 15. Jahrhundert im Osten ein starker Gegenspieler nach Westen zu expandieren begann. Davon waren insbesondere litauische Gebiete betroffen, sofern sie nicht schon vorher Po-len zugeschlagen worden waren. Als Bestandteil der Adelsrepublik war Li-tauen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von den drei polnischen Teilungen direkt betroffen und wurde ins Zarenreich integriert. Erst mit der Desintegration Russlands im Zuge der Niederlage während des Ersten Welt-krieges und der folgenden Revolutionswirren gelang es der inzwischen ent-standenen Nationalbewegung, einen litauischen Staat zu errichten. Dieser umfasste jedoch nur das nordöstliche Kerngebiet des mittelalterlichen Groß-reiches Litauen und deckte sich im Wesentlichen mit dem litauischen Sied-lungsgebiet. Das ebenfalls neu entstandene Polen gliederte sich einen Teil der vor allem von Ostslawen bewohnten ehemaligen litauischen Ostgebiete ein, darunter auch die spätere litauische Hauptstadt Vilnius. Die Unabhängigkeit Litauens hatte nur gut zwei Jahrzehnte Bestand. Im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes besetzte die Sowjetunion 1940 Litauen wie die beiden anderen baltischen Staaten. Abgesehen von der kurzfristigen deutschen Besetzung während des Zweiten Weltkrieges verblieb das Gebiet als eine der 15 Unionsrepubliken innerhalb der UdSSR. In der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre übernahm Litauen während der Perestrojka (> Glossar) eine Vorreiterrolle innerhalb der verschiedenen auf Unabhängigkeit zielenden Nationalbewegungen. Seit 1991 existiert die einstige Sowjetrepublik wieder als unabhängiger Staat, der
Teil C: Regionale Schwerpunkte
302
wie die beiden anderen baltischen Staaten vergleichsweise rasch grundle-gende politische und ökonomische Reformen realisierte und so zu einer sta-bilen Demokratie wurde. Litauen war die einzige mittelalterliche Herrschaftsbildung von Dauer, die im östlichen Ostseeraum aus lokalen Herrschaften hervorgegangen war. In das übrige Siedlungsgebiet der baltischen und ostseefinnischen Stämme zwi-schen Weichselmündung und Finnischem Meerbusen drangen verstärkt seit dem 12. Jahrhundert Kaufleute und Missionare aus den westlichen Anrai-nergebieten der Ostsee vor. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts setzten sich bestehende oder speziell zur Missionierung im Ostseeraum gegründete Rit-terorden primär aus dem norddeutschen Raum in Form von Kreuzzügen entlang der Küsten fest. Daraus gingen Preußen als Herrschaftsbereich des Deutschen Ordens (nach der Reformation als weltliches Herzogtum in polni-scher Lehensabhängigkeit) sowie nördlich des Unterlaufs der Düna das mit-telalterliche Livland hervor. Der während der Kreuzzüge in Palästina entstandene Deutsche Orden hatte im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts auf Einladung des Herzogs von Ma-sowien begonnen, das Land der paganen Prussen, die namengebend für das Gebiet wurden, östlich der Weichselmündung zu erobern. Von Anfang an war dabei die Etablierung einer eigenen Landesherrschaft beabsichtigt gewe-sen, was schließlich zur Entstehung Preußens als Land des Deutschen Or-dens führte. Zu Beginn der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts konnte sich der westliche Teil Preußens der Ordensherrschaft entziehen und dem polni-schen König unterstellen (sogenanntes Preußen königlichen Anteils). Das im Zuge der Reformation 1525 aus der Umwandlung der Ordensherrschaft ent-standene Herzogtum Preußen im östlichen Teil stand bis zu Beginn der zwei-ten Hälfte des 17. Jahrhunderts in polnischer Lehensabhängigkeit. Es geriet nach 1618 im Erbgang unter die Herrschaft der Kurfürsten von Brandenburg, die ihr Herrschaftsgebiet 1701 unter dem Namen Preußen zum Königreich erhoben. Für das Gebiet um Königsberg wurde später der Name Ostpreußen üblich. Es verblieb Teil des Königreiches Preußen und später des deutschen Reiches bis zum Zweiten Weltkrieg. Danach wurde das Gebiet zwischen Polen und der Sowjetunion aufgeteilt. Der sowjetische Anteil bildet seit dem Ende der UdSSR die russische Enklave Kaliningrad. Am Unterlauf der Düna um die 1201 gegründete Stadt Riga entstand mit Livland zu Beginn des 13. Jahrhunderts ein Gebiet, das der Herrschaft der neu geschaffenen Bistümer und zugleich des eigens für die Absicherung der hiesigen Mission 1202 gegründeten Schwertbrüder-Ordens unterstand. Der Landesname, für die Zeit bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts üblicherweise als Alt-Livland bezeichnet, leitet sich vom Stamm der ostseefinnischen Li-ven ab, die an der unteren Düna siedelten. Über lehensrechtliche Abhängig-
2. Ostmitteleuropa
303
keiten stand Livland in Verbindung mit dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und dem Papst. Die herrschaftliche Durchdringung des eroberten Gebietes erfolgte durch den Ausbau der Kirchenorganisation und die Zuwan-derung von Siedlern aus Westeuropa, vor allem dem deutschsprachigen Raum. Daran beteiligten sich auch Kaufleute, so dass in Livland im Spätmittelalter eine im Wesentlichen bis ins frühe 20. Jahrhundert fortbestehende Sozialstruk-tur entstand. Adel und Stadtbürgertum wurden von Deutschen gestellt, wäh-rend die ansässige Bevölkerung baltischer bzw. ostseefinnischer Herkunft als teils unfreie Bauern und städtische Unterschicht lebte. Die rasche Expansion des Ordens nach Norden im Rahmen von Kreuzzügen vergrößerte den Einzugsbereich der livländischen Herrschaft bis in die zwei-te Hälfte des 13. Jahrhunderts erheblich. Das mittelalterliche Livland um-fasste so ein Gebiet von der Ostseeküste im Westen, dem Finnischen Meer-busen im Norden, der Narva und dem Peipussee im Osten sowie der mittle-ren Düna und der Ostseeküste nördlich der kurischen Nehrung im Süden – grob also das Territorium des heutigen Lettland und Estland. 1237 ging der Schwertbrüder-Orden nach einer vernichtenden militärischen Niederlage gegen die Litauer im Deutschen Orden auf. Neben der Landesherrschaft in Preußen übte dieser nun im Rahmen seines livländischen Zweiges auch die Hoheit über Livland aus. Der Norden Livlands befand sich allerdings seit der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Machtbereich Dänemarks. Von Reval (Tallinn) aus er-oberte dieses das von estnischen Stämmen besiedelte Gebiet südlich des Finnischen Meerbusens. Der nördliche Teil Estlands blieb nach Rückschlä-gen von 1238 an unter dänischer Kontrolle, bis er 1346 an den Deutschen Orden verkauft und damit als Ordensgebiet in die livländische Konföderati-on eingegliedert wurde. Dem Deutschen Orden unterstand damit ein Gebiet, das sich mit Ausnahme Litauens über die gesamte Ostseeküste von Danzig bis zum Finnischen Meerbusen mit ihrem Hinterland erstreckte. Allerdings gelang es dem Deutschen Orden in Livland anders als in Preußen nicht, als Landesherr die dominierende Rolle zu übernehmen. Vielmehr ent-wickelte sich Livland während des Spätmittelalters zu einer Konföderation der verschiedenen Territorialherrschaften und der Stände, die in den seit 1419 institutionalisierten Landtagen vertreten waren. Gemeinsam und zugleich in Konkurrenz gegeneinander lenkten die verschiedenen Akteure die Geschicke des Landes in einem fragilen Wechselspiel der Kräfte. Die Kontrolle über das Gebiet teilten sich die fünf geistlichen Territorien des Erzbistums Riga und der Bistümer Kurland, Dorpat (Tartu), Ösel-Wiek und Reval (Tallinn) mit dem livländischen Zweig des Deutschen Ordens als größter Territorialherr-schaft sowie mit den beiden Ständen der Ritterschaft und der drei Hansestäd-te Riga, Dorpat (Tartu) und Reval (Tallinn). Die komplexe Machtbalance
Teil C: Regionale Schwerpunkte
304
begann jedoch aus dem Gleichgewicht zu geraten, als zugleich mit der Schwächung des Ordens und der Hanse das Moskauer Reich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit der Eroberung Groß-Novgorods bis an die Ostgrenzen Livlands vordrang. Die Reformation verschärfte die inneren Ge-gensätze Alt-Livlands zusätzlich, so dass die Konföderation schließlich im lang anhaltenden Livländischen oder Ersten Nordischen Krieg (1558–1583) unter den benachbarten Mächten Polen-Litauen, Schweden und Dänemark aufgeteilt wurde. Der livländische Zweig des Deutschen Ordens, dessen Abhängigkeit vom preußischen Zweig sich schon seit dem frühen 15. Jahrhundert zu lockern begonnen hatte, löste sich 1561/62 auf und unterstellte zusammen mit den Ständen große Teile Livlands der polnischen Krone. In Kurland entstand derweil ein Herzogtum unter polnischer Lehenshoheit, das bis Ende des 18. Jahrhunderts existierte. Das nördliche Estland mit Reval geriet unter schwedische, die Insel Ösel (estnisch Saaremaa) bis 1645 unter dänische, danach ebenfalls unter schwedische Herrschaft. 1629 konnte Schweden auf Kosten Polens einen Großteil Livlands und die preußische Küste seiner Herrschaft unterstellen. Im östlichen Ostseeraum war Schweden damit zur dominierenden Macht geworden. Das Ende der schwedischen Großmachtsstellung und damit eine abermalige Änderung der Herrschaftsverhältnisse brachte der Dritte oder Große Nordi-sche Krieg zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Die schwedischen Besitzungen in Estland und Livland wurden ins Russländische Reich eingegliedert, womit das Zarenreich Ostseeanrainer geworden war. Bis Ende des 18. Jahrhunderts wurden als Folge der drei polnischen Teilungen auch die der Krone Polens unterstehenden Gebiete des Baltikums weiter im Süden Teil des Zarenrei-ches, womit die gesamte Küste und das Hinterland der Ostsee von der Me-mel im Süden bis zum Finnischen Meerbusen im Norden unter der Herr-schaft der Zaren standen. Erst nach dem Ersten Weltkrieg entstanden hier die drei unabhängigen Staa-ten Estland, Lettland (im Kerngebiet des mittelalterlichen Livlands) und weiter südlich Litauen. Die Geschichte der drei Staaten verlief im 20. Jahr-hundert ähnlich. Die 1918 von allen drei Staaten ausgerufene Unabhängig-keit musste zuerst mit Waffengewalt gegen deutsche und dann russländische Truppen (vor allem der revolutionären Bol’ševiki) verteidigt werden. Das politische Leben in der Zwischenkriegszeit mündete in allen drei baltischen Staaten in ein autoritäres Regime, in Litauen bereits 1926, in Estland und Lettland 1934. Der kurzen Phase der Unabhängigkeit von 1918/20 bis 1940 folgte 1940 die Eingliederung als je eigene Unionsrepublik in die Sowjet-union. Schon 1941 erfolgte die deutsche Besetzung im Rahmen des An-griffskrieges auf die Sowjetunion. Das Ausmaß der Kollaboration der balti-
2. Ostmitteleuropa
305
schen Bevölkerung mit dem nationalsozialistischen Besatzungsregime ge-hört wie in andern Ländern Osteuropas zu den heikelsten zeitgeschichtlichen Forschungsfragen. 1944 wurden Estland, Lettland und Litauen abermals als eigene Republiken in die Sowjetunion eingegliedert. Während der bis 1991 dauernden Zugehörigkeit zur UdSSR zogen viele Personen aus anderen Ge-genden des Landes ins Baltikum, besonders Russen. Der russische Anteil an der Bevölkerung erhöhte sich so vor allem in den Städten, was bei der ein-heimischen Bevölkerung die Furcht vor einem Verlust der nationalen Identi-tät auslöste. Darin wie auch in der völkerrechtlich nie anerkannten sowjeti-schen Annexion der unabhängigen baltischen Staaten lag der Ausgangspunkt für die in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahren einsetzende Unabhängig-keitsbewegung. Als Vorreiter der Desintegration der Sowjetunion erhielten die drei baltischen Staaten im Spätsommer 1991 als erste unter den 15 Sow-jetrepubliken die Unabhängigkeit. Damit und durch die 2004 erfolgte Auf-nahme in die Europäische Union und die NATO ist das Baltikum wieder, wie in der Zwischenkriegszeit und der Zeit vor dem 18. Jahrhundert, eng mit der der ostmitteleuropäischen Geschichtsregion verknüpft.
2.2.5 Ausblick: Ostmitteleuropa seit 1989
1989 ging als Epochenjahr in die Geschichte Ostmitteleuropas ein. In diesem Jahr kam in allen Staaten der Region die Alleinherrschaft der Kommunisten zu einem Ende. Die Hintergründe für den friedlichen und unerwartet rasch ver-laufenden Zusammenbruch des Sozialismus in Osteuropa sind noch nicht ab-schließend erforscht. Sicher spielten wirtschaftliche Gründe eine Rolle. Die schlechte Versorgungslage und massive Einschnitte in das Alltagsleben der Bürger betrafen auch die administrativ-technischen Eliten, die maßgeblich für die konkrete Umsetzung der politischen Vorgaben und damit das Funktionie-ren des Systems insgesamt verantwortlich waren. Aufgrund der Mangelwirt-schaft wurde es für diese intermediäre Schicht immer schwieriger, die gegen-läufigen Ansprüche sowohl der politischen Führung als auch der Bevölkerung zu befriedigen. So entstanden überall Gruppierungen im Partei- und Staatsap-parat, die grundlegende Reformen befürworteten. Als die sowjetische Führung als Garantin der sozialistischen Regimes ihrerseits zu erkennen gab, dass sie einen fundamentalen Wandel der politischen und sozioökonomischen Ord-nung nicht verhindern würde, lenkten die Parteiführungen rasch aus Eigenini-tiative oder unter dem Druck der Straße ein und ermöglichten so den Über-gang zu einem demokratischen und marktwirtschaftlichen System. Die Systemtransformation stellte sich wie überall in Osteuropa nach anfäng-licher Euphorie über das friedliche Ende der Einparteiendiktatur schon bald als äußerst schwieriges Unterfangen heraus. Die wirtschaftlichen Altlasten wie hohe Verschuldung und marode Industrieanlagen, einseitige Ausrichtung
Teil C: Regionale Schwerpunkte
306
auf die Schwerindustrie und Monopolbetriebe, ineffiziente Arbeitsorganisation und das Ende der im Sozialismus praktizierten Abnahmegarantien erforderten einen radikalen Neuanfang. Die ostmitteleuropäischen Staaten trieben diesen in der Regel schneller und konsequenter voran als die Länder Südosteuropas oder der ehemaligen Sowjetunion (mit Ausnahme der baltischen Staaten). Doch forderten die Maßnahmen erhebliche Opfer von der Bevölkerung, deren Lebensstandard massiv sank. Soziale Sicherungsmaßnahmen wie die Garantie auf einen Arbeitsplatz wurden im Sinne des Übergangs von der Plan- zur Marktwirtschaft aufgehoben oder verloren wie etwa im Falle von Renten aus finanziellen Zwängen oder in Folge von Inflation ihre Existenz sichernde Funktion. Von der Verarmung waren daher die schwächsten Glieder der Ge-sellschaft, die bisher auf staatliche Unterstützung hatten zählen können, be-sonders betroffen: alte Menschen, wenig Gebildete oder in der Landwirtschaft tätige Personen. Von den neuen Freiheiten profitierte überall die ehemalige Nomenklatura (> Glossar), die sich schnell an die neuen Gegebenheiten an-passte und nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft eine führen-de Stellung behaupten konnte. Ehemalige kommunistische Kader trugen so aus Eigeninteresse den Umbau der Gesellschaft und die außenpolitische Neuausrichtung auf Westeuropa und die USA mit, was entscheidend für die schnelle Stabilisierung der «Reform-staaten» war. Wirtschaftlicher oder auch nationalistisch argumentierender Populismus, besonders etwa in der Slowakei oder Polen, wie auch heillos zer-strittene politische Eliten, die in Ungarn besonders deutlich ausgeprägt sind, vermochten am prinzipiellen Ziel, eine Gesellschaftsordnung nach dem west-europäischen Vorbild aufzubauen, nichts zu ändern. Mehrfache friedliche Machtwechsel und die zunehmende Rechtssicherheit schufen die Grundlagen für den Beitritt der ostmitteleuropäischen Länder in die nordatlantische Mili-tärallianz NATO 1999 bzw. 2004 und in die Europäischen Union. Nicht zufäl-lig nahm seit 1989 nach einem halben Jahrhundert der Zugehörigkeit zum «Ostblock» auch der Westen die Existenz einer europäischen Großregion «Ostmitteleuropa» wieder verstärkt wahr. Nun Teil der westeuropäischen poli-tischen, wirtschaftlichen und Wertegemeinschaft sind die Länder zwischen Adria und Ostsee aufgrund ihrer kulturellen Prägung und der Nachwirkungen des Sozialismus aber immer noch deutlich unterscheidbar von den Ländern Westeuropas.
2.3 Vertiefender Exkurs I: Landesbewusstsein und Adelskultur Die enge Verbindung von Landesbewusstsein und Adelskultur ist ein cha-rakteristisches Merkmal der ostmitteleuropäischen Geschichte. Zwar hingen beide Erscheinungen auch anderswo zusammen, doch kam ihnen selten eine
2. Ostmitteleuropa
307
derart prägende Funktion zu wie in den Ländern Ostmitteleuropas. Die stän-disch geprägten Gesellschaftsstrukturen, die sich im Spätmittelalter heraus-gebildet hatten, blieben hier teilweise bis ins 20. Jahrhundert bedeutsam. Sie können als eine der charakteristischsten Eigenschaften des östlichen Mittel-europa angesehen werden, die wesentlich zur Konstituierung dieses Raumes als eigenständiger europäischer Geschichtslandschaft beigetragen haben. Eine bedeutende Rolle spielten dabei Heiligenkulte um Herrscher aus den jeweiligen Dynastien. In Böhmen und Ungarn entwickelte sich die religiös aufgeladene Herrscherverehrung zu einem zentralen Bestandteil des Landes-bewusstseins. Die Verehrung des böhmischen Fürsten Wenzel (Václav, ca. 921–929/35), die schon kurz nach seinem Tod eingesetzt hatte, wurde im 11. Jahrhundert von der Dynastie der Přemysliden für die Legitimation ihrer Herrschaft in Anspruch genommen. Im 13. Jahrhundert verschob sich die Be-deutung Wenzels von einem die Dynastie repräsentierenden Heiligen zu einem Landespatron. Die Verehrung löste sich nun von der Bindung an das Herr-scherhaus und wurde ein identitätsstiftendes Element des Landesbewusstseins. Hand in Hand damit ging die Aufteilung der Herrschaft zwischen König und Adel, der sich im 13. Jahrhundert als korporativer Stand formierte und das Selbstverständnis, eigentlicher Träger des Landes zu sein, pflegte. Wenzel wurde nun als Beschützer Böhmens verehrt und half so mit, die Vorstellung vom Land als vom König gelöste institutionalisierte Größe, die vom Adel repräsentiert wurde, zu festigen. 1347 fand erstmals die sogenannte Wen-zelskrone bei der Königskrönung Verwendung. Die Krone wurde nun zum Symbol des Landes und der Heilige Wenzel zum Inhaber der Herrschaft er-nannt. Der jeweils regierende Monarch aber erhielt mit der Krönung die Ver-waltung des Landes anvertraut, so dass er seine Herrschaft nicht mehr aus eigener Machtvollkommenheit ausübte, sondern dank Verleihung durch den Adel. Eine noch deutlicher ausgeprägte Vorstellung der Übertragung der Herr-schaftskompetenz vom Adel an den König entstand in Ungarn. Hier wurde der Stephanskrone, die angeblich bereits von Stephan dem Heiligen (997–1038) getragen worden sein soll, tatsächlich aber erst viel später entstanden ist, eine heilige Kraft zugesprochen. Doch obschon die Krone erst lange nach Stephans Tod angefertigt worden war, sollte es seit dem 13. Jahrhundert ausschlaggebend für jeden Thronanwärter sein, sich mit der vermeintlich echten Krone Stephans krönen zu lassen. Nur wem dies gelang, galt als legi-timer Herrscher. Jedoch rückte die Krone in ihrer materiellen Form als Kopfschmuck schon bald in den Hintergrund. Vielmehr setzte der Adel die Vorstellung durch, wonach er selber als Inhaber der Krone über die eigentli-che Machtkompetenz verfüge, ja am Ende des Mittelalters bezeichnete sich der Adel gar selber als «Glieder der Heiligen Krone». Die Krone stellte so die Verkörperung der abstrakten Herrschaftsgewalt des Adels dar. Die Ver-
Teil C: Regionale Schwerpunkte
308
leihung der Krone an einen König wurde daher als Übertragung der Verfü-gungsgewalt über das Land interpretiert. Dadurch wurde ein vertragsähnliches Verhältnis zwischen Adel und König begründet, der sich als Sachwalter auf die Wahrung der Landes- und damit der Adelsinteressen zu verpflichten hatte. In Polen wurde im 14. Jahrhundert die ungarische Vorstellung der Krone als Verkörperung des Landes übernommen. Hier erfüllte die Idee von der Krone zusätzlich die Funktion einer inneren Konsolidierung des Landes, das nach dem Zerfall in Teilfürstentümer eben erst wieder geeint worden war. Ein polnischer Herrscherheiliger wie Wenzel oder Stephan existierte nicht, doch spielte hier der auch in Böhmen verehrte Heilige Adalbert (Wojciech), der bei Missionierungsversuchen der Prussen Ende des 10. Jahrhunderts den Märtyrertod erlitten hatte, eine vergleichbare Rolle als Landespatron. Seit dem späten 12. Jahrhundert gesellte sich dazu der Kult um den Heiligen Stanisław, Bischof von Krakau in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Die Vereh-rung der beiden Heiligen als Integrationsfiguren half während der Zeit des Zerfalls in Teilfürstentümer dabei, die Erinnerung an ein geeintes Polen und den Wunsch, die Einheit wiederherzustellen, aufrecht zu erhalten. Im 15. Jahr-hundert entwickelte sich Częstochowa (Tschenstochau) zu einem herausra-genden Wallfahrtsort. Die Schwarze Madonna im dortigen Paulinerkloster Jasna Góra erlangte als Heiligtum endgültig gesamtpolnische Bedeutung, als das Kloster 1655 erfolglos durch schwedische Truppen belagert wurde. Die erfolgreich überstandene Belagerung gegen die zahlenmäßige Übermacht wurde als Wunder interpretiert und trug landesweit zu einer patriotischen Mobilisierung gegen die evangelischen Schweden bei. Im Gedenken an die-ses Ereignis und im Zuge der Gegenreformation wurde das Marienbild von Częstochowa 1717 gar als Schutzpatronin des Landes zur Königin Polens gekrönt. Die enge Verbindung zum Katholizismus ist seither ein Grundbe-standteil des polnischen Landesbewusstseins und später der polnischen Nati-onalbewegung. Noch während der kommunistischen Zeit stellte das Be-kenntnis zur katholischen Kirche einen wirkmächtigen Ansatzpunkt für Wi-derstand gegen das Regime dar, das durch die Wahl des Polen Karol Wojtyła (Johannes Paul II.) zum Papst 1978 zusätzlichen Auftrieb erhielt. Die im Spätmittelalter in den drei ostmitteleuropäischen Königreichen Form annehmende Vorstellung der Krone als materielles Sinnbild des Landes und seiner Adelsschicht war ein Zeichen für die zunehmend abstrakter werdende Vorstellung von Herrschaft. Wurde sie anfänglich noch als hierarchisch strukturierter Personenverband gesehen, mit dem König an der Spitze, setzte sich im politischen Leben immer mehr eine als transpersonale Staatsvorstel-lung bezeichnete Sichtweise durch. Ausgangspunkt der Herrschaft bildete dabei nicht mehr die persönliche Machtausübung durch den Herrscher über seine Untertanen, sondern in einem allgemeineren Sinn das von diesem ge-löste Land bzw. das Königreich als eigenes Rechtssubjekt. Die Königswürde
2. Ostmitteleuropa
309
erhielt damit die Eigenschaften eines Amtes, in das ein Herrscher ein- und notfalls auch wieder abgesetzt werden konnte. Ähnlich wie Bischöfe ihr Amt als Verwalter einer abstrakten Institution Kirche bekleideten, wurden auch die Könige nun in eine unabhängig von ihrer Person existierende Struktur eingebunden und waren nicht mehr gleichsam Eigentümer des Landes. Aus-druck fand diese transpersonale Staatsvorstellung in der Formulierung der «Krone des Reiches» (corona regni), die inhaltlich als Vorläuferin des mo-dernen Staatsbegriffes betrachtet werden kann. In Polen fand seit dem aus-gehenden Mittelalter der Begriff der res publica (poln. Rzeczpospolita) brei-tere Verwendung, während vor allem in Ungarn die Krone ein Symbol für die Stellung des Landes als eigenständige Einheit bedeutsam blieb. In Böh-men diente der Begriff der Krone des Reiches dazu, die unterschiedlichen Besitzungen des böhmischen Landesherrn (das eigentliche Böhmen inklusi-ve seiner Nebenländer Mähren, Lausitz, Schlesien) zusammenzufassen. Die Vorstellung vom Land als eigenständiger Größe ermöglichte es dem Adel in allen drei Ländern, sich allmählich aus der Abhängigkeit vom König zu lö-sen und selber als eigentlicher Träger der politischen Institutionen und Rep-räsentant des Landes aufzutreten. Als einigendes Band des Adels erwies sich in allen drei Ländern das ge-meinsame Interesse, die eigene Vorrangstellung gegen auswärtige Edelleute zu verteidigen. Insbesondere nach dem Aussterben der einheimischen Dy-nastien der ungarischen Arpaden (1301), böhmischen Přemysliden (1306) sowie der polnischen Piasten (1370) brachten die neuen Könige in ihrem Gefolge Bedienstete von außerhalb der Landesgrenzen mit. Dieser Praxis setzte der Landesadel massiven Widerstand entgegen und festigte damit das ständische Landesbewusstsein als Mittel im Konflikt mit den Fremden. Be-sonders prägend wurden vornationale Auseinandersetzungen in Böhmen mit dem Gegensatz zwischen den beiden großen Sprachgruppen des Landes, den Tschechen auf der einen und den Deutschen, die vor allem im städtischen Bürgertum stark vertreten waren, auf der anderen Seite. Die «nationalen» Interessen richteten sich nicht nur gegen die landesfremden Personen im Gefolge der Könige, sondern führten auch zu Konflikten mit dem deutsch-sprachigen Stadtbürgertum. Schon im Spätmittelalter bahnte sich hier ein Sprachenstreit zwischen Deutsch- und Tschechischsprachigen an. Im Zent-rum der Spannungen stand dabei unter anderem die 1348 gegründete Uni-versität Prag (die erste in Mitteleuropa, vor Krakau 1364, Wien 1365, Fünf-kirchen/Pécs 1367, Buda 1389, Pressburg/Bratislava 1467 oder Vilnius 1579), die zu einem Ausgangspunkt der hussitischen (> Glossar) Bewegung des 15. Jahrhunderts wurde. Diese auf den tschechischen Reformator Johan-nes Hus (ca. 1370–1415) zurückgehende Bewegung vereinte religiöse, sozia-le und vormodern-nationale Ziele und weitete sich seit 1419 zu einem regel-rechten Aufstand mit langjährigen, heftigen Kämpfen aus. Das Gedenken an
Teil C: Regionale Schwerpunkte
310
Hus blieb auch nach dem Abflauen der Hussitenkriege ein wichtiges Ele-ment des böhmischen Landesbewusstseins. Eine ethnische Aufladung ständisch-sozialer Unterschiede lässt sich in ei-nem anderen Kontext in Polen beobachten. Die Szlachta (> Glossar) pflegte als verbindenden Mythos die Idee einer gemeinsamen Herkunft. Die adligen Männer sahen sich dabei als Nachfahren der antiken Sarmaten, eines irani-schen Stammesverbandes, der in den Steppen nördlich des Schwarzen Meeres gelebt hatte. Damit deutete der Adel die herrschende soziale Ordnung, die ihm eine weitreichende Verfügungsgewalt über die untertänigen Bauern in die Hand gab, in Kategorien der Abstammung. Während sich die Adligen in der Tradition einer kriegerischen Herrenschicht von den Sarmaten herleiteten, wurden gleichzeitig die (slawischen) Bauern von der gemeinsamen Identität ausgeschlossen. Der im ausgehenden Mittelalter durch den Humanismus auf-kommende, besonders in der Frühen Neuzeit sehr populäre Sarmatismus blieb bis zum Untergang Polens Ende des 18. Jahrhundert ein zentraler Referenz-punkt adligen Selbstbewusstseins. In bildender Kunst, Literatur und nicht zu-letzt auch in der Kleidung und Haartracht kultivierten die Angehörigen der Szlachta das bewusst exotisierende Bild der orientalischen Reiterkrieger, um so dem besonderen Stellenwert ihres Standes Ausdruck zu verleihen. Teils vergleichbar mit dem polnischen Sarmatismus führten sich ungarische Adlige auf eine skythisch-hunnische Herkunft zurück, mit der sie ihre gesellschaftli-che Vorrangstellung zu begründen suchten. Die im 18. Jahrhundert aufgrund sprachwissenschaftlicher Erkenntnisse festgestellte finno-ugrische (> Glos-sar) Herkunft der Magyaren stieß daher anfänglich auf heftige Ablehnung bei der gesellschaftlichen Elite und wurde erst allmählich akzeptiert. Das vom Adel am Leben gehaltene Landesbewusstsein stellte sich besonders in Zeiten der Aufteilung des Landes als bedeutungsvoll heraus. In Polen war dies bereits im Hochmittelalter in der Phase des Zerfalls in Teilfürstentümer der Fall gewesen. Als Polen Ende des 18. Jahrhunderts unter den drei be-nachbarten Großmächten aufgeteilt wurde, war das adlige Landesbewusst-sein eine Keimzelle der nun einsetzenden Nationsbewegung, die sich die Wiederherstellung eines geeinten Landes zum Ziel setzte. In Ungarn waren es während der Dreiteilung im 16. und 17. Jahrhundert der Klein- und Mit-teladel, der sich als Inhaber der Herrschaftsgewalt verstand und so den Ge-danken an die Einheit des dreigeteilten Landes aufrechterhielt. Diverse Ver-suche, Ungarn unter adliger Führung zu einen, scheiterten zwar am Wider-stand der Osmanen und insbesondere der Habsburger. Doch die starke Adelsopposition kämpfte auch nach der Eingliederung des ganzen Landes in das Habsburger Reich für die Einheit aller Länder innerhalb der Donaumo-narchie, die im Mittelalter der ungarischen Krone unterstanden hatten.
2. Ostmitteleuropa
311
2.4 Vertiefender Exkurs II: Mittelalterliche Ostsiedlung Unter dem Begriff der mittelalterlichen bzw. deutschen Ostsiedlung werden eine Reihe von Prozessen zusammengefasst, die seit dem ausgehenden Frühmittelalter bis ins 14. Jahrhundert zu einer erheblichen Erweiterung des deutschsprachigen Siedlungsgebietes nach Osten und damit eng verknüpft zum Transfer rechtlicher und kultureller Traditionen in diesen Raum führten. Am östlichen und südöstlichen Saum des fränkischen Reiches können Vor-läufer der späteren Ostsiedlung schon ins 9. Jahrhundert zurückverfolgt wer-den. In den folgenden Jahrhunderten weitete sich das Verbreitungsgebiet der deutschen Sprache sukzessive auf die östliche Hälfte des heutigen Deutsch-land und auf das heutige Österreich aus. Von dort gerieten seit dem 10. und 11. Jahrhundert der slawisch besiedelte Ostalpenraum sowie die Gebiete Po-lens, Böhmens und Ungarns in den Einzugsbereich der Deutschen Ostsied-lung, die ihren Höhepunkt im 12. und 13. Jahrhundert erreichte. Das Versiegen des Zustroms aus Westen im 14. Jahrhundert hing insbesondere mit den Pest-epidemien in der Mitte des Jahrhunderts zusammen. Die Bevölkerungsdichte im Westen nahm ab und machte ein Ausweichen in dünner besiedelte Regio-nen des Ostens überflüssig. Nicht zu verwechseln mit der mittelalterlichen Deutschen Ostsiedlung ist die neuzeitliche Ansiedlung von Deutschen im öst-lichen Europa. Im 18. und 19. Jahrhundert entstanden vor allem im Süden Ungarns (Donauschwaben) und im Russländischen Reich (Russlanddeut-sche) durch Kolonisation neue deutsche Siedlungsschwerpunkte. Unter den Kolonisten, die der mittelalterlichen Ostsiedlung zuzurechnen sind, befanden sich nicht ausschließlich deutschsprachige Siedler, auch wenn diese die größte Gruppe bildeten, sondern ebenfalls Italiener, Wallonen, Flamen, Dänen und Personen anderer Herkunft aus dem Heiligen Römischen Reich und seiner Randgebiete. In den zeitgenössischen Quellen werden sie oft zusammenfassend als hospites (Gäste) bezeichnet. Im mittelalterlichen Ungarn, Bosnien und Serbien tauchten sie als saxones (Sachsen) auf, was auf ihre privilegierte Rechtsstellung (ursprünglich sächsisches Bergrecht) und nicht die Herkunft verweist. Doch auch die lokalen Bevölkerungen slawi-scher oder magyarischer Herkunft wurden mit der Zeit durch Binnenkoloni-sation in diesen Ansiedlungsprozess einbezogen, der vor allem durch die privilegierte rechtliche Situation der Kolonisten gekennzeichnet war. Daher wird anstelle des Begriffes «Deutsche Ostsiedlung» passender von einer Kolonisation nach deutschem Recht gesprochen. Die Ansiedlung erfolgte nicht nach einem zentral gesteuerten Plan, sondern verlief dezentral und aus verschiedenen Motiven. Es gab spontane Ansied-lungen, jedoch ging die Initiative häufig von den Landes- und Grundherren der neuen Herrschaftsgebilde in Ostmitteleuropa aus. Diese waren an der gezielten Anwerbung von Menschen interessiert, um die Zahl der Arbeits-
Teil C: Regionale Schwerpunkte
312
kräfte und der Steuerzahler in den dünn besiedelten Ländern zu erhöhen. Nur so konnten die großen ungenutzten Landreserven urbar gemacht werden. Viele Städtegründungen des Hoch- und Spätmittelalters in Ostmitteleuropa gehen gleichfalls auf die Anwerbung von Siedlern aus den westlichen Teilen des Heiligen Römischen Reiches zurück. Die Zuwanderer brachten neue Techniken in der Landwirtschaft (Eisenpflug, Dreifelderwirtschaft), dem Bergbau oder dem Handwerk in ihre neue Heimat mit und trugen auch so nicht unerheblich dazu bei, die wirtschaftliche Grundlage der ostmitteleuro-päischen Reiche zu konsolidieren. Darüber hinaus waren Kaufleute und Klöster an der Kolonisation beteiligt. Neben dem Landesausbau spielte viel-fach der Grenzschutz eine Rolle bei der Anwerbung. Die Einwanderer ihrerseits profitierten etwa von Steuer- und Rechtsprivile-gien oder erhielten Land zugeteilt, was angesichts der relativen Überbevöl-kerung ihrer Herkunftsgebiete ein nicht zu unterschätzender Vorteil war. Die Ansiedlung geschah häufig durch Vermittlung sogenannter Lokatoren, die im Namen der Landes- oder Grundherrn gezielt Auswanderungswillige im Westen anwarben und die praktische Abwicklung der Einwanderung organi-sierten. Für die Könige waren die Kolonisten etwa für den Bergbau von spe-ziellem Interesse, da sie durch ihre Kenntnisse hoch geschätzte Fachleute waren. Doch auch die Kolonisten, die im Rahmen der bäuerlichen Ansied-lung nach Osten gekommen waren, erhielten weitreichende Privilegien. Sie waren persönlich frei und verfügten über umfangreiche Autonomie, etwa in Form einer eigenen Gerichtsbarkeit oder der freien Pfarrwahl. Solche An-siedlungen von Bauern und Bergleuten sind vor allem für Polen (seit dem späten 12. Jhd.), Böhmen und Ungarn, hier speziell Siebenbürgen und das Gebiet der Zips in der heutigen Slowakei, charakteristisch. Ein grundlegend anderes Muster der Kolonisation nach deutschem Recht stellt die meist mit Missionsbestrebungen verknüpfte Eroberung dar, die sich manchmal mit der erwähnten bäuerlichen und städtischen Siedlung überla-gerte. Die mit dem Schwert geführte «Heidenmission» war vor allem für den Ostseeraum (Preußen und das Baltikum) kennzeichnend, wo Ritterorden die treibende Kraft des Landesausbaus wurden. Eine bäuerliche Siedlung ist hier kaum zu beobachten, hingegen trugen Kaufleute maßgeblich zur Entstehung von Städten im Baltikum bei. Im Ost-West-Handel zwischen Norddeutsch-land und Russland kam diesen im Spätmittelalter im Rahmen der Hanse die Rolle einer Drehscheibe zu. Die deutschrechtliche Siedlungsbewegung prägte die historischen Land-schaften Ostmitteleuropas nachhaltig. Sie erfasste in unterschiedlicher Inten-sität ein Gebiet, das vom Finnischen Meerbusen im Norden bis weit nach Südosteuropa etwa zu den Bergwerken Kosovos reichte. Besonders nachhal-tig erwies sich die Kolonisation nach deutschem Recht in Ungarn, Böhmen,
2. Ostmitteleuropa
313
Polen und Livland. Dabei ist nicht allein an die Ausbreitung deutschsprachi-ger Gruppen zu denken, die teilweise bis ins 20. Jahrhundert in weitgehend kompakten deutschen Sprachinseln lebten. Noch viel bedeutender waren die Übernahmen im rechtlichen, technischen und kulturellen Bereich. Namentlich das (deutsche, insbesondere das Magdeburger) Stadtrecht verbreitete sich so seit dem 13. Jahrhundert bis weit nach Osten und erreichte schließlich die Gebiete des heutigen Weißrussland und der westlichen Ukraine. Die Privile-gien für die Zuwanderer aus dem Westen wirkten sich auch auf die ansässige Bevölkerung aus, deren Rechtsstatus verbesserte sich zumindest vorüberge-hend wesentlich. Die enge kulturelle Verbundenheit der deutschsprachigen Siedler Ostmitteleuropas mit dem mitteleuropäischen Raum übte eine Kataly-satorfunktion auf diese Regionen aus. Als Vermittler westeuropäischer Ent-wicklungen hatten Deutsche nicht geringen Anteil an der Herausbildung der historischen Großregion Ostmitteleuropa. So nahmen die deutschsprachigen Gruppen dieses Raumes während der Reformation praktisch durchweg das lutherische Glaubensbekenntnis an. Die hiervon ausgehenden Impulse waren mit verantwortlich für die Entstehung oder Verbreitung des Schrifttums in den Volkssprachen, so bei den Rumänen, Litauern, Letten oder Esten. In der älteren Historiografie sind die deutsche Ostsiedlung und die daraus hervorgehenden «deutschen Kulturleistungen» oft in rassistischer Sicht als Überlegenheit gegenüber den osteuropäischen Völkern interpretiert worden. Diese Perspektive reduziert jedoch den Blick in unzulänglicher Weise, in-dem die komplexen kulturellen Austauschbeziehungen einseitig als Ver-dienst der «Deutschen» angesehen werden. Abgesehen davon, dass eine einheitliche Deutsche Nation im Mittelalter nicht existierte und die vermit-telten Innovationen unterschiedlicher Herkunft waren, wäre die historische Wirkung der Siedlung nach deutschem Recht ohne die Beteiligung, ja häufig der Initiative und Privilegiengewährung auf ostmitteleuropäischer Seite un-denkbar gewesen.
2.5 Vertiefender Exkurs III: Juden in Ostmitteleuropa Von ihrer Bedeutung für das Erscheinungsbild der historischen Landschaften Ostmitteleuropas mit den Deutschen vergleichbar sind die Juden. Obwohl vereinzelt schon früher belegbar, entstanden jüdische Gemeinschaften in größerer Zahl seit dem 13. Jahrhundert. Wesentlich waren dabei die Privile-gien, die ihnen die Könige Ungarns, Böhmens und Polens gewährten – die jüdische Ostwanderung war hier Teil der deutschrechtlichen Ostkolonisati-on. Im Allgemeinen konnten die Juden ihren Glauben frei ausüben, einer systematischen Verfolgung waren sie nicht unterworfen. Zwar wurden Juden Opfer gelegentlicher Pogrome, insbesondere mit der Begründung, sie wür-den Seuchen verbreiten oder in Kriegszeiten Verrat begehen. Im Vergleich
Teil C: Regionale Schwerpunkte
314
mit den Judenverfolgungen, die im westlichen Europa im Spätmittelalter zur Auflösung und Auswanderung der jüdischen Gemeinschaften führten, waren die Übergriffe in Ostmitteleuropa jedoch seltener und deren Folgen weniger nachhaltig. In England und Frankreich waren die Juden schon seit dem spä-ten 13. Jahrhundert ausgewiesen worden, in Deutschland wurden sie vor allem seit den Pestepidemien in der Mitte des 14. Jahrhunderts, die den Ju-den angelastet wurde, systematisch vertrieben. In Böhmen führten im 15. Jahrhundert die Hussitenkriege zu antijüdischen Verfolgungen, wodurch sich viele Juden veranlasst sahen zu fliehen. Polen wurde dabei bevorzugtes Ziel der Flüchtlinge aus dem Westen, da die Könige den Juden umfangreiche Rechtsprivilegien und religiöse Toleranz zusicherten. Durch die Ausdehnung regionaler Rechte unter Kasimir III. dem Großen (1333–1370) auf das ganze Land (und später auch auf Litauen) er-hielten die Juden im Spätmittelalter eine Sonderstellung mit eigener Ge-richtsbarkeit, Selbstverwaltung ihrer Gemeinden sowie Handelserlaubnis, die sie im Wesentlichen bis zum Untergang der Adelsrepublik Ende des 18. Jahrhunderts behalten sollten. Der König profitierte seinerseits von Ab-gaben, welche die Juden an ihn zu entrichten hatten. Juden waren in Polen auch deshalb willkommen, weil sie häufig Tätigkeiten vor allem im dritten Wirtschaftssektor ausübten, auch in Bereichen, in denen Christen sich aus religiösen Gründen nicht betätigen wollten oder konnten. So arbeiteten Ju-den als Kaufleute, Verwalter, Pächter von Abgaben oder Adelsgütern, Geld-verleiher oder Betreiber von Wirtshäusern und besetzten damit eine wichtige Schaltstelle zwischen Adel, Städten und Bauern. Die Arbeitsteilung entsprach dem Prinzip einer ständischen Gesellschaft, in der die verschiedenen Tätigkeitsfelder korporativ organisierten und klar ab-gegrenzten Gruppen übertragen wurden: die Kriegsführung und Landesver-waltung dem Adel, verarbeitende Tätigkeiten den städtischen Bürgern, die Versorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs den Bau-ern. Die Juden konnten in diesem Gesellschaftsgefüge eine Nische füllen. Das relativ geringe Gewicht der Städte und damit von Bürgern als einer Zwischenschicht zwischen Adel und Bauern trug mit dazu bei, dass sich in Polen-Litauen ein erheblicher gesellschaftlicher Spielraum für Personen jüdischer Herkunft öffnete. Hierin sind die Juden Ostmitteleuropas mit Gruppen wie etwa den Armeniern und Griechen im Osmanischen Reich vergleichbar, die ebenfalls im Handel und der Verwaltung wertvolle Dienste leisteten. Anders als bereits zeitgenössische antijüdische Anfeindungen wie auch später der moderne Antisemitismus es wahrhaben wollten, hatten die Betätigungsfelder der Juden nicht mit jüdischer Identität als solcher zu tun, sondern entstanden aus Anpassung an die Umstände. Zum Geldverleih etwa wurden die Juden, in Polen wie anderswo, anfänglich gezwungen, später zum Teil dann wieder daraus verdrängt, als Christen ihre religiösen Vorbe-
2. Ostmitteleuropa
315
halte diesbezüglich angesichts der lukrativen Verdienstmöglichkeiten aufga-ben. Davon abgesehen fanden die polnischen Juden auch in anderen Berei-chen ein Auskommen, so im Handwerk oder in der Landwirtschaft. Die Städte und insbesondere die Zünfte wehrten sich zwar heftig gegen die unerwünschte Konkurrenz, aber da sowohl der König und insbesondere der hohe Adel auf die Dienste von Juden angewiesen waren, hatten sie damit geringen Erfolg. Zwischen dem Adel und den Juden entwickelte sich eine gegenseitig vorteil-hafte enge Beziehung. Vielerorts wurden die Juden zwar gezwungen, sich in separaten Vierteln oder außerhalb der Stadt anzusiedeln, ohne dass jedoch geschlossene Siedlungen entstanden wären. Erst im 19. Jahrhundert, als ver-armte Juden vom Land in großer Zahl in die Städte zogen, entstanden vieler-orts Ghettos. Die Mehrzahl der ostmitteleuropäischen Juden stammten aus den deutschspra-chigen Gebieten und werden kulturell daher dem aschkenasischen (> Glos-sar) Kulturkreis zugerechnet. Die Einwanderer brachten eine Sprache auf der Grundlage oberdeutscher Dialekte mit hebräischen Elementen, das Jiddische, in ihre neue Heimat. Vor Ort erfuhr die jiddische Sprache sprachliche Beein-flussungen durch die lokalen slawischen Sprachen. Der Zuzug von Juden in die polnisch-litauische Adelsrepublik hielt auch in der Frühen Neuzeit an. Durch Binnenwanderung wurden immer mehr die östlichen Landesteile Polen-Litauens zum Siedlungsschwerpunkt, da hier das Städtewesen noch viel weni-ger entwickelt war als weiter westlich und die adligen Großgrundbesitzer die-ser Gegend auf die Dienste jüdischer Pächter und Verwalter nicht verzichten konnten. Juden wanderten aber auch über die Landesgrenzen hinaus in die benachbarten Länder. Besonders seit den Teilungen Polens Ende des 18. Jahr-hunderts erfasste die jüdische Binnenwanderung, nun innerhalb der Teilungs-mächte, vermehrt Regionen, die nie zu Polen-Litauen gehört hatten. Im 18. und 19. Jahrhundert stieg so der jüdische Bevölkerungsanteil in Ungarn, der Bukowina und Bessarabien, aber auch in dem unter osmanischer Oberhoheit stehenden rumänischen Fürstentum Moldau zum Teil massiv. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten die unter der Fremdbezeichnung «Ostjuden» zusam-mengefassten, ursprünglich aus Polen-Litauen stammenden jüdischen Grup-pen ihre größte territoriale Ausdehnung erreicht, die sich über weite Teile Ostmitteleuropas und angrenzender Regionen erstreckte (> Karte 4, S. 374, siehe Verbreitungsgebiet der jiddischen Sprache). Neben einer relativ kleinen Oberschicht, die über Wohlstand verfügte, gab es die große Masse, die in äußerst bescheidenen Verhältnissen wenn nicht sogar bitterem Elend lebte. Gerade die Juden Osteuropas führten im 19. und 20. Jahrhundert, als sie im Rahmen des auch wirtschaftlich argumentierenden Antisemitismus Anfeindungen und Pogromen bis hin zum Genozid ausge-setzt waren, überwiegend ein Leben in Armut – der reiche Kaufmann oder Industrielle war hier die Ausnahme, nicht die Regel. Die nicht zuletzt von
Teil C: Regionale Schwerpunkte
316
ökonomischem Neid genährten Vorurteile gegenüber Juden rührten unter anderem daher, dass in Ostmitteleuropa vormoderne Gesellschaftsstrukturen noch bis ins 20. Jahrhundert nachwirkten. Juden waren daher in gewissen Bereichen überproportional vertreten. Im westlichen Europa übten im Zuge der Modernisierung Christen diejenigen Funktionen aus, die im Osten als jüdische Domänen galten. Das geringe Gewicht der Städte und die hohe Anzahl Adliger hatten die Juden bis ins 18. Jahrhundert zu einem unverzicht-baren Teil der Gesellschaft gemacht. Wenn sich das Bürgertum in der Frühen Neuzeit im westlichen Europa immer mehr gesellschaftliche Bereiche er-schloss, erfüllten im Osten Juden solche Funktionen. Geldgeschäfte etwa wur-den lange Zeit Juden überlassen, die entweder selbstständig oder im Namen von Adligen agierten. Daher erstaunt es wenig, dass es überdurchschnittlich oft Juden waren, die über das notwendige Kapital verfügten, um Investitionen etwa in der Industrie zu tätigen. Erst im 19. Jahrhundert begannen verarmte Adlige und eine sich bildende Schicht von städtischen Bürgern und Intellektu-ellen, sich vermehrt in diesen Bereichen zu engagieren. Juden wurden damit zur ungeliebten Konkurrenz und immer mehr aus ihren Positionen verdrängt. Der gesellschaftliche Wandel ließ die von Juden ausgefüllten Nischen schrumpfen oder gar verschwinden und trug damit zur massenhaften Verar-mung bei. Die Präsenz von Juden prägte die ostmitteleuropäische Geschichtslandschaft seit dem Spätmittelalter und bis ins 20. Jahrhundert hinein entscheidend mit. In vielen Städten, vor allem in kleineren, stellten Juden im frühen 20. Jahr-hundert eine relative oder sogar absolute Bevölkerungsmehrheit. Durch den Glauben und die eigene jüdische Kultur unterschieden sie sich deutlich von ihrer Umgebung, doch durch Mehrsprachigkeit und Akkulturation passten sie sich vielfach zumindest gegen außen sprachlich an die Mehrheitsbevölke-rung an. Die stark magyarisierten ungarischen Juden sind ein typisches Bei-spiel hierfür. Deutsch schreibenden ostmitteleuropäischen Juden verdankt die deutsche Literatur eine ganze Reihe bedeutender Autoren wie Franz Kaf-ka, Joseph Roth oder Paul Celan. Doch mit dem Holocaust (> Glossar) kam die jüdische Präsenz in Ostmitteleuropa nahezu zum Erliegen. Der größte Teil der Juden war geflüchtet oder in den nationalsozialistischen Vernich-tungslagern ermordet worden. Von den Überlebenden wanderten viele in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel oder in die USA aus. Um die Mitte des 20. Jahrhunderts war damit aus völlig unterschiedlichen Gründen mit den Deutschen und den Juden die Präsenz zweier Gruppen zu Ende gegangen, die nachhaltig zur Konturierung Ostmitteleuropas als eigen-ständiger historischer Region innerhalb Europas beigetragen hatten.
2. Ostmitteleuropa
317
Literatur zum Abschnitt C.2: Ostmitteleuropa Ostmitteleuropa allgemein, übergreifende Themen Aleksiun, Natalia; Beauvois, Daniel; Kłoczowski, Jerzy et al.: Histoire de l’Europe du Centre-Est, Paris 2004.
Auerbach, Inge: Stände in Ostmitteleuropa. Alternativen zum monarchischen Prinzip in der frühen Neuzeit, Litauen und Böhmen, München 1997.
Bahlcke, Joachim: Unionsstrukturen und Föderationsmodelle im Osten des ständischen Euro-pa. Anmerkungen zu vergleichenden Ansätzen über das frühneuzeitliche Ostmitteleuropa, in: Comparativ 8/5 (1998), S. 57–73.
Bahlcke, Joachim; Strohmeyer, Arno (hrsg.): Die Konstruktion der Vergangenheit: Ge-schichtsdenken, Traditionsbildung und Selbstdarstellung im frühneuzeitlichen Ostmitteleuro-pa. Berlin 2002.
Conze, Werner: Ostmitteleuropa. Von der Spätantike bis zum 18. Jahrhundert, München 1992.
Conze, Werner; Boockmann, Hartmut et al. (Hrsg.): Deutsche Geschichte im Osten Europas, Berlin 1993–1999 (10 Bände).
Curta, Florin (Hrsg.): East Central and Eastern Europe in the Early Middle Ages. Ann Arbor 2005.
Dygo, Marian; Gawlas, Sławomir; Grala, Hieronim (Hrsg.): Ostmitteleuropa im 14.–17. Jahr-hundert – eine Region oder Region der Regionen? Warszawa 2003.
Font, Márta: Mitteleuropa – Osteuropa – Ostmitteleuropa? Bemerkungen zur Entstehung einer europäischen Region im Frühmittelalter, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 7 (2006), S. 101–125.
Götz, Norbert; Hackmann, Jörg; Hecker-Stampehl, Jan (Hrsg.): Die Ordnung des Raums. Mentale Landkarten in der Ostseeregion, Berlin 2006.
Halecki, Oscar: Jadwiga of Anjou and the Rise of East Central Europe, Boulder 1991.
Haumann, Heiko: Geschichte der Ostjuden, München 41998.
Herbers, Klaus; Jaspert, Nikolas: Grenzräume und Grenzüberschreitungen im Vergleich. Der Osten und der Westen des mittelalterlichen Lateineuropa, Berlin 2007.
Higounet, Charles: Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter, München 1990.
Hroch, Miroslav: Ethnonationalismus – eine ostmitteleuropäische Erfindung? Leipzig 2004.
Johnson, Lonnie R.: Central Europe. Enemies, Neighbors, Friends, New York 22002.
Kirschbaum, Stanislav J.: Historical reflections on Central Europe. Selected papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies, Basingstoke 1999.
Kłoczowski, Jerzy: East Central Europe in the Historiography of the Countries of the Region, Lublin 1995.
Lemberg, Hans (Hrsg.): Grenzen in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Aktuelle Forschungsprobleme, Marburg 2000.
Lübke, Christian: Das östliche Europa, München 2004.
Teil C: Regionale Schwerpunkte
318
Lübke, Christian: Mitteleuropa, Ostmitteleuropa, östliches Europa. Wahrnehmung und Struk-turen im frühen und hohen Mittelalter, in: Themenportal Europäische Geschichte (2006) http://www.europa.clio-online.de/2006/Article=173.
Piskorski, Jan M.: Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters in der Entwicklung des östlichen Mitteleuropa, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 40 (1991), S. 27–84.
Sugar, Peter F.; Treadgold, Donald W. (Hrsg.): A History of East Central Europe, Seattle u.a. 1974– [bisher erschienen Band 1, 3–9].
Szücs, Jenö: Die drei historischen Regionen Europas, Frankfurt/M. 1990.
Urbańczyk, Przemysław (Hrsg.): Origins of central Europe, Warszawa 1997.
Wandycz, Piotr S.: The Price of Freedom. A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present, London, u.a. 1992.
Weithmann, Michael W.: Die Donau. Ein europäischer Fluss und seine 3000-jährige Ge-schichte, Regensburg 2000.
Wieczorek, Alfried; Hinz, Hans-Martin (Hrsg.): Europas Mitte um 1000. 3 Bände, Stuttgart 2000.
Willoweit, Dietmar; Lemberg, Hans (Hrsg.): Reiche und Territorien in Ostmitteleuropa. Histo-rische Beziehungen und politische Herrschaftslegitimation, München 2006.
Böhmische Länder, Tschechoslowakei, Tschechien, Slowakei Alexander, Manfred: Kleine Geschichte der böhmischen Länder, Stuttgart 2008.
Bartl, Július et al. (Hrsg.): Lexikon der slowakischen Geschichte, Bratislava 2002.
Begert, Alexander: Böhmen, die böhmische Kur und das Reich vom Hochmittelalter bis zum Ende des Alten Reiches. Studien zur Kurwürde und zur staatsrechtlichen Stellung Böhmens, Husum 2003.
Bosl, Karl (Hrsg.): Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder. Stuttgart 1967–1974 [4 Bände].
Hoensch, Jörg K.: Geschichte Böhmens. Von der slavischen Landnahme bis ins 20. Jahrhun-dert, 21992.
Hoensch, Jörg Konrad: Geschichte der Tschechoslowakei, Stuttgart u.a. 31992.
Kirschbaum, Stanislav J.: A History of Slovakia. The Struggle for Survival, New York 22005.
Mannová, Elena: A concise history of Slovakia, Bratislava 2000.
Habsburger Reich Bérenger, Jean: Die Geschichte des Habsburgerreiches, 1273–1918, Wien u.a. 1995.
Evans, Robert J. W.: Das Werden der Habsburgermonarchie, 1550–1700. Gesellschaft, Kul-tur, Institutionen, Wien u.a. 21989.
Fichtner, Paula S.: The Habsburg Empire. From Dynasticism to Multinationalism, Malabar 1997.
Fichtner, Paula S.: The Habsburg Monarchy, 1490–1848. Attributes of Empire, Basingstoke 2003.
Ingrao, Charles W.: The Habsburg Monarchy, 1618-1815, Cambridge 22000.
2. Ostmitteleuropa
319
Kann, Robert A.: Geschichte des Habsburgerreiches 1526 bis 1918, Wien u.a. 31993.
Rumpler, Helmut; Urbanitsch, Peter (Hrsg.): Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Wien 1973– [bisher 8 Bände in 12 Teilbänden].
Wheatcroft, Andrew: The Habsburgs. Embodying Empire, London 22005.
Baltikum, Estland, Lettland, Finnland Bilmanis, Alfred: A History of Latvia, Westport 21970.
Hackmann, Jörg; Schweitzer, Robert (Hrsg.): Nordosteuropa als Geschichtsregion, Lübeck 2006.
Heyde, Jürgen: Bauer, Gutshof und Königsmacht. Die estnischen Bauern in Livland unter polnischer und schwedischer Herrschaft, 1561–1650, Köln u.a. 2000.
Kiaupa, Zigmantas; Mäesalu, Ain; Pjur, Ago et al.: Geschichte des Baltikums, Tallinn 22002.
Kirby, David: A Concise History of Finland, Cambridge 2006.
Laur, Mati; Lukas, Tõnis; Mäesalu, Ain et al.: History of Estonia, Tallinn 2000.
Mapping Baltic History. The Concept of Northern Eastern Europe. Journal of Baltic Studies 33/4 (2002) [Themenheft].
Plakans, Andrejs: The Latvians. A Short History, Stanford 1995.
Raun, Toivo U.: Estonia and the Estonians, Stanford 32001.
Subrenat, Jean-Jacques (Hrsg.): Estonia. Identity and Independence, Amsterdam u.a. 2004.
Tuchtenhagen, Ralph: Geschichte der baltischen Länder, München 2005.
Wittram, Reinhard: Baltische Geschichte. Die Ostseelande, Livland, Estland, Kurland 1180–1918. Grundzüge und Durchblicke, Darmstadt 21973.
Zernack, Klaus: Nordosteuropa. Skizzen und Beiträge zu einer Geschichte der Ostseeländer, Lüneburg 1993.
Polen, Litauen, Preußen Alexander, Manfred: Kleine Geschichte Polens, Ditzingen 22008.
Bömelburg, Hans-Jürgen: Frühneuzeitliche Nationen im östlichen Europa. Das polnische Geschichtsdenken und die Reichweite einer humanistischen Nationalgeschichte (1500–1700), Wiesbaden 2006.
Clark, Christopher: Preußen: Aufstieg und Niedergang, 1600–1947, München 52007.
Davies, Norman: God’s Playground. A History of Poland in Two Volumes, 22005.
Davies, Norman: Im Herzen Europas. Geschichte Polens, München 42006.
Heyde, Jürgen: Geschichte Polens, München 2006.
Hellmann, Manfred: Grundzüge der Geschichte Litauens und des litauischen Volkes, Darm-stadt 51999.
Hoensch, Jörg K.: Sozialverfassung und politische Reform: Polen im vorrevolutionären Zeit-alter, Köln u.a. 1973.
Jaworski, Rudolf; Lübke, Christian; Müller, Michael G.: Eine kleine Geschichte Polens, Frankfurt/M. 2000.
Kiaupa, Zigmantas: The History of Lithuania, Vilnius 22005.
Teil C: Regionale Schwerpunkte
320
Lukowski, Jerzy; Zawadzki, Hubert: A Concise History of Poland, Cambridge u.a. 22006.
Niendorf, Mathias: Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569–1795), Wiesbaden 2006.
Opgenoorth, Ernst (Hrsg.): Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens. Lüneburg 1994– [bisher Band 2, Teile 1–4].
Prażmowska, Anita: A History of Poland, Basingstoke u.a. 2004.
Schulze Wessel, Martin: Russlands Blick auf Preußen. Die polnische Frage in der Diplomatie und politischen Öffentlichkeit des Zarenreiches und des Sowjetstaates 1697–1947, Stuttgart 1995.
Stone, Daniel: The Polish-Lithuanian State, 1386–1795, Seattle u.a. 2001.
Tumler, Marian; Arnold, Udo: Der Deutsche Orden. Von seinem Ursprung bis zur Gegen-wart, Bad Münstereifel 51992.
Wyczański, Andrzej: Polen als Adelsrepublik, Osnabrück 2001.
Slowenien, Kroatien (siehe auch Südosteuropa) Guldescu, Stanko: History of Medieval Croatia, The Hague 1964.
Guldescu, Stanko: The Croatian-Slavonian Kingdom 1526–1792, The Hague 1970.
Hösler, Joachim: Slowenien: von den Anfängen bis zur Gegenwart, Regensburg 2006.
Nećak, Dušan; Božo, Repe: Slowenien, Klagenfurt 2006.
Štih, Peter; Simoniti, Vasko; Vodopivec, Peter: Slowenische Geschichte. Gesellschaft - Poli-tik - Kultur, Graz 2008.
Ungarn, Siebenbürgen Bogyay, Thomas von: Grundzüge der Geschichte Ungarns, Darmstadt 41990.
Hauszmann, Janos: Ungarn: vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Regensburg 2004.
Klimó, Árpád von: Ungarn seit 1945, Göttingen 2006.
Kontler, László: A History of Hungary. Millenium in Central Europe, Houndmills 2002.
Kósa, László (Hrsg.): Die Ungarn. Ihre Geschichte und Kultur. Budapest 1994.
Köpeczi, Béla (Hrsg.): Kurze Geschichte Siebenbürgens, Budapest 1990 [dreibändigen Versi-on]: Ders. (Hrsg.): History of Transylvania, Boulder 2001–2002.
Kósa, László: A Cultural History of Hungary. Vol. 1: From the Beginnings to the Eighteenth Century. Vol. 2: In the Nineteenth and Twentieth Centuries, Budapest 1999–2000.
Nemeskürty, István: Abriss der Kulturgeschichte Ungarns. Budapest 1994.
Roth, Harald: Kleine Geschichte Siebenbürgens, Köln u.a. 22003.
Tóth, István György (Hrsg.): Geschichte Ungarns, Budapest 2005.
3. Südosteuropa
321
3. SÜDOSTEUROPA
3.1 Epochen
3.1.1 Von der Spätantike bis zur osmanischen Landnahme
Die seit dem ersten nachchristlichen Jahrhundert verfestigte römische Herr-schaft auf dem Balkan legte die Grundlagen für eine politische Einigungspe-riode. Unter der römischen Provinzialverwaltung kam es zu einer Befriedung der vielen verschiedenen und untereinander verfeindeten Stammesgebiete. Die Völker Südosteuropas erlebten dank der Pax Romana eine wirtschaftli-che und kulturelle Prosperität. Die Donau sowie die Provinz Dacia im heuti-gen Siebenbürgen, welche allerdings lediglich von 107–271 Bestand hatte, bildeten die Grenzen des Römischen Reichs. Der Einbruch der Westgoten 271 markierte den Anfang eines ständig wachsenden Drucks von Steppen-völkern auf die Ostgrenzen des Imperiums und läutete die Zeit der Völker-wanderung ein. Grundsätzlich hatten die Ostprovinzen seit Ende des zweiten Jahrhunderts an Bedeutung gewonnen. Diese Orientierung der Kaiser nach Osten zeigt sich nirgends deutlicher als in der Verlegung des Regierungssitzes in das «Nea Roma» Konstantinopel während der Regierungszeit Konstantins des Großen (306–337). Konstantinopel sollte als neue Metropole des Oströmischen Rei-ches die Geschichte ganz Südosteuropas für weitere 1000 Jahre maßgeblich beeinflussen. Nicht minder folgenreich war die sogenannte Reichsteilung unter Theodosius im Jahr 395, welche die eigentlich schon bestehende Ver-waltungsteilung innerhalb des Imperiums auch de iure umsetzte. Die Linie, die damals gezogen wurde, schied Südosteuropa in zwei Teile und beein-flusste deren sprachliche, kulturelle und religiöse Entwicklung maßgeblich. Die Grenze verlief von Skutari (Scodra) im heutigen Nordalbanien in Rich-tung Norden bis Belgrad. Da die Grenzziehung im Wesentlichen auch der Diözeseneinteilung und damit den kirchenrechtlichen Einflusssphären von Rom bzw. Konstantinopel entsprach, wurden die Gebiete westlich der Gren-ze lateinisch-abendländisch, diejenigen östlich davon byzantinisch-orthodox geprägt. Im späten 6. Jahrhundert erschütterte die Landnahme der Awaren (> Glos-sar), eines weiteren Steppenvolkes, die byzantinische Vorherrschaft auf dem Balkan. Nach der Niederlage der Awaren vor den Toren Konstantinopels im Jahr 626 prägten die nachfolgenden slawischen Völker die Landkarte Südost-europas. Sie hatten sich den Kriegszügen der Awaren als deren Verbündete angeschlossen und besetzten das Machtvakuum, das die Awaren und das ge-
Teil C: Regionale Schwerpunkte
322
schwächte Byzantinische Reich zurückgelassen hatten. Im Unterschied zu den Hunnen und Awaren zeichneten sich die slawischen Stämme durch eine sess-hafte Lebensweise aus. Bis Ende des 7. Jahrhunderts hatten sie ganz Südosteu-ropa besiedelt. Soweit aufgrund der schlechten und einseitig byzantinisch ge-prägten Quellenlage bekannt, blieben sie vorerst in einem Klientelverhältnis zum Byzantinischen Reich, dessen Oberhoheit zumindest nominal weiterhin bestand. In die gleiche Zeit fällt das Vordringen des Turkvolkes (> Glossar) der Bul-garen (> Glossar). Aus der Verschmelzung der protobulgarischen Ober-schicht mit der slawischen Masse der Bevölkerung ging das Volk der Bulga-ren hervor. Rasch wurde die dünne Oberschicht slawisiert. Das bulgarische Reich war das erste große Herrschaftsgebilde innerhalb der slawischen Stammeswelt auf dem Balkan, das sich dem byzantinischen Zugriff entzie-hen konnte. Das krisengeschüttelte Byzanz war durch den Abwehrkampf gegen den Arabersturm zu sehr geschwächt, um auch an der Nordwestflanke Widerstand zu leisten. Die Christianisierung der Bulgaren nach der Taufe des Khan (> Glossar) Boris (864) legte die Grundlagen für eine Byzantinisie-rung des bulgarischen Reiches, das unter Zar Symeon (893–927) seinen Hö-hepunkt erlebte. Die Annahme des Christentums war ein innenpolitisches Instrument der Khane, um den Partikularismus der protobulgarischen Stammesorganisation endgültig zu zerschlagen und die Alleinherrschaft in Form eines Kaisertums durchzusetzen. Die bulgarischen Herrscher wurden vom byzantinisch-religiösen Staatsdenken geprägt, das gemäß dem Kirchenvater Eusebius nur ein einziges legitimes christlich-römisches Reich vorsieht. So sahen die bul-garischen Herrscher ihre Mission darin, das Erbe des Byzantinischen Rei-ches anzutreten und ein bulgarisch-byzantinisches Reich zu gründen. Die Christianisierung der umliegenden slawischen Herrschaftsgebilde hatte By-zanz einerseits geholfen, das Verhältnis zu den benachbarten Völkern in festere Bahnen zu lenken und an Einfluss zu gewinnen; denn erst die An-nahme des Christentums machte die neuen slawischen Herrscher aus der Sicht der Byzantiner bündnisfähig, und insofern war die Missionstätigkeit Ausdruck einer aktiven Außenpolitik. Andererseits führte diese religiös ge-tragene Herrschaftslegitimität dazu, dass in der Folge alle südslawischen Königreiche den Anspruch auf das Erbe von Byzanz erhoben. So war ein friedliches Nebeneinander von Byzanz und jungen südslawischen Macht-zentren langfristig nicht möglich. Unter der Kaiserdynastie der Makedonen (867–1056), die das Konkurrenzreich der Bulgaren um 1000 vernichteten und dem Byzantinischen Reich einverleibten, erlebte Byzanz seine letzte große Blütezeit.
3. Südosteuropa
323
An der Nord- und Nordwestgrenze Südosteuropas bildeten sich gleichzeitig feste machtpolitische Strukturen aus, welche die Balkanhalbinsel einrahm-ten. Der Vorstoß der Franken hatte die in den südöstlichen Alpen gelegene Markgrafschaft Friaul begründet, die Reste des awarischen Reiches zer-schlagen und Istrien den Byzantinern entrissen. Die Slowenen, in den Ostal-pen wohnhafte slawische Stämme, blieben unter dem Einfluss fränkisch bestimmter Landesherrschaften, bevor ihre Gebiete im 9. Jahrhundert Teil der habsburgischen Erblande wurden, zu denen sie bis 1918 gehören sollten. Venedig installierte in den vormals byzantinischen Städten entlang der ost-adriatischen Küste ein überseeisches Kolonialreich, das mit Ausnahme kurz-zeitiger ungarischer und lokaler Stadtherrschaften bis 1797 Bestand hatte. Einzig die Stadtrepublik Ragusa – das heutige Dubrovnik – vermochte sich aus der Umklammerung der Markusrepublik zu lösen und im späten 15. und 16. Jahrhundert zur drittgrößten Handelsrepublik des Mittelmeers nach Ge-nua und Venedig aufzusteigen. Ragusa lavierte geschickt zwischen allen Mächten und schaffte es, gleichzeitig Vasall des Sultans (> Glossar) und Untertan des Papstes zu sein. Die Stadt diente nicht nur als wichtiger Um-schlagplatz für Waren zwischen dem Mittelmeer und dem Binnenbalkan, sondern auch als Börse für Informationen und diplomatische Netzwerke zwischen dem osmanischen Osten und dem christlichem Westen. Erst der Wiener Kongress von 1815 bedeutete das Ende der Stadtrepublik, die an das Habsburger Reich fiel. Die byzantinisch-bulgarische Auseinandersetzung, die erlahmende Präsenz von Byzanz in der nördlichen Adria und die defensive fränkische Vorherr-schaft im späten 9. Jahrhundert eröffneten ein Machtvakuum, das die kroati-schen Stämme für die Gründung eines Königreiches nutzten. Unter der Dy-nastie der Trpimiriden taktierte das kroatische Königreich – ähnlich wie das bulgarische – zwischen byzantinischer und päpstlicher Missionierung. Die Verlagerung des königlichen Machtzentrums in den Raum der dalmatini-schen Städte, die sich 928 endgültig für Rom und gegen das Patriarchat (> Glossar) Konstantinopel entschieden hatten, war ausschlaggebend für die Unterstellung unter Rom. Am nördlichen Saum der Balkanhalbinsel erfolgte Ende des 9. Jahrhunderts die Landnahme der ungarischen Stämme – und damit auch die letzte Herr-schaftsbildung durch ein Reitervolk nach den Hunnen und Awaren. Die Nie-derlage der Ungaren gegen Otto den Großen auf dem Lechfeld bei Augsburg 955 verhinderte eine weitere Expansion. Deutlich wurde der Dynastie der Arpaden vor Augen geführt, wie wichtig die Annahme des Christentums war, um ihre Macht nachhaltig nach innen und außen zu stärken. Fürst Géza ließ sich wahrscheinlich 973 taufen. Sein Sohn Stephan der Heilige wurde um die Jahreswende 1000/1001 mit einer vom Papst übersandten Krone ge-krönt. Als die Dynastie der Trpimiriden im 11. Jahrhundert ausstarb, konnten
Teil C: Regionale Schwerpunkte
324
sich die Arpaden unter König Koloman die kroatische Krone in den soge-nannten pacta conventa (1102), einer Übereinkunft zwischen dem kroatischen Adel und Koloman, sichern und ihren Einfluss auch auf die dalmatinischen Städte ausweiten. Jenseits der Frage nach der Echtheit dieser Vereinbarung – die heutige Forschung geht von einer Fälschung aus – dauerte die Personal-union der ungarischen und kroatischen Herrschaft bis 1918. Venedig war nach 1000 endgültig seiner Rolle als Juniorpartner von Byzanz entwachsen und verdrängte seine ehemalige Schutzmacht. Byzanz war längst nicht mehr die tonangebende Flottenmacht in der Adria und im östlichen Mittelmeer, sondern wurde von den Seldschuken in Anatolien, von Norman-nen, Venezianern und anderen italienischen Seerepubliken in die Defensive gedrängt. Gleichzeitig wuchs in Westeuropa seit Ende des 11. Jahrhunderts die Kreuzzugsbewegung heran mit dem Ziel, die heiligen Stätten des Chris-tentums im Nahen Osten von den Moslems zu befreien und Byzanz in sei-nem Kampf gegen die Muslime zu unterstützen. Doch der Einfluss Venedigs als Geldgeber und Flottenmacht bei den Kreuzzügen bewirkte eine tiefe Zä-sur in der Geschichte des östlichen Mittelmeers und ganz Südosteuropas: Der vierte Kreuzzug wurde seiner ursprünglichen Zielsetzung entfremdet und unter maßgeblichem Einfluss Venedigs gegen Konstantinopel abgelenkt, das 1204 erobert wurde. Unter der Ägide des venezianischen Dogen wurde das byzantinische Reich in drei griechische und verschiedene lateinische Herrschaftsgebilde (Kreuzfahrerstaaten und venezianische Kolonien) aufge-splittert. Erst 1261, unter der Dynastie der Palaiologen (1261–1453), gelang den By-zantinern die Rückeroberung Konstantinopels. Zur Zeit der Palaiologen er-lebte das Byzantinische Reich noch einmal eine eindrückliche Renaissance; dennoch konnte es seine bisherige Funktion als Bollwerk gegen die aus dem Osten unter der Flagge des Islams vordringenden Mächte nicht mehr wahr-nehmen. Die Osmanen, ein bis dahin unbekannter Turkstamm, machten sich daran, das Erbe von Byzanz anzutreten. Bereits 1350 hatten sie ihre Herr-schaft über den Bosporus auf das europäische Festland ausgedehnt. Da das Byzantinische Reich als ordnende Instanz entfiel, entstand im südli-chen Balkan ein Machtvakuum, das auch am Nordsaum die Entstehung neu-er Herrschaftsverbände ermöglichte. Unter der Dynastie der Aseniden ent-stand ein zweites bulgarisches Reich (ca. 1190–1250), das nach einigen her-ausragenden Herrscherpersönlichkeiten rasch in kleinere Teilherrschaften zerfiel und schließlich von den Osmanen überrannt wurde. Die Herrschafts-ideologie der Aseniden lavierte zwischen den Königsinsignien aus der Hand des Papstes und dem nicht verwirklichten Ziel, das Erbe Konstantinopels anzutreten. Eine eigenständige sakrale Ideologie zur Machterhaltung jenseits des personenorientierten Führercharismas wurde vernachlässigt und zu spät
3. Südosteuropa
325
entwickelt. Zudem schwächte der Mongoleneinfall 1240 das Bulgarische Reich schwer. Weitaus nachhaltiger baute die serbische Dynastie der Nemanjiden ein serbi-sches Reich auf. Auch hier empfing Stefan der Erstgekrönte die Krone vom Papst, um sich von Byzanz zu emanzipieren. Andererseits baute man eine eigenständige serbische Kirchenstruktur auf, und es entstand eine reiche serbi-sche Klosterwelt. Die Sakralisierung der Nemanjiden-Könige durch deren Nachfolger legitimierte erfolgreich den Herrschaftsanspruch der Dynastie für zwei Jahrhunderte. Es entstanden Heiligenviten und eine entsprechende sakra-le Ikonografie; in der serbischen Klosterwelt wurde das Zusammengehen von Kirche und Dynastie mit prachtvollen Fresken zur Schau gestellt. Unter Stefan Dušan dem Großen erreichte das serbische Großreich seine maximale Aus-dehnung und erstreckte sich von der ostadriatischen Küste bis zu den Toren Thessalonikis und Konstantinopels. Die Krönung Dušans zum «Kaiser der Serben und Griechen» 1346 erfüllte beinahe das Ziel aller bisherigen slawi-schen Reiche auf dem Balkan, die Nachfolge von Byzanz antreten zu kön-nen. Allerdings zerfiel das Reich nach Dušans Tod rasch in kleine Fürsten-tümer, die untereinander um den Vorrang kämpften. Durch den Machtzerfall der Nemanjiden entstand zwischen den serbischen Despoten und dem ungarischen Königreich ein Machtvakuum, das sich das bosnische Fürstengeschlecht der Kotromaniden zu Nutze machte. Unter dem bosnischen König Tvrtko konnte sich Ende des 14. Jahrhunderts noch einmal kurzzeitig ein übergreifendes Königreich etablieren. Doch auch hier be-schränkte sich die einigende Kraft auf überragende Herrschergestalten; nach deren Tod überwogen wieder die zentrifugalen Kräfte untereinander verfeh-deter Magnaten (> Glossar).
3.1.2 Südosteuropa zwischen habsburgischer und osmanischer Herrschaft
Angesichts der Herrschaftszersplitterung traf die osmanische Expansion auf zwar erbitterten, aber kaum erfolgreichen Widerstand in den südosteuropäi-schen Reichen und Fürstentümern. Noch im 14. Jahrhundert überquerten die Osmanen auf Kriegs- und Plünderungszügen immer wieder die Donau und drängten den Einfluss der ungarischen Krone kontinuierlich zurück. Das Fürstentum Walachei wurde in ein Abhängigkeitsverhältnis gezwungen. Aus einer ungarischen Grenzmark war das rumänische Fürstentum Moldau her-vorgegangen, das im 15. Jahrhundert zumeist unter polnischer Oberhoheit stand. Unter Stefan dem Großen konnte sich das Fürstentum kurzzeitig mili-tärisch erfolgreich gegen das osmanische Vordringen behaupten. Doch auf-
Teil C: Regionale Schwerpunkte
326
grund der Kräfteverhältnisse unterordnete sich auch die Moldau bald schon der osmanischen Oberhoheit. Im 15. Jahrhundert hatten beide Donaufürstentümer (die Moldau und die Walachei) eine Blütezeit erlebt. Der byzantinische Ritus konnte sich früh durchsetzen und wurde zum Ausgangspunkt einer slawisch-rumänischen Literatur. Eindrückliche Kirchen- und Klosterbauten wurden erschaffen; vor allem in der Moldau waren Letztere Teil der Verteidigungsplanes Stefan des Großen, der die Anlagen mit Mauerringen umfassen ließ. Der Vojvode Vlad Ţepeş (1430–1476, «der Pfähler»), auch Drăculea genannt, ging als erfolg-reicher Türkenkämpfer und als strenger, aber gerechter Herrscher in die ru-mänische Historiografie ein: Als Throninhaber der Walachei errang er einige Achtungserfolge gegen die Osmanen. In der westeuropäischen Literatur ist er hingegen aufgrund von Verleumdungen seiner Gegner als äußerst grau-samer Schreckensherrscher bekannt und wurde im 19. Jahrhundert als Graf Dracula zur Hauptfigur des gleichnamigen Horrorklassikers. Beide Vasallenstaaten, die Walachei und die Moldau, erhielten vorerst Rech-te, die typisch für Herrschaftsgebiete waren, die dem Osmanischen Reich angegliedert, aber nicht besetzt waren. Ihnen wurde eine relativ freie Fürs-tenwahl, eine Verwaltungsautonomie und das Recht zugestanden, die inne-ren Angelegenheiten gemäß dem Gewohnheitsrecht zu regeln. Ab dem 16. Jahrhundert jedoch schränkte die Hohe Pforte (> Glossar) diese Vorrech-te immer mehr ein. Es wurden zunehmend, im 18. Jahrhundert ausschließ-lich, fremde Statthalter – zumeist griechischstämmige sogenannte Phanario-ten (> Glossar) – als Fürsten eingesetzt. Die direkte Berufung von Statthal-tern bewirkte eine noch engere Integration der Walachei und der Moldau in den Osmanischen Herrschaftsbereich, auch wenn sie formell nie Teil des Reiches wurden. Die Herrschaft der phanariotischen Statthalter in den Do-naufürstentümern drängte das Kirchenslawische zurück und bewirkte eine starke Gräzisierung der Kultur und der Religion. Auch im südwestlichen Balkan bestimmten die Osmanen den weiteren Ver-lauf der Geschichte. Die berühmte Schlacht auf dem Amselfeld (Kosovo polje) 1389 zwischen Sultan Murat und einer Koalition serbischer, bosni-scher, kroatischer und albanischer Fürsten endete wohl unentschieden; trotz-dem wurde sie während der langen Jahrhunderte der osmanischen Herrschaft und im 19. Jahrhundert, der Zeit der nationalen Wiedergeburt, mythisch zum Opfergang des serbischen Volkes überhöht. 1459, nach dem Fall der Festung Smederovo in der Nähe des heutigen Belgrad, hörte das letzte serbische Herrschaftsgebilde auf zu bestehen – nur mit Hilfe der ungarischen Krone hatten sich die letzten serbischen Fürsten überhaupt so lange halten können. Ungarische Bemühungen, dem osmanischen Vordringen mit Hilfe von Kreuz-zugsrittern Einhalt zu gebieten, schlugen indes fehl; bereits 1396 hatte ein
3. Südosteuropa
327
christliches Ritterheer bei Nikopolis eine Niederlage erlitten. Päpstliche Be-strebungen, den Abwehrkampf unter abendländischer Flagge zu koordinieren, scheiterten an der Uneinigkeit der christlichen Mächte. Nach ersten spektaku-lären Erfolgen – etwa im Abwehrkampf um Belgrad – musste auch der Gene-ralkapitän Ungarns, Johannes Hunyadi, sich bei Varna geschlagen geben. Gleichzeitig mit Hunyadi vermochte sich im albanischen Raum Georg Kastriota eine Zeitlang gegen die Osmanen zu behaupten. Er ging als Skan-derbeg in die Geschichte ein, der Papst nannte ihn aufgrund seiner Erfolge «athleta christi». Doch auch Skanderbeg konnte die Eroberung durch die Osmanen nur hinauszögern. Dennoch vermochte die Hohe Pforte das gebir-gige und zerkammerte Hochland Albaniens nie vollständig bzw. lediglich nominell unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie beschränkte sich darauf, die Ebenen und die wichtigsten Verbindungsstrassen zu kontrollieren und die Autorität im Hochland durch sporadische Strafexpeditionen und das Eintrei-ben der Steuern durch lokale Bevollmächtigte zu sichern. 1453 fiel schließlich die letzte Bastion des Byzantinischen Reiches: die Stadt Konstantinopel. Nach zwei Monaten Belagerung konnten die Osmanen die Metropole stürmen. Die Frontlinie in Südosteuropa verlief nun zwischen dem Osmanischen Reich einerseits und dem ungarischen Reich und Venedig andererseits; die Markusstadt kontrollierte weiterhin einen schmalen Gürtel von ostadriatischen Städten. Doch die Osmanen drangen kontinuierlich wei-ter in Richtung Norden vor. 1526 schlug Sultan Süleiman der Prächtige (1520–1566) ein böhmisch-ungarisches Heer bei Mohács vernichtend. Der ungarische König Ludwig II. Jagiełło kam dabei um, womit gemäß Erbvertrag der Habsburger Ferdinand die Herrschaftsfolge über Ungarn antrat. 1540/1541 besetzten die Osmanen den größten Teil Ungarns und festigten ihre Herrschaft für 150 Jahre. Die Reste des noch nicht besetzten Kroatien schlossen sich dem Habsburgischen Reich an. 1527 wählten die kroatischen Adligen Ferdinand I. zum König. Aufgrund seiner effizienten militaristisch-zentralistischen Regierungsform war das Osmanische Reich den europäischen Mächten militärisch und finan-ziell überlegen. Mitte des 16. Jahrhunderts befand es sich auf dem Höhe-punkt seiner Machtentfaltung: drei Jahre nach der Schlacht bei Mohács soll-ten die Osmanen ein erstes Mal Wien belagern, allerdings erfolglos. Kaum günstiger verlief jedoch der venezianische Widerstand gegen die Osmanen: Im Laufe des 16. Jahrhunderts waren vom levantinischen Reich Venedigs nur noch Städte an der istrischen und dalmatinischen Küste übrig geblieben, die Besitzungen in Griechenland und an der albanischen Küste mussten En-de des 16. Jahrhunderts endgültig geräumt werden. Das hing zum größten Teil damit zusammen, dass Venedig seine Überlegenheit zur See verloren hatte und die Flagge des Halbmondes das östliche Mittelmeer beherrschte;
Teil C: Regionale Schwerpunkte
328
um 1550 waren der gesamte Binnenbalkan und seine Küsten fest in osmani-scher Hand. Nach 1570 pendelte sich mit dem Erstarken des Habsburgischen Reiches allmählich eine Pattsituation ein. Erst nach einem zweiten erfolglo-sen Vorstoß der Osmanen bis vor die Stadttore Wiens 1683 gingen die Habsburger dazu über, die Osmanen definitiv aus Ungarn zu verdrängen. Venedig und Habsburg bemühten sich früh, die Frontlinie zu den Osmanen mit einem Grenzkorridor, dem sogenannten triplex confinium, sozial und mili-tärisch nachhaltig zu sichern. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden bei den Venezianern und Habsburgern Grenzergesellschaften mit spezifischen Privilegien, welche auf habsburgischer Seite bis 1881 bestehen sollten. Die Schaffung des triplex confinium begann mit der Ansiedlung von Uskoken – serbokroatisch für «Entsprungene», das heißt Flüchtlinge aus den von den Osmanen eroberten südslawischen Gebieten – an den Grenzlinien. Sie erhiel-ten Grund und Boden und blieben abgabefrei, als Gegenleistung hatten sie unbesoldete Wehrdienstleistungen zu entrichten. Das Ziel Habsburgs und Ve-nedigs bestand darin, die Wüstungsgebiete (> Glossar Wüstung) der jahrzehn-telangen Kriege gegen die Osmanen mit einem Wiederbesiedlungsprogramm neu aufzubauen und einen Sperrgürtel gegenüber dem Osmanischen Reich zu schaffen. Aus ersten wehrdorfähnlichen Siedlungen entstand im 17. und 18. Jahrhundert ein geschlossenes Siedlungsgebiet, das sich vom veneziani-schen Split bis nach Siebenbürgen zog. Diese auch als Militärgrenze be-zeichneten Gebiete Habsburgs wurden aus der Ziviladministration herausge-löst und im 18. Jahrhundert direkt dem Wiener Hofkriegsrat unterstellt. Der Vorteil des freien Grundbesitzes zog viele Bauern an, die vor ihren Grund-herren geflohen waren; zahlreiche orthodoxe Vlachenfamilien (> Glossar Vlachen) wechselten von der osmanischen auf die habsburgische Seite über und ließen sich in dieser Grenzregion nieder. Diese speziellen Bedingungen konservierten bis ins 19. Jahrhundert eine eigentümliche sozioökonomische Gesellschaftsform von Militärbauern; da sich eine starre Gesellschaftsform ohne soziale Differenzierung bewahren konnte, blieben alte Formen des Zusammenlebens in komplexen Familienstrukturen lange erhalten. Die An-siedlung von Wehrbauern führte zu einem kompakten orthodoxen Sied-lungsstreifen innerhalb katholischer und islamischer Siedlungsgebiete, was die ethnisch-religiöse Verflechtung auf kleinstem Gebiet förderte – ein Phä-nomen, das im Zeitalter der nationalen Bewusstseinswerdung und der Ent-stehung von Nationalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert zu einer schwerwie-genden Hypothek für diese Region wurde.
3. Südosteuropa
329
3.1.3 Der Niedergang des Osmanischen Reiches und das lange 19. Jahrhundert
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts konnte das Osmanische Reich noch einmal die inneren Zerfallserscheinungen aufhalten und militärisch aus-greifen. Die Niederlage vor Wien 1683 leitete jedoch endgültig eine lange Periode habsburgischer Rückeroberungen ein. Der westlichen Antitürkenalli-anz – der sogenannten «Heiligen Liga», der sich auch das aufstrebende Russ-land anschloss – konnte der Sultan nur noch defensiv begegnen. Die Erfolge der Türkenkriege brachten bald die Rückeroberung der ungarischen Gebiete und Siebenbürgens. Die kaiserlichen Truppen Habsburgs stießen wiederholt bis nach Makedonien vor. 1699 musste das Osmanische Reich im Frieden-schluss von Karlowitz erstmals auf dem europäischen Kontinent einen diktier-ten Frieden mit beträchtlichen territorialen Verlusten hinnehmen. In den Krie-gen von 1768–1774 und 1806–1812 verdrängte Russland die Osmanen vom Schwarzen Meer und sicherte sich die politische – nicht aber die territoriale – Kontrolle über die Donaufürstentümer. Bei den Habsburgern setzte sich all-mählich die Erkenntnis durch, dass das Zurückdrängen des im 19. Jahrhundert zunehmend als «kranker Mann am Bosporus» bezeichneten Osmanischen Reiches eine schwierige und brisante Neuordnung der Kräfte in Südosteuropa nach sich ziehen würde. Daraus resultierte die sogenannte «Orientalische Frage», nämlich: wie das Erbe des Osmanischen Reiches unter den europäischen Großmächten zu verteilen sei. Die Siegermächte Habsburg und Russland sahen sich gezwun-gen, einen Ausgleich zwischen ihren Interessen, der Integrität des Osmani-schen Reiches und den Bestrebungen der christlichen Völker in Südosteuro-pa zu finden. Diese sahen ihre Chance gekommen, endlich die osmanische Fremdherrschaft abzuschütteln. Hierbei erhielten sie die Unterstützung Russ-lands, das im Panslawismus (> Glossar) und in der Glaubensgemeinschaft mit den orthodoxen Balkanvölkern ein Instrument für die Erweiterung seiner Einflusszone sah. Russland beabsichtigte, sein panslawisches Konzept auf dem Balkan mit der Errichtung eines christlichen Balkanstaates unter zari-scher Ägide zu verwirklichen – sehr zum Unwillen der Habsburger, die eine russische Hegemonie über Istanbul zu verhindern suchten. Wien befürchtete auch, dass die Unabhängigkeitsbestrebungen auf die südslawischen Völker des Habsburger Reiches übergreifen könnten. Das Vordringen Russlands an der Nordküste des Schwarzen Meeres machte die Meerenge am Bosporus zu einem politisch heiklen Punkt, da Russland seit 1782 die Kontrolle über den Zugang zum Mittelmeer anstrebte. Wirtschaftliche Gründe (Exportmöglich-keiten) und strategische Begehrlichkeiten (ein vergrößerter Aktionsradius der russischen Schwarzmeerflotte) waren dafür ausschlaggebend. Der Bos-porus wurde zu einem Angelpunkt der Großmachtpolitik auf dem Balkan
Teil C: Regionale Schwerpunkte
330
und bestimmte die Traktandenliste aller Friedensschlüsse bis zum Ersten Weltkrieg. Vor diesem Hintergrund sahen die westlichen Großmächte Europas – Eng-land, Frankreich, Preußen und Habsburg – zunehmend davon ab, das Osmani-sche Reich endgültig zu zerschlagen. Ohne Erfolg versuchte man, die «Orien-talische Frage» mit einem neuen Mächtegleichgewicht anstelle des entstehen-den Machtvakuums zu lösen. Russland ermunterte nach 1800 seine «Glau-bensbrüder» immer häufiger, sich gegen die Osmanen zu erheben, um ohne das Risiko eigener Interventionen in Südosteuropa an Einfluss zu gewinnen. In diesem Kontext müssen die serbischen Aufstände und der mäßig erfolgreiche Freiheitskampf der Griechen und Rumänen 1821–1829 verstanden werden. Der Freiheitskampf der jungen christlichen Völker gegen die osmanische Herrschaft stieß in ganz Europa auf große Zustimmung. Insbesondere die europaweite philhellenische Bewegung unterstützte den griechischen Frei-heitskampf und setzte die westlichen Mächte unter Druck, aktiv gegen die Hohe Pforte vorzugehen. Die antiosmanische Stimmungslage erhielt auch Zulauf, weil die Osmanen mit übertriebener Härte gegen Aufständische und die Zivilbevölkerung vorgingen. Die jungen Balkanvölker waren zu schwach, um sich ohne fremde Hilfe zu befreien: Stets waren Interventionen der westeuropäischen Mächte nötig, um die Osmanen bei Aufständen zu Zugeständnissen zu bewegen. Der russisch-osmanische Krieg 1829 und das Eingreifen der alliierten Flotte brachten im Frieden von Adrianopel die staatsrechtlich anerkannte Souveränität Griechenlands, das eine Erbmonar-chie wurde. Gleichzeitig musste der Sultan die Autonomie Serbiens unter der Führung des Fürsten Miloš Obrenović anerkennen. Zwar hatte bereits 1804–1812 eine zuerst sozial getragene Revolte des unzufriedenen serbischen Bauernstandes gegen die lokalen Janitscharen (> Glossar) zu einem allge-meinen Aufstand geführt; doch erst der zweite Aufstand 1815–1817 brachte den Erfolg. Auch hier war der politische und militärische Druck Russlands für den Erfolg der Aufständischen ausschlaggebend. Im Gebiet des heutigen Montenegro hatte sich das Osmanische Reich früh darauf beschränkt, eine nominelle Oberhoheit zu bewahren. Das isolierte und abgelegene montenegrinische Bergland war administrativ kaum zu durch-dringen. In dieser patriarchalischen und vielgestaltigen Stammeswelt kam dem Bischof vom Cetinje bald eine stammesübergreifende Autorität zu: Er war der Hüter des orthodoxen Glaubens und ein einigender Identitätsfaktor. 1697 löste der Bischof von Cetinje (Vladika) das montenegrinische Gebiet de facto aus der osmanischen Herrschaft. Die Erblichkeit des Vladika-Titels setzte sich in der bischöflichen Familie der Njeguši durch, indem der Titel jeweils vom Onkel auf den Neffen übertragen wurde. Mit einer erstaunlichen Kontinuität regierte die Dynastie Montenegro bis Ende des Ersten Welt-
3. Südosteuropa
331
kriegs. Erst 1918 beschloss eine Große Nationalversammlung in Podgorica gegen den Willen politischer Kräfte, die eine Unabhängigkeit Montenegros verfolgten, die Vereinigung mit Serbien. Das Osmanische Reich versuchte, diesen Zerfallsprozess aufzuhalten. Doch die während der Reformära des Tanzimats (> Glossar, 1839–1876) in An-griff genommene Restauration brachte nur mäßige Reformergebnisse – zu groß war der Widerstand lokaler Machtträger und muslimischer Bevölke-rungsgruppen gegen die Neuerungen. Insbesondere die Beamtenschicht hatte Angst, ihre Privilegien zu verlieren. Angesichts der militärischen Ohnmacht gegenüber Russland gingen die territorialen Verluste des Osmanischen Rei-ches an seinen christlichen Rändern ungehindert weiter. Um einen unkontrol-lierten Zerfall zu verhindern, sahen sich die alliierten Mächte mehrmals zu Stützungsaktionen zugunsten des Sultans gezwungen. Im Krimkrieg 1853–1856, nachdem das Osmanische Reich wegen überzogener russischer Forde-rungen zugunsten orthodoxer Christen und wegen der russischen Besetzung der Donaufürstentümer Russland den Krieg erklärt hatte, mussten Frankreich und England dem Sultan zu Hilfe eilen. Dem Vordringen Russlands konnte bei dieser Gelegenheit zwar ein Riegel geschoben werden, nicht aber den Autonomiebestrebungen der Völker Südosteuropas. Im politischen Nach-gang zum Krimkrieg konnten sich die Donaufürstentümer 1858 ihre de facto Unabhängigkeit sichern. Mit dem Einverständnis der Großmächte entstand kurze Zeit später aus den beiden Fürstentümern Moldau und Walachei, die bereits dem gleichen Herrscher unterstellt waren, Rumänien, das 1878 unab-hängig und 1881 ein Königreich wurde. Die «Orientkrise» erreichte ihren Höhepunkt in den 1870er-Jahren. In der ganzen «panslawischen» Welt wurde der Befreiungsnationalismus gegen das «osmanische Joch» zum wichtigsten politischen Traktandum der breiten Be-völkerungsschichten. Die Unterstützung aufständischer herzegowinischer Stämme verwickelte Serbien und Montenegro in einen erneuten Krieg gegen die Osmanen, die sie erst nach der Intervention Russlands zu besiegen ver-mochten. Der Friedenschluss von San Stefano 1878 zwischen Russland und der Hohen Pforte sowie die nachfolgende Friedenskonferenz am Berliner Kongress zeichneten die politische Landkarte auf dem Balkan neu. Das Os-manische Reich sah sich vor vollendete Tatsachen gestellt und musste die Unabhängigkeit Serbiens, Montenegros und Rumäniens auch de iure aner-kennen. Allerdings banden die Schutzmächte Frankreich und Großbritannien die Hoffnung der jungen Balkanstaaten zurück, die Osmanen endgültig vom europäischen Boden zu vertreiben: Österreich-Ungarn besetzte Bosnien-Herzegowina und den Sandžak, und die Bulgaren erhielten lediglich eine Teilsouveränität zugesprochen, die erst 1908 in einer Unabhängigkeitserklä-rung mündete.
Teil C: Regionale Schwerpunkte
332
Der Damm der westlichen Großmächte, der den Zerfall der osmanischen Souveränität über den Balkan verhindern sollte, war nach dem Berliner Kon-gress endgültig gebrochen. Der Befreiungsnationalismus und Irredentismus der jungen Staaten führten zu einem schwierigen Nationsbildungsprozess mit großem Konfliktpotenzial. Bei der Verteilung der osmanischen Erbmasse wurden viele Gebiete wie Bosnien-Herzegowina, Dobrudscha, Kosovo und Makedonien zu umstrittenen Konfliktzonen. In der Regel wurden die Gebiete von verschiedenen Nationalstaaten als angestammte Regionen ihrer Geschich-te und Tradition beansprucht. Diese Auseinandersetzungen sollten trotz der Neuordnung der Staatenwelt nach dem Ersten Weltkrieg die Stabilität auf dem Balkan weiterhin negativ beeinflussen; denn meist wurde der nationalistisch getragene Irredentismus der jeweiligen Völker am grünen Tisch der Groß-mächte zwar übertüncht, aber angesichts des ausgprägten nationalen Selbst-bewusstseins nicht überwunden. Die territorialen Gewinne Serbiens in Rich-tung Süden zogen die systematische Vertreibung von Albanern und Türken aus dieser Region nach sich. Vertreibungen nach ethnischen Kriterien fanden auch in Bulgarien und Griechenland statt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-hunderts wurde der Balkan zum viel zitierten «Pulverfass der Nationen». Im Kosovo wie auch in Makedonien wirken die Folgen bis ins jüngste Zeitge-schehen nach. In den Balkankriegen 1912/1913 wurden die letzten Reste des Osmanischen Reiches auf europäischem Boden unter den Siegerstaaten. Montenegro, Ser-bien, Griechenland und Bulgarien aufgeteilt. Einmal mehr wurde Makedo-nien mit seiner höchst heterogenen ethnischen Struktur zum Zankapfel. Als neue Hegemoniemacht auf dem Balkan versuchte Bulgarien, die Region für sich zu sichern; Serbien und Griechenland verhinderten dies im zweiten Bal-kankrieg. Nun sah sich Serbien beinahe am Ziel seiner irredentistischen Poli-tik, alle serbisch bewohnten Gebiete unter die Herrschaft eines serbischen Nationalstaats zu bringen, denn es erhielt den Kosovo und die Hälfte Make-doniens. Die andere Hälfte fiel Griechenland zu. Die Verlierer dieses 100-jährigen Erbstreites um den osmanischen Besitz waren die Albaner. Die dünne albanische Oberschicht blieb länger als die Eliten der benachbarten Völker dem osmanischen Sultanat loyal ergeben und versuchte hauptsächlich, innerhalb des Osmanischen Reiches einen Auto-nomiestatus zu erkämpfen. Anders als bei den umliegenden orthodoxen Völ-kern spielte die Religion für die Entwicklung eines nationalen Bewusstseins keine einigende, Identität stiftende Rolle. Die Bereitschaft, zum Islam zu konvertieren, war bei den Albanern mindestens so ausgeprägt wie bei der bosnischen Bevölkerung: Zwischen 1650 und dem frühen 19. Jahrhundert waren breite albanische Bevölkerungsschichten zum Islam übergetreten. So entwickelten die Albaner erst viel später einen eigenständigen, gegen die osmanische Herrschaft gerichteten Nationalismus. Noch während des Auf-
3. Südosteuropa
333
standes der Jungtürken (> Glossar) von 1908 kämpften sie auf deren Seite, um innerhalb der neuen Türkei zu ihren Autonomierechten zu gelangen. Aus der Sicht der westeuropäischen Mächte gab es daher keine Albaner und kei-nen albanischen Befreiungskampf. So soll Bismarck am Berliner Kongress gesagt haben: «Es gibt keine albanische Nation.» Erst als es 1912/1913 darum ging, die osmanischen Restgebiete auf europäischem Boden aufzuteilen, konn-ten die Albaner als letztes der größeren Balkanvölker ihre Unabhängigkeit erringen. Aufgrund der Expansion der umliegenden Mächte verblieb aber die Hälfte der mehrheitlich albanisch bewohnten Gebiete unter serbischer, griechi-scher und montenegrinischer Herrschaft. In diesen Gebieten wurden die Alba-ner zur unterprivilegierten Bevölkerungsminorität. Der Zerfall des osmanischen Vielvölkerreiches hinterließ eine Vielzahl neuer Staaten. Allerdings vermochten sich diese kaum zu konsolidieren. Fehlende politische Traditionen ließen keine stabile Staatsführung in den neu geschaf-fenen Monarchien zu; Putsche, Militärverschwörungen und Königsmorde waren an der Tagesordnung. Ein militanter Befreiungsnationalismus und die Kriege gegen das Osmanische Reich belasteten die Nationalwirtschaften. Die rückständigen staatlichen Ökonomien waren ohnehin kaum in der Lage, die Kosten der Eigenstaatlichkeit zu tragen und den Lebensstandard zu verbessern. So kam es den Eliten gerade Recht, die nationalistische Stim-mungslage breiter Bevölkerungsschichten auszunützen, um von dringenden inneren und wirtschaftlichen Problemen abzulenken. Aufgrund der engma-schigen ethnischen Verflechtung in Südosteuropa waren nationalstaatliche Grenzziehungen im Grunde gar nicht möglich, was zu weiteren Expansions-absichten verlockte. So brachte auch der Sieg über das Osmanische Reich keinen Frieden, sondern immer neue Konflikte mit den Nachbarstaaten im Kampf um die Hegemonie in Südosteuropa. Im Ersten Weltkrieg kämpften die einzelnen Staaten gegeneinander, um ihre jeweiligen nationalen Ziele zu verwirklichen: Serbien, Montenegro, Griechenland und Rumänien schlossen sich den Alliierten an, Bulgarien und das Osmanische Reich kämpften auf der Seite der Mittelmächte. Die Konstellation der Balkankriege 1912 und 1913 setzte sich im Ersten Weltkrieg fort.
3.1.4 Die Zwischenkriegszeit (1918–1939)
Nach dem Zerfall Venedigs 1797 zerstörte der Erste Weltkrieg die beiden anderen Vielvölkerreiche, die Südosteuropa über ein halbes Jahrtausend entscheidend geprägt hatten: Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich. Die Pariser Vorortsverträge beendeten die Neugestaltung der politischen Landkarte auf dem Balkan. Der Zerfall Österreich-Ungarns brachte die größ-ten Veränderungen mit sich: Slowenien, Kroatien, Slawonien, die Vojvodina und Dalmatien verließen die Doppelmonarchie und schlossen sich mit den
Teil C: Regionale Schwerpunkte
334
Serben zum Königreich der Slowenen, Kroaten und Serben zusammen – es entstand das erste Jugoslawien. Rumänien konnte sein Territorium um die Regionen Siebenbürgen, große Teile des Banats, die Bukowina, Bessarabien sowie die Süd-Dobrudscha auf das Doppelte erweitern. Das damit verbunde-ne Minderheitenproblem wurde für Rumänien zu einer kaum tragbaren Hy-pothek seiner Geschichte im 20. Jahrhundert: Weit über ein Dutzend Natio-nalitäten steigerten die Minoritätenrate auf beinahe 30 %. Der größte Verlie-rer war Ungarn, das als Teil der Mittelmächte zu den Besiegten gehörte und mit dem Vertrag von Trianon zwei Drittel seiner Territorien an die umlie-genden Staaten abzutreten hatte. Das Trauma von Trianon ist bis heute im kollektiven Gedächtnis der Ungaren haften geblieben. Der Zusammenschluss aller Südslawen der ehemaligen Donaumonarchie mit Serbien und Montenegro unter der serbischen Königsdynastie erschien nur auf den ersten Blick als Umsetzung der südslawischen Staatsidee – eines Ideals des 19. Jahrhunderts, das die Vereinigung aller Südslawen anstrebte. Die Staatswerdung von 1918 entpuppte sich bald als überstürzter Kompro-miss zwischen dem föderativen Konzept der Slowenen und Kroaten einer-seits und dem serbischen Zentralismus andererseits. Serbien erhoffte sich vom Staatsvertrag eine schnelle Umsetzung der serbischen Hegemoniebe-strebungen über alle Südslawen. Die Slowenen und Kroaten sahen den Zu-sammenschluss als eine pragmatische Lösung, um sich unter der Schirm-herrschaft der Siegermacht Serbien dem italienischen Irredentismus zu ent-ziehen, denn die Adriagebiete Kroatiens drohten von Italien annektiert zu werden. Auf dem Prüfstand der gemeinsamen Staatlichkeit erwies sich das Zweckbündnis als brüchig. Aufgrund einer rein national aufgefächerten Par-teienlandschaft schlitterte Jugoslawien von einer Regierungskrise in die nächste. Schließlich löste der jugoslawische König das Parlament 1929 in einem Staatsstreich auf und führte eine Königsdiktatur ein. Erst 1939 wurde ein föderativer Weg eingeschlagen, der im sogenannten Sporazum (Aus-gleich) eine weitreichende Autonomie für die Banschaft Kroatien vorsah. Doch kam dieser Ausgleich am Vorabend des Zweiten Weltkriegs zu spät, um Jugoslawien im Innern zu einen. Ein parlamentarisches, auf Parteienpluralismus beruhendes politisches Sys-tem scheiterte in allen südosteuropäischen Staaten der Zwischenkriegszeit. Spätestens Ende der 1920er-Jahre bestimmten Königsdiktaturen und Militär-putsche das politische Geschehen. In allen Ländern fehlten parlamentarische Traditionen und eine breite Mittelschicht als Trägerin eines parlamentari-schen Systems. Die Eliten waren dünn, durch die Ausrichtung auf einzelne Führerfiguren fragmentiert und auf den eigenen Machterhalt bedacht. Diese oligarchischen Gruppierungen versuchten durch Korruption, Wahlmanipula-tionen und Sturz der jeweiligen Regierung an ihr Ziel zu gelangen. Nicht der Kampf der verschiedenen Staatsformen – Militärdiktatur, Monarchie und
3. Südosteuropa
335
Parlamentarismus – waren hier wegbestimmend, sondern der Verteilungs-kampf zwischen diesen relativ jungen Eliten. Die Bauernparteien wiederum, die das Bauerntum und damit den Großteil der Bevölkerung Südosteuropas zu repräsentieren vorgaben, waren kaum in der Lage, ein parlamentarisches Sys-tem alleine zu stützen; ihnen fehlten nur schon die bildungsmäßigen Voraus-setzungen. Zudem bremste das Wirtschaftskonzept der Bauernparteien, das hauptsächlich auf die Bewahrung bzw. Förderung des agrarwirtschaftlichen Status quo ausgerichtet war, die weitere Wirtschaftsentwicklung. Kaum hatten die jungen Nationalwirtschaften die Talsohle der frühen 1920er-Jahre durchschritten, stellte die Weltwirtschaftskrise alles Erreichte wieder in Frage. Angesichts der kurzen Zwischenkriegszeit und der schwie-rigen weltwirtschaftlichen Bedingungen blieb der sozioökonomische Aufbau unvollständig. Dies musste sich negativ auf die Herausbildung einer demo-kratischen parlamentarischen Gesellschaft auswirken. Seit 1918 standen sich urbane landbesitzende Eliten und pauperisierte bäuer-liche Schichten auf dem Land unversöhnlich gegenüber. Diese soziopoliti-sche Kluft unterhöhlte das Fundament der jungen Demokratien zusehends. Die Bauernbewegungen bildeten ein ständiges Reservoir für revolutionäre Konzepte, die von radikaldemokratischen über nationalistisch-faschistische bis zu sozialistischen Vorstellungen reichten; überall kam der Übergang zur Massendemokratie nach 1918 zu unvorbereitet. Durch die Bankrotterklärung des aus Westeuropa importierten parlamentarischen Systems Ende der 20er-Jahre erwiesen sich Königsdiktaturen als vermeintlich letzte Möglichkeit, die junge Staatlichkeit zu retten. Die sogenannte «Makedonische Frage» – der Kampf um Makedonien zwi-schen Serbien, Bulgarien und Griechenland – blieb durch die Gebietsvertei-lung der Versailler Verträge ungelöst. Damit erhielt die IMRO (Innere Ma-kedonische Revolutionäre Organisation) einen ungeheuren Zulauf in Bulga-rien, wo sie als Terrororganisation und Partei ein «Staat im Staat» wurde. Mehrfach stand das Land am Rande eines Bürgerkrieges. Dies förderte auto-ritäre Kräfte in Bulgarien, was 1934 nach einem Militärputsch schließlich in einer Königsdiktatur endete. In Rumänien sah sich der König durch auf-kommende faschistische Strömungen (Eiserne Garde oder auch «Legion Erzengel Michael») gefährdet, woraufhin er 1938 eine Königsdiktatur mit einer Einheitspartei durchsetzte. Die Legion wurde systematisch verfolgt, was die politische Stabilität weiter zerrüttete. Albanien war aufgrund der desolaten wirtschaftlichen Lage und patriarchalisch geprägter Machtstruktu-ren kaum je ein funktionierender Staat. Zu einer Schlüsselfigur der Zwischen-kriegszeit wurde Ahmed Zogu: Durch einen Putsch 1924 als Premierminister entmachtet, floh er nach Jugoslawien und kehrte mit Waffengewalt wieder zurück. Mit italienischer Unterstützung ließ sich Zogu von der albanischen
Teil C: Regionale Schwerpunkte
336
Nationalversammlung 1928 zum König ausrufen; wirtschaftlich zunehmend von Italien abhängig, musste er jedoch hinnehmen, dass Albanien im Lauf der 1930er-Jahre de facto zu einem Protektorat Italiens wurde. Mit dem Ein-marsch italienischer Truppen 1939 ging auch die de iure Eigenstaatlichkeit wieder verloren. Als der Zweite Weltkrieg Südosteuropa erfasste, waren die einzelnen Staaten also höchst instabil. Revisionistische und nationalistische Kampfparolen bestimmten den Kurs in Bulgarien, Ungarn und Rumänien. Die Bemühungen der Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg, stabile Bündnissysteme in Südost-europa zu schaffen, hatten wenig Erfolg gezeigt. Die von Frankreich geför-derte sogenannte Kleine Entente zwischen Jugoslawien, Rumänien und der Tschechoslowakei zerbrach. Der nach 1933 zunehmende Machteinfluss Deutschlands polarisierte die ohnehin divergierenden Interessen der Bünd-nispartner. Das Dritte Reich hatte Frankreich als wichtigsten Handelspartner auf dem Balkan abgelöst, was auch Frankreichs politisches Sicherheitssys-tem aushöhlte: Bulgarien, Rumänien und Jugoslawien waren längst in eine wirtschaftliche Abhängigkeit von Deutschland geraten. Als erfolglos erwiesen sich auch der Balkanbund und zuletzt der Balkanpakt zwischen Jugoslawien, Griechenland und Rumänien. Dieses Bündnis hätte dem Vordringen des faschistischen Italien und seines Verbündeten Bulgarien einen Riegel schieben sollen. Denn nach der Demütigung durch die Pariser Vorortsverträge strebte Bulgariens Außenpolitik mehr denn je eine Wieder-herstellung der Grenzen des San-Stefano-Vertrages an: Ziel war ein Groß-bulgarien. Mit dem Anfang des Krieges 1939 nutzte Deutschland geschickt den schwelenden Revisionismus, den rechtsradikalen Nationalismus und die wirtschaftliche Abhängigkeit der verbündeten Balkanstaaten Ungarn, Rumä-nien und Bulgarien, um seine Hegemonie über Südosteuropa bis 1940 durchzusetzen. Jugoslawien und Griechenland wurden 1941 militärisch be-setzt und den Siegern zugeschlagen: Bulgariens Besitzansprüche auf make-donische Gebiete wurden ebenso erfüllt wie diejenigen Italiens, das die Ziele seines Irredentismus vollständig verwirklicht sah. Mussolini erhielt die dal-matinische Küste, Albanien, den Kosovo und Teile Bosnien-Herzegowinas. Ungarn bekam hingegen nur die Gebiete zurück, die es durch den Trianon-Vertrag verloren hatte. Daneben entstand unter deutscher Ägide ein faschis-tischer Unabhängiger Staat Kroatien (nach der kroatischen Bezeichnung abgekürzt NDH), der auch den größten Teil Bosniens und der Herzegowina erhielt. Zentralserbien wurde zum deutschen Protektorat.
3. Südosteuropa
337
3.1.5 Vom Zweiten Weltkrieg bis zum Zusammenbruch der kommunistischen Systeme 1939–1989/1991
Die deutsche Besatzung und der antifaschistische Kampf führten in Grie-chenland und in Jugoslawien zu verheerenden Bürgerkriegen, die tiefe Spu-ren im kollektiven Gedächtnis der Völker hinterließen. Nach dem Rückzug der Deutschen aus Griechenland 1944 entbrannte ein Kampf zwischen lin-ken, von kommunistischen Ländern – vor allem Jugoslawien und Bulga-rien – unterstützten Kräften einerseits und dem konservativ-monarchischen Lager anderseits. Insbesondere die USA ließen der konservativen Gruppie-rung Hilfe zukommen, um das kommunistische Element in Südosteuropa einzudämmen. Erst 1949 gaben die Kommunisten Griechenlands den Kampf auf. Als einziges südosteuropäisches Land vermochte sich Griechenland dem kommunistischen Einfluss zu entziehen. 1952 trat Griechenland der Nato und 1979 der Europäischen Gemeinschaft bei. Auch in Jugoslawien formierten sich verschiedene Widerstandsbewegungen. Die serbischen Četnik-Verbände mit einer monarchisch-nationalistischen Aus-richtung kämpften gegen die faschistischen Besatzungsmächte: sowohl gegen die Deutschen als auch gegen die sogenannten Ustaša-Verbände des NDH-Staates, der alle Minderheiten systematisch zu vernichten suchte. Deutschland hatte dem faschistischen Kroatien beinahe ganz Bosnien zugeschlagen, wo die Serben die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe stellten. In Anlehnung an das nationalsozialistische Rassenprinzip liess das NDH-Regime, Juden, Roma und vor allem Serben verfolgen. Unter dem NDH-Terror kamen mindestens 350000 Menschen um. Der Hauptfeind der Četniks wurden allerdings die kommunistischen Partisanen Josip Broz Titos. Der Befreiungskampf und der äußerst brutal geführte Bürgerkrieg forderten von Jugoslawien einen hohen Blutzoll – betroffen war vor allem die zivile Bevölkerung, da der gärende nationalistische Revisionismus der Vorkriegszeit nun in ethnischen Säuberun-gen umgesetzt wurde. Mit Ausnahme der Sowjetunion hatte Jugoslawien im Zweiten Weltkrieg proportional betrachtet die größte Opferrate. Titos Partisanen gewannen schließlich die Oberhand. Ihr Erfolg beruhte jen-seits aller ethnisch-nationalistischen Gräben auf einer kommunistischen Ideologie, die sich militärisch nur gegen die deutschen und italienischen Besatzer und Kollaborateure richtete. Im Gegensatz dazu scheuten die ande-ren Widerstandsgruppen bei der Durchsetzung ihrer nationalistischen Ziele nicht davor zurück, mit der Besatzungsmacht zu kooperieren. Je brutaler der Bürgerkrieg zwischen den Ethnien geführt wurde und je mehr die Kollabora-tionsbereitschaft der anderen Widerstandgruppen zunahm, desto größeren Zulauf gewannen die Partisanen. 1945 war Jugoslawien das einzige Land mit einer eigenständigen kommunistischen Führung, das hauptsächlich aus eige-ner Kraft den Befreiungskampf hatte gewinnen können. So entstand 1945 ein
Teil C: Regionale Schwerpunkte
338
(nach 1918) zweites Jugoslawien, nun aber unter Führung einer kommunisti-schen Partei. Die westlichen Alliierten unternahmen nichts gegen das Vordringen der sowjetischen Truppen in Südosteuropa. Bis 1945 hatte die Sowjetunion durch ihren raschen militärischen Vorstoß in Südosteuropa vollendete Tatsachen geschaffen: Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien und Albanien gehörten ihrem Einflussgebiet an. Das Abkommen zwischen Churchill und Stalin aus dem Jahre 1944 über eine Abgrenzung der Interessensphären in Südosteuropa war Ende des Krieges längst hinfällig geworden – gemäß dieser informellen Über-einkunft hätte Großbritannien 90 % der Einflusskontrolle über die Nach-kriegsordnung in Griechenland und 50 % in Ungarn und in Jugoslawien erhal-ten sollen. In Bulgarien und Rumänien verhalf die Rote Armee (> Glossar) den lokalen kommunistischen Parteien bis 1948 zur absoluten politischen Kontrolle: Die übrigen Parteien wurden durch massive Manipulationen, die Besetzung des Militär- und Polizeiapparates, Repressionen und Verleum-dungskampagnen entmachtet und schließlich verboten. Die Durchsetzung der kommunistischen Einparteienherrschaft war nur mit Zwang zu realisie-ren, da in Rumänien wie auch in Bulgarien kommunistische Parteien kaum eine Tradition besaßen. Ihre Macht musste von Grund auf neu aufgebaut werden – umso willfähriger waren die neuen kommunistischen Parteikader gegenüber Moskau. Die Gesellschaften wurden Schritt für Schritt dem sow-jetischen Muster angepasst und zu loyalen Satellitenstaaten der Sowjetunion umgepolt. Die neuen Volksdemokratien sollten nach dem Wunsch Stalins nur noch lokale Varianten der Sowjetunion sein, die kommunistischen Par-teien als Marionetten Moskaus dienen. Die Entstalinisierung unter Chruščev ab 1956 schuf Freiräume, in denen sich der absolute Machtanspruch der Sowjetunion und die totale Kontrolle über die Satellitenstaaten aufzuweichen begannen. Die Ansprüche der Satelliten-staaten auf nationale Unabhängigkeit und Gleichberechtigung mit der Sow-jetunion wurden immer spürbarer; lediglich Bulgarien wies im sozialisti-schen Lager Südosteuropas bis in die 1980er-Jahre die größte Regimetreue auf. Rumänien suchte nach 1963 einen eigenständigen politischen und wirt-schaftlichen Weg. Die innen- und außenpolitische Umorientierung führte zu einer Annäherung an China. Maßgeblich daran beteiligt war Nicolae Ceauşescu, der 1965 zum Generalsekretär der rumänischen kommunisti-schen Partei aufstieg. Die erste Entwicklungsphase gestaltete sich durchaus positiv: So weigerte sich Rumänien 1968, am Einmarsch des Warschauer Paktes (> Glossar) in die Tschechoslowakei teilzunehmen. Die emanzipierte rumänische Außenpolitik verurteilte das Vorgehen des Warschauer Paktes scharf. Doch im Laufe der 1970er-Jahre verschärfte Ceauşescu die Repressi-
3. Südosteuropa
339
on in der Innen- und Außenpolitik. Er setzte eine persönliche Diktatur durch und sicherte seine Macht mittels einer zunehmend totalitären Kontrolle durch die Geheimpolizei (Securitate). Sein Regime stützte sich auf einen überzeich-neten Personenkult und nationalistischen Chauvinismus. Massive wirtschaftli-che Fehlinvestitionen und das diktatorische Regime führten in den 1980er-Jahren zur einer katastrophalen Versorgungslage der Bevölkerung – die relativ isolierte Stellung Rumäniens im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (> Glossar) trug ebenfalls dazu bei. Vor dem Hintergrund der Reformpolitik Gorbačevs wandte sich ein Teil der Elite 1989 schließlich gegen den Dikta-tor und gewann rasch die Hilfe der rumänischen Bevölkerung. In einem all-gemeinen Volksaufstand wurde Ceauşescu entmachtet und hingerichtet. Die Ereignisse brachten schließlich reformkommunistische Eliten an die Macht. Weit schwieriger gestaltete sich die sowjetische Machtentfaltung nach dem Zweiten Weltkrieg im titoistischen Jugoslawien und in Albanien. Jugosla-wiens kommunistische Partei hatte den Kampf gegen die faschistischen Besat-zungsmächte aus eigener Kraft gewonnen. Entsprechend selbstbewusst trat sie bei der Durchsetzung ihrer strategischen Nachkriegsziele auf, obwohl sie nach wie vor – zumindest vordergründig – den innen- und außenpolitischen Kurs Stalins verfolgte. Doch Tito stellte Stalins Primatsanspruch in Südosteuropa zunehmend in Frage, was 1948 zum Bruch zwischen Jugoslawien und der UdSSR führte. Die Sowjetunion brach alle Wirtschaftsverbindungen ab und schloss den abtrünnigen sozialistischen Bruderstaat aus der Kominform (Nachfolgeinstitution der Komintern > Glossar) aus. Aus dem Konflikt ent-spann sich eine ideologische Propagandaschlacht, in der der Bund der Kommunisten Jugoslawiens (SKJ) auf die Möglichkeit eines selbstständigen sozialistischen Wegs pochte und der Sowjetunion das alleinige Interpretati-onsrecht des Marxismus-Leninismus absprach. Die jugoslawischen Kommu-nisten warfen dem Marxismus-Leninismus stalinistischer Auslegung in ers-ter Linie vor, die sowjetische Partei habe sich mit dem Staatsapparat identi-fiziert. So gehöre das gesellschaftliche Eigentum immer mehr dem Staat, anstatt allmählich in die Hände der Produzenten zu gelangen, wie es Lenin ursprünglich vorgesehen hatte. Tatsächlich war der ideologische Grabenkampf lediglich eine im Nachhinein konstruierte Rechtfertigung für unüberwindbare strategische Interessenkon-flikte zwischen Moskau und Belgrad. Titos Kommunisten hatten den Sieg der kommunistischen Partei unter Enver Hoxha in Albanien tonangebend unterstützt, weshalb sie den albanischen Kommunisten höchstens die Bedeu-tung eines Juniorpartners zuerkannten. Da Tito auch Bulgarien und Grie-chenland als seine Einflusszone betrachtete, strebte er eine Föderation mit Albanien, Bulgarien und Griechenland unter jugoslawischer Führung an: Sein Ziel war es, die strategische Hegemonie in Südosteuropa an sich zu reißen. Titos unanfechtbare Stellung innerhalb der Partei und seine eigen-
Teil C: Regionale Schwerpunkte
340
ständige, ohne Rücksicht auf die Interessen Moskaus vorpreschende Außen-politik provozierten schließlich eine harsche Reaktion Stalins. Daraufhin suchte Jugoslawien eine wirtschaftliche und außenpolitische An-näherung an den Westen. Grundpfeiler des gesamten jugoslawischen Kon-zepts während des Kalten Krieges (> Glossar) blieb aber eine neutrale Politik zwischen den Blöcken. So wurde Tito zum Mitinitiator und zur leitenden Figur innerhalb der Bewegung der Blockfreien Staaten (> Glossar). Innenpo-litisch versuchte man mit verschiedenen Ansätzen, das Ideal einer Arbeiter-selbstverwaltung umzusetzen, die eng mit dem politischen Modell verzahnt werden sollte. Der zum Mythos beschworene Partisanenkampf gegen den Faschismus wurde zum wichtigsten Identifikationsmodell des neuen Jugos-lawien. Eine Aufarbeitung des nationalistisch aufgeladenen Bürgerkrieges zwischen 1941 und 1945 wurde vermieden. Um neue nationalistische Strö-mungen Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre aufzufangen, gestal-tete Tito Jugoslawien föderalistisch um, die Kompetenzen der einzelnen Republiken wurden erheblich erweitert. Um gleichzeitig divergierende Kräf-te zu unterbinden, wurde die Partei im Innern gestärkt und auf einen gemein-samen Kurs gebracht. Die (kon-)föderale Strukturen sollten durch die linien-treuen Parteikader in allen Republiken kompensiert werden. Der Tod des charismatischen Parteichefs Tito 1980 legte offen, wie brüchig das kommunistische System bereits war. Gerade in den Parteikadern zeigten sich bald massive nationale Spannungen; die kommunistischen Parteien in den Republiken verfolgten zunehmend ihre eigenen Interessen. In Serbien begann der Aufstieg Slobodan Miloševićs, der sich zum Sprachrohr serbi-scher nationaler Forderungen machte. Auf der anderen Seite lehnten die Republiken Kroatien und Slowenien den großserbischen Hegemoniean-spruch innerhalb Jugoslawiens strikt ab. Die Unabhängigkeitserklärungen Sloweniens und Kroatiens 1991 läuteten den Krieg zwischen den ehemaligen «Bruderrepubliken» ein, 1992 bis 1995 folgte der Bürgerkrieg in Bosnien. Damit war auch das zweite Experiment «Jugoslawien» gescheitert. In Albanien verfolgte der kommunistische Parteichef Enver Hoxha nach dem Zweiten Weltkrieg ebenfalls einen selbstständigen Weg des Sozialismus (> Glossar). Beim Bruch Titos mit Stalin bekannte sich Hoxha noch deutlich zu Moskaus Führungsanspruch: Angesichts der prekären Lage Titos inner-halb des kommunistischen Lagers erschien es dem albanischen Parteichef ratsam, sich von seinem ehemaligen Mentor zu distanzieren. Zudem konnte Hoxha damit aus dem Schatten Titos heraustreten und angesichts der geo-strategischen Lage Albaniens zum umhätschelten Partner Moskaus in der Region werden. Allerdings distanzierte sich Hoxha bereits 1960 von der UdSSR und geißelte die Entstalinisierungspolitik als Revisionismus und Verrat am marxistisch-leninistischen Ideal. Dem Bruch mit der Sowjetunion
3. Südosteuropa
341
folgte die Annäherung an die neue Schutzmacht China, da Albanien ohne massive Wirtschaftshilfe nicht überlebensfähig war. Doch die abnehmende Bereitschaft Chinas, Albanien weiterhin finanziell zu unterstützen, führte 1978 zum Bruch: Das Außenhandelsdefizit Albaniens gegenüber China hatte astro-nomische Höhen erreicht, und nach 1975 hatte China angefangen, Rückzah-lungen zu verlangen. In der Folge schottete sich Albanien immer mehr ab. Das Streben nach finanzieller und politischer Unabhängigkeit mündete in die Selbstisolation, während die Mangelwirtschaft katastrophale Züge annahm. Albanien fehlten schlichtweg die Mittel, um das Land aus eigener Kraft zu modernisieren. Bis zu seinem Tod 1985 regierte Enver Hoxha das Land mit einem totalitären Machtapparat, wobei «Säuberungen», Terror und Zwangs-umsiedlungen nach stalinistischem Muster an der Tagesordnung waren. In-sofern vollzog Albanien als letztes Land in Südosteuropa eine «Entstalinisie-rung». Als das Land 1991 – nach den ersten freien Wahlen – in das Zeitalter der Transformation eintrat, lag es wirtschaftlich und soziopsychologisch am Boden. 40 Jahre kommunistische Herrschaft hatten zwar althergebrachte soziale Strukturen zerschlagen, aber keine funktionierende Zivilgesellschaft hervorgebracht. So gestaltete sich der Neuaufbau äußerst schwierig.
3.2 Vertiefender Exkurs I: Traditionelle Sozialformen in Südosteuropa Südosteuropa zeichnet sich durch eine ausgeprägte geografische Zerkamme-rung aus. Verschiedene mächtige Gebirgszüge, das Dinarische Gebirge, der Pindos-Gebirgszug, das Rhodopen-Massiv und das Balkangebirge (Stara Planina) prägen das Relief. Die abgeschiedenen und isolierten Gebiete erstrecken sich von der adriatischen Küste und Montenegro im Nordwesten bis zu Thessalien und Epiros im Südwesten. Zwar machten in der Geschichte Südosteuropas mehrere Großreiche ihre Oberhoheit über diese Region und deren Bevölkerung geltend, doch keine vermochte das Gebiet vollständig zu durchdringen. An der Peripherie Roms, Byzanz’, Venedigs, des Osmani-schen Reiches und des Habsburger Reiches blieben Rückzugszonen und Reliktgebiete erhalten. Hier entwickelten bzw. hielten sich spezifische sozia-le und kulturelle Muster des Zusammenlebens, für welche die Wissenschaft den Ausdruck «pastorale Gesellschaften» geprägt hat. Charakteristische Zü-ge dieser Gesellschaften sind Formen der Weidewirtschaft, Transhumanz (> Glossar) und Nomadismus sowie das Fehlen eines ausgeprägten Acker-baus. Die pastoralen Gesellschaften wechselten zwischen Sommer- und Winterweiden, wobei die sesshaften Stämme in der Regel eine Tal- und Alpwirtschaft betrieben. Nomaden- und Halbnomaden hatten hingegen keine permanenten Winter- und Sommerdörfer, sondern lebten in Hütten – eine Lebensweise, die bei den Aromunen und insbesondere bei den Sarakatsanen
Teil C: Regionale Schwerpunkte
342
(wahrscheinlich vlachischer Abstammung) bis in die 1970er-Jahre des 20. Jahrhunderts überlebt hat. Dabei weidete man die Herden im Winter in den Küstengegenden und im Tal, im Sommer trieb man sie über weite Entfer-nungen (Transhumanz) in die höher gelegenen Gebirgslandschaften. In diesen Regionen erstarrten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Mechanis-men des menschlichen Zusammenlebens, die in den letzten 20 Jahren zu einem wichtigen Schwerpunkt der Geschichtsforschung in Südosteuropa geworden sind: In Überwindung einer rein ethnozentrierten und in Südosteu-ropa höchst nationalistischen Geschichtsschreibung nimmt die Forschungs-richtung der Historischen Anthropologie den Menschen in seinem kulturel-len, wirtschaftlichen und zeitlichen Umfeld in den Fokus. Politik- und Er-eignisgeschichte treten dabei in den Hintergrund, die Forschung konzentriert sich auf lebensweltliche Zusammenhänge wie die Heirats- und Erbschafts-muster, soziale Netzwerke, Familie und Familienideologie, Verwandtschafts-verhältnisse, Geschlechterbeziehungen, spezifische Arbeitsorganisationen und die Rolle des Alters. Ein weiterer zentraler methodischer Ansatz ist der des historischen Kulturvergleichs: Der komparatistische Ansatz hilft, Zivilisati-onsmuster einander gegenüberzustellen und Mischzonen herauszuarbeiten, da reine Ost-West Konstruktionen höchstens wertend, aber wenig erhellend sind. Grob unterteilt, überschneiden sich in Südosteuropa drei Zivilisationsmuster mit spezifischen Eigenschaften. Im Unterschied zum Westen herrschte nicht das gleichberechtigte, individua-lisierte Erbe beider Geschlechter vor, sondern der Besitz blieb innerhalb der Sippe bzw. Großfamilie: Alle Männer waren am Kollektivbesitz beteiligt, während die Frauen weder erbberechtigt noch rechtsfähig waren. Weiter galt das Senioratsprinzip (> Glossar), die Herrschaft der älteren über die jüngeren Männer. Dieses Prinzip ermöglichte – anders als im westlichen Zivilisati-onsmuster – ein frühes Heiraten, da die Eheschließung nicht von der finan-ziellen Möglichkeit des Bräutigams abhing, einen eigenen Hausstand zu gründen. Im Gegensatz dazu war westlich der sogenannten Hajnal-Linie ein hohes Heiratsalter mit vielen Ledigen die Regel, da hier Individualbesitz, Erbrecht und zum Teil auch die Erbzersplitterung die finanziellen Startbe-dingungen für junge Männer erschwerten. Der Lebensmittelpunkt in den pastoralen Gesellschaften blieb die Großfami-lie und deren kollektiver Besitz. Dies war nur möglich, weil pastorales Wirt-schaften weit weniger Bodenrechtsfragen aufwirft – und zu regeln hat – als Ackerbau und Grundbesitz. Die sozialen Grundstrukturen blieben männer-zentriert, was ein ausgeprägtes Patriarchat hervorbrachte. Im Unterschied zu den Beckengegenden waren die Gebirgslandschaften des Balkans kaum von herrschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen erfasst. Die Sippe selbst musste eine Vielzahl von überlebensnotwendigen Funktionen sicherstellen:
3. Südosteuropa
343
Die Verteidigung, die wirtschaftliche Autarkie und eine Arbeitsteilung, die bei der Bewältigung der schwierigen Umweltbedingungen einen hohen Grad an geschlechtsspezifischer Rollenverteilung voraussetzte. Da sich in diesen peripheren Gegenden weder konfessionelle noch ethnische Identifikationsele-mente durchsetzten, blieb ein ausgeprägter familienzentrierter Ahnenkult das wichtigste Symbol des Zusammenhalts. Die Frau heiratete lediglich in eine Familie ein; allein der Mann galt als Hüter und Verteidiger des Ahnenkults. Die Lebensgemeinschaften stützten sich auf diese Struktur strikt patrilinearer Abstammungsgruppen. Ein weiteres Unterscheidungskriterium beim Vergleich der Zivilisationsmus-ter ist die Form der sozialen Beziehungen: Welche Art der Konfliktregelung herrscht vor? Wie werden Freundschaft und Feindschaft gehandhabt? In der Regel unterscheidet die Wissenschaft drei Grundformen. In Westeuropa wurden die Sozialbeziehungen bereits im Mittelalter institutionalisiert und zum Beispiel im Lehnswesen in vertragliche respektive verschriftlichte For-men überführt; daraus sollten später Behörden entstehen. In mediterranen Raum sowie in Ost- und Südosteuropa institutionalisierten sich die sozialen Beziehungen viel später; hier regelten Netzwerke auf traditioneller kliente-listischer Basis das soziale Zusammensein. In den Gebirgsgegenden des Balkans schließlich waren hauptsächlich verwandtschaftliche Beziehungen entscheidend: Die komplexe Familie oder Sippe, die mehrere Generationen und alle männlichen Mitglieder umfasste, war das tragende Element dieser pastoralen Gesellschaft. Obwohl schwierig nachzuweisen, scheint diese Ge-meinschaftsform bereits früh von den Völkern des Balkans entwickelt wor-den zu sein, um unter schwierigen ökonomischen, politischen und ökologi-schen Bedingungen das Überleben im Gebirge zu sichern. Im Speziellen ging die Forschung der Frage nach, warum diese soziale Ord-nung gerade bei den Albanern, Vlachen und vereinzelten slawischen Grup-pen – insbesondere bei den Montenegrinern – so lange überdauern konnte. Die eindringenden Stämme der Völkerwanderung vertrieben die romanisier-ten altbalkanischen Bevölkerungsgruppen (Vlachen) und die Albaner aus den Ebenen und Küstengebieten in die Gebirgsregionen. Die flüchtende Be-völkerung musste dort die Lebensweise der viehwirtschaftenden Urbevölke-rung übernehmen, um sich an die neue Lebenswelt anzupassen. Die nachrü-ckenden slawischen Stämme blieben in den Ebenen, Tälern und Küstenge-bieten. Sie bauten langsam eine soziale und wirtschaftliche Ordnung auf, die auf Ackerbau beruhte und im Hochmittelalter feudalähnliche Strukturen hervorbrachte. Die Bulgaren und Serben waren sich der Unterschiede zwi-schen ihrer Lebensweise und derjenigen der pastoralen Bevölkerung wohl bewusst: So unterscheiden mittelalterliche serbische Gesetzbücher zwischen Vlachen und der eigenen Bevölkerung anhand der Wirtschaftsweise und des Lebensortes.
Teil C: Regionale Schwerpunkte
344
Die osmanische Eroberung des Balkans führte im 14. und 15. Jahrhundert zu neuen Wanderbewegungen. Die agrarischen und herrschaftlichen Strukturen wurden durch die Osmanen zerstört, Christen durften keinen Grund und Bo-den mehr besitzen. Teile der slawischen Bevölkerung zogen sich auf der Flucht vor den Osmanen in den Norden, auf die ostadriatischen Inseln und in die Gebirgsregionen zurück: die Bulgaren in die Sredna Gora und die Serben in die Karstregionen Montenegros. In ihren Rückzugsgebieten mussten sie sich schnell den neuen Lebensbedingungen anpassen und übernahmen das sozioökonomische Erbe der pastoral lebenden Lokalbevölkerung. Der lang andauernde Widerstandskampf gegen die Osmanen hatte die komplexen hie-rarchischen Strukturen zwischen den feudalen Eliten und der bäuerlichen Schicht ausgehöhlt – schließlich war die die alte christliche Elite ausgelöscht. Eine neue osmanische Ordnung hatte sich in dieser Übergangszeit kriegsbe-dingter Wüstungsphänomene nicht durchsetzen können. Das Entstehen von Stammesgesellschaften sowie von Verwandtschafts- und Geschlechterverbän-den kann als Antwort auf die zerrütten Lebenswelten und den Rückzug in die Gebirgsregionen verstanden werden. Die Selbstorganisation mit einer Regelung der Sommer- und Winterweidetä-tigkeit (Katun > Glossar) sowie ein mündlich tradiertes Gewohnheitsrecht waren überlebensnotwendig. Bei den Montenegrinern bildeten sich patriar-chalische Stammesorganisationen aus, weil hier die Sommer- und Winter-weiden nahe beieinander lagen, was eine klare Abgrenzung fester Stammes-territorien ermöglichte. Bei den Albanern fand diese Entwicklung ebenfalls statt, war jedoch wegen der größeren Distanzen weniger ausgeprägt; die Territorialisierung des Katun und die Stammesbildung stellten einen lang-samen Prozess dar, der sich bis ins 18. Jahrhundert erstreckte. In den Sied-lungsgebieten der Vlachen lagen die Winter- und Sommerweiden noch weiter auseinander, was die Territorialisierung behinderte und nomadisierende Le-bensweisen stützte: Tendenziell blieben hier eher Verwandtschafts- und Ge-schlechterverbände vorherrschend. Als sich die Vlachen im 16. und 17. Jahr-hundert vom Habsburger Reich für die Ansiedlung an der Militärgrenze an-werben ließen, brachten sie ihre spezifische Lebensweise in das Gebiet der heutigen Krajina (im heutigen Kroatien) mit. Auch hier erwies sich die soziale Organisationsform als äußerst geeignet, den rauen Lebensbedingungen zu trotzen: Diese Lebensart entsprach den Anforderungen des Wehrbauerntums und wurde in den Valachenprivilegien (statuta valachorum) von 1630 schrift-lich festgehalten. Obwohl diese sozioprofessionelle Gruppe relativ schnell zum Ackerbau überging, bewahrte sie Eigenheiten ihrer Vorfahren. Sie über-gab das Modell an die anderen Siedler, die sich an der slawonisch-kroatischen Militärgrenze niederließen und gar keine Vlachen waren. So perpetuierten die besonderen Lebensbedingungen und die statuta valachorum archaische Le-bensformen auch weit vom ursprünglichen Entstehungsgebiet entfernt.
3. Südosteuropa
345
Es stellt sich weiter die Frage, warum sich während der osmanischen Herr-schaft die pastorale Lebensweise auch außerhalb des Grenzerwesens nicht abschwächte, sondern im Gegenteil weiterentwickelte. Dies hängt vor allem mit der tributären Verwaltungspraxis des Osmanischen Reiches zusammen: Die Hohe Pforte verzichtete darauf, alle Gebiete verwaltungstechnisch zu durchdringen, und beschränkte sich darauf, über lokale Organisationseinhei-ten den Tribut, die Steuern und andere Abgaben sicherzustellen. Der einzel-ne Untertan musste dafür nicht von einer zentralen Administration – einer sogenannten intervenierenden Verwaltungspraxis – erfasst werden. Das Inte-resse der Osmanen an den kargen Gebirgsgegenden war ohnehin schwach und die Oberhoheit entsprechend nur lose verankert. Die osmanische Herr-schaft begnügte sich mit zeitlich beschränkten Machtdemonstrationen im Falle lokaler Aufstände. Die vorgefundenen Gewohnheitsrechte wurden anerkannt und als regional geltende Kanune (> Glossar) dem osmanischen Recht zugesellt; verschiedene Varianten des albanischen Gewohnheitsrech-tes überlebten in mündlich tradierter Form bis ins 20. Jahrhundert, als sie schriftlich festgehalten wurden. Der sogenannte Kanun des Lekë Dukagjini wurde für die Forschung eine wichtige Quelle, um die rechtliche Praxis in den pastoralen Gesellschaften des Balkans nachzuvollziehen. Auch die Reli-gionsgemeinschaften wurden von der osmanischen Administration nicht angetastet: Da die Sorge um die jenseitige Welt durch die Schwäche zentra-ler religiöser Institutionen in der Verantwortung einzelnen Stämme und Fa-milien blieb, überlebten familien- und stammeszentrierte Ahnenkulte, die wiederum die patriarchale Abstammungsideologie stärkten. Die osmanische Administration griff also kaum in die lokalen Strukturen ein und bot weder lokale regulierende Behörden noch Richtlinien für das alltägliche Leben. Andererseits verhinderte die osmanische Oberhoheit, dass sich stammes-übergreifende Herrschaftsstrukturen etablieren konnten. Das daraus entstehende Vakuum füllten die überlieferten traditionellen Stammes- und Sippenmuster. So konservierte die osmanische Herrschaft diese pastorale Welt bis ins 19. und 20. Jahrhundert – erst dann brachte die Nationswerdung der einzelnen Völker neue soziale Ordnungen hervor, welche die alten Lebensweisen nur allmählich und gegen viel lokalen Widerstand zu verdrängen vermochten.
3.3 Vertiefender Exkurs II: Nationalismus und die Entstehung von Nationen in Südosteuropa Die Idee des Nationalismus und das Konzept des Nationalstaates im Westeu-ropa des ausgehenden 18. Jahrhunderts trugen Elemente in sich, die sich hoch explosiv auf die südosteuropäische Gemeinschaft auswirkten. Dazu gehörten erstens die Erfindung des Volkes als Kulturträger in der Folge von Romantik und Aufklärung: Die Sprache erhielt eine erstrangige Bedeutung
Teil C: Regionale Schwerpunkte
346
als Trägerin der Volkskultur. Zweitens die Abkehr vom dynastischen Staats-prinzip und einer vertikalen Herrschaftsauffassung: Das Volk sollte sich emanzipieren und sich entscheidend an der politischen Willensbildung betei-ligen. Drittens schließlich die zunehmende soziale Differenzierung der Ge-sellschaften in Südosteuropa, welche neue junge Eliten hervorgebracht hatte: Diese suchten Herrschaftsmodelle, um ihr sozio-nationales Bewusstsein in politische Vorrechte umzumünzen. Dieser Katalog von Forderungen stieß Nationsbildungsprozesse an, die im-mer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen führten und bis heute nicht abgeschlossen sind. So wurde die bosnisch-muslimische Nation erst 1963 amtlich festgehalten; die Infragestellung der jungen, zwischen serbi-schem und kroatischem Nationalismus bedrängten Nation mündete in den Bosnienkrieg von 1992 bis 1995. Die Ethno- und Nationsgenese der Make-donen wiederum erhielt 1944 einen wichtigen Schub, als Tito in einem for-cierten Nationsbildungsprozess die Makedonier offiziell zu einer Nation erklärte: Im übersteigerten Selbstverständnis des bulgarischen und serbi-schen Nationalismus hatte es nie Makedonier gegeben, sondern nur Bulgaren oder Serben, die ihre wahre nationale Heimat aufgrund der Geschichte verlo-ren hatten; gemäß dieser Argumentation galt es, diese Gebiete und deren Bevölkerung wieder zu befreien. Die Liste dieser problematischen und im-mer noch nicht abgeschlossenen Nationsbewusstseinsprozesse ließe sich beliebig fortsetzen. Diese Entwicklung darf nicht erstaunen. Die Idee des Nationalismus und das Konzept des Nationalstaates waren in Ländern entstanden, in denen die dy-nastischen Herrschaftsgebilde bereits sprachliche, kulturelle und religiöse Interessengemeinschaften hervorgebracht hatten. Nationswerdung und Nati-onalismus halfen hier vor allem, die demografischen Umwälzungen der in-dustriellen Revolution aufzufangen – nachdem die Dorfgemeinschaft auf-grund der Urbanisierung zerbrochen war, suchte man nach supralokalen Identifikationsmustern. Daneben trug der Begriff der Nation revolutionäre Elemente: In einer Bewegung von unten wurde der Untertan zum Staatsbür-ger. Im Gegensatz dazu prallte das westeuropäische Konzept in Südosteuro-pa auf traditionelle, vorindustrielle, multikonfessionelle und ethnisch außer-ordentlich gemischte Gesellschaften, die sich unter osmanischer und habs-burgischer Herrschaft befanden. Der antiosmanische Befreiungskampf, das Bewusstsein, eine Nation zu sein, und der Schritt von einer archaisch-agrarischen zu einer modernen Massengesellschaft trafen in Südosteuropa in einer verhängnisvollen Weise zeitlich zusammen. Gerade für das Osmani-sche Reich waren traditionelle Multiethnizität und konfessionelle Durchmi-schung charakteristisch gewesen: Gesellschaftliche Homogenisierungspro-zesse, wie sie die absolutistischen Staaten gekannt haben, etwa der viel zi-tierte Grundsatz cuius regio eius religio, blieben hier fremd. Doch auch der
3. Südosteuropa
347
Freiraum für die Entstehung von Willensnationen war nicht gegeben; denn der Schritt von der Ethnie zur Nation hätte über eine politische Emanzipation geführt, die auch die Oberhoheit des Sultans in Frage gestellt hätte. Sowohl das habsburgische als auch das osmanische Herrschaftssystem wa-ren zu sehr erstarrt, um dem Freiheitswillen der untergebenen Völker mit einer föderativen Umgestaltung zu begegnen. Die Reformen des Tanzimats propagierten zwar eine supranationale Staatsidee des Osmanismus und ein einheitliches Staatsbürgerrecht für alle Reichsbewohner, das 1856 tatsäch-lich erlassen wurde; doch die Reformen wurden angesichts innerer Wider-stände nicht umgesetzt. Vielmehr gewann nach 1876 ein türkischer Nationa-lismus zunehmend Einfluss und errang mit der Revolution der Jungtürken 1908 die Oberhand. Der Osmanismus hatte die Chance verpasst, aus den Untertanen des Sultans supraethnische osmanische Bürger zu formen. Der Kampf der jungen Nationen gegen das Sultanat richtete sich bald gegen die Nachbarvölker. Durch die ethnische, sprachliche und konfessionelle Durchmischung war es schwer, nationale Grenzen zu ziehen. Da die Verei-nigung der eigenen Volksgruppen und derer Territorien zum Prinzip des Nationalstaats erhoben wurde, sprach man oftmals den umliegenden Ethnien eine eigene nationale Identität ab. Das Ziel war, möglichst große Bevölke-rungsgruppen benachbarter Völker der eigenen Nationalität zuzuschlagen; so galten die Makedonier für die Bulgaren als Bevölkerungselemente bulgari-scher Identität. Exemplarisch lässt sich dieses Phänomen auch am kroatisch-serbischen Konflikt festhalten. Die gemeinsam normierte Schriftsprache Serbokroatisch hatte das sprachliche Unterscheidungsmerkmal wegfallen lassen: Für Vuk Stefanović Karadžić, den serbischen Sprachreformer im 19. Jahrhundert, waren alle Kroaten eigentlich Serben, da sie ja Serbisch spra-chen, während der Begründer der kroatischen Partei des Rechts, Ante Starčević, alle Serben schlichtweg als Kroaten betrachtete. In den Augen beider waren die bosnischen Muslime lediglich islamisierte Serben bzw. Kroaten. Angesichts dieser chauvinistischen Übersteigerung nationalen Selbstbewussteins fanden Konzepte, die alle Südslawen umfassten – wie der Illyrismus und der spätere Jugoslawismus –, zu wenig Anklang in den brei-ten Bevölkerung, um das Konstrukt Jugoslawien abzustützen. Die griechischen Nationalisten sahen in den slawischen Makedoniern Sla-wophone, die ihre «ursprüngliche Muttersprache» verloren hatten, und leite-ten daraus ihren historischen Anspruch auf Makedonien ab. Auch in Bezug auf die Albaner, die in von Serbien beanspruchten Territorien lebten, machte der serbische Nationalismus die Abstammungsthese geltend: Gemäß dieser Argumentation sind die Albaner eigentlich Serben, die nach dem 17. Jahr-hundert von den Osmanen und einströmenden albanischen Bevölkerungs-elementen zwangsislamisiert und zwangsalbanisiert wurden. Die Aneignung
Teil C: Regionale Schwerpunkte
348
dieser Gebiete – vor allem des Kosovo – 1878 und 1912/1913 wurde von den Serben folgerichtig nicht als Eroberung, sondern als Befreiungskrieg interpretiert. Es galt, die «verloren gegangenen Serben» wieder zu reassimi-lieren. Der Rückgriff auf die vermutete Abstammung von Ethnien und auf mittelalterliche, vor der osmanischen Landnahme geltende Grenzen und Reiche wurde bei den jungen Nationen zur gängigen Strategie, um das eige-ne nationale Staatskonzept zu legitimieren. In Serbien spielte auch die ortho-doxe Kirche eine entscheidende Rolle, da sie den Mythos der eigenen Ge-schichte religiös überhöhte; historisierende Mythologie und religiöse Weihe verbanden sich zu einem explosiven Gemisch, als der serbische Ministerprä-sident Garašanin 1844 den Anspruch in ein politisches Geheimprogramm überführte. Die Politik zielte von nun an auf die Wiederherstellung Serbiens innerhalb der Grenzen, die zur Zeit seiner größten Ausdehnung unter Zar Dušan dem Großen Geltung hatten. Nicht minder expansionistisch war der etatistische Nationsbegriff Ungarns, der alle Bewohner innerhalb seiner historischen Grenzen zu Mitgliedern der ungarischen Nation erklärte, was vor allem bei den Rumänen und Kroaten auf erbitterten Widerstand stieß. Die Griechen strebten – in Anlehnung an die Antike und an Ostrom – nach einem Großgriechenland im ägäischen Raum und an der Westküste Kleinasiens, was zu Konflikten mit dem jungtürkischen Nationalismus führte. Die Bulgaren griffen auf die Geschichte des ersten und zweiten Bulgarischen Reiches des Mittelalters zurück und leiteten daraus ihren Hegemonieanspruch über weite Teile Südosteuropas und insbesondere über Makedonien ab. Bei den Rumänen setzte sich die Idee durch, sie würden un-mittelbar von den Römern in der Provinz Dacia abstammen; von dieser angeb-lichen Romanität versprachen sie sich ein historisches Anrecht auf Land und Boden. Gerade die Rumänen Siebenbürgens sahen sich von der ungarischen Vorherrschaft im Habsburger Reich übervorteilt und entwickelten einen anti-magyarischen Nationalismus. Die Albaner führten ihre Geschichte direkt auf illyrische Stämme zurück, woraus sie sich als angebliche Ureinwohner ein legitimes Recht über alle albanisch bewohnten Gebiete erhofften; aus diesem Anspruch erwuchs nach 1913 ein unüberwindbarer Gegensatz zum serbischen Nationalismus, der insbesondere den Kosovo als Wiege der serbischen Kultur betrachtete. Durch die neue realpolitische Umsetzung nationalistischen Gedankenguts schaukelten sich im gesamten Südosteuropa des 19. Jahrhunderts nationale Programme hoch. Im 20. Jahrhundert bildeten sie die Grundlage für nationa-listische Exzesse, ethnische Säuberungen und Bürgerkriege. Der Rückgriff auf die Geschichte und deren Instrumentalisierung wurde zum probaten Mit-tel, um eigene nationale Ansprüche zu legitimieren. So hat sich die Ge-schichtsschreibung in ganz Südosteuropa bis heute nicht von den Fesseln des Missbrauchs und der tendenziösen Darstellung befreien können. Das Gedan-
3. Südosteuropa
349
kengut, das vor 1850 in einer elitären, sich für die eigene nationale Vergan-genheit, Kultur, Sprache und Mythologie begeisternde Minderheit herange-reift war, erreichte in den jungen Nationalstaaten in popularisierter Form die breiten Bevölkerungsschichten. Der Befreiungsnationalismus wurde zum wichtigsten Bestandteil der nationalen Identität. Realpolitisch kaum umsetz-bar, mündeten die übersteigerten Vorstellungen oft genug in einem verletz-ten nationalen Selbstwertgefühl und in nationalistischer Aggression. Die Eliten beriefen sich regelmäßig auf diesen nationalen Kult, um von tief grei-fenden sozioökonomischen Problemen abzulenken und ihre Machtposition zu festigen. Faschistische Bewegungen in Kroatien, Rumänien und Ungarn schöpften während der Zwischenkriegzeit aus diesen nationalistischen Strö-mungen, die ihre Quellen im 19. Jahrhundert haben. Wer waren die ersten Trägerschichten, welche die ideologischen Grundlagen für die sogenannte «nationale Wiedergeburt» (in den einzelnen Sprachen preporod bei den Serben und Kroaten, văzraždenie bei den Bulgaren, rilindja bei den Albanern) schufen? Eine herausragende Rolle spielten nicht lokale Eliten, da sie – der hohe Bojaren-Adel (> Glossar Bojaren) in Rumänien, die Phanarioten im ganzen Osmanischen Reich und die kirchlichen Hierarchien – an der Herrschaft der Osmanen partizipierten und diese daher wenig in Frage stellten. Die ideologischen Grundlagen brachten vielmehr junge Ak-teure dieser Eliten hervor, die sich in den Emigrationszentren außerhalb des osmanischen Einflusses befanden, etwa weil sie im Ausland studierten, sich an Priesterseminaren ausbilden ließen, im Ausland arbeiteten oder als Kauf-leute unterwegs waren – im Osmanischen Reich gab es weder die entspre-chenden Bildungsinstitute noch Möglichkeiten zur politischen Betätigung. Sie kamen bereits im späten 18. Jahrhundert im Habsburger Reich, in Italien und in Russland mit den Ideen der französischen Revolution und der Aufklä-rung in Kontakt und brachten diese revolutionären Ideen nach Hause. Das griechische Nationalbewusstsein wiederum hatte sich bereits seit dem 18. Jahrhundert entwickeln können, da die Handelstätigkeit und die Mög-lichkeit, über den Seeweg zu emigrieren, Kolonien in West- und Mitteleuro-pa hatten entstehen lassen. Bereits viel früher waren byzantinische Gelehrte an die Fürstenhöfe Italiens und nach Venedig geflüchtet; auf diese Weise hatten sie nicht nur für ein Überleben der griechischen Kultur, sondern auch für die Ursprünge der philhellenischen Begeisterung innerhalb der westeuro-päischen Bildungseliten gesorgt. In der griechischen Diaspora sammelten sich sowohl das politische und ideologische Wissen als auch die finanziellen Mittel an, um den antiosmanischen Kampf in der Heimat zum Erfolg zu führen. Da die rumänische Oberschicht entweder den Phanarioten angehörte oder zumindest teilweise gräzisiert war, lag die Geburtsstätte des rumänischen Nationalbewusstseins im habsburgischen Siebenbürgen. Innerhalb der unier-
Teil C: Regionale Schwerpunkte
350
ten (> Glossar) Kirche der siebenbürgischen Gebiete verband sich in den Priesterseminaren die Entdeckung der lateinischen Antike mit der Rückbe-sinnung auf die rumänische Geschichte und Sprache. Aus dem ursprüngli-chen Kampf um die Gleichberechtigung der siebenbürgischen Rumänen im Habsburger Reich entstand eine nationalrumänische Idee, die bald ihren Weg in die Donaufürstentümer (Walachei und Moldau) fand. Auch für die Serben war das offenere Habsburger Reich in Südungarn die Wiege ihrer nationalen Wiedergeburt: Hier hatten die vor den Osmanen nordwärts flüchtenden Serben im 17. und 18. Jahrhundert eine neue Heimat gefunden. Die in der Diaspora erhaltenen Privilegien bildeten die Grundlage für das Erkennen der eigenen nationalen Sprache und Identität. Hier konnte eine junge Intelligenz heranwachsen, die – in Wien und Westeuropa ausge-bildet – zum Sprachrohr des nationalen Selbstbewusstseins wurde. So übte das Habsburger Reich die Funktion eines Katalysators bei der Entstehung der rumänischen und serbischen Nation aus. Schwierig gestaltete sich die Genese der bulgarischen und insbesondere der albanischen nationalen Identität, welche – verglichen mit den bereits er-wähnten Beispielen – sich erst mit einer beträchtlichen zeitlichen Verzöge-rung entfaltete. In Bulgarien fehlte eine Elite, die sich an einer bulgarischen Identität, Sprache und Orthodoxie orientiert hätte. In den Zentren der Bil-dung und in den Städten stellten Muslime die Mehrheit, die Grundherren waren osmanischer Herkunft, die geistliche Elite der Orthodoxie war gräzi-siert und von Griechen dominiert. Die ersten Impulse einer Wiederentde-ckung der eigenen Geschichte kamen von bulgarischen Geistlichen des hei-ligen Berges Athos; die dortigen Schriften wurden von der gräzisierten Elite in der Diaspora Odessas, Konstantinopels und Bukarests rezipiert, womit die Grundlagen für die Neuerfindung eines eigenen Volkstums gelegt wurden. Als noch hürdenreicher erwies sich die nationale Selbstfindung bei den Al-banern. Die dünne albanische Elite wie der Großteil des Volkes waren weit-gehend islamisiert und nach Istanbul ausgerichtet. Die osmanische Oberho-heit wurde trotz zahlreicher lokaler Aufstände zwischen 1750 und 1830 nie in Frage gestellt – eine gesamtalbanische Unabhängigkeitsbewegung ging daraus nicht hervor. Zudem hatte auch die Religion, anders als in umliegen-den Staaten, bei den Albanern keine einigende Wirkung, weil diese auf drei Religionsgemeinschaften (70 % Muslime, 20 % Orthodoxe und 10 % Katho-liken) aufgesplittert waren. Auch die Normierung der Sprache und die Wahl des Alphabets wurden erst 1908 in Angriff genommen: Seit der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert war das kyrillische, später das arabische oder auch das lateinische Alphabet mit speziellen Sonderzeichen im Gebrauch. Die albanische nationale Bewegung entstand sehr spät als Gegenreaktion auf die ausgreifenden Nationalismen der umliegenden Staaten, als sich auf dem
3. Südosteuropa
351
Höhepunkt der «orientalischen Frage» 1878 die sogenannte Liga von Prizren zusammenfand. Doch bis 1911 blieb die albanische Elite sich darin uneinig, ob sie lediglich Autonomie innerhalb des Osmanischen Reiches oder eine vollständige Unabhängigkeit anstreben sollte.
Literatur zum Abschnitt C.3: Südosteuropa Südosteuropa allgemein
Castellan, Georges: Histoire des Balkans. XIVe–XXe siècle, Paris 1991.
Curta, Florin: Southeastern Europe in the Middle Ages, 500–1250, Cambridge 2006.
Fine, John V. A. Jr.: The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, Michigan 1987.
Gallagher, Tom: Outcast Europe. The Balkans, 1789–1989. From the Ottomans to Miloševic, London 2001.
Glenny, Michael: The Balkans. Nationalism, War, and the Great Powers, 1804–1999, New York 2000.
Harden, Eggert u.a. (Hrsg.): Der Balkan in Europa, Frankfurt/M. 1996.
Hatschikjan, Magarditsch; Troebst, Stefan (Hrsg.): Südosteuropa. Ein Handbuch. Gesell-schaft, Politik, Wirtschaft, Kultur, München 1999.
Hösch, Edgar: Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart. München 21993.
Hösch, Edgar; Nehring, Karl; Sundhaussen; Holm (Hrsg.): Lexikon zur Geschichte Südosteu-ropas, Köln u.a. 2004.
Hupchick, Dennis Paul: The Balkans: from Constantinople to Communism, New York 2002.
Jelavich, Barbara: History of the Balkans. Bd. 1: Eighteenth and Ninetheenth Century. Bd. 2: Twentieth Century, Cambridge 1983.
Kaser, Karl: Südosteuropäische Geschichte und Geschichtswissenschaft, Stuttgart 22002.
Sowards, Steven W.: Moderne Geschichte des Balkans. Der Balkan im Zeitalter des Nationa-lismus, Seuzach 2004.
Stadtmüller, Georg: Geschichte Südosteuropas, München 1976.
Stavrianos, L.S.: The Balkans Since 1453, London 2000.
Stoianovich, Traian: Balkan Worlds. The First and Last Europe, New York 1994.
Todorova, Maria: Die Erfindung des Balkans. Europas bequemes Vorurteil, Darmstadt 1999.
Teil C: Regionale Schwerpunkte
352
Byzanz
Ostrogorsky, Georg: Geschichte des byzantinischen Staates, München 31963.
Schreiner, Peter: Byzanz, München 1994.
Osmanisches Reich
Brown, L. Carl (Hrsg.): Imperial Legacy. The Ottoman Imprint on the Balkans and the Middle East, New York 1996.
Faroqhi, Suraiya; Fikret, Adanir (Hrsg.): The Ottomans and the Balkans, Leiden u.a. 2002.
Faroqhi, Suraiya: Kultur und Alltag im Osmanischen Reich vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, München 1995.
Fleet, Kate; Faroqhi, Suraiya; Kasaba, Reşat: The Cambridge History of Turkey. Bd. 2, The Later Ottoman Empire, 1603–1839, Cambridge 2006.
Kreiser, Klaus: Der Osmanische Staat 1300–1922, München 2001.
Matuz, Josef: Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte, Darmstadt 1985.
Sugar, Peter F.: Southeastern Europe under Ottoman Rule, 1354–1804, Seattle 1977.
Traditionelle Sozialformen in Südosteuropa
Brunnbauer, Ulf: Gebirgsgesellschaften auf dem Balkan. Wirtschaft und Familienstrukturen im Rhodopengebirge (19./20. Jahrhundert), Wien 2004.
Kaser, Karl: Freundschaft und Feindschaft auf dem Balkan, Klagenfurt 2001.
Kaser, Karl: Hirten, Kämpfer, Stammeshelden, Weimar 1992.
Todorova, Maria N.: Balkan Family Structure and the European Pattern. Demographic Deve-lopments in Ottoman Bulgaria, Budapest 2006.
Nationalismus und die Entstehung von Nationen in Südosteuropa
Behschnitt, Wolf Dietrich: Nationalismus bei Serben und Kroaten 1830–1914. Analyse und Typologie der nationalen Ideologie, Diss., Köln 1976.
Heppner, Harald; Preshlenowa, Rumjana (Hrsg.): Die Bulgaren und Europa von der nationa-len Wiedergeburt bis zur Gegenwart, Sofia 1999.
Kolar, Othmar: Rumänien und seine nationalen Minderheiten 1918 bis heute, Wien 1997.
Reiter Norbert, (Hrsg.): Nationalbewegungen auf dem Balkan, Wiesbaden 1983.
Sundhaussen, Holm: Nationsbildung und Nationalismus im Donau-Balkan-Raum, in: For-schungen zur osteuropäischen Geschichte 48 (1993), S. 233–258.
Seewan, Gerhard; Dippold, Peter (Hrsg.). Bibliographisches Handbuch der ethnischen Grup-pen Südosteuropas, 2 Bd., München 1997.
Seewan, Gerhard (Hrsg.): Minderheitenfragen in Südosteuropa, München 1992.
3. Südosteuropa
353
Albanien
Grothusen, Klaus-Detlev (Hrsg.): Albanien, Göttingen 1993.
Bartl, Peter: Albanien, Regensburg 1995.
Jandot, Gabrie: L’Albanie d’Enver Hoxha (1944–1985), Paris 1994.
Vickers, Miranda: The Albanians. A Modern History, London u.a. 1995.
Bosnien
Hoare, Marko Attila: The History of Bosnia, London 2007.
Mudry, Thierry: Histoire de la Bosnie-Hercégovine, faits et controverses, Paris 1999.
Malcolm, Noel: Geschichte Bosniens, Frankfurt/M. 1996.
Bulgarien
Crampton, Richard J.: A Concise History of Bulgaria, Cambridge 1997.
Crampton, Richard. J.: A Short History of Modern Bulgaria, Cambridge 1987.
Grothusen, Klaus Detlef (Hrsg.): Bulgarien, Göttingen 1990.
Härtel, Hans-Joachim; Schönfeld, Roland: Bulgarien: vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Regensburg 1998.
Griechenland
Clogg, Richard: A Concise History of Greece, Cambridge 2002.
Eichheim, Hubert: Griechenland, München 1999.
Tzermias, Pavlos: Neugriechische Geschichte. Eine Einführung, Tübingen 1999.
Weithmann, Michael W. Griechenland vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart, Regensburg 1995.
Woodhouse, C. M.: Modern Greece. A Short History, London 1991.
Jugoslawien
Allcock, John B.: Explaining Yugoslavia, London 2000.
Bartl, Peter: Grundzüge der jugoslawischen Geschichte, Darmstadt 1985.
Ramet, Sabrina P.: The Three Yugoslavias. State-Building and Legitimation, 1918–2005, Washington 2006.
Sundhaussen, Holm: Experiment Jugoslawien. Von der Staatsgründung bis zum Staatszerfall, Mannheim 1993.
Djokić, Dejan (Hrsg.): Yugoslavism. Histories of a Failed Idea, 1918–1992, London 2003.
Jäger, Friedrich: Bosniaken, Kroaten, Serben. Ein Leitfaden ihrer Geschichte, Frankfurt/M. 2001.
Teil C: Regionale Schwerpunkte
354
Kosovo
Malcolm, Noel: Kosovo. A Short History, London 2002.
Reuter, Jens; Clewing, Konrad (Hrsg.): Der Kosovo-Konflikt. Ursachen, Verlauf, Perspekti-ven, Klagenfurt 2000.
Vickers, Miranda: Between Serb and Albanian. A History of Kosovo, London 1998.
Kroatien (siehe auch Ostmitteleuropa)
Goldstein, Ivo: Croatia. A History, London 22001.
Perić Ivo: A History of the Croats, Zagreb 1998.
Steindorff, Ludwig: Kroatien. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Regensburg u.a. 2001.
Tanner, Marcus: Croatia. A Nation Forged in War, London 2001.
Makedonien
Adanir, Fikret: Die Makedonische Frage. Ihre Entstehung und Entwicklung bis 1908, Wies-baden 1979.
Lange-Akhund, Nadine: The Macedonian Question, 1893–1908: From Western Sources, New York 1998.
Lukan, Walter; Jordan, Peter (Hrsg.): Makedonien. Geographie, Ethnische Struktur, Ge-schichte. Sprache und Kultur, Politik, Wirtschaft, Recht, Wien 1998.
Troebst, Stefan: Das makedonische Jahrhundert: Von den Anfängen der nationalrevolutionä-ren Bewegung zum Abkommen von Ohrid 1893–2001, München 2007.
Montenegro
Heer, Caspar: Territorialentwicklung und Grenzfragen von Montenegro in der Zeit seiner Staatswerdung, 1830–1887. Bern 1981
Roberts, Elizabeth: Realm of the Black Mountain. A History of Montenegro. Ithaca 2007.
Rumänien
Boia, Lucian: Geschichte und Mythos. Über die Gegenwart des Vergangenen in der rumäni-schen Gesellschaft, Köln 2003.
Giurescu, Dinu C.; Fischer-Galati, S. (Hrsg.): Romania. A Historic Perspective, Boulder 1998.
Hitchins, Keith: The Romanians, 1774–1866, Oxford 1996.
Hitchins, Keith: Romania, 1866–1947, Oxford 1994.
Völkl, Ekkehard: Rumänien: vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart, Regensburg 1995.
Serbien
Cox, John K.: The History of Serbia, Westport 2002.
Pavlović, Kosta Stevan: Serbia. The History Behind the Name, London 2002.
Petrovich, Michael Boro: A History of Modern Serbia 1804–1918. Bd. 1–2, New York 1976.
Sundhaussen, Holm: Geschichte Serbiens, 19.–21. Jahrhundert, Wien 2007.
Glossar
355
GLOSSAR
GLOSSAR Animisten, animistisch: veraltet auch Naturreligionen, bezieht sich zusammenfassend auf die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen schriftlosen Religionsgruppen, die häufig von der Be-seeltheit (lat. animus, Seele) der Natur ausgehen.
Annales-Schule: französische Historikergruppe, die Ende der 1920-er Jahre um die Zeit-schrift «Annales d’histoire économique et sociale» (später: Annales: histoire, sciences socia-les) entstand und daraus hervorgehend eine geschichtswissenschaftliche Schule begründete. Im Unterschied zu der fakten- und ereignisorientierten Darstellungsweise der traditionellen Politikgeschichte jener Zeit konzentrierte sich diese Schule auf die Analyse der Phänomene von langer Dauer und historischer Zusammenhänge der Wirtschafts- und Sozialgeschichte mit Berücksichtigung kultureller Faktoren.
Aschkenasim, aschkenasisch: Bezeichnung für die ursprünglich aus deutschsprachigen Gebieten stammenden Juden und deren Kulturkreis (im Gegensatz zu den von der iberischen Halbinsel stammenden > Sephardim), im östlichen Europa seit dem Spätmittelalter vor allem in Polen und später auch in den Nachbarländern verbreitet.
Autokephalie: kirchenrechtliche Selbstständigkeit einzelner Kirchen des orthodoxen Christen-tums. In der Regel verfügen die jeweiligen orthodoxen Landeskirchen über Autokephalie unter Führung eines Patriarchen oder streben dies zumindest an (etwa Makedonien, Ukraine). Das Primat des ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel ist nicht mehr als ein Ehrenprimat. Anders als in der römisch-katholischen Kirche existiert somit keine länderübergreifende zentrale Hierarchie.
Awaren, awarisch: multiethnischer, reiternomadischer Stammesverband, der von 567–822 in Pannonien (heutiges Ungarn) ein Reich bildete, weite Teile Ostmitteleuropas beherrschte und auf Kriegszügen bis nach Konstantinopel vordrang; das awarische Reich spielte eine bedeu-tende Rolle bei der Ausbreitung der Slawen.
Banschaft, Banat: bezeichnet Grenzmarken des ungarischen Königreiches, vor allem im kroatisch-slawonischen Gebiet; als königlicher Vertreter amtete der Ban (Banus); als Land-schaftsbezeichnung meint Banat heute das Temescher Banat im rumänisch-serbisch-ungarischen Dreiländereck.
Bektaschi-Orden: dem Islam zugerechnete, aber viele synkretistische Elemente aufweisende Bruderschaft (Derwischorden), die in Anatolien entstand und unter den Janitscharen große Verbreitung fand; seit dem 17. Jhd. wurde Albanien zu einer Hochburg des Bektaschi-Ordens.
Blockfreie Staaten: Zusammenschluss von Staaten (1961), die sich während des Kalten Krieges weder dem (kapitalistischen) Westen noch dem (sozialistischen) Osten anschlossen. Wichtige Gründungsmitglieder waren Jugoslawien, Ägypten und Indien. Grundprinzip war die Ablehnung einer Beteiligung an Bündnissystemen.
Glossar
356
Böhmische Brüder: 1457 aus der > hussitischen Bewegung in Böhmen hervorgegangene Konfession neben den > Utraquisten; orientierte sich allein am Evangelium, kannte Laienpre-diger und war besonders bei ländlichen Unterschichten verbreitet; im Zuge der Reformation im 16. Jhd. auch in Polen.
Bojaren: oberste soziale, politische und wirtschaftliche Gesellschaftsschicht in Bulgarien, Russland, Litauen, der Walachei und der Moldau, unterscheidet sich rechtlich und sozial zum Teil deutlich vom ostmittel- und westeuropäischen Adel; bezeichnete im engeren Sinne in Russland den höchsten Rang der Mitglieder in der Duma (fürstliches Beratergremium).
Bol’ševiki: (russ. Mehrheitler) bezeichnet nominell die aus der Spaltung der Russländischen Sozial-Demokratischen Arbeiterpartei (RSDRP) 1903 hervorgegangene Mehrheitsfraktion, gegenüber der unterlegenen Minderheitenfraktion der > Men’ševiki; unter Führung Lenins als straffe Kaderpartei organisiert, gelang es ihnen in der > Oktoberrevolution, die alleinige Herr-schaft zu erringen; 1918–1925 Russländische Kommunistische Partei (der Bol’ševiki) (RKP(b)), 1925–1952 Kommunistische Allunionspartei (der Bol’ševiki) (VKP(b)), 1952–1991 Kommunistische Partei der Sowjetunion (KPdSU).
Brandrodewirtschaft: Bei der Brandrodewirtschaft werden die Bäume gefällt und das Ge-strüpp und die Äste verbrannt. Der mit der Asche gedüngte Boden wird nachher nur ober-flächlich aufgerissen und für die Landwirtschaft nutzbar gemacht. Sind die Böden ausgelaugt, wird im Wald die nächste Fläche urbar gemacht.
Brežnev-Doktrin: aus westlicher Sicht eine angebliche außenpolitische Leitlinie der UdSSR, dergemäß diese den Mitgliedsstaaten des Warschauer Paktes eine nur begrenzte Souveränität zugestand und sich ein Interventionsrecht zuschrieb; im Westen auf Aussagen des sowjeti-schen Partei-Generalsekretär Brežnev nach der Invasion der Tschechoslowakei 1968 zurück-geführt, gab es eine solche Doktrin nach offizieller sowjetischer Lesart nicht.
Bulgaren: ursprünglich Bezeichnung für diverse, v.a. turksprachige Stammesverbände der eurasischen Steppenzone; die sogenannten Wolgabulgaren herrschten vom 10. bis Mitte des 13. Jhd. in einem Reich an der mittleren Wolga; eine auch als Donau- oder Protobulgaren bezeichnete Gruppe gründete im 7. Jhd. südlich der Donau ein Reich; in der Folge nahmen die Bulgaren die Sprache der unterworfenen Slawen an, so dass heutzutage der Name Bulgare das beidseits des Balkangebirges siedelnde südslawische Volk meint.
ČK, VČK: (Abkürzung für russ. Vserossijskaja črezvyčajnaja komissija po bor’be s kontrre-voljuciej, spekuljaciej i sabotažem, Allrussische außerordentliche Kommission zur Bekämp-fung von Konterrevolution, Spekulation und Sabotage), 1917 gegründete Geheimpolizei der Sowjetunion, 1922–1923 GPU (russ. Gosudarstvennoe političeskoe upravlenie, Staatliche Politische Verwaltung), ab 1923 als OGPU (russ. Ob-edinennoe gosudarstvennoe političeskoe upravlenie, Vereinigte staatliche politische Verwaltung) und später unter weiteren Bezeich-nungen dem sowjetischen Innenministerium, NKVD (russ. Narodnyj komissariat vnutrennich del, Volkskommissariat der inneren Angelegenheiten, ab 1946 MVD: Ministerstvo vnutren-nich del, Ministerium für innere Angelegenheiten) angegliedert; 1954–1991 als sowjetischer
Glossar
357
Geheimdienst, KGB (russ. Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti, Komitee für Staatssicher-heit), wieder aus dem Innenminiterium ausgegliedert.
Demokratischer Zentralismus > Zentralismus, demokratischer
Diskursanalyse: aus der französischen Sozialwissenschaft der 1960er-Jahre stammende Herangehensweise an Texte und Phänomene, die davon ausgeht, dass Wirklichkeit nur über sprachliche Vermittlung zugänglich ist bzw. durch diese erst konstituiert wird. Der Sprache und ihrem Gebrauch kommt daher entscheidende Bedeutung bei der Diskursanalyse zu. Da es keinen allgemein gültigen Diskursbegriff gibt und unterschiedliche Theoretiker darunter divergierende Konzepte verstehen, sei an dieser Stelle nur generell darauf verwiesen, dass es bei einer Diskursanalyse darum geht, die Begrenzungen des Sagbaren in unterschiedlichen Epochen und Kulturen und deren Einfluss auf die Handlungen der Menschen zu ergründen.
Dönme: aus der sabbatianischen (> Sabbatianer) im späten 17. Jhd. hervorgegangene religiöse Gemeinschaft jüdischer Konvertiten mit dem Zentrum in Saloniki, die neben einem offiziellen Bekenntnis zum Islam im eigenen Kreis der jüdischen Mystik anhing.
Družina: Gefolgschaft des Fürsten in der Kiever Rus’, aus der oberen Schicht gingen die > Bojaren hervor.
Erbuntertänigkeit: Bezeichnung für Formen der bäuerlichen Unfreiheit, in der Regel ge-braucht für weniger einschneidende Abhängigkeit vom Herrn als im Falle der (extremen) > Leibeigenschaft, besonders in Ostmitteleuropa.
Erzählung von den vergangenen Jahren > Nestorchronik
Februarrevolution: bezeichnet den Sturz des Zaren im Februar 1917 durch eine bürgerliche Parteienkoalition und die Schaffung einer Doppelherrschaft von provisorischer Regierung und Arbeiter- und Soldatenräten, die bis zur > Oktoberrevolution Bestand haben sollte.
Feudalisierung: Begriff, der die Entstehung des Feudalismus im Mittelalter beschreibt. Der Feudalismus (gründet auf dem Begriff féodalité) ist eine sozioökonomische/politische Ord-nung, die auf der Verleihung von lehensrechtlichen Rechten (Grundherrschaft, politische, rechtliche und militärische Rechte) des Herrschers an eine adlige Oberschicht basiert.
Finno-Ugrier, finno-ugrisch: Sprachfamilie, der u.a die Sprachen Ungarisch (Magyarisch), Finnisch und Estnisch angehören.
Freizügigkeit, bäuerliche: Bezeichnet das Recht der freien und minderfreien bäuerlichen Bevölkerung, den Aufenthaltsort/Grundstück (die Scholle) bzw. den Grundherren frei zu wählen bzw. zu wechseln; der Verlust der Freizügigkeit, des Abzugsrechts, wird als Schollen-bindung bezeichnet.
Glasnost’: (russ.: Transparenz), Schlagwort für die politische Öffnung in der späten Sowjet-zeit, steht zusammen mit > Perestrojka für die Amtsperiode des Partei-Generalsekretärs Mi-chail Gorbačev (1985–1991) und damit die letzte Phase der sowjetischen Geschichte.
Glossar
358
Goldene Horde: Bezeichnung für das von Khan Batu um 1240 gegründete Reich, vorerst als westlicher Teil des mongolischen Weltreiches, später weitgehend selbstständig; ihr Einflußbe-reich reichte im 13. Jhd. von Zentralasien bis an die Westküste des Schwarzen Meeres, mit dem Reichszentrum am Unterlauf der Wolga und Oberhoheit über weite Teile der Rus’ (bis 1480); seit dem 15. Jhd. Zerfall, ein stark verkleinerter Rest der Goldenen Horde existierte bis 1502, daneben verselbständigten sich die Khanate von Sibir’ (ca. 1430-1581/98), auf der Krim (ca. 1430-1783; 1475-1774 unter osmanischer Oberhoheit), in Kazan’ (1436/8-1552), Astrachan’ (ca. 1460-1556) sowie Ende des 14. Jahrhunderts die Nogaier Horde, die sich Mitte des 16. Jahrhunderts ihrerseits in Teilherrschaften im eurasischen Steppengürtel und dem Kaukasus aufspaltete (teils unter Oberhoheit des Khanats der Krim).
Großwesir: höchster osmanischer Beamter und Vertreter des Sultans, entwickelte sich bis ins 17. Jhd. zum faktischen Leiter der osmanischen Administration; viele Großwesire waren balkanisch-christlicher Herkunft, die als Folge der > Knabenlese in osmanisch-islamischem Geist erzogen worden waren.
GULAG: (russ. Abkürzung für Glavnoe upravlenie ispravitel’no-trudovych lagerej, Haupt-verwaltung der Besserungs-Arbeitslager), sowjetische Behörde, die von 1930 bis 1956 für die Straflager zuständig war; davon abgeleitet wird GULAG auch für das sowjetische Lagersys-tem der Stalinzeit und in einem erweiterten Sinne gelegentlich für das Repressionssystem sozialistischer Staaten schlechthin verwendet.
Gutsherrschaft: v.a. im östlichen Europa (Russland, Ostmitteleuropa) mit der Elbe als unge-fährer Westgrenze während der Frühen Neuzeit verbreitete Form der Grundherrschaft, charak-terisiert durch eine starke Stellung des Herrn gegenüber seinen Untertanen und Großgrundbe-sitz, der in Eigenwirtschaft des Grundherrn zur Erzielung von Überschüssen für den Markt (Gutswirtschaft) betrieben wurde; rechtliche und soziale Schlechterstellung der Bauern (> Zweite Leibeigenschaft) mit dem Zusammenfall der Grund-, Leib- und Gerichtsherrschaft in einer Hand; faktisch waren die Gutsbetriebe administrativ, rechtlich und wirtschaftlich weitgehend geschlossene Territorien.
Hanse: aus diversen Zusammenschlüssen im Hochmittelalter entstandener Verband von Kaufleuten und Handelsstädten primär des Nord- und Ostseeraumes, erreichte im Spätmittel-alter seine größte Ausdehnung und verlor seit dem 16. Jhd. an Bedeutung.
Historismus: in der deutschen Geschichtswissenschaft im 19. und frühen 20. Jhd. dominie-rendes Interpretationsparadigma, das in Abgrenzung von philosophischen Zugängen zur Geschichte die Unvergleichbarkeit jedes Einzelphänomens (Epochen, Staaten, Personen) möglichst objektiv zu ergründen sucht; thematisch dominieren die Geschichte von Reichen und Staaten und ihrer Staatsmänner (Geschichte der großen Männer), methodisch die Empirie (Quellenstudien).
Hohe Pforte: hergeleitet vom Sitz der osmanischen Regierung, seit der Frühen Neuzeit Syn-onym für das Osmanische Reich bzw. seiner Regierung.
Glossar
359
Holocaust: (griech./engl. völlig verbrannt, Brandopfer), bezeichnet den während des Zweiten Weltkrieges insbesondere an Juden, daneben auch Roma und anderen Gruppen vollzogenen Massenmord auf rassistischer Grundlage, speziell im Rahmen der industriell organisierten Vergasung in deutschen Vernichtungslagern; bezieht sich im weiteren Sinne auch auf diverse eigenständige Verfolgungs- und Vernichtungsmaßnahmen u.a. im östlichen Europa (Kroatien, Rumänien, Ungarn); für jüdische Opfer auch der biblische Audruck Schoah (hebr. Unheil, große Katastrophe).
Hussitismus, hussitisch: auf den tschechischen Reformator Jan Hus (ca. 1370–1415) zurück-gehende religiös-soziale und (vor-)nationale Bewegung in Böhmen, die in den Hussitenkrie-gen der 1420er- und 1430er-Jahre ihren Höhepunkt fanden.
Intelligencija: bezeichnet seit dem 19. Jhd. die am öffentlichen Leben interessierten, häufig reformorientierten Mitglieder der russländischen Gesellschaft, weniger die intellektuelle Schicht an sich; meint in der Sowjetzeit dann die gebildete Elite, mit der zahlenmäßig domi-nierenden technischen Intelligenz.
Janitscharen: (osman.-türk. Yeni çeri: neue Truppe) in der 2. Hälfte des 14. Jhd. gegründete osmanische Infanterietruppe, bildete als stehendes Heer und eng an den Sultan gebundener Verband eine Eliteeinheit der osmanischen Militärmacht und dementsprechend einen Macht-faktor, was sich in diversen Janitscharen-Aufständen zeigte; seit dem 17. Jhd. Rückgang der militärischen Bedeutung und zunehmend reformfeindliche Kraft; rekrutierte sich v.a. anfäng-lich im Rahmen des devşirme (Knabenlese) mit der zwangsweisen Aushebung von Knaben christlicher Herkunft von der Balkanhalbinsel, die osmanisch-islamisch erzogen wurden; aufgelöst wurden die Janitscharen 1826.
Jungtürken: Ende des 19. Jhd. im osmanischen Reich entstandene politische Bewegung, die auf grundlegende Reformen zielte und zunehmend türkisch-nationalistische Ziele verfolgte; von 1908 stellten sie bis 1918 zeitweise die Regierung; viele Jungtürken schlossen sich schließlich dem aus ihren Reihen hervorgegangen Republiksgründer (1923) Mustafa Kemal (Atatürk) an.
Kalter Krieg: zusammenfassende Bezeichnung für die nach dem Ende des Zweiten Welt-krieges von ca. 1948 bis 1989/91 andauernde Epoche der weltpolitischen Spannungen zwi-schen den zwei ideologisch-politisch-militärischen Blöcken der beiden Supermächte (USA, UdSSR) mit ihren jeweiligen Bündnissystemen (NATO und Warschauer Pakt).
Kanun: Sammlung rechtlicher Bestimmungen, die religiöse (Elemente der Scharia) aber vor allem weltliche Bestimmungen und Verfügungen beinhaltet. Häufig sind darunter auch Sammlungen von lokalen Gewohnheitsrechten zu verstehen, so etwa das Kanuni i Lëke Du-kagjinit aus dem albanischen Raum.
Katun: Bezeichnet die Organisationsform der Sommer- bzw. Winterweidetätigkeit der Wan-derhirten auf dem Balkan.
Glossar
360
Khan, Khanat: Khan, ursprünglich Khagan, Herrschertitel bei diversen reiternomadischen Stammesverbänden im eurasischen Steppengürtel, so bei den Awaren oder Mongolen (Tschingis Khan); unter Khanat wird der Herrschaftsbereich eines Khans verstanden (z.B. Khanat der Krim).
Kolchos: (russ. kolchoz, kollektivnoe chozjajstvo, Kollektivwirtschaft) sowjetischer Land-wirtschafts-Großbetrieb auf kollektiver (genossenschaftlicher) Grundlage, im Gegensatz zum reinen Staatsbetrieb, dem > Sovchos.
Komintern: (kommunistische 3. Internationale) wurde auf Anregung Lenins 1919 als Verei-nigung aller kommunistischen Parteien gegründet mit dem Ziel, die Weltrevolution zu ver-wirklichen. Die Komintern war hauptsächlich ein Instrument der UdSSR, um die kommunisti-schen Parteien der Welt unter ihre Kontrolle zu bringen; 1943 aufgelöst (Nachfolgeorganisa-tion: Kominform, ab 1947).
Kommunismus: Gesellschaftsutopie, die von einem anzustrebenden Endzustand der Menschheitsgeschichte ausgeht, in dem jegliche Form von Unterdrückung und Ausbeutung beseitigt ist, so dass auch kein Staat als Herrschaftsinstrument mehr nötig ist; als ideologi-sches (Fern-)Ziel strebten alle > sozialistischen Systeme den Kommunismus an, ohne ihn in der Praxis aber zu erreichen.
Komsomol: (russ. Kommunističeskij sojuz molodeži, Kommunistischer Jugendverband), gängige Abkürzung für VLKSM (russ. Vsesojuznyj Leninskij Kommunističeskij Sojuz Mo-lodeži, Leninsche kommunisischer Allunionsbund der Jugend), offizieller Jugendverband in der UdSSR, dessen Ziel in der Heranführung der Jugend an die Werte der sozialistischen Gesellschaftsordnung bestand.
Kongresspolen: Bezeichnung für das auf dem Wiener Kongress 1815 geschaffene, konstitu-tionelle Königreich Polen in Personalunion mit Russland; nach dem Aufstand von 1830/31 Aufhebung der Verfassung und schrittweise Eingliederung ins Zarenreich.
Korenizacija: (russ. Einwurzelung), auch Indigenisierung, in den 1920er-Jahren in der Sow-jetunion verfolgte Politik, nationale und ethnische Gruppen durch Förderung der jeweiligen Sprache und Kultur und den gezielten Aufbau eigener Institutionen sowie der Rekrutierung lokaler Parteikader in das sozialistische System einzubinden.
Kosaken: ursprünglich kriegerische Verbände entlaufener Bauern, primär Ostslawen, die sich v.a. seit dem 16. Jhd. in den herrschaftlich unerschlossenen südlichen und östlichen Grenzre-gionen Polens und des Moskauer Reiches an Flussläufen niederließen, um der Leibeigen-schaft zu entgehen; entwickelten sich mit der Zeit zu Wehrbauern im Dienst der Zaren und trugen maßgeblich zur Kolonisierung des nördlichen Schwarzmeerraumes, des Uralgebietes und Sibiriens bei.
Kulak: (russ. Faust) ursprünglich Bezeichnung für einen wohlhabenden Bauern, wurde im Stalinismus v.a. in den 1930er-Jahren als Etikette für alle Bauern, die eine selbstständige
Glossar
361
Wirtschaft führten und während der Kollektivierung als eine vermeintlich einheitliche soziale Gruppe ausgelöscht werden sollten.
Kumanen: auch als Polovcer (in russ. Quellen), Qipčaq etc. bezeichnet, turksprachig gepräg-ter Stammesverband von Reiternomaden, beherrschte vom 11. bis 13. Jhd. die Steppengebiete von der unteren Donau bis Zentralasien; diverse Kontakte zur Kiever Rus’, nach dem Vor-dringen der Mongolen im 13. Jhd. lassen sich Gruppen in Ungarn und auf dem Balkan nieder, wichtige Einflüsse u.a. auf das Zweite Bulgarische Reich.
Leibeigenschaft: historischer Ordnungsbegriff, zusammenfassende Bezeichnung für eine Vielzahl sozialer und rechtlicher Regelungen, die den Status bäuerlicher Unfreiheit definierte; bezeichnet im engeren Sinne eine persönliche Abhängigkeit von einem Leibherrn (südwest-deutscher Raum), wird für Osteuropa jedoch in der Regel für besonders ausgeprägte Formen bäuerlicher Unfreiheit (Russland, Polen) verwendet.
Magnaten: bezeichnet v.a. in Polen und Ungarn die Angehörigen des sozial führenden Hoch-adels; wenn auch rechtlich mit dem mittleren und niederen Adel gleichgestellt, zeichneten sich Magnaten wirtschaftlich durch Großgrundbesitz und politisch durch einflussreiche Ämter am königlichen Hof aus und bestimmten zeitweise faktisch als Oligarchie die Politik.
Marshall-Wirtschaftshilfeplan: (Umgangssprachlich für ERP, Abk. für European Recovery Program) Ein von den USA ins Leben gerufenes wirtschaftliches Wiederaufbauprogramm, um Europa nach 1945 wirtschaftlich beim Wiederaufbau zu unterstützen. Im Rahmen des Marshallplans erhielten die nicht zum sowjetischen Block gehörenden Länder rund 13 Mrd. $ bis 1952.
Men’ševiki: (russ. Minderheitler) bezeichnet die aus der Spaltung der Russländischen Sozial-Demokratischen Arbeiterpartei (RSDRP) 1903 als nominelle Minderheitenfraktion (> Bol’ševiki) hervorgegangenen gemäßigten Berfürworter eines Sozialismus auf der Grundlage einer repräsenativen Demokratie und eines Reformwegs statt eines bewaffneten Aufstandes. Zwischen der > Februarrevolution und > Oktoberrevolution 1917 stellten sie die führende Fraktion in den Räten.
mestničestvo: (russ. Rangplatzordnung) hierarchische Ordnung der > Bojaren und Dienstade-ligen in Russland vom 14./15. Jhd. bis 1682, die adlige Familien bzw. Einzelpersonen an-fänglich eher nach dem Kriterium der Herkunft, mit der Zeit immer stärker entsprechend der Dienstposition, in hierarchische Ränge einteilte.
Millet: (arab. Religion), nach älterer Auffassung im osmanischen Reich ein System der Selbstverwaltung nichtmuslimischer Religionsgruppen (millet-System); nach neuerer Auffas-sung in dieser Form jedoch bestenfalls im 19. Jhd., zuvor regional und zeitlich sehr unter-schiedlich ausgeprägt, mit Millet in der Bedeutung als unter osmanischem Schutz stehende Glaubensgemeinschaft.
Modernisierungstheorien: Überbegriff für eine Gruppe von Entwicklungstheorien seit den späten 1950er Jahren. Die M. gehen von einem Prozess der Nachahmung und Angleichung
Glossar
362
der Entwicklungsländer an die Industrieländer aus. Die These, dass es nur einen vom Westen vorgezeichneten Weg in die Moderne gibt, hat sich mittlerweile als obsolet erwiesen. Die neusten Modernisierungstheorien operieren mit einem stark differenzierten Modell.
NĖP: (russ. novaja ėkonimičeskaja politika, neue ökonomische Politik) innen- und wirt-schaftspolitische Leitlinie der sowjetischen Politik 1921–1927, die mittels wirtschaftlicher Liberalisierung die negativen Folgen des rigorosen Kriegskommunismus während des sowje-tischen Bürgerkrieges überwinden sollte; ging auch mit einer relativen gesellschaftlichen Liberalisierung (u.a. Freigabe der Geld- und Marktbeziehungen) einher.
Nestorchronik: gemäß dem Anfangstext auch «Erzählung von den vergangenen Jahren» genannt, wird einem Mönch des Kiever Höhlenklosters namens Nestor zugeschrieben; die älteste Chronik der Kiever Rus’, verfasst zu Beginn des 12. Jhd., vermutlich auf einer älteren Vorlage basierend; erzählt u.a. die mythische Gründung der Kiever Rus’ nach.
New Cultural History: zusammenfassende Bezeichnung für eine Reihe heterogener, anfäng-lich insbesondere angelsächsischer kulturgeschichlicher Ansätze, deren Gemeinsamkeit darin besteht, sämtliche menschlichen Handlungen und Äußerungen als komplexe kulturelle Zei-chensysteme zu konzipieren, deren Sinn es zu verstehen gilt. Sie arbeitet vordergründig mit Texten, Bildern, Ritualen sowie anderen Trägern symbolischer Bedeutungen.
Nomenklatura: Sammelbezeichnung für die politisch-gesellschaftliche Elite bzw. die Kade-rangehörigen, besonders des Parteiapparates, im Sozialismus.
Oktoberrevolution: bezeichnet den Sturz der provisorischen Regierung Russlands durch die > Bol’ševiki im Oktober 1917, der ihnen den Aufstieg zur alleinigen Macht ebnete, sowie den Beginn des grundlegenden Umbaus der Gesellschaft zu einem sozialistischen System.
Oktobristen: Aus der Revolution von 1905 hervorgegangene und bis 1917 bestehende gemä-ßigt-konservative Partei in Russland, die eine konstitutionelle Monarchie befürwortete; be-nannt nach dem Oktobermanifest von 1905, das beschränkte bürgerliche Freiheiten einführte (russ. Sojuz 17 oktjabrja, Union des 17. Oktober).
Opričnina: (russ. das Abgesonderte) ursprünglich Bezeichnung für den Anteil der Witwen und Mitglieder der großfürstlichen Familie am Erbe; von Ivan IV. eingeführte gesonderte Verwaltungsterritorien, in denen er zwischen 1565 und 1572 mit Terror regierte.
Panslawismus: geistige Strömung des 19. Jhd., die eine kulturelle oder politische Vereini-gung aller slawischer Völker anstrebte; von einer einheitlichen Bewegung kann nicht gespro-chen werden, insbesondere die Russland zugedachte Rolle war stark umstritten. Von der zweiten Hälfte des 19. Jhd. bis zum Ersten Weltkrieg nutzte Russland den Panslawismus zur außenpolitischen Machtpolitik gegenüber dem Habsburger und dem Osmanischen Reich.
Patriarch: höchstes geistliches Oberhaupt in der orthodoxen Kirche; im Frühmittelalter wur-de die gesamte Kirche den fünf Patriarchen (Pentarchie) von Rom, Jerusalem, Alexandria, Antiochien und Konstantinopel unterstellt, wobei Letzterem als ökumenischem Patriarchen das Ehrenprimat in der Orthodoxie gebührt; seit dem Mittelalter wurden im Zuge der Bildung
Glossar
363
autokephaler (> Glossar) Kirchen weitere Kirchenoberhäupter in den Rang des Patriarchen erhoben, so in Bulgarien, Serbien und dem Moskauer Reich (1589), in der Neuzeit etwa auch in Griechenland und Rumänien.
Perestrojka: (russ. Umgestaltung), die in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre von Michail Gorbačev in Gang gebrachte Politik der grundlegenden wirtschaftlichen und politischen Re-formen des sozialistischen Gesellschaftssystems; bezeichnet verallgemeinert bzw. zusammen mit > Glasnost’ die Umbruchsphase in der späten Sowjetunion.
Petschenegen: aus Zentralasien stammender, turksprachiger Verband von Reiternomaden, enge Sprachverwandte der > Kumanen; seit dem späten 9. bis in die erste Hälfte des 11. Jhd. dominierten die Petschenegen den osteuropäischen Steppengürtel des unteren Wolga- und nördlichen Schwarzmeer-Raumes; Petschenegen ließen sich danach u.a. im byzantinischen Reich und in Ungarn nieder (dort rechtliche Sonderstellung bis im 13. Jhd.).
Phanarioten: (griech. Phanari, Leuchtturm) nach dem christlichen Viertel Phanar der osma-nischen Reichshauptstadt Konstantinopel benannte Gruppe osmanischer Christen diverser ethnischer Herkunft (aufgrund der orthodoxen Konfession und griechischer Sprache auch schlicht «Griechen» genannt), die im Dienste des Sultans standen; Haupttätigkeitsfelder im Handel, der Verwaltung, als Diplomaten oder Dolmetscher; vom 17. bis zum frühen 19. Jhd. wurden die Fürsten der Moldau und Walachei zuerst sporadisch, dann regelmäßig aus den Reihen der Phanarioten ernannt.
Polovcer > Kumanen
Pomaken: ethnografische Gruppe in Bulgarien und Griechenland, deren Angehörige einen südslawischen Dialekt sprechen und sich zum Islam bekennen.
Positivismus: in der Geschichtswissenschaft eine Arbeitsweise, die sich v.a. darauf konzent-riert, «positive» (empirische) Befunde (Daten, Fakten) zusammenzustellen, sich jedoch mit der Interpretation zurückhält; positivistische Arbeiten zeichnen sich daher in der Regel durch Quellennähe und Faktenreichtum aus.
Primogenitur: Erbfolgeregelung, bei der jeweils der erstgeborene Sohn die Thronfolge antritt.
Protobulgaren > Bulgaren
Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW): 1949–1991 bestehende Organisation der sozialistischen Staaten Osteuropas (ohne Jugoslawien), die später auch einige außereuropäi-sche sozialistische Staaten umfasste; Aufgabe der Organisation war im Rahmen der Planwirt-schaft die Arbeitsteilung zwischen den Mitgliedsländern, Koordinierung der Handelstätigkeit und wirtschaftliche Unterstützung der ärmeren Mitglieder.
Realunion von Lublin > Union von Lublin
Rote Armee: gängige Abkürzung für RKKA (russ. Raboče-Krest’janskaja Krasnaja Armija, Rote Arbeiter- und Bauernarmee), Bezeichnung für die von den > Bol’ševiki 1918 während
Glossar
364
des Bürgerkriegs gegründete Armee des jungen Sowjetstaats, ab 1946 wurden die sowjeti-schen Landstreitkräfte in Sowjetische Armee (russ. Sovetskaja Armija) umbenannt.
Ruthenen, ruthenisch: Bezeichnung für die ostslawische (ukrainische) Bevölkerung des Habs-burger Reiches, geht etymologisch auf die alle Ostslawen bezeichnende Form Rus’ zurück.
Sabbatianer: Mystisch-messianische Bewegung des 17. Jahrhunderts im Judentum um den selbsternannten Messias Sabbatai Zwi (1626–1676). Nachdem die für das Jahr 1666 verkün-dete Erlösung des jüdischen Volkes nicht eintrat, wurde er gezwungen, zum Islam überzutre-ten. Zahlreiche Anhänger folgten Sabbatai Zwi auf diesen Weg oder praktizierten ihren mysti-schen Glauben im Geheimen. Aus dieser Bewegung sind zahlreiche spätere Gruppen von Mystikern hervorgegangen, die synkretistische Riten praktizierten und zugleich anderen Religionsgemeinschaften angehörten, wie etwa > Dönme.
Sanacja: Bezeichnung für das rechts-autoritäre polnische Regierungslager in Polen von 1926 bis 1939, anfänglich informell angeführt von Marschall Józef Piłsudski (bis zu seinem Tod 1935); die Selbstbezeichnung sollte das Ziel einer moralischen Gesundung der Gesellschaft zum Ausdruck bringen.
Schollenbindung > Freizügigkeit, bäuerliche
Seniorat: Erbfolgeregelung, bei der das jeweils genealogisch älteste Mitglied der herrschen-den Sippe die Nachfolge antritt; in der Kiever Rus’ stand dem ältesten Mitglied der Rjuriki-den-Dynastie die Herrschaft in Kiev zu, die nachfolgenden Dynastiemitglieder rückten gemäß der Altershierarchie ins nächstbedeutende Fürstentum nach; in der Praxis häufig mit Thron-streitigkeiten verbunden.
Sephardim, sephardisch: Bezeichnung für die ursprünglich von der iberischen Halbinsel stammenden Juden und deren Kulturkreis (im Gegensatz zu den aus deutschsprachigen Regi-onen stammenden > Aschkenasim), im östlichen Europa seit dem Ende des Mittelalters v.a. im Osmanischen Reich bzw. Südosteuropa ansässig.
Smuta: (russ. smuta, smutnoe vremja, Wirren, Zeit der Wirren) von politischer Instabilität geprägte Epoche der russländischen Geschichte vom Tod Ivans IV. bzw. Aussterben der Rjurikiden-Dynastie 1584/98 bis zur Wahl des ersten Vertreters der Romanov-Dynastie zum Zaren 1613; gekennzeichnet von mit Machtkämpfen verbundenen mehrmaligen Thronwech-seln, Volksaufständen und militärischer Invasion der Nachbarmächte (Schweden, Polen).
Smyčka: (russ. Bündnis) während der NĖP von der Sowjetregierung propagiertes Bündnis der ländlichen und der städtischen Bevölkerung.
Sovchos: (russ. Sovchoz, sovetskoe chozjajstvo, Sowjetwirtschaft): staatlicher Landwirt-schaftsbetrieb in der Sowjetunion, im Unterschied zu den genossenschaftlich organisierten > Kolchosen.
Sozialismus: nach der marxistisch-leninistischen Sichtweise das Übergangsstadium vom Kapitalismus zum > Kommunismus, das geprägt ist von der Diktatur des Proletariates (fak-
Glossar
365
tisch der Parteispitze) und der Beseitigung der kapitalistischen Überreste; in diesem Sinne waren die Gesellschaften der Sowjetunion sowie der osteuropäischen Staaten in der Phase des Kalten Krieges sozialistisch (real existierender Sozialismus).
Sozialistischer Realismus: in der stalinistischen Sowjetunion 1932 staatlich vorgegebene Grundsätze sozialistischer Kunst (Literatur, Malerei, Film, Musik etc.), die für die UdSSR und später die sowjetisch dominierten Länder Osteuropas bis in die 1980er-Jahre als verbind-lich deklariert wurden; das künstlerische Schaffen sollte dabei auf den Prinzipien der «Volks-tümlichkeit» (verständlich für die Volksmassen), «Parteilichkeit» (ideologische Basis des Schaffens sollte auf der Linie der kommunistischen Partei sein) sowie «Konkretheit» (künstle-rischer Realismus) basieren. Typisch für die sozrealistische Kunst sind realistische Wiederga-be der Wirklichkeit, revolutionäres Pathos, Heroismus, handelnde Volksmassen unter Anfüh-rung eines Parteivertreters, konservative Ästhetik mit Verzicht auf experimentelle Kunst sowie traditionelle Wertvorstellungen (etwa bzgl. Familie, Sexualität).
Stachanov-Bewegung: 1935 anlaufende sowjetische Propagandaoffensive, die gemäß dem Vorbild des Kohle-Arbeiters Stachanov die Werktätigen zu quantitativen Höchstleistungen und Übererfüllung der vorgegebenen Arbeitsnormen anspornen sollte, um so die Produktivität der sozialistischen Wirtschaft zu steigern.
Stratiotensystem: im 7./8. Jhd. im byzantinischen Reich zeitgleich mit der Themen-Verfassung eingeführte Heeresorganisation, die auf freien Wehrbauern (griech. Stratioten) beruhte, die gegen Militärdienst Land übertragen erhielten, verlor im 11./12. Jhd. an Bedeutung.
Sultan: in der islamischen Welt verbreiteter Herrschertitel, getragen u.a. von der Dynastie der Osmanen, den Herrschern des Osmanischen Reiches.
Sunniten: (arab. Sunna, Brauch, Sitte), Angehörige der zahlenmäßig größten Glaubensrich-tung im Islam, im Unterschied zu den Schiiten; fast alle in der Geschichte Osteuropas auftre-tenden Moslems gehörten der sunnitischen Richtung an.
Szekler: in Siebenbürgen ansässige, ungarischsprachige Gruppe, als bäuerliche Gruppe seit dem Spätmittelalter kollektiv im Besitz adelsähnlicher Freiheiten und damit einer der drei siebenbür-gischen Landstände (neben dem ungarnländischen Adel und den Siebenbürger Sachsen).
Szlachta: (von dt. Geschlecht) Bezeichnung für den polnischen Adel, die Angehörigen eines vornehmen «Geschlechts»; bezieht sich eigentlich auf den gesamten, rechtlich einheitlichen Adelsstand, häufig aber auch nur auf den mittleren und niederen Landesadel, ohne die als > Magnaten bezeichnete Aristokratie.
Tanzimat: Bezeichnung für Reformen im Osmanischen Reich, die ab 1839 bis zur Verkün-dung der osmanischen Verfassung von 1876 unternommen wurden. Aufgrund unklarer Be-stimmungen, Korruption, der Unfähigkeit vieler Beamter und innerer Unruhen konnten die Reformen nicht umgesetzt werden. Auch Bezeichnung für die Epoche dieser Reformen.
Totalitarismustheorie: nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene sozialwissenschaftliche Ansätze, welche die stalinistische Sowjetunion und das nationalsozialistische Deutschland, in
Glossar
366
einem weiteren Sinne auch andere faschistische und kommunistische Regime, als Ausprägun-gen eines gemeinsamen, als totalitär bezeichneten Herrschaftssystems begreifen; zentrale Komponenten totalitärer Systeme sind je nach Ansatz massenhafter Terror, eine Herrschafts-ideologie, ein Repressionsapparat und die absolute Kontrolle der Gesellschaft durch ein dikta-torisches Regime im Rahmen einer Massenpartei.
Transhumanz: halbnomadische Wirtschaftsweise von Hirten mit einem Wechsel von weit auseinander liegenden Sommer- und Winterweiden, v.a. in den Gebirgsregionen Südosteuro-pas stark ausgeprägt, wird als typisch für die Lebensweise der > Vlachen angesehen.
Transleithanien: bezeichnet nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 die östliche, ungarische Reichshälfte der Habsburger Monarchie, nach dem Fluss Leitha, der stellenweise die Grenze zwischen den österreichischen Ländern (dementsprechend auch Cisleithanien genannt) und Ungarn bildete.
Trudoviki: (russ. Trudovaja gruppa, Gruppe der Arbeit) 1906 gegründete und bis 1917 beste-hende linksorientierte Partei, die die Interessen der Bauern vertrat. Während der > Oktoberre-volution stand sie in Opposition zu den > Bol’ševiki.
Turkvölker, turkische Sprachen: Sprachfamilie, der viele in den eurasischen Steppengebie-ten lebende nomadische Stämme angehörten; zu den Turkvölkern zählen u.a. die Türken; wesentlich turksprachig geprägt waren etwa die Stammesverbände der Chazaren, Petschene-gen und Kumanen.
Unierte Kirchen: (auch griechisch-katholische Kirchen) diverse Kirchen orthodoxen Ritus, die sich formell dem Papst unterstellen und in der Glaubenslehre einige Elemente der katholi-schen Doktrin akzeptieren; bedeutende Kirchenunionen v.a. 1596 in Brest, 1646 in Užho-rod/Ungvár (für die Ostslawen Polens bzw. Ungarns: Ruthenen bzw. Ukrainer und Weißrus-sen) und 1699/1701 in Siebenbürgen (Rumänen); bei der Bildung eines modernen National-bewusstseins spielten die unierten Kirchen eine wichtige Rolle; nicht zu verwechseln mit den > Unitariern.
Union von Lublin: die 1569 in der Stadt Lublin geschlossene Realunion zwischen Polen und Litauen führte zur administrativen Vereinigung beider Länder, die bisher (seit 1386) in Perso-nalunion verbunden gewesen waren.
Unitarier: (auch Antitrinitarier, Sozinianer, Rakowianer oder Arianer) im 16. Jhd. entstande-nes reformatorisches Glaubensbekenntnis v.a. in Polen und Siebenbürgen; theologische Diffe-renz zu den anderen reformatorischen Gruppen besteht in der Leugnung der Dreieinigkeit Gottes, daher im frühneuzeitlichen Europa fast überall Verfolgungen ausgesetzt, nur in Sie-benbürgen als offizielle Konfession anerkannt; nicht zu verwechseln mit den > Unierten Kirchen.
Utraquisten: 1436 nach der Bewilligung des Laienkelches in Böhmen (Empfang des Abend-mahls für Laien in beiderlei Gestalt – »sub utraque specie« – Brot und Wein) aus der > hussi-tischen Bewegung hervorgegangene Konfession, die bis ins 16. Jhd. fortbestand.
Glossar
367
Veče: seit dem 11. Jhd. belegte und stellenweise bis ins 15. Jhd. bestehende städtische Volks-versammlungen in der alten Rus’, deren Kompetenzen in der Forschung umstritten sind; stark ausgeprägte veče existierten v.a. im Nordwesten (Novgorod, Pskov).
Vlachen: Sammelbezeichnung für diverse romanischsprachige Gruppen Südosteuropas; bis ins 19. Jhd. auch für die Rumänen verwendet; in vielen Regionen Südosteuropas ist die ur-sprünglich sprachlich-ethnische Bezeichnung Vlache einer sozialen Bedeutung gewichen und steht für Hirte oder Angehöriger der Orthodoxie.
Waräger: auch Wikinger, Rus’, aus Skandinavien stammende Männerbünde, die als bewaffnete Händler weiträumige Raub- und Handelszüge unternahmen; drangen spätestens im 9. Jhd. über die Flusssysteme ins osteuropäische Binnenland zwischen Ostsee und Schwarzem Meer vor und waren im Verbund mit Ostslawen wesentlich an der Entstehung der Kiever Rus’ beteiligt.
Warschauer Pakt: als Reaktion auf die Gründung der NATO 1955 unter sowjetischer Füh-rung gegründetes und 1991 aufgelöstes Militärbündnis der UdSSR und der in ihrem Einfluss-bereich stehenden osteuropäischen Staaten (Polen, DDR, Tschechoslowakei, Ungarn, Rumä-nien, Bulgarien, Albanien bis 1968).
Wüstung: nach Zerstörung oder Verfall aufgegebene bzw. verlassene Siedlungen (Dörfer, Städte) oder Landwirtschaftsflächen.
Zemstvo: 1864 in Russland geschaffene lokale Selbstverwaltungs-Einheiten.
Zentralismus, demokratischer: organisatorische Richtlinie marxistisch-leninistischer Partei-en, von Lenin theoretisch beschrieben und bei den Bol’ševiki durchgesetzt; zeichnet sich durch straff organisierte Kaderpartei, strikt hierarchischen Aufbau und im Rahmen einer unbedingten Parteidisziplin die Unterordnung unter die Mehrheitsmeinung aus.
Zweite Leibeigenschaft: v.a. in der marxistischen Geschichtswissenschaft verbreiteter Be-griff, der den ganzen Komplex der verstärkten bäuerlichen Abhängigkeit der ostmittel- und osteuropäischen Bauern während der Frühen Neuzeit (im Gegensatz zu der angenommenen «ersten» Leibeigenschaft im «Frühfeudalismus») bezeichnet, inklusive der > Schollenbin-dung, der rechtlichen Schlechterstellung, gesteigerter Verfügungsrechte über die Bauern durch Übergang obrigkeitlicher Recht an den Grundherrn sowie Belastung durch Fronleistun-gen und Abgabeverpflichtungen (siehe auch > Gutsherrschaft).
Orts-, Personen- und Sachregister
380
ORTS-, PERSONEN- UND SACHREGISTER O R T S - , P E R S O N E N - U N D S A C H R E G I S T E R ORTS-, PERSONEN- UND SACHREGISTER Die fett gedruckten Seitenzahlen verweisen auf Glossareinträge. Literaturangaben wurden im Register nicht berücksichtigt. Abendland (Okzident) 13, 14, 169, 274, 280 Abodriten 62 Absolutismus, absolutistisch 17, 147, 185, 287,
291, 298, 346 Adalbert der Heilige (Wojciech) 308 Adria, adriatisches Meer 15, 58, 59, 60, 61,
64, 99, 131, 133, 171, 172, 173, 182, 280, 282, 291, 295, 296, 306, 323, 324, 325, 327, 341, 344
Adrianopel, Frieden von 330 Afghanistan 260, 261, 262 Afrika 13, 154 Ägäis, ägäisches Meer 15, 55, 151, 348 Ahnenkult 111, 343–345 Albanien (Albaner) 16, 18, 34, 35, 55, 66, 67,
68, 69, 79, 94, 103, 112, 117, 150, 151, 154, 174, 178, 205, 217, 258, 321, 327, 332, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 355, 367
Aleksej Michajlovič, 110, 111 Alexander I. 241, 242 Alexander II. 108, 242, 243 Alexander III. 243, 244 Ali Paşa von Janina 150 Alltag, Alltagsgeschichte 35–38, 47, 76, 86,
93, 157, 163, 232, 267, 305, 345 Alpen 60, 61, 169, 170, 206, 282, 283, 297,
311, 323 Altgläubige 100, 110, 111, 199, 239 Amselfeld > Kosovo polje Anatolien 103, 148, 324, 355, 348 Andrej Bogoljubskij, 234 Andropov, Jurij 261 Animisten, animistisch 95, 269, 355 Anjou (Dynastie) 291, 317 Annales-Schule 31, 35, 355 Anten 57, 58 Antisemitismus, antisemitisch 116, 314, 315 Antonescu, Ion 116 Araber 322 Arbeiterselbstverwaltung 220, 340 Armand, Inessa 256 Armenien, Armenier 18, 74, 94, 113, 151, 203,
252, 262, 314 Aromunen > Vlachen Arpaden 173, 290, 291, 295, 309, 323, 324
Aschkenasim (auch > Juden, Ostjuden) 94, 104, 315, 355, 364
Aseniden 324 Aserbaidschan, Aserbaidschaner 18, 269 Asien 13, 14, 15, 16, 19, 154, 267 Astrachan’ 237, 358 Atheismus, atheistisch 114–117 Athos 350 Aufklärung, aufklärerisch 14, 26, 27, 104,
240, 242, 269, 345, 349 Augsburg 70, 160, 323 Augustinus 98 Autokephalie, autokephal 102, 103, 117, 355,
363 Autokratie, autokratisch, Selbstherrschaft
27, 28, 140, 141, 143–144, 147, 156, 185, 191, 192, 199, 211, 221, 237, 238, 242–246, 248, 264–266
Avvakum 110 Awaren, Awarenreich 48, 52–55, 58, 60–62,
65, 88, 131, 133–135, 166, 173, 282, 283, 295, 321, 323, 355, 360
Azovsches Meer 234 Babel 50 Babenberger 297 Baberowski, Jörg 250, 256 Baiern 283 Balkanbund (Balkanpakt) 336 Balkangebirge > Haemus Balkaren 271 Balten, baltische Völker 15, 43, 55, 62, 71–73,
85, 88, 99, 131, 136, 210, 211, 269, 287, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 319
Baltendeutsche (> auch Deutsche) 20, 71, 73, 96, 174, 211, 246, 268, 286, 300, 302, 303
Baltikum 18, 19, 21, 72, 88, 92, 173, 176, 180, 183, 210, 250, 251, 262, 281, 300, 304, 305, 312
Ban/Banus 295–296, 355 Banat (Banschaft) 291, 293, 295, 334, 355 Basel 12, 23, 87 Batschka 293 Batu (Khan) 138, 358 Bayer, Gottlieb Siegfried 26
Orts-, Personen- und Sachregister
381
Befreiungsnationalismus 331–333, 349 Bektaschi-Orden 112, 355 Belgrad 117, 321, 326, 339 Berija, Lavrentij 258 Berkeley 24 Berlin 21, 151, 209, 259, 331–333 Berliner Kongress 151, 227, 331–333 Bern 12, 23 Bessarabien 82, 241, 251, 257, 315, 334 Bevölkerungsdichte 15, 107, 129, 163–167,
176, 186, 187, 196, 202, 311 Bevölkerungsverluste 169, 213, 268 Bewegung, philhellenische
> Philhellenismus Białystok 209 Birobidschan 116 Bloch, Marc 35 Blockfreie Staaten 220, 340, 355 Bocheński, Joseph 23 Böhmen (böhmische Länder;
auch > Tschechoslowakei) 17, 18, 22, 37, 61, 75, 94, 100, 131, 144, 147, 165, 166, 171, 174, 176, 180, 183, 190, 191, 195, 206, 207, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 297, 298, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 356, 359, 366
Böhmerwald 186 Böhmische Brüder (auch > Hussitismus
>Utraquisten) 100, 356 Bohn, Thomas M. 254 Bojaren, Bojarentum 141–144, 177, 181, 184,
185, 202, 234, 237, 239, 349, 356, 357, 361 Bol’ševiki (> auch Men’ševiki) 12, 30, 82,
151, 152, 201, 211, 212, 244, 249, 250, 253, 270, 280, 293, 304, 355, 356, 361–363, 366, 367
Bolotnikov, Ivan 238 Bonnell, Victoria 39, 246 Boris Godunov 238 Boris I. 96, 322 Bosnien, Bosnien-Herzegowina 18, 60, 85,
94, 103, 113, 117, 119, 165, 169, 170, 171, 172, 178, 180, 182, 183, 184, 204, 220, 291, 298, 311, 325, 331, 332, 336, 337, 340, 346, 347, 353
Bosporus 324, 329 Brabant 167 Brackmann, Albert 21 Brandenburg 302 Brandrodewirtschaft 168, 169, 356 Bratislava > Pressburg Breslau 21 Brest, Brest-Litovsk 101, 250 Brežnev, Leonid 31, 115, 154, 215, 260,
261, 356
Brežnev-Doktrin 154, 356 Brunnbauer, Ulf 37 Brzeziński, Zbignew 266 Buchara 29 Buda 309 Bug 51, 289 Bukowina 298, 315, 334 Bulgaren (Protobulgaren) 54, 55, 58, 60, 79,
93, 96, 119, 130, 134, 166, 230, 322, 331, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 356, 363
Bulgarien, Bulgaren (auch > Bulgaren, Protobulgaren) 18, 34, 35, 56, 58, 59, 67, 68, 74, 81, 94, 96, 102, 103, 104, 113, 151, 169, 170, 183, 184, 202, 203, 204, 205, 206, 217, 232, 257, 282, 322, 324, 325, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 348, 350, 356, 361, 363, 367
Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien (BIOst) 22
Bunge, Nikolaj v. 244 Burgenland 291, 293 Burjäten 95 Burke, Peter 35 Bürokratisierung 16, 107, 155, 242 Byzanz, Byzantinisches Reich 13, 17, 49,
55, 57, 58, 61, 73, 74, 95–98, 105, 106, 113, 114, 131, 133, 134, 137, 140, 148, 167, 169, 170–174, 178, 182, 184, 230, 232, 237, 239, 264, 282, 290, 294–296, 321–327, 341, 348, 349, 363, 365
Cambridge 24, Cäsar 57 Ceauşescu, Nicolae 338, 339 Čechov, Anton 198 Celan, Paul 316 Černenko, Konstantin 261 Černigov 136, 180, 233 Cetinje 330 Četnik-Verbände 337 Chakassen 93 Chanten 70, 95 Chazaren, Chazarenreich 48, 62, 70, 130,
135, 136, 230, 233, 366 Cherson 230 Chicago 24 China 138, 193, 259, 338, 341 Chiva 29 Chlevnjuk, Oleg 256, 257 Chruščev, Nikita 115, 153, 215, 258–260, 338 Chulos, Chris J. 122 Churchill, Winston 338 Čičerin, Boris 27 Çiftlik-System: 184, 194
Orts-, Personen- und Sachregister
382
ČK, VČK 250, 255, 256, 356 Cluj (Klausenburg) 37, 40 Collegium Carolinum 22 Conze, Werner 21 Częstochowa (Tschenstochau), 308 Dacia 65, 66, 133, 321, 348 Daker 65 Dalmatien 55, 114, 138, 174, 294, 295, 298,
323, 324, 327, 333, 336 Dänemark, Dänen 71, 300, 303, 304, 311 Daniel, Ute 35 Danilov, Viktor 31 Danzig 165, 180, 189, 303 Datini 192 DDR (Deutsche Demokratische Republik)
16, 257, 262, 367 Demidov (russ. Familie) 192 Demokratischer Zentralismus > Zentralismus Dependenz- / Sogtheorien 164 Deutschbalten > Baltendeutsche Deutsche (> auch Baltendeutsche, Sieben-
bürger Sachsen, Russlanddeutsche) 14, 21, 73, 79, 80, 81, 172, 234, 271, 278, 282, 285, 286, 288, 293, 302, 303, 309, 311, 313, 316, 337
Deutsche Gesellschaft zum Studium Osteuropas (DGO) 21
Deutscher Orden 71, 300, 302–304 Deutsches Reich > Deutschland Deutschland (Deutsches Reich, Heiliges
Römisches Reich; auch > Fränkisches Reich) 14, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 46, 82, 94, 130, 131, 192, 200, 246, 248, 250, 257, 260, 262, 279, 281, 284, 286, 289, 293, 294, 296, 297, 300, 303, 311, 312, 314, 336, 337, 365
Dinarisches Gebirge 341 Diskursanalyse 36, 357 Dmitrij (Sohn Ivans IV.) 238 Dmitrij Donskoj 236 Dnjepr 51, 62, 70, 135, 137, 230, 231, 238 Dobrudscha 332, 334 Don 51, 70, 135 Donau 16, 18, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 65,
66, 67, 70, 128, 130, 131, 133, 138, 170, 280, 283, 291, 297, 321, 325, 356, 361
Donaufürstentümer (> auch Walachei, Moldau) 326, 329, 331, 350
Donaumonarchie > Habsburgerreich Donauschwaben 311 Dönme (> auch Sabbatianer) 112, 357, 364 Dorpat > Tartu Drava 295
Dreifelderwirtschaft 166–168, 196, 200, 312 Drevljanen 57 Drugoviten 57 Družina 137, 141, 177, 184, 357 Dschingis Khan 138 Dubček, Alexander 218 Dubnow, Simon 28 Dubrovnik (Ragusa), 149, 172, 182, 296, 323 Dukagjini, Lekë 345 Duklja 60 Duma 142, 245, 246, 248, 263, 356 Düna 302, 303 Dvina, westliche 230 Einparteienherrschaft 155, 294, 305, 338 Eiserne Garde > Legion des Erzengels Michael Eisernes Tor 280 El’cin, Boris 262, 263 Elbe 60, 163, 167, 175, 176, 186, 187, 358 Elieser, Israel ben 105 Engels, Friedrich 151 England > Großbritannien Entstalinisierung 153, 154, 215, 258, 294,
338, 340f Epiros 341 Erbuntertänigkeit (> auch Leibeigenschaft)
187, 278, 288, 357 Ėrenburg, Ilja 258 Erinnerung, Erinnerungskultur 36, 39, 254,
259, 299, 308 Erster Weltkrieg 17, 21, 33, 71, 76, 77, 144,
151, 152, 195, 201, 204, 205, 207, 208, 210, 212, 222, 246–248, 252, 279, 285, 288, 293, 296, 299, 301, 304, 332, 333, 336, 362
Erzählung von den vergangenen Jahren > Nestorchronik
Estland (Esten) 18, 69, 70–73, 94, 100, 101, 211, 240, 257, 262, 268, 269, 303–305, 313
Eurasien 24, 138 Europäische Gemeinschaft 337 Europäische Türkei, europäischer Orient
14, 18 Europäisierung 229, 240 Eusebios von Caesareia 98, 322 Evenken (Tungusen) 95 Ewenen 95 Februarrevolution 144, 152, 248, 357, 361 Febvre, Lucien 35 Feischmidt, Margit 37 Ferdinand I. 327 Ferner Osten 18, 242
Orts-, Personen- und Sachregister
383
Ferrara 101 Feudalisierung, Feudalismus, feudal
30–32, 170, 174–180, 184, 188, 201, 343, 344, 357, 367
Filofej (Mönch) 106 Finnischer Meerbusen 71, 280, 303, 304, 312 Finnland, Finnen 16, 18, 69, 70, 71, 94,
211, 217, 241, 251, 267–269, 269, 281 Finno-Ugrier 55, 62, 69, 70, 136, 169,
268, 310 Fitzpatrick, Sheila 257, 266 Flamen 311 Florenz 101 Frank, Jakub 105 Fränkisches Reich (auch > Deutschland)
62, 97, 131, 166, 239, 279, 282, 283, 294, 295, 311, 323
Frankreich, 25, 35, 36, 40, 46, 112, 114, 129, 147, 164, 173, 203, 314, 330, 331, 336
Franz Joseph I. 299 Frau, Frauengeschichte 17, 36, 109, 150,
232, 238, 256, 342, 343 Freeze, Gregory 121 Freizügigkeit, bäuerliche (> auch
Schollenbindung) 175, 176, 357, 364 Friaul 323 Fribourg 23 Fugger (Handelshaus), 172, 192 Fünfkirchen > Pécs Gagarin, Jurij 259 Gajdar, Egor 263 Galizien (Halič) 90, 102, 105, 137, 209, 233,
288, 298 Gallier 57 Garašanin, Ilija 348 Gatrell, Peter 246 Gediminiden (Dynastie) 300, 301 Gefter, Michail 31 Gegen 69 Gender, Gender Studies 36, 93 Genua 131, 169, 323 Georgien, Georgier 18, 85, 94, 103, 252,
262, 268 Gepiden 65, 66 Germanen 15, 50, 52, 53, 57, 66, 71 Geyer, Dietrich 156, 246, 247, 265 Géza (ung. Fürst) 323 Gilde 179, 192, 204 Ginzburg, Carlo 35 Glasnost’ 156, 261, 357, 363 Gnesen > Gniezno Gniezno (Gnesen) 286 Godunov > Boris Godunov
Goehrke, Carsten 239 Goldene Horde (> auch Mongolen )
7, 136, 138, 139, 140, 141, 234, 235, 236, 237, 264, 268, 358
Gončarov, Ivan 198 Goranen 56 Gorbačev, Michail 215, 216, 261, 262,
339, 357, 363 Goten 53, 65, 66, 98, 166, 321 Grandits, Hannes 37 Gregory, Paul R. 246 Griechen 55, 93, 119, 203, 314, 325, 330,
348, 350, 363 Griechenland, 16, 18, 56, 74, 81, 102, 103,
133, 150, 202, 204, 205, 211, 217, 327, 330, 332, 333, 335–339, 353, 363
Großbritannien (England) 16, 25, 35, 46, 164, 189, 196, 197, 314, 330, 331, 338
Großmährisches Reich 95, 283, 290 Großwesir 150, 358 Guido Hausmann 247, 265 GULAG 152, 255, 274, 275, 358 Gurevič, Aron (Aaron Gurevitch; Aaron
Gurjewitsch) 31 Gutsherrschaft 187–190, 358, 367 Habsburgerreich, Österreich-Ungarn,
Donaumonarchie 14, 17, 38, 78, 79, 82, 92, 100, 102, 129, 136, 147, 148, 190, 200, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 241, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 287, 288, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 310, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 341, 344, 348, 349, 350, 362, 364, 366
Haemus (Balkangebirge) 58, 60 Häfner, Lutz 247, 265 Haimson, Leopold 246 Hajnal-Linie 342 Halfin, Igal 257 Halič > Galizien Hanse 188, 280, 304, 312, 358 Harvard, 24 Haumann, Heiko 12, 37, 247, 250, 256 Heilige Liga 329 Heiliges Römisches Reich > Deutschland Heinrich I. 232 Heinrich IV. 232 Hellbeck, Jochen 257 Herder, Johann Gottfried 80 Herder-Institut (Marburg) 22 Herzberg, Julia 38 Herzegowina (> auch Bosnien) 18, 117,
119, 178, 204, 220, 331, 332, 336 Hetmanat der Kosaken 269
Orts-, Personen- und Sachregister
384
Hildermeier, Manfred 246, 250 Historische Anthropologie 36 Historismus 26–28, 127, 358 Hitler, Adolf 257, 289, 301 Hitler-Stalin-Pakt 257, 289, 301 Hobsbawm, Eric J. 35 Hoetzsch, Otto 21 Hohe Pforte 326, 327, 330, 345, 358 Holocaust 105, 157, 316, 359 Holquist, Peter 248 Hóman, Bálint 33 Hösch, Edgar 19, 239 Hoxha, Enver 339, 340, 341, 353 Hroch, Miroslav 34, 77 Hruševs’kyj, Mychajlo 29 Hum (Zahumlje) 60 Hundert, Gershon 37 Hunnen 48, 53, 54, 65, 166, 310, 322, 323 Hunyadi, Johannes 327 Hus, Jan 100, 309, 310, 359 Hussitismus, hussitisch 100, 309, 310,
314, 356, 359, 366 Illyrer, illyrisch 59, 64, 67, 68, 82, 348 Illyrismus 347 Indien 73, 74, 355 Industrialisierung 28, 115, 163, 164, 189,
191, 192, 195, 196, 199–214, 217, 219, 222, 223, 244, 246, 247, 253, 271, 284
Inguschen 271 Intelligencija 28, 121, 203, 243, 245, 248, 359 Ionisches Meer 15 Iorga, Nicolae 33 iranische Völker 59, 62, 70, 310 Irredentismus 332, 334, 336 Islam, islamisch (auch > Moslems) 13, 29,
69, 94, 103, 104, 111, 112, 114, 116, 118, 130, 138, 148, 149, 151, 195, 231, 235, 237, 267, 280, 324, 328, 332, 347, 355, 357, 363, 364, 365
Israel 105, 116, 316 Istanbul > Konstantinopel Istrien 174, 283, 294, 296, 323 Italien, Italiener 15, 25, 46, 96, 114, 164,
169, 182, 183, 192, 221, 296, 311, 324, 334, 336, 337, 349
Ius militare 183 Ius teutonicum / sächsisches Stadtrecht
174, 180 Ivan Groznyj (der Schreckliche) > Ivan IV. Ivan III. 105, 236 Ivan IV. 191, 237, 238, 268, 362, 364
Jadwiga (Polen) 301 Jagiełło (Jogaila) 235, 287, 301, 327 Jagiellonen (Dynastie) 145, 183, 287, 301 Janitscharen 330, 355, 359 Japan 201, 245 Japhet (Sohn Noahs) 50 Jaroslav der Weise 232, 233 Jaroslavl’ 236 Jasna Góra 308 Jelzin >El’cin, Boris Jenissei 69 jiddisch 94, 315 Jireček, Constantin 20 Jogaila > Jagiełło Johannes Paul II. (Karol Wojtyła) 308 Johanneshundertschaft 181 Joseph II., josephinische Zeit 207, 298 Josip Broz > Tito Juden auch > Aschkenasim, Sephardim
17, 28, 29, 37, 74, 79, 92, 94, 104, 105, 111, 112, 116, 118, 120, 130, 157, 188, 203, 208, 231, 241, 268, 269, 278, 289, 313, 314, 315, 316, 337, 355, 359, 364
Judenspanisch > Ladino Jugoslawien 16, 19, 81, 85, 117–119, 122,
129, 154, 161, 205, 206, 211, 217, 220, 283, 293, 296, 334–340, 347, 355, 363
Jugoslawismus 118, 347 Jungtürken, jungtürkisch 151, 333, 347,
348, 359 Jurij Dolgorukij, 234 Kádár, János 218 Kafka, Franz 316 Kaliningrad (> auch Königsberg) 302 Kalmücken 95, 271 Kalter Krieg 22–24, 153, 154, 218, 258,
340, 355, 359, 365 Kama 130, 138 Kamenev, Lev 253 Kanun 345, 359 Kapiton (Mönch) 110 Kappeler, Andreas 16, 256, 264, 270 Karadjordjevići (Dynastie) 296 Karadžić, Vuk Stefanović 347 Karäer > Karaim Karaim (Karäer) 105 Karamzin, Nikolaj 27 Karantanien, Karantanier 57, 62, 283 Karatschaer 271 Karelier, Karelisch 71, 94 Karl der Große 97, 282, 283 Karlowitz, Friedensschluss von 329
Orts-, Personen- und Sachregister
385
Kärnten 283, 297 Karol Wojtyła > Johannes Paul II. Karolinger (Dynastie) 239 Karpaten 51, 60, 61, 62, 65, 67, 99, 136,
232, 280, 281, 290, 291, 292, 295 Karpato-Ukraine 57 Kasachstan, Kasachen 18, 242, 254, 259, 268 Kaschuben 56, 101 Kaser, Karl 37, 42 Kasimir III. (d. Große) 314 Kaspisches Meer 130, 132, 133, 135, 136 Kastriota, Georg > Skanderbeg Katharina II. 108, 143, 240, 241, 269 Katun 344, 359 Katzer, Nikolaus 254 Kaukasus 70, 116, 182, 245, 262, 268,
269, 270, 358 Kavelin, Konstantin 27 Kazan’ 237, 267, 273, 358 Kelly, Catriona 38 Kerenskij, Aleksandr 248 Khan, Khanat 96, 104, 136, 138, 139, 149,
166, 191, 235, 237, 267, 268, 233, 358, 360 Kharkhordin, Oleg 257 Khlevniuk > Chlevnjuk, Oleg Khodarkovsky, Michael 270 Kiever Rus’, Kiever Reich, Kiev (> auch
Russland) 14, 17, 26, 29, 57, 62, 63, 72, 82, 96, 100, 105, 106, 108, 109, 121, 131, 132, 135–142, 165, 168, 169, 171–173, 177, 180, 181, 221, 229–239, 264, 267, 268, 281, 300, 357, 358, 361, 362, 364, 367
kirchenslawisch 99 Kirgistan 18 Kivelson, Valerie A. 39, 239 Kleinasien > Anatolien Ključevskij, Vasilij 28 Kolchos 213, 254, 360, 364 Kollektivierung 115, 213, 220, 253, 268,
271, 289, 361 Kollontaj, Aleksandra 256 Köln, 22 Koloman (König) 324 Kolonialismus, kolonial 157, 172, 176, 193,
267, 270, 271, 298, 323 Kominform 339, 360 Komintern 339, 360 Kommunismus 30, 33, 34, 151, 155, 212,
251, 294, 360, 362, 364 Komsomol 114, 360 Konfessionalisierung 16, 92, 93, 99, 101, 181 Kongresspolen 210, 241, 287, 360 Königsberg (auch > Kaliningrad) 21, 44, 302 Königsdiktatur (Südosteuropa) 334, 335
Konstantin der Große 97, 98, 321 Konstantin XI. 105 Konstantinopel (Istanbul) 61, 95, 96, 97,
101, 102, 133, 134, 139, 169, 321, 323, 324, 325, 327, 329, 350, 355, 362, 363
Korenizacija 83, 252, 270, 271, 360 Kosaken 238, 241, 269, 360 Kosovo 18, 56, 67, 112, 117, 119, 126,
312, 332, 336, 348, 354 Kosovo polje (Amselfeld) 326 Kosygin, Aleksej 215, 219 Kotkin, Stephen 266 Kotor 60 Kotromaniden (Dynastie) 325 Krain 297 Krajina 296, 344 Krakau (Kraków) 104, 209, 286, 308, 309 Kraków > Krakau Kreuzzug 17, 92, 114, 120, 302, 303, 324, 326 Krim 105, 199, 230, 241, 242, 331, 358, 360 Krimkhanat (Khanat der Krim;
> auch Krimtataren) 136, 149 Krimtataren (auch > Krimkhanat)
29, 259, 269, 271 Krivičen 57 Kroatien, Kroaten 17, 18, 58, 59, 61, 75, 80,
82, 85, 94, 99, 102, 116, 118, 119, 131, 178, 183, 188, 282, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 323, 327, 333, 334, 336, 337, 340, 344, 347, 348, 349, 359
Krylova, Anna 257 Kuba 260 Kuban 70 Kulak 153, 254, 360 Kumanen 48, 166, 234, 361, 363, 366 Kuren 72 Kurland 303, 304, 319 Kyrill 95 Ladino 94 Ladogasee 62, 136, 137 Landesausbau 167, 176, 177, 312 Latein 68, 99, 133, 277 Lateinamerika 24, 154 Laue, Theodore H. von 246 Lausitz (Ober-, Nieder-) 56, 284, 297, 309 Lebenswelt, lebensweltlich 37, 38, 163,
342, 344 Lechfeld 70, 290, 323 Legion des Erzengels Michael (Eiserne Garde)
335 Lehen, Lehenswesen 131, 166, 175, 179,
183–185, 277, 284, 286, 302, 304, 343, 357
Orts-, Personen- und Sachregister
386
Leibeigenschaft, leibeigen (auch > Zweite Leibeigenschaft) 195, 198, 199, 207, 226, 233, 242, 264, 265, 278, 357, 358, 360, 361, 367–368
Leitha 163, 186, 366 Lenin, Vladimir 31, 91, 152, 159, 245, 249,
253, 256, 258, 261, 276, 339, 356, 360, 367 Leningrad > St. Petersburg Leo III. 97 Lettland (Letten) 18, 72, 73, 94, 101, 211,
257, 262, 268, 303, 304, 305, 313 Levi, Giovanni 35 Levin, Moshe 257, 266 Liechtenstein, Franz von und zu 20 Liga von Prizren 351 Linguistic turn 36 Litauen, Litauer, litauisch 18, 40, 63, 72, 79,
94, 96, 99, 100, 102, 104, 105, 120, 129, 136, 146, 160, 161, 167, 173, 174, 176, 177, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 209, 210, 234–238, 241, 257, 259, 262, 269, 281, 287, 300–305, 314, 315, 356, 366
Liven, livisch 71, 72, 302 Livland 71, 72, 73, 100, 125, 165, 173, 188,
191, 237, 240, 302, 303, 304, 313, 319 Łódź 210 Lomonosov, Michail 27 London 244 Lotman, Jurij 32 Lourdes 112 Löwe, Heinz-Dietrich 246, 247 Lübeck 173, 180 Lublin, 104, 146, 301, 363, 366 Lüdtke, Alf 36 Ludwig II. 327 Magdeburg 173, 180, 181, 313 Magdeburger Stadtrecht 181, 313 Magnaten 100, 147–148, 174, 184, 188,
325, 361, 365 Magyaren > Ungarn Mähren 18, 81, 94, 96, 100, 138, 165,
180, 183, 190, 206, 284, 285, 286, 309 > auch Böhmen
Makedonen (Dynastie) 322 Makedonien, Makedonier (Volk), 18, 56, 68,
74, 79, 81, 93, 103, 117, 133, 150, 151, 178, 220, 329, 332, 335, 346–348, 355
Makedonische Frage 335 Malia, Martin 246, 250, 257, 266 Mani 113 Mansen (Wogulen) 70 March > Morava
Maria Theresia 298 Marija Bistrica 118 Marshall-Wirtschaftshilfeplan 218, 361 Martov, Julij 244 Marx, Karl 29, 31, 151, 212, 220, 256 Marxismus, Marxismus-Leninismus
30,31, 211, 212, 339 Masowien 146, 165, 302 Materialismus, historischer 29–30, 33 Mati 68 McKean, Robert 246 McReynolds, Louise 247 Medick, Hans 36 Memel (Nemunas) 300, 304 Men’ševiki (> auch Bol’ševiki) 244, 356, 361 Mentalität, Mentalitätsgeschichte 25, 32, 35,
207 Mesopotamien 105 Mestničestvo 142, 185, 361 Method 95 Michail I. Romanov 238 Michail II. Romanov 248 Mikrogeschichte 35–36, 38 Militärgrenze (triplex confinium)
295, 328, 344 Miljukov, Pavel 28 Millet 120–121, 149, 361 Milošević, Slobodan 340 Minderheit 17, 46, 56, 76, 77, 79, 84, 93,
94, 119, 120, 250, 271, 285, 288, 334, 337, 349, 356
Mir (Umverteilungsgemeinde) 177, 200–201, 222, 243, 244
Mironov, Boris 246, 247, 250 Mission (christliche), Missionstätigkeit
112, 120, 268, 282, 283, 302, 322 Mittelmeer 128, 131 Modernisierung 16, 28, 35, 140, 164, 189,
191, 192, 195, 197, 198, 201, 204, 208, 212, 220, 222, 240, 242, 316
Modernisierungstheorien 163, 361–362 Mohács 291, 297, 327 Mohyla, Petro 100 Moldau 18, 67, 82, 85, 99, 103, 149, 182,
183, 262, 281, 291, 315, 325, 326, 331, 350, 356, 363
Molotov, Vjačeslav 258 Mongolen, Tataren 14, 63, 96, 104, 120,
131, 136, 138–140, 146, 165, 166, 168, 169, 171, 181, 191, 230, 234–237, 252, 267, 325, 360, 361
Montenegro (Montenegriner) 18, 60, 69, 93, 99, 103, 151, 203, 204, 330, 331, 332, 333, 334, 341, 343, 344
Orts-, Personen- und Sachregister
387
Morava (March) 170, 290 Moskau, Moskauer Reich, Moskowien
(> auch Russland) 17, 26, 28, 30, 32, 39, 53, 63, 72, 82, 99, 105, 106, 108, 110, 111, 117, 135, 136, 138–142, 146, 159, 165, 170, 174, 177, 182, 185, 191, 221, 225, 230, 234–239, 241, 245, 247, 250, 251, 262–265, 267, 268, 271, 294, 301, 304, 338, 339, 360, 363
Moskauer Reich > Moskau Moskowien > Moskau Moslems (auch > Islam) 17, 92, 94, 103,
104, 112, 117, 119, 120, 231, 268, 269, 324, 347, 350, 365
Müller, Gerhard Friedrich 26 Multiethnizität, multiethnisch 63, 84,
129, 263, 267, 268, 289, 346, 355 München 12, 22 Murat I. 326 Mussolini, Benito 336 Narva 173, 237, 303 Nationalitätenpolitik 71, 82, 84, 252, 267,
270–272 NATO 154, 305, 306, 337, 359, 367 Neidhardt, Friedhelm 35 Nemanjiden (Dynastie) 60, 325 NĖP 212, 213, 252, 253, 362, 364 Neretva 60 Nestorchronik (Erzählung von den vergange-
nen Tagen) 50, 57, 62, 135, 231, 357, 362 Neuberger, Joan 39 New Cultural History 36, 362 New York, 24, 111 Niederlande 164, 166, 168 Nikolaus I. 111, 241, 242 Nikolaus II. 111, 245, 248 Nikon (Patriarch) 100, 109, 110 Nikopolis 327 Niš 68 Njeguši (Dynastie) 330 Noah 50 Nomaden 54, 58, 61, 62, 66, 69, 70, 83,
128, 165, 166, 168–169, 234, 254, 271, 341, 361, 363
Nomenklatura 260, 306, 362 Nomisma 170 Nordamerika (auch > USA) 24 Nordosteuropa 18, 189, 211, 281, 319 Nordpolarmeer 15 Normannen (auch > Waräger) 231, 324 Normannismusstreit 27, 135
Novgorod 17, 57, 137–139, 142, 165, 174, 180–182, 221, 232–234, 236, 238, 304, 367
Novi Pazar 60 Ob 56, 62, 68, 69, 356 Obertreis, Julia 12, 39 Oberungarn > Slowakei Obrenović, Miloš 330 Oder 15, 51, 53, 289 Odessa 350 Ohrid 79, 102, 354 Oka 169 Oktoberrevolution 23, 151,205, 211, 249, 250,
255, 256, 261, 356, 357, 361, 362, 366 Oktobristen 248, 362 Okzident > Abendland Opričnina 191, 238, 362 Orient > Europäische Türkei Orientalische Frage 150, 329, 330 Ösel (Saaremaa) 303, 304 Osmanen > Osmanisches Reich Osmanisches Reich, Osmanen (> auch Türkei)
14, 17, 18, 38, 53, 69, 78, 81, 92, 94, 99, 101–103, 106, 112, 119, 120, 129, 134, 146, 148–151, 164, 165, 167, 168, 170, 172, 178, 182, 184, 190, 194, 195, 201, 202, 204–206, 240–242, 280, 291, 292, 295, 298–300, 310, 314, 324–333, 341, 344–347, 349, 350, 358, 359, 362, 364, 365
Ostblock 14, 16, 23, 24, 33, 34, 114, 154, 259, 260, 262, 306
Österreich (> auch Habsburgerreich) 23, 82, 208, 209, 288, 291, 293, 296–299, 311, 331, 333, 366
Österreich-Ungarn > Habsburgerreich Ostforschung 21–22 Ostjaken > Chanten Ostjuden (auch > Juden, Aschkenasim)
104, 122, 315, 317 Ostkolonisation 15, 165–168, 173, 176, 177,
180, 187, 313 Ostpreußen > Preußen Ostrowski, Daniel 264 Ostsee 15, 16, 56, 58, 60, 61, 70–73, 88,
99, 131, 132, 135, 165, 171, 187, 226, 230, 232, 238, 240, 280, 282, 300, 302–304, 306, 312, 367
Ostseefinnen (auch > Finnland, Finnen) 71, 72, 131, 300, 302
Ostseeprovinzen (Russland) 240, 245, 267 Otto der Große 323 Ottonen (Dynastie) 232
Orts-, Personen- und Sachregister
388
Pacta conventa 324 Paisij Chilendarski, 119 Palaiologen (Dynastie) 173, 324 Palästina 302 Pannonien, pannonische Tiefebene 55, 60, 69,
70, 128, 133, 163, 166, 176, 186, 282, 355 Panslawismus 151, 329, 362 Paris 25, 333, 336 Pastorale Wirtschaftsweise (pastorale
Gesellschaft) 168–170, 341–345 Patriarch 27, 96–103, 106–110, 115, 117,
139, 178, 202, 239, 323, 330, 335, 342, 344, 345, 355, 362–363
Paulikianer 113 Pax ottomanica 194 Pax romana 321 Pazifik 140 Pécs (Fünfkirchen) 309 Peipussee 303 Peloponnes 58 Perejaslavl’ 136 Perestrojka 31–34, 84, 156, 261, 262, 301,
357, 363 Permier 93 Persien 74, 105 Peter I., der Große 28, 106, 107, 110, 111,
191, 193, 198, 229, 230, 239–241, 269 Peter III. 241 Petrograd > St. Petersburg Petschenegen 48, 70, 166, 234, 363, 366 Phanarioten 326, 349, 363 Philhellenismus, philhellenische
Bewegung 330, 349 Piasten (Dynastie) 286, 287, 309 Pindos 341 Pipes, Richard 250, 257, 266 Pippin III. 96 Plaggenborg, Stefan 261 Plattensee (Balaton) 291 Podgorica 331 Podolien 105 Poebene 166, 168 Pogrom 243, 269, 313, 315 Pohl, Walter 47, 52, 54 Pokrovskij, Nikolaj 30 Polanen 57, 286 Polen (Land, Volk) 14, 17, 18, 21, 33, 34, 37,
51, 57, 60, 63, 75, 79, 92, 94, 99, 100, 102–105, 118–120, 125, 129, 131, 136, 138, 144–148, 154, 157, 165–167, 173, 174, 176, 177, 181, 183, 184, 187–191, 209–211, 217–220, 234–238, 241, 245, 251, 257, 260, 267–269, 278, 279, 281,
282, 286–290, 294, 299–302, 304, 306, 308–315, 355, 356, 360, 361, 364, 366, 367
Polen-Litauen (Adelsrepublik) 17, 94, 120, 148, 157, 209, 241, 287, 288, 289, 301, 314, 315, 320
Poljanen 57 Polock 232, 233, 237 Pomaken 56, 94, 363 pomeščiki 185 pomest’e 142, 185 Pommern 289 Pomoranen 57 Portugal 94 Posen 209 Positivismus 28, 30, 363 Post-Colonial Studies 37, 38 Prag 90, 104, 160, 283, 309 Přemysliden (Dynastie) 176, 183, 283,
307, 309 Pressburg (Bratislava) 79, 180, 291, 309 Preußen (Ost-, West-) 73, 78, 129, 148, 190,
209, 226, 241, 279, 281, 287, 288, 289, 293, 302, 303, 304, 312, 319, 320, 330
Primogenitur 140, 236, 363 Pripjat 51 Prizren 351 Pronoia, Pronoiaren 169, 170, 173, 178, 184 Prussen 73, 101, 302, 308 Pseudodemetrien 238 Pskov 17, 137, 174, 181, 182, 221, 233,
274, 367 Pugačev, Emel’jan144, 241 Pula 182 Putin, Vladimir 216, 263 Ragusa > Dubrovnik Ranke, Leopold von 28 Raška 60 Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe
(RGW) 218, 219, 339, 363 Razin, Stepan (Stenka) 144 Realismus, sozialistischer
> Sozialistischer Realismus Reformation 92, 99–101, 120, 164,
277, 302, 304, 308, 313, 356 Regensburg 22 Reval > Tallinn Rheinland 173 Rhodopen 341 Riga 189, 211, 302, 303 Rjazan’ 169 Rjurik 135, 231
Orts-, Personen- und Sachregister
389
Rjurikiden (Dynastie) 27, 63, 137, 140, 143, 231, 232, 233, 238, 364
Rom 64, 78, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 106, 133, 321, 323, 362
Roma (Zigeuner) 17, 73, 74, 94, 157, 337, 359 Romanov (Dynastie) 143, 238, 248, 364 Römisches Reich (auch > Byzanz) 49, 52,
64–66, 96, 100, 106, 112, 128, 131, 133, 134, 311, 321, 341
Rostov 236 Rote Armee 118, 250, 251, 261, 286, 294,
338, 363 Roth, Joseph 316 Rückständigkeit, rückständig (backwardness)
14, 28, 29, 104, 163, 186, 199, 204, 210, 223, 229, 239, 246, 269, 333
Rudolf II. 297 Rumänien, Rumänen (> auch Vlachen)
18, 19, 33–35, 37, 57, 64–68, 74, 78, 79, 81, 82, 93, 100–103, 116, 117, 119, 133, 155, 202, 204–206, 217, 257, 291–293, 299, 313, 315, 326, 330, 331, 333–336, 338, 339, 348–350, 359, 363, 366, 367
Rumelien 104 Russen 63, 71, 79, 84, 106, 233, 267, 268,
269, 271, 305 Russifizierung 82–84, 244, 268–271, 288 Russinen 57 Russland, Russländisches Reich (> auch
Kiever Rus’, Moskau, Sowjetunion) 14, 15, 17–32, 34, 38, 53, 55, 56, 71, 79, 82, 84, 92, 93, 100, 102–106, 108, 110, 114, 116, 120–122, 129, 136, 140, 141, 148, 151, 156, 163–166, 168, 171, 172, 174, 177, 180, 181, 183, 185, 190–202, 209–212, 221, 222, 229, 230, 239–252, 259, 262–268, 270, 278–281, 287, 288, 293, 299, 301, 304, 311, 312, 329–331, 349, 356, 360–362, 367
Russlanddeutsche 311 Ruthenen 57, 78, 82, 288, 292, 293, 299,
364, 366 Rüthers, Monica 39 Saale 186 Saaremaa > Ösel Sabbatianer 112, 357, 364 Sacharov, Andrej 259 Sager, Peter 23 Säkularisierung, säkular 92–93, 108, 118, 239 Saloniki 43, 104 Samo 62, 282, 283 samojedische Sprachen 69 San Stefano, Friedenschluss von 331, 336
Sanacja 288, 364 Sandborn, Joshua A. 248 Sandžak 331 Sarakatsanen 341 Sarmaten 310 Šatalin-Plan 216 Satellitenstaaten 154, 211, 217, 218, 220, 338 Sava (Heiliger) 78 Save (Fluss)18, 280, 291, 295 Ščerbatov, Michail 27 Scharia 149, 195, 359 Schattenberg, Susanne 38 Schieder, Theodor 22 Schiemann, Theodor 20 Schlesien 18, 190, 195, 284, 289, 297, 309 Schleswig 173 Schlögel, Karl 39 Schlötzer, August Ludwig 26 Schmidt, Christoph 38, 264 Scholle, Schollenbindung (> auch Freizügig-
keit, bäuerliche) 107, 175, 187, 189, 191, 238, 357, 364, 367
Schramm, Gottfried 68, 246 Schulze Wessel, Martin 92 Schwarze Bauern (> auch weiße Bauern)
177, 192 Schwarzes Meer 15, 53, 57, 70, 130, 131, 132,
133, 135, 136, 233, 241, 300, 310, 329, 358 Schweden (> auch Skandinavien) 17, 18, 71,
188, 200, 231, 234, 237, 238, 240, 300, 304, 308, 364
Schweiz 20, 22, 25, 200, 297 Securitate 339 Sejm (Reichstag) 145, 147, 184 Selbstherrschaft > Autokratie Seldschuken 324 Selen 72 Semgaller 72 Seniorat 140, 233, 342, 364 Sephardim, sephardisch (auch > Juden)
94, 104, 355, 364 Serbien (Serben) 18, 58, 60, 61, 74, 78, 81,
82, 85, 93, 94, 96, 99, 102, 103, 117, 118, 119, 151, 165, 169, 170, 171, 172, 178, 180, 182, 183, 184, 202, 203, 204, 205, 220, 291, 292, 293, 295, 296, 299, 311, 325, 326, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 340, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 363
serbokroatisch 80 Severjanen 57 Shevzov, Vera 122 Shields Kollmann, Nancy 239 Sibirien 15, 18, 54, 69, 83, 95, 138, 191, 237,
267, 269, 270, 360
Orts-, Personen- und Sachregister
390
Siebenbürgen (Transsylvanien) 18, 19, 37, 65, 66, 67, 78, 99, 102, 146, 149, 165, 171, 172, 174, 180, 281, 290, 291, 292, 293, 295, 312, 321, 328, 329, 334, 348, 349, 350, 365, 366
Siebenbürger Sachsen 90, 291, 365 Simon, Gerhard 254 Sinti (> auch Roma) 73 Sipahi 184, 194 Skanderbeg (Georg Kastriota) 327 Skandinavien (> auch Schweden, Finnland)
18, 27, 31, 46, 71, 128, 132, 135, 197, 230, 280, 367
Skutari (Shkodra) 182, 321 Skythen 310 Slawonien (> auch Kroatien) 293, 295,
296, 333 Slawophile 229 Slovenen (Novgoroder) 57 Slovinzen 57 Slowakei, Slowaken, Oberungarn 18, 56, 57,
60, 74, 78, 79, 82, 90, 94, 101, 116, 119, 171, 174, 180, 283, 285, 286, 290, 291, 292, 293, 299, 306, 312
Slowenien, Slowenen 18, 57, 94, 101, 119, 281, 283, 293, 296, 320, 323, 333, 334, 340
Smederovo 326 Smolensk 41, 233, 238, 276 Smuta (Zeit der Wirren) 143, 185, 191, 238,
364 Smyčka 252, 364 Solov’ev, Sergej 27 Sorben 56, 61, 94 Sovchos 213, 254, 360, 364 Sowjet (Rat) 248–249, 251, 263 Sowjetunion, UdSSR (> auch Russland)
14, 15, 17–19, 21–26, 29–34, 37–39, 42, 71, 82–85, 90, 95, 114–118, 121, 122, 129, 130, 135, 136, 151–157, 211–214, 216–220, 222, 229, 230, 245, 250–254, 256–263, 266–268, 270–272, 279, 280, 286, 288–290, 294, 300–302, 304–306, 337–340, 356–365, 367,
Sozialismus 30, 33, 34, 41, 86, 87, 119, 130, 151, 152, 157, 158, 211, 212, 220, 244, 253, 254, 256, 275, 286, 294, 300, 305, 306, 340, 361, 362, 364–365
Sozialistischer Realismus 256, 365 Spanien 46, 94, 298 Spatial turn 39 Speranskij, Michail 242 Split 328 Sporazum 334 Sredna Gora 344
St. Gallen 12, 23, 225 St. Petersburg 26, 39, 230, 240, 241, 248–250 Stachanov-Bewegung 214, 365 Stadelmann, Matthias 256 Stadtrecht 129, 131, 173–174, 180–182, 221,
277, 313 Stadtrecht, Lübecker 173, 180 Stadtrecht, Magdeburger 173, 180, 181, 313 Stalin, Iosif 30, 31, 33, 38, 82, 84, 115, 118,
152, 153, 212, 213, 218, 220, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 266, 271, 289, 301, 338, 339, 340
Stalinismus, stalinistisch 22, 24, 30, 31, 37, 153, 211, 212, 214–216, 255–257, 259–261, 266, 267, 339, 341, 360, 365
Stanisław (Heiliger) 308 Starčević, Ante 347 Statuta valachorum 344 Stefan der Große (Moldau) 325 Stefan II. Nemanja, der Erstgekrönte 325 Stefan Uroš IV. Dušan Nemanja 325 Steiermark 297 Stephan der Heilige (Ungarn) 290, 307,
308, 323 Štip 68 Stolypin, Petr 201, 222, 246 Stratiotensystem 170, 365 Stroganov (Familie) 192 Studer, Brigitte 257 Suburbium 180 Sudetendeutsche (auch > Deutsche)
22, 285, 286 Südost-Institut (München/Regensburg) 22 Süleiman der Prächtige (Gesetzgeber) 327 Sultan 148–150, 323, 326, 327, 329–332,
347, 358–359, 363, 365 Sundhaussen, Holm 223 Sunniten, sunnitisch 94, 104, 365 Suny, Ronald G. 250, 256 Suzdal’> Vladimir (Stadt/Fürstentum) Symeon (bulgar. Zar) 322 Szekler 146, 291, 365 Szlachta 146, 184, 310, 365 Tacitus 57, 71 Tadschikistan 18 Tallinn (Reval) 189, 211, 303, 304, 319 Tanzimat 201, 331, 347, 365 Tartu 32, 43, 303 Tataren > Mongolen Tatarstan 263 Tatiščev, Vasilij 27 Tauwetter 31, 258, 260
Orts-, Personen- und Sachregister
391
Terror 130, 152, 153, 191, 237, 243, 250, 251, 254–258, 263, 335, 337, 341, 362, 266
Theiß 53 Theodosius (Kaiser) 321 Thessalien 341 Thessaloniki 325 Thraker, thrakisch 64, 67, 68 Thrakien 56, 68, 74, 113 Tichon (Patriarch) 115 Timâr-System 178, 194 Timočanen 57 Tirol 297 Tito (Josip Broz) 117, 118, 220, 337,
339, 340, 346 Titoismus 220 Todorova, Maria 223, 227, 351, 352 Tondern 173 Torke, Hans-Joachim 156, 247, 265 Tosken 69 Totalitarismus, Totalitarismustheorie
24, 34, 266, 365 Trakai 300 Transhumanz 64, 170, 341, 342, 366 Transkaukasien 18, 242, 245 Transleithanien, transleithanisch
(> auch Ungarn) 285, 293, 366 Transsylvanien > Siebenbürgen Travunien (Trebinje) 60 Trianon, Vertrag von 293, 294, 334, 336 triplex confinium > Militärgrenze Trockij, Lev (Trotzki) 12, 250, 253 Trotzki > Trockij, Lev Trpimiriden (Dynastie) 295, 323 Trudoviki 248, 366 Tschechoslowakei, Tschechien, Tschechen
(> auch Böhmen, Slowakei) 34, 60, 81, 82, 85, 94, 119, 154, 208, 218, 257, 259, 283, 285, 286, 293, 299, 309, 336, 338, 356, 367
Tschenstochau > Częstochowa Tschetschenien, Tschetschenen 263, 271 Tschudi, Daniela 38 Tschuwaschen 93, 94 Tuchtenhagen, Ralph 18 Tucker, Robert 256, 266 Tungusen > Evenken Türkei, europäische > Europäische Türkei Türkei, Türken (> auch Osmanisches Reich)
79, 104, 151, 332, 366 Turkmenistan 18 Turkvölker, Turksprachen 54, 55, 58, 59, 62,
70, 94, 96, 103, 268, 271, 322, 324, 366 Tuwiner 95 Tver’ 235, 236 Tvrtko (bosn. König) 325
Udegen 95 UdSSR > Sowjetunion Ugrier > Finno-Ugrier Ukraine, Ukrainer (> auch Ruthenen) 18, 19,
29, 51, 53, 63, 64, 72, 78, 82, 85, 92–94, 99, 102, 103, 105, 136, 173, 233, 238, 241, 249, 250, 251, 254, 257, 262, 267–269, 281, 286, 287, 289, 290, 293, 313, 355, 366
Ungarn (Land, Volk), Magyaren 17–19, 34, 37, 55, 57, 60, 65, 67, 69, 70, 74, 75, 78–80, 94–95, 99, 100, 102, 116, 119, 130, 131, 138, 144, 146, 147, 154, 155, 165, 166, 172–174, 176, 180, 181, 183, 184, 187, 188, 191, 206–208, 218, 219, 257, 259, 278, 279, 281–285, 288, 290–299, 306–313, 315, 316, 323–329, 331, 333, 334, 336, 338, 348–350, 355, 359, 361, 363, 366, 367
Unierte 78, 93, 99, 101, 102, 117, 119, 269, 279, 349, 366
Union von Lublin 146, 301, 363, 366 Unitarier 100, 101, 366 Ural 15, 16, 69, 70, 71, 137, 171, 192, 193,
268 uralische Sprachen 69 USA 23, 24, 35, 114, 116, 214, 218, 253, 258,
259, 260, 261, 306, 316, 337, 359, 361 Usbeken 29 Usbekistan 18 Uskoken 328 Uspenskij, Boris 32 Ustaša 296, 337 Utraquisten 100, 356, 366 Uvarov, Sergej 242 Václav > Wenzel Varna 327 Veče (Volksversammlung) 137, 142, 181,
221, 234, 236, 367 Venedig 131, 169, 172, 174, 296, 323, 324,
327, 328, 333, 341, 349 Vereinigte Staaten von Amerika > USA Verfassung 17, 54, 62, 84, 127–128, 141,
144–154, 148, 156, 172, 173, 179, 184, 186, 221, 222, 242, 246, 249, 250, 262, 287, 296, 298, 360, 365
Vernadsky, George 23 Versailler Vertrag 21, 205, 335 Verv’ 177 Vilnius (Wilno) 79, 91, 104, 189, 300, 301,
309, 319 Vitte, Sergej 199, 244 Vlachen 55, 64, 65, 67, 295, 328, 342, 343,
344, 366, 367
Orts-, Personen- und Sachregister
392
Vlad Ţepeş 326 Vladika 330 Vladimir (Stadt/Fürstentum),
Vladimir-Suzdal’ 137, 139, 233–235 Vladimir I. (der Heilige) 96, 231 Vladimir Monomach 233 Vojvodina 53, 293, 333 Volchov 230 Völkerwanderung 52, 165–167, 182, 321, 343 Vorarlberg 297 Walachei 18, 67, 99, 149, 182, 183, 291,
325, 326, 331, 350, 356, 363 Wallonen 311 Waräger (> Normannen) 62, 132, 135, 136,
230, 367 Waräger 62–63, 132, 135–136, 230–231, 367 Warschau 12, 210 Warschauer Pakt 16, 154–155, 286, 338, 356,
359, 367 Warthe 286 Weber, Max 164, 179, 246 Wehrbauern 295, 328, 344, 360, 365 Weichsel 51, 73, 302 Weiße Bauern (> auch schwarze Bauern) 177 Weißer Berg (Böhmen) 147, 284 Weißrussland, Weißrussen, weißrussisch
18, 19, 29, 51, 63, 64, 82, 83, 92–94, 99, 103, 105, 136, 173, 233, 241, 251, 267, 269, 281, 287, 289, 313, 366
Weltkrieg > Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg
Weltwirtschaftskrise 196, 208, 210, 214, 335 Wenden 58 Wenzel (Václav) 307, 308 Wepsisch 71 Westpreussen > Preußen Wheatcroft, Stephen G. 247 Wien 147, 206, 284, 287, 288, 292, 293,
298, 299, 309, 323, 327–329, 360 Wiener Kongress 287, 298, 323, 360 Wilno > Vilnius
Wilzen 57 Wislanen 57 Wogulen > Mansen Wolga 53, 70, 130, 135, 136, 137, 138,
168, 191, 230, 233, 237, 259, 268, 269, 356, 358, 363
Wolgabulgaren 96, 130, 356 Wolgatataren (> auch Mongolen) 29, 268, 269 Wolhynien 137, 233 Wotisch 71 Wüstung 163, 165, 167, 168, 191, 194, 328,
344, 367 Zadar 114, 182 Zadruga 178, 202 Zagreb 118, 295, 354 Zahumlje > Hum Zemskij Sobor (Reichstag; auch > veče)
185, 238 Zentralismus, Demokratischer 152, 251, 357 Zemstvo 143, 243, 245, 367 Zentralasien 18, 24, 25, 29, 83, 116, 128, 130,
133, 242, 254, 268–272, 358, 361, 363 Zentralismus > Demokratischer Zentralismus Zernack, Klaus 18 Zeta (> auch Montenegro) 60 Zigeuner > Roma Zinov’ev, Grigorij 253 Zips 312 Zogu, Ahmed 335 Župane 184 Zürich 12, 23 Zweite Leibeigenschaft 164, 186–188,
358, 367 Zweiter Weltkrieg (auch Großer
Vaterländischer Krieg) 14, 16, 22, 33, 39, 81, 84, 114–116, 122, 130, 154, 204, 206, 208, 210–211, 214–215, 217, 251, 257, 259, 268, 271, 278, 286, 289, 294, 296, 301–302, 316, 334, 336, 337, 339, 340, 359, 365