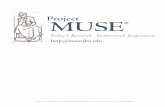Blumers Rebellion 2.0: Eine Wissenschaft der Interpretation
Transcript of Blumers Rebellion 2.0: Eine Wissenschaft der Interpretation
7
Einleitung: Blumers Rebellion 2.0. Eine Wissenschaft der
Interpretation
Der vorliegende Band versammelt sechs Aufsätze Herbert Blumers, von denen vier erstmalig in deutscher Übersetzung und zwei nach langer Zeit erstmalig wieder im Druck erscheinen. Der mit deut-lichem Abstand längste und auch bekannteste dieser Aufsätze ist »Der methodologische Standort des symbolischen Interaktionis-mus«, der den meisten Studierenden der Soziologie – Lehrenden und Forschenden – zumindest wegen der darin formulierten be-rühmten »drei Prämissen« geläufig ist: Menschen handeln in Bezug auf Dinge auf Grundlage der Bedeutungen, die sie ihnen zuschrei-ben; Bedeutungen entstehen aus der sozialen Interaktion; und die-se Bedeutungen verändern sich im Prozess der Handhabung dieser Dinge (vgl. S. 64-69 in diesem Band). Ebenso auf Deutsch bereits erschienen war Blumers Beitrag »Soziale Probleme als kollektives Verhalten«, in dem er der nachfolgenden Soziologie sozialer Proble-me den Weg bereitet: Malcolm Spectors und John Kitsuses Einfüh-rung in die Konstruktion sozialer Probleme (2001 [1977]) nimmt Blumers Linien auf und entwickelt aus ihnen ein Programm.
In erster Linie tritt Blumer in diesen und den hier ausgewählten weiteren Schriften als Kritiker auf, der sich gegen zu seiner Zeit dominante und bis heute wichtige Strömungen in der Soziologie wendet: gegen die sozialphilosophisierende Beschäftigung mit all-gemeinen Konzepten, gegen die methodologische Apriorisierung von beliebig anwendbaren Methoden und gegen den sozialwissen-schaftlichen Zerstörungsreflex gegenüber alltäglich gebräuchlichen Begriffen. Vor allem die ersten beiden sind Opfer scharfer Kritik in »Wissenschaft ohne Begrifffe«, »Soziologische Analyse und die Variable« und im »Methodologischen Standort«; gegen Letztere stellt Blumer sich vor allem in seinen Schriften zur Macht, »Grup-penspannung und Interessengruppen« und »Sozialstruktur und Machtkonflikte«. In ihnen verteidigt Blumer die Reflexion gegen die Methode, die intime Bekanntschaft gegen die wissenschaftliche Distanz und die Bedeutungskonstruktionen des Alltags gegen ihre
29669 Blumer 2. Lauf.indd 6-7 05.03.2013 08:41:00
8 9
sozialwissenschaftliche Geringschätzung. Vor allem aber vertritt er den Vorrang der Forschung vor der Wissenschaft: Beschäftigung mit der Sache statt Beschäftigung mit der Methode oder der Kategori-sierung. Blumers Texte stellen sich gegen die Algorithmisierung der Soziologie, die sich hinter ihren Ansätzen verschanzt, um sich nicht um die Phänomene kümmern zu müssen. Sie stellen sich damit ge-gen eine Soziologie, in der Forschung zugunsten der Algorithmen verloren geht, und gegen die seltsame stilistische Form putativer »Forschungsbeiträge«, aus denen wenig über die Welt zu erfahren ist, weil sie sich zentral um ihre eigenen Ordentlichkeiten drehen. Blumers Schriften »methodologisch« zu nennen ist nachvollzieh-bar, aber es übertüncht die Tatsache, dass sich seine Rebellion ge-rade gegen das richtet, was vielerorts unter »Methode« verstanden wird: feste Vorgaben, rigide Programme, detaillierte Vorschriften zu Vorgehensweisen.
Blumers Wissenschaft der Interpretation
Blumers Werk ist zunächst als ganz altmodische interpretative Prozesssoziologie verständlich: Die Bedeutung von Objekten liegt nicht in diesen Objekten, an denen sie einfach »entdeckt« werden müsste, sie liegt auch nicht in den Subjekten, die die Objekte mit Bedeutungen aus ihren »Ideen« tränken, sondern sie liegt im sozi-alen Zwischenraum, was die praktische Welt der Interaktion und die lokale Bezugnahme auf die konkrete Situation erfordert. Es gibt keine Welt ohne Situation, keine Bedeutung ohne Interpretation, kein soziales Leben ohne Interaktion. Es gibt die Objekte nicht ob-jektiv oder abstrakt, sondern immer nur im Kontext einer Interak-tion. Die »Elemente« dieses Interaktionsprozesses kommen selbst erst in sozial geteilten Interpretationsprozessen zustande. Löst man die Objekte aus ihrem Interaktions- und Situationszusammenhang und fügt sie in einen anderen ein, sind es nicht mehr dieselben. Auch im Verlauf einer sozialen Situation, über die verschiedenen Stufen der Interaktion hinweg oder aus verschiedenen Perspekti-ven gesehen bleiben Objekte nicht dieselben. Ohne Kontext bleibt nicht das reine Objekt übrig, sondern vielmehr gar nichts. Blumers eigentlich sehr einfache Mission bestand darin, die notwendige Verwobenheit von mitgebrachten und aufgefundenen Bedeutun-
gen zu betonen und sich stetig und konsequent zu weigern, feste Bedeutungen vorauszusetzen. Symbole geraten in Situationen in einen Verweisungszusammenhang anderer Symbole, und Bedeu-tungen geraten in ein reziprokes Spiel miteinander, in dem keines dieser Symbole automatisch für sich beanspruchen kann, »Fundie-rungssymbol« zu sein. Es handelt sich also um ein Spiel, in dem die Bedeutungen nirgendwo einen festen Ausgangspunkt haben, von dem aus sie wandern, sondern die putativen »Ausgangspunkte« selbst dem Tanz der Bedeutung in der Situation unterliegen. An-ders gesagt: Bedeutungen fließen nicht durch Kanäle, haben keine Quellen und Mündungen, sondern entstehen immer wieder in ge-genseitiger Aufeinanderbezogenheit.
Blumers Mission innerhalb dieser basalen Soziologie ist einfach: Es geht ihm darum, die Geister hinter der Welt, die unterstellten abstrakten Antriebe hinter dem Vorhang der konkreten mensch-lichen Interaktion auszutreiben. Er war gnadenlos in seiner Ab-lehnung aller Versuche, unsichtbare Ordnungszentren auffinden zu wollen, aller Versuche, denen Handlung nur als Epiphänomen erschien: »Er hat immer und immer wiederholt, dass menschliches Verhalten nicht von außen von Einstellungen, Strukturen und kul-turellen Mustern determiniert ist. Auch soziale Veränderungen ge-schehen nicht aufgrund des Einflusses von ›Kräften‹, die von außen oder innen auf soziale Strukturen wirken« (Shibutani 1988, S. 29). Howard Becker bemerkt dazu:
[M]an kann einen Reiz oder eine kulturelle Norm nicht wirklich sehen, aber man kann sich Dinge sagen hören wie: »Nun ja, ich weiß, ich sollte tun, was der Chef sagt, aber …«. Das zeigte uns, dass diese Dinge, die man Normen nennen könnte, zwar von anderen manchmal angerufen werden, dass sie aber nicht so bestimmend sind, wie Kulturtheoretiker sich das vorgestellt haben, schon gar keine Objekte, die automatische Reaktionen hervorrufen, wie die Behavioristen das glaubten. Das war sehr ernüchternd. (Becker 1988, S. 16)
Das ist gleichbedeutend mit dem Ziel, nirgendwo »Bedeutungsan-ker« zu verorten: Keine reifizierten Größen erlauben es uns, sich an ihnen festzuhalten, nicht Objekte, nicht Personen (siehe etwa Blumer, S. 63 in diesem Band, und Blumer 1937), nicht Einstel-lungen (Blumer 1958), Ideen, Theorien oder Konzepte. »Der ›Stoff‹ [orig. »stuff« – das »Zeug«] der menschlichen Gesellschaft« besteht
29669 Blumer 2. Lauf.indd 8-9 05.03.2013 08:41:00
10 11
aus »dem Komplex laufender sozialer Handlungen« (Blumer 1980, S. 412), und dieses »Zeug« ist niemals als Folge oder Ergebnis ei-ner »realeren« Mechanik »hinter« ihnen ableitbar. »Blumer lehnte alle mechanistischen Erklärungen ab […]. Er war gegen alle Erklä-rungen, die Verhaltensmuster als Reaktionen auf Stimulation oder andere Kräfte behandelten« (Shibutani 1988, S. 29). In seinen fünf Schaffensjahrzehnten kämpfte er gegen die verbreitete Tendenz, die soziale Welt in festen Objekten einfrieren oder die Abstrakta, die Sozialwissenschaftler postulieren, als feste Objekte behandeln zu wollen. Diese Konzepte seien Abstraktionen, mit denen in be-stimmten Situationen Argumentationen aufgebaut werden kön-nen – nicht mehr.
Es gibt solche Dinge wie soziale Rollen, Statuspositionen, Rangordnun-gen, bürokratische Organisationen, Beziehungen zwischen Institutionen, differentielle Autoritätsarrangements, soziale Codes, Normen, Werte und so weiter. Und sie sind sehr wichtig. Aber ihre Wichtigkeit liegt nicht in einer angeblichen Determination von Handlung oder in einer angeblichen Existenz als Teile irgendwelcher eigenoperationaler sozialer Systeme. Sie sind vielmehr nur wichtig, insofern sie in den Prozess der Interpretation und Definition eintreten, aus denen gemeinsame Handlung geformt wird. (Blumer 1966a, S. 547)
Blumers Soziologie ist eine nachdrückliche Aufforderung, der Ver-suchung zu widerstehen, diesen zum Zwecke der Ordnung erfun-denen konzeptionellen Abstraktionen eine leitende Rolle zukom-men zu lassen und ihre dienende Rolle mit dieser Leitfunktion zu überschreiben. In John Loflands zeitloser Formulierung: »Abstrak-tionen sind Abscheulichkeiten vor der Welt« (Lofland 1976).
Blumer betrieb so die Orientierung der Soziologie weg von Ab-strakta, von mechanischen Kausalzusammenhängen und »biederer Faktorensoziologie« (ein Begriff, den von Trotha prägte; von Trotha 1997) und hin zur »bodenständigen Erforschung des Gruppenle-bens« (Plummer 2000, S. 200), die herausstellt, wie »Gesellschaft« nur in alltagspraktischen Aushandlungen gemacht wird. Das ist die eigentlich basal-soziologische Feststellung: Was auch immer in der sozialen Welt abläuft, hängt in Interpretationsprozessen und kommt in Situationen auf, und eine Wissenschaft, die diese Situati-onen nicht beachtet und stattdessen von diesen Situationen zu ab-strahieren versucht, ist daher von vornherein auf Sand gebaut. Für
die Forschung als Erforschung, als Entdecken der Welt bedeutet das, nicht die Wissenschaft der Methode, mit der das geschieht, in den Vordergrund zu stellen. Wenn wir uns auf Forschung konzen-trieren, insistiert Blumer, dann besteht der Dreh- und Angelpunkt vielmehr aus
der Erforschung von Verhalten und Gruppenleben, wie sie in der alltägli-chen Existenz von Menschen natürlich aufkommen – in den Interaktionen von Menschen, während sie in ihrem täglichen Leben miteinander umge-hen und die Breite der Handlungen betreiben, die notwendig sind, um die Situationen, mit denen sie konfrontiert sind, zu meistern. Dieser natürli-che Aufbau des menschlichen Verhaltens deckt all das ab, was Individuen, Organisationen, Institutionen, Gemeinschaften und Kollektivitäten tun, während sie ihre Leben führen. (Blumer 1980, S. 412)
Oder wie Robert Prus im Rekurs auf Blumer bemerkt: Das mensch-liche Gruppenleben besteht nicht aus Normen, Werten, Strukturen oder Diskursen, sondern aus Menschen, die gemeinsam handeln (Prus 1994, S. 16). Das führt in bester pragmatistischer Manier an jeder Stelle auf die Kontextualität, Aushandlungsoffenheit und lo-kale Fluidität von Bedeutungen zurück, und die Forscherin führt es zu der Pflicht, diese fluiden Bedeutungen in ihrem »natürlichen Lebensraum«, im Leben, zu erforschen. Dafür nutzt Blumer die Praxis der »intimen Bekanntschaft«, die voraussetzt, dass die Um-felder, die erforscht werden, am eigenen Leib erfahren werden müs-sen. Es muss nicht nur punktueller Kontakt mit dem Feld, sondern längerfristiger Kontakt mit der Lebenswelt der untersuchten Grup-pen gesucht werden. Shibutani erkennt in Blumers Zielsetzung das Desiderat, dass »Forschung irgendwie den Prozess erfassen muss, in dem bewusste Verweise vorgenommen werden« (Shibutani 1988, S. 27). Sie muss sich an Prozessen orientieren, in dem Objekte gemacht werden, und nicht konzeptionelle Rahmen über die für gegeben gehaltenen Objekte werfen, seien es Kategorien aus Theo-riesystemen oder Operationalisierungen.
Die Blumer’sche Antwort auf die Frage, wie das funktionieren soll, ist zunächst die der sensibilisierenden Konzepte: Im Wissen, dass selbstverständlich jede Wahrnehmung voraussetzungsvolle Wahrnehmung und ein »reines Aufnehmen« nie möglich ist, plä-diert er dafür, mit konzeptionellen Vorannahmen ins Feld zu ge-hen, die aber nicht die Struktur der Beobachtung und der Analyse
29669 Blumer 2. Lauf.indd 10-11 05.03.2013 08:41:00
12 13
vorentscheiden sollen, sondern die vielmehr mitgebracht werden mit der expliziten Zielsetzung, dass sie im Laufe der Erlangung intimer Bekanntschaft mit dem Feld wieder verloren gehen. Das weist zunächst zur Ethnografie, und in der Tat haben viele der pri-mären und sekundären Schüler Blumers ihre empirische Arbeit ethnografisch betrieben. David Maines hat dieses Projekt Blumers eine »Wissenschaft der Interpretation« genannt, und das ist wo-möglich die beste Kurzbezeichnung, die in der Betrachtung seines Werkes aufgekommen ist. Blumers einfache Grundlegung der Per-spektive erinnert uns daran, dass eine »Wissenschaft der Interpre-tation« erfassen muss, welche Bedeutungen in welchen Kontexten wie zustande kommen. Um diese Bedeutungen-in-Situationen zu erfassen, müssen diese Situationen jedoch miterlebt werden.
Der erste Widerstand Blumers hat damit den Strukturfunkti-onalismus und seine »überzogenen Ordentlichkeiten« (Shibutani 1988, S. 23) zum Ziel; aber das wäre als Analyse von Blumers Werk so banal wie konventionell. Blumers Rebellion geht tiefer als die normale Grenzerhaltungspraxis, eine wissenschaftliche Perspektive innerhalb einer Disziplin gegen eine andere abzugrenzen. Zu Blu-mers Zeit hat die Umfrageforschung mit ihren großen Datensätzen die amerikanische Soziologie genauso fest im Griff, wie der Drang zur Sozialphilosophisierung der Soziologie in Europa die Vertreter der Disziplin bezirzt, immer komplexere Systeme von Begriffsap-paraten zu erfinden. Blumer rebelliert so an zwei Fronten, einmal gegen Lazarsfeld und einmal gegen Parsons: einerseits gegen den Drang zur methodologischen Ordentlichkeit, der vom Versuch ei-ner Imitation der Naturwissenschaften herrührt (Stephen Mennell spricht in einer ganz ähnlichen Kritik in Anlehnung an Freud vom »Physikneid« der Soziologie), und andererseits gegen die »Begriffs-himmel« einer sozialphilosophisch beeinflussten Arbeit. Becker stellt fest, dass die Soziologie
sich schon immer geriert hat wie die armen Verwandten von Menschen in Disziplinen mit mehr Prestige und sichtbarerem Anspruch auf Wis-senschaftlichkeit. […] Mit einem Unterlegenheitsgefühl gegenüber den »echten Wissenschaften« hat sie versucht, den wissenschaftlichen Cha-rakter ihrer empirischen Forschung zu etablieren, indem sie rigoroses und präzises Messen betont hat. Mit einem Unterlegenheitsgefühl gegenüber Philosophie und Geschichte hat sie versucht, andere Forscher mit der Tiefe ihrer allgemeinen Theorien zu beeindrucken, indem sie germanische Ab-
straktionen und komplexe Satzstrukturen verwendete. Damit hat sie häufig Substanz durch äußere Erscheinung ersetzt. (Becker 1988, S. 14)
Mit Erving Goffman gesprochen: Sowohl die sozialphilosophische Abstrahierung als auch die »naturwissenschaftlich« anmutende Methodologisierung sind Formen des Eindrucksmanagements, mit dem eine Identität im Kleid respektablerer Wissenschaften darge-stellt wird, mit denen man jedoch Substanz für Fassade opfert. Blu-mer will solch eine algorithmische »Wissenschaft« zugunsten von Sozialforschung begraben.
Rebellion gegen die Sozialtheorie
Herbert Blumer gilt abwechselnd als Begründer oder als Haupt-vertreter, unbestritten jedenfalls als Namensgeber des symbolischen Interaktionismus. Als Schüler und Nachfolger von George Herbert Mead, der bekanntlich wenig Schriftliches hinterlassen hat, greift er dessen soziologische Gedanken auf. Bleibt man den Annahmen des Interaktionismus treu, gibt es zwar keine »feste Bedeutung« dieser Schule (Plummer 2000, S. 196); Blumer wird jedoch schnell zum semioffiziellen Interpreten von Meads Werken, eine Rolle, die er bis zu seinem Tod 1986 innehat (oft auch zum Unmut abwei-chender Mead-Interpreten, vergleiche McPhail/Rexroat 1980). Er liefert zur richtigen Zeit eine Ausformulierung, die das Schaffen der »Chicagoer«, vor allem die Forschung Robert Parks und damit verbunden die Studien der Chicagoer Schule, einfängt, und er in-formiert damit die ihm nachfolgenden Klassiker, vor allem How-ard Becker, aber auch Tomatso Shibutani und John Lofland. Diese Konstellation hat viele Betrachter dazu verführt, Blumers Arbeiten unter der Überschrift »Sozialtheorie« zusammenzufassen.
Damit ist Blumer schlecht gedient. Becker bemerkt, Blumer berufe sich zwar auf Mead, habe jedoch keine Allüren gezeigt, »im philosophischen Spiel zu punkten« (Becker 1988, S. 17). Wie Goffman reagierte Blumer ungehalten, wenn man ihn in solche Spiele hineinziehen wollte. In späteren Lebensphasen drückte er mehrfach seinen Unmut darüber aus, dass Autoren sich daran abarbeiteten, ob er nun »Realist« oder »Idealist« sei, ob er »Mead richtig verstanden habe« oder welche Mischung zwischen »Ideen«
29669 Blumer 2. Lauf.indd 12-13 05.03.2013 08:41:00
14 15
und »materieller Realität« die richtige sei. In seiner Kritik an ei-nem Übersichtswerk über die Chicagoer Tradition, in der solche Dualismen einen prominenten Platz erhielten, intervenierte er, um festzustellen, dass die intellektuelle Tradition seiner Alma Mater gravierend missrepräsentiert werde:
Der Streit zwischen Nominalisten und Realisten in seiner philosophischen Form ist in der soziologischen Fakultät Chicagos in der [vom Übersichts-werk] betrachteten Zeit niemals aufgekommen. Wenn man durchschnitt-liche Masterstudierende und Doktoranden gefragt hätte, »sind Universalia real?«, hätte er oder sie nicht gewusst, worüber man redet. Es gab keine Diskussion des philosophischen Themas, ob Universalia real sind oder nicht, weder innerhalb noch außerhalb des Kursraums. Studierende hatten keine Gelegenheit, von solchen Themen zu erfahren oder sich um sie zu kümmern; sie waren mit anderen Dingen beschäftigt. […] Robert Faris hat […] richtig bemerkt: »Masterstudierende und Doktoranden der Soziologie wurden angehalten, sich in die Daten zu vertiefen, wie gute Zeitungsre-porter auf Details zu achten. Es gab weder die Zeit noch die Ermutigung, einen Schritt zurückzugehen und die philosophischen Grundlagen des For-schungsprozesses zu untersuchen.« (Blumer 1983, S. 128 f.)
Blumer hielt sich nicht damit auf, abstrakte Konzeptionalitäten zu bedenken; vielmehr kritisierte er seine Kollegen dafür, »mit sorg-loser Hemmungslosigkeit [Konzepte] herzustellen, ohne sich dar-
Ein Konzept ist lediglich ein Anfang, und in jedem Fall lediglich ein Werkzeug. Blumer legte so zeitlebens »eine feindselige Einstel-lung gegenüber dem gesamten Genre des generalisierten Diskur-ses« an den Tag (Colomy/Brown 1995, S. 58). Gerade die interpreta-tive Sozialwissenschaft, und dort besonders die von Blumer immer wieder betonte Route der »intimen Bekanntschaft«, kann mit solch hohen Abstraktionen der soziologischen Theorie nicht gewinnbrin-gend arbeiten, die die zu untersuchende Welt unter ihre Fittiche zu bringen versuchen, anstatt die Eigenproduktion von Konzepten in der sozialen Welt zu betrachten.
Umso irriger ist es, diese hohen Abstraktionen zur Selbstbe-trachtung der soziologischen Disziplin zu verwenden und die Per-spektiven ihrer Vertreter zum Objekt der Studie zu machen, die nun ebendiesen Abstraktionen unterworfen werden: sich also mit der Frage zu beschäftigen, ob Blumers Arbeiten realistische oder idealistische seien. Generell ist ein solcher Versuch, Arbeiten zu ab-
strahieren und als Kollektionen allgemeiner Prämissen und Struk-turen, als theoretisches System »in sich«, zu verstehen, das dann Objekt der Exegese wird, ein kurioses Unterfangen, das gerade amerikanische Sozialwissenschaftler im Dunstkreis Blumers ge-ringschätzten: Goffman (den Blumer nach Berkeley geholt hatte, ohne dass beide dort an konkreten Projekten zusammengearbeitet hätten) hatte das abwertend »scholastisches Interesse an der Diszip-lin« genannt (Lofland 1984) und wollte die Soziologie von solchen Betätigungen lieber verschont wissen. Becker bemerkt:
[D]arüber zu streiten, was Mead »wirklich« gesagt hat […] ist eine ver-ständliche Aktivität in der Geschichte von Philosophie und Soziologie, hat aber keine wichtigen Implikationen dafür, was Soziologen tun. Es ist na-türlich genauso fruchtlos, darüber zu streiten, was Blumer »wirklich gesagt« hat. Die Frage ist vielmehr: Was hat Blumer (oder sonst irgendjemand) gesagt, das wir verwenden können, um damit bei unserer eigenen Arbeit voranzukommen?« (Becker 1988, S. 17)
Man muss nur kurz reflektieren, um zu bemerken, dass Versuche, die »wahre Bedeutung« einer Perspektive oder das »wahre Ver-hältnis« einer Perspektive zu einer anderen zu ermitteln bzw. die »gründliche Exegese« eines wissenschaftlichen Textes zu betreiben, auf der Prämisse beruhen, es gäbe ein abstraktes Objekt. Dann gäbe es »Blumers Theorie«, ein abstraktes Objekt »symbolischer Interaktionismus«, ein abstraktes Objekt »Ethnomethodologie«, die untereinander und mit einer abstrakten, im Text liegenden Be-deutung von Blumers dagegengestellten Texten verglichen werden könnten. Da das offensichtlich die Einsichten der interpretativen Soziologie sofort wieder kassiert, muss auch die Rezeption von Texten im jeweiligen Kontext verstanden werden: Eine Einleitung in Blumers Werk wäre daher schlecht beraten, Prämissen wieder-zugeben, Linien der Arbeit zu explizieren, Blumers »theoretische Perspektive« nachzuzeichnen und so die »Grundlinien der Theorie des symbolischen Interaktionismus« zu systematisieren, Exegese zu betreiben und auf andere Klassiker zu beziehen. Die ist ohnehin eine Arbeit, die man bleibenlassen sollte: Theorie ist nur in Bezug auf etwas zu etwas gut, auf sich selbst gewendet wird sie ein merk-würdiges Unterfangen.
Blumer sollte daher nicht als Sozialwissenschaftler behandelt werden, der eine »Theorie der Interpretation« oder eine »Episte-
29669 Blumer 2. Lauf.indd 14-15 05.03.2013 08:41:00
16 17
mologie« hat, die genau und detailliert nachvollzogen werden müsste. Man tut Blumer auch keinen Gefallen, wenn man die Übereinstimmungen und Unterschiede mit und gegenüber Mead, auf den er sich immer berufen hat, expliziert, ihn ins Pantheon der interpretativen Soziologie hebt, ihn mit Schütz oder Garfinkel vergleicht oder andere Spiele treibt, die die soziologische Theorie auf diesen Feldern spielt. In der Tat ist die Konsequenz daraus, die interpretative Soziologie und ihre Betonung von Bedeutungen-in-Situationen ernst zu nehmen, auch die Bedeutungen der Soziolo-gie, ihrer Autoren und Texte, nicht als feste Objekte zu sehen, die unabhängig von Situation im Abstrakten existieren und erkannt werden können. Das heißt dann, auch die soziologische Theorie nicht als »Objekt« zu betrachten, das diskutiert werden müsste, als existierte es in einem »luftleeren«, situationslosen Raum. Blumers Intervention gilt für Alltagssituationen genauso wie für die Wissen-schaft, die ihrerseits auch wieder nur eine Form von Alltag anderer sozialer Gruppen ist.
Wenn man diese Kontextualität, die eigentlich offensichtlicher sein sollte, als sie es in der Praxis vieler Soziologen häufig ist, mitbe-denkt, folgt schnell, Blumer nicht als Autor einer abstrakten Theo-rie zu diskutieren. Er war vielmehr ein Sozialwissenschaftler, der in einer besonders frustrierenden Stunde der amerikanischen Soziolo-gie gegen eine Praxis interveniert hat, die ihm als Unding erschien.
Der »Totengräber«: Blumers Rebellion gegen die Methodologie
Blumers Ungeduld mit Abstrakta und Versuchen, von Alltagshan-deln stark abstrahierte Systeme zu erstellen, bezieht sich nicht bloß auf die Sozialphilosophisierung und den Glauben an handlungslei-tende Strukturen hinter der Handlung. Sie dehnt sich vor allem, und noch einmal polemischer, auf die Methoden (angeblich) em-pirischer Sozialforschung aus.
Blumer selbst nannte seine Schriften nicht sozialtheoretisch, sondern »methodologisch«; der zentrale Blumer-Text trägt den Titel »Der methodologische Standort des symbolischen Interak-tionismus«, und Blumer wiederholt diese Einordnung mehrfach. Diese Titulierung kann irreführend sein: Seine Texte sind keine
allgemeinen Anweisungen, so konzeptionell sie daherkommen; sie sind eine Intervention in einer bestimmten Situation der ameri-kanischen Soziologie. Praktisch, in ihrem historischen Kontext, stellen sie sich gegen die Abstraktionsordnung Parsons’ und die Philosophisierung der Soziologie, wie sie vor allem europäische Vertreter betrieben haben; methodisch stellen sie sich gegen die po-sitivistische Datensammelwissenschaft der Faktorensoziologie. Zur »Meinungsforschung«, der Königsdisziplin der Umfragesoziologie, schreibt Blumer: »Ich glaube, es ist fair, zu sagen, dass jene, die versuchen, die ›öffentliche Meinung‹ zu untersuchen, so mit ihren Techniken verheiratet sind, dass sie die wesentliche Frage beiseite-schieben, ob ihre Technik geeignet ist, das zu untersuchen, was sie vermeintlich untersuchen wollen« (1948, S. 542).
Wissenschaft als Methode ist somit das gespiegelte Gegenstück zur Wissenschaft als Sozialphilosophie, bleibt aber auf derselben Seite: Beides ist keine Forschung. Wo die eine Abstraktionen in der Welt der Konzepte sucht, denen in schlechtester philosophischer Manier nicht nur ein Eigenleben, sondern die sprichwörtlichen sieben Leben der Katze zugesprochen werden, sucht die andere die Abstraktion der Welt in einer mit nicht weniger Eigenleben ausge-statteten Methodologie. Blumer toleriert nichts davon, er legt in seinen Schriften eine »ungezügelte Opposition zu methodischen Apriorismen« an den Tag (Baugh 2006, S. 37). »Die Hauptstoßrich-tung von Professor Blumers Kritik an sozialwissenschaftlicher For-schung stellte sich gegen die blinde Anwendung von Forschungs-prozeduren, die in den Naturwissenschaften erfolgreich waren […] Aus dieser Perspektive heraus hielt er es für voreilig, Operationali-sierungen, Maße und Experimente zu verwenden« (Shibutani 1988, S. 27). Im selben Geiste sagt Baugh über Blumer: »Blumer warnt uns, dass wir echte empirische Erforschung zunichtemachen, wann immer wir es erlauben, dass Methoden die Natur unserer Daten determinieren statt umgekehrt« (Baugh 2006, S. 33). Blumer selbst lobte dagegen Arbeiten, die dieser quasireligiösen Methodologisie-rung der Soziologie nicht folgten. Über Goffman sagte er:
[E]in zusätzliches Lob gebührt ihm, in diesem Fall seiner Forschungs-prozedur. Im wahren Geist eines wissenschaftlichen Pioniers ist er bestän-dig bereit, in neuen Umfeldern herumzustochern, anstatt seine Untersu-chung in das feste Protokoll hineinzuzwängen, das in der gegenwärtigen
29669 Blumer 2. Lauf.indd 16-17 05.03.2013 08:41:00
18 19
Sozialforschung so oft verlangt wird. Glücklicherweise liegt sein Interesse darin, die empirische Welt zu entwirren, nicht darin, irgendeinem gehei-ligten Schema, das zur Forschung entwickelt wurde, zu huldigen. (Blumer 1972, S. 50)
Shibutani bemerkt, dass Blumer in »giftige Kontroversen verstrickt wurde« (Shibutani 1988, S. 27), Becker weist darauf hin, dass »seine Kritiken heftige, wütende Entgegnungen […] hervorriefen« (Be-cker 1988, S. 15) und zitiert als Beispiel die Reaktion von Samuel Stouffer, einem der Autoren von The American Soldier, einem ganz und gar durch quantitative Umfragemethoden charakterisierten Werk. Stouffer »verschrie Blumer als ›Totengräber der amerikani-schen Soziologie‹« (ebd.). Auseinandersetzungen dieser Art »führ-ten dazu, dass er [Blumer] eine feindselige Haltung einnahm« (Shibutani 1988, S. 27).
An diesem Punkt müsste vielleicht kurz in Erinnerung gerufen werden, dass wir es hier mit einem in der Wissenschaft häufigen Phänomen zu tun haben: Wird Blumer an seinen Schriften ge-messen, erwartet man einen kämpferischen, aggressiven Wissen-schaftler, der Brücken verbrennt. In der Praxis war nichts davon der Fall. Trotz seines kontroversen Standpunkts in diesen Debatten ist man sich allgemein einig, dass es sich um einen ruhigen, höf-lichen, großzügigen Gentleman gehandelt habe. In seiner Zeit an der Universität Berkeley wurde Blumer das Mandat erteilt, junge, vielversprechende Soziologen an die Universität zu holen. Er ver-wendete dieses Mandat keineswegs dazu, nur Gleichgesinnte an-zustellen, sondern war in seiner Rekrutierungspraxis Pluralist: Wer vielversprechend war, war auf Blumers Radar, unabhängig davon, ob diese Kandidatinnen das vertraten, was Blumer so vehement an-griff oder nicht. Rodney Stark, der später in der Religionssoziologie mit einer Variante der Rational-Choice-Theorie berühmt wurde, erinnerte sich daran, dass Blumer »nicht sehr dogmatisch war, wenn er mit seinen Studenten gearbeitet hat, obwohl er in seinem eigenen Werk völlig dogmatisch war« (Shalin/Stark 2009). Eine der Personen, die Blumer nach Berkeley holte, war Erving Goffman – der bald versuchte, sich aus seinen Lehrverpflichtungen zu winden und einen großen Einführungskurs einem jungen Kollegen, Kurt Lang, aufzubürden (Shalin/Lang 2009). Blumer verteidigte Lang nicht nur, sondern übernahm die Lehrveranstaltung gleich selbst, um es Goffman zu ermöglichen, nicht zu lehren und zugleich Lang
nicht unvorbereitet in diesen Kurs zu werfen. Jacqueline Wiseman, Autorin von Stations of the Lost, einer Studie über Alkoholiker, zu der Blumer das Vorwort verfasste, kam ursprünglich von Goffman. Dieser schlug Blumer als Vorsitzenden ihres Promotionskomitees vor: »Er sagte, Blumer könne das Komitee dazu bringen, entgegen-kommend zu bleiben« (Shalin/Wiseman 2003). Wiseman kannte Blumer zu diesem Zeitpunkt jedoch überhaupt nicht. Als sie, den Umständen entsprechend nervös, zum ersten Mal vorstellig wurde und zudem noch gestehen musste, niemals einen Kurs bei Blumer belegt zu haben, reagierte dieser, indem er »aufstand, sich halb ver-beugte und sagte: ›Madam, es ist mein Verlust.‹ Und ich bin fast umgefallen. Er war diese Art von Mensch.« (Ebd.) In seinen Schrif-ten war dieser Charme jedoch nicht häufig zu bemerken.
Rebellion 2.0
Becker spricht Blumer das Verdienst zu, daran mitgewirkt zu ha-ben, dass die Extreme der Sozialphilosophisierung der Soziologie, ihrer pseudonaturwissenschaftlichen Methodisierung und ihrer pseu dophilosophischen Begründung zumindest im Zaum gehalten wurden (Becker 1988, S. 14). Auch Shibutani bemerkt: »[S]ein kri-tischer Standpunkt könnte sehr gut dazu beigetragen haben, dass es der Soziologie erspart blieb, von Extremformen des Positivismus dominiert zu werden, wie es Psychologie und Ökonomie wider-fuhr« (Shibutani 1988, S. 30). Dass soziale Prozesse auf Interpreta-tionen der Teilnehmer beruhen und ihrerseits wieder nur interpre-tiert in den Blick von Beobachtern geraten, ist für alle außer den radikalsten Positivisten in der Soziologie wohl heute ein Gemein-platz: Interpretation ist nichts weiter als die Betonung der Inter-subjektivität aller Bedeutung und damit aller Interaktion. Für die interpretative Soziologie ist die richtige Reaktion auf diese Einsicht wohl: Und weiter?
Wenn wir Blumers Widerstand aktualisieren wollen, reicht es nicht, seine früheren Widerstände zu explizieren, sondern man muss fragen, wogegen Blumer heute rebellieren würde – wenn er dies denn täte. Und wir sind der Ansicht: das würde er – deutlich, dezidiert und unverhohlen polemisch. Die quantitativ orientierte empirische Sozialforschung hat kleinteiligste Methodenwerkzeuge
29669 Blumer 2. Lauf.indd 18-19 05.03.2013 08:41:00
20 21
entwickelt, für deren Beherrschung man Jahre des Lernens benötigt und die so ihr Expertentum dramatisiert. Aber in dieser Drama-tisierung ist sie nicht allein: Das Objekt dieser Rebellion wären heute die gängigen Versuche, die interpretative Sozialwissenschaft, die die Blumer’schen Prämissen unterschreiben müsste, zu algorith-misieren, was sie damit wieder von der Forschung abbringt und ihr die Last nimmt, sich mit den erforschten Phänomenen tatsächlich beschäftigen zu müssen.
Heute würde Blumer seinen Feldzug gegen die variablen- und faktorenzentrierte Methodenwissenschaft auf diese Techniken aus-weiten, die die Grundeinsichten der interpretativen Soziologie ausklammern müssen, um ihre gebundenen Formen der Interpre-tation leisten zu können. Die objektive Hermeneutik, die Sequenz-analyse, die Konversationsanalyse und die festeren Varianten der Grounded Theory sind nur einige der Versuche, abstrakte Auswer-tungsmethoden zu erdenken, deren gewissenhafte und detailge-treue Anwendung die Forscher befähigt, die Bedeutungen im Feld nachzuvollziehen. Die gegenwärtige interpretative Soziologie hat einen beeindruckend komplexen Methodenapparat entwickelt, der algorithmische Auswertungsprogramme bietet, die die Interpreta-tionsleistungen in einer Mechanik liefern sollen, die aussieht, als stünde sie an des Forschers Statt: ein obskures Expertentum der Interpretation, in dem die Expertise nicht einer Kenntnis des er-forschten Feldes entspringt, sondern der Kenntnis einer Interpreta-tionsmethode, die dann unter dramatisiertem Ausschluss kreativen Einfühlens Erkenntnisse generieren soll (ein Ausschluss, der nur dramatisiert sein kann, denn wäre dieses kreative Einfühlen tatsäch-lich ausgeschlossen, gäbe es keine Ergebnisse, die diese Experten-methoden liefern könnten). Das ist weiterhin eine Fortführung des Eindrucksmanagements, dass nur feste, strukturierte wissenschaft-liche Methodologien zu einem wissenschaftlichen Ergebnis führen können; auch das hätte Blumer für eine künstliche Strukturierung gehalten, die die Einsichten, die sie generieren soll, vielmehr syste-matisch obskuriert. Stanley Fish würde diese Mechanismen nach ihrem Erfinder, dem US-Cartoonisten Reuben »Rube« Goldberg, Goldberg contraptions nennen: ausgreifende, komplexe Maschinen, die einfache Aufgaben erledigen, raumfüllende Monstrositäten, die nach tausend Zwischenschritten einen Lichtschalter umlegen oder ein Glas mit Wasser füllen. Aber das sind Kunstwerke; die Mecha-
niken der Auswertungsmethodik sind dagegen gerade Versuche, die Kunst der Interpretation zu blockieren und zu obskurieren, so zu tun, als fände sich die »Rekonstruktion« der Bedeutung im Materi-al auf eine Art und Weise versteckt, die nur ein steriler Algorithmus auffinden könnte.
Blumer besteht darauf, dass die Generierung von Konzepten und Analysen eine Aufgabe ist, die nicht auf vorgegebenen Bahnen verlaufen kann. Seine Rebellion gegen die positivistisch-objektivis-tische Wissenschaft war nicht lediglich eine Rebellion gegen eine bestimmte Form festgezurrter Methodologie: Es war auch eine Re-bellion gegen den gesamten Glauben an die wissenschaftliche Me-thodik als Ausgangspunkt von Wissenschaft und gegen die Allüren einer Disziplin, die so tut, als wären ihre Forschungsergebnisse das Produkt rigider Wissenschaft. Es war eine Rebellion gegen Versu-che, die Forscher und ihre lokalen, auf ihr Feld bezogenen und aus dem Feld gewonnenen Interpretationen zu sterilisieren und diese Erkenntnisse als »aufgefunden« statt als forscherisch, künstlerisch, kreativ gemacht zu stilisieren. Gegen das Primat der Methode be-tont Blumer »die Rolle der Reflexion in der Wissenschaft« (Baugh 2006, S. 2). Am Ende des langen Standort-Aufsatzes bemerkt Blu-mer, seine Zusammenfassung sei in der Tat kurz: »Berücksichtigen Sie die Beschaffenheit der empirischen Welt.« Das mag als eine viel-deutige, vielleicht auch ziellose Aussage erscheinen. Kenneth Baugh nennt das abschätzig »Look and see-Empirismus« (ebd., S. 34), eine Abwertung, die in der Sozialwissenschaft häufig wiederzufinden ist, die aber gerade Blumers spätere Verteidiger abgewehrt haben. Die Bedeutungen im Feld werden erst sichtbar, wenn man sie durch-schaut, weil man selbst Teil des Feldes geworden ist: Ethnografen nennen das »Immersion«. Sie werden soziologisch anschlussfähig, indem man diese Felderkenntnisse in die Relevanzen der Soziologie übertragen kann und, immer kreativ und künstlerisch, etwas aus diesem Material macht und sich auf die Kategorien der erforschten Welt einlässt. Forschung ist ein praktisches Unterfangen, das mit falschen Anfängen, verschwendeter Zeit, Ideenblitzen und zufäl-ligen Entdeckungen arbeitet. Ihre Systematisierungen sind nicht etwa die Unterordnung von »Daten« unter ein »System« der In-terpretation, sondern vielmehr Übersetzungsleistungen von einer Sprache der Darstellung in eine andere, Übersetzungen, die immer kontingent dazu bleiben, welche Art von Projekt man gerade ver-
29669 Blumer 2. Lauf.indd 20-21 05.03.2013 08:41:00
22 23
folgt. Die Einsichten der Sozialwissenschaft stammen nicht aus tie-fer Theorie oder gereinigter Methode, finden sich nicht in Formeln oder Gesetzen und zielen nicht darauf, die »Maschine Gesellschaft« in ihrer Funktionsweise zu erläutern. Wir haben an anderer Stelle, gemeinsam mit Robert Prus, den Begriff der »Methode« durch den Begriff der »Forschungspraxis« ersetzt (Dellwing/Prus 2011). Ein-sichten generieren sich diesem Ansatz zufolge daraus, sich auf die Welten einzulassen, die man erforscht, offen dafür zu sein, dass sowohl die mitgebrachten Kategorien und Definitionen als auch die mitgebrachten Praktiken nicht funktionieren. Wenn das pas-siert, macht man es eben anders: Das bedeutet, sich im Feld treiben lassen zu können, um es erforschen zu können. Blumer bietet uns so ein »Bottom-up«-Bild der sozialen Welt, in dem jede Beschäfti-gung mit den »großen« Fragen des gesellschaftlichen Lebens immer wieder auf die kleinen Interaktionen des Alltags verweist. Diese Verweise führen nicht über den Umweg eines umfassenden metho-dologischen Programms, sondern zu einer einfachen, in den drei Kernprämissen leicht zu greifenden Frage: Wie leisten Menschen ihre Welt? Die Praktiken, die so etwas erforschen können, verwirk-lichen eine phänomenoffene Forschung mit Rücksicht auf die klei-nen Handlungen des Alltags, in denen Interpretationen und damit Definitionen der Situation generiert und Handlungen aufeinander abgestimmt werden. Bei Blumer besteht die Anweisung darin, auf die Interpretationen der Teilnehmer zu schauen und darauf, wie sie ihre Welt durch die Abstimmung ihrer Interpretationen aufei-nander machen. Und das ist alles, was man wissen muss. Es ist nicht einfach, es ist nicht banal, es ist nicht voraussetzungslos. Aber es ist auch nicht nur methodisch und schon gar nicht philosophisch, und gerade deshalb ist es erst einsichtsreich. Was Blumer uns so anbietet ist ein Programm, das Goffman dann umgesetzt hat: eine lebensweltnahe Skalpellarbeit an der Art und Weise, wie Bedeu-tungen ausgehandelt und damit Lebenswelten geleistet werden. Das haben die Schüler Blumers immer wieder betont. Mit Gary Alan Fine gesprochen: Sie untersuchen Ordnung als ein durch und durch situiertes Phänomen (Fine 2010) und lenken unsere Auf-merksamkeit damit auf diese Situationen. Diese Situationen sind, im Strauss’schen Sinne, »dicht besiedelt«, und somit schauen wir auf die Handlungen der Siedler, dieser Pioniere in Situationen. Sie »tun« die Welt gemeinsam, machen ihre Bedeutungen in aufein-
ander bezogenen Handlungen, und so schauen wir auf ihre Hand-lungen als Schritte im Bedeutungstanz. Das ist die Vorgabe: Die Soziologie wird dazu aufgefordert, (wieder) die durch und durch sozialen Lebenswelten handelnder Menschen zu untersuchen, ihre inflationäre Produktion von Abstrakta hinter sich zu lassen. Das benötigt Aufmerksamkeit fürs Detail, Befremden angesichts des scheinbar Selbstverständlichen, viel Zeit und die Neugier des Nichtkenners. »Blumer spornt uns an, Anfänger zu bleiben und zu bemerken, dass wir uns nur selbst täuschen, wenn wir etwas anderes glauben« (Baugh 2006, S. 3); das folgt selbstverständlich wieder einmal dem üblichen modus operandi der Ethnografen, die angehalten sind, nicht ins Feld zu gehen in dem Glauben, sie wüssten bereits etwas darüber. Die Bescheidenheit der Ethnografie verbietet es, sowohl vorher Hypothesen festzuzurren als auch das Feld unter strikt strukturierter Methode und Forschungplanung zu begraben. Klassische Ethnografie schert sich nicht um die abstrakte Legitimation ihrer Studien, sondern sie möchte herausfinden, wie Menschen leben und – in interpretativer Haltung – wie sie ihre Welten leisten.
Becker berichtet, dass Blumer seinen Studierenden regelmäßig aufgetragen habe, die abstrakten Konzepte anderer soziologischer Ansätze mit in den Alltag zu nehmen, um festzustellen, ob sie einer halben Stunde Beobachtung der eigenen Lebenswirklichkeit stand-halten. Becker und seine Mitstudierenden mussten in der Regel die Erfahrung machen, dass sie das nicht taten. Er schreibt:
Soziologen mochten es immer sehr, unbeobachtbare Größen und Kräfte zu postulieren. Sie haben sich dafür auf das prestigeträchtige Beispiel der Physik berufen. Sie füllen ihre Seiten mit »Strukturen« und »Kräften«, und nicht etwa, weil sie die alltäglicheren Ereignisse […] nicht sehen könnten. […] Blumer hat immer darauf bestanden, in unserer theoretischen Sprache Raum für das zu schaffen, was jeder sehen kann, wenn er nur hinschauen würde.« (Becker 1988, S. 16)
Dann fasst er in seiner üblichen, unaufgeregten Art zusammen:
[D]ie praktische Lösung für Methodenprobleme, jetzt und schon immer, besteht darin, die Mängel zu reparieren, dann hinzugehen und es einfach zu machen, indem man die Ad-hoc-Werkzeuge verwendet, die Garfinkel und andere expliziert haben, und das, ohne sich darüber Gedanken zu
29669 Blumer 2. Lauf.indd 22-23 05.03.2013 08:41:00
24 25
machen, ob die Ergebnisse philosophisch vertretbar sind […] Ich denke, so hat Forschung schon immer funktioniert und tut das weiterhin.« (Ebd., S. 20)
Hierin liegt die besondere Sprengkraft Blumers, die zur Aktualität seines Werkes wesentlich beiträgt, denn wie man hier sieht, lässt sich Blumers Rebellion weiträumig übertragen. Seine Intervention stellt sich nicht nur gegen die eingegrenzte Praxis der Variablen-analyse (obwohl er gerade hierzu viele bissige Kommentare lieferte und seine quantitativ arbeitenden Kolleginnen nachhaltig irritier-te). Seine Intervention stellt sich gegen eine Form, Wissenschaft zu betreiben, die sich mit Methoden und Theorien beschäftigt und sie mehr liebt als die Welt, die sie zu untersuchen vorgibt. Ob das Korrelationsberechnungen oder sozialphilosophisierende Theorien sind, operationalisierte Begriffe oder Mechaniken zum gewissen-haften Durchkämmen jeder halbsekündigen Redepause in einer Interviewtranskription: Blumer will (später in seinem Leben immer deutlicher) aus diesen Goldberg-Apparaturen ausbrechen, um den Blick darauf zu richten, was Menschen im Alltag zusammen tun. Seine Leistung besteht darin, die methodologischen Höhenflüge seiner Gegner zu beenden: Seine Methodologie ist Antimethodolo-gie, und sein Mantra ist: Die Welt zu verstehen ist so schwer nicht, wie es Vertreter rigider Methodiken immer behaupten. Blumers Nachlass ist daher letztlich einer, der in der Gegenwart wieder so wichtig und nötig wird wie lange nicht: Es ist nicht der Ruf nach »Interpretation« oder »Intersubjektivität«, sondern der Ruf nach reflexiver, kreativer und auch künstlerischer Bodenständigkeit der Soziologie.
Literatur
Kenneth Baugh, Jr., The Methodology of Herbert Blumer, Cambridge 2006.Howard S. Becker, »Herbert Blumer’s Conceptual Impact«, in: Symbolic
Interaction 11, 1 (1988), S. 13-21.Herbert Blumer, »Science Without Concepts«, in: American Journal of
Sociology 36 (1931), S. 515-533, »Wissenschaft ohne Begriffe«, in diesem Band.
–, »Social Disorganization and Individual Disorganization«, in: American Journal of Sociology 42, 6 (1937), S. 871-877.
–, »The Problem of the Concept in Social Psychology«, in: American Jour-nal of Sociology 45 (1940), S. 707-719.
–, »Public Opinion and Public Opinion Polling«, in: American Sociological Review 13 (1948), S. 524-554.
–, »Social Science and the Desegregation Process«, in: Annals of the Ameri-can Academy of Political and Social Science 304, (1956), S. 137-143.
–, »Race Prejudice as a Sense of Group Position«, in: The Pacific Sociological Review 1, 1 (1958), S. 3-7.
–, »Sociological Implications of the Thought of George Herbert Mead«, in: American Journal of Sociology 71, 5 (1966a), S. 535-544.
–, »Foreword«, in: Severyn T. Bruyn (Hg.), The Human Perspective in So-ciology, Englewood Cliffs 1966b.
–, Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Englewood Cliffs 1969.
–, »Action vs. Interaction: Relations in Public – Microstudies of the Public Order by Erving Goffman«, in: Society 9 (1972), S. 50-53.
–, »Mead and Blumer: The Convergent Methodological Perspectives of So-cial Behaviorism and Symbolic Interactionism«, in: American Sociologi-cal Review 45, 3 (1980), S. 409-419
–, »Going Astray with a Logical Scheme«, in: Symbolic Interaction 6, 1 (1983), S. 127-137
Michael Dellwing und Robert Prus, Einführung in die Interaktionistische Ethnografie: Soziologie im Außendienst, Wiesbaden 2011.
Gary Alan Fine, »The Sociology of the Local: Action and its Publics«, in: Sociological Theory 28 (2010), S. 355-376.
Joan Huber, »Reply to Blumer: But Who Will Scrutinize the Scrutinizers?«, in: American Sociological Review 38, 6 (1973), S. 798-800.
John Lofland, Doing Social Life: The Qualitative Study of Human Interaction in Natural Settings, New York 1976.
– und Lyn H. Lofland, Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis, New York 1984.
David R. Maines, »Herbert Blumer and the Possibility of Science in the Practice of Sociology: Further Thoughts«, in: Journal of Contemporary Ethnography 18 (1989), S. 160-177.
Clark McPhail und Cynthia Rexroat, »Ex Cathedra Blumer or Ex Libris Mead?«, in: American Sociological Review 45, 3 (1980), S. 420-430.
Thomas J. Morrione, Harvey A. Farberman, »Conversation with Herbert Blumer: II«, Symbolic Interaction 4, 2 (1981) S. 272-295.
–, »Herbert G. Blumer (1900-1987): A Legacy of Concepts, Criticisms and Contributions«, in: Symbolic Interaction 11, 1 (1988), S. 1-12.
Kenneth Plummer, Documents of Life 2: An Invitation to a Critical Human-ism, London 2000.
29669 Blumer 2. Lauf.indd 24-25 05.03.2013 08:41:00
26 27
Robert Prus, Mary Lorenz Dietz und William Shaffir, Doing Everyday Life: Ethnography as Human Lived Experience, Mississauga 1994.
Dmitri N. Shalin, »Interview with Kurt Lang«, in: Bios Sociologicus: The Er-ving Goffman Archives, hg. von Dmitri N. Shalin, UNLV: CDC Publica-tions, 2009, ⟨cdclv.unlv.edu//archives/interactionism/goffman/langg_09.html⟩.
–, »Interview with Rodney Stark«, in: Bios Sociologicus: The Erving Goffman Archives, hg. von Dmitri N. Shalin, UNLV: CDC Publications, 2009, ⟨http://cdclv.unlv.edu//archives/interactionism/goffman/stark_08.html⟩.
–, »Interview with Jacqueline Wiseman«, in: Bios Sociologicus: The Erving Goff-man Archives, hg. von Dmitri N. Shalin, UNLV: CDC Publications, 2009, ⟨http://cdclv.unlv.edu//archives/interactionism/goffman/wiseman_09. html⟩.
Tamotsu Shibutani, »Herbert Blumer’s Contribution to Twentieth-Centu-ry Sociology«, in: Symbolic Interaction 11, 1 (1988), S. 23-31.
Malcolm Spector und John Kitsuse, Constructing Social Problems, New Brunswick 2001 [1977].
Samuel Stouffer et al, The American Soldier, Princeton 1949.Trutz von Trotha, »Soziologie der Gewalt«, in: Trutz von Trotha (Hg.),
Soziologie der Gewalt, Wiesbaden 1997.Jacqueline Wiseman, Stations of the Lost: The Treatment of Skid Row Alco-
holics, Chicago 1979.Elvi Whittaker, »The Contribution of Herbert Blumer to Anthropology«,
in: Mary Lorenz Dietz, Robert Prus und William Shaffir (Hg.), Doing Everyday Life, Mississauga 1994, S. 379-392.
1. Soziologische Analyse und die Variable1
Mein Ziel in diesem Beitrag ist es, das Modell der soziologischen Analyse kritisch zu hinterfragen, das menschliches Gruppenleben auf Variablen und ihre Beziehungen untereinander reduzieren will. Ich werde dieses Modell fortan »Variablenanalyse« nennen. Es ist weit verbreitet und erfreut sich wachsender Anerkennung: Es scheint zur Norm der korrekten soziologischen Analyse zu wer-den. Seine ausgefeilten Formen werden zum Musterbeispiel einer korrekten Forschungsprozedur. Aufgrund des Einflusses, den es in unserer Disziplin ausübt, denke ich, dass es erstrebenswert ist, auf einige der ernsteren Defizite in seiner praktischen Nutzung hin-zuweisen und gewisse Grenzen seiner effektiven Anwendung zu bedenken. Der erste Teil dieses Aufsatzes beschäftigt sich mit den gegenwärtigen mir bekannten Defiziten, der zweite Teil mit der wichtigeren Frage der Grenzen der Angemessenheit dieses Modells.
Defizite der gegenwärtigen Variablenanalyse
Das erste Defizit der gegenwärtigen Variablenanalyse in unserem Feld, auf das ich hinweisen möchte, besteht im recht chaotischen Zustand, der bei der Auswahl von Variablen herrscht. Es scheint kaum eine Beschränkung zu geben, was als Variable ausgewählt oder bezeichnet werden kann. Dabei kann etwas so Simples wie eine Geschlechterverteilung oder etwas so Komplexes wie eine Depression ausgewählt werden, etwas so Spezifisches wie eine Ge-burtenrate oder etwas so Vages wie die soziale Kohäsion, etwas so Offensichtliches wie ein Umzug oder etwas so Unterstelltes wie das kollektive Unbewusste, etwas so universell Anerkanntes wie der Hass oder etwas so Doktrinäres wie der Ödipuskomplex, etwas so direkt Gegebenes wie die Auflagenhöhe einer Zeitung oder etwas so elaboriert Fabriziertes wie ein Anomieindex. Variablen können auf der Basis fadenscheiniger Eindrücke davon ausgesucht werden, was wichtig ist, auf der Basis ihrer konventionellen Verwendung,
1 Rede des Vorsitzenden der American Sociological Association, im September 1956.
29669 Blumer 2. Lauf.indd 26-27 05.03.2013 08:41:00