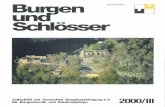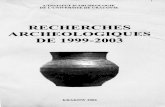Ausgrabungen in der mittelalterlichen Burg- und Klosteranlage Oybin
Serbeti, E., Panagou, T. and Efstathopoulos A., 2013. “Oiniadai. Die Ausgrabungen der Universität...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Serbeti, E., Panagou, T. and Efstathopoulos A., 2013. “Oiniadai. Die Ausgrabungen der Universität...
F. Lang, P. Funke, L. Kolonas, E.-L. Schwandner, D. Maschek (Hrsg.)Interdisziplinäre Forschungen in Akarnanien
Διεπιστημονικές έρευνες στην Ακαρνανία
Akarnanien-ForschungenΑκαρνανία ΈpeΎneΣ
1
Habelt-Verlag · Bonn
Herausgegeben vonFranziska Lang
Peter FunkeLazaros Kolonas
Ernst-Ludwig Schwandner
εις μνήμην
Frangiska KefallonitouNikolaos Ch. Kaponis
F. Lang, P. Funke, L. Kolonas, E.-L. Schwandner, D. Maschek (Hrsg.)
Interdisziplinäre Forschungen in AkarnanienΔιεπιστημονικές έρευνες στην Ακαρνανία
Akarnanien-ForschungenΑκαρνανία ΈpeΎneΣ
1
Habelt-Verlag · Bonn
© 2013 by Dr. Rudolf Habelt GmbH, BonnDas Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung und die
Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Satz: Erika FahnenbruckUmschlaggestaltung: polynox – büro für gestaltung | elke lang thomas hahn gbr
Druck: Beltz Bad Langensalza GmbH
ISBN 978-3-7749-3877-9
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detailliertere bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Lazaros KolonasTwenty years of Greek-German interdisciplinary collaboration in Akarnania 1
Claudia AntonettiVenetian and Italian research on Akarnania and adjacent areas 7
Svenja Brockmüller, Andreas Vött, Helmut BrücknerGeoarchive, archäologische Befunde und historische Quellen. Mosaiksteine zur Rekonstruktion der holozänen Küstenentwicklung am Sund von Leukas (NW-Griechenland) 15
Ulrich Floth, Andreas Vött, Simon M. May, Svenja Brockmüller, Helmut BrücknerExtreme wave events in the coastal zone of Lefkada and Akarnania (NW Greece) and their possible influence on civil structures. A comparison of field evidence and modeling results 31
Klaus FreitagWann wurde Leukas Mitglied des Akarnanischen Bundes? 41
Peter Funke, Klaus HallofZwei neue Staatsverträge aus Akarnanien 55
Thomas HinsbergerDie Dachterrakotten vom Tempelplateau bei Palairos 65
Susanne JahnsPalynologische Untersuchungen an Sedimenten des Ozeros-Sees 81
Nikolaos Ch. Kaponis (†)Acarnania: a byzantine landscape and its study 87
Stephan Kinsner“Economics and Culture” in Akarnanien 107
Marlene KösterAmphorenhenkel mit Stempel auf der Halbinsel Plaghiá 115
Vassilis LambrinoudakisDas archäologische Projekt Palaiomanina 127
Franziska LangDifferenzanalyse städtischer Praxis in Akarnanien 137
Judith LeyThukydides und die befestigten Städte in Akarnanien. Ein Beitrag der Bauforschung zu einer alten Frage 163
Georg A. Th. PantelidisDie römischen Matrizenlampen aus Stratos. Überlegungen zu Merkmalsanalyse und –klassifikation 177
Georg PasewaldHandgemachte oder scheibengedrehte Keramik? Ein Beitrag zu Techniken der Keramikproduktion und deren Identifikation 193
Anja PrustFaunal remains from Stratos, Acarnania 205
Armin SchrieverPaleogeographic studies of the former island Trikardo and the ancient city Oinidai (Iniades) in the Acheloos-Deltaplain in Akarnania 219
Ernst-Ludwig SchwandnerNotizen zum westgriechischen Regionalstil archaischer Dachterrakotten 233
Eleftheria Serbeti, Tania Panagou, Alexis EfstathopoulosOiniadai. Die Ausgrabungen der Universität Athen 239
Anne SieverlingErnährung in der griechischen Frühzeit. Keramik aus Akarnanien als Indikator für trophische Entwicklungen 249
Maria Stavropoulou-GatsiΝεώτερα μυκηναϊκά δεδομένα Ακαρνανίας και Λευκάδας 257
Daniela SummaDie Sammlungen der griechischen Inschriften von Akarnanien. Alte und neue Ergebnisse im Rahmen des Projektes Inscriptiones Graecae 271
Ismini Trianti, Angelika Lambaki, Alexandra ZampitiDas Heiligtum des Apollon in Aktion 279
Vasiliki TsantilaΟι εισηγμένοι «δηλιακοί» ανάγλυφοι σκύφοι των ακαρνανικών Οινιαδών 293
Vorwort
Unser Bild vom antiken Griechenland hat sich grundlegend verändert, seitdem man verstärkt auch jene Regionen in das Blickfeld intensiver Forschungen rückt, die eher im Windschatten und am Rand der ereignisgeschichtlich besser bezeugten Zentren der antiken Mittelmeerwelt liegen. Diese Regionalstudien haben wesentlich dazu beigetragen, dass wir heute eine differenziertere Sicht auf die wechselvolle Ge-schichte Griechenlands haben.
Mit dem vorliegenden Band, der die Ergebnisse einer von der DFG in großzügiger Weise geförderten Ta-gung präsentiert, wird unter dem Namen „Akarnani-en-Forschungen. Ακαρνανία 'Έρευνες“ eine Publikati-onsreihe eröffnet, die vornehmlich den Forschungen zu dieser im Nordwesten Griechenlands gelegenen Landschaft gewidmet sein wird. Erst seit wenigen Jahrzehnten ist diese Region stärker in den Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen genommen worden. Zahlreiche national wie auch international getragene Forschungsunternehmungen sind mittler-weile initiiert worden, aus denen sich ein intensiver und nachhaltiger interdisziplinärer Dialog entwi-ckelt hat, dem diese neue Reihe ein publizistisches Forum bieten möchte.
Forschungen der archäologisch-historischen Diszi-plinen – mit dem zeitlichen Bogen von den prähis-torischen über die antiken bis zu den byzantinisch-
osmanenzeitlichen Epochen – sind ebenso wie Un-tersuchungen der Epigraphik, der Numismatik und der geo- und naturwissenschaftlichen Fächer (Geoarchäologie, Paläogeographie, Archäobotanik, Archäozoologie, Archäometrie) in die holistische Landschaftsanalyse integriert. Durch diesen interdis-ziplinären Verbund werden die anthropogenen wie auch naturräumlichen Gegebenheiten untersucht, aus denen sich die Dynamik der Landschaft Akarnanien von verschiedenen Blickwinkeln rekonstruieren lässt.
Die „Akarnanien-Forschungen. Ακαρνανία 'Έρευνες“ sind ein internationales Gemeinschafts-projekt, das nur durch die großzügige Unterstützung der griechischen Kolleginnen und Kollegen seine heutige Gestalt annehmen konnte.
Die Freude, mit Band 1 die Reihe „Akarnanien-Forschungen. Ακαρνανία 'Έρευνες“ zu eröffnen, wird von zwei traurigen Ereignissen überschattet. Frankiska Kefalonitou, ehemalige Direktorin des Landesdenkmalamtes für byzantinische Archäologie, hatte gerade die neue Ephorie in Naupaktos auf-gebaut, als sie 2009 verstarb. Am 16. Februar 2012 verunglückte Nikolaos Kaponis tödlich. Mit beiden hat die byzantinische Archäologie Akarnaniens zwei wesentliche Stützen verloren, die sich tatkräftig, enga-giert und mit großem Enthusiasmus ihren Forschungen widmeten. Ihnen sei dieser erste Band „Akarnanien-Forschungen. Ακαρνανία Έρευνες“ gewidmet.
Franziska Lang Peter Funke Lazaros Kolonas Ernst-Ludwig Schwandner
Sites mentioned in the map in numerical order
1 Aktion /Aktium2 Anaktorion3 Ag. Nikolaos4 Prof. Elias / Palairos5 Palairos6 Sterna7 Leukas8 Poros (Leukas)9 Ag. Nikitas (Leukas)10 Echinos (modern Rouga)11 Thyrreion12 Limnaia (modern Amphilocheia)13 Olpe14 Argos Amphilochikon 15 Medeon (near Katouna)16 Torybeia (near Komboti)17 Alyzeia (modern Kandila)18 Ag. Andreas (near Alyzeia)19 Phoitiai (modern Kloster Ag. Georghios)20 Skourtou (ancient Derion ?)21 Kouvaras22 Stratos23 Spathari24 Kechrenia ( Valtos)25 Rigani (antike Sauria?)26 Palaiomanina (ancient Metropolis?) 27 Koronta (modern Chrysovitsa)28 Astakos29 Oiniadai30 Pleuron31 Kalydon32 Thermos33 Angelokastro34 Nikopolis35 Kassopea Lake Voulkaria (ancient Myrtountion?)
Sites mentioned in the map in alphabetical order
18 Ag. Andreas (near Alyzeia)9 Ag. Nikitas (Leukas)3 Ag. Nikolaos1 Aktion /Aktium17 Alyzeia (modern Kandila)2 Anaktorion33 Angelokastro14 Argos Amphilochikon 28 Astakos10 Echinos (modern Rouga)31 Kalydon35 Kassope24 Kechrenia ( Valtos)27 Koronta (modern Chrysovitsa)21 Kouvarasa Lake Voulkaria (ancient Myrtountion?)7 Leukas12 Limnaia (modern Amphilocheia)15 Medeon (near Katouna)34 Nikopolis29 Oiniadai13 Olpe26 Palaiomanina (ancient Metropolis?)5 Palairos19 Phoitiai (modern Kloster Ag. Georghios)30 Pleuron8 Poros (Leukas)4 Prof. Elias / Palairos25 Rigani (ancient Sauria?)20 Skourtou (ancient Derion ?)23 Spathari6 Sterna22 Stratos32 Thermos11 Thyrreion16 Torybeia (near Komboti)
239
Oiniadai. Die Ausgrabungen der Universität AthenEleftheria Serbeti, Tania Panagou, Alexis Efstathopoulos
Summary: The city of ancient Oiniadai near the Acheloos River delta is famous for the monumental remains of its city-walls, theatre and ship-sheds. The Department of Archaeology and History of Art of the University of Athens under the direction of prof. E. Serbeti has been excavating since 1989 in the Agora, the Acropolis and a necropolis of the ancient city.Thus far a number of buildings and structures forming a substantial part of the Agora, dated from the 4th to the 2nd c. B.C., have come to light: the bouleuterion, two stoas, a small temple (?), a heroon, three votive monuments and two more buildings of not clearly identified use. Their study reveals interesting architectural features, although due to the lack of thick layers and characteristic finds many questions remain unanswered. On the Acropolis two small trial trenches have been investigated, in order to collect information about the dating and the use of the site. In the eastern cemetery of the city, outside the city-walls, some hundred graves, dated mainly to the 3rd and 2nd c. B.C., have been excavated. They offer rich material for the study of burial customs and small finds (pottery, figurines, coins, etc.).
Keywords: Oiniadai, agora, acropolis, necropolis, late classical - hellenistic
Die antike Stadt von Oiniadai liegt in der Mündungs-ebene des Flusses Acheloos, 5 km vom heutigen Dorf Katochi-Neochori entfernt. Sie befindet sich auf einer Felshöhe, dem „Trikardos“ (der Name besteht seit dem 15. Jh., siehe Weil 1903, 341-354; Bodnar 1960, 111-112), der bei 3 km Länge und 2 km Breite eine Höhe von bis zu 100 m erreicht (Abb. 1). Von der antiken Stadt sind verschiedene eindrucksvolle Reste in recht gutem Zustand erhalten geblieben, wie die über 5 km lange Stadtmauer mit Toren und Türmen (Portelanos 1998, 1114-1192; Ley 2009), oder andere Bauten, wie z. B. die sehr gut erhaltenen Schiffshäuser (Sears 1904, 227-237; Kolonas 1992; Kolonas 2000) und das Theater, das Raum für ungefähr 5.000 Zu-schauer bietet (Powell 1904, 174-201; Bulle 1928, 91-97; Fiechter 1931, 7-18; Gerkan 1933, 152-154; Arias 1934, 52-57; Cailler 1966, 126-128; Gogos 2004).
Die Geschichte der Stadt wurde sehr von ihrer strategischen Lage bestimmt. Oiniadai liegt in der südwestlichsten Ecke Akarnaniens, und von dort konnte man den Meeresweg vom Korinthischen Golf zum Ionischen Meer überwachen (Xen. Hell. 4, 6, 14; Pol. 4, 65, 8-15; Walbank 1957, 520; Freitag 1994, 212-238; Schoch 1997, 52-55). Gleichzeitig beweist die Existenz der monumentalen Schiffshäusern, dass Oiniadai eine wichtige Hafenstadt war (Schriever et al. 2010).
Dem Mythos nach wurde die Stadt Oiniadai von Alkmaion, Sohn des Amphiaraos, des Königs von Argos, gegründet (Apoll. 3, 7, 2-7; Paus. 8, 24, 8-9; vgl. Hilpert-Greger 1996, 66-68). Geschichtlich tritt die Stadt erst kurz vor der Mitte des 5. Jhs. v. Chr. auf, als sie eine Belagerung von Perikles siegreich überstand
(Thuk. 1, 111, 3; Diod. 11, 85, 2) und von den Messe-niern aus Naupaktos angegriffen wurde (Paus. 4, 25; Gehrke – Wirbelauer 2004, 367-368). Während des Peloponnesischen Krieges stand Oiniadai erst an der Seite der Lakedaimonier; im Jahr 424 v. Chr. wurde es aber zwangsweise zum Mitglied des Akarnanischen Bundes und dann des Athenischen Seebundes (Thuk. 2, 82 und 102, 2-3; 3, 7, 4; 4, 77, 2; Diod. 12, 47, 4-5; Kagan 1974, 280-281; Salmon 1984, 309). Die Stadt wurde in der hellenistischen Zeit dreimal aitolisch, aber seit dem Anfang des 2. Jhs. v. Chr., mit der Unterstützung der Römer, blieb sie akarnanisch (Serbeti 2001, 38-59). Die letzte Nachricht über Oiniadai wird von Strabon überliefert (10, 2, 2). Sein Bericht, der keineswegs Klarheit schafft, wird mit der Gründung von Nikopolis und der Umsiedlung der Akarnanen in Verbindung gebracht und kritisch behandelt (Purcell 1987; Lang 1994; Büscher 1997, 146; Serbeti 2001, 59-60).
Im 19. Jh. hat der Brite William Martin Leake zum ersten Mal die Überreste des Trikardos-Hügels mit Oiniadai identifiziert (Leake 1835, 556-574). Die ersten Ausgrabungen wurden 1900 vom Ameri-kaner Benjamin Powell unternommen (Powell 1904; Sears 1904). In den 1980er- und 1990er-Jahren hat die 6. Ephorie für Prähistorische und Klassische Alter-tümer die Schiffshäuser und das Theater freigelegt (Kolonas 1992; Kolonas 2000), und seit 2002 sorgt das Projekt für Palairos, Oiniades und Plevrona unter der Leitung von Lazaros Kolonas und die 36. Ephorie für die Freilegung, Erhaltung und Restaurierung der Monumente (Kolonas 2006, 341-343).
Die Abteilung für Archäologie und Kunstge-schichte der Universität Athen unter der Leitung
240
ELE
FTH
ER
IA S
ER
BE
TI, T
AN
IA P
AN
AG
OU
, ALE
XIS
EFS
TATH
OP
OU
LOS von Prof. Eleft heria Serbeti unternimmt in Oiniadai
unabhängige Ausgrabungen seit 1989, stets nach der Genehmigung der Ephorie. Diese Präsentation dient als ein allgemeiner Überblick der bisherigen Arbeiten, die auf die Erforschung der Überreste und gleichzeitig auf die Ausbildung von Studenten abzielt. Die Gra-bungsplätze sind die Agora, die Akropolis und eine der Nekropolen der antiken Stadt.
In der Agora (Abb. 2) wurde eine Reihe von öff ent-lichen Gebäuden entdeckt, die vom 4. bis zum 2. Jh. v. Chr. datiert werden (Serbeti 2001). Die absolute Abwesenheit von Funden aus der Zeit vor dem 4. Jh. v. Chr. bleibt ein Rätsel, wenn man die literarischen Quellenbelege bedenkt (Serbeti 2006, 293-294). Es handelt sich um grobe Gebäude, von denen nur die untersten Blöcke der Mauern oder gar nur ihre Fundamente in relativ schlechtem Zustand erhalten sind. Dazu führten sowohl die Bauweise (Lehmziegeln auf Mauersockel aus Stein) als auch die geringe Aufschüttung in der Agora. Deshalb waren auch jene Funde spärlich, die Antworten auf die Frage nach den Funktionen der Gebäude geben konnten (Serbeti 2006, 297-298; zu den in der Agora gefundenen Münzen s. Serbeti 2004). Die Gebäude wurden vorrangig durch ihre Form identifi ziert.
Ein der wichtigsten Gebäude für das politische Leben der Stadt war das Bouleuterion (Abb. 2 Nr. 3). Es handelt sich um ein typisches geräumiges quadra-tisches Gebäude monumentaler Bauweise, 17 m lang, das innen vier Basen für Säulen oder Pfeilern aufweist und einen Eingang im Osten hat (Serbeti 2001, 62-73).
Die östliche Mauer des Bouleuterions – also seine Eingangsseite – ist gleichzeitig die westliche schmale Mauer eines weiteren Gebäudes der Agora, nämlich einer Halle (Abb. 2 Nr. 4). Der Eingang zum Bouleuterion erfolgte nur durch eben diese Halle, die 124 m lang und 17 m breit ist. Sie hatte eine zentrale, 117,8 m lange Mauer und je eine Säu-lenreihe in ihrer südlichen und nördlichen Front. Die zentrale Mauer reichte nicht bis zu den Schmalseiten des Gebäudes, um den Kontakt zwischen den Lang-seiten zu ermöglichen. Von den Säulenreihen sind nur die zertrümmerten Basen der möglicherweise hölzernen Säulen erhalten. In der südwestlichen und der südöstlichen Ecke der Halle formt sich je ein quadratischer Raum von 5x5 m (Serbeti 2001, 73-80).
In engem Zusammenhang mit den vorigen Ge-bäuden steht noch eines, das aus sechs gleich großen Räumen mit je einem Eingang zu einer langen Vor-halle geformt ist (Abb. 2 Nr. 1). Ihre Front bestand aus einer Reihe von hölzernen Pfeilern, von denen
heute nur noch fünf steinerne Basen existieren. Die Länge des Gebäudes beträgt 32 m, die Breite 17 m. Vom Typus her weist es die meisten Ähnlichkeiten zum „bâtiment à oikoi“ im Herakles-Heiligtum in Th asos (34,60x17,35 m) auf, das an das Ende des 5. und den Beginn des 4. Jhs. v. Chr. datiert wird. Für dieses Gebäude vermutete man, dass es die Festban-kette des Kults beherbergte (Launey 1944, 77-85; Bergquist 1973, 47-48). Über die Funktionen des Oikoi-Komplexes in der Agora von Oiniadai kann man hingegen nur spekulieren. Wegen seines Grund-risses könnte man eher an einen kommerziellen Cha-rakter denken, aber seine Position direkt neben dem Bouleuterion und seine ähnliche Bauweise könnten andeuten, dass es im selben Bauprogramm errichtet wurde und möglicherweise mit dem politischen Leben der Stadt zu tun hatte, etwa als Archiv und Prytaneion (Serbeti 2001, 80-96).
Der Raum zwischen dem vorigen Gebäude und dem Bouleuterion, der nur 6 m breit ist, wurde im Nachhinein durch vier Wände in drei Teile unter-gliedert (Abb. 2 Nr. 2): der vordere hatte vier kleine Stützen aus Stein für zwei Bänke, die an den Wänden entlang standen. Im mittleren, schmalen Teil be-fi ndet sich eine kleine Zisterne. Die Funktion dieses Zwischenraums bleibt unbekannt (Serbeti 2001, 96-106).
Ein kleines interessantes Gebäude (11,80 m mal 5,60 m) liegt am Osten der Halle, unabhängig vom Rest der Gebäude (Abb. 2 Nr. 5). Nach seinem Grundriss könnte es sich um einen kleinen Tempel handeln (Serbeti 2001, 126-128). Ein ähnliches Ge-bäude wurde von Powell in der Nähe des Hafens ge-funden und als „kleiner Tempel“ bezeichnet (Powell 1904, 202-206).
Im freien Raum der Agora befi ndet sich eine weitere unabhängige Struktur, die ebenfalls religiösen Charakter gehabt haben muss (Abb. 2 Nr. 8). Sie be-steht aus einer niedrigen runden Umfassungsmauer (8 m im Durchmesser), deren Eingang zu den rest-lichen Gebäuden der Agora gerichtet ist. Im Zentrum des Kreises gibt es einen rechteckigen Bothros. Er be-steht aus vier vertikal gelegten Steinplatten und einer Deckplatte. Unter der Deckplatte wurden fünf Sky-phoi gefunden, zwei davon umgedreht, also mit dem Fuß nach oben. Leider waren die Gefäße von extrem schlechter Qualität und konnten nicht mehr restau-riert werden. Unter ihnen öff nete sich eine schmale, über 5 m tiefe natürliche Spalte in den Felsen, die nicht näher erforscht werden konnte. Wir nehmen an, dass man hier eventuell Votivgaben hinabwerfen
241
OIN
IAD
AI.
DIE
AU
SG
RA
BU
NG
EN
DE
R U
NIV
ER
SIT
ÄT
ATH
ENkonnte. Neben dem Bothros gibt es einen niedrigen
rechteckigen Altar, der aus kleinen Steinen geformt ist. Allgemein wurden in diesem runden Raum etliche Scherben von Trinkgefäßen und Lampen gefunden, die in die 2. Hälft e des 2. Jhs. v. Chr. datiert werden. Es ist off ensichtlich, dass es sich hier um den Kultplatz einer chthonischen Gottheit, etwa um ein Heroon handelt (Serbeti 2001, 116-125).
Außerdem wurden im freien Platz der Agora die Fundamente von drei Weihmonumenten entdeckt. Zwei davon sind in Form von Exedrai gehalten, bilden also im Halbkreis einen Sockel, worauf einst Statuen gestanden haben müssen (Abb. 2 Nr. 6). Das dritte Monument hingegen ist größer und rechteckig. Wegen seiner Form deutete man es zu Beginn als einen Altar, aber von Asche wurde keine Spur gefunden (Serbeti 2001, 106-110, 112-116).
In der Nähe der einen Exedra wurde ein kleines rechteckiges Gebäude freigelegt (4,60x5,60 m) (Abb. 2 Nr. 7). Die dezentralisierte Tür in Zusammenhang mit der Lage dieses unabhängigen Raumes so nah zum Bouleuterion führt zu der Annahme, dass er für staatliche Trinkgelage gedient haben dürft e (Serbeti 2001, 110-112).
Diese hier nur grob skizzierten Bauten, die ge-wiss mit dem religiösen und politischen Leben der Bewohner zu tun hatten, formen einen wesentlichen Teil der Agora von Oiniadai. Zuletzt sollte man noch hinzufügen, dass östlich der Halle noch ein großes Gebäude sichtbar ist (Abb. 2 Nr. 9), dessen Grund-riss und Funktion unklar bleiben (Serbeti 2006, 289-290). Vielleicht handelt es sich um ein Katagogion oder gar um eine Privatwohnung.
Auf der Akropolis (Abb. 1) hat man bis jetzt nur zwei kleine Schnitte unternommen, die aber interes-sante Hinweise zur Datierung lieferten. Es sind dort zum ersten Mal Scherben von Glas und Keramik ge-funden worden, die eine Präsenz in der römischen und frühen byzantinischen Zeit bezeugen (Serbeti 2006, 298-299). Aber sie sind so spärlich und ohne jeglichen Zusammenhang mit irgendwelchen Bauten, dass man keineswegs von einem Weiterleben der Stadt sprechen kann.
Im Jahr 1992 begann parallel zu den Unter-suchungen auf der Agora die Ausgrabung in der östlichen Nekropole der Stadt, in der man die For-schungen in den letzten Jahren intensiviert hat. Der Datierungsrahmen der Funde weist auf eine kon-stante Benutzung des Friedhofes vom Ende des 4. bis zum Anfang des 1. Jhs. v. Chr., intensiver aber im 3. und 2. Jh. v. Chr. (Serbeti et al. 2009).
Dieser antike Friedhof befi ndet sich an einem Hang des Hügels von Oiniadai, außerhalb der Stadtmauer, entlang einer antiken Straße, die vom östlichen monumentalen Tor der Stadtmauer in Richtung Osten führt (Abb. 1). Diese Straße ist an vielen Stellen aus dem Felsen gehauen und kann auf einer gewissen Länge verfolgt werden. An der nörd-lichen, d. h. an der höher gelegenen Seite der Straße innerhalb der Nekropole wurde eine Reihe von Mauerteilen gefunden. Sie sind von recht guter Bauweise, polygonal oder rechteckig und fungieren zugleich als Stützmauern für die Straße und als eine Art von Bezirksmauern für die Gräber (Abb. 3).
Bis heute sind über 100 Gräber freigelegt worden, die teilweise sehr dicht aneinander gelegt sind (Abb. 4). Ihre Orientierung ist nicht fest und wurde off en-bar eher vom Platz am Hang bestimmt. Die meisten Gräber sind rechteckige Gruben im Felsen, die selten mit senkrechten Ziegeln oder Steinplatten umstellt wurden. Gleichzeitig benutzte man aber auch Asche-Urnen in bloßen Vertiefungen im Felsen. Die Abdeckung der Gräber formen normalerweise Steinplatten von weißem oder rötlichem Stein, aber gelegentlich wurden auch Ziegel verwendet. In den meisten Fällen liegen Körperbestattungen vor, aber manchmal fi nden sich auch Brandgräber, meist für Kinder. In einigen Gräbern gibt es nur eine Bestat-tung oder nur eine Asche-Urne, aber öft er ist ein Grab mehrmals nacheinander benutzt.
Leider haben die langjährigen Raubgrabungen am Ort eine zerstörte Befundsituation hinterlassen. Trotzdem kann man feststellen, dass fast alle Bestat-tungen mit Beigaben versehen waren, die das für Gräber übliche Repertoire umfassen. Am häufi gsten handelt es sich um Lampen, Unguentaria, Pyxiden, Trinkgefäße, Strigilen, Webgewichte und Münzen.
Die meisten Lampen gehören zu gut bekannten Typen, die hauptsächlich in das 3. und 2. Jh. v. Chr. datiert werden (Abb. 5). Es gibt auch einige, die von wenigen oder gar auch vereinzelten Exemplaren ver-treten werden (Serbeti et al. 2009, 261-263, Abb. 6, 9, 12).
Die Unguentaria sind ausschließlich spindelför-mig; es gibt dickbauchige schwarzgefi rnisste, graue und ungefi rnisste des 3. und 2. Jhs. v. Chr., aber auch Formen, die vielleicht aus dem 1. Jh. und dem Westen stammen (Serbeti et al. 2009, 260-262, 264, Abb. 3, 5, 11, 15).
Die Pyxiden gehören zu bekannten Typen der hel-lenistischer Zeit und sind aus Ton, Blei oder Bronze. Hinsichtlich der tönernen Exemplare ist erwähnens-
242
ELE
FTH
ER
IA S
ER
BE
TI, T
AN
IA P
AN
AG
OU
, ALE
XIS
EFS
TATH
OP
OU
LOS wert, dass man auch den recht ungewöhnlichen Typ
mit Standfl äche und drei Relieff üßen fi ndet (Abb. 6; vgl. Kotitsa 1996, 168-169).
Die Trinkgefäße, meist Skyphoi, Kantharoi und Einhenkler, sind oft von schlechter Qualität; selten fi nden wir einige mit Dekoration im Typ der West-Abhang-Keramik (Serbeti et al. 2009, 261-263, Abb. 7, 10, 13). Sehr oft kommen auch Näpfe des tiefen Typus vor, die meist in die 1. Hälft e des 3. Jhs. v. Chr. zu datieren sind (Abb. 7; vgl. Rotroff 1997, 167
„footed saltcellar“, 347-348 Nr. 1075-1089).Größere Gefäße, wie z. B. Amphoren, Spitzam-
phoren und Hydrien wurden oft als Asche-Urnen benutzt und seltener als Beigaben (z. B. Serbeti et al. 2009, 260 Abb. 2). Sie sind meist tonfarbig, und nur wenige tragen Dekoration.
Die meisten Münzen sind bronzene Prägungen aus Oiniadai selbst, jedoch gibt es auch einige bron-zene und silberne Münzen aus anderen Städten, wie z. B. Sikyon oder Leukas (Georgiou 2004).
Selten gibt es in den Gräbern Schmuck, Spiegel
oder Terrakotten. Die Schmuckstücke, wie z. B. Ringe, Ohrringe, Armbänder, sind manchmal grobe Teile aus Eisen oder Bronze, und nur extrem selten exis-tieren feinere aus Gold oder Glas. Die Terrakotten sind stets bloß in sehr fragmentarischem Zustand erhalten.
Die Gräber verfügten auch über Grabstelen, da man immer wieder entweder auf Bruchteile von Grabstelen oder von deren Sockeln stößt. Außerdem wurden bis heute zehn, mehr oder weniger intakte, mit männlichen und weiblichen Namen versehene Grabstelen gefunden.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass diese Ausgrabung, die mit geringen fi nanziellen Mitteln für sehr kurze Perioden geführt wird, doch große Teile der Agora und der Nekropolis von Oiniadai freige-legt hat. Die Funde von der Agora sind schon zum größten Teil in einem Band publiziert (Serbeti 2001), und zur Zeit werden die Funde von der Nekropolis restauriert und erforscht, damit bald eine Veröff ent-lichung dieser Ausgrabung möglich ist.
LiteraturverzeichnisArias, P. E. 1934, Il teatro fuori di Atene. Firenze.Bergquist, B. 1973, Herakles on Th asos. Th e Archaeological,
Literary and Epigraphic Evidence for his Sanctuary, Status and Cult Reconsidered. Uppsala.
Bodnar, E. W. 1960, Cyriacus of Ancona and Athens. Bruxelles-Berchem.
Bulle, H. 1928, Untersuchungen an griechischen Th eatern. München.
Büscher, P. 1996, Die Gruendung von Nikopolis und die Um-strukturierung Akarnaniens. in: P. Berktold, J. Schmid, Chr. Wacker, eds., Akarnanien, eine Landschaft im antiken Griechenland. Würzburg, 145-153.
Cailler, P., Cailler, D. 1966, Les Th éâtres greco-romaines de Grèce. Pully-Lausanne.
Fiechter, E. 1931, Die Th eater von Oiniadai und Neupleuron. Stuttgart.
Freitag, K. 1994, Oiniadai als Hafenstadt: einige historisch-topo-graphische Überlegungen, Klio 76, 212-238.
Gehrke, H.-J., Wirbelauer, H. 2004. Akarnania and Adjacent Areas, in: M.H. Hansen, T.H. Nielsen, eds., An Inventory of Archaic and Classical Poleis. Oxford, 351-378.
Georgiou, Ε. 2004, Νομίσματα από τάφους του Νεκροταφείου των Οινιαδών, in: Β΄ Διεθνές Ιστορικό και Αρχαιολογικό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας. Αγρίνιο 29-31 Μαρτίου 2002, Αγρίνιο, 243-258.
Gerkan, Α. v. 1933, Rez. zu: E. Fiechter, Die Th eater von Oiniadai und Neupleuron, Gnomon 9, 152-154.
Gogos, S. 2004, Το αρχαίο θέατρο των Οινιαδών. Αποτελέσματα ερευνητικής συνεργασίας του Ινστιτούτου Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Βιέννης και της Στ΄ Ε.Π.Κ.Α. υπό τη διεύθυνση του Λάζαρου Κολώνα. Αθήνα.
Hilpert-Greger, R. 1996, Die Gründungsmythen des akarnanischen Ethnos, in: P. Berktold, J. Schmid, Chr. Wacker, eds., Akar-nanien, eine Landschaft im antiken Griechenland. Würzburg, 71-74.
Kagan, D. 1974, Th e Archidamian War. Ithaca – London.Kolonas, L. 1992, Ανασκαφή Οινιαδών. Τα Νεώρια, Αρχαιογνωσία
6, 1989-90, 153-158.Kolonas, L. 2000, Οινιάδες, ΑΔ 50 (1995) Β΄1, 239-240.Kolonas, L. 2006, Το έργο της Επιτροπής Προστασίας,
Έρευνας και Ανάδειξης Τριών Αρχαίων Πόλεων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας: «Πάλαιρος, Οινιάδες, Πλευρώνα», in: Το Έργο των Επιστημονικών Επιτροπών Αναστήλωσης, Συντήρησης και Ανάδειξης Μνημείων, Αθήνα, 339-351.
Kotitsa, Z. 1996, Hellenistische Tonpyxiden. Untersuchung zweier hellenistischer Typen einer Keramikform, Mainz am Rhein.
Lang, F. 1994, Veränderung des Siedlungsbildes in Akarnanien von der klassisch - hellenistischen zur römischen Zeit, Klio 76, 239-254.
Launey, M. 1944, Le sanctuaire et le culte d’Héraklès à Th asos. Etudes Th assiennes I. Paris.
Leake, W. M. 1835, Travels in Northern Greece 3. London.
243
OIN
IAD
AI.
DIE
AU
SG
RA
BU
NG
EN
DE
R U
NIV
ER
SIT
ÄT
ATH
ENLey, J. 2009, Stadtbefestigungen in Akarnanien. Ein bauhistorischer
Beitrag zur urbanen Entwicklungsgeschichte einer antiken Landschaft . Diss. TU Berlin (D83).
Oost, S. I. 1954, Roman Policy in Epirus and Akarnania in the Age of the Roman Conquest of Greece. Dallas.
Portelanos, A. 1998, Οι αρχαίες αιτωλικές οχυρώσεις. Diss. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Powell, B. 1904, Oeniadae I-IV, American Journal of Archaeology 8, 137-215.
Purcell, Ν. 1987, Th e Nicopolitan Synoecism and Roman Urban Policy, in: Ε. Chrysos, ed., Nicopolis I. Proccedings of the fi rst International Symposium on Nicopolis (23 – 29 September 1984). Preveza, 71-90.
Rotroff , S. I. 1997, Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Wheelmade Tableware and Related Material. Th e Athenian Agora XXIX. Princeton.
Salmon, J. B. 1984, Wealthy Corinth. A History of the City to 338 BC. Oxford.
Schoch, M. 1997, Beiträge zur Topographie Akarnaniens in klassischer und hellenistischer Zeit. Würzburg.
Schriever, A., Vött, A., Brückner, H. 2010, Erst Segen, dann Fluch.
– Die Verlandung des Hafens der antiken Stadt Oiniadai durch den Acheloos, in: F. Lang, ed. Akarnanien. Interdisziplinäre Regionalstudien im Westen Griechenlands. Darmstadt.
Sears Jr., J. M. 1904, Oeniadae V-VI, American Journal of Archaeo-logy 8, 216-237.
Serbeti, Ε. 2001, Οινιάδες. Δημόσια Οικοδομήματα από την Αγορά. Αθήνα.
Serbeti, Ε. 2004, Νομίσματα από την Αγορά των Οινιαδών, in: Β΄ Διεθνές Ιστορικό και Αρχαιολογικό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας. Αγρίνιο 29-31 Μαρτίου 2002. Αγρίνιο, 293-305.
Serbeti, E. 2006, Ανασκαφή Οινιαδών. Συμπεράσματα και προβληματισμοί, Αρχαιογνωσία 14, 285-299.
Serbeti, E., Panagou, T., Efstathopoulos, A. 2009, Κεραμική από το νεκροταφείο των Οινιαδών, in: Ελλ ηνιστική Κεραμική από την αρχαία Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα Ιόνια Νησιά. Αθήνα, 259-266.
Walbank, F. W. 1957, A Historical Commentary on Polybius. Oxford.
Weil, R. 1903, Oeniadae. Ein Beitrag zur Nordgriechischen Reise des Cyriacus von Ancona (1436), Beiträge zur Bücherkunde und Philologie. August Wilmanns zum 25. März 1903, 341-354.
AbbildungsnachweiseAbb. 1: Plan: E. Vranopoulou und A. Portelanos, bearbeitet von A. Efstathopoulos — Abb. 2: Plan: E. Vranopoulou und A. Portelanos, bearbeitet von A. Efstathopoulos — Abb. 3: Phot. E. Serbeti — Abb. 4: Phot. E. Serbeti — Abb. 5: Phot. A. Efstathopoulos — Abb. 6: Phot. A. Efstathopoulos — Abb. 7: Phot. A. Efstathopoulos
245
Abb
. 2: P
lan
der A
gora
von
Oin
iada
i: 1.
Geb
äude
mit
Oik
oi, 2
. Zw
ische
nrau
m, 3
. Bou
leut
erio
n, 4
. Hal
le, 5
. Tem
pel ?
, 6. W
eihm
onum
ente
, 7. R
echt
ecki
ger R
aum
, 8. H
eroo
n,
9. K
atag
ogio
n ?
246
Abb. 4: Ein typisches Grab mit Bestattung und Beigaben
Abb. 3: Polygonale Stütz- und Bezirksmauer in der Nekropole
247
Abb. 5: Der Haupttypus der Lampen aus der Nekropole
Abb. 6: Pyxis mit Standfläche und Relieffüssen aus der Nekropole
Abb. 7: Napf des tiefen Typus aus der Nekropole