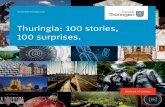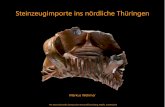Geoarchäologisches Praktikum der FSU Jena 2010 und 2011 auf dem Alten Gleisberg,...
Transcript of Geoarchäologisches Praktikum der FSU Jena 2010 und 2011 auf dem Alten Gleisberg,...
Neue Ausgrabungen und
Funde in Thüringen
ISBN 978-3-941171-80-0
7 | 2012-13
Werden Sie Mitglied der Archäologischen Gesellschaft in Thüringen e. V.!
Jahresbeitrag 30,– €Schüler, Studenten, Rentner, Arbeitslose, Auszubildende 15,– €
Archäologische Gesellschaft in Thüringen e. V.Weimarische Straße 199423 Weimar-Ehringsdorf
www.arch-thueringen.de
Archäologische Gesellschaft in Thüringen e. V.
97
Peter Ettel, Thomas Jahr, Lars Kleinsteuber, Anna Petruck, Florian Schneider, Heike Schneider,Christian Tannhäuser, Stefanie Zeumann
GEOARCHÄOLOGISCHES PRAKTIKUM DER FSU JENA 2010 UND 2011 AUF DEM ALTEN GLEISBERG, SAALE-HOLZLAND-KREIS
Die Ausgrabungen 2010 und 2011
Siedlungssysteme, gleichgültig ob Flachland- oder Hö-hen sied lungen, benötigen einen Zugang zum Frisch-wasser, um das Überleben der ansässigen Bevöl kerung zu sichern. So stellt sich die Frage, wie die Wasser ver-sor gung der prähistorischen Höhensiedlung des Alten Gleisberges bei Graitschen, Saale-Holzland-Kreis, be-schaffen war. Hierzu schrieb 1962 bereits K. Simon: „Der Alte Gleisberg ist im Gegensatz zu vielen ande-ren besiedelten Höhen reich an natürlichen Wasser-vorkommen. An fast allen Seiten des Massivs treten in dem ausgepräg ten Quellhorizont zwischen Röt und Muschelkalk mehr oder weniger kräftige Quellen zu-tage. Die Bewoh ner des Gleisberges haben sicherlich die nur etwa 250 m vom östlichen Plateaurand ent-fernte, heute fast versiegte Quelle am Ausgang des nach Grait schen gerichteten Tälchens benutzt. Die Stelle, von der auch vorgeschichtliche Funde bekannt sind, bil-det heute den Beginn einer waldbestandenen, feuch-ten Rinne. Die Quelle selbst entspringt jetzt ein Stück weiter unten“ (Simon 1962, 4). Auf dieser Grundlage sollten im Rahmen des geoarchäologischen Praktikums der Friedrich-Schiller-Universität Jena1 die Frage der Wasserversorgung aus archäologischer Sicht unter-sucht werden. In den Jahren 2010 und 2011 wurden deshalb in zwei Kampagnen unterhalb des Nordhanges drei Schnitte geöffnet, um für ausgewählte geomor-phologisch auffällige Geländestrukturen exemplarisch
zu prüfen, ob eine anthropogene Genese und gege-benenfalls ein Zusammenhang mit den Quellaustritten vorliegt (siehe hierzu auch: Ettel u. a. 2011, 81 Abb. 5).
Die jeweils einen Zeitraum von zwei Wochen umfas-senden Kampagnen2 konzentrierten sich auf den nördli-chen Hang unterhalb des „Nordplateaus“ auf dem Alten Gleisberg (Abb.1). Hier leiten die nach Norden abfallen-den Schichten des Unteren Muschelkalks und Oberen Buntsandsteins das anfallende Oberfl ächenwasser des Plateaus zu verschiedenen Schichtwasseraustritten auf der Nordseite des Alten Gleisberges ab (siehe hierzu auch: Ettel u. a. 2011, 79–81). Das ist die von K. Simon postulierte Zone der möglichen Wasserversorgung des Alten Gleisberges.
Im Gelände des lichten Buchenmischwaldes sind meh rere zum Teil stark profi lierte Geländestufen zu er-kennen. Für die Grabung des Jahres 2010 wurde eine jener ostwestlich, parallel zum Hang verlaufenden Ge-län destufen von etwa 10 m Breite ausgewählt. Der Schnitt ist in Nord-Süd-Richtung über den Scheitel der Ge län de stufe angelegt worden und hatte eine Größe von 18 x 7 m. Im südlichen Drittel des Schnittes trat in einer Tiefe von ca. 0,3 m unter der Geländeoberfl äche eine Lage aus Kalksteinen mit Brandspuren zu Tage. Während der Aus grabung wurden drei Profi le angelegt und do ku mentiert. Im Profi l 1 (Ost-West) zeigte sich ein V-förmiger Befund (Befund 358), der relativ homogen ver füllt und von einem ca. 0,6 m mächtigen Schicht pa-ket (Befund 353) überdeckt wurde. Dieser V-förmige Be -fund ließ sich auch in Profi l 3 nachweisen. Im Befund 358 sind einige Vertiefungen im Negativ sowie eine stark mit verwittertem Kalkstein durchsetzte Schicht (Befund 359), die im Sohlenbereich des Profi ls 3 dokumentiert wurde, aufgedeckt worden (Abb. 2). Dieser Befund ist auf Grund seines scharf ausgeprägten V-förmigen Pro-fi ls, der geringen Tiefe von 0,6 bis 0,8 m und der ge-
1 Dieses Praktikum wird seit 2005 als transdisziplinäres Projekt von Dozenten der Ur- und Frühgeschichte, der Geologie und Geographie der Friedrich-Schiller-Universität geplant und mit Studierenden durchgeführt. Das Praktikum legt Wert auf Fragen zur Besiedlung des Inselberges, auf geophysikalische Prospektionen auf dem Berg selbst sowie in seinem direkten Umfeld, auf Fragen zu seinem geologischen Aufbau und zur Wasserversorgung der Siedlung. Ebenso werden palynolo-gische Daten erhoben bzw. durch bodenkundliche Analysen Daten zur Erosion und Kolluvienbildung. Die Finanzierung der archäologischen Arbeiten erfolgte dankenswerterweise durch die gGmbH „Alter Gleisberg“.
2 Örtliche Grabungsleitung: Christian Tannhäuser, M. A., 2011 unter Mitarbeit von Lars Kleinsteuber, M. A.
98
Neue Ausgrabungen und Funde in Thüringen | 7 / 2012-13 | 97–107
ringen Breite von maximal 1 m an seiner Oberkante als Palisadengraben interpretiert worden. Hierbei dürften die im Negativ erfassten Vertiefungen die Standspuren einer zugehörigen Palisade darstellen.
Der dem Hanggefälle folgende Verlauf der Graben-struktur in dem Bereich der natürlichen Schicht wasser-aus tritte lässt vermuten, dass es sich um den Teil ei-ner Fortifi kation zum Schutz der Wasserversorgung der Siedlung gehandelt haben könnte. Ähnliche Struk-turen sind aus Thüringen von der Siedlung auf dem Öchsenberg bei Vacha im Wartburgkreis bekannt (Do-nat 1966, 249). Zur abschließenden Deutung des Be-fun des auf dem Alten Gleisberg sind jedoch weitere archäo logische Untersuchungen und Prospektionen im Bereich des Nordhanges nötig, da die Kampagne 2010 bisher die einzige Untersuchung in diesem Bereich war.
Das Fundmaterial aus der Verfüllung von Befund 358 bestand zum überwiegenden Teil aus Keramik frag -menten, deren Kanten meist stark verrundet sind. Le dig-lich eine größere Randscherbe mit fast vollständig erhal-tenem Gefäßprofi l ließ sich vorläufi g in die Spät hall statt-/Frühlatènezeit datieren (Abb. 3.1). Der einzige datierbare Metallfund ist das Fragment einer eisernen Drahtfi bel mit
0 100 km
Abb. 1
Plan der Höhensiedlung Alter Gleisberg bei Grait-schen, Saale-Holzland-Kreis, mit Eintragung der Grabungsschnitte 1 (2004), 2 (2004–2008), 3 (2009), 4 (2010) und 5 (2011 A und B), Qu: Quellhorizonte bzw. Schichtwasseraustritte
oben liegender Sehne, sechs Spiralwindungen, Nadelrest und Bügelansatz, die in Befund 353 entdeckt wurde (Abb. 3.2). Auf Grund der wenigen erhaltenen typolo-gischen Merkmale lässt sich diese Fibel vorläufi g in die Mit tel latènezeit datieren.
Im Fokus der Grabungskampagne 2011 stand erneut der nördliche Hang unterhalb des „Nordplateaus“. Der ausgewählte Bereich befand sich ca. 60 m nördlich des Grabungsschnittes von 2010. Die Untersuchung zielte auf zwei deutlich im Gelände sichtbare Stufen. Mit der Grabung des Jahres 2011 sollte geklärt werden, ob es sich bei den Geländestufen um eine Fortifi kation zum Schutz der vermuteten Wasserversorgung am Nordhang der ei-senzeitlichen Höhensiedlung gehandelt haben könnte.
Im Vorfeld der Grabung wurde die geplante Unter-suchungsfl äche geomagnetisch prospektiert.3 Dabei wurden keine Hinweise auf archäologische Strukturen im Untergrund festgestellt. Die zu untersuchende Flä-che wurde in Nord-Süd-Richtung über den Scheitel der
3 Die geomagnetische Prospektion mittels Protonenmagneto-meter wurde durch Dr. rer. nat. D. Hansen und L. Kleinsteuber, M. A., durchgeführt.
Peter Ettel u. a. | Geoarchäologisches Praktikum der FSU Jena 2010 und 2011 auf dem Alten Gleisberg
99
Abb. 2 Grabung 2010, Profi l 1 und 3, 352 – Grabenverfüllung, 353 – Erosionsschicht, 354 – Hu mus-schicht, 355 – Humusschicht, 356 – A-Horizont, 358 – Spitzgraben, G – Unterer Muschelkalk
0 3 cm
Abb. 3 1: Randscherbe (Bef. 352, Grabung 2010); 2: Fragmente einer eisernen Drahtfi bel (Bef. 353, Gra bung 2010); 3: Fragment einer Eisenfi bel (Planum 2, Grabung 2011)
0 2 cm
1 2, 3
G
353
352
359
358
Profil 1
Profil 3
G
354
353
355 356
352
358
1 m0
1 m0
A
C D
1 m0
AB
CD
B
100
Neue Ausgrabungen und Funde in Thüringen | 7 / 2012-13 | 97–107
beiden Geländestufen geführt und zog sich auf bei-den Seiten über deren Enden hinaus; sie wurde in zwei Bereiche (A und B) aufgeteilt und nacheinander geöffnet (Abb. 1). Fläche A (38 m²) war 19 m lang und 2 m breit. Fläche B (ca. 26 m2) hatte eine Länge von 9,65 m und eine Breite von 2,70 m. Im Bereich A wurden ein Ost- und ein Westprofi l dokumentiert, im Bereich B nur das Ostprofi l (Abb. 4). Im nördlichen Drittel des Bereiches A befand sich, im M-Horizont eingelagert, eine Kon zentration aus Kalksteingeröll. Dieses zeigte teilweise Brandspuren. Bei
dem Befund dürfte es sich um eine schräg zum Hang verlaufende Erosionsrinne handeln, die sukzessive mit Steinmaterial verfüllt worden war. Laut Aussagen orts-kundiger Anwohner handelt es sich vermutlich um re-zente Verfüllungen.4 Innerhalb der Erosionsrinne befan-den sich keine Funde. Weitere Befunde wurden in der Grabungsfl äche A nicht entdeckt.
1
3
5
1
3
5
1
3
45
0 1 m
A
B
B
A
Abb. 4 Grabung 2011, Ostprofi l; 1: 5 bis 10 cm Schichtdicke, starke Durchwurzelung, keine Einschlüsse, vermutlich Humus; 3: 20 bis 90 cm Schichtdicke, Kalkmycel, vereinzelte Steine eingelagert (Muschelkalk, Flussschotter), schwache Durchwurzelung, Migrationsschicht; 4: 0 bis 20 cm Schichtdicke, grau gefärbt, keine Einschlüsse, verwitterter Röt; 5: 10 bis 20 cm Schichtdicke, Kalkmycel (vereinzelt), keine Einschlüsse, Muschelkalk
4 Freundl. Mitteilung von Familie Weidner, Löberschütz, am 26.07.2011
Peter Ettel u. a. | Geoarchäologisches Praktikum der FSU Jena 2010 und 2011 auf dem Alten Gleisberg
101
Das Fundspektrum aus Grabungsfl äche A umfasst Keramik und Tierknochen. Bei den Scherben handelt es sich sowohl um vorgeschichtliches als auch um neuzeit-liches Material. Da die vorgeschichtliche Keramik sehr kleinstückig und an den Enden stark verrollt ist, lässt sie sich anhand der Machart und Art der Magerung lediglich als eisenzeitlich deuten. Das keramische Fundmaterial aus Grabungsfl äche B weist eine ähnliche Erhaltung auf. Abgesehen von zwei Randscherben, besteht es aus-schließlich aus Wandungsscherben. An Metallfunden wurden in diesem Grabungsschnitt neben dem Fragment einer eisernen, nach Lt C/D zu datierende Fibel im Planum 2 (Abb. 3.3) einige stark korrodierte neuzeitliche bis mo-derne Eisenfragmente geborgen.
Zusammenfassend mit den Grabungsergebnissen des Jahres 2010 konnten die in der Altforschung zum Alten Gleisberg getroffenen Aussagen zu den Holz-Erde-Wällen im Bereich des nördlichen Hanges nicht bestä-tigt werden. Die deutlich sichtbaren Geländestufen sind durch die neuzeitliche land- bzw. forstwirtschaftliche Nutzung des Areals entstanden. Ebenso wenig konnte die leichte Depression im südlichen Geländeabschnitt als Absetzbecken der Schichtwasseraustritte iden-tifi ziert werden. Um weitergehende Aussagen zur Wasserversorgung und zur Fortifi kation zu gewinnen, wären weitere Untersuchungsareale im Bereich des Nordosthanges notwendig.
Das Umfeld des Alten Gleisbergs
Die Frage, wie Siedlungen in ihr lokales, regionales und über regionales Umfeld eingebunden sind, gehört zu den klassischen Ansatzpunkten der archäologischen Sied lungsforschung (Jankuhn 1977). In besonderem Maße gilt das für Höhensiedlungen. Zum einen dürf-ten diese auf ein zumindest wirtschaftliches Umland angewiesen gewesen sein, sei es zur Versorgung mit landwirtschaftlichen Gütern oder zur Distribution hand-werklicher Produkte. Zum anderen ist die oftmals pau-schal formulierte Frage nach der „Zentralörtlichkeit“ von Höhensiedlungen nicht ohne die Analyse der sie um gebenden Siedlungslandschaften zu beantworten.
Für den Alten Gleisberg fand in den frühen 2000er-Jah ren eine erste systematische Annäherung an diese Fra gen statt. Dazu wurden alle archäologischen Fund-stellen, die in dem Gebiet liegen, das durch einen Kreis mit dem Radius von 5 km und dem Alten Gleis-berg als Mittelpunkt defi niert ist, den Ortsakten des Thü rin gisches Landesamtes für Denkmalpfl ege und Archäologie (TLDA) Weimar sowie der Sammlung für
Vor- und Frühgeschichte der Friedrich-Schiller-Uni ver-sität Jena entnommen. Die erste Aufnahme der Fund-stellen wurde durch Jörg Fritz, M. A., im Rahmen sei-ner Tätigkeit als studentische Hilfskraft am Bereich für Ur- und Frühgeschichte der Friedrich-Schiller-Uni ver-sität Jena durchgeführt.5 Eine zweite, systematische Fund stel lenerfassung und erste Auswertung fand an-schließend von M. Wehmer in Vorbereitung und Durch-führung seiner Magisterarbeit statt (Wehmer 2006). Erste Auswertungen wurden durch M. Wehmer und K. Jebramcik, beide M. A., in den Jahren 2006 und 2010 im Rahmen ihrer Magisterarbeiten durchgeführt (Wehmer 2006; Jebra mcik 2010). Neben einer Zusammenstellung und Auswertung der bereits publizierten und über die Orts akten zugänglichen Informationen (Wehmer 2006) fand in diesem Rahmen auch die Bearbeitung des Fund materials einzelner und die gezielte Begehung wei terer ausgewählter vorgeschichtlicher Fundstellen statt (Jebramcik 2010). Seit Herbst 2011 werden diese An sätze als neuer Teilbereich in dem universitären For-schungsprojekt „Alter Gleisberg“ aufgenommen und wei terverfolgt.
Derzeit liegen aus dem Arbeitsgebiet etwa 270 Fund stellen aus dem Zeitraum vom Mesolithikum bis zum Hochmittelalter vor. Die genaue Anzahl hängt da-von ab, wie die einzelnen Fundstellen räumlich defi niert und voneinander abgegrenzt werden. Während M. Wehmer den Fundplatz Kunitz „Spielberg“ z. B. in drei räumliche Einheiten aufteilte (Wehmer 2006, Kat.-Nr. 508, 518, 526), wird er in Tab. 1 als ein einziger Fundplatz gezählt. Ohne auf die methodischen Implikationen so-wie die praktischen Vor- und Nachteile der beiden Vorgehensweisen detailliert eingehen zu wollen, sei an-gemerkt, dass für die vorliegende Statistik Fundplätze mit einer räumlich kontinuierlichen Fundstreuung als ein einziger Fundpunkt gezählt wurden.
Der Forschungsstand zu den einzelnen Fundplätzen ist als sehr unterschiedlich und insgesamt nach wie vor unbefriedigend zu bezeichnen. Die Mehrzahl der Fundstellen ist lediglich durch Feldbegehungen be-kannt; in weniger als 5 % der Fälle erfolgten Ausgrabun-gen oder zumindest Notbergungen.6 Auch die Zahl der Fundstellen, zu denen wissenschaftliche Auswertungen, publizierte Fundvorlagen oder Vorberichte vorliegen, ist gering. Nur ein Viertel der Fundstellen wurde in der Fachliteratur in unterschiedlicher Ausführlichkeit be-
5 Fortgeführt durch N. Baumann, M. A., und E. Herrmann, M. A.
6 Z. B. Beutnitz „Gleistalperle“ (Peschel 1992); Bürgel „Kirch-fried hof“ (OA Bürgel, TLDA Weimar); Großlöbichau „Schafs-wiese“ (OA Großlöbichau, TLDA Weimar; Jebramcik 2010, 19.35); Großlöbichau, Siedlung Neolithikum und vorrömi-sche Eisenzeit (frdl. Mitteilung von Frau Dr. Ines Spazier, TLDA Weimar, am 15.05.12); Golmsdorf „In den Hofäckern“ (frdl. Mitteilung von Frau Dr. Ines Spazier, TLDA Weimar, am 15.05.12); Dornburg „Galgenberg“ (Peschel 1963)
102
Neue Ausgrabungen und Funde in Thüringen | 7 / 2012-13 | 97–107
handelt. Darüber hinaus liegt zu 39 Fundstellen des Neolithikums, der Bronzezeit und der Eisenzeit eine wis-senschaftliche, allerdings unveröffentlichte Fundvorlage vor (Jebramcik 2010).
Für die Kartierung der Fundstellen ist zu bedenken, dass drei unterschiedliche Lokalisierungsgenauigkeiten vorliegen. In knapp 180 Fällen liegen genaue Koordinaten vor. In weiteren 40 Fällen ist immerhin eine ungefähre Lokalisierung mithilfe von Koordinaten möglich, ein Umstand, der für Kartierungen im Maßstab 1 : 25 nicht oder nur gering ins Gewicht fällt. Für die Lokalisierung der restlichen Fundstellen stehen nur ungefähre Lage- oder sogar nur Gemeindeangaben zur Verfügung; eine sinnvolle Kartierung dieser Fundstellen ist daher nicht möglich. Der insgesamt hohe Lokalisierungsgrad vie-ler Fundstellen dürfte dadurch bedingt sein, dass ein Großteil der Fundpunkte in den vergangenen dreißig Jahren durch systematische Begehung insbesondere von M. Böhme entdeckt wurde (Wehmer 2006, 71).
Im Folgenden seien nun die vorliegenden Anhalts-punkte zur vorgeschichtlichen und kaiserzeitlichen Be-sied lungsentwicklung skizziert.7 Zur Beurteilung die ses Zeitabschnittes stehen nach derzeitigem Kennt nis stand 240 Fundstellen zur Verfügung. Diese liegen in der Regel im Hangbereich der Flusstäler und sind im Gleise-tal, dem Mündungsbereich des Gönnerbaches in die
Saale auen, im Gembdental, um Kunitz herum und auf den Hochfl ächen bei Dornburg verbreitet (Abb. 5). Die-ses Verbreitungsbild wird mit unterschiedlichen Quan-titäten für fast alle kartierten Zeitabschnitte bestätigt. Die deutlichste Ausnahme ist die Römische Kaiserzeit. Hier konzentrieren sie sich im Saaletal bzw. im Mün-dungsbereich der in die Saale mündenden Neben fl üsse (Abb. 6).
Diese Verbreitungsbilder sind in hohem Maße durch die topographischen Gegebenheiten und forschungs-geschichtlichen Schwerpunkte gefi ltert (Wehmer 2006, 71). So verwundert das Fehlen einer größeren Anzahl von Fundstellen auf den Hochfl ächen kaum, sind diese doch vielfach bewaldet und daher – mit Ausnahme von Grabhügeln – archäologischen Feldmaßnahmen we-nig zugänglich. Dass allerdings nicht alle Fundlücken mit den landschaftlichen Gegebenheiten erklärt wer-den können, zeigt der Bereich zwischen dem Alten Gleisberg, Taupadel und Nausnitz. Obwohl dort grö-ßere agrarwirtschaftliche Nutzfl ächen vorhanden sind, fehlen Fundstellen. Da aus diesen Bereichen bislang auch keine Fundpunkte des Früh- und Hochmittelalters bekannt sind (vgl. Wehmer 2006, Karte 55–56) und die Flächen zumindest in den vergangenen Jahren nach derzeitigem Kenntnisstand kaum begangen wurden8, ist die Vermutung naheliegend, dass es sich um eine forschungsbedingte Fundlücke handeln könnte.
Bei der Beurteilung der Verbreitungsbilder ist fer-ner zu bedenken, dass die Datierung der meisten Fund-stellen auf den noch ungeprüften Angaben in den Ortsakten beruht. Darüber hinaus besteht für verschie-dene Zeitabschnitte das Problem der Datierbarkeit des Fund materials, ein Problem, das insbesondere die Hall-stattzeit betrifft. Die Tatsache, dass von den meisten Fundstellen lediglich Lesefundkomplexe vorliegen und damit eine nähere Datierung mit der wünschenswer-ten Zuverlässigkeit oftmals nicht möglich ist, trägt zu dieser Problematik bei. Aus diesen Gründen sind so-wohl die räumliche als auch die quantitative Zuweisung von Fundstellen unterschiedlicher Zeitstellung nur als Anhaltspunkt zur Formulierung von ersten Arbeits hypo-thesen zu verstehen. Dass diese zwingend einer schritt-weisen Überprüfung bedürfen, ist selbstverständlich.
Peter Ettel, Lars Kleinsteuber, Florian Schneider, Christian Tannhäuser
Datierunggrob
Datierunggenauer
AnzahlFundstellen
Römische Kaiserzeit Ältere und Jüngere Römische Kaiserzeit
15
Eisenzeit Latènezeit 23
Hallstattzeit 45
Allgemein 9
Bronzezeit Spätbronzezeit 28
Frühbronzezeit 4
Allgemein 11
Neolithikum End- und Spätneolithikum
6
Alt- und Mittelneolithikum
11
Allgemein 69
Tab. 1 Anzahl an Fundstellen pro angegebener Zeitstufe. Die Summe der Fundstellen entspricht nicht der Anzahl der datierten Fundstellen, da von mehreren Fundstellen Funde unterschied-licher Zeitstellung vorliegen.
7 Eine ausführliche Darstellung des aktuellen Forschungs stan-des ist in Vorbereitung.
8 Freundl. Mitteilung der ehrenamtlichen Bodendenkmalpfl eger W. Voigt, Prof. Dr. M. Köhler und J. Petermann am 16.05.2012
Peter Ettel u. a. | Geoarchäologisches Praktikum der FSU Jena 2010 und 2011 auf dem Alten Gleisberg
103
Abb. 5 Verbreitung der vor- und frühgeschichtlichen Fundstellen (Neolithikum, Bronzezeit und Eisenzeit) im Umfeld des Alten Gleisbergs; Kreis: Grenzen des Arbeitsgebietes
Abb. 6 Verbreitung der Fundstellen der Römischen Kaiserzeit im Umfeld des Alten Gleisbergs; Kreis: Grenzen des Arbeitsgebietes
104
Neue Ausgrabungen und Funde in Thüringen | 7 / 2012-13 | 97–107
Geophysik am Alten Gleisberg
Kampagne 2010
Im Rahmen der seit 2005 jährlich stattfi ndenden inter-universitären Kooperation der Fachgebiete Archäologie, Geologie, Geophysik und Geographie wurde 2010 eine Fläche von 3,25 x 4,25 m mit geophysikalischen Methoden vermessen. Auf der späteren Grabungsfl äche wurden geomagnetische Messungen (Totalintensität) und eine elektromagnetische Erkundung (Leitfähigkeit) mit einem Messpunktabstand von 0,25 m x 0,25 m vor-genommen. Im Anomaliefeld der Totalintensität zeigt sich eine von Norden nach Süden gestreckte Struktur mit niedriger Totalintensität (Abb. 7). In der Leit fähig-keitsmessung konnte diese Struktur nicht nachgewie-sen werden. Spätere Grabungen auf der Messfl äche er-gaben an der Stelle der Anomalie eine Rinnen struktur mit Pfostenlöchern, die als früherer Pali sa denzaun in-terpretiert werden kann. Allerdings konnte die Struktur bei den geophysikalischen Messun gen 2011 auf einer angrenzenden Messfl äche nicht weiter verfolgt werden.
Nachtrag zur Kampagne 2009
Während der Kampagne 2009 wurde ein 70 m langer und 2,5 m breiter Schnitt senkrecht zu der rezenten Terrassierung angelegt (Ettel u. a. 2011). Ent lang des späteren Grabungsprofi ls zeigten geomagnetische Mes-sungen (Totalintensität) und eine elektromag netische Erkundung (Leitfähigkeit) mit einem Mess punkt abstand von 0,5 x 0,5 m ein fein strukturiertes Anomaliefeld (Ettel u. a. 2011).
Im Rahmen der Diplomarbeit „Geophysikalische Un-ter such ungen zur Unterstützung von archäologischen Ar bei ten am Alten Gleisberg“ (Petruck 2012) wur de das dreidimensionale Modell eines Ausschnittes der Gra-bung 2009 aufgrund der vorliegenden Daten erstellt. In Abb. 8 ist der Ausschnitt der Grabung 2009 mit dem dazugehörigen Anomaliefeld dargestellt. Es sind ein-deutige Zusammenhänge zwischen Befunden und Ano-malien, z. B. zwischen Befund 309 und dem Bereich mit niedriger Totalintensität zwischen Profi lmeter 22 und 23, sichtbar.
Das 3D-Modell wurde mit dem Programm IGMAS+ erstellt (Schmidt/Götze 2012). IGMAS+ steht für Inter-active Geophysical Modelling ASsistant. Das Pro gramm wird zur Interpretation von Potentialfeldern (Mag net- oder Schwerefeld) und für die Modellierung einer Unter-grundsituation genutzt. Die Zuordnung physika lischer Materialparameter (Dichte, Suszepti bili tät), Kalku lation der gravimetrischen oder magnetischen „Antwort“ sowie eine interaktive Änderung und Veran schaulichung des
Modells durch ein „real-time update“ für das berechnete Feld sind möglich (Schmidt u. a. 2010).
Der geophysikalische Parameter, die Suszeptibilität, wurde im Rahmen der natürlichen Variation von T. Schü-ler (2011) für die drei Bodenschichten und den an-stehenden Kalkstein übernommen (Tab. 2). Das An fangs -modell besteht aus vier Schichten, und die Geo me trie ist aus Abb. 1 entnommen. Durch die Einfüh rung von mehreren Körpern sowie durch kleine Änderungen der Geometrie des Ausgangsmodells wurde die von dem Pro gramm IGMAS+ berechnete Magnetfeldkurve der gemessenen angepasst (Petruck 2012). Das resultie-rende 3D-Modell ist in Abb. 9 dargestellt.
Körper 1 entspricht in Lage und Form Befund 310. Körper 2 liegt im Bereich von Befund 309 und hat die höchste negative Suszeptibilität. Die Körper 3, 4 und 5 unterscheiden sich in der magnetischen Eigen-schaft um jeweils 0,01 voneinander. Diese kann als Lese steinkomplex interpretiert werden, in dem keine homo gene Suszeptibilitätsverteilung vorherrscht. Der Körper 6, welcher das Modellierungsgebiet am südsüd-west lichen Rand schneidet, kann, von der Lage ausge-hend, als Befund 326 gedeutet werden. Körper 7 hat die höchste Suszeptibilität und spiegelt Befund 327 wider. Körper 8 wurde in einer Lage modelliert, in der keine archäologischen Befunde oder Funde vorliegen. Hier kann es sich um eine Suszeptibilitätsveränderung der Schicht 2 handeln, die nicht im direkten Zusammenhang mit einer vorgeschichtlichen Besiedlung steht. In der Modellierung konnte für Befund 328 kein Körper ange-legt werden, da wahrscheinlich kein oder nur ein sehr geringer Suszeptibilitätskontrast zu den umgebenden Schichten 2 und 3 existiert. Die Mächtigkeiten der ein-zelnen Schichten wurde weitestgehend nicht verändert. Insgesamt stimmt das Modell mit der Realität gut über-ein (Petruck 2012).
Geomagnetische 3D-Modellierungen zur Vorberei-tung von archäologischen Arbeiten sollten einerseits für weitere magnetische Anomalien auf dem Alten Gleisberg vorgenommen werden. Andererseits sollte auch die großräumigere Umgebung des Inselberges mit einbezogen werden, um ein dreidimensionales Gesamt-bild des Untergrundes zu erhalten. Für zukünftige Magnetometer-Prospektionen auf dem Alten Gleisberg ist aufgrund der vorherrschenden klein räu migen Geo-metrien der Befunde ein kleinerer Mess punkt abstand zu empfehlen, um eventuelle Alias-Effekte und damit verbundene Fehlinterpretationen zu verhindern.
Anna Petruck, Thomas Jahr, Stefanie Zeumann
Peter Ettel u. a. | Geoarchäologisches Praktikum der FSU Jena 2010 und 2011 auf dem Alten Gleisberg
105
Körper Farbe Suszeptibilität Körper Farbe Suszeptibilität
Schicht 1 0,0033 Körper 3 0,012
Schicht 2 0,0044 Körper 4 0,013
Schicht 3 0,0068 Körper 5 0,014
Schicht 4 0,0001 Körper 6 -0,05
Körper 1 0,01 Körper 7 0,04
Körper 2 -0,12 Körper 8 0,01
Tab. 2 Parameter des Modells des Ausschnittes der Grabung 2009
Abb. 7 Magnetische Anomalie-Karte mit Nord-Süd gestreckter Struktur mit niedriger Totalintensität, die auf die später ausgegra-bene Rinnenstruktur hindeutet.
Abb. 8 Ausschnitt Profi l Grabung 2009 auf der Nordterrasse des Alten Gleisbergs (nach Ettel u. a. 2011) und Magnetogramm des Anomaliefeldes für die Modellierung für diesen Ausschnitt
106
Neue Ausgrabungen und Funde in Thüringen | 7 / 2012-13 | 97–107
Erste Ergebnisse zu den sedimentologischen Untersuchungen in den Mittelmühlenwiesen nahe Bürgel
Abb. 9 3D-Modell des Ausschnittes der Grabung 2009 (Petruck 2012)
Im Rahmen der interdisziplinären Untersuchungen auf dem Alten Gleisberg bei Graitschen wurden zum Ver-ständnis des Einfl usses der Landnutzungsgeschichte fort führende sedimentologische und palynologische For schun gen im Umfeld der Höhensiedlung durchge-führt. Dazu erfolgte in den Jahren 2011 sowie im Frühjahr 2012 die Aufnahme sedimentologischer Profi le in Form eines Transekts in den Mittelmühlenwiesen nahe Bürgel, das der Erfassung der Sedimentzusammensetzung, aber auch der Sedimentverbreitung innerhalb des Talab-schnit tes dient (Abb. 10). Die Untersuchungen erlauben Rück schlüsse auf Klimaveränderungen, aber auch auf anthro pogene Einfl üsse, schließlich aus den Abfolgen und deren palynologischer Analyse die Rekonstruktion der Land schaftsgeschichte.
Dieser Bereich des Gleisetals zeichnet sich durch spe-zifi sche Bedingungen aus. Zum einen entspringt in den unteren Bereichen des Westhangs eine stark karbonati-sche Quelle, die in bestimmten Klimaperioden Kalksinter sedimentiert; zum anderen führt die Gleise, die aus dem Buntsandstein stammt, karbonatfreie Hochfl utsedimente mit sich. Beide Sedimentarten vermischen sich im Bereich der Mittelmühlenwiesen zusätzlich mit torfi gen Abla ge-rungen. Die entnommenen Profi le zeigen eine maximale Länge von ca. 380 cm. Zudem weisen sie, entsprechend der Entfernung vom Liefergebiet (Quelle oder Gleise), ei-nen unterschiedlichen Anteil kalkhaltiger bzw. kalkfreier Sedimente auf (Abb. 11).
Die entnommenen Proben wurden im Labor des Insti tuts für Geographie in dem üblichen Verfahren mit Hilfe von Salzsäure, Kaliumhydroxid, Flusssäue und mit Acetolyseverfahren (Moore u. a. 1991) chemisch auf-bereitet, in verschiedenen Siebungsschritten kon zen-triert und anschließend zur Aufbewahrung in Sili konöl überführt. Aus diesen Probenrückständen wur den Prä-parate hergestellt, die mit einem Durchlicht mi kros kop (Axiostar der Firma Zeiss) und einer 400-fachen Ver-grö ßerung palynologisch ausgewertet werden. Die bis herigen Ana lysen zeigen, dass die torfi gen unteren
Abb. 10 Bohrtransekt in den Mittelmühlenwiesen nahe Bürgel
Peter Ettel u. a. | Geoarchäologisches Praktikum der FSU Jena 2010 und 2011 auf dem Alten Gleisberg
107
Abb. 11 Darstellung des Transekts der Sedimentprofi le im Bereich der Mittelmühlenwiesen
Bereiche paly nologisch dem Präboreal zuzuordnen sind, während die Sedimente des jüngeren Holozäns ab etwa 150 cm und darüber abgelagert wurden. Weiter-
Literaturverzeichnis
Donat, P. 1966: Probegrabung auf dem Burgwall Öch-sen bei Vacha, Kr. Bad Salzungen. In: Ausgr. u. Funde 11, 249–253. Berlin.
Ettel , P. u. a. 2011: Geoarchäologisches Praktikum der FSU Jena 2009 auf dem Alten Gleisberg, Saale-Holzland-Kreis. In: Neue Ausgr. u. Funde Thüringen 6, 75–90. Langenweißbach.
Jankuhn, H. 1977: Einführung in die Siedlungsarchä o-logie. Berlin u. a.
Jebramcik, K. 2010: Die Siedlungskammer des Alten Gleis bergs in der Vorgeschichte (unveröff. Magister-arbeit Friedrich-Schiller-Universität Jena).
Moore, P. D. u. a. 1991: Pollen Analysis. Oxford. Peschel , K. 1963: Ein Grabhügel mit Schnurkeramik von
Dorn burg, Landkreis Jena. In: Prähist. Zeit schr. 41, 1963, 83–133.
– 1992: Zum Beginn der mittleren Latènezeit an der Thüringischen Saale. Neufunde von Beutnitz, Kreis Jena. In: Beiträge zur keltisch-germanischen Besied-lung im Mittelgebirgsraum. Internationales Kollo-quium, 15.–17. Mai 1990 in Weimar (Weimarer Monogr. Ur- u. Frühgesch. 28). 129–139. Stuttgart.
Petruck, A. 2012: Geophysikalische Untersuchungen zur Unterstützung archäologischer Arbeiten am
Alten Gleisberg (unveröff. Diplomarbeit Friedrich-Schiller-Universität Jena).
Simon, K. 1962: Die vor- und frühgeschichtliche Be sied-lung des Alten Gleisberges bei Bürgel, Kr. Eisenberg (unveröff. Diplomarbeit Friedrich-Schiller-Universität Jena).
– 1984: Höhensiedlungen der Urnenfelder- und Hall-stattzeit in Thüringen. In: Alt Thüringen 20, 23–80. Weimar.
Schmidt, S./Götze, H.-J./Fichler, C./Alvers, M. 2010: IGMAS+ a new 3D Gravity, FTG and Magnetic Modeling Software. In: A. Zipf/K. Behncke/F. Hil-len/J. Schefermeyer (eds.), Die Welt im Netz (Geo-in formatik 2010, Kiel, 17.3.–19.3.2010). 57–63. Osnabrück.
Schüler, T. 2011: Topografi e und Magnetfeld-Gradien-ten-Kartierung am Alten Gleisberg bei Graitschen, Saale-Holzland-Kreis. In: Neue Ausgr. u. Funde Thürin gen 6, 91–95. Langenweißbach.
Wehmer, M. 2006: Bronzezeitliche Höhensiedlungen und ihr Umfeld in Mitteldeutschland (unveröff. Magis terarbeit Friedrich-Schiller Universität Jena).
führende palynologische Untersuchungen sollen Auf-schluss über die Landschaftsentwicklung sowie die ge-nauere zeitliche Stellung der Sedimente geben.
Heike Schneider
120 40 60 80 100 140 0 20 Distanz in m
Wechsellagerungen Torf- und Schluffmudden Torfe Sinter sandige Tone und Schluffe Sande
400
300
200
100
0 Ti
efe
in c
m
SONW
5/124/123/122/12 1/111/12