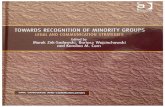Compositional analysis of Byzantine ceramics from Serres and Thessaloniki (1997)
Im Angesichte Roms. Überlegungen zu kaiserzeitlichen männlichen Porträts aus Athen, Thessaloniki...
Transcript of Im Angesichte Roms. Überlegungen zu kaiserzeitlichen männlichen Porträts aus Athen, Thessaloniki...
Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία
στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας
Επιμέλεια
Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου
Παυλίνα Καραναστάση
Δημήτρης Δαμάσκος
UNIVERSITY STUDIO PRESS
UNIVERSITY STUDIO PRESSEκδόσεις Eπιστημονικών Bιβλίων και Περιοδικών
ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗ 2012
Κλασική παράδοση
και νεωτερικά στοιχεία
στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας
Πρακτικά Διεθνούς ΣυνεδρίουΘεσσαλονίκη, 7-9 Μαΐου 2009
Επιμέλεια
Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου
Παυλίνα Καραναστάση
Δημήτρης Δαμάσκος
ΑΝΑΤΥΠΟ
Επιμέλεια κειμένων
Διαλεχτή Καψάλα
Επιμέλεια υποσημειώσεων και γερμανικών κειμένων
Dr. Diana Breitfeld von Eickstedt και Dr. Klaus-Valtin von Eickstedt
Επιμέλεια ιταλικών κειμένων
Dr. Valentina di Napoli
Επιμέλεια αγγλικών περιλήψεων
Valerie Nunn
DTP
χρήστος Τζιώκος
Φωτογραφία εξωφύλλου
Ανδριάντας του Αυγούστου. Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο
(Φωτ.: Αρχείο Γλυπτών Μουσείου Εκμαγείων ΑΠΘ. Μ. Σκιαδαρέσης)
Φωτογραφία οπισθοφύλλου
Αγαλμάτιο Κυβέλης. Αθήνα, Γ΄ ΕΠΚΑ
(Φωτ.: Αρχείο Γ΄ ΕΠΚΑ. Γ. Μαραβέλιας)
O τόμος τυπώθηκε σε χαρτί velvet 115 γρ. τον Μάρτιο του 2012
© UNIVERSITY STUDIO PRESS A.E.Aρμενοπούλου 32, 546 35 ΘεσσαλOνIκη
Tηλ. 2310 208731, 209637, 209837 Fax 2310 216647
e-mail: [email protected]
Hλεκτρονικό βιβλιοπωλείο: www.universitystudiopress.gr
σTOA TOY BIBλIOY – Πεσμαζόγλου 5, 105 64 AΘHNA – Tηλ. & Fax 210 3211097
UNIVERSITY STUDIO PRESSEκδόσεις Eπιστημονικών Bιβλίων & Περιοδικών
Πρώτη έκδοση: Θεσσαλονίκη 2012 ISBN 978-960-12-2084-0
H μερική ή ολική ανατύπωση είτε η καθ' οιονδήποτε τρόπον αναπαραγωγή του
βιβλίου, καθώς και η φωτοτύπηση τμήματος ή ολόκληρου του βιβλίου, χωρίς την
έγγραφη άδεια του εκδότη και των συγγραφέων, τιμωρείται από το νόμο.
Πρόλογος .............................................................................................................................................. 9
Εισαγωγικό σημείωμα της Θεοδοσίας Στεφανίδου-Τιβερίου
Η έρευνα της πλαστικής των ρωμαϊκών χρόνων στην Ελλάδα ......................................................... 11
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Γεώργιος Ι. Δεσπίνης
Ακρόλιθα αγάλματα των ρωμαϊκών χρόνων ...................................................................................... 19
Guntram Koch
Οι αττικές σαρκοφάγοι και η σημασία τους για την τέχνη της αυτοκρατορικής εποχής ............... 35
Roland R. R. Smith
The second lives of classical monuments in late antique Aphrodisias ................................................... 57
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ισμήνη Τριάντη
Κεφαλή νέου στον τύπο του Αθλητή Petworth από το οικόπεδο Μακρυγιάννη στην Αθήνα ........... 77
Olga Palagia
The peplos figure Athens National Museum 3890: Roman copy of a classical Μedea? ....................... 89
Στυλιανός Ε. Κατάκης
Αγαλμάτια Δήμητρας και Κυβέλης των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων από την Aθήνα ...................... 99
Άλκηστις Χωρέμη-Σπετσιέρη
Πορτρέτα της ύστερης αρχαιότητας από την Αθήνα ..................................................................... 115
Χριστίνα Παπασταμάτη-von Moock
Θέατρο του Διονύσου Ελευθερέως. Tα γλυπτά της ρωμαϊκής σκηνής:
χρονολογικά, καλλιτεχνικά και ερμηνευτικά ζητήματα .................................................................. 129
Derk W. von Moock
Η αναβίωση της παραγωγής των αττικών επιτυμβίων στηλών κατά τον 1ο αι. π.Χ. ................... 151
Άννα-Βασιλική Καραπαναγιώτου
Ανδρική εικονιστική κεφαλή από τη Μεσσήνη.
Πορτρέτο και κοινωνία στην Πελοπόννησο του ύστερου 1ου αι. π.Χ. ........................................... 163
Πέτρος Θέμελης
Έργα επωνύμων γλυπτών και εργαστήριο γλυπτικής πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων
στη Μεσσήνη .................................................................................................................................... 177
5
Περιεχόμενα
Ναταλία Καζακίδη
Ένα οικογενειακό σύνταγμα ανδριάντων της εποχής του Κλαυδίου και το γυμνάσιο στη Σικυώνα .......................................................................................................... 193
Hans Rupprecht Goette
Klassisches Original oder klassizistische τradition in der Kaiserzeit? Zum Relief Αthen, Νationalmuseum Inv. 226 aus Mantineia ............................................................. 213
Σταύρος Βλίζος
Εικονογραφικά παράδοξα και ερμηνευτικά ζητήματα: επιτύμβιο άγαλμα νέου από τη Λακωνία ........................................................................................ 225
Margherita Bonanno Aravantinos
La scultura di età romana nella Beozia: importazioni e produzioni locali .......................................... 233
Ιφιγένεια Λεβέντη
Eπιτύμβια ανάγλυφα από τη Θεσσαλία. Παρατηρήσεις στη γλυπτική της κεντρικής Eλλάδας στα χρόνια της ρωμαιοκρατίας ................. 251
Εμμανουήλ Βουτυράς
Όρθιος Σάραπις από τη Θεσσαλονίκη ............................................................................................ 265
Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου
τα λατρευτικά αγάλματα του ναού του Διός και της ρώμης στη Θεσσαλονίκη ............................ 273
Μπάρμπαρα Σμιτ-Δούνα
Γυναικεία κεφαλή από το ανατολικό τείχος της Θεσσαλονίκης ..................................................... 287
Ελένη Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου
Άγαλμα Διονύσου των αυτοκρατορικών χρόνων από τη Θεσσαλονίκη .......................................... 297
Κατερίνα Τζαναβάρη
Μαρμάρινο πορτρέτο του Βεσπασιανού από τη Βέροια ................................................................. 307
Εμμανουέλα Γούναρη
Αγάλματα ιματιοφόρων ανδρών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.Ο «κανονικός τύπος» στη Μακεδονία κατά την αυτοκρατορική περίοδο ...................................... 325
Πολυξένη Αδάμ-Βελένη
Εικονιστική γυναικεία κεφαλή από την Αγορά των αυτοκρατορικών χρόνων της Θεσσαλονίκης ............................................................................................................................ 337
Δημήτρης Δαμάσκος
Αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά γλυπτά στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας .................... 347
Βικτώρια Αλλαμανή-Σουρή
τα ανάγλυφα επιτύμβια μνημεία της Βέροιας από τον 1ο αι. π.Χ. έως τον 3ο αι. μ.Χ. Παράδοση και νεωτερισμοί ............................................................................................................. 357
Χρυσούλα Ιωακειμίδου
Ναόσχημο ταφικό μνημείο από την κοινότητα του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγγίστας Σερρών ............................................................................. 373
Ελένη Παπαγιάννη
ταφικά ανάγλυφα ρωμαίων στρατιωτών στη Μακεδονία .............................................................. 385
ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑρΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΝΕΩτΕρΙΚΑ ΣτΟΙΧΕΙΑ ΣτΗΝ ΠΛΑΣτΙΚΗ τΗΣ ρΩΜΑϊΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
6
Vassiliki Gaggadis-Robin
Sculptures romaines de Bouthrôte ...................................................................................................... 399
Bernard Holtzmann
Les médaillons funéraires de Thasos .................................................................................................. 409
François Queyrel
Modes de représentation des Julio-Claudiens dans les Cyclades. τraditions régionales et reprises de schémas iconographiques ............................................................ 417
Παυλίνα Καραναστάση
H πλαστική της Κρήτης στην αυτοκρατορική περίοδο .................................................................. 433
Katja Sporn
Römische Grabreliefs auf Kreta. Alte Traditionen und neue Wege ...................................................... 451
Katia Mannino
Bronzi antichi dall’Adriatico: una statua di Polydeukion da Punta del Serrone (Brindisi) ................... 467
Elisa Chiara Portale
Una “nuova” Livia da Leptis Magna. Osservazioni sul contributo delle botteghe attichenell’elaborazione e diffusione dell’immaginario imperiale .................................................................. 477
Thoralf Schröder
Im Angesichte Roms. Überlegungen zu kaiserzeitlichen männlichen Porträts aus Αthen,Thessaloniki und Korinth .................................................................................................................. 497
Ειρήνη Χιώτη
Επιδράσεις του έκτου εικονιστικού τύπου της Φαυστίνας της νεότερης στα ιδιωτικά πορτρέτα του ελλαδικού χώρου ................................................................................. 513
Marco Galli
Antinoos heros e gli eroi della Seconda Sofistica ................................................................................ 523
ΠΕρΙΕΧΟΜΕΝΑ
7
Αbstract
This paper focuses on the different options for self-fashioning in athens, Thessaloniki and corinth du-ring the Imperial period based on an analysis of maleportrait heads. Through a comprehensive examina-tion of these portraits one can recognize a wide di-versity of workmanship. In athens, for example, the-re are specific technical characteristics, such as chi-sel-marks on the marble-surface or signature drillingsof the eyes. furthermore different iconographicfeatures can be identified. In the first century ad theso-called Period face (Zeitgesicht) was the conven-tional form of representation throughout Greece. Butfrom about ad 130 to 240 distinctive references toolder Greek archetypes can be observed, in varyingdegrees, in portraiture in athens. By contrast in theprovincial capitals Thessaloniki and corinth this sortof retrospection was virtually unknown. So in con-clusion, it can be asserted that no standardized“Greek” iconography was developed for male por-traits in the first three centuries ad.
einleitung
fragen nach dem charakter der bürgerlichen Selbst-darstellung in den griechischen Provinzen achaia undMakedonia während der römischen Kaiserzeit kannman auf der Grundlage unterschiedlicher Quellen stel-len. dazu ließen sich beispielsweise literarische,epigraphische oder bildliche Zeugnisse heranziehen.Im rahmen dieses Beitrags möchte ich auf Stilisie-rungsformen der städtischen eliten eingehen und da-bei vor allem das jeweilige Verhältnis von zeitge-nössischen Modeerscheinungen zu Bezügen auf äl-tere griechische Vorbilder untersuchen. Zu diesem
Zweck sollen die männlichen Privatporträts des 1.bis 3. Jhs. n. chr. aus drei der wichtigsten Städte Grie-chenlands analysiert werden. als bekanntestes Zen-trum für die herstellung von Skulpturen in römischerZeit1 und als domicilium studiorum2 bildet athen denausgangspunkt für die vorliegenden Überlegungen.Thessaloniki und Korinth bieten sich als Provinz-hauptstädte zum Vergleich an. Sie unterscheiden sichin einem Punkt voneinander, der für die Betrachtungder jeweiligen bürgerlichen Selbstdarstellung andieser Stelle von Interesse sein könnte. Während Thes-saloniki eine in hellenistischer Zeit gegründete Po-lis war, wurde Korinth 44 v. chr. von Iulius caesarals römische Bürgerkolonie neu angelegt3.Gab es nun innerhalb des “alten Griechenlands” eineKoine in Bezug auf die Selbstdarstellung der elitenoder lassen sich für deren Porträts lokale Spezifikaeruieren? In diesem Zusammenhang gilt es auch zuuntersuchen, in welchem Maße die Stilisierungen vonden Modeerscheinungen in der hauptstadt rom be-einflusst wurden.
* Ich danke Theodosia Stefanidou-Tiveriou sehr für die einladung,an diesem Kongress teilzunehmen. für die freundliche Unter-stützung bei der herstellung von fotos und der Genehmigung zuderen reproduktion bedanke ich mich bei den Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern der 3. ephorie in athen und der 37. ephorie inKorinth. für anmerkungen zum vorliegenden Text danke ich Ma-rianne Bergmann, Benjamin Bernat, dimitris damaskos, Birte Geiß-ler und Pavlina Karanastassi.
1. Vgl. dazu G. Kokkorou-alevra, Δραστηριότητες των ατ τικώνεργαστηρίων γλυπτικής κατά την εποχή της ρωμαιοκρατίας,in: Α. alexandri – Ι. leventi (hrsg.), Καλλίστευμα. Μελέτεςπρος τιμήν της Ο. Τζάχου-Αλεξανδρή (athen 2001) 319-348und K. fittschen, Über den Beitrag der Bildhauer in athen zurKunstproduktion im römischen reich, in: S. Vlizos (hrsg.), ΗΑθήνα κατά τη ρωμαϊκή εποχή: πρόσφατες ανακαλύψεις, νέεςέρευνες, Mouseio Benaki Suppl. 4 (athen 2008) 325-336.
2. cic. de orat. 3, 43.
3. Vgl. zu diesen fragen r. haensch, Capita provinciarum. Statt-haltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit(Mainz 1997) 104-112 (Makedonia), 322-328 (achaia).
497
Thoralf Schröder
Im angesichte romsÜberlegungen zu kaiserzeitlichen männlichen Porträts aus athen,
Thessaloniki und Korinth
herstellungszentren für Skulpturen im römischenGriechenland: das Beispiel athen
Um mittels der Porträts aussagen über die Selbst-darstellung der Bürger in verschiedenen Gegendendes römischen Griechenland treffen zu können, müs-sen diejenigen mit sicherem fundkontext das fun-dament bilden. ausgehend von diesen können dannanhand der erarbeiteten stilistischen und hand-werklichen charakteristika weitere Bildnisse mitnicht gesicherter Provenienz angeschlossen werden.So ist es möglich, einzelne herstellungszentren zu un-terscheiden. die Zuweisung eines Porträts ohnefundzusammenhang an eine bestimmte Werkstattsagt jedoch a priori noch nichts über den entspre-chenden auftraggeber und die aufstellung des Bild-nisses aus, wie weiter unten am Beispiel Korinthsdeutlich werden wird.
für athen kann man auf eine Materialgrund-lage von über 250 Porträts4 mit gesichertem fund-kontext5 zurückgreifen, während sich aus Thessa-loniki und Korinth deutlich weniger Bildnisse er-halten haben. Man kann für die attischen Porträtsverschiedene Spezifika herausarbeiten, von denen inder bisherigen forschung schon vereinzelt Merkmaleangesprochen6, jedoch nie anhand des gesamten Ma-terials diskutiert wurden. die im folgenden sum-marisch angesprochenen charakteristika7 sind je-weils einzelelemente. In der regel weisen die ein-zelnen Porträts mehrere von ihnen, aber nicht allegemeinsam auf8.
Haarbohrung und -strukturierung
anhand der an stadtrömischen Kaiserbildnissen er-arbeiteten typologischen und stilistischen entwick-lung kann man für das 2. Jh. zeigen, dass ab etwa140 das haar der Porträts durch fein gearbeiteteBohrkanäle untergliedert wurde, um so einen hell-dunkel-effekt zu erzielen9. ein Überblick über diein athen hergestellten Porträts der Kaiser antoninusPius, lucius Verus und Marc aurel lässt dagegen eineandere Gestaltungsweise erkennen. der Bohrer istspärlich bis gar nicht und wenn, dann fast aus-schließlich am Vorderkopf eingesetzt worden10.Besonders eindrucksvolle Beispiele dafür sind die zu-sammen gefundenen Büsten des Marc aurel, luci-us Verus und herodes atticus aus Brexiza11. Sie ge-hören zu den hochwertigsten Bildnissen, die in dermittleren Kaiserzeit in athen hergestellt wordensind12. Gerade diese Porträts sind nun im haar aus-schließlich mit dem Meißel und ohne die Benutzung
4. das umfangreiche Material ist noch nicht vollständig erschlossenworden, vgl. als Überblick e. B. harrison, Portrait Sculpture, ago-ra 1 (Princeton 1953); datsouli-Stavridi 1985; G. S. dontas, lesportraits attiques au Musée de l’acropole, cSIr Griechenland I 1(athènes 2004).
5. Nicht alle in athen aufbewahrten Porträts dürfen für die Be-stimmung lokaler handwerklicher Besonderheiten herangezogenwerden, da lange Zeit funde aus ganz Griechenland in die haupt-stadt gebracht wurden. Vgl. beispielsweise folgende Bildnisse, dieverbürgt nicht aus attika stammen: athen, Nat. Mus. Inv. 355 (Kre-ta): a. datsouli-Stavridi, συμβολή στην εικονογραφία της αυ -τοκράτειρας λιβίας Δρουσίλλας στον ελληνικό χώρο, in: N. Za-pheiropoulos u. a. (hrsg.), ΣΤΗΛΗ. Τόμος εις μνήμην Νικο λάουΚοντολέοντος (athen 1980) 301 Taf. 137; athen, Nat. Mus. Inv.417 (Patras): Kaltsas 2002, 340 f. Nr. 723 mit abb.; athen, Nat.Mus. Inv. 420 (Phleious, Peloponnes): Kaltsas 2002, 340 Nr. 721mit abb.; athen, Nat. Mus. Inv. 448 (Smyrna): J. Inan – e. al-földi-rosenbaum, römische und frühbyzantinische Porträtplastikaus der Türkei. Neue funde (Mainz 1979) 302 f. Nr. 284; athen,Nat. Mus. Inv. 459 (Melos): Kaltsas 2002, 372 Nr. 796; athen,Nat. Mus. Inv. 582 (epidauros): Kaltsas 2002, 371 Nr. 792; athen,Nat. Mus. Inv. 689 (Kriekuki, bei Mantineia): fittschen 1999, 80Nr. 1 Taf. 130 a-d.
6. Vgl. jüngst vor allem Goette 2003, 549-557; Goette 2008, 189-196.
7. ausführlich werden die athenischen Besonderheiten in meinerin arbeit befindlichen dissertation besprochen.
8. das bedeutet gleichzeitig natürlich auch, dass einzelne bei at-tischen Porträts auftretende stilistische und handwerkliche ele-mente auch bei Bildnissen aus anderen regionen des römischenreiches vorkommen können.
9. Goette 2003, 552 f. das Phänomen ist an den gut zu datieren -den stadtrömischen Kaiser- und Prinzenbildnissen nachvollziehbar,wie ein Blick in den umfassenden Katalog von fittschen – Zan-ker 1994 lehrt. auch bei den stadtrömischen Privatporträts sindsolche ausarbeitungen festzustellen. Vgl. etwa für die höchste qua-litative ausarbeitungsstufe folgendes Porträt: München, Glypt o- thek Inv. 340: fittschen 1999, 95 Nr. 113 Taf. 181.
10. So bereits erkannt und formuliert u. a. von Goette 2003. e.Voutiras, Beobachtungen zu einem athenischen Kosmetenporträt,in: M. Şahin – I. h. Mert (hrsg.), festschrift für ramazan öz-gan (Istanbul 2005) 475; Goette 2008, 193. Vgl. als Beispiele einBildnis des Marc aurel im 3. Typus: athen, Nat. Mus. Inv. 572:datsouli-Stavridi 1985, 62 f. Taf. 74. Kaltsas 2002, 342 Nr. 725;und eines des lucius Verus im haupttypus: athen, Nat. Mus. Inv.350: datsouli-Stavridi 1985, 67 f. Taf. 83.
11. Paris, louvre Inv. Ma 1161 (Marc aurel); Ma 1164 (hero-des atticus); oxford, ashmolean Museum Inv. 1947.277 (luciusVerus). Vgl. zum ensemble K. fittschen, eine Werkstatt atti-scher Porträtbildhauer im 2. Jh. n. chr., in: chr. reusser (hrsg.),Griechenland in der Kaiserzeit. Kolloquium zum sechzigsten Ge-burtstag von Prof. dietrich Willers, Bern 12.-13. Juni 1998, haSBBeih. 4 (Bern 2001) 71-74 Nr. 2. 3, 13 Taf. 11, 3. 4; 13, 1; M.Galli, die lebenswelt eines Sophisten. Untersuchungen zu den Bau-ten und Stiftungen des herodes atticus (Mainz 2002) 194-197Taf. 27,1-3; h. r. Goette – Th. M. Weber, Marathon. Sied-lungskammer und Schlachtfeld (Mainz 2004) 106-108 abb. 127-129 (falsche Inv.-Nr. für den lucius Verus). Sie standen ursprünglichentweder in einem heiligtum für ägyptische Götter oder in einerThermenanlage und nicht in einem Grab, wie es e. d’ambra, Ko-smetai, The Second Sophistic, and Portraiture in the Second cen-tury, in: J. M. Barrington – J. M. hurwit (hrsg.), Periklean athensand its legacy: Problems and Perspectives (austin 2005) 216 anm.85 angibt.
12. P. Zanker, Provinzielle Kaiserporträts, abhMünchen N.f. 90(München 1983) 26 anm. 74 hält gerade diese Porträts für stadt-römische Importe.
ΚλΑσΙΚΗ ΠΑρΑΔΟσΗ ΚΑΙ ΝεωΤερΙΚΑ σΤΟΙχεΙΑ σΤΗΝ ΠλΑσΤΙΚΗ ΤΗσ ρωΜΑϊΚΗσ ελλΑΔΑσ
498
eines Bohrers bearbeitet worden13. auch die haar-oberfläche zeigt Spuren von Meißelschlägen14. diein jeweils größerer replikenzahl erhaltenen Por-trättypen des herodes atticus15 und seines ZöglingsPolydeukion16 haben alle keine Bohrungen imhaar.
häufiger wurden diese erst ab der commodei-schen Zeit von athenischen Werkstätten als Stilmit-tel eingesetzt. So zeigt zum Beispiel ein Bildnis descommodus im athener Nationalmuseum17 mit ita-lischen Porträts vergleichbare tiefe Bohrungen imBart, während ein anderes exemplar im akropolis-Museum18 kaum solche aufweist, soweit dies der er-haltungszustand erkennen lässt.
die Privatporträts bestätigen dieses Bild. Bis inspätantoninische Zeit wurde der Bohrer nur vereinzeltintensiv benutzt, während anschließend einige Por-träts durch sehr ausgeprägte Bohrungen auffal-len19. Wie bei den Kaiserbildnissen gibt es parallelauch nur mit dem Meißel bearbeitete Bildnisse20.
an diesen Beispielen wird das Nebeneinanderverschiedener handwerklicher ausarbeitungsmög-lichkeiten sehr deutlich. die jeweilige Intensität derBohrung kann demnach per se nicht als primäres In-diz für die datierung eines Porträts herangezogen wer-den21. außerdem ist sie nicht der mangelnden Qua-lität der objekte geschuldet, da gerade die hand-werklich besten Bildnisse, wie etwa der oben ange-sprochene Marc aurel im louvre, ohne Bohrer ge-arbeitet wurden.
Augenform
eine weitere Besonderheit der athenischen Werk-stätten besteht darin, dass die augen teilweise “man-delförmig” gestaltet wurden (abb. 1), was eigentlichtypisch für klassische griechische Skulpturen ist. eincharakteristisches Beispiel dafür bildet der dory-phoros des Polyklet22. die augen zeichnen sich durchihre stark gelängte ovale form aus. die relativ brei-ten ebenmäßig angelegten ober - und Unterlider bie-gen zudem nahezu rechtwinklig zum augapfel um.Genau diese darstellungsweise kann nun auch an ver-hältnismäßig vielen in athen hergestellten Bildnissennachgewiesen werden. exemplarisch zeigt dies ein an-toninisches Porträt im Nationalmuseum23. die läng-liche form der augen und die harmonisch gestalte-ten ober- und Unterlider mit der scharfgratigen ab-grenzung gegenüber dem augapfel sind unmittelbarvergleichbar.
auch in anderen Gebieten des römischen rei-
ches tritt diese art der augengestaltung vereinzelt auf.dann besteht allerdings in der regel ein Zusam-menhang mit bestimmten kulturellen Phänomenen,wie etwa bei den sog. augusteischen und hadriani-schen Klassizismen24. In athen dagegen ist diese Ge-staltungsweise während der gesamten mittleren Kai-serzeit zu finden25. die mandelförmige augendar-
13. Vgl. dazu und zu weiteren handwerklichen und stilistischenfragen auch f. c. albertson, a Bust of lucius Verus in the ashmo-lean Museum, oxford, and it’s artist, aJa 87, 1983, 153-163. Indiesem fall bestätigt sich ferner die aussage von M. Pfanner, Vomlaufenden Bohrer bis zum bohrlosen Stil. Überlegungen zur Bohr-technik in der antike, aa 1988, 672, dass die besten Bildhauerden Bohrer nicht einsetzten.
14. Bereits von M. Bergmann, Studien zum römischen Porträt des3. Jahrhunderts n. chr. (Bonn 1977) 82 als eine athenische eigenarterkannt.
15. dazu u. anm. 69.
16. Zuletzt zum Typus: Goette 2003.
17. athen, Nat. Mus. Inv. 337: datsouli-Stavridi 1985, 70 f. Taf.87. 88.
18. athen, akropolis Museum Inv. 2363: dontas a. o. (anm. 4)74 f. Nr. 59.
19. Vgl. etwa das Kosmetenbildnis athen, Nat. Mus. Inv. 415:datsouli-Stavridi 1985, 99 Taf. 147. 148; Kaltsas 2002, 331 Nr.694. Selten bleibt für attische Porträts der einsatz des Werkzeugsam hinterkopf. s. dazu jetzt die Bemerkungen von Goette 2008,192 f. zu zwei aus athen stammenden Porträts in Berlin.
20. Vgl. etwa athen, Nat. Mus. Inv. 2727: a. datsouli-Stavridi,Υστε ρω μαϊκά πορτραίτα 2ου-5ου μ.χ. αιώνα στο εθνικόΑρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, aephem 120, 1981, 129 f. Taf.46g.
21. So allgemein auch von Pfanner a. o. (anm. 13) 675 festge-stellt. für die attischen Porträts wurde die Bohrtechnik häufig alsdatierungskriterium genutzt. Vgl. etwa r. Bol, die Porträts desherodes atticus und seiner Tochter athenais, antK 41, 1998, 123,die drei Porträts des herodes atticus unter anderem aufgrund dernicht vorhandenen Bohrung zu einer frühen Gruppe zusammen-fasst. das muss verwundern, da sie bereits auf der darauffolgen-den Seite selbst anerkennt, dass “bei östlichen arbeiten der Boh-rer sehr viel seltener als bei stadtrömischen Schöpfungen und erstverhältnismäßig spät verwendet wird”.
22. Vgl. zu Polyklet mit reicher Bebilderung und weiterführenderliteratur c. Bol, Polyklet, in: P. c. Bol (hrsg.), die Geschichte derantiken Bildhauerkunst II. Klassische Plastik (Mainz 2004) 123-132.
23. athen, Nat. Mus. Inv. 369: a. datsouli-Stavridi, Πορτραίτατης εποχής των Αντωνίνων στο εθνικό Αρχαιολογικό ΜουσείοΑθηνών, aephem 121, 1982, 218 f. Taf. 52g. d; fittschen 1999,89 Nr. 72 Taf. 160c-d.
24. Zum augusteischen Klassizismus vgl. P. Zanker, augustus unddie Macht der Bilder 2(München 1990) 240-263; e. la rocca, deraugusteische Klassizismus, in: W.-d. heilmeyer (hrsg.), die grie-chische Klassik. Idee oder Wirklichkeit, eine ausstellung in Mar-tin-Gropius-Bau, Berlin 1. März – 2. Juni 2002 (Mainz 2002) 627-658. Zum hadrianischen Klassizismus s. als Überblick M. Papini,der hadrianische Klassizismus, in: heilmeyer ebenda 659-662.
25. Sie kann schon früher vereinzelt belegt werden, wie etwa dasflavische Privatporträt athen, Nat. Mus. Inv. 431: datsouli-Stav-ridi 1985, 39 Nr. 431 Taf. 34 beweist. ab traianischer Zeit trittdiese art der augenbildung dann vermehrt auf.
T. Schröder | IM aNGeSIchTe roMS
499
stellung verschwindet grosso modo um 240 aus demrepertoire der athenischen Bildhauer. Über dieGründe kann man an dieser Stelle zwar nur speku-lieren, ein plötzlich eintretendes handwerklichesUnvermögen kann jedoch kaum ursächlich gewesensein. dies äußert sich auch darin, dass die augen-bohrung, auf die im folgenden abschnitt einzugehensein wird, immer noch in der gleichen qualitätvollenWeise auftreten kann.
Augenbohrung
ab den Jahren zwischen 120 und 130 wurde bei Mar-morporträts im gesamten römischen reich die an-gabe von Iris und Pupille durch eintiefungen in denStein üblich26. diese sog. augenbohrung führten dieathenischen Werkstätten sofort nach der einführungin einer charakteristischen Weise aus27. ein antoni-nisches Porträt im Nationalmuseum28 zeigt die ty-pische Gestaltungsweise, für welche die kräftig undrund angegebene Irisumrandung kennzeichnend ist.Sie wird kombiniert mit einer sehr tief ausgearbeite-ten Pupille, die in der regel entweder halbkreis - oderbohnenförmig ausgeführt wurde29. festzustellen istferner eine häufig nahezu senkrechte Innenwan-dung, die sich von der normalerweise angewandten,meist flachen, konkaven einziehung unterscheidet, wiesie etwa ein stadtrömisches Bildnis des commodusim 3. Typus in den Kapitolinischen Museen30 zeigt.auch „innergriechische“ Unterschiede können hier
deutlich gemacht werden, da beispielsweise Bildnis-se aus Thessaloniki häufig eine sichelförmige und rechtflache ausarbeitung zeigen, die in athen nicht auf-tritt31. eine entwicklung in der Gestaltungsweise deraugenbohrung kann für das 2. und 3. Jh. nicht nach-gewiesen werden, es ist vielmehr als eine lokalspezi-fische stilistische Besonderheit zu definieren32.
Oberflächenbearbeitung
das sicherste erkennungsmerkmal für Bildnisse ausathen bilden auf dem Inkarnat belassene Zahnei-senspuren33. auf einer detailaufnahme eines spät-
26. Vgl. dazu zuletzt K. fittschen, Zum aufkommen der Mar-kierung von Iris und Pupille an römischen Porträts und zu ihrerVerwendbarkeit für datierungszwecke, aa 2006, 43-53.
27. Vgl. dazu auch Goette 2003, 193 f. mit ähnlichen Bemer-kungen.
28. athen, Nat. Mus. Inv. 1961: datsouli-Stavridi a. o. (anm. 23)220 f. Taf. 54a. b.
29. Wenige ausnahmen, wie das Kosmetenbildnis athen, Nat. Mus.Inv. 409: Kaltsas 2002, 332 Nr. 700, zeigen eine ganz runde Pu-pille. eine weitere Möglichkeit stellt die Verwendung von einge-setzten augen aus anderem Material dar. Vgl. etwa eine akro-lithstatue des antinoos aus der Villa bei luku: G. Spyropoulos,Η έπαυλη του Ηρώδη Αττικού στην εύα/λουκού Κυνουρίας(athen 2006) 130-132 Nr. 21 abb. 34 und ein mutmaßliches Bild-nis des commodus: athen, Nat. Mus. Inv. 488: G. despinis,Ακρόλιθα (athen 1975) 32 Nr. 15 Taf. 34. 35; Kaltsas 2002, 346Nr. 733. dieses Phänomen muss noch weiter untersucht werden,aber es scheint sich dabei um eine in Griechenland spezifisch fürkaiserliche Porträts (ausschließlich für akrolithe?) gebräuchlicheoption zu handeln.
30. rom, Kapitolinische Museen, Stanza degli Imperatori 60 Inv.454: fittschen – Zanker 1994, 81-83 Nr. 74 Taf. 86-88 Beil. 96.
31. Vgl. hier stellvertretend das hadrianische Bildnis Thessaloni-ki, arch. Mus. Inv. 6076: Κατάλογος II, 148 f. Nr. 263 (Th. Ste-fanidou-Tiveriou).
32. Gegen datierungen anhand einer entwicklung der Gestalt deraugenbohrung bereits fittschen 1999, 18 anm. 133. Wenn d. Wil-lers, hadrians panhellenisches Programm, antK Beih. 16 (Basel1990) 45 f. Taf. 5,1-4 die berühmte Büste aus dem Gebiet desolympieions (s. auch anm. 61) aufgrund der kräftigen Bohrung,die nicht mehr »den leicht touchierenden charakter« früher ha-driansbildnisse mit augenbohrung aufweist, in die späthadria-nisch – frühantoninische Zeit datiert, ist dem argumentativ nichtzu folgen. er vergleicht Porträts hadrians aus unterschiedlichenregionen des römischen reiches, aber ein Blick auf die attischenBildnisse dieses Kaisers, wie auch auf die hadrianischen Privat-porträts, lehrt, dass sie ausnahmslos die angabe nach dem hierbeschriebenen Schema zeigen.
33. In der forschung werden sie häufig als raspelspuren an-gesprochen. Sie gelten teilweise als allgemeines Zeichen für eineöstliche herkunft, s. M. c. Monaco, dall’acropoli di atene alMuseo Barracco: nuove considerazioni sulla testa inv. no. 101,Bcom 99, 1998, 105 f., oder wurden schon für ein spezifischesathenisches Phänomen in anspruch genommen, vgl. P. Grain-dor, les cosmètes du Musée d’athènes, Bch 39, 1915, 272; lat-tanzi 1968, 76; fittschen 1999, 40; Goette 2003, 555; Vouti-ras a. o. (anm. 10) 475. Jüngst wurde von l. a. riccardi, TheBust-crown, the Panhellenion, and eleusis. a New Portrait from
ΚλΑσΙΚΗ ΠΑρΑΔΟσΗ ΚΑΙ ΝεωΤερΙΚΑ σΤΟΙχεΙΑ σΤΗΝ ΠλΑσΤΙΚΗ ΤΗσ ρωΜΑϊΚΗσ ελλΑΔΑσ
500
abb. 1. Bildnis des onasos aus Pallene. athen, Nat. Mus. (lattanzi 1968, Taf. 7)
severischen Porträts im Magazin der 3. ephorie inathen34 (abb. 2) kann man deutlich erkennen, wiediese Stege die gesamte Gesichtsoberfläche überzie-hen35. Sie können allerdings auch nur in einzelnenBereichen des Gesichtes, wie etwa dem hals oder denWangen, auftreten. eine große anzahl attischerSkulpturen weist dieses Kennzeichen auf, so dass die-se handwerksspuren nicht mit Unfertigkeit erklärtwerden dürfen. Im restlichen Griechenland und ge-samten Imperium romanum sind sie hingegen einKennzeichen für genau diesen Zustand innerhalb desfertigungsprozesses36. außerhalb von athen galt esin der regel als besonderes Qualitätsmerkmal, wennder Marmor am ende der herstellung eines Porträtspoliert wurde37. das bekannteste Beispiel hierfür stelltdie berühmte Büste des commodus als hercules inrom38 dar.
Stehen gelassene Zahneisenspuren bei der ober-flächenbearbeitung treten in athen bei den Porträts39
spätestens seit dem 1. Jh. n. chr. auf40. daneben sindsie vielfach auf Grabreliefs41 und Sarkophagen42
nachzuweisen, aber auch an Werken der Idealskul p- tur, wie etwa dem Phaidrosbema43 oder an Ge-wandstatuen, wie denjenigen aus dem Nymphäumdes herodes atticus in olympia44. Ursache und Be-deutung dieser athenischen eigenart sind bislang un-geklärt.
Marmor
an dieser Stelle sei auch noch kurz auf die frage derverschiedenen Marmorsorten verwiesen. allein dieVerwendung von pentelischem oder hymettischemMarmor kann keine entstehung eines Porträts in ei-ner athenischen Werkstatt beweisen, da auch au-ßerhalb von attika, wie etwa in ostia oder Kyrene45,
the athenian agora, hesperia 76, 2007, 379 f. zwar anerkannt,dass diese Spuren in athen bei vollendeten Porträts auftretenkönnen, für den von ihr publizierten Neufund von der agora(S 3500) zog sie diese jedoch als Zeichen einer Umarbeitung her-an. es ist jedoch ausschließlich der Bart nachträglich überar-beitet worden, die Gesichtsoberfläche verblieb im ursprüngli-chen Zustand.
34. athen, Magazin der 3. ephorie Inv. 2565: o. alexandri, adelt22, 1967, chron 40-43 Taf. 67a. b.
35. Vgl. auch die detailaufnahmen des oben angesprochenen Kopfesvon der athener agora bei riccardi a. o. (anm. 33) 370 abb. 3;380 abb. 12. daneben gibt es Porträts, die diese Spuren nicht auf-weisen und gelegentlich auch poliert wurden, vgl. zu diesen zuletztGoette 2008, 192 f. das berühmteste Beispiel dieser richtung istder sog. rhoimetalkes: athen, Nat. Mus. Inv. 419: datsouli-Sta-vridi 1985, 84 f. Taf. 118. 119; Kaltsas 2002, 362 f. Nr. 775.
36. für Kleinasien bereits festgestellt von J. Inan – e. rosenbaum,
roman and early Byzantine Portraits in asia Minor (london1966) 10.
37. s. hier anm. 35. diese Bearbeitungsart tritt auch bei in athenhergestellten Idealskulpturen auf, vgl. etwa einen athena-Kopf vonder Pnyx: P. Karanastassi, Untersuchungen zur kaiserzeitlichen Pla-stik in Griechenland 2. Kopien, Varianten und Umbildungen nachathena-Typen des 5. Jhs. v. chr., aM 102, 1987, 413 Nr. BII 2Taf. 43,1. 2. diesen hinweis verdanke ich der autorin.
38. rom, Kapitolinische Museen Inv. 1120: fittschen – Zanker1994, 85-90 Nr. 78. Zuletzt dazu r. von den hoff, commodusals hercules, in: l. Giuliani (hrsg.), Meisterwerke der antikenKunst (München 2005) 114-135.
39. Sie sind an Skulpturen auch schon früher nachzuweisen, manvergleiche etwa die späthellenistische Kopie des diadumenos ausdelos: athen, Nat. Mus. Inv. 1826: Kaltsas 2002, 111 Nr. 201,welche am ganzen Körper diese Zahneisenspuren aufweist.
40. Vgl. stellvertretend das iulisch-claudische Bildnis athen, Nat.Mus. Inv. 353: datsouli-Stavridi 1985, 26 f. Taf. 12. 13.
41. Gut zu erkennen bei d. von Moock, die figürlichen Grabstelenattikas in der Kaiserzeit. Studien zur Verbreitung, chronologie,Typologie und Ikonographie, BeitreSkar 19 (Mainz 1998) Taf.11c; 12c; 30b; 32a.b; 35d; 42d.
42. Guntram Koch wies mich im rahmen dieser Konferenz dar-auf hin, dass sehr viele attische Sarkophage diese Bearbeitungs-spuren aufweisen.
43. G. despinis, hochrelieffriese des 2. Jahrhunderts n. chr. ausathen (München 2003) 73.
44. r. Bol, das Statuenprogramm des herodes-atticus-Nym-phäums, of 15 (Berlin 1984) 19.
45. für ostia vgl. r. calza, I ritratti, Scavi di ostia 5 (rom 1964);r. calza, I ritratti II, Scavi di ostia 9 (rom 1978), die für vieleBildnisse den Marmor als griechisch anspricht. für Kyrene vgl.
T. Schröder | IM aNGeSIchTe roMS
501
abb. 2. Spätseverisches Privatporträt, detail. athen, 3. ephorie (fot.: Th. Schröder)
Skulpturen aus diesem Material hergestellt wurden46.ferner gibt es auch attische Bildnisse, die man ausanderem, beispielsweise parischem, Marmor fertig-te47.
Fazit
Treffen nun mehrere von diesen lokalstilistischen Kri-terien auf ein Bildnis zu, kann man es m. e. mit ziem-licher Sicherheit als ein Produkt einer athenischenWerkstatt ansprechen. Vor allem für das 2. und 3. Jh.lassen sich die attischen Porträts auf diese Weise sehrgut erkennen. für das 1. Jh. ist es schwieriger, Zu-weisungen vorzunehmen, da uns weniger charakte-ristische anhaltspunkte zur Verfügung stehen48.Ähnliche ergebnisse für andere landschaften in Grie-chenland erzielen zu können, wird durch die sehr vielgeringere Materialgrundlage erschwert. Trotzdem loh-nen sich derartige Untersuchungen49, weil man da-durch ein sehr viel differenzierteres Bild der her-stellungszentren von Skulpturen im römischen Grie-chenland gewinnen kann50.
Kaiserzeitliche Porträts in Griechenland: athen,Thessaloniki, Korinth
In athen lassen sich für die ersten drei Jahrhunder-te n. chr. dementsprechend genügend männliche Bild-nisse zusammenstellen, um entwicklungen und ver-schiedene ikonographische ausprägungen nach-vollziehen zu können. folglich ist es angebracht, dieattischen Porträts als ausgangspunkt für die Ge-genüberstellung der kaiserzeitlichen Bildnisse zuwählen.
Athen
die in athen hergestellten Porträts der römischen Kai-ser zeigen keine auffälligen abweichungen zu denstadtrömischen Vorlagen. So weist ein in der Gegendder römischen agora gefundenes Bildnis des augu-stus im Nationalmuseum51 die typischen Merkma-le des Typus Prima Porta auf: Jugendlichkeit, Bart-losigkeit und vor allem natürlich das nachzählbarelockenschema52.
Von der einrichtung des Prinzipats im ausge-henden 1. Jh. v. chr.53 bis in die traianische Zeit fol-gen die attischen Porträts in ihrer Ikonographie denBildnissen der jeweiligen Kaiser. dieses Phänomenkennen wir unter dem Begriff Zeitgesicht54. es istüberall im römischen reich die vorherrschende artder bürgerlichen Selbstdarstellung gewesen. Gut
vergleichbar mit Bildnissen des ersten römischen Kai-sers ist ein Privatporträt im agora-Museum55 (abb.3), welches früher sogar für eine darstellung des au-gustus selbst gehalten wurde56. dies kann aufgrundder fehlenden typologischen Übereinstimmungen je-doch sicher ausgeschlossen werden. auch im mittleren1. Jh. ist diese Stilisierung vorherrschend, wie die Ge-genüberstellung einer mutmaßlichen Statue des
e. rosenbaum, a catalogue of cyrenaican Portrait Sculpture (lon-don 1960) 5 f., die auch kurz auf die Gemeinsamkeiten und Un-terschiede zu den Bildnissen in athen eingeht.
46. allgemein für athenische Skulpturen ähnlich vorsichtig auchfittschen a. o. (anm. 1) 326 f. Unterscheidungen anhand ei-ner autopsie, gerade auch im Kunstlicht im Museum, sind im-mer von Unsicherheiten geprägt. Verbesserungen können nurdurch naturwissenschaftliche analysen erreicht werden. Wich-tig für diese fragen sind die regelmäßig stattfindenden Kon-ferenzen der association for the Study of Marble and other Sto-nes Used in antiquity. Zuletzt erschienen ist Y. Maniatis (hrsg.),aSMoSIa VII. Proceedings of the 7th International conferenceof association for the Study of Marble and other Stones in an-tiquity, Thassos 15-20 September, 2003, Bch Suppl. 51 (Pa-ris 2009).
47. So z. B. das Kosmetenbildnis athen, Nat. Mus. Inv. 416: da-tsouli-Stavridi 1985, 94 f. Taf. 139. 140; Kaltsas 2002, 326 f. Nr.686.
48. es gibt noch weitere Kriterien, wie etwa die ausführung derBüstenstützen. Vgl. dazu fittschen a. o. (anm. 11) 71-77. Mitrecht einschränkend dazu T. Stefanidou-Tiveriou, Septimius Se-verus, divi Marci pii filius. eine Büste in Thessaloniki, aM 117,2002, 318-320.
49. erinnert sei an dieser Stelle nur an die sichelförmige Gestal-tung der augenbohrung, die als typisch für Thessaloniki angese-hen werden kann.
50. die Beiträge zu dieser Konferenz haben sehr deutlich gezeigt,wie vielfältig das Bild sowohl der hergestellten objekte als auchder Produktionsstätten im römischen Griechenland ist.
51. athen, Nat. Mus. Inv. 3758: datsouli-Stavridi 1985, 28 f. Taf.15; d. Boschung, die Bildnisse des augustus, das römische herr-scherbild I 2 (Berlin 1993) 142 Nr. 72 Taf. 186; Kaltsas 2002, 316f. Nr. 661.
52. Vgl. grundsätzlich Boschung a. o. (anm. 51).
53. die späthellenistischen/spätrepublikanischen Porträts aus athenzeigen häufig die darstellung von alterszügen, wie es nahezu über-all im Mittelmeerraum vorherrschend war. Vgl. stellvertretend dieBildnisse athen, agora-Museum Inv. S 333: harrison a. o. (anm.4) 12-14 Nr. 3; athen, Nat. Mus. Inv. 331: datsouli-Stavridi 1985,24 f. Taf. 6. 7; Kaltsas 2002, 312 Nr. 652 oder athen, Nat. Mus.Inv. 437: datsouli-Stavridi 1985, 27 f. Taf. 14; Kaltsas 2002, 311f. Nr. 650.
54. S. dazu grundlegend M. Bergmann, Zeittypen im Kaiserpor-trät, WissZBerl 31, 1982, 143-147; P. Zanker, herrscherbild undZeitgesicht, WissZBerl 31, 1982, 307-312. J. fejfer, roman Por-traits in context (Berlin 2008) 270-285. M. Bergmann, Kaiser-& Privatporträt in der römischen Kaiserzeit, <http://viamus.uni-goettingen.de/fr/e/uni/d/04> (15.11.09).
55. athen, agora-Museum Inv. S 356: harrison a. o. (anm. 4)17-20 Nr. 7; Boschung a. o. (anm. 51) 203 Nr. 280.
56. Zuletzt m. W. so angesprochen worden von a. Stavridis, Por-trätkopf eines julisch-claudischen Prinzen (?) im Nationalmuseumzu athen, rM 88, 1981, 403 anm. 1.
ΚλΑσΙΚΗ ΠΑρΑΔΟσΗ ΚΑΙ ΝεωΤερΙΚΑ σΤΟΙχεΙΑ σΤΗΝ ΠλΑσΤΙΚΗ ΤΗσ ρωΜΑϊΚΗσ ελλΑΔΑσ
502
Nero in eleusis57 mit einem südlich der akropolis ge-fundenen Privatporträt58 beispielhaft zeigt. Sowohlin der anlage der Strähnenfrisur als auch in der Phy-siognomie sind die Parallelen nicht zu negieren. auchin traianischer Zeit ändert sich an dieser Situationnichts59. Bis in das frühe 2. Jh. sind also keine grund-legenden abweichungen zwischen den in athenund im restlichen Imperium romanum fassbaren Mo-deerscheinungen nachweisbar60.
ab der hadrianischen Zeit lässt sich dann al-lerdings eine grundlegende Veränderung innerhalb desikonographischen Spektrums der attischen Porträtsfeststellen. Weiterhin gibt es Bildnisse, die sich an derkaiserlichen Mode orientieren. Besonders deutlichzeigt dies die berühmte, beim olympieion gefunde-ne Büste im Nationalmuseum61, in der bis heute im-mer wieder ein unkanonisches Porträt des Kaisers ha-drian erkannt wird62. Stellt man die Büste dem ähn-lichsten Bildnis des hadrian im Typus Imperatori 3263
gegenüber, kann man erkennen, dass es neben all-gemeinen Übereinstimmungen in der Physiognomieund der anlage der frisur keinen konkreten typo-logischen Zusammenhang gibt und es sich bei demdargestellten um eine Privatperson handeln muss.
ferner lassen sich ab ca. 130/40 Porträts finden,denen eine andere Konzeption zugrunde liegt und diein ihrer Ikonographie auf ältere Bildnistypen zu-
rückgreifen, wie es in der forschung für die Kos-metenbildnisse schon lange gesehen wurde64. So zogman für den späthadrianisch-frühantoninisch zu da-tierenden Bildniskopf des Kosmeten onasos aus Pal-lene65 (abb. 1) bislang unterschiedliche Vorbilder inBetracht66; m. e. kommt onasos dem Bildnistypus
57. eleusis, arch. Mus. Inv. 5268: h. r. Goette, Studien zu rö-mischen Togadarstellungen, BeitreSkar 10 (Mainz 1989) 38 f.125 Ba 248 Taf. 11,1; f. havé-Nikolaus, Untersuchungen zu denkaiserzeitlichen Togastatuen griechischer Provenienz, Trierer Bei-träge zur altertumskunde 4 (Mainz 1998) 98-106 Nr. 10 Taf. 8,2; d. Boschung, Gens Augusta. Untersuchungen zu aufstellung,Wirkung und Bedeutung der Statuengruppen des julisch-claudi-schen Kaiserhauses, Mar 32 (Mainz 2002) 111 Nr. 36, 2.
58. athen, akropolis-Museum Inv. 1955 NaM 22: a. Karivie-ri, The “house of Proclus” on the Southern Slope of the acro-polis: a contribution, in: P. castrén (hrsg.), Post-herulian athens.aspects of life and culture in athens, a.d. 267-529 (helsiniki1994) 131 f. abb. 30a. b; M. S. Brouskari, Οι ανασκαφές νοτίωςτης Ακροπόλεως. Τα γλυπτά, aephem 141, 2002, 130 f. abb.134.
59. exemplarisch kann man für die frisur und die Physiogno-mie das Bildnis des Traian im Piräusmuseum Inv. 276: W. h.Gross, die Bildnisse Trajans, das römische herrscherbild II 2(Berlin 1940) 74. 101 f. 130 Nr. 54 Taf. 27b; G. Steinhauer, ΤαΜνημεία και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά (athen1998) 91 f. mit abb. mit dem Porträt im Nationalmuseum Inv.342: datsouli-Stavridi 1985, 54 f. Taf. 58 vergleichen. die Bär-tigkeit steht dazu nicht im Gegensatz, da sie schon vor hadri-an bei den Privatbildnissen auftreten kann, vgl. dazu P. cain,Männerbildnisse neronisch-flavischer Zeit (München 1993) 100-104.
60. dazu zählt auch die sich seit flavischer Zeit abzeichnende Mo-deerscheinung, bei der wieder altmännerbildnisse geschaffen wur-den, deren formensprache an diejenige der späten republik er-innert. aber auch dabei handelt es sich um ein reichsweit fest-stellbares Phänomen. Vgl. für den athenischen Kontext zwei Bild-nisse von der agora Inv. S 1182 und S 1299: harrison. a. o. (anm.4) 28-31 Nr. 18. 19. Taf. 13. 14.
61. athen, Nat. Mus. Inv. 249: datsouli-Stavridi 1985, 44 f. Taf.42. Kaltsas 2002, 339 Nr. 718.
62. So zuletzt ausführlicher l. a. riccardi, Uncanonical ImperialPortraits in the eastern roman Provinces. The case of the Ka-nellopoulos emperor, hesperia 69, 2000, 126 f. abb. 22.
63. athen, Nat. Mus. Inv. 3729: datsouli-Stavridi 1985, 42 f. Taf.39. 40; Willers a. o. (anm. 32) 48 Taf. 6, 3. 4. Kaltsas 2002, 340Nr. 720.
64. Vgl. zu diesen grundlegend Graindor a. o. (anm. 33) 241-401;lattanzi 1968; Krumeich 2004, 131-155; d’ambra a. o. (anm.11).
65. athen, Nat. Mus. Inv. 387: lattanzi 1968 26 f. 39 f. Nr. 7 Taf.7; Kaltsas 2002, 326 f. Nr. 685; Krumeich 2004, 141 f. 146. 151f. abb. 2,7.
66. Vorgeschlagen wurden etwa der lateranische Sophokles, dersog. aischylos farnese, Metrodor oder allgemein die epikureer.Vgl. die Zusammenstellung der unterschiedlichen ansätze bei Kru-meich 2004, 142 anm. 52, der sich selbst für aischylos als Vor-bild entschied. eine retrospektive Stilisierung wurde allerdings auchschon abgestritten. So etwa danguillier 2001, 106 f., die eine her-leitung der charakteristischen elemente des onasos-Porträts ausder aktuellen Kaisermode postulierte. dagegen hat sich auch schonKrumeich 2004, 142 anm. 53 ausgesprochen.
T. Schröder | IM aNGeSIchTe roMS
503
abb. 3. augusteisches Privatporträt. athen, agora-Museum (fot.: Th. Schröder)
des epikur (abb. 4) am nächsten67. allgemeine Ge-meinsamkeiten sind in der gelängten Kopfform, demVolumen von haar und Bart und der Strukturierungder frisur in mittellange locken erkennbar. auffal-lend ist vor allem die Übereinstimmung der über derStirnmitte nach links gelegten haare mit dem cha-rakteristischen Mittelmotiv, bei dem jeweils zweiSträhnen tiefer in die Stirn fallen und sich mit ihrenSpitzen zur Nase hin wenden. Über der rechten Schlä-fe befindet sich bei beiden Porträts eine Gabel. dar-über hinaus sind beiden Bildnissen ein überhängen-der oberlippenbart, dessen enden nach außen zei-gen, und ein unter dem Kinn geteilter Bart gemein-sam. In dem kräftig ausgeprägten Nasenhöckerlässt sich sogar ein vergleichbares physiognomischesdetail finden. der größte Unterschied offenbart sichoberhalb der Nasenwurzel, wo das epikur-Porträtdurch zwei Steilfalten charakterisiert ist, die durchdie extreme Kontraktion der augenbrauen bewirktwurden, während das athenische Bildnis einen ent-spannten Gesichtsausdruck zeigt. dieses und vieleweitere attische retrospektive Porträts zeigen einenentsprechenden Befund, indem ältere Vorbilder nurselektiv zitiert und nicht etwa komplette frisuren-schemata kopiert werden68. ab der späthadria-nisch-frühantoninischen Zeit existieren nun diese dar-stellungsweise und das Zeitgesicht als jeweilige Poleder Stilisierungsoptionen in athen. dazwischen gibtes unterschiedliche abstufungen, so dass ein extrem
vielseitiges Bild der attischen Privatporträts entsteht.ein weiteres instruktives Beispiel für die retro-
spektive Stilisierung bildet der Porträttypus des he-rodes atticus69. dies wird besonders deutlich, wennman die Bildnisse des Kaisers Marc aurel70 denje-nigen seines lehrers und engen Vertrauten gegen-überstellt. Ikonographisch sind überhaupt keineÜbereinstimmungen feststellbar. die Bildnisse desatheners weisen eine aus langen Strähnen gebilde-te frisur auf, die sich von den aus eingedrehten lo-cken gebildeten haaren des Kaisers kaum mehr un-terscheiden könnte. ein konkretes Vorbild lässt sichfür das Porträt des herodes im Moment nicht er-mitteln, vielmehr könnte sogar gerade diese Unschärfeintendiert gewesen sein71. es ist bemerkenswert, dassder lokale Kontext und nicht die Verwandtschaft mitMarc aurel maßgeblich für die Ikonographie des Bild-nisses des atheners war72.
Bis in die severische Zeit hinein lassen sich diehier herausgestellten Stilisierungsoptionen parallelnachweisen. So entspricht ein auf der römischen agora
67. Zum Typus des epikur und seiner Statue vgl. r. von den hoff,Philosophenporträts des früh- und hochhellenismus (München1994) 69-75 abb. 22-24, 39-45; ch. Kunze, Zum Greifen nah.Stilphänomene in der hellenistischen Skulptur und ihre inhaltli-che Interpretation (München 2002) 249-255 abb. 27-30.
68. Neben diesen retrospektiven Porträts gibt es Bildnisse, die ak-tuelle Modefrisuren aufgreifen, allerdings einen formalen Klas-sizismus in ihrer Gestaltung aufweisen. Vgl. exemplarisch das be-reits oben (anm. 47) angesprochene Kosmetenbildnis.
69. Vgl. zum Typus Bol a. o. (anm. 21) 118-129. Ihrer liste hin-zuzufügen sind noch mindestens drei Bildnisse im Museum vonastros aus der Villa von luku. Vgl. vorläufig Spyropoulos a. o.(anm. 29) 108 Nr. 5; 110 f. abb. 19; 132. Jüngst hat e. Vouti-ras, representing the >Intellectual< or the active Politician? ThePortrait of herodes atticus, in: a. d. rizakis – f. camia(hrsg.), Pathways to Power. civic elites in the eastern Part of theroman empire, Proceedings of the International Workshop heldat athens, Scuola archeologica Italiana di atene, 19 december2005, Tripodes 6 (athen 2008) 209-219 einen zweiten Porträt-typus des athener erkennen wollen. Bei den von ihm zusam-mengestellten Bildnissen in athen und Toronto handelt sich al-lerdings weder um repliken, noch gibt es eine Grundlage für dieBenennung.
70. Vgl. grundlegend zur Typologie M. Bergmann, Marc aurel2
(frankfurt a. M. 1988).
71. In der forschung wurde z. B. eine Nähe zum demosthenes-Typus gesehen, vgl. dazu r. r. r. Smith, cultural choice and Po-litical Identity in honorific Portrait Statues in the Greek east inthe Second century a.d., JrS 88, 1998, 78. Vgl. für eine Zu-sammenstellung der verschiedenen forschungsmeinungen dan-guillier 2001, 128-131, die selbst darauf hinwies, dass herodeswohl allgemein auf das Vorbild eines reifen Mann im spätklassi-schen/frühhellenistischen Typus anspielen wollte.
72. Wie wichtig ihm auch die Präsentation der Nähe zum rö-mischen Kaiser war, vermag etwa die Statuenausstattung seinesNymphäums in olympia zeigen. Vgl. dazu Bol a. o. (anm. 44).
ΚλΑσΙΚΗ ΠΑρΑΔΟσΗ ΚΑΙ ΝεωΤερΙΚΑ σΤΟΙχεΙΑ σΤΗΝ ΠλΑσΤΙΚΗ ΤΗσ ρωΜΑϊΚΗσ ελλΑΔΑσ
504
abb. 4. Bildnis des epikur. rom, Kapitolinische Museen(fot.: Gipsabguss Göttingen. St. eckardt)
gefundenes Bildnis im Nationalmuseum73 den frü-hen Bildnistypen des Septimius Severus74, währendein südlich der akropolis entdeckter Kopf, dersich ebenfalls im Nationalmuseum befindet75, phy-siognomisch und typologisch an die Bildnisse desalexander Severus76 erinnert. daneben gibt es wei-terhin retrospektive Bildnisse. So zeigt ein auf-grund der Inschrift auf der herme sicher in die Jah-re 231/3277 zu datierendes Kosmetenporträt78 un-mittelbar mit dem Bildnistypus des aischines79
verwandte Züge80. Vergleichbar sind etwa derkompakte aufbau des Kopfes mit der in der Mitteder hohen Stirn vorspringenden haarzunge, die vonrecht voluminösem Schläfenhaar gerahmt wird,und der kurzgeschnittene Bart. Ungeachtet der Tat-sache, dass sich keine Strähnen einzeln abzählen las-sen, ist die ikonographische abweichung von denKaiserbildnissen dieser Jahre bemerkenswert. Bei die-sen, wie auch bei den Privatpersonen überall im rö-mischen reich, hatte sich die Kurzhaarmode durch-gesetzt. dieses athenische Bildnis ist aufgrund derInschrift eines der spätesten Beispiele für die retro-spektive Stilisierung. die in gallienische Zeit zu da-tierenden attischen Porträts folgen nun wieder aus-schließlich den im gesamten Imperium romanumverbreiteten Typen81.
Im frühkaiserzeitlichen athen gibt es also kei-ne von der kaiserlichen Mode abweichenden Porträts,während sich von ca. 130 bis etwa 230/40 retro-spektive Bildnisse mit ikonographischen Bezügen aufältere Typen nachweisen lassen. es bleibt demge-genüber zu fragen, wie sich die Bürger von Thessa-loniki und Korinth selbst dargestellt haben und obdort ähnliche Phänomene greifbar sind.
Thessaloniki
Zunächst kann man festhalten, dass – wie in athen– auch in Thessaloniki die wenigen erhaltenen Kai-serbildnisse keine auffallenden typologischen ab-weichungen von den stadtrömischen Vorlagen zeigen,wie z. B. die bekannte hüftmantelstatue des augu-stus beweist82.
die in Thessaloniki und Umgebung gefundenenBildnisse sind inzwischen der forschung durch ei-nen hervorragenden Skulpturenkatalog zugänglichgemacht worden, so dass eine Überprüfung des iko-nographischen Spektrums unter den hier verfolgtenfragestellungen ermöglicht wird. Bis auf eineschwierig zu datierende ausnahme83 sind in Thes-saloniki keine männlichen Privatporträts mit fund-
kontext aus der iulisch-claudischen epoche erhal-ten84. Bis in hadrianische Zeit bleibt die Material-basis sehr dünn85. deutlich wird, dass sich die we-nigen Bildnisse in ihrer Ikonographie nicht von derim römischen reich vorherrschenden Mode unter-scheiden. aufgrund der Überlieferungssituation seies an dieser Stelle gestattet, ein aus dem späten 1. Jh.stammendes Bildnis aus drama86 abzubilden (abb.5), welches wegen des erhaltungszustandes besserzur Veranschaulichung geeignet ist. es ist typologischgut mit dem Bildnistypus des Nerva87 vergleichbar.
73. athen, Nat. Mus. Inv. 1764: datsouli-Stavridi 1985, 71 f. Taf.91, 92.
74. Typologisch gut vergleichbar ist ein Kopf in den Kapitolini-schen Museen in rom, Sala X Inv. 2309: fittschen – Zanker 1994,94 f. Nr. 82.
75. athen, Nat. Mus. Inv. 330: datsouli-Stavridi 1985, 79 f. Taf.107. 108; Kaltsas 2002, 357 Nr. 760.
76. Vgl. etwa das Bildnis rom, Kapitolinische Museen, Stanza de-gli Imperatori 51 Inv. 480: fittschen – Zanker 1994, 117-121 Nr.99 Taf. 122. 123. 126.
77. IG II/III2 2241. s. dazu ausführlich S. follet, athènes au IIe
et au IIIe siècle. Études chronologiques et prosopographiques (Pa-ris 1976) 240, 287, 331 f. 504.
78. athen, Nat. Mus. Inv. 388: datsouli-Stavridi 1985, 100 f. Taf.151, 152; Kaltsas 2002, 332 f. Nr. 701.
79. Vgl. zur Statue in Neapel, Nat. Mus. Inv. 6018 zuletzt r. vonden hoff, die Skulptur der diadochenzeit, in: P. c. Bol (hrsg.),Geschichte der antiken Bildhauerkunst III. hellenismus (Mainz2007) 21 f. abb. 24, 37.
80. Zuerst so vorgebracht von von den hoff a. o. (anm. 67)18. Vgl. auch danguillier 2001, 69 f. mit der diskussion andererVorschläge und Krumeich 2004, 144. 146. 155 abb. 17-20 mitder treffenden Gegenüberstellung der beiden Bildnisköpfe.
81. Man vgl. stellvertretend etwa das Bildnis athen, Nat. Mus.Inv. 432: Bergmann a. o. (anm. 14) 85 Taf. 25,4 mit dem 1. Ty-pus des Gallienus in Berlin, Staatliche Museen Inv. Sk 423: Berg-mann ibid. 51 Nr. I 4 Taf. 12, 5. 6.
82. Thessaloniki, arch. Mus. Inv. 1065: Boschung a. o. (anm. 51)189 Nr. 197 Taf. 117, 173,3. 217,1; Κατάλογος II, 108-113 Nr.244 (G. despinis).
83. Thessaloniki, arch. Mus. 880: Κατάλογος II, 60 f. Nr. 197(G. despinis). s. dazu auch die Bemerkungen in der rezension vonK. fittschen, GGa 257, 2005, 156 f.
84. Wahrscheinlich gehört das Bildnis Thessaloniki, arch. Mus.Inv. 1269: Κατάλογος II, 120 f. Nr. 248 (Th. Stefanidou-Tiveriou)in diese Zeit, was aufgrund des erhaltungszustandes aber nichtsicher entschieden werden kann.
85. Vgl. beispielsweise das flavische Privatporträt Thessaloniki, arch.Mus. Inv. 6934: Κατάλογος II, 131 f. Nr. 253 (Th. Stefanidou-Tiveriou) oder das traianische Bildnis Thessaloniki, arch. Mus. Inv.174: Κατάλογος II, 136 f. Nr. 257 (Th. Stefanidou-Tiveriou).
86. drama, arch. Mus. Inv. l 184: Κατάλογος II, 121-123 Nr.249 (Th. Stefanidou-Tiveriou) mit einer datierung in claudischeZeit.
87. Zur Ikonographie dieses Kaiser immer noch grundlegend M.Bergmann – P. Zanker, ‘Damnatio Memoriae’. Umgearbeitete Nero-und domitiansporträts. Zur Ikonographie der flavischen Kaiserund des Nerva, JdI 96, 1981, 317-412.
T. Schröder | IM aNGeSIchTe roMS
505
auch im 2. und 3. Jh. folgen die Bildnisse fastgenerell weiterhin den überall auftretenden Mo-deerscheinungen, worin ein grundlegender Unter-schied zu den Porträts in athen in ikonographischerhinsicht zu sehen ist88. ein in Thessaloniki gefun-denes Bildnis aus severischer Zeit89 vermag beson-ders zu verdeutlichen, wie eng die Bezüge zum kai-serlichen Porträt sein konnten. aufgrund der phy-siognomischen Ähnlichkeit und der vergleichbarenanlage der frisur wurde es lange für ein Bildnis deselagabal gehalten90 (abb. 6). Zuerst hat sich T. Ste-fanidou-Tiveriou dagegen ausgesprochen91. Nebenden typologischen abweichungen in der frisurspricht auch der himationrest im Nacken gegen eineZuweisung92, da bislang keine Statue eines römischenKaisers im griechischen Mantel nachgewiesen wer-den konnte93. daneben gibt es weitere an den offi-ziellen Modeerscheinungen orientierte Bildnisse,
88. Vgl. für das 2. Jh. stellvertretend folgende Bildnisse: Thessa-loniki, arch. Mus. Inv. 6076: Κατάλογος II, 148 f. Nr. 263 (ha-drianisch) und 6790: Κατάλογος II, 161 f. Nr. 272 (Th. Stefa-nidou-Tiveriou) (antoninisch).
89. Thessaloniki, arch. Mus. Inv. 855: Κατάλογος II, 195 f. Nr.294 (Th. Stefanidou-Tiveriou).
90. die erwägung, dass es sich um elagabal handeln könnte, gehtzurück auf Bergmann a. o. (anm. 14) 22-24 Nr. 3 Taf. 1,5. 6. Vgl.zu den beiden Typen dieses Kaisers anhand von zwei stadtrömi-schen Beispielen fittschen – Zanker 1994, 114 f. Nr. 97 Taf. 119Beil. 82 (1. Typus); 115-117 Nr. 98 Taf. 120. 121 Beil. 83 (2. Ty-pus). abzuwarten bleiben die ergebnisse der 2009 in Münchenvon florian leitmeir eingereichten dissertation zu severischen Kai-serbildnissen.
91. Th. Stefanidou-Tiveriou, Δύο πορτρέτα της εποχής τωνσεβήρων από εργαστήριο της Θεσσαλονίκης, egnatia 6,2001/2002, 239-250. Vgl. Κατάλογος ΙΙ, 195 f. Nr. 294 (Th. Ste-fanidou-Tiveriou).
92. So auch fittschen a. o. (anm. 83) 161.
93. als Beleg dafür galt immer eine himation-Statue mit demPorträtkopf des hadrian aus Kyrene in london, British MuseumInv. 1381: rosenbaum a. o. (anm. 45) 51 f. Nr. 34 Taf. 26,1.2; 27,1. Bei restaurierungsmaßnahmen konnte jetzt allerdingsnachgewiesen werden, dass Kopf und Körper erst nachantik zu-sammengefügt wurden. Vgl. dazu vorläufig T. opper, hadrian.Machtmensch und Mäzen (darmstadt 2009) 68-70 abb. 53. da-neben gibt es in Kyrene eine angebliche himation-Statue des Ti-berius, Kyrene, arch. Mus. Inv. c 17031 a. b: rosenbaum ibid.43-45 Nr. 17 Taf. 25,3. 4. dabei handelt es sich jedoch um eineaus einer frauenstatue, wohl des 4. Jhs. v. chr., umgearbeitetefigur, die eine Toga nachbilden wollte. Vgl. dazu d. Boschung,das römische Kaiserbildnis und seine aufnahme im griechischenosten, in: chr. Berns u. a. (hrsg.), Patris und Imperium. Kul-turelle und politische Identität in den Städten der römischen Pro-vinzen Kleinasiens in der frühen Kaiserzeit. Kolloquium Köln,November 1998, BaBesch Suppl. 8 (leuven 2002) 140-143 abb.11. 12. Vgl. in diesem Band aber auch den Beitrag von P. Ka-ranastassi zu einer jüngst auf Kreta entdeckten und auf Traianbezogenen himation-Statue, was m. e. allerdings unsicher blei-ben muss.
ΚλΑσΙΚΗ ΠΑρΑΔΟσΗ ΚΑΙ ΝεωΤερΙΚΑ σΤΟΙχεΙΑ σΤΗΝ ΠλΑσΤΙΚΗ ΤΗσ ρωΜΑϊΚΗσ ελλΑΔΑσ
506
abb. 5. Privatporträt aus dem späten 1. Jh. drama, archäologisches Museum (fot.: ΑΓΜε 1 Α. Μ. Skiadaressis).
abb. 6. Privatporträt aus den Jahren um 220. Thessaloniki, archäologisches Museum
(fot.: ΑΓΜε 63 Α. Μ. Skiadaressis)
wie ein ebenfalls in Thessaloniki gefundenes Porträt94
zeigt, welches typologisch das Bildnis des alexanderSeverus95 rezipiert.
aus Thessaloniki sind mir nur zwei sicherdort hergestellte Bildnisse bekannt, die in ihrer Iko-nographie von dieser am Zeitgesicht orientierten dar-stellungsweise abweichen. es handelt sich um zweizusammen mit weiteren Skulpturen in einer spätenMauer verbaut aufgefundene Büsten, von denen dieeine96 (abb. 7) in frühantoninische Zeit und die an-dere97 in mittelseverische Zeit zu datieren ist. die-se retrospektiven Beispiele weisen jedoch keine de-zidierten ikonographischen rückgriffe wie in athenauf, sondern gliedern sich in eine überall im römi-schen reich, vor allem aber im Westen, seit dem frü-hen 2. Jh. auftretende “Intellektuellenstilisierung”ein98. dabei handelt es sich um eine von den offi-ziellen Kaiserporträts divergierende darstellungs-weise, die sich hauptsächlich durch frisurenunter-schiede, wie etwa halbglatzen, und abweichendeBarttracht auszeichnet. In diesem Kontext lässtsich das antoninische Porträt gut in eine reihe mitvier von Paul Zanker zusammengestellten Bildnis-sen99 einordnen, die ebenfalls einen kurz geschnit-
tenen Bart mit über der Stirnmitte schütterem haarkombinieren. den severischen Bildniskopf kann manmit seiner halbglatze, der an den Schläfen aus län-geren Strähnen gebildeten frisur und dem relativspitz zulaufenden Bart dagegen besonders gut mitdem sog. Plotin-Typus100 vergleichen.
Überblickt man die Bildnisse in Thessaloniki ausden ersten drei nachchristlichen Jahrhunderten zu-sammenhängend, wird deutlich, dass sie sich viel en-ger an die stadtrömischen Modeerscheinungen an-schließen als diejenigen in athen.
Korinth
auch die in Korinth gefundenen Kaiserporträts fol-gen typologisch den stadtrömischen Vorlagen101, wiestellvertretend die berühmten Statuen des augustusund seiner enkel aus der iulischen Basilika zeigen102.
die Privatporträts des 1. Jhs. folgen auch hierin ihren Stilisierungen den stadtrömischen Modellen.So zeigt ein iulisch-claudisches Bildnis im Museumvon Korinth103 (abb. 8) eine aus einzelnen dicken
94. Thessaloniki, arch. Mus. Inv. 11451: Κατάλογος II, 155-157Nr. 268 (Th. Stefanidou-Tiveriou).
95. Vgl. folgendes Bildnis: Paris, louvre Inv. Ma 1051: K. de Ker-sauson, Musée du louvre. catalogue des portraits romains II (Pa-ris 1996) 418 f. Nr. 193.
96. Thessaloniki, arch. Mus. Inv. 11201: Κατάλογος II, 151-153Nr. 265 (emm. Voutiras) mit einer datierung in die Jahre 130-140.
97. Thessaloniki, arch. Mus. Inv. 11204: Κατάλογος II, 200 f.Nr. 297 (emm. Voutiras) mit einer datierung um 220.
98. Vgl. dazu vorerst P. Zanker, die Maske des Sokrates. das Bilddes Intellektuellen in der antiken Kunst (München 1995) 190-251und danguillier 2001.
99. Zanker a. o. (anm. 98) 215 abb. 122a-d.
100. Vgl. dazu Zanker a. o. (anm. 98) 215 abb. 122e. f; W. fi-scher-Bossert, der Porträttypus des sog. Plotin. Zur deutung vonBärten in der römischen Porträtkunst, aa 2001, 137-152. die-sen Zusammenhang hat bereits danguillier 2001, 55-57 erkannt.
101. die meisten Porträts in Korinth sind bislang noch nicht voll-ständig für die forschung erschlossen worden. aus diesemGrund möchte ich mich an dieser Stelle bei Konstantinos Kissas,Guy Sanders und Ioulia Tzonou-herbst bedanken, die mir in kol-legialer Weise die Möglichkeit gaben, das Material vor ort zu stu-dieren. Vgl. für einen einblick c. de Grazia Vanderpool, romanPortraiture. The Many faces of corinth, in: c. K. Williams II –N. Bookidis (hrsg.), corinth, the centenary 1896-1996, corinth20 (Princeton 2003) 369-384. die arbeit von c. de Grazia, ex-cavations of the american School of classical Studies at corinth.The roman Portrait Sculpture (diss. Universität columbia1973) hat leider keinen abbildungsteil.
102. Vgl. zur Statuengruppe und ihrem Kontext Boschung a. o.(anm. 57) 64-66 Taf. 48-51.
103. Korinth, arch. Mus. Inv. S 1155: f. P. Johnson, Sculpture1896-1923, corinth 9, 1 (cambridge, Mass. 1931) 85 Nr. 159mit abb.; ridgway 1981, 447 Taf. 97a.
T. Schröder | IM aNGeSIchTe roMS
507
abb. 7. Privatporträt aus dem mittleren 2. Jh. Thessaloniki, archäologisches Museum (fot.: daI athen 71/659. G. hellner)
Strähnenkompartimenten bestehende frisur, die ty-pologisch gut mit Bildnissen des augustus im TypusPrima Porta vergleichbar ist104. auch für das 2. und3. Jh. lassen sich keine abweichungen von den stadt-römischen Modeerscheinungen nachweisen. So fin-den sich für ein weiteres Bildnis105 (abb. 9) in deranlage von Bart und frisur die engsten Parallelen beiden Kaiserporträts des 2. Viertel des 2. Jhs. ein Por-trät im athener Nationalmuseum aus Korinth aus demmittleren 2. Jh.106 kann man hingegen gut mit dem2. und 3. Typus des lucius Verus vergleichen107. auchin severischer Zeit sind diese Stilisierungen nach demZeitgesicht noch in Korinth vorherrschend. ein imStadtzentrum gefundener Kopf108 aus dem frühen 3.Jh.109 (abb. 10) erinnert in der aus vertikal ausge-richteten Korkenzieher-locken gebildeten Stirnfrisuran den Sarapis-Typus des Septimius Severus110 undin dem am Kinn ausrasierten, kurz geschnittenen Bartund allgemein in der Physiognomie an die schwer aus-einanderzuhaltenden Bildnisse des caracalla oder Getain einer späten Version des 2. Typus111.
der Befund in Korinth ist also mit demjenigenin Thessaloniki vergleichbar. dies ist umso bemer-kenswerter, als sich für viele in Korinth gefundene Por-träts trotz der ikonographischen Unterschiede sehrenge stilistische und handwerkliche Parallelen in
athen finden lassen112. So entspricht beispielsweiseein Porträt113, das vermutlich Nero Germanici dar-stellt, in allen Punkten, vor allem in den stehen ge-lassenen Zahneisenspuren, den gleichzeitigen attischenBildnissen. ein stark bestoßener Kopf114 aus demmittleren 2. Jh. ist an den erhaltenen Teilen der Ge-sichtsoberfläche ebenfalls mit ihnen überzogen. an-hand dieser handwerklichen Parallelen kann manschlussfolgern, dass athenische Werkstätten an-scheinend viel häufiger aufträge in Korinth als inThessaloniki115 ausgeführt und dabei die Wünscheder lokalen auftraggeber berücksichtigt haben. dassin Korinth Bildhauer aus athen gearbeitet haben, istdurch eine Inschrift gesichert, die von Mary Sturge-on überzeugend mit dem ausbau der Skene des Thea-ters in hadrianischer Zeit in Verbindung gebrachtwurde116. Sie lautet: Θεόδοτος Ἀθηναῖος ἐποίει. die-ser Theodotos war wahrscheinlich eine art Werk-stattleiter und für die herstellung der Skulpturen ver-
104. daran können weitere Beispiele des 1. Jhs. angeschlossen wer-den, vgl. z. B. Korinth, arch. Mus. Inv. S 69-22: J. Wiseman, TheGymnasium area at corinth 1969-1970, hesperia 41, 1972, 19 f. Taf. 8 und Korinth, arch. Mus. Inv. T 277: M. c. Sturgeon,Sculpture. The assemblage from the Theater, corinth 9, 3(Princeton 2004) 136-139 Nr. 28 Taf. 44b, 45, 46.
105. Korinth, arch. Mus. S 22: Johnson a. o. (anm. 103) 88 Nr.171 mit abb.
106. athen, Nat. Mus. Inv. 3251: datsouli-Stavridi 1985, 63 f.Taf. 75. 76; fittschen 1999, 88 Nr. 62 Taf. 158a-d.
107. Vgl. zu den beiden Typen fittschen 1999, 39-45.
108. Korinth, arch. Mus. Inv. S 1470: fittschen 1999, 106 Nr.150 Taf. 201e. f.
109. Jüngst wurde von Goette 2008, 195 anm. 17 aufgrund derBohrtechnik eine datierung in antoninische Zeit in erwägung ge-zogen. dem kann ich wegen der oben angestellten Überlegungenzu athen als herstellungszentrum nicht folgen. der datierung an-hand motivischer Parallelen ist m. e. an dieser Stelle der Vorzugzu geben.
110. Vgl. das Bildnis rom, Kapitolinische Museen, Sala degli Im-peratori 38 Inv. 461: fittschen – Zanker 1994, 95-97 Nr. 83.
111. Sehr ähnlich ist das Bildnis rom, Nat. Mus. 88: fittschen –Zanker 1994, 102 replik 15 zu Nr. 88 Beil. 69a. b.
112. anders de Grazia Vanderpool a. o. (anm. 101) 373-375,welche die stilistische Vielfalt als das besondere charakteristikumder korinthischen Bildnisse hervorhebt. diesen eindruck kann ichnach der autopsie der Bildnisse nicht bestätigen. Ich werde dar-auf an anderer Stelle ausführlicher eingehen.
113. Korinth, arch. Mus. Inv. S 1088: Boschung a. o. (anm. 57)65 f. Nr. 17.4 Taf. 51,2. 4.
114. Korinth, arch. Mus. Inv. S 2505: c. c. Vermeule, roman Im-perial art in Greece and asia Minor (cambridge, Mass. 1968) 249abb. 142.
115. auch hier lassen sich attische Porträts nachweisen. Vgl. alsBeispiel die herme Thessaloniki, arch. Mus. Inv. 3026: Κατάλο-γος II, 187-189 Nr. 290 (emm. Voutiras).
116. Vgl. dazu Sturgeon a. o. (anm. 104) 22-24 Taf. 2c.
ΚλΑσΙΚΗ ΠΑρΑΔΟσΗ ΚΑΙ ΝεωΤερΙΚΑ σΤΟΙχεΙΑ σΤΗΝ ΠλΑσΤΙΚΗ ΤΗσ ρωΜΑϊΚΗσ ελλΑΔΑσ
508
abb. 8. augusteisches Privatporträt. Korinth, archäologisches Museum (ridgway 1981, Taf. 97a)
antwortlich. daneben wird Korinth sicher auch ei-gene Werkstätten besessen haben. allein aufgrund derGröße und des Status als Provinzhauptstadt darf mandas annehmen. Wie man sich nun das genaue Ver-hältnis zwischen athen und Korinth in hinsicht aufdie Skulpturenproduktion vorzustellen hat, muss vor-erst offen bleiben und bedarf weiterer Untersu-chungen117.
Schlussbetrachtungen
Betrachtet man alle der forschung zugänglichenmännlichen Bildnisse aus athen, Thessaloniki und Ko-rinth im Überblick, wird deutlich, dass im 1. Jh. allePorträts in ihrer Ikonographie nicht von den im ge-samten Imperium romanum auftretenden Modeer-scheinungen abweichen. erst seit hadrianischer Zeitlassen sich Unterschiede feststellen. Porträts mit de-zidierten ikonographischen rückgriffen auf ältereVorbilder sind ganz spezifisch für athen, währendman sich in Thessaloniki und Korinth weiterhin ander römischen Mode orientierte118. die beidenoben angesprochenen, in ihrer Ikonographie vom ak-tuellen herrscherbild divergierenden Büsten in Thes-saloniki lassen sich in die reihe der seit hadrianischerZeit für rom und andere Gebiete nachweisbaren Por-träts mit “Intellektuellenstilisierungen” mit be-grenztem typologischen rahmen eingliedern.
an dieser Stelle können die Gründe für diese ab-
weichenden Stilisierungen in den einzelnen Städtennicht umfassend erläutert werden. die Unterschiedeim 2. und 3. Jh. aber allein auf die gesteigerte römi-sche Präsenz in Thessaloniki und Korinth zurück-zuführen, geht an der historischen realität vorbei,wie ein Blick in prosopographische Untersuchungenzum kaiserzeitlichen athen zeigt119. eine mono-kausale erklärung wird dem Phänomen sicher oh-nehin nicht gerecht. ein Zusammenhang könnte mög-
117. einen Versuch, eine lokale Werkstatt zu identifizieren, hatM. c. Sturgeon, roman Sculptures from corinth and Isthmia. acase for a local “Workshop”, in: S. Walker – a. cameron (hrsg.),The Greek renaissance in the roman empire, Papers from theTenth British Museum classical colloquium, ΒIcS Suppl. 55 (lon-don 1989) 114-121 unternommen. ob die von ihr angeführtenunfertigen und umgearbeiteten Bildnisse tatsächlich dafür spre-chen, muss m. e. offen bleiben, da man immer auch mit der Mo-bilität von Bildhauern rechnen muss.
118. es ließen sich noch weitere divergierende erscheinungen an-führen, die hier nicht weiter ausgeführt werden können. So gibtes etwa in athen von hadrianischer bis in gallienische Zeit au-ßergewöhnlich viele bekränzte Porträts, die ein bemerkenswertesikonographisches Spektrum aufweisen. aus Korinth haben sichnur sehr wenige Bildnisse mit Kranz erhalten und aus Thessalo-niki gibt aus dem angesprochenen Zeitraum sogar kein einzigesmännliches bekränztes Porträt. Vgl. zu athen vorläufig M. hor-ster – Th. Schröder, Priests, crowns and Priestly headdresses inImperial athens, in: B. alroth – ch. Scheffer (hrsg.), attitudes To-wards the Past in antiquity. creating Identities? International con-ference in Stockholm, May 15-17 2009 (im druck).
119. Vgl. S. G. Byrne, roman citizens of athens, Studia helle-nistica 40 (leuven 2003).
T. Schröder | IM aNGeSIchTe roMS
509
abb. 9. Privatporträt aus dem 2. Viertel des 2. Jhs. Korinth, archäologisches Museum (fot.: Th. Schröder)
abb. 10. Privatporträt aus dem frühen 3. Jh. Korinth, archäologisches Museum (fot.: Th. Schröder)
licherweise in dem jeweiligen politischen Status derStädte gesehen werden. In den hauptstädten der Pro-vinzen gab es vielleicht keine konkreten Impulse, dieretrospektive darstellungsweise zu wählen. Interes-sant ist, dass sich trotz der unterschiedlichen Ge-schichte Thessalonikis und Korinths keine signifi-kanten Unterschiede in diesem aspekt der Selbst-darstellung nachweisen lassen. athen spielte zwar po-litisch keine große rolle mehr, aber Korinth konn-te der Stadt den rang als kultureller und ideeller Mit-telpunkt der Provinz achaia nie streitig machen120.diese Voraussetzungen förderten sicher die heraus-bildung einer auf die eigene Vergangenheit ausge-richteten Selbstdarstellung, zumindest für einen Teilder lokalen athenischen elite. rückgriffe und Bezü-ge auf die eigene Geschichte kann man hier in ver-schiedenen Bereichen und Zeitabschnitten für die ge-samte Kaiserzeit zeigen. Beispiele hierfür wärenetwa die rückführungen einiger Stammbäume auf be-rühmte athener, wie Perikles oder Konon121 oder diean den klassischen Vorbildern orientierten kaiser-zeitlichen Grabreliefs122. die retrospektive darstel-lungsweise bei Porträts trat allerdings nur zwischengrosso modo 130 und 240 auf. dieser spezifischeZeitraum lässt vermuten, dass erklärungen für dieauftretenden Phänomene nur in einem größeren kul-turellen Kontext gesucht werden können. In diesemZusammenhang spielt die im 2. und 3. Jh. reichsweit
präsente sog. Zweite Sophistik123 als ausdruck derWertschätzung der Kultur des alten Griechenlandseine große rolle. darauf kann an dieser Stelle jedochnicht näher eingegangen werden.
Bei der Gegenüberstellung der kaiserzeitlichenmännlichen Porträts aus athen, Thessaloniki und Ko-rinth wurde also deutlich, dass sich keine einheitli-che “griechische” Ikonographie in den Bildnissen wi-derspiegelt. Vielmehr konnten charakteristische Un-terschiede in der Selbstdarstellung der Bürger der ein-zelnen Städte herausgearbeitet werden, die vor demhintergrund der jeweiligen lokalen Gegebenheitenerklärt werden müssen.
Thoralf Schröder M. A.Institut für Klassische ArchäologieFreie Universität [email protected]
ΚλΑσΙΚΗ ΠΑρΑΔΟσΗ ΚΑΙ ΝεωΤερΙΚΑ σΤΟΙχεΙΑ σΤΗΝ ΠλΑσΤΙΚΗ ΤΗσ ρωΜΑϊΚΗσ ελλΑΔΑσ
510
danguillier 2001: c. danguillier, Typologische Untersuchungen zur dichter- und denkerikonographie inrömischen darstellungen von der mittleren Kaiserzeit bis in die Spätantike, BarIntSer 977 (oxford2001).
datsouli-Stavridi 1985: a. datsouli-Stavridi, ρω μαϊκά πορτραίτα στο εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο τηςΑθήνας (athen 1985).
fittschen 1999: K. fittschen, Prinzenbildnisse antoninischer Zeit, BeitreSkar 18 (Mainz 1999).fittschen – Zanker 1994: K. fittschen – P. Zanker, Katalog der römischen Porträts in den capitolinischen
Museen und den anderen kommunalen Sammlungen der Stadt rom I. Kaiser- und Prinzenbildnisse²(Mainz 1994).
Goette 2003: h. r. Goette, Zum Bildnis des Polydeukion. Stiltendenzen athenischer Werkstätten im 2. Jahr-hundert n. chr., in: P. Noelke – f. Naumann-Steckner – B. Schneider (hrsg.), romanisation und re-sistenz in Plastik, architektur und Inschriften der Provinzen des Imperium romanum. Neue funde undforschungen, akten des VII. Internationalen colloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunst-schaffens, Köln 2. bis 6. Mai 2001 (Mainz 2003) 549-557.
Goette 2008: h. r. Goette, ein antoninisches Jünglings–Portrait in Berlin, in: e. Bechraki – M. Kreeb (hrsg.),Amicitiae Gratia. Τόμος στη μνήμη Αλκμήνης σταυρίδη (athen 2008) 189-196.
Kaltsas 2002: N. Kaltsas, Sculpture in the National archaeological Museum, athens (los angeles 2002).
abkürzungen
120. Vgl. etwa haensch a. o. (anm. 3) 323.
121. Vgl. etwa die Beispiele bei J. Touloumakos, Zum Ge-schichtsbewusstsein der Griechen in der Zeit der römischen herr-schaft (Göttingen 1971) 55 f. und K. clinton, a family of eu-molpidai and Kerykes descended from Pericles, hesperia 73, 2004,39-57.
122. von Moock a. o. (anm. 41).
123. Vgl. dazu als Überblick B. e. Borg (hrsg.), Paideia: The Worldof the Second Sophistic (Berlin 2004) und T. Whitmarsh, The Se-cond Sophistic (oxford 2005).
T. Schröder | IM aNGeSIchTe roMS
511
Κατάλογος II: G. despinis – Th. Stefanidou-Tive riou – emm. Voutiras (hrsg.), Κατάλογος γλυπτών τουΑρχαιολογικού Μουσείου Θεσ σαλονίκης ΙΙ (Θεσσαλονίκη 2003).
Krumeich 2004: r. Krumeich, “Klassiker” im Gymnasion. Bildnisse attischer Kosmeten der mittleren undspäten Kaiserzeit zwischen rom und griechischer Vergangenheit, in: B. e. Borg (hrsg.), Paideia: TheWorld of the Second Sophistic (Berlin 2004) 131-155.
lattanzi 1968: e. lattanzi, I rittrati dei cosmeti mel Museo Nazionale di atene (roma 1968).ridgway 1981: B. S. ridgway, Sculpture from corinth, hesperia 50, 1981, 422-448.