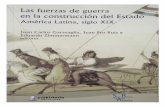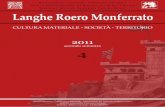avram, bîrzescu, mărgineanu, zimmermann, ausgrabungen in der tempelzone von histria, il mar nero...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of avram, bîrzescu, mărgineanu, zimmermann, ausgrabungen in der tempelzone von histria, il mar nero...
Comitato scientificoM. Balard (Sucy-en-Brie), L. Bianchi (Roma), Sir J. Boardman (Oxford), A. A. M. Bryer (Birmingham), F. Coarelli (Perugia), D. Deletant (London), R. Étienne (Paris), M. Gras (Roma), E. Greco (Napoli–Atene), K. Hitchins (Urbana, Illinois), H. Inalcık (Ankara), A. Ivantchik (Mosca–Bordeaux), S. P. Karpov (Mosca), A. La Regina (Roma), M. Luni (Urbino), L. Marangou (Joannina), J.-P. Morel (Aix-en-Provence), M. Özdoğan (Istan-bul), G. Pistarino (Genova), A. Savvides (Atena), W. Schuller (Konstanz), B. Teržan (Ljubljana–Berlin), P. P. Toločko (Kiev), J. Touratsoglou (Atene), G. R. Tsetskhladze (Melbourne), G. Veinstein (Paris), M. Verzar-Baas (Trieste).
RedazioneV. Ciocîltan, O. Cristea, A. RobuBulevardul Aviatorilor 1 – 011851 Bucureşti - RO
In copertina: Codex Voss. Lat. F. 23, fols. 75v-76r (Biblioteek der Rijksuniversiteit, Leiden).
Prezzo di abbonamento / Prix d’abonnement: € 37
Distribution dans tout pays sauf en ex-URSS et pays de l’EstCID, 131 boulevard Saint-Michel, 75005 ParisTél.: (1) 43-54-47-15, fax (1) 43-54-80-73
© 2013 Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l.via Ajaccio 41-43 - 00198 RomaTel. 0685358444, fax 0684833591email [email protected]
ISSN 1125-3878ISBN 978-88-7140-520-9
Finito di stampare nel mese di febbraio 2014 presso UniversalBook (CS)
Estratti
IL MAR NEROAnnali di archeologia e storia - Annales d’archéologie et d’histoire - Jahrbuch für Archäologie und Geschichte - Journal of Archaeology
and History - Anales de Arqueología e Historia
Direttori: Şerban Papacostea e Alexandru Avram (Bucarest, Romania)
VIII ° 2010/2011
Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l., Roma
Estratti
Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne à la mémoire de Petre Alexandrescu
édités par
ALEXANDRU AVRAM et IULIAN BÎRZESCU
Estratti
ALEXANDRU AVRAM (Bucarest/Le Mans) et IULIAN BÎRZESCU (Bucarest), Notre maître Petre Alexandrescu (1930-2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Liste des travaux de Petre Alexandrescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
*MARIA ALEXANDRESCU VIANU (Bucarest), Considérations sur le culte d’Aphrodite à Histria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23ALEXANDRU AVRAM (Bukarest/Le Mans), IULIAN BÎRZESCU (Bukarest), MONICA MăRGINEANU CÂRSTOIU (Bukarest) und KONRAD ZIMMERMANN (Rostock), Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39FLORINA PANAIT-BÎRZESCU (Bucharest), A New List of Priests of Dionysos Karpophoros from Histria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103JOHN BOARDMAN (Oxford), A Scythian Maenad on the Black Sea . . . . . . . . . . . 113OCTAVIAN BOUNEGRU (Iaşi), Le commerce en Méditerranée orientale. Le témoignage de Philostrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117JAN BOUZEK (Prague), Phoenicians and the Black Sea (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . .125BRIGITTE FREYER-SCHAUENBURG (Kiel), Asklepios, die Buchrolle und das Ei. Zu einem Asklepiostorso auf Samos und weiteren Repliken des Typus Amelung . . . 133CHRISTIAN HABICHT (Princeton), The Eponyms of Cyzicus . . . . . . . . . . . . . . . .171ALAN JOHNSTON (London/Athens), Curiouser and Curiouser, from Histria? . . . .181VASILICA LUNGU (Bucarest) et PIERRE DUPONT (Lyon), Nouveaux frag-ments Hadra d’Istros et Tomis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187FLORIAN MATEI-POPESCU (Bucharest), The Roman Auxiliary Units of Moesia . . 207JUTTA MEISCHNER (Berlin) und ERGÜN LAFLI (Izmir), Der Fischer am Meer. Römische Brunnenlandschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231KEES NEEFT (Amsterdam), A Corinthian Aryballos by the PRK Painter in Bucharest 239MANFRED OPPERMANN (Halle an der Saale), Nymphenkult im Ostbalkanraum zwischen Donau und Rhodopen während der Römerzeit . . . . . .249CONSTANTIN C. PETOLESCU (Bucarest), Bellum Bosporanum . . . . . . . . . . . . . .277ADRIAN ROBU (Paris/Bucarest), Traditions et rapprochements onomastiques dans les cités grecques de la mer Noire : quelques exemples tirés du « monde mégarien » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281GOCHA R. TSETSKHLADZE (Melbourne), The Greeks in Colchis Revisited . . . .295
Abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309
Normes pour la rédaction des articles destinés à la revue Il Mar Nero . . . . . . . . . .313
SOMMARIO
Estratti
I. Einführung
Die Geschichte von Istros (oder lateinisch Histria1) umfaßt einen Zeitrahmen von über 1300 Jahren: sie reicht von der Gründung der Apoikia südlich des Donaudeltas durch die Milesier um die Mitte des 7. Jhs. v. Chr. bis in die unmittelbare Folgezeit nach der Preisgabe der Donaugrenze durch das Byzantinische Reich im Jahre 602 n. Chr. Vielfältige, unter Umständen sogar dramatische Ereignisse entweder welthi-storischen oder bloß lokalgeschichtlichen Zuschnitts haben dabei seine Entwicklung begleitet. Zudem stimmen – zufälligerweise oder nicht – die zeitlichen Einschnit-te der antiken Weltgeschichte mit den Hauptetappen der histrianischen Entwick-lung überein, insoweit am Ende einer jeden Großperiode (etwa der archaischen, klassischen oder hellenistischen Zeit) jeweils eine Zerstörung bzw. ein Wiederauf-bau belegt sind. Die Rekonstruktion der Stadtgeschichte ist zwar weitgehend dem bemerkenswerten Reichtum von über 400 Inschriften zu verdanken (ISM I)2 und berücksichtigt außerdem die spärlichen literarischen Quellen, beruht aber haupt-sächlich auf der Auswertung der archäologischen Resultate, die sich seit 1914, als Vasile Pârvan, der Begründer archäologischer Forschungen in Rumänien, seine erste Grabungskampagne in Histria begonnen hatte, in zunehmendem Maße angehäuft haben. Mit Ausnahme der Weltkriegs- und Nachkriegsjahre fanden und finden hier jährliche Grabungskampagnen statt, die bis heute unter der Leitung des Archäolo-gischen Instituts Bukarest stehen3.
Das histrianische Temenos, das unter dem Namen ‘Tempelzone’ bekannt ge-worden ist, lag von Anfang an im Mittelpunkt des Interesses der Ausgräber von
1 Da in der Fachliteratur der Ort fast immer Histria benannt ist (vgl. dazu auch die 1954 begründete Publikationsreihe), wird im folgenden der lateinische Name benutzt. – Nur die nachchristlichen Zeit-angaben werden mit dem Zusatz “n. Chr.” versehen, alle anderen Daten sollen als “v. Chr.” verstanden werden. – Die Verweise auf Histria IX und XII (siehe Abkürzungen) werden ohne den Namen der Verfas-serinnen (Maria Alexandrescu Vianu bzw. Monica Mărgineanu Cârstoiu) angegeben. Dasselbe gilt für Hi-stria VII (größtenteils Petre Alexandrescu zu verdanken), außer den Fällen, wo Beiträge anderer Autoren innerhalb desselben Bandes zitiert werden. 2 Dazu vor kurzem auch A. Avram, Le corpus des inscriptions d’Istros revisité, Dacia N. S. 51, 2007, S. 79-132.3 Allgemein dazu: P. Alexandrescu und W. Schuller (Hg.), Histria. Eine Griechenstadt an der rumänischen Schwarzmeerküste, Konstanzer althistorische Vorträge und Forschungen, 25, Konstanz, 1990; A. Avram, Histria, in D. V. Grammenos und E. K. Petropoulos (Hg.), Ancient Greek Colonies in the Black Sea, Bd. I, Thessaloniki, 2003, S. 279-340.
ARCHÄOLOGISCHE AUSGRABUNGEN IN DER TEMPELZONE VON HISTRIA, 1990-2009
Alexandru Avram, Iulian Bîrzescu, Monica Mărgineanu Cârstoiu und Konrad Zimmermann
Estratti
40 Alexandru Avram et alii
Histria4. Denn wie sich auch sonst in der griechischen Welt die Stadtgeschichte im Schicksal ihres Temenos konzentriert, so konnten auch in Histria die Hauptetappen der Entwicklung dank der in der Tempelzone erzielten Grabungsergebnisse näher bestimmt werden.
II. Kurzbeschreibung der Tempelzone
Histrias Tempelzone liegt in der nordöstlichen Ecke der Stadt5, und zwar auf einem wenig hohen Schieferfels am Rande des Sinoë-Sees, einer antiken Bucht des Schwarzen Meeres (Taf. I). Während der vorrömischen Zeit befand sich hier vermut-lich die Akropolis der Stadt. In deren westlichem Teil, auf einer niedrigeren Erhö-hung, dem sog. Plateau, wurde dagegen die Zivilsiedlung identifiziert.
Die Landschaft um die Stadt hat sich seit der Gründung der Kolonie stark verän-dert. Wie die Gegend aussah, als sich die ersten Kolonisten hier niedergelassen ha-ben, bleibt weiterhin im Dunkeln. Jedenfalls haben wiederholte geomorphologische und archäomagnetische Untersuchungen bewiesen, daß ein Teil dieser Akropolis infolge einer Meerestransgression, deren Anfänge vermutlich gegen Ende der vor-christlichen Zeit zu datieren sind, überschwemmt wurde. Noch vor Ende des 3. Jhs. n. Chr., als die neue Festungsmauer nach der Gotenzerstörung (wohl um 251 n. Chr.) bereits errichtet worden war, zerschnitt ihre Ostseite, von der übrigens ein Teil während der letzten Kampagnen entdeckt wurde, Reste von Monumenten der ehe-maligen Tempelzone. Die Ostseite des Temenos bleibt also so gut wie unbekannt6.
Die Ergebnisse der bis 1989 durchgeführten Ausgrabungen in der Tempelzone sind 2005 von Petre Alexandrescu, dem die vorliegende Gedenkschrift gewidmet ist, und seinen Mitarbeitern veröffentlicht worden. Einzelne Funde aus der Tem-pelzone wurden außerdem in zahlreichen Beiträgen publiziert. Im folgenden wird hauptsächlich auf die 2005 erschienene Monographie verwiesen, ohne dabei zwei weitere Werke außer Acht zu lassen, die als wertvolle Ergänzungsbände zur Thema-tik zu gelten haben, insoweit sie der Steinskulptur (Histria IX) und den architektoni-schen Fragmenten (Histria XII) gewidmet sind7. Natürlich geht es nicht darum, die
4 Zu den Hauptetappen der Forschungsgeschichte: D. M. Pippidi, Gli scavi nella zona sacra di Histria, Da-cia N. S. 6, 1962, S. 139-156; K. Zimmermann, Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, Ethnographisch-archäologische Zeitschrift 22, 1981, S. 453-467; ders., Griechische Altäre in der Tempelzone von Histria, in R. Étienne und Marie-Thérèse Le Dinahet (Hg.), L’espace sacrificiel dans les civilisations méditerranéennes de l’antiquité, Actes du Colloque tenu à la Maison de l’Orient, Lyon, 4-7 juin 1988, Publications de la Bibliothèque Salomon-Reinach, 5, Paris, 1991, S. 147-154.5 Letzter publizierter Gesamtplan in Histria VII, Klapptafel 1.6 Zur Topographie Histrias: P. Alexandrescu, Notes de topographie histrienne, Dacia N. S. 22, 1978, S. 331-342 = L’Aigle et le dauphin. Études d’archéologie pontique, Bukarest – Paris, 1999, S. 47-63 ; O. Höckmann, G. J. Peschel und Anja Woehl, Zur Lage des Hafens von Histria. Die Prospektionskampagne von 1996, Dacia N. S. 40-42, 1996-1998, S. 55-102. Zur Stadtplanung bleibt der Aufsatz von Monica Mărgineanu Cârstoiu grundlegend, Plans de villes romaines en Mésie inférieure, in W. Hoepfner (Hg.), Bauplanung und Bautheorie der Antike, Diskussionen zur archäologischen Bauforschung, 4, Berlin, 1983, S. 297-315.7 Außerdem seien zwei jüngere Beiträge erwähnt: A. Avram, K. Zimmermann, Monica Mărgineanu Cârstoiu und I. Bîrzescu, Nouvelles données sur la Zone Sacrée d’Histria, in A. Bresson, A. Ivantchik und J.-L. Ferrary (Hg.), Une koinè pontique. Cités grecques, sociétés indigènes et empires mondiaux sur le littoral
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 41
während mehrerer Jahrzehnte angesammelten reichen Erkenntnisse ausführlich zu behandeln; stattdessen scheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine zusammenfas-sende Beschreibung der Tempelzone unerläßlich.
Der Beginn des Heiligtums ist zweifellos mit der Gründung der Stadt zu verbinden. Die ersten Hinweise auf Kulteinrichtungen liefern einige Gruben, die an das Ende des 7. und an den Anfang des 6. Jhs. zu datieren sind. Zu diesen Gruben sakralen Charak-ters gehört vor allem eine, die sicher ein Bothros war, da sie gerade an der nordwest-lichen Ecke des wohl der Hauptgottheit Apollon Ietros dedizierten Tempels (des Mo-numentes A’) lag. Von diesem Kultbau später aller Wahrscheinlichkeit nach teilweise überschnitten, enthielt diese Opfergrube ausschließlich Material aus dem ersten Drit-tel des 6. Jhs. – vornehmlich Keramik und Überreste von Steinskulpturen – und stellt somit wohl einen geschlossenen Befund dar8. Außerdem weist die Datierung einiger Dachterrakotten, vor allem eines Firstkalypters aus dem ersten Viertel des 6. Jhs.9, der eine Weihinschrift an Aphrodite trägt, auf eine erste Reihe von hölzernen Kultbauten hin. Dazu muß u. a. der Oikos gehört haben, der wohl als Vorläufer des nachfolgenden Steintempels für Aphrodite anzusehen ist und auf den noch einzugehen sein wird.
Die ersten Steinmonumente datieren in den Anfang des dritten Viertels des 6. Jhs. Ihre Bau- und späteren Wiederaufbauphasen stimmen im großen Ganzen mit den Hauptetappen der Stadtentwicklung überein. In dem bis 1989 ausgegrabenen Bereich der Tempelzone “trois téménè se partageaient l’espace: celui d’Aphrodite, avec la grande fosse sacrée, celui d’Apollon Iètros et celui de Zeus”10.
Der erste der drei Tempel archaischer Zeit, der zwischen 1949 und 1952 ausge-graben und 1954 von Dionisie M. Pippidi veröffentlicht wurde, ist der Tempel A11. Es handelt sich um einen ionischen Bau, der auf einer niedrigen Plattform liegt, aus ei-nem Adyton, einem Naos und einem Pronaos in antis besteht und Treppen an seiner Vorderseite aufweist12. Die westliche Seite der Plattform wurde noch nicht ausgegra-ben, da sie von einem kaiserzeitlichen Bau überlagert ist. Obwohl im allgemeinen nur Reste der Fundamente und wenige Orthostaten vom Aufbau der Cellawände vorgefunden wurden, ließen sich einige Vermutungen zu gewissen Besonderheiten seines Grundrisses formulieren, die auf die Merkwürdigkeit dieses Baues hinwei-sen13. Von der archaischen Phase ist nur das Tempelfundament erhalten geblieben.
nord de la mer Noire (VIIe s. a.C. – IIIe s. p.C.), Actes du colloque de Bordeaux, 14-16 novembre 2002, Ausonius, Mémoires, 18, Bordeaux, 2007, S. 241-249; A. Avram, I. Bîrzescu und K. Zimmermann, Die apollinische Trias von Histria, in Renate Bol, Ursula Höckmann und P. Schollmeyer (Hg.), Kult(ur)kontakte. Apollon in Milet-Didyma, Histria, Myus, Naukratis und auf Zypern, Akten der Table Ronde in Mainz vom 11.-12. März 2004, Internationale Archäologie, 11, Rahden/Westfalen, 2008, S. 107-144.8 Ausgrabungen K. Zimmermann, 1991 (Publikation in Vorbereitung). Erster Hinweis auf die hier gefun-denen Skulpturfragmente in Histria IX, S. 32-33, Kat. 3-5.9 K. Zimmermann, ∆Afrodivthi ajnevqhken ...... Zu einem Dachziegel mit Votivinschrift, in A. Avram und M. Babeş (Hg.), Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. Hommage à Petre Alexandrescu à son 70e anniversaire, Bukarest, 2000, S. 239-251; ders., in Histria VII, S. 475-476, Ta 319.10 Histria VII, S. 70.11 D. M. Pippidi, Sectorul templului grec, in Histria. Monografie arheologică [I], Bukarest, 1954, S. 231-277.12 Histria VII, S. 80-82.13 D. Theodorescu, Un chapiteau ionique de l’époque archaïque tardive et quelques problèmes concernant le style d’Histria, Dacia N. S. 12, 1968, S. 261-303; Histria XII, S. 384-386 und Abb. 106.
Estratti
42 Alexandru Avram et alii
Mehrere Tiefschnitte haben gezeigt, daß die sich nach Süden richtende Fassade ge-genüber den darauffolgenden Phasen vorgesprungen ist. Zwar gibt es in situ keine aussagekräftigen Befunde, die den Kalksteinoberbau rekonstruieren lassen, dennoch sind manche Vermutungen zur Rekonstruktion der Grundelemente seiner Fassade erwähnenswert, die davon ausgingen, daß ein als ‘A’ bezeichnetes ionisches Kapi-tell (Taf. XII a) zu diesem Kultbau gehörte14. Auf sein archaisches Dach lassen sich darüber hinaus fünf Kalyptere15 und die Fragmente eines Gorgoneions16 beziehen. Zudem weisen die epigraphischen Funde auf die Gottheit hin, der der Tempel ge-weiht war. Es handelt sich um eine Reihe von Graffiti aus der zweiten Hälfte des 5. Jhs., die in dem an der südwestlichen Ecke des Tempels in den Fels eingeschnittenen Bothros entdeckt wurden und die alle die Weihung DI aufweisen17, sowie um ein Dekret aus dem 3. Jh. (ISM I 8), aus dem u. a. zu erfahren ist, daß es in unmittelba-rer Nähe des Altars des Zeus Polieus, der sich üblicherweise vor dem zugehörigen Tempel befunden haben muß, aufgestellt werden sollte. Diese Angaben reichen aus, um den genannten Tempel Zeus zuzuweisen18.
Der zweite, bald nach der Mitte des 6. Jhs. errichtete Tempel (als I bezeichnet) wurde Aphrodite geweiht. Gründe dafür liefern ein paar allerdings spätere Weihin-schriften, weitere Votive, darunter eine archaische Kultschale aus Basalt mit Weihin-schrift19 und vor allem die Weihung des bereits genannten Dachziegels, der mit dem vorhergehenden Oikos aus Holz in Verbindung gebracht worden ist20. Der Tempel besteht aus einem fast quadratischen Naos, einem tiefen Pronaos sowie an der Front einer vermutlichen Säulenstellung in antis und sitzt auf einer niedrigen Plattform (als J bezeichnet), die ihrerseits Treppenstufen sowohl an der Südseite (Taf. XVIII b), d. h. an der Tempelfront, als auch an der Ostseite aufweist21. Dem Tempel, von des-sen archaischer Bauphase nur Fundamentreste erhalten sind, könnte wohl ein 1992 in einem spätantiken Pflaster südöstlich von ihm entdecktes ionisches Antenkapitell (Taf. XI e) angehört haben22. Dank einer großen Zahl von Dachterrakotten, die bei
14 D. Theodorescu, a. a. O., S. 283 ff., Kat. A 3, Abb. 6-7; Histria XII, S. 97-99, Kat. VI.A.1, Taf. XXXIX und 25. Erstes Viertel des 5. Jhs.15 K. Zimmermann, in Histria VII, S. 471, Ta 163-165; S. 476, Ta 320, 321.16 D. Theodorescu, Notes histriennes, RA, 1970, S. 29-31, Abb. 1-2; K. Zimmermann, in Histria VII, S. 481, Ta 394.17 I. Bîrzescu, in Histria VII, S. 414-416, G 1-4, mit der älteren Literatur.18 ISM I 8 erwähnt den Altar des Zeus Polieus. Unsicher bleibt, ob bereits zu jener Zeit die Epiklesis Polieus auch an den Patron des Tempels geknüpft wurde. Daß aber Zeus als Polieus schon im Mo-ment der Errichtung des Tempels in der spätarchaischen Zeit verehrt wurde, ist fraglos auszuschließen. M. Oppermann, Die westpontischen Poleis und ihr indigenes Umfeld in vorrömischer Zeit, Schriften des Zen-trums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, 2, Langenweißbach, 2004, S. 19, stellt sich sogar die Frage, “ob Zeus schon damals einen Tempel besaß und ob allein aufgrund von Graffiti mit Zeusdedikation … das Bauwerk tatsächlich diesem Gott zuzuweisen ist”.19 K. Zimmermann und P. Alexandrescu, Steingeräte griechischer Zeit aus Histria, Dacia N. S. 24, 1980, S. 275-279, Nr. 4, Abb. 4/3 und 6.20 Vgl. Anm. 9.21 Histria VII, S. 159-173, Abb. 5, Taf. 1.1, 3.3-5, 4.1-2, 6.2, 8.1, 11.1, 12.1, Klapptafeln 3-5.22 Monica Mărgineanu Cârstoiu, Ein spätarchaisches ionisches Kapitell von Histria. Bemerkungen zur geome-trischen Komposition, in A. Avram und M. Babeş (wie Anm. 9), S. 252-273; Aenne Ohnesorg, Ionische Altäre. Formen und Varianten einer Architekturgattung aus Insel- und Ostionien, Deutsches Archäologisches Institut,
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 43
Tiefgrabungen im Pronaos entdeckt wurden, darunter auch solchen mit ornamen-talem Dekor, läßt sich wenigstens ein Eindruck von der vielfarbigen Bedachung des Tempels gewinnen23.
In dieselbe spätarchaische Zeit (zweite Hälfte des 6. Jhs.) gehört seiner stratigra-phischen Lage nach auch das Monument H, weil es später vom frühhellenistischen Monument G überlagert wurde. Obwohl nur die unteren Steinlagen in Gestalt einer Plattform erhalten blieben, könnte H wegen seiner Dimension und Rechteckform ei-nen Altar getragen haben; trifft diese Vermutung zu, wäre es verlockend, in ihm den Zeus-Altar zu sehen, da er einerseits der einzige ist, der in diese ältere Zeit gehört, andererseits vor dem Zeus-Tempel liegt24. Weiter östlich befindet sich ein zeitlich jüngerer Kalksteinblock mit einem Ring aus Bronze, an den Opfertiere angebunden werden konnten25.
Ein dritter Tempel (als A’ bezeichnet) wurde östlich von Tempel A (Zeus-Tempel) entdeckt. Von diesem sind nur wenige Baureste erhalten geblieben, da er fast voll-ständig während der Errichtung der spätrömischen Festungsmauer zerstört wurde. Es handelt sich um Fundamentreste im Norden und Westen, spärliche Teile seines Oberbaus an der westlichen Langseite sowie an seiner Südwestecke. Der nahe sei-ner Nordwestecke in den gewachsenen Schieferfels eingeschnittene und – wie oben bereits angedeutet26 – möglicherweise vom Tempelfundament teilweise überdeckte Bothros läßt demzufolge eher einen terminus post quem für den Tempel als Gleich-zeitigkeit zu. Obwohl verlockend, kann also nicht auf dasselbe frühe Datum ge-schlossen werden und das Bauwerk stellt nicht den ältesten Tempel des Temenos dar, zumal auch hier eine Holzphase nicht auszuschließen ist27. Petre Alexandrescu hat vorgeschlagen, diesen Tempel dem Apollon Ietros zuzuweisen28. Das südlich vom Tempel A’ liegende Monument E könnte seinerseits ein Altar und nach Mei-nung desselben Autors dem genannten Tempel zuzuordnen sein.
Archäologische Forschungen, 21, Berlin, 2005, S. 182-184 (vermutet, daß dieses Kapitell einem Altar hät-te angehören können); Histria XII, S. 100-102, Kat. VI.A.3a, Taf. XL und 27. Als Kapitell ‘B’ bezeichnet, um 490-470. Ist diese Zuweisung haltbar, so würde das Datum dieses Kapitells einen chronologischen Hinweis auf den Wiederaufbau des Tempels nach der höchstwahrscheinlich um 490 anzusetzenden Zer-störung des Temenos (S. 44-45) liefern. Unter Vorbehalt (“éventuellement”, S. 96) könnte man demselben Tempel auch die sehr fragmentarisch erhaltenen Kapitelle Histria XII, S. 103, Kat. VI.A.3b-d, Taf. XLI und 27-28, zuweisen. Zu einem Neufund siehe ferner Anm. 87.23 K. Zimmermann, in Histria VII, S. 463-466, Ta 4-7, 9, 10, 12-16, 18, 19, 24-38, 43-46, 48-87, 93-96 (Flach-ziegel); S. 472-475, Ta 167-180, 226-274, 281-290, 341-347 (Deckziegel); S. 480-481, Ta 369, 370 (Verklei-dungsplatten), Ta 392 (Sima), Ta 395 (Gorgoneion-Antefix).24 Histria VII, S. 203-204, Abb. 1.1-2, 2.1., Taf. 33.1-2, 119, 127.25 Monument h; Bronzering durch Vandalismus verloren. K. Zimmermann, Griechische Altäre (wie Anm. 4), Taf. 40b (rechts unten); Histria VII, S. 202, Taf. 37.1. Zu den mit Ring versehenen Opferblöcken siehe im allgemeinen Cl. Parisi Presicce, Il bue alla corda e le guance degli altari cirenei, Karthago 24, 1999, S. 75-116.26 Vgl. S. 41 mit Anm. 8.27 Diesem Tempel könnte dann wohl das Fragment eines spätarchaischen Antenkapitells angehören, das etwas früher als das Kapitell ‘A’ (vermutlich Zeus-Tempel; vgl. Anm. 14) zu datieren ist: D. Theodorescu, Remarques sur la composition et la chronologie du kymation ionique suscitées par quelques exemplaires découverts à Histria, Dacia N. S. 11, 1967, S. 101 ff., Abb. 14 ff.; Histria XII, S. 100, Kat. VI.A.2, Taf. XXXIX und 26. Dieses Kapitell weist Aenne Ohnesorg (wie Anm. 22), S. 183, unter Vorbehalt dem weiterhin noch als Zeus-Altar interpretierten Monument D zu. Zu dem Monument D siehe aber jetzt Anm. 56.28 Histria VII, S. 83-84.
Estratti
44 Alexandru Avram et alii
Eine noch nicht völlig beantwortete Frage betrifft das Monument C, das als Propy-lon des Temenos interpretiert und in seinem jetzigen Erhaltungszustand in frühhel-lenistische Zeit datiert wurde. Da aber seine Flucht mit denen der Fassaden der in ar-chaischer Zeit errichteten Tempel A und A’ übereinstimmt, hatte Petre Alexandrescu angenommen, daß es wie auch andere Kultbauten derselben Zone schon in dieser Zeit einen Vorläufer gehabt haben müsse29. Die Reste des Monumentes sind aber lei-der schwer lesbar, zumal es inzwischen eine nicht von Eingriffen freie Restaurierung erfahren hat. Deshalb bleibt die nach wie vor verlockende Hypothese, wonach es sich um ein Propylon gehandelt haben könne, unbewiesen30. Archäologisch sind nur zwei Phasen belegt. Die ältere entspricht laut Petre Alexandrescu dem Ende des 4. oder dem Anfang des 3. Jhs., doch bleibt offen, ob dieser Zeitansatz mit dem eigent-lichen Errichtungsdatum des Monumentes in Verbindung gebracht werden kann. Beim jetzigen Forschungsstand erlauben die von jenem selbst gemachten wichtigen Beobachtungen zu den für die horizontalen Schichtverbindungen benutzten Klam-mertypen sowie gewisse Elemente, die sich aus der Vermessung ergeben, durch-aus die Vermutung, daß der ersten sichtbaren Phase eine viel ältere, vielleicht sogar hochklassischer Zeit zugehörige vorausging. Wie dem auch sei, man besitzt auch kein entscheidendes Argument dafür, daß schon während dieser vermuteten Früh-phase das Monument C bereits ein Propylon dargestellt hätte.
Die Tempelzone wurde wie die ganze Stadt unter Umständen, die noch unklar bleiben, gegen Ende der archaischen Zeit zerstört. Dafür ist der Perserfeldzug unter Dareios im Jahre 514 in Betracht gezogen worden, aber der archäologische Sachver-halt31 scheint zu einem solch hohen Datum kaum zu passen. Vermutlich sollte man weiterhin mit den Persern rechnen, doch wird der Kontext ein anderer gewesen sein. Allerdings scheint im Tumulus XII der Hügelnekropole von Histria, der auf Grund der keramischen Funde in den Anfang des 5. Jhs. zu setzen ist, ein örtlicher Feldherr bestattet worden zu sein, der allem Anschein nach einen Sieg über die Perser errun-gen hatte, weil nämlich an der Grenze der Bestattungsfläche Reste von nicht weni-ger als fünfunddreißig auf menschliche Opfer hinweisende und auf Grund anthro-
29 Ebd., S. 187-197, Abb. 2.2, 3.1, Taf. 26-32. Dabei wurde u. a. davon ausgegangen, daß das Monument C auf Grund einer vermutlichen Ante, die aber nur innerhalb des Fundamentes entdeckt wurde, ein dori-sches Gebäude war (S. 194).30 Die Annahme eines Propylon beruht zudem auf dem Eindruck, daß die von D. Theodorescu, Date noi în legătură cu pătrunderea stilului doric la Histria, SCIV 16, 1965, S. 486-487 (vgl. Monica Mărgineanu Cârstoiu, Ein neuer Vorschlag für die statistische Analyse der Komposition der dorischen Kapitelle, Dacia N. S. 38-39, 1994-1995, S. 73) bloß als Beispiel angegebene Rekonstruktion eines dorischen Monumentes (eine Hypothese, die ihrerseits selbst davon ausgeht, daß ein in der spätrömischen Zeit als Säulenbasis in der Nähe des Monumentes C wiederverwendetes dorisches Kapitell und ein im Dorf Sinoë entdeckter und eine Inschrift tragender Marmorarchitrav, ISM I 144, zu demselben Bau gehört hätten) perfekt auf das Monument C passen würde. Daraus ergäbe sich, daß jenes in die letzten Jahre des 4. Jhs. datierte dori-sche Kapitell, das auch nur vermutungsweise mit dem Marmorarchitrav von Sinoë in Zusammenhang gebracht wurde, die Chronologie des Propylon sichern würde. Doch ist auf derselben hypothetischen Ebene zu bemerken, daß, von demselben Architrav von Sinoë ausgehend, auch eine andere Rekonstruk-tionsvariante möglich erscheint, die eher zu einem Tempel als zum Monument C passen würde (Histria XII, S. 455-465).31 Histria VII, S. 95-96. Die Anwesenheit der attischen C-Schalen (Kat. C 112 und 113), die bis auf 500 zu reichen scheinen, und vor allem gewisser “pièces un peu plus tardives” in der Zerstörungsschicht eröff-nen die Möglichkeit einer späteren Datierung dieses Ereignisses.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 45
pologischer Analysen iranischen Typen zuzuweisende Skelette freigelegt wurden32. Demnach könnte es sich um persische Soldaten handeln, was sich übrigens auch durch die in der Zivilsiedlung gemachte Entdeckung einer einheitlichen Gruppe von 13 persischen Zaumzeugornamenten noch untermauern läßt33. Zieht man alle diese Angaben sowie den unentbehrlichen Herodot in Betracht (auch wenn der Historiker seine Aufmerksamkeit fast ausschließlich auf das ägäische Thrakien lenkt), so ließen sich die Ereignisse wohl auf folgende Art und Weise rekonstruieren: Anläßlich ihres Skythenfeldzuges im Jahre 514 hätten die Perser in Histria bloß eine bescheidene Garnison eingerichtet; diese müßte dann kurz nach 499 im Zusammenhang mit dem ionischen Aufstand (vgl. Hdt. 5, 103 zur Solidarität der Byzantier und thrakischer Küstenstädte mit Ionien) niedergemetzelt worden sein, was einerseits der Tumulus XII mit seinen menschlichen Opfern, andererseits die iranischen Zaumzeugbeschlä-ge nahelegen; dafür hätten sich wohl später – vermutlich im Kontext des Feldzuges des Mardonios in Thrakien im Jahre 492 (Hdt. 6, 43-45) – die Perser gerächt, indem sie die Stadt zerstörten34.
Wie dem auch sei, der Wiederaufbau der Tempelzone hat frühestens nach den siebziger Jahren, wenn nicht sogar erst um die Mitte des 5. Jhs. stattgefunden, und zwar nach einem Programm, das das archaische Erbe an Bauformen weitgehend übernommen zu haben scheint. Der offenkundig tiefgreifend zerstörte Altar H wurde dabei aufgegeben und entweder durch den Altar G, dessen Quader ihn z. T. überlagern, oder – weniger wahrscheinlich – vom daneben etwas gegen Norden lie-genden Monument F ersetzt. Gleichzeitig wurden auf den vorhandenen Fundamen-ten die Zeus und Aphrodite geweihten Tempel neu errichtet35, höchstwahrschein-lich auch andere Monumente, für die uns aber die konkreten Angaben fehlen36. Für den Zeitpunkt dieser Bautätigkeit liefern neun vollständig erhaltene chiotische
32 P. Alexandrescu, in E. Condurachi (Hg.), Histria II, Bukarest, 1966, S. 155-159; ders., Un rituel funéraire homérique à Istros, in Juliette de La Genière (Hg.), Nécropoles et sociétés antiques (Grèce, Italie, Languedoc), Actes du Colloque international de Lille, 1991, Cahiers du Centre Jean-Bérard, 18, Paris, 1994, S. 15-32 = L’Aigle et le dauphin (wie Anm. 6), S. 117-137, mit zusammenfassender Darlegung der Knochenanalysen.33 Ders., Însemnări arheologice histriene. Ornamente de căpăstru achemenide la Istros. Perşi, sciţi şi saci, Pontica 41, 2008, S. 119-143; ders., Achämenidische Zaumzeugornamente in Istros. Perser, Skythen, Saken, Archäologi-sche Mitteilungen aus Iran und Turan 42, 2010, S. 267-284.34 Zur Politik der Perser in Thrakien von Dareios bis auf Mardonios siehe vor allem H. Castritius, Die Okkupation Thrakiens durch die Perser und der Sturz des athenischen Tyrannen Hippias, Chiron 2, 1972, S. 1-15; A. Fol und N. G. L. Hammond, Persia in Europe, Apart from Greece, in The Cambridge Ancient History IV2, Cambridge, 1988, S. 234-253; E. Badian, Persians and Milesians in Thrace at the End of the 6th Century BC, in Athena Iakovidou (Hg.), Thrace in the Graeco-Roman World, Proceedings of the 10th International Congress of Thracology, Komotini – Alexandroupolis 18-23 October 2005, Athen, 2007, S. 36-43.35 Wären die Kapitelle ‘A’ (Anm. 14) und ‘B’ (Anm. 22) dem Zeus-Tempel bzw. dem Aphrodite-Tempel mit Sicherheit zuzuweisen, so würde ihre Datierung (erstes Viertel des 5. Jhs. bzw. ca. 490-470) den Zeit-punkt dieser Arbeiten stützen.36 Darauf weisen einzelne Architekturstücke hin, die sich mangels aussagekräftiger Anhaltspunkte den bisher bekannten Denkmälern nicht genau zuweisen lassen, so etwa ein keramischer Altaraufsatz (oder etwas anderes?) aus der ersten Hälfte des 5. Jhs.: K. Zimmermann, Akroter oder Altaraufsatz?, in Renate Rolle, Karin Schmidt und R. F. Docter (Hg.), Archäologische Studien zu Kontaktzonen der antiken Welt [Hans Georg Niemeyer gewidmet], Veröffentlichungen der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften Ham-burg, 87, Göttingen, 1998, S. 849-856, Taf. 64; vgl. Marie-Françoise Billot, RA, 2000, 2, S. 363: “sima d’angle droit de rampant”, spätere Datierung; Aenne Ohnesorg (wie Anm. 22), S. 182, Anm. 1013: “Das Fragment könnte m. E. aber ebensogut das Eckakroter eines kleinen Baus sein”.
Estratti
46 Alexandru Avram et alii
Transportamphoren, die mit der Mündung nach unten in den Fußboden der zweiten Phase des Zeus-Tempels als Opfergaben eingegraben wurden und die in das zweite Viertel des 5. Jhs. gehören37, ebenso einen gewissen chronologischen Anhaltspunkt wie ein während der neuesten Ausgrabungen zum Vorschein gekommener Kom-plex um den Bau M, der später behandelt wird.
Die Architekturfragmente sprechen für eine an der ionischen Bauordnung fest-haltende Stadt. Die absolute Vorherrschaft des Ionischen seit dem Beginn der Stein-architektur, insgesamt seit dem dritten Viertel des 6. bis an das Ende des 4. Jhs., wird von den Neufunden kaum in Frage gestellt. Obwohl bis in hellenistische Zeit die Kalksteinarchitektur vorherrschte, kannte Histria schon seit dem Ende des 6. oder dem Anfang des 5. Jhs. den Marmor, jedoch – soweit beim jetzigen Forschungsstand erkennbar ist – nur für gewisse Bestandteile von Altären. Indem sie vor allem unter orientalischen Einflüssen, in gewisser Weise aber auch unter Nachwirkungen des okzidentalen Stils steht, erweist sich die histrianische Architektur schon seit ihren Anfängen fähig, fremde Vorbilder umzuarbeiten. Zu den ältesten Architekturfrag-menten aus Stein gehören eine cavetto-artige Bekrönung mit gemalten hängenden Blättern (Taf. XI c)38, die zusammen mit einem Pfeilerdenkmal, das sie vielleicht einst in der Nähe des Zeus-Tempels bekrönt hat, ihre Einzigartigkeit ausmachte und so den besonderen Charakter des Tempels hervorhob, sowie ein Scheibenakro-ter mit eingeritztem und vielleicht bemaltem Dekor (Taf. XI a)39. Sie weisen auf eine Architektur hin, die sowohl von der Kleinkunst beeinflußt ist als auch die Absicht verfolgt, neue Ideen in Steinmaterial umzusetzen40. Die ionischen Kapitelle vom Ende des 6. oder aus den ersten Jahrzehnten des 5. Jhs. widerspiegeln in ihrer pla-stischen Körperlichkeit und der Intimität ihrer Komposition die Fähigkeit der hi-strianischen Architektur, neueste Anregungen aufzugreifen und zugleich zu expe-rimentieren. Verschiedene miteinander verbundene Einflüsse aus Kleinasien, dem äolischen und dem Inselgebiet zeigen ein paar bemerkenswerte Architekturglieder, die hauptsächlich den Kultbauten der bisher ergrabenen Tempelzone zuzuordnen sind, d. h. dem Zeus-Tempel, eventuell dem als A’ bezeichneten Tempel oder dem Aphrodite-Tempel (Taf. XII a-c)41. Die ionischen Kymatien (Taf. XI d) und die mit Anthemien dekorierten, von Altären oder anderen Kultbauten stammenden An-tenkapitelle, die strukturell dem Stil Kleinasiens verpflichtet sind (Taf. XI e), führen in die histrianische Formensprache der ersten Jahrzehnte des 5. Jhs. ihrerseits For-men aus einer “vaste koinè culturelle, aux horizons de laquelle brillent des centres comme Milet, Didymes, Samos, Paros ou Thasos” ein42. Ein quantitiv sehr schwach vertretener Klassizismus drückt sich dagegen vor allem in zwei ionischen Kapitel-len (aus einer Zeit wahrscheinlich vor der Mitte des 5. Jhs. bzw. aus dessen letztem
37 Histria VII, S. 99-100; vgl. P. Dupont, ebd., S. 242.38 Histria XII, S. 81-90, Kat. V.4, Abb. 13-14, Taf. XXXV-XXXVII und 23. Dort wird u. a. die Vermutung geäußert (S. 90), daß dieses Monument und der Zeus-Tempel das Werk desselben Baumeisters gewesen sein könnten.39 Ebd., S. 90-95, Kat. V.5, Abb. 15-16, Taf. XXXVIII und 24.40 Ebd., S. 84-90.41 Kapitelle VI.A.1, VI.A.2, VI A 3 a-b; dazu ebd., S. 97-103 (mit Literatur). 42 Ebd., S. 14.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 47
Viertel)43 aus, deren gewissermaßen empfindliches kompositionelles Suchen diese eher mit dem attischen Festland verbindet, wenn dabei auch die kleinasiatische ‘Erinnerung’ nicht ganz verloren geht.
Die zweite Zerstörung der Stadt bzw. ihres Temenos hat offenbar kurz nach 313 stattgefunden, als Lysimachos eine Strafexpedition gegen die westpontischen grie-chischen Städte unternahm44. Der erneute Wiederaufbau der Tempelzone ab dem Ende des 4. Jhs. ging zugleich mit ihrer Umgestaltung einher. Außer der neuen Bau-phase (III) des Aphrodite-Tempels mit gesicherter prostyler Front, von dem sogar das untere Wandprofil und die darauf folgende Orthostatenreihe des Oberbaus in großen Teilen erhalten geblieben sind, handelt es sich vor allem um die Einführung neuer Kulte, die nach architektonischem Ausdruck verlangten. Um die Mitte des 3. Jhs. wurde ein neuer Tempel dem “Großen Gott” (Theos Megas) geweiht (Taf. XIV a-a’). Innerhalb der Tempelzone an einer Stelle abgelegt, wurden davon mar-morne Bestandteile ausschließlich seiner Fassade dorischer Ordnung gefunden45, darunter auch ein Architrav mit der Weihinschrift eines gewissen Peisistratos aus Thasos (ISM I 145), der diesen Bau dem Theos Megas geweiht hatte46. Da offenbar nur die Fassadenteile aus Marmor gefertigt waren, wird für den übrigen Bau der auch sonst übliche Kalkstein verwendet worden sein. Andere, dank inschriftlicher Belege nachweisbare Kulte werden über bescheidenere Bezirke verfügt haben; von solchen sprechen z. B. die Grenzsteine der Kultbezirke für Apollon Pholeuterios47 oder Phorkys48.
Der Beginn einer deutlichen Umgestaltung der Tempelzone ab dem Ende des 4. Jhs. wird also noch vom Aufkommen der dorischen Ordnung in Histria, das genau
43 Ebd., S. 103-105, Kat. VI.A.4, Taf. XLII und 28; S. 106-107, Kat. VI.A.5, Taf. XLIII-XLIV und 29. Zudem ließe sich das Bild der attischen Einflüsse noch erweitern, je nachdem wie die schwierige, aber grundle-gende Frage der Rekonstruktion eines ionischen Eckkapitells aus einem leider wenig aussagekräftigen Fragment, ebd., S. 127-136, Kat. VI.B.1, Abb. 17-21, Taf. LVII und 37 (5.-4. Jh. oder späte Kopie?) beantwor-tet wird.44 Histria VII, S. 106-108, mit einer Zusammenfassung der historischen Ereignisse, wobei aber P. Alexan-drescu einen späteren Zeitpunkt nicht ausschließt.45 Zu einem Neufund siehe ferner Anm. 114.46 Gabriella Bordenache und D. M. Pippidi, Le temple de Qeo;" Mevga" à Istros, BCH 83, 1959, S. 455-465. Zu den Bauelementen und verschiedenen Vorschlägen für die Rekonstruktion der Fassade: Monica Mărgineanu Cârstoiu, Der Theos-Megas-Tempel von Histria. Die Architektur, Dacia N. S. 33, 1989, S. 79-110; dies., Bauelemente des Theos-Megas-Tempels von Histria, in A. Hoffmann, E.-L. Schwandner, W. Hoepfner und G. Brands (Hg.), Bautechnik der Antike, Diskussionen zur archäologischen Bauforschung, 4, Mainz, 1991, S. 39-58; Histria XII, S. 406-431. Zum Charakter der Gottheit: Maria Alexandrescu Vianu, Théos Mé-gas, Dacia N. S. 43-45, 1999-2001, S. 73-78; dies., in Histria VII, S. 127-137, mit kritischem Bezug auf die ältere Literatur.47 ISM I 105 (eher ein Horos als eine Weihung). Ju. G. Vinogradov, Heilkundige Eleaten in den Schwarz-meergründungen, in M. Dreher (Hg.), Bürgersinn und staatliche Macht. Festschrift für Wolfgang Schuller zum 65. Geburtstag, Konstanz, 2000, S. 133-149 (SEG 51, 976), hatte diese Epiklesis auf den fwleov" der Eleaten bezogen und daher versucht, Spuren der von Parmenides gegründeten Sekte in mehreren Schwarzmeer-städten zu identifizieren. Zurückhaltend dazu L. Vecchio, Medici e medicina ad Elea-Velia, in Giovanna Greco (Hg.), Elea-Velia. Le nuove ricerche, Atti del Convegno di Studi, Napoli, 14 dicembre 2001, Pozzuoli, 2003, S. 256-257 (SEG 53, 787 und 1114). 48 ISM I 106 (eher ein Horos als eine Weihung) und zwei Graffiti, die I. Bîrzescu, in Histria VII, S. 418-420, G 9, ausführlich kommentiert hat. Die Weihinschrift des Graffito G 9 beweist, daß diese Gottheit schon in der archaischen Zeit in Histria verehrt wurde.
Estratti
48 Alexandru Avram et alii
in diese Zeit fällt, verstärkt. Damit entsteht zugleich ein für die Erhellung des Ver-hältnisses zwischen der Entwicklung der histrianischen Denkmäler und der Stadtge-schichte grundlegendes Problem. Denn es könnte sich dabei um eine die Stilgrenzen weit überschreitende Strukturentwicklung handeln, die sich in der möglichen Um-wandlung beliebiger Kultdenkmale vom Ionischen ins Dorische widerspiegelt. Eine solche Veränderung hätte nur infolge einer dramatischen Zerstörung a fundamentis des besagten ionischen Kultbaus stattfinden können, was womöglich auf die Ereig-nisse um 313 zurückzuführen wäre. Unabhängig von der Bestimmung dieses ersten dorischen Kultbaus in Histria (Umgestaltung des Apollon-Temenos49 oder sogar des Apollon-Tempels selbst50) erlaubt die große Zahl dorischer Kapitelle und Gebälk-elemente die Annahme, daß man es während der hellenistischen Zeit mit “une vé-ritable hégémonie du dorique” zu tun hat51. Außer dem genannten ersten dorischen Denkmal, zu dem der eine Weihung an Apollon tragende Architrav (ISM I 144) ge-hörte52, weisen zwei weitere dorische Tempel mit Marmorfassade nachdrücklich auf die Besonderheiten der histrianischen ars aedificandi hin. Obwohl die hellenistische Architektur durch ihre Tempel mit drei Metopen pro Säulenjoch, ihren Stil und ihre Fassadenkomposition gewisse orientalische Einflüsse aufgreift, die sich vor allem durch die Wahl einer ‘pergamenischen’ Lösung für den Theos-Megas-Tempel53 be-legen lassen, verbreitete sich das Dorische durch Vermittlung der Kykladen, deren Stilkonzept entscheidend durch schlanke Säulen und breite Abstände dazwischen geprägt wird54. Beide Tempel (von denen allerdings nur der für Theos Megas archi-tektonisch teilrekonstruiert werden konnte) scheinen infolge dramatischer Ereignis-se zugrunde gegangen zu sein, vielleicht wegen eines Erdbebens. Danach wurde der schon genannte Theos-Megas-Tempel nie wieder errichtet, während der andere, der aus derselben stilistischen Matrix stammt, anscheinend einen Wiederaufbau er-fahren hat (Taf. XIV b-b’)55. Die erhaltenen Bauteile des Theos-Megas-Tempel hat Petre Alexandrescu mit dem Monument D, das in der älteren Literatur als Altar in-terpretiert worden war, in Verbindung gebracht. Seiner Meinung nach ergäbe sich dadurch ein nach Osten orientierter Tempel, dessen Reste – vergleichbar der Situati-on beim Tempel A’ (Apollon?) – durch die Errichtung der spätrömischen Festungs-mauer größtenteils abgetragen wurden56. Von einem vierten dorischen Denkmal mit
49 D. Theodorescu (wie Anm. 30), S. 486-487. 50 Histria XII, S. 455-465.51 Ebd., S. 187.52 Es handelt sich um das Denkmal, das Ausgangspunkt für den in Anm. 30 erwähnten Rekonstruk-tionsversuch war.53 Vgl. Anm. 46 und 56.54 Histria XII, S. 452.55 Belegt ist er nur durch im Museum von Histria ohne genaue Fundangaben verwahrte architektonische Fragmente; daher wurde der Kultbau konventionell als ‘Tempel X’ bezeichnet (Histria XII, S. 432-454, Taf. CXXXVII-CXL).56 Zum Verhältnis zwischen den in situ gefundenen membra disiecta und dem Monument D sowie für einen neuen Rekonstruktionsvorschlag des Tempels: P. Alexandrescu, Le temple de Théos Mégas redressé, Dacia N. S. 43-45, 1999-2001, S. 79-96; Histria VII, S. 174-186, Abb. 2.2, Taf. 1.1, 2.2, 22.1-25.3, 34.2, 37.1, 110, Klapptafeln 7-8. Die Frage bleibt aber weiterhin offen.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 49
Marmorelementen (Tempel?)57 läßt sich behaupten, daß es bereits während seiner Errichtung eine Reparatur erfahren hat58.
Indessen besteht das ‘ionische Histria’ fort, wobei sich dies allerdings eher in der Kleinarchitektur, d. h. durch Statuenbasen, Votive oder allerlei Bauzubehör wie etwa Sakralumzäumungen oder Brunnen, ausdrückt59. Der Wiederaufbau der Tem-pel in hellenistischer Zeit bietet die Gelegenheit, die Umrahmungen der Türen zu ‘modernisieren’. Zeugnisse dafür stellen ein Hyperthyron60 aus Marmor mit gera-der Girlande und ionischem Kymation über der dreiteiligen Leiste sowie die Ge-simsbekrönungen61 dar, deren Friese mit Palmetten- und Lotusblumen, manchmal auch mit lesbischen Kymatien dekoriert sind (Taf. XIII b-c). Außerdem sind Altäre, Statuenbasen sowie andere Kultbauten durch eine auffällige Vielfalt ihrer dekora-tiven Friese mit Bukranien, Girlanden und Rosetten geschmückt. So entsteht das Bild einer Stadt, die mit der Fähigkeit, ihre kultische Vergangenheit zu rekonstru-ieren, zugleich ihre Vitalität nicht verloren hat. Der Ornamenttyp mit Lorbeerblät-tern verzierter Girlanden erreicht seinen stilistischen Höhepunkt im 2. Jh. mit der Basis der von Athenagoras der Aphrodite geweihten Statue (ISM I 113)62. Als noch spektakulärer erweist sich nicht nur zahlenmäßig, sondern vor allem durch seine mögliche Verbindung mit dem in Histria epigraphisch belegten Samothrakion63 der Ornamenttyp mit (vermutlich bemalten) Flachgirlanden64. Offenkundig bleibt bis in die späthellenistische Zeit die architektonische Vielfalt Histrias bestehen, obwohl die Einzelstücke allein nicht ausreichen, um die komplexe Gestalt einer Stadt, deren Hauptdenkmäler erst am Ende dieses Zeitabschnittes zerstört wurden, rekonstruie-ren zu können. Immerhin bezeugen die membra disiecta für das hellenistische Histria einen gewissen Wohlstand, der es ihm erlaubte, sowohl den Marmor für die Er-richtung neuer Tempel, die Teilerneuerung älterer Kultbauten oder die Ausstattung letzterer mit Votiven zu importieren als auch die Baumeister, die dieses prächtige Material zu bearbeiten fähig waren, an sich zu binden.
57 Konventionell als ‘Tempel N’ bezeichnet: Histria XII, S. 465-467.58 Ebd., S. 465: “Ces monuments doriques dont on ignore l’emplacement, sauf peut-être le problématique temple de Théos Mégas, témoigneraient de l’existence d’un groupe de temples qui attendent à être mis au jour. La découverte de leur emplacement s’avère essentielle, et non seulement de la perspective archi-tecturale. Il se peut que le désastre, dont nous ignorons les proportions, et qui a produit l’abandon total d’une partie importante de la Zone Sacrée, n’eût pas atteint tous les temples histriens”.59 Darüber hinaus wurden auch zwei Fragmente von ionischen Marmorkapitellen sowie ein ionisches Kalksteinkapitell gefunden, die in die hellenistische Zeit gehören könnten. Die Datierung dieser Stücke bleibt aber offen: ebd., S. 107-110, 113, Taf. XLV-XLVI.60 Ebd., S. 294-298, 467-470, Kat. IX.E, Abb. 97, Taf. LXXVIII und 49.61 Ebd., S. 71-75, Kat. IV.11.a-e, Taf. XXX-XXXII und 20-21.62 Zu Fundumständen und Interpretation: G. Bordenache, Sculture greche e romane nel Museo Nazionale di Antichità di Bucarest I. Statue e rilievi di culto, elementi architettonici e decorativi, Bukarest, 1969, S. 124, Nr. 278; Histria IX, S. 89-96, Kat. 105, Abb. 5-8, Taf. 44-45 (wo Maria Alexandrescu Vianu die Friese dieser Basis etwas früher, d. h. in das 3. Jh. ansetzt); Histria XII, S. 397-406 und Taf. CXXIII-CXXIV.63 Ein Heiligtum der Götter von Samothrake erwähnen seit dem 3. Jh. die Inschriften ISM I 11, 19, 36 (ergänzt von A. Avram, Autour de quelques décrets d’Istros, Pontica 33-34, 2000-2001, S. 344-348; vgl. SEG 51, 936) und 58.64 Insofern bedeutet Histria eine Ausnahme, als die Friese mit Flachgirlanden im allgemeinen ein weni-ger verbreitetes Ornament darstellen (vgl. Histria XII, S. 313).
Estratti
50 Alexandru Avram et alii
Die dritte Zerstörung der Tempelzone fand allem Anschein nach infolge eines Erdbebens um das Jahr 100 statt. Die Untersuchungen des Aphrodite-Tempels liefer-ten dafür mehrere Hinweise. Sein Inventar muß gerettet worden sein, was eine Plün-derung ausschließt, und der Tempel selbst wurde in größter Eile wieder aufgebaut (Phase IV: ca. 100-48), indem dafür ältere Bauglieder als Spolien benutzt wurden. Zudem verlegte man im Pronaos Kieselsteine zu einem Mosaik und bedeckte die Treppen an der Ostseite des Gebäudes mit einem Estrich65.
Um die Mitte des 1. Jhs., höchstwahrscheinlich im Jahre 48, wurde die Tempel-zone infolge der Angriffe der von Burebista geführten Geten endgültig vernichtet66. Archäologische Belege dieser Zerstörung liefern die auf mehreren Grabungsprofilen deutlich lesbare Brandschicht, die getische Keramik, die in der Zerstörungsschicht gefunden wurde, und merkwürdigerweise sogar Opfergaben, die Geten an der südwestlichen Ecke des von ihnen selbst abgebrannten Tempels deponiert haben müssen. Ohne Einzelheiten dieser vielfältigen Fragestellung auszubreiten, ist die Tatsache zu erwähnen, daß der bisher ausgegrabene Bereich der Tempelzone in der Kaiserzeit seinen heiligen Charakter gänzlich verloren hat. Zunächst wurden die Reste der Tempel, Altäre und Basen sorgfältig mit einer ziemlich dicken Schicht von speziell zu diesem Zweck von anderer Stelle herbeigebrachtem Lehm abgedeckt. Bezeichnenderweise findet man in dieser Schicht überhaupt keine archäologischen Reste. Daraus ist zu schließen, daß es sich um eine Desakralisierung handelte, d. h. um die Preisgabe eines von nun an profanen Aktivitäten vorbehaltenen Bezirkes67.
Gegen das Ende der vorchristlichen Zeit wurden in diesem Bereich ein paar Werkstätten eingerichtet, später entstand an derselben Stelle ein Wohnviertel. Im 3. Jh. n. Chr. wird die neue Festungsmauer, die nach der Vernichtung Histrias durch die Goten errichtet wurde, wegen ihrer tiefen Fundamente viele andere Reste von Monumenten des ehemaligen Temenos zerstören. Die kaiserzeitlichen Kultbauten Histrias, auf die manche Inschriften hinweisen, sind demnach an einer anderen Stel-le zu suchen, manche davon vielleicht sogar in der Nähe68.
Insgesamt entspricht dieser Überblick also dem Forschungsstand des Jahres 1990, an den die seither kontinuierlich fortgeführten Ausgrabungen unmittelbar anknüp-fen konnten.
III. Die neueren Forschungen (1990-2009)
Die Hauptprobleme der in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten unternomme-nen Ausgrabungen, deren Ergebnisse im folgenden zusammenfassend dargestellt werden sollen, beziehen sich einmal auf die Anfänge des Temenos, zum anderen
65 Histria VII, S. 139-141.66 P. Alexandrescu, La destruction d’Istros par les Gètes. 1. Dossier archéologique, Il Mar Nero 1, 1994, S. 179-214; Histria VII, S. 142-154; ders., La fin de la Zone Sacrée d’époque grecque d’Istros, Dacia N. S. 51, 2007, S. 211-219. 67 Histria VII, S. 152. 68 Siehe Anm. 132 und 134.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 51
auf die im Süden, Osten und Westen des Bezirkes neu ausgegrabenen Monumente. Diese neueren Forschungen wurden unter der Leitung des Archäologischen Insti-tuts “Vasile Pârvan” (Bukarest) der Rumänischen Akademie von den Verfassern des vorliegenden Beitrages durchgeführt69.
Die heilige Grube und das Monument K (Taf. I-IV, XV-XVI)
Zu den wichtigsten und zugleich spektakulärsten Resultaten der neuen Ausgra-bungen gehört die Freilegung einer heiligen Grube. Es handelt sich um eine tie-fe und unregelmäßig elliptisch geformte Felskluft (max. Länge 14 m, max. Breite 7 m, Tiefe ca. 4 m) im anstehenden Schiefergestein, mit steilen, manchmal sogar senkrechten Wänden, die unmittelbar neben der südöstlichen Ecke des Aphrodite-Tempels liegt. Ursprünglich bestand hier vielleicht nur eine tiefe Mulde, die aber im Laufe der Zeit künstlich vertieft worden sein muß. Ihr nördlicher Rand hatte sich schon während der Ausgrabungen der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ab-gezeichnet und in den damaligen Grabungsnotizen den Namen ‘marea depresiune’ erhalten; dennoch ahnte zu jener Zeit noch niemand ihre Größe und erst Jahre später ihre Bedeutung70. Zwischen 1998 und 2004 fand schließlich die Ausgrabung dieser Grube statt (Taf. XV a-b).
Die Grube wurde in archaischer und frühklassischer Zeit offensichtlich nicht ver-füllt, denn es gibt aus dieser Zeit nur spärliche Funde, danach aber schon. Von we-nigen Ausnahmen abgesehen datieren die ältesten aus der künftigen Füllung stam-menden Scherben nicht früher als vom Ende des 5. Jhs. Wie die Grube ursprünglich ausgesehen hat und wie groß sie war, bleibt allerdings weiterhin unklar. In einer späteren Zeit wurden auf ihrer Sohle zwei parallele Mauern aus Muschelkalkstein errichtet, die den Eindruck einer räumlichen Abgrenzung vermitteln (Monument K). Von ihnen erhalten sind jedoch nur die unteren Blöcke (Taf. II-IV). Zwischen die-sen Mauern wurden unmittelbar auf dem Fels zahlreiche Amphorenfragmente ge-funden (Taf. XV b), die vor allem von solchen aus Thasos herrühren, darunter auch gestempelte Henkel. Diese Amphorenstempel gestatten, den hier deponierten Kom-plex in die erste Hälfte des 4. Jhs. zu datieren71. Demnach ist es sehr wahrscheinlich,
69 Eng zusammengearbeitet haben wir im Laufe der Zeit mit Emilian Teleagă, Florina Panait Bîrzescu, Alexandra Ţârlea, Alexandrina Liţu sowie mit den Architekten Virgil Apostol und Ştefan Bâlici. Die Pläne und Architekturschnitte stammen von der Architektin Monica Mărgineanu Cârstoiu, unter Beteiligung (ab 2001) von Virgil Apostol und Ştefan Bâlici, die Zeichnungen von Grabungssituationen und einzelnen Objekten haben Florina Panait Bîrzescu und Argeş Epure gefertigt, während die Photos von Alexandru Avram, Iulian Bîrzescu und Konrad Zimmermann aufgenommen wurden. Während dieser Kampagnen haben uns zahlreiche studentische Hilfskräfte aus Rumänien, Deutschland, Österreich und den Vereinig-ten Staaten unterstützt. – Außer den längeren Beiträgen, auf die wir hier verweisen (Anm. 7), haben wir jährlich Kurzberichte in der rumänischen Reihe Cronica săpăturilor arheologice veröffentlicht.70 Dazu zuerst K. Zimmermann, Ausgrabungen in der Tempelzone (wie Anm. 4), S. 463; ders., Griechische Altäre (wie Anm. 4), S. 148 (“… Felsmulde […], die ursprünglich, d. h. noch vor der Bebauung der Tem-pelzone möglicherweise als Opfergrube und dann wohl auch als dessen kultischer Ausgangspunkt anzu-sehen ist”) und 154 (“mögliche Keimzelle des Kultbezirkes”).71 A. Avram, Les timbres amphoriques du remplissage de la fosse sacrée du téménos d’Istros, Vortrag am 5. Februar 2010 auf dem internationalen Kolloquium Analyse et exploitation des timbres amphoriques grecs, École Française d’Athènes (im Druck in dessen Akten). Die ältesten Amphorenstempel sind die Nr. 1-6 (Thasos, Gruppen A, D, E und F1, von ca. 390 bis ca. 355) und 68-69 (Herakleia Pontike, ca. 390), aber sie
Estratti
52 Alexandru Avram et alii
wenn auch nicht unbedingt zwingend, daß beide Mauerzüge etwa um dieselbe Zeit errichtet worden sein können72.
Bei aller gebotenen Vorsicht läßt sich aus der vorgefundenen Form der Grube und den wenigen baulichen Überresten vielleicht auf folgende Ausgestaltung schlie-ßen: Allem Anschein nach ist die im Schiefer vorgefundene natürliche Felskluft in größeren Teilen noch künstlich erweitert worden, wobei ein tief gelegener, etwa ku-busförmiger Raum entstand. Falls diese ‘Grotte’ schon vor dem 4. Jh. und damit vor der Errichtung des Monumentes K realisiert worden wäre, müßten deren Felswände noch überall sichtbar gewesen sein. Eine solche Behandlung eines heiligen Bezirkes kann nicht überraschen, weil – wie sogar heute noch – das Schiefergestein in diesem Bereich den Abbruch großer, nahezu perfekter, aber schnell wieder erodierender Schnittflächen erlaubt. Damit wäre es möglich gewesen, in der Tiefe eine Art in sich geschlossenen Gehäuses zu errichten, dessen Abgeschlossenheit zu einem Raum passen würde, der einem nicht allen zugänglichen Ritual vorbehalten blieb. Die er-haltenen Spuren lassen auch die Existenz eines Nebenraumes vermuten, d. h. einer Art Vorhalle, die an die südwestliche Felswand anstieß und von der aus vielleicht die für den Zugang nötigen Treppenstufen ihren Ausgang nahmen. Es bleibt ferner unklar, ob dieser mögliche Zugang gleichzeitig mit der Errichtung des Monumentes K oder erst später angelegt wurde. Der tief gelegene Bau wurde sicher aufgegeben, als infolge eines Erdbebens sein aufgehendes Mauerwerk einstürzte und dabei auch sein innerer Fußboden zerstört wurde. Es erscheint naheliegend, diesen Zeitpunkt mit der oben erwähnten dritten Zerstörung des Sakralbezirkes in Zusammenhang zu bringen. Die heute sichtbare, annähernd ellipsenförmige Gestalt der Grube ist möglicherweise aber auch als Ergebnis dieser Zerstörung anzusehen.
In Rücksicht auf den gesamten Sachverhalt ist anzunehmen, daß es sich bei dem Befund um eine heilige Grube handelt, die entweder mit dem Kult der Aphrodite73 oder auch mit anderen Kulten im Zusammenhang stand. In einem vor ein paar Jahren veröffentlichten Aufsatz haben wir mehrere Argumente angeführt, um die Hypothese, es ginge hier um ein Abaton, zu untermauern74; doch könnte es sich ebensogut um eine eingefaßte heilige Quelle, einen tief gelegenen Altar, ein Heroon oder ein Hypogäum handeln. Unabhängig davon muß der Bau oben bedeckt gewesen sein, denn sonst hät-te sich bereits beim kleinsten Regen eine beträchtliche Menge Wasser in seinem Innen-raum gesammelt. Eine solche Schlußfolgerung läßt sich leicht nachvollziehen, wenn man bedenkt, wieviel Regenwasser sich heute in der freigelegten Grube im Laufe der
liegen nicht alle in ungestörter stratigraphischer Lage. In Anbetracht der Fundumstände ist es im Mo-ment unmöglich, eine akkurate Trennung zwischen dem ursprünglichen Depot und der späteren Füllung vorzunehmen.72 Ein weiteres Argument für die Errichtung dieses Baus am Anfang des 4. Jhs. liefert die Feststellung des Geologen Dr. Albert Baltres, der zufolge Muschelkalkstein bei den histrianischen Denkmälern nicht vor dem Ende des 5. – Anfang des 4. Jhs. auftaucht.73 Dazu der Aufsatz von Maria Alexandrescu Vianu im vorliegenden Band, S. 23-37.74 A. Avram, K. Zimmermann, Monica Mărgineanu Cârstoiu und I. Bîrzescu (wie Anm. 7), S. 243-245. Zwei Graffiti aus Olbia erwähnen nämlich “die Abata der Aphrodite” (IGDOP 71 a-b). Daraus ist zu folgern, daß es in Olbia, dessen kultische Einrichtungen in engem Zusammenhang mit denen von Histria stehen, solche Abata gab; sie wurden im Gelände allerdings noch nicht lokalisiert. Allgemein dazu A. S. Rusjaeva u. a., Drevnejšij temenos Ol’vii Pontijskoj, Simferopol, 2006.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 53
Jahre ansammelt. Deshalb ist zu vermuten, daß das tief in der Grube gelegene ‘Gehäu-se’ mit einem flachen Satteldach versehen war75. Die beiden Parallelmauern, die sich seit dem 4. Jh. in der Grube befanden, können also nur zweierlei Zweck verfolgt haben, entweder für die Festigung des an den Grubenwänden erodierenden Felsens zu sorgen oder – was vorzuziehen wäre – als Stütze für ein Dach zu dienen.
Nach dem um das Jahr 100 datierten Erdbeben wurde die Grube zu Beginn des 1. Jhs., d. h. nur wenige Jahrzehnte vor der endgültigen Aufgabe der Tempelzo-ne, zugeschüttet und verlor so ihren sakralen Charakter. Für die Datierung dieses Zeitpunktes und die Umstände gibt es mehrere Anhaltspunkte. Erstens wiesen alle Querprofile, die für die stratigraphische Kontrolle der Ausgrabung angelegt wor-den waren, auf das Bestehen einer Zwischenschicht zwischen der oberen Grenze der Füllung und einer noch höher gelegenen, mit der Zerstörung der Tempelzone durch die Geten in Verbindung gesetzten Brandspur hin (Taf. XVI)76. Zweitens lag unmittelbar auf der Füllung der Grube in deren östlichem Teil eine Reihe von sechs bearbeiteten Kalksteinblöcken, möglicherweise ein Altar oder eine Basis und als Monument u bezeichnet (Taf. XV b). Seine stratigraphische Lage ist insofern wichtig, als es sich eindeutig um eine Baulichkeit handelt, die chronologisch zwischen den Zeitpunkt der Einfüllung der Grube und der endgültigen Zerstörung der Tempelzo-ne fällt. Drittens und letztens gehört das aus der Füllung geborgene Material einer Zeitspanne vom 4. bis in den Anfang des 1. Jhs. an. Jüngste Exemplare sind zwei Amphorenstempel (Rhodos bzw. Knidos) aus der ‘Periode V’ (vor ca. 108)77 sowie zwei Bruchstücke von Gefäßen mit Reliefdekor der Hadra-Gattung, die in die zwei-te Hälfte des 2. bis erste Hälfte des 1. Jhs. gehören78.
Nun läßt sich sogar ein Zusammenhang zwischen der Grubenfüllung und der Chronologie des Aphrodite-Tempels herstellen. Es wurde ja bereits erwähnt, daß um das Jahr 100 der Aphrodite-Tempel höchstwahrscheinlich einem Erdbeben zum Opfer fiel. Einen solchen Tatbestand scheinen jetzt die neuen Ausgrabungen zu be-kräftigen: Die Schieflage der südlichen Mauer von Monument K (Taf. IV) kann auf die Folgen eines Erdbebens zurückgeführt werden. Andererseits scheint die an den Grubenrändern fortschreitende Erosion des Felsens, die zu einem gewissen Zeit-punkt die Partien unter den Treppen des Aphrodite-Tempels erreichte79, das Fort-
75 Eine solche Dachform weisen z. B. der Opferschacht im Heiligtum der Demeter in Priene (F. Rum-scheid und W. Koenigs, Priene. Führer durch das Pompeji Kleinasiens, Istanbul, 1998, S. 157, Abb. 140) oder das sog. unterirdische, d. h. in den Boden eingetiefte Heroon (auch sog. sacellum) in Paestum (zuletzt E. Greco und D. Theodorescu, L’agora de Poseidonia: une mise au point, CRAI, 1994, S. 230) auf. Ein über dem Grund nur wenig angehobenes Dach konnte entweder unmittelbar oder mittels kleiner, als Stütze dienender Steinblöcke auf dem Fels liegen.76 Was die Amphorenstempel anbelangt (vgl. Anm. 71), von denen in dieser Zwischenschicht keine datie-rungsfähigen Exemplare aufgetaucht sind, lohnt sich der Hinweis, daß in der Brandschicht außer älteren Stücken (so etwa Nr. 33, Sinope, ca. 255-250; Nr. 48-49, Rhodos, ca. 180-150; Nr. 61, Knidos, ca. 146-108; Nr. 63, Knidos, ca. 115-108) ein rhodischer Stempel von ca. 107-88/6 (Nr. 43) gefunden wurde; er gehört der ‘Periode VI’ an, die bezeichnenderweise in der Füllung nicht vertreten ist.77 A. Avram (wie Anm. 71), Nr. 42 (Rhodos, ca. 150, Ende der ‘Periode IV’), 51 (Rhodos, ca. 132-121) und 62 (Knidos, ca. 146-108). 78 Freundliche Mitteilung von Dr. Vasilica Lungu (Institut für südosteuropäische Studien Bukarest).79 Bemerkenswert ist u. a., daß ein paar Stufenblöcke der genannten Treppen in der Füllung der Grube gefunden wurden.
Estratti
54 Alexandru Avram et alii
bestehen des Tempels selbst bedroht zu haben. Dabei ist daran zu erinnern, daß während der letzten Bauphase des Aphrodite-Tempels (IV: ca. 100-48) die niedrigen Treppen seiner Ostseite durch einen Estrich bedeckt wurden. Somit ergibt sich eine unmittelbare Beziehung zwischen dem Verschwinden der Treppen und der Füllung der Grube.
Neue Monumente, ältere und neue Fragen
A. Die Frühphase des Heiligtums: bis zur Mitte des 6. Jhs. (Taf. I, VIII, XVII, XXVIII)
Ein Hauptziel der Ausgrabungen betraf in den letzten Jahren die Frühphase des Heiligtums. Die Zeit vor der Mitte des 6. Jhs. ist besonders durch Einarbeitungen und den Oikos als Monument von bescheidenen Ausmaßen gekennzeichnet, dazu treten unter Umständen noch einige kleine Votive (Terrakotten und Keramikbruch-stücke mit Weihinschriften). Der anstehende Schieferfels scheint in dieser frühen Benutzungsphase nur von Fall zu Fall bearbeitet und geglättet worden zu sein. Zu erwähnen ist außerdem, daß es am Fundplatz bisher keinen Hinweis auf eine menschliche Tätigkeit vor Ankunft der Milesier gibt80.
Wie die ersten Kulteinrichtungen genau aussahen, weiß man nicht, was auf den schlechten Erhaltungszustand der archaischen Schichten – häufig werden sie von bis auf den Fels hinabreichenden Fundamenten späterer Gebäude zerschnitten – und auf die geringe Dauerhaftigkeit der verwendeten Baustoffe wie z. B. Holz oder Schilf zurückzuführen ist. Die Spuren eines aus vergänglichem Material errichteten Oikos der Aphrodite sieht Petre Alexandrescu in einem unter dem späteren Steintempel gelegenen Kalksteinfundament und datiert dieses in die erste Hälfte des 6. Jhs.81.
Eine erste wohl kultische Einrichtung tauchte südlich der heiligen Grube auf. Es handelt sich dabei um eine kreisförmige Einarbeitung in den Fels mit einem Durch-messer von 75 cm und einer Tiefe von 10 bis 20 cm. Daneben sind zwei kleine Lö-cher im Fels erkennbar, die vielleicht zur Fixierung von Holzpfosten dienten (Taf. XVII a).
Eine zweite Felsabarbeitung, diesmal 16 cm tief, wurde südlich vom Aphrodite-Tempel gefunden. Sie weist eine etwa rechteckige Form auf, wobei der Fels unre-gelmäßig geglättet ist. Es konnte nur eine Fläche von 2,70 x 1,70 m untersucht wer-den, da sich im Süden und Osten darüber noch frührömische Mauern befinden (Taf. XVII b). Diese Abarbeitung schneidet eine unmittelbar auf dem Fels liegende Schicht brauner Erde, in der spätestens ca. 590/580 zu datierende Keramikfragmente aufge-taucht sind. Erwähnenswert sind dabei Scherben von mindestens fünf Vogelschalen und von einem äginetischen Kochtopf82 sowie Fragmente von Transportamphoren,
80 Allerdings gehören die frühesten Funde in das Neolithikum und in die Bronzezeit. Dabei handelt es sich um den Kopf einer Statuette (Taf. XXV a), ein paar Feuersteinfragmente und eine Steinaxt, die aber ausnahmslos aus Schichten der frührömischen Zeit stammen. Höchstwahrscheinlich wurde die für die Errichtung der römischen Häuser nötige Erde, die u. a. auch diese Funde enthalten haben dürfte, von einer entfernter liegenden Stelle hierher gebracht.81 Histria VII, S. 53 Abb. 1.1, 68-70, Taf. 95.82 Freundliche Mitteilung von Dr. Gudrun Klebinder-Gauss (Athen/Wien).
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 55
die ausschließlich in den frühesten milesischen Siedlungen des Schwarzmeerrau-mes wie Berezan, Apollonia, Jagorlyk und Taganrog vorkommen, nämlich attische SOS-Amphoren, solche aus Klazomenai, Chios, Samos sowie milesische und äoli-sche Typen.
Eine weitere, diesmal etwa ellipsenförmige Felsabarbeitung wurde im südlichen Teil der Grabungsfläche identifiziert (Maße ca. 3 m in O-W und 1,65 m in N-S-Rich-tung). Leider lassen sich keine Aussagen zur Bestimmung und kultischen Rolle aller genannten Abarbeitungen treffen.
Diese Spuren einer ersten Phase menschlichen Handelns am Ort weisen nur bescheidene Maße auf. Außer83 dem erwähnten Oikos der Aphrodite ist auf zwei weitere Abarbeitungen hinzuweisen, die an der südöstlichen Ecke des jetzigen Grabungsareals identifiziert wurden (1,10 x 1,17 m bzw. 1,46 x 0,85 m). Auch die aufgefundenen Überreste von Votiven bleiben sowohl hinsichtlich ihrer geringen Zahl als auch als Qualität in recht bescheidenem Rahmen. Erwähnenswert sind allerdings mehrere Fragmente von Kuroi, das Fragment eines plastischen Gefäßes in Form eines nackten Jünglings, der eine Inschrift auf seinem Rücken trägt, Frag-mente mittels Sandkerntechnik hergestellten Glases sowie Fayencegefäße. Frühe Keramik kommt nicht in großer Menge vor, gelegentlich ist sie aber von guter Qua-lität: Das zeigen z. B. die Fragmente von einem chiotischen Kelch, von milesischen Tierfrieskannen (Taf. XXVIII a) und einem Krater (Taf. XXVIII b; Klassifikation nach Kerschner/Schlotzhauer: SIA Id) sowie von einem attischen korinthisierenden Di-nos (Taf. XXVIII c).
B. Die spätarchaische Zeit: Mitte des 6. bis Anfang des 5. Jhs. (Taf. I, V-VII, IX, XVIII-XXII)
Die drei schon beschriebenen, ganz aus Stein errichteten Tempel (Zeus, Aphrodi-te und möglicherweise Apollon) und etliche Kultbauten zweitrangigen Charakters lassen nur annähernd die Monumentalität der Tempelzone in der zweiten Hälfte des 6. Jhs. erahnen. Auf die Ursachen dieser bemerkenswerten Entwicklung soll hier nicht eingegangen werden, da dies an anderen Stellen wiederholt geschehen ist84. Außer Präzisierungen zu schon bekannten Kultdenkmälern haben die neuesten Forschungen zur Entdeckung weiterer Monumente geführt, die im folgenden kurz vorgestellt werden sollen.
Die Ausgrabungen während der beiden zurückliegenden Jahrzehnte haben sich besonders in südliche, westliche und östliche Richtung bewegt. Im Osten bleibt die Grenze der Tempelzone weiterhin am Grund des Sinoë-Sees zu suchen, während im Norden die hellenistische Festungsmauer85 eine gewisse Abgrenzung darstellt,
83 Hinzu käme noch eine nicht geklärte Abarbeitung, die allem Anschein nach in die erste Hälfte des 6. Jhs. zu datieren ist und die weiter unten behandeln wird (Anm. 93).84 Vor allem P. Alexandrescu, Histria in archaischer Zeit, in P. Alexandrescu und W. Schuller (wie Anm. 3), S. 56-62 = L’Aigle et le dauphin (wie Anm. 6), S. 85-95.85 An sich handelt es sich um die Flucht der spätrömischen Mauer, die hier archäologisch belegt ist. Doch aus mehreren topographischen wie archäologischen Gründen liegt die Vermutung nahe, daß sie in die-sem Bereich als Nachfolgerin einer hellenistischen Mauer derselben Flucht gedient habe.
Estratti
56 Alexandru Avram et alii
obwohl rein theoretisch eine Ausdehnung des Heiligtums darüber hinaus in archa-ischer Zeit nicht auszuschließen ist.
Ein erster bemerkenswerter Befund ergab sich in ca. 1 m Abstand vor dem Nord-westen der Plattform, auf der sich der Aphrodite-Tempel erhebt. Es handelt sich um eine Anhäufung von Dachterrakotten auf einer Fläche von 1,50 x 2 m auf dem Niveau, das der spätarchaischen Phase (I) des Tempels entspricht. Diese Reste gehö-ren ohne Zweifel zum Dach des archaischen Tempels, das mit diesem zu Beginn des 5. Jhs. niedergebrannt wurde. Teile von diesem Dach waren hier allerdings schon während früherer Ausgrabungen und dann in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts vor allem im Inneren des Pronaos gefunden worden86. Die neuesten Funde (2007 und 2008) haben beträchtlich dazu beigetragen, die Umstände der Zer-störung zu klären, zumal viele dieser Dachterrakotten in ihrer Sturzlage angetroffen wurden und damit den Moment des Zusammenbruches des Daches bewahrt haben. Als Beweis dafür gelten eine Reihe von fünf Verkleidungsplatten (Taf. XXVI a) mit Bleiresten für ihre Befestigung, verkohlte Balken sowie gebrochene Strotere, die ih-rerseits von Kalypteren überlagert sind. Alle diese Dachziegel fielen auf einen lehm-haltigen Boden, der sich im Kontakt mit den brennenden Balken rötlich verfärbte (Taf. XIX a-b). Westlich von diesem Haufen, etwa 2,80 m von der Plattform entfernt, kamen Fragmente eines ionischen Kapitells (Taf. XVIII a, XXVII a-a’) aus gelbem Kalkstein87, ein Fragment eines schlecht erhaltenen Torus88 sowie zahlreiche bemalte Antefixe (Taf. XXVI b) zu Tage. Vom Dach ist außerdem ein Simafragment zu erwäh-
86 K. Zimmermann, Zu den Dachterrakotten griechischer Zeit aus Histria, in P. Alexandrescu und W. Schuller (wie Anm. 3), S. 155-177; ders., Archaische Dachterrakotten aus Histria, Hesperia 59, 1990, S. 223-233; ders., in Histria VII, S. 463-485.87 Dieses Kapitell ist nicht nur wegen des neuen Blickes auf die Ausgestaltung des spätarchaischen Aphrodite-Tempels besonders wichtig, sondern ebenso für die allgemeine Entwicklung der ionischen Ordnung in Histria insgesamt. Einige stilistische Aspekte (der Typ von Stab und Spirale, die scheiben-förmigen Augen und das Fehlen des Abakus) erinnern sowohl an das vorher erwähnte Kapitell ‘A’, das vermutlich vom Zeus-Tempel stammt (Anm. 14), als auch an das Kapitell ‘B’, von dem angenommen wurde, es hätte zum Aphrodite-Tempel gehört (Anm. 22). Gewisse Indizien sprechen nachdrücklich da-für, daß dieser Kapitell-Neufund eher dem ältesten Typ der ionischen Kapitelle (Histria XII, S. 100, Kat. VI.A.2, Taf. XXXIX und 26) nahesteht. Obwohl auch für die anderen Kapitelle eine Bemalung vermutet werden kann, ist das neugefundene das einzige aus dieser Serie, auf dem Reste von roter Farbe klar erkennbar sind. Es wäre natürlich verlockend, dieses Kapitell der Front des Aphrodite-Tempels zuzu-ordnen. Obwohl es theoretisch möglich ist, aus allen vorhandenen Fragmenten ein einziges Kapitell zu rekonstruieren, darf die Alternative, nämlich daß die Fragmente zu mehreren Kapitellen gehört haben, nicht völlig ausgeschlossen werden. In letzterem Fall wäre dann auch die Vermutung in Betracht zu ziehen, daß der Aphrodite-Tempel vor seiner Zerstörung zu Beginn des 5. Jhs. ein Peripteros war. Da für eine zweifelsfreie Rekonstruktion des Kapitells jedoch weitere Fragmente fehlen, läßt sich in Rücksicht auf bestimmte Details bis zu einem Gegenbeweis derzeit ebenso annehmen, daß dieses für einzigartig zu haltende Kapitell entweder als Votiv diente oder auf einer Holzsäule lag, ohne aber seine Zugehörigkeit zum Aphrodite-Tempel (West-Peristasis oder Prostyl) gänzlich auszuschließen. Wie dem auch sei, ist dar-auf aufmerksam zu machen, daß die Verwendung von Holzsäulen zusammen mit Lehmziegeln, die in derselben Zerstörungsschicht wie die Kapitellfragmente entdeckt wurden, chronologisch passen würde. Die Lehmziegelfragmente könnten darauf verweisen, daß eine ältere archaische Phase des Aphrodite-Tempels aus einem Holz- und Lehmziegelbau über einem Steinsockel bestand, wobei die Säulen ebenfalls aus Holz gefertigt waren. Andererseits ist die Möglichkeit nicht völlig auszuschließen, daß die Lehmzie-gel und anderen Fragmente nichts anderes als Bestandteile des schon genannten ursprünglichen Oikos waren.88 Dieses ziemlich abgesplitterte Fragment gehört demselben Typ an wie ein anderes, das in der Nord-mauer des Monumentes D wiederverwendet wurde.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 57
nen (Taf. XXVI c), das mit früheren Funden typologisch zusammenpaßt89. Aus der Laboranalyse einiger Balkenfragmente hat sich ergeben, daß zwei Holzarten – Eiche und Esche – am Dachstuhl Verwendung fanden90.
Nördlich von diesem Komplex wurde ein spätrömischer Brunnen freigelegt, der schon in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts identifiziert, jedoch erst im Jahre 2007 ausgegraben wurde (Taf. VII). Da dieser Brunnen bis auf den Fels reicht, wurden durch ihn an dieser Stelle alle vorhergehenden Schichten zerstört. Nördlich und südlich vom Brunnen traf man dagegen auf eine ungestörte stratigraphische Abfolge. Wichtigster Befund ist dabei das Fundament einer etwa von Nord nach Süd verlaufenden Mauer, deren virtuelle Flucht – eben weil sie zur Westseite des Aphrodite-Tempels nicht parallel verläuft – unter der südwestlichen Ecke von des-sen Plattform verschwindet. Dieser Tatbestand zeigt, daß dieses Fundament fraglos älter ist als die Plattform des Tempels (Taf. XX, A). Das bisher auf ca. 20 m freigelegte und wenig tiefe Fundament muß also im Moment der Anlage der Tempelplattform aufgegeben worden sein, wobei an manchen Stellen nur eine einzige Mauerschicht erhalten geblieben ist (Taf. XX, B). Seine Breite beträgt zwischen 1 und 1,10 m und besteht aus unbearbeiteten Schieferplatten und ebensolchen kleinen Brocken. Dieser Mauerzug wird auch in seinem Nordverlauf und hier vom Monument C überlagert (Taf. XX, C).
Dieser Befund wirft Fragen auf, die beim jetzigen Forschungsstand nicht völ-lig beantwortet werden können, jedoch für künftige Forschungen wichtig sind. Da besagter, nur im Fundament erhalten gebliebener Mauerzug und der Aphrodite-Tempel kaum gleichzeitig sein können, muß geklärt werden, ob er mit dem dem Tempel vohergehenden angenommenen Oikos aus Holz gleichzeitig war oder nicht. Bedeutsam für die relative Chronologie ist die Beobachtung, daß der Lehmboden, auf den die Dachziegel gefallen waren und der daher das Niveau des archaischen Tempels zum Zeitpunkt seiner Zerstörung festlegt, über dieses Mauerfundament hinweggeht. Daraus gewinnt man ein zusätzliches Argument dafür, daß letzteres älter als der Steintempel ist und damit chronologisch in die erste Hälfte des 6. Jhs. fällt. Datierungsfähige Funde stellen außer den erwähnten Dachziegeln die Frag-mente einer Siana-Schale des Heidelberg-Malers dar, die kurz vor die Mitte des 6. Jhs. anzusetzen ist91. So könnte dieses Fundament zu einer Mauer gehören, die um diese Zeit errichtet wurde. Aber zu welchem Zweck? Zwei Hypothesen scheinen sich im Moment anzubieten: Man kann sich entweder ein Peribolos92 aus Holz aus der Zeit vor den ersten Kultbauten aus Stein vorstellen oder an einen mißlungenen
89 Vgl. K. Zimmermann, Zu den Dachterrakotten griechischer Zeit aus Histria, in P. Alexandrescu und W. Schuller (wie Anm. 3), S. 158, 172, Abb. 14; ders., Archaische Dachterrakotten aus Histria, Hesperia 59, 1990, S. 230-231, Taf. 31 a-b; ders., in Histria VII, S. 479-480, Ta 362-368, Taf. 129,3.90 Die Analyse hat Prof. Dr. Karl-Uwe Heußner (DAI Berlin) durchgeführt, dem die Verfasser sehr zu Dank verpflichtet sind.91 Darstellung einer Männerprozession mit Rhytha. Zu dieser Gattung: A. G. Brijer, Siana Cups III. The Read-Black Painter, Griffin-Bird Painter and Siana Cups Resembling Lip-Cups, Amsterdam, 2000, S. 569 ff.92 Dabei würde es sich um den Sockel mit hölzernem Aufbau handeln. Für Beispiele auf Samos (Südbau) oder in Irya siehe G. Gruben, Griechische Tempel und Heiligtümer, München, 22001, S. 355, Abb. 269; S. 377, Abb. 284.
Estratti
58 Alexandru Avram et alii
und daher aufgegebenen Versuch denken, für den Aphrodite-Tempel eine Plattform anzulegen.
Nahebei, nämlich westlich von Monument C, wurde 2008 ein weiterer, allerdings halbkreisförmiger Mauerzug aus kleinen Sandsteinquadern komplett freigelegt (Taf. XX, D)93. Da er wegen seiner Dicke von 15 cm allem Anschein nach keinen Oberbau tragen konnte, muß er als Abgrenzung für etwas gedient haben (möglicherweise für ein Heroon oder eine Eschara). Die einzigen Vermutungen, die gegenwärtig dazu gemacht werden können, betreffen seinen ursprünglich möglicherweise kreisförmi-gen Grundriß und seine Chronologie. Laut der Analyse der Fußböden aller anderen Monumente aus diesem Bereich scheint dieser Mauerzug am ältesten zu sein (Taf. V-VI). Deshalb könnte er mit gewissen Holzbauten gleichzeitig gewesen sein, so vielleicht mit dem hölzernen Vorläufer des Aphrodite-Tempels (Oikos). Während einer Phase, die sowohl diesem kreisförmigen Monument als auch dem zuvor ge-nannten Mauerfundament (Taf. XX, B) folgte und die wahrscheinlich in das 5. Jh. zu datieren ist, wurde eine rechtwinklige Abgrenzung (für eine neue Eschara?) ange-legt, von der in situ nur ein paar prismatische Kleinblöcke erhalten geblieben sind (Breite 2,5 m).
In der Nähe dieser Mauerzüge wurden viele Architekturfragmente gefunden, die entweder als Spolien in römischen Mauern oder als Füllungsmaterial in nachhelleni-stischen Schichten wiederverwendet wurden. Zu den wichtigsten Spolien gehören die Fragmente von zwei Typen archaischer Spirae, die neben den schon bekannten Torus-Scheiben einen Eindruck von den während archaischer Zeit in Histria ver-wendeten verschiedenen kleinasiatischen Typen ionischer Säulen erlauben. Eine dank der eingeritzten Markierungen rekonstruierbare Spira (Taf. XI b) mit einem bisher unbelegten Profil gehört wahrscheinlich zu einer Säule des Aphrodite-Tem-pels und stellt durch die erhaltenen Reparaturspuren ein unmittelbares Zeugnis für die Wiederherstellung dieses Denkmals nach seiner Vernichtung Anfang des 5. Jhs. dar94. Die Entdeckung eines neuen Fragmentes von einem mit Palmetten und Lotusblättern dekorierten Anthemions bekräftigt die Hypothese, daß in den ersten Jahrzehnten des 5. Jhs. U-förmige Altäre existierten (Taf. XI e)95, was deutlich auf den Einfluß Kleinasiens und der ionischen Inselwelt auf Histria verweist. Mehrere Blöcke ionischer Flachkymatien, die als wiederverwendete Spolien in spätantiken Mauern südlich vom Aphrodite-Tempel entdeckt wurden und wahrscheinlich in das letzte Viertel des 6. Jhs. gehören, sowie einige Fragmente von unkannelierten Säulenschäften sind unvollendet geblieben, so daß sich fragen läßt, ob das zu-gehörige Monument nicht bereits vor seiner Fertigstellung der Zerstörung zum Opfer fiel.
93 Auf die Reste dieses halbkreisförmigen Mauerzuges waren schon die älteren Ausgrabungen gestoßen: Gabriella Bordenache, Victoria Eftimie und Suzana Dimitriu, Şantierul arheologic Histria. Sectorul T, Mate-riale şi cercetări arheologice 9, 1970, S. 179 (dort als Aschengrube gedeutet, obwohl aus dem Grabungsbe-richt hervorgeht, daß keine Aschenreste gefunden wurden).94 Histria XII, S. 26, Kat. I.Ao.2; S. 388, Taf. I, CXI, CXIII und 1. Diese Spira und ein bereits vorher entdeck-tes ionisches Kapitell ermöglichten die zeichnerische Rekonstruktion einer Säule des spätarchaischen Aphrodite-Tempels (Taf. XII d).95 Dazu Rekonstruktionsvorschläge ebd., S. 389, Taf. CXVII und CXX.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 59
Ein Kymation aus Marmor mit Eierstab und Blattspitzen stellt einen außeror-dentlichen Fund dar. Durch die Art und Weise, wie sich das Profil des Blockes auf der Schaufläche manifestiert, wird es zum ersten konkreten Zeugnis für die Verwen-dung einer vertikalen Abfolge von Eierstab- und Blattspitzen-Registern in Histria. Zusammen mit einem Astragal-Fragment belegt dieses Stück einen bemerkenswer-ten spätarchaischen Marmoraltar, der im 5. Jh. wiederhergestellt wurde96.
Unter den Votiven sind vor allem figürliche Terrakotten zu erwähnen, die größ-tenteils zu Typen gehören, die bereits aus der Tempelzone bekannt sind: sitzende oder stehende Frau mit verschleiertem Kopf, aber auch eine dickbauchige Figur, auf der noch rote Farbe erhalten geblieben ist (Taf. XXV c). Alle diese Terrakotten lassen deutlich milesische Prägung erkennen. Hinzuzufügen ist ein 2008 entdeckter archa-ischer Treppenaltar en miniature (arula) aus Gips, der bisher ein Unikum unter den Votiven aus der Tempelzone darstellt (Taf. XXV b)97. Eine weitere, immer häufiger vorkommende Votivgattung stellen die Graffiti dar, die Weihungen an Gottheiten beinhalten und vornehmlich, jedoch nicht immer, südlich und östlich der heiligen Grube entdeckt wurden: eine Weihung an Apollon auf einer attischen Augenscha-le98, eine Weihung an Dionysos im Inneren einer Fikellura-Tasse oder eine Weihung an Hermes auf einer attischen Kleinmeisterschale99.
Eine der wichtigsten neuen Entdeckungen zur spätarchaisch-frühklassischen Zeit wurde 2007 im südöstlichen Bereich der jetzigen Grabungsfläche, d. h. in der Nähe der spätrömischen Festungsmauer gemacht. Da die Ausgrabung noch im Gange ist, können hier nur vorläufige Ergebnisse vorgestellt werden.
Es handelt sich um die Fundamentreste eines neuen Kultbaus (mit M bezeichnet), der wie alle anderen archaischen Tempel ungefähr in Nord-Süd-Richtung orientiert ist. Die erhaltenen Fundamente liegen direkt auf dem Fels und werden größtenteils von den Mauern einer 1997 freigelegten christlichen Basilika aus dem 5. Jh. n. Chr.100 überlagert (Taf. IX, Schnitte 14-14, 15-15 und 16-16; XXI a-b). Der Grundriß weist eine länglich rechteckige Form mit einer Länge von 10,49 m sowie einer rekonstruierten Breite von ca. 6,50 m auf und enthält drei Räume (deren lichte Längen jeweils 3,50 m im Süden, 2,45 m für den Zwischenraum und 3,15 m im Norden betragen); die lichte Weite der Innenräume beträgt 5,25 m. Die Dicke der direkt auf dem Schiefer-fels liegenden Fundamente reicht bis zu 0,65-0,70 m. Ein Teil des Fundamentes der
96 Ebd., S. 391-397, Abb. 107-109, Taf. CXX und CXXI.97 Zur Funktion solcher Arulae vor allem M. P. Nilsson, Griechische Hausaltäre, in R. Lullies (Hg.), Neue Beiträge zur klassischen Altertumswissenschaft. Festschrift zum 60. Geburtstag von Bernhard Schweitzer, Stutt-gart, 1954, S. 218-221; Hellebora van der Meijden, Terrakotta-Arulae aus Sizilien und Unteritalien, Amster-dam, 1993, bes. S. 155 ff. 98 A. Avram, I. Bîrzescu und K. Zimmermann, Die apollinische Trias von Histria (wie Anm. 7), S. 117, Nr. 25, Abb. 6 a-c.99 I. Bîrzescu, Histria. Graffiti din “Zona Sacră”. Dedicaţii către divinităţi, SCIVA 54-56, 2003-2005, S. 208, Abb. 1/7; ders., Inscriptions on Pottery from the Istrian Sanctuaries: the Naukratis Approach, in U. Schlotzhauer und Alexandra Villing (Hg.), Naukratis: Greek Diversity in Egypt. Studies on East Greek Pottery and Exchange in the Eastern Mediterranean, London, 2006, S. 171-172.100 Ferner S. 69-70. Während der Freilegung der Basilika wurden übrigens die Fundamentreste des später sich als Kultbau erweisenden Monumentes M zum ersten Mal identifiziert.
Estratti
60 Alexandru Avram et alii
nördlichen Mauer konnte unter dem Fundament des die Apsis der Basilika abgren-zenden Triumphbogens festgestellt werden, während sich dank mehrerer Funda-mentpartien, die unter der westlichen Mauer derselben Basilika erhalten geblieben sind, die westliche Begrenzung feststellen ließ. Die rückwärtige Mauer des Pronaos wird ihrerseits durch Fundamentreste belegt, die an ihrer Einbindung in die westli-che Mauer der Basilika erhalten sind. Dagegen fehlt das Fundament der etwas nach Norden gelegenen Quermauer, so daß sogar ein Teil des zum inneren Fußboden dieses Gebäudes gehörenden Estriches erhalten blieb. Die Flucht dieser Quermauer wird zudem von den ausschließlich aus Spolien bestehenden Basen zweier helleni-stischer Votivdenkmäler (aa und bb; dazu später) überlagert (Taf. XXI a). Das Fun-dament der östlichen Begrenzungsmauer (Taf. XXI b) wurde in seiner nördlichen Hälfte durch die Errichtung der spätrömischen Festungsmauer fast völlig zerstört, dabei erlitt der Bereich an der Überschneidung mit dem Triumphbogen der Basilika dasselbe Schicksal.
Eine Überraschung stellt das Fundamenmaterial des Monumentes M dar, soweit es neben sporadisch verwendeten Schiefersteinen größtenteils aus unbearbeiteten Marmorfragmenten besteht. Die Verwendung dieses prächtigen, ausschließlich durch Import zugänglichen Baumaterials101 für das Fundament zeigt, daß vor der Errichtung des Monumentes ein oder mehrere Altäre zerstört worden sein müs-sen102. Deren Werkstücke wurden nicht als Spolien verwendet, sondern noch einmal zerschlagen, um als Baumaterial für ein Fundament zu dienen, das unregelmäßige Steine untereinander mit Erde verbindet. Die ungewöhnliche Wiederverwendung derart prächtigen Materials läßt vermuten, daß diese absichtliche ‘Profanierung’ des oder der ursprünglichen Monumente nicht nur deren Wiederherstellung, sondern auch die Erinnerung an sie auf Dauer unmöglich machen sollte. Dennoch sieht es so aus, als ob dieses Vorgehen zugleich einer kultischen Deponierung gleichkommt, die einen Neubau nicht nur im architektonischen, sondern auch im religiösen Sinne begleitete.
Das Monument M war aus über Steinsockeln liegenden Holz- und Lehmziegel-mauern erbaut und dürfte nur eine geringe Höhe erreicht haben. Ziegeldach und dabei insbesondere die dekorative Qualität der Simen und Antefixe weisen trotz des für die Mauern verwendeten vergänglichen Baumaterials auf einen Baukörper mit einer besonderen Bestimmung hin. Der Grundriß des Monumentes legt nahe, daß es sich – gemessen an den anderen archaischen Tempeln des histrianischen Sa-kralbereichs – um einen etwas kleineren Tempel handelt, der wie diese einen tiefen Pronaos und eine ähnliche Verteilung seiner Innenräume aufweist und trotz seiner geringeren Abmessungen und des ungewöhnlichen Baumaterials unmittelbar an den Grundriß des Zeus-Tempels erinnert.
Höchstwahrscheinlich wurde das Monument M im dritten Viertel des 6. Jhs er-richtet, obwohl eine etwas spätere Datierung nicht völlig auszuschließen ist. Bemer-
101 In Histria ist Marmor in archaischer Zeit ausschließlich bei einigen Altären und mehreren Kurosfrag-menten belegt: Histria IX, S. 19; Histria XII, S. 391-397, Abb. 107-109, Taf. CXX und CXXI.102 Daß es archaische Altäre gab, die unter unbekannten Umständen schon vor der ersten großen Ver-nichtung der Tempelzone zu Beginn des 5. Jhs. zerstört wurden, beweisen auch die Streufunde verschie-dener Einzelstücke.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 61
kenswert ist dieselbe Orientierung wie die der Tempel A und A’. Der Aphrodite-Tempel hingegen zeigt, obwohl in derselben Zeit errichtet, eine geringe Abweichung in seiner Ausrichtung, was womöglich mit der Lage des früheren Oikos und der heiligen Grube zusammenhängen mag.
Die Stratigraphie der ausgegrabenen Fläche hat drei archaische Niveaus erbracht (Taf. XXII b). Ein erstes Niveau, das nicht über die Mitte des 6. Jhs. herabreicht, stellt das glättende Ausgleichen des anstehenden Felsens mittels einer lehmhaltigen Schicht dar, auf der auch zwei kleine Gruben und eine Herdstelle entdeckt wurden. Der Kultbau korrespondiert dann mit einem zweiten, durch einen Estrich aus split-terigem Schiefergestein gekennzeichneten Niveau, in dem u. a. mehrere Fragmente einer chiotischen Transportamphora vom Typ Lambrino A (ca. 540-510/500) gefun-den wurden (Taf. XXIX a). Das dritte Niveau bzw. die zweite Phase des kleineren Tempels datiert ca. 500, als im nördlichen Raum ein neuer Lehmfußboden angelegt wurde, in dem ein paar Pfeilspitzen mit monetärem Wert ans Licht kamen. Der Bau insgesamt fiel höchstwahrscheinlich zu demselben Zeitpunkt wie die übrigen Kult-bauten der Tempelzone einem Feuer zum Opfer. Auch die Chronologie des Monu-mentes M scheint anzudeuten, daß diese Katastrophe etwas später als bisher ange-nommen stattgefunden hat, d. h. wohl eher um 492-490103 als um 514.
In der Zerstörungsschicht wurden zahlreiche Lehmziegelfragmente (oft mit ge-glätteten Flächen), verkohltes Holz104 und eine ganze Menge von Dachterrakotten geborgen. Auf dem gut erhaltenen lehmhaltigen Fußboden, der selbst Brandspuren aufwies, lagen gebrannte Lehmziegel und stark zersplitterte Dachterrakotten (Taf. XXII a).
Weitere Dachterrakotten scheinen vom Feuer nicht betroffen worden zu sein; denn mehrere davon, die keine Brandspuren aufweisen, wurden offenbar einige Zeit nach der Zerstörung südlich vom Gebäude sorgfältig niedergelegt, um zusammen mit Fragmenten von thasischen (Taf. XXIX b) und unbemalten chiotischen Trans-portamphoren mit geschwelltem Hals eine Art Fußboden (‘Pavage’) auszubilden. In den letzten drei Kampagnen hat man hier hunderte von Dachterrakotten geborgen. Die Mehrzahl stellen rote und weiße Strotere und Kalyptere dar, es gibt aber auch Antefixe, Traufziegel und Simen (Taf. XXVI d-e), die auf einen feineren Bauschmuck hinweisen. Die sichersten Angaben für die chronologische Verankerung dieses Be-fundes liefern die verhältnismäßig zahlreichen Amphorenfragmente, die eine Da-tierung dieser ‘keramischen’ Schicht gegen die Mitte des 5. Jhs. erlauben. An dieser Stelle ist daran zu erinnern, daß die Wiederherstellungsarbeiten an den Tempeln von Zeus und Aphrodite etwa in dieselbe Zeit fallen105.
Vom Inventar dieses kleineren Kultbaus wurden mehrere Gegenstände haupt-sächlich in der Zerstörungsschicht gefunden. Bemerkenswert ist vor allem eine tö-nerne korinthische Dreifußschale mit Eierstabfries, von der Teile sowohl des Beckens als auch vom Untersatz erhalten geblieben sind106. Eine weitere Votivgattung stellen
103 Vgl. Anm. 34.104 Eiche und Kiefer, wie die Laboruntersuchungen von Prof. Heußner gezeigt haben (vgl. Anm. 90). 105 Histria VII, S. 98-104.106 Dazu M. Iozzo, Corinthian Basins on High Stands, Hesperia 56, 1987, S. 355-416.
Estratti
62 Alexandru Avram et alii
die figürlichen Terrakotten dar, wobei es sich zumeist um weibliche Protomen han-delt, die noch schöne Farben bewahrt haben (Taf. XXX b)107. Außerdem ist auf einen Hahn zu verweisen, der allem Anschein nach an einer Wand hing und der sogar fünf Farben aufweist (Taf. XXX a)108. Zu demselben Inventar gehörten auch Anhän-ger und dünne, mit Palmetten dekorierte Goldblätter. Diese letzteren schmückten vermutlich einen Kopf aus Elfenbein, da in derselben Brandschicht auch zwei schön bearbeitete Elfenbeinfragmente entdeckt wurden. Die Goldblätter sind schon mit dem Ergebnis analysiert worden109, daß hier Gold von 22 bzw. 23 Karat vorliegt. Sind die keramischen Überreste in der Brandschicht unbedeutend, so ist dagegen auf einen wichtigen epigraphischen Fund hinzuweisen. Es handelt sich um eine ar-chaische Weihinschrift auf einem Kalksteinblock, den ein gewisser Hephaistodoros aufgestellt hat (Taf. XXIX c)110.
Die weiblichen Protomen sprechen eher für den Kult einer Göttin. Bei allem Vor-behalt könnte der Kultbau daher der Göttermutter (Kybele) zugewiesen werden111. Allerdings findet eine solche Hypothese bisher keine Unterstützung durch die Graf-fiti, die in den archaischen Schichten im Bereich des Kultbaus gefunden wurden.
C. Die klassische und hellenistische Zeit (Taf. I, VIII-IX)
Im Gegensatz zu den Tempeln von Zeus und Aphrodite, die um die Mitte des 5. Jhs. wiederaufgebaut wurden, ist der Kultbau M nach seiner ersten Zerstörung endgültig aufgegeben worden. Erst in hellenistischer Zeit wurden im Rahmen einer neuen Raumgestaltung neue Monumente in diesem Bereich errichtet.
Südlich vom Aphrodite-Tempel fehlen Monumente klassischer Zeit gänzlich. Dafür können unter Umständen auch römerzeitliche Gebäude verantwortlich sein, da mehrfach zu bemerken war, daß ihre tiefen Fundamente bis auf den Fels hinab-reichen. Ferner ist daran zu erinnern, daß noch in der ersten Hälfte des 4. Jhs. das Monument K in der heiligen Grube errichtet wurde112.
Immerhin beweist das Fragment einer monumentalen Marmorplatte, welches die Reste einer allem Anschein nach in das 5. Jh. datierbaren Stoichedon-Inschrift bewahrt, daß in jenem Jahrhundert wohl doch eine gewisse Bautätigkeit entfaltet wurde. Die wichtigsten Belege dafür liefern jedoch einige Spolien. Unter diesen hervorzuheben ist ein bislang unpublizierter Türsturz aus Kalkstein (Maximallän-ge 1,83 m), der in einer Mauer eines römerzeitlichen, westlich vom Monument C
107 Die Typen sind wie auch sonst milesischer Prägung und datieren um 500.108 Gute Analogie in Pantikapaion: P. F. Silant’eva, Terrakoty Pantikapeja, in M. M. Kobylina (Hg.), Terrako-tovie statuetki III. Pantikapej, Moskau, 1974, S. 16, Taf. 3-4.109 Dafür sind wir Herrn Dr. Bogdan Constantinescu (Institut für Atomphysik Bukarest) sehr zu Dank verpflichtet.110 Es handelt sich um die vierte archaische Inschrift in Histria überhaupt und um die dritte aus der Tempelzone. Die zweite Zeile weist auf eine Bustrophedon-Inschrift hin.111 Vgl. dazu den Kybele-Tempel in Olbia: A. S. Rusjaeva u. a. (wie Anm. 74), S. 20-22. Allgemein dazu: Maria Alexandrescu Vianu, Sur la diffusion du culte de Cybèle dans le bassin de la mer Noire à l’époque archaï-que, Dacia N. S. 24, 1980, S. 261-265.112 Dazu oben Anm. 71-72.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 63
liegenden Gebäudes wiederverwendet worden war. Dieser Türsturz könnte in das erste Viertel des 5. Jhs. gehören.
Der auf Lysimachos zurückgeführten Zerstörung des gesamten Temenos folgte eine neue, auffallend rege Bautätigkeit, deren Schwerpunkt in die erste Hälfte, ver-mutlich genauer in das zweite Viertel des 3. Jhs. fällt113. Das wichtigste Monument, das in dieser Zeit zu den wiederhergestellten älteren Bauten hinzugefügt wurde, ist der dem Theos Megas geweihte Tempel, von dem einzelne Bestandteile gefunden wurden114.
Außerdem ist ein Neufund südlich des Aphrodite-Tempels bemerkenswert. Un-ter den Fundamenten eines Gebäudes aus dem 2. Jh. n. Chr. wurden Spuren eines möglichen Altars identifiziert (als Monument L bezeichnet). Bestätigt sich diese Ver-mutung, so kann es sich nur um den hellenistischen Altar der Aphrodite handeln. Teile seines Unterbaus in Gestalt einer Plattform, die aus unregelmäßigen Kalkstein-blöcken besteht, wurden ca. 8 m südlich vom Aphrodite-Tempel entdeckt und lassen auf eine Grundfläche von etwa 5,50 x 5,50 m schließen (Taf. VIII, IX, Schnitt 13-13)115. Den Altar umgab wohl eine U-förmige oder gar komplette Umzäumung, was ein während der älteren Ausgrabungen im Inneren des Aphrodite-Tempels entdeck-ter Gebälkblock aus Marmor vermuten läßt (Taf. XIII d). Dieser Block weist an drei seiner Seiten einen alternierend mit Lilienblüten und Palmetten dekorierten Fries auf116. Gehört er wirklich zu diesem vermuteten Altar, so würde dies auf dessen Wie-derherstellung in späthellenistischer Zeit hinweisen117. Wenn die Fundamentreste wirklich zu einem Altar gehörten, dürfte dieser so alt wie der Tempel selbst und in hellenistischer Zeit nur restauriert worden sein. Es ist schließlich auffallend, daß die Nord-Süd-Orientierung des vermutlichen Altars derjenigen des Aphrodite-Tempels entspricht.
Etwa in dieselbe Zeit scheint auch die Wiederherstellung der heiligen Straße zu fallen118. Es ist anzunehmen, daß sie von Anfang an bestand; doch wie sie in ar-
113 Histria VII, S. 109-127.114 Dazu Anm. 46 und 56. Die Diskussion über die ursprüngliche Lage dieses Kultbaus und den Zeit-punkt seiner Zerstörung kann jetzt im Lichte eines Neufundes wieder aufgenommen werden, da im Jahre 2009 in einer frührömischen Schicht, die zerstörte ältere Reste im Bereich des Monumentes C versiegelte, ein Gesimsblock mit Mutuli zutage kam, der höchstwahrscheinlich dem Theos-Megas-Tempel zuzuwei-sen ist (Taf. XXIII a (B) und b).115 Diese Ausmaße haben einen rein orientierenden Charakter; in Erwartung künftiger Verifizierungen geht es vorerst nur um die rekonstruierbare Fläche.116 Histria VII, S. 118-119 (wo P. Alexandrescu den Block dem zu jener Zeit noch nicht lokalisierten Altar der Aphrodite zuweist); Histria XII, S. 343-347, Kat. XII.7, Taf. XCVII und 65-66.117 P. Alexandrescu datierte das Gebälkfragment in das 3. Jh., dagegen zieht Monica Mărgineanu Câr-stoiu das 2. oder die erste Hälfte des 1. Jhs. vor. Unter diesen Umständen würde es sich um die Wie-derherstellung des Altars kurz nach dem Erdbeben um 100 handeln, d. h. während der letzten, (spät-)hellenistischen Phase der Tempelzone.118 Vgl. einen ersten Bericht dazu: A. Avram, K. Zimmermann, Monica Mărgineanu Cârstoiu und I. Bîr-zescu (wie Anm. 7), S. 246-247. Eine iJeroplateiva wird während der antoninischen Zeit auf eine indirekte Weise durch die Inschrift ISM I 57, Z. 32, belegt (iJeropªlaºtei'ai, d. h. “die Bewohner entlang der hei-ligen Straße”). Da man aber über keine aussagekräftigen Beweise für das sakrale Fortleben dieser Zone nach der Zerstörung Mitte des 1. Jhs. verfügt, wäre es voreilig, einen Zusammenhang zwischen jener auf Grund archäologischer Angaben vermuteten heiligen Straße hellenistischer Zeit und der indirekt in der kaiserzeitlichen Inschrift erwähnten iJeroplateiva herzustellen.
Estratti
64 Alexandru Avram et alii
chaisch-klassicher Zeit aussah, ist unbekannt, obwohl dazu manche Vermutungen geäußert wurden. Dagegen gibt es genügend archäologische Anhaltspunkte für die hellenistische Zeit, und zwar im Bereich zwischen dem Monument D und der der-zeit erreichten Südgrenze des Grabungsareals. Es handelt sich dabei um eine Reihe von Votivbasen, die mehrheitlich durch die älteren Ausgrabungen zutage gefördert wurden. Dieses Bild wird durch die neueren Untersuchungen noch bekräftigt, inso-weit als eine im 3. Jh. angelegte und später im 2. bzw. in der ersten Hälfte des 1. Jhs. restaurierte Straße nachgewiesen werden konnte. Sie sieht wie ein Estrich aus, der aus zersplitterten, mit scherbenhaltigem Lehm gemischten Kalksteinen besteht. Un-ter den Scherben, die in diesem Estrich auftauchten, gibt es z. T. auch chronologisch verwertbare Stücke, u. a. Amphorenstempel, die eine Datierung zulassen.
Am Rande dieser Straße wurden östlich der heiligen Grube und unter dem Ni-veau der frühbyzantinischen Basilika aus dem 5. Jh. n. Chr.119 zwei neue Basen (aa und bb) in situ entdeckt (Taf. IX, Schnitt 14-14; XXI a). Die beiden Basen, die höchst-wahrscheinlich Votive trugen, liegen 58,3 cm in N-S-Richtung voneinander entfernt, und zwar im Bereich der in spätarchaischer Zeit vom oben behandelten Monument M und in frühbyzantinischer Zeit von einer christlichen Basilika eingenommenen Are-al. Die südliche Basis (bb) hat die Gestalt eines aus vier Blöcken bestehenden Funda-mentsockels (128,1 x 133,4-9 cm). Zwei Euthynterie-Blöcke bilden die westliche und östliche Seite, während die anderen, die Spuren des groben Meißels neben solchen vom Spitzhammer auf den sporadischen Resten des Anathyrose-Rahmens aufweisen, die Süd- und Nordseiten ergänzen. Etwa gleichartig ist auch die nördlicher gelegene Basis (aa) gebildet, von der vier Blöcke erhalten geblieben sind. Der gegen Westen vorspringende nördliche Block war ursprünglich die Basis eines Eckpfeilers. Die an-deren Blöcke bewahren zum einen auf ihre ursprüngliche Bestimmung hinweisende Spuren (Dübellöcher mit Angußkanälen und flache schwalbenschwanzförmige Klam-mereinarbeitungen), zum anderen sekundär geschnittene schwalbenschwanzförmige Klammereinarbeitungen, wobei letztere beweisen, daß – wie sonst in Sardes oder auf Delos – auch in Histria eine ‘Wiedergeburt’ des archaischen Embolontyps im 2. Jh. stattfindet120.
Im Bereich dieser Basen sind Reste eines Estrichs erhalten geblieben, die ihr Ni-veau angeben, das übrigens das gleiche ist wie jenes, welches dem oben erwähnten, vermutlichen hellenistischen Altar der Aphrodite zuzuordnen ist (Taf. IX). Da es sich dabei um das zweite hellenistische Bodenniveau handelt, datieren diese Basen in das 2. Jh. Allem Anschein nach lagen in diesem Bereich noch weitere derartige Monumente, die aber durch die sukzessiven Abtragungen verschwunden sein dürf-ten. Ebenfalls in der Nähe der heiligen Straße sind – in allerdings unstratifizierter Lage – verschiedene Inschriftenträger entdeckt worden, die auf etliche Weihungen an Gottheiten oder auf Abgrenzungen heiliger Bezirke hindeuten. Auch wenn es unmöglich ist, diese Stelen jeweils mit einer dieser Basen zu verbinden, so läßt sich
119 Hervorzuheben ist dabei, daß – von den tief reichenden Fundamenten abgesehen – die Basilika mit ihrem ziemlich hohen Bodenniveau die vorhergehenden hellenistischen Schichten sonst kaum berührt hat, so daß in ihrem Inneren das chronologisch Ältere gleichsam versiegelt war und gut nachgeprüft werden konnte.120 Dazu R. Martin, Manuel d’architecture grecque I, Paris, 1965, S. 254-255.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 65
doch annehmen, daß Horoi wie etwa der des Apollon Pholeuterios (ISM I 105) oder des Phorkys (ISM I 106)121 irgendwie dazu gehört haben.
Außer diesen in situ entdeckten Denkmälern lohnt es sich wiederum, den archi-tektonischen Spolien die ihnen gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Sie wurden entweder als Baumaterial für die Häuser des im ersten nachchristlichen Jahrhundert errichteten Wohnviertels verwendet oder einfach weggeworfen. Solche membra disiecta stützen die Feststellung, daß im Gegensatz zur vorhergehenden, weitgehend von der ionischen Ordnung dominierten Zeit die hellenistische Epoche mehr von der dorischen Ordnung geprägt war122. Unter den Neufunden sind zwei Friese zu erwähnen, der eine aus Kalkstein, mit Bukranien und Bandgirlanden dekoriert (Taf. XXVII b) und stilistisch der Basis der Kultstatue der Aphrodite nahestehend (Taf. XIII a)123, der andere mit der Darstellung von Löwen und Greifen124. Was die aufgefundenen Votive anbelangt, so sind diese ebenso repräsentativ wie in den vorhergehenden Zeitabschnitten.
D. Das römische und römisch-byzantinische Nachleben (Taf. I, X, XXIV a-b)
Wie oben schon gezeigt worden ist, datiert das Ende der Tempelzone in die Mitte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts, allem Anschein nach um das Jahr 48, als Histria – wie übrigens auch Olbia und andere west- und nordwestpontische Städte – den Plünderungszügen der Geten unter Burebista zum Opfer fiel125. Der spätesthel-lenistische (‘augusteische’) Horizont läßt sich nur teilweise nachweisen. Zu erwäh-nen sind allein die geringen Spuren von einigen Werkstätten: ein nordöstlich des ehemaligen Aphrodite-Tempels liegender Ofen, in dem Lampen hergestellt wurden, oder Kalköfen westlich der Trümmer desselben Tempels.
Die römerzeitliche Bautätigkeit scheint unter Augustus zu beginnen, wobei das durch die Ausgrabungen festgestellte wichtigste Ergebnis die endgültige Desakra-lisierung des Bezirkes darstellt. Beweise dafür liefert die Tatsache, daß die in dieser Zeit errichteten Gebäude über die einstige Plattform des Aphrodite-Tempels aus-greifen und schließlich sogar die südwestliche Ecke des älteren Naos überdeckt ha-ben. Wie auch sonst im Stadtbereich wurden die hellenistischen Fluchten (NO-SW) auch zwischen der hellenistischen und der nachgotischen Festungsmauer beibehal-ten126. Die Folgen dieser Entwicklung zeigten sich vor allem bei den Ausgrabungen im Süden und Westen der ehemaligen Tempelzone.
Im Westen reichen die Ausgrabungen heute bis an eine Mauer heran, deren Fun-damentreste auf einer Länge von ca. 26 m freigelegt wurden und die u. a. die süd-westliche Ecke der Plattform des Aphrodite-Tempels überlagert und zerstört hat. Ein paar Quermauern lassen Innenräume entstehen, deren Breite nahezu konstant bleibt (ca. 7 m). Der südliche dieser Räume berührt an seiner südöstlichen Ecke die
121 Dazu Anm. 47-48.122 Dazu Anm. 49-58.123 Dazu Anm. 62.124 I. Bîrzescu, Istros/Histria, in Pia Guldager Bilde et alii, Archaeology in the Black Sea Region in the Classical Antiquity, Archaeological Reports for 2007-2008 (2010), S. 126, Abb. 8. 125 Dazu Anm. 66.126 Dazu Monica Mărgineanu Cârstoiu, Plans de villes (wie Anm. 6), S. 303-310 mit Abb. 3,5.
Estratti
66 Alexandru Avram et alii
westliche Naos-Seite des ehemaligen Tempels. Dieselbe Phase ist auch weiter im Süden nachweisbar (Taf. X).
Die zweite urbanistische Phase ist in traianische Zeit zu datieren und läßt sich besser fassen, weil sich die damals angelegte Insula, die bis zur gotischen Zerstö-rung in der Mitte des 3. Jhs. n. Chr. fortbestand, trotz späterer Umgestaltungen im großen Ganzen gut erhalten hat. Die Ausgrabungen haben diese Insula (oder meh-rere?) größtenteils freigelegt. Dieser neue Siedlungshorizont nimmt im allgemeinen auf die vorige Orientierung Rücksicht, wobei aber ein anderer Gebäudezuschnitt entsteht. Hierzu gehören unter anderem eine mit Steinplatten gepflasterte Fläche westlich vom ehemaligen Aphrodite-Tempel sowie ein südlich von diesem gelege-ner, ebenfalls mit flachen Steinplatten gepflasterter Innenhof mit Brunnen, auf den eine zum Sammeln des Regenwassers bestimmte Rinne hinführt.
Die Mauern verwenden neben Schiefer größtenteils schon bearbeitete Kalkstein-blöcke, die den zerstörten Monumenten griechischer Zeit entnommen worden waren. Solchen Spolien127 ist eine erweiterte Kenntnis der Architektur ehemaliger Kultbauten zu verdanken, während die unter denselben Bedingungen gefundenen Inschriften zu-sätzliche Angaben zu den Kulten liefern. Unter den wichtigeren epigraphischen Fun-den sei hier nur auf die vor kurzem publizierte Weihung an Leto verwiesen128.
Mit größter Wahrscheinlichkeit stellte die lange Mauer, die westlich vom ehe-maligen Aphrodite-Tempel freigelegt wurde, die westliche Grenze der Insula dar. Ihre nördliche Grenze, auf die die älteren Ausgrabungen teilweise gestoßen waren – sie ist seit langem demontiert –, verlief etwa im Bereich zwischen dem Monument C und den Vorderseiten der Tempel A und A’, während die noch nicht freigelegte Südgrenze irgendwo zu suchen sein wird, wo die zeitlich nachfolgende spätrömi-sche Insula im Süden aufhört129. Was schließlich ihre Ostgrenze anbelangt, so liegt hier der Sachverhalt wesentlich komplizierter. Zwar kennt man die östliche Flucht der frührömischen Festungsmauer nicht, doch wenn diese – in Rücksicht auf die zu Beginn der Kaiserzeit immer mehr fortschreitende und einen Rückzug der Mauer nach Westen erzwingende Transgression des Wasserspiegels – vielleicht derselben Richtung wie die spätrömische, nach der Gotenzerstörung neu errichtete Mauer ge-folgt sein sollte, ist höchstwahrscheinlich ein intervallum zwischen letzterer und der Ostgrenze der Insula anzunehmen. Falls in diesem Bereich jemals Gebäude existiert haben sollten, müßten sie spätestens bei Errichtung der Basilika im 5. Jh. n. Chr. zer-
127 Erwähnenswert ist u. a. ein späthellenistischer Trapezophor aus Marmor, zu dem auch Fragmente, die in der Füllung der heiligen Grube gefunden wurden, passen: Histria XII, S. 348-352, Kat. XII.9.a, Taf. XCVIII und 68-69 (“fin du IIe siècle – début du premier siècle av. J.-C. ou même plus tard”). Die Einfüllung der Grube zu Beginn des 1. Jhs. (vgl. Anm. 76-77) bietet jetzt aber einen unerwarteten terminus ante quem, daher sollte man von nun an auf “même plus tard” verzichten.128 Diese Weihung hatte eine Priesterin der Artemis Pythie aufgestellt, wobei die Epiklesis in Histria erstmals auftaucht. Dazu A. Avram, I. Bîrzescu und K. Zimmermann (wie Anm. 7), S. 115-117, Nr. 24, Abb. 5 a-b; A. Avram, Épigraphie et histoire religieuse: le culte de Léto dans les cités de la mer Noire, in À. Martínez Fernández (Hg.), Estudios de Epigrafía Griega, La Laguna, 2009, S. 309-310, Nr. 4.129 Allgemein wurde festgestellt, daß das neu eingerichtete römische Straßennetz die auf die hellenisti-sche Zeit zurückgehenden Fluchten größtenteils übernimmt, so A. S. Ştefan, Cercetări aerofotografice pri-vind topografia urbană a Histriei I. Epoca romană (sec. I-III e. n.), Revista muzeelor şi monumentelor 43, 1974, 1, S. 39-51; Monica Mărgineanu Cârstoiu, Plans de villes (wie Anm. 6), S. 303.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 67
stört worden sein, denn die Fundamente dieses frühchristlichen Neubaus (Taf. X)130 reichen teilweise bis auf den Fels. Alles in allem bleibt die Ostgrenze der Insula traia-nischer Zeit weiterhin unbekannt.
Kein Gebäude unter den innerhalb dieser Insula freigelegten läßt sich als Kult-bau identifizieren. Jedoch scheint es darauf vielleicht einen indirekten Hinweis zu geben, der einem allerneuesten Befund zu verdanken ist. An der südöstlichen Ecke des Grabungsareals kam gegen das Ende der Kampagne 2009 eine römische Mar-morskulptur ans Licht, die in einer spätrömischen Mauer als Spolie Verwendung gefunden hatte. Vollständig erhalten ist ein Panther mit einer Pfote auf einem Rin-derschädel; daneben erscheint ein kolossaler beschuhter Fuß von einem möglicher-weise stehenden Menschen (Taf. XXX c). Die Größe des Fußes läßt auf eine Höhe des Standbildes von etwa 2,50 m schließen. An der Spitze des sorgfältig mit einer Schnur gebundenen Schuhes ist deutlich ein Efeublatt sichtbar. Die ikonographischen Ele-mente sprechen daher für eine Darstellung des Dionysos131, die Größe sehr wahr-scheinlich für dessen in das 2. Jh. n. Chr. anzusetzende Kultstatue, die in seinem Heiligtum aufgestellt gewesen sein muß.
Wo aber lag dieses Heiligtum? Zwar läßt sich dazu noch keine sichere Aussage treffen, doch daß es von dem genannten Fundplatz nicht allzu weit entfernt lag, scheint aus anderen Befunden hervorzugehen. Im Abstand von nur etwa drei Meter von der genannten Fundstelle wurde während derselben Grabungskampagne ein völlig erhaltener und beschrifteter Marmorblock gefunden, der eine sehr genaue Da-tierung zuläßt. Es handelt sich um eine Liste von Priestern des Dionysos Karpopho-ros132, die sich durch die Eponymie des Statthalters der Provinz Moesia Inferior Ma-nius Laberius Maximus auf 100-103 n. Chr. datieren läßt133. Eine andere gleichartige und aus prosopographischen Gründen nur ein paar Jahrzehnte jüngere Priesterliste war schon 1994 an derselben Stelle entdeckt worden, diesmal im Pflaster der etwa in iustinianische Zeit datierten Straße II wiederverwendet134. Diese beiden Inschriften gehören zu einer Reihe anderer, schon länger bekannter Kataloge von Priestern des Dionysos Karpophoros (ISM I 198, 203-206), die aber an nicht mehr lokalisierbaren Stellen gefunden worden waren. Ob dazu auch ein Relief mit der Darstellung des Thrakischen Reiters gehört, das 1998 etwa acht Meter westlich derselben Fundstelle gefunden wurde135, bleibt allerdings fraglich. Hier ist daran zu erinnern, daß in Thra-
130 Es handelt sich um die Basilika, die die Reste des oben beschriebenen Monumentes M überlagert und die weiter unten kurz behandelt werden wird.131 Die Statue wird Frau Dr. Maria Alexandrescu Vianu veröffentlichen.132 Florina Panait Bîrzescu, im vorliegenden Band, S. 103-112.133 Wohl sogar genauer auf 100 oder 101 n. Chr., soweit die berühmte Abgrenzung des histrianischen Territoriums (ISM I 67-68) – eine der bedeutendsten Privilegurkunden, die die Römer der Stadt verlie-hen haben – am 25. Oktober 100 vom genannten Statthalter erlassen wurde, was für die Histrianer ein schwerwiegender Grund gewesen sein könnte, um den großzügigen Legaten in voller Dankbarkeit mit der Stadteponymie zu ehren. 134 Fragmentarisch erhaltenes hellenistisches Ehrendenkmal, das in antoninischer Zeit für einen Priester-katalog wiederverwendet wurde: A. Avram und Mihaela Marcu, Monument epigrafic inedit de la Histria, SCIVA 50, 1999, S. 71-77 (SEG 50, 683).135 E. Teleagă, O reprezentare a Cavalerului Trac de la Histria, SCIVA 50, 1999, S. 163-169; Histria IX, S. 121-122, Kat. 152, Taf. 64 c; M. Oppermann, Der Thrakische Reiter des Ostbalkanraumes im Spannungsfeld von
Estratti
68 Alexandru Avram et alii
kien solche Funde mehrfach in Tempeln des Dionysos auftauchen. Da wenigstens zwei der Inschriftenkataloge mit Namen von Priestern des Dionysos, der stets die in Histria nur während der Kaiserzeit belegte Epiklesis Karpophoros (‘der Erntebrin-gende’) trägt, und dazu in demselben eng begrenzten Bereich auch noch die ihn dar-stellende kolossale Marmorstatue entdeckt wurden, gewinnt die Annahme, daß sich das Heiligtum der genannten Gottheit im 2. Jh. n. Chr. unweit von der Stelle befand, an der diese Gegenstände auftauchten, ausreichende Wahrscheinlichkeit. Entweder ist eines der schon freigelegten Gebäude damit zu identifizieren (was allerdings we-niger wahrscheinlich erscheint), oder das Heiligtum hat etwas weiter nach Süden gelegen und wäre dann bei künftigen Ausgrabungen noch zu erwarten, oder aber es ist bereits von den nachgotischen Bauten völlig zerstört worden. Im Moment ist es unmöglich, auf diese Frage zu antworten; immerhin bleibt die Möglichkeit offen, daß im direkten Umfeld der aus den schon erwähnten Umständen aufgelassenen griechischen Tempelzone doch ein römerzeitlicher heiliger Bezirk lag, in den dann vielleicht einige Kulte verlegt worden sein könnten. Im Moment handelt es sich je-denfalls um den einzigen Hinweis auf das Fortbestehen einer gewissen Kulttätigkeit in diesem Bereich nach dem vernichtenden Einschnitt Mitte des 1. Jhs.136.
Das zeitliche Ende der bisher behandelten Insula ist – wie schon angedeutet – mit der gotischen Zerstörung in Verbindung zu bringen (wohl um 251 n. Chr.). Nach dieser Katastrophe lag im Zentrum der Wiederaufbautätigkeit verständlicherwei-se die Errichtung einer neuen Festungsmauer. Genau an deren Nord-, West- und Südseite untersucht137 und dank wiederholter moderner Restaurierungsarbeiten auch heute in ihrer Monumentalität erlebbar, war diese Mauer im Osten so gut wie unbekannt138. Erst durch die jüngsten Ausgrabungen in der Tempelzone wurde ein Teil davon freigelegt: die Innenwand aus etwa regelmäßigen Kalksteinen sowie das Emplekton aus zersplitterten und mit Mörtel gebundenen Schiefersteinen. Das Fun-dament dieser Mauer war, wie die nördlich der im folgenden zu behandelnden Ba-silika freigelegte Partie zeigt, in ein in den anstehenden Schieferfels flach eingetieftes Bett eingelassen139. Die Außenwand der Festungsmauer bleibt derzeit nicht faßbar, da sie in den schon aufgedeckten Bereichen zerstört ist oder noch gar nicht ausge-graben wurde.
Graecitas, Romanitas und lokalen Traditionen, Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, 7, Langenweißbach, 2006, S. 10, 323, Kat. 26, Taf. 4,26.136 Nur unter größtem Vorbehalt sei noch ein kleiner Raum in einem in die zweite Phase des ursprünglich traianischen Horizontes (ca. 170-250 n. Chr.) datierten Gebäude erwähnt, wo eine von senkrecht stehen-den Ziegeln abgegrenzte Herdstelle und daneben ein Hirschgeweih entdeckt wurden (Taf. XXIV a-b). Ob daraus eine sakrale Deponierung hergeleitet werden darf, bleibt höchst fraglich.137 Allgemein dazu Catrinel Domăneanţu, Die spätrömische Festungsmauer von Histria, in P. Alexandrescu und W. Schuller (wie Anm. 3), S. 265-283. Dort findet sich auch eine zusammenfassende Behandlung der wichtigsten historischen Ereignisse, auf die hier kaum eingegangen werden kann.138 Außer im Bereich des Turmes A, wo die Ostseite der Festungsmauer an die Nordseite anschließt. Für Einzelheiten siehe den bereits in der vorigen Anm. zitierten Aufsatz.139 Im Bereich der Basilika macht das Fundament der Festungsmauer einen Knick und verläuft nicht genau parallel zur Flucht des darüber liegenden Baus. Dieser springt nämlich in seiner Nordpartie ca. 20 cm nach Westen vor, während er im Süden unter der Kurtine verschwindet. Dabei kann es sich entweder um einen Hinweis auf verschiedene Phasen bei der Errichtung der Festungsmauer oder bloß um eine Ungenauigkeit beim Verlegen des Fundamentes handeln.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 69
Was die Bauaktivitäten des 4. oder 5. Jhs. n. Chr. anbelangt, so weiß man davon so gut wie nichts. Grund dafür ist die Tatsache, daß nach einer höchstwahrscheinlich unter Anastasius, d. h. ca. 500 n. Chr. begonnenen urbanistischen Neugestaltung mit allem Vorhergehenden wiederum tabula rasa gemacht wurde. Dabei scheinen die äl-teren Ruinen unterschiedlich behandelt worden zu sein: Entweder wurden die noch bestehenden Mauerreste als Fundamente für neue Gebäude benutzt oder wurde der Schutt eingeebnet, um neue Bauten auf einem deutlich höher liegenden Bodenni-veau zu errichten. Allein beim Straßennetz ist mit einer gewissen Kontinuität zu rechnen. Unabhängig davon, daß man bei derselben Gelegenheit viel Älteres abge-räumt hat, gestaltet sich der Sachverhalt dadurch noch komplizierter, wenn auch mehrere Abfallgruben oder Brunnen aus derselben Zeit in Betracht gezogen werden: Sie reichen nämlich oftmals bis auf den Fels hinunter, wodurch alle im Wege befind-lichen älteren Mauerreste sowie die komplette Stratigraphie zerstört wurden140.
Jedoch gibt es zwei Stellen, an denen sich die Bautätigkeit zwischen den beiden bedeutenden Zäsuren – d. h. der gotischen Zerstörung bzw. dem Wiederaufbau un-ter Anastasius – gleichermaßen fassen läßt. Erstens handelt es sich um einen kleinen Bereich an der westlichen Grenze der ehemaligen traianischen Insula, wo sich eine ungestörte Stratigraphie vom Ende der Tempelzone um die Mitte des 1. Jhs. v. Chr. bis zur Preisgabe der Stadt um den Anfang des 7. Jhs. n. Chr. erhalten hat. Zwei-tens ist auf die im östlichen Bereich des Grabungsareals liegende und ungefähr nach Norden orientierte christliche Basilika zu verweisen, die in der ersten Hälfte des 5. Jhs. n. Chr. errichtet wurde141. Von ihr sind vor allem die Fundamente erhalten geblieben, die z. T. unmittelbar auf dem anstehenden Fels liegen. Ihr Fußboden liegt ziemlich hoch, was Aufschüttungen und wiederholtes Einebnen über den vorherge-henden Trümmern voraussetzt.
Die in Nord-Süd-Richtung orientierte einschiffige Basilika mit halbkreisförmiger Apsis stößt im Osten direkt an die nachgotische Festungsmauer an. Ihre Außenlän-ge (ohne Apsis) erreicht ca. 11,65 m, ihre Breite 7,20 m; die ca. 2,75 m weiter nach Norden vorspringende, dabei leicht eingerückte Apsis mißt deshalb außen in der Breite nur noch 5,40 m. Das Innere der Basilika besteht aus einem ca. 6,20 m langen und im Bereich des Triumphbogens, dessen Öffnung sich auf etwa 3,45 m rekon-struieren läßt, ungefähr 5 m breiten Naos sowie einem weiteren Raum, vermutlich einem Pronaos, der sich auf eine Länge von 3,10 m und einer Breite von im Süden max. 6,20 m erstreckt; die lichten Innenmaße der Apsis errechnen sich aus deren Innenradius von ca. 1,70 m. Die Dicke der Mauerfundamente – auch bei der Apsis – kann bis zu 90 cm erreichen, während sie im Westen und Süden etwas geringer
140 Dafür sollen hier nur ein paar Beispiele angeführt werden: Der Brunnen in der Nähe der nordwest-lichen Ecke des ehemaligen Aphrodite-Tempels hat alle Schichten bis auf den Fels durchschnitten. Eine Grube etwa runder Form (Durchmesser bis 2 m) aus dem 4. oder 5. Jh. n. Chr. wurde in die Füllung der ehemaligen heiligen Grube nahezu bis auf den Fels eingetieft, was zur Folge hatte, daß man während der Ausgrabungen bis zu einer erheblichen Tiefe auf römische Amphoren oder Amphorenreste dieser Zeit gestoßen ist. Endlich zeichnet sich im südwestlichen Bereich des jetzigen Grabungsareals eine riesige Grube aus dem 4. oder dem 5. Jh. n. Chr. ab, der an dieser Stelle die westliche Grenze der traianischen Insula völlig zum Opfer gefallen war und die später ihrerseits von der etwa in iustinianische Zeit gehö-renden Straße I versiegelt wurde.141 Ausgrabungen 1997.
Estratti
70 Alexandru Avram et alii
ausfällt (ca. 75 cm). Das einzige Zeugnis für den Oberbau blieb an der Nordwestek-ke erhalten, wo Mauerschichten aus untereinander mit Erde gebundenen unregel-mäßigen Kalksteinblöcken zu erkennen sind. Im Inneren des Naos wurden spärli-che Reste einer aus Steinplatten bestehenden Pavage vorgefunden, in der Spolien wiederverwendet wurden. Gleichzeitig mit Errichtung der Basilika legte man eine an ihre Westmauer anstoßende und von Nord nach Süd gerichtete Straße an. Diese wurde ihrerseits während der der Zerstörung der Basilika folgenden Phase blok-kiert, um danach erneut angelegt zu werden. Südlich der Basilika überschnitt diese Nord-Süd-Achse eine von Ost nach West orientierte Straße, deren Flucht vielleicht derselben Richtung verpflichtet war wie die Straße, welche die spätrömische Insula südlich abgrenzte (siehe im folgenden Straße III).
Mehrere stratigraphische Schnitte im Gebiet der Basilika haben erkennen lassen, daß die älteren Schichten nur bis in späthellenistische Zeit einigermaßen ungestört geblieben sind142; das macht zugleich verständlich, daß alles Jüngere abgetragen wurde und warum die östliche Grenze der traianischen Insula zumindest in diesem Bereich verschwunden ist.
Die Basilika erfuhr ihre Zerstörung unter unbekannten Umständen, indem man ihre Mauern offenbar bis auf die Höhe der Fundamente systematisch abgebaut hat. Zunächst wurde an derselben Stelle nichts Neues errichtet. Denn soweit sich fest-stellen ließ, endeten die wenigen erhaltenen Mauerzungen, die unmittelbar nach der Erbauungszeit der Basilika anzusetzen sind, genau an ihrer Apsis. Erst während einer nächsten Phase, als nämlich in der Regierungszeit des Anastasius beginnend allmählich eine neue Insula entstand, wurde die Basilika von einem in dieser Zeit errichteten Wohnviertel überlagert. Dasselbe Schicksal erfuhr die an ihrer Westseite entlang führende Straße: Ein darüber liegendes Straßeniveau (Straße II) kann näm-lich auf Grund der jüngsten Münzen, die in ihrer Füllung gefunden wurden, in die Zeit Iustinians datiert werden. Mit Rücksicht auf diese Abfolge und in Anbetracht der Existenz einer ‘Zwischenphase’, in der anstelle der niedergelegten Basilika nicht neu gebaut wurde, spricht sehr viel dafür, den Sakralbau in die erste Hälfte des 5. Jhs. n. Chr. zu datieren143. Eine solche für Kleinskythien ziemlich frühe Datierung scheint auch vom architektonischen Typ (länglicher Grundriß, ohne Querschiff) so-wie von der Orientierung der Apsis nach Norden – und nicht wie später ausnahms-los nach Osten – bekräftigt zu werden.
Der letzte für die Stadtplanung Histrias wichtige Siedlungshorizont, der der Zeitspanne von Anastasius bis Iustinian entspricht, vertritt ein teilweise neues Kon-zept, das zwar die älteren Fluchten annähernd aufrechterhält, aber die innere Ein-teilung der Wohnkerne ändert. Es ist nicht ausgeschlossen, daß vom Vorhandensein der Nord-Süd-Achse westlich der ehemaligen Basilika folgenreiche urbanistische Umwälzungen ausgegangen sind. Die neue Insula weist im Vergleich zur vorigen geringere Abmessungen in ihrer Ost-West-Erstreckung auf, während ihre westliche und südliche Begrenzung dieselben geblieben zu sein scheinen. Denn hier zeichnen
142 Dies erklärt u. a., warum unter dem Fußboden der Basilika die Basen aa und bb aus dem 2. Jh. sowie die Fundamente des Kultbaus M ungestört blieben und auch untersucht werden konnten (siehe oben).143 Die ‘Zwischenphase’ würde demnach in die zweite Hälfte des 5. Jhs. n. Chr. fallen.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 71
sich jeweils Straßenniveaus ab, deren Estrich stellenweise auch Steinplatten auf-weist. Die Straße I (im Westen) steht in einer auffälligen Kontinuität zu ihrer Vor-läuferin, die die traianische Insula vor der gotischen Zerstörung westlich abgrenzte. Die Straße II (im Osten) überlagerte ihrerseits – wie bereits gezeigt – die Mauerfun-damente der ehemaligen Basilika, ehe sie einen leichten Knick nach NW aufweist. Was die Straße III anbelangt, so schloß sie nicht nur die neue Insula nach Süden ab, sondern stellt im Moment auch die Grenze des Grabungsareals in dieser Richtung dar. Die nördliche Grenze der Insula war schon während der älteren Ausgrabungen am Aphrodite-Tempel freigelegt worden und existiert heute nur noch auf den Plä-nen. Östlich dieser Insula aus der ersten Hälfte des 6. Jhs. wurden zur gleichen Zeit mehrere Gebäude errichtet, die an die Festungsmauer anstießen.
Die Häuser aus diesem letzten histrianischen Horizont waren alle aus Schieferge-stein errichtet und wiesen keinen Mörtel auf. Ihre Fußböden bestanden üblicherwei-se aus festgestampftem Lehm, wobei Schieferplatten nur stellenweise auftauchen. Erwähnenswert wäre ein großer Innenhof, dessen westliche Front die parallel zur ehemaligen Basilika laufende Straße II bildete und in dessen Boden sich dickbau-chige Dolia eingegraben fanden. Wie in den vorhergehenden Epochen wurden auch in die Gebäude dieser Zeit vielfach Spolien eingemauert. Ebenso reich an solchen membra disiecta erwiesen sich die verschiedenen Auffüllungen und die genannten Straßen, in denen Kapitelle, Friese, Fragmente von Steinskulpturen und Reliefs144, Inschriften bzw. Inschriftenbruchstücke145 und einiges mehr entdeckt wurden.
Aus allem Gesagten geht hervor, daß dieser nachgriechische Horizont von ziem-licher Bedeutung für die Erforschung Histrias in römischer bzw. römisch-byzantini-scher Zeit ist146. Dazu liefert die Tempelzone die nötigen membra disiecta, auf denen verschiedene Hypothesen sowohl zur Architektur als auch zur Benennung der Kult-bauten beruhen. Allerdings liegt das Schwergewicht des Gesamtprojektes darin, vorrangig die griechische Tempelzone als solche zu erforschen und nicht, was spä-ter an deren Stelle gebaut bzw. zerstört wurde. Das bedingt bei aller Hochachtung, die die römischen Denkmäler verdienen, ja erzwingt geradezu, die späteren Mo-numente allmählich abzubauen, um für künftige Ausgrabungen Platz zu schaffen. In gleicher Weise verfuhren bereits alle früheren Ausgräber, um die Tempel, Altäre und Kleinmonumente freizulegen, die heute das Bild der histrianischen Tempelzone ausmachen, und um wie bisher auch weiterhin neue Elemente zur Erforschung des sakralen Mittelpunktes der Stadt zu gewinnen.
144 Dazu Anm. 135.145 Dazu Anm. 134. Unter den Bruchstücken soll ein winziges Fragment aus dem 2. Jh. v. Chr. hervorge-hoben werden, das den Anfang eines vom Verein der aus Histria schon bekannten Taureasten erlassenen Dekretes beinhaltet. Vor kurzem (2006) kam aus einer Füllung in der Nähe des ehemaligen Monumentes C auch das Fragment eines Katalogs antoninischer Zeit ans Licht.146 A. Avram und Monica Mărgineanu Cârstoiu bereiten zur Zeit eine ausführliche Veröffentlichung der nachgriechischen Monumente dieser Zone vor. Dabei werden die Keramikfunde von Dr. Andrei Opaiţ (Toronto), die Münzen von Frau Dr. Florina Panait Bîrzescu (Archäologisches Institut Bukarest) behandelt.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 73
Taf.
II. S
chni
tt 1-
1.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 75
Taf.
IV. S
chni
tt 3-
3.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 77
Taf.
VI.
Schn
itte
6-6,
7-7
und
8-8
.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 79
Taf.
VIII
. Sch
nitte
11-
11 u
nd 1
2-12
.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 81
Taf. X. Histria, Tempelzone: nachgriechische Phasen.
Estratti
82 Alexandru Avram et alii
Taf. XI. Spätarchaische und frühklassische Architekturglieder: a. Scheibenakroter mit Ritzlinien; b. Archaische Spira vom Aphrodite-Tempel; c. Cavetto-artige Bekrö-nung mit gemalten hängenden Blättern; d. Ionisches Kymation; e. Anthemion mit Palmetten, Lotusblumen und lyraförmigen Spiralen.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 83
Taf. XII. Spätarchaische und frühklassische Architekturglieder: a-c. Ionische Kapitel-le; d. Zeichnerische Rekonstruktion einer Säule des Aphrodite-Tempels.
Estratti
84 Alexandru Avram et alii
Taf.
XIII.
Hel
leni
stis
che A
rchi
tekt
urgl
iede
r: a.
Mar
mor
plat
ten
mit
Girl
ande
n un
d Bu
kran
ien
von
der B
asis
der
Kul
tsta
tue
der
Aph
rodi
te (A
then
agor
as-B
asis
); b,
c. F
ragm
ente
von
Sim
en m
it Pa
lmet
ten
und
Lotu
sblu
men
; d. G
ebäl
kblo
ck v
om h
elle
nist
i-sc
hen
Alta
r der
Aph
rodi
te.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 85
Taf. XIV. Hellenistische Architektur: a-a’. Theos-Megas-Tempel; b-b’. Tempel ‘X’.
Estratti
86 Alexandru Avram et alii
Taf. XV. a. Heilige Grube: Ansicht von Süden, Stand 2009; b. Heilige Grube: Ansicht von Westen, Stand 2002.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 87
Taf.
XVI.
Hei
lige
Gru
be: S
üdpr
ofil.
Estratti
88 Alexandru Avram et alii
Taf. XVII. a. Kreisförmige Felsabarbeitung südlich der heiligen Grube, daneben Pfo-stenlöcher; b. Felsabarbeitung südlich vom Aphrodite-Tempel.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 89
Taf. XVIII. a. Situation westlich vom Aphrodite-Tempel, 2007; b. Stufen an der Süd-west-Ecke des Aphrodite-Tempels, 2001
Estratti
90 Alexandru Avram et alii
Taf. XIX. Situation westlich vom Aphrodite-Tempel (vgl. Taf. VII, Schnitt 10-10): a, b. Zerstörungsschicht vom Anfang des 5. Jhs. v. Chr. mit in situ gefallenen Verklei-dungsplatten.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 91
Taf. XX. Situation westlich von Monument C und Aphrodite-Tempel, Ansicht von Norden: A. Westliche Plattform des Aphrodite-Tempels; B. Archaisches, dem Aphro-dite-Tempel und dem Monument C vorausgehendes Mauerfundament; C. Monu-ment C; D. Halbkreisförmiger Mauerzug; E. Frührömische Mauerzunge.
Estratti
92 Alexandru Avram et alii
Taf. XXI. Bereich des Kultbaus M unter der christlichen Basilika: a. Hellenistische Basen aa, bb, Ansicht von Südwesten; b. Kultbau M: Fundament der östlichen Be-grenzungsmauer aus Marmor (links) neben spätrömischer Festungsmauer (rechts), Ansicht von Süden.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 93
Taf. XXII. Situation südlich vom Kultbau M: a. Reste von Dachterrakotten; b. West-profil.
Estratti
94 Alexandru Avram et alii
Taf. XXIII. Situation westlich vom Monument C, 2009: a. Ansicht von oben mit Spoli-en, darunter Schwelle (A) und Gesimsblock mit Mutuli (B); b. Ansicht von Osten.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 95
Taf. XXIV. Herdstelle mit Hirschgeweih in frührömischer Insula: a. Ansicht von Nor-den; b. Ansicht von Westen.
Estratti
96 Alexandru Avram et alii
Taf. XXV. a. Kopf einer neolithischen Tonfigur; b. Miniaturaltar aus Gips; c. Spätar-chaische Terrakotte.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 97
Taf. XXVI. Dachterrakotten vom Aphrodite-Tempel (a-c) und vom Kultbau M (d-e): a. Verkleidungsplatte; b. Palmettenantefix; c. Simafragment; d. Simafragment; e. Antefixfragment.
Estratti
98 Alexandru Avram et alii
Taf. XXVII. Neuentdeckte Architekturglieder: a-a’. Spätarchaische Kapitellfragmen-te; b. Bukranion.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 99
Taf. XXVIII. Archaische Keramik: a. Kanne, Südionien, SiA I d; b. Krater, Südionien, SiA I d; c. Attisch-korinthisierender Dinos.
Estratti
100 Alexandru Avram et alii
Taf. XXIX. a. Chiotische Transportamphora, Typus Lambrino A; b. Thasische Trans-portamphora, 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.; c. Spätarchaische Inschrift.
Estratti
Archäologische Ausgrabungen in der Tempelzone von Histria, 1990-2009 101
Taf. XXX. a. Figürliche Terrakotte: Hahn; b. Weibliche Protome; c. Fragment einer kolossalen Dionysosstatue frührömischer Zeit.
Estratti
AA Archäologischer Anzeiger. Berlin.AAPhStudArch Acta Antiqua Philippopolitana, Studia Archaeologica, Sofia,
1963.AÉ L’Année épigraphique. Paris.AJA The American Journal of Archaeology. Boston.AM Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts,
Athenische Abteilung. Athènes.ANRW Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und
Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, Berlin – New York, 1970 sqq.
ARV D. Beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters, Oxford, 1956, 21963.
ASAtene Annuario della Scuola Italiana di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente. Padoue.
AvP Altertümer von Pergamon. Berlin.BCH Bulletin de correspondance hellénique. Athènes - Paris.BSA Annual of the British School at Athens. Londres.Bull. ép. « Bulletin épigraphique », dans Revue des études grec-
ques. Paris.CIG A. Boeckh et alii, Corpus Inscriptionum Graecarum I-IV,
Berlin, 1828-1877. CIL Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin, 1863 sqq.CIRB V. V. Struve et alii, Corpus Inscriptionum Regni Bosporani,
Moscou–Leningrad, 1965.CorVP D. A. Amyx, Corinthian Vase-Painting of the Archaic Period,
Berkeley – Los Angeles – London, 1988.CorVPAC C. W. Neeft, Addenda et Corrigenda to D. A. Amyx, Corinthian
Vase-Painting of the Archaic Period, Allard Pierson Series – Scripta Minora, 3, Amsterdam, 1991.
CQ Classical Quarterly. Oxford.CRAI Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Paris.CVA Corpus Vasorum Antiquorum, Paris, 1922 sqq.
ABRÉVIATIONS
Estratti
310 Abréviations
EA Epigraphica Anatolica. Bonn.GMJuB Godišnik na muzeite ot južna Bălgarija. Plovdiv. GMPO Godišnik na muzeite v Plovdivski okrăg. Plovdiv.GNAMP Godišnik na Narodnija archeolgičeski muzej Plovdiv.
Plovdiv.HASB Hefte des archäologischen Seminars Bern. Berne.Histria VII P. Alexandrescu, avec le concours de l’architecte Anişoara
Sion et d’A. Avram et la collaboration de Maria Alexandrescu Vianu, A. Baltreş, I. Bîrzescu, N. Conovici, P. Dupont, Cristina Georgescu, M. Măcărescu, K. Zimmermann, Histria VII. La Zone Sacrée d’époque grecque, Bucarest – Paris, 2005.
Histria IX Maria Alexandrescu Vianu, Histria IX. Les statues et les re-liefs en pierre, Bucarest – Paris, 2000.
Histria XII Monica Mărgineanu Cârstoiu, Histria XII. Architecture grec-que et romaine. Membra disiecta. Géométrie et architecture, Bucarest, 2006.
IAI Izvestija na Bălgarskija archeologičeski institut. Sofia.IAD Izvestija na Bălgarskoto archeologičesko družestvo. Sofia. IDR Inscripţiile Daciei romane, Bucarest, 1975 sqq.IDRE C. C. Petolescu, Inscriptiones Daciae Romanae externae –
Inscriptions externes concernant l’histoire de la Dacie (Ier–IIIe siècles) I-II, Bucarest, 1996-2000.
IG Inscriptiones Graecae, Berlin, 1903 sqq.IGBulg G. Mihailov, Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, vol. I-V,
Sofia, 1956-1997) ; I2, Sofia, 1970.IGDOP L. Dubois, Inscriptions grecques dialectales d’Olbia du Pont,
Hautes études du monde gréco-romain, 22, Genève, 1996.IGR R. Cagnat et alii, Inscriptiones Graecae ad res Romanas perti-
nentes I, III-IV, Paris, 1906-1927.I.Kalchedon R. Merkelbach, F. K. Dörner et S. Şahin, Die Inschriften von
Kalchedon, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, 20, Bonn, 1980.
I.Byzantion A. Łajtar, Die Inschriften von Byzantion I, Inschriften grie-chischer Städte aus Kleinasien, 58, 1, Bonn, 2000.
I.Kyzikos E. Schwertheim, Die Inschriften von Kyzikos und Umgebung I. Grabtexte, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, 18, Bonn, 1980.
ILBulg B. Gerov, Inscriptiones Latinae in Bulgaria repertae. Inscriptiones inter Oescum et Iatrum repertae, Sofia, 1989.
ILJug. Anna et J. Šašel, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMLX et MCMLXX repertae et editae sunt, Situla, 19, Ljubliana, 1978 ; iidem, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMII et MCMXL repertae et editae sunt, Situla, 25, Ljubliana, 1986.
Estratti
Abréviations 311
ILNovae V. Božilova, J. Kolendo, L. Mrozevic, Inscriptions latines de Novae, Poznań, 1992.
ILS H. Dessau, Inscriptiones Latinae selectae I-V, Berlin, 1892-1916.IMJuIB Izvestija na muzeite ot jugoiztočna Bălgarija. Stara
Zagora – Burgas.IMS Inscriptions de la Mésie supérieure, Belgrade, 1976 sqq.INMV Izvestija na narodnija muzej Varna. Varna.InscrIt Inscriptiones Italiae, Rome, 1931 sqq.ISM I D. M. Pippidi, Inscripţiile din Scythia Minor greceşti şi latine
I. Histria şi împrejurimile, Bucarest, 1983.ISM II I. Stoian, Inscripţiile din Scythia Minor greceşti şi latine II.
Tomis şi teritoriul, Bucarest, 1983ISM III A. Avram, Inscriptions grecques et latines de Scythie Mineure
III. Callatis et son territoire, Bucarest – Paris, 1999.IstMitt Istanbuler Mitteilungen. Deutsches Archäologisches
Institut, Abteilung Istanbul. Istanbul.IVAD Izvestija na Varnenskoto archeologičesko družestvo.
Varna.JDAI Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts.
Berlin.JHS The Journal of Hellenic Studies. Londres.LGPN P. M. Fraser, Elaine Matthews et alii (éds), A Lexicon of Greek
Personal Names, Oxford, 1987 sqq. LIMC Lexicon iconographicum mithologiae classicae I-VIII, Zurich,
1981-1999.MAMA Monumenta Asiae Minoris Antiqua, Manchester, 1928 sqq.Michel, Recueil Ch. Michel, Recueil d’inscriptions grecques, Bruxelles, 1900.OGIS W. Dittenberger, Orientis Graeci inscriptiones selectae I-II,
Leipzig, 1903-1905.ÖJh Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen
Institutes in Wien. Vienne.PIR2 E. Groag, A. Stein, Leiva Petersen, Kl. Wachtel et alii,
Prosopographia Imperii Romani (Saec. I. II. III), editio altera, Berlin, 1933 sqq.
PME H. Devijver, Prosopographia militiarum equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum I-V, Louvain, 1976-1993 ; VI (edd. Segolena Demougin et Maria-Theresa Raepsaet-Charlier), Louvain, 2001.
RA Revue archéologique. Paris.RE G. Wissowa et alii, Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft, Stuttgart, 1894-1980.REA Revue des études anciennes. Bordeaux.RM Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts,
Römische Abteilung. Rome.
Estratti
312 Abréviations
RMD M. M. Roxan et alii, Roman Military Diplomas, Londres, 1978 sqq.
RPh Revue de philologie, de littérature et d’histoire ancienne. Paris.
SbNUNK Sbornik na narodni umotvorenija, nauka i knižnina. Sofia.SCIV(A) Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie).
Bucarest.SEG Supplementum Epigraphicum Graecum. Leyde, puis
Amsterdam, ensuite Boston, 1923 sqq.SGDI H. Collitz, F. Bechtel et alii, Sammlung der griechischen
Dialekt-Inschriften I-V, Göttingen, 1884-1915.Syll.3 W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum, editio
tertia, I-IV, Leipzig, 1915-1924.VDI Vestnik drevnej istorii. Moscou.ZPE Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Bonn.
Estratti