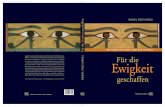Privat versus Öffentlich in hellenistischen Bädern, in: A. Matthaei – M. Zimmermann (eds.),...
Transcript of Privat versus Öffentlich in hellenistischen Bädern, in: A. Matthaei – M. Zimmermann (eds.),...
Die hellenistische Polis als Lebensform BAND 4
Herausgegeben von
Martin Zimmermann
Herausgegeben von Albrecht Matthaei und Martin Zimmermann
Stadtkultur imHellenismus
VerlagAntike
Sonderdruck
www.verlag-antike.de
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2014 Verlag Antike e.K., Heidelberg Satz Stylianos Chronopoulos, Freiburg i. Br., für Verlag AntikeEinbandgestaltung disegno visuelle kommunikation, WuppertalEinbandmotive Vorderseite: Modelle von Knidos mit freundlicher Genehmigung von H. Bankel, V. Hinz und S. Franz. Rückseite: Athen, Akropolis. Basis einesWeihgeschenks des Hegelochos. Zeichnung von A. Brauchle und Z. Spyranti mit freundlicher Genehmigung. (Hauptmotiv spiegelverkehrt verwendet; alleAbbildungen in Band 1 dieser Reihe, Stadtbilder im Hellenismus, S. 114, 115 und 226). Druck und Bindung AZ Druck und Datentechnik GmbH, KemptenGedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem PapierPrinted in Germany
ISBN 978-3-939032-54-1
Sonderdruck
Inhaltsverzeichnis
Martin ZimmermannStadtkultur im Hellenismus ................................................................................................... 7
Wolfgang EhrhardtInklusion und Exklusion. Die Temene innerhalb des Westsektors in Knidos ..................................... 9
Dirk SteuernagelIndividuelle Bedürfnisse und kollektive Normen. Zur baulichen Gliederungund zur Nutzung griechischer Tempelräume in hellenistischer Zeit ................................................. 52
Lars HeinzeModernisierte Hüllen? Das Letoon bei Xanthos und die Verwendung von Tempelnals Medium der Erinnerungskultur in hellenistischen Heiligtümern................................................. 76
Péter KatóAsylie-Variationen. Bemerkungen zu den Entstehungsgründen und Funktionen derhellenistischen Asylie............................................................................................................ 97
Marietta HorsterDionysos-Thiasoi und -Bakchoi in „öffentlichen“ und „privaten“ Kulten .......................................... 109
Sara SabaIsopoliteia in the Hellenistic Polis ........................................................................................... 122
Linda-Marie GüntherNothoi und nothai – eine Randgruppe in der hellenistischen Polis? Zur Auswertungder einschlägigen Inschriften Milets ......................................................................................... 133
Daniel KahDemokratie in der Kleinstadt. Überlegungen zu Demographie und Partizipationam Beispiel des hellenistischen Priene ...................................................................................... 148
Frank RumscheidUrsprünglicher Bebauungsplan, Erstbebauung und Veränderungen im hellenistischenStadtbild Prienes als Ergebnis öffentlicher und privater Ambitionen ............................................... 173
Ulrich ManiaZur Planungsidee der Stadtanlage Prienes ................................................................................ 191
Monika Trümper„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern .................................................................. 206
Winfried HeldHellenistische Grabmonumente der Karischen Chersones.............................................................. 250
Indices .............................................................................................................................. 269
Adressen der Autoren ........................................................................................................... 277
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern
Monika Trümper
„Now, to give all the particulars plainly would disgrace the fair fame of the city, but I may not pass over the modesty andvirtue of Democles. He was still a young boy, and it did not escape the notice of Demetrius that he had a surname whichindicated his comeliness; for he was called Democles the Beautiful. But he yielded to none of the many who sought towin him by prayers or gifts or threats, and finally, shunning the palaestras and the gymnasium, used to go for his bath toa private bathing-room (balaneion idiotikon). Here Demetrius, who had watched his opportunity, came upon him whenhe was alone. And the boy, when he saw that he was quite alone and in dire straits, took off the lid of the cauldron andjumped into the boiling water, thus destroying himself, and suffering a fate that was unworthy of him, but showing aspirit that was worthy of his country and of his beauty.“1
Diese Szene, die sich am Ende des 4. Jh. v.Chr. in Athen abgespielt haben soll, suggeriert, dass es einen deutlichenGegensatz zwischen palaistra und gymnasion auf der einen und dem balaneion idiotikon auf der anderen Seite gab.Während palaistra und gymnasion offenbar als öffentliche bzw. öffentlich zugängliche Bauten zu verstehen sind, wirddas balaneion idiotikon gewöhnlich mit privatem Bad bzw. Badezimmer übersetzt. Das „private“ Bad scheint aber fürkollektive Nutzung konzipiert gewesen zu sein, denn Demetrios mußte eine günstige Gelegenheit abwarten, um Demo-kles alleine anzutreffen. Und obwohl dieses Bad „privat“ war, konnte sich Demetrios offensichtlich Zugang zu diesemverschaffen. Wie sind folglich die Kategorien „privat“ und „öffentlich“ in dieser Textstelle in Bezug auf die Badean-lage zu verstehen? Ist das vermeintliche Paradox einer privaten, aber dennoch öffentlich zugänglichen und kollektivenBadeanlage nur in einer mangelnden adäquaten Interpretation und Übersetzung der antiken Begriffe begründet oderreflektiert es vielmehr, gerade auch in der deutlichen Abgrenzung des balaneion von palaistra und gymnasion, antikePraktiken, Normen und Perzeptionen der Badekultur?2 Das Ziel dieses Beitrages ist, diese Fragen kritisch zu diskutie-ren. Ein kurzer Abriss über den Forschungsstand soll zeigen, wie man diesen Fragenkomplex methodisch angehen kannund welche Aspekte nachfolgend im Vordergrund stehen werden.
Das Problem „privat“ versus „öffentlich“ ist bislang für griechische Bäder nicht umfassend diskutiert worden.3 Indem vorbildlichen Handbuch Balaneutikè von 1962 hat René Ginouvès ein Kapitel dem balaneion, dem öffentlichen Bad,gewidmet; zwei weitere Kapitel behandeln Bad und Badezimmer in Privathäusern und das Bad im Freien bzw. Badenim gymnasion.4 Das Problem „privat“ versus „öffentlich“ wird im Wesentlichen auf terminologische Fragen beschränkt:das Bad im Haus sei als loutron und das öffentliche als balaneion bezeichnet worden. Als balaneia bzw. öffentliche Bädergelten nach Ginouvès selbständige Bauten, die runde oder rechteckige Räume mit mehreren Sitzbadewannen aufweisenund all denen zu Reinigungszwecken dienten, die kein Badezimmer zu Hause hatten oder sich nicht mit dem Duschbadim Brunnenhaus begnügen wollten.5 In ihrem 1999 erschienenen Buch Griechische Bäder diskutiert Michaela Hoffmanndas Problem „privat“ versus „öffentlich“ auf einer halben Seite. Ausschlaggebend für die Unterscheidung privater undöffentlicher Anlagen seien nicht die Benutzer, sondern die Betreiber, wobei als öffentliche Betreiber die Polis, aber auch
1 Ich möchte Marietta Horster und Frank Rumscheid herzlich für die Einladung zu dem Treffen des SPP Netzwerkes „Die urbaneInfrastruktur der hellenistischen Polis“ sowie für ihre Gastfreundschaft danken. Für wichtige Hinweise und Diskussionen binich Wolfgang Blümel, William Bubelis, Daniel Kah, Werner Riess und William West sehr verbunden. Nathalie De Haanhat mir freundlicherweise ein Exemplar ihrer Studie zu römischen Privatbädern zur Verfügung gestellt, die sich noch imDruck befand, als ich diesen Beitrag geschrieben habe, aber mittlerweile erschienen ist. Dieser Beitrag geht aus meinemForschungsprojekt zur griechischen Badekultur hervor, in dessen Rahmen ein Großteil der nachfolgend erwähnten Anlagenuntersucht wurde. Den zahlreichen Personen und Institutionen, die meine Forschungen ermöglicht und unterstützt haben,sei hier kollektiv herzlich gedankt. Plu. Demetr. 24, 2–3 (Übersetzung: Perrin 1959).
2 Wobei man bei Plutarchs Text streng genommen zwischen den beiden unterschiedlichen relevanten chronologischen Peri-oden differieren müsste: der Erfahrungshorizont Plutarchs im 1./2. Jh. n.Chr. könnte die Darstellung des kulturhistorischenKontextes im Athen des späten 4. Jh. v.Chr. beeinflusst haben.
3 Zur problematischen ethnischen Etikettierung von Badeanlagen (griechisch, punisch, römisch etc.) bzw. vor allem der Unter-scheidung griechischer und römischer Bäder, s. unten, Anm. 15.
4 Ginouvès 1962, 109–224.5 Ginouvès 1962, 183–184.
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 207
private Besitzer oder Pächter identifiziert werden. Obwohl Bäder in Palästen wie die in Häusern eigentlich als privat zuklassifizieren seien, bezieht Hoffmann diese in ihre Untersuchung ein, die ausdrücklich auf öffentliche Bäder beschränktbleibt.6 Unter öffentlichen Anlagen subsumiert sie somit Badevorrichtungen in Palästen, gymnasia und Heiligtümernsowie Ginouvès’ Kategorie öffentlicher Bäder.
Das Problem „privat“ versus „öffentlich“ hat mehr Beachtung gefunden in der Forschung zu römischen Bädernder späten Republik und besonders der Kaiserzeit, die insgesamt deutlich besser bekannt sind als ihre griechischenPendants.7 Bei einer Untersuchung von Bädern im römischen Italien konstatiert Janet DeLaine, dass der Terminus„öffentliche Bäder“ („public baths“) vieldeutig sei und im Prinzip alle Badeanlagen umfassen könne, die öffentlichzugänglich waren. Dagegen suggeriere die Bezeichnung „private Bäder“ („private baths“) häusliche Anlagen. Bei den„public baths“ differenziert sie zwischen „public-sector“ Bädern, die von öffentlicher Hand (Städten bzw. Magistraten,Kaiser) oder generösen Wohltätern errichtet wurden und sich in öffentlichem Besitz befanden, und „private-sector“Bädern, die etwa von Spekulanten zu kommerziellen Zwecken oder von Vereinen zur eigenen Nutzung gebaut wurdenund sich in privatem Besitz befanden.8 In der Kaiserzeit hätten „private-sector“ Bäder vermutlich die „basic bathingneeds“ italischer Städte abgedeckt und die viel größeren und reicher ausgestatteten „public-sector“ bzw. kaiserlichenBäder imitiert.9 Selbst in der Stadt Rom, die sukzessive mit großen kaiserlichen Thermen ausgestattet wurde, hatten„private-sector“ Bäder nach Ausweis verschiedener schriftlicher Quellen offenbar hohe Bedeutung und wurden unteranderem auch von Senatoren als profitable Investitionen gebaut und gekauft.10 Allerdings kann die Unterscheidungzwischen „private-sector“ versus „public-sector“ oft nicht anhand des archäologischen Befundes allein getroffen werden,und selbst epigraphische und andere schriftliche Quellen sind nicht immer hinreichend aufschlussreich.11 Dieses diffe-renzierte Bild von der Bandbreite „öffentlicher“ bzw. öffentlich zugänglicher Badeanlagen ist um die „privaten“ Bäderin Häusern und Villen zu ergänzen, die gewöhnlich streng getrennt von den „öffentlichen“ Bädern untersucht werden,wie jüngst Nathalie De Haan betont hat.12 In ihrer Monographie zu römischen Privatbädern diskutiert De Haan kurzdas Verhältnis „öffentlicher“ und „privater“ Bäder im Hinblick auf Badeprogramme und Kapazitäten im urbanen Kon-text.13 Diese zentrale Frage – wer, wann, wo, wie, mit wem und warum in einem spezifischen städtischen „privaten“oder „öffentlichen“ Kontext badete und wer die jeweiligen Badeanlagen aus welchem Grund zur Verfügung stellte – istallerdings bislang für keine römische Stadt detailliert untersucht worden, obwohl dies für umfassend freigelegte Städtewie Pompeji, Ostia und Timgad theoretisch möglich wäre. Dennoch sind für römische Bäder richtungweisend Fragen-komplexe angeschnitten worden, die im Folgenden für die Untersuchung des Problems „privat“ versus „öffentlich“ inhellenistischen Bädern aufgegriffen seien.
Zunächst sei kritisch erörtert, ob und wie man die Begriffe „privat“ und „öffentlich“ für hellenistische Bäder anwen-den kann, basierend auf einer differenzierenden Diskussion folgender Aspekte: Eigentümer, Betreiber, Zugänglichkeitbzw. Nutzer und Funktion von Badevorrichtungen. Dies schließt notwendig einen Überblick ein, in welchen urbanisti-
6 Hoffmann 1999, 5, 9.7 Dies sei hier nur exemplarisch diskutiert, da der chronologische Schwerpunkt auf der hellenistischen Zeit liegt. Zur Biblio-
graphie von 1988 bis 2001, Manderscheid 2004, 26 Nr. 407–418.8 DeLaine 1999, 67–68. Die „public-sector“ Bäder werden von anderen Forschern auch als balnea publica bezeichnet und die
„private-sector“ Bäder als balnea meritoria; Nielsen 1990, 119; De Haan 2010b, 5, 113. Auf die in diesem Zusammenhanghäufig angesprochene, aber hochumstrittene terminologische Differenzierung von balnea und thermae sei hier nicht weitereingegangen.
9 DeLaine 1999, 73.10 Bruun 1999.11 So einheitlich DeLaine 1999 und Bruun 1999, der kritisch die Aussagekraft von Inschriften auf fistulae aquariae diskutiert, die
„private-sector“ Bäder mit Wasser versorgt haben könnten. Vgl. auch De Haan 2010b, 113–115 und vor allem Fagan 1999, 104–175, der auf Basis der Inschriften ausführlich die „bath benefactors“ in und außerhalb von Rom untersucht; sein „epigraphicsample“ (225–347) listet getrennt „constructional benefactions“, „nonconstructional benefactions“, „nonbenefactory texts“und „Greek texts“ auf und sein Appendix 2 (357–367) benannte und unbenannte Bäder in Rom. Fagan ist allerdings gerade fürRom skeptisch (123–127), was genau die mit Bädern verbundenen Namen indizieren: den Bauherrn, einen der möglicherweisewechselnden Besitzer oder Wohltäter, die für Reparaturen oder Erweiterungen aufkamen. Trotz dieser Unsicherheiten schließter: „The majority of the baths discussed above were most probably run as (family?) business investments.“ (126).
12 De Haan 2010b, 6–8. Zu den häuslichen Bädern generell, Dickmann 1999, 256–267 und vor allem die zahlreichen Publikationenvon N. De Haan; De Haan 1992, 1993, 1997, 2001, 2007, 2010a, 2010b.
13 S. vorige Anm., bes. De Haan 2010b, 93–117.
208 Monika Trümper
schen und architektonischen Kontexten Badevorrichtungen zu finden sind. In einem zweiten Schritt wird analysiert, obsich eine deutliche Korrelation zwischen bestimmten Kontexten und bestimmten Badeprogrammen nachweisen lässt,d.h. es geht um die Frage, ob sich etwa in „privaten“ Kontexten andere Badeformen als in „öffentlichen“ finden undwie mögliche Differenzen zu erklären sind: z.B. mit Verfügbarkeit von Platz, Geld und notwendigen Ressourcen (Was-ser, Heizmaterial), mit sozial-gesellschaftlichen Praktiken und Restriktionen oder mit der intendierten Nutzerschaft.Als letztes sei das Verhältnis „privater“ und „öffentlicher“ Badeanlagen in Städten untersucht, vor allem im Hinblickauf die Frage, ob „öffentliche“ Anlagen als Substitut für fehlende „private“ Pendants dienten oder möglicherweise ausanderen Gründen errichtet und aufgesucht wurden, etwa wegen sozial-geselliger Aspekte oder signifikant differierenderBadestandards und -programme.
Die folgenden Betrachtungen beziehen Badeanlagen aus dem gesamten Mittelmeerraum ein, bleiben aber in chrono-logischer Hinsicht auf die Zeit vom 5. bis 1. Jh. v.Chr. beschränkt, wobei aufgrund der Quellenlage der Schwerpunkt aufder hellenistischen Epoche liegt. In diesen breiten chronologischen und geographischen Rahmen gehören Badeanlagen,die häufig mit ethnischen Etikettierungen (griechisch, römisch, punisch etc.) versehen werden. Diese Bezeichnungenseien hier weitgehend vermieden, da sie in vielerlei Hinsicht problematisch und umstritten sind. Relevant und nichtzu umgehen ist allerdings eine Differenzierung für die unabhängigen, „öffentlichen“ Bäder, bei denen lange Zeit fun-damentale Unterschiede zwischen einfachen reinigenden griechischen und den viel fortschrittlicheren, der Entspannungund dem Genuss dienenden römischen Anlagen postuliert wurden. Auch wenn diese Differenzen aufgrund neuerer For-schungen entscheidend zu modifizieren und die griechischen Bäder in vielerlei Hinsicht als wegweisende Vorläufer derrömischen Pendants zu identifizieren sind,14 sei hier die terminologische Unterscheidung aus Gründen der einfacherenVerständigung beibehalten: als griechische Bäder werden solche bezeichnet, die – neben möglichen anderen Badeformen– (noch) mit einfachen Sitzbadewannen für reinigende Duschbäder versehen waren; als römische Bäder gelten Anla-gen, die keine Sitzbadewannen (mehr) umfassten und ferner mit einem Hypokaustsystem zur Beheizung von Wannenund Boden ausgestattet waren. Obwohl beide Versionen gleichzeitig existierten, sicher im 2. und 1. Jh. v.Chr. undmöglicherweise sogar schon im 3. Jh. v.Chr., d.h. fast in der gesamten hellenistischen Zeit, sei das Augenmerk imFolgenden auf die griechischen Bäder gerichtet.15 Vollständigkeit ist hier in keinem Fall angestrebt, vielmehr geht esum die Vorstellung repräsentativer Beispiele.
1 Terminologie
Weder im Griechischen noch im Lateinischen scheinen „private“ und „öffentliche“ Badeanlagen konsequent terminolo-gisch unterschieden worden zu sein. Im Lateinischen wurden unterschiedslos die Termini balneum, balnea, balneae undthermae verwendet, so dass die entsprechenden Vorrichtungen nur aufgrund des Kontextes oder spezifischer Zusätze(publica/-um, Eigennamen) näher bestimmt werden können.16 Auch die von Ginouvès angeführte terminologische Dif-ferenzierung im Griechischen ist nur bedingt hilfreich, da die gebräuchlichsten Begriffe loutron und balaneion in denantiken Schriftquellen offenbar nicht konsistent verwendet wurden: loutra sind nicht nur für Häuser, sondern auch fürHeiligtümer17 und vor allem für gymnasia bezeugt, und der Begriff balaneion wurde nicht nur für unabhängige öffent-liche Bäder, sondern – selten – auch für Badevorrichtungen in hellenistischen Wohnbauten und möglicherweise schon
14 Lucore 2003–2004, 2009; Trümper 2009.15 Zum terminologischen Problem, Trümper 2009, 141. Das früheste römische Beispiel stellt möglicherweise das erste Bad in
Fregellae dar, das in das 3. Jh. v.Chr. datiert wird. Da es unter dem späteren Bad des 2. Jh. v.Chr. nicht vollständigfreigelegt werden konnte, ist sein Plan nicht genau zu rekonstruieren und die Existenz eines Raumes mit Sitzbadewannennicht mit letzter Sicherheit auszuschließen; Tsiolis 2001, 2006, 2008a, 2008b, 2013. Weitere römische Bäder, die ins 2. undfrühe 1. Jh. v.Chr. datiert werden, sind in folgenden Orten identifiziert worden: Ampurias, Antibes, Baetulo, Cabañetadi Burgo del Ebro, Cabrera del Mar, Cales, Cuma (Zentralthermen), Kroton, Musarna, Norba, Pompeji (Forumsthermen,Republikanische Thermen, Stabianer Thermen), Rom (Via Sistina), Valentia; für Literatur zu diesen Anlagen, Palauí – Vivó1993; Volpicella 2006–2007; Tsiolis 2008a, 139–140; Trümper 2009, 154 Anm. 59.
16 Nielsen 1990, passim; Fagan 1999, passim; De Haan 2010b, 113. Da die lateinische Bäder-Terminologie viel besser untersuchtist als die griechische, sei sie hier nicht eingehender behandelt.
17 Laut IG VII 4255, datiert 335–322 v.Chr., gab es im Amphiareion von Oropos ein loutron für Männer und eines für Frauen.
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 209
ab dem 1. Jh. v.Chr. auch für solche in gymnasia benutzt.18 In einigen Quellen sind balaneia mit erklärenden Zusätzenversehen: idiotika, demosia und demosieuonta balaneia werden für Athen im 4. Jh. v.Chr. und für Antiocheia in derersten Hälfte des 2. Jh. v.Chr. erwähnt19 und zahlreiche balaneia werden wie im Lateinischen von Eigennamen imGenitiv gefolgt.20 Auf die partiell umstrittene Deutung dieser Zusätze wird noch zurückzukommen sein. Problematischist ferner, dass die Begriffe balaneion und loutron offensichtlich keine klar definierbaren Badeformen oder -programmebezeichneten. Während in balaneia offenbar quasi immer – aber nicht notwendig nur – mit warmem Wasser gebadetwurde, umfassten loutra je nach Kontext Warmwasser- oder Kaltwasser-Badeformen.21 Und schließlich können nur insehr wenigen Fällen literarische und epigraphische Zeugnisse mehr oder weniger sicher mit archäologischen korreliertund so Informationen über das Aussehen potentiell „öffentlicher“ und „privater“ Badeanlagen gewonnen werden.22
Da die Schriftquellen für das Problem „privater“ versus „öffentlicher“ Badevorrichtungen nur wenig aufschlussreichsind, sei der Blick auf die archäologischen Befunde, d.h. die verschiedenen Kontexte von Badeanlagen im 5.–1. Jh. v.Chr.,gerichtet.
2 Kontexte von Badeanlagen
Eindeutig identifizierbare Badevorrichtungen, die feste Installationen bzw. eigene permanente Räumlichkeiten umfas-sten,23 finden sich integriert in Wohnbauten, Vereinsbauten, Sportanlagen (gymnasia bzw. palaistrai), verschiedeneAnlagen in Heiligtümern und Porticus-Anlagen. Unabhängige Badeanlagen wurden in oder bei extraurbanen Heiligtü-mern, außerhalb der Stadtmauer bei Stadttoren und in verschiedenen innerstädtischen Lagen errichtet, etwa an oderbei der Agora bzw. dem Forum, am Hafen, bei intraurbanen Heiligtümern und in Wohnvierteln. Diese unabhängigenBäder konnten sowohl freistehend als auch in größere Baukontexte (Insulae) integriert sein. Der Kontext bestimmteentscheidend die hier im Vordergrund stehenden Kriterien, d.h. die Eigentümerschaft, Zugänglichkeit und (intendierte)Nutzerschaft von Badeanlagen.24
18 Delorme 1960, 244–250, 304–311; Ginouvès 1962, 129 Anm. 7; 179 Anm. 5; 184 Anm. 1–2. Ab wann genau die Badevorrichtungeines gymnasion als balaneion bezeichnet wurde, ist allerdings nicht sicher festzustellen. Von großem Interesse für diese Fragesind die Ehrenschriften für Aulus Aemilius Zosimos aus Priene (I. Priene 112, 113), die weiter unten ausführlicher diskutiertseien. Dass die Begriffe loutron und balaneion in der Kaiserzeit zunehmend weniger scharf unterschieden wurden, sei hiernicht weiter erörtert; vgl. etwa Schörner 2000, 312–313.
19 Ath. 13, 590f; Plb. 26, 1, 12; Plu. Demetr. 24, 2–3; Plu. Phoc. 4, 2. Zur problematischen Inschrift IG I2 385, die um 440–410v.Chr. datiert wird und ein balan[eion de]mosi[on - -] auflistet, was in der Neuedition IG I3 420 aber zu balan[eio . . .]iosit[.. . . ] verändert ist, s. ausführlich unten, Anm. 46–47. Nach Meyer 1994, 277 sind demosia balaneia in Ägypten erst für dieKaiserzeit belegt; vgl. dazu auch Łukaszewicz 1986, 65–72.
20 S. oben, Anm. 11, und ausführlich unten, Anm. 39–44.21 Dazu ausführlich unten, im Abschnitt über Badeprogramme in unterschiedlichen Kontexten.22 Im archäologischen Befund identifiziert werden können möglicherweise: 1) das balaneion des Diochares (IG II2 2495) und
das balaneion am Thriasischen bzw. Dipylon Tor in Athen (Isaios, zitiert bei Harpokration s.v. Anthemokritos), s. dazuausführlicher unten, Anm. 81; 2) das sog. Serangeion Bad im Piräus, s. dazu unten, Anm. 42; 3) das sog. Griechische Bad imAsklepiosheiligtum von Epidauros, bei dem es sich um das in den Inschriften IG IV2 103 C und 110 C erwähnte balaneionhandeln könnte, s. dazu unten, Anm. 54; 4) loutra diverser gymnasia (z.B. Delos, Pergamon, Priene); Delorme 1960, 306–307;Trümper im Druck (zu Pergamon). Dagegen ist die Verbindung der beiden Badeanlagen im Amphiareion von Oropos mitden inschriftlich im 4. Jh. v.Chr. erwähnten loutra (IG VII 4255, vgl. oben, Anm. 17) hochproblematisch; beide Anlagenweisen zahlreiche Umbauten und eine Nutzung bis weit in die Kaiserzeit auf, und es ist fraglich, ab wann sie überhaupt alsBadeanlagen und mit welchen Badeprogrammen genutzt wurden; beide sind aber kaum erforscht und deshalb nicht fundiertzu beurteilen; kritisch zu diesen Anlagen Ginouvès 1962, 345–349. Im sogenannten Männer-loutron und in anderen Teilendes Heiligtums sind Becken unterschiedlicher Größe und unterschiedlichen Materials verteilt, die ihrer Form nach alle gutmit Becken in Badeanlagen von gymnasia und Athletenbädern zu vergleichen sind. Vielleicht gab es hier ein Athletenbad wiein den Heiligtümern von Epidauros, dem Lykeiongebirge und Nemea; s. dazu unten, Anm. 56.
23 Mobile Becken, Badewannen und sonstige Gefäße, die zum Waschen oder Baden benutzt worden sein mögen, bleiben vonder Betrachtung ausgeschlossen.
24 Einen Grenzfall bilden Schwimmbäder, die nicht eigentlich dem Waschen, Baden oder Ein- und Untertauchen, sondern deraktiven Fortbewegung des Körpers im Wasser dienten. Sie seien hier weitgehend von der Betrachtung ausgeschlossen undweiter unten nur kurz diskutiert.
210 Monika Trümper
2.1 Badeanlagen in Wohnbauten
Die in Wohnbauten integrierten Badevorrichtungen gehörten den Bewohnern, die Zugänglichkeit und Nutzung kontrol-lieren konnten. Anhand der Lage im Haus, Größe und Badeformen lässt sich aber eine differenzierte Nutzung häuslicherBadevorrichtungen rekonstruieren. Das zwischen 432 und 348 v.Chr. errichtete und genutzte Haus A2 in Olynth ver-fügte über ein kleines Badezimmer mit einer Sitzbadewanne, das relativ abgelegen angelegt und nur über die Küchezugänglich war (Abb. 1). Dieses Bad dürfte in erster Linie von den Bewohnern genutzt worden sein, die es einzeln zumZwecke der Reinigung aufsuchten, und könnte folglich als rein „privates“ Bad gedeutet werden.25
Das hellenistische Peristylhaus 1 in Monte Iato wurde nachträglich im 2. Jh. v.Chr. mit einer Badeanlage ausge-stattet, die einen Vorraum (22), einen Baderaum mit beheizbarer Liegebadewanne (21), einen separaten Serviceraummit praefurnium (20 Westteil) und einen Korridor zu Raum 18 (20 Ostteil) umfasste (Abb. 2). Die Räume 21 und 22waren mit verzierten opus signinum Böden ausgestattet, die zu den qualitativ hochwertigsten Bodenbelägen in diesemHaus gehörten, und der Korridor 20 (Ostteil) war mit einem einfacheren cocciopesto Belag versehen. Die Badesuite warvon der nördlichen Portikus des Peristylhofs aus zugänglich, an der auch die am reichsten ausgestatteten, hausinternranghöchsten Räume des Erdgeschosses lagen, die Dreiraumsuite 15–17, die sicherlich dem Gastempfang diente. Ob-wohl in der Badesuite nur eine Person auf einmal baden konnte, boten der Baderaum selbst sowie der gut ausgestatteteVorraum 22 genug Platz für weitere wartende bzw. ausruhende Badegäste. Ferner war der Baderaum 21 ursprünglichüber einen Korridor in Raum 20 und später direkt über eine Tür mit dem großen benachbarten Raum 18 verbunden,26
hatte also zwei Zugänge, die möglicherweise eine Differenzierung nach Nutzern oder bei größeren Nutzergruppen eineRegulierung der Zirkulation erlaubten. Die prominente Lage, die Größe, das aufwendige Zirkulationssystem und dieluxuriöse Ausstattung dieser Badesuite legen nahe, dass sie nicht nur von den Bewohnern des Hauses, sondern auchvon Gästen genutzt wurde. Folglich wäre dieses Bad als „private“, kollektiv nutzbare Anlage mit klar kontrollierbarerund begrenzter „öffentlicher“ Funktion zu klassifizieren.27
Das ins letzte Viertel des 2. Jh. v.Chr. datierte Haus der Tritonen in Delos wurde nachträglich mit einer Badesuiteversehen, die einen Baderaum mit Sitzbadewanne (AL), ein rundes Schwitzbad (AM) und einen separaten Serviceraummit Ofen und anderen Strukturen (AN) umfasste und vermutlich zwei Zugänge hatte: einen vom Peristylhof des Hausesdurch einen Serviceraum (AI) und vorbei an der Latrine (AI´) und einen zweiten, der direkt von der Straße durcheinen langen Korridor (AK/AK´) zum Baderaum führte (Abb. 3). Das Schwitzbad dürfte wegen seiner Größe und vorallem wegen der Kosten und des Aufwandes, die seine Beheizung erforderten, kollektiv genutzt worden sein, und derVorraum bot neben der Sitzbadewanne auch Platz zum Warten und Ausruhen. Die doppelte Zugänglichkeit legt nahe,dass die Badeanlage sowohl von den Hausbewohnern als auch von Außenstehenden genutzt werden konnte, wobei derexterne Zugang hier für Gäste und möglicherweise sogar für eine separate, profitable Vermietung konzipiert worden seinkönnte. Die notwendigen Serviceinstallationen für das Bad waren allerdings immer nur durch das Haus zu erreichen,über den Gang AH’, der nachträglich von Raum AH abgetrennt wurde. Die Badesuite hätte folglich als rein „privatesBad“ für die Hausbewohner, als klar beschränkt „öffentliches“ Bad für die Gäste der Hausbewohner und evtl. auchals unabhängiges, kleines „öffentliches“ Bad fungieren können, das von den Hausbewohnern vermietet und bedientwurde.28
Für alle drei Varianten der in Häusern integrierten Badeanlagen, besonders aber für die ersten beiden, gibt esVergleichsbeispiele, die ähnlich zu interpretieren sind und hier nicht weiter diskutiert seien.29
25 Robinson – Graham 1938, 72, 198–204 Taf. 89; Trümper 2010, 531–532.26 Die mit einem Bogen überwölbte Verbindungstür zwischen den Räumen 20 und 21 sowie die Verbindungstüren zwischen den
Räumen 18 und 20 im Ostteil wurde nachträglich vermauert; zu diesem Zeitpunkt wurde nach Dalcher 1994, 33 die Türzwischen den Räumen 18 und 21 eingebrochen, die bis zum Ende der Nutzungszeit des Bades offen blieb.
27 Dalcher 1994, 35–40; Wolf 2003, 90; Trümper 2010, 536; Russenberger 2013, bes. zur Frage der Datierung. Die unterschiedlicheQualität der Fußbodenbeläge ist nicht vollständig reflektiert in Dalcher 1994, Beil.3 (hier Abb. 2): unter „feine Böden“ sindKalkestrich, cocciopesto, opus signinum und opus spicatum Böden subsumiert.
28 Trümper 1998, 205–207; Trümper 2008, 230.29 Zu hellenistischen Bädern in Häusern vor allem des östlichen Mittelmeerraums, Trümper 2010. Zu Bädern in Häusern des
westlichen Mittelmeerraums, allen voran in den Vesuvstädten, wo sie überwiegend ab dem 1. Jh. v.Chr. eingebaut wurden,Dickmann 1999, 256–267, der überzeugend für die Nutzung kleiner wie großer Badesuiten im Rahmen des Gastempfangsplädiert; und De Haan 1992, 1993, 1997, 2001, 2007, 2010a, 2010b. Für die dritte Variante, häusliche Bäder mit eigenen
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 211
2.2 Badeanlagen in Vereinsbauten
Einige Vereinsbauten, die für die klassische und hellenistische Zeit insgesamt nur wenig bekannt und erforscht sind,boten den Vereinsmitgliedern Badevorrichtungen. Es wird allgemein angenommen, dass der Verein als Eigentümerdie Zugänglichkeit und Nutzung seines Clubhauses kontrollierte.30 Ein kürzlich freigelegtes und noch unpubliziertesGebäude, das in der Mitte des 4. Jh. v.Chr. in Aigeira errichtet wurde, umfasste einen großen andron sowie einenBaderaum mit vier Sitzbadewannen für offenbar kollektive Nutzung.31
In einem späthellenistischen Komplex in Delos, dem sogenannten Fournihaus, war ein zentral platziertes Vereinsge-bäude von verschiedenen zu Wohnzwecken und kommerziell nutzbaren Einheiten umgeben, zu denen auch eine kleineseparate Badesuite zählte (Abb. 4). Diese Badesuite bestand aus einem von der Straße zugänglichen großen Vorraum(39/40) und einem kleinen runden, kollektiv nutzbaren Schwitzbad. Möglicherweise befand sich der gesamte Komplexim Besitz des Vereines, der die verschiedenen Einheiten seinen Mitgliedern zur Verfügung stellte oder profitabel externvermietete. Die unabhängige Badesuite war theoretisch separat nutzbar und vermietbar. Die Lage des Komplexes, dersich im Süden der Insel und weitab vom Stadtzentrum befindet, legt aber nahe, dass die Badeanlage in erster Linieden Vereinsmitgliedern und anderen Nutzern des Komplexes zur Verfügung stand.32
Die Badeanlagen der beiden Vereinsbauten sind auf der Skala „privat – öffentlich“ nur schwer zu klassifizieren.Beide waren vermutlich im „privat-kollektiven“ Besitz des Vereins, und ihre kollektiv intendierte Nutzung konnte vomVerein kontrolliert werden. Die delische Anlage ließ sich allerdings deutlich variabler nutzen als das Pendant in Aigeira,das voll in den Vereinsbau integriert gewesen zu sein scheint.
2.3 Bäder in Sportanlagen
Sportanlagen, d.h. gymnasia und palaistrai, waren wohl überwiegend öffentlicher Besitz griechischer Städte, konntenaber nachweislich auch Privatpersonen gehören.33 Die Differenzierung zwischen gymnasion und palaistra ist umstritten,aber am wahrscheinlichsten architektonisch zu begründen.34 Demzufolge werden palaistrai als Bauten mit zentralem(Peristyl-)Hof und umliegenden Räumen identifiziert, die Bestandteil größerer gymnasion-Komplexe oder unabhängigsein konnten. Badevorrichtungen waren zumeist integriert in diese palaistrai und nur denjenigen zugänglich, die Zutrittzu den palaistrai hatten. Dies war immer nur eine eingeschränkte Öffentlichkeit bzw. Gruppe, die etwa freie männlicheBürger einer Stadt oder Gäste des Besitzers einer palaistra umfasste.35 Die Errichtung oder Renovierung von Badein-stallationen in staatlichen palaistrai wurde bisweilen von Einzelpersonen, allen voran gymnasiarchoi, finanziert bzw.gestiftet, was aber nicht die Eigentumsverhältnisse der entsprechenden Bauten änderte.36
Zugängen von der Straße, listet De Haan 2010b, 129 Anm. 80 nur 10 Beispiele auf, die überwiegend aus dem kaiserzeitlichenNordafrika und in drei Fällen aus Hanghäusern Pompejis stammen.
30 Grund- und Immobilienbesitz ist für griechische wie römische Vereine bezeugt; s. z.B. Poland 1909, 453–488; Ausbüttel 1982,43–44; Zimmermann 2002, 124–132; Aneziri 2003, 169–179. Auf die mit Vereinsbesitz verbundenen juristischen Probleme, dieetwa Bollmann 1998 in ihrem zentralen Werk zu römischen Vereinshäusern nicht anspricht, kann hier nicht näher eingegangenwerden.
31 Ladstätter 2003, 2004, 2005; Trümper 2010, 531–532 Anm. 13. Das Gebäude wurde möglicherweise um 200 v.Chr. in einprivates Haus umgewandelt, als der Baderaum umgebaut und seine Ausstattung auf eine Sitzbadewanne reduziert wurde.
32 Trümper 1998, 317–318; Trümper 2006a, 123–131; Trümper 2008, 251; Trümper 2011, 52 Anm. 12; 68–70. Die Identifizierungdes zentralen Peristylbaus (Räume a-q) als Vereinshaus ist derzeit nicht sicher zu belegen; für eine fundierte Funktionsbe-stimmung des Komplexes bleibt die endgültige Publikation der Architektur, Dekoration und Funde durch Chr. Le Roy undH. Wurmser abzuwarten. – Für weitere mögliche Vereinsbauten mit Badeanlagen, Trümper 2010, 531–532 Anm. 13.
33 Delorme 1960, 261–262.34 Delorme, 1960, 253–271; Mango 2003, 19.35 Kobes 2004; Zugangsbeschränkungen zu gymnasia waren in Gesetzen festgesetzt; am besten sind sie derzeit in dem Gesetz
aus Beroia zu fassen, das in die erste Hälfte oder Mitte des 2. Jh. v.Chr. datiert wird.36 Schörner 2000, 308: Euandros, Sohn des Agathokles, stiftete als gymnasiarchos für Hermes und die polis Hypata im
phthiotisch-thessalischen Grenzgebiet wohl nach 168/7 v.Chr. eine exedra, einen oikos, ein loutron und ein - - ]konima(IG IX2 31); alle Strukturen dürften sich im lokalen gymnasion befunden haben. Am besten bekannt ist aus Inschriften diemehrfache Verbesserung und Verschönerung der Badeanlagen im gymnasion von Pergamon; Trümper im Druck.
212 Monika Trümper
Als Beispiel sei die palaistra in Eretria genannt, die um 300 v.Chr. mit einem einfachen loutron mit Kaltwasserbecken(B, Bauphase 1) errichtet und im 2. Jh. v.Chr. um ein rundes Schwitzbad (G, Bauphase 2) bereichert wurde (Abb. 5).Beide Badeanlagen waren nur vom Innern der palaistra aus zu erreichen.37
Anders wurde die Situation in der nur wenig bekannten hellenistischen palaistra von Assos gelöst, an die vermutlichnachträglich im Nordosten ein rundes Schwitzbad angebaut wurde (Abb. 6). Dieses Schwitzbad war offenbar nichtvom Innern der palaistra, sondern nur von außen zugänglich, so dass seine Nutzung nicht notwendig auf den Kreisder palaistra-Nutzer beschränkt gewesen sein musste. Ob diese ungewöhnliche Zugänglichkeit des Schwitzbades, daseindeutig architektonisch mit der palaistra verbunden war, bewusst im Hinblick auf eine variablere und breitere Nutzungoder nur wegen technisch-baulicher Probleme gewählt wurde, muss derzeit offen bleiben.38
2.4 Unabhängige Badeanlagen
Als letzte Kategorie seien die unabhängigen griechischen Badeanlagen diskutiert, die nicht nachweislich in einen über-greifenden funktionalen Kontext integriert waren und weitgehend mit der von Ginouvès’ identifizierten Kategorieöffentlicher Bäder übereinstimmen. Nur wenn man diese mit Ginouvès als balaneia identifiziert, sind in einigen wenigenFällen Aussagen zu den Eigentümern möglich, die nicht notwendig identisch mit den Betreibern der Anlagen waren. Ausdem 5. und 4. Jh. v.Chr. sind für Athen inschriftlich das balaneion des Isthmonikos39 und das balaneion des Diocharesbelegt;40 ein weiteres balaneion wurde im 4. Jh. v.Chr. von Dikaiogenes an Mikion verkauft oder verpfändet.41 Ebensowurde ein balaneion beim Serangeion im Piräus im 4. Jh. v.Chr. von Euktemon an Aristolochos verkauft.42 In delischenInschriften des frühen 4. Jh. v.Chr. wird ein balaneion des Aristonos erwähnt.43 Im ptolemäischen Ägypten besaß dieElite, wie etwa der Dioiketes Apollonios und sein Angestellter und Sekretär Zenon, balaneia als Geschäftsanlagen, diesie gewinnbringend verpachteten.44
Aus dieser Reihe fallen die bereits erwähnten balaneia demosia heraus, die aber erst in späthellenistischen undkaiserzeitlichen Quellen genannt werden.45 Die einzige Inschrift, die aus Athen stammt, ins späte 5. Jh. v.Chr. datiertwird und ein balaneion demosion zu erwähnen schien, scheidet nach einer Neuedition aus: statt de]mosi[on - -] wirdjetzt . . .]iosit[. . . . ] gelesen, das sich vielleicht zu einem Eigennamen ergänzen ließe.46 Die Inschrift wird als „cityproperty inscription“ gedeutet, in der unter anderem auch ein gymnasion, ein bouleuterion und eine oikia aufgeführtwerden und ferner Namen von mindestens drei Personen, die vermutlich als Eigentümer von Grundbesitz oder Bautenfungierten.47 Vermutlich dienten die mit Eigennamen aufgeführten Güter als topographische Referenz für verpachteten
37 Mango 2003, 53, 56–59,122–126. Nach Mangos eigener Definition (S. 19) handelt es sich bei dem freigelegten Bau um einepalaistra, aber der Bau wird traditionell als gymnasion bezeichnet.
38 Clarke – Bacon – Koldewey 1902, 171–185; Delorme 1960, 168–169. Auch dieser Bau ist als palaistra zu identifizieren, wirdaber gewöhnlich als gymnasion bezeichnet. Das Schwitzbad war bei einem Besuch der Anlage im Jahr 2007 völlig überwachsen,so dass seine ungewöhnliche Zugänglichkeit nicht überprüft werden konnte. – Für einen Überblick über Badevorrichtungenin palaistrai und gymnasia, Trümper im Druck, Anm. 126.
39 IG I3 84, 418/417 v.Chr.40 IG II2 2495, 335/334 v.Chr.; Walbank 1983, 191–199. Das balaneion des Diochares diente als topographische Referenz in
einer Liste, die Verpachtungen von Grundbesitz aufführt, der diversen Göttern bzw. Heiligtümern gehörte; Walbank 1983,197–198.
41 Is. Dikaiogenes 22–24.42 Is. Philoktemon 33.43 ID 98, B, 33–34; Hellmann 1992, 63–64; Chankowski 2008, 294, 362, 421.44 Préaux 1947, 44.45 S. oben, Anm. 19.46 Vgl. IG I2 385 mit IG I3 420; Ginouvès 1962, 215 Anm. 5 kannte nur IG I2 385 und vermutete, demosion könne hier einfach
bedeuten, dass das Bad der Öffentlichkeit zugänglich war; da ihm selber zufolge ja schon der Begriff balaneion an sich dieöffentliche Zugänglichkeit einer Badeanlage anzeigt, scheint dies wenig wahrscheinlich – für diese Inschrift wie vor allem fürliterarische Erwähnungen von balaneia demosia.
47ΕΡΜΑΓΟΡΑΣ, Vater von -Ι . ΑΓΟΠΑΣ; ΜΟΡΙΜΟΣ; ΦΙΛΩΝ, Vater von -ΡΟΣ. Traill 7, 1998, 36 Nr. 401850; Traill 12,2003, 449 Nr. 658800; Traill 18, 2009, 34 Nr. 954030.
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 213
staatlichen Grundbesitz.48 Folglich kann diese Inschrift nicht belegen, dass die Stadt Athen in der klassischen Zeitbalaneia besaß oder gar baute.49
Die insgesamt spärlichen Quellen legen also nahe, dass balaneia bis in die hellenistische Zeit wesentlich, wenn nichtsogar ausschließlich von privater Hand als profitable Investitionen errichtet, verwaltet und betrieben und häufig einfachnach ihren Eigentümern benannt worden sind. Die unabhängigen Bäder scheinen nicht zum Standardbauprogramm derpoleis gehört zu haben, wie etwa Theater, gymnasia und bouleuteria. Darüber hinaus zählten selbst in der hellenistischenZeit balaneia noch nicht zu den bevorzugten Bauten, die generöse euergetai den Städten finanzierten.50 Dies ändertesich erst in der späthellenistischen Zeit und dann vor allem in der Kaiserzeit, als unabhängige Bäder (balaneia, balnea,thermae) rapide zu respektablen Stiftungsobjekten und zu Standardbauaufgaben der öffentlichen Hand avancierten.51
So ehrte eine wohl späthellenistische Inschrift aus Mylasa den vielverdienten Uliades für seine mannigfaltigen Wohltaten,die auch verschiedene Aktivitäten im Rahmen der Errichtung und Finanzierung eines von der Stadt beschlossenenbalaneion umfassten.52 Zu diesem Zeitpunkt mag es folglich notwendig geworden sein, Bäder, die der Staat besaß undvielleicht auch errichtet hatte, durch Zusätze wie demosios und publicus von Anlagen im Privatbesitz zu unterscheiden– diese Praxis könnte wiederum in den späthellenistischen und kaiserzeitlichen Quellen reflektiert sein, welche dieExistenz von balaneia demosia bzw. die Differenzierung zwischen balaneia idiotika und demosia in das spätklassischeAthen zurückprojizieren.
Einen Sonderfall bildeten die Badeanlagen in oder bei extraurbanen Heiligtümern,53 für die sich in keinem Fall einprivater Eigentümer nachweisen lässt. Vermutlich gehörten sie dem entsprechenden Heiligtum.54
48 Zu Privatbauten als topographische Referenzen, s. oben, Anm. 40. Für wertvolle Hinweise zu dieser Inschrift und anregendeDiskussionen danke ich W. Bubelis, W. Riess und W. West.
49 Auch eine fragmentarisch erhaltene Bauabrechnung für den Parthenon, IG I3 440 von 443/432 v.Chr., in der die in Zeile 121erhaltenen Buchstaben BA zu balaneion ergänzt werden, kann hier nicht weiterhelfen. W. Bubelis teilte mir freundlicherweisein einem ausführlichen Kommentar zu dieser Inschrift mit, dass diese Ergänzung ausgeschlossen ist; sie würde erfordern, dassdie tamiai der Athena Einkünfte aus heiligem Grundbesitz (ein balaneion der Athena) oder gar aus staatlichem Grundbesitz(ein balaneion demosion) verwalteten, was aber beides nicht belegt ist; zudem legt der gesamte Aufbau der Inschrift in Zeile121 eine andere Ergänzung nahe.
50 Deshalb ist im Zeitraum vom 5. bis 1. Jh. v.Chr. die Verbindung des Terminus balaneion mit einem Eigennamen wenigerproblematisch und vieldeutig als bei den kaiserzeitlichen Bädern; vgl. oben, Anm. 11.
51 Schörner 2000 listet alle Belege für Stiftungen von Badeanlagen im hellenistischen und kaiserzeitlichen Griechenland auf;abgesehen von dem bereits erwähnten loutron in einem gymnasion, s. oben, Anm. 36, wurden keine Badevorrichtungen inhellenistischer Zeit dediziert und bildete das Stiften von Badeanlagen vielmehr ein „römerzeitliches Phänomen“ (314). ZuStiftern von Bädern in der spätrepublikanischen Zeit und Kaiserzeit, vgl. oben, Anm. 11. Bemerkenswerterweise zählte nachPaus. 10, 4, 1 selbst im 2. Jh. n.Chr. ein Bad (noch immer) nicht zur Standardausstattung einer Stadt.
52 I. Mylasa 101, Zeilen 24–30. Die Inschrift ist gerade bei den Zeilen 29–30 nur fragmentarisch erhalten. Die Stadt hatte offenbarper Gesetz den Bau eines balaneion verfügt; Uliades half bei der Auswahl des geeigneten Orts und versprach den Bürgern,die Kosten für den Erwerb des Grundstücks zu übernehmen, um dem Gott (Zeus von Labraunda) gefällig zu sein. Ob diesesBad in der Stadt Mylasa lag oder aber eher im Heiligtum des Zeus von Labraunda, dessen Vorsteher Uliades war, kannallerdings nicht bestimmt werden. Für Hinweise zu dieser Inschrift bin ich W. Blümel, D. Kah und W. West sehr verbunden.W. Blümel bestätigte mir freundlicherweise, dass die in den Zeilen 36–37 erwähnte philotimia kai legon kai prasson hyper teste patridos kai ton Romaion des Uliades die Inschrift frühestens im 2. Jh. v.Chr. datieren lasse; die Buchstabenform sprecheallerdings gegen eine noch spätere Datierung im 1. Jh. v.Chr.; ferner fänden Inhalt und sprachlicher Duktus der Inschriftgute Parallelen in anderen kleinasiatischen Ehrendekreten aus dem 2. Jh. v.Chr. Dagegen hält D. Kah, auf der Basis vonVergleichen mit anderen kleinasiatischen Ehrenschriften, eine Datierung der Inschrift erst um 100 v.Chr. oder in das frühe1. Jh. v.Chr. für möglich.
53 Unabhängige Badeanlagen in/bei extraurbanen Heiligtümern vom 5. bis 1. Jh. v.Chr.: Eleusis, Demeterheiligum; Epidauros,Asklepiosheiligtum; Karnak, Heiligtum des Amun-Re (zwei verschiedene Bäder); Nemea, Zeusheiligtum; Olympia, Zeushei-ligtum (mind. vier verschiedene Bäder); Lykaiongebirge, Zeusheiligtum. Umstritten ist die Lage des Asklepiosheiligtumsin Gortys, das die am besten bekannte unabhängige Badeanlage beherbergt: intraurban, suburban oder extraburban; vgl.Riethmüller 2005, II, 197–199; Melfi 2007, 216–221.
54 Balaneia sind epigraphisch für verschiedene Heiligtümer fassbar, wo sie jeweils zum Heiligtumsbesitz gehört zu haben schei-nen: Paton – Hicks 1891/1990, 260–261 Nr. 369: der nur allgemein hellenistisch datierte, fragmentarische Text bezieht sichauf ein Heiligtum der Aphrodite, das möglicherweise in Halarsana auf Kos lag; erwähnt werden auch ein Bad und ein Gar-ten, die offenbar verpachtet waren und „were probably situated in the temenos of the goddess“ (261). Mehrere offizielle,ins 4./3. Jh. v.Chr. datierte Inschriften aus dem Asklepiosheiligtum in Epidauros listen ein balaneion auf: IG IV2 103 C(Rechenschaftsbericht, der nach Roux, Ginouvès und Melfi die Tholos betraf, und nach Burford den Bau eines balaneion im
214 Monika Trümper
„Öffentlichkeit“ scheint sich folglich bei der Mehrzahl der unabhängigen griechischen Bäder im hier betrachtetenZeitraum lediglich auf die Zugänglichkeit bezogen zu haben: Alle diese Anlagen waren für kollektive Nutzung konzi-piert, d.h. es konnten immer mehrere Personen gleichzeitig baden. Die Zugänglichkeit dieser Bäder mag durchaus nichtvollständig öffentlich, sondern eingeschränkt gewesen sein, nach Kriterien wie sozio-ökonomischem Status (der Eintrittkostete gewöhnlich Geld), Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft oder Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen. Überdas Nutzerspektrum ist den literarischen und archäologischen Quellen aber nur wenig zu entnehmen. Etwa 30% derunabhängigen Bäder zeigen eine auffällige Verdopplung der Baderäume mit Sitzbadewannen (Räume 1 und 2), was sicham ehesten mit einer intendierten Trennung der Geschlechter erklären lässt (Abb. 7); folglich konnten diese Anlagenvon Männern und Frauen genutzt werden.55 In seltenen Fällen wie etwa bei den Badeanlagen im Asklepiosheiligtumvon Epidauros, im Zeusheiligtum des Lykeiongebirges und im Zeusheiligtum von Nemea erlaubt das BadeprogrammRückschlüsse auf die intendierte Nutzerschaft. Es handelt sich in allen Fällen um unabhängige Bäder, die vermutlichnicht die üblichen Sitzbadewannen enthielten. Das ins späte 4. Jh. v.Chr. datierte Bad in Nemea umfasste vielmehrsicher einfache Kaltwasserbecken auf hohem Fuß sowie ein Kaltwassertauchbecken (Abb. 8), und die beiden noch un-publizierten Beispiele in Epidauros und im Lykeiongebirge scheinen ähnliche Kaltwasserbadeformen geboten zu haben.Diese Badeformen weisen die Anlagen als typische Athletenbäder aus, die vermutlich den Sportlern vorbehalten waren,die an den in allen drei Heiligtümern abgehaltenen athletischen Wettkämpfen teilnahmen.56 In anderen Bädern magder urbanistische Kontext, etwa die Nähe zu Hafen oder Agora oder die Lage in bestimmten Wohnvierteln, die Zu-sammensetzung des Badepublikums bestimmt haben. Gerade bei den als Investment betriebenen Anlagen dürften abergenerell kommerzielle Interessen, d.h. die Erzielung möglichst hoher Besucherzahlen, die Regelung der Zugänglichkeitbeeinflusst haben. Über unterschiedliche Eintrittspreise könnte ferner eine wünschenswerte soziale Differenzierung derBadegäste erzielt worden sein, wie es für römische kaiserzeitliche Bäder vermutet wird: besonders reich ausgestatteteEtablissements könnten spezifisch für den Genuss einer sozial arrivierten, wohlhabenden Klientel konzipiert wordensein, die bereit war, für das Privileg exklusiven Badens unter „peers“ entsprechend zu bezahlen.
2.5 Kontexte von Badeanlagen – Resümee
Zieht man nach diesem Überblick über die verschiedenen Kontexte von Badevorrichtungen ein erstes Resümee, ergibtsich kein homogenes Bild mit klaren Kategorien bzw. eindeutig identifizierbaren „privaten“ versus „öffentlichen“ Anla-gen. Am sinnvollsten scheint es, die Kategorien „privat“ versus „öffentlich“ anhand der Zugänglichkeit bzw. intendiertenNutzerschaft zu bestimmen und nicht anhand der Eigentümer oder Betreiber. Ordnet man die Badeanlagen in verschie-denen Kontexten nach dem Grad der Zugänglichkeit bzw. intendierten „Öffentlichkeit“, könnte man folgende Skala mit
Heiligtum, ca. 290–270 v.Chr.); IG IV2 110 (Rechenschaftsbericht über den Bau von oikoi; die Seite C listet in den Zeilen6–7 ein balaneion und seine Wasserversorgung auf, dessen Verhältnis zu den oikoi aber unklar bleibt; ca. 320–300 v.Chr.);IV2 116 (Rechenschaftsbericht über die Anlage von Kanälen für ein [bala]neion; spätes 4. Jh. v.Chr.); IV2 123, Zeile 130(Heilungsbericht; 350–300 v.Chr.). Für das Heiligtum des Apollo Maleatas in Epidauros ist ebenfalls ein balaneion erwähnt,IV2 109 (Rechenschaftsbericht über Ausgaben für den Bau der skanamata; ein loutron ist auf Seite A, Zeile 85, und einbalaneion mit Wasserversorgung auf Seite C, Zeilen 34, 45, erwähnt; ca. 290–270 v.Chr.); vgl. Roux 1961, 176; Ginouvès1962, 358 Anm. 4; Burford 1969, 76–79, 83, 209, 221; Melfi 2007, 156–159, 167. Zu den loutra im Amphiareion von Oro-pos, die möglicherweise ebenfalls unabhängige Badeanlagen bildeten, s. oben, Anm. 17, 22. Zu Badeanlagen (balaneion undaleipterion) im Karneiasion von Andania, s. IG V1 1390, Zeilen 106-111; Trümper 2013, 64, Anm. 17.
55 Derzeit sind ca. 70 unabhängige griechische Bäder mit Sitzbadewanne bekannt; vgl. Trümper 2008, 427–433, Tabellen 4–8;Trümper 2009, 164–168, Tabellen 1–6. Diese Tabellen sind nach neuesten Forschungen leicht zu modifizieren und ergänzen;vgl. den Katalog aller derzeit bekannten großen unabhängigen griechischen Bäder in Lucore – Trümper 2013, 264–333. ZurGeschlechterdifferenzierung in griechischen Bädern, Trümper 2012.
56 Epidauros: Ginouvès 1962, 359; Aslanides – Pinatse 1999: es könnte sich theoretisch um das inschriftlich in IG IV2 103C und 110 C erwähnte balaneion handeln; s. oben, Anm. 22, 54. Lykeiongebirge: Romano 2005, 388–389. Nemea: Miller1992. – Möglicherweise gehörte zu dieser Gruppe auch ein Athletenbad im Amphiareion von Oropos, wo ebenfalls sportlicheWettkämpfe stattfanden; s. oben, Anm. 22. Die Heiligtümer in Epidauros und Oropos dienten aber vor allem als Heil- undOrakelstätten und mögen für diese Zwecke andere Badevorrichtungen etwa für rituelle Waschungen und Reinigungen gebotenhaben. Zur „Dualität“ (oder besser Pluralität) der Badeanlagen in ein und denselben Heiligtümern, die unterschiedliche –etwa profane, medizinisch-therapeutische und rituelle – Bedürfnisse abdeckten, Ginouvès 1962, 348, 357–361. Kritisch zurFunktion von Badeanlagen in/bei Heiligtümern, Trümper 2013, 52-62.
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 215
zunehmender „Öffentlichkeit“ rekonstruieren: Wohnbauten mit abgelegenen einfachen Badezimmern; Wohnbauten mitgut zugänglichen, ausgedehnten Badesuiten; Badeanlagen in Vereinsbauten; Badevorrichtungen in Sportanlagen derpoleis; unabhängige Bäder. Auf allen Ebenen ist aber mit Ausnahmen, Differenzen und Variationen zu rechnen. Beifast allen Anlagen konnte etwa eine Nutzerdifferenzierung nach Tageszeiten, Wochentagen oder besonderen Ereignissenerfolgen, was archäologisch aber nicht fassbar ist.57
3 Badeprogramme
Im Folgenden sei untersucht, ob sich in den verschiedenen Kontexten signifikant differierende Badeprogramme nach-weisen lassen, die möglicherweise mit den unterschiedlichen Zugänglichkeitsgraden korrelieren und erlauben, auf dieserEbene den Gegensatz „privat“ versus „öffentlich“ schärfer zu fassen. Zunächst sei ein kurzer Überblick über die inklassischer und hellenistischer Zeit verfügbaren Badeformen gegeben und jeweils die Kontexte, in denen sie vorkom-men. Bei der Verwendung der Badeformen sind markante regionalspezifische Differenzen nachzuweisen, die für dieFragestellung hier aber nicht zentral sind und deshalb nicht weiter berücksichtigt werden.58 Wichtig dagegen und inder folgenden Aufzählung hervorgehoben ist der Unterschied zwischen reinigenden und entspannenden Badeformen.Entspannende Badeformen erforderten einerseits deutlich mehr technischen und finanziellen Aufwand zur Beheizungals einfache Reinigungsbäder, und andererseits mehr Zeit für den Badeprozess. Die Verlängerung des Badens über denpuren Akt der Reinigung hinaus setzt ein gesellschaftlich etabliertes und akzeptiertes Konzept von Muße und Genussvoraus. Entspannende Badeformen wurden in der hellenistischen Zeit eingeführt und trugen sicherlich wesentlich zu derfür diese Epoche immer wieder konstatierten Steigerung des allgemeinen Lebensstandards und Verfeinerung urbanenLebensstils bei.59
1. Am weitesten verbreitet war die Sitzbadewanne für individuelle reinigende Duschbäder mit warmem oder kaltemWasser, die ab dem 6. Jh. v.Chr. nachweisbar ist und bis weit in die römische Kaiserzeit benutzt wurde (Abb. 1, 3, 7,9). Sie fand in Wohnbauten, Vereinsbauten und unabhängigen Bädern Verwendung, aber niemals in Sportanlagen.In unabhängigen Bädern wurden Sitzbadewannen in ein oder zwei Räumen gruppiert, wobei die Kapazitäten vonzwei bis über 50 reichen. Für Bäder in Sitzbadewannen benötigte man nur wenig Wasser, das auf Öfen erhitzt undvon Hand über die Badenden gegossen und auch von Hand wieder ausgeschöpft werden musste.60
2. Einfache Wasserbecken auf hohem Fuß, die an einer Wand aufgestellt und mit kaltem Wasser gefüllt wurde, findensich ausschließlich in den Baderäumen der Sportanlagen und in den seltenen unabhängigen Athletenbädern (Abb. 5,10).61 Sie dienten reinigenden Ganzkörperwaschungen, bei denen das verspritzte Wasser auf den Boden fiel undabgeleitet werden musste. In den meisten Fällen konnten die Becken von mehr als einer Person gleichzeitig benutztwerden.62
3. Kollektive Tauchbecken, die mit kaltemWasser gefüllt wurden, bildeten ebenfalls quasi ein Unikum der Sportanlagenund Athletenbäder (Abb. 11). Sie stellten die bequemere Variante für reinigende Ganzkörperwaschungen bzw.Tauchbäder dar, erforderten aber auch mehr Wasser sowie Installations- und Wartungsaufwand.63
57 Trümper 2012.58 Dazu ausführlich, Trümper 2009.59 Trümper 2009, 2010.60 Zum Material und Maßen von Sitzbadewannen, Trümper 2006b, 151 Anm. 20.61 S. oben, Anm. 56.62 Zu den durchschnittlichen Maßen der Kaltwasserbecken, s. etwa Miller 1992, 210, 215; Mango 2003, 39: die Becken im
Athletenbad von Nemea und im gymnasion von Eretria waren 1,40–1,45m lang, 0,60–0,80m breit, 0,55–0,75m hoch (inklusivemöglicher Basen). – Häufig wurden diese Becken auf hohem Fuß durch flachere Pendants ergänzt, die in den Boden eingelassenwaren und zum Reinigen der Füße dienten; sie seien hier nicht als eigene Badeform behandelt.
63 Solche Tauchbecken sind bislang sicher nachgewiesen in: Delphi, gymnasion: rundes Becken mit 5 Stufen, Durchmesser max.10m und Tiefe max. 1,90m, beides inklusive der Stufen; nachträglich eingerichtet, möglicherweise im zweiten Viertel des3. Jh. v.Chr.; Delorme 1960, 313; Wacker 1996, 198–199. Nemea, Bad: 8,20 × 3,90m, max. 1,25–1,30m tief; Ende des 4. Jh.v.Chr.; Miller 1992, 212–213. Pella, Palast, als palaistra gedeuteter Peristyl-Komplex V: 7,5 × 6m, ursprünglich vermutlich1,65m tief, Ende 4./Anfang 3. Jh. v.Chr.; Chrysostomou 1988, 117–118. Das Tauchbecken in Korinth, Badeanlage im Gebiet
216 Monika Trümper
4. In einem Atemzug mit den kollektiven Tauchbecken werden gewöhnlich (zu Unrecht) Becken genannt, die aufgrundihrer Größe zum Schwimmen geeignet waren, d.h. zur sportlichen Aktivität in kaltem Wasser und nicht nur zureinigenden Tauchbädern. Bislang sind nur wenige Beispiele sicher in die Zeit zwischen dem 5. und 1. Jh. v.Chr. zudatieren. Zwei Beispiele befanden sich in den Heiligtümern von Olympia und Isthmia, wo sie gänzlich frei zugänglichund auch einsehbar gewesen zu sein und keine unmittelbare Verbindung zu anderen Bauten gehabt zu haben schei-nen. Obwohl in beiden Heiligtümern athletische Wettkämpfe abgehalten wurden, ist derzeit nicht zu bestimmen,ob die Schwimmbecken in diesem Rahmen genutzt wurden bzw. wer wann und zu welchen Zwecken diese generellfrequentierte (Abb. 12).64 Große Becken wurden ferner in und bei einigen hellenistischen gymnasia gefunden, wo sienicht mit anderen Badevorrichtungen gruppiert waren,65 sowie in den späthellenistischen Palästen der Hasmonäerund Herodes des Großen, wo sie vor allem als Luxuselemente in aufwendige Gartenanlagen integriert wurden.66
Alle großen Becken erforderten einen enormen Aufwand in der Errichtung und besonders in der Betreibung bzw.Versorgung mit Wasser und werden deshalb, vor allem in den Palästen, als Symbole von Macht und Reichtum ge-dient haben. In diversen Untersuchungen zum Schwimmen bei den Griechen, die im wesentlichen auf Schriftquellenberuhen und in keinem Fall alle archäologischen Befunde berücksichtigen und analysieren, ist umstritten, inwieweitSchwimmen bei den Griechen überhaupt als Freizeit- und Leistungssport betrieben wurde.67 Während nicht festzu-stellen ist, wann und in welchem Umfang natürliche Gewässer für vergnügliches und sportliches Schwimmen genutztwurden, sind die großen Becken zumindest in/bei den gymnasia und in Palästen, wahrscheinlich aber auch die in den
des gymnasion wird dagegen schon ins 1. Jh. n.Chr. datiert: 10,32m lang, Breite nicht ergraben, aber kaum mehr als 11–12m;1,58m tief an den Seiten, tiefer im Zentrum; Wiseman 1972, 18–19. – Kleine Becken für kalte Tauchbäder, die kaum für wirk-lich kollektiven Genuss geeignet waren, wurden ferner in den unabhängigen griechischen Bädern von Oiniadai (nachträglichzu einem unbekannten Zeitpunkt, möglicherweise im späten 2. Jh. v.Chr.) und Delos (eine insgesamt sehr späte Anlage, wohlkurz vor 88 v.Chr. eingerichtet) eingebaut, vermutlich als Reaktion auf einen Wandel der Badepraktiken in späthellenistischerZeit; Trümper 2006b, 152–154, 196–197 Anm. 160. Dagegen ist die Identifizierung von Kaltwassertauchbecken in anderenunabhängigen griechischen Bädern wie etwa denen von Olympia (Älteres Sitzbad), Piräus (sog. Serangeion Bad) und Gortys(erste Phase) nicht überzeugend. – Nicht näher diskutiert seien hier die Quell- und Brunnenhäuser in Heiligtümern, die zurituellen Waschungen und Tauchbädern dienten; vgl. etwa Riethmüller 2005, I, 386.
64 Isthmia, Poseidonheiligtum: 30,04 × 30,31m, maximal 1,40m tief (Wasser vermutlich nur 1,20m tief; kurz nach 365 v.Chr.;überbaut vom römischen Bad des 2. Jh. n.Chr.). Das Schwimmbad lag am nördlichen Rand des Heiligtums und war imOsten möglicherweise von einem Gebäude oder einer Stoa flankiert; Gregory 1995, 282–283 Abb. 2–3, 303–312, bes. 305–306. Gregory 1995, 305 nimmt an, dass das Schwimmbad ergänzt wurde durch „normal facilities for a bath of the Greekperiod, such as exercise grounds, bathing basins, and cisterns“, aber bislang wurde nichts dergleichen entdeckt. Olympia,Zeusheiligtum: 24,60 × 16,40m, 1,64m tief (spätes 5./frühes 4. Jh. v.Chr.?, um oder kurz nach 100 v.Chr. aufgelassen).Das Schwimmbad lag zwischen dem ersten unabhängigen griechischen Bad (Älteres Sitzbad) und dem Kladeos, ganz amwestlichen Rand des Heiligtums; Kunze – Schleif 1944, 40–45, 70–72. Das benachbarte gymnasion wurde erst ab der erstenHälfte des 3. Jh. v.Chr. sukzessive errichtet; Wacker 1996, 56.
65 Aï Khanoum: Um 150–145 v.Chr. wurde zwischen dem Palast und dem sogenannten gymnasion ein großes Becken errichtet,41,50 × 44m, maximal 2,10m tief im Zentrum, das von einer eigenen Mauer umgeben war. Der Haupteingang zu demBereich war im Osten; möglicherweise gab es eine Tür in der Westmauer, die zum Gebiet südlich des „gymnasion“ führte.Das Becken konnte folglich vermutlich von den Benutzern des „gymnasion“ wie den Bewohnern des Palastes genutzt werden.Veuve 1987, 39–41, 97, 103–106 Taf. IV, VI. Samos: Becken, 15,70 × 14,80m, 1,65m tief, im mittleren der drei Höfe des insfrühe 3. Jh. v.Chr. datierten gymnasion; Martini 1984, 23–25 Taf. 36. Man könnte hier den Komplex nördlich des Forums vonPaestum hinzufügen, der im 3. Jh. v.Chr. oder 2. Jh. v.Chr. mit einem großen Becken errichtet wurde, 47 × 21m, mit einerArt Plattform an einem Ende, dessen Funktion aber (Campus für prae- und paramilitärisches Training und/oder rituelleFunktion?) umstritten ist; Torelli 1999, 35–38; Borlenghi 2011, 151–153, 234–237. Ein Becken von 29,75 × 21,80m (Tiefe inder Literatur nirgends erwähnt), das auf dem Akradine Plateau in Syrakus freigelegt und vorsichtig mit einem gymnasion inVerbindung gebracht wurde, lässt sich nicht sicher datieren und kontextualisieren und ist heute nicht mehr zu identifizieren;Delorme 1960, 91; Ginouvès 1962, 134.
66 Jericho: Palast des Johannes Hyrkanos I.: zwei Becken, je 8 × 9m, mind. 2–3m tief; Palast des Alexander Jannaios: zweiBecken, je 18 × 13m, 3,5m tief; Erster Palast des Herodes: 32 × 18m, 3,5m tief; Unteres Herodeion: 69 × 45m, 3m tief;Palast des Herodes in Caesarea Marittima: 35 × 18m, vermutlich 2m tief; Netzer 1999, 11–17, 28–29, 36, 101–102, 110–111;Japp 2000, 36, 68–69. Nielsen 1994, 296–299 interpretiert auch ein Becken von 12,4 × 18,4m Größe und 2,6m Tiefe imsüdlichen Bereich von Masada als Schwimmbecken.
67 Skeptisch: Auberger 1996, 54; Handy 2008, 101–102 Anm. 8. Befürwortend: Maniscalco 1995, 24–26; Miedico 2005, 293–294.Pausanias 2, 35, 1 erwähnt einen Schwimmwettbewerb in Hermione, der bei einem jährlichen Fest zu Ehren des DionysosMelanaigis abgehalten wurde, aber es ist unbekannt, wann dieser Wettkampf eingerichtet wurde.
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 217
Heiligtümern mit hoher Wahrscheinlichkeit spezifisch für Schwimmaktivitäten gebaut worden.68 Sie können deshalb– als Grenzfall – zu den eigens eingerichteten Badeanlagen gezählt werden.
5. Zu den entspannenden Badeformen gehörte zunächst die individuelle Liegebadewanne für Bäder in warmemWasser, die mit und ohne Hypokaust installiert wurde.69 Die Version ohne Hypokaust wurde vermutlich bereits im3. Jh. v.Chr. eingeführt und in Wohnbauten wie unabhängigen Bädern eingebaut, wo fast immer mehrere Wannen ineinem Raum gruppiert waren (Abb. 7, 13). Die aufwendigere Variante mit Hypokaust ist ab dem 2. Jh. v.Chr. fassbarund findet sich vor allem in Wohnbauten (Abb. 2, 14) und selten auch in unabhängigen Bädern. In den unbeheiztenLiegebadewannen musste das Wasser gewöhnlich von Hand eingefüllt werden, konnte aber durch Löcher nahe demBoden der Wannen ablaufen. Die beheizten Pendants wiesen dagegen eine elaboriertere Wasserversorgung mitZuleitung vom Wasserkessel über dem praefurnium auf, von dem aus auch das Hypokaustsystem beheizt wurde.70
Bislang sind keine Liegebadewannen aus Sportanlagen oder Vereinsbauten bekannt.
6. Deutlich aufwendiger war die beheizte Tauch- oder Liegewanne, die mit ca. 3,20–5,80m Länge und 1,20–1,80mBreite und ca. 0,50–0,60m Wassertiefe installiert wurde und somit für kollektive entspannende warme Bäderkonzipiert war (Abb. 15). Auf der Eingangsseite war sie mit Stufen ausgestattet, um den Einstieg zu erleichtern;ihre Rückwand war gebogen oder abgeschrägt, so dass sich Badende bequem anlehnen konnten. Die Wanne war miteinem Hypokaustsystem ausgestattet, um das Wasser in der Wanne zu erhitzen bzw. warm zu halten, und wurdemöglicherweise auch von einem Kessel mit heißem Wasser versorgt. Diese aufwendige Badeform, die viel Wasser,Heizmaterial und Personal erforderte, wurde im 3. Jh. v.Chr. eingeführt und ausschließlich in unabhängigen Bäderninstalliert.71
7. Die vielseitigste Badeform bildete das runde Schwitzbad für entspannende Schwitzbäder, das mit Durchmessernvon ca. 1,55 bis 10,20m errichtet wurde. Es hatte gewöhnlich einen einzigen engen Eingang, um Hitzeverlust zuminimieren, und war mit hölzernen Sitzmöbeln ausgestattet. Beheizt wurde das Schwitzbad mit einem Hypokaustoder – viel häufiger – mit oberirdischen Heizquellen wie heißen Steinen oder tragbaren Kohleöfchen. Die Größeund der Aufwand in der Beheizung und Bedienung legen nahe, dass Schwitzbäder immer kollektiv genutzt wurden.Diese Badeform wurde im 2. Jh. v.Chr. eingeführt und in allen verschiedenen Kontexten verwendet: in luxuriösenBadesuiten in Wohnbauten (Abb. 16), in Vereinsbauten, in Sportanlagen (Abb. 5, 6, 18), wo das Schwitzbad die ein-zige akzeptierte Warmbadeform bildete, und in unabhängigen Bädern (Abb. 17). Schließlich konnte diese Badeformsogar ganz allein auftreten in kaum klassifizierbaren Kontexten wie der sogenannten Agora der Italiker in Delos(luxuriöse Porticus-Anlage, Abb. 19) und möglicherweise auch einer wohl unabhängigen Badeanlage in Priene.72
Die aufwendigen Versionen mit fortschrittlichem Hypokaustsystem wurden nur in einigen unabhängigen griechi-schen Bädern installiert (Abb. 17); Beispiele mit experimentellen Heizsystemen bleiben auf verschiedene Kontextein Delos beschränkt.73
68 Die Becken in den Palästen der Hasmonäer und des Herodes könnten, je nach Größe, zusätzlich auch als Reservoire, fürBootsfahrten und vielleicht auch zur Fischzucht genutzt worden sein; Netzer 1999, 11, 102.
69 Diese Wannen waren durchschnittlich 1,40–1,80 × 0,50–0,70m hoch und ca. 0,50m tief und damit gut mit modernen Bade-wannen vergleichbar; vgl. Trümper 2009, 145.
70 Trümper 2009, 145–151: unbeheizte Liegebadewannen wurden in den unabhängigen griechischen Bädern im südöstlichenMittelmeerraum, allen voran Ägypten eingebaut; beheizte Liegebadewannen sind bislang nur sicher für die unabhängigengriechischen Bäder in Gortys und Olympia (Späthellenistisches Bad) nachgewiesen, waren aber möglicherweise auch inden Anlagen von Dilesi und Thessaloniki vorhanden. Zur Verbreitung der unbeheizten und beheizten Liegebadewannen inhäuslichen Bädern, Trümper 2010, 534–539; Russenberger 2013.
71 Diese Badeform ist bislang nur in wenigen unabhängigen griechischen Bädern im westlichen Mittelmeerraum nachgewiesen(Gela?, Kaulonia, Locri Epizefiri, Megara Hyblaea, Morgantina Nord-Bad, Syrakus, Velia), bildet aber den konstitutivenBestandteil aller unabhängigen römischen Bäder; Trümper 2009, 151–152; s. oben, Anm. 15.
72 Trümper 2008, 226–275, 421–426 Tabelle 3; Trümper 2009, 143–144 Tabellen 7–8; ferner arbeite ich an einer separaten Studiezu Schwitzbädern aus kulturvergleichender Perspektive, in der 37 sicher identifizierbare runde Schwitzbäder des 2./1. Jh.v.Chr. und zahlreiche problematische Beispiele aus dem gesamten Mittelmeerraum zusammengestellt und ausgewertet wer-den.
73 Schwitzbäder mit Hypokaust in den unabhängigen griechischen Bädern von Gortys, Olympia (Späthellenistisches Bad) undThessaloniki; Trümper 2009, 145–149. Die Pendants in den unabhängigen römischen Bädern des 2. und 1. Jh. v.Chr., s.oben, Anm. 15, mussten dagegen alle mit oberirdischen Heizquellen erwärmt werden, mit Ausnahme des kleinen rechteckigen
218 Monika Trümper
Aus diesem Überblick ergibt sich folgendes Bild: Die Badevorrichtungen in Sportanlagen fallen deutlich heraus, dasie bis ins 2. Jh. v.Chr. nur Kaltwasserbecken, kollektive Kaltwassertauchbecken sowie in seltenen Fällen Kaltwasser-schwimmbecken und keine der sonst üblichen Badeformen aufwiesen (Abb. 5, 6, 8, 11). Mit Ausnahme der insgesamtungewöhnlichen und in ihrer Deutung problematischen Schwimmbecken waren die Kaltwasserbadeformen quasi exklu-siv, d.h. finden sich gar nicht oder nur sehr selten in einem der anderen Kontexte. Gerade aufgrund dieser auffälligenExklusivität lassen sich einige unabhängige Anlagen wie die Bäder in Epidauros, im Lykeiongebirge und in Nemea alsAthletenbäder identifizieren (Abb. 8, 11). Erst im 2. Jh. v.Chr. folgten athletische Badeanlagen dem allgemeinen Trendund erhielten mit den neumodischen runden Schwitzbädern ihre erste Warmbadeform, die das Badeerlebnis in diesemKontext revolutioniert haben muss (Abb. 6, 7, 18). Allerdings wurde diese Innovation keineswegs Standard, da sichrunde Schwitzbäder bislang nur in fünf oder sechs Sportanlagen nachweisen lassen.74 Die Gründe für diese markanteAusprägung und Entwicklung der Athletenbäder sind in der spezifischen Funktion ihres Kontextes und den mit diesemverbundenen sozio-kulturellen Praktiken zu sehen: Kaltbäder galten als asketisch-abhärtend und damit als die einzigegeeignete Bäderart für Athleten, die durch Warmbäder physisch wie moralisch verdorben und verweichlicht wordenwären – eine Haltung, die sich in späthellenistischer Zeit nur langsam und dann erst in der Kaiserzeit umfassend undnachhaltig änderte.
Aufschlussreicher für die Frage „privat“ versus „öffentlich“ sind die anderen Kontexte, bei denen sich eine er-staunliche Durchlässigkeit bzw. parallele Entwicklung konstatieren lässt. Im 5. und 4. Jh. v.Chr. wurde die einfacheSitzbadewanne unterschiedslos und ohne sichtbare Differenzen in der Qualität in Wohnbauten, Vereinsbauten undunabhängigen Bädern installiert, wo sie jeweils die einzige Badeform bildete (Abb. 1). Lediglich die Zahl der Sitzbade-wannen pro Raum differierte je nach Kontext. Ab dem 3. Jh. v.Chr. wurde in einigen unabhängigen Bädern ein deutlichbesserer Badestandard erreicht mit der Einführung neuer entspannender Badeformen, zu denen sicher die kollektivebeheizte Tauchwanne (Abb. 15) und möglicherweise auch individuelle unbeheizte Liegebadewannen gehörten (Abb. 7,13).75 In Wohnbauten scheint ein vergleichbarer Standard mit individuellen beheizten Liegebadewannen erst im 2. Jh.v.Chr. erreicht worden zu sein (Abb. 2, 14) und die Einführung der einfacheren unbeheizten Pendants ist wiederumnicht näher zu datieren (3. oder erst 2. Jh. v.Chr.).
Im 2. Jh. v.Chr. stand dann das gesamte Repertoire beheizter und unbeheizter Liegebadewannen sowie runderSchwitzbäder zur Verfügung – für Wohnbauten, Vereinsbauten und unabhängige Bäder gleichermaßen (Abb. 16–19).76
Die Etablierung von Feinchronologien ist derzeit unmöglich, aber die Pionierrolle unabhängiger Bäder im 3. Jh. v.Chr.legt nahe, dass diese auch bei der Einführung neuer Badeformen und Badeprogramme im 2. Jh. v.Chr. eine leitendePosition einnahmen. Es sei jedoch betont, dass es offenbar keine Restriktionen oder sozialen Normen und Praktiken gab,die eine deutliche Differenzierung zwischen dem „privateren“ Bad im Haus oder Vereinsbau und dem „öffentlicheren“Bad in unabhängigen Bädern erfordert hätten. Im Gegenteil waren reiche Hausbesitzer offenbar sehr bemüht, Innova-tionen, wie sie in größeren Anlagen sicherlich leichter auszutesten waren, in ihren eigenen Häusern einzuführen und dengegebenen Möglichkeiten und Konditionen anzupassen: So finden sich in Häusern natürlich keine großen kollektiven be-
Schwitzraumes (15) im zweiten Bad von Fregellae, der derzeit das früheste „römische“ Hypokaustsystem mit kleinen Zie-gelpfeilern aufweist; Tsiolis 2004, 91; Tsiolis 2006, 248–250; Trümper 2009, 144 Anm. 16. Zu den experimentellen delischenSchwitzbädern, Trümper 2008, 226–235.
74 Von den ca. 23 spätklassischen und hellenistischen gymnasia, die sich archäologisch hinreichend erfassen lassen, besaßennur die Anlagen in Akrai, Assos, Eretria, Solunt und Thera sicher ein rundes Schwitzbad und das Beispiel in Aï Khanoummöglicherweise eines in der 3. Phase des Baus; Trümper 2008, 258–275, 421–426 Tabelle 3; Trümper im Druck, Anm. 126.Diesen Beispielen sind auch die ungewöhnlichen Schwitzbadeformen in zwei delischen Sportanlagen hinzuzugesellen, s. dazuunten, Anm. 102.
75 Die unabhängigen Bäder in Ägypten, in denen überwiegend diese Liegebadewannen zu finden sind, werden gewöhnlich nurallgemein in die ptolemäische Zeit datiert, ohne dass präzisiert wird bzw. beim derzeitigen Forschungsstand fundiert zupräzisieren wäre, ob diese Bäder bereits im 3. oder erst im 2. Jh. v.Chr. errichtet wurden. Archäologisch ist die Existenz vonSitzbadewannen in ägyptischen Häusern bereits für das späte 4. Jh. v.Chr. belegt, und unabhängige Bäder (mit unbekanntemBadeprogramm) werden in Papyri des 3. Jh. v.Chr. erwähnt; aber die Einführung der entspannenden Liegebadewannen lässtsich bislang nicht näher datieren. Fournet – Redon 2007; Boraik 2009, 79–80; Gallo 2009, 67; Fournet – Redon 2009, 124–126.
76 Dagegen ist bislang kein unabhängiges griechisches Bad bekannt, das nach dem 3. Jh. v.Chr. noch mit einer kollektivenbeheizten Tauchwanne versehen worden wäre; vielmehr wurden Bäder mit Sitzbadewannen und kollektiven beheizten Tauch-wannen spätestens im 2. Jh. v.Chr. vollständig von den unabhängigen römischen Bädern abgelöst.
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 219
heizten Tauchwannen, aber individuelle beheizte Liegebadewannen, und keine runden Schwitzbäder mit Hypokaust,77
aber solche ohne. Darüber hinaus bildete nicht einmal Kollektivität bzw. der sozial-gesellige Aspekt des Badens einPrivileg unabhängiger Bäder, da in Häusern mit dem runden Schwitzbad eine fundamental kollektive Badeform eta-bliert wurde und außerdem kollektiver Badegenuss in größeren häuslichen Badesuiten allein dadurch ermöglicht wurde,dass sich mehrere Personen gleichzeitig in den Baderäumen aufhalten konnten. Die wesentliche Differenz zwischen Ba-deanlagen in Wohnbauten und unabhängigen Bädern war vermutlich quantitativer Natur: In der späthellenistischenZeit boten über 60% der derzeit bekannten unabhängigen griechischen Bäder und alle unabhängigen römischen Bä-der mindestens eine entspannende Badeform. Für die nur vereinzelt bekannten Pendants in Wohnbauten lassen sichzwar keine umfassenden statistischen Angaben machen, aber es ist sicher, dass nur sehr wenige zeitgenössische Häuserüberhaupt über eigene permanente Badevorrichtungen verfügten, geschweige denn solche mit entspannenden Bade-formen.78 Dies ist, zumindest auf dem höchsten Wohnniveau, nicht mit Platzmangel zu erklären, weil es in Städtenwie Delos, Morgantina, Pella, Pergamon und Solunt große Häuser gab, die nicht einmal ein eindeutig identifizierbaresBadezimmer mit einfacher Sitzbadewanne hatten. Das Vorweisen einer eigenen Badesuite für den Eigenbedarf oder garGastempfang war offenbar kein Standard elitären Wohnens, sondern scheint wesentlich von individuellen und lokalenPräferenzen bestimmt worden zu sein. Badeanlagen in hellenistischen Palästen sind insgesamt zu wenig bekannt, um sieumfassend mit den Pendants in Privathäusern oder auch anderen Kontexten vergleichen zu können,79 aber die großen,repräsentativ-extravaganten Schwimmbecken der Hasmonäer stechen in jedem Fall als einzigartiger Luxus heraus.
Wo und wie badeten Personen, die kein eigenes Badezimmer zu Hause hatten?
4 Verteilung von Badeanlagen in Städten
Dies führt zu der Frage nach der Verteilung von Badeanlagen in unterschiedlichen Kontexten in einer Stadt bzw. derFrage, wie viele Bewohner einer Stadt theoretisch Zugang zu Badevorrichtungen hatten. Dabei geht es nicht um dasohnehin unmögliche Unterfangen, Kapazitäten genau zu kalkulieren,80 sondern vielmehr um folgende Fragen: WelchenStellenwert hatte Baden nach Ausweis archäologischer Befunde in einer Stadt; wie war das quantitative und qualitativeVerhältnis von häuslichen zu diversen öffentlich zugänglichen Badevorrichtungen; wo waren Badeanlagen lokalisiert undwie sehr bestimmten sie das Stadtbild, etwa auch im Hinblick auf die Organisation des Verkehrs und das Durchschreitenund Erleben der Städte.
Da es für den hier betrachteten Zeitraum kein Pompeji, Timgad oder Ostia gibt und aus nur wenigen Städtenüberhaupt Badevorrichtungen in unterschiedlichen Kontexten bekannt sind, können diese Fragen derzeit jedoch nichtsystematisch untersucht werden. Deshalb seien hier nur einige Fallstudien vorgeführt, um die Komplexität und Viel-schichtigkeit dieser Problematik zu veranschaulichen. Die Auswahl erfolgte nach der Verfügbarkeit von Informationenüber die lokale Badekultur; folglich ist das Spektrum der nachfolgend diskutierten Fallbeispiele notwendig breit, inchronologischer wie geographischer Hinsicht. Da nur Badevorrichtungen in Sportanlagen nachweislich überwiegend instaatlichem Besitz und die unabhängigen Bäder dagegen eher private Investitionen waren, könnte man erwarten, dasses keine staatliche Regelung und Kontrolle bei der Anlage unabhängiger Bäder gab, etwa im Hinblick auf Kapazität,regelmäßige Verteilung und Lage.
4.1 Athen
Das erste Fallbeispiel, Athen, widerlegt diese Erwartung jedoch. In Athen lassen sich vom 5. bis 1. Jh. v.Chr. nurBadevorrichtungen in unabhängigen Bädern einigermaßen sicher lokalisieren; die zeitgenössischen Badestandards in
77 Abgesehen von den beiden Häusern in Delos, in denen runde Schwitzbäder mit experimentellen Beheizungsformen eingebautwurden; s. oben, Anm. 73.
78 Trümper 2010, 544–547.79 Trümper 2010, 541–542; vgl. auch Nielsen 1994, 214–215.80 Dies scheitert allein an dem vielumstrittenen Problem, die Bevölkerungszahl antiker Städte zu ermitteln; hinzu kommen
zahlreiche andere unbekannte Faktoren: etwa wie lange Badeanlagen (pro Tag, Woche, Monat, Jahr) geöffnet waren, wielange man sich in diesen durchschnittlich aufhielt, wie häufig man diese pro Woche oder Monat aufsuchte, welche Bevölke-rungsschichten überhaupt Zugang zu Badeanlagen hatten etc.
220 Monika Trümper
Häusern und Sportanlagen sind dagegen nicht zu rekonstruieren, so dass das Bild athenischer Badekultur notwendigfragmentarisch bleibt. Die unabhängigen Bäder sind vor dem 2. Jh. v.Chr. ausnahmslos außerhalb der Stadtmauer,in der Nähe von Stadttoren angelegt worden. Anhand epigraphischer, literarischer und archäologischer Quellen sindinsgesamt vier unabhängige Bäder zu rekonstruieren (Abb. 20).81 Erst im 2. Jh. v.Chr. ist mit der Anlage südwestlichder Agora, die von den Piräus- und Areopag-Straßen flankiert wird, ein unabhängiges griechisches Bad innerhalb derStadtmauer eindeutig fassbar.82 Diese auffällige Platzierung der Bäder dürfte kaum nur auf den Zufall der Überlieferung,sondern eher auf zentrale Regulierung zurückgehen und in lokalspezifischen sozialen Praktiken und Normen begründetgewesen sein. Unabhängige Bäder hatten zumindest in der Alten Komödie eine zweifelhafte Reputation83, und Athenaiosüberliefert sogar ein Verbot, Bäder innerhalb der Stadt anzulegen, das sich allerdings nicht genau datieren und mitletzter Sicherheit auf Athen beziehen lässt.84 Auch wenn die nachweisbaren Bäder nicht alle gleichzeitig genutzt wurden,zeichnet sich doch insgesamt ein relativ dichtes, systematisch angelegtes Netz unabhängiger Bäder ab, die trotz ihrerextra- bzw. suburbanen Lage sicher nicht nur von Reisenden bzw. Fremden, sondern auch von Athenern selber benutztwurden.85 Folglich war der Besuch eines balaneion für die Athener vor dem 2. Jh. v.Chr. physisch wie konzeptionelljedenfalls mit einem Verlassen der Stadt und möglicherweise häufig auch mit weiteren Wegen verbunden.86 Balaneiawerden folglich kaum das Stadtbild Athens geprägt haben und scheinen selbst bei Fremden, die sich der Stadt aufeiner der großen Straßen näherten, keinen besonderen Eindruck hinterlassen zu haben. So werden sie jedenfalls vonHerakleides, der Athen in der ersten Hälfte des 3. Jh. v.Chr. besuchte, mit keinem Wort erwähnt; dies erstaunt umsomehr, als Klaus Fittschen zufolge Herakleides die Stadt als Privatmann bereiste und erlebte und als solcher allein anUnterhaltung und Bildungsgenuss interessiert war.87
81 1) Bad im Kerameikos, beim Thriasischen/Dipylon Tor, errichtet nach 487/486 v.Chr., überbaut in der Mitte des 4. Jh.v.Chr.: literarische und archäologische Belege; Isaios, zitiert bei Harpokration, s.v. Anthemokritos; Trümper 2009, 164 Tabelle1. Die Inschriften Kerameikos III A 19 und A 46 werden mit diesem Bad verbunden, wobei sich der Horosstein A 19 aberwohl eher auf ein Stück Land mit Haus bezog und nicht auf das Bad; vgl. Gebauer 1940, 330, 336 Abb. 16; Finley 1985,28–37, 60–65, 126 Nr. 23.2) Bad beim Piräus Tor, Pouloupoulou-Straße 34, möglicherweise im 5./4. Jh. v.Chr. errichtet und benutzt bis in diehellenistische Zeit: archäologische Befunde; Trümper 2009, 164 Tabelle 1.3) Bad beim Diochares Tor, Kreuzung Voulis- und Apollonos-Straßen; vermutlich um die Mitte oder in der zweiten Hälfte des4. Jh. v.Chr. errichtet: epigraphische und archäologische Belege, die hier erstmals verbunden werden; IG II2 2495 (334/333v.Chr.); Tsouklidou – Penna 1987, 28–31; Walter-Karydi 1998, 76–78; Trümper 2009, 163.4) Bad des Isthmonikos beim Itonischen Tor, vorhanden um 418/417 v.Chr.: epigraphische Belege; IG I3 84.Wo das in IG I3 420 erwähnte balaneion sowie die in den Schriftquellen der klassischen Zeit und der Kaiserzeit erwähntenbalaneia, lagen, ist den Texten nicht zu entnehmen; s. oben, Anm. 19, 46–49.
82 Trümper 2009, 164 Tabelle 2.83 S. etwa Ar. Nu. 1044–1054.84 Ath. 1, 18c: „Only recently, too, have balaneia been introduced, for in the beginning they would not even allow them within
the city limits.“ (Übersetzung: Gulick 1951). Dieses Argument steht am Anfang einer längeren Passage, in der Dekadenzphä-nomene beschrieben werden. Es wird erläutert mit zwei Zitaten attischer Komödiendichter des späten 5. und 4. Jh. v.Chr.,Antiphanes und Hermippus, die sich beide bitterlich über die üblen Nebenwirkungen des Badens mit heißem Wasser bekla-gen. Folglich könnte sich die Bemerkung, dass Bäder einst nicht einmal innerhalb der Stadtmauer erlaubt waren, durchausauf das Athen klassischer Zeit beziehen.
85 Schriftquellen legen eindeutig nahe, dass Athener im 5. und 4. Jh. v.Chr. unabhängige Bäder besuchten; s. Anm. 83–84 unddie (unvollständige) Sammlung von Quellen bei Hoffmann 1999, 214–242. Travlos 1971, 180 schlug vor, dass die unabhängigenBäder „probably for the use of weary travellers arriving in Athens“ außerhalb der Stadtmauer angelegt wurden. Dies mag einGrund – oder praktischer Nebeneffekt – der extra- bzw. suburbanen Lage gewesen sein. Aber da balaneia innerhalb Athensauffälligerweise fehlen, müssen auch die Athener selber die extraurbanen Badeanlagen aufgesucht haben.
86 Dies könnte auch durch Dem. Konon 9–10 suggeriert werden: Nachdem Ariston von Konon und seinen Söhnen angegriffenworden war, wurde er erst nach Hause, aber dann sofort zu einem balaneion gebracht, wo er gebadet und den Ärztenvorgeführt wurde. Er musste die Nacht im Hause des Meidias verbringen, weil er zu schwach war, um den weiten Weg vombalaneion nach Hause getragen zu werden. Obwohl die Häuser von Meidias und Ariston sowie das balaneion innerhalb derStadt nicht näher zu lokalisieren sind, könnte man vorsichtig schließen, dass es kein dichtes Netzwerk von balaneia innerhalbder Stadt gab.
87 Herakleides Kritikos 1, 1–5; Fittschen 1995, 56–57, 59, 69. Arenz 2006, 27, 56–83 bescheinigt dem Herakleides allerdingsumfassendere Interessen, die vor allem Beobachtungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt einschließen; anhand dieser Be-obachtungen datiert Arenz die Periegese des Herakleides in den Zeitraum von 279 bis 267 v.Chr. S. 56 stellt Arenz fernerheraus, dass Herakleides von Eleusis nach Athen gekommen sei und deshalb die Stadt vom Kerameikos her betreten habe,
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 221
4.2 Kerkouane
Im punischen Kerkouane hatten im 4. und 3. Jh. v.Chr. fast alle Häuser (44 der 46 freigelegten) ein eigenes kleinesBadezimmer mit fest eingebauter Sitzbadewanne. M. Fantar hat darüber hinaus zwei Komplexe in der Stadt als un-abhängige öffentlich zugängliche Bäder identifiziert, ohne jedoch zu diskutieren, welches Badeprogramm diese gebotenhätten und wer sie angesichts der flächendeckenden Ausstattung der Privathäuser mit eigenen Badezimmern zu welchenZwecken genutzt haben sollte (Abb. 21). Beide Komplexe waren zwar offenbar mit wasserfesten Boden- und Wandde-korationen ausgestattet, weisen aber keine eindeutig identifizierbaren Badeformen auf. Ferner hatte einer der Komplexekeine Wasserversorgung und der andere keine Abwasserentsorgung. Folglich ist die Identifizierung beider Komplexe alsBadeanlagen stark zu bezweifeln und stattdessen zu folgern, dass man in Kerkouane offenbar ausschließlich individuellund im „privaten“ häuslichen Rahmen badete. Der Besitz eines eigenen Badezimmers war im lokalen Kontext offenbarvon außerordentlicher Bedeutung, denn der stadtweit erreichte häusliche Badestandard ist ohne jeden Vergleich in derantiken Wohnarchitektur.88
4.3 Priene
In Priene sind mehrere Badeanlagen erhalten, die sich derzeit aber nicht alle genau datieren und folglich nur begrenztfür eine Rekonstruktion der Entwicklung der lokalen Badekultur auswerten lassen (Abb. 22). Das untere gymnasion,dessen Errichtung sich über längere Zeit in der zweiten Hälfte des 2. Jh. v.Chr. hinzog, besaß ein typisches loutronmit Kaltwasserbecken für kollektive Waschungen. Auch das obere gymnasion (bzw. palaistra), das vielleicht schon kurznach der Gründung der Stadt in der Mitte des 4. Jh. v.Chr. angelegt wurde und in jedem Fall einmütig früher datiertwird als das untere Pendant, dürfte von Anfang an Badevorrichtungen aufgewiesen haben; diese sind aber aufgrundzahlreicher Umbauten, zu denen die Installation einer Badeanlage mit hypokaustierten Räumen möglicherweise in derfrühen Kaiserzeit zählte, nicht mehr zu rekonstruieren.89 Vor einer Erdbebenkatastrophe um ca. 135 v.Chr. wurde wohlein kleiner Verschlag mit Sitzbadewanne nachträglich in den Hof des Hauses 21a eingebaut; dabei handelt es sich umdas einzige Badezimmer, das bislang in den etwa 70 freigelegten Häusern Prienes identifiziert werden konnte.90 Wanngenau die bereits erwähnte ungewöhnliche unabhängige Badeanlage, die wohl nur ein rundes Schwitzbad umfasste,nachträglich in eine Insula mit Wohnhäusern (28b) eingefügt wurde, ist derzeit nicht sicher zu bestimmen. Sie laggünstig in der Nähe der Agora und des Kaufmarktes und könnte sowohl vor 135 v.Chr. errichtet worden sein, alsdie umliegenden Häuser noch bewohnt waren, als auch nach 135 v.Chr., als zumindest die benachbarten öffentlichenBauten wiederaufgebaut und weitergenutzt wurden.91 Schließlich ist die Existenz von Badeanlagen durch die in das1. Jh. v.Chr. datierten Ehrendekrete für den vielverdienten Bürger Aulus Aemilius Zosimos bezeugt. Als Gymnasiarch
wo es im 3. Jh. v.Chr. möglicherweise kein Bad mehr gab; das Dipylon Bad, s.o. Anm. 81, war jedenfalls zu diesem Zeitpunktschon längst überbaut. Inwieweit Athen repräsentativ für die Badekultur klassischer Zeit ist, kann aufgrund der mangeln-den ausreichenden Vergleichsbasis derzeit nicht sicher bestimmt werden; s. unten, Anm. 109. Obwohl sich zeitgenössischeParallelen für die extraurbane Lage unabhängiger Bäder finden (Piräus, sog. Serangeion Bad; Hephaistia/Lemnos), scheinenmehrere Beispiele klassischer Zeit innerhalb der Stadtmauern angelegt worden zu sein (Ambrakia, evtl. sogar in der Näheoder an der Agora; Kolophon; Korinth; Marseille); dazu ausführlicher Trümper 2013.
88 Fantar 1985, 305–358; Fantar 1998, 53; Trümper 2010, 545, 548 Anm. 82–83.89 Unteres und oberes gymnasion: Rumscheid 1998, 181–185, 202–211, bes. 208; das obere gymnasion wird derzeit von U. Mania
untersucht; da es früher als das untere gymnasion erbaut wurde und zudem kleiner als dieses war, dürften seine Badeanlagenkaum größer und besser ausgestattet gewesen sein als das einfache loutron des unteren gymnasion.
90 Zur Zahl der Häuser: Hoepfner – Schwandner 1986, 170: etwa 70 Häuser, die um die in neueren Grabungen freigelegten zuergänzen sind; Raeck 2003. Zu dem Badezimmer in Haus 21a: Wiegand – Schrader 1904, 292–293; Hoepfner – Schwandner1994, 218; Rumscheid 2010, 123–124; Trümper 2010, 545 Anm. 68. Die Häuser im Westviertel von Priene wurden nacheiner Erdbebenkatastrophe um 135 v.Chr. weitgehend verlassen; Rumscheid 2006, 34–41; dies scheint auch für den östlichenNachbarn von Haus 21a, Haus 21b, zu gelten; Rumscheid 2006, 47. Bemerkenswerterweise weisen auch die nach 135 v.Chr.weitergenutzten und bis in die Kaiserzeit großzügig ausgebauten Häuser wie Haus 33 keine Badezimmer auf; zu Haus 33,Rumscheid 2006, 51–52.
91 Diese Badeanlage ist bislang unpubliziert; erst die geplanten Untersuchungen im Rahmen der Priene-Grabung werden diegrundlegenden Fakten (Größe, Plan, Datierung, Badeprogramm etc.) zur fundierten Bewertung dieser Anlage liefern können;bis dahin, Hoepfner – Schwandner 1986, Abb. 147 (Grundriß mit Notizen); Trümper 2008, 421–426 Tabelle 3; Trümper 2009,169 Tabelle 8.
222 Monika Trümper
spendete Zosimos an Markt- und traditionellen Festtagen parfümiertes Öl im gymnasion und balaneion und Salbe;präzisiert wird nochmals eigens, dass alle für das Fest Angereisten während aller Festtage in den Genuss kostenloserSalbe und kostenlosen Öls im balaneion kamen92; als Stephanephoros stellte er an Festtagen allen Bürgern, paroikoi,katoikoi, Fremden und Römern ein freies loutron zur Verfügung und spendete Öl und Salbe für das balaneion.93
Aus den Dekreten geht nicht eindeutig hervor, ob gymnasion, balaneion und loutron unterschiedliche unabhängigeEinrichtungen oder aber physisch und institutionell verbunden waren, welche Badeformen loutron und balaneion botenbzw. darstellten, und in welcher Eigenschaft Zosimos als Stephanephoros über das loutron verfügen konnte.94 Folglichlassen sich diese Inschriften derzeit nicht sicher mit den archäologischen Befunden verbinden95 und in ihrer Signifikanzfür die lokale Badekultur einschätzen. Die archäologischen Befunde suggerieren, dass Badevergnügen und Badeluxuskein Hauptanliegen der Bewohner Prienes war, zumindest nicht in ihren eigenen Häusern – und dies obwohl ihre Stadtmit einem gut ausgebauten Wasserleitungssystem versorgt war.96 Selbst wenn Priene am Ende des 2. Jh. v.Chr. oderAnfang des 1. Jh. v.Chr. mit den Badevorrichtungen der gymnasia und dem unabhängigen Bad neben der Agoramit drei öffentlich zugänglichen Badeanlagen ausgestattet gewesen wäre, hätte dies kaum entscheidend das Bild undLeben in der Stadt geprägt und die lokale Badekultur maßgeblich verbessert. Ob Zosimos dann im 1. Jh. v.Chr.seinen Mitbürgern mit dem kostenlosen Besuch einer öffentlich zugänglichen Badeanlage ein ganz außergewöhnliches,extravagantes Vergnügen bereitete, oder ob die Priener regelmäßig öffentlich zugängliche Anlagen frequentierten, dienoch nicht (alle) entdeckt worden sind, muss aber vorerst offen bleiben.
4.4 Krokodilopolis (Medinet el-Fayyum)
Krokodilopolis (Medinet el-Fayyum) war seit dem Alten Reich die regionale Hauptstadt des Fayum und war nachAusweis schriftlicher Quellen eine der größten Städte Ägyptens in hellenistischer Zeit und vor allem der Kaiserzeit.Ein Gebiet von ca. 3–4km2 mit Ruinen pharaonischer bis byzantinischer Zeit (Kiman Fares) war noch sichtbar, alsGeorg Schweinfurth 1887 den einzig verfügbaren Plan der Stadt angefertigte. Dieses Gebiet ist heute fast vollständigüberbaut und wurde kaum erforscht.97 Die Stadt war möglicherweise um den zentralen Haupttempel des Gottes Sobekangeordnet, der in der 12. Dynastie errichtet und bis ins 3./4. Jh. n.Chr. mehrfach umgebaut und genutzt wurde, undbesaß offenbar in hellenistischer Zeit und der Kaiserzeit zahlreiche Badeanlagen unterschiedlicher Größe, darunter dasgrößte je freigelegte unabhängige griechische Bad.98 Von diesen Bädern lassen sich heute aber nur noch vier unabhän-gige Badeanlagen einigermaßen sicher lokalisieren, deren Größe und Badeprogramm nicht sicher zu bestimmen sind;
92 I. Priene 112, Zeilen 63–66, 84–91.93 I. Priene 113, Zeilen 73–78.94 Für eine Übersetzung der relevanten Textstellen und intensive Diskussion bin ich Daniel Kah sehr verbunden. Seine vollstän-
dige Bearbeitung und Publikation dieser Dekrete bleibt abzuwarten für eine mögliche Lösung der hier formulierten Probleme.Die genaue Datierung der Dekrete im 1. Jh. v.Chr. ist umstritten. Loutron könnte sich hier nicht auf eine separate Badevor-richtung beziehen, sondern den Vorgang des Badens meinen; dann hätte Zosimos möglicherweise den kostenlosen Eintritt indas balaneion sowie Öl und Salbe für den Besuch desselben gestiftet.
95 Unabhängig von der problematischen Datierung ist aber zu bezweifeln, ob das unabhängige Bad neben der Agora ausgereichthätte, um all die unterschiedlichen Gruppen zu bedienen, denen Zosimos an Festtagen ein kostenloses Bad finanzierte.
96 Fahlbusch 2003; Raeck 2003, 336–342; Fahlbusch 2005. – Häusliches Baden muss an tragbaren Becken u.ä. stattgefundenhaben. Trümper 2010, 548–549.
97 Davoli 1998, 149–159: nach Schweinfurths Plan betrug die Ausdehnung des Ruinengebietes ca. 2,4 × 1,2km; Davoli 1998,150, 156 Abb. 68; Bagnall – Rathbone 2004, 153.
98 Das sog. Sarapeion mit einer Grundfläche von mind. 918m2, 52 Sitzbadewannen und 10 individuellen unbeheizten Liege-badewannen; Trümper 2009, 156–157 Anm. 70, 167 Tabelle 5. P. Davoli teilte mir auf Anfrage freundlicherweise brieflichmit, dass in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Badeanlagen in der Stadt entdeckt wurden, die aber bislang unpubliziertgeblieben sind. Auch den diversen Publikationen ist zu entnehmen, dass in der Stadt im Laufe des 20. Jh. viele Badeanlagenunterschiedlichster Größe gefunden wurden: Lecleant 1967, 191 erwähnt, dass seit 1963 „des installations de bains“ freigelegtworden seien und bildet in Abb. 21–23 möglicherweise zwei verschiedene Anlagen ab, die je zwei tholoi mit Sitzbadewannenhaben. Yacoub 1968 publiziert eine Anlage mit zwei Sitzbadewannen, die ohne nähere Begründung (vermutlich wegen derExistenz von „brick vaults“) als „Roman private bath, attached to one of the houses in the town“ identifiziert wird; es wirderwähnt (55), dass das Department of Antiquities 1964 noch weitere (private?) Bäder entdeckt habe; vgl. Davoli 1998, 152.El-Khachab 1978, 65: Das sog. Sarapeion sei nicht das einzige Bad in der „Agora“ dieser Stadt gewesen, „car il y avaitplusieurs sarapeia dispersés dans cette agora (...) on trouvait des bains à dix, six, trois et même deux sièges dans ce Kom de
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 223
möglicherweise besaßen sie ursprünglich alle zwei tholoi mit Sitzbadewannen und weitere Baderäume und -formen.Eine Skizze, die mit Hilfe von Schweinfurths Plan, einem Luftbild von google.earth und GPS-Daten erstellt wurde,zeigt, dass diese Bäder relativ regelmäßig verteilt im Stadtgebiet lagen und folglich gut als Stadtteilbäder für die um-liegenden Bewohner fungiert haben könnten (Abb. 23).99 Die Verteilung könnte von zentralen Autoritäten und/oderkommerziellen Interessen reguliert worden sein. Die hohe Zahl lokalisierbarer wie nicht lokalisierbarer unabhängigerBäder suggeriert, dass die Stadt weitgehend flächendeckend mit öffentlich zugänglichen Badeanlagen versorgt war unddass kollektives Baden in öffentlich zugänglichen Anlagen sich hoher Akzeptanz und Beliebtheit erfreute. Dies giltähnlich für andere Siedlungen im Fayum wie etwa Euhemeria, Theadelphia und Dionysias, die alle mindestens zweiunabhängige Bäder hatten.100 Für Krokodilopolis wird in der Literatur sogar eine enorme Bandbreite und Abstufungin den Größen und Kapazitäten der Badeanlagen konstatiert (zwei, drei, sechs, zehn, 52 Sitzbadewannen), die eine aus-gefeilte Ausdifferenzierung – möglicherweise gezielt im Hinblick auf unterschiedliche Nutzergruppen – nahe legt, sichaber derzeit weder anhand der Publikationen noch der archäologischen Befunde nachvollziehen lässt. Ferner ist in denerwähnten Fayum-Siedlungen die Wohnarchitektur kaum oder gar nicht bekannt, so dass sich häusliche Badestandardsnicht umfassend bewerten lassen und die urbane Badekultur in ihren unterschiedlichen Kontexten in qualitativer wiequantitativer Hinsicht nicht vollständig zu erfassen ist.101 Erschwerend kommt hinzu, dass die Datierung häuslicher wieunabhängiger Badeanlagen weitgehend unbekannt ist und folglich offen bleiben muss, ob sie alle gleichzeitig genutztwurden oder in einer klaren chronologischen Abfolge markante Veränderungen in den Badesitten reflektieren. In denwenigen heute noch sichtbaren unabhängigen Bädern sind häufig vielfältige Umbauten und vor allem auch Moderni-sierungen erkennbar, die nahe legen, dass diese Anlagen lange genutzt und an veränderte Badestandards angepasstwurden.
4.5 Delos
Der späthellenistische Handelsfreihafen Delos (167/6 bis ca. 69 v.Chr.) bot eine einzigartige Kollektion ungewöhnlicher,experimenteller Badeanlagen (Abb. 24). Zwei Sportanlagen, das sogenannte gymnasion und die palaistra am HeiligenSee, besaßen je eine nicht genau identifizierbare, innovative Schwitzbadvariante. Während das sogenannte gymnasion
Kiman Fares.“ Davoli 1998, 153 erwähnt geomagnetische Untersuchungen in den 1980ern in drei Sektoren, „in corrispondenzadi strutture circolari affioranti, costruite in mattoni cotti e pertinenti ad altrettanti bagni di tipo greco-romano.“
99 Plan von Schweinfurth, abgebildet in Davoli 1998, 156 Abb. 68; es ist allerdings nicht möglich, diesen Plan exakt deckungs-gleich mit dem Luftbild aus google.earth zu bringen, so dass die Verteilungskarte Abb. 23 nur als grober Anhaltspunkt dienenkann. Das Bad Nr. 1 war 2007 noch vollständig sichtbar, Nr. 2 dagegen schon stark zugewachsen. Die Bäder Nr. 3 und 4 war2007 völlig überwachsen, sind aber nach mündlichen Aussagen und alten Fotos, vgl. vorige Anm., ungefähr zu lokalisieren; eskönnte sich bei Nr. 3 um das Bad mit zwei Sitzbadewannen-tholoi und „colored mosaic roundel with a star pattern“ handeln,das Bagnall – Rathbone 2004, 153 erwähnen („in a small fenced area west of the Fire Station“) und das in Davoli 1998, 155Abb. 167 abgebildet ist.1) Bad am Nordwest-Rand der heutigen Stadt (29º 19’ 44.13”N, 30º 49’ 53.63”E); ursprünglich zwei tholoi mit je ca. 18Sitzbadewannen und ein Raum mit individuellen unbeheizten Liegebadewannen; Trümper 2009, 167 Tabelle 5.2) Bad am West-Rand der heutigen Stadt (29º 19’ 31.87”N, 30º 49’ 46.97”E); mindestens eine tholos mit Sitzbadewannen,ein Raum mit individuellen unbeheizten Liegebadwannen; Trümper 2009, 167 Tabelle 5.3) Bad im Zentrum der heutigen Stadt, südöstlich von Nr. 2 (29º 19’ 20.40”N, 30º 49’ 59.56”E); möglicherweise zwei tholoimit Sitzbadewannen, evtl. weitere Badeformen.4) Sog. Sarapeion, im Zentrum der heutigen Stadt, südöstlich von Nr. 2 (29º 19’ 20.40”N, 30º 49’ 48.8”E); zwei tholoi mit je26 Stizbadewannen, drei Räume mit insgesamt 10 individuellen unbeheizten Liegebadewannen; Trümper 2009, 167 Tabelle5.
100 Zum Survey verschiedener Siedlungen mit Badeanlagen im Fayum, Römer 2004; Römer 2013. Zu den Badeprogrammendieser Bäder, s. auch Trümper 2009, 165, 167–168 Tabellen 3, 5: Euhemeria hatte zwei Bäder mit je zwei tholoi mit je 22–25Sitzbadewannen und – in einem Bad – zusätzlich einem Raum mit individuellen unbeheizten Liegebadewannen; Theadelphiahatte ein Bad mit zwei tholoi mit Sitzbadewannen und ein zweites kaum erforschtes, von dem bislang nur eine tholos mitSitzbadewannen und ein Raum mit individuellen unbeheizten Liegebadewannen bekannt ist; Dionysias/Qasr Qarun hatteein kleines Bad mit einer tholos mit nur 10 Sitzbadewannen und ein zweites kaum erforschtes, von dem nur eine tholos mit18 Sitzbadewannen bekannt ist.
101 Zu den in Kiman Fares identifizierten häuslichen Bädern, s. oben, Anm. 98; auch in Theadelphia wurden mehrere kleineBadeanlagen entdeckt, die vermutlich zu Häusern gehörten; s. Römer 2013.
224 Monika Trümper
neuerdings, allerdings nicht einmütig, an das Ende des 2. Jh. v.Chr. datiert wird, ist für die Badevorrichtung inder palaistra am Heiligen See nur sicher festzustellen, dass sie nachträglich und irgendwann nach 167/166 v.Chr.eingebaut wurde.102 Eine Badeanlage im Theaterviertel, die entweder als ein ungewöhnlich kleines unabhängiges Badoder aber – wohl eher – als Teil eines Vereinshauses fungierte, umfasste drei Sitzbadewannen und drei Becken für kalteTauchbäder im Stehen. Das Bad wurde nachträglich, möglicherweise erst kurz vor 88 v.Chr., in ein Haus eingebaut.103
Die den Italikern gehörende Porticus-Anlage („Agora“) im Zentrum der Stadt wurde vermutlich in den 120er Jahrenv.Chr. errichtet und nachträglich (vor 88 v.Chr.) in zwei verschiedenen Phasen mit zwei unterschiedlich großen rundenSchwitzbädern ausgestattet. Der Zugänglichkeit zu dieser Badeanlage konnte quasi doppelt kontrolliert werden, erstensüber verschließbare Türen, mit denen die vollkommen geschlossene Porticus-Anlage versehen war, und zweitens überGitter, die das Bad nochmals innerhalb der Porticus-Anlage abriegelten.104 Kleinere runde Schwitzbäder wurden fernernachträglich in den schon erwähnten Vereinshauskomplex Fournihaus sowie in drei der ca. 89 freigelegten Häusereingebaut; wo dieser Prozess näher zu datieren ist, fand er gegen Ende des 2. Jh. v.Chr. bzw. kurz vor 88 v.Chr. statt.Darüber hinaus erhielt ein Haus nachträglich ein rechteckiges Schwitzbad und hatten sechs Häuser sicher und drei bisfünf weitere möglicherweise ein einfaches Badezimmer mit Sitzbadewanne.105
Dieser Überblick zeigt, dass alle näher datierbaren Badevorrichtungen in den letzten Jahrzehnten des 2. Jh. und imersten Jahrzehnt des 1. Jh. v.Chr. errichtet wurden, als der Freihafen seine größte Blüte erreichte, bevor er 88 v.Chr.von Truppen des Mithridates überfallen wurde. Der mit diesen Jahrzehnten allgemein verbundene Bau- und Bevölke-rungsboom brachte offenbar eine entscheidende Verbesserung der Badekultur mit sich – quantitativ wie qualitativ durchdie Einführung hochmoderner extravaganter Badeformen, die sich in Delos auffällig konzentriert finden. Die allgemeineWasserknappheit der Insel, die nur über Regenwasser versorgt wurde, könnte für die deutliche Bevorzugung von unddas so einzigartige Experimentieren mit Schwitzbadformen verantwortlich gewesen sein. Bemerkenswerterweise ist inden weitflächig freigelegten Vierteln der späthellenistischen Stadt bislang kein großes unabhängiges griechisches Badentdeckt worden, obwohl es ein solches nach Ausweis der Inschriften im 4. Jh. v.Chr. möglicherweise gab.106 Für dieBadevorrichtungen in Sportanlagen, die einer privilegierten Nutzerschaft vorbehalten waren, wird wohl die öffentlicheHand zuständig gewesen sein. Darüber hinaus blieb es aber der Initiative einzelner Hausherren oder Gruppen (Ver-eine, Gemeinschaft der Italiker) überlassen, sich Bademöglichkeiten zu verschaffen, die über den Eigenbedarf hinausdurchaus auch zu kommerziellen Zwecken betrieben worden sein könnten.107 Baden war wichtig im späthellenistischenDelos, aber dies manifestierte sich nicht etwa in einer umfassenden Versorgung der breiten Masse mit reinigendenBadeanlagen, sondern in restriktiv zugänglichen Vorrichtungen für den Badegenuss selektiver privilegierter Gruppen.Interessant ist jedoch, dass die neuen entspannenden Badestandards in allen verschiedenen Kontexten gleichermaßeneingeführt wurden, vermutlich in einem dynamisch-kompetitiven Prozess.
4.6 Verteilung von Badeanlagen in Städten – Resümee
Diese wenigen Fallstudien lassen im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Badeanlagen in Städten kein homogenes Bild,sondern im Gegenteil markante Differenzen erkennen, die wohl von einem komplexen Geflecht topographischer, klima-
102 GD 67 und 76. Die Identifizierung der beiden Badeanlagen ist umstritten, aber beide waren rechteckig und überwölbt undweisen keine der für Sportanlagen üblichen Kaltwasserbadeformen auf; s. ausführlich Trümper 2008, 251–255.
103 GD 121; Trümper 2006b.104 Trümper 2008, 225–250.105 S. oben, Anm. 28, 32; Trümper 1998, 63–66; Trümper 2008, 250–251; Trümper 2010, 546.106 Das balaneion des Aristonos, s. oben, Anm. 43, das allerdings noch nicht gefunden worden ist. Ein solches balaneion wird
deutlich mehr Wasser verbraucht haben als Schwitzbäder, in denen man allenfalls etwas Wasser für abkühlende Güssebrauchte. Zur Berechnung des Wasserverbrauchs in der kleinen unabhängigen Badeanlage im Theaterviertel, die über einegroße Zisterne mit zwei Kammern verfügte, s. Trümper 2006b, 157–161.
107 Die Badesuiten im Haus der Tritonen und im Vereinshauskomplex Fourni könnten partiell extern vermietet worden sein(s. oben, Anm. 28, 32), und die Badeanlage in der sogenannten Agora der Italiker könnte deshalb mit Gittern versehenworden sein, um Eintrittsgelder (durchaus auch von Italikern) zu erheben und sie profitabel oder zumindest kostendeckendzu betreiben. Mit großen unabhängigen Bädern sind diese Anlagen aber keinesfalls vergleichbar, und Eigenbedarf mag inallen Fällen an erster Stelle gestanden haben.
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 225
tischer und urbanistischer Konditionen sowie lokaler sozio-kultureller Normen und Praktiken bestimmt wurden.108 InKerkouane badete man ausschließlich „privat-individuell“, d.h. im häuslichen Kontext, in den Städten des Fayum viel-leicht überwiegend „öffentlich-kollektiv“, d.h. in unabhängigen Bädern. Der möglichen öffentlich-staatlichen Kontrolleund Regulierung im klassischen Athen steht die Dominanz von Partikularinteressen und Eigeninitiative im späthelle-nistischen Handelshafen Delos gegenüber. Die chronologische Entwicklung der Badekultur kann diese Differenzen nurzum Teil erklären: So stieg etwa die Zahl unabhängiger griechischer Bäder in der hellenistischen Zeit rasant an, sodass man annehmen könnte, dieser Bautyp habe zu der in hellenistischer Zeit allgemein maßgeblich verbesserten Stan-dardausstattung der Städte gezählt – aber in großflächig freigelegten Städte wie Priene und Delos fehlt er bislang.109
Bei den häuslichen Badezimmern wurden im klassischen Olynth und im spätklassisch-frühhellenistischen Kerkouane inquantitativer Hinsicht Standards erreicht, die kaum eine der späthellenistischen Städte mit großen luxuriösen Häusernbot.110
5 Zusammenfassung
Das Problem „privat“ versus „öffentlich“ ist für Bäder auf keiner der hier diskutierten Ebenen scharf und klar zufassen. Am deutlichsten heben sich die Badeanlagen in gymnasia der poleis ab, deren Bau von den poleis initiiert oderzumindest kontrolliert wurde, die aber immer nur begrenzt öffentlich zugänglich waren; die athletischen Badeprogrammemit ihrer Dominanz von Kaltwasserbadeformen waren wohl nur deshalb exklusiv, weil sie insgesamt unattraktiv und inanderen Kontexten nicht aus moralisch-ideologischen Gründen erforderlich waren. Im Gegensatz zu den Badeanlagenfür Athleten bildeten wohl die unabhängigen Bäder, die potentiell einer viel breiteren oder zumindest anders definiertenÖffentlichkeit zugänglich waren, in der klassischen und hellenistischen Zeit keine zentrale Bauaufgabe der poleis, wennsie überhaupt je von diesen initiiert oder zumindest in ihrer Verteilung und Platzierung – aus soziokulturellen oderpraktikablen Gründen – reguliert wurden. Unabhängige Bäder mögen zwar zum Stadtbild vieler hellenistischer Städtegehört haben, aber sie wurden dennoch – ganz im Gegensatz zu zahlreichen anderen urbanen Standardbauten – bisin späthellenistisch-spätrepublikanische Zeit wesentlich von Privatpersonen als einträgliche Investitionen errichtet undbetrieben. Vor diesem Hintergrund stellt sich die interessante Frage, wer für die Revolutionierung der Badekultur abdem 3. und vor allem 2. Jh. v.Chr. verantwortlich zeichnete: wurde diese etwa von den Bauherren der Bäder als Reaktionauf veränderte gesellschaftliche Bedürfnisse und Konzepte und zur Steigerung des Profits initiiert; und/oder fördertengroßzügige euergetes wie Uliades in Mylasa und Aulus Aemilius Zosimos in Priene die Modernisierung der lokalenBadekultur? Inwieweit und wo diese unabhängigen Bäder ein Substitut für fehlende häusliche Pendants bildeten,ist derzeit nicht zu ermitteln. Aber sie ermöglichten in der klassischen Zeit exklusiv und in der hellenistischen Zeitvermutlich auch noch weitgehend etwas, das den häuslichen Badeanlagen fehlte: Baden als sozial-geselliges Phänomen,das wesentlich durch die Bereitstellung luxuriöser entspannender Badeformen gesteigert und bereicherte wurde. WelcheBedeutung diese Komponente des Badens in der hellenistischen Zeit erlangte, verdeutlicht gerade die Etablierungkollektiver Badeanlagen in Vereinsbauten und ausgedehnter luxuriöser Badesuiten für den Gastempfang in einigenwenigen Wohnhäusern.
Um abschließend auf das eingangs zitierte Beispiel zurückzukommen: nach der hier vertretenen Interpretationdürfte es sich bei dem balaneion idiotikon, das der verzweifelte Demokles aufsuchte, um eine öffentlich zugängliche, fürkollektive Nutzung konzipierte Badeanlage gehandelt haben, die in Privatbesitz war. Deshalb konnte Demetrios dasBad problemlos, d.h. wohl nach Entrichtung eines Eintrittsgeldes, betreten, musste aber den günstigen und vielleichtseltenen Augenblick abpassen, in dem Demokles allein im Bad war. Da Plutarch diese Begebenheit in der mittlerenKaiserzeit niedergeschrieben hat, ist fraglich, wie genau die dezidierte Verwendung von idiotikon in diesem Kontext
108 Die vielfältigen Gründe für diese Differenzen können hier nicht im Detail diskutiert werden; dafür müssten umfassend derhistorische Hintergrund sowie topographische Gegebenheiten der einzelnen Städte und Regionen untersucht werden; s. dazuTrümper 2009.
109 Von 70 großen unabhängigen Bädern sind nur zehn im 5. und 4. Jh. v.Chr. entstanden; Trümper 2009, 141–142, 164 Tabelle1: zu den dort aufgelisteten Bädern ist auch das Bad beim Diochares Tor in Athen (s. oben, Anm. 81) und das jüngst ins4. Jh. v.Chr. datierte Bad in Hephaistia/Lemnos zu rechnen; Greco – Vitti 2013. Möglicherweise sind auch alle Athletenbäder(s. oben Anm. 56) ins 4 Jh. v.Chr. zu datieren; s. Trümper 2013, 40–43.
110 Mit Ausnahme von Monte Iato; s. dazu ausführlich Trümper 2010; Russenberger 2013.
226 Monika Trümper
zu verstehen ist, ob dies wirklich die sozialhistorische Realität im Athen des späten 4. Jh. v.Chr. reflektiert oder nichteher von Plutarchs eigenem kulturellen Hintergrund, d.h. der zeitgenössischen kaiserzeitlichen Badekultur, geprägtist.111 Das balaneion scheint jedenfalls in diesem Kontext weniger deshalb so deutlich von gymnasion und palaistraabgesetzt zu werden, um unterschiedlichen Besitzstand – privaten versus staatlichen Besitz – oder eine signifikantunterschiedliche Zugänglichkeit zu indizieren; alle drei Bauten waren jedenfalls Demokles wie Demetrios gleichermaßenzugänglich, wenn auch möglicherweise unter verschiedenen Bedingungen. Der Unterschied reflektiert vielmehr implizitsoziale Normen und Werte der Athener: als pais anebos sollte Demokles gymnasion und palaistra frequentieren, um zutrainieren und sich anschließend mit kaltem Wasser zu waschen – und potentielle Liebhaber konnten erwarten, ihn dortanzutreffen und ungehindert beobachten zu können. Stattdessen suchte der verfolgte Demokles ein balaneion mit einerWarmwasserbadeform auf, das er wegen seines verweichlichenden und demoralisierenden Charakters eigentlich hättestrengstens meiden sollen; aber er hoffte offenbar, durch die Wahl des für die athenische Jugend untypischen bzw. sogarverwerflichen Ortes seinen Verfolgern zu entkommen. Das balaneion war aber in doppeltem Sinne Demokles’ Verderben,denn in der Badevorrichtung eines gymnasion oder einer palaistra hätte er jedenfalls vor der frühen Kaiserzeit keinenSelbstmord durch den Sprung in einen Kessel mit kochendem Wasser begehen können.
111 Zum breiteren Spektrum an Bauherren und Besitzern von Bädern in der Kaiserzeit, das terminologische Differenzierungenerforderte, s. oben, Anm. 11. Plutarch könnte auch davon beeinflusst gewesen sein, dass in der Kaiserzeit die Bäder inöffentlichem Besitz häufig größer als die in privatem Besitz waren und große Peristylanlagen besaßen, die noch sportlichesTraining ermöglichten.
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 227
Abb. 1: Olynth, Haus A2: Plan
Abb. 2: Monte Iato Peristylhaus 1: rekonstruierter Plan
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 229
Abb. 4: Delos, Fournihaus: Plan (Badesuite grau markiert)
Abb. 5: Eretria, gymnasion: Phasenplan
230 Monika Trümper
Abb. 6: Assos, gymnasion: rekonstruierter Plan
Abb. 7: Krokodilopolis, „Sarapeion“ Bad: rekonstruierter Plan
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 231
Abb. 8: Nemea, Bad: rekonstruierter Plan und Rekonstruktion des Westraumes
Abb. 9: Aidone/Morgantina, Museum: Sitzbadewanne aus Terrakotta
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 233
Abb. 11: Nemea, Bad: Kaltwassertauchbecken, von Westen
Abb. 12: Isthmia, Poseidonheiligtum, griechisches Schwimmbad: rekonstruierter Plan
234 Monika Trümper
Abb. 13: Athribis, Südost-Bad: Raum mit individuellen unbeheizten Liegebadewannen, von Osten
Abb. 14: Monte Iato, Peristylhaus 1: Baderaum 21 mit individueller beheizter Liegebadewanne, von Süden
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 235
(a) Pompeji, Republikanische Thermen: Re-konstruktion der kollektiven beheiztenTauchwanne im Männertrakt
(b) Syrakus, Bad nördlich der Latomia delParadiso: kollektive beheizte Tauchwan-ne, von Süden
Abb. 15
Abb. 16: Solunt, Casa a vano circolare: rekonstruierter Plan und Ansicht des runden Schwitzbades p von Norden
236 Monika Trümper
Abb. 17: Gortys, Asklepiosheiligtum, Bad: rekonstruierter Plan der Gesamtanlage und Steinplan des Hypokausts des rundenSchwitzbades E
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 237
Abb. 18: Eretria, gymnasion: rundes Schwitzbad G, von Norden
Abb. 19: Delos, „Agora der Italiker“: rundes Schwitzbad 31, von Norden
238 Monika Trümper
Abb. 20: Athen: Stadtplan mit Lage der unabhängigen Bäder vom 5. bis 1. Jh. v.Chr.
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 239
Abb. 21: Kerkouane: Plan mit Markierung der vermeintlichen unabhängigen Bäder
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 241
Abb. 23: Krokodilopolis: schematischer Plan mit Lage der heute noch sichtbaren unabhängigen Bäder
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 243
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Olynth, Haus A2: Plan; Robinson – Graham 1938, Taf. 89Abb. 2: Monte Iato Peristylhaus 1: rekonstruierter Plan; Dalcher 1994, Beil.3Abb. 3: Delos, Haus der Tritonen: Plan; M. Trümper nach Bruneau 1970, Taf. AAbb. 4: Delos, Fournihaus: schematischer Plan; M. Trümper nach H. Wurmser – S. Zugmeyer, BCH 134, 2010,
586 Abb. 1Abb. 5: Eretria, gymnasion: Phasenplan; Mango 2003, 56 Abb. 58Abb. 6: Assos, gymnasion: rekonstruierter Plan; Clarke – Bacon – Koldewey 1902, S. 171, 183Abb. 7: Krokodilopolis, „Sarapeion“ Bad: rekonstruierter Plan; M. Trümper nach El-Khachab 1978 ohne Bez.Abb. 8: Nemea, Bad: rekonstruierter Plan und Rekonstruktion des Westraumes, Miller 1992, Beilage Abb. 260;
233 Abb. 331Abb. 9: Aidone/Morgantina, Museum: Sitzbadewanne aus Terrakotta; Foto M. TrümperAbb. 10: Priene, unteres gymnasion: loutron mit Kaltwasserbecken, von Süden; a) Foto M. Trümper; b) Rumscheid
1998, 211, 183Abb. 11: Nemea, Bad: Kaltwassertauchbecken, von Westen; Miller 1992, 203 Abb. 284Abb. 12: Isthmia, Poseidonheiligtum, griechisches Schwimmbad: rekonstruierter Plan; Gregory 1995, 304 Abb. 11Abb. 13: Athribis, Südost-Bad: Raum mit individuellen unbeheizten Liegebadewannen, von Osten; Foto M. Trüm-
perAbb. 14: Monte Iato, Peristylhaus 1: Baderaum 21 mit individueller beheizter Liegebadewanne, von Süden; Foto
M. TrümperAbb. 15: (a) Pompeji, Republikanische Thermen: Rekonstruktion der kollektiven beheizten Tauchwanne im Män-
nertrakt; Maiuri 1950, 123 Abb. 5(b) Syrakus, Bad nördlich der Latomia del Paradiso: kollektive beheizte Tauchwanne, von Süden; Foto M.Trümper
Abb. 16: Solunt, Casa a vano circolare: rekonstruierter Plan und Ansicht des runden Schwitzbades p von Norden;Cutroni Tusa et al. 1994, 53 Taf. 12; Foto M. Trümper
Abb. 17: Gortys, Asklepiosheiligtum, Bad: rekonstruierter Plan der Gesamtanlage und Steinplan des Hypokaustsdes runden Schwitzbades E; Ginouvès 1959, 165 Abb. 187; 72, Abb. 93
Abb. 18: Eretria, gymnasion: rundes Schwitzbad G, von Norden; Mango 2003, 37 Abb. 25Abb. 19: Delos, „Agora der Italiker“: rundes Schwitzbad 31, von Norden; Foto M. TrümperAbb. 20: Athen: Stadtplan mit Lage der unabhängigen Bäder vom 5. bis 1. Jh. v.Chr.; M. Trümper nach Travlos
1971, 169 Abb. 219Abb. 21: Kerkouane: Plan mit Markierung der vermeintlichen unabhängigen Bäder; M. Trümper nach Fantar 1998,
114–115Abb. 22: Priene: Plan mit Lage der verschiedenen Badevorrichtungen; M. Trümper nach Rumscheid 1998, Abb. 30Abb. 23: Krokodilopolis: schematischer Plan mit Lage der heute noch sichtbaren unabhängigen Bäder; M. Trümper
nach Davoli 1998, 156 Abb. 68Abb. 24: Delos: Plan mit Lage der verschiedenen Badevorrichtungen; M. Trümper nach Trümper 2008, Abb. 1
Literaturverzeichnis
Aneziri 2003 S. Aneziri, Die Vereine der dionysischen Techniten im Kontext der hellenistischenGesellschaft. Untersuchungen zur Geschichte, Organisation und Wirkung der hel-lenistischen Technitenvereine. Historia Einzelschriften 163. Stuttgart 2003.
Arenz 2006 A. Arenz, Herakleides Kritikos „Über die Städte in Hellas“: eine Periegese Grie-chenlands am Vorabend des Chremonideischen Krieges. München 2006.
244 Monika Trümper
Aslanides – Pinatse 1999 K. Aslanides – Chr. Pinatse, „Ta ellenika loutra“, in: V.K. Lambrinoudakes(Hrsg.), To Asklepieio tes Epidaurou. He hedra tou theou giatrou tes archaiotetas.Periphereia Peloponnesou 1999, 51–52.
Auberger 1996 J. Auberger, „Quant la nage devint natation ...“, Latomus 55, 1996, 48–62.Ausbüttel 1982 F.M. Ausbüttel, Untersuchungen zu den Vereinen im Westen des Römischen Rei-
ches. Frankfurter Althistorische Studien 11. Regensburg 1982.Bagnall – Rathbone 2004 R. Bagnall – D. Rathbone, Egypt from Alexander to the early Christians: an
archaeological and historical guide. Los Angeles 2004.Bollmann 1998 B. Bollmann, Römische Vereinshäuser. Untersuchungen zu den Scholae der römi-
schen Berufs-, Kult- und Augstalen-Kollegien in Italien. Mainz 1998.Boraik 2009 M. Boraik, „Ptolemaic baths in front of the Temple of Karnak. A brief preliminary
report – November 2007“, in: M.-Fr. Boussac – Th. Fournet – B. Redon (Hrsg.), Lebain collectif en Égypte. Institut français d’archéologie orientale. Études urbaines7. Kairo 2009, 73–86.
Borlenghi 2011 A. Borlenghi, Il Campus. Organizzazione e funzione di uno spazio pubblico in etàromana. Le testimonianze in Italia e nelle Province occidentali. Rom 2011.
Bruneau 1970 Ph. Bruneau et al., L’îlot de la Maison des comédiens. Exploration archéologiquede Délos XXVII. Paris 1970.
Bruun 1999 Chr. Bruun, „Ownership of baths in Rome and the evidence from lead pipe in-stallations“, in: J. DeLaine – D.E. Johnston (Hrsg.), Roman baths and bathing.Proceedings of the First International Conference on Roman Baths held at Bath,England, 30. March – 4. April 1992. JRA Suppl. 37. Portsmouth 1999, 67–74.
Burford 1969 A. Burford, The Greek temple builders at Epidauros. Toronto 1969.Chankowski 2008 V. Chankowski, Athènes et Délos á l’époque classique. BEFAR 331. Athen 2008.Chrysostomou 1988 P. Chrysostomou, „Loutra sto anaktoro tes Pellas“, AErgoMak 2, 1988, 113–126.Clarke – Bacon – Koldewey 1902 J.Th. Clarke – F.H. Bacon – R. Koldewey, Investigations at Assos. Drawings and
photographs of the buildings and objects discovered during the excavations of 1881– 1882 – 1883. Cambridge/Mass. 1902.
Cutroni Tusa et al. 1994 A. Cutroni Tusa – A. Italia – D. Lima – V. Tusa, Solunto. Rom 1994.Dalcher 1994 K. Dalcher, Das Peristylhaus 1 von Iaitas. Studia Ietina VI. Zürich 1994.Davoli 1998 P. Davoli, L’archeologia urbana nel Fayyum di età ellenistica e romana. Neapel
1998.De Haan 1992 N. De Haan, „Privatbäder in Pompeji und Herkulaneum und die städtische Wasser-
leitung“, in: Geschichte der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus im mediterranenRaum. Vorträge und schriftliche Beiträge zum 8. Internationalen Symposium zurGeschichte des Wasserbaus. Mérida, 12.–20. Oktober 1991. Braunschweig 1992,423–445.
De Haan 1993 N. De Haan, „Dekoration und Funktion in den Privatbädern von Pompeji undHerculaneum“, in: E. Moormann (Hrsg.), Functional and spatial analysis of wallpainting. Proceedings of the fifth international congress on ancient wall painting,Amsterdam 8.–12. September 1992. BABesch Suppl. 3. Leuven 1993, 34–37.
De Haan 1997 N. De Haan, „Nam nihil melius esse quam sine turba lavari. Privatbäder in denVesuvstädten“, MededRom 56, 1997, 205–226.
De Haan 2001 N. De Haan, „Si aquae copia patiatur. Pompeian private baths and the use ofwater“, in: A.O. Koloski-Ostrow (Hrsg.), Water use and hydraulics in the Romancity. Dubuque/Iowa 2001, 41–49.
De Haan 2007 N. De Haan, „Luxus Wasser. Privatbäder in der Vesuvregion“, in: R. Aßkamp, M.Brouwer, J. Christiansen, H. Kenzler, and I. Warmser (Hrsg.), Luxus und Deka-denz. Römisches Leben am Golf von Neapel. Mainz 2007, 122–137.
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 245
De Haan 2010a N. De Haan, „Private luxury and public prestige. Roman private baths“, in: O.Hekster – St. Mols (Hrsg.), Cultural messages in the Graeco-Roman world. BA-Besch Suppl. 15. Leuven 2010, 67–78.
De Haan 2010b N. De Haan, Römische Privatbäder. Entwicklung, Verbreitung, Struktur und so-zialer Status. Frankfurt 2010.
DeLaine 1999 J. DeLaine, „Benefactions and urban renewal: bath buildings in Roman Italy“, in:J. DeLaine – D.E. Johnston (Hrsg.), Roman baths and bathing. Proceedings of theFirst International Conference on Roman Baths held at Bath, England, 30. March– 4. April 1992. JRA Suppl. 37. Portsmouth 1999, 67–74.
Delorme 1960 J. Delorme,Gymnasion. Étude sur les monuments consacrés à l’éducation en Grèce(des origines à l’Empire romain). BEFAR 196. Paris 1960.
Dickmann 1999 J.-A. Dickmann, domus frequentata. Anspruchsvolles Wohnen im pompejanischenStadthaus. Studien zur antiken Stadt 4. München 1999.
El-Khashab 1978 Abd El-Mohsen El-Khashab, Ta Sarapeia à Sakha et au Fayum ou les bains théra-peutiques. ASAE Suppl. 25. Kairo 1978.
Fagan 1999 G.G. Fagan, Bathing in public in the Roman world. Michigan 1999.Fahlbusch 2003 H. Fahlbusch, „Wasserwirtschaftliche Anlagen des antiken Priene. Befundlage auf-
grund der Literatur und Ergebnisse der Kampagne 2001“, in: Chr. Ohlig (Hrsg.),Wasserhistorische Forschungen. Schwerpunkt Antike. Siegburg 2003, 55–80.
Fahlbusch 2005 H. Fahlbusch, „Wasserwirtschaftliche Anlagen des antiken Priene“, in: St. Mols –E.M. Moormann (Hrsg.), Omni Pede Stare. Saggi architettonici e circumvesuvianiin memoriam Jos de Waele. Neapel 2005, 65–84.
Fantar 1985 M.H. Fantar, Kerkouane. Architecture domestique. Tunis 1985.Fantar 1998 M.H. Fantar, Kerkouane. A Punic town in the Berber region of Tamezrat. Tunis
1998.Finley 1985 M.I. Finley, Studies in land and credit in ancient Athens, 500–200 B.C. The horos
inscriptions. Reprinted edition with a new introduction by Paul Millett. NewBrunswick – Oxford 1985.
Fittschen 1995 K. Fittschen, „Eine Stadt für Schaulustige und Müßiggänger“, in: M. Wörrle – P.Zanker (Hrsg.), Stadtbild und Bürgerbild im Hellenismus. Kolloquium, München,24. bis 26. Juni 1993. München 1995, 55–77.
Fournet – Redon 2007 Th. Fournet – B. Redon, „Tell el-Herr, Taposiris Magna et les bains de l’Égyptegréco-romaine“, in D. Valbelle (Hrsg.), Tell el-Herr. Les niveaux hellénistiques etdu Haut-Empire. Paris 2007, 116–127.
Fournet – Redon 2009 Th. Fournet – B. Redon, „Les bains souterrains de Taposiris Magna et le bainde tradition hellénique en Égypte“, in: M.-Fr. Boussac – Th. Fournet – B. Redon(Hrsg.), Le bain collectif en Égypte. Institut français d’archéologie orientale. Étudesurbaines 7. Kairo 2009, 113–137.
Gallo 2009 P. Gallo, „Un bain à la grecque dans l’île de Nelson“, in: M.-Fr. Boussac – Th. Four-net – B. Redon (Hrsg.), Le bain collectif en Égypte. Institut français d’archéologieorientale. Études urbaines 7. Kairo 2009, 139–179.
GD Ph. Bruneau – J. Ducat, Guide de Délos. Quatrième édition refondue et miseà jour avec le concours de M. Brunet, A. Farnoux, J.-Ch. Moretti. Athen 2005.Zitiert wird die Nummer der Monumente, nicht die Seitenzahl.
Gebauer 1940 K. Gebauer, „Ausgrabungen im Kerameikos“, AA 1940, 308–362.Ginouvès 1959 R. Ginouvès, L’établissement thermal de Gortys d’Arcadie. Études Peloponné-
siennes II. Paris 1959.Ginouvès 1962 R. Ginouvès, Balaneutike. Recherches sur le bain dans l’antiquité grecque. BEFAR
200. Paris 1962.
246 Monika Trümper
Greco – Vitti 2013 E. Greco – P. Vitti, „The bath complex in Hephaistia (Lemnos)“, in: S. Lucore – M.Trümper (Hrsg.), Greek baths and bathing culture. New discoveries and approaches.Babesch Suppl. 23. Leuven 2013, 211–228.
Gregory 1995 T. Gregory, „The Roman bath at Isthmia: preliminary report 1972–1992“, Hesperia64, 1995, 279–313.
Grossmann 2009 P. Grossmann, „Badeeinrichtungen in ägyptischen frühchristlichen Klöstern“, in:M.-Fr. Boussac – Th. Fournet – B. Redon (Hrsg.), Le bain collectif en Égypte.Institut français d’archéologie orientale. Études urbaines 7. Kairo 2009, 287–295.
Gulick 1951 C.B. Gulick, Athenaeus. The Deipnosophists. Cambridge/Mass. 1951.Handy 2008 M. Handy, „Schwimmen bei den Römern“, in: P. Mauritsch et al. (Hrsg.), Anti-
ke Lebenswelten. Konstanz – Wandel – Wirkungsmacht. Festschrift für IngomarWeiler zum 70. Geburtstag. Wiesbaden 2008, 101–111.
Hellmann 1992 M.-Chr. Hellmann, Recherches sur le vocabulaire de l’architecture grecque d’aprèsles inscriptions de Délos. BEFAR 278. Athen 1992.
Hoepfner – Schwandner 1986 W. Hoepfner – E.-L. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland.Wohnen in der klassischen Polis I. München 1986.
Hoepfner – Schwandner 1994 W. Hoepfner – E.-L. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland.Wohnen in der klassischen Polis I. 2. Aufl. München 1994.
Hoffmann 1999 M. Hoffmann, Griechische Bäder . München 1999.Japp 2000 S. Japp, Die Baupolitik Herodes des Großen. Die Bedeutung der Architektur für die
Herrschaftslegitimation eines römischen Klientelkönigs. Internationale Archäolo-gie 64. Rahden/Westf. 2000.
Kerameikos III W. Peek, Inschriften, Ostraka, Fluchtafeln. Kerameikos III . Berlin 1941.Kobes 2004 J. Kobes, „Teilnahmeklauseln beim Zugang zum Gymnasion“, in: D. Kah – P.
Scholz (Hrsg.), Das hellenistische Gymnasion. Berlin 2004, 237–245.Kunze – Schleif 1944 E. Kunze – H. Schleif, IV. Bericht über die Ausgrabungen in Olympia. Berlin 1944.Ladstätter 2003 G. Ladstätter, „Grabung Aigeira“, ÖJh 72, 2003, 330–332.Ladstätter 2004 G. Ladstätter, „Grabung Aigeira“, ÖJh 73, 2004, 388–390.Ladstätter 2005 G. Ladstätter, „Grabung Aigeira“, ÖJh 74, 2005, 367–368.Lecleant 1967 J. Leclant, „Fouilles et travaux en Égypte et au Soudan, 1965–1966“, Orientalia
36, 1967, 191–227.Lucore 2003–2004 S. Lucore, „The Hellenistic Baths at Morgantina“, Kodai. Journal of ancient hi-
story 13–14, 2003–2004, 209–215.Lucore 2009 S. Lucore, „Archimedes, The North Baths at Morgantina and early developments
in vaulted construction“, in: C. Kosso – A. Scott (Hrsg.), The nature and functi-on of water. Baths, bathing and hygiene from Antiquity through the Renaissance.Leiden 2009, 43–59.
Lucore – Trümper 2013 S. Lucore – M. Trümper (Hrsg.), Greek baths and bathing culture. New discoveriesand approaches. Babesch Suppl. 23. Leuven 2013.
Łukaszewicz 1986 A. Łukaszewicz, Les édifices publics dans les villes de l’Égypte romaine. Warschau1986.
Maiuri 1950 A. Maiuri, „Pompei. Scoperta di un edificio termale nella Regio VIII, Insula 5,nr. 36“, NSc 1950, 116–136.
Manderscheid 2004 H. Manderscheid, Ancient baths and bathing: a bibliography for the years 1988–2001 . JRA Suppl. 55. Portsmouth 2004.
Mango 2003 E. Mango, Das Gymnasion von Eretria. Eretria XIII. Gollion 2003.Maniscalco 1995 F. Maniscalco, Il nuoto nel mondo greco-romano. Neapel 1995.Martini 1984 W. Martini, Das Gymnasium von Samos. Samos 16. Bonn 1984.Melfi 2007 M. Melfi, I santuari di Asclepio in Grecia I . Studia archaeologica 157. Rom 2007.
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 247
Meyer 1994 B. Meyer, „L’eau et les bains publics dans l’Égypte ptolémaïque, romaine et by-zantine“, in B. Menu (Hrsg.), Les problèmes institutionnels de l’eau en Égypteancienne et dans l’antiquité méditerranéenne. Actes du 2ème colloque AIDEA1992. Kairo 1994, 273–279.
Miedico 2005 C. Miedico, „Il nuoto nel mondo greco“, in : B.M. Giannattasio – C. Canepa –L. Grasso – E. Piccardi (Hrsg.), Aequora, jam, mare ... Mare, uomini e merci nelMediterraneo antico. Atti del Convegno Internazionale Genova, 9.–10. dicembre2004. Borgo S. Lorenzo 2005, 292–295.
Miller 1992 St.G. Miller, „The bath“, in: D. Birge – L. H. Kraznak – St.G. Miller (Hrsg.),Excavations at Nemea. Topographical and architectural studies: the sacred square,the xenon, and the bath. Nemea I. Berkeley 1992, 188–261.
Netzer 1999 E. Netzer, Die Paläste der Hasmonäer und Herodes des Großen. Mainz 1999.Nielsen 1990 I. Nielsen, Thermae et balnea. The architecture and cultural history of Roman
public baths. Aarhus 1990.Nielsen 1994 I. Nielsen, Hellenistic palaces. Tradition and renewal. Aarhus 1994.Palauí – Vivó 1993 L. Palauí – D. Vivó, „Termes de la ‘Basilica’ d’Empúries“, in: R. Mar Medina – J.
López – L. Piñol (Hrsg.), Utilització de l’aigua a les citutats romanes. Tarragona1993, 103–110.
Paton – Hicks 1891/1990 W.R. Paton – E. L. Hicks, The inscriptions of Cos. Oxford 1891, NachdruckHildesheim 1990.
Perrin 1959 B. Perrin, Plutarch’s Lives. Cambridge/Mass. 1959.Poland 1909 F. Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens. Leipzig 1909.Préaux 1947 C. Préaux, Les Grecs en Égypte d’après les archives de Zénon. Brüssel 1947.Raeck 2003 W. Raeck, „Priene. Neue Forschungen an einem alten Grabungsort“, IstMitt 53,
2003, 313–423.Riethmüller 2005 J.W. Riethmüller, Asklepios. Heiligtümer und Kulte. Studien zu antiken Heiligtü-
mern 2. Heidelberg 2005.Robinson – Graham 1938 D.M. Robinson – J.W. Graham, The Hellenic house. Olynthus VIII. Baltimore
1938.Romano 2005 D.G. Romano, „A new topographical and architectural survey of the sanctuary of
Zeus at Mount Lykaion“, in: E. Østby (Hrsg.), Ancient Arcadia. Papers from theThird International Seminar on ancient Arcadia held at the Norwegian Instituteat Athens, 7.–10. May 2002. Athen 2005, 381–396.
Römer 2004 C. Römer, „Philoteris in the Themistou Meris. Report on the archaeological surveycarried out as part of the Fayum survey project“, ZPE 147, 2004, 281–305.
Römer 2013 C. Römer, „The Greek Baths in the Fayum at Euhemeria and Theadelphia“, in:S. Lucore – M. Trümper (Hrsg.), Greek baths and bathing culture. New discoveriesand approaches. Babesch Suppl. 23. Leuven 2013, 229–238.
Roux 1961 G. Roux, L’architecture de l’Argolide aux IVe et IIIe siècles avant J.-C., BEFAR1999. Paris 1961.
Rumscheid 1998 F. Rumscheid, Priene. Führer durch das „Pompeji Kleinasiens“. Istanbul 1998.Rumscheid 2006 F. Rumscheid, Die figürlichen Terrakotten von Priene. Fundkontexte, Ikonographie
und Funktion in Wohnhäusern und Heiligtümern im Licht antiker Parallelbefunde.Priene 1. Wiesbaden 2006.
Rumscheid 2010 F. Rumscheid, „Fragen zur bürgerlich-hellenistischen Wohnkultur in Kleinasien“,in: S. Ladstätter – V. Scheibelreiter (Hrsg.), Städtisches Wohnen im östlichenMittelmeer. 4. Jh. v.Chr. – 1. Jh. n.Chr. Akten des Internationalen Kolloquiumsvom 24.–27. Oktober 2007 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.Wien 2010, 119–143.
248 Monika Trümper
Russenberger 2013 Ch. Russenberger, „A new bathtub with hypocaust in Peristyle House 2 at MonteIato“, in: S. Lucore – M. Trümper (Hrsg.), Greek baths and bathing culture. Newdiscoveries and approaches. Babesch Suppl. 23. Leuven 2013, 189–199.
Schörner 2000 G. Schörner, „Stiftungen von Badeanlagen im hellenistischen und kaiserzeitlichenGriechenland“, in: Les civilisations du bassin mediterranéen. Hommages à J. Sliwa.Krakau 2000, 307–315.
Torelli 1999 M. Torelli, Paestum Romana. Salerno 1999.Traill 1994–2010 J.S. Traill, Persons of ancient Athens, Bde. 1–19. Toronto 1994–2010.Travlos 1971 J. Travlos, Pictorial dictionary of ancient Athens. New York 1971.Trümper 1998 M. Trümper, Wohnen in Delos. Eine baugeschichtliche Untersuchung zum Wan-
del der Wohnkultur in hellenistischer Zeit. Internationale Archäologie 46. Rah-den/Westf. 1998.
Trümper 2006a M. Trümper, „Negotiating religious and ethnic identity: The case of clubhousesin Late Hellenistic Delos“, in: I. Nielsen (Hrsg.), Zwischen Kult und Gesellschaft.Kosmopolitische Zentren des antiken Mittelmeerraums als Aktionsraum von Kult-vereinen und Religionsgemeinschaften. Hephaistos 24, 2006, 113–150.
Trümper 2006b M. Trümper, „Baden im späthellenistischen Delos I: Die öffentliche Badeanlage imQuartier du théâtre“, BCH 130, 2006, 1–87.
Trümper 2008 M. Trümper, Die ‚Agora des Italiens‘ in Delos. Baugeschichte, Architektur, Aus-stattung und Funktion einer späthellenistischen Porticus-Anlage. InternationaleArchäologie 104. Rahden/Westf. 2008.
Trümper 2009 M. Trümper, „Complex public bath buildings of the Hellenistic period. A case-study in regional differences“, in: M.-Fr. Boussac – Th. Fournet – B. Redon (Hrsg.),Le bain collectif en Égypte. Institut français d’archéologie orientale. Études ur-baines 7. Kairo 2009, 139–179.
Trümper 2010 M. Trümper, „Bathing culture in Hellenistic domestic architecture“, in: S. Lad-stätter – V. Scheibelreiter (Hrsg.), Städtisches Wohnen im östlichen Mittelmeer.4. Jh. v.Chr. – 1. Jh. n.Chr. Akten des Internationalen Kolloquiums vom 24.–27.Oktober 2007 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien 2010,529–572.
Trümper 2011 M. Trümper, „Where the Non-Delians met in Delos: The meeting-places of foreignassociations and ethnic communities in Late Hellenistic Delos“, in: O. van Nijf– R. Alston (Hrsg.), Political culture in the Greek city after the Classical age.Groningen-Royal Holloway Studies on the Greek City after the Classical Age.Leuven 2011, 49–100.
Trümper 2012 M. Trümper, „Gender differentiation in Greek public baths“, in: R. Keiner –W. Letzner (Hrsg.), SPA. Sanitas Per Aquam. Tagungsband des InternationalenFrontinus-Symposiums zur Technik- und Kulturgeschichte der antiken Thermen,Aachen, 18.-22. März 2009. Babesch Suppl. 21. Leuven 2012, 37-45.
Trümper im Druck M. Trümper, „Modernization and change of function of Hellenistic gymnasia in theImperial period: Case-studies Pergamon, Miletus, and Priene“, in: W. Habermann– P. Scholz – D. Wiegandt (Hrsg.), Das kaiserzeitliche Gymnasion. Wissenskulturund gesellschaftlicher Wandel Bd. 34. Berlin, im Druck.
Trümper 2013 M. Trümper, „Urban context of Greek public baths“, in: S. Lucore – M. Trümper(Hrsg.), Greek baths and bathing culture. New discoveries and approaches. BabeschSuppl. 23. Leuven 2013, 33–72.
Tsiolis 2001 V. Tsiolis, „Las termas de Fregellae. Arquitectura, tecnología y cultura balnear enel Lacio durante los siglos III y II a.C.“, CPAM 27, 2001, 85–114.
„Privat“ versus „öffentlich“ in hellenistischen Bädern 249
Tsiolis 2006 V. Tsiolis, „Fregellae: Il complesso termale e le origini degli edifici balneari ur-bani nel mondo romano“, in: M. Osanna – M. Torelli (Hrsg.), Sicilia ellenistica,consuetudo italica. Alle origini dell’architettura ellenistica d’occidente. Spoleto,Complesso monumentale di S. Nicolo 5–7 Novembre 2004. Rom 2006, 243–255.
Tsiolis 2008a V. Tsiolis, „Modelli di convivenza urbana. Fregellae e la questione dell’introduzionedelle pratiche termali nel Lazio meridionale“, in: C. Corsi – E. Polito (Hrsg.), Dallesorgenti alla foce. Il bacino del Liri-Garigliano nell’antichità. Culture, contatti,scambi. Atti del convegno, Frosinone – Formia, 10–12 novembre. Rom 2008, 133–143.
Tsiolis 2008b V. Tsiolis, „El modelo balnear republicano entre Italia e Hispania“, in: J. Uroz –J.M. Noquera – F. Coarelli (Hrsg.), Iberia e Italia. Modelos romanos de integraciónterritorial. Murcia 2008, 285–306.
Tsiolis 2013 V. Tsiolis, „The baths at Fregellae and the transition from balaneion to balne-um“, in: S. Lucore – M. Trümper (Hrsg.), Greek baths and bathing culture. Newdiscoveries and approaches. Babesch Suppl. 23. Leuven 2013, 89-111.
Tsouklidou – Penna 1987 D. Tsouklidou – V. Penna, „Odos Boules 31–33 kai Apollonos“, ADelt 34, 1979(1987), 28–31.
Veuve 1987 S. Veuve, Le Gymnase. Fouilles d’Aï Khanoum VI. Paris 1987.Volpicella 2006–2007 D. Volpicella, „Cuma. Le terme centrali. Un preliminare inquadramento crono-
logico delle fasi edilizie“, Annali di archeologia e storia antica 13–14, 2006–2007,197–220.
Wacker 1996 Chr. Wacker, Das Gymnasion in Olympia. Geschichte und Funktion. Würzburg1996.
Walbank 1983 M.B. Walbank, „Leases of sacred properties in Attica, Part II“, Hesperia 52, 1983,177–199.
Walter-Karydi 1998 E. Walter-Karydi, The Greek house. The rise of noble houses in Late Classicaltimes. Athen 1998.
Wiegand – Schrader 1904 Th. Wiegand – H. Schrader, Priene. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersu-chungen in den Jahren 1895–1898 Berlin 1904.
Wiseman 1972 J. Wiseman, „The Gymnasium area at Corinth, 1969–1970“, Hesperia 41, 1971,1–42.
Wolf 2003 M. Wolf, Die Häuser von Solunt und die hellenistische Wohnarchitektur . Mainz2003.
Yacoub 1968 F. Yacoub, „A private bath discovered at Kîman-Fâris, Fayûm“, ASAE 60, 1968,55–56.
Zimmermann 2002 C. Zimmermann, Handwerkervereine im griechischen Osten des Imperium Roma-num. Mainz 2002.