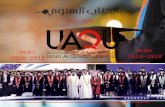Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el-Amed, ZDPV 130/1, 2014, 77-95.
-
Upload
uni-tuebingen -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el-Amed, ZDPV 130/1, 2014, 77-95.
ZDPV 130 (2014) 1
Hellenistische Stelen mit Kultakteurenaus Umm el- Amed *
Von Henrike Michelau
1. Die Stelen aus Umm el- Amed
Umm el- Amed liegt 19km südlich von Tyros und 26km nördlich von Akko auf einer Hang-terrasse. Die Ausdehnung der Stadtanlage beträgt 18ha. Der Ort ist vor allem für seine beidenhellenistischen Tempelanlagen bekannt 1, dem Milkaschtart-Tempel und dem sogenanntenÖstlichen Tempel, der vermutlich der Astarte geweiht war.
Aus Umm el- Amed kommen insgesamt 23 reliefierte Stelen, die größtenteils aus Raub-grabungen 2 zu Beginn des 19. Jh.s n. Chr. stammen und bis auf eine Ausnahme, die sich inder Ny-Carlsberg-Glyptotek in Kopenhagen befindet 3, an den Louvre verkauft wurden 4.Nach CHARLES CLERMONT-GANNEAU sowie MAURICE DUNAND und RAYMOND DURU kanndas Gebiet, in dem die Stelen gefunden wurden, zwischen dem westlichen Ende des Milk-aschtart-Tempels und der Nordwest-Nekropole lokalisiert werden 5. Die Lage am Stadtrandlässt vermuten, dass die Stelen ursprünglich in einer Nekropole und nicht im Tempel 6 aufge-stellt waren.
Drei weitere Stelenfragmente wurden 1943 zu Grabungsbeginn von MAURICE DUNAND
und RAYMOND DURU in der Nähe des Milkaschtart-Tempels zusammen mit anderen Objektenim sogenannten Camp Lorey gefunden. Entweder sind die Stelenfragmente Reste der Raub-grabungen oder sie wurden in den Grabungen von EUSTACHE LOREY im Jahr 1921 freigelegt,
* Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag, der im Rahmen des vom Deutschen Palästina-Verein (DPV)durchgeführten Kolloquiums „Sprachen in Palästina im 2. und 1. Jahrtausend v. Chr.“ im November2012 gehalten wurde. Ich bedanke mich bei den Teilnehmern für ihre zahlreichen Anregungen undHinweise, die diesen Artikel vervollständigten. Dem Deutschen Palästina-Verein danke ich herzlichfür die finanzielle Unterstützung meiner Forschungen. Die hier vorgelegten Untersuchungen ent-standen im Rahmen eines Promotionsstipendiums nach dem Landesgraduiertenförderungsgesetz desLandes Baden-Württemberg, mit dessen Hilfe ich eine umfassende Bearbeitung der „phönizischenStelen aus der Levante“ erstelle. JENS KAMLAH danke ich für die Betreuung meines Promotions-vorhabens, ANNE-MARIE AFEICHE, ELISABETH FONTAN und TINE BAGH für ihre Unterstützung beider Sichtung der Stelen in den Museen in Beirut, Paris und Kopenhagen, INGRID GAMER-WALLERTfür die Genehmigung zum Abdruck der Abbildungen auf Taf. 11.
1 Zu den Tempelanlagen vgl. unter anderem DUNAND / DURU 1962, 21–79; WAGNER 1980, 27– 35;VELLA 2000; KAMLAH 2008.
2 CLERMONT-GANNEAU 1903, 2.148.3 Vgl. unter anderem JACOBSEN 1907; ARNDT, P. (ed.) 1912; INGHOLT 1926 – 28.4 Insgesamt befinden sich 15 Stelen im Louvre (GUBEL 2002, 138, cat. 150.153 –154.156 –163), von
denen vier erst später durch ERIC GUBEL aufgrund ihres Stils Umm el- Amed zugewiesen wurden(2002, cat. 151–152.155.164). Eine weitere Stele aus den Raubgrabungen befindet sich heute inHarissa bei Beirut (DUNAND / DURU 1962, 164 –165, no. 8).
5 CLERMONT-GANNEAU 1903, 2.148 –149; DUNAND / DURU 1962, 5, Pl. 99.6 Für eine Aufstellung innerhalb des Tempels sprechen sich unter anderem DUNAND / DURU 1962, 161.
165 –166 und VELLA 2000, 37 aus.
ZDPV 130 (2014) 1
78 Henrike Michelau
die jedoch unpubliziert blieben7. Anzumerken ist, dass in den groß angelegten Grabungen vonMAURICE DUNAND und RAYMOND DURU zwischen 1943 und 1945 keine weiteren Stelenzutage gekommen sind 8. Dies bekräftigt die Schlussfolgerung, dass die Stelen ursprünglichaußerhalb des Tempels und des Stadtkerns aufgestellt waren.
Schließlich wurden in den Grabungen im Jahr 1953 von MAURICE CHEHAB 500m südlichvon Umm el- Amed drei Stelen in einer Ummauerung verbaut aufgefunden 9.
1. 1. Das Bildprogramm der Stelen
Das Bildprogramm der Stelen ist sehr homogen. Es besteht im Wesentlichen daraus, eineaufrecht stehende Person im Adorationsgestus darzustellen (Abb. 1). 13 Stelen zeigen eineeinzelne männliche Person, sechs eine weibliche und vier ein sich gegenüberstehendes Per-sonenpaar, dreimal bestehend aus einem Mann und einer Frau und einmal aus zwei Männern.Alle Frauen tragen ein langes, bis zum Boden reichendes Gewand sowie einen darüber lie-genden knielangen Mantel, den sie sich über den Hinterkopf gezogen haben. Die insgesamt18 männlichen Personen lassen sich anhand ihrer Gewandung in zwei Gruppen untergliedern:(1) Männer, die ein knöchellanges Gewand sowie eine Kopfbedeckung tragen und einenGegenstand in ihrer auf Taillenhöhe angewinkelten linken Hand halten; (2) Männer im knie-langen Kurzgewand ohne Kopfbedeckung und ohne Gegenstand in der linken Hand. DemTypus des Mannes im Langgewand lassen sich insgesamt 12 Bildnisse und dem des Mannesim Kurzgewand sechs Stelen zuweisen. Ein weiteres Element der Stelen stellt als obererStelenabschluss die geflügelte Sonnenscheibe dar (Taf. 3A und 4A), die auf mindestens achtStelen vorkommt und in Kombination mit jedem Personentypus auftreten kann 10. Außerdemkann die Sockelzone der Stelen eine trapezförmige, podestartige Ausgestaltung aufweisen(vgl. Taf. 3A und 8A). Das Podest scheint in seiner Formgebung wesentlich durch den Auf-bau ägyptischer Pylone beeinflusst zu sein 11.
Die erhobene Hand weist die dargestellten Personen als Adoranten und somit als Akteureeiner kultischen Handlung aus. Die Abbildung dieser Kulthandlung wird in einigen Fällen
7 DUNAND / DURU 1962, 7.101, no. M6.11.16; 158.164, no. 5.7. Die Auflistung unter „Inventaire desfragments architecturaux et des sculptures, Temple de Milk ashtart“ (S. 101) suggeriert, dass alleObjekte aus dem entsprechenden Tempel stammen würden, was aber nicht zutrifft. Auf dem Plan desMilkaschtart-Tempels mit den eingetragenen Fundnummern (Pl. 91) taucht keine der Objektnummernauf. In ihrer Einleitung erwähnen sie (S. 7), dass im Lager von M. DE LOREY Skulpturenfragmentehinterlassen wurden, zu denen vermutlich auch die Stelenfragmente zu rechnen sind. Von der Gra-bung DE LOREYs konnten DUNAND und DURU aus den Archiven einige Photographien gewinnen,detaillierte Informationen über die Grabung selber konnten sie jedoch nicht erlangen (S. 4 – 5 Pl.1.3 – 5). Da die entsprechenden Stelenfragmente einen sehr schlechten Erhaltungszustand aufweisenund jeweils auf den unteren Beinausschnitt einer Person begrenzt sind, erzielten sie vermutlichkeinen guten Preis bei den Museen und verblieben in Umm el- Amed.
8 DUNAND 1944 – 45; DUNAND / DURU 1962; GUBEL 2002, 138.9 CHEHAB 1956 sowie eine vierte undekorierte Stele; DUNAND / DURU 1962, 165. Die entsprechenden
Stelen befinden sich heute im Nationalmuseum in Beirut (Inv. 2070 – 2072).10 Der Erhaltungszustand der Stelen gibt zu erkennen, dass fünf Stelen ohne Flügelsonne konzipiert
waren, während sich bei den restlichen neun Stelen der entsprechende obere Abschluss nicht erhaltenhat. Drei der mit einer Flügelsonne gestalteten Stelen zeigen eine männliche Person, sowohl imLang- als auch im Kurzgewand, vier eine weibliche Person und eine ein Personenpaar.
11 CHEHAB 1956, 48; DUNAND / DURU 1962, 163.166 –167 Fig. 69; WAGNER 1980, 80 – 89.147–151.
ZDPV 130 (2014) 1
79Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed
Abb. 1. Stele des Baalyaton aus Umm el- Amed(Zeichnung: HENRIKE MICHELAU).
durch das Halten eines Gefäßes oder Gegenstandes präzisiert. Der Aufbau der Szene ent-spricht derjenigen der bekannten Stele des Yehawmilk, König von Byblos (Abb. 2; Mitte des5. Jh.s v. Chr.) 12. Auch König Yehawmilk ist unter einer Flügelsonne im Adorationsgestusdargestellt. Er trägt ein langes Gewand, eine Kopfbedeckung und hält in seiner linken Handeine Schale. Zudem gibt die Stele des Yehawmilk die Gottheit zu erkennen, die der Königverehrt und der er ein Opfer darbringt: die „Herrin von Byblos“, wiedergegeben als thronendeGöttin.
12 GUBEL 2002, cat. 50 mit weiterführender Literatur; vgl. auch 1986, 266.
ZDPV 130 (2014) 1
80 Henrike Michelau
Abb. 2. Bildszene der Yehawmilk-Stele (Zeichnung: HENRIKE MICHELAU).
Bei den hellenistischen Stelen aus Umm el- Amed wird die verehrte Gottheit nicht dargestellt.Am engsten verwandt sind dieser Gruppe von Stelen die Grabstelen aus Karthago 13.
13 JEAN FERRON (1976) katalogisiert 300 Grabstelen und 29 Grabfiguren, die jeweils eine frontaldargestellte Person zeigen, die sowohl männlich (185-mal) als auch weiblich (144-mal) sein kann.Ihren rechten Arm haben sie jeweils im Adorationsgestus erhoben, während der linke Arm aufTaillenhöhe angewinkelt ist. Im Unterschied zu den Stelen der Levante können nicht nur Männer,sondern auch Frauen einen Gegenstand in der linken Hand halten: Pyxide (228-mal), Aryballos(1-mal), Unguentarium (5-mal), Lotusblume (2-mal), Pyxide in Kombination mit einer Olpe (5-mal).Da die Figuren nur grob ausgearbeitet sind, lassen sich kaum Details der Bekleidung erkennen. DieFrauen tragen ein langes Gewand mit einem Schleier über dem Kopf, die Männer dagegen einbodenlanges Gewand und in einigen Fällen einen Stoffstreifen über ihrer linken Schulter. In manchenFällen lässt sich eine Kopfbedeckung erahnen. Zumeist werden die Stelen ins 4. – 2. Jh. v. Chr.datiert (vgl. CHARLES-PICARD 1955, 18).
ZDPV 130 (2014) 1
81Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed
1. 2. Die Inschriften der Stelen
Sieben der 23 Stelen sind mit einer Inschrift (Tabelle 1: A– F) versehen 14. Fünf Inschriftenbeziehen sich auf eine männliche Person, von denen vier ein knöchellanges Gewand (A– D;Taf. 3A, 4A, 5A) tragen und eine mit einem knielangen Gewand (E) bekleidet ist. EineInschrift bezieht sich auf eine weibliche Person (F) und eine weitere auf ein Personenpaar(Taf. 8A). Letztere wurde jedoch bereits antik eradiert. Die Inschriften sind weder an einbestimmtes Geschlecht noch an einen Personentypus gebunden, sondern konnten frei denunterschiedlichen Stelentypen hinzugefügt werden. In vier Fällen befand sich die Inschrift aufder Sockelzone (A, C – D), in drei Fällen wurde die Inschrift im Bildfeld (B, E – F) ange-bracht.
Grundsätzlich sind die Inschriften nach einem festen Formular aufgebaut, bestehend auseiner Einleitung, der Nennung des Verstorbenen und der Filiation. Die Einleitung erfolgtentweder durch die Präposition l – „zu, für“ (A, C – D) oder durch das Formular z ms
˙bt skr –
„Dies ist die Stele des Gedenkens für“ (B, E – F). Der Einleitung folgt die Nennung desSteleninhabers mit der Filiationsangabe bn – „Sohn des“ bzw. bt – „Tochter des“. EineErweiterung des Formulars kann durch die Nennung des Stifters sowie die Angabe einesTitels erfolgen.
Ein Titel taucht in vier Steleninschriften (A– D) auf, bei denen es sich ausschließlich umden Typus des Mannes im knöchellangen Gewand mit Kopfbedeckung und Gegenstand in derHand handelt 15. Zweimal erfolgt die Nennung rb (Oberster; B, D), einmal rb s rm (Obersterder Tore; A) und einmal khn (Priester; C). Die Inschriften der Stelen mit der Darstellung derFrau (F) und des Mannes im knielangen Gewand (E) weisen keinen Titel auf 16.
Während khn 17 eindeutig als ein sakrales Amt angesehen werden kann, umfasst die Be-zeichnung rb 18 ein recht breit gefasstes Bedeutungsspektrum. Durch die Spezifizierung s rm
(Tore) wird der Bereich zwar eingegrenzt, welche Tore aber gemeint sind, lässt sich zunächst
14 Während elf Stelen zu fragmentarisch sind, um das Vorhandensein einer Inschrift nachweisen zukönnen, waren fünf Stelen unbeschriftet. Somit waren mindestens ein Drittel, maximal drei Viertelder Stelen beschriftet. Inwiefern darüber hinaus mit aufgemalten Inschriften zu rechnen ist, entziehtsich unserer Kenntnis.
15 Parallelen lassen sich in Karthago finden. Auf einem Ossuar, dessen Deckel einen Mann im Lang-gewand mit der rechten Hand im Adorationsgestus zeigt und der in seiner linken eine Pyxide hält,befindet sich die Inschrift: Baalschallik, der Oberste (hrb); vgl. BENICHOU-SAFAR 1982, 225 – 226,Fig. 112 und 125:1. In der punischen Nekropole Sainte Monique finden sich in den GrabkammernInschriften, die unter anderem Titel aufweisen: Von insgesamt 71 Inschriften (BENICHOU-SAFAR1982, 206 – 224) weisen 11 Inschriften den Titel hknt /hkhnm (Priester) und fünf Inschriften hrb(Oberster) sowie zwei Inschriften rb khnm (Oberster der Priester) auf. Weiterhin sind dreimal hsh
˙r
(Kaufmann / Händler), dreimal hspt˙
(Suffet) und jeweils einmal p l ht lbt (Macher der Pyxiden), hnsk(Schmied) und hkbs (Walker [Wäschereinigung]) belegt.
16 Auch wenn bei der Kurzgewanddarstellung (E) die letzte Zeile fehlt, kann hier von der Struktur derInschrift nur die Nennung des Stifters folgen. Sollte der Name mit einem Titel versehen gewesensein, würde sich diese auf den Stifter und nicht auf den Verstorbenen und somit nicht auf die im Bilddargestellte Person beziehen.
17 HOFTIJZER/ JONGELING 1995, 490 – 492 khn1; DOMMERSHAUSEN 1984; RINGGREN 1984. Im Allge-meinen zu Priestern in der Levante vgl.: STUCKY 1973; 1976; 2005; AMADASI GUZZO / LIPINSKI1992; NIEHR 1998; 2010; BONNET 2010, 145 –149.
18 Grundbedeutungen: 1) wichtiger Mann, 2) Lehrer, 3) Oberhaupt, Vorsteher, Befehlshaber. Vgl. dazuHOFTIJZER/ JONGELING 1995, 1045 –1051, rb2, B, 1– 4; FABRY 1993, 294.
ZD
PV
130(2014)
1
82H
enrikeM
ichelau
Tabelle 1. Inschriften auf den Stelen ausUmm el- Amed (Umzeichnungen der Inschriften nach: LIDZBARSKI 1907, 23 [A]; DUNAND /DURU1962, 188, no. 6 [B]; 191, no. 12 [C]; 190, no. 10 [E]; 191, no. 11 [F]; CHEHAB 1956, Fig. 3 [D]).
ZDPV 130 (2014) 1
83Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed
nur vermuten. Da sich der Oberste ikonographisch nicht vom Priester unterscheidet, könnendie angeführten Amtsbezeichnungen rb und rb s rm hier wie khn auf eine sakrale Ebenebezogen werden. Somit können die als rb bezeichneten Personen als Vorsteher bestimmter derTempelverwaltung untergeordneter Arbeitsbereiche betrachtet werden. Ein rb s rm könnte derVorsteher der Tempeltore gewesen sein, der für das Öffnen und Schließen der Tempeltoreverantwortlich war und den Waren- und Personenverkehr regulierte und protokollierte. Funk-tionale Parallelen bilden die prkm (Hüter des Vorhangs) und dmm s l dl (Männer, die überdie Tür [wachen]) in einer phönizischen Tarifliste des Astarte-Tempels aus Kition 19 sowie dieim Alten Testament bezeugten so arım /some
˙r sa ar /somǩrım hassǩ arım (Wächter der [Tem-
pel-]Tore) 20.Anhand der Steleninschrift des Baalschamar (A) lässt sich weiterhin ableiten, dass die
Ämter unter Umständen vererbbar waren und vom Vater auf den Sohn übergehen konnten.Inwiefern dies auf alle Ämter zutrifft und die vorherrschende Norm war, ist jedoch unge-wiss 21.
Das Formular sowie der Aufbau der Inschrift entsprechen dem Typus der Grabinschriften.Ein Titel in der Inschrift hebt die männlichen Personen im langen Gewand mit Kopfbede-ckung und Gegenstand in der linken Hand von den Männern im knielangen Gewand sowieden Frauendarstellungen ab und unterstreicht ihre herausgehobene Stellung.
2. Zu den Männern im langen Gewand mit Kopfbedeckungund einem Gegenstand in der Hand
Elf Männer tragen ein knöchellanges Untergewand und einen knöchellangen Mantel, der sichnach vorne öffnet, den Blick auf das Untergewand freigibt und lange, weite Ärmel besitzt(Taf. 4A, 5A, 8A) 22. Der persische Einfluss dieser Art der Kleidung wurde in der Forschungbereits herausgestellt 23. Im Unterschied dazu steht das Gewand von Baalschamar (Taf. 3A) inhellenistisch-griechischer Tradition. Er trägt nur eine Tunika, die weit und locker in zahlrei-chen Falten auf den Boden fällt und die Arme bis zum Ellenbogen bedeckt. Ebenfalls unter-scheidet sich die Kopfbedeckung von den zylindrischen Kappen der anderen Personendar-stellungen und ist nach ANDRE PARROT und ERIC JANSSEN eine Kausia 24. Weiterhin hat
19 NIEHR 1998, 134; KAI 37 A, 6; BONNET 2010, 147.20 OTTO 1995, 369; SCHÖPFLIN 2007; vgl. unter anderem: 1 Chr 9,17– 28; 16,37– 38; 23,5; 26; 2 Chr
8,14; 23,4.19; 35,15; Es 2,42.70; 7,7; Neh 3,29; 7,72; 10,40; 13,5.22.21 Würde man die Steleninhaber der Stelen B und C aufgrund ihrer Namensgleichheit in eine genea-
logische Verbindung setzen, fällt auf, dass der Sohn des Priesters Baalyaton die Amtsbezeichnungdes rb trägt und demnach zwar im selben Bereich wie sein Vater tätig war, aber eine untergeordneteStellung innehatte. Geht man weiterhin davon aus, dass das Priesteramt als oberste Instanz nur vonwenigen Personen oder in Umm el- Amed nur von einer Person zeitgleich ausgeübt werden durfte,kam der Sohn vermutlich gar nicht dazu, die Funktion seines Vaters zu übernehmen, da dieser zuseinen Lebzeiten noch im Amt war und der Sohn nur die untergeordnete Funktion ausüben konnte.
22 Diese Art der Bekleidung lässt persischen Einfluss erkennen; vgl. dazu z. B. HEUZEY 1902, 201– 202;INGHOLT 1926 – 28, 12; MAES 1991, 213.
23 HEUZEY 1902, 201– 202.24 PARROT/ CHEHAB / MOSCATI 1977, 118; JANSSEN 2007, 218.272 – 273, *Re 6, Abb. 74. Der grie-
chische Terminus kaysiÂa leitet sich von kayÄsiw (brennende Hitze) ab und bezeichnet einen Kopf-schutz gegen die Hitze. Die Kausia wird ebenfalls von einer Männerdarstellung auf einer Stele ausBustan es-Seh
˘(vgl. CHEHAB 1934, Pl. XII) und auf einer unpublizierten Stele im Museum der
American University of Beirut getragen. DUNAND / DURU 1962, 165 sowie MAES 1991, 222 sehen inder Kopfbedeckung keine Kausia, sondern ein einfaches, um den Kopf gelegtes Band.
ZDPV 130 (2014) 1
84 Henrike Michelau
Baalschamar über seine rechte Schulter ein schmales Stoffband gelegt, das in einer Troddelendet und bis zu den Knien reicht 25. Auf seiner linken Hand liegt ein kästchenartiger Ge-genstand, in dem MAURICE CHEHAB das Abbild eines Naos sehen will, „sa main gauche parcontre porte un coffret, en forme de naos“ 26. Jedoch sind weder Form noch Aufbau desObjekts mit den phönizischen Naiskoi übereinzubringen. Nach MAURICE DUNAND und RAY-MOND DURU handelt es sich bei dem Objekt um ein nicht näher definiertes Kästchen, in demeventuell Weihrauch aufbewahrt wurde 27. Eine andere These leiten die beiden Autoren ausder Amtsbezeichnung „Oberster der Tore“ ab, mit welcher der Stelenbesitzer in der Inschrift(A) ausgewiesen ist. Aufgrund dessen schlagen sie vor, dass der Schlüssel der Tempeltore indem Kästchen verwahrt wurde 28. Der Gegenstand scheint entweder ein Kästchen mit vogel-förmigem Griff zu sein oder ein Miniaturtisch bzw. -altar, auf dem ein Vogelopfer darge-bracht wird (Taf. 3B – C).
2. 1. Ein Kultgefäß mit frauenförmigem Griff
Von den Männern im knöchellangen Gewand mit Mantel und zylindrischer Kopfbedeckungwird jeweils ein Gefäß in Händen gehalten, das aus einer Schale mit einem horizontal an-setzenden, frauenförmigen Griff besteht. Aufgrund des Adorationsgestus, der die dargestell-ten Personen innerhalb einer Kulthandlung darstellt, kann das gehaltene Gefäß als Kultgefäßinterpretiert werden 29. Das Gefäß liegt stets auf dem linken, auf Taillenhöhe angewinkeltenUnterarm der männlichen Person auf. Demnach zeigt sich das Gefäß bei den nach linksorientierten Männern stets in seiner Gesamtheit (Taf. 5 und 7), während es bei den nach rechtsorientierten Männern zur Hälfte von ihren Körpern verdeckt wird (Taf. 4, 6 und 8).
In der französischsprachigen Literatur wird das Gefäß als „Schale mit einer Sphinxpro-tome“ beschrieben 30. Eine Gegenposition findet sich begründet durch die dänischen Forscherin Bezug auf die Kopenhagener Stele des Baalyaton (Taf. 4; Abb. 1). CARL JACOBSEN be-schrieb das Objekt als eine Opferschale mit einer Göttinnenfigur als Griff, nach Art derägyptischen Löffel 31. Der Interpretation, in dem Griff eine bäuchlings liegende Frauengestaltzu sehen, die eine Schale umfasst, folgten zunächst die dänischen Forscher sowie die deutsch-sprachige Literatur, die teilweise bereits weitere Stelen aus Umm el- Amed in die Diskussionmit einbezogen 32. Darüber hinaus haben meine Recherchen das Objekt auf mindestens zweiweiteren aus dem Umland von Umm el- Amed stammenden Stelen 33 sowie bei den Personen-
25 Nach CHEHAB 1956, 48 und PARROT 1977, 118 handelt es sich um die Tefillin, die von den Juden alsKennzeichen ihrer Mannbarkeit umgelegt wird, während JANSSEN 2007, 218 sich für einen hebräi-schen (Gebets-)Mantel ausspricht. Dieser Stoffstreifen findet sich darüber hinaus bei einer weiterenStele aus Umm el- Amed (Taf. 7).
26 CHEHAB 1956, 48.27 DUNAND / DURU 1962, 165.28 DUNAND / DURU 1962, 165.29 Zur Rekonstruktion dieses spezifischen Kultgefäßes siehe MICHELAU in press.30 Unter anderem HEUZEY 1902, 203 „en petit sphinx couche, coiffe du pschent egyptien et tenant, a ce
qui’il sembles, une tres petite coupe entre ses pattes etendues“; DUNAND / DURU 1962, 153 –154.161– 162 „coupe dominee par le protome d’un haut sphinx accroupi“ (161); GUBEL 2002, 144 cat.157 „dans la main g. ramenee a la taille, il tient une coupe munie d’un protome de sphinx accroupi“;zuletzt FONTAN 2012.
31 JACOBSEN 1907, 299.32 SCHMIDT 1912, 83; INGHOLT 1926 – 28, 82.91; GALLING 1977; PARROT/ CHEHAB / MOSCATI 1977,
117; FISCHER 2007, 339 mit Anm. 309.33 Beide Stelen befinden sich im Louvre AO 1001 und AO 14710; vgl. GUBEL 2002, cat. 113 und 171.
ZDPV 130 (2014) 1
85Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed
darstellungen auf einem Steinblock 34 aus Umm el- Amed (Taf. 9; Abb. 3), einer Terrakotta-figur aus Gaza 35 und acht Figuren aus el-H
˘ara ib 36 (Taf. 10A– B) nachgewiesen. Außerdem
ist auf weitere, aus dem Umland stammende Stelen mit dem Typus des Mannes im knöchel-langen Gewand mit Kopfbedeckung hinzuweisen. Diese zeigen zwar nicht das gleiche Gefäß,sondern analog einen anderen Gegenstand in der linken Hand des Mannes, nämlich eineeinfache Schale 37, eine Pyxis 38 und ein Etui(?) 39.
Die Stele des Baalyaton, des Obersten (Inschrift B; Taf. 4A– C; Abb. 1), ist die am bestenerhaltene Stele von allen 40. Das Gefäß wird vom Körper des Mannes halb verdeckt, dennochsind die weiblichen Körperkonturen des anthropomorphen Griffes sowie die Gesichtszüge derFrau gut zu erkennen. Die Stele des Baalyaton, des Priesters des Milkaschtart (Inschrift C;Taf. 5A– C), wurde aus zwei Teilstücken wieder zusammengesetzt 41. Das Gefäß ist in seinerGesamtheit inklusive des in Form einer Frau gestalteten Griffes sichtbar. Die Person auf eineroberen Stelenhälfte (Taf. 6A– C) 42, kann trotz der fehlenden unteren Hälfte als eine Person ineinem knöchellangen Gewand identifiziert werden. Von dem Gefäß sind nur die Umrisseerkennbar. Ein vermutlich an allen Seiten zugesägtes Stelenfragment (Taf. 7A– C) zeigt eineweitere Person im knöchellangen Gewand mit zylindrischer Kappe, die zusätzlich einenschmalen Stoffstreifen über ihre linke Schulter gelegt hat 43. Vom Gefäßgriff in Frauenformist der Körper gut erkennbar, während vom Kopf nur die Umrisse sichtbar sind. Die letzteStele zeigt ein sich gegenüberstehendes Personenpaar (Taf. 8A– C) 44. Die männliche Figurzeichnet sich durch das Langgewand und das Gefäß mit frauenförmigem Griff aus. Heraus-zuheben ist, dass in diesem Fall auch die Frau ein Objekt, eine zylindrische Vase, in ihrenHänden hält, während die Frauen in den Einzeldarstellungen stets ohne Objekt dargestelltwerden 45.
34 DUNAND / DURU 1962, 46, 113 M.361, 152 Fig. 66, 151–153 Pl. 36,1– 2 und 37,1.35 FONTAN 2012.36 CHEHAB 1951– 52, 23 – 24 Kh. 90 – 97, Pl. 9 und 10:2. CHEHAB beschreibt das Gefäß als „une
cuillere a encens dont la forme est celle d’une femme nue etendue en plongee“. Jedoch wurde seinInterpretationsansatz in der Literatur bisher kaum aufgegriffen; PARROT/ CHEHAB / MOSCATI 1977,119 Abb. 124.
37 Eine aus Sidon stammende Stele (PARLASCA 1982, Taf. 1:1) zeigt einen Mann mit einer Phiale. Eineweitere sidonische Stele, die in Istanbul aufbewahrt wird (MENDEL 1966, 257 cat. 101), stellt einenMann mit einer tiefen Schale dar.
38 Eine unpublizierte Stele, die sich im Museum der American University in Beirut befindet, zeigt einenMann, der eine Pyxis hält, deren Deckelrand zwischen Daumen und Zeigefinger sichtbar ist.
39 Eine Stele aus Bustan es-Seh˘
(CHEHAB 1934, Pl. 12) zeigt ein zylindrisches Objekt, bei dem es sichentweder um eine Papyrusrolle (vgl. STUCKY 2012, 89 „un objet rond – peut-etre un rouleau depapyrus“) oder um ein Etui handeln könnte.
40 Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek IN 1835. Literatur in Auswahl: JACOBSEN 1907; INGHOLT1926 – 28, 81– 94; DUNAND / DURU 1962, 160 –161, no. 1, Pl. 77; GALLING 1969 –70, 105 –106.
41 Louvre, AO 4047.3137. In Auswahl: DUNAND / DURU 1962, 161–162, no. 2, Pl. 79:3; GUBEL 2002,144, cat. 157.
42 Louvre, AO 3136. HEUZEY 1902, 201– 203, Fig. 2; DUNAND / DURU 1962, 162, no. 3, Pl. 81:1; MAES1991, 213 – 214, Fig. 3; GUBEL 2002, 154, cat. 159.
43 Louvre, AO 3754. DUNAND / DURU 1962, 162, no. 4, Pl. 82:1; MAES 1991, 216.218; GUBEL 2002,144 –145, cat. 158.
44 Louvre, AO 3123.3134. HEUZEY 1902, 201; INGHOLT 1926 – 28, 84; DUNAND / DURU 1962, 162 –163, no. 6, Pl. 78:1; MAES 1991, 216.219, Fig. 7; GUBEL 2002, 141, cat. 150.
45 DUNAND / DURU 1962, 163 –165, no. 1– 2.8.10 –11, Pl. 78:2, 84:3, 85:1, 88:2 – 3; GUBEL 2002,143, cat. 155.
ZDPV 130 (2014) 1
86 Henrike Michelau
2. 1. 1. Identifizierung des Kultgefäßes
Die nähere Betrachtung der Objekte zeigt, dass es sich bei dem gehaltenen Gegenstand umeine Schale handelt, die in der Größe ungefähr dem Handteller der Männer entspricht. DieSchale verfügt über einen horizontalen Griff, der in der Form einer nackten Frau gestaltet ist,die bäuchlings mit nach vorn ausgestreckten Armen und nach hinten ausgestreckten Beinenliegt. Mit den Armen umfasst sie die Schale. Schalen dieser Art stellen einen ursprünglich ausÄgypten stammenden Gefäßtyp dar (Taf. 11A– C). Aufgrund der Nacktheit und der ausge-streckt liegenden Körperhaltung wird in der Forschung zumeist davon ausgegangen, dass essich um eine schwimmende Frau handelt. Dieses brachte dem gesamten Typus die Bezeich-nung „Schwimmerin“ ein 46. Entsprechend findet sich in der englischsprachigen Literatur derTerminus „swimming girl“ 47 und im Französischen „(la) nageuse“ 48.
Das Gefäß hat seinen Ursprung in Ägypten, wo es seit dem Neuen Reich bezeugt ist 49. Inder späten Bronzezeit gelangten solche Gefäße nach Palästina. Insgesamt sind mindestens 10Exemplare aus Palästina bekannt, die, sofern bestimmbar, aus Fundkontexten des 13. – 12.Jh.s v. Chr. stammen 50. Für das 1. Jt. v. Chr. sind 46 Exemplare in Ägypten 51 belegt, miteinem Schwerpunkt vom 8. – 6. Jh. v. Chr. Darüber hinaus hat sich das Verteilungsgebietstark ausgedehnt, das nun Mesopotamien 52, Zypern 53, Kleinasien 54, Griechenland 55 und Ita-lien 56 umfasst. Unmittelbar von der Levanteküste ist nur ein Fundstück aus Byblos 57 bekannt.
46 Unter anderem WALLERT, 1967; DECKER/ HERB, 1994, 855 – 870; FISCHER 2007, 277– 340.47 Unter anderem DAYAGI -MENDELS 1989, 46; DOTAN 1998, 32; KOZLOFF/ BRYAN 1992, 290 – 323.48 Unter anderem SCHMIDT 1912, 83; KEIMER 1952; VANDIER D’ABBADIE 1972, V, 11–17 OT 1– 21;
LOBSTEIN 1984; KOZLOFF 1993, 331– 357.49 Dem Neuen Reich können insgesamt 62 Exemplare zugewiesen werden: WALLERT 1967, 18 – 23 Taf.
11–15; DECKER/ HERB 1997, T.13 –14.33 – 34.36; FISCHER 2007, 277.279 – 281.319 – 329 *L.1–18(mit Fundkontext), *L.19 – 47 (unbekannter Herkunft), *L.58 – 57 (problematische Stücke), Taf. 97–115.
50 Tell el-Mutesellim / Megiddo: FISCHER 2007, 281– 282.316 – 319 Nr. 1– 8, Taf. 93 – 96; Tell el-H˙
is˙
n / Bet-Schean: FISCHER2007, 332 – 333 *L.67, Taf. 119; Der el-Belah˙
: FISCHER2007, 333 *L.68,Taf. 119; Tell ed-Duwer / Lachisch: FISCHER 2007, 333 *L.69, Taf. 120; Tell es
˙-S˙
afı: FISCHER 2007,333 – 334 *L.70, Taf. 120; Tell es-Sa ıdiye: FISCHER 2007, 334 *L.71, Taf. 121 sowie Enkomi:FISCHER 2007, 334 *L.72, Taf. 122.
51 WALLERT 1967, 38 – 41, Taf. 34; Memphis: FISCHER 2007, 331 *L.58, Taf. 115; Nubien: FISCHER2007, 331 *L.59 – 60, Taf. 116; unbekannter Herkunft: FISCHER 2007, 331 *L.61– 66, Taf. 117–118sowie zusätzlich nach DECKER/ HERB 1994: T.48 – 50.52.54 – 57.63.66 –76.78.80 – 84.86.
52 Nimrud: FISCHER 2007, 336 – 337 *L.81– 86, Taf. 125 –127; Uruk (Deutung jedoch fraglich): FISCHER2007, 337 *L.87, Taf. 128.
53 Amathus (Zuordnung jedoch fraglich): FISCHER 2007, *L.73 –74, Taf. 122.54 Lindos: FISCHER 2007, 335 – 336 *L.78, Taf. 123; Samos: FISCHER 2007, 335 – 336 *L.79, Taf. 124;
Kamiros: DECKER/ HERB 1994, T.61– 52.55 Athen: FISCHER 2007, 335 – 336 *L.75, Taf. 122; Heraklion: FISCHER 2007, 335 – 336 *L.77, Taf.
123; GALLING 1969 –70, 100 –107, Abb. 1– 4.56 Tharros: FISCHER2007, 336 *L.80, Taf. 124; Chiusa: BECK / BOL / BÜCKLING (ed.) 2005, 536, Kat. 98
mit Abb.57 FISCHER 2007, 335 *L.76, Taf. 122. Weiterhin ist sicherlich mit einer gewissen Anzahl an aus Holz
gefertigten Objekten zu rechnen, die aufgrund der Erhaltungsbedingungen verloren sind. BEN-SHLOMO erwähnt ein weiteres Objekt aus Ekron (2010, 87– 88 Fig. 3.45.), wobei es sich um dasFragment einer Schale aus Steatit mit einer Palmette auf der Unterseite handelt, an dessen Schalen-wandung sich eine Hand abzuzeichnen scheint. Die Deutung ist jedoch unsicher. Das Stück erinnerteher an die Hand- und Löwenschalen, die in der Regel aus Stein sind und mit einer entsprechendenPalmette verziert sein können, die bei den Schwimmerinnen bisher nicht nachgewiesen wurde. Vgl.zu den Hand- und Löwenschalen REICHERT 1977, 192 –193 Abb. 45; ATHANASSIOU 1977 mit zahl-reichen Abbildungen; MAZZONI 2005, 43 – 66 Fig. 8, Pl. 15:8 – 9.
ZDPV 130 (2014) 1
87Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed
Allerdings können zum levantinischen Bestand sechs „Schwimmerinnen“ aus Nimrud alsursprünglich syrisch-phönizische Produktionen des 9. – 8. Jh.s v. Chr. addiert werden 58.
Die Funktion und der Verwendungszweck dieser Gefäße sind schwer zu ermitteln. Diemeisten Funde stammen aus dem Kunsthandel. Die wenigen aus Grabungen zutage gekom-menen Objekte fanden sich überwiegend in funerären Kontexten. In den betreffenden Gräbernsind sowohl männliche als auch weibliche Verstorbene beigesetzt worden. Meistens wurdendie Gefäße in Kombination mit Toilettenutensilien gefunden 59. Die Schalen selbst weisenselten Gebrauchsspuren oder andere Merkmale auf, die auf ihre Primärfunktion schließenlassen. In einigen Fällen wurde von einer Masse berichtet, die sich beim Auffinden in derSchale befunden habe, jedoch wurde diese ohne weitere Analysen entfernt 60.
2. 1. 2. Deutung des Kultgefäßes
Die Objektbezeichnung „Schwimmerin“ vermittelt bereits einen bestimmten Bedeutungsge-halt für die Gefäße. Obwohl diese Deutung in der Forschungsliteratur weit verbreitet ist,sollte sie kritisch hinterfragt werden. So sprechen sich unter anderem ANGELIKA LOHWASSER
und JOACHIM QUACK gegen eine Deutung der Griffe als Schwimmerinnen aus. Sie sehen inden dargestellten Frauen vielmehr Dienerinnen.
Für die Deutung der weiblichen Gestalten als schwimmende Personen wird ein Exemplareiner Schwimmerin herangezogen, bei welcher der Kopf nach vorn geneigt ist und mit demKästchen, das sie hält, verschmilzt (Taf. 11A) 61. In ihr wird der erste Versuch gesehen, einenGriff in Gestalt einer schwimmenden Person zu formen. Der nach vorn geneigte Kopf ent-spräche der natürlichen Schwimmhaltung. Hingegen sei bei den anderen Schwimmerinnender Kopf stark in den Nacken gezogen, um das Gesicht darstellen zu können. Weiterhin sindbei einigen Exemplaren die Unterschenkel und /oder Füße leicht voneinander abgespreizt,was als Darstellung einer Paddelbewegung aufgefasst wird 62.
Im Folgenden soll der Interpretationsweg von ANGELIKA LOHWASSERdargelegt werden.Sie verglich die Frauendarstellungen der Gefäßgriffe mit Darstellungen von schwimmendenFrauen auf Ostraka 63 und Kacheln 64 des Neuen Reiches, auf Bronzeschalen 65 der ZweitenZwischenzeit sowie auf Löffeln 66 und einem Grabrelief 67 der Spätzeit. Außerhalb Ägyptensfindet sich das Motiv von schwimmenden Frauen auf einem Paneel eines Kästchens 68 ausH˘
irbet el-Muqanna / Ekron und einer Silberschale 69 aus Zypern. Die Darstellungen zeigenalle jeweils eine oder mehrere schwimmende Frauen, umgeben von Schilf, Lotusblumen,Fischen und Vögeln. Nach ANGELIKA LOHWASSERhandelt es sich dabei um die Umgebung
58 Vgl. dazu BARNETT 1975, 52.59 FISCHER 2007, 302 – 303.60 WALLERT 1967, 49; FISCHER 2007, 305.61 WALLERT 1967, 18 Taf. 11:P35.62 DECKER/ HERB 1994, 856; FISCHER 2007, 290.63 DECKER/ HERB 1994, 861, T2.5; FISCHER 2007, *L.90; LOHWASSER2008, 63, Taf. 10:1.64 FISCHER 2007, *L.91– 92; LOHWASSER2008, 63, Abb. 7.65 FISCHER 2007, 338 *L.93 – 94, Taf. 130 –131; LOHWASSER2008, 64 – 65, Abb. 9, Taf. 10:2.66 WALLERT 1967, 39, Taf. 35; FISCHER2007, 338 *L.95 – 96, Taf. 131–132; LOHWASSER2008, 65 – 66,
Taf. 11:1.67 FISCHER 2007, 339 *L.97, Taf. 132; LOHWASSER2008, 66, Taf. 11:2.68 FISCHER 2007, 339 *L.98, Taf. 134; LOHWASSER2008, 63, Abb. 8; BEN-SHLOMO 2010, 85 – 86.69 FISCHER 2007, *L.99, Taf. 133.
ZDPV 130 (2014) 1
88 Henrike Michelau
eines Gartenteiches, wie er in größeren Privathäusern, Palästen, Tempelanlagen und Grab-vorhöfen zu finden ist 70. Solche Szenerien erscheinen in den altägyptischen Quellen als Orte,an denen sich die Liebenden treffen und ein Bad nehmen 71.
Die in den bildlichen Szenen dargestellten Frauen zeichnen sich durch eine gemeinsameKleidung aus, die aus einem Hüftgürtel und einem über der Brust gekreuzten Kettenbandbesteht 72. Die Frauen auf den Gefäßgriffen können mit einem Halskragen oder einem Gürtelbekleidet sein, der entweder aufgemalt, eingeritzt oder im sehr flachen Relief wiedergegebenist 73. Das über der Brust gekreuzte Band hingegen findet sich nur bei zwei Gefäßen desNeuen Reiches 74. Das Fehlen des gekreuzten Brustbandes, das bei den szenischen Darstel-lungen von schwimmenden Frauen ein elementarer Bestandteil zu sein scheint, nimmt AN-GELIKA LOHWASSERals ein Argument, in den Frauen der Gefäßgriffe keine schwimmendenFrauen zu sehen. Die Bekleidung mit einem Hüftgürtel spricht vielmehr für eine Deutung alsDienerin, wie sie häufig in der Darstellung von Bankettszenen zu finden ist 75.
Als eine eng verwandte Gruppe lässt sich den Gefäßen mit frauenförmigem Griff einespezifische Art von Spiegeln zur Seite stellen, deren Griffe in der Form einer aufrecht ste-henden Frau gestaltet sind. Auch bei diesen Spiegeln sind die Frauen überwiegend nacktdargestellt, lediglich mit einem Gürtel und einem Halskragen bekleidet 76. Nach JOACHIM
QUACK handelt es sich bei der in den Spiegelgriffen dargestellten Personen um eine Dienerin,„die in der Realität den Spiegel am Griff der Herrin hinhält [und] in der kunsthandwerklichenAusführung als Griffteil eben eines solchen Spiegels dargestellt wird“ 77. Vor diesem Hinter-grund deutet JOACHIM QUACK auch die Frauen der Gefäßgriffe als Dienerinnen 78. Die schein-bar liegende Haltung der Frauen ergäbe sich aus der unterschiedlichen Handhabung der Ob-jekte. Während die Spiegel senkrecht vor dem Körper gehalten werden, wird eine Schale inwaagerechter Position verwendet 79.
Inwiefern wurden jedoch die frauengestaltigen Gefäßgriffe in den Augen der Phöniziernoch als Dienerinnen wahrgenommen? Dienende Frauen, die einer Herrin bei der Schönheits-pflege behilflich sind, bilden offensichtlich den realen Hintergrund für die ägyptischen Scha-len mit frauenförmigem Griff. Für die Gefäße, die auf den Stelen und den Terrakotten inPhönizien abgebildet sind, kommt diese Sinngebung aber nicht in Frage. Denn bei den Per-sonen, die die Schalen in den Händen halten, handelt es sich um Männer. Vor allem jedochsind die Frauengestalten der Gefäßgriffe auf den Stelen mit einem zusätzlichen Attributausgestattet, das sich bei den ägyptischen Vorbildern nicht findet und der Deutung als Die-nerin entgegensteht: die pschent, die ägyptische Doppelkrone. In der Bildsprache der Stelenvon Umm el- Amed verleiht die Doppelkrone der Frauengestalt der Gefäßgriffe Sakralität.Dafür lassen sich aus der phönizischen Ikonographie andere Beispiele anführen, wie vorallem die weit verbreiteten phönizischen Sphingendarstellungen. Demnach handelt es sich bei
70 LOHWASSER2008, 67– 68.71 LOHWASSER2008, 58.68.72 LOHWASSER2008, 63 – 65.73 –74. Eine Ausnahme scheinen die im Relief dargestellten schwimmen-
den Frauen auf den Löffeln zu bilden, die keine Anzeichen einer Bekleidung erkennen lassen.73 FISCHER 2007, 295.74 FISCHER 2007, 295 *L.18 und 37.75 QUACK 2003, 60 – 62; LOHWASSER2008, 73 – 74.76 QUACK 2003, 47.77 QUACK 2003, 54.58 – 59; Zitat 59.78 QUACK 2003, 63.79 QUACK 2003, 63.
ZDPV 130 (2014) 1
89Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed
den Frauengestalten der Gefäßgriffe an den phönizischen Gefäßen nicht um reale Frauen-gestalten, sondern um Wesen, welche die Sakralität und die kultische Funktion der Gefäßebetonen.
2. 1. 3. Überlegungen zur Art des mit dem Kultgefäß durchgeführten Rituals
Für die Rekonstruktion des Rituals, das mit den Kultgefäßen auf den Stelen und den Terra-kotten ausgeführt wurde, kann zunächst angemerkt werden, dass die ägyptischen Original-gefäße zwischen 25 – 34cm lang waren und somit der Unterarmlänge eines erwachsenenMenschen entsprachen. Dies zeigt, dass nicht nur auf den Stelen, sondern auch auf denTerrakotten (Taf. 10) und dem Reliefblock (Taf. 9) das Gefäß proportional richtig dargestelltist. Da sich die Personen in einer Kulthandlung befinden, muss dem Gefäß hier eine kultischeFunktion zukommen. Als mögliche Kultrituale kommen die Libation, das Räuchern oder diekultische Verwendung von Salben in Frage. MAURICE DUNAND und RAYMOND DURU, die dasGefäß als Sphinx deuten, gehen von einer Räucherfunktion aus 80. ERIC GUBEL schließt sichdieser Deutung an und postuliert darüber hinaus, dass wegen der Räucherschale mit einer hierverehrten Heilgottheit zu rechnen sei 81. Geht man jedoch davon aus, dass die auf den Stelendargestellten Gefäße vermutlich wie die Originalfunde aus Elfenbein oder Holz bestanden, sospricht dies gegen eine Verwendung als Räuchergerät. Außerdem würde die beim Räuchernentstehende Hitze es unmöglich machen, das Kultgefäß so zu halten, wie es auf den Stelenund Terrakotten dargestellt ist, denn die größte Hitze entstünde unmittelbar auf der innerenHandfläche der Kultakteure.
Um die Handhabung der auf den Stelen abgebildeten Gefäße besser eingrenzen zu kön-nen, sind die Terrakottafiguren aus el-H
˘ara ib (Taf. 10A– B) hilfreich. Während bei der
Statuette aus Gaza der rechte Arm wie bei den Personendarstellungen der Stelen im Adora-tionsgestus erhoben ist, zeigen die Figuren aus el-H
˘ara ib einen anderen Gestus: Die Männer
greifen mit ihrer rechten Hand in die Schale des Gefäßes hinein (Taf. 10A– B). Diese Hand-haltung ist in Bezug auf die Klärung der Funktion der Gefäße äußerst aufschlussreich. Denneine Räucherfunktion, die aus den oben genannten Gründen bereits als unwahrscheinlicherschien, scheidet nun vollends aus. Die Handbewegung deutet vielmehr an, dass entwederetwas der Schale entnommen oder in ihr abgelegt wird.
Dabei könnte es sich z. B. um eine flüssige bzw. zähflüssige Substanz gehandelt haben.Daraus ließe sich ein Ritual rekonstruieren, in dessen Vollzug der Kultakteur mit den Fin-gerspitzen eine Flüssigkeit oder eine Salbe auf jemanden oder etwas sprengt bzw. streicht. Indiesem Kontext wäre ein Reinigungs- oder Salbungsritual denkbar. Alternativ könnten dieSchalen auch eine feste Materie beinhaltet haben (z. B. vegetabile Votivgaben oder Räucher-werk), die mit ihrer Hilfe im Vollzug eines Depositopfers an die dafür vorgesehene Stellegetragen wurde. Die Frage, welches Opferritual mithilfe des Kultgefäßes mit frauenförmigemGriff ausgeführt wurde, lässt sich beim derzeitigen Stand der Forschung nicht sicher ent-scheiden.
80 DUNAND / DURU 1962, 153 mit Anm. 1, 154 mit Anm. 2 – 3, 160, 162. Die angeführten Vergleiche imHinblick auf einen Räucherkult beziehen sich alle auf Hand- und Löwenschalen, die in Palästina fürdas 1. Jt. v. Chr. zwar belegt sind, deren Funktion zum einen aber nicht gesichert ist und die zumanderen generell in einem anderen Kontext zu betrachten und mit den hier behandelten Gefäßen nichtvergleichbar sind.
81 GUBEL 2002, 144 cat 157: „La divinite (Milk ashtart?), objet de la veneration de Ba alyaton et deBa alshamar, serait per consequent un dieu guerisseur.“
ZDPV 130 (2014) 1
90 Henrike Michelau
2. 2. Die kultische Funktion des Mannes mit Kultgefäß
Zunächst kann festgehalten werden, dass sich die Stelen mit einer männlichen Person ineinem knöchellangen Gewand in zwei Gruppen einteilen lassen: (A) Männer, die die persischbeeinflusste Kleidung mit zylindrischer Kopfbedeckung tragen und stets ein Kultgefäß mitfrauenförmigem Griff halten. Dieses Motiv findet sich auf den Stelen von Umm el- Amed
sowie zwei Stelen aus dem Umland 82 und bei den Terrakottafiguren aus Gaza und el-H˘
ara ib
wieder. (B) Männer, die ein griechisches Gewand und die Kausia tragen und verschiedeneObjekte in ihrer linken Hand halten (Kästchen, Schale, Pyxis oder Etui). Dieses Motiv istüberwiegend im Umland von Tyros bezeugt und nur einmal in Umm el- Amed.
Gegenüber der ersten Gruppe zeigt die zweite eine wesentlich größere Bandbreite anObjekten, die in der linken Hand gehalten werden. Die Stelen von Umm el- Amed weisen imHinblick auf die dargestellten Kultobjekte eine sehr geringe Variation auf und zeichnen sichdadurch aus, dass die Personen stereotyp bei einer Opferhandlung gezeigt werden, die mitHilfe des Kultgefäßes mit frauenförmigem Griff durchgeführt wird. Im Umland bricht diesestatische Form auf und wird durch andere Elemente erweitert.
Innerhalb des Bildprogramms der Stelen aus Umm el- Amed stehen 12 Stelen mit derDarstellung eines Mannes im Langgewand sechs Männern im knielangen Gewand und achtFrauendarstellungen gegenüber. Zur Klärung, in welchem Verhältnis die Personen im Kurz-gewand zu denen im Langgewand stehen, sind die Reliefs eines Steinblocks (Taf. 9A– C;Abb. 3) aufschlussreich, der nach Meinung der Ausgräber im Tempelkomplex des Milkasch-tart aufgestellt war und als Altar gedient hat 83. Die Frontseite (Taf. 9B) des Kalksteinblockszeigt zwischen zwei Säulen einen Volutenbaum, unter dem sich eine von zwei Stieren flan-kierte Sonnenscheibe befindet. Der Volutenbaum steht für die Vegetation und die Stiere fürden Wettergott, zu dessen Wirkungsbereich die Vegetation zählt 84. Die zwei Säulen verweisenvermutlich auf eine Tempelfassade und markieren den Handlungsort der ganzen Szenerie, beidem es sich um einen Tempel des Wettergottes handeln könnte. Die sich anschließendenSeiten (Taf. 9A und C) zeigen jeweils eine männliche Person, die mit dem Langgewandbekleidet ist und die das Kultgefäß mit dem frauenförmigen Griff hält. Auf der einen Relief-seite (Taf. 9C) folgt der Person im Langgewand ein Mann in einem knielangen Gewand. AllePersonen sind jeweils in Richtung auf die Frontseite mit dem Volutenbaum ausgerichtet undsomit auf diesen bezogen.
Die Reliefs des Steinblocks zeigen die dargestellten Personen bei einer kultischen Hand-lung. Ausgedrückt wird dies durch den Adorationsgestus und die angedeutete Tempelfassademit dem darin eingestellten Volutenbaum. Die Bildsprache differenziert zwischen den an der
82 Louvre AO 1001 und AO 14710. Eine dieser Personendarstellungen hebt sich durch das Tragen einerhellenistischen Bekleidung und durch ihre frontale Darstellungsweise von den anderen Stelen derGruppe ab.
83 DUNAND / DURU 1962, 46, 113 M.361, 151 Fig. 66, 151–153 Pl. 36,1– 2 und 37,1. Bei dem Objekthandelt es sich um einen viereckigen, 1,10m hohen Kalksteinblock, der an drei Seiten reliefiert ist.Die vierte Seite weist eine Aushöhlung in Trogform auf. Gefunden wurde der Reliefblock westlichdes Milkaschtart-Tempels unterhalb der Raumnische 35. Die Ausgräber MAURICE DUNAND undRAYMOND DURU vermuten eine Aufstellung des Objekts als Altar in dieser Nische (DUNAND / DURU1962, 151–153). Auf der Oberseite des Blocks befindet sich ein viereckiger Zapfen, der als Auflagerfür eine Platte gedient haben könnte.
84 YORK 1975; DUNAND / DURU 1962, 153. Zur Deutung des Volutenbaumes als „Weltenbaum“ sieheMETZGER 2004, 80 – 82.
ZDPV 130 (2014) 1
91Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed
A B C
Abb. 3. Steinblock aus der Nähe des Milkaschtart-Templs von Umm el- Amed: A. Linke Seite;B. Frontseite; C. Rechte Seite (Zeichnung: HENRIKE MICHELAU).
Kulthandlung beteiligten Personen. Der Mann im knöchellangen Gewand ist mit dem Kult-gefäß dargestellt und somit als derjenige Akteur gekennzeichnet, der die Kulthandlung aktivausübt. Demgegenüber wird die Person im kurzen Gewand lediglich als Teilnehmer darge-stellt, dessen Gestus die Verehrung der Gottheit zum Ausdruck bringt. Diese Differenzierungwird durch die Positionierung der Kurzgewanddarstellung hinter der Person im Langgewandverdeutlicht.
3. Zusammenfassung
Die besondere Bedeutung der beiden Tempelkomplexe aus Umm el- Amed geht bereits ausihrer zentralen Lage im Stadtgebiet sowie aus ihrer Monumentalität hervor. Sicherlich nah-men sie im politischen und wirtschaftlichen Geschehen von Umm el- Amed eine wichtigeStellung ein. Die Verwaltung solcher Tempelkomplexe bedurfte einer guten Organisation.Dies wirft die Frage nach der Struktur des „Priestertums“ in Umm el- Amed auf.
Die Forschung sieht in der Darstellung der Personen im Langgewand mit Kopfbedeckungeine Priesterdarstellung per excellence 85 und beruft sich dabei auf die epigraphische Erwäh-nung eines Priesters (khn) auf einer der Stelen (C). Allerdings zeigt die Auswertung derInschriften, dass über die Amtsbezeichnung „Priester“ (C) hinaus auch die Titel „Oberster“(B, E) und „Oberster der Tore“ (A) vertreten sind. Inhaltlich bestehen sicherlich Abgrenzun-gen der einzelnen Ämter zueinander, die heute jedoch nicht mehr eindeutig nachvollziehbarsind. Ikonographisch zeichnen sich die betreffenden Personen durch ein Langgewand mit
85 Vgl. unter anderem GALLING 1969 –70, 105; 1977; GUBEL 2002, 144.
ZDPV 130 (2014) 1
92 Henrike Michelau
Kopfbedeckung und ein in der Hand gehaltenes Kultgerät aus. Bei den Kultgeräten, die aufden Stelen aus Umm el- Amed dargestellt sind, handelt es sich in einem Fall um einen nichtsicher zu identifizierenden Gegenstand 86 und in allen anderen Fällen um ein Gefäß mit einemGriff in Form einer weiblichen Gestalt mit Doppelkrone. Diese Gefäße wurden aus Ägyptenübernommen und adaptiert. Die Stelen bezeugen, dass sie in hellenistischer Zeit im südphö-nizischen Raum innerhalb von Kulthandlungen verwendet wurden, eventuell im Zusammen-hang mit einem Reinigungs- oder Salbungsritual.
Wie eingangs erwähnt, waren die Stelen offensichtlich bei Gräbern aufgestellt und sindsomit als Grabstelen zu deuten. Im sozial- und religionsgeschichtlichen Kontext von Toten-darstellungen sind sowohl die Reliefs der Personen im Lang- und im Kurzgewand als auchdiejenigen der Frauen primär als Bildnisse von loyalen Gläubigen aufzufassen. Denn sievermitteln den Betrachtern ein Bild des Verstorbenen als Kultakteur, also als einer Person, dieihre Opferhandlungen stets ausgeübt hat.
Bibliographie
AMADASI GUZZO, M. G. / E. LIPINSKI1992 Clerge, in: E. LIPINSKI (ed.), Dictionnaire de la civilisation phenicienne et punique
(Turnhout), 114 –115.ARNDT, P. (ed.)
1912 La Glyptotheque Ny-Carlsberg. Les monuments antiques (München).ATHANASSIOU, H.
1977 Rasm et-Tanjara. A Recently Discovered Syrian Tell in the Ghab, I. Inventory of theChance Finds (Ann Arbor, London).
BARNETT, R. D.1975 A Catalogue of the Nimrud Ivories with Other Examples of Ancient Near Eastern
Ivories in the British Museum. With a Supplement by L. G. DAVIES, 2. Auflage (Lon-don).
BECK, H. / P. C. BOL / M. BÜCKLING (ed.)2005 Ägypten, Griechenland, Rom. Abwehr und Berührung. 26. November 2005 bis 26.
Februar 2006. Begleitheft zur Ausstellung (Frankfurt am Main).BENICHOU-SAFAR, H.
1982 Les tombes puniques de Carthage. Topographie, structures, inscriptions et rites funerai-res (Etudes d’Antiquites africaines; Paris).
BEN-SHLOMO, D.2010 Philistine Iconography. A Wealth of Style and Symbolism (Orbis Biblicus et Orientalis
241; Fribourg, Göttingen).BONNET, C.
2010 Die Religion der Phönizier und Punier, in: C. BONNET/ H. NIEHR, Religionen in derUmwelt des Alten Testaments, II. Phönizier, Punier, Aramäer (Studienbücher Theologie4/2; Stuttgart), 11–185.
CHARLES-PICARD, G.1955 Catalogue du Musee Alaoui. Nouvelle serie (Collections puniques 1; Tunis).
CHEHAB, M. H.1934 Trois steles trouvees en Phenicie, in: Berytus 1, 44 – 46.1951– 52 Les terres cuites de Kharayeb, I. Texte, in: Bulletin du Musee de Beyrouth 10, 1–186.1953 – 54 Les terres cuites de Kharayeb, II. Planches, in: Bulletin du Musee de Beyrouth 11.1956 Nouvelles Steles d’Oum el- Awamid, in: Bulletin du Musee de Beyrouth 13, 43 – 52.
CLERMONT-GANNEAU, C.1903 Recueil d’archeologie orientale, V (Paris).
86 Entweder ein Kästchen mit vogelförmigem Griff oder ein Altar mit Vogelopfer.
ZDPV 130 (2014) 1
93Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed
DAYAGI -MENDELS, M.1989 Perfumes and Cosmetics in the Ancient World (Israel Museum Catalog 305; Jerusalem).
DECKER, W. / M. HERB1994 Bildatlas zum Sport im alten Ägypten. Corpus der bildlichen Quellen zu Leibesübungen,
Spiel, Jagd, Tanz und verwandten Themen, I – II (Handbuch der Orientalistik I 14;Leiden, New York, Köln).
DOMMERSHAUSEN, W.1984 ñhÈ KÊ II.1. – VIII., in: G. BOTTERWECK/ H. RINGGREN/ H.-J. FABRY (ed.), Theologisches
Wörterbuch zum Alten Testament, IV (Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz), 68 –79.DOTAN, T.
1998 Cultural Crossroads. Deir el-Balah & the Cosmopolitan Culture of the Late Bronze Age,in: Biblical Archaeology Review 24/5, 24 – 37.70.72.
DUNAND, M.1944 – 45 Fouilles d’Oum el-Amed, in: Bulletin du Musee de Beyrouth 7, 110 –115.
DUNAND, M. / R. DURU1962 Oumm el- Amed. Une ville de l’epoque hellenistique aux echelles de Tyr, I – II (Etudes
et documents d’archeologie 4; Paris).FABRY, H.-J.
1993 brÅ I.1. – II.2., in: H.-J. FABRY / H. RINGGREN (ed.), Theologisches Wörterbuch zumAlten Testament, VII (Stuttgart, Berlin, Köln), 294 – 300.
FERRON, J.1976 Mort-dieu de Carthage ou les steles funeraires de Carthage, I – II (Collection cahiers de
Byrsa. Monographies 2; Paris).FISCHER, E.
2007 Ägyptische und ägyptisierende Elfenbeine aus Megiddo und Lachisch. Inschriftenfunde,Flaschen, Löffel (Alter Orient und Altes Testament 47; Münster).
FONTAN, E.2012 Priest Holding an Incense-Burner, in: A. CHAMBON (ed.), Gaza from Sand and Sea,
I. Art and History in the Jawdat al-Khoudary Collection (Gaza), 66 – 67.GALLING , K.
1969 –70 Ein phönikisches Kultgerät(?) aus Kreta, in: Die Welt des Orients 5, 100 –107.1977 Priesterkleidung, in; K. GALLING (ed.), Biblisches Reallexikon (BRL2), 2. Auflage
(Handbuch zum Alten Testament I 1; Tübingen), 256 – 257.GUBEL, E.
1986 Une nouvelle representation du culte de la Baalat Gebal?, in: C. BONNET/ E. LIPINSKI / P.MARCHETTI (ed.), Religio Phoenicia. Acta Colloquii Namurcensis habiti diebus 14 et 15mensis Decembris anni 1984 (Studia Phoenicia 4; Collection d’etudes classiques 1;Namur), 263 – 276.
2002 Art phenicien. La sculpture de tradition phenicienne (Paris, Gand).HEUZEY, L.
1902 Archeologie orientale, in: Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendusdes seances de l’annee 46/2, 190 – 206.
HOFTIJZER, J. / K. JONGELING1995 Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions. With Appendices by R. C. STEINER et
al. (Handbuch der Orientalistik I 21; Leiden, New York, Köln).INGHOLT, H.
1926 – 28 Ba aljatons Gravstele et sen-Fønikisk Portræt, in: Kunstmuseets aarsskrift 13 –15,81– 94.
JACOBSEN, C.1907 Ny Carlsberg Glyptotek (Kopenhagen).
JANSSEN, E.2007 Die Kausia. Symbolik und Funktion der makedonischen Kleidung [Dissertation; Georg-
August-Universität Göttingen].KAI
H. DONNER/ W. RÖLLIG, Kanaanäische und aramäische Inschriften, I, 5. Auflage (Wies-baden 2002).
ZDPV 130 (2014) 1
94 Henrike Michelau
KAMLAH , J.2008 Die Bedeutung der phönizischen Tempel von Umm el-Amed für die Religionsgeschichte
der Levante in vorhellenistischer Zeit, in: M. WITTE / J. F. DIEHL (ed.), Israeliten undPhönizier. Ihre Beziehungen im Spiegel der Archäologie und der Literatur des AltenTestaments und seiner Umwelt (Orbis Biblicus et Orientalis 235; Fribourg, Göttingen),125 –164.
KEIMER, L.1952 Remarques sur les ‘cuillers a fard’ du type dit a la nageuse, in: Annales du Service des
Antiquites de l’Egypte 52, 59 –72.KOZLOFF, A. P.
1993 Amenophis III. Le Pharaon-Soleil (Paris).KOZLOFF, A. P. / B. M. BRYAN
1992 Egypts Dazzling Sun. Amenhotep III and His World (Cleveland).LIDZBARSKI, M.
1907 Altsemitische Texte herausgegeben und erklärt, I. Kanaanäische Inschriften (moabitisch,althebräisch, phönizisch, punisch) (Giessen).
LOBSTEIN, D.1984 Objets de toilette ou objets de culte? A propos de cuillers »a la nageuse«, in: La Revue
du Louvre et des Musees de France 34, 235 – 237.LOHWASSER, A.
2008 Schwimmen – Kulturtechnik und Darstellung im Land am Nil. Mit einem Exkurs zu denso genannten »Schwimmerinnen« als Löffelgriff, in: Nikephoros – Zeitschrift für Sportund Kultur im Altertum 21, 53 – 80.
MAES, A.1991 Le costume phenicien des steles d’Umm el- Amed, in: E. LIPINSKI (ed.), Phoenicia and
the Bible. Proceedings of the Conference Held at the University of Leuven on the 15thand 16th of March 1990 (Studia Phoenicia 11; Orientalia Lovaniensia Analecta 44;Löwen), 209 – 230.
MAZZONI, S.2005 Pyxides and Hand-Lion Bowls. A Case of Minor Arts, in: C. E. SUTER/ C. UEHLINGER
(ed.), Crafts and Images in Contact. Studies on Eastern Mediterranean Art of the FirstMillennium BCE (Orbis Biblicus et Orientalis 210; Fribourg, Göttingen), 43 – 66.
MENDEL, G.1966 Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzantines, I (Rom).
METZGER, M.2004 Der Weltenbaum in vorderorientalischer Bildtradition, in: M. METZGER, Vorderorienta-
lische Ikonographie und Altes Testament. Gesammelte Aufsätze, ed. M. PIETSCH/ W.ZWICKEL (Jerusalemer Theologisches Forum 6; Münster), 77– 89.
MICHELAU, H.in press Recovering a Lost Phoenician Cult Object, in: Bulletin d’Archeologie et d’Architecture
Libanaise.NIEHR, H.
1998 Religionen in Israels Umwelt. Einführung in die nordwestsemitischen Religionen Sy-rien-Palästinas (Die neue Echter-Bibel. Ergänzungsband zum Alten Testament 5; Würz-burg).
2010 Die Grabstelen zweier Priester des Mondgottes aus Neirab (Syrien) im Lichte alter undneuer Funde, in: S. ERNST/ M. HÄUSL (ed.), Kulte, Priester, Rituale. Beiträge zu Kultund Kultkritik im Alten Testament und Alten Orient. Festschrift für Theodor Seidl zum65. Geburtstag (Arbeiten zu Text und Sprache im Alten Testament 89; St. Ottilien),41– 59.
OTTO, E.1995 ryÅwÏÅ , in: H.-J. FABRY / H. RINGGREN (ed.), Theologisches Wörterbuch zum Alten Testa-
ment, VIII (Stuttgart, Berlin, Köln), 358 – 403.PARLASCA, K.
1982 Syrische Grabreliefs hellenistischer und römischer Zeit. Fundgruppen und Probleme(Trierer Winckelmannsprogramme 3; Mainz am Rhein).
ZDPV 130 (2014) 1
95Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed
PARROT, A. / M. H. CHEHAB / S. MOSCATI1977 Die Phönizier. Die Entwicklung der phönizischen Kunst von den Anfängen bis zum
Ende des dritten Punischen Krieges (Universum der Kunst [23]; München).QUACK, J. F.
2003 Das nackte Mädchen im Griff halten. Zur Deutung der ägyptischen Karyatidenspiegel,in: Die Welt des Orients 33, 44 – 64.
REICHERT, A.1977 Kultgeräte, in: K. GALLING (ed.), Biblisches Reallexikon (BRL2), 2. Auflage (Hand-
buch zum Alten Testament I 1; Tübingen, 189 –194.RINGGREN, H.
1984 ñhÈ KÊ I.2., in: G. J. BOTTERWECK/ H. RINGGREN/ H.-J. FABRY (ed.), Theologisches Wör-terbuch zum Alten Testament, IV (Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz), 66 – 68.
SCHMIDT, V.1912 Monuments egyptiens, in: ARNDT (ed.) 1912, 47– 83.
SCHÖPFLIN, K.2007 Wächter, erstellt April 2007, http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/
lexikon/sachwort/anzeigen/details/waechter-3/ch/2facc824793a6005e9261c5632d1ef32/[10. 07. 2013].
STUCKY, R. A.1973 Pretres Syriens I. Palmyre, in: Syria, 163 –180.1976 Pretres Syriens II. Hierapolis, in: Syria 53, 127–140.2005 Pretres Syriens III. Le relief votif du pretre Gaios de Killiz et la continuite des motifs
proche-orientaux aux epoques hellenistique et romaine, in: P. BIELINSKI / F. M. STEP-NIOWSKI (ed.), Aux pays d’Allat. Melanges offerts a Michal Gawlikowski (Warschau),277– 284.
2012 Le culte d’Echmoun a Boustan ech-Cheikh, Sidon, in: MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE(ed.), Fascination du Liban. Soixante siecles d’histoire de religions, d’art et d’archeo-logie (Mailand), 83 – 93.
VANDIER D’ABBADIE, J.1972 Catalogue des objets de toilette egyptiens (Paris).
VELLA , N.2000 Defining Phoenician Religious Space. Oumm el- Amed Reconsidered, in: Ancient Near
Eastern Studies 37, 27– 55.WAGNER, P.
1980 Der ägyptische Einfluß auf die phönizische Architektur (Habelts Dissertationsdrucke.Reihe klassische Archäologie 12; Bonn).
WALLERT, I.1967 Der verzierte Löffel. Seine Formgeschichte und Verwendung im alten Ägypten (Ägyp-
tologische Abhandlungen 16; Wiesbaden).YORK, H.
1975 Heiliger Baum, in: D. O. EDZARD (ed.), Reallexikon der Assyriologie und Vorderasia-tischen Archäologie, IV (Berlin, New York), 269 – 282.
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 130 (2014) 1 Tafel 3
B
A
C
Stele des Baalschamar, des Obersten der Tore (A) mit Detailaufnahme des Kästchens (B) und dessenUmzeichnung (C); zur Verfügung gestellt durch: The National Museum of Beirut;
Zeichnung: HENRIKE MICHELAU.
Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed (Seiten 77– 95)
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 130 (2014) 1 Tafel 4
B
C
A
Stele des Baalyaton, des Obersten (A) mit Detailaufnahme des Gefäßes (B) und dessenUmzeichnung (C); zur Verfügung gestellt durch: Ny Carlsberg Glyptotek, København;
Zeichnung: HENRIKE MICHELAU.
Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed (Seiten 77– 95)
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 130 (2014) 1 Tafel 5
B
C
A
Stele des Baalyaton, des Priesters des Milkaschtart (A) mit Detailaufnahme des Gefäßes (B)und dessen Umzeichnung (C) nach DUNAND / DURU 1962, Pl. 79:3;
Zeichnung: HENRIKE MICHELAU.
Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed (Seiten 77– 95)
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 130 (2014) 1 Tafel 6
AB
C
Fragment einer Stele (A) mit Detailaufnahme des Gefäßes (B) und dessen Umzeichnung (C)nach DUNAND / DURU 1962, Pl. 81:1; Zeichnung: HENRIKE MICHELAU.
Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed (Seiten 77– 95)
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 130 (2014) 1 Tafel 7
A B
C
Fragment einer Stele (A) mit Detailaufnahme des Gefäßes (B) und dessen Umzeichnung (C)nach DUNAND / DURU 1962, Pl. 82:1; Zeichnung: HENRIKE MICHELAU.
Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed (Seiten 77– 95)
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 130 (2014) 1 Tafel 8
B
A
C
Stele mit einem Mann und einer Frau (A) mit Detailaufnahme des Gefäßes (B)und dessen Umzeichnung (C) nach DUNAND / DURU 1962, Pl. 78:1;
Zeichnung: HENRIKE MICHELAU.
Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed (Seiten 77– 95)
Zeitschrift
desD
eutschenP
alästina-Vereins
130(2014)
1Tafel
9
A B C
Steinblock, in der Nähe des Milkaschtart-Tempels aufgefunden, mit linker Seite (A), Frontseite (B) und rechter Seite (C)nach DURAND /DURU 1962, Pl. 36:1– 2 und 37:1.
Hellenistische
Stelen
mit
Kultakteuren
ausU
mm
el-
Am
ed
(Seiten
77–
95)
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 130 (2014) 1 Tafel 10
Terrakottafigurinen aus el-H˘
ara ib nach CHEHAB 1953 – 54, Pl. 9 und 10:2.
Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed (Seiten 77– 95)
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 130 (2014) 1 Tafel 11
A
B
C
Gefäße mit frauenförmigem Griff aus Maiyana, 18. Dynastie (A), Ägypten, 18. Dynastie (B – C)nach WALLERT 1967, Taf. 11:P35, 12:N22 und 13:P34.
Hellenistische Stelen mit Kultakteuren aus Umm el- Amed (Seiten 77– 95)