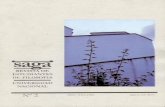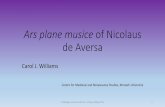\"Nicolaus Ficke.. der sich mit Physiognomie, Astrologie etc. abgab, übrigens ein schlechter Mann...
Transcript of \"Nicolaus Ficke.. der sich mit Physiognomie, Astrologie etc. abgab, übrigens ein schlechter Mann...
„Nicolaus Ficke... der sich mit Physiognomie, Astrologie etc. abgab, übrigens
ein schlechter Mann war“
Biographische Notizen zum Kepler-Briefpartner Nicolaus von Vicken
Nils Lenke, Rheinbach und Nicolas Roudet, Straßburg1
1. Einleitung 1.1 Einführung
Im Umfeld Johannes Keplers haben auch viele weniger bedeutende Gestalten die
Aufmerksamkeit der Forschung gewonnen, so z.B. Helisaeus Röslin2, David Fabricius
3 oder
Philipp Feselius4, und viele andere mehr. Und doch gibt es hier noch mehr zu entdecken. So
hat es Nicolaus von Vicken5 immerhin auf einen Briefwechsel mit Kepler von mehr als einem
Dutzend Briefen gebracht6, er ist der erste dokumentierte Leser von Keplers „Astronomia
Nova“7
und das Bindeglied zwischen Kepler und Simon Marius; von Marius frühen
Fernohrbeobachtungen weiß Kepler nur durch einen Brief von Vickens, den er im Vorwort
seines Buches Dioptrice auch zitiert.8 Zudem hat sich Kepler auch in Vickens Stammbuch
verewigt, und nicht nur er, sondern auch Tycho Brahe und der astronomisch sehr interessierte
Simon VI zur Lippe9. Schwarz hat dieses Stammbuch ediert
10. Auch an David Fabricius hat
Vicken geschrieben11
. War er also ein Astronom oder Astrologe, der noch zu entdecken wäre?
Bisher gibt es zu wenig an veröffentlichten biographischen Informationen zu diesem Nicolaus
von Vicken, um diese Frage zu beantworten. Schwarz‘ eigener biographischer Abriss
1 Die Autoren danken den Gutachtern für ihre wertvollen Hinweise zu einer Vorversion dieses Aufsatzes, sowie
Konrad Kögler und Concetta Luna für Ihre Hilfe bei der Transkription und Identifizierung einiger lateinischer
und griechischer Zitate. 2 Wilhelm Kühlmann: „Eschatologische Naturphilosophie am Oberrhein – Helisaeus Röslin (1554-1616) erzählt
sein Leben.“, in: Günter Frank, Anja Hallacker, Sebastian Lalla: „Erzählende Vernunft“, Berlin: Akademie-
Verlag, 2006, S. 153-174; Miguel Granada: „Helisaeus Röslin on the eve of the appearance of the nova of 1604:
his eschatological expectations and his intellectual career as recorded in the Ratio studiorum et operum meorum
(1603-1604).”, in: Sudhoffs Archiv, Band 90 (2006), S. 75-96 3 Menso Folkerts: „Johannes Kepler und David Fabricius“, in: Edouard Mehl (Hrsg.): „Kepler. La Physique
Céleste. Autour de L’Astronomia Nova (1609)“, Paris: Les Belles Lettres, 2011, S. 43-66 4 Nils Lenke und Nicolas Roudet, “Philippus Feselius. Biographische Notizen zum unbekannten Medicus aus
Keplers Tertius Interveniens“, in: Kepler, Galilei, das Fernrohr und die Folgen, hrsg. von Karsten Gaulke u.
Jürgen Hamel [= Acta historica Astronomiae ; 40], Frankfurt/Main : H. Deutsch, 2010, S. 131-159. 5 Der Name taucht in vielen Varianten auf: Nikolaus, Nicolas, Niclas, Claus usw. als Vorname und Vicke,
Viccius, Ficke, Ficken, Ficcius, usw. als Nachname. Außerhalb von Zitaten wird durchgehend hier die Form
Nicolaus von Vicken verwendet 6 Siehe Michael Gottlieb Hansch: “Johannis Keppleri Aliorumque Epistolae mutuae“, 1718, S. 306ff; Siehe
Kepler, Gesammelte Werke (KGW) Band 15, S. 283für den Brief aus dem Jahr 1605, S. 532 für den
„Nachbericht“ dazu; KGW 16, S. 256-390 für die Briefe selbst und S. 444-469 für die „Nachberichte“ zu den
Briefen aus dem Jahr 1609-11; 7 H. Darrel Rutkin: „Celestial Offerings: Astrological Motifs in the Dedicatory Letters of Kepler’s Astronomia
Nova and Galieo’s Sidereus Nuncius“, in: William R. Newman, Anthony Grafton (Hrsgg.): “Secrets of Nature.
Astrology and Alchemy in Early Modern Europe”, Cambridge/London: MIT Press, 2001, S. 133-172; S. 156 8 Cornelia Liesenfeld: “Die Astronomie Galileis und ihre Aktualität heute und morgen”, Münster: Lit 2003, S. 65
9 Michael Bischoff: „Graf Simon VI. zur Lippe (1554–1613). Ein europäischer Renaissanceherrscher“,
Weserrenaissance-Museum Schloß Brake, Lemgo 2010; Schwarz 2002, S. 327 liest den Namen als „Kipp“ 10
Christiane Schwarz: „Studien zur Stammbuchpraxis der Frühen Neuzeit. Gestaltung und Nutzung des Album
amicorum am Beispiel eines Hofbeamten und Dichters, eines Politikers und eines Goldschmieds (etwa 1550 bis
1650) (= Mikrokosmos. Beiträge zur Literaturwissenschaft und Bedeutungsforschung; Bd. 66), Bern / Frankfurt
a.M.: Peter Lang 2002 11
Dr. Bunte: „Über David Fabricius. Zweiter Teil. Auszüge aus dem Briefwechsel des David Fabricius mit
Kepler“, in: Jahrbuch der Ges. für bildende Kunst und vaterländ. Altertümer zu Emden, Band 7, Heft 2, 1887, S.
18-66; S. 48
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
2
beschränkt sich auf gerade einmal eine halbe Druckseite; sie stellt fest, es gäbe „wenige
biographische Quellen“12
. Sie behandelt von Vicken dabei nicht als Astronomen, sondern als
Politiker. Sicherlich eine berechtigte Sichtweise, hat dieser aus Riga stammende Adlige doch
in drei Kriegen u.a. dem polnischen und schwedischen König gedient, mehreren Kaisern und
zahlreichen Fürsten; sein Leben entpuppt sich dabei als ein möglicher Stoff für
Abenteuerromane, wie wir noch sehen werden.
Für Suermann hingegen ist derselbe Nicolaus von Vicken ein „dubioser Magier aus
Hildesheim“13
. Auch diese Sichtweise ist nicht von der Hand zu weisen, wie sich zeigen wird.
Sollte er also doch eher als „Alchemist“ einsortiert und biographisch gewürdigt werden?
Auch ein solches Unterfangen kann ergiebig sein und einen Einblick in den Beginn der
modernen Wissenschaft ermöglichen, wie wir spätestens seit Moran und Nummedal wissen,
und die Alchemie war ein weites Feld, sowohl was Personen als auch Themen angeht, und
unser Proband fügt diesem Bild durchaus eine interessante Facette hinzu.14
Oder war er ganz einfach „ein schlechter Mann“, wie es ein Archivar in Wolfenbüttel
aufgeschrieben hat15
und es im Titel wiedergegeben wurde? Eine Antwort auf diese Fragen
versucht diese biograpische Skizze. Dazu ergänzt sie auch das Stammbuch, denn auch wenn
Schwarz feststellt, die Edition desselben mache auch ohne biographischen Hintergrund Sinn16
,
so ist es doch erhellend, aus der Biographie heraus zu erkennen, warum sich z.B. von Vicken
und zahlreiche Einträger in seinem Stammbuch so ausführlich mit der Frage des „wahren
Adels“ im Verhältnis zum Geburtsadel beschäftigt haben.17
Oder warum in diesem
Stammbuch eine mehrjährige Lücke ohne Einträge klafft. Möglich ist dies, weil die Suche
nach weiteren Quellen, die über von Vickens‘ Leben Aufschluss geben können, ergiebiger war
als, als es Schwarz‘ oben zitierte pessimistische Feststellung erwarten ließ.
1.2 Quellen
Eine der Hauptquellen bleibt natürlich das Stammbuch Vickens. Ihm sind nicht nur indirekte
Hinweise aufgrund der Eintragungsorte und der eintragenden Personen zu entnehmen,
sondern es enthält auch eine kurze biographische Selbstaussage. Diese Hinweise werden noch
ergiebiger im Zusammenspiel mit den neu entdeckten Quellen.
Dazu gehören zunächste einige veröffentlichte Briefe, darunter natürlich die Keplerbriefe, der
erwähnte Hinweis auf einen Brief an Fabricius sowie Briefe an den schwedischen Herzog
Karl aus dem Reichsarchiv in Stockholm18
. Dazu kommt ein Brief an den ungarischen
Adligen Emerico Thurzo.19
Darüber hinaus konnten aber in verschiedenen Archiven zahlreiche weitere unveröffentlichte
Briefe und sonstige Schriftstücke lokalisiert werden, die – neben einem Brief aus dem Jahr
1596 - vor allem die Jahre 1603-1617 abdecken, also eine Periode, die recht gut mit dem
Schriftwechsel mit Kepler übereinstimmt (1605-1620). Zudem hilft dies, eine Lücke von 8
12
Schwarz 2002, S. 77 13
Marie-Theres Suermann: „Zur Baugeschichte und Ikonographie des Stadthagener Mausoleums“, in
Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte, Band 22, 1983, S. 67-90, S. 69 14
Bruce T. Moran: „Distilling Knowledge. Alchemy, Chemistry, and the Scientific Revolution”, Cambridge
Mass.: Harvard University Press 2005, S. 9 15
Deckblatt der Akte STAWO 1 Alt 5a Nr. 102a 16
Schwarz 2002, S. 126 17
Schwarz 2002, S. 127 18 Fr. Beinemann jun.: „Zur Geschichte der livländischen Ritter- und Landschaft 1600-1602. Briefe und
Aktenstücke“, in: Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands 17, 1900, S. 463-600 19
Siehe: Befejezö Közlemény: „Gróf Batthyány József. Köpcsényi Levéltárából“, in Történelmi tár, 1888, S.
609-662, S. 619; Zu Thurzo siehe auch Schwarz 2002, S. 120, Thurzo ist auch mit einem Eintrag im Stammbuch
vertreten. Auch hier (Emmerich Thurzo); zu ihm siehe auch: Joseph von Hormayr: „Taschenbuch für die
vaterländische Geschichte“, 19. Jahrgang (NF), Berlin: Reimer 1848, S. 129f.
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
3
Jahren zu schließen, die sich im Stammbuch auftut; zwischen 1611 und 1619 erfolgten dort
keine Eintragungen. Weiterhin erklären die Funde auch (wie wir sehen werden), warum es
diese Lücke gibt, und auch warum der Briefwechsel mit Kepler ebenfalls nach 1611 zunächst
zum Erliegen kam (und erst 1620 fortgesetzt wurde).
Da sich von Vicken eine ganze Zeit lang im Dunstkreis der welfischen Höfe und ihrer
Verwandten bewegte, haben die dortigen Archive, Wolfenbüttel, Hannover und Bückeburg,
den meisten Ertrag geliefert. Im Einzelnen:
In Hamburg findet sich in der Uffenbach-Wolfschen Briefsammlung ein Brief von
Nicolaus von Vicken an Joh. Georg Gödelmann, datiert Leipzig 8.12.159620
In Wolfenbüttel findet sich zum einen eine Akte21
, die sich um die Tätigkeit eines
Bruders von Nicolaus, Heinrich von Vicken, als Hofmeister bei Herzog Joachim Karl
(1573-1615)22
, dreht und in der der Nicolaus auch eine Rolle spielt. Zum anderen wird
dort eine Gerichtsakte23
von ca. 900 Seiten aufbewahrt, die zahlreiche interessante
Dokumente enthält.
In Hannover findet sich eine an Kaiser Rudolf II adressierte, 12 Folios umfassende
„Kurze verandtwortung vnd Refutation derer beschuldigungen, damit von der
königlichen würden in Polen, zur vnschuld belegt wirtt“ aus dem Jahr 160424
, sowie
ein Bestand von Briefen25
, die sich mit einer Inhaftierung Nicolaus von Vickens im
Jahr 1609 in Halberstadt beschäftigen, und schließlich ein Brief26
der Wolfenbütteler
Räte an den abwesenden Herzog Friedrich Ulrich (1591-1634)27
, in dem sie auch auf
den Rechtsstreit mit Nicolaus von Vicken eingehen.
In Bückeburg befinden sich in zwei Beständen28
insgesamt acht Dokumente aus dem
Jahr 1614, darunter in Kopie ein „Entschuldigungsbrief“ an die Regentin Elisabeth
von Braunschweig-Wolfenbüttel (1573–1625), sechs Briefe an Graf Ernst zu Holstein-
Schaumburg (* 24. September 1569 in Bückeburg; † 17. Januar 1622 ebendort), sowie
eine Anlage. Besonders interessant ist aus biographischer Sicht dabei neben dem
Schreiben an Elisabeth ein Brief an Graf Ernst, der einen „Cursus vitae et
studiorum“ enthält.29
In Wien finden sich im Haus-, Hof- und Staatsarchiv, sowie im Habsburg-
Lothringischen Staatsarchiv insgesamt fünf Nicolaus von Vicken betreffende Briefe.30
In Stockholm liegen im Kriegsarchiv neben den oben erwähnten publizierten Briefen
weitere Dokumente; einige erwähnt z.B. Sjödin31
. Vier Briefe wurden für diese Arbeit
ausgewertet.32
20
Nilüfer Krüger: „Supellex Epistolica Uffenbachii et Wolfiorum. Katalog der Uffenbach-Wolfschen
Briefsammlung. Zweiter Teilband“, Hamburg: Hauswedell, 1978, S. 1060; Signatur des Briefes: Sup. ep. 103,
fol. 152-153 21
STAWO Best. 3 Alt, Nr. 359 22
Ein jüngerer Bruder von Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel, der zeitweise Domprobst in
Strassburg war. Siehe Inge Mager: „Die Konkordienformel im Fürstentum Braunschweig-
Wolfenbüttel“ Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1993, S. 331n 23
STAWO 1 Alt 5 Nr. 102a-d 24
HSTAH Best. Celle Br. 16, Nr. 552 25
HSTAH Best. Celle Br. 71, Nr. 123 26
HSTAH Best. Cal. Br. 22, Nr. 1860 27 Artikel „Friedrich Ulrich, Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel“ von Ferdinand Spehr in: ADB, Band 7
(1878), S. 501–505 28
STABU Best. F3, Nr. 239 und 240 29
STABU Best. F3, Nr. 240 30
AT-OeStA/HHStA RHR Passbriefe 17-3-38, AT-OeStA/HHStA RHR Schutzbriefe 14-2-25, AT-
OeStA/HHStA HausA Lang-Akten 2-2-65, AT-OeStA/HHStA HausA Lang-Akten 5-1-8 31
Lars Sjödin: „Hans Bilefeldt rapporter till Knut Person“, Historisk Tidskrift, Stockholm 1939, S. 419-449, S.
432n.
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
4
In Magdeburg findet sich ein Vorgang aus den Jahren 1624/5, in dem Heinrich und
auch Nicolaus von Vicken eine Rolle spielen33
; dieser Bestand wurde bereits von
verschiedenen Autoren ausgewertet, s.u., Kapitel 8.
In Innsbruck liegt die Korrespondenz Nicolaus von Vickens mit Erzherzog
Maximilian.34
Diese ist von J. Hirn35
ausgewertet worden (s.u., Kapitel 3.1) und wurde
bisher noch nicht im Original eingesehen; hier ist evtl. noch interessantes Material für
zukünftige Arbeiten zu erwarten.
2. Die Jugend und Erziehung eines Politikers
2.1 Riga im 16. Jahrhundert Um Nicolaus von Vickens Biographie zu verstehen, muss man sich zunächst die Situation
seiner Heimat Riga um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert vergegenwärtigen. Seit 1522
war Riga reformiert und der letzte Bischof dankte 1561 ab. Dies tat im selben Jahr auch der
Ordensmeister des Deutschen Ordens, der von Riga aus bis dahin die baltischen Besitztümer
des Ordens regiert hatte; er und seine Nachfolger schielten aber vom neuen Ordenssitz
Mergentheim aus noch gelegentlich nach diesen. So dominierten ab dieser Zeit noch stärker
als bisher die reichen Kaufmannsfamilien das politische Leben Rigas. Auch das
wirtschafliche Leben wurde von ihnen und ihrem Handel geprägt, schließlich war Riga bereits
seit 1282 Mitglied der Hanse.
Auch Nicolaus von Vicken entstammte einer solchen reichen, aber zunächst noch bürgerlichen
Kaufmannsfamilie, in der der Vorname „Nicolaus“ (auch als „Niclas“ oder „Claves“) in jeder
Generation vorkam.36
Der Großvater, ebenfalls mit diesem Vornamen, taucht in den
Erbebüchern und anderen Quellen zwischen 1534 und 1564 wegen zahlreicher
Immobiliengeschäfte auf; er besaß offenbar mehrere Häuser, Scheunen und Gärten. 1557 wird
er zudem als Ratsherr genannt, 1559 als „Ziegelherr“ (Aufseher über die städtischen
Ziegelöfen)37
und 1563/65 als Stadtkämmerer. Noch mehr Ämter füllte sein Sohn, wiederum
ein Nicolaus (+ 14.12.1591) und der Vater „unseres“ Nicolaus, aus. 1572 wird er Bürger,
später Ratsherr und 1580 „Oberamtsherr“, auch als Bürgermeister und Burggraf wird er
genannt. 1564 heiratete er Katrine Hane, die die Mutter unseres Nicolaus wurde. Als Witwe
Johann Dullens brachte sie dessen Anteile an einer in Köln und Riga ansässigen Handelsfirma
in die Ehe ein, die über Amsterdam und Seeland Wein, Brandwein und Essig nach Riga
importierte und auf dem Rückweg Roggen, Flachs, Talg, Wachs und Teer exportierte;
hierüber gibt eine Gerichtsakte aus dem Historischen Archiv Köln Auskunft (u.a. gab es Streit
mit dem Kölner Zweig der Familie über die Kosten für ein gesunkenes Handelsschiff).38
32
Reichsarchiv Stockholm, Signatur: Riksregistraturet, vol. 94 33
Landesarchiv Magdeburg, Best. Rep. A 3a Domkapitel zu Magdeburg, Tit. I, Nr ad 18 34
Tiroler Landesarchiv, Best. Kanzlei Erzherzog Maximilian III. 1596-1618 35
J. Hirn: “Die Renuntiation des Deutschmeisters Maximilian auf Polen und die damit zusammenhängenden
Pläne. Ein Beitrag zur Geschichte der österreichisch-nordischen Politik in den Tagen Rudolfs II.“, in:
Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung, IV. Ergänzungsband, Innsbruck: Wagner
1893, S. 248-96 36
Die folgende Darstellung der Familienverhältnisse basiert auf J.G.L. Napiersky: Die Erbebücher der Stadt
Riga 1384-1579, Riga: Gesellschaft für Geschichte und Alterthumkunde der Ostseeprovinzen Russlands, 1887;
H. J. Bötführ: „Die Livländer auf auswärtigen Universitäten in vergangenen Jahrhunderten, Erste Serie: Prag,
Köln, Erfurt, Rostock, Heidelberg, Wittenberg, Marburg, Leyden, Erlangen“, Riga: W. F. Häcker 1884, S. 79f.;
Karina Kulbach-Fricke: Familienbuch Riga (auf CD), Selbstverlag 2010 und persönliche Mitteilung; Esa A.
Reiman: „Der Tod vom D. Gotthard Welling[k] i.J. 1586.
http://personal.inet.fi/koti/ear/Wellingk,%20Gotthard%20I.pdf (11.9.2011) 37
C.E. Napiersky: „Riga’s ältere Geschichte in Uebersicht, Urkunden und alten Aufzeichnungen
zusammengestellt. Band 4“, Neudruck der Ausgabe 1835-1847, Osnabrück: Zeller 1968, S. 122 38
Best 310D, Reichskammergericht Buchstabe D, A 20; siehe Findbuch:
http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=2&tektId=171&id=0350&klassId=1; die
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
5
Außenpolitisch lagen Riga und das umliegende Livland eingekeilt zwischen Russland und
Polen auf der einen und dem auftstrebenden Schweden auf der anderen Seite. Ab 1561 und
verstärkt nach 1580 geriet Riga zunächst in den Einflussbereich Polens, das jedoch selbst
politisch unruhige Zeiten durchlebte. Bis 1587 regierte der Siebenbürger Stephan Bátory39
,
der durch Heirat mit der Thronerbin überraschend König von Polen-Litauen geworden war; in
seine Zeit fielen die sogenannten „Kalenderunruhen“ in Riga. Dabei handelte es sich um
bürgerkriegsähnliche Zustände, die dadurch ausgelöst wurden, dass das katholische Polen
versuchte, das reformierte Riga zu re-katholisieren, u.a. durch die zwangsweise Einführung
des gregorianischen Kalenders. Diese Bemühungen, die Riga in Polenfreunde und -feinde
spaltete, blieben letztlich erfolglos. Vor diesem Hintergrund ist zudem die Tatsache zu sehen,
dass Nicolaus Vicken (Vater), zusammen mit seinen Brüdern Johann und Hermann vom
polnischen König 1580 geadelt wurde.40
Dabei war die Nobilitierung später strittig, wie wir in
Nicolaus‘ Fall noch sehen werden, und ein Neffe, der in schwedischen Diensten stand, musste
sich 1659 vom Rigaischen Rat bestätigen lassen, dass sein Adelsbrief verloren gegangen
war.41
Der schwedische Zweig führte jedoch noch dasselbe Wappen, wie es auch
Nicolaus‘ Siegel bereits zeigen.42
Weiteres Zeichen für die einflussreiche Stellung der Familie Vicken ist die Tatsache, dass
Nicolaus Vicken (Vater) vom polnischen König (indirekt durch Verpfändung) 1576 die Burg
Tarwast erhielt.43
Nach dem Tod Bathorys wurde Sigismund III Wasa44
König von Polen-
Litauen, der bis zu seiner Absetzung 1599 auch König des protestantischen Schwedens war.
In diese Situation hinein wird nun „unser“ Nicolaus Vicken geboren. Dies geschah wohl kurz
nach 1570, wie sich aus einer Rückrechnung aus seiner (vermutlichen) Immatrikulation in
Königsberg ergibt (s.u.). Er könnnte am 29.4.1572 geboren sein, und zwar um 7:45 Uhr
vormittags. Denn Johannes Kepler hat ein Horoskop für „Nicolaus von Vicke“ mit diesem
Datum (und der ungefähren geographischen Breite von Riga, 57°30‘) erstellt.45
Allerdings
gibt es auch einen Brief von Vickens an Kepler, in dem er um die Erstellung dreier Horoskope
bittet, darunter eines für sich selbst, und dort gibt er „als meyne genitur 1571. die 21. Juny
hora 12.m. 15. P.M. 57° 40‘“46
. Bis zur Auffindung weiterer Quellen kann dieses Rätsel nicht
gelöst werden. Nicolaus hatte (mindestens) zwei Brüder, Heinrich und Dietrich47
, wie sich u.a.
aus einem Brief Heinrichs ergibt.48
Für den heranwachsenden Knaben dürften die bereits
Akte ist unter den Verlusten des Archiveinsturzes vom 3.3.2009 und konnte nicht eingesehen werden. Eine
Zusammenfassung und Ausführungen zum Weinhandel zwischen Köln und Riga finden sich in: Klaus Militzer:
„Weinhandel in Riga und Livland“, in: Bernhart Jähnig und Klaus Militzer (Hrsgg.): „Aus der Geschichte Alt-
Livlands. Festschrift für Heinz von zur Mühlen zum 90. Geburtstag“, Münster: LIT 2004, S. 101-111. 39
http://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_B%C3%A1thory (14.9.2012) 40 Barbara Trelinska: „Album armorum nobilium Regni Poloniae XV – XVIII saec.“, Lublin 2001, S. 194, Nr.
430-432 41
J. Siebmacher: „Der Adel der russsischen Ostseeprovinzen. Band III, 11. Abteilung: 2. Teil.
Nichtimmatrikulierter Adel“, Neustadt an der Aisch: Bauer & Raspe 1980, S. 233 42
Zum Wappen siehe: http://www3.acadlib.lv/broce/vol_1_1.htm, Nicolaus Siegel ist in mehreren Exemplaren
in STAWO Best. 1 Alt 5 Nr. 102d erhalten. 43
Jürgen Heyde: „Zwischen Kooperation und Konfrontation: Die Adelspolitik Polen-Litauens und Schwedens in
der Provinz Livland 1561-1650“, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 47/4 (1998), S. 544 - 567; S.
557n; zu Tarwast siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Ordensburg_Tarwast 44
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/543630/Sigismund-III-Vasa 45
Nr. 1031. KGW 21-2/2, 372; dieses scheint Schwarz 2002, S. 77 nicht bekannt zu sein, da sie von der
Immatrikulation 1598 in Rostock zurückrechnet, dass er „im letzten Viertel des 16. Jhdts.“ geboren sei; sie
übersieht dabei aber auch, dass er sich zuvor schon an einer oder sogar zwei anderen Universitäten
immatrikuliert hatte. 46
KGW 16, S. 290, Brief Nr. 558, Post Scriptum 47
Auch Siebmacher 1980 erwähnt einen in Riga ansässigen Dietrich F./V.; Kulbach-Fricke 2010 nennt ihn als
Sohn des Nicolaus (Vater). Ein Dietrich von Vicken ttritt noch 1647 in Königsberg als Beiträger zu einer
Gelegenheitsschrift in Erscheinung, siehe VD17 12:652124U. 48
STAWO Best. 3 Alt, Nr. 359
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
6
erwähnten Kalenderunruhen ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein, bei dem sein Vater
eine - eher als unrühmlich zu bezeichnende - Rolle spielte. 1581 wurde er wegen Beleidigung
des Syndikus, Dr. Welling, des Rates verwiesen und erst 1582 wieder zugelassen, nachdem er
eine Ehrenerklärung abgegeben hatte. Als dann Dr. Welling auf dem Höhepunkt der
Kalenderunruhren 1586 vom Schafott bedroht, und am 27.6.1586 diesem nur knapp entronnen
war, sorgte Vicken dafür, dass er in der Nacht des 29.6. wieder verhaftet, gefoltert und am 1.7.
hingerichtet wurde. Dabei wurde das Ratsmitglied Vicken von einigen als der Anführer der
anti-polnischen und gegen den Rat gerichteten Bewegung in der Bürgerschaft angesehen.49
Teilweise wird sogar vermutet, er habe Riga unter die Herrschaft des russischen Zaren
bringen wollen, um die Vorherrschaft Polens abzuschütteln.50
1587 wird er jedoch noch als
Teilnehmer am Reichstag in Warschau genannt51
. 1588 kam es gar zu einem Mordversuch an
Nicolas Vicken (Vater), ein anderer Ratsherr ging vor dem Rathaus mit dem Dolch auf ihn
los.52
Interessant ist im Hinblick auf die spätere „Karriere“ seines Sohnes auch noch, dass er
in seiner Funktion als Obervogt im Januar 1589 den Scharfrichter für die Folterung,
Wasserprobe und Verbrennung einer „Zauberin“ (Hexe) bezahlte, und zwar „vor de
touewesche tho pinigen 3 mrk, noch vor up edt water tho werpen gegeuen 1 mrk, noch vor
lichte [...] 2 mrk, noch vor de touewesche tho bernende 5 mrk, noch vor 2 faden holt gegeuen
9 mrk.“53
Noch 1589 wurde der Vater wegen seiner Rolle während der Kalenderunruhen von der Witwe
Dr. Wellings verklagt, musste fliehen und kam nur mithilfe eines königlichen Befehls (er
muss auch zu dieser Zeit noch am Hofe des polnischen Königs verkehrt haben), wieder ins
Amt. Um die gleiche Zeit wurde Nicolaus von Vicken jun. auf die Universität und an den
polnischen Hof geschickt; vermutlich wohl auch, um ihn in Riga aus der Schusslinie zu
bringen. Das Lavieren des Vaters zwischen den politischen Fronten dürfte sich dem Sohn
jedoch eingeprägt haben; er selber agierte später ganz ähnlich.
2.2 Ausbildung
Zu einer Karriere als „Politiker“ passt auch die Ausbildung unserer Hauptperson. Der junge
Nicolaus dürfte in Riga auf die Schule54
gegangen sein. In seinem „Cursus vitae et
studiorum“55
aus dem Jahr 1614 schreibt von Vicken, es seien „26 ihar vergangen, das; nach
dem meyn godtselige lieber vater mich in allen güten sitten, freÿen künsten vnd tügenden in
schola principali erzhien laßen, vnd nachmaln in frembde lande vnd zwar nahe konningspergk
in preußen aüf der hochen schulen verschickken wollen“. D.h. er müsste 1588 das Studium in
Königsberg aufgenommen haben. Zwar verzeichnet die edierte Matrikel der Universität
Königsberg56
weder 1588 noch zu einem anderen Jahr den Eintritt eines Nicolaus von Vicken,
49
Karl Eduard Napiersky: „Monumenta Livoniae Antiquae. Sammlung von Chroniken, Berichten, Urkunden
und anderen schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Ehst- und
Kurlands dienen. Zweiter Band“, Riga und Leipzig: Frantzen 1839, S. 96; A. Von Richter: „Geschichte der dem
russischen Kaiserthum einverleibten deutschen Ostseeprovinzen bis zur Zeit ihrer Vereinigung mit demselben.
Theil II. Die Ostseelande als Provinzen fremder Reiche. 1562-1721.I Band“, Riga: Khymmel, 1858, S. 96 50
Ph. Schwarz: „Beziehungen des Zaren Boris Godunow zu Riga“, in Sitzungsberichte der Gesellschaft für
Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands aus dem Jahre 1897, Riga 1898, S. 27-35; S. 30 51
Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands, Band IV, Heft 3, Dorpat: Kluge 1845, S. 289 5252
Karl Eduard Napiersky: „Monumenta Livoniae Antiquae. Sammlung von Chroniken, Berichten, Urkunden
und anderen schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Ehst- und
Kurlands dienen. Vierter Band“, Riga und Leipzig: Frantzen 1844, S. 129 53
August Wilhelm Hupel; „Neue nordische Miscellaneen, Bände 15-16“, Riga: Hartknoch 1797, S. 549 54
Zur Schulsituation in Riga um diese Zeit siehe: Martin Klörer: "Sturm in Riga : Einflüsse Johannes Sturms auf
das altlivländische Bildungswesen", in : Matthieu Arnold (Hrsg.), Johannes Sturm (1507-1589). Rhetor,
Pädagoge und Diplomat, Tübingen : Mohr Siebeck, 2009, S. 331-336 55
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, 20.10.1614 „in loco“ 56
Georg Erler, Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. III. Band, Register (München;
Leipzig: Duncker & Humblot, 1917)
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
7
allerdings immatrikuliert sich 1589 ein Nicolaus „Fillius“ aus Riga - ein Transkriptionsfehler
für „Ficcius“ scheint plausibel.57
Allerdings sind die Angaben aus dem „Cursus“ nicht ohne Hinterfragen zu übernehmen; so ist
der im Lebenslauf folgende Abschnitt ein reines Phantasieprodukt. Der Vater habe
„gar lange mitt sich selbst vnd anderen vornhemen hochgelartten leütten deliberirt vnd
zu rhate gegangen, In welcher facultet er mich studirn Vnd animum appliciren laßen
wolte vnd solte, wozu ihn dan nicht geringe vrsach, nemblich das er nebst meÿner
godtseligen vielgeliebten mutter zu vnterschiedtlichen viellmhalen drüber kommen
vnd gesehen, das eine weiße Nater mit der guldenen kronen |: davon die naturkundigen
vnerhorte wunder seltzame sachen schreiben :| mir, da ich 4 oder 5 iharen gewesen, in
den schoß geseßen, mitt mir gespilet, vnd da die elteren sich genahet wiederümb zu
loch gekrochen, welchs sie dan, fur ein nicht gering zeichen kunftiger weißheitt,
verstandes vnd erkündigung der natur heimligkeÿtten gehalten.“58
Die weiße Natter mit einer goldenen Krone greift verbreitete Sagen über Nattern und ihre
Kräfte auf59
, hinterlässt jedoch starke Zweifel am Wahrheitsgehalt von Vickens Schilderung,
die im Kontext des Briefes zu sehen ist, aus dem sie stammt. Von Vicken bewirbt sich damit
als Alchemist, und muss natürlich begründen, warum er zu dieser Naturlehre geeignet ist.
Um so mehr als die Darstellung mit der Feststellung fortgesetzt wird, Nicolaus sei in
Königsberg für Jura eingeschrieben worden, und habe dieses Fach 3 Jahre lang studiert. Diese
Fach passt natürlich eher zu einem angehenden „Politiker“, der Nicolaus von Vicken damals
noch war, denn Nicolaus Interesse an der „natur heimligkeytten“ erwachte erst später (mehr
dazu unten).
Dabei habe er „so woll das gantze Ius Ciuile et Canonicum, als auch Magdeburgense,
Polonicum vnd andere Iura mher nicht alleÿn comprehendirt vnd begriffen“60. Indizien für
weitere Stationen in von Vickens Lebenslauf ergeben sich danach zunächst aus Eintragungen
in das Stammbuch, die im Zeitraum April 1596 - Mai 1598, mit der Ausnahme von Dresden,
Torgau und „Cöln an der Spree“, sämtlich aus Leipzig stammen. So war bereits von anderen
Autoren ein Studium dort vermutet worden, was jedoch von Schwarz negiert wird.61
Allerdings zeigt ein Blick in die Matrikel sehr wohl einen „Nic. Viccius Rigen.“, der sich
bereits 1593 in Leipzig immatrikuliert.62
Bereits aus der Leipziger Zeit stammt auch der erste
erhaltene Brief Nicolaus‘; ein in Latein abgefasstes Empfehlungsschreiben für einen aus einer
alteingesessenen Rigaer Familie stammenden potentiellen Studenten.63
Interessant ist hier vor
allem der Adressat, Johann Georg Gödelmann (1559-1611)64
. Er war ebenfalls Jurist, u.a.
Professor in Rostock, und von der Stadt Riga mit der Wahrnehmung ihrer Interessen betraut;
ab 1592 war er außerdem für Christian II. von Sachsen tätig, u.a. als Gesandter in Prag. Damit
stellt er möglicherweise eine Verbindung her zwischen Vickens Heimatstadt Riga, seinem
57
Erler 1917, S. 109 58
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, 20.10.1614 „in loco“ 59 Z.B. in Schlesien, siehe Anton Peter: „Volksthümliches aus Österreich-Schlesien, Band II“, Troppau 1867, S.
32f; auch Paracelus kennt magische Nattern, siehe Karl R.H. Frick: „Das Reich Satans. Luzifer / Satan / Teufel
und die Mond- und Liebesgöttinnen in ihren lichten und dunklen Aspekten - eine Darstellung ihrer
ursprünglichen Wesenheiten in Mythos und Religion“, Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1982, S.
352 60
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, 20.10.1614 „in loco“ 61
Schwarz 2002, S. 77 62
Georg Erler, Die iüngere Matrikel der Universität Leipzig, 1559-1809 (Leipzig 1909), S. 481. 63
Nilüfer Krüger: „Supellex Epistolica Uffenbachii et Wolfiorum. Katalog der Uffenbach-Wolfschen
Briefsammlung. Zweiter Teilband“, Hamburg: Hauswedell, 1978, S. 1060; Signatur des Briefes: Sup. ep. 103,
fol. 152-153 64
Artikel „Godelmann, Johann Georg“ von Theodor Distel in: ADB, Band 9 (1879), S. 316–317
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
8
Studienort Rostock und Prag. Dafür spricht auch, dass sich Gödelmann 1598 in Prag in das
Stammbuch Nicolaus von Vickens einträgt.65
Der Hof Rudolfs II. ist zweifelsohne – um der
Darstellung vorzugreifen - ein zentraler Ort des Lebens von Nicolaus von Vicken, hier hat er
sich am häufigsten aufgehalten (fast 40 Eintragungen in das Stammbuch stammen von dort),
und dort konnte er auch (fast) all fürstlichen und anderen Einträger in sein Stammbuch
kennenlernen, auch jene, für die er später tätig war. Und auch eine Verbindung zu Christian II.
von Sachsen gibt es (s.u.). Einzig weiterer nachweisbarer Studienort ist dann noch Rostock,
wo sich am 20.März 1598 „Nicolaus Viccius, Rigensis, Livonius nobilis“ immatrikuliert.66
Interessanterweise gibt es aus den Jahren 1598ff. keinerlei Stammbucheintragungen aus
Rostock, es ist daher unklar, wieviel Zeit er dort tatsächlich verbracht hat.
2.3 Aufenthalt am königlichen Hof in Polen
Handfester sind andere Aktivitäten, denen von Vicken während seines Studiums nachging.
Laut seinem „Cursus“ habe er an sein Studium in Königsberg anschließend seine juristischen
Kenntnisse in „aula polonica“ praktiziert und die dortigen Sitten und Gebräuche
kennengelernt. Auch habe er dort das „hofmeysters vnd Marschalcks ampt in polen“67
bedient.
Kann man annehmen, dass Vicken seine Angaben hier übertreibt, so dürfte dies auf seine
„kurze verandtwortung“ aus dem Jahr 1604 nicht zu treffen, da er seine Angaben dort
gegenüber dem Kaiser macht, und zwar „mit Godt vnd an Eydes Stadt bezeugendt“68
. Zudem
liegt es in der Natur des Textes, einer Rechtfertigung gegen Vorwürfe, er habe seinen
Dienstherrn, den König von Polen, nach seinem Übergang auf die Seite König Karls IX.
verraten, dass er versuchen dürfte, seine Tätigkeit am polnischen Hof möglichst unwichtig
erscheinen zu lassen. Er schreibt dort über diese Zeit, „daß ich 15 Jahrlanck am Polnischen
Hoffe wegen der Rechtlichen ACTIONEN vnd PROCESSEN, So wir Erben mit der Stadt Riga vnd
andern gehabt, nicht CONTINUÈ SED INTERRUPTIM INUITUS vnd wieder meinen willen auch mit
grossem schaden vnd vorderb meiner Jugendt vnd STUDIORUM sein mußen“69
. Das würde
erklären, warum er gleichzeitig auch in Leipzig und Rostock eingeschrieben sein konnte. Am
polnischen Hofe habe er übrigens keinerlei Geheimnisse erfahren, da er sich nur um seine
Prozesse gekümmert habe. Er versichert „daß ich Niemals Ihr königl wurd: geheimer oder
Cammer oder anderer Rath gewesen vielweniger von derselbigen, oder ihrer Würden Räthen
in solcher sachenn bin zu Rath getzogen, Vnd mir etwas, ohne was NOTORIUM PÚBLICÈ
tractiret, vnd in ORE OMNIUM geweßen ist, offenbahret worden“70
. Aufgrund der
widersprüchlichen Darstellungen bleibt unklar, welche Rolle von Vicken genau am polnischen
Hof gespielt hat.
3. Die Initiation eines Alchemisten
‹‹OH, ESOTERISCH››, LÄCHELTE AGLIÈ, UND BELBO ERRÖTETE.
‹‹SAGEN WIR ...HERMETISCH?››
‹‹OH, HERMETISCH››, LÄCHELTE AGLIÈ
65
Schwarz 2002, S. 108 66
Adolph Hofmeister, Die Matrikel der Universität Rostock. Bd. II, Mich(aelis) 1499-Ost(ern) 1611, Rostock:
Stiller, 1890 S, 258; in Rostock hatte sich bereits am 22.11.1560 ein Hermann Ficke aus Riga immatrikuliert,
siehe Hofmeister 1890, S. 141 67
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, 20.10.1614 „in loco“ 68
HSTAH Celle Br. 16 Nr. 552, f. 4v 69
HSTAH Celle Br. 16 Nr. 552, f. 4v 70
HSTAH Celle Br. 16 Nr. 552, f. 7v-8r
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
9
‹‹NA GUT›› MEINTE BELBO, ‹‹VIELLEICHT GEBRAUCHE ICH DIE
FALSCHEN TERMINI, ABER SICHER VERSTEHEN SIE DAS
GENRE.››
‹‹OH››, LÄCHELTE AGLIÈ ERNEUT. ‹‹DAS IST KEIN GENRE, ES
IST DAS WISSEN. SIE WOLLEN EINE SAMMLUNG DES NICHT-
DEGENERIERTEN WISSENS HERAUSBRINGEN. ››“
Umberto Eco, „Das Foucaultsche Pendel“
3.1 Heikle Mission beim „Deutschmeister“
Bereits zu polnischer Zeit kam es jedoch auch zu einer Tätigeit für einen anderen
Dienstherren, die auch Vickens Darstellung seiner Treue zu König Sigismund in einem
anderen Licht erscheinen lässt. Die „kurze verandtwortung“ an den Kaiser erwähnt einen
Kontakt mit Erzherzog Maximilian (III. von Habsburg), jedoch in sehr bescheidenen
Ausmaßen. Im Jahr 1598 sei er „an E.k.Myt. abgesandt geweßen, dieselbe zu Poidebrad
angetroffen, vnd noch maln von derselben zu Königl. Würden Ertzhertzogk Maximilian in
Oberungern abgefertigt worden, wie solches in der Reichshoffkantzley wirt zufinden sein.“71
Dagegen hat er sich laut „Cursus“ von der „Rom:Kay:Maytt, vnd Erzherzogen
Maximileanum“ in „in anßenlichen gantz wichtigen handlen, fur einen abgesantten
gebrauchen laßen“ und „nach verrichter legation in Vngarn, in der belagerung für ofen mich
eingestellet, der belagerung beÿgewhonet“72
. Dass von Vicken auf seiner Rückreise von seiner
ersten Begegnung mit Maximilian tatsächlich an der Belagerung Ofens im Jahr 1599 teilnahm,
wie er es behauptet, lässt sich nicht überprüfen. Allerdings stammt aus diesem Jahr ein
Stammbucheintrag durch Adolf Graf von Schwarzenberg73
, den kaiserlichen Feldherrn bei der
genannten Schlacht. Gesichert ist jedoch seine Beziehung zu Erzherzog Maximilian (1558-
1618), Ordens- und Hochmeister des Deutschen Ordens74
. Dieser war ein Bruder Kaiser
Rudolfs und residierte teils in Mergentheim, dem Sitz des Ordens nach dem Verlust Livlands,
teils in den habsburgischen Stammlanden in Östereich, die er für seinen Bruder zeitweise
verwaltete. Maximilian hatte zweimal versucht, sich zum polnischen König wählen zu lassen,
1587 war es zu einer Doppelwahl gekommen; der andere gewählte Kandidat (Sigismund)
setzte sich nach einer militärischen Niederlage Maximilians durch, bei der dieser kurrzeitig in
Gefangenschaft geriet. Auf Druck des Kaisers musste Maximilian unter Eid auf Polen
verzichten, da seine Ansprüche einem möglichen Bündnis des Kaisers mit Russland im Wege
standen. In dieser Situation kommt nun Nicolaus von Vicken ins Spiel und wir sehen ihn
zunächst wieder als Politiker im Einsatz75
. 1598 wendet sich von Vicken, als Abgesandter des
Palatins von Wilna, Christof Radzivil, zunächst an Karl von Sarntein, den diplomatischen
Agenten Maximilians am Kaiserhof, und im November 1598 in Kaschau direkt an Maximilian
(wo dieser als Oberbefehlshaber des Heeres gegen die Türken residierte). Unter Berufung auf
die Grafen Erich und Gustav Brahe (und sicherlich ohne Wissen des polnischen Königs,
seines Dienstherrn) berichtet Vicke, dass König Sigismund in Schweden zu bleiben plane und
Polen aufzugeben bereit sei; die Grafen Brahe würden gegen Geld daraufhin wirken, dass
Polen ohne weitere Bedingungen an Maximilian fallen würde. Er verlangte daraufhin
Antwortbriefe an die Grafen, die er jedoch nicht erhielt. Stattdessen wurde ihm mitgeteilt,
dass Maximilian sich erst mit seinem Bruder (dem Kaiser) beraten müsse. Den Grafen könne
er mitteilen, dass sie für evtl. Hilfe im Erfolgsfall belohnt würden, Kosten würden ihnen aber
nicht erstattet.
71
HSTAH Celle Br. 16 Nr. 552, f. 8r 72
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, 20.10.1614 „in loco“ 73
Artikel „Schwarzenberg, Adolf Graf v.“ von Adolf Schinzl, Franz von Krones in: ADB, Band 33 (1891), S. 259–262 74
Artikel „Maximilian, Erzherzog von Oesterreich“ von Heinrich Ritter von Zeißberg in: ADB, Band 21 (1885), S.
72–76 75
Die folgende Darstellung gründet sich auf Hirn 1893, vor allem S. 279ff.
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
10
Für von Vicken war die Unternehmung trotz dieser recht vagen Antwort sehr nützlich. Zum
einen wurde ihm schon auf dem Weg zu Maximilian in Wien eine „Zehrung“ für seine
Unkosten ausgezahlt. Und vor allem wünschte der Erzherzog sich Vickens Dienste dauerhaft
zu sichern, wofür er sogar per Dekret (das aber beim Erzherzog verblieb) zum wirklichen,
besoldeten Diener Maximilians ernannt wurde. Und schließlich erfolgte auf der Rückreise
nach Polen seine Inititiation als Alchemist, Astrologe und Magier.
3.2 Astrologische/ hermetische Einflüsse
Laut eigner Aussage im „Cursus“ erlernte von Vicken die Astronomie bzw. Astrologie im
Alter von 28 Jahren, also um 1599/1600, was gut zur Reise nach Österreich zu Erzherzog
Maximilian passt. Dabei blieb es jedoch nicht, sondern es folgte eine „Initiation“ auch als
Alchemist, ausgelöst durch ein Studium der Werke Paracelsus‘:
„Vnd demnach ich anno etat. meæ 28 in meÿner wiederkunft ex Vngaria et Aüstria,
die gottliche vnd niemaln genugsame lobwürdige kunst Astrologiam erlernet vnd so
weit in acht tagen darÿn progredirt das ich ein Iudicium Generaliarum stellen vnd dem
Itzigen Regi Poloniae naufragium & amissionem regni Sueciæ verkündigen konnen;
Habe ich immefort, den sachen weiter nachgesetzet, vnd durch anreizung eines
osterreichschen Baronis die philosophiam Sagacem et Astronomiam Magnam
Theophrasti Paracelsi, hominis plus quàm diuino ingenio praeditj zulesen angefangen,
welche lection, mich dan also vnd derogestalt delectiret, das ich mich nicht genügsamb
damitt ersetigen konnen: sondern weitter fortgeschritten vnd seyne opera alle fleißig
dürchgelesen, concordantiar drauß gemacht v[n]d seÿn mentem vnd sinn in
abstrüsiontien assequiret“76
.
In der Tat sind zahlreiche Bezugnahmen auf Paracelsus in von Vickens späteren Briefen nicht
zu übersehen. Gerade gegen Ende des 16. Jahrhunderts erlebten die Werke Paracelsus‘ eine
Wiederentdeckung und beeinflussten zahlreiche Magier und Wissenschaftler77
. Auch die
Werke des Paracelsus-Nachfolgers Leonhard Thurneysser muss von Vicken gekannt haben;
1609 wird ihm von Melchior Leporinus in Braunschweig ein Band mit mehreren Schriften
Thurneyssers, darunter eine „Magna Alchymia“ geschenkt; 1611 schenkt er ihn weiter.78
Wie
Nummedal79
zeigt, gab es zahlreiche Wege zum „Berufsbild“ des Alchemisten, und das Lesen
einschlägiger Bücher, auch und vor allem Paracelsus, gehörte dazu, vor allem für die
gelehrteren Adepten. Auch die Behauptung von Gott direkt berufen oder erleuchtet zu sein,
wie sie auch von Vicken anführt, so spricht er in einem Brief an Graf Ernst von „kunsten, die
godt mir auß gnaden offenbharet“80
, ist für Alchemisten nicht untypisch.81
Die Kombination
von Alchemie und Astrologie war aufgrund der Vorstellung, dass die Dinge auf der Erde
durch die Vorgänge im Himmel beeinflusst wurden, nicht ungewöhnlich.82
Wie wir sehen
werden, begann von Vicken sofort seine neuen Kenntnisse in seine Tätigeit als Politiker
einzubringen. An späteren Stationen des Lebenslaufes, am ausführlichsten am Briefwechsel
76
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, 20.10.1614 „in loco“ 77
Philipp Ball: „The Devil’s Doctor. Paracelsus and the World of Renaissance Magic and Science”, London:
Random House / Arrow, 2007, S. 358f. 78
Paul H. Boelin: „Leonhard Thurneysser als Auftraggeber. Kunst im Dienste der Selbstdarstellung zwischen
Humanismus und Barock“, Basel und Stuttgart: Birkhäuser 1976, S176f 79
Tara Nummedal: „Alchemy and Authority in the Holy Roman Empire“, Chicago and London: Chicago
University Press 2007, S. 17ff, zu Paracelsus vor allem 23f. 80
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, 20.10.1614 „in loco“ 81
Nummedal 2007, S. 27ff. 82
Moran 2005, S. 49.
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
11
mit Graf Ernst zu Holstein-Schaumburg (s.u. Kapitel 6), lässt sich der gesamte Kanon, an
„wunderbaren“ Themen ablesen, den Nicolaus von Vicken dabei im Gebrauch hatte.
3.3 Beiträger zu den Schriften des Basilius Valentinus?
Sehr interessant ist eine mögliche Verbindung von Vickens zu den Schriften des angeblichen
Benediktinermönches Basilius Valentinus aus dem 15. Jahrhundert, der mittlerweile als
Erfindung des späten 16. Jahrhunderts erkannt ist. Seine zahlreichen alchemistischen und
paracelsistisch beeinflussten Schriften werden verschiedenen Autoren zugeschrieben, darunter
Joachim Tancke, Rektor der Universität Leipzig und Johann Thölde, dem Herausgeber der
Schriften des Basilius. Außerdem wurde ein Teil des Textes von Basilius‘ Letztem Testament
als Kopie des „Büchleins von dem Bergwergk“83
eines „Nicolas Solea[s]“ identifiziert. Dieser
ist teilweise mit einem allerdings nur 1566 in Altenstein in Thüringen genannten Pfarrer und
Alchimisten identifiziert worden.84
Dabei wird sein Name in zeitgenössischen Schriften auch
als „Nikolaus de Solea“ wiedergegeben.85
Interessanterweise nun wird Nicolaus von Vicken in einigen der Akten als „Nicolaus Vicken
de Solaea“ bezeichnet.86
Könnte er mit dem Autoren des „Büchleins von dem
Bergwergk“ identisch, und damit Beiräger zum unter dem Namen Basilius Valentinus
veröffentlichten Korpus sein? Einiges scheint, neben der Namensähnlichkeit, in der Tat für
diese Hypothese zu sprechen: Zum einen hatte von Vicken zeitlich durchaus Gelegenheit zu
seiner Leipziger Zeit, oder sogar davor, den entsprechenden Text zu schreiben. Zudem hat
sich der oben erwähnte Joachim Tancke in sein Stammbuch eingetragen.87
Von Bergwerken
scheint von Vicken ebenfalls etwas verstanden zu haben, denn ab 1616 fungiert er als
„Consiliarius Metallicus“ für Kaiser Matthias, und 1614 erwähnt er in seinem Schreiben an
Graf Ernst als eine mögliche Aufgabe, dass „Eur hochg.gn. von mir gnedig begert das
bergwerck zübauwen“88
, und schon 1609 ist er im Harz in ähnlicher Sache tätig, s.u. Kapitel 6.
Und schließlich ist er sehr stark von Paracelsus beeinflusst, wie bereits erwähnt. Bis zum
Auffinden weiterer Quellen muss diese Verbindung jedoch eine, wenn auch interessante,
Spekulation bleiben.
3.4 Das neue Wissen im Einsatz
Sicher ist jedoch, dass Vicken sofort nach 1598 begann, seine neuen „herme-
tischen“ Kenntnisse zur Beförderung seiner politischen Karriere einzusetzen. Nach seiner
Rückkehr nach Polen begann er, Berichte an Maximilian zu senden, die teils auch
„magischen“ Inhalt hatten. Hirn fasst zusammen89
:
>>Seine Gewährsmänner sind zwei Magier, „so speculum Magiae gehabt.“ Nicht
leichtfertig, so versichert er, habe er ihnen Glauben geschenkt, sondern sie vorerst
„ausgeforscht.“ Diese Ausforschung bestand darin, dass sie ihm sagen sollten, was er
in Kaschau gethan habe. Nun wussten sie nicht allein darüber guten Bescheid, sondern
83
Erstmals publiziert 1600 von Elias Montanum bei Johann Scheer in Zerbst, VD16 ZV 14495 84
F. Fritz: “Basilius Valentinus”, in: Angewandte Chemie, Band 38, 1925, Heft 1, S. 325-329; Claus Priesner:
„Johann Thoelde und die Schriften des Basilius Valentinus“, in: Christoph Meckel (Hrsg.): „Die Alchemie in der
europäischen Kultur- und Wissenschaftsgeschichte“, Wiesbaden: Harrassowitz 1986 (= Wolfenbütteler
Forschungen, 32), S. 107–118 85
Siehe z.B. Carlos Gilly: „Hermes oder Luther. Der philosophische Hintergrund von Johann Arndts Frühschrift
>>De antiqua philosophia et divina veterum Magorum Spaientia recuperanda<<“, in Hans Otte / Hans Schneider
(Hrsgg.): Frömmigkeit oder Theologie“, Göttingen: V&R Unipress 2007, S. 163-200, S. 170 86
Etwa HSTAH Best. Celle Br. 71, Nr. 123 aus dem Jahr 1609; von eigener Hand unterschreibt er so in STAWO
1 Alt 5 Nr. 102c, f.90v 87
Schwarz 2002, S. 101f. und 324; der Eintrag ist undatiert. 88
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, 20.10.1614 „in loco“ 89
Hirn 1893, S. 282f.
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
12
sie präsentierten auch die Prophezeiung, dass Maximilian sicherlich König von Polen
werde, sei es dass der jetzige König stirbt, sei es, dass er das Reich verlässt, „welches
von beiden sich nicht lange verziehen wird“. Der Zauberspiegel hatte freilich auch
Gefahr angezeigt: „denn es stünden Eurer fürstlichen Durchlaucht Gefängnis zu,
darum Aufsehen von nöten“ [...]. Der eine der beiden Magier redete auch von einer
baldigen Vergiftung des Wasa und von einer türkischen Gefangenschaft Maximilians.
Die „zwei Captivitates“ (die eine war schon überstanden) bestätigte auch noch ein
„justus befundener Mathematicus“ in Breslau, „der auch guten Trost gibt de regno
Poloniae, doch will er noch nit heraus damit.“ Bald hatte Ficke noch weitere
astrologische Beweise, dass jedenfalls das kommende Jahr dem Deutschmeister die
Königskrone bringe werde.<<
Das Muster aus positiven und negativen Prophezeiungen, quasi „Zuckerbrot und
Peitsche“ sollte später typisch für von Vickens Interaktion mit seinen „Kunden“ sein, auch der
„Zauberspiegel“ wird uns wieder begegenen. Die Tätigkeit für Erzherzog Maximilan scheint
jedoch für von Vicken keine ausreichende ökonomische Grundlage geboten zu haben und
auch der polnische Hof bot nicht mehr lange eine gute Heimat, so dass sich der nunmehr
knapp 30-jährige Politiker (und neu gebackene Astrologe und Alchemist) nach einem neuen
Herrn umsah.
4. Schwedisches Intermezzo 1599 musste König Sigismund III. von Polen seinen Anspruch auf den schwedischen Thron
aufgeben. Dort folgte ihm sein Onkel Herzog Karl90
, zunächst als Reichsverweser, und ab
1604 als gekrönter König Karl IX. von Schweden. Im Jahr 1600 begann der erste von einer
Reihe von Kriegen Schwedens gegen Polen, in deren Verlauf Schweden mehrfach versuchte,
Riga und Livland unter seine Kontrolle zu bringen (dies gelang letztlich 1621). In dieser Zeit
(1599) wandte sich von Vicken laut eigener Aussage über verschiedene Mittelspersonen an
den polnischen König (seinen Noch-Dienstherrn), „zu erweisung meiner vnderthenigsten trew,
vnd affection, auch erhaltung würcklicher execution meiner erlangten decreten vnd
vrtheilen“ und hat sich dabei
„so woll schrifftlich alß Mundtlich dahin erbotten, das von ihr Würden die Decreta, so
wir in vnsern Rechtsachen erhalten Würcklichen würden EXEQUIREN, vnd
vollentziehen laßen, Ich auff meine eigene vncosten mich in Schweden begeben, Ihme
dem König alle vnderthanen geneigt vnd Hertzog Caroln vngeneigt machen, Vnd zu
seinen Königreich durch sonderlich MEDIA ohne Schwerdtschlagk verhelffen wolle“91
.
Der König habe als Antwort auf dieses „wunderbare“ Angebot daraufhin Samuel Laski (1553-
1611)92
zu ihm geschickt, da er zunächst offengelegt haben wollte, wie dieser Plan denn
funktionieren werde. Da er diesem Wunsch nicht hätte nachkommen können, ohne den Erfolg
zu gefährden, sei sein Vorschlag vom polnischen König abgelehnt worden. Daraufhin sei er in
die schwierige Situation geraten, dass er „nicht sicher in Polen, Littau, vnd theils Lieflandes
sein“93
konnte, und habe sich im November 1600 auf Schloss Nitau94
versteckt, das als Lehen
im Besitz eines Verwandten gewesen sei. Von dort aus habe er sich dann in den Dienst des
Königs Karl IX. von Schweden begeben.
90
Erik Gustav Geijer: “Geschichte Schwedens (dt.). Zweiter Band”, Hamburg: Perthes 1834, vor allem S. 308ff. 91
HSTAH Celle Br. 16 Nr. 552, f. 5r 92
Oskar Bartel: „Jan Laski (dt.)“, Berlin,1981, S. 263f. 93
HSTAH Celle Br. 16 Nr. 552, f. 6r 94
Heinz Pirang: “ Das baltische Herrenhaus. Band 2”, 1976, S. 64
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
13
Wiederum nach den Angaben im Cursus habe er dem „konningk in schweden Carolo zuzhien
ein Zeittlang in Liuonia, dem krige beywhonen, vnd so woll Cancellarÿ, als Commissarÿ
supremi bellici Münüs in Germania verwalten mußen“95
. Im biographischen Teil seines
Stammbuchs liest sich dies so: „Serenissimi ac Potentissimi Suecorum Gothorum et
Wandalorum REGIS, CAROLI olim Consilary, et in Livonia Cancellary, Anno 1601. Supremi
Commissary, Bellici in Germania, Anno 1601“, (von der vorherigen Zeit in Polen ist dort
übrigens nicht die Rede)96
. In seiner vom 25.2.1604 datierten Widmung97
eines Exemplares
der „Uranometria“ des Johann Bayer an die Universität Breslau bezeichnet sich Vicken u.a.
als „Serenissimi Suecorum Gothorum Vandalorumque Electi Regis Caroli98
Consiliarius et
Comissarius Bellicus Supremus”. Laut der „kurzen verandtwortung“ trat von Vicken bereits
gegen Ende des Jahres 1600 in den Dienst König Karls; er sei „... Hertzogk Caroln
zugetzogen, vnd meine dienste im Decembri präsentiret.“ und sei von ihm „mit allen gnaden
auffgenommen, vnd sein Rath worden“99
. Dieses sei während des Feldzuges Karls in Livland
geschehen, und zwar in Weißenstein100
.
Interessant ist die Beschreibung seiner Tätigkeit, denn sie weicht stark von der oben zitierten
als oberster Kriegskommissar ab; er schreibt - wiederum vor dem Hintergrund des Vorwurfs,
er habe Karl IX. zu Livland verholfen, entgegen seiner vorherigen Tätigkeit für Polen -
„so kan mit Warheit nit erwiesen werden, das ich von Hertzogk Carlln in kriegsachen
vnd eroberung des Liefflandes zue Rath getzogen sey, Sondern mir zu außtheilung der
guter vnd verfertigung der Priuilegien, Insonderheit aber zu Administrirung der
Justitien bin deputiert worden, das nachdem, ich dabeuorn in Lieffandt weiter nicht als
14 Meilen Von Riga kommen gewesen, auch des Landes Paß vnd gelegenheit |:
Welches alles dan einer der ein Land einehmen, oder Rath datzu geben will, gewiß
vnd woll wissen muß :| nicht gewußt, wie kan ich dan den König vmbs Liefflandt
gebracht haben“101
Wo liegt nun die Wahrheit über die Tätigkeit, die von Vicken für den schwedischen Herzog
ausführte? Im Jahr 1600 notiert ein livländischer Edelmann, der vor dem Krieg geflohen war,
in seinem Tagebuch, dass er vom herzoglichen Sekretär „Claus Fick“ brieflich mit dem
Verlust seiner Güter bedroht worden war, wenn er nicht vor Herzog Karl erscheinen würde.102
Dass von Vicken durchaus auch in die Eroberungsversuche Karls involviert gewesen sein
muss, darüber geben auch Briefe Auskunft, die er an den Herzog schrieb, so einen am 18.
Februar 1601, in dem er die Einnahme bzw. die freiwillige Übergabe mehrerer Ortschaften
bzw. Adelssitze meldet103
; am nächsten Tag übersendet er einen Bericht über die Stimmung in
Riga.104
Umgekehrt war Vickens Rolle in Riga um diese Zeit bekannt; am 12. März 1601 sagt
ein in Riga befragter Zeuge aus „Claus Ficke soll ein secretarius und bei Carolo wol dran
sein“.105
.
95
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, 20.10.1614 „in loco“ 96
Schwarz 2002, S. 78 97
Siehe Fitzwilliam Museum: “McClean Bequest. Catalogue of the Early Printed Books Bequeathed to the
Museum by Frank McClean, M.A., F.R.S.”, Cambridge: University Press 1916, S. 73 98
In der Tat war Karl von Schweden wie oben erwähnt 1604 zwar zum König gewählt, wurde aber erst 1607
gekrönt. 99
HSTAH Celle Br. 16 Nr. 552, f. 7r 100
Wilhelm Neumann: „Burg Weißenstein“: Sitzungsberichte Riga von 1896 (1897), 30—33 101
HSTAH Celle Br. 16 Nr. 552, f. 10r 102
Friedrich Bienemann jun.: „Philipp Uraders Tagebuch. Eine Skizze aus Livlands Vergangenheit zu Begin des
17. Jahrhunderts“, in: Baltische Monatsschrift Band 55, S. 59-77, S. 64 103
Bienemann 1900, S. 498 104
Bienemann 1900, S. 500 105
Bienemann 1900, S. 509f.
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
14
Nähere Details sind von einem Vorgang bekannt, der in der zweiten Jahreshälfte 1601 begann,
Nicolaus Vicken und seinen Bruder Heinrich noch Jahrzehnte später verfolgen sollte und
seinen Ruf als „schlechter Mann“ endgültig begründete. Glücklicherweise haben sich hierzu
mehrere Quellen erhalten. Dazu gehören zunächst Briefe im schwedischen Kriegsarchiv in
Stockholm106
sowie Berichte, die der Stockholmer Stadtschreiber (und polnische Spion) Hans
Bilefeldt nach Polen schickte107
. Einen Nachklang der Ereignisse findet man auch in Briefen
des Domkapitels in Mageburg aus den 1620er Jahren.108
Interessante Details lassen sich
schließlich einem Brief109
entnehmen, den Herzog Franz II. von Sachsen-Lauenburg110
an
Heinrich Julius von Braunschweig als Antwort auf eine Bitte um eine Referenz schickte (s.u.
Kapitel 5.3).
Alles beginnt mit einer „Instruction“ von Herzog Karl an „Nicklaus Ficke“ (und zwei andere
Untertanen), datiert am 4. Juni 1601 in Reval.111
In dieser wird ihm aufgetragen, sich zunächst
nach Rostock zu begeben und nach Erledigung einiger Geschäfte nach Ratzeburg zu Herzog
Franz weiterzuziehen. Mit diesem war bereits verabredet, dass Reiter und Landsknechte
anzuwerben seien, und dass diese dann unter dem Kommando des herzoglichen Sohnes
August vor dem Winter nach Schweden verschifft werden sollten. Nicolaus Vicken als
Bevollmächtigter Herzog Karls soll die genannten Reiter und Knechte mustern, und ihnen
danach Geld auszahlen, und zwar „jedlichem Reuter 5 taller zum anrid gelde, den knechten
aber ein thaler laufgeld“; diese Gelder sollen nicht auf den Sold angerechnet werden. Sind die
neu geworbenen Truppen zur Verschiffung bereit, so ist ihnen außerdem ein Monatssold als
Zuschuss auszuzahlen, und zwar „9 taller auf ein pferdt“ sowie zwei Taler pro Landsknecht.
Auch die Ausrüstung an Waffen wird beschrieben, die Teils vor der Verschiffung, teils erst in
Schweden auszuhändigen ist, und vom Sold abgezogen werden soll. Als nächstes soll von
Vicken herausfinden, ob die Truppen am besten aus Rostock, Wismar, Stralsund oder
Greifswald zu verschiffen sind; in der gewählten Stadt sind dann die nötigen Verabredungen
zu treffen und Schiffe anzumieten. Zu diesen Zwecken hatte von Vicken folglich erhebliche
Barmittel mitzuführen. Auch wenn in dieser Instruktion Heinrich Vicken nicht erwähnt wird,
so wissen wir aus dem obern erwähnten Bericht Hans Bilefeldts, dass er in ähnlicher Mission
für Herzog Karls in Nordost-Deutschland unterwegs war. Nicolaus wird am 2.7 ein Pass für
die Reise nach Deutschland ausgestellt112
, so dass er frühestens danach gereist sein dürfte. Am
30.9. schickt ihm Herzog Karl einen weiteren Brief113
, in dem er zunächst den Eingang zweier
Schreiben Nicolaus‘ vom 15. und 23. August bestätigt, woraus er verstanden habe, was dieser
„wegen annemung unsers kriegs volckes vnd sonsten an vns gelangen lassen“. Da von Vicken
insbesondere geschrieben habe, dass „noch zu annemung des volckes etliche gelde mangeln
sollen“, habe er seinen Verwandten Fürst Johann (III. Von Schleswig-Holstein-
Sonderburg114
) gebeten, von Vicken weitere 4600 Taler auszuzahlen. Auch drängt der Herzog,
da der Winter herannahe, bald die Einschiffung der geworbenen Truppen nach Schweden
einzuleiten. Zu diesem Zeitpunkt scheint das Verhältnis von Herzog Karl und Nicolaus von
Vicken also noch ungetrübt gewesen zu sein. Kurze Zeit später ist dies jedoch nicht mehr der
106
In Riksregistraturet, vol. 94 107
Sjödin 1939 108
S.u., Kapitel 8. 109
STAWO Best. 1 Alt 5a, Nr. 102a,f. 5r-8r 110
Johann Samuel Ersch: „Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge,
Band 48“, J. f. Gleditsch, 1848, S. 60 ff. 111
Riksregistraturet, vol. 94, f. 292r - 294r 112
Riksregistraturet, vol. 94, f. 351v-352r 113
Riksregistraturet, vol. 94, f. 426v-427v 114
Artikel „Johann der Jüngere, Herzog zu Schleswig-Holstein-Sonderburg“ von Paul Hasse in: ADB, Band 14 (1881),
S. 409–412
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
15
Fall. In einem weiteren Schreiben, das nur wenige Tage später, am 8.10. datiert ist115
, rügt der
Herzog seinen Bevollmächtigten in scharfen Worten:
„wir haben [...] deiner underschiedlichen schreiben empfangen, vnd daraus große
weitleuffigkeit vernommen, welches wir erachten vnnötig zu beandwortten, wir haben
dir eine INSTRUCTION gegeben, darnach gebuert dir als ein diener sich zurichten vnd
verwundert vns nicht wenig, daß du dich vnderstehest vns furzuschreiben, waß fur
leuthe wir in oder vnseren dinst sollen gebrauchen oder annemen, dan wir Gott lob des
verstandes sein, daß wir wißen, waßen wir in solchen sachen thun oder lassen sollen“
Scheinbar hat von Vicken selbstständig Offiziere entlassen, neue ernannt und mit den
anvertrauten Geldern bezahlt, und Herzog Karl schreibt dazu:
„solches hatt dir nicht gebuert, haben dir auch deßen keinen beuelch gegeben, sondern
allein hertzog Frantzen zu Sachsen, das anrittgeld mit sambt den monad sold
zukommenzulassen welches aber nicht geschehen“.
Zudem habe Herzog Karl aus dem Schreiben verstanden, dass die geworbenen Offiziere auch
keine Reiter stellen könnten, „und hast also wider vnsern willen gehandelt“, insgesamt habe
man nun nur wenige Truppen zu erwarten, und wenn von Vicken dafür die 6000 Taler
verbraucht habe, so sei dies auch nicht instruktionsgemäß gewesen. Stattdessen wird von
Vicken daher nunmehr befohlen „daß du die gelde auf hertzog Frantzen seine Reuter
außteilest“. Auch habe von Vicken zu melden, ob die Reiter bereit seien, zu dem Ort zu ziehen,
den man Herzog Franz mitgeteilt habe. Karl verweist auch noch mal auf den im letzten Brief
avisierten Wechsel über 4600 Taler und bemerkt abschließend zu den bereits angesprochen
weitläufigen anderen Themen von Vickens: „waß du ferner schreibest von der Legation an den
Kayser vnd waß mehr ist, was darzu gehöret, da wollen wir woll zu gelegenheitt vns wissen
einzuschicken.“
Mehr zu diesem Vorgang, und wie er weiterging, erfahren wir dann aus dem oben erwähnten,
6. April 1603 in Lauenburg datierten, Schreiben Herzog Franz‘ II. Es enthält zahlreiche
Beschwerden über Nicolaus von Vicken und bezieht sich auf die Geschehnisse des
Jahreswechsels 1601/2. Damals sei von Vicken mit einem Schreiben von Herzog Karl zu ihm
gekommen und hätte die Werbung von 500 Pferden und 600 Soldaten angeboten. Diese habe
man tatsächlich durchführen wollen, damit Franz‘ Sohn August dieselben nach Schweden
hätte führen können. Jedoch sei es zu finanziellen Unregelmäßigkeiten gekommen. Zum einen
habe von Vicken aus den von ihm mitgeführten 8000 Talern an „anrit: lauf: vnd
vortheilgeldt“ nur 1500 Taler tatsächlich an die Offiziere ausgezahlt, und den Rest stattdessen
auf „schöne prechtige kleider vnd Junge leute vorwandet“116
. Weiterhin habe er 2000 Taler
unterschlagen, die er angeblich für die zur Überfahrt nötigen Schiffe und Proviant benötigte
und vom Herzog erhalten hatte. Dazu kommen Beschwerden über von Vickens Verhalten.
Obwohl man diesen nach Gebühr traktiert und geraume Zeit an der fürstlichen Tafel
verköstigt hätte, habe er dies mit grobem Undank quittiert. So habe er Angestellte und
Adelige des herzoglichen Hofes, die ihm aufgewartet hätten, nach Geheimnissen ausgehorcht
und „hinderrucks heimblich vnd meuchlich boten vnd briefe von Vnßer Festung Razeburg in
Schweden geschicket“117
. Zudem sei er während des Aufenthalts mit „selzamen
verdechtlichen hendeln, so bey Vnß vnd andern verstendigen das ansehen geberet, es
115
Riksregistraturet, vol. 94, f. 434v-436r 116
STAWO Best. 1 Alt 5a, Nr. 102a, f. 6r 117
STAWO Best. 1 Alt 5a, Nr. 102a, f. 7r
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
16
Teufelsche vnd schwarzkunstle wheren, vmbgangen“118
. Dazu habe er noch „andere
vnziembliche sachen mher, die einem Kriegs COMMIßARIO vnd ehrlichen vom adel, wie er
sein wollen, nicht geziemen, getrieben, vnd sich damit gekleidet“119
, so dass man sich bei
Herzog Karl beschwert und von Vicken bis zur Klärung auf Schloss Ratzeburg in Arrest
genommen hätte. Dieser sei jedoch „zu sambt seinem Jungen, gleich anderen, die sich
übelthadt bewußt, vnd schwerer straf zubefahren, aus der CUSTODIA gebrochen, bublich
dauon gelauffen“120
.
Damit könnte man annehmen, dass nicht nur der Aufenthalt Nicolaus von Vickens beim
Herzog von Sachsen-Lauenburg, sondern aufgrund der veruntreuten schwedischen Gelder,
auch der Dienst für Herzog Karl zu Ende gegangen war. Passend hierzu zitiert der Sohn
August, nunmehr Herzog in Ratzeburg, im Jahr 1624 aus einem altem Brief des schwedischen
Königs an seinen Vater, „wofern in Sachsen, wie Vns glaubwurdig berichtet wird, keine
Baume, woran sie [= Nicolaus und Heinrich von Vicken] gehangen werden
konnten“ vorhanden seien, so wolle er „etzliche herauß senden“.121
Andererseits wird noch im
Mai 1603 ein „Claus Vicke“ genannte, der sich als „schwedischer Kriegsbestallter“ in
Stralsund aufhält. An gleicher Stelle wird auch der Bruder Dietrich in gleicher Rolle genannt,
so dass also scheinbar alle drei Vicke-Brüder in schwedischen Diensten standen.122
Die also
evtl. im Jahr 1603 trotz aller Vorfälle noch andauernde Tätigkeit für den schwedischen König
hielt von Vicken nicht davon ab, spätestens 1602 nach neuen oder weiteren Arbeitgebern zu
suchen, wie wie im nächsten Abschnitt sehen werden. Und noch 1606 hielt der Herzog von
Sachsen-Lauenburg seinen Bruder Heinrich in Haft, sowie den ebenfalls aus Riga
stammenden und in schwedischen Diensten stehenden Bernhard Helfrich123
; Heinrich kam
schließlich erst auf Fürsprache Dritter gegen Ablegung eines Revers frei.124
5. Diener vieler Herren 5.1 Das Jahrzehnt der Astronomie
Im Jahrzehnt nach seinem schwedischen Abenteuer war von Vicken für mehrere Dienstherren
tätig, wobei wir über viele der Stationen nur bruchstückhaft Bescheid wissen. Dies ist
bedauerlich, fällt in diese Zeit doch eine erste Häufung seiner astronomischen und astrolo-
gische Kontakte. So fällt in die Zeit um 1605 der erste erhaltene briefliche Austausch mit
Johannes Kepler. In einem Schreiben vom 11.12.1605 aus Leipzig bestellt von Vicken Grüße
von Joachim Tancke, bei dem er sich scheinbar aufhielt. Außerdem erkundigt er sich bei
Kepler nach dessen Meinung dazu, ob die Nova von 1604 eine Eigenbewegung hat oder nicht,
wobei er Schriften von David Herlitz (Herlicius) und Johann Krabbe125
zitiert. Kepler bezieht
sich auf die genannten Werke dann in seiner 1606 erschienen Nova-Schrift, so dass nicht
ausgeschlossen werden, kann, dass er durch von Vicken auf sie aufmerksam wurde.
118
STAWO Best. 1 Alt 5a, Nr. 102a, f. 7r-v 119
STAWO Best. 1 Alt 5a, Nr. 102a, f. 7v 120
STAWO Best. 1 Alt 5a, Nr. 102a, f. 8r 121
Landesarchiv Magdeburg, Best. Rep. A 3a Domkapitel zu Magdeburg, Tit. I, Nr ad 18; Neubauer 1890, S. 17
bezieht diese Stelle auf Gustav Adolf, was jedoch keinen Sinn macht, da dieser erst 1611 den Thron bestieg; es
muss sich auf Karl IX. beziehen. 122
Max von Stojentin: „Aus Pommerns Herzogstagen. Kulturgeschichtliche Bilder“, Stettin: Herrcke & Lebeling,
1902, S. 97f. 123
Dies ergibt sich aus einem Schreiben Nicolaus von Vickens an Philipp Lang zu Langenfels, siehe AT-
OeStA/HHStA HausA Lang-Akten 2-2-65; siehe auch unten, Kap. 5.4 124
Landesarchiv Magdeburg, Best. Rep. A 3a Domkapitel zu Magdeburg, Tit. I, Nr ad 18, siehe auch unten, Kap.
8. 125
Braunschweigischer Hofastronom, siehe unten, Kapitel 6.3
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
17
Ebenso stand von Vicken 1606 in brieflichem Kontakt mit David Fabricius126
. Sicherlich hat
er auch die Werke vieler anderer Astronomen und Astrologen gelesen, mit einigen könnte er
auch in Kontakt gestanden haben, ohne dass sich die Briefe erhalten hätten. In seinen Briefen
an Kepler werden z.B. Brahe und Magini erwähnt. In seinen mehr astrologischen Schriften
bezieht er sich u.a. auf Werke von Paul Nagel (+1624)127
und David Herlitz128
(Brief an
Herzogin Elisabeth von Braunschweig 1614). In den Kepler-Briefen wiederum wird auch
Agrippa von Nettesheim erwähnt.
Dass er die 1603 erschienene „Uranometria“ des Johann Bayer besaß, wurde oben (Kapitel 4)
bereits erwähnt. Auch mit dem Astronomen Simon Marius war er in Kontakt, wie sich
wiederum aus seinem Briefwechsel mit Kepler ergibt.129
Daneben hat er scheinbar auch eigene astronomische Beobachtungen und Berechnungen
gemacht; diese spielen auch in seinem Briefwechsel mit Kepler eine Rolle, zudem erwähnt er
in einem Brief an Graf Ernst aus dem Jahr 1614, dass er ein Horoskop nur so gut habe
erstellen können, wie es „wegen des tefects vnd mangelung meyner bucher, eignen
astrologischen obseruationen, vnd meiner TABULARUM PTOLOMAICARUM“130
möglich
gewesen sei. (Diese Unterlagen hatte er wegen seiner Haft und anschließenden Verbannung in
Wolfenbüttel zurücklassen müssen, s.u.). Dieses tiefe Interesse an der Astronomie und
Astrologie, zusammen mit der bereits oben beschriebenen Affinität zur Alchemie, muss man
im Hinterkopf haben, wenn man nun die Stationen anschaut, die von Vicken in den Jahren
nach 1602 durchlief.
5.2 Kurze sächsische Eskapade
Eine Station bei der Suche Nicolaus‘ nach neuen Einkünften könnte Sachsen gewesen sein.
Kurfürst Christian II von Sachsen (1583-1611)131
ist mit zwei Einträgen in Nicolaus von
Vickens Stammbuch vertreten, datiert 1598 und 1602 und jeweils ohne Ort132
. 1598 enthält
das Stammbuch einen Eintrag in Dresden, d.h. von Vicken könnte Christian II dort getroffen
haben. In der Sächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Dresden befindet sich eine
Schrift, die Nicolaus von Vicken anlässlich der Heirat Christians II. mit Hedwig von
Dänemark133
im Jahre 1602 verfasst hat134
. Bei dem in Prag gedruckten und prachtvoll
ausgestatteten Einzelblattdruck (siehe Abbildung) handelt sich um die einzige erhaltene
Druckschrift Nicolaus von Vickens überhaupt.
126
S.o., Einleitung, Kapitel 1.1 127
Mit ihm stand von Vicken im regen Austausch, wie sich aus dem Stammbuch ergibt, siehe Schwarz 2002, S.
92; siehe zu Nagel auch: Artikel „Nagel, Paul“ von Gustav Frank in: ADB, Band 23 (1886), S. 215–216 128
Claudia Brosseder, „Im Bann der Sterne. Caspar Peucer, Philipp Melanchthon und andere Wittenberger
Astrologen“, Berlin: Akademie Verlag, 2004, S. 72ff.; Artikel „Herlitz, David“ von Theodor Pyl in: ADB, Band 12
(1880), S. 118 129
Josef Klug: „Simon Marius aus Gunzenhausen und Galileo Galilei. I. Teil“, in: Abhandlungen der II. Klasse
der Königl. Bayerischen Akad. d. Wissenschaften, Band XXII, II. Abt., S. 386-443, S. 418ff. 130
STABU Best. F3, Nr. 240, kurzer Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, o.D. 131
Artikel „Christian II., Kurfürst von Sachsen“ von Heinrich Theodor Flathe in ADB, Band 4 (1876), S. 172–
173 132
Schwarz 2002, S. 107, 325 133
Eduard Maria Oettinger: „Geschichte des dänischen Hofes. Band I“Hamburg: Hoffmann & Campe, 1857, S.
256 134
Titel: “Sygcharma nuptiale ... Christiano II ... nec non ... Hedvigae ... scriptum”, SLUB, Signatur:
Hist.Sax.C.33,15
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
18
Im Stammbuch finden sich jedoch nur wenige sächsische Einträge aus den Jahren nach 1602,
lediglich Leipzig (1605 und 1606) und Dresden (1606) sind sporadisch vertreten. Und 1607
schreibt Fabricius an Kepler, dass ihm von Vicken ein Jahr zuvor (1606) „ex Saxo-
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
19
nia“ geschrieben habe.135
. Von Vicken war also wohl nicht, oder wenn nur von Prag aus für
Sachsen tätig; vielleicht war die Schrift nur ein Versuchsballon. In jedem Fall war die
genannte Hochzeit 1602 (so Vicken eingeladen war) eine gute Gelegenheit, zahlreiche weitere
potentielle Arbeitgeber zu treffen.
5.3 Erste „welfische Phase“136
Der Hof in Wolfenbüttel war das nächste Ziel von Vickens. Herzog Heinrich Julius von
Braunschweig-Wolfenbüttel (1564-1613)137
war dabei eine durchaus logische Wahl. Nicht nur,
weil das Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel unter ihm seine größte Ausdehnung
erfuhr138
und er somit ein durchaus einflussreicher Fürst war, sondern auch weil er ein
bekannter Anhänger der Astrologie und Alchemie war. Er ließ sich zahlreiche Horoskope
aufstellen und richtete in Braunschweig und Prag gleich zwei alchemistische Labore ein; auch
Kontakte zu den Rosenkreuzern unterhielt er.139
Ein Schreiben Vickens scheint das Interesse des Herzogs geweckt zu haben, denn am 20.
März schickte er einen Brief140
an Herzog Franz von Sachsen-Lauenburg (s.o. Kapitel 4) um
eine Referenz über den Absender einzuholen. Die Antwort fiel für von Vicken - wie oben
erwähnt - wenig schmeichelhaft aus, so dass aus einer Tätigkeit für Herzog Heinrich Julius
zunächst nichts geworden sein dürfte. Im Jahr 1605 (datiert 24.10. in Güstrow) erhielt der
Herzog dann ein Empfehlungsschreiben141
von Herzog Karl zu Mecklenburg-Güstrow142
über
von Vicken. Angestrebt wird eine Tätigkeit für Heinrich Julius am Hof in Prag, doch ein
Vemerk auf dem Umschlag besagt, dass niemand zum Dienst am Hofe benötigt würde; es
wird nicht klar, ob der Brief Herzog Heinrich Julius überhaupt persönlich erreicht hat. Kurz
darauf scheint es jedoch zumindest zu einer Tätigkeit zumindest für einen welfischen
Verwandten gekommen zu sein, denn 1606 vertritt von Vicken Herzog Johann Friedrich von
Braunschweig-Harburg143
in einem Rechtsstreit mit der Stadt Hamburg.144
Ausser der
Gerichtssache ist auch von einer längeren Tätigkeit von Vickens in Hamburg oder Harburg
nichts bekannt. Stattdessen kam es ein Jahr später zu einer erneuten Tätigkeit von Vickens für
Erzherzog Maximilian, denn ab 1607 fungierte er als dessen Agent am Kaiserhof in Prag,
wobei Hirn konstatiert: „Ficke’s Berichte aus Prag unterscheiden sich sehr zu ihren
Ungunsten von denen Vischers [seinem Vorgänger]“.145
5. 4 Kaiser Rudolf II
Nahezu unvermeidlich mussten seine hermetischen Künste und seine Aufenthalte in Prag von
Vicken in Kontakt mit Rudolf II bringen, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und bekannt
135
Bunte 1887, S. 48 136
Wie oben erwähnt werden die Bezüge von Vickens zu Brausnchweig / Wolfenbüttel näher behandelt in: Nils
Lenke, unter Mitarbeit von Nicolas Roudet: „‘alle Eysen omnia ferra in plurali numero in 24. stunden in Stael zu
transmutiren‘. Der Kepler-Briefpartner Nicolaus von Vicken im Rechtsstreit mit dem Syndikus des Stiftes
Magdeburg wegen eines alchemistischen Kontraktes“, in Vorbereitung 137
Hilda Lietzmann: „Herzog Heinrich Julius zu Braunschweig und Lüneburg (1564-1613) Persönlichkeit und
Wirken für Kaiser und Reich“ (= Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Geschichte, Band 30),
Braunschweig: Geschichtsverein, 1993 138
Lietzmann 1993, S. 29 139
Lietzmann 1993, S. 16 140
STAWO Best. 1 Alt 5 Nr. 102a, f. 4 141
STAWO Best. 1 Alt 5 Nr. 102a , f. 10r-11r 142
Wilhelm Fischer & Friedrich Wilhelm Streit: „Historischer und geographischer Atlas von Europa, Band 2, 1.
Abtheilung“, Berlin: Ratorff 1836, s. 175 143
W.C. Ludewig: „Otto II., Herzog zu Harburg“, in: Vaterländisches Archiv für hannoverisch-
braunschweigische Geschichte, Jg. 1834, Lüneburg: Herold & Wahlstab, 1835, S. 96-130, S. 127 144
Siehe Schreiben von Vickens and die Stadt Hamburg vom 8.2.1606, STAWO 1 Alt 5a Nr. 102 a f. 12r bis 14r 145
Hirn 1893, S. 283n
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
20
als „Alchimist von Prag“.146
Nicolaus van Vicken wird in den späteren Quellen konsequent als
„kaiserlicher Truchsess“ oder „dapifer“ bezeichnet; in seinen biograpischen Angaben im
Stammbuch datiert er den Beginn dieser Tätigkeit auf 1603147
. Allerdings berichtet Hirn, dass
bereits 1601 Erzherzog Maximilian von Vicken zu einer Anstellung bei Rudolf verhalf148
. Im
Hofarchiv in Wien findet sich allerdings in Übereinstimmung der Darstellung von Vickens als
früheste Quelle ein Passbrief vom 25. Juni 1603149
, in dem angezeigt wird, dass „Vnser
Hofdiener und des Reichs lieber getreuer Niclaß Vick“ darum gebeten habe „in seinen
angelegenen geschäfften“ „nacher Liflandt, vnd furnemblich die Statt Rigae“ zu reisen, und
dieses vom Kaiser genehmigt worden sei. Am 22. November desselben Jahres wird „Niclaßen
Vick, Niclaßen Sohn“ ein Schirm- und Schutzbrief150
durch Kaiser Rudolf ausgestellt.
Dabei darf man sich unter dem Titel eines „Truchsessen“ wohl keine zu wichtige Tätigkeit
beim Hofe vorstellen; wie Zajic bemerkt, handelt es sich um einen niedrigen am Hofe
geführten Titel, der von Rudolf gleich dutzendfach vergeben wurde.151
Laut von Vickens
eigener Aussage in seinem „Cursus vitae“ kam er an dieses Amt – wie kann es anders sein –
aufgrund seiner Paracelsusstudien und „hermetischer“ Schriften, die er dem Kaiser widmete:
„...wegen meynes libelli metoposcopicj et Chyromantici, so ich der Rom. Kay: Maytt
Rudolpho, hochsten gedachtniß dedicirt, dieselbe mich wieder meÿnen willen vnd
furnhemen in dero dienst zütreten vnd fur ihren trüchsaßen anzunhemen vnd bestallen
zulaßen, gezwungen“.152
Bei dem angeblich unfreiwilligen „Zwang“ in dieses Amt handelt es sich natürlich um einen
gängigen Bescheidenheitstopos. Bei den erwähnten libelli handelt sich vielleicht um das
selbe Werk, das er auch an Herzog Heinrich Julius und David Fabricius schickte. Mit der
nötigen Skepsis ist wohl wiederum die folgende Angabe aus dem „Cursus vitae“ zu genießen,
die den von Rudolf an von Vicken erteilten Auftrag beschreibt. Der Kaiser habe ihn
„nachmals in teutch vnd andere lander abgeschickt, alle Closter vnd gelartte leüte, heimlich
zubesuchen, mitt ihnen zureden, v[n]d in allen verborgenen kunsten v[n]d wißenschaften;
gewiße Experimenta zuwege zubringen, woruber ich fast vier ihar zugebracht, vnd nicht einen
geringen schatz erlangt“.153
In der „kurzen verwandtwortung“ bittet von Vicken den Kaiser
hingegen, ihn aufgrund der Umstände von dem Versprechen zu entbinden „die zugesagte
STRATAGEMATA BELLITA |: Welche itzo Woll in vngern Von nöthen wehren : |“154
liefern zu
müssen. Diese Strategemata sind auch später noch Gegenstand zweier Briefe von Nicolaus
von Vicken an den Kaiser, bzw. dessen Kammerdiener Philipp Lang zu Langenfels. Beim
ersten Brief handelt es sich um eine undatierte Supplikation155
an den Kaiser. Darin beklagt
sich von Vicken, er sei nunmehr seit 15 Tagen im Gefängnis, ohne dass man ihm den Kläger
bzw. eine Klage als Ursache für seine Verhaftung genannt habe. Daher bittet er nun darum
„mich in meine herberge heut zubestricken, die klage zuzustellen, vnd zur veranttwortung
146
Jacqueline Dauxois: „Der Alchimist von Prag. Rudolf II. von Habsburg. Eine Biographie“, dt.
Düsseldorf/Zürich: Artemis & Winkler, 1997 147
Schwarz 2002, S. 78 148
Hirn 1893, S. 283n 149
AT-OeStA/HHStA RHR Passbriefe 17-3-38 150
AT-OeStA/HHStA RHR Schutzbriefe 14-2-25 151
Andreas Zajic: „Rezension von: Christiane Schwarz: Studien zur Stammbuchpraxis der Frühen Neuzeit.
Gestaltung und Nutzung des Album amicorum am Beispiel eines Hofbeamten und Dichters, eines Politikers und
eines Goldschmieds (etwa 1550 bis 1650)“, Bern / Frankfurt a.M. [u.a.]: Peter Lang 2002, in: sehepunkte 4
(2004), Nr. 4 [15.04.2004], URL: http://www.sehepunkte.de/2004/04/4767.html 152
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, 20.10.1614 „in loco“ 153
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, 20.10.1614 „in loco“ 154
HSTAH Celle Br. 16 Nr. 552, f. 3r 155
AT-OeStA/HHStA HausA Lang-Akten 5-1-8
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
21
kommen zu laßen“. Aus dem Hausarrest heraus wolle er sich dann binnen zwei Tagen
verantworten, und könne sich dann auch wieder um die „stratagemata“ kümmern, die er dem
Kaiser versprochen habe. Er motiviert dies mit einer gewissen Dringlichkeit, denn sein Bruder
habe ihm vor wenigen Tagen aus Rostock geschrieben
„das graf Moritz einen Capitan zu dem Meyster geschickt vd ihn zu sich fürdern laßen;
welches sie wegen meyner absents biß auf den alten bartolomeus tagk verschoben;
zusagende, wo ich mich nicht bey ihnen vmb die zeitt einstellen wurde, das sie alsdan
zu graf Moritz wolten“
Gemeint ist wohl Moritz von Oranien-Nassau156
, Feldherr der Niederlande im Krieg gegen
die Spanier, und die Strategemata sind nun nicht mehr für den Türkenkrieg in Ungarn sondern
für den genannten spanisch-niederländischen Krieg gedacht. Von Vicken mahnt weiter, Eile
sei geboten um zu „verhindern vd verhuten, das dieselbe [strategemata] in der Hollander
hande, zu mercklichen abbruch des konnigs in Hispanien, nicht kommen mogen“. Da Philipp
Lang im Schreiben erwähnt wird, dürfte dieses vor 1608 entstanden sein, da Lang in diesem
Jahr in Ungnade fiel. Direkt an Lang addressiert ist das zweite Schreiben aus dem Jahr 1606,
datiert in „Neustadt in francken“. Lang war, obgleich lediglich Kammerdiener, bekanntlich
von immensem Einfluss auf den Kaiser, nahezu dessen gesamte Korrespondenz ging durch
seine Hände157
. Von Vicken scheint zu Philipp von Lang ein recht enges Verhältnis gehabt zu
haben, denn er läßt die Ehefrau Langs grüßen, und bedankt sich dafür, dass er in ihrem Haus
in Prag Unterschlupf gefunden habe, auch dankt er Lang dass ihm „von dem h[errn] große
befurderung geschen (: die ich nicht genugsamb vergellten konnen :)“. Auch in diesem
Schreiben ist wieder von Dingen die Rede, die von Vicken an sich bringen könne, „dadurch
der ganzen christenheit vd insonderheitt in dießem turcken kriege konte gedient seyn“. Diese
bietet er dem Kaiser an, allerdings verlangt er Gegenleistungen. Zu einen möge der Kaiser
seinen „lieben brudern [Heinrich] vd Bernhardt Helfrich158
, auß der gefengniß bey herzogk
Frans von Sachsen, gnedigst erledigen vd zu prag stellen laßen“. Außerdem geht es um Geld,
denn „weilen ichs mitt großem gelde an mich bringen muß; wolte vd konte ichs auch nicht
thun; wan von ihrer Maytt durch den h[errn] ich nicht zuvor die zusage in schrifften hette“.
Wiederum ist Eile geboten, „weilen man mit den sachen zu den staden in Hollande will“.
Unklar ist, ob von Vicken in der Lage ist, solche Forderungen zu stellen, denn der Kaiser hat
ihn per Brief über Philipp Lang nach Prag beordert; er sagt, er habe dieser Forderung wegen
eines Fiebers bisher nicht nachkommen könne, hoffe aber, „das sichs innerhalb 14 tagen mit
mir beßern soll, Also will ich nach verlaßung des fiebers, ihrer Kay: Maytt befhell nachleben
vd mich alsbaldt vngesaumbet einstellen“. Interessant in diesem Zusammenhang ist noch ein
undatiertes Schreiben des kaiserlichen Kammersteinschneiders Kaspar Thomas Lehemnanns,
der gegen Lang aussagt, dieser habe „den Alchymisten Nicolaus Vick, der vom Könige von
Polen bei Kaiser Rudolf II. des Landesverrathes angeklagt worden sei, gegen verschiedene
156
Artikel „Moritz, Prinz von Oranien, Graf von Nassau-Dillenburg“ von Pieter Lodewijk Muller in: ADB, Band 22
(1885), S. 283–293 157
Friedrich Hurter: „Philipp Lang, Kammerdiener Kaiser Rudolphs II. Eine Criminal=Geschichte aus dem
Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts“, Schaffhausen: Hurter, 1851; Moritz Herrmann: „Dunkle Geschichten
aus Oesterreich“, Wien: Waldheim 1868, S. 104-115. 158
Von Vicken bittet auch den Antwortbrief an „Niclas Helffrich auf Nurnbergh“ zu adressieren; ein aus Riga
stammender Bernhard Helfrich wird in Ingeborg Krekler: „Die Handschriften der Württembergischen
Landesbibliothek Stuttgart, Sonderreihe Zweiter Band, „Die Autographensammlung des Stuttgarter
Konsistorialdirektors Friedrich Wilhelm Fromman“, Wiesbaden: Harrassowitz 1992“, S. 236, genannt, ein
Nicolas Helfrich ebenda; ein Porträt Nicolaus Helffrichs befindet sich in Nürnberg, siehe Werner W. Schnabel:
„Die Handschriften der Stadtbibliothek Nürnberg / Die Stammbücher und Stammbuchfragmente: Teil 1: 16. und
17. Jahrhundert. Teil 2: 18. und 19. Jahrhundert. Teil 3: Indices: Sonderband“, Wiesbaden: Harassowitz 1995, S.
31 und 151
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
22
Geschenke aus dem Gefängnisse entlassen und ihn wie einen Sohn bei sich behalten“159
,
woraus sich wohl die Ursache der oben erwähnten Haft ersehen lässt. Jedenfalls war von
Vickens Position am Hofe zu keiner Zeit so, dass er ausschließlich von seiner Tätigkeit dort
hätte leben können, erst recht nicht, nach dem Lang in Ungnade gefallen war.
6. Zweite braunschweigische Periode
Von Vicken muss daher weiterhin versucht haben, in den Dienst Heinrich Julius‘ zu gelangen,
denn zu einem folgenschweren Vorfall, der eine Aktenspur hinterlassen hat, kam es 1609 im
Bistum Halberstadt, dessen postulierter Bischof Heinrich Julius ebenfalls war. Nicolaus von
Vicken hielt sich dort zunächst in den Harzer Bergbaugebieten auf, um für den Herzog eine
„Hebekunst“ zu errichten. Doch auch für private Investoren arbeitete er und bot ihnen die
alchemistische Herstellung von Stahl aus jeglichen Eisensorten binnen 24 Stunden an. Einen
solchen Vertrag schloss er mit Dr. Christoph Lüder, der einen Hof in Blankenburg besaß, aber
auch bischöflicher Syndikus in Halberstadt war. In diesem Vertrag verpflichtete sich von
Vicken alle Sorten Eisen, auch solches aus Blankenburg, in Stahl zu „mutieren“. Für genau
solches Erz, wie es Dr. Lüder aber in Blankenburg günstig zur Verfügung stand, schlug die
Stahlprobe fehl und Dr. Lüder kündigte den Vertrag im Frühjahr 1609 auf und verweigerte
die Zahlung einer Summe von mehreren tausend Reichstalern. Darüber kam es zwischen ihm
und von Vicken zu einem erbitterten Konflikt. Dieser wurde nicht in erster Linie über die
Sache selbst ausgetragen, sondern von Vicken sammelte einen Katalog an Vorwürfen gegen
Dr. Lüder und macht diesen öffentlich. Diese reichen von Trivialitäten und angeblichen
charakterlichen Schwächen bis hin zu dem massiven Vorwurf, Dr. Lüder habe den Plan
gehegt den Herzog mithilfe eines magischen Ringes umzubringen, aus Rache dafür, dass
dieser in den 1590er Jahren seine Mutter als Hexe habe verbrennen lassen. Als Dr. Lüder
nicht reagiert übergibt von Vicken den Katalog offiziell an das Halberstädter Domkapitel und
die fürstlich braunschweigische Regierung und beschwert sich schriftlich beim Herzog. Dr.
Lüder, der auch das das Amt eines „Fiscals“, also einer Art Staatsanwalt ausübt, machte als
Reaktion von diesem Amt Gebrauch, in dem er von Vicken unter einem Vorwand gefangen
nehmen und auf Schloss Krottorf in Haft setzen ließ. Auf Intervention des Herzogs hin wurde
von Vicken jedoch nach kuzer Zeit am 30. August unter Auflagen wieder entlassen. Ende
November dringt von Vicken mit einer weiteren Beschwerde zu Herzog Heinrich Julius durch,
und dieser ordnet eine Untersuchung der Vorwürfe an. Im Anschluss kommt es im Dezember
und Januar zu einer Phase intensiver Tätigkeit; sowohl von Vicken als auch Dr. Lüder reichen
Kataloge von gegenseitigen Vorwürfen ein und benennen Zeugen, Dr. Lüder führt dabei u.a.
eine ganze Reihe von Vorfällen an, die bereits geschildert wurden, darunter der Übergang von
Vickens vom polnischen zum schwedischen König und die Unterschlagung von Geldern bei
Herzog Franz. Auch August von Anhalt soll er um 5100 Taler betrogen habe. Ebenfalls wirft
Dr. Lüder ihm dunkle Praktiken vor, so brüste sich von Vicken selber, seit vielen Jahren einen
Teufel oder Geist zu besitzen, der ihm dienen müsse. Die eingesetzte Kommission vernimmt
zahlreiche Zeugen, als Reaktion benennen beide Seiten weitere Zeugen, die ebenfalls
vernommen werden usw. Ende Januar verläuft dies zunächst alles im Sande (oder die
weiteren Schritte werden von den vorhandenen Aklten nicht erfasst). Bei diesem Vorgang ist
auch das Timing interessant, denn quasi gleichzeitig mit dem Beginn der Untersuchung
schickt von Vicken am 3. Dezember aus Halberstadt nach einer vierjährigen Pause wieder
einen Brief an Johannes Kepler (wobei durchaus Briefe aus der Zeit dazwischen verloren
gegangen sein können); der Brief ist der bereits erwähnte Hinweis, dass Vicken der erste
159
Hugo Graf von Abendsperg und Traun: „Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten
Kaiserhauses“, Band 19, Wien 1898, S. XCIII
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
23
dokumentierte Leser der Astronomia Nova ist.160
Am 18. Januar folgt ein Brief (wiederum aus
Halberstadt), in dem er auffallende Wetterbeobachtungen mitteilt und sich nach Keplers
Urteil zu Krabbes Planetentafeln erkundigt. Am 23. Februar schließlich ein weiterer
(wiederum aus Halberstadt), in dem weitere Fragen zu Berechnungen und astrologischen
Beurteilungen folgen.161
Auch immer Sommer 1610 folgen weitere Briefe; zu dieser Zeit
scheint von Vicken zum ersten Mal am Hof in Wolfenbüttel Fuß gefasst zu haben. Zumindest
erwähnt er später Horoskope und Traumdeutungen, die er in dieser Zeit für Herzogin
Elisabeth erstellt habe. 1611 kommt es zunächst zu einem neuen Konflikt zwischen Nicolaus
von Vicken, seinem Bruder Heinrich und auf der anderen Seite Herzog Joachim Karl (von
Braunschweig-Wolfenbüttel), einem Bruder Herzog Heinrich Julius‘. Bei letzterem wurde
Heinrich nämlich im Frühjahr Hofmeister, im Sommer jedoch wieder entlassen, nachdem
Joachim Karl eine Abneigung gegen ihn gefasst hatte. Darüber kam es zu einigen
Beschwerdebriefen, u.a. auch einem von Nicolaus an Joachim Karl, in dem er in recht rüdem
Ton den Namen desjenigen verlangt, der das Gerücht aufgebracht habe, sein Bruder und er
würden ihren Adelstitel zu Unrecht führen. Ebenfalls im Frühjahr oder Sommer 1611 forderte
Herzog Heinrich Julius die Akten in der causa von Vicken vs. Dr. Lüder zur eigenen
Einsichtnahme nach Prag an und irgendwann gegen Ende des Jahres wurde von Vicken wieder
in Haft genommen, diesmal auf Burg Schöningen. Erst drei Jahre später, 1614, Herzog
Heinrich Julius war inzwischen gestorben, wurde er aus dieser Haft zumindest in eine Art
Verbannung entlassen, und versuchte über einen Brief an die jetzige Regentin Herzoginwitwe
Elisabeth am Hof wieder aufgenommen zu werden, wobei er „wunderbare“ Versprechungen
mit Drohungen kombinierte, die auf angeblich sehr schlechten Horoskopen für das Haus
Braunschweig basierten. Als dies scheiterte, probierte es von Vicken auf einem anderen Wege,
wie im nächsten Kapitel zu behandeln sein wird.
Noch 1617 war der Rechtsstreit zwischen ihm und Wolfenbüttel nicht endgültig beigelegt,
denn in einem Brief der in Wolfenbüttel zurückgelassenen Räte an den verreisten Herzog
Friedrich Ulrich ist u.a. von Büchern die Rede, um deren Rückgabe von Vicken kämpft, dazu
dürfte auch sein Stammbuch gehört haben; eine Rückgabe scheint jedoch erst einige Zeit
später erfolgt zu sein, denn 1619 beginnen die Eintragungen wieder, nach einer Pause, die seit
1611 angedauert hatte.
7. Ein Angebot an Graf Ernst zu Holstein-Schaumburg
Es hatte sich im Sommer 1614 für von Vicken, der sich in der Verbannung in Hildesheim
aufhielt, ein Kontakt zu Graf Ernst zu Holstein-Schaumburg162
ergeben. Wie von Vicken
beschreibt habe dieser
„zu meyner geringen person eine gnedige christliche beliebung getragen, Vnd meyner
in Astrologiam geringer wissenschaft, in meÿnem exilio vnd elendt, ein geringes
specimen vnd dokimasian163
begert, mich drauf gnedig von meÿner auf lübeck
Eingenommenen reiße abgerhaten vnd abgehalten vnd zu sich erfurdert; mitt mir
vnwürdigen, von dießer welt vnd deßen kinderen, veracht: vnd vernichteten; geringen
160
S.o., Einleitung (Kapitel 1.1); zur Druckgeschichte der Astronomia Nova siehe auch: Isabelle Pantin:
„L’Astronomia Nova: le point de vue de l’histoire du livre“, in: Edouard Mehl (Hrsg.): „Kepler. La Physique
Céleste. Autour de L’Astronomia Nova (1609)“, Paris: Les Belles Lettres, 2011, S. 23-41 161
KGW 16, S. 444, 446, 448 162
Helge bei der Wieden: „Ein norddeutscher Renaissancefürst. Ernst zu Holstein-Schaumburg (1569-1622)“, 2.
Auflage, Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2010 163
Griech. δοκιμασίαν = Probe, Versuch (Akkusativ)
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
24
gliede vnd brudern christi; viellmhall gnedig conferiret, vnd von hochwichtig
verborgenen sachen geredet“164
.
Zunächst versucht er den Grafen einzuspannen, um am Hofe in Wolfenbüttel wieder gnädig
aufgenommen zu werden, als dies jedoch nicht zum Erfolg führte, versuchte er auch bei dem
Grafen selbst zu „landen“, hatte er doch festgestellt, dass dieser „zü den geheimen natürlichen
den gemeÿnen leuten verborgenen kunsten, großs beliebung, auß angeborner lust vnd
begierde tragen.“165
In der Tat ist von Herzog Ernst ein gewisses Interesse an astrologischen
Dingen bekannt, er ließ sich zahlreiche Horoskope verfertigen, duldete an der von ihm
gegründeten Hochschule in Rinteln die Lehren des Paracelsus und wurde mit den
Rosenkreuzern in Verbindung gebracht; alchimistische Versuche Gold herzustellen lehnte er
hingegen ab.166
Daher schreibt von Vicken, er habe sich entschieden, sich „selbst mitt allem was ich habe vnd
khan auf eine gewiße zeitt entweder zur stelle oder von hauß auß, zu offeriren“167
. Vielleicht
hatte er auch in Erfahrung gebracht, dass der Graf zahlreiche Gelehrte und Künstler am Hofe
und „von Haus aus“ beschäftigte und sehr freigiebig entlohnte und beschenkte.168
Angeboten werden dem Grafen allerlei „wunderbare“ Dienstleistungen. Als erstes gehört dazu
die Erstellung von Horoskopen, von denen sich Auszüge, z.B. für die Gattin des Grafen in den
Briefen finden, zur genaueren Erstellung bräuchte er bessere Ephemeriden für Hildesheim
und stellt fest, er wolle „gantz gern die figuram Coeli von Krabben169
.... haben nach seyner
obseruation, wan Eur.gn. einen nach Wolfenbuttel schikken wurden.“170
, dieses scheint
tatsächlich geschehen zu sein, denn in einem weiteren Schreiben heißt es „das gestrige
Judicium so von Wolfenbutt kommen, habe ich noch nicht durchlesen, soll erst presentium
geschen“171
.
Zu den angebotenen Diensten gehört auch die Herstellung wundertätiger Salze (ein für die
paracelsische Alchemie typisches Konzept172
), die jedoch von Hindernissen begleitet ist, denn
von Vicken teilt dem Grafen brieflich mit, er habe „itzo erfharen das der apotecker das saltz
nicht wurde machen konnen, vnd da es gleig gemacht; das ubrige alhir wegen mangelung der
instrumenten auch nicht wurde konnen gemacht werden; es where dan das ich es selbst an
einem orte machete da man die Instrumente hette“173
. Bereits erwähnt wurde das Anliegen,
ein Bergwerk einzurichten (s.o. Kapitel 3.3); weiter werden „Familiengeister“174
offeriert,
„weilen ich vermercke |: welchs auch bey mir bleiben vd mitt mir ins grab soll :| Eur
gn. zu den SPIRITIBUS FAMILIARIBUS groß lust haben; ich Eur gn. etliche loca, nennen
khan, da man nicht einen: sonderen alle sieben vmb ein geringes erlangen konte, denn
164
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, 20.10.1614 „in loco“ 165
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, 20.10.1614 „in loco“ 166
Bei der Wieden 2010, S. 87f., 105ff., 188f. 167
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, 20.10.1614 „in loco“ 168
Bei der Wieden 2010, S. 20ff., 71ff. 169
Gemeint ist wohl der Hofastronom Johann Krabbe, siehe Karl Brethauer: „Johannes Krabbe Mundensis.
Goldschmied, Instrumentenbauer, Landmesser, Kartenzeichner, Büchsenmacher, Feuerwerker, Kupferschmied,
Leib- und Kammerdiener der Herzöge Julius, Heinrich Julius, Friedrich Ulrich am Hof zu Wolfenbüttel“, in:
Braunschweigisches Jahrbuch 55, 1974, S. 72-89 170
STABU Best. F3, Nr. 239, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, o.D. 171
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, o.D. 172
Ball 2007, S. 268ff. 173
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, o.D. 174
Vgl. z.B. Abraham Seidel: „Pneumatologia Oder Kurtzer Bericht Von denen Geistern über der unlangst
publicirten Frage Ob natürliche gewisse Geister seyen/ und einem Menschen geziemt solche an sich zu locken/
und in dero Gemeinschafft zugerathen? : Welche durch etliche kurtze Fragen aus der hierüber gegebenen
Antwort baß erläutert/ und berichtet wird/ was von denen Spiritibus familiaribus, Wassernixen/ Bergschwaden/
Pygmaeis/ Güttgen/ Bock- und Mantelfahrt ... [et]c. zu halten / ...“, Erfurt, 1648.
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
25
vor etlichen iharen mir an etzlichen orten welche angeboten wurden als zu prag, Wien
in osterreich, Lintz, Gratz, Breßlaulen in der Schlesie nicht zweiflende, Ich wurde
dieselbe leutte oder andere noch dafinden; wo nicht; sindt dießelbe gewiß
zubekommen, Zu Venedig vd weiter in Italia, wie dan auch zu Basell, Vnd nach dem
ich den sachen verner nachgedacht; befinde ich, das man mitt guttem gewißen solche
spiritus woll haben konne“175
Auch von der „veram preparationem Mumiae“ ist die Rede; in der Akte findet sich auch ein
separates Dokument176
, das diesen Zauber beschreibt, der aus eigenem Körperteilen, wie z.B.
Blut, herzustellen ist und es ermöglicht, die Zuneignung anderer Menschen oder Tiere gegen
deren Willen zu gewinnen (Anhang B). Diese „Mumia“ unterscheidet sich deutlich von der
damals gebräuchlichen Verwendung von (echten oder gefälschten) ägyptischen Mumien in
Pulverform als Medizin, aber auf den esten Blick auch von Paracelsus‘ Begriff der
„Mumia“ als dem Körper innewohnende Lebenskraft, die zur Selbstheilung beiträgt.177
Allerdings ist von Vickens Darstellung ganz ähnlich einer Interpretation des paracelsischen
Mumia-Begriffes durch den Leipziger Professor Joachim Tancke, den wir bereits als einen
Bekannten von Vickens kennengelernt haben (s.o., Kap. 3.3). Dieser verglich in seinem
Manuskript „Secreta Secretissimorum“, das er Landgraf Moritz von Hessen zuschickte,
ebenfallls die von der Mumia induzierte Anziehungskraft auf andere Wesen mit der
Magnetkraft.178
Auch ein Zauberspiegel wird wieder erwähnt, und eine Kerze, deren Leuchten das
Lebensende des Grafen vorhersagen könnte. Der Graf hat scheinbar auch nach Hilfestellung
beim Glückspiel gebeten; von Vicken schreibt, nach einigen Suchen habe er einschlägige
Zauber in seinem „Manual“ gefunden, in das er sie vor 25 Jahren in seiner Jugend eingetragen
habe, er wisse aber nicht mehr, welches davon funktioniere. Und schließlich wird dem Graf
noch mitgeteilt, er habe „ein recept at potentiam coitus vnter meynen scharteken gefunden, so
mir fur allen anderen gefallen thutt“179
. Trotz allem scheint es nicht zu einer dauerhaften
Anstellung gekommen zu sein, und die Spur von Vickens verliert sich zunächst, sieht man
von einer möglichen Spur nach Heidelberg ab: Um sich gegen Plagiatsvorwürfe gegen seinen
ursprünglich 1615 erschienenen alchemistischen „Heldenschatz“ zu wehren, schreibt der
Autor Johann Staricius, dass dieses Buch auf einen Text Heinrich Khunraths zurückgehe, den
er auch anderswo, u.a. „zu Heidelberg / jtem / bey deme von Ficken“ gesehen habe.180
8. Späte Stationen: Kaiser Matthias, Gabriel, König von Ungarn. Da die neu aufgefunden Quellen hier zunächst enden, sind wir für spätere Stationen wieder
auf die Angaben im Stammbuch angewiesen. Danach bekleidete er ab 1616 das Amt des
„Consiliarii Metallici“ bei Kaiser Matthias, und 1621 das des „Supremi Consiliarii Metallici,
ac Generalis Mineralium et Monetarum per Regnum Hungariae ut et Transsilvaniae
Inspectoris“ beim kurzzeitigen König von Ungarn, Gabriel Bethlen181
. Während der ganzen
Zeit scheint er den Kontakt nach Riga nie verloren zu haben, denn noch 1618 tritt er als
175
STABU Best. F3, Nr. 240, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, o.D. 176
STABU Best. F3, Nr. 240, „Beschreibung der wharen lebendigen Mumia und ihrer wirckung“ 177
Ball 2007, S. 273ff. 178
Bruce T. Moran: „The Alchemical World of the German Court. Occult Philosophy and Chemical Medicine in
the Circle of Moritz of Hessen (1572-1632)” (= Sudhoffs Archiv, Beiheft 29), Stuttgart: Franz Steiner 1991
S. 138-141 179
STABU Best. F3, Nr. 239, Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, o.D. 180
Helmut Möller: „Staricius und sein HeldenSchatz. Episoden eines Akademikerlebens“, als Manuskript
gedruckt, Göttingen: Basta, 2003, S. 49ff. 181
Johann Christian von Engel: „Geschichte des Ungrischen Reiches. 4. Theil“, Wien: Camesina 1814, S. 401ff.
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
26
Unterzeichner einer Urkunde in Riga in Erscheinung182
. 1620 steht er zuletzt mit Kepler in
(überliefertem) Briefkontakt.
Übrigens gibt es nur vage Hinweise auf ein Familienleben Nicolaus von Vickens, und diese
verweisen wiederum schon auf die Zeit vor 1600. Johannes Kepler hat neben dem erwähnten
Horoskop für Nicolaus von Vicken auch eines für Hieronymus (*1595) und Gustav (*1595)
von Vicken183
erstellt, es könnte sich dabei um Kinder Nicolaus‘ handeln. Dagegen spricht,
dass in einem „Schuz- vnd Schirmbrieff fur Niclaßen von Vickhen“, datiert in Prag, 29.
Oktober 1616184
, ausgestellt durch Kaiser Matthias, in der Vorschrift noch davon die Rede ist,
dass der Brief auch für Eheweib und Kinder, sowie Diener gelte; Frau und Kinder sind jedoch
in der Reinschrift gestrichen, was darauf hindeutet, dass es keine gab.
9. Nachspiel: Magdeburg Im Jahr 1625 hören wir noch einmal kurz von Nicolas von Vicken, also nach dem letzten
datierten Eintrag in seinem Stammbuch. Hauptperson in diesem Nachspiel185
ist jedoch sein
Bruder Heinrich. Dieser steht 1624 in den Diensten des Administrators der Stifte Halberstadt
und Magdeburg, Christian Wilhelm von Brandenburg (1587-1665)186
. Wie wir das schon bei
Heinrich Julius kennengelernt haben, ist er postuliert, aber nicht vom Papst bestätigt, ja nicht
einmal vom Kaiser. Und so wie Heinrich Julius mit Brauschweig im Konflikt war, so wird
Christian Wilhelm zwar im Stift, aber nicht in der Stadt Magdeburg anerkannt. Dort führte das
Domkapitel seine Geschäfte, während Christian Wilhelm anderswo residierte. Allerdings war
das Umfeld ein anderes, der 30-jährige Krieg war im sechsten Jahr und der sächsische
Reichskreis stand unter dem Einfluss der kaiserlichen Truppen. Der Protestant Christian
Wilhelm führte Geheimverhandlungen mit Holland und England sowie mit der Stadt
Magdeburg. Dabei bediente er sich der Dienste des, nunmehr einen Obristen- oder Obrist-
Leutnants-Titel führenden, „nichtswürdigen Abenteurers“187
Heinrich von Vicken, den der
Herzog bereits spätestens 1619 als Kommandeur der von der Stadt Magdeburg angeheuerten
Truppen installiert hatte. Ab 1620 führte von Vicken dann für Christian Wilhelm geheime
Verhandlungen, und zwar zunächst mit einer Gruppe von etwa 20 Bürgern der Stadt
Magdeburg über eine Anerkennung Herzog Christian Wilhelms durch die Stadt; als
gegenleistung war die Zuschlagung einiger Vorstädte zur Stadt Magdeburg im Gespräch.
Doch auch „international“ agierte von Vicken für den Herzog, der um 1624 Ambitionen
entwickelte, in der Reichspolitik eine größere Rolle zu spielen. In Den Haag verhandelte er
182
Hermann von Bruiningk, Nicolaus Busch: „Livländische Güterurkunden: aus den Jahren 1207 bis 1500“,
Riga 1908, S. 526. 183
Nr. 1029 and 1030. KGW 21-2/2, 372; der Nachname fehlt, und ist von den Herausgebern aufgrund der
identischen geographischen Breite hinzugefügt worden. Wenn es sich also um Kinder Nicolaus‘ handelt, so
wären diese ebenfalls in Riga geboren. 184
AT-OeStA/HHStA RHR Schutzbriefe 14-2-25 185
Die Darstellung basiert auf dem Bestand Rep. A 3a, „Domkapitel zu Magdeburg“, Tit I, Nr. ad 18; sowie
Julius Otto Opel: „Die Resignation des Herzogs Christian von Braunschweig auf das Bisthum Halberstadt i. J.
1623. Mit Urkunden“, in: Neue Mittheilugen aus dem Gebiet historisch-antiquarischer Forschungen, Halle:
Thüringisch-Sächsischer Verein für die Erforschung des vaterländischen Alterthums und Erhaltung seiner
Denkmale, Band 13, 1874, S. 1-100; speziell S. 61-65; ders.: „“Eine Flugschrift über die Zerstörung
Magdeburgs“, a.a.O.., S. 407-451, speziell S. 408-415; ders.: „Der niedersächsisch-dänische Krieg. Zweiter
Band. Der dänische Krieg 1624-1626“, Magdeburg: Faber, 1878, speziell S. 55-56; Ernst Neubauer: „Heinrich
Viecke, ein politisch wichtiger Stadtcommandant von Magdeburg“, in Blätter für Handel, Gewerbe und sociales
Leben (Beiblatt zur Mageburgischen Zeitung), 1890, S. 17-19 und 25-25. 186
Artikel „Christian Wilhelm“ von Karl Janicke in: ADB, Band 4 (1876), S. 164–168 187
Opel 1878, S. 55.
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
27
im Frühjahr 1624 im Auftrag des Herzogs mit Moritz von Oranien und Christian von
Braunschweig und berichtete darüber in einem Brief, der sich erhalten hat.188
Im Sommer des Jahres 1624 war von Vicken dann in Süddeutschland unterwegs und machte
sich damit dem Domkapitel in Magdeburg verdächtig, es gingen nämlich Gerüchte ein, von
Vicken habe auf seiner Reise in den Fürstentümern Brandenburg-Ansbach und Brandenburg-
Bayreuth im Namen des Herzogs die Übertragung des Stiftes auf einen katholischen
Herrscher angekündigt. Das aufgeschreckte Domkapitel schreibt Briefe an die beiden
Herrscher. Ob aus politischem Kalkül heraus oder aus anderen Motiven, die beiden Fürsten
bestreiten jedoch, dass so etwas vorgefallen sei. Christian von Brandenburg-Bayreuth189
schreibt unter dem Datum 18.8.1624 aus Neustadt an der Aisch190
: „Nun mögen wier Euch
darauf nicht bergen, das zwar ermelter Vick vor einer geraumen Zeit durch vnser Land vnd
fürstenthumb: sonderlich aber ieziger vnserer Residenz Stadt Culmbach durchgereist, einen
abstandt darinnen gehalten, vnnd bey vnns sich anmelden laßen“. Allerdings sei es während
der folgenden kurzen Begegnung bei der Bestellung von Grüßen geblieben. Von Plänen, wie
sie das Domkapitel beschreibe, sei keine Rede gewesen, „künnen Vnns auch nicht erinnern,
das wir solches bey seinen geführten DISCURSEN, darauff wir auch nicht sonder acht gehabt,
etwas vernommen“. Und Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach191
schreibt am 26.8. aus
Ansbach192
ganz ähnlich, dass von Vicken zwar durchgereist sei und man gegenseitige Grüße
ausgetauscht habe, allerdings „die übrige DISCOURS, so Inn der wenigen Zeitt, welche Er bey
Vns gewesen, Inn gehalttenen Gesprächen gefallen, haben Wir so eben nicht Inn acht: oder
gedächtniß genommen.“ (Pikanterweise sollte Christian Wilhelm bekanntlich unter
jesuitischem Einfluss später zum Katholizismus konvertieren; er resignierte jedoch vorher als
Bischof von Magdeburg).
Außerdem hatte man im Domkapitel aber auch von der oben beschriebenen Haft von Vickens
in Ratzeburg in den Jahren nach 1602 Wind bekommen und schrieb an den dortigen Herzog
August mit der Bitte um Hintergrundinformation. Dieser antwortete am 16.8.1624193
, dass in
der Tat der „...gedachte Vicken alhir, auf Vnser Veste Razeburgk etzliche Jahre INCARCERIRET
gewesen, können auch leichtlich muhttmaßen, Solches nicht ohne Vhrsach geschehen, in
deme der Eine [= Nicolaus] fur endfliehung Verdienter straffe [...] sich auß der gefengnuß
loßgearbeidet, aber nicht wieder bekommen, vnd der andere [= Heinrich] hernacher gegen
heraußgebung Eines Reverßs auch etzlicher Vorbitt, loßgelaßen worden“. Man wisse jedoch
nicht mehr, was eigentlich die Ursache der Haft gewesen sei, und müsse hierzu erst die Akten
durchsehen. Dies werde jedoch etwas dauern, da Kanzler und Räte gerade anderweitig
beschäftigt seien und man den Boten nicht habe warten lassen wollen. Besagte Kanzler und
Räte schreiben dann noch im November194
, dass „die ACTA nach langer vielfaltiger vnd
vleißiger nachsuchungk erstlich vor funff tagen, in ziemblicher großer anzahll gefunden
worden“ seien, man diese aber erst durchlesen müsse, was etwas dauern könne. Damit bricht
der Briefwechsel ab.
Um den Jahreswechsel 1624/5 war von Vicken dann erneut in diplomatischer Mission in Den
Haag unterwegs. Kurz später soll er jedoch Geheimnisse an den kaiserlichen Feldherrn Tilly
verraten haben und wurde im Frühjar 1625 auf Betreiben Christian Wilhelms in Halle
verhaftet. Laut einer zeitgenössischen Quelle wurden dabei „schreckliche zauberische
188
Opel 1874a, S. 61-65 189
Johann Georg Heinritz: „Die Regierungsjahre des Markgrafen Christian 1603-1655“; in: Archiv für
Geschichte und Alterthumskunde des Ober-Main-Kreises, Band 1, Heft 3, 1832, S. 17-60 190
Rep. A 3a, „Domkapitel zu Magdeburg“, Tit I, Nr. ad 18 191
Artikel „Joachim Ernst (Markgraf von Brandenburg-Ansbach)“ von Theodor Hirsch in: ADB, Band 14 (1881), S.
91 192
Rep. A 3a, „Domkapitel zu Magdeburg“, Tit I, Nr. ad 18 193
Rep. A 3a, „Domkapitel zu Magdeburg“, Tit I, Nr. ad 18 194
Rep. A 3a, „Domkapitel zu Magdeburg“, Tit I, Nr. ad 18
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
28
Händel“ bei ihm gefunden.195
Im April 1625 tritt nun sein Bruder Nicolaus noch einmal in
Erscheinung. Er taucht in Magdeburg auf und verlangt laut Bericht des Domkapitels an
Christian Wilhelm196
die Freilassung seines Bruders, unter Androhung andernfalls kaiserliche
Mandate zu seiner Freilassung zu erwirken. Heinrich soll aber noch 1625 in der Haft
gestorben sein. Interessanterwiese gerät aber im April 1626 bei der Schlacht an der Dessauer
Brücke, bei der auch ein Regiment Magdeburger Truppen teilnahm, das von Heinrich von
Vicken aufgestellt worden war, ein Oberst „Fick“ in Gefangenschaft und gibt Kenntnisse der
Magdeburger Verhältnisse zu erkennen.197
Ist es Heinrich, der doch nicht bereits 1625 in der
Haft gestorben war? Oder Nicolaus, der seinen Platz eingenommen hatte?
Aus Briefen aus dieser Zeit ergibt sich auch, dass mindestens Heinrich von Vicken nach den
Ereignissen des Jahres 1601 noch längere Zeit in Diensten Schwedens gewesen sein dürfte
und dort noch in Erinnerung war. So lässt am 8. Februar 1625 der schwedische Kanzler
Oxenstierna durch einen nach Mageburg reisenden schwedischen Bediensteten noch Grüße
des Königs an „hern Ficken“ (Heinrich oder Nicolaus?) ausrichten, der sich früher in
schwedischen Diensten befunden habe, und dessen gute Dienste noch in Erinnerung seien,
auch wenn er jetzt einem anderen Herren diene.198
Und Ludwig Camerarius199
erwähnt im April 1625 in einem Brief, den er aus Den Haag an
den schwedischen Kanzler Oxenstierna schickt, Heinrich von Ficken mit einer interessanten
Charakterisierung. Diese stellt bis auf die genannte Episode an der Dessauer Brücke die letzte
schriftliche Spur der Gebrüder von Vicken dars und ist nicht das schlechteste Schlusswort (das
sich genauso auf Nicolaus wie auf Heinrich beziehen könnte): „Audio Fickium, qui est apud
Magdeburg. Administratorum, in Sueciam venturum esse. Homo est vanus, et ad res magnas
ac secretas non tantum ineptus, sed etiam dubiae fidei. Circumspecte igitur cum illo agendum.
Multa hic Principi et Ordinibus promisit, sed nihil praestitit.”200
9. Schluss Wer war nun der echte Nicolaus von Vicken, der in der Einleitung genannte Politiker, der
Astronom und Astrologe, der Alchemist oder der Betrüger? Die Frage ist vermutlich falsch
gestellt, denn er war alles das auf einmal. Sicherlich diente er vielen Herren auf dem
komplizierten politischen und kriegerischen Spielfeld seiner Zeit, reiste herum als
Unterhändler und Kriegskommissar, durchlebte Schlachten in mehreren Kriegen, verbrachte
Zeit an Fürsten- und Königshöfen als Unterhänder und Spion. Dabei setzte er oft auf mehrere
Pferde, diente mehr als einem Herren, und war immer schon auf der Suche nach dem nächsten
potentiellen Arbeitgeber. Als Türöffner diente ihm dabei sein Adelstitel. Auf der einen Seite
verzichtet er auf ihn, wenn es nicht nötig ist (oft unterschreibt er einfach als Nicolaus Ficke
oder Vicke), umso heftiger verteidigt er ihn, wenn er ihm von anderen abgesprochen wird,
man denke nur an den Briefwechsel mit Herzog Joachim Carl. Ähnlichen Gebrauch macht er
von seinem Titel als kaiserlicher Truchseß; beide Titel öffneten ihm die Türen der Höfe seiner
zukünftigen Dienstherren. Und auch sein Stammbuch dürfte ihm als Hilfsmittel gedient
haben: welch besseren Vorwand konnte es geben, um bei öffentlichen Anlässen mit den
zahlreichen fürstlichen Einträgern ins Gespräch zu kommen als das Stammbuch mit der
artigen Bitte um einen Eintrag vorzuzeigen und vielleicht zu hoffen, mit den bereits
195
Opel 1874b, S. 415 196
Rep. A 3a, „Domkapitel zu Magdeburg“, Tit I, Nr. ad 18 197
Onno Klopp: „Der dreissigjährige Krieg bis zum Tode Gustav Adolf 1632: 2 Ausg. des Werkes: Tilly im
dreissigjährigen Kriege“, Schöningh 1893, S. 594f. 198
Carl Gustav Styffe: „Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling“, Band 3, Norstedt 1900, S. 22. 199
Artikel „Camerarius, Ludwig“ von Moriz Ritter in: ADB, Band 3 (1876), S. 724–726 200
M. G. Schybergson: „Sveriges och Hollands diplomatiska Förbindelser 1621-1630“, Helsingfors: Finska
Vetenskaps-Societeten 1881, S. 191
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
29
vorhanden prominenten Unterschriften und Wappen etwas Eindruck zu schinden. Und
schließlich passt hierher auch das „hermetische“ Wissen. War von dem fürstlichen Objekt der
Begierde bekant, dass er (oder sie) sich für Alchemie, Astrologie oder Zauberei interessierte
(und das taten viele unter den Fürsten des Reichs), so könnte ein geraunter Satz über das
geheime Wissen des Paracelsus, die Kunst der Metallverwandlung, die Verheißung eines
Horoskops oder die Erwähnung eines Zauberspiegels oder Flaschengeistes gereicht haben, um
eine Einladung zu weiterer Konversation oder Korrespondenz zu erhalten. Und wie ein roter
Faden zieht sich durch die erhaltenen Briefe das Doppelspiel aus der Verheißung wahrlich
wunderbarer Dienste, die von Vicken für seine fürstlichen Herren erbringen könnte, und auf
der andere Seite der Warnung vor großen Gefahren und Risieken, sollte dieses Angebot
ausgeschlagen werden. Natürlich brachte die Annahme dieser Angebote gleich das nächste
Problem für Nicolaus von Vicken mit sich: wie sollten die versprochenen Wunder nun
vollbracht werden. Und so finden sich in den Briefen auch die typischen Ausreden des
Alchemisten, wie sie schon Ben Jonsons Stück „The alchemist“ aufzählt: “... a series of
excuses about bad charcoal, improper heating of glass vessels, offerings to the Virgin Mary,
bribes to officials, and the priest’s own sinfulness in order to explain why he needed more
money and why the alchemical process was not yet finished.”201
Bei von Vicken sind es etwa
der Apotheker, der das wundertätige Salz nicht herstellen kann, und die fehlenden
Instrumente, die von Vicken davon abhalten, es selbst herzustellen. War er also nur einer der
Betrüger, die in seiner Zeit so zahlreich auftraten, dass sein Zeitgenosse Thurneisser eine
ganze Typologie der “betrüglichen Alchymisten” aufstellte?202
Dass er allgemein dem Betrug
oder auch einer Hinterziehung von Geld nicht abgeneigt war, steht fest, so wir den
Beschwerden Herzog Franz‘ von Sachsen Glauben schenken wollen, und auch mehrere
Gefängnisaufenthalte sprechen eine deutliche Sprache. Und doch sollte man vorsichtig sein,
so hat Nummedal nicht umsonst darauf hingewiesen, wie schwierig es sein kann zu
entscheiden, ob Alchemisten betrügen wollten, oder an ihre Werke glaubten und
scheiterten.203
Auch ist daran zu erinnern, dass auch Newton, der Inbegriff der rationalen
Wissenschaft gleichzeitig ein an den Schriften des Hermes Trismegistos interessierter
Alchemist war.204
Und Ball schreibt mit Bezug auf Agrippa von Nettesheim, der in
verschiedenen Schriften Magie sowohl ablehnt als auch befürwortet: „As we have seen, this
apparent coexistance of contradictory extremes in a single individual is a recurring feature of
Renaissance thought - we see it very clearly in Paracelsus - and the skeptical mystic is one of
the difficult personality types of that age, with which anyone seeking for the origins of
scientific thought must at some point wrestle.”205
Könnte von Vicken also auch ein
“Suchender” gewesen sein, der immer hoffte im nächsten Ort, beim nächsten Magier oder
Astrologen, den er traf, auf das echte Wissen zu stoßen? Einige Anhaltspunkte sprechen
durchaus dafür. Zum einen ist da die Breite und Tiefe seiner Korrespondenz mit Kepler und
anderen Astronomen: um in betrügerischer Absicht ein Horoskop für einen Fürsten zu
erstellen, wäre es wohl nicht nötig gewesen, mit Kepler über geringfügige Unterschiede
verschiedener Berechnungsmodelle zu diskutieren. Auch die Hinweise auf eigene
astronomische Beobachtungen deuten in diese Richtung. Und schließlich kann man auch die
Vorgänge in Blankenburg 1609/10 in diese Richtung interpretieren: Wenn er an seine
Versuche in der Stahlherstellung nicht geglaubt hätte, wäre er dann bei ihrem Scheitern nicht
eher still und heimlich verschwunden, statt sich mit einem übermächtigen Gegner vor Gericht
anzulegen?
201
Nummedal 2007, S. 54 202
Nummedal 2007, S. 66f., 203
Nummedal 2007, S. 172f. 204
Moran 2005, S. 168ff. 205
Ball 2007, S. 87
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
30
Vielleicht können weitere Dokumente, die vielleicht noch unentdeckt in einem Archiv
schlummern, in Zukunft über diese Frage Aufschluss geben. Und auch weitere Aspekte im
Leben dieses interessanten Menschen wären noch zu untersuchen, etwa Nicolaus von Vickens
Verhältnis zur Religion. Offenbar protestantisch scheut er sich nicht, für den katholischen
Kaiser zu arbeiten, und er steht mit auffallend vielen Theologen in Kontakt, die am Rande der
Amtskirche stehen oder sogar mit dieser im Konflikt. So z.B. mit den Chiliasten Paul Nagel
und Melchior Leporinus.206
10. Summary This arcticle summarizes what could be learned from newly discovered documents about the
biography of Nicolas von Vicken, first known reader of Kepler’s „Astronomia Nova“ and
Kepler’s partner in an exchange of more than a dozen letters over several years. Von Vicken
stems from a rich and influential family of merchants in Riga, made noble by the Polish King
(who ruled Riga at the time) in 1580. His education included legal studies at the universities
of Königsberg, Leipzig and Rostock, partially overlapping with a stay of ten years at the
Polish court. There von Vicken pursued family business but also served in an official court
role. In 1600/1 von Vicken switched sides and started to serve the Swedish ruler (and later
king) Duke Carl IX, who was at war with Poland to gain control over Riga and Livonia. In
1602 a mission for Sweden to Northern Germany brought him in conflict with Francis II,
Duke of Saxe-Lauenburg, who accused von Vicken of withholding money from him, which
was supposed to be used for hiring troops. Von Vicken, together with his brother Heinrich,
was imprisoned, but could flee. During a mission to Maximilian III, Archduke of Austria, in
1599/1600 von Vicken had been initiated as an alchemist and astrologer through reading the
works of Paracelsus and his future stations in life were influenced by this. These include an
attempt to get employed at the Saxon court in Dresden, and stays in Wolfenbüttel and
Halberstadt, both ruled by Duke Henry Julius of Brunswick-Lüneburg. Von Vicken offered
various astrological and alchemical services to the Duke and private investors. With one of
them he got into a serious conflict over the alleged non-fillment of a contract to produce steel
in an alchemical way. During that vonVicken got imprisoned twice, in 1609 and between 1611
and 1614. A subsequent attempt to get employed by Ernst of Schaumburg left us with several
letters that detail von Vicken’s alchemical and astrological thinking, two of these are
published here in the appendix. Since 1603 von Vicken was also in the service of Emperor
Rudolf II; again he got imprisoned in Prague at least once. An interesting speculation based on
some hints in the documents is that after reading Paracelsus and during his time in Leipzig
von Vicken authored a book on mining, that was later to become part of the works of the
alleged medevial monk Basilius Valentinus.
Anschrift der Verfasser:
Dr. Nils Lenke, Blumenstraße 50, 53359 Rheinbach; e-mail: [email protected]
Dr. Nicolas Roudet, 26, rue de La Lamproie, F-67000 Strasbourg;
e-mail: [email protected]
Anhang A
Brief von Nicolaus von Vicken an Graf Ernst, 20.10.1614 „in loco“; Beinhaltend den “Cursus
Vitae“. STABU Best. F 3, Nr. 240
206
Schwarz 2002, S. 80 und 94
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
31
[r°]
Hochgeborner Graf. Gnediger herr, Ein weiser Mann, sagt Syrach, der das geseze des
hochsten gelernet, die weißheitt aller alten erforschet, vnd in den Propheten studiret, die
geschichte der berhumpten leüte vermercket hatt, vnd denselben nachdencket was sie
bedeuten vnd lheren, derselbe khan den fursten dienen vnd beÿ den herrn seÿn, Er khan sich
schikken laßen in frembde lande dan, er hatt versücht, was beÿ den leüten taüg oder nicht taüg,
vnd dencket wie er fhrüe aüfsthehe den hernn zusuchen der ihn geschafen hatt, vnd betet für
den herrn, Er thütt seÿnen mundt getrost aüf, vnd betet fur des gantzen volcks sünde. Vnd
wann dan der herr also verßunet ist, so gibt er ihm den geist der weißheitt reichlich, das er
weisen radt vnd lher geben khan gewaltiglich, dafür er dem herrn danckt in seÿnem gebete
vnd der herr gibt gnade dazü, das seÿn radt vnd lhere vortghen vnd betrachtet es vor beÿ sich
selbst, darnach sagt er seÿnen radt vnd lher herauß, v[n]d beweisets mitt der heiligen schrift,
vnd viell verwunderen sich seÿner weißheitt, vnd sie wirdt nimmermher vnterghen. Cap 39.
Vnd der weiße konningk Salomon sagt, Ich habe auch dieße weißheitt geßen vnter der sonnen,
die mich groß dauchte, das ein kleÿne stadt whar v[n]d weinig leute darÿnnen, vnd kham ein
großer konningk vnd belegt sie, v[n]d baüwet groß bolwerck darumb. Vnd wardt darynnen
funden ein armer weißer Mann, der dieselbe stadt, durch seyne weißheitt konte erretten, vnd
keyn mensch gedacht deßelben armen mannes, da sprach ich, weißheitt ist ia beßer dan
starcke Noch wardt des armen weißheit veracht vnd seynen wortten nichts gehorchet, das
machet, der weißen worte gelten mher beÿ den stillen, dan der hern schreÿen beÿ den narren,
dan weißheitt ist beßer dan harnisch. Ecclesiast. 9207
. was nün godt hiraüf in nur seyner armen
creatür fur gaben weißenschafft in naturlichen vnd vbernaturlichen |: der himlischen muß ich
geschweigen, sintemall man mich, oder den geist gottes in mir, davon nicht hatt horen reden :|
in mir gelegt: solches wirdt Eur hochg. Gnad. so woll auß denen von mir derselben
eingelieferten verzeichnißen: als auch mundlicher gnediger unterredung vnd conuersation,
zweifels ohn, nür zum teill gnedig vernommen vnd verstanden haben. Wan ich dan beÿ mir
entschloßen, Einem furnhemen herren, der sonderlich lust vnd liebe zu allen naturlichen
verborgenen, vnd sonderlich denen kunsten, die godt mir auß gnaden offenbharet, hatt vnd
tragt; vnd mir eine ehrliche, meÿner person, beÿ Kaÿser, koningen, heren vnd fursten
bedienten officien, vnd wißenschaften gemeße bestallung vnd vnterhalt entweder zur stelle
oder von haüß auß, geben vnd vermachen wurde; solcher meÿner, von oben herab, vom vater
des lichts, von dem weißheitt v[n]d alle volkomne gaben herfließen [v°] verlhienen geben vnd
geringen wißenschaften, auf den halben gewinn getreüwlich vnd ohn allen betrüg teilhaftig
zümachen; Vnd aber Eur hochgeb. Gn. fur allen anderen herrn und fursten dießer welt mir
itzo furkompt, dem ich willig vnd gern |: welchs ich doch fur dießen mitt godt bezeugende,
großen heren v[n]d fürsten verweigert v[n]d abgeschlagen :| meÿne vnterthenige, mitt leib vnd
leben, ehr vnd gütt verfaste , ehrliche, christliche, getreuwe dienste, zu offeriren v[n]d zu
praesentiren, von meÿnem Genio vnd Ingenio gezwungen werde, vnd zwar auß
nachfolgenden vrsachen
Erstlich, weilen Eür hochg. gn.; ohn zweifell auß anreichung des heiligen geistes |: ohn deßen
willen nichts geschicht :| zu meyner geringen person eine gnedige christliche beliebung
getragen, Vnd meyner in Astrologiam geringer wissenschaft, in meÿnem exilio vnd elendt, ein
geringes specimen vnd dokimasian208
begert, mich drauf gnedig von meÿner auf lübeck
Eingenommenen reiße abgerhaten vnd abgehalten vnd zu sich erfurdert; mitt mir vnwürdigen,
von dießer welt vnd deßen kinderen, veracht: vnd vernichteten; geringen gliede vnd brudern
christi; viellmhall gnedig conferiret, vnd von hochwichtig verborgenen sachen geredet |: drob
207
Prediger 9, 13-18 208
Griech. δοκιμασίαν = Probe, Versuch (Akkusativ)
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
32
mich andere nicht weinig anschielen, ein vngunstig aüg auf mich geworfen vnd werfen, vnd
verhast zümachen furhabens :| vnd alle gnade vnd gnedige contentament erwiesen.
Zum anderen, weilen auß solcher gnedigen geheimen vnterredung, ich mher den gnug
vernommen, das Eur hochg. gn. zü den geheimen natürlichen den gemeÿnen leuten
verborgenen kunsten, großs beliebung, auß angeborner lust vnd begierde tragen.
Zum dritten, weilen auch derselbe, auß besonderer gnedigen zuneigung mir, viell sachen,
meÿne person, v[n]d zur vnschuldt mitt godt, bezeügende erlittene gefengniß vnd schmach,
betrefendt, zur nachrichtung, wobey ich dennoch Eur hochg. Gn. gnedige affektion gegen mir
demütig vermercket, vertrauwlich entdecket,
Als khan ich aüß eingebung des geists gottes; eben so weinig, als Eur Gn auß derselben
eingebung sich meÿne enteußeren konnen, vmbgang haben, Eur hochg. gn. fur allen anderen;
so woll, wegen der mir erzeigten gnediger gewogenheitt, als auch tragenden heimlichen
beliebung zu natûrlichen verborgenen kunsten v[n]d wißenschaften, damitt mich godt fur woll
taüsenden, aüß laüter gnaden begabet; Mich selbst mitt allem was ich habe vnd khan auf eine
gewiße zeitt entweder zur stelle oder von hauß auß, zu offeriren v[n]d zu praesentiren, nicht
zweiflende, Eur hochgeb. Gn. werden in viell wege, sich meÿner [r°] vnterthenigen diensten
gefrommet vnd genoßen befinden, vnd am ende in der tadt mher erfahren vnd spüren, als ich
mich, durch zwang des geists gottes, habe vermercken vnd horen laßen.
Vndt damitt Eur hochg. Gn. nicht vermeynen mochten, das ich mir in diesem Natürlichen, den
hochschülerischen Theologen, Iuristen, philosophen, soldaten verborgenen, vnd nicht auch
ihnen bekannten künsten, erfharen where; habe ich eine noturft erachtet, meÿnen Cursum
Vitae et studiorum gar kurtzlich anhero züsetzen vnterthenig bittens, Eur hochg gn. solches
anders nicht, als in allen gnaden zuvermercken gerhüen wollen.
Es sindt 26 ihar vergangen, das; nach dem meyn godtselige lieber vater mich in allen güten
sitten, freÿen künsten vnd tügenden in schola principali erzhien laßen, vnd nachmaln in
frembde lande vnd zwar nahe konningspergk in preußen aüf der hochen schulen verschickken
wollen; er gar lange mitt sich selbst vnd anderen vornhemen hochgelartten leütten deliberirt
vnd zu rhate gegangen, In welcher facultet er mich studirn Vnd animum appliciren laßen
wolte vnd solte, wozu ihn dan nicht geringe vrsach, nemblich das er nebst meÿner godtseligen
vielgeliebten mutter zu vnterschiedtlichen viellmhalen drüber kommen vnd gesehen, das eine
weiße Nater mit der guldenen kronen |: davon die naturkundigen vnerhorte wunder seltzame
sachen schreiben :| mir, da ich 4 oder 5 iharen gewesen, in den schoß geseßen, mitt mir
gespilet, vnd da die elteren sich genahet wiederümb zu loch gekrochen, welchs sie dan, fur ein
nicht gering zeichen kunftiger weißheitt, verstandes vnd erkündigung der natur
heimligkeÿtten gehalten; bewegt vnd angereizet; Endlich aber nach langem deliberiren was
auß mir werden wolte machte godt wißen sintemall sie oftmalig wie angezeigt, Eine weiße
Nater mitt mir spielen geßen, woraüf ich ihnen valedicirt vnd naher konningspergk gezogen,
alda das Iuris studium, tanquam immensum et inexhaustum pelagüs angefangen, dreÿ ihar
continüirt, vnd im selbigen disputando also fortgefahren, das ich in den dreÿen iaren so woll
das gantze Ius Ciuile et Canonicum, als auch Magdeburgense, Polonicum vnd andere Iura
mher nicht alleÿn comprehendirt vnd begriffen: sonderen auch nachmalen solche gefaste
Theoriam in aula polonica ad praxin dediciren mußen, vnd also in aula polonica zhen ihar
commorirt, vnd die polnische sitten vnd gebreüche gelernet.
Demnach ich aber in solcher rechtfertigung reipsa erfharen, das es mitt dem rechte gar
vngleig zügehe, vnd mher der faüor in Iudice qüam lex in Codice gelte vnd viell darynnen
muß practicirt werden, das wieder gottes wordt vnd die liebe des negsten ist; habe ich solch
studium [v°] fharen laßen, die gelegenheitt vnd den zustandt des krigswesens nach dem ich
hofmeysters vnd Marschalcks ampt in polen bedient gehabt erforschen vnd erfharen wollen:
Mich derowegen an die Rom: Kay: Maÿtt, vnd Erzherzogen Maximilianüm in anßenlichen
gantz wichtigen handlen, fur einen abgesantten gebrauchen laßen, vnd drauf nach verrichter
legation in Vngarn, in der belagerung für ofen mich eingestellet, der belagerung
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
33
beÿgewhonet; Nachmaln aber, wie woll vngern, dem konningk in schweden Carolo zuzhien
ein Zeittlang in Liuonia, dem krige beywhonen, vnd so woll Cancellarÿ, als Commissarÿ
supremi bellici Münüs in Germania verwalten mußen. In welchem exercitio, weiln ich
daßelbig, wozu mich meÿn von godt, eingeblaßener geist getrieben, noch nicht erfharen
konnen, bin ich entschloßen gewesen sinceriori et püriori philosophiæ natüralj et veræ
Theosophiæ mich züergeben, Vnd demnach ich anno etat. meæ 28 in meÿner wiederkunft ex
Vngaria et Aüstria, die gottliche vnd niemaln genugsame lobwürdige kunst Astrologiam
erlernet vnd so weit in acht tagen darÿn progredirt das ich ein Iudicium Generaliarum stellen
vnd dem Itzigen Regi Poloniae naufragium & amissionem regni Sueciæ verkündigen konnen;
Habe ich immefort, den sachen weiter nachgesetzet, vnd durch anreizung eines
osterreichschen Baronis die philosophiam Sagacem et Astronomiam Magnam Theophrasti
Paracelsi, hominis plus quàm diuino ingenio praeditj zulesen angefangen, welche lection,
mich dan also vnd derogestalt delectiret, das ich mich nicht genügsamb damitt ersetigen
konnen: sondern weitter fortgeschritten vnd seyne opera alle fleißig dürchgelesen,
concordantiar drauß gemacht v[n]d seÿn mentem vnd sinn in abstrüsiontien assequiret,
welcher vrsachen halben dan so woll, als auch wegen meynes libelli metoposcopicj et
Chyromantici, so ich der Rom. Kay: Maytt Rudolpho, hochsten gedachtniß dedicirt, dieselbe
mich wieder meÿnen willen vnd furnhemen in dero dienst zütreten vnd fur ihren trüchsaßen
anzunhemen vnd bestallen zulaßen, gezwungen, vnd nachmals in teutch vnd andere lander
abgeschickt, alle Closter vnd gelartte leüte, heimlich zubesuchen, mitt ihnen zureden, v[n]d in
allen verborgenen kunsten v[n]d wißenschaften; gewiße Experimenta zuwege zubringen,
woruber ich fast vier ihar zugebracht, vnd nicht einen geringen schatz erlangt. In dem ich nun
mitt dießer secretiori philosophia vmbgehe v[n]d daneben viell anders philsosphos, auf
meÿner reiße de lapide benedicto durchblättert, vnd zum teill meinem operj admoniert; vnd
aber reipsa [r°] dabey befunden, das der lapis philosophorum terrestris, iuxta illud christi,
quærite primum regnum Dei et iusticiam ipsius, et cætera adijcientur uobis: Item, Iouæ
metüentibus, patefit eius arcanüm et foedus nicht konte assequiret werden, ehe vnd bevor man
den Lapidem Cælestem in seipso recht erkennet vnd ergriffen: Als habe ich mich auf die
whare vnuerfelschte aüß dem lichte des heiligen geistes herfließende philosophiam v[n]d
Theosophiam begeben, In derselbigen durch verlhieung gottlicher gnaden, vnd durch die drey
Gradus Veræ Magiæ et Cabalæ Cælestis et Christianæ, die vns Christus Math. 1 selbst lheret
vnd zügebrauchen befhielet, fleißig, so nachtlich, so teglich stüdiret biß ich ohn rhumb
zumelden, zu den wharen vnd inneren, der [w?]haren vnd durch das vom teuffel verfelschte
licht der natür, vnuerfelschten Theosophia, das ist, des rechten vnd wharen, von den
hochschulrischen [unleserlich]leutten vnd Theologen verworfenen ecksteins vnd Lapidis
Cælestis, Grunde vnd kern das ist Ihesum Christum in wharem glaüben, vnd mitt deßen zür
erkentniß lapidis philosophorum terrestris ohn vppigen rhümb zumelden; kommen, vnd den
wharen verstandt der heiligen schrift godt lob erlangt vnd in simplicitate, humilitate et
rectitudine cordis begriffen, dafur ich godt meÿnem schopfer vnd godt meÿnem erloser vnd
seligmacher; vnd godt meÿnem erleuchter, nicht gnugsamb dancken khan vnd will, das er
mich fur viell hundert tausenden so gnedig angeßen, vnd mitt dem lieben Paulo dem
außerwelten vaße vnd rustzeuge gottes, durch viell arbeitt ud mhue, viele gefengniß v[n]d
verfolgung, durch viel reisen, durch waßers v[n]d feuers gefhar; durch gefherlig keytt vnter
mordern; vnter falschen bruderen; in mhue vnd arbeitt, in viell wachen; in hünger vnd dürst;
durch viell fasten, in froste vnd bloße, in großer gedult, in trubsalen, in noten, in angsten, in
aufrhuren, in keuschheitt in erkentniß, in langmütt, in freundtligkeÿtt, in dem heiligen geiste,
in vngefarbter liebe, in dem worte der warheitt, in der craft gottes, durch weysen der gerechtig
keytt, zur rechten vnd zur lincken, durch ehre vnd schande, durch boß geruchte vnd gut
geruchte: als ein verfhürer vnd doch warhaftig, als ein ketzer vnd doch ein ersamer
christglaübiger, als ein zauberer, v[n]d doch so vnschuldig davon als meyn selig macher, als
ein vnbekante vnd doch bekandt, als ein sterbender, vnd sehe ich lebe, als ein gezuchtigter
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
34
vnd doch nicht [atodter?]; als ein traüriger aber allezeitt frolich; als ein armer aber der viell
reich machet; als der reiches innen hatt vnd doch alles hatt; in summa
Per üarios casus, per tot discrimina rerüm209
[v°] Ad portum salutis; vnd zu solchen hochen Mysterien, kommen vnd gelangen laßen,
dahero ich nicht vnbillig; Nachfolgendt Sÿmbolum fhure vnd in stambucheren hinter mich
verlaße.
Arte et Marte
Tendit in ardüa Virtus
Per
An ta
güs güs
ta Aü
ad
Sic Per oppositúm nascitur omne BONVM.
Nam qui assidue in rebus prosperis et laetis quid Sapiat? Non temere
aduersa Casuum reputat, quem Fortuna nunquam decepit210
; at qui etiam
eam expertus est, magis ille ad Modestiam factus et Cautionem
præcipuas PRVDENTIÆ partes
Vnde Pÿndarus recte
ό πονήσας δἐ νόω
καἰ προμάθειαν φέρει211
Qui mente laborauit
Prudentiam inde aufert
Et non inconcinne Mythridates de seipso
Mihi fortuna mültis rebus ereptis, dedit Vsum bene suadendi
Et reuera Nocumenta Docümenta
Nec Dulcia meminit, qui non gustauit amara
Sic; sine cruce et morte ad amissa bona reditus fierj nullo potest
modo, nec Deus Vult hominem mortalem a se nunc peregrinantem
ad immortalem beatitudinem et gloriam delicato peruenire itinere: sed
per ignem tentationis et tribulationis cum tristi et amara morte, Quia
Coronatio et lachrimarum abstersio demum superatorum hostium victoriam
subsequitur. Digna enim est et maioribus praelijs, VITA ÆTERNA
Auß dießem hatt nun eur. Hochg. gn. Meynen Cursum vitae aufs kurzest zuvernehmen, was
nemblich mich godt, als seyn zum ewigen leben predestinirtes vnd außerweltes kindt, durch
alle praedicamenta vnd prædicabilia hatt exerciren, vben, vnd nicht wie Silber brüteren,
sondern in dem ofen des Elendes außerwelt machen wollen. Esai: 48:212
also, das ich auch ohn
tumb zumelden woll sagen vnd schreiben khan
Mihi fortüna multis rebus ereptis dedit vsum bene sua dendi
Das ist; wie der weiße Mann Syrach sagt. Ein wolgeübter Mann versthett viell, vnd ein
wolerfharner khan von weißheitt reden, wer aber nicht geübt ist, der versthett weinig, vnd die
vngeübten v[n]d irrigen stifften viell boses. Cap. 34.
[r°] Derowegen dan, weiln ich, wie gesagt, bey mir entschloßen, Mich vnter einem herrn
Niederzulassen, daßelbe was mir godt auß gnaden offenbharet ins werck zurichten; vnd also
209
Vergil, Aeneis 1, 204 210
Livius „AB VRBE CONDITA LIBER XXX”, 30 211
Pindara, Isthmia, I, 40. Als von Vickens Quelle für dieses so wie weitere Zitate kommt in Betracht: Justus
Lipsius: "Politicorum sive Civilis doctrinae libri sex. Additae Notae auctiores, tum & De una religione liber.
Omnia postremò auctor recensuit", Antverpiae : Ex officina Plantiniana, Apud Joannem Moretum , 1610-1613. 212
Jesaja 48: 10
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
35
einem herren, der mich mittt einem ehrlichen vnterhalt vnd bestallung verßen wûrde, meyner
wißenschaft teilhaftig zü machen; Als thue Eur hochgeb. Gn. fur allen anderen, auß
vorangesagenen vrsachen, meyne vnterthenige treüwe, Eur hochgeb. Gn. vnd dero land vnd
leüttten wolersprießliche, dienste auf zwey ihar hirmitt praesentiren vnd offeriren, mitt dem
erbieten, da von Eur. hochg. gn. ich von haüß auß, wurde bestalt werden, vnd eine ehrliche
vnterhalt zuerwartten haben |: doch das anfenglich niemandt; als Eur hochgeb. Gn. vnd ich
davon wißen moge, biß ich meyne vnschuldt außgefhurett vnd an tags licht gebracht, v[n]d im
lande brunßwigk sicher reisen moge :| mich auf die nahe, oder wohin mich Eur. hochgeb. gn.
verordnen werden; damitt selbige mich iederzeitt haben v[n]d meÿner mechtig seyn konne,
aüfzuhalten, vnd anfenglich meÿne wißenschaft in dem hafen leüchten zülaßen
Erstlich, das ich allerley wildt, von den grentzen, in Eur hochgeb. Gn. grafschaft, nach;
meynes verhoffens; für den vorihass bringen, vnd dereÿn auch erhalten will, gantz Natürlich.
Zum andern, weilen Eur hochg.gn. von mir gnedig begert das bergwerck zübauwen, will vnd
khan ich mich als dan desto beßer vmbthun vnd ezlichs gewerken; die nebst mir die handt am
bauwen anlegen mochten, dan so von mir vnd anderen daßelbe solte gebaüwet werden, ist
vonnoten, das von Eur hochgeb. gn. ich eine bestallung habe, damitt ich am baüwen was
anzuwenden hette; where auch als dan entschloßen, das stallwerck in eur. hochg.gn.
Graffschaft Holstein oder Schaüenburgk, selbst anzurichten, vnd in der tadt zuerweißen, das
Eur hochg. gn. mitt warheitt deßwegen berichtet würden, vnd das die stallkunst so whar seÿ,
das im geringsten nicht daran zu zweiflen, wodurch dan Eur. Gn. einkommen nicht weinig
wurde verbeßert werden.
Zum dritten weilen ich auch vernommen, das Eur. hochg. gn große lust vnd beliebung haben
einen oder mher spiritum familiarem zühaben; konte ich als dan, wan ich von hauß auß bestalt
where, vnd demnach geschickt würde, Eur Gn. dazu verhelfen, welchs woll einen anderen
nicht zuvertraüwen, v[n]d auch von ihm schwerlich was früchtbarliches außgerichtet werden
konte
Vors vierte, so wolte eur hochg. gn. ich auch die veram præparationem Mumiae |: dan, an der
præparation ist das meÿste gelegen vnd khan abheß [?] suspicione von Eur. Gn. oder anderen
nicht, præparirt werden :| [v°] welches ich fur einen großen schatz halte eroffnen vnd selbst
verfertigen, was nun diß alleÿn fur ein schatz sey vndwas damitt außzurichten, bey den
vnterthanen vnd anderen, hatt man leichlich abzunhemen.
Zum fünften, so werde ich auch fur hochg. gn einen duchtigen knaben verschafen konnen, den
Eur. Gn. zum Spigell, derer description Eur hochg. gn. ich gutwillig communicirt, vnd
dadurch mher zuerfahren vnd zuverrichten, als man glaüben khan; ohn allen verdacht vnd
wißen anderer leüte, in geheimb wirdt gebrauchen konnen
Zum sechsten, so will ich auch auß dem blute, Eur hochg. gnaden ein licht bereitten, das da
ohn außloschen so lang brennen soll; als Eur gn.leben; vnd hett dieße tugendt, wann Eur
hochg. Gn. sich nicht woll befinden oder schwach werden will; so brennt das licht gar fenster,
vnd wan sie baldt sterben sollen; so erloscht das licht ganz und gar.
Zum siebenden; so werde ich auch desto beßer, das Sal gemmæ ad confortationem Naturae;
vnd das oleum Talci, Eur hochgebor. gn. nebst anderen sachen verfertigen konnen.
Was aber mher innerhalb der Zeitt von mir wirdt præstiret werden damitt groß wunder
zuverrichten; als mitt den sieben sigillis vnd laminis Planetarum, signorum vnd atinium [?]
Imaginum, das wirdt die zeitt vnd stunde geben vnd bringen; vd ist vnnotig viell worte davon
zusagen; weilen es nicht ehe geschen khan, als wan ich mich ein weinig werde eingerichtet
vnd dazu geschickt gemacht haben.
Wann ich nun bey mir wolbedencke; das Eur hochg gn. viell dienere alhir, in welschlanden
vnd anderen ortten auf ihre vnkosten halten, von denen sie solchen nutzen v[n]d frommen
nicht zugewaren als von mir; als khan ich nicht sehen, was Eur hochg gn dieße meyne
vnterthenige præzestirung; nicht anzunehmen; davon abhalten mochte; als das mir zur
vnschuldt, von meynen feynden v[n]d mißgunstigen hinterrucks viell nachgeredet wirdt, das
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
36
sie niemaln, so ßer sie sich auch bemhüet, erwißen, v[n]d in ewigkeytt auch nicht erweißen
werden; wan aber eure hochg. gn. bey sich wegen werden, das ich mich gegen alle meyne
feynde zur antwordt erbiete v[n]d deßwegen vnb sicher gleitte bitte, zu dem niemandt, als Eur
Gn v[n]d ich anfenglich von dießer bestallung wißen sollen; ich auch inmittelst wiederumb zu
gnaden mitt gottes hulf gelangen v[n]d meyn vnschüldt aüßscheinlich zumachen verhoffe; Als
wirdt meynes erachtens, Eur [r°] hochg gn. auch diß nicht daran behindern konnen;
insonderheitt, wan Eur hochg gn. gnedig betrachten werden, wie durch die Astrologische
kunst, Eur Gn. dero gesundheitt vnd langes leben betreffendt; was dan auch ihren Graf: vnd
herrschaftten mitt meynen warnungen vnd Nachrichtungen, fur nützen vnd frommen, in
legationibus, fursthehenden krige vnd vberfall |: des man so liederlich nicht achten soll :| fur
nutzen vnd frommen werde schaffen konnen; gewiß glaubends; das; so ich bereit v[n]d willig
gewesen vnd noch bin, fur ihrer f.g. herzogen zu B. vnd L. von denen mir aller schimpf v[n]d
spott zür vnschüldt wiederfharen; mir nicht einen finger: sonderen eine gantze handt laßen
abzunehmen, da es die nott erfurdert; bey Eur hochg. gn., der mir bestallung wurde geben vnd
alle gnade erzeigen, in zeitt der nott; viell ein mheres vnd hochers, ich ausstehen wurde.
So nun eur hochg. Gn meyner vnterthenige praesentirte dienste wolgefellig sindt; bitte Eur
hochg. gn ich vnterthenig; damitt ie ehe ie lieber fortzufharen; damitt, wo ich solte bestallet
werden, desto ehe meÿne, hin vnd wieder spargirte vnd versteckte secreta vnd instrumenta
mochte zusamen bringen, meyn furnhemen ins werck richten, vnd desto ehe Eur hochg. gn.
nützlich vnd ersprießlich bedienet seyn konnen; wo mich nicht, meyne dienste einen andern
herren den ich in erfahrung dießes, mir hingesetzet vnd erwhelet, praesentiren vnd offeriren
konnen, gewiß dafür haltende, das selbiger herr dem godt meyne person vnd wißenschaft
gunnen wirdt; ßer gluckselig seyn vnd eynen gnedig gott habe vnd haben muße; dan was
keynes menschen aüge geßen; keÿnes menschen ohr gehort; v[n]d in keynes menschen hertz
kommen; das bereittet godt nur denen die ihn furchten, lieben v[n]d von ihm außerwelt sindt.
1. Cor. 2.213
dieses habe Eur hochg gn ich also zu bezeignung meynes wolaffectionirten
gemutts andeutten wollen; demutig & gehorsambst bittend; anders nicht als in allen gnaden
zuvermercken, meyn gnediger Graf v[n]d herr zü seyn v[n]d zubleiben, v[n]d gnedig sich
gegrust mir drauf zuerkleren welches ich nach vermugen zuverdienen vrbutigk. datum den 20.
Octobr. 1614. in loco
Eur hochgebor. Gn.
demutige willige
gehorsame servitor
Niclas Von Vicken
mpp
[v°] Post Scripta
Gnediger herr, Nach dem ich dießen brief verfertigt; werde ich berichtet; das alhir in Eur. Gn.
Grafschaft; etliche haselstauden verhanden, drauf mispell wachßen soll. Wie hoch ich mich
hirob erfreuwett, da ich solches gehoret; ist nicht zu schreiben, dan vnter solchen haselstauden,
wirdt die weiße Nater gefunden derer gleigen mir in der iugent im schoß geseßen v[n]d mitt
mir gespilet, Ich habe derselben lang nachgegangen vnd lang nachgetrachtet; dieselbe auch
zweÿmhall geßen, vnd beÿ den na werd nach gegraben; ist mir aber auß vergonnen oder
mißgunst des teufels |: davon ich wurcklich viell sagen khan :| entzogen würden; Paracelsüs
schreibt, das die schlangen; fürnemblich aber die weiße, so große, vnd den vnerfharenen
vnglaubliche, potentiæ vnd gleichsame vbernatürliche virtutes habe; das niemandt glauben
khan. was aber sonsten die weiße Nater fur Virtutes habe; habe ich aüß meÿner Memoria
wollen äufsetzen vnd Eur hochg gn. zulesen schikken, damitt sie drauß erßen mogen, was es
fur ein Mÿsterium sey; Man halts fur gewiß dafur, das Paracelsus, dieße nater gehabt vnd
213
1. Kor. 2: 9
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
37
davon gegeßen weilen er aller Kreütter eigenschaft gewust & beschrieben: v[n]d ich habe nur
etliche experimenta, mitt der gemeÿnen schlangen gemacht die seltsam sindt; wie viell mher
wurdes die weißte Nater mitt der guldenen kronen thun, wan sie zu rechter zeitt genommen
vnd erlangt wirdt; dan sie ergibt sich nicht einem ieden. Diß habe Eur hochg. gn. ich nicht
vnuermeldet laßen wollen; Datum den 21. Octobr, da der Mondt, in Eur Gn. signo
ascendenten ist; sextili Veneris applicirt, vnd die Sonne mitt Joüe eine gluckselige
Coniunction machet.
Eur hochgeb. Gn.
williger gehorsamer
servitor
Niclas Von Vicken
Anhang B
STABU Best. F3, Nr. 240 „Beschreibung der wharen lebendigen Mumia und ihrer wircküng“
[r°]
Beschreibung der wharen lebendigen
Mumia vnd ihrer wircküng
Es khan ein ieglicher mensch seÿnen leib in Mümiam transmütiren, seÿnen leib vnd leben ohn
schaden, vnd khan ein stück von seÿnem leibe nhemen, das mans doch dem leibe nicht ansihet,
vd dieße wirdt die lebendige Mumia genant.
Mitt dießer Mümia haben sich viell bemhüet die büler vnd bülerinen, welche ihre eigne
Mumiam gar lieblich bereitet, vnd deßelben ein gar kleÿn gewicht ihrer bülschaft
beÿgebracht: alsbaldt ist die liebe angangen vnd angezündet würden, vnd derselbe leib, von
dem die Mümia genommen ist, hatt den andern leib in liebe solche maßen zu sich gezogen
vnd in liebe entzündet, das er nicht woll ohn den anderen hatt seÿnen konnen: sondern ihm
alzeitt nachgefolgt.
Vnd da man nün solche wirckung in dießem Mümia erfünden, hatt man den sachen weitter
nachgedacht: da ist solches auch vnter die baüren kommen, die haben aüch also wie
vorgemeldet ihrem viehe, geißen, hennen, taüben etc. vnd desgleigen thieren, das ihnen gern
hinliefe vnd hinfloge, gethan, das es nicht hinwegliefe oder hinfloge: sondern alzeitt
wiederkhere, vnd keÿnen anderen hern liebe gewinnen solte: Also etliche, ihren roßen, etliche
ihren hünden etliche ihren falcken, auch allen anderen voglen: Also auch die iager oftmals
ihrem gewilt haben gethan, vd solcher maßen zür lieb bezwüngen, das es ihnen selbst biß ins
garn nachgegangen ist: Also auch etliche, die mitt wilden thieren haben müßen vmbgehen,
haben deßgleigen denselbigen wilden thieren gethan mitt ihrer Mümia, vnd zür liebe
bezwungen, also das ihnen keÿn schaden konten oder mochten thün: sondern sie lieben
müsten vnd nach ihrem geheiß thün, vnd ihnen gehorsamb seyn in allen dingen.
Vnd das ist hir zuwißen vnd woll zümercken, das man also die zwen ergsten vnd großisten
feÿnde nemblich ein affen vnd ein schlangen mitteinander verßünen vnd in ewige liebe
gegeneinander verkheren magk. dan zügleiger weiß, wie ein mensch seÿnem eigenen leibe
nicht feÿndt ist; also da auch geschicht. dan, da begert ein leib des anderen, als der magnet des
eisens: vnd ist hiebeÿ anders nicht züversthen, dan zwischen einem Magneten vnd einem
eisen, die alzeitt einander lieben, einander anhangen, nachgehen vnd nachfolgen. Vnd gleig
wie der Magnet ohn das eisen nit woll beÿ kreften khan erhalten werden: sondern daßselbige
haben muß; vnd aber das eisen des magneten woll entrhaten magk, vnd woll ohn denselben
Nicolaus von Vicken (1571 - nach 1624)
38
seyn khan, auch nichts destoweiniger beÿ seÿn kreften bleiben: Also geschicht auch zwischen
zwen menschen, oder zwischen einem menschen vd zwischen einem viehe, in allen zuweg
gebrachten lieben wie vorgemeldet.
Dan ein iedes corpüs, dem ein lebendige Mümia wirdt beÿgebracht von einem [m]enschen,
daßelbe corpüs wirdt alsbaldt zu einem Magneten. Auß dießem ist aüch der große mißbraüch
vnd der elendt iammer beÿ den erzhüren und teüfelshuren; welche dießen process vnrecht
verstanden oder von dem teufel vnd dem seÿnem vnrecht berichtet würden, das sie haben ihr
Menstrüüm für die Mümia genommen, vermeÿnendt es seÿ auch ihr Mümia, vnd diene
insonderheitt dahero, nemblich ihre liebe damitt züerhalten, so es doch ein teüflische lügen
vnd betrüg ist, dan es ein laüter gift ist, dem es wirdt beÿgebracht, der wirdt nimmer gesündt
biß in seÿn todt, vnd nach dem seÿn complexion starck ist, lebe er desto lenger, mag aber
doch solches nicht vberwinden: sondern müß es mitt [v°] der haüt, vnd mit dem leben
bezhalen Mitt dießer rechten wharen Mumia ist es aber nicht also, die erregt keÿne
kranckheitt, viel weiniger den todt. Vnd also mag nün ein ieglicher durch seÿne eigne
Mümiam, seÿnen feÿndt, zü seÿnem besten freundt machen; also, das er hernach gleig nach
allem seÿnem willen thüt, vnd mitt nichten wieder ihn: sondern mitt ihm ist.