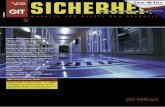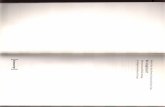Schwell, Alexandra: »Niemand darf sich sicher fühlen!« Anthropologische Perspektiven auf die...
Transcript of Schwell, Alexandra: »Niemand darf sich sicher fühlen!« Anthropologische Perspektiven auf die...
JENS ADAM, AsTA VoNDERAU (He.)
Formationen des Politischen Anthropologie µolltlscher Felder
( transcript]
Blbllograflsche Information der Deutschen Natlonalblbllothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2014 transcrlpt Verlag, Bielefeld
Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
Umschlagkonzept: Kordula Röckenhaus, Bielefeld Korrektorat: J ohanne Lefeldt Satz: Harry Adler Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar Print-ISBN 978-3-8376-2263-8 PDF-ISBN 978-3-8394-2263-2
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Besuchen Sie uns im Internet: http://www.transcript-verlag.de Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis und andere Broschüren an unter: [email protected]
Inhalt
Formationen des Politischen. Überlegungen zu einer Anthropologie politischer Felder Jens Adam und Asta Vonderau l 7
1. (TRANS· )FORMATIONEN STAATLICHER POLITIKEN
Das Ende der Hauptschule in Berlin. Zur ideologischen Dimension von Bildungsmythen Stefan Wellgraf 1 35
Vertagte Anerkennung. Teilwerdung des Islams und die Grenzen der Zugehörigkeit im politischen Dialog der Deutschen Islam Konferenz Fabian Engler 1 67
Klassifizieren für einen guten Zweck. Wie psychologische Traumaa.tteste begannen, Im ausländerrechtlichen Verwaltungshandeln relevant zu werden Anne-Kathrin Will 1 95
Staatliche Definition nationaler Zugehörigkeit und ausschließende Verwaltungspraxis in der Dominikanischen Republik Tobias Schwarz 1123
II. MOBILE KONZEPTE - IMPROVISIERTE ORDNUNGEN
Die Improvisation einer Politik. Katastrophenbewältigung, neoliberale Experimente und die Grenzen ökonomischen Wissens Ignacio Parias 1 153
The Pollcy of Mothering. Praktiken und Effekte der Politik einer internationalen Hilfsorganisation Sarah Speck 1 183
Energie-Kollektiv - Energie-Autarkie. Lokale Energieproduktions- und -konsumgemeinschaften vor dem Hintergrund politisch Induzierter Energieregulierung Franziska Sperling 1 215
III. RESKALIERUNGEN POLITISCHER FELDER
Das Regieren der Migration als wissensbasierte Netzwerkpolitik. Eine ethnografische Policy-Analyse des International Centre for Migration Pollcy Development Sabine Hess 1 241
»Niemand darf sich sicher fühlen!« Anthropologische Perspektiven auf die Politik der Inneren Sicherheit Alexandra Schwell l 275
Zettelwirtschaft. Consumer Citizenship, Europäisierung und Krisenpolitik in Griechenland Kerstin Poehls l 305
IV. METHODISCHE ZUGÄNGE -ETHNOGRAFISCHE POSITIONIERUNGEN
Das Bohren der Bretter -Zur trans-sequentiellen Analyse des Politikbetriebs Thomas Scheffer l 333
Troubling policies. Gender- und queertheoretische Interventionen in die Anthropology of Pollcy Beate Binder 1 363
Autorinnen und Autoren 1 387
Formationen des Politischen Überlegungen zu einer Anthropologie politischer Felder
JENS ADAM UND AsTA VoNDERAU
RELATIONEN DES UN·/SICHTBAREN
Ende der l99oer Jahre beschwerten sich israelische Siedler über den schlechten Mobilfunkempfang, wenn sie von Jerusalem in Richtung Norden fuhren. Sie forderten die Errichtung einer neuen Antenne und schlugen hierfür eine Anhöhe vor, auf der bereits einige Jahre zuvor erfolglos die Anlage einer neuen Siedlung versucht worden war. Zwar befand sich dieser Hügel im Besitz palästinensischer Bauern, doch verfügte die israelische Armee über das Recht, Mobilfunkantennen auf privatem Grund zu errichten, indem sie diese zu einer »Sicherheitsangelegenheit« erldärte. Dies geschah und in der Folge schlossen die israelischen Elektrizitäts- und Wasserwerke die Anhöhe an ihre Netzwerke an, um den Bau einer Antenne zu ermöglichen. Der Mobilfunkanbieter zögerte, die Antenne aufzustellen und so errichteten die ,Siedler zunächst eine Attrappe, um den Prozess dennoch voranzutreiben. Zur Absicherung der »Baustelle« wurde dort ein Wohnwagen platziert, in dem sich der Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsunternehmens niederließ. Dieser holte bald darauf Frau und Kinder nach und verband seinen Wohnwagen mit den inzwischen vorhandenen Wasser- und Elektrizitätsleitungen. Fünf weitere Familien folgten und »da nun dort schon Familien wohnten, sorgte das israelische Ministerium für das Bau- und Wohnungswesen für einen Kindergarten und ein paar Spenden aus Übersee für eine Synagoge«. Im Jahre 2006 umfasste Migron als damals größter Siedlungsvorposten in der Westbank »etwa 60
Wohnwagen und Container, in denen über 42 Familien wohnten« (Weizman 2008: 8).
»Niemand darf sich sicher fühlen!« Anthropologische Perspektiven auf die Politik
der Inneren Sicherheit
ALEXANDRA ScHWELL
1. EINLEITUNG
Der Titel dieses Textes stammt aus einem Interview, das ich im Juni 2oro
mit einem leitenden Beamten der österreichischen Polizei in Wien führte. Das Gespräch drehte sich um die sogenannten Ausgleichsmaßnahmen der Wiener Polizei, die im Dezember 2007 eingesetzt wurden, um das durch die Erweiterung der Schengenzone und den Wegfall der Grenzkontrollen zu den osteuropäischen Nachbarn vermeintlich entstandene Sicherheitsdefizit wettzumachen. Diese Maßnahmen, so der Beamte, bestehen in erster Linie in »verdachtsabhängigen« Kontrollen von »Fremden«. Herr -Raphael, so soll er hier genannt werden, bezog sich zudem auf wiederkehrend erhobene Vorwürfe, die Wiener Polizei betreibe Kontrollen nach dem Muster des Ethnic Projiling'-, demzufolge allein Merkmale wie Hautfarbe oder Herkunft ein Verdachtsmoment begründen (siehe Republik Österreich 2009). Diesen Vorwurf wies er weit von sich, und er bestand darauf, die Polizei dürfe auf keinen Fall einen derartigen Eindruck erwecken, das sage er seinen Leuten auch immer wieder. Sein Gegenmittel: Nicht nur die mutmaßlichen Ausländer, die Schwarzen und die Dunkelhäutigen, son-
1 1 Es existiert keine verbindliche Definition für Ethnic Profiling, allgemein be
schreibt der Begriff jedoch: »the police practice of stopping someone for ques
tioning or searching on the basis of their ethnic or •racial• appearance and not
because of their behaviour or because they match an individual suspect descrip
tion« (Goodey 2006: 207).
r
1 ::
ALEXANDRA SCHWELL
dern immer auch ein paar weiße Österreicher kontrollieren. Sich ja nicht angreifbar machen. Sein Credo: »Kontrolliert so, dass sich jeder betroffen fühlt! Niemand darf sich sicher fühlen!«
Aber sollte es nicht eigentlich darum gehen, dass sich alle sicher fühlen sollten? Wessen Sicherheit wird hier verhandelt und gegeneinander aufgewogen? Herr Raphael fasst mit dem oben zitierten Satz das Wesen der, Praktiken, Diskurse und Politiken der inneren Sicherheit nicht allein in Österreich zusammen. Er umschreibt ein Universum aus Gut und Böse, aus unterschiedlichen Wahrheiten und gegenseitigen Ängsten. Nur wenn diejenigen, die die Referenzpunkte sicherheitspolitischer Maßnahmen sind, sich nicht mehr sicher fühlen können, dann erst kann sich die »Bevölkerung« beruhigt zurücklehnen. Inwieweit dies gelingt, steht und fällt mit dem Vertrauen in die Effizienz und das Vermögen von Polizei und Sicherheitspolitik.
Diesen Vorgang der Securitization, den Prozess, der aus gesellschaftlich diskutierten Themen Sicherheitsthemen werden lässt, werde ich im folgenden Beitrag aus einer anthropologischen Perspektive nachzeichnen und analysieren. Obwohl Sicherheit in vielen ethnologischen und kulturanthropologischen Arbeiten unterschwellig eine wichtige Rolle spielt, taucht sie selten als eigenständige Forschungskategorie auf. Entsprechend hat sich bislang kein eigener disziplinärer theoretischer Ansatz zur Beschäftigung mit der Thematik herausgebildet. Diese Lücke möchte der vorliegende Text ein Stück weit schließen.
Sicherheit, sofern sie über das grundlegende menschliche Bedürfnis nach Geborgenheit und Schutz hinausgeht, hat häufig eine staatliche, und damit auch eine hochgradig politische Dimension. Politiken wirken auf vielfältige Weise auf Menschen ein, indem sie sie kategorisieren, normieren, erziehen, besteuern, kriminalisieren, gesund machen (oder auch nicht) und damit ausschließen oder einschließen. Politiken haben einen kaum zu überschätzenden Einfluss auf die Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten von Akteuren. Gleichzeitig besteht die Ironie darin, dass Politiken wohl genau deshalb so erfolgreich sind, weil sie häufig als apolitisch erscheinen. Die Welt ist nun einmal so. Diese scheinbare Neutralität und Rationalität gilt es zu hinterfragen: »Thus, a key task for the anthropology of policy is to expose the political effects of allegedly neutral statements about reality.« (Wedel et al. 2005: 37) Der Text folgt damit dem Forschungsprogramm einer Anthropology of Policy, wie es vor allem in den Beiträgen der von Shore und Wright (1997a) und Shore, Wright und Pero (2on) he-
»NIEMAND DARF SICH SICHER FÜHLEN I «
rausgegebenen Sammelbände formuliert wurde, und das methodologisch wie theoretisch neue Wege eröffnet, Politik(en) anthropologisch in den Blick zu nehmen: »From our perspective, policies are not simply external, generalised or constraining f9rces, nor are they confined to texts. Rather, they are productive, performative and continually contested. A policy finds expression through sequences of events; it creates new social and semaritic spaces, new sets of relations, new political subjects and new webs of meaning.« (Shore/Wright 2on: 1)
Der folgende Abschnitt führt in unterschiedliche Ansätze zur Bearbeitung von Sicherheit und Unsicherheit ein. Im nächsten Schritt werden theoretische Grundzüge zu einer Anthropologie der Sicherheit vorgeschlagen und anhand eines empirischen Beispiels erläutert: Eine ethnologischkulturanthropologische Perspektive ermöglicht den Einbezug alltäglicher Praktiken und alltagskultureller Phänomene, die von der Makroebene gerahmt werden und wiederum auf sie zurückwirken. Gesellschaftsübergreifende Prozesse, wie die Europäisierung von Politiken der inneren Sicherheit, finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern haben konkrete und lokal situierte Effekte auf der Ebene des sozialen Handelns, die wiederum auf die überlokale Ebene zurückwirken. Gemeinsam konstituieren sie das Forschungsfeld der europäischen inneren Sicherheit. Diese politische und soziale Konstruktion von Sicherheit wird anhand des Fallbeispiels der eingangs erwähnten Ausgleichsmaßnahmen der Wiener Polizei exemplifiziert. Sie verdeutlichen, wie die Öffnung der Schengengrenze dafür genutzt wurde, eine von der Polizei gewÜnschte Ausweitung von Kompetenzen mit Verweis auf funktionale Notwendigkeiten und ein angeblich mit der Schengenerweiterung entstandenes Sicherheitsdefizit zu begründen. Abschließend fragt der letzte ';f'eil nach den weiterreichenden gesellschaftlichen Effekten dieser Securitization-Prozesse.
2. EINE ANTHROPOLOGIE DER SICHERHEIT
Spätestens seit 9/n scheint das Thema Sicherheit allgegenwärtig, der Imperativ der Sicherheit dominiert anscheinend die Art und Weise, wie wir über uns und andere, die soziale Welt, nachdenken (vgl. Goldstein 2010b: 487). Zunächst jedoch ist Sicherheit an sich nichts Schlechtes. In einer sehr allgemein gehaltenen Definition wird Sicherheit als gleichbedeutend mit der Abwesenheit von Bedrohung verstanden (Booth 1991: 319). Sie ist
277
ALEXANDRA SCHWELL
idealiter identisch mit Geborgenheit; sie bietet die Möglichkeit zur Entfaltung und zur Entwicklung. Diese Form der Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Manche Autoren sprechen so auch von einer »anthropologischen Konstante« (so Bonß 1995: 90, zit. n. Eisch-Angus 2009: _71).
Sicherheit impliziert aber auch einen bcestimmten Zustand einer gesellschaftlichen Ordnung. Laut Foucault (2006: 20) ist Sicherheit ein als optimal angesehener Mittelwert für soziales Funktionieren, der auch die »Grenzen des Akzeptablen« definiert. Sicherheit als Idealzustand stellt zudem ein kollektives öffentliches Gut dar, ein »thick public good« (Walker 2002). Sie ist jedoch nicht nur der Idealzustand, sondern ebenso die Bedingung und gleichzeitig das Mittel für die Herbeiführung und Bewahrung dieser Ordnung. Entsprechend identifiziert Glaeßner (2002: 4) grundsätzlich vier Bedeutungsebenen von Sicherheit: (1) Gewissheit, Verlässlichkeit, Abwesenheit von Gefahr, (2) Statussicherheit und das Bewahren gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse, (3) das institutionelle Arrangement zur Abwehr äußerer und innerer Bedrohungen sowie (4) die Unversehrtheit von Rechtsgütern, bis hin zu einem Grundrecht auf Sicherheit.
Je nachdem, ob Sicherheit als Grundbedürfnis und erstrebenswert im Fokus steht, oder ob die Instrumentalisierung ihres unweigerlichen Gegenspielers, der Unsicherheit, in den Blick genommen wird, ändern sich die relevanten Bezugspunkte (wer oder was soll wovor geschützt werden?) und Kontextfaktoren (in welche anderen Diskurse und Erzählungen ist (Un-)Sicherheit eingebettet?), unter denen dieses hoch emotionale Thema betrachtet wird. All dies bestimmt in nicht unwesentlichem Maße, inwieweit der Begriff der Sicherheit selbst in einer spezifischen sozialen Gruppe prinzipiell positiv oder negativ konnotiert ist. Was für wen zu welcher Zeit Sicherheit bedeutet, unterliegt gesellschaftlichen Deutungs- und Institutionalisierungsprozessen. Sicherheit ist damit keine objektivierbare Größe, sondern ein soziales Konstrukt, das auf Gewissheiten, Emotionen, Vertrauen und Vertrautheiten basiert. Sicherheit lässt nicht gleichgültig; es ist ein in jeder Hinsicht »essentially contested concept« (Gallie 1956).
In der ethnologisch/kulturanthropologischen Literatur ist das Thema Sicherheit bislang wenig bearbeitet worden, jedoch ist durchaus ein Interessenzuwachs zu verzeichnen: Weldes und Kollegen unternehmen den Versuch, eine interdisziplinäre Brücke zwischen Anthropologie und den vor allem US-amerikanischen Security Studies der Internationalen Beziehungen zu schlagen (Weldes et al. 1999), Maguire (2009) betrachtet den
»NIEMAND DARF SICH SICHER FÜHLEN!«
Einsatz von Biometrie, die Beiträge in Bajc (2on) fragen danach, wie privates und öffentliches Leben vom »Meta-Frame« der Sicherheit und Überwachung geprägt werden, und Cultural Anthropology widmete dem Thema Sicherheit im Jahr 2009 eine eigene virtuelle Ausgabe.2 Im deutschsprachigen Raum beschäftigt sich Eisch-Angus (2on) mit dem Komplex »safety/security« in Alltagsdiskursen und Praktiken der Gouvernementalität sowie mit der Praxis der ethnografischen Methode bei der Erforschung von Sicherheit (Eisch-Angus 2009). Zudem zeigen zahlreiche Autoren, dass Sicherheit in verschiedenen Kontexten durchaus unterschiedliche Funktionen und Bedeutungen zugeschrieben werden können, wie Kent (2006) am Beispiel Kambodschas oder Goldstein (201ob) für Bolivien beschreiben. Bubandt benutzt dabei den Begriff der »vemacular security«, um auf die lokale Verankerung und Kontextabhängigkeit von Sicherheitsvorstellungen hinzuweisen: >»Vemacular security< is a convenient term for the analysis of different scales of creating imagined communities through a comparison of different but constantly interpenetrating political forms of management of threat and (un)certainty.« (Bubandt 2005: 277)
Aus einer anderen Perspektive heraus haben sich vor allem Eriksen und Kollegen (Eriksen et al. 2oro) damit beschäftigt, wie der Begriff der Human Security, der Mitte der l99oer Jahre im Dunstl<reis des United Nations Development Programme (UNDP) aufgetreten ist, für das Fach nutzbar gemacht werden kann.J Tehranian (2004) beschäftigt sich insbesondere im Zusammenhang mit Migration zudem mit der Cultural Security als einer spezifischen Dimension von Human Securify. Einen wiederum stark militärisch informierten sowie auf den Staat fokussierten Begriff von Sicherheit bearbeitet Gusterson (2004, 2007) in seinen Untersuchungen zu Krieg, Militarismus und Atommacht und führt, in Anlehnung an Appadurai (1997), den Begriff der Securityscapes ein, wobei er sich gleichzeitig
2 1 Http://culanth.org/?q=node/258, eingesehen am 01.02.2013.
3 J Nicht zuletzt existiert, im Unterschied zum Anspruch der Formulierung ei
ner »Anthropology of Security«, die sogenannte Security Anthropo/ogy. Hierbei
handelt es sich um eine vornehmlich US-amerikanische Diskussion, die sich um
die Frage dreht, ob es für Anthropologen ethisch vertretbar sei, für Regierungs
institutionen und Militär Informationen über die Bevölkerung in Einsatzgebieten
bereitzustellen. Gusterson (2007: 164) verwendet für diese besondere Form der
»angewandten« Anthropologie den Begriff weaponizing culture - der Versuch,
Kultur »waffenfähig« zu machen.
279
280 ALEXANDRA SCHWELL
explizit gegen die Tendenz vieler anthropologischer Ahsätze zur Globalisierung wendet, die staatliche Dimension auße.n vor zu lassen (Gust~rson 2004). Für ihn umfasst ein Securityscape »asymmetrical distributions of weaponry, military force, and military-scientific resources among nationstates and the local and global imaginaries of identity, power, and vulnerability that accompany these distributions« (Gusterson 2004: 166). Obwohl der Begriff in der Folge weitreichend aufgegriffen wurde, monieren Kritiker den wiederum zu engen Fokus auf die Rolle des Nationalstaates und fordern den Einbezug heterogener, hybrider und verknüpfter Akteure, die staatlich oder nicht-staatlich, privat oder öffentlich sein können (Albro et al. 2012: n). Entsprechend schließt sich dieser Text der Kritik an und versteht Securityscapes als liminale Räume, »where the practices of everyday life are unstable and insecure and where bodies are subjected to routine surveillance and violence« (Wall/Monahan 2on: 240). Im Zuge einer zunehmenden Vermischung von innerer und äußerer Sicherheit, Polizei und Militär, erscheint es zudem sinnvoll, Securityscapes nicht allein auf den militärischen Bereich zu beschränken, sondern auch andere Formen der Ver-Unsicherung einzubeziehen.
2.1 Das Konzept der Securitization
Auf der Suche nach Anknüpfungspunkten und theoretischen Inspirationen wirft der vorliegende Beitrag den Blick über den disziplinären Tellerrand. Im Bereich der europäischen Internationalen Beziehungen sind in den letzten Jahren zahlreiche Arbeiten im Umfeld der sogenannten Neuen Sicherheitstheorien entstanden, die sich aufgrund ihrer theoretischen Ausrichtung als durchaus anschluss- und ausbaufähig für das Vorhaben einer Anthropologie der Sicherheit erweisen (siehe auch Goldstein 201oa, b).
Neue theoretische Ansätze zur Sicherheit entstanden in der politikwissenschaftlichen Disziplin der Internationalen Beziehungen in expliziter Abgrenzung zu den Security oder Strategie Studies des Kalten Krieges. Hier herrschte ein enger Begriff von Sicherheit vor, der allein militärisch definiert war und Angriff und Verteidigung im bewaffneten Konflikt mit einem anderen Staat umfasste. Bereits in den 198oer Jahren mit dem Erstarken der Friedens- und Umweltbewegungen, spätestens jedoch mit dem Ende des Kalten Krieges, wurden Stimmen laut, die sich für eine Erweiterung des bis dato eng definierten Sicherheitsbegriffes sowie einen, zumindest
»NIEMAND DARF SICH SICHER FÜHLEN!«
partiellen, Abschied von der Zentrierung auf den Staat als alleinigem Sicherheitsakteur starkmachen.
Die Neuen Sicherheitstheorien entwickelten ein sozialkonstruktivistisches Konzept von Sicherheit, das zwischen d.en beiden Polen von allein militärisch definierter Sicherheit und einem weiten Begriff von Sicherheit als allem, worüber Menschen sich Sorgen machen können, angesiedelt ist. Sicherheit wurde auf den zivilen, gesellschaftlichen Bereich erweitert. Sie ist damit keine objektive Tatsache, sondern bewusst gewählte Praxis. Indem etwas zum Sicherheitsthema erklärt wird, legitimiert sich ein Akteur selbst dazu, ungewöhnliche und extreme Mittel zur Bekämpfung dieser Bedrohung durchzusetzen, um ein höheres Ziel zu erreichen. Das höchste Ziel ist das überleben (von Staatsbürgern, eines Staates, einer Nation, einer Firma, des Waldes).
Für die Vorreiter dieser Neuen Sicherheitstheorien, die sogenannte Copenhagen School (CS), liegt der Fokus auf dem Sprech-Akt selbst, der ein Thema zu einem Sicherheits-Thema werden lässt (Buzan et al. 1998). Mit diesem Sprech-Akt hebt der Sprecher das Thema aus dem normalen politischen Handlungsablauf heraus, die normalen politischen Regeln gelten nicht mehr: »The necessity of an existential quality (>survival<) follows from the function of security discourse as li:fting [Herv. i.O.] issues to urgency and necessity above normal politics.« (W~ver 1996: 107) Entsprechend schlagkräftig, schnell und außerordentlich wie diese Bedrohun
gen müssen auch die Gegenmaßnahmen sein. Inwieweit diese Maßnahmen tatsächlich geeignet sind, die außerordentliche Bedrohung in ihre Schranken zu weisen, ist zunächst zweitrangig. Wenn das angesprochene »Publikum«4 (die Öffentlichkeit, die Wahler) diesen Securitizing Move akzeptiert und unterstützt und die außergewöhnlichen Mittel mitträgt, dann ist die Securitization erfolgreich. Der Akteur, der die Bedrohung nicht nur ausgerufen hat, sondern auch gleichzeitig Lösungen liefert, erwirbt symbolisches Kapital, Ressourcen, Legitimität.
4 1 Das »Publikum« ist einer der zentralen Begriffe der Neuen Sicherheitstheo
rien; die Rolle und Handlungsmacht des Publikums für eine Securitization ist
unter den Autoren stark umstritten. Eine anthropologische akteurszentrierte Per
spektive kann sich den Implikationen des Publikumsbegriffs allerdings kaum
anschließen; aus diesem Grund wird, wie in Abschnitt 3.2 deutlich wird, auch
das Publikum als mit Handlungsmacht ausgestatteter Akteur betrachtet.
ALEXANDRA SCHWELL
Der Idealfall für die Autoren der CS ist allerdings der umgekehrte Prozess, die Desecuritization, wenn Themen aus dem Level des Ausnahmezustands herausgenommen und wieder in den normalen politischen Handlungsablauf integriert werden: »Security should be seen as negative, as a
failure to deal with issues as normal politics.« (Buzan/Wcever/Wilde 1998: 29) »Sicherheit« und »Politik« werden, hier als entgegengesetzte Konzepte begriffen, wobei sich erstere als dominante und strategisch intendierte In
terpretation der sozialen Welt durchzusetzen sucht. Die positive Betonung der Desecuritization findet nicht überall gleichermaßen Zustimmung. So sind Vertreter der Human Security wie auch der Critical Security Studies der Ansicht, die beabsichtigte Securitization beispielsweise von Krankheiten wie HIV oder auch Minderheitenrechten könne durchaus eine moralisch
vertretbare Ermächtigungsstrategie darstellen, um die Dringlichkeit einer
Thematik zu verdeutlichen (vgl. Floyd 2007). Das Modell der Copenhagen School und die Erweiterung des klassischen
Sicherheitsbegriffs sind von zahlreichen Autoren kritisiert, jedoch auch aufgegriffen und kritisch wie konstruktiv adaptiert und modifiziert worden. Ein praxeologisch informierter Begriff von Securitization verschiebt den Fokus von der Betonung des Ausnahmezustands hin zu den »diffu
se politics of little security nothings« (Huysmans 2orr: 372). Damit bezeichnet Huysmans Praktiken, Tätigkeiten oder auch Geräte, denen für sich genommen keine außerordentliche Bedeutung für die Wahrnehmung
und Herstellung von Sicherheit innewohnt, die jedoch im Kontext des Securityscapes ihre besondere Bedeutung erlangen, wie Programmierungsalgorithmen, routinehaftes Datensammeln oder der teilnahmslose Blick auf Überwachungskameras: »Yet, these little security nothings are highly significant, since it is they rather than exceptional speech acts that create
the securitizing process.« (Huysmans 2orr: 377) Vor diesem Hintergrund soll sich Balzacq angeschlossen werden, der Securitization aus einer soziologischen Sichtweise wie folgt definiert:
»an artlculated assemblage of practices whereby heuristic artefacts (meta
phors, policy tools, Image repertolres, analogies, stereotypes, emotions, etc.)
are contextually mobilized by a securltizing actor, who works tD prompt an
audience to bulld a coherent netwDrk of impllcations (feelings, sensations,
thoughts and institutions), about the critical vulnerabllity of a referent object,
that concurs wlth the securltizing actor's reasons for choices and actlons, by
investing the referent subject with such an aura of unprecedented threatening
»NIEMAND DARF SICH SICHER FÜHLEN 1 «
complexion that a custDmized policy must be undertaken immediately to block its development.« (Balzacq 2011: 3)
Der besondere Beitrag der Kultur- und Sozialanthropologie/Europäischen Ethnologie zum Feld der Sicherheit liegt in diesem Sinne in einem theo
retischen wie praktischen Mehrwert: Der Anspruch der Disziplin, lokale Ereignisse eingebettetin ihren weiteren (nationalen und transnationalen) Kontext und die wechselseitigen Effekte zu analysieren, lässt sie als be
sonders geeignet erscheinen, Fragen der Sicherheit, die sich nicht allein räumlich begrenzt, sondern tendenziell übergreifend stellen, im Wechsel
spiel mit der lokalen Ebene kritisch zu beleuchten. Sie trägt der Tatsache Rechnung, dass Sicherheit unterschiedlich erfahren und kulturell imaginiert wird. Der skizzierte praxeologische Ansatz und das methodologische
Rüstzeug der Ethnografie sind besonders geeignet, die Dynamiken der Securitization aus einer akteurszentrierten Perspektive zu analysieren.
3. DIE AUSGLEICHSMASSNAHMEN DER WIENER POLIZEI
Die Ausgleichsmaßnahmen (AGM) der Wiener Polizei sind ein hervorragen
des Beispiel für mehrere Prozesse, die unter dem Stichwort der Securitization gefasst werden können. Was eine Anthropologie der Sicherheit leisten kann, illustriert die folgende Analyse der AGM als eine von vielen Anwendungsmöglichkeiten und Perspektiven. Eine außerordentliche Bedrohung wird von politischen und polizeilichen Akteuren zum Anlass genommen, unter Bezug auf eine imaginierte Zielgruppe Maßnahmen durchzusetzen, die auf den zweiten Blick in keinem direkten Zusammenhang stehen, sondern diesen lediglich vorspiegeln. Die Ausgleichsmaßnahmen sind Teil eines Securityscapes in einem weiten Sinn, als lokaler Ausdruck einer iransnationalen und deterritorialisierten »Landschaft« der Sicherheitsexperten, Bedrohungsszenarien, Kontrolltechnologien und Imaginationen. Wie ich anhand des folgenden Fallbeispiels zeigen werde, sind vier Faktoren für eine anthropologisch informierte Herangehensweise von besonderem Be
lang: (r) Die Bedeutung des Kontexts, (2) die Werkzeuge der Securitization, (3) die Strategien und Praktiken der unterschiedlichen Akteure sowie (4) der temporale Aspekt des Securitization-Prozesses.
ALEXANDRA SCHWELL
3.1 Ausgleichsmaßnahmen im Kontext
Herr Raphael ist ein hochrangiger Beamter der Bundespolizeidirektion Wien und selbst eng mit den AGM aufleitender Ebene befasst. Er fand sich zu einem ausführlichen, mehrstündigen Gespräch bereit, und er versorgte mich zudem reichlich mit Zeitungsausschnitten, Power-PointPräsentationen und anderen Materialien. Herr Raphael hat seine Karriere außerhalb der Polizei begonnen; entsprechend nimmt er für sich einen kritischen Blick auf die Behörde in Anspruch und möchte nicht alles unhinterfragt geschehen lassen. Herr Raphael gehört damit zu denjenigen Mitarbeitern von Organisationen und Behörden, ohne die ein studying up nur schwer möglich wäre.5
Polizeiliche oder grenzpolizeiliche AGM beziehen sich zumeist auf die sogenannten Schengener Ausgleichsmaßnahmen. Diese AGM sind ein Sammelbegriff für diejenigen Maßnahmen, deren Einführung oder Intensivierung den Wegfall der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der Mitgliedsstaaten der Schengenzone kompensieren sollen. Mit der vollständigen Implementierung der Schengener Abkommen entfallen Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedsstaaten; die Binnengrenze darf an jeder Stelle überschritten werden. Der Logik von Polizei und Politik folgend, ist dieser Wegfall der Grenzkontrollen gleichbedeutend mit einem Verlust an Sicherheit: Die Filterfunktion der nationalen Grenze muss an anderer Stelle ausgeglichen werden, daher der Begriff Ausgleichsmaßnahmen.6 Zu den
5 \ Studying up bezieht sich auf die Forderung, ethnologische Forschungen
nicht allein auf marginalisierte Gruppen zu richten, also »nach unten« zu for
schen, sondern auch gesellschaftlich machtvolle Akteure, Institutionen und Or
ganisationen in den Fokus zu nehmen (vgl. Nadet 1972). Wie Warneken/Wlttel
(1997) ausführen, sind damit jedoch stets auch spezifische methodologische
Schwierigkeiten und Fallstricke verbunden, welche die »ethnographische Auto
rität« infrage stellen können, wenn die zu Beforschenden einen ähnlichen oder
höheren sozialen Status besitzen.
6 \ Den Befürchtungen hinsichtlich eines entstehenden Sicherheitsdefizits wur
de bereits im Schengener Durchführungsübereinkommen in Titel III (Polizei und
Sicherheit) sowie mit der Einrichtung des SIS Rechnung getragen. Nichtsdesto
trotz spielen vermeintlich drohende Sicherheitseinbußen rund um die Schenge
ner Abkommen immer wieder eine wichtige Rolle, die auch von pDpullstischen
Politikern genutzt werden, wie das Beispiel der hochgradig kontroversen Wieder-
»NIEMAND DARF SICH SICHER FÜHLEN!«
damit verbundenen Werkzeugen zählen so unterschiedliche Maßnahmen wie die Verstärkung der Personenkontrollen an den Außengrenzen, die Harmonisierung der Visapolitik, grenzüberschreitende Zusammenarbeit der. Polizeien, verstärkte justizielle Zusammenarbeit sowie das Schengener Informationssystem (SIS). »Wenn die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit es indessen erfordern«, darf eine, jedoch lediglich temporäre, Rückkehr zu Grenzkontrollen erfolgen, wie in Art. 2 des Schengener Durchführungsübereinkommens (SDÜ) festgelegt. Das SDÜ und der Schengener Grenzkodex »untersagen zwar Grenzübertrittskontrollen an den Binnengrenzen, überlassen aber die Durchführung von Personenkontrollen im Inland der jeweiligen nationalen Gesetzgebung.« (Maurer /Kant 2008: 53)
So auch in Österreich. Diesem sehr weiten Begriff von Ausgleichsmaßnahmen steht ein konkreter, schon fast schlagwortartiger Begriff gegenüber, der als Referenzpunkt für eine spezifische Kontrollform gebraucht wird: AG M im österreichischen öffentlichen und medialen Diskurs beziehen sich fast ausschließlich auf die Kompensation der mit Dezember 2007
abgebauten Grenzkontrollen zu den osteuropäischen Mitgliedsstaaten der EU.7 Dabei ist höchst relevant, dass »jeder Grenzkontrollaspekt [„.] zu vermeiden« ist (Bundesministerium für Inneres o.J .: r). Weiter heißt es:
»Die Grenzkontrolle an den nunmehrigen Binnengrenzen wird ersetzt durch ein
mehrschichtiges Fahndungssystem, das aus dem nun unkontrolliert fließenden
grenzüberschreitenden Verkehr die vor allem kriminal-, verkehrs- und migrati
onsrelevanten Verdachtsmomente diagnostiziert, ausfiltert und einer polizei
lichen lntensivkontrolle unterzieht. Dies geschieht in einem geographischen
Raum von nicht von vorn herein zu definierender Dimension und setzt sich an
den Hauptverkehrsrouten bis in die Ballungszentren fort.« (Ebd.)
Das Beispiel der AGM, deren Funktion und Bedeutung sich allein aus ihrer Einbettung in ein europäisches Sicherheitssystem erschließt, verdeutlicht, dass Sicherheit nicht als isolierter Sprech-Akt betrachtet werden kann. Sicherheit findet nicht nur dort statt, wo jemand (sinngemäß) »Si-
einführung der Grenzkontrollen auf Druck der Dänischen Volkspartei von Mai bis Oktober 2011 zeigt.
7 \ Dabei wurde bereits 1997 nach Österreichs Schengenbeitritt eine sogenannte Fachinspektion AGM in Tirol eingerichtet.
ALEXANDRA SCHWELL
cherheit« ausspricht. Eine erfolgreiche Securitization kann vielmehr ausschließlich innerhalb eines unterstützenden Umfeldes erfolgen, das in der Lage ist, Kontext und Referenzen zu verknüpfen und zu dekodieren (vgl. Stritzel 2007: 367). Securitization erscheint damit als Produkt eines historischen Prozesses, der jedoch selbst nie abgeschlossen ist, und zugleich als Symbol, das nur für diejenigen bedeutsam ist, di.e in der Lage sind, es zu lesen. Entsprechend erschließen sich die scheinbar längst vergangenen Gefahren durch BSE, das Ozonloch oder den Atomkrieg nicht aus der quantitativ messbaren Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens, sondern aus ihrer Bedeutung und Rezeption innerhalb eines historischen Kontextes. Darüber hinaus können Prozesse der Securitization sowie relevante Akteure in Abhängigkeit vom jeweiligen spezifischen (soziologischen, bürokratischen, politischen, wissenschaftlichen„.) Kontext oder Setting differieren (Salter 2008). Was die eine soziale Gruppe als dramatisches Problem begreift, kann eine andere Gruppe wiederum in einem gänzlich anderen Rahmen betrachten. Das Beispiel der (unerlaubten) Migration führt dies einleuchtend vor: Für die Einen ist Migration ein selbstverständlicher Teilbereich der inneren Sicherheit, für Andere spielen dagegen allein soziale, arbeitsmarkt- oder familienpolitische Fragen eine Rolle.
Für eine anthropologische Analyse bedeutet dies zugleich, dass die Forschung sich nicht allein auf die Perspektive eines eng umzäunten Feldes beschränken darf, sondern dass der ethnologische Feldbegriff einer Rekonzeptualisierung bedarf. Politiken umspannen weite Räume, verknüpfen verschiedene Akteure, Diskurse und Institutionen und treffen auf unterschiedliche lokale Bedingungen und Übersetzungsprozesse; gleichzeitig stehen politische und damit zusammenhängende Praktiken in Verbindung mit weiter gefassten kontextuellen sozialen, politischen und ökonomischen Prozessen. Dieser Komplexität wird der Ansatz einer teilnehmenden Beobachtung mit dem Fokus auf der Eigenlogik eines räumlich definierten Feldes kaum gerecht; stattdessen schlagen die Protagonisten einer Anthropology of Policy eine alternative Methodologie vor, welche die Verknüpfungen zwischen unterschiedlichen Orten, Diskursen und sozialen Gruppen, die im Rahmen einer Policy entstehen, nachzeichnet: >»Studying through< entails multi-site ethnographies which trace policy connections between different organizational and everyday worlds, even where actors in different sites do not know each other or share a moral universe.« (Shore/Wright r997b: r4) Für die Wahl eines Feldes be
deutet dies:
»NIEMAND DARF SICH SICHER FÜHLEN!«
»lf the field is the full range of people, activities and institutions potentially re
levant for the study of the chosen issue, one of the arts of fieldwork is to choo
se sites within this field and design methods for their ethnographic study so
that they shed light on the operations of political processes and their change ov.er time.« (Wright 2011: 28)
Entsprechend der Prämisse, dass in einer Anthropology of Policy »field« und »site« keineswegs gleichzusetzen sind (Shore/Wright 2orr: r2), stellen die AGM der Wiener Polizei einen Ort (»site«) innerhalb des weiten Feldes der europäischen Politik der inneren Sicherheit dar. AGM sind also ohne ihren kontextuellen und zugleich historischen Verweis auf die ehemalige Sehengen-Außengrenze und die Einbettung in eine europäische Sicherheitsarchitektur nicht zu denken. Sie stehen jedoch gleichzeitig in einem Spannungsverhältnis, da sie ihren Referenzpunkt, die Grenzkontrolle, verleugnen müssen, um der Abschaffung der Binnengrenzkontrollen auch praktisch Genüge zu tun. Die Zielgruppe der AGM, das impliziert dieser Verweis ebenfalls, befindet sich idealiter auf der anderen Seite der Grenze. Der Fokus auf »migrationsrelevante Verdachtsmomente« (s.o.) bedingt es, dass die - im Polizeijargon - »Klientel« der AGM-Beamten in erster Linie aus Nicht-Österreichern besteht; ihre Zusammensetzung entspricht Vorstellungen vom bedrohlichen Anderen, die gleichfalls keine rein österreichische Erfindung sind, sondern beispielsweise in der Liste der für die EU visapfüchtigen Drittstaaten festgeschrieben sind. Gleichzeitig finden sich hier verdichtete Fremdbilder vom bedrohlichen »Osten« (vgl. Wolff r994) und »Balkan« (vgl. Todorova r999), die sich nicht zuletzt aus der spezifisch österreichischen Situation speisen, sich als ehemalige Kolonialmacht im Habsburg er Reich nun von den ehemaligen Kronländern umzingelt zu fühlen (siehe dazu Schwell 2or2).
3.2 AGM als Werkzeuge der Securitlzatlon
Imaginationen und Diskurse zu Sicherheit funktionieren in erster Linie, weil sie in spezifische politische Werkzeuge und Instrumente übersetzt werden, in »policy tools of securitization« (Balzacq 2008). Dies können Gesetze, Regeln, Verordnungen, Datenbanken, aber auch andere Maßnahmen sein, die menschliches Handeln kodifizieren, regeln und auf diese Weise mit Bedeutung versehen. Diese Werkzeuge sind Teil eines spezifischen Dispositivs, und sie spielen eine äußerst relevante Rolle, indem sie
ALEXANDRA SCHWELL
Sicherheitspraktiken verkörpern und objektivieren. Gleichzeitig strukturieren sie Interaktionen und determinieren Situationen, sie transportieren Hintergrundwissen. zu Bedrohungsszenarien und halten Problemlösungen bereit: »Security tools or instruments are the social devices through which pröfessionals of in-security think about a threat. They contribute to the taken-for-grantedness of security practices.« (Balzacq 2on: r6)
Die AGM können als Werkzeuge der Securitization gefasst werden, als es sich hier nicht allein um politisch legitimierte bürokratieförmige Institutionen handelt, die im Politikbereich der inneren Sicherheit angesiedelt sind, sondern die Maßnahmen, Praktiken und Institutionen selbst verkörpern den Wahrheitsanspruch (vgl. Foucault r980: r31) und schreiben ihn fort, indem sie die Aura legitimen staatlichen Handelns weitertragen. Konkret bedeutet dies, dass in Wien drei Fachinspektionen (AGM-PI) existieren, die exakt zum 2r. Dezember 2007, dem Tag der Erweiterung der Schengenzone und des Abbaus der Grenzkontrollen zu den osteuropäischen Nachbarstaaten, ihren Dienst aufnahmen und das Stadtgebiet in Überwachungsbereiche einteilen. Hinzu kommt das Operative Zentrum AGM in Wiener Neustadt. Wie Innenministerin Mikl-Leitner verlauten ließ, >>setze man [hier] >die Besten der Besten< ein, die dann von hier aus >an die Brennpunkte in den einzelnen Bundesländern geschickt< würden« (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 2on). Die Betonung der Personalqualität verstärkt den Eindruck der Dringlichkeit der Mission.
Die AGM-PI sind direkt der Organisations- und Einsatzabteilung im Landespolizeikommando nachgeordnet. Tätigkeitsbereiche sind Kfz-Diebstahl und -Verbringung, Suchtkriminalität, Waffen, Drogen, Dokumente, illegale Migration, Schlepperei und Menschenhandel. Die Dienststellen haben keinen Parteienverkehr. Insgesamt sind 75 Planstellen für die AGM vorgesehen, davon gehören 50% zum Stammpersonal, und 50% kommen aus den Bundesländern, die meisten davon sind ehemalige Grenzschützer. Die Arbeitsbereiche der AGM-Beamten gliedern sich in die Bereiche (r) Fahndungs- und Kontrolltätigkeiten im Großraum Wien, (2) Überwachung der Haupttransitrouten und (3) Überwachung und Kontrolle des internationalen Zugverkehrs und der Bahnhöfe und Bahnknotenpunkte. Dazu zählen beispielsweise auch stark frequentierte U-Bahnhöfe wie der Schwedenplatz. Zudem sind die Beamten der AGM-PI an Schwerpunkteinsätzen und Kooperationen mit anderen Einheiten beteiligt und unter
stützen andere Dienststellen bei Bedarf.
»NIEMAND DARF SICH SICHER FÜHLEN!«
Securitization anhand ihrer Werkzeuge zu betrachten, erhellt den Blick darauf, wie politische Akteure· Intentionen in Handlungen übersetzen; zudem zeigt sich, wie ein politisches Werkzeug von sozialen und gesellschaftlichen Prozessen beeinflusst wird. Nicht zuletzt produzieren Werkzeuge Effekte, die häufig viel weitreichender sind als die vordergründigen Ziele (Balzacq 2008: 76). Analog schlagen Shore und Wright (2on: 3) vor, Politiken als Aktanten im Sinne der Akteur-Netzwerk-Theorie zu betrachten. Die Werkzeuge der Securitization sind entscheidend, wenn es darum geht, die Öffentlichkeit mit der »Wahrheit« des Sicherheitsexperten zu verbinden, indem sie kodifiziertem Wissen den Anschein des Richtigen, Neutralen und ewig Wahren verleihen, das unabhängig von menschlichem Zutun Gültigkeit habe. Gleichzeitig informieren und formen sie die Handlungen verschiedener Akteursgruppen.
3.3 Akteure und Sicherheitspraktiken
Sicherheitspolitiken und entsprechende Maßnahmen, Gesetze und Regelungen werden von Akteuren ersonnen, und sie werden von diesen Akteuren in Interaktion mit anderen Handelnden in die Tat umgesetzt. Für die Analyse der Politiken der inneren Sicherheit sind deshalb die Akteure der Securitization zentrale Figuren. Die augenfälligsten unter ihnen, die über direkten »Publikumskontakt« verfügen, sind die AGM-Beamten. Jedes Team besteht aus vier Beamten, zwei mehr als im Streifenwagen. Herr Raphael betont den bewusst proaktiven Charakter der AGM-PI, da die Beamten nicht auf Weisung oder Anzeige tätig werden, sondern losfahren und verdachtsabhängige Kontrollen durchführen: »Sie müssen sich ihre Arbeit selbst suchen.« Sie leisten keine Ermittlungsarbeit, und sie werden auch nicht aufgrund von Ermittlungsarbeit tätig. Wenn sie auf etwas stoßen, geben sie den Fall an das Landeskriminalamt ab. Die AGM sind kein Schreibtischjob, sondern die Beamten sollen so viel Zeit wie möglich draußen verbringen. Dabei sind sie in Zivilkleidung und mit Zivil-Kfz unterwegs, führen lediglich die Kokarde mit sich und können sich bei Bedarf zu erkennen geben. Diese Semi-Sichtbarkeit und das damit einhergehende Überraschungsmoment sind nicht allein aus Gründen der Polizeitaktik relevant, sondern spielen eine wichtige dramaturgische Rolle für die öffentlichkeitswirksame Inszenierung von Effizienz, wie später noch deutlich wird.
ALEXANDRA SCHWELL
Die Aufträge vergibt der Kommandant; es gibt keine festen Vorgaben,
welches Team an welchem Ort tätig zu werden hat. Hier ist Eigeninitiati-1
ve gefragt. Raphael erzählt, wenn es darum gehe, illegale Migranten auf.
zugreif~n. dann solle man an Bahnhöfe und Verkehrsknotenpunkte, wie
den Schwedenplatz, gehen. Dort könne man für »Quantität« sorgen, einer
von fünf sei ganz bestimmt illegal. Besser als »Quantität« sei allerdings
»Qualität«, wenn ein Schlepper gefasst werde. Wenn man dagegen nach
Diebesgut und Verbringungskriminalität suchen solle, dann sei man wie
derum in anderen Gegenden besser aufgehoben. Wenn also eine Truppe
gegen illegale Migration nur in einer Einfamilienhaussiedlung rumstehe,
so Raphael, dann wisse man schon, dass die nicht allzu viel taugten. Die
Vorgesetzten bauen auf den polizeilichen professionellen Ehrgeiz der Be
amten, ihre Aufgabe »als Polizisten« richtig zu machen. Gleichzeitig be
fördert die Arbeit selbst eine bestimmte, enthumanisierende Sichtweise,
die Migranten in Kategorien wie »quantitativ« und »qualitativ« wertvoll
einordnet (vgl. Reiner 2000). Entsprechend berichtet der Autor einer Re
portage über die AGM im Hausblatt des Innenministeriums von einer er
folglosen Kontrolle eines Zuges im Wiener Westbahnhof:
»Diesmal bleibt die Zugskontrolle ohne Fahndungserfolg. •Am Samstag haben
wir mehr Glück gehabt•, schildert [Polizist] Kelz. 20 Minuten vor der Abfahrt des
IG 26, dem >Stiegl-Express• nach Dortmund, die für 10.50 Uhr vorgesehen war,
hatten die Beamten zwei Serben aus dem Zug geholt. Sie hatten aufrechte Auf
enthaltsverbote.« (Brenner 2008: 22)
In diesem Sinne ähneln die Beamten der AGM-PI den »Street-Level Bu
reaucrats« Lipskys (2010), die Politiken nicht allein in die Tat umsetzen,
sondern sie in Interaktion mit ihrer »Klientel« herstellen und aushandeln.
Dabei reproduzieren die Beamten spezifische Vorstellungen und Wahrhei
ten über Bedrohungsszenarien und »richtiges« Handeln nicht nur, son
dern sie tragen sie in die Öffentlichkeit hinein. Insbesondere die Betonung
und Förderung der eigenverantwortlichen Rolle von Polizisten, deren
vorrangiges Merkmal doch darin bestehen sollte, als anonyme Vertreter
des »Monopols legitimen physischen Zwanges« (Weber 2005 [r92r]: 39) nüchtern und distanziert zu agieren, verdeutlicht die praxisrelevanten und
handlungsanleitenden Aspekte der Werkzeuge der Securitization. Die AGM-Polizisten, Kommandanten und leitenden Beamten sind
jedoch nicht die einzigen relevanten Akteure der AGM. Ebenso, wie die
»NIEMAND DARF SICH SICHER FÜHLEN!«
AGM selbst in das weite Feld der europäischen inneren Sicherheitspolitik
eingebettet sind, agieren auch ihre Protagonisten nicht autonom. Zu die
sem Netzwerk im weiteren Sinn gehören Sicherheitspolitiker, Mitarbeiter
sicherheitsrelevanter Behörden (Ministerien,. Polizei, Justiz, Gefängnis,
etc.), aber auch privatW:irtschaftliche Organisationen und Dienstleister.
Didier Bigo verortet diese Securitizing Actors in Anlehnung an Bourdieu
(r994) innerhalb eines »Sicherheitsfeldes«, eines sozialen Raumes, wo
verschiedene Akteure um Hegemonie, Ressourcen und Einfluss wettei
fern. Sowohl Akteure als auch Organisationen sind Teil ihrer jeweiligen
sozialen, kulturellen und politischen Umwelt wie auch ihrer spezifischen
nationalen Kontrollkultur und -tradition:
»The field is thus established between these •professionals•, with specific •ru
les of the game•, and rules that presuppose a particular mode of socialization
or habitus. This habitus is inherited from the respective professional trajecto
ries and social positions, but is not strongly defined along the lines of national
borders.« (Bigo 2008: 14)
Die Glaubwürdigkeit dieser Akteure beruht auf der Behauptung, im Be
sitz verborgenen und privilegierten Wissens über Sicherheitsbedrohun
gen zu sein, das sie aus Datenquellen beziehen, die allein für den Insider
zugänglich und »lesbar« sind. So wird eine strikte Grenze zwischen Si
cherheitsexperten auf der einen Seite und der Bevölkerung und (unwis
senden) Kritikern auf der anderen Seite konstruiert. Dieses professionelle
Wissen existiert nicht auf der sicherheitspolitischen und -professionellen
Hinterbühne allein, sondern es geht über die Grenzen des Sicherheitsfel
des hinaus und zielt darauf ab, sich als verbindlich in der Gesellschaft zu
etablieren. Das Feld produziert eine »Wahrheit« im Sinne Foucaults, ein
privilegiertes Wissen professioneller und politischer Sicherheitsakteure,
das im Idealfall so gut wie unhinterfragt gesellschaftlich akzeptiert wird.
Es wird genau deshalb als legitim betrachtet, weil es eben innerhalb des
Sicherheitsfeldes der Experten produziert wurde. Je weniger das angespro
chene Publikum über ein Thema weiß - weil es z.B. auf Expertenwissen
einschlägiger Wissenschaftler (Nanotechnologie) oder der Geheimdienste
(Terrorismus) basiert - umso anfälliger wird die öffentliche Meinung zu
dem für die Dramatisierung unbestätigter wie bestätigter Meldungen sein
(Vultee 2on: 84). Ebenso reproduziert die Kontrolle von Menschen mit
dunkler Hautfarbe an vielfrequentierten Verkehrsknotenpunkten Wissen
1:
ALEXANDRA SCHWELL
und Gewissheiten bei außenstehenden Beobachtern: Ganz grundlos werden diese Illegalen/Drogenhändler/Kriminellen ja sicherlich nicht kont
rolliert. Securitization funktioniert in diesem Sinne durch Alltagstechnologien, ·
Alltagspraktiken und Aushandlungen sowie durch den Wettstreit von In- · stitutionen innerhalb dieses Sicherheitsfeldes, in dem es um Macht, Ressourcen, Ansehen oder auch nur persönliche Karrieren geht (Bigo 2002:
73). Die Analyse der Praktiken der Sicherheitsexperten ist außerordentlich relevant, da sie es ermöglicht, bürokratische, organisationale und andere Alltagspraktiken in den Blick zu nehmen, die für die Öffentlichkeit normalerweise weitgehend unsichtbar sind und nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten wie die »außerordentliche Bedrohung«. Nichtsdestotrotz können sie weit effektiver und nachhaltiger eine Securitization herstellen und be
einflussen als Sprech-Akte über »Ausnahmezustände«. Neben den Securitizing Actors des Sicherheitsfeldes existieren zudem
weitere Akteure, die eine wichtige Rolle bei der Analyse von Sicherhei.tskonstruktionen spielen können, und die in politikwissenschaftlichen Ansätzen zu Securitization zumeist unter dem Begriff des »Publikums« subsumiert werden. Spätestens seit Stuart Halls (r999) Überlegungen zum Mechanismus des Kodierens und Dekodierens hat sich die Ansicht weitge· hend durchgesetzt, dass die Beziehung zwischen Sender und Empfänger keineswegs eine Einbahnstraße darstellt, da eine Nachricht auf Seiten des Empfängers durchaus anders (und auch subversiv) interpretiert werden kann als dies vom Sender ursprünglich vorgesehen war. Das Gleiche gilt für die Konstruktion und Aufrechterhaltung eines Sicherheitsthemas. Um also zu verstehen, warum sich eine Securitization als erfolgreich erweist (oder nicht), müssen die zugrundeliegenden Motive nicht nur politischer und sicherheitspraktischer Akteure, sondern auch von Akteuren anderer sozialer Felder in Betracht gezogen werden, die zwar außerhalb des Sicherheitsfeldes stehen, jedoch nichtsdestotrotz Einfluss ausüben können, z.B. über Wahlentscheidungen, Bürgerinitiativen oder Leserbriefe.
Eine Analyse, warum diese Akteure einen Securitizing Move ablehnen, unterstützen, oder ihn auch vorantreiben oder sogar fordern, muss die jeweiligen Handlungsstrategien, Motive und Intentionen einschließen. Diese können durchaus über den Sicherheitsdiskurs hinausgehen und andere Themen beinhalten, wie ökonomischen Wohlstand und die Angst vor sozialem Abstieg (vgl. Schwell 2oro). Das soll allerdings nicht implizieren, dass diese zivilgesellschaftlichen Akteure sich in derselben Machtposition
»NIEMAND DARF SICH SICHER FÜHLEN 1 «
befinden wie die Securitizing Actors des Sicherheitsfeldes; sie können wohl die ursprüngliche Nachricht subvertieren und entsprechend der eigenen Präferenzen interpretieren, aber die Sicherheitsexperten haben nichtsdestotrotz in einem hohen Maß die Autorität, die Agenda zu bestimmen.
3.4 Die Inszenierung und Materlallsierung von Sicherheit
Die Beschaffenheit der AGM als Werkzeuge forciert nicht allein, quasi nach innen, die Nutzung polizeilich-professionellen Ehrgeizes und des »polizeilichen Auges<<, des professionell geschulten spezifischen Blicks polizeilicher Akteure. Dieser bedinge, so Klockars (r980: 39), dass der Polizist seine Umwelt innerhalb einer »ecology of guilt« wahrnehme und als potentielle Straftäter, Opfer oder Tatorte »lese«. Das im Feld produzierte Wissen über Sicherheitsbedrohungen wird zudem aktiv nach außen getragen: Der performative und öffentlichkeitswirksame Aspekt der AGM zeigt sich deutlich, wenn beachtet wird, welchen Anteil die Medien an der Inszenierung von Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen haben.
Raphael erzählt eine Anekdote: Ein ORF-Team plante einen Bericht über die AGM-PI, und man hatte verabredet, an einem Wiener Bahnhof den Alltag der AGM-Beamten zu drehen. Als Raphael mit dem Fernsehteam eintraf, waren seine Beamten bereits vor Ort und hatten die Reisenden beobachtet. Sie hatten bemerkt, wie einer von ihnen insgesamt acht Bahntickets löste - eine ganze Menge, wie sie fanden. Sie beobachteten, dass der Mann mitnichten zu seiner mehrköpfigen Familie ging, sondern zu einer Gruppe erwachsener Personen, die von den Beamten prompt kontrolliert wurde, und siehe da: Es handelte sich um »illegal aufhältige Personen«; der Mann mit den Fahrkarten war damit automatisch ihr »Schlepper«. Das Team vom ORF war baff und fragte Raphael, ob er die denn extra bestellt habe! Er wiederum war stolz auf seine umsichtigen und
raffinierten Beamten.8
Nicht allein führt diese Episode das Insistieren auf »verdachtsabhängige« Kontrollen regelrecht ad absurdum. Sie erhellt auch den Blick auf die Rolle der Medien bei der Inszenierung von Effizienz und der Verbreitung von Wissen über Sicherheitsbedrohungen. Die Medien spielen bei der Securitization einer Thematik eine herausragende Rolle; insbesondere -·
8 1 Zur Funktion von narrativen Heldenerzählungen in der Polizei siehe Shea
ring/Ericson (1991).
2 93
ALEXANDRA SCHWELL
der Sensationsjournalimus entspricht der Tendenz zur Dramatisierung und stellt einen eindeutigen Interpretationsrahmen bereit, indem Vorstellungen polizeilicher und sicherheitspolitischer Akteure über Bedrohungen häufig kaum gefiltert weitergetragen werden (vgl. Vultee 2on). Ins- · besondere im Kontext der Schengenerweiterung 2007 überschlugen sich die österreichischen Boulevardmedien geradezu angesichts der angeblich zu erwartenden Migrations- und Einbruchswelle; die Aussicht auf hereinbrechende kriminelle »Ostbanden« ließ die Bevölkerung in Berichterstattung und Leserbriefen zutiefst verängstigt erscheinen. Aus der Fülle der medialen Dramatisierungen sei an dieser Stelle lediglich ein lyrisch herausragender Vertreter genannt: Der mittlerweile verstorbene Kolumnist der »Kronen Zeitung«, Österreichs auflagenstärkstem Blatt, dichtete im
Januar 2010:
».A,lsD denken die bekannten/ sogenannten Asylanten:/ >Von Italien bis Polen
/ ist für uns nicht viel zu holen. / Durchgewunken sind wir gleich. / Unser Ziel
ist Österreich 1 / Dort gibt es die meiste Beute / und so viele gute Leute. /
Schlampert ist die Politik. / Dort macht unsereins sein Glück.< / Wenn die Leu
te an den Spitzen / schon auf ihren Ohren sitzen, / muss sich wehren halt der
Bürger/ gegen seines Wohlstands Würger.« (Martin 2010)
Die Protagonisten der Bedrohung existieren in diesem Narrativ als reine Projektionsfläche; sie erscheinen nicht als Akteure mit eigener Geschichte, sondern als Illegale, Ostbanden, Asylbetrüger und Drogenhändler. Entsprechend bemerkt Chavez (2008: 42) über das US-amerikanische Bedrohungsszenario der illegalen Einwanderung: »The Latino Threat Narrative is a social imaginary in which Latinos are >virtual characters<«, deren tatsächliche Lebensumstände mit dem - zu einem großen Teil medial vermittelten - Wissen und den Wahrheiten der Mehrheitsgesellschaft wenig
bis nichts gemein haben. Auf der anderen Seite bleibt stets die Frage, inwieweit die imaginierte
Bevölkerung als Zielgruppe insbesondere der Boulevardmedien, aber auch populistischer Politiker und Politikerinnen, ebenso analog eine Projektion dieser Akteure darstellt. Auch im Fall der AG M spielt eine imaginierte Bevölkerung als Zielgruppe eine wichtige Rolle, sie war regelrecht konstitutiv für die Einrichtung der AGM, und dies hängt wiederum mit ihrem expliziten Bezug auf den Wegfall der Grenzkontrollen und der damit angeblich eintretenden Sicherheitslücke zusammen. So meint Raphael, der Impetus,
»NIEMAND DARF SICH SICHER FÜHLEN 1 «
die AG M einzurichten, sei vor allem aus dem Bedürfnis der Beruhigung der Bevölkerung entstanden. Sie machten die Bevölkerung glücklich, und sie seien ein effizientes Mittel gegen Kriminalität. Diese Doppelfunktion erscheint damit als das herausragende Merkmal der AG M: Raphael betont, urrnbhängig von den Grenzkontrollen seien AG M ein effizientes Mittel, das man ruhig schon früher hätte einführen sollen. Auf die Frage, inwieweit es sich denn nun tatsächlich um Ausgleichsmaßnahmen im Wortsinne handle, die direkt mit den Grenzkontrollen korrelierten, antwortet Raphael: Nein, die stünden ganz für sich selbst. Der Wegfall der Grenzkontrollen sei eben ein guter Zeitpunkt und Anlass für die Einführung gewesen, aber einen direkten Zusammenhang, was die Notwendigkeit angeht, sehe er nicht. Die Schengenerweiterung bot auf diese Weise eine gute Gelegenheit zur Einführung der verdeckten Kontrollen unter dem Deckmantel der AGM. Eine funktionale Notwendigkeit wurde suggeriert, um eine Maßnahme einzuführen, die ansonsten zumindest diskussionswürdig gewesen wäre.
Die Relevanz der Verbindung von Effizienz und Inszenierung wird deutlich, wenn die AGM mit einer weiteren Maßnahme der österreichischen Polizei kontrastiert werden: Die sogenannten »Aktionen scharf« werden regelmäßig von den jeweiligen Innenministern und Innenministerinnen ausgerufen und von den Boulevardmedien entsprechend begeistert begleitet. Eine »Aktion scharf« kann beispielsweise in der Sperrung eines Autobahnabschnitts und einer Vollkontrolle sämtlicher Fahrzeuge bestehen, flankiert von jeder Menge Blaulicht und mindestens einem Hubschrauber. Der leitende Beamte im Bereich AG M hält davon nichts, er bevorzugt es, die Aktionen einen »hochpolitischen Kunstgriff« zu nennen. Solch massive ereignisunabhängige Kontrollen dienten allein der Beruhigung der Bevölkerung. Außer ein paar alkoholisierten Fahrern bekomme man sowieso auf diese Weise niemanden zu fassen, besonders keinen, der etwas Größeres angestellt habe, denn dank Handy und Internet seien die größeren Fische so schnell über die Straßensperre informiert, dass sie dann eben woanders langfahren würden.
Der Unterschied zwischen verdeckten Kontrollen und öffentlichkeitswirksamen Aktionen ist jedoch nicht so groß wie es zunächst den Anschein hat. Wahrend die »Aktionen scharf« und andere öffentlichkeitswirksame Maßnahmen in erster Linie an nicht-polizeilichen Erfolg~kriterien gemessen werden, haben die AGM eine Doppelfunktion: Aus Sicht der Polizei steht der praktische Nutzen im Vordergrund. Die Effektivität wird durch die geringe Sichtbarkeit erreicht. Genau diese Semi-Sichtbarkeit erzeugt
295
ALEXANDRA SCHWELL
die Akzeptanz und den Effekt der Beruhigung des -subjektiven Sicherheitsgefühls in einer imaginierten Zielgruppe, der Bevölkerung, vermittelt •, durch die Medien. Zum einen steht hier die Unwägbarkeit der Kontrolle, zum anderen ist die Kontrolle nicht nur für die Kontrollierten sichtbar, sondern fungiert auch als Botschaft für Außenstehende, sie hat eine Signalwirkung: Wir sind überall, wir könnten jederzeit eingreifen. Für die einen ist das ein Versprechen, für die anderen eine Drohung: Niemand
darf sich sicher fühlen. Alle sollen sich sicher fühlen.
3.5 Der temporale Aspekt der Securitization
Mittlerweile sind die AGM-PI eine feste Einrichtung und haben keineswegs mehr den Anschein eines Provisoriums. Ein Zusammenhang zwischen Kriminalitätsrate und AGM, positiv wie negativ, sei allerdings
nicht zu verzeichnen, so Raphael, auch wenn das Ministerium genau jenes immer wieder behaupte. Zudem impliziert »Ausgleich« eine zeitliche Beschränkung bis hin zur Wiederherstellung eines »Normalzustandes«.
Dies ist hier nicht der Fall, sondern die AGM werden mit der Zeit zum natürlichen Teil des polizeilichen Repertoires - dies ist ein Hinweis darauf, dass einer Securitization im Zeitverlauf ein gewisser Gewöhnungseffekt innewohnt. Was zu Beginn »außerordentlich« schien, kann bald »normal«
sein. Entsprechend muss eine Analyse stets zwei Dimensionen berücksichtigen: Die Dauer der Securitization sowie die »entropy of the public
imagination« (Salter 2008: 324). So ist es bei Weitem nicht der Fall, dass auf eine Securitization stets eine Desecuritization folgt. Viel häufiger tritt ein Habitualisierungseffekt ein, der den Umgang mit und die Wahrnehmung einer aktuellen oder diffusen Bedrohung und ihre Bekämpfung
betrifft. Aus dem Ausnahmezustand wird schnell Alltag, der zunehmend weniger hinterfragt wird - insbesondere wenn die Handlungen in hohem Maße professionalisiert, durch Wiederholungen institutionalisiert und in
ritualisierten Handlungen mythisch aufgeladen wurden. Im Fall der AGM halten sie jedoch durch ihre Bezeichnung weiterhin
die Erinnerung an und den Bezug auf die vorgeblich weiterhin bestehende Bedrohung durch den Wegfall der Sehengen-Außengrenze wach. Nicht
zuletzt aus diesem Grund sind die AGM ein treffendes Beispiel für Werkzeuge der Securitization, als sie ein spezifisches Dispositiv verkörpern, das eine bestimmte Vorstellung von Bedrohung zum Ausdruck bringt und Themen und Akteure als Sicherheitsprobleme rahmt. Auf diese Weise
»NIEMAND DARF SICH SICHER FÜHLEN!«
werden die öffentliche Wahrnehmung und öffentliches Handeln in Bezug auf den Umgang mit dieser Sicherheitsbedrohung in bestimmte Bahnen gelenkt.
4'. 0THERING: DIE EFFEKTE DER (UN· )SICHERHEIT
Zusammenfassend soll dieser Abschnitt einen Blick auf die weiterreichen
den Effekte des Otherings durch Sicherheitsdiskurse und -praktiken werfen. Sie betreffen sowohl das Selbst- und Fremdbild der angesprochenen Mehrheitsgesellschaft als auch das der Securitized und Securitizing Actors.
Die Securitizing Actors, die Experten des Sicherheitsfeldes, also auch die AGM-Beamten, sind stets ein untrennbarer Teil des Feldes, dessen Wahrheiten und Gewissheiten die Effekte produzieren, die wiederum spezifische Routinen und Praktiken hervorbringen. Ihr Habitus ist von ihrer Position und derjenigen ihrer Organisation im Feld sowie von den Relationen mit anderen Akteuren des Feldes geprägt. Zudem bespielen Akteure nicht nur ein Feld. Wie Bourdieu (2001) gezeigt hat, wird das Denken politischer Akteure durch ihre Teilhabe am politischen Feld und dessen
Illusio strukturiert. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, politische Akteure glaubten voll und ganz an die Geschichten, die sie über Migranten, Islamisten usw. verbreiteten:
»Nonetheless, they cannot call into question those myths about state, about
the integrity of the people, because the myths are the way they frame their
everyday explanation of the political and social world anil the way they see
their own struggles and values. Even the most cynlcal among them do not
have another framework in which to speak about the state and security.« (Bigo
2002: 69)
Zudem wirken die Sicherheitsmaßnahmen auf das politische Feld zurück, das durch die Übersetzung in politische Programme, Verlautbarungen, Gesetze und Vorschriften das »Wahrheitsregime« legitimiert und repro
duziert. Zudem haben Securitization-Prozesse stets Auswirkungen auf die Ge
sellschaft, innerhalb derer sie stattfinden, die über die akute Bedrohung und ihre Bekämpfung hinausreichen. Einer der wichtigsten Punkte, der zudem weitreichende Konsequenzen für eine Analyse von Sicherheit hat,
2 97
-. __________________ L
ALEXANDRA SCHWELL
ist das Moment der Habitualisierung, Naturalisierung und Institutiona
lisierung, das dazu führt, dass Sicherheitspiaßnahmen immer weniger,
hinterfragt und stattdessen als natürlicher Bestandteil des Alltags integ
riert und normalisiert werden. Wenn immer weitere Teile der Gesellschaft verdächtig scheinen, verschwindet der besondere Dringlichkeitsstatus
von Notfallmaßnahmen, der Ausnahmezustand wird mehr und mehr
zur Routine. Inwiefern Sicherheitsmaßnahmen in einem Kosten-Nutzen
Verhältnis stehen, wird zunehmend weniger hinterfragt; vielmehr werden
sie zum Selbstzweck. Schlussendlich folgt der Habitualisierung die Inter
nalisierung der Regeln, die von der Maßnahme gesetzt werden, und eine
Unterwerfung unter dieselben - Securitization als gouvernementale Praxis
(Pram Gad/Lund Petersen 2on: 319). Insbesondere technische Maßnahmen, wie Videoüberwachung, sind
dazu geeignet, die Alltagswahrnehmung grundlegend zu verändern, selbst
(oder besonders) dann, wenn sie gar nicht vorhanden sind und aus einem
nicht überwachten Raum in logischer Konsequenz einen gefährlichen
Raum machen. Eisch-Angus weist daraufhin, dass derartig von Sicherheit
durchdrungene Orte wie der Flughafen keines expliziten Verweises mehr
auf existierende Sicherheitsbedrohungen bedürfen, um ihre Maßnahmen
und ihre Sicherheitsarchitektur zu legitimieren. Stattdessen schließen sie
nahtlos an gesellschaftliche Sicherheitsdiskurse an: »Vermittelt wird nur
noch die reine Präsenz eines Systems von Gefahr und Risiko, dessen ge
sellschaftliche Totalität der Flughafen, als Tempel der Moderne und Kult
stätte der mythischen Antinomie von Freiheit und Sicherheit, als unhinter
fragbar und unentrinnbar setzt.« (Eisch-Angus 2009: 85) Schließlich bleiben die Securitized Actors, die vermeintlichen Terroris
ten, »Kopftuchmädchen« (Thilo Sarrazin), Kriminellen und Drogenhänd
ler, die Klientel der AGM, kaum von den Konsequenzen von Sicherheits
diskursen und -praktiken unberührt. Sie bekommen die Effekte wohl am
unvermitteltesten zu spüren, da sie sich von Securitization als einer Politik
des Othering und der Exklusion betroffen sehen. So verweist auch Schiffau
er auf die möglichen nicht intendierten Folgen einer staatlichen Terroris
muspräventionspolitik, die sich in erster Linie durch Druck auf Mitglieder
islamischer Gemeinden ausweist: »Sie führt zu einer wachsenden Distanz
zur Mehrheitsgesellschaft; sie untergräbt das Vertrauen in den Rechtsstaat;
sie schwächt das Reformlager in den Gemeinden; und sie macht Integrati
on durch Partizipation unmöglich.« (2007: 370)
»NIEMAND DARF SICH SICHER FÜHLEN!«
Es ist demnach mitnichten der Fall, dass Sicherheit allein für diejenigen relevant ist, die zum Kre!s der »Verdächtigen« respektive der »Ge
fährdeten« zählen; vielmehr stellt Sicherheit als Ausdruck einer Praxis der
»govemmentality of unease« (Bigo 2002) eine untrennbare diskursive und praktische Wechselbeziehung aller Akteure dar. Bei der Analyse dieser
Wechselbeziehungen kann eine Anthropologie der Sicherheit ansetzen.
LITERATUR
Albro, Robert et al. (2012): »Introduction«, in: Robert Albro/George Mar
cus/Laura A. McNamara/Monica Schoch-Spana (Hg.), Anthropologists
in the Security Scape. Ethics, Practice, and Professional Identity, Walnut Creek: Left Coast Press, S. 7-14.
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (2on): LH Pröll und BM
Mil<l-Leitner eröffneten »Operatives Zentrum für Ausgleichsmaßnah
men« in Wiener Neustadt. Pressemitteilung vom 30.08.2on: APA OTS.
Appadurai, Arjun (1997): Modernity at Large: Cultural Dimensions ofGlo
balization, Minneapolis: University ofMinnesota Press.
Bajc, Vida (Hg.) (2on): Security and Everyday Life, New York: Routledge.
Balzacq, Thierry (2008): »The Policy Tools of Securitization: Information
Exchange, EU Foreign and Interior Policies«, in: Journal of Common
Market Studies 46 (1), S. 75-100.
Balzacq, Thierry (2on): »A Theory of Securitization: Origins, Core As
sumptions, and Variants«, in: Ders. (Hg.), Securitization Theory. How
Security Problems Emerge and Dissolve, London/New York: Routledge, S. l-30.
Bigo, Didier (2002): »Security and Immigration: Toward a Critique of the
Governmentality ofUnease«, in: Alternatives 27 (Special Issue), S. 63-92.
Bigo, Didier (2008): »Globalized (In)Security: the Field and the Ban-Op
ticon«, in: Ders./Anastassia Tsoukala (Hg.), Terror, Insecurity and
Liberty. Illiberal Practices of Liberal Regimes, the (In)Security Games,
London/New York: Routledge, S. ro-48.
Booth, Ken (1991): »Security and Emancipation«, in: Review of Interna
tional Studies 17 (4), S. 313-326.
Bourdieu, Pierre (1994): Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
2 99
1 i
1
300 ALEXANDRA SCHWELL
Bourdieu, Pierre (2001): Das politische Feld. Zur Kritik der politischen Vernunft, Konstanz: UVK.
Brenner, Gerhard (2008): »Kontrollen auf Straße und Schiene. In Wien wurden nach der Verlagerung der Schengengrenzen drei Fachinspektionen für Ausgleichsmaßnahmen eingerichtet«, in: Öffentliche Sicher
heit (3-4), S. 18-22. Bubandt, Nils (2005): »Vernacular Security: The Politics of Feeling Safe
in Global, National and Local Worlds«, in: Security Dialogue 36 (3), S.
275-296. Bundesministerium für Inneres (o.J.): Möglicher Assistenzeinsatz des
Bundesheeres nach Abbau der Sehengen Außengrenze - Grundsätze für den militärischen Aufgabenbereich.
Buzan, Barry et al. (1998): Security: A New Framework for Analysis, Boulder/Colorado: Lynne Rienner Publishers.
Chavez, Leo R. (2008): The Latino Threat. Constructing Immigrants, Citizens, and the Nation, Stanford: Stanford University Press.
Eisch-Angus, Katharina (2009): »Sicher forschen? Methodische Überlegungen zum Ethnografieren von Sicherheit und Alltag«, in: Sonja
Windmüller/Beate Binder/Thomas Hengartner (Hg.), Kultur - Forschung. Zum Profil einer volkskundlichen Kulturwissenschaft, Müns
ter: Lit, S. 69-90. Eisch-Angus, Katharina (2orr): »>You Can't Argue with Security.< Tue
Communication and Practice of Everyday Safeguarding in the Society of Security«, in: Behemoth. A Journal on Civilisation 4 (2), S. 83-ro6.
Eriksen, Thomas Hylland et al. (Hg.) (2oro): A World of Insecurity. Anthropological Perspectives on Human Security, London/New York: Plu
toPress. Floyd, Rita (2007): »Human Security and the Copenhagen School's Securi
tization Approach: Conceptualizing Human Security as a Securitizing Move«, in: Human Security Journal - Revue de la securite humaine 5,
s. 38-49. Foucault, Michel (1980): »Truth and Power«, in: Colin Gordon (Hg.), Pow
er/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, New York: Pantheon, S. ro9-133.
Foucault, Michel (2006): Geschichte der Gouvernementalität l: Sicherheit,
Territorium, Bevölkerung: Vorlesung am College de France 1977 /1978, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
»NIEMAND DARF SICH SICHER FÜHLEN!« 301
Gallie, William B. (1956): »Essentially Contested Concepts«, in: Proceedings ofthe Aristotelian Society 56, S. 167-198.
Glaeßner, Gert-Joachim (2002): »Sicherheit und Freiheit«, in: Aus Politik und Zeitgeschichte ro-rr, S. 3-13.
Goldstein, Daniel M. (2broa): »Security and the Culture Expert: Dilemmas
of an Engaged Anthropology«, in: PoLAR: Political and Legal Anthropology Review 33 (1), S. 126-142.
Goldstein, Daniel M. (2orob): »Toward a Critical Anthropology of Secu
rity«, in: Current Anthropology 51 (4), S. 487-517. Goodey, Jo (2006): »Ethnic Profiling, Criminal (In)Justice and Minority
Populations«, in: Critical Criminology 14, S. 207-212.
Gusterson, Hugh (2004): People of the Bomb. Portraits of America's Nuclear Complex, Minneapolis: University ofMinnesota Press.
Gusterson, Hugh (2007): »Anthropology and Militarism«, in: Annual Re
view of Anthropology 36, S. 155-175. Hall, Stuart (1999): »Kodieren/Dekodieren«, in: Roger Bromley/Udo Gött
lich/Carsten Winter (Hg.), Cultural Studies. Grundlagentexte zur Einführung, Lüneburg: Zu Klampen, S. 92-rro.
Huysmans, Jef (2orr): »What's In an Act? On Security Speech Acts and
Little Security Nothings«, in: Security Dialogue 42 (4-5), S. 371-38} Kent, Alexandra (2006): »Reconfiguring Security: Buddhism and Moral
Legitimacy in Cambodia«, in: Security Dialogue 37 (3), S. 34n6r. Klockars, Carl B. (1980): »The Dirty Harry Problem«, in: Annals of the
American Academy of Political and Social Science 452, S. 33-47. Lipsky, Michael (2oro): Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Indi
vidual in Public Services, New York: Russell Sage Foundation. Maguire, Mark (2009): »The Birth of Biometrie Security«, in: Anthropol
ogy Today 25 (2), S. 9-14. Martin, Wolf (2oro): »In den Wind gereimt...«, in: Kronen Zeitung,
24.or.2oro, S. 2.
Maurer, Albrecht/Kant, Martina (2008): >»Vergrenzung< des Inlands. Von der Schleierfahndung zur neuen Bundespolizei«, in: Bürgerrechte & Polizei/CILIP 89 (1), S. 52-57.
Nader, Laura (1972): »Up the Anthropologist - Perspectives Gained from
Studying Up«, in: Dell Hymes (Hg.), Reinventing Anthropology, New York: Pantheon Books, S. 284-31r.
Pram Gad, Ulrik/Lund Petersen, Karen (2orr): »Concepts of Politics in Se
curitization Studies«, in: Security Dialogue 42 (4-5), S. 315-328.
302 ALEXANDRA SCHWELL
Reiner, Robert (2000): The Politics ofthe Police, Oxford: Oxford University
Press. Republik Österreich, Parlament (2009): Anfrage der Abgeordneten Korun,
Pilz·, Freundinnen und Freunde an die Bundesministerin für Inneres
betreffend »Rassenkontrolle« durch die Wiener Polizei, http://www.
parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_o3075/fnameorig_r6866r.
html, eingesehen am 23.09.2009. Salter, Mark B. (2008): »Securitization and Desecuritization: A Dramatur
gical Analysis of the Canadian Air Transport Security Authority«, in:
Journal oflnternational Relations and Development II, S. 321-349. SDÜ (1985): übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens
von Sehengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der BENELUX-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen vom 19. Juni 1990 einschließlich der Erklärungen zur Nacheile gern. Art. 41 Abs. 9 des Über
einkommens. BGBL II 1993 S. ror3ff. Schiffauer, Werner (2007): »Nicht-intendierte Folgen der Sicherheitspoli
tik nach dem rr. September«, in: Kurt Graulich/Dieter Simon (Hg.), Terrorismus und Rechtsstaatlichkeit: Analysen, Handlungsoptionen,
Perspektiven, Berlin: Akademie Verlag, S. 361-375. Schwell, Alexandra (2oro): »The Iron Curtain Revisited: The >Austrian
Way< of Policing the fnternal Sehengen Border«, in: European Security,
s. 317-336. Schwell, Alexandra (2012): »Austria's Return to Mitteleuropa. A Postcolo
nial Perspective on Security Cooperation«, in: Ethnologia Europaea 42
(r), S. 21-39. Shearing, Clifford D./Ericson, Richard V. (1991): »Culture as Figurative Ac
tion«, in: The British Journal of Sociology 42 (4), S. 481-506. Shore, Cris/Wright, Susan (Hg.) (r997a): Anthropology of Policy. Critical
Perspectives on Governance and Power, London/New York: Routledge.
Share, Cris/Wright, Susan (r997b): »Policy. A New Field of Anthropology«, in: Cris Shore/Susan Wright (Hg.), Anthropology of Policy. Critical Perspectives on Governance and Power, London/New York: Routledge, S.
3-39. Shore, Cris/Wright, Susan (2on): »Conceptualising Policy: Technologies
of Governance and the Politics of Visibility«, in: Cris Shore/Susan
»NIEMAND DARF SICH SICHER FÜHLEN 1 « 303
Wright/Davide Pero (Hg.), Policy Worlds. Anthropology and the Analysis of Contemporary Power, New York/Oxford: Berghahn, S. r-25.
Shore, Cris/Wright, Susan/Pero, Davide (Hg.) (2on): Policy Worlds. An. thropology and the Analysis of Contemporary Power, New York/Ox-ford: Berghahn. ·
Stritzel, Holger (2007): »Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and Beyond«, in: European Journal oflnternational Relations 13, S. 357-
383. Tehranian, Majid (2004): »Cultural Security and Global Governance: In
ternational Migration and Negotiations ofldentity«, in: Jonathan Friedman/Shalini Randeria (Hg.), Worlds on the Move. Globalization, Mi
gration, and Cultural Security, London/New York: I.B. Tauris, S. 3-22. Todorova, Maria (1999): Die Erfindungs des Balkans. Europas bequemes
Vorurteil, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Vultee, Fred (2on): »Securitization as a Media Frame. What Happens
When the Media >Speak Security«<, in: Thierry Balzacq (Hg.), Securitization Theory. How Security Problems Emerge and Dissolve, London/
New York: Routledge, S. 77-93-Wrever, Ole (1996): »European Security Identities«, in: Journal of Com
mon Market Studies 34 (r), S. ro3-r32. Walker, Neil (2002): »The Problem ofTrust in an Enlarged Area ofFree
dom, Security and Justice: A Conceptual Analysis«, in: Joanna Apap/ Malcolm Anderson (Hg.), Police and Justice Co-Operation and the New
European Borders, The Hague/London/New York: Kluwer Law Inter
national, S. 19-3} Wall, Tyler/Monahan, Torin (2on): »Surveillance and Violence from Afar:
The Politics of Drones and Liminal Security-Scapes«, in: Theoretical
Criminology 15 (3), S. 239-25+ Warneken, Bernd Jürgen/Wittel, Andreas (1997): »Die neue Angst vor
dem Feld. Ethnographisches research up am Beispiel der Unternehmensforschung«, in: Zeitschrift für Volkskunde 93 (r), S. r-r6.
Weber, Max (2005 [1921]): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Frankfurt a.M.: Zweitausendeins.
Wedel, Janine R. et al. (2005): »Toward an Anthropology of Public Poli
cy«, in: Annals of the American Academy of Political and Social Science 600 (Issue Title: The Use and Usefulness ofthe Social Sciences: Achievements, Disappointrnents, and Promise), S. 30-5r.
304 ALEXANDRA SCHWELL
Weldes, Jutta et al. (Hg.) (1999): Cultures oflnsecurity. States, Communities, and the Production of Danger, Minneapolis: University of Min
nesota Press. Wolff, Larry (1994): Inventing Eastern Europe: The Map ofCivilization on
the Mind ofthe Enlightenment, Stanford: Stanford University Press. Wright, Susan (2orr): »Studying Policy: Methods, Paradigms, Perspec
tives«, in: Cris Shore/Susan Wright/Davide Pero (Hg.), Policy Worlds. Anthropology and the Analysis of Contemporary Power, New York/Ox
ford: Berghahn, S. 27-3r.
Zettelwirtschaft
Consumer Citizenship, Europäisierung
und Krisenpolitik in Griechenland
KERSTIN PoEHLS
Die politische Auseinandersetzung über die Finanzprobleme innerhalb der EU, über die Nationalökonomien Spaniens, Italiens und Griechenlands sowie über ihre Rolle innerhalb der Europäischen Union (EU) verschärft sich seit 2010. Sie fördert grundsätzlich unterschiedliche Ansichten über die Ursachen und Folgen der Krise, die Rolle des Staates und dementsprechend gegensätzliche Lösungsansätze zutage. Politische Reformprogramme, Gesetze und ihre bürokratischen Folgen - policies - stoßen nicht einfach auf ein gesellschaftliches Gefüge und öffentliche Debatten wie diese, sie unterliegen je nach sozialem und kulturellem Kontext, je nach der Weltanschauung und politischer Position der Akteure, auch ReInterpretationen (Shore/Wright 2orr: 20) - und bringen gesellschaftliche Debatten und Konflikte zugleich hervor.
Ein rund zehnmonatiger Forschungsaufenthalt 2orr an der Universität der Ägäis in Mytilini - auf der drittgrößten griechischen Insel Lesbos - führte mir die Kluft zwischen Innen- und Außensichten auf die griechischen Zustände vor Augen und gab so den Anstoß für diesen Text. Die folgenden Überlegungen sind Teil einer andauernden Forschung.' Auch eröffuete sich mir das breite alltägliche Meinungsspektrum über Ursachen und Lösungsmöglichkeiten der Krise, in die historisch gewachsene Auffassungen über Verantwortlichkeiten und Funktionen des Staates und seiner
1 / Die hinzugezogenen Dokumente und Medienberichte decken das Jahr 2011
ab - spätere politische Ereignisse wie etwa die nationalen Wahlen am 6. Mai
2012 werden nur punktuell berücksichtigt.





















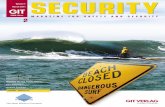









![Wie funktioniert Sicherheit ohne (viel) Staat? Befunde aus Nordostafghanistan und Pakistan [DRAFT attached - for published version see book!]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632e1c3c2be52b9c7202f98c/wie-funktioniert-sicherheit-ohne-viel-staat-befunde-aus-nordostafghanistan-und.jpg)