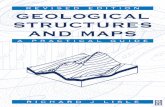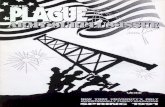Konferenzbericht: Intentionally left blank. Raum für Notizen. Aufzeichnungsverfahren mit...
Transcript of Konferenzbericht: Intentionally left blank. Raum für Notizen. Aufzeichnungsverfahren mit...
Zeitschrift für Germanistik
Neue Folge
XXV - 1/2015
Herausgeberkollegium
Alexander Košenina (Geschäftsführender Herausgeber, Hannover)Steffen Martus (Berlin)Erhard Schütz (Berlin)Ulrike Vedder (Berlin)
Gastherausgeber
Hans Jürgen Scheuer (Berlin)
PETER LANGInternationaler Verlag der Wissenschaften
Bern · Berlin · Bruxelles · Frankfurt am Main · New York · Oxford · Wien
Sonderdruck
Schwerpunkt: Am Beispiel des Esels. Denken, Wissen und Weisheit in literarischen Darstellungen der „asinitas“
Hans Jürgen scHeuer – Topos „asinitas“. Edi-torial 8
andreas Bässler – Gute Gründe, ein Esel zu werden. Zur humanistischen Rezeption des anti-ken Eselsromans 14
Bernd roling – Burnell the Ass. Nigel von Longchamp und die Wissenschaftskritik seiner Zeit 28
Hans Jürgen scHeuer – Eselexegesen. Spiel-räume religiöser Kommunikation im Schwank-exempel des Mittelalters und der Frühen Neu- zeit 42
Kristin rHeinwald – Das unerhörte Rätsel der Haut: Der geschundene Esel zwischen Immanenz und Transzendenz 58
BJörn reicH – Pegasinus. Giordano Brunos ge-flügelter Esel und die silenische Poetik des Komi-schen 76
udo FriedricH – Die Paradigmatik des Esels im enzyklopädischen Schrifttum des Mittelalters und der frühen Neuzeit 93
alexander Košenina – Aktenzeichen Esel-schatten ungelöst. Vertrackter Rechtsfall in den literarischen Gerichtshöfen von Wieland, Kotze-bue und Dürrenmatt 110
HuBertus FiscHer – Eselsästhetik – malerisch, satirisch. Der Esel in der Theorie des Malerischen und seine Entstellung zur Kenntlichkeit 123
*corina caduFF – Kollektive Autorschaft. Zu den Literaturkollektiven GRAUKO (Graz), Bern ist überall (Schweiz), G13 (Berlin) 132
Inhaltsverzeichnis
Diskussion
astrid lemBKe – Literarische Verwandtschaft im Mittelalter. Literatur- und geschichtswissen-schaftliche Perspektiven 147
Dossier
Hans-edwin FriedricH – „Ja, der hat ja gar keine Chancen!“ Zur jüngsten Arno-Schmidt-Forschung. Arno Schmidt (1914–1979) zum 100. Geburtstag 154
Miszellen
cHristian Kaserer – Lenzens drei Weimarer Pandämonien 158
nils FieBig – Auch Autographen haben ihre Schick-sale. Der Nachlass von Richard M. Meyer 162
Konferenzberichte
Umbriferi prefazi: Die Wiederentdeckung des Schattens in Mittelalter und Renaissance (Inter-disziplinäre Tagung in Göttingen v. 3.–5.7.2014) (Katharina Wimmer) 170
Literarische Öffentlichkeit im mittleren 19. Jahr-hundert. Vergessene Konstellationen literarischer Kommunikation zwischen 1840 und 1885 (In-ternationale Tagung in Göttingen v. 3.–5.4.2014) (Philipp Böttcher) 172
Geist im Buch: Historische Formen und Funk-tionen des Buchs in den Geisteswissenschaften (Arbeitsgespräch in Berlin v. 3.4.2014–5.4.2014) (Claudia Löschner) 174
6
Wissens(trans)formationen. Strategien der media-len Repräsentation und Vermittlung von Wissen (Interdisziplinäre Tagung in Passau v. 30.–31.5. 2014) (Lars Bülow) 178
Intentionally left blank. Raum für Notizen. Auf-zeichnungsverfahren mit Arbeitsheften, Notizbü-chern, Alben (Internationale Konferenz in Jerusa-lem v. 12.–14.5.2014) (Stefanie Mahrer) 180
Besprechungen
susanne KöBele, Bruno Quast (Hrsg.): Lite-rarische Säkularisierung im Mittelalter (Maximi-lian Benz) 184
JoacHim Heinzle (Hrsg.): Das Nibelungenlied und die Klage. Nach der Handschrift 857 der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mittelhochdeutscher Text, Übersetzung und Kommentar (Katharina Philipowski) 187
wolFgang HauBricHs, Patricia oster (Hrsg.): Zwischen Herrschaft und Kunst. Fürstliche und adlige Frauen im Zeitalter Elisabeths von Nassau-Saarbrücken (14.–16. Jh.) (Jörn Münkner) 190
andré scHnyder (Hrsg.): Historische Wunder= Beschreibung von der so genannten schönen Melusi na. Die ‚Melusine‘ (1456) Thürings von Ringoltingen in einer wiederentdeckten Fassung aus dem frühen 18. Jahrhundert, Edition und Bei-träge zur Erschließung des Werkes von Catherine Drittenbass, Florian Gelzer, Andreas Lötscher und Franz Simmler (Carmen Stange) 192
nicola KaminsKi, BenJamin KozlowsKi, tim ontruP, nora ramtKe, JenniFer wagner (Hrsg.): Original-Plagiat. Peter Marteaus Un-partheyisches Bedenken über den unbefugten Nachdruck von 1742, Bd. 1: Quellenkritische Edition; Bd. 2: Stellenkommentar, Glossar (Han-nes Fischer) 194
Hermann Korte, Hans-JoacHim JaKoB (Hrsg.): „Das Theater glich einem Irrenhause“. Das Publi-kum im Theater des 18. und 19. Jahrhunderts; Hermann Korte, Hans-JoacHim JaKoB, Bas-tian dewenter (Hrsg.): „Das böse Tier Theater-publikum“. Zuschauerinnen und Zuschauer in
Theater- und Literaturjournalen des 18. und frü-hen 19. Jahrhunderts (Wilm Grunwaldt) 197
miKe Frömel: Offene Räume und gefährliche Reisen im Eis. Reisebeschreibungen über die Po-larregionen und ein kolonialer Diskurs im 18. und frühen 19. Jahrhundert (Michael Ewert) 199
BernHard FiscHer: Johann Friedrich Cotta. Verleger – Entrepreneur – Politiker (Ute Schnei-der) 201
ariane martin (Hrsg.): Georg Büchner 1835 bis 1845. Dokumente zur frühen Wirkungsge-schichte (Roland Berbig) 202
nils FieBig (Hrsg.): Richard M. Meyer. Moral und Methode. Essays, Vorträge und Aphorismen (Ralf Klausnitzer) 204
nicola gess: Primitives Denken. Wilde, Kin - der und Wahnsinnige in der literarischen Mo-derne (Müller, Musil, Benn, Benjamin) (Norman Kasper) 206
HeinricH detering, maren ermiscH, Porn-san watanangura (Hrsg.): Der Buddha in der deutschen Dichtung. Zur Rezeption des Buddhismus in der frühen Moderne (Thomas Schwarz) 208
Hans-alBrecHt KocH (Hrsg.): Rudolf Alex-ander Schröder (1878–1962) (Yvonne Zimmer-mann) 210
Peter uwe HoHendaHl: Erfundene Welten. Relektüren zu Form und Zeitstruktur in Ernst Jüngers erzählender Prosa (Helmuth Kiesel) 212
FranzisKa scHössler: Drama und Theater nach 1989. Prekär, interkulturell, intermedial (Thomas Wortmann) 215
Florian Vassen: Bibliographie Heiner Müller (Kristin Schulz) 217
silKe HorstKotte, leonHard Herrmann (Hrsg.): Poetiken der Gegenwart. Deutschsprachi-ge Romane nach 2000 (Annika Differding) 220
georgina Paul (Hrsg.): An Odyssey for Our Time. Barbara Köhler’s „Niemands Frau“ (Kim Holtmann, Uta Caroline Sommer) 222
siegFried ulBrecHt, edgar Platen (Hrsg.): Peter Härtling (Burckhard Dücker) 223
Inhaltsverzeichnis
7
nicolas Berg, dieter BurdorF (Hrsg.): Text-gelehrte. Literaturwissenschaft und literarisches Wissen im Umkreis der Kritischen Theorie (Michael Kämper-van den Boogaart) 225
alexander Košenina (Hrsg.): Kriminalfall-geschichten (Frank Wessels) 227
natalie BinczeK, till demBecK, Jörgen scHäFer (Hrsg.): Handbuch Medien der Litera-tur (Burkhardt Wolf) 229
marcus willand: Lesermodelle und Lesertheo-rien. Historische und systematische Perspektiven (Adrian Brauneis) 232
VeroniKa wieser, cHristian zolles, catHe-rine FeiK, martin zolles, leoPold scHlön-dorFF (Hrsg.): Abendländische Apokalyptik. Kompendium zur Genealogie der Endzeit (Solan-ge Landau) 235
Informationen
Scherer-Preis 2014 verliehen 238
Eingegangene Literatur 238
Inhaltsverzeichnis
170
Konferenzberichte
Umbriferi prefazi: Die Wiederentdeckung des Schattens in Mittelalter und Renaissance (Interdisziplinäre Tagung in Göttingen v. 3.–5.7.2014)
Unter dem Motto Umbriferi prefazi veranstalteten FranzisKa meier (Göttingen), BJörn reicH (Ber-lin) und cHristoPH scHanze (Gießen), im Rah-men des von Franziska Meier etablierten Dante-Forums, eine Tagung zur Wiederentdeckung des Schattens vom 12.–16. Jahrhundert. Das titelgebende Zitat aus Dantes Paradiso (30. Gesang) umschreibt einen zentralen Gedanken der Tagung: die „Voran-kündigung des göttlichen Lichts“, da Dante noch nicht bereit war, das wahre Licht zu erblicken. Der Schatten ist also etwas von Absenz Gekennzeichne-tes. In diesem Sinne waren die Beiträge der Tagung als erste „Probebohrungen“ zum Thema ,Schatten‘ zu verstehen, die den Schatten aus inter disziplinärer Perspektive und unter verschiedenen thematisch gebündelten Gesichtspunkten behandelten.
Nach einer Einführung der Veranstalter wur-den in der ersten Sektion zunächst Annäherungen an die Thematik vorgenommen. cHristoPH wag-ner (Regensburg) versuchte, den Schatten anhand der Porträtmalerei des 15. und 16. Jahrhunderts als polyvalente Erscheinung zu fassen. Er beschrieb das Phänomen als Zeichen einer anthropologischen Entwicklung hin zur Selbsterkenntnis (umbra et potentia), als visuelle Metapher und wirkungsäs-thetisches Medium. Daran schloss die Musikwis-senschaftlerin nicole scHwindt (Trossingen) an und erläuterte die „hörbare“ Transponierung des Schattenmotivs bei Monteverdis vertonter Insze-nierung des Orpheus-Mythos in eine tiefe Bass-linie. Ihr zufolge besteht eine neurologisch nach-weisbare Synästhesie zwischen dem räumlichen Verorten von Tönen im Gehirn und dem visuellen Helligkeitsgrad der Töne, die im 15. Jahrhundert erstmals dazu benutzt wurde, die ‚Schatten‘ der Dunkelheit durch tiefe Töne auszudrücken. Der Romanist Kai nonnenmacHer (Regensburg) verband in seinem Vortrag Schrift und Bild, indem er den „Caravaggio of Poetry“, Torquato Tasso, und dessen Einsatz des tenebrismo untersuchte. Tassos Stilistik sei als „chiaroscuro der Rhetorik“
interpretierbar, da Tasso durch die Schattenmeta-pher eine dramatische Steigerung erreiche.
Es folgte die Sektion „Schatten-Bilder“ mit kunst-historischen Beiträgen von gerd micHeluzzi (Wien) und sören FiscHer (Dresden/Kamenz), die sich mit dem Schatten-Umgang italienischer Freskokünstler auseinandersetzten. Micheluzzi wies darauf hin, dass nicht in jeder Epoche der Kunstge-schichte der Schlagschatten inszeniert wurde. An-hand der Kirche Santa Croce eröffnete er die Prä-missen für die Durchsetzung eben dieses Schattens in der Wandmalerei. Beide Vorträge zeigten anhand der italienischen Wandmalerei aus dem Trecento bzw. Cinquecento, dass der Schatten als Medium des Übergangs von Realität zu Fiktion fungiert.
Die nächste Sektion hinterfragte den Schatten als Medium der Erkenntnis. Eröffnet wurde die Reihe mit dem Beitrag der Kunsthistorikerin ul-riKe Kern (Frankfurt a. M.). Wie in der vorigen Sektion, so stellte auch sie die Illusionskraft des Schattens in den Vordergrund. Ausgehend von Pla-tons Höhlengleichnis interpretierte sie den Künstler als Produzenten des Schattens und damit als Er-zeu ger von Täuschung, was sie am Beispiel des nie derländischen Malers und Neoplatonisten Ka-rel van Mander ausdifferenzierte. In einer anthro-pologischen, erzähl- und bildtheoretischen Analyse stellte matteo Burioni (München) drei Aspekte des Schattens bei Vasari dar: Bewusstwerden der eigenen Vergänglichkeit, initia pictura bzw. di-segnio und Tugendabglanz. Die Introspektion, die Christoph Wagner bereits thematisierte, scheint auch hier, bei Vasari, in der Bewusstwerdung der eige-nen Vergänglichkeit, mithin der Selbsterkenntnis, auf. An diese epistemische Funktion des Schattens knüpfte der Vortrag von sergius Kodera (Wien/St. Pölten) an und untersuchte kunstphilo sophisch Giordano Brunos Sicht auf den Schatten, der die-sen als „Spur“ (vestigio) des Lichts und der Erkennt-nis interpretiert und so aufwertet: umbra est nun-cius rerum – der Schatten ist eine Ahnung der Sache.
© Peter Lang AG Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXV (2015), H. 1, S. 170–183
171Umbriferi prefazi: Die Wiederentdeckung des Schattens in Mittelalter und Renaissance
Die folgende Sektion betrachtete den Schatten aus der Sicht der Lyrik. susanne Friede (Kla-genfurt) zeigte in einem Beitrag zu Michelangelos Rime heuristisch die verwendete Schattenkonzep-tion, die insgesamt ambivalent zu bewerten sei. Die Romanistin mira mocan (Rom) untersuch-te aus bedeutungs- und kulturgeschichtlicher Per-spektive den Schatten als Symbol und Metapher der schöpferischen Macht der Imagination und der Dichtung. Auch hier stand der Schatten im ‚Verdacht‘, eine Schnittstelle zwischen Realität und Täuschung zu markieren. Den Abschluss dieser und zugleich den Bogen zur folgenden Sek-tion bildete mattHias KircHHoFFs (Stuttgart) Betrachtung des Schattens im Werk Heinrichs von Morungen, dem mittelhochdeutschen ‚Dich-ter des Lichts‘. Der Schatten fungiert hier als Me-tapher zur Veranschaulichung des Umgangs des Sängers mit der strahlenden Herrlichkeit der vrouwe und als trennendes Element zwischen Sänger und Dame.
Daran schloss der motivgeschichtliche Beitrag von gesine mierKe (Chemnitz) und cHristoPH scHanze (Gießen) an, der den Auftakt zur Sek-tion „Der Schatten im Roman“ bildete. Sie be-schäftigten sich mit dem Motiv des Schattens in Kombination mit dem des Baumes in mittelhoch-deutschen Romanen wie dem Wigalois, dem Ro-landslied und dem Parzival. Das Phänomen habe sowohl eine raumkonstituierende als auch eine (göttliche) Schutzfunktion und verdeutliche be-sonders im Parzival den Schritt des Protagonisten zur Erkenntnis. Der Schatten hat die Funktion eines liminalen Übergangsraums, dient als natür-liche und topische Grenze, ist zeitlich enthoben und stellt einen ‚Merkpunkt‘ zur Strukturierung der Handlung dar. maría ximena ordóñez (Göttingen) verlegte den Fokus ins 17. Jahrhun-dert und untersuchte die Veränderung der Licht-regie in Cervantes Don Quixote, die mit der Ana-gnorisis des Helden vom Positiven zum Negativen wechselt. Daran anknüpfend erweiterte zaneta samBunJaK (Zadar) die Perspektive auf die kroa-tische Renaissance-Dichtung, indem sie Petar Zoranícs Roman Planine im Hinblick auf seine Schattenmotivik untersuchte. Der Schatten steht hier für eine visuelle Halluzination im Sinne Pla-tons: eine Verstellung der tatsächlichen Wahrheit.
Das nächste Panel widmete sich der Frage „Der Schatten der Transzendenz?“. anJa BecKer
(München) betrachtete den Schatten des Heiligen Geistes, der unter Rückgriff auf die Verkündi-gungsszene etwa in Pfingstsonntagspredigten thematisiert wird. Als Schatten der Transzendenz gewährt er Schutz, heilt und ermöglicht Erkennt-nis. Heilende Funktion hat der Schatten auch in der Kunst Massacios, wie im Beitrag von Jasmin mersmann (Berlin) deutlich wurde.
Daran schloss die Sektion zur Korrespondenz von Schatten und Spiegel an. rené wetzel (Genf) analysierte anhand des Tristan Wahrnehmungs- und Erkenntniszusammenhänge der Schatten- und Spiegelmotivik. Der Schatten (mhd. auch schate für das Spiegelbild) ist Mittel der Manipu-lation und des Schutzes, aber auch raumkonsti-tuierendes Element. Der Kunsthistoriker eric Hold (Paris) untersuchte die Koinzidenz von Spiegelung und Schatten in Kunstwerken von Jan van Eyk und Hieronymus Bosch, in denen durch ein dezidiertes Schatten- und Lichtspiel die Bild-grenze zum Rezipienten aufgeweicht wird.
Es folgte die abschließende Sektion „Ausblicke“. Pia claudia doering (Münster) untersuchte Jean Racines Tragödie Phèdre und Racines ethi-sche und epistemologische Aufladung von Schat-ten, die besonders zur politischen Kritik genutzt wird. Den Abschluss der Tagung bildete ein Vor-trag von almut nicKel (Kassel) zu Jakob Böhmes Licht- und Dunkelheitssymbolik, mit dem sie auf die weitere Entwicklung des Schattens zu Beginn des 17. Jahrhunderts aufmerksam machte.
Als Fazit der Tagung lässt sich festhalten, dass der Schatten – gerade in der breiten interdisziplinä-ren Perspektive – im Zeitraum von 1200 bis nach 1600 eine tendenziell positive Umcodierung er-fährt: Die ‚Wiederentdeckung‘ geht mit einer Re-Seman ti sierung einher. Der Schatten dient als Metapher für (Selbst-)Erkenntnis sowohl in spiri-tueller wie auch in geistiger Hinsicht, als Schutz vor realer und transzendenter Gefahr, als raum-konstituierendes Element und damit als Grenz- und Übergangmarkierung – und nicht zuletzt als Symbol für Heiligkeit und Wundertaten.
Katharina WimmerEberhard Karls Universität TübingenDeutsches SeminarWilhelmstr. 50D–72074 Tübingen<[email protected]>
© Peter Lang AG Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXV (2015), H. 1, S. 170–183
172 Konferenzberichte
Literarische Öffentlichkeit im mittleren 19. Jahrhundert. Vergessene Konstellationen lite-rarischer Kommunikation zwischen 1840 und 1885 (Internationale Tagung in Göttingen v. 3.–5.4.2014)
In der Rückschau auf die Anfänge der jungdeut-schen Poeten der Jetztzeit klagte der demokratisch gesinnte Literatur- und Kulturhistoriker Johannes Scherr: „[W]ir Deutsche haben kein anderes öf-fentliches Leben als das der Literatur“1. Was sich aus Scherrs Sicht Mitte der 1840er Jahre noch als Mangel darstellt, wendet der nachrevolutionäre programmatische Realismus der Zeitschrift Die Grenzboten einige Jahre später ins Positive, wenn die neuen Herausgeber Gustav Freytag und Julian Schmidt bei der Übernahme des Blattes die ‚Ver-senkung der Literatur ins (zuvor verarmte) öffent-liche Leben‘ zum Maßstab ihrer Literaturkritik erklären und zugleich den integrativen Anspruch auf Gesamtreflexion der „wichtigsten politi schen, socialen und künstlerischen Erscheinungen“ der Gegenwart formulieren.2
Diese Konstellation einer literarisch-politi-schen Öffentlichkeit der Jahrhundertmitte ver-weist auf die zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig vollzogene funktionale Trennung bei-der Bereiche und die diskursübergreifend-inte-grierende Anlage realistischer Programme und Öffentlichkeitskonzepte – eine Diagnose, die den Ausgangspunkt jener Überlegungen bildete, mit denen KatJa mellmann (Göttingen) in die von ihr zusammen mit JesKo reiling (Bern) organi-sierte Tagung einführte. Mellmann charakteri-sierte das bürgerliche Literatursystem der Jahre zwischen 1840 und 1885 als eine sich im Wandel befindliche literarische Öffentlichkeit, die sich – entgegen der klassischen sozialgeschichtlich-sys-temtheoretischen Sicht auf die Epoche – gerade noch nicht durch eine abgeschlossene Differen-zierung gesellschaftlicher Teilbereiche auszeich-ne, wie sie mit dem Strukturwandel Ende des Jahrhunderts einhergehe, der völlig eigenständige Kommunikationsbereiche hervorgebracht habe. Vielmehr sei in dieser Phase eine sich als zusam-menhängende Einheit verstehende kulturräsonie-rende Öffentlichkeit zu beobachten, innerhalb derer die Diskurse über Politik, Philosophie und Literatur z. T. noch eng miteinander verknüpft seien und etwa mittels eines weiten Literatur-begriffs gesamtgesellschaftliche Deutungs- sowie
Sinnbildungskompetenz proklamiert werde. So wie sich die wichtigsten Kulturzeitschriften in diesem Sinne auch als politische Organe begriffen hätten, gehe die ein breites Spektrum umfassende realistische Erzählliteratur weder in einer funktio- nalistischen oder genredifferenzierenden Klassi-fikation auf noch sei sie losgelöst von der media-len Bedingtheit ihrer Entstehung und Publikation in einem Feld „exoterisch-partizipativer Massen-kommunikation“ zu denken.
Im Fokus der Tagung standen entsprechend die medialen, ökonomischen sowie distributiona-len Konstellationen und Bedingungen der Litera-tur einer ‚langen Jahrhundertmitte‘, die ebenso wie einige ihrer zeitgenössisch hochpopulären Repräsentant(inn)en im Zuge einer am Paradig-ma der Kunstautonomie erfolgten Kanonisierung vergessen bzw. verdrängt wurden.
Einen Blick auf ein tatsächlich gänzlich ver-gessenes, ja weithin noch unentdecktes Gebiet bot Holger Böning (Bremen), der aus der Arbeit an dem von ihm mitherausgegebenen biobibliogra-phischen Handbuch zur Volksaufklärung (Stutt-gart/Bad Cannstatt 1990 ff.) berichtete und nach-zeichnete, in welcher kaum zu überschauenden Breite und Kontinuität die bäuerlich-ländliche Epik (v. a. in Form von Dorfgeschichten und Bauern-romanen) noch über das gesamte 19. Jahrhundert vom Fortwirken der volksaufklärerischen Poetik geprägt war. Die mitunter selbstreferen tiell auf ihr ästhetisches Eigenrecht verweisenden Schwarz-wälder Dorfgeschichten Berthold Auerbachs stellen demgegenüber eine Ausnahme dar.
Für das jüngst – ähnlich wie im Fall von Auer-bach – wieder gestiegene Interesse der Forschung an Paul Heyse zeichnet nicht zuletzt walter HettcHe (München) verantwortlich. Anhand dreier Fallstudien zu den Publikationsstrategien Heyses (im Kontext der Debatten um Antisemi-tismus und Frauenemanzipation sowie seiner Nachdichtungen aus dem Italienischen) profilier-te Hettche den sonst gemeinhin als ziemlich an-gejahrt geltenden Nobelpreisträger als umsichtig-geschickt agierenden Akteur auf dem modernen Literaturmarkt und als Autor von enormem so zial-
© Peter Lang AG Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXV (2015), H. 1, S. 170–183
173Literarische Öffentlichkeit im mittleren 19. Jahrhundert
geschichtlichem Erkenntniswert. Gleiches gilt für W. F. A. Zimmermann – ein Pseudonym, hinter dem sich offenbar der Populärwissenschaftler Carl Gottfried Wilhelm Vollmer verbirgt, über den die Forschung ungeachtet seines zeit genössisch großen Erfolgs allerdings kaum etwas weiß. Des-sen Naturwissenschaftliche Romane stellte gert VonHoFF (Exeter) gleichsam mitten aus dem Ent-deckungsprozess vor. Für diese sei das Nebenein-ander verschiedener Wissensbereiche kennzeich-nend. Die Texte seien damit als Gegen entwurf zum programmatischen Grenz boten-Realismus zu lesen, der sich solcher polyphon-diskursiven Of-fenheit ebenso versperrt habe wie der Auseinan-dersetzung mit den Naturwissenschaften.
Was für Schriftsteller wie den Grenzboten-Herausgeber Gustav Freytag und seine männli-chen Autorenkollegen stets mehr behauptet denn belegt wurde, wies lynne tatlocK (St. Louis/MO) detailliert am Beispiel der Rezeption von Charlotte Brontës Jane Eyre für die weiblichen deutschen Populärschriftstellerinnen (z. B. Euge-nie Marlitt) nach – nämlich den Import, kulturel-len Transfer sowie die umfängliche Adaptation angelsächsischer Vorbilder, die in diesem konkre-ten Fall von deutlich kenntlich gemachten Anleh-nungen und Bearbeitungen bis zu ungekenn-zeichneten Übereinstimmungen in Textanlage, Figurentableau und Inhalt reichen.
Den weiblichen Prosaistinnen der zweiten Jahrhunderthälfte widmete sich auch der Vortrag von alice HiPP (Karlsruhe), die die statistische Repräsentanz weiblicher Autorschaft in Die Gar-tenlaube, Westermanns Monatsheften und der Deutschen Rundschau untersuchte. Im autopsier-ten Zeitraum von 1871–1891 habe die Präsenz von Autorinnen in allen drei Periodika insgesamt kontinuierlich zugenommen. Mit Ausnahme der Deutschen Rundschau, für die dies erst nach 1890 gelte, gehe damit eine thematische Öffnung der Zeitschriften für Fragen der Frauenemanzipation einher. Die Gartenlaube bemühte sich nach ihren Erfolgen u. a. mit Eugenie Marlitt oder ‚E. Wer-ner‘ [d. i. Elisabeth Bürstenbinder] am intensivs-ten um das Anwerben neuer Autorinnen und ge-nerierte diese sogar aus der eigenen Leserschaft.
Mit der Veröffentlichung von Gottfried Kellers Das Sinngedicht in der Deutschen Rundschau (Ja-nuar–Mai 1881) beschäftigte sich daniela gretz (Bochum). Sie deutete Kellers Zyklus vor dem
Hintergrund des spezifischen Profils der Rund-schau als Medienexperiment im ‚Experimentier-feld‘ Zeitschrift, mit dem Keller etwa Bezug neh-me auf andere zuvor in der Deutschen Rundschau veröffentlichte Texte. So sei sein Sinngedicht z. B. als kommentierender Beitrag zu den Rundschau-Debatten um Monismus und Evolutionstheorie zu lesen. Wie Gretz sprach sich auch manuela gün-ter (Köln) dafür aus, literarische Veröffentlichun-gen immer auch von ihrem medialen Umfeld, von ihren Kon- und Kotexten zu denken. In diesem Verständnis verfolgte sie – ausgehend von seiner Popularität im 19. Jahrhundert – Schillers Publi-kations- und Medienpolitik u. a. am Beispiel seiner Jungfrau von Orleans, die in Ungers Kalender auf das Jahr 1802 erschien. Als ‚Kalendergeschichte‘ betrachtet, die mit ‚dem Wunderbaren‘ das Kalen-darische in den Kalender zurückführe und diesen an das klassizistische Kunstprogramm an binde, stehe das Drama in diesem Veröffentlichungskon-text paradigmatisch für die Wechselbeziehungen zwischen Literatur und populären Medien im bür-gerlichen Zeitalter.
Mit dem Regensburger Marienkalender, der 1879 eine Auflage von fast 400.000 Exemplaren erreichte, führte silVia serena tscHoPP (Augs-burg) ein weiteres vergessenes Massenmedium in die Diskussion ein. Indem sie den Kalender aus dem Spannungsfeld zwischen konsequenter religiö ser Überformung und traditioneller Erbauungs funk-tion einerseits sowie ökonomisch-marktstrategi-schen Innovationen und zeitgemäßer konfessions-politischer Positionierung andererseits erklärte, plausibilisierte sie nicht nur den Erfolg des Me-diums, sondern stellte den Anschluss an eine ge-schichtswissenschaftliche Forschung her, die als einst genuin protestantische Zunft in den vergan-genen Jahren ein differenziertes Bild des Katholi-zismus zwischen ultramontaner Ausrichtung und modernen Frömmigkeitspraktiken im „zweiten konfessionellen Zeitalter“ (Olaf Blaschke3) ge-zeichnet hat.
Auf konsequente Historisierung läuft auch der Ansatz hinaus, den steFan scHerer (Karlsruhe) zur Abgrenzung von Feuilleton und Essay in den periodischen Printmedien des 19. Jahrhunderts ent-warf. Anstelle einer typologischen oder essentia-listischen Wesensbestimmung plädierte Scherer für eine funktionsgeschichtliche Trennung im Sin-ne eines gestuften Systems von Wissensforma tio-
© Peter Lang AG Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXV (2015), H. 1, S. 170–183
174 Konferenzberichte
nen. Der aus der Publizistik bürgerlicher Revuen wie der Deutschen Rundschau geborene Essay er-schließe den intermediären Raum zwischen Kunst und Wissenschaften und verspreche durch die Ent-spezialisierung disziplinären Wissens die Lösung eines funktionalen Defizits für den Umgang mit neuem Wissen. Demgegenüber fungiere das Feuil-le ton als Interdiskurs in der Zeitung, als zentrale Um-schaltstelle zwischen Tagesaktualität und Essay.
Die (Massen-)Medien als entscheidende Agen-ten und Institutionen der literarischen Öffentlich-keit im mittleren 19. Jahrhundert bildeten damit ein zentrales Thema der Tagung. Den allgemeinen Veränderungen des literarischen Marktes wandte sich dagegen martina zeroVniK (Wien) in Form der erfolgreichen Reiheneditionen zu. Sie ver - ortete diese beim bürgerlichen Lesepublikum zu-nehmend beliebten Publikationsformen zwischen Kunst, Kommerz und typischen Merkmalen einer sich entwickelnden Kulturindustrie, die eine Stan-dardisierung der Form und des ästhetischen Ma-terials nach sich gezogen habe.
Die Transformationsprozesse des Literatur-markts von der Mitte des 19. bis hinein ins 20. Jahrhundert stellte cHristine Haug (Mün-chen) mit Blick auf den Bedeutungszuwachs der buchhändlerischen Nebenmärkte dar. Vor allem am Beispiel der Geschichte des Bücherverkaufs im Warenhaus Wertheim umriss Haug das Panorama juristisch-ökonomischer Aspekte und Bedingun-gen eines Buchmarkts im Umbruch der Moderne. So standen die neuen Formen der Produktpräsenta-tion in den Warenhäusern, die das Buch stapelwei-se „zwischen Fisch und Käse“ verfügbar machten, bereits den zeitgenössischen Mahnern als versinn-bildlichter Bedeutungsverlust und Ökonomisie-rungszuwachs des Buchs als Ware unter anderen.
Einer Gattung, die seit diesen Entwicklungen kontinuierlich an Popularität eingebüßt hat und
im Warenhaus – als Ort schnellen Warenum-schlags durch bewusste Ausschaltung schlecht verkäuflicher Literatur – heute kaum mehr anzu-treffen ist, nahm sich niKolas immer (Trier) an. Er profilierte die Erinnerungslyrik als eine für das 19. Jahrhundert charakteristische lyrische Praxis und bestimmte neben deren typologischen Er-scheinungsformen auch das Verhältnis zur jüngst breiter diskutierten Geschichtslyrik. Dass die oft konventionelle und schematische Form der Erin-nerungslyrik zwar kurzfristig der Memorialfunk-tion förderlich ist, im Prozess der Kanonisierung aber wesentlich ihr Vergessen – und damit der von ihr erinnerten Gegenstände – bedingt, erwies sich als gelungene Abschlusspointe einer Tagung, die sich den vergessenen und vernachlässigten Konstellationen dieser Zeit widmete und vom schematischen Blick auf die Epoche entschieden abwich.
Eine Publikation der Beiträge ist geplant.
Anmerkungen
1 J[ohannes] Scherr: Poeten der Jetztzeit in Briefen an eine Frau, Stuttgart 1844, S. 124.
2 Julian Schmidt, Gustav Freytag: Den Lesern der Grenzboten. In: Die Grenzboten 7 (1848), II. Se-mester, III. Band, S. 1–4, hier S. 2.
3 Vgl. Olaf Blaschke: Der „Dämon des Konfessiona-lismus“. Einführende Überlegungen. In: Ders. (Hrsg.): Konfessionen im Konflikt. Deutschland zwischen 1800 und 1970: ein zweites konfessionel-les Zeitalter, Göttingen 2002, S. 13–69.
Philipp BöttcherUniversität GöttingenSeminar für Deutsche PhilologieKäte-Hamburger-Weg 3D–37073 Göttingen<[email protected]>
Geist im Buch: Historische Formen und Funktionen des Buchs in den Geistes wissenschaften (Arbeitsgespräch in Berlin v. 3.–5.4.2014)
Wehmütig wird Geisteswissenschaftler(inne)n heute zumute, wenn sie auf das „Goldene Zeit-alter der Theorie“ der 1960er Jahre und seine Er-folgsbücher zurückblicken. Einflussreiche Titel
erschienen in kurzer Folge, z. B. 1962 Titel von Austin, Popper, Habermas, Strauss oder 1966 von Foucault, Greimas, Derrida, Barthes… Zurück bleibt heute ein „Traum von einem Fachbuch, das
© Peter Lang AG Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXV (2015), H. 1, S. 170–183
175Historische Formen und Funktionen des Buchs in den Geistes wissenschaften
in allen umliegenden Disziplinen wahrgenom-men wird und eine breite Öffentlichkeit erreicht“ (carlos sPoerHase). Er löse eine Art „Phan-tomschmerz“ aus, der einen beachtenswerten Teil des gegenwärtigen Krisenempfindens im Bereich der akademischen Buchpublikation ausmache. Zudem habe er eine paradoxe Folge – einen „Mikro boom“: Immer häufiger erscheinen geis-teswissenschaftliche Dissertationen als hochwer-tig ausgestattete Verlagspublikationen – selbstver-ständlich hochsubventioniert. Sie erwecken den unzutreffenden Eindruck, nicht ein kleiner Spe-zia listenkreis, sondern ein breites Publikum sei angesprochen. Es handelt sich mit anderen Wor-ten um eine ‚Scheinblüte‘. Sie betrifft keineswegs das gesamte Feld des ‚academic publishing‘, das ein nach Regeln, Normen und Wertungen höchst ausdifferenziertes und überdies bislang viel zu we-nig beforschtes Gebiet ist. In Deutschland beste-he derzeit ein auffallendes Missverhältnis von Klage und Wissen über die akademische Buch-markt-Situation (casPar HirscHi). Genaues Hin sehen und insbesondere der Einbezug buch-wissenschaftlicher Forschung und Vorarbeit wa-ren daher Hauptanliegen der Berliner Arbeitsta-gung, die von casPar HirscHi (St. Gallen) und carlos sPoerHase (Berlin) veranstaltet sowie von der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, der Waldemar-Bonsels-Stiftung, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Univer-sität St. Gallen gefördert wurde.
Der buchwissenschaftliche Fokus kann als eine der Folgen des ‚material turn‘ aufgefasst werden, der nicht nur Literaturwissenschaftler unter neuen Fragestellungen verstärkt in die Archive und zu buchwissenschaftlichen Exkursen zieht. Er erwies sich beim Berliner Arbeitsgespräch als ebenfalls ertragreich für die Wissenschafts- und Fachge-schichte. Konkretisiert wurde hier, inwiefern auch Theorie(-geschichte) materiale Aspekte und Be-dingungen hat, die sich an Buchformaten und -reihen, Verlagsprofilen und bestimmten medialen Konjunkturen verdeutlichen lassen. In fünf Sek-tionen („Das Buch als kulturelles und kommer-zielles Gut“, „Das Bild im geisteswissenschaft-lichen Buch“, „Handbücher und Lehrbücher“, „Das gelehrte Buch in der frühen Neuzeit“, „The-orie und Taschenbuch“) wurde nicht das Buch in den Geistes wissenschaften abgehandelt, sondern ein weites Spektrum des Themenfeldes eröffnet.
Stellenweise trat allerdings nicht beabsichtigte Buchnostalgie und Emotionalität in der Diskus-sion auf, so im Auftakt-Vortrag, den micHael Hagner (Zürich) „mit einem kurzen, leiden-schaftlichen Plädoyer für das gedruckte Buch“ beendete. Vorausgegangen war die These, häufig fungiere derzeit Buchkritik als Kulturkritik, aller-dings nicht aus einer rückwärtsgewandten Sehn-sucht nach dem Buch, sondern aufgrund einer angeblichen Rivalität: Die Buchpublikation hem-me die Durchsetzung eines geforderten vollstän-dig digitalen Zeitalters. Es sei weit sinnvoller, so Hagner, Buch- und digitale Wissenskultur kom-plementär aufzufassen und einzusetzen. dieter tHomä (St. Gallen) verstärkte das Pathos, indem er für eine „mehr kantische“ Buchkritik votierte, die den schmerzhaft-schönen Doppelcharakter des Buches betone, die positiv wie negativ auffass-bare „Weltferne des Buches“.
daVid oels (Mainz) (Geist im Sachbuch? Das schwierige Verhältnis der Wissenschaft zu ihrer Popularisierung) verdeutlichte an renommierten Sachbuchreihen aus den ersten zwei Dritteln des 20. Jahrhunderts, welche konkreten Umsetzun-gen der (definitorisch eigentlich problematischen) Begriffe ,Sachbuch‘ und ,Popularisierung‘ auftra-ten. Zur Rolle der Geisteswissenschaften im Fä-cherspektrum dieser Reihen stellte er fest: Die Permeabilität der Geisteswissenschaft in die Ge-sellschaft sei grundsätzlich größer als in den Na-turwissenschaften. Daran meldete – zumindest in Bezug auf die Gegenwart – der Kommentator PHiliPP tHeisoHn (Zürich) Zweifel an; tatsäch-lich sinke die Bereitschaft wie das Interesse der Geisteswissenschaftler an gesellschaftlicher Teil-habe. Daher sei der „Essay“ im Sinne eines Gen-res, das diese Aufgabe wahrnehme, wiederzubele-ben. georg stanitzeK erwiderte, es sei vielmehr die Enzyklopädistik, die die eigentliche „Adresse Gesellschaft“ habe, da sie nicht forsche, sondern Forschung repräsentiere. Damit kam die Frage auf: Ist für das reale Verschwinden der populären Buchreihen ein Verschulden in den Geisteswis-senschaften zu suchen oder steckt dahinter eher die gesunkene Bereitschaft, sich nie gelesene Re-nommierwerke ins Regal zu stellen? claus zit-tel gab Wechselwirkungen zwischen fiktionaler und nichtfiktionaler Literatur zu bedenken; auf die fiktionale werde zunehmend der Anspruch, nützliches Wissen zu vermitteln, übertragen,
© Peter Lang AG Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXV (2015), H. 1, S. 170–183
176 Konferenzberichte
mög licherweise löse sie das Sachbuch in seiner Funktion ab, Wissen in möglichst angenehm les-barer Form zu popularisieren.
Beim öffentlichen Abendvortrag bot JoHn B. tHomPson (Cambridge) (Trade Publishing: Past, Present, Future) als Wissenschaftler mit jahrzehntelanger Praxiserfahrung als Verleger einen Kontrast. Etwas ernüchtert beschrieb er das transnationale Agieren der anglo-amerikanischen Publikumsverlage als äußerst einsinnig, es resul-tiere folgerichtig in einer zunehmend extremen Polarisierung des Feldes.
andreas Hauser (Zürich) (Kunst im Buch: des Geisteswissenschaftlers Kunst) stellte Tendenzen des kunstgeschichtlichen Buchs bzw. Buchmarkts zwischen Kostendruck und rasant verbesserten technologischen Möglichkeiten vor. cHristian demand ergänzte im Kommentar eine denkbare Systematik von Bild-Verwendungsarten im Kunst-buch, räumte allerdings ein, dass bis heute beim Endprodukt Kunstbuch häufig Diskrepanzen zwi-schen Absichten und Lösungen auftreten. Sie seien auf eine zu große Anzahl der an den Entscheidungs-prozessen Beteiligten zurückzuführen. In der Dis-kussion kam die Frage nach Bildlichkeit in beson-ders theorieorientierten geisteswissenschaftlichen Publikationen zur Sprache: eine große Spannbreite: von „Suhrkamps Ikonoklasmus“ bis zur Ausstel-lung von Theorie (Paul Virilio im Centre Pompidou 1976). Die Geschichte des modernen Ausstellungs-kataloges skizzierte anKe te Heesen (Berlin) (Objekte im Buch?). Kataloge zu Sonderausstellun-gen, wie sie sich im Laufe des 20. Jahrhunderts etablierten, seien nicht (mehr) Beschreibungen einer Sammlung, sondern thematische Kataloge – zugespitzt: Um 1990 wurde der Ausstellungskata-log (dessen Zeit bereits wieder abgelaufen sei) zur Monographie. Valentin groeBner (Luzern) führte im Kommentar den Sonderfall des ,Aus-stellungs-Mythos‘ L‘âme au corps vor Augen – kurz nach Eröffnung aus Sicherheitsgründen wieder geschlossen, blieb lediglich ihr Katalog.
Kalkül und Genese mehrerer publikatorischer Großprojekte rekonstruierten Hans-Harald müller und myriam ricHter (Hamburg) (Grundrisse und Handbücher. Zu einem geisteswis-senschaftlichen Publikationstypus zwischen 1880 und 1930). steFFen martus (Berlin) kommen-tierte, die beiden Jahrhundertwenden 1900 und 2000 ähnelten einander, indem beide eine Hand-
buch-Welle ausgelöst haben. Bei der näheren Charakterisierung des Buchtypus sei die Vielzahl seiner ,Binnen-Genres‘ zu differenzieren. Prinzi-piell funktionierten Textgattungen nicht mono-generisch, setzten sich vielmehr aus verschiedenen Genres zusammen. Dementsprechend seien auch die Handbücher als Vielzahl von Aktivitäten in ihrer Arrangiertheit zu analysieren.
Die Buchwissenschaftlerin ute scHneider (Mainz) legte dar, dass [D]as mathematische Lehr-buch um 1900 als soziales Konstrukt zur Positions-bestimmung der Disziplin zu verstehen sei. Es han-delte sich also nicht allein darum, einen Mangel an geeigneten Lehrbüchern für Studierende zu beheben; die neuen Lehrbücher dienten vielmehr um 1900 der Selbstvergewisserung der zwar er-folgreichen, doch vom Auseinanderbrechenden bedrohten mathematischen Disziplin. Es galt auf den Legitimationsdruck zu reagieren, zwischen der Vermittlung von hochabstraktem formalem Wissen einerseits und gegenüber reinem Arbeits-wissen für Techniker und Ingenieuren anderer-seits zu entscheiden (Position David Hilberts vs. Felix Kleins). lutz danneBerg (Berlin) ergänz-te die notwendigen Präliminarien für diese histo-rische Analyse und stellte geeignete Kriterien auf, wie ,Lehrbücher‘, die durchaus nicht immer als solche betitelt waren, eigentlich erkennbar seien.
In der vierten Sektion zeigte emma sPary (Cambridge) (Pharmacists into print: publicity and the sciences in France) Beispiele für ein ausgeklü-geltes Zusammenwirken von Druckerzeugnis, Fachwissen und Ansehen zwischen 1750–1790 (der Phase des Aufkommens erster spezialwissen-schaftlicher Zeitschriften) auf, u. a. am Beispiel der Geschäftskarten der Pariser Apotheker Hou-demart und Demachy. Ihnen gelang es, sowohl den Status ihres Berufstandes in der höfischen Gesellschaft zu heben und ihre Geschäfte anzu-bahnen als auch Rivalen zu schädigen. andrea alBrecHt (Stuttgart) hob im Kommentar die von Spary eingenommene Perspektive auf ephemere Printprodukte der Frühen Neuzeit hervor (welche seit kurzem häufiger berücksichtigt werden), die aufschlussreiche Beispiele für früh professiona-lisierte Print-Anwendungen zutage fördere, so den Fall Demachys, der souverän in den verschie-densten Formaten publizierte und das gesamte Funktionsspektrum des gelehrten Buches für sein Unter nehmen auszunutzen wusste.
© Peter Lang AG Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXV (2015), H. 1, S. 170–183
177Historische Formen und Funktionen des Buchs in den Geistes wissenschaften
Im Abendvortrag nahm ian maclean (Ox-ford) (Publishing Learned Books in Europe Before and After the Thirty Years War: the Case of Legal Humanism) als Beispielprojekte den Thesaurus Ju-ris Romani (1725–1726, hrsg. v. Everhard Otto bei Johannes van der Linden) und den Novus The-saurus Juris Civilis et Canonici (1751–1753, hrsg. v. Gerard Meerman bei Pieter de Hondt) in den Blick. Der Rechtshumanismus nach Johann Friedrich Jugler (1714–1791), der die Orientie-rung an antiken Rechtsquellen zur methodischen Grundlage erhob, hatte Editionsprojekte zur Fol-ge, die aus heutiger Sicht für die Überlieferung der antiken Texte entscheidend waren.
In der letzten Tagungssektion stellte morten Paul (Konstanz) Eine kleine Dialektik des wissen-schaftlichen Taschenbuchs vor. Buchgeschichtlich sei das Taschenbuch als relativ stabiles, institutio-nelles Phänomen herleitbar, weise das auch als Begriff kaum Merkmalseinheit auf und habe rein material betrachtet im 19. Jahrhundert bereits vorgelegen. Entscheidend für das Format sei der Reihencharakter gewesen, der das ,Gesicht‘ eines Programmes prägte. Prestige erwies sich als er-zeugbar, indem in eine Reihe ausgewählte Klassi-ker einbezogen wurden, ebenso Aktualität, indem ,Theorie-Moden‘ als Übersetzungen internatio-naler Titel aufgenommen wurden. Fazit: Die ‚Ar-mut‘ des Taschenbuchs passe eigentlich zur Rolle der Geisteswissenschaften. Der Kommentar von alexander scHmitz ergänzte Beispiele für ,Er-folg durch Abschottung‘, so die Gruppe Poetik und Hermeneutik, deren Erfolgsgeschichte aus der Isoliertheit ihrer Fragestellung (Literaturtheorie statt Literaturwissenschaft) abzuleiten sei. Dieses dezidierte ‚Theorie-Kalkül‘ ist seit kurzem im Briefwechsel Hans Blumenberg – Jacob Taubes 1961–1981 nachlesbar (Berlin 2013). Vom Aspekt einer Gegenkultur ausgehend, stellte dieter tHomä die Rede vom ,geisteswissenschaftlichen Taschenbuch‘ in Frage, da die gemeinten Autoren vieler dieser Erfolgsbände eigentlich an den diszi-plinären Rändern stehen, von Fachverlagen zu-meist abgelehnt wurden und hinsichtlich ihrer disziplinären Selbstzuordnung gebrochen seien (z. B. Koselleck). andreas Hauser unterstrich, 68er-Intellektuelle verfolgten einen Gegentraum einer „Suhrkampkultur“, wollten keine Geistes-wis senschaftler, höchstens Geistestheoretiker sein. Zudem sei es eine Generationenfrage gewesen:
Taschenbücher gaben den Vertretern der jüngeren Generation wie Blumenberg ein „Dissidentenge-fühl“, also gehe es dezidiert um „neuen Geist im Taschenbuch“, der gegen die als langweilig emp-fundene, akademische Disziplinen-Ordnung ge-richtet sei. PHiliPP FelscH (Berlin) sprach über Theorie im Zeitalter der Taschenbuchrevolution, über die Gestalt der Bücher des Merve-Verlags. Die „Theoriegeladenheit“ der Merve-Bücher mar-kiere das Ende bzw. eine Transformation von bür-gerlicher Gelehrsamkeit; ihre Ausstattung – be-tont grauer Karton, bewusster Verzicht auf Buchdesign – sei programmatisch gegen eine Fe-tischisierung des Buchs und Heiligsprechung sei-ner Inhalte gerichtet. Die Merve-Bücher wurden zerlegt und zum Lesen in der Gruppe verteilt, nach Felsch ein Abschied vom „Gott Buch“ als ein befreiender Akt.
In der Abschlussdiskussion räumten die Veran-stalter ein, hinsichtlich der Repliken, die kritisch pointiert angefordert worden, jedoch meist har-monisch ergänzend als Übersetzungen des Vorge-tragenen ins Tagungskonzept ausgefallen waren, sei das Tagungskonzept nicht ganz eingelöst wor-den. Bewusst habe man an einen wichtigen Ge-sichtspunkt der Erfolgsgeschichte der Geisteswis-senschaften in den 1970er Jahren – an ihre kritische Schärfe – anzuschließen versucht. Heute sei hin-gegen unklar, wie sich die Geisteswissenschaften in der Gesellschaft positionierten, „Kritik“ gelte allgemein als überholt, als ein zu naives Modell der Gesellschaftsverbesserung. Nicht allein die Bedin-gungen des akademischen Buchmarkts, so ergab sich im Ausblick, entscheiden darüber, ob eine neue Welle an Erfolgsbüchern von Geisteswissen-schaftlern erwartbar sei; abhängig sei diese auch von den Forschern selbst, nämlich davon, dass ein neuer, zeitgemäßer Modus gesellschaftlicher Ein-mischung gefunden werde.
Ausgewählte Beiträge werden 2015 in der fünf-ten Ausgabe von Kodex. Jahrbuch der Inter natio-na len Buchwissenschaftlichen Gesellschaft (Harras-sowitz Verlag) publiziert.
Claudia LöschnerUniversität StuttgartInstitut für LiteraturwissenschaftNeuere Deutsche Literatur ID–70190 Stuttgart <[email protected]>
© Peter Lang AG Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXV (2015), H. 1, S. 170–183
178 Konferenzberichte
Wissens(trans)formationen. Strategien der medialen Repräsentation und Vermittlung von Wissen (Interdisziplinäre Tagung in Passau v. 30.–31.5.2014)
In ihrer Einführung betonten die Organisatoren steFan HalFt und steFFi Krause (Passau), dass die Tagung Wissens(trans)formationen u. a. zum Ziel habe, terminologische Unschärfen um die Konzepte Wissen, Wissensgenerierung, Wissensver-arbeitung und Wissensvermittlung zu diskutieren sowie interdisziplinäre Zugänge zu überprüfen. Erarbeitet werden sollte, welche Rolle insbesonde-re die Medien bei der Wissensvermittlung und Wissenssetzung spielen. Von Interesse war zu-dem, wie Medien Wissensmengen in Abhängig-keit von ihrer sozio-ökonomischen und zeitlichen Bedingtheit rekonstruieren und rekontextualisie-ren. Eingeladen wurden Wissenschaftler aus ver-schiedenen kultur- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen, um den gestellten Fragen in vier Sek-tionen nachzugehen.
In der ersten Sektion stand die „Theoretisch-methodologische Modellierung medien- und kul-turanalytischer Praxis“ im Vordergrund. Den Eröffnungsvortrag hielt Klaus HemPFer (Berlin), der seinen Ansatz zu einer neuen Interpretations-theorie auf der Grundlage des Inferenzialismus nach Brandom vorstellte, der sich dadurch aus-zeichne, dass er einen nicht-intentionalistischen Zugang zum Verständnis von Texten anbiete: Es gehe bei der Textanalyse um das Explizitmachen impliziter Inferenzbeziehungen, und damit sei eben nicht impliziert, dass das Textinterpretation vollkommen beliebig ist. lutz Hagestedt (Ros-tock) stellte die Notwendigkeit kulturellen Wis-sens für die Textinterpretation in den Mittelpunkt; zum kulturellen Wissen gehöre auch das Wissen um die Biografie des Autors. Hagestedt verdeut-lichte, dass kulturellem Wissen bei der Textinter-pretation unterschiedliche Relevanz beigemessen werden könne. Zu differenzieren sei zwischen prominentem und diskretem kulturellem Wissen. Das Erkennen und die Setzung der Bedeutung der Relevanz des jeweiligen kulturellen Wissens für die Interpretation sei die Aufgabe des Wissen-schaftlers. Eine journalistische Perspektive brach-te Karl n. renner (Mainz) (Textsortenspezifisch präsupponiertes Vorwissen der Rezipienten) ein und zeigte, dass bei der journalistischen Wissensver-mittlung besonders Textsorten dominieren, die
einen informierenden Charakter haben. Weiter-hin diskutierte Renner, dass im angelsächsischen Kulturraum ein handlungstheoretischer Ansatz dominiere, der den Journalisten zentral setze, wo-hingegen in Deutschland eher eine systemtheore-tische Position vertreten werde, die den Journalis-mus als Ganzes im Auge habe. Beide Ansätze hätten aber blinde Flecken. Zuletzt erörterte Ren-ner das Problem, dass Journalismus nicht frei von ökonomischen Interessen sei. Hans KraH (Pas-sau) stellte das kulturelle Wissen ins Zentrum seines Vortrags darüber, wie sich epistemisches und konfiguratives Wissen zueinander verhalten. Krah exemplifizierte seinen Modellvorschlag am Wissen über den Spartaner-König Leonidas, das als epistemisches Wissen in die Semantik von Fil-men wie 300 (2007, Zack Snyder) und Der Löwe von Sparta (1962, Maté) einfließt, dort aber mo-difiziert wird und über die Rezeption als konfigu-ratives Wissen ins kulturelle Allgemeinwissen wirkt. Das inszenierte Wissen aus dem Film 300 über Leonidas kann so wieder zur Wissensreferenz über Leonidas werden.
Die zweite Sektion beschäftigte sich schwer-punktmäßig mit „konkurrierendem und konfli-gierendem Wissen und Nichtwissen“ und wurde von VolKer HoFFmann (München) eröffnet, der über die Wissensvermittlung im Lehrgedicht Die Mergelgrube von Droste-Hülshoff sprach und be-stätigte, dass das Spiel von Wissen, Nichtwissen und konfligierendem Wissen zum poetologischen Konzept der Autorin gehörte, eine Strategie, die auch aus der Novelle Die Judenbuche bekannt ist. Hoffmann verdeutlichte z. B., wie das Lyrische-Ich biblisches und naturwissenschaftliches Wis-sen der Zeit um 1840 vermengt. Hermann sot-tong (Regensburg) (Die Selbstorganisation der Ignoranz) thematisierte, wie Dogmen der Ökono-mie wie Berechenbarkeit auf das Wissen übertra-gen werden. Unternehmen wie Google betrachte-ten Wissen über das Verhalten von Kunden und dessen Generierung als wichtige Ressource, wes-halb Unmengen an Daten über die Nutzer gesam-melt und ausgewertet würden. In dem Maße, wie die Hermeneutik von technischen Produkten an-steige, falle die Autonomie des Kunden gegenüber
© Peter Lang AG Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXV (2015), H. 1, S. 170–183
179Wissens(trans)formationen
diesen Produkten. Auch die Technisierung und Vermarktung des Wissens habe zur Folge, dass der Wert des Wissens des Einzelnen ab-, die Her-meneutik der Wissensgenerierung durch Unter-nehmen wie Google aber stetig zunehme. steFFi Krause (Passau) sprach über Liebeskonzeptionen und deren Inszenierung im modernen Film und fragte nach den Konzeptionen von Erklärungs-strategien für künstliche Befruchtung und Homo-sexualität. Als Beispiel für den Diskurs um künst-liche Befruchtung diente ihr u. a. der Tatort Ohnmacht (2014, Jauch). So konnte Krause her-ausarbeiten, dass künstliche Befruchtung als ‚un-natürliches und steriles‘ Verfahren inszeniert wird, was als Grund dafür funktionalisiert werde, dass dem aus der künstlichen Befruchtung ge-zeugten Kind das Attribut ‚ontologisch böse‘ zu-zusprechen sei. micHael titzmann (Passau) (Wissen als Wissensverhinderung), Vertreter eines soziologischen Wissensbegriffs, fragte, wie die Kirche mit Wissen umgegangen ist, das ihren Dogmen entgegenstand und unterstrich, dass der theologische den wissenschaftlichen Diskurs bis ins 20. Jahrhundert dominierte und so neue Wis-sensgenerierung unterdrückt wurde. Dies ver-deutlichte Titzmann anhand des Konfliktes um ein heliozentrisches Weltbild. Er gab zudem einen Einblick in die kirchlichen Mechanismen der Wissensverhinderung, zu denen u. a. Verbote, Zensur, Erziehung oder auch körperliche Gewalt gehörten.
Die dritte Sektion „Mediale Diskursivierung von Spezialwissen: Wissensobjekte und Hybrid-wissen“ wurde von claus-micHael ort (Kiel) (Medizinisches Wissen und pikarische Diskursivie-rung in Johann Christoph Ettners Maul-Affen- Romanen [1694–1720]) eingeleitet. Ort legte dar, mit welchen poetologischen Strategien Ettner ver-suchte, medizinische Quacksalber und Maulaffen zu entlarven, um das eigene fiktionale literarische Werk, das in Teilen den Anspruch von Wissen-schaftlichkeit erhebt, gegenüber den vermeint-lichen Gauklern und medizinischen Laien zu legi timieren. Jan-oliVer decKer (Passau) be-schäftigte sich mit dem Aufklärungs- und Sitten-film der Weimarer Republik und arbeitete am Beispiel Falsche Scham (1926) heraus, dass Auf-klärungs- und Sittenfilme nicht nur die Sexuali - tät zum filmischen Thema erheben, sondern auch eine Popularisierung des Wissens über Ge-
schlechtskrankheiten bewirkten. Zudem werde impliziert, dass Geschlechtskrankheiten die bür-gerliche Familie bedrohen. Allein durch das me-dizinische Wissen des Arztes, der die Rolle eines Sozialhelfers übernimmt, kann diese bewahrt werden. In Falsche Scham wird aber auch die Rol-le des Films selbstreflexiv thematisiert. Der fiktio-nale Film kann eine zur unsittsamen Sexualität stimulierende Wirkung haben. Demgegenüber inszeniert sich der Sittenfilm mit Hilfe der Dar-stellung von medizinischem Wissen durch Trick-technik als dokumentarischer Film mit sublimie-render Wirkung. Sittenfilme tragen damit auch zur Ausdifferenzierung filmischer Gattungsfor-men bei. wolFgang luKas (Wuppertal) (Funk-tionen juristischen Wissens in der neueren Krimi-nalgeschichte. Zu Ferdinand von Schirachs „Der Fall Collini“) legte dar, dass die inszenierte Logik der Straftat von Collini mit der Logik des insze-nierten Strafprozesses isomorph ist. Wie Collinis Straftat folge auch die Strafprozessordnung einer Logik der Vergeltung. Zentrales Thema der De-tektivgeschichte ist zudem der § 50 StGB, der 1968 ‚unbemerkt‘ um Abs. 2 ergänzt wurde. Die-ser Absatz sieht vor, dass Beihilfe zum Mord ver-jähren kann. Der Fall Collini sei damit zugleich eine Kritik an der Justiz, zumal Lukas unter-streicht, dass der Urteilsspruch immer nur eine stark formalisierte Wahrheit abbildet, die in einer sprachlichen Verhandlung performativ hervorge-bracht wurde. Schirachs Kriminalgeschichte hat als mediales Ereignis zudem bewirkt, dass das Justizministerium den Paragraphen nun prüft und überarbeitet. steFan HalFt (Passau) (Reprä-sentation und Funktionalisierung naturwissen-schaftlicher Diskurse im zeitgenössischen Film) defi-nierte Wissen zunächst als kognitives und soziales Konstrukt, das in der Regel eine mediale Basis hat und semiotisch repräsentiert ist. Am Beispiel des Films The Core (2003, Amiel) zeigte Halft, wie Konzepte von Wissen, Wissenschaftler und Wis-senschaft filmisch inszeniert werden. In The Core wird veranschaulicht, dass insbesondere der ‚fehl-geleitete‘ Wissenschaftler zur Bedrohung einer natürlichen Ordnung werden kann, wenn er be-stimmte moralische und ethische Grenzen nicht beachtet. Der ‚verantwortungsbewusste‘ Wissen-schaftler wird dann zum Gegenkonzept und Re-gulativ, um die gefährdete Ordnung wieder her-zustellen. Weiterhin machte Halft deutlich, dass
© Peter Lang AG Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXV (2015), H. 1, S. 170–183
180 Konferenzberichte
Wissen auch an die medienspezifische Gestaltung gebunden ist und maßgeblich durch diese beein-flusst wird.
Die vierte Sektion „Medial konstruiertes Wis-sen als diskursive Strategie der kulturellen In-tegration“ wurde durch micHael müller (Stuttgart) (Daten, Informationen, Wissen: Die Konstruktion von Identität im digitalen Raum) er-öffnet. Müller führte aus, dass Identität für ihn immer ein narratives Konstrukt sei. Es folgte eine Erläuterung der (Teil-)Diskurse, die unseren Identitätsbegriff traditionell prägen, um dann die Faktoren hervorzuheben, die Identität im Zeital-ter digitaler Medien beeinflussen. Zu nennen sind etwa eine Potenzierung der Daten für die Fremd-narration, eine längere Konservierung des narra-tiven Wissens, ständige Reaktivierbarkeit von Information und die Vorhersage von Zukunfts-identitäten durch die computergestützte Auswer-tung von Daten über das Verhalten im digitalen Raum. Karoline Frenzel (Regensburg) (Die Interdependenz von Wissen und Werten in autobio-grafischen Erzählungen), die mit der Storytelling-Methode arbeitet, unterstrich, dass Wertewandel einen Wissenswandel voraussetze, wohingegen Werte-Koexistenz auch eine Wissens-Koexistenz bedeuten würde. Diese Thesen belegte Frenzel mit einer Studie über Mütter (2008) und mit einer Studie über Frauen in Führungspositionen (2009). marianne wünscH (Kiel) (Wissensmen-gen und Wissensvergabe in Wagners Ring des Nibe-
lungen) arbeitete heraus, dass eine Asymmetrie der Wissensverteilung innerhalb der dargestellten Welt vorliege und fragte allerdings, ob Wissen für die Prozessdynamik des Rings überhaupt eine Rolle spiele und die Götterdämmerung durch Wis-sen der Figuren hätte verhindert werden können.
Die Einzelstudien konnten insgesamt zwar überzeugen, aufgrund der interdisziplinären Zu-sam men setzung der Tagung, die durch Literatur-wissenschaftler dominiert wurde, blieben über-raschende Ergebnisse allerdings aus. In der Abschlussdiskussion einigte man sich in termino-logischer Hinsicht, dass ein adäquater Wissensbe-griff über propositionales Wissen hinausgehen müsse. Wissen sei zeit- und kulturrelativ; aus syste mischer Perspektive sei entscheidend, wer die Diskursmacht über das Wissen zu einer bestimm-ten Zeit habe. Aus sozialhistorischer Perspektive müsse überlegt werden, wer neues Wissen popu-larisiert, wie Wissensmengen diffundieren und welche Faktoren Wissenswandel beeinflussen. Diese Fragen ließen sich nur unter Berücksichti-gung einer wissenssoziologischen und wissenspsy-chologischen Sicht beantworten.
Lars BülowUniversität PassauPhilosophische FakultätPHIL 476D–94030 Passau<[email protected]>
Intentionally left blank. Raum für Notizen. Aufzeichnungsverfahren mit Arbeitsheften, Notizbüchern, Alben (Internationale Konferenz in Jerusalem v. 12.–14.5.2014)
Die von Birgit erdle (Jerusalem) und anne-gret Pelz (Wien) organisierte internationale Konferenz an der Hebräischen Universität Jerusa-lem und der Nationalbibliothek Jerusalem zum Umgang mit Notizbüchern und Alben – also ab-sichtlich leergelassenen Büchern – schließt an ein junges Forschungsinteresse an. Untersucht wurde das Notizenmachen als eine Form der Aufzeich-nung von Gegenwart aus material- und archiv-ästhetischen sowie literatur-, geschichts- und me-dienwissenschaftlicher Perspektive. Das Interesse galt sowohl dem Inhaltlichen wie auch den Tech-
niken und Praktiken des Aufzeichnens. Der Workshop-Charakter der Konferenz lud dazu ein, Beobachtungen zu sammeln und danach zu fra-gen, in welcher Sprache man über das Material, das Momentaufnahmen einer Begebenheit oder eines Gedankens widergibt, sprechen und wie man auf der Basis von Notizbüchern, Alben und Arbeitsheften wissenschaftlich verallgemeinerba-re Aussagen treffen kann.
marie luise Knott (Berlin) (Der ‚Span des Gegenwärtigen‘ und sein Kampf mit dem Nichts. Anmerkungen zu einem Heft-Eintrag von Hannah
© Peter Lang AG Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXV (2015), H. 1, S. 170–183
181Raum für Notizen. Aufzeichnungsverfahren mit Arbeitsheften, Notizbüchern, Alben
Arendt aus dem Jahr 1942) ging den frühen Auf-zeichnungen Hannah Arendts in New York nach. Sie beschäftigte sich mit einer leeren Doppelseite, deren Leere nur von dem Wort „Nebel“ unter-brochen wird. In spärlichen Notizen zeichnete Arendt in verdichteter Form Erfahrungen und Geschichten auf, immer mit dem Wissen, dass erst dort, wo das „unaufhörliche Gespräch mit sich selbst“1 Bilder und Begriffe prägt, die dem weiteren Denken und Andenken als Wegweiser dienen können, das Gespräch nicht der Vergäng-lichkeit anheimfällt. mona Körte (Greifswald) (Heim liche Wörter. Das Diktat der freien Fläche im anonymen Ghetto-Tagebuch Les Vrais Riches) hin-gegen untersuchte ein Aufzeichnungsverfahren, das mit „intentionally not left blank“ beschrieben werden kann. Das anonym verfasste Buch nach Tagen2 ist auf den Rändern und Vakatseiten in Form von mehrsprachigen Notizen verfasst. Körte argumentierte, dass das Ineinander der Bücher (Tagebuch aus dem Ghetto und Erzählband Les vrais riches) nicht als Kontingentes zu verstehen sei, sondern als Objekt begriffen werden soll, das im Zusammenspiel zum Nachdenken über Rand und Mitte, Raum und Gewalt anregt.
marianne windsBerger (Wien) (Momente totaler Gegenwart. Das Zamlbukh Oyshvits von Av-raham Levite) stellte die Frage, welche Rolle Sam-melbüchern in Momenten auseinanderbrechen-der Zusammenhänge zukommt. Sie ging von einem jiddischen Text aus, der erstmals 1946 in den Yivo-bletern u. d. T. dos zamelbukh oyshvits (das Sammelbuch Auschwitz) erschienen war. Der Text, der in immer wieder neuen Kontexten und Sprachen auftaucht, war als Vorwort zu einem ge-planten Sammelbuch, das im Konzentrations-lager Auschwitz hätte entstehen sollen, gedacht. Windsberger stellte dabei die Frage, wie das Vorwort auf das nie existierende Sammelbuch verweisen kann. Der Vortrag der Historikerin elisaBetH gallas (Jerusalem) (‚Große Mengen gestapelter Bücher‘. Aufzeichnungen aus dem Offen-bacher Depot 1946) befasste sich mit der Ge-schichte und Dokumentation des Offenbach Ar-chival Depot, in dem nach Kriegsende u. a. die von den Nationalsozialisten geraubten Buch-sammlungen jüdischer Provenienz gesammelt und zur Restitution vorbereitet wurden. Gallas rekonstruierte die kaum bekannte Geschichte des Depots anhand von Tagebuchnotizen (Gershom
Scholem) und Alben (Isaac Bencowitz). Die ein-genommene Perspektive erlaubte ihr einen Ein-blick in die Selbstwahrnehmung der beteiligten Akteure.
ute Holl (Basel) (Überstrahltes Licht und glei-ßendes Weiß. Der Raum des Film-Archivs. Trauma-tisches Kino) ging den „intentional blanks“ im Film nach und legte dar, dass sich das intendierte und insistierende Weiß eines Filmbildes nicht nur als Zeichen und Signal deuten ließe, sondern stets auch eine physische, manchmal blendende Wir-kung ins Dunkel der Projektion habe. Am Bei-spiel der Verfilmung von Schoenbergs Oper Moses und Aron (BRD 1974) zeigte Holl, dass die Regis-seure Jean-Marie Straub und Danièle Huillet mit dem leeren Frame die Frage des Bildverbotes ver-handeln.
guy miron (Jerusalem) eröffnete den zweiten Tag (From ‚Public Space‘ to ‚Space of Writing‘: Jew - ish Diarists in Nazi Germany) und legte dar, dass das Phänomen des Tagebuchschreibens als eine Reaktion auf die zunehmende Verdrängung der deutschen Juden aus dem öffentlichen Raum ver-standen werden muss, also als Rückzug in einen privaten Raum des Schreibens. Anhand zweier Biographien (Victor Klemperer, Willi Cohn) machte Miron deutlich, dass sich die Praxis des Schreibens während der Jahre veränderte und an-gesichts des sich verengenden Raumes zu einer eigentlichen Notwendigkeit wurde. tHomas as-singer (Wien) (‚Aber Mimesis ist ein Buch ohne Einleitung‘. Zwei Briefe zur hebräischen Ausgabe von Erich Auerbachs Mimesis im Martin Buber-Archiv) stellte keine persönlichen Aufzeichnun-gen, sondern den Paratext der Übersetzungen von Auerbachs Mimesis ins Zentrum seiner Überle-gungen und befasste sich mit der hebräischen Übersetzung und Edition von Auerbachs Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit der abendländischen Kul-tur (1946). Assinger warf, ausgehend von einem kontrastiven Vergleich der englischsprachigen Ju-biläumsausgabe von 2003 mit einem Vorwort von Edward Saïd und der hebräischen Ausgabe mit ihrem Vorwort von Dov Sadan (1958) Fragen nach dem Status von Mimesis als „Exilbuch“ auf, und diskutierte die Bedeutung von De- und Re-Kon-textualisierung von Literaturgeschichten durch ihre paratextuelle Rahmung.
caroline Jessen (Marbach, Jerusalem) (Jeru-salem – München. Kontinuität, Parallelität und
© Peter Lang AG Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXV (2015), H. 1, S. 170–183
182 Konferenzberichte
Bruch in einem Album Schalom Ben-Chorins) skiz-zierte die narrative Struktur in Ben-Chorins Al-bum Kritiken über mich, das 1931 beginnt und in den 1940er Jahren nur noch unregelmässige teil-weise undatierte Einträge enthält, und setzte sie in Bezug zu Ben-Chorins gescheiterter Karriere als Schriftsteller. Das Album dokumentiert die religionskritischen und literarischen Arbeiten Ben-Chorins und die Selbstinterpretation des Au-tors. Mit der Mechanisierung des Findens neuen Wissens durch Verzettelung befasste sich Karin KrautHausen (Berlin) (Entwerfen mit Kartei- und Zettelkästen. Beispiele von Wissenschaftlern und Schriftstellern im 20. Jahrhundert). Am Bei-spiel der Kartei- und Zettelkästen dreier Wissen-schaftler und Autoren erläuterte sie, dass die Ver-zettelung sowohl eine strenge Logistik der Lektüre und des Schreibens (Hans Blumenberg), eine kalkulierte Unordnung (Niklas Luhmann) oder aber eine stillgestellte, lineare Ordnung (Arno Schmidt) erzeugen kann. Auch annegret Pelz (Wien) (Roland Barthes und die Praxis des Notizenmachens) beschäftigte sich mit der Praxis des Notizenmachens und setzte sich mit Barthes’ Gedankenexperiment über die Möglichkeit eines großen Romans im Kleinen auseinander. Die ge-suchten, bewusst minderen Formen sollten annä-herungsweise an das japanische Haiku, die Joyce’sche Epiphanie und an den Tagebuchein-trag erinnern und wie die alltäglichen Praktiken des Notizenmachens das kontemporäre, fortlau-fende Leben aufzeichnen. Barthes ging es darum, die Distanz der schriftlichen Äußerung mit der Erregung der unmittelbar erlebten Gegenwart in Einklang zu bringen. inKa arroyo antezana (Jerusalem) (Aufzeichnungsverfahren aus drei aus-gewählten Nachlässen in den Central Archives for the History of the Jewish People: Archivfieber, Steck-fahnen und Gedankenfetzen bei Paul J. Diamant, Ismar Freund und Ernst G. Straus) beschloss den Konferenztag.
Walter Benjamin stand im Zentrum der ersten Hälfte des dritten Konferenztages. ursula marx und erdmut wizisla (Berlin) (Zarteste Quar-tiere. Eine Lektüre von Benjamins Jerusalemer Per-gamentheft vor dem Hintergrund aller überlieferten Notizbücher) zeigten, dass die Aufzeichnungen Benjamins nicht Vorstudien oder Fragmente auf dem Weg zum eigentlichen Werk sind, sondern Fragmente, die durchaus Fragmente bleiben kön-
nen. Vielmehr könne die Notiz als eigentlicher Prototyp von Benjamins Schreiben verstanden werden. Bei ViVian lisKa (Antwerpen, Jerusa-lem) (Unintentionally Left Out or La Place du Crime. Maurice Blanchot’s Notes on Walter Benja-min) stand die bislang kaum beachtete Affinität zwischen Benjamin und Maurice Blanchot im Mittelpunkt. Die bedeutendste Referenz zu Ben-jamin kommt in Blanchots Aufsatz Traduire (1971) zum Vorschein. Hinter diesem Text stehen unveröffentlichte Lesenotizen zu Benjamins Es-say, die Blanchots eigenen Aufsatz inspirierten. Diese Notizen können, so Liska, als eigentlichen Übergang zwischen Benjamins und seinem eige-nen Aufsatz verstanden werden.
Birgit erdle (Jerusalem) (Notizen zur Zeit-lichkeit: ausgehend von Adorno und Benjamin) frag-te nach der Zeitlichkeit der Notiz und machte deutlich, dass für Adorno die Struktur des Auf-zeichnens im Notizbuch der Forderung nach einer Schreibpraxis entspricht, die Denkbruchstücke festhält, deren Ausschnittcharakter bewahrt und sie in serieller Form anordnet, ohne dass Überblen-dungen die Bruchränder und die Lücken zwischen ihnen unkenntlich machen. Entlang photographi-scher Metaphern – Schnappschuss, Momentauf-nahme, blackout – untersuchte sie, wie Adorno und Benjamin unterschiedliche Zeitmodi einer Aufzeichnung von Gegenwart entwarfen.
Die letzten Vorträge beschäftigten sich mit den Aufzeichnungen zweier Literaten. lina Ba-roucH (Jerusalem) (Silent Territory and Echo Landscapes: Bio-Lingual Notebooks of Arie Ludwig Strauss) stellte die zweisprachigen Notizbücher des deutsch-jüdischen Dichters ins Zentrum. Diese Notizbücher enthalten sowohl einen deut-schen wie auch einen hebräischen Teil. Strauss entwarf von 1940–1946 Gedichte in beiden Spra-chen. Die Entwürfe, Notizen und Verbesserun-gen sind Zeugnis von Strauss’ zweisprachiger Schreibpraxis nach der Flucht von Deutschland nach Palästina und zeigen gleichzeitig seine Ver-bundenheit mit der deutschen Sprache und die Entwicklung seiner hebräischen Stimme. Im Ab-schlussvortrag Weisser Rückhalt Kapsel. Zum Ver-hältnis zwischen Veröffentlichtem und Aufgezeich-netem bei Elias Canetti deutete Justus FetscHer (Mannheim) die Aufzeichnungen Canettis, des-sen Werk im Wesentlichen aus einer Konfigura-tion und Transformation von Aufzeichnungen,
© Peter Lang AG Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXV (2015), H. 1, S. 170–183
183Raum für Notizen. Aufzeichnungsverfahren mit Arbeitsheften, Notizbüchern, Alben
Merkbüchern und Tagebüchern entstand, als eine besondere zweite Form seiner Autobiographie, als Protokoll und Performanz eines über Jahrzehnte fortgeschriebenen Schreib-Denkens. Fetscher stell-te Das Buch gegen den Tod 3, das Canetti nie vollendet hatte, für das aber mehre tausend Auf-zeichnungen überliefert sind, ins Zentrum seiner Überlegungen.
Die Vorträge und die Diskussionen haben die enorme Spannbreite der Materialien, Themen und Zugänge im Umgang mit Notizen und Notiz-büchern deutlich gemacht. So wurden auf der Ebene der Formen, Situationen und Konfigura-tionen die Aufzeichnungsprozesse der kleinen Formen und ihre komplexen Entstehungs- und Anordnungsverhältnisse beschrieben, untersucht und diskutiert. Die Publikation der Beiträge ist geplant.
Anmerkungen
1 Vgl. Hannah Arendt: Über die Revolution, Übers. aus dem Englischen, München 1973 (11963), S. 283.
2 Hanno Loewy, Andrzej Bodek (Hrsg.): Les Vrais Riches. Notizen am Rand. Ein Tagebuch aus dem Ghetto Łódz, Leipzig 1997.
3 Das Buch wurde posthum veröffentlicht: Elias Ca-netti: Das Buch gegen den Tod. Mit einem Nachw. v. Peter von Matt, hrsg. v. Sven Hanuschenk u. a., München 2014.
Stefanie MahrerThe Franz Rosenzweig Minerva Research CenterHebrew University of JerusalemYitzhak Rabin BuildingMount Scopus91905 JerusalemIsrael<[email protected]>
© Peter Lang AG Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXV (2015), H. 1, S. 170–183