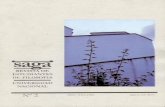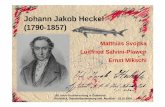Introduction to Georg Friedrich Meier’s Zuschrift an Seine Zuhörer and to Johann Nicolaus...
Transcript of Introduction to Georg Friedrich Meier’s Zuschrift an Seine Zuhörer and to Johann Nicolaus...
Forschungen und Materialien zur Universitätsgeschichte FMU
Herausgegeben von Riccardo Pozzo und Ulrich Johannes Schneider Abteilung I: Quellen zur Universitätsgeschichte Abteilung II: Forschungen zur Universitätsgeschichte
Wissenschaftlicher Beirat: Bruno Bianco (Università di Trieste) Jean-François Courtine (École Normale Supérieure, Paris) Norbert Hinske (Universität Trier) Helga Robinson-Hammerstein (Trinity College, Dublin)
Abteilung I: Quellen zur Universitätsgeschichte Band 4
!
Philosophical Academic Programs of the German Enlightenment A Literary Genre Recontextualized edited by Seung-Kee Lee, Riccardo Pozzo and Marco Sgarbi Redaction and Lectorate by Maria Cristina Dalfino and Dagmar von Wille
frommann-holzboog
Gedruckt mit der Unterstützung des Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca scientifica e tecnologica,
der Università degli Studi di Verona (PRIN 2007: Per una storia pragmatica della filosofia) und des
Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee-CNR
Bibliographische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie;
detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar
ISBN 978-3-7728-2617-7
© frommann-holzboog Verlag Stuttgart-Bad Cannstatt 2011
Satz: golden section · Klaus H. Pfeiffer, Stuttgart Druck: Offizin Chr. Scheufele, Stuttgart Einband: Litges & Dopf, Heppenheim
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTION Riccardo Pozzo: Philosophical Academic Programs of the
German Aufklärung ………………………………….. IX PHILOSOPHICAL ACADEMIC PROGRAMS Christian Thomasius, Welcher Gestalt man denen Frantzosen
in gemeinem Leben und Wandel nachahmen solle?, edited by Mario Longo
Introduction … … … … … … … 3 Text … … … … … … … … … … 13 Christian Wolff, Programma de necessitate methodi scientificæ
et genuino usu Juris Naturæ ac Gentium, edited by Ferdinando Luigi Marcolungo
Introduction … … … … … … … … 41 Text … … … … … … … … … … … 45
Joachim Georg Darjes, Anmerkungen über einige Lehrsätze
der Wolfischen Metaphysic, edited by Ferdinando Luigi Marcolungo
Introduction … … … … … … … … 67 Text … … … … … … … … … … … . 71
Georg Friedrich Meier, Zuschrift an Seine Zuhörer, worin er
Ihnen seinen Entschluß bekannt macht, ein Collegium über Locks Versuch vom Menschlichen Verstande zu halten, edited by Davide Poggi
Introduction … … … … … … … … 109 Text … … … … … … … … … … ... 115 Johann Nicolaus Tetens, Gedancken über einige Ursachen, warum in
der Metaphysik nur wenige ausgemachte Wahrheiten sind, als eine
Table of contents
VI
Einladungs-Schrift zu seinen den 13ten October auf der neuen Bützowschen Academie anzufangende Vorlesungen, edited by Davide Poggi
Introduction … … … … … … … …. 123 Text … … … … … … … … … … .. 133 Immanuel Kant, Versuch einiger Betrachtungen über den
Optimismus, edited by Marco Sgarbi Introduction … … … … … …… … … 173 Text … … … … … … … … …..… … 177 Immanuel Kant, Die falsche Spitzfindkgeit der vier syllogistischen
Figuren, edited by Marco Sgarbi Introduction … … … … … … … … .. 187 Text … … … … … … … … … …….. 193 Immanuel Kant, Versuch, den Begriff der negativen Grossen in die
Weltweisheit einzuführen, edited by Tommaso Tuppini Introduction … … … … … … … … 209 Text … … … … … … … … … … … 215 Immanuel Kant, Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen
in dem Winter-Halben Jahre von 1765-1766, edited by Tommaso Tuppini
Introduction … … … … … … … … 249 Text … … … … … … … … … ….. 253 Immanuel Kant, Von den verschiedenen Racen der Menschen,
edited by Mario Longo Introduction … … … … … … … … 265 Text … … … … … … … … … … 273 Johann Gottlieb Fichte, Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre,
edited by Paolo Giuspoli Introduction … … … … … … … …. 287 Text … … … … … … … … … … … 299 Johann Friedrich Herbart, Kurze Darstellung eines Plans zu
Table of contents
Philosophischen Vorlesungen, edited by Nazzareno Fioraso
Introduction … … … … … … … …. 343 Text … … … … … … … … … … … 347 Friedrich Eduard Beneke, Neue Grundlegung zur Metaphysik
als Programm zu seinen Vorlesungen über Logik und Metaphysik dem Druck übergeben, edited by Nazzareno Fioraso
Introduction … … … … … … … …… 357 Text … … … … … … … … … … ….. . 363 INDEX … … … … … … … …… … … … … … 389
GEORG FRIEDRICH MEIER: ZUSCHRIFT AN SEINE
ZUHÖRER, WORIN ER IHNEN SEINEN ENTSCHLUß BEKANNT MACHT, EIN COLLEGIUM ÜBER LOCKS VERSUCH VOM MENSCHLICHEN VERSTANDE ZU
HALTEN
Davide Poggi
Georg Friedrich Meier was born in Ammendorf near Halle on March 29, 1718. In his Leben Georg Friedrich Meiers (published in 1778, a biography whose redaction was requested by Meier himself),61 Samuel Gotthold Lange informs that Meier received his earliest education from his father, Gebhard Friedrich Meier, Lutheran pastor in Ammendorf and Besen. In 1729 he en-tered the Realschule of Johann Christoph Semler. Later on he studied at the Waisenhaus and at the Alma Fridericiana, the University of Halle recently founded (in 1694) by Frederick III Elector of Brandenburg, the future King Frederick I of Prussia. Meier already had a solid technical and scientific educa-tion, but he was deficient in the humanities. On this subject, Meier himself put on record in the biography written by Lange:
Ich hatte den Nachtheil, daß überhaupt die humaniora bey unserm Unterrichte we-niger getrieben wurden, daher ich das Meiste von dem, was ich davon weiß, durch meine eigene Lecture gelernt habe.62
Meier’s academic curriculum started in 1735 (although he had been taking some courses since 1732) and ended in 1739 with the Magisterpromotion. Among the professors were Martin Heinrich Otto, Alexander Gottlieb
61 Samuel Gotthold Lange, Leben Friedrich Meiers (Halle: Gebauer, 1778), 195. Other
biogaphies of Meier are: Willi Gorzny, Hans-Albrecht Koch, Ute Koch and Ange-lica Koller (eds.), Deutsches biographisches Archiv (München-London-New York-Oxford-Paris: Saur, 1986), Mf. 836, 202-228; Historische Kommission bei der Bay-erischen Akademie der Wissenschaften (ed.), Neue Deutsche Biographie (Berlin: Duncker & Humblot, 1990), vol. XVI, 649-651; Gunter Schenk, Leben und Werk des halleschen Aufklarers Georg Friedrich Meier (Halle: Hallescher Verlag, 1994); Riccardo Pozzo, Georg Friedrich Meiers ‹Vernunftlehre›: Eine historisch-systematische Untersuchung (Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-holzboog, 2000), 63-88.
62 Lange, Leben Friedrich Meiers, 30.
Davide Poggi
110
Baumgarten, Siegmund Jakob Baumgarten and Christian Benedict Michaelis. He declared:
Ich hörete anfänglich beym Prof. Otto die Logic, Metaphysic und das Ius Naturae. Nachher aber habe ich vornemlich die Philosophie von Alex. Gottlieb Bamgarten gelernt. Bey dem hörte ich die Logic, Metaphysic, Ius Naturae, die Philosophische Moral, die hebräische Grammatic, ein Collegium philologicum über den Esaias. Sonst hörte ich bey Christian Benedict Michaelis einige Collegia philologica über das alte und neue Testament. D. Siegmund Jacob Baumgarten ist mein einziger Lehrer in der Theologie gwesen. Ich habe von ihm gehört: Dogmatic, Moral, Kirchenhisto-rie, Polemic, christliche Alterthümer, Homiletic, und beständig Exegetica.63
In his monograph on Meier’s Vernunftlehre, Riccardo Pozzo has made it clear that if Martin Otto (who was clearly oriented to Wolff’s positions)64 definitely shaped the beginning of the formal education of the philosopher from Am-mendorf, he was replaced after his premature death in 1738 by Siegmund Ja-kob Baumgarten, who acted as praeses during Meier’s doctoral examination on September 30, 1739 (with a thesis titled De nonnullis abstractis mathemati-cis)65 and who committed himself to helping his protégé in starting a scientific career.66
Meier started teaching in Halle in 1739 and continued until 1746, when he became extraordinary professor (on November 4). Two years later, on Octo-ber 10, he was appointed full professor, a position he kept until 1777, the year of his death. These were very important years for Prussia and, most of all, for Halle. In 1740, in fact, the country saw the beginning of Frederick II’s ‹enlightened despotism› and Wolff was recalled to Halle (seventeen years after his dismissal and removal ordered by Frederick William I at the request of the pietist August Hermann Francke and Joachim Lange).67 63 Ibid., 33. 64 Pozzo, Georg Friedrich Meiers ‹Vernunftlehre›, 74: «Auch hier ist eine Antwort
möglich, denn zu der Zeit, als Meier philosophische Vorlesungen zu besuchen be-gann, war A.G. Baumgarten noch Privatdozent … und sowohl S.J. Baumgarten als auch C.B. Michaelis boten zwar an der Philosophischen Fakultät Veranstaltungen an, waren aber hauptamtlich Theologen. Mit Sicherheit wurde Meier zunächst von Martin Heinrich Otto unterrichtet».
65 See Lange, Leben Friedrich Meiers, 37. 66 Ibid. 67 On Wolff’s life, see Heinrich Wuttke (ed.), Christian Wolffs eigene Lebensbeschrei-
bung (Leipzig: Weidmann, 18411), in Jean École, Joseph Ehrenfried Hoffmann, Marcel Thomann, Hans Werner Arndt and Charles Anthony Corr (eds.), Christian
Georg Friedrich Meier
111!
This is the context in which to place the Zuschrift that introduced the Col-legium über Locks Versuch vom menschlichen Verstande (1754).68 In a private audience, Meier had received from Frederick II himself (who was a connois-seur of the English thinker)69 the counsel (in fact, almost an ‹order›) to offer a Collegium upon Locke’s Essay concerning Human Understanding.70 In spite of the fact that the course ended up being an isolated case, a sort of una tan-tum in Halle (Meier gave up re-offering it in the following years because of the low turnout of students),71 it was an episode that Riccardo Pozzo has noted as a turning point for the German Aufklärung:
Wolffs Gesammelte Werke, I, 10 (Hildesheim: Olms, 1980), 208. About Wolff’s role in the German Enlightenment and the controversy at the University of Halle bet-ween Lange and Wolff, see Norbert Hinske, «Wolffs Stellung in der deutschen Aufklärung», in Werner Schneiders (ed.), Christian Wolff 1679-1754: Interpretatio-nen zu seiner Philosophie und deren Wirkung: Mit einer Bibliographie der Wolff-Literatur (Hamburg: Meiner, 1983), 305-319; Bruno Bianco, «Libertà e fatalismo: Sulla polemica tra Joachim Lange e Christian Wolff», Verifiche 15 (1986), 43-89 (the paper was translated into German by Norbert Hinske: «Freiheit gegen Fata-lismus. Zu Joachim Langes Kritik an Wolff», in Norbert Hinske (ed.), Zentren der Aufklärung I: Halle. Aufklärung und Pietismus (Heidelberg: Schneiders, 1989), 111-155. About the relationship between Frederick William I, Frederick II the Great and Wolff, see Hans Droysen, «Friedrich Wilhelm I., Friedrich der Große und der Philosoph Chr. Wolff», Forschungen zur Brandenburgischen und Preußi-schen Geschichte 23 (1910), 1-34; Riccardo Pozzo, «Georg Friedrich Meier, Imma-nuel Kant und die friderizianische Universitätspolitik», Jahrbuch für Universitäts-geschichte 7 (2004), 147-167.
68 Georg Friedrich Meier, Zuschrift an Seine Zuhörer, worin er Ihnen seinen Entschluß bekannt macht, ein Collegium über Locks Versuch vom Menschlichen Verstande zu halten (Halle: Hemmerde, 1754). See Klaus Fischer, «John Locke in the German Enlightenment: An interpretation», Journal of the History of Ideas 36 (1975), 434-436; Pozzo, Georg Friedrich Meiers ‹Vernunftlehre›, 83-85, 106; Kon-stantin Pollok, «Die Locke-Rezeption in der deutschen Aufklärung. Frühe lateini-sche und deutsche Übersetzungen von Lockes Werken (1709-61)», in Konstantin Pollok (ed.), Locke in Germany: Early German Translations of John Locke, 1709-61 (Bristol: Thoemmes, 2004), vol. I, XXV.
69 On the website http://friedrich.uni-trier.de/ one can read Frederick’s works and search items through the texts. Of the term ‹Locke› one finds 34 occurrences and 14 for ‹Lock›: see Johann David Erdmann Preuss (ed.), Œuvres de Frédéric le Grand (Berlin: Decker, 1846), vol. X, 4.
70 John Locke, An Essay concerning Humane Understanding: In Four Books (Lon-don: Basset, 1690; 2nd edn., London: Churchill, 1694 «with large Additions», 3rd edn. 1695, 4th edn. 1700 ‹with large Additions›; in 1706 there would be another publication, posthumous, that includes the corrections the author made).
71 See Pozzo, Georg Friedrich Meiers ‹Vernunftlehre›, 83-85. Meier himself was quite skeptical about the opportunity of offering a course on Locke, because of the diffi-culty of purchasing his works: see Lange, Leben Friedrich Meiers, 38-39. These
Davide Poggi
112
Meier [hielt] als erster deutscher Philosoph im SS 1754 … ein Kolleg über Lockes Hauptwerk … , eine Tatsache, die entscheidende Folgen für die gesamte Quellenge-schichte der deutschen Hochaufklärung mit sich brachte.
72
For the first time, a ‹quiet subterranean force in German philosophy› emerged firmly and explicitly, namely Locke’s philosophy. The University of Halle, which had already proven itself to be ‹open› to Anglo-Saxon philosophy with Thomasius and Wolff’s presence,73 was profiling itself as the most vital center of dissemination of Lockean thought.74 It is not a coincidence at all, then, that in the same year of Meier’s course the third edition of an anonymous exposi-tion of Locke’s life and writings (Leben und Schriften des Weltberhümten und Hochgelahrten Engländers Johann Locke, which was published for the first time in Halle in 1717) was reprinted right in Halle.75
problems will be mentioned also in Meier, Zuschrift an Seine Zuhörer, worin er Ih-nen seinen Entschluß bekannt macht, ein Collegium über Locks Versuch vom Menschlichen Verstande zu halten, 12.
72 Pozzo, Georg Friedrich Meiers ‹Vernunftlehre›, 106. 73 Francis Andrew Brown, «German interest in Locke’s Essay, 1688-1800», Journal of
English and Germanic Philology 50 (1951), 477: «Under the stimulus provided by Christian Thomasius and his fellows, Halle became an early center for the diffusion of Locke’s ideas». About Locke’s presence in Wolff, see Carl Immanuel Gerhardt (ed.), Briefwechsel zwischen Leibniz und Christian Wolff (Halle: Schmidt, 1860; re-print Hildesheim: Olms, 1971), iii, Lipsiae d. 4 april. 1705, 23; Davide Poggi, «L’Essay di John Locke e la Psychologia empirica di Christian Wolff», in Ferdinan-do Luigi Marcolungo (ed.), Christian Wolff, tra psicologia empirica e psicologia ra-zionale (Hildesheim: Olms, 2007), 63-94.
74 At the University of Jena, Johann Franz Budde (a disciple of Thomasius’s) was attentive to Locke’s philosophy. On Locke’s philosophy in Königsberg and Berlin see Pollok, Die Locke-Rezeption in der deutschen Aufklärung, XXV.
75 Leben und Schriften des Weltberühmten und Hochgelahrten Engländers Johann Locke (Halle: Kümmel, 1754) is based on the bio-bibliography of Locke compiled by Jean Le Clerc; significantly, the first edition (published in Halle) bore a less re-sounding title: Leben und Schriften des Engländers Johann Locke (1717); the same is true of the second edition published in Glogau (1720). Brown suggests 1754 as the year of publication: see Brown, «German interest in Locke’s Essay», 477. Con-trary to this, the authors of the following texts suggest the year 1755: see Wilhelm Gottlieb Tennemann, Geschichte der Philosophie (Leipzig: Barth, 1819; reprint Bruxelles: Culture et Civilisation, 1974), vol. XI, 9; Johann Samuel Ersch, «Litera-tur der Schönen Künste», in Johann Karl August Rese and Christan Anton Geissler (eds.), Johann Samuel Ersch’s Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit (Leipzig: Brockhaus, 1827; re-print Hildesheim: Olms, 1982), vol. IV, 873.
Georg Friedrich Meier
113!
The description of Locke’s personality and the relevance of his philosophi-cal thought, which Meier offered to his Zuhörer, are all built around the no-tions of ‹freedom of thought› and ‹freedom from prejudice.› The Zuschrift turns out to be in no way a precise and accurate exposition of the main theses of the Essay concerning Human Understanding (which was read and pro-posed in the Latin version edited by Gotthelf Heinrich Thiele),76 but rather a pamphlet testimony of the battle against dogmatism and against the blind, ‹enthusiastic› (schwärmerisch – very close to Locke’s meaning) assent that was proper, according to Meier, to the German eighteenth-century academic world. Meier compares without hesitation the extant curricula and academic collegia to the uncritical learning of practical skills useful to professions and crafts.77
The battle against praejudicia was a typical enlightened topic (praejudicia meant not only the surreptitious assumption of undemonstrated principles but more generally all ‹mistakes›), which Meier re-considered twelve years later, in 1766, in his Beyträge zu der Lehre von den Vorurtheilen des menschlichen Geschlechts,78 an essay in which Meier takes up a proactive posi- 76 See Meier, Zuschrift an Seine Zuhörer, worin er Ihnen seinen Entschluß bekannt
macht, ein Collegium über Locks Versuch vom Menschlichen Verstande zu halten, 12-13. This confirms the role played by Thiele’s version in the circulation of the Lockean Essay among the thinkers of Spätaufklärung: John Locke, Libri 4 De In-tellectu Humano, denuo ex novissima editione idiomatis Anglicani, longe accuratiori in puriorem stylum Latinum translati. Preaefixae sunt huic editioni auctoris scripta et vita, nec non elenchus capitum (Leipzig: Georg, 1741). Meier also shows himself to be well aware of the publishing history of the Lockean Essay. In fact he refers to: John Locke, «Extrait d’un Livre Anglois qui n’est pas encore publié, intitulé ESSAI PHILOSOPHIQUE concernant L’ENTENDEMENT, où l’on montre quelle est l’étendue de nos connoissances certaines, & la manière dont nous y parvenons. Communiqué par Monsieur LOCKE», Bibliothèque universelle et historique 8 (1688), 49-142; John Locke, Of the Conduct of the Understanding, in John Locke, Posthumous Works (London: Churchill, 1706); fully translated into French as: John Locke, De la conduite de l’Esprit dans la Recherche de la Vérité, in John Locke, Œuvres diverses de Monsieur Locke (Rotterdam: Fritsch & Böhm, 1710). Meier rightly emphasizes that, in 1754, this essay had received neither a Latin nor a Ger-man translation. The German translation (by G.D. Kypke and M. Kuntzen) will appear the next year: John Locke, Anleitung des menschlichen Verstandes (Königs-berg: Hartung, 1755; ed. by Terry Boswell, Riccardo Pozzo and Clemens Schwaiger, Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-holzboog, 1996).
77 See Meier, Zuschrift an Seine Zuhörer, worin er Ihnen seinen Entschluß bekannt macht, ein Collegium über Locks Versuch vom Menschlichen Verstande zu halten, 4-5.
78 Georg Friedrich Meier, Beyträge zu der Lehre von den Vorurtheilen des menschli-chen Geschlechts (Halle: Hemmerde, 1766). See the recent critical edition with Ital-
Davide Poggi
114
tion regarding the enlightened discussion about the use of the ‹mathematical method› in philosophy and, in particular, in metaphysics.79 He again makes explicit reference to Lockean theses concerning the uselessness of the princi-ples of identity and of contradiction for the advancement of learning.80
In conclusion, although the Zuschrift an Seine Zuhörer, worin er Ihnen seinen Entschluß bekannt macht, ein Collegium über Locks Versuch vom Menschlichen Verstande zu halten by Meier does not seem particularly help-ful for reconstructing the spectrum of themes examined in the collegium itself (1754), it is nonetheless essential for understanding Kant’s ‹awakening from dogmatic slumber.›81 Thanks to Meier, one is able to grasp the full extent of the pivotal role played by Locke in the German Aufklärung.
ian translation, ed. Norbert Hinske, Heirich Delfosse and Paola Rumore (Pisa-Stuttgart: ETS-Frommann-holzboog, 2006).
79 I return to this topic in the Introduction to Johann Nicolaus Tetens’ Gedancken über einige Ursachen, warum in der Metaphysik nur wenige ausgemachte Wahrhei-ten sind, als eine Einladungs-Schrift zu seinen den 13ten October auf der neuen Bützowschen Academie anzufangenden Vorlesungen (Bützow-Wismar: Berger und Boedner, 1760), •.
80 See Locke, Essay, IV, 7, xi, 602; IV, 8, 5, 612; IV, 8, 7, 614; IV, 8, 9, 615; Meier, Beyträge zu der Lehre von den Vorurtheilen des menschlichen Geschlechts, § 35, A 67-70 (original German pagination; 98-101 of the ETS-Frommann-holzboog, editi-on).
81 Immanuel Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissen-schaft wird auftreten können, in Immanuel Kant, Gesammelte Schriften (Berlin: de Gruyter, 1968), vol. IV, 260.
[/] [2] Georg Friedrich Meier
Zuschrift an Seine Zuhörer,
worin er Ihnen seinen Entschluß bekannt macht,
ein Collegium über Locks Versuch
vom Menschlichen Verstande zu halten.
Halle, im Magdeburgischen
verlegt von Carl Hermann Hemmerde
1754.
Georg Friedrich Meier
117!
[/] [3] Da ich in dem bevorstehenden Winter ein Collegium anfangen werde, welches bisher ungewöhnlich gewesen ist; so habe ich es für meine Schuldig-keit gehalten, diejenigen welche etwa Willens sind, dasselbe mit zu halten, zum voraus von der Einrichtung desselben zu benachrichtigen. Ich übergehe, mit einem Ehrfurchtsvollem Stillschweigen, die nächste Veranlassung dessel-ben, da sie ohnedem bekannt genug ist; und mein jetziges Vorhaben gehet nur dahin, denenjenigen, welchen Locks Versuch vom menschlichen Verstande unbekant ist, zum voraus einigermassen bekannt zu machen, was sie sich von einem Collegium über dieses Werck zu versprechen haben, und wie ich mei-nen Vortrag über dasselbe einzurichten geden[/]cke [4]. Dergestalt wird ein jeder auf eine vernünftige Art untersuchen können, ob er dieses Collegium halten wolle, oder nicht.
Es giebt viele unter denen Herrn Studierenden, welche ihr Studieren auf Universitäten nicht anders, als die Erlernung einer Profeßion einrichten, durch welche sie diejenige unentbehrliche Geschicklichkeit zu erlangen trach-ten, die man haben muß, wenn man nach der heutigen Verfassung der Staaten ein gewisses Amt bekleiden, und seinen Unterhalt verdienen will. Die lange Erfahrung hat gelehrt, welche Theile der Gelehrsamkeit zu diesem Ende nöthig sind, und es hat daher die Gewohnheit bestimt, welche Wissenschaften ein Theologe, ein Jurist, ein Medicus zu diesem Ende lernen muß. Den In-begrif dieser Wissenschaften nennt ein jeder Studierender seinen Cursus, und wenn er so viele Collegia gehört hat, als nöthig ist, seinen gantzen Cursus nothdürftiger Weise durchzugehen, so meynt er: er habe seinen Cursus absol-virt, und er habe nichts mehr zu lernen übrig. Ein Studierender von dieser Art komt nicht einmal in die löbliche Versuchung, ein anderes Collegium zu be-suchen, welches nicht zu seinem Cursus gehört. Er betrachtet die Gelehrsam-keit nicht anders als ein Handwerck, und er denckt [/] [5] viel zu niedrig, als daß man im Stande seyn solte, ihm ein Collegium kräftig anzupreisen, ohne welchem er dennoch im Stande ist, so viel zu lernen, als nöthig ist, um ein Amt nach der gewöhnlichen Art zu verwalten: denn die Welt wird durch eine kleine Weisheit regiert. So lange jemand nur einen so schlechten Begrif vom Studieren hat, so lange ists unmöglich ihn zu überzeugen, daß ihm, ein Colle-gium über Locks Versuch vom menschlichen Verstande, sehr vielen Nutzen verschaffen werde.
Wer im Gegentheil sich über diese elende Art zu dencken in die Höhe schwinget, und zwar auch zu dem Ende studiert, damit er sich zu einem nütz-lichen Amte geschickt mache, und dergestalt ein brauchbares Mitglied des menschlichen Geschlechts und des Staats werde, allein ausserdem noch andere edlere Absichten hat: der wird sich nicht in die engen Schrancken, des ge-
Davide Poggi
118!
wöhnlichen Cursus im Studieren, einschräncken. Er wird das Studieren als ein Mittel betrachten sich geschickt zu machen, die Wahrheit mit eigenen Augen zu sehen. Er wird es daher als ein Bestreben ansehen, sich über die Vorurtheile und Irrthümer des menschlichen Geschlechts, und wenn ehe wird es dem menschlichen Geschlechte an Irrthümern und Vorurtheilen [/] [6] fehlen? in die Höhe zu heben, und die Natur der Dinge, samt dem Urheber derselben richtig und practisch kennen zu lernen? Es ist wahr, es wird dieses Bestreben keinem Menschen jemals völlig gelingen. Unterdessen ist es doch ein wahrhaf-tig edles Bestreben, und ein Studierender hat schon sehr viel gewonnen, wenn sein Studieren ein solches Bestreben ist. Edle Unternehmungen können nicht schlecht gelingen, noch viel weniger gantz mißlingen. Und wenn ein Studie-render so denckt, so ist man im Stande ihn aufzumuntern, ein Collegium zu halten, welches nicht mit in den Circul dererjenigen Theile der Gelehrsamkeit gehört, den man einen Cursus nennt. Und auf diese Weise kan man, des vortreflichen Locks Versuch vom menschlichen Verstande, einem jedweden, der ein wahrer Gelehrter werden will, anpreisen.
Lock, wie er selbst erzehlt, stelte mit einigen gelehrten Freunden, allerley gelehrte Untersuchungen an. Und da nun diese Gesellschaft zum guten Glück aus lauter ehrlichen Leuten bestand, denen es blos um die Erkentniß der Wahrheit zu thun war; so bemerckten sie, daß sie sich in unüberwindliche Schwierigkeiten, durch ihre Art der Untersuchung, verwickelten. Sie wurden deshalb beküm[/]mert [7], und untersuchten, woher es doch kommen möge, daß sie sich aus den aufstossenden Schwierigkeiten nicht heraus wickeln könnten. Und da entdeckte Lock, daß sie nicht auf dem rechten Wege nach der Wahrheit sich befänden, oder daß sie ihren Verstand nicht recht gebrauch-ten, um die Wahrheit zu entdecken. Er gerieth demnach auf den Einfall, von vorne anzufangen, und zu untersuchen, wie der menschliche Verstand ge-braucht werden müsse, um zu einer richtigen Erkenntniß zu gelangen. Und daraus ist sein Versuch vom menschlichen Verstande entstanden. Er zeigt erstlich, daß uns keine Erkenntniß angebohren werde, und hernach, daß wir alle unsere Erkenntniß, entweder durch die Sinne, oder zugleich durch die Reflexion erlangen. Er geht alle unsere vornehmsten Begriffe durch, und zeigt, wie wir zu derselben gelangen. Er bemerckt überall die Grentzen des mensch-lichen Verstandes, und er folget allerwegen der Erfahrung. Er handelt zugleich sehr viele Sachen ab, die zur Metaphysic und andern Theilen der Weltweisheit gehören. Und obgleich in seinem Versuche viele Sachen vorkommen, die zur Vernunftlehre gehören, so ist derselbe doch nicht blos eine Vernunftlehre, und noch viel weniger ein vollständiges System der Vernunftlehre.
Georg Friedrich Meier
119!
[/] [8] Lock ist also als ein grundehrlicher Mann zu betrachten, welcher alle Vorurtheile, sonderlich diejenigen, welche aus den Systemen der Gelehrten unvermerckt entstehen, beyseite gesetzt; welcher den Spuren der einfältigen Erfahrung nachgegangen, und einen sichern Weg durch das Reich der Wahr-heiten zu entdecken gesucht hat. Bey einem jeden Schritte, den er aufs vor-sichtigste gethan hat, hat er sehr nützliche Entdeckungen gemacht, aus deren Sammlung er sein Buch zusammengesetzt hat. Zu seinen Zeiten waren die meisten seiner Entdeckungen neu, und er verdient demnach den grösten Ver-besserern der Weltweißheit an die Seite gesetzt zu werden. Die gelehrte Welt hat auch seine grossen Verdienste erkant, und so lange noch gefunde Vernunft unter den Weltweisen seyn wird, so lange wird der Versuch vom menschli-chen Verstande gelesen und bewundert werden. Ein Collegium über densel-ben giebt demnach Gelegenheit, sehr viel philosophische Materien viel besser abzuhandeln, als es geschehen kan, wenn man sie nur beyläufig oder kurtz in einem System der Logic, Metaphysic oder einer andern Wissenschaft berührt. Und weil dieser Versuch kein methodisches System enthält, so läßt es den Verstand der Leser und Zuhörer in mehrerer [/] [9] Freyheit von einer Mei-nung, und von einem gantzen System zu urtheilen.
Es würde allerdings unvernünftig seyn, wenn man einen Studierenden, für aller methodischen und systematischen Erkenntniß, warnen wolte. Sicht es gleich viele falsche Systeme, und sind gleich die meisten Systeme, die von den Menschen erfunden worden, mit Irrthümern angefült; so ist es doch unge-reimt zu sagen, daß Wahrheiten deswegen in Irrthümer verkehrt werden, weil sie ordentlich mit einander verknüpft, und weil eine aus der andern auf eine übereinstimmende Art hergeleitet, das ist: weil sie in ein System gebracht werden. Eine Wahrheit kan nur in ihrer völligen Richtigkeit gedacht werden, wenn sie mit ihren Gründen und Folgen gedacht wird, und eben alsdenn wird sie systematisch gedacht. Wenn man eine Wahrheit aus ihrem System heraus-reißt, so vergißt man fast auf eine nothwendige Art viele Bestimmungen der-selben, und man kan ofte das Unrichtige an einem Satze nicht anders entde-cken, als vermittelst anderer Wahrheiten; wie ein Balcken nicht eher seine gehörige Gestalt bekomt, bis er nicht an die übrigen Theile eines Gebäudes angefugt wird. Wer gar nicht systematisch zu dencken gelernt [/] [10] hat, der ist wie ein Landstreicher in dem Reiche der Wahrheiten anzusehen, welcher die gebahnten Wege verläßt, und querfeldein herum läuft. Die betrübte Erfah-rung lehrt auch zur Gnüge, daß dergleichen Gelehrte in unendlich viele Irrthümer gerathen, in deren Gefahr man nicht einmal kommen kan, wenn man systematisch zu dencken gelernt hat.
Davide Poggi
120!
Auf der andern Seite aber ist es sehr gefährlich, wenn ein Gelehrter niemals anders als systematisch, und noch dazu nur nach einer gewissen Methode denckt. Die Wahrheit hat überall einerley Natur, und dogmatische Wahrhei-ten können daher mit den historischen einerley Schicksal haben. Nun lehrt die Erfahrung, daß wenn man nur recht zusammenhängend lügen kan, die offen-barsten Lügen der Wahrheit so ähnlich gemacht werden können, daß man sie nicht für eine Lügen ansehen kan. Wenn man sich in einen Roman vertieft, so ist man nicht im Stande, das wahre in demselben von dem falschen zu unter-scheiden. Ein System ist mehrentheils ein Roman abstracter Säze. Und man darf sich daher nicht wundern, daß ofte ein ungereimter Einfall eine offenbare Wahrheit zu seyn scheinen kan, wenn man ihn recht künstlich in ein gelehrtes System einzuflech[/]ten [11] im Stande ist. Wenn man also blos systematisch denckt, so ist man entweder in Gefahr, wohl gar durch Hülfe der mathemati-schen Methode in einen Irrthum auf eine recht philosophische Art gestürtzt zu werden; oder wenigstens nur, durch das Vorurtheil des Systems, von der Wahrheit überredet zu werden, und also zu keiner wahren Ueberzeugung zu gelangen. Es ist demnach zu rathen, daß man sich manchmal aus der engen und abgemessenen Laufbahn des Systems herauswage, um so zu reden zu sich selbst zu kommen, und mit mehr Freyheit die Richtigkeit des Systems zu beurtheilen.
Ausser dem, daß in Locks Versuch vom menschlichen Verstande sehr viele besonders nüßliche Untersuchungen vorkommen, hat man sich von der An-leitung dieses grossen Weltweisen den Nutzen zu versprechen, daß man sich desto leichter wird in acht nehmen können, sich unter das Joch eines Systems dergestalt zwingen zu lassen, daß man so gar in ein Vorurtheil für dasselbe gerathe. Lock giebt vortrefliche Anleitungen, unendlich viele Irrthümer, Vo-rurtheile und Gedanckenlosigkeit der Gelehrten zu entdecken, welche ofte blos daher entstehen, weil man durch ein System voller Lügen verblendet wird.
[/] [12] Vielen wird es anfänglich unmöglich zu seyn scheinen, über Locks Versuch ein Collegium zu lesen, weil derselbe nicht nur ein ziemlich weitläuf-tiger Tractat ist, sondern weil auch das gantze Buch in einem freyen Discours besteht. Allein eben daraus erhellet, daß es unnöthig sey, in dem mündlichen Vortrage über dasselbe alle Säze und Perioden des Verfassers zu erläutern. Ich werde demnach aus einem jedweden Absatze den Hauptsatz herausziehen, und denselben gehörig zu erläutern suchen. Zugleich werde ich meine eigene Betrachtungen hinzufügen, und kein Sclave von Locken seyn, sondern mit aller vernünftigen Freyheit von seinen Meinungen abgehen, wenn ich Grund dazu zu haben glaube. Und da in seinem Versuche sehr viele Untersuchungen
Georg Friedrich Meier
121!
vorkommen, die seit seiner Zeit, so zu sagen, in allen Compendien der Ver-nunftlehre und Metaphysic vorgetragen werden, so werde ich mich bey de-nenselben sehr wenig aufhalten. Und also werde ich meine Zuhörer vornem-lich mit solchen Untersuchungen zu unterhalten suchen, die man sonst in dem mündlichen Vortrage der gewöhnlichen philosophischen Lesestunden nicht ausführlich abzuhandeln pflegt.
Ehe Lock seinen Versuch der Welt mittheilte, gab er eine kleine Schrift her-aus, [/] [13] welche ein Auszug aus dem grössern Wercke war, und zwar in englicher Sprache. Clericus übersetzte sie ins frantzösche, und ließ sie in dem achten Theile seiner Bibliothec im Jenner 1688. abdrucken, gab sie auch her-nach besonders mit Locks eigenen Vermehrungen heraus. Meines Wissens ist dieser Auszug weder ins deutsche noch lateinische übersetzt, und es ist dem-nach unmöglich, daß ich denselben zum Grunde meiner Vorlesungen legen solte. Er hat auch noch ein anders kleines Werck, von dem Gebrauch des Verstandes in der Untersuchung der Wahrheit, geschrieben, welches nach seinem Tode erst gedruckt worden, und wovon meines Wissens weder eine deutsche noch lateinische Uebersetzung vorhanden ist. Ich habe mich dem-nach entschliessen müssen, über das grosse Werck selbst zu lesen und zwar will ich die lateinische Uebersetzung zum Grunde legen, welche zu Leipzig 1741. unter folgendem Titel herausgekommen: Johannis Lockii, Armigeri, Libr. IV. de intellectu humano etc. cura M. Gotthelf Henr. Thiele Rectoris Scholae Lubenensis. Wenn ich dieses Collegium einmal werde gelesen haben, so will ich selbst einen kurtzen deutschen Auszug, zur Bequemlichkeit meiner Herrn Zuhörer, machen.
[/] [14] Weil ich meines bekanten Gefundheits-Zustandes wegen es nicht wagen kan, viele Stunden des Tages zu lesen, so will ich anfänglich nur erst alle Sonnabende von 2-3 dieses Collegium über den Lock halten, und so bald ich das Privatißimum über die Metaphysic werde zu Ende gebracht haben, will ich dasselbe alle Tage in eben der Stunde fortsetzen.
Ich werde dieses Collegium wie ein anderes philosophisches Privatcollegi-um halten, und wenn es Gott gefält, den Anfang desselben den 26 October in meinem Hause machen. Geschrieben auf der Königlichen Friedrichs-Universität in der Michaelismesse 1754.
JOHANN NICOLAUS TETENS: GEDANCKEN ÜBER
EINIGE URSACHEN, WARUM IN DER METAPHYSIK NUR WENIGE AUSGEMACHTE WAHRHEITEN SIND, ALS EINE
EINLADUNGS-SCHRIFT ZU SEINEN DEN 13TEN OCTOBER AUF DER NEUEN BÜTZOWSCHEN ACADEMIE
ANZUFANGENDEN VORLESUNGEN
Davide Poggi
On June 23, 1761, when the Akademie der Wissenschaften of Berlin announ-ced the call for submissions - the winner of the competition was to be awar-ded in 1763 - focusing on the question «si le vérités métaphysiques en général et en particulier les premiers principes de la Théologie naturelle et de la Mo-rale sont susceptibles de la même évidènce que les vérités mathématiques, et en cas qu’elles n’en soient pas susceptibles, quelle est la conviction?»,82 the import of a substantial debate (which had been taking place in Europe for decades) was officially recognized. In fact, it had escalated to such a degree that the community of savants was forced to deal with it. At issue was the validity and the applicability of mathematical method to the different domains of knowl-edge.
This debate, as Fülleborn in Beyträge zur Geschichte der Philosophie (1795)83 and, more recently, Tonelli (1959)84 and Engfer (1982)85 have pointed out, finds its roots in the early seventeenth century. Descartes himself, among the first to propose the ‹mathematical› or ‹analytical› approach for demonstra-tions and expositions in philosophy,86 had expressed doubts about the chances
82 Adolf Harnack, Geschichte der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu
Berlin (Berlin: Reichsdruckerei, 1900), vol. II, 306-307. 83 Georg Gustav Fülleborn, «Zur Geschichte der mathematischen Methode in der
deutschen Philosophie», Beyträge zur Geschichte der Philosophie 5 (1795), 108-30. 84 Giorgio Tonelli, «Der Streit über die mathematische Methode in der Philosophie in
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und die Entstehung von Kants Schrift über die ‹Deutlichkeit›,» Archiv für Philosophie 9 (1959), 37-66.
85 Hans-Jürgen Engfer, Philosophie als Analysis: Studien zur Entwicklung philosophi-scher Analysiskonzeptionen unter dem Einfluss mathematischer Methodenmodelle im 17. und frühen 18. Jahrhundert (Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-holzboog, 1982).
86 See René Descartes, Discours de la Méthode pour bien conduire sa raison, & cher-cher la verité dans les sciences, in Charles Adam and Paul Tannery (eds.), Œuvres de Descartes, (Paris: Vrin, 1996), vol. VI, 4-22; Id., Secundae Responsiones, in Œuvres de Descartes, vol. VII, 155-156.
Davide Poggi
124!
for an effective and full realization of such an endeavor, namely the use of the demonstrative ‹synthetic› method, typical of geometry. In the Secundae Re-sponsiones to the Objectiones by Mersenne,87 Descartes had seen the core of the problem in the differences between metaphysics and mathematics and in their respective objects:
Haec … differentia est, quod primae notiones, quae ad res Geometricas demon-strandas praesupponuntur, cum sensuum usu convenientes, facile a quibuslibet ad-mittantur. Ideoque nulla est ibi difficultas, nisi in consequentiis rite deducendis … Contra vero in his Metaphysicis de nulla re magis laboratur, quam de primis notio-nibus clare et distincte percipiendis. Etsi enim ipsae ex natura sua non minus notae vel etiam notiores sint, quam illae quae a Geometris considerantur, quia tamen iis multa repugnant sensuum praejudicia quibus ab ineunte aetate assuevimus, non nisi a valde attentis & meditantibus, mentemque a rebus corporeis, quantum fieri potest, avocantibus, perfecte cognoscuntur.88
Descartes admits that there is a ‹cognitive problem› that is proper to the meta-physicas res (as distinct from things given by the senses), a problem that makes them ‹difficult› for the mathematical-geometrical model.
These problems (once the gap between mens and corpus is narrowed and the role of sensible ideas is reassured as fundamental part of the contents of consciousness) become unsolvable for Locke’s Essay concerning Human Un-derstanding. From Locke’s point of view, metaphysics is a ‹presumptive› sci-ence, which is built on ‹undoubted propositions› that are grounded on ‹ob-scure› concepts and meaningless words (without any meaning, namely, that goes beyond a mere ‹idea of relation›).89 Just like mathematics, moral philoso-phy can be verified by means of sure and clear demonstrations,90 because its concepts are ‹arbitrary› combinations of simple ideas, which are eventually ‹archetypical› to themselves (thus also certain, true, adequate, and real). The presupposition of this thesis is the ‹compositional model› of Lockean psy-
87 Mersenne suggested in fact to Descartes that he should explain the results of his
own meditations about prima philosophia following the geometric order (‹more geometric›) that Descartes knew well (‹in quo versatus [est]›): see Descartes, Œu-vres de Descartes, vol. VII, 128.
88 Descartes, Secundae Responsiones, 156-157. 89 See John Locke, Essay concerning Human Understanding (Oxford: Clarendon
Press, 1975), IV, 8, ix, 615. 90 See Locke, Essay, III, 11, xv-xvi, 516; IV, 3, xviii-xix, 548-552; IV, 12, viii, 643-644.
Johann Nicolaus Tetens
125!
chology: the possibility of composing and de-compositing certain ideas into other simpler or more complex ideas.
In Germany, Leibniz and Wolff were among the first to intervene in the debate about mathematical method.91 Leibniz pointed to the need to apply mathematical-geometrical method to philosophy and, especially, to meta-physics (which he considered not only a ‹verbal› knowledge, but a knowledge «cum fundamento in re»). He acknowledged the problematic nature of the project, due to the absence of a symbolic support during the reasoning proc-ess,92 and due to the inadequacy of the principle of identity for metaphysics.93
On this subject, it is extremely important that, in the Nouveaux Essais (1703), one of the rare occasions in which Théophile (Leibniz’s mask) fully agrees with Philalèthe (Locke’s spokesman) is when the fruitfulness of the «Méthode des Mathématiciens» for philosophy is at stake:
Je voy bien … comment il faut que la Methode, que nous suivons dans nos recher-ches quand il s’agit d’examiner led idées, soit reglée sur l’exemple des Mathemati-ciens, qui depuis certains commencemens fort clairs et fort faciles (qui ne sont autre chose que les Axiomes et les Definitions) montens par des petits degrés et par une enchainure continuelle de raisonnemens à la decouverte et à la demonstration des verités, qui paroissent d’abord au dessus de la capacité humaine. … Mais de savoir, si avec le temps on ne pourra point inventer quelque semblable Methode, qui serve aux autres idées, aussi bien qu’à celles qui appartiennent à la grandeur, c’est ce que je ne veux point determiner. Du moins, si d’autres idées estoient examinées selon la Methode ordinaire aux Mathematiciens, elles conduiront nos pensées plus loin que nous ne sommes peutestre portés à nous figurer. Et cela se pourroit faire par-ticulierement dans la Morale.94
91 See Tonelli, «Der Streit über die mathematische Methode»; Raffaele Ciafardone,
L’illuminismo tedesco: Metodo filosofico e premesse etico-teologiche (1690-1765) (Rieti: Il Velino, 1978); Federica de Felice, Filosofia e matematica nell’Illuminismo tedesco (Roma: Aracne, 2008).
92 Gottfried Wilhelm Leibniz, Animadversiones ad Weigelium, in Foucher de Careil (ed.), Nouvelles lettres et opuscules inédit (Paris: Durand, 1857; reprint Hildesheim: Olms, 1971), 150.
93 Gottfried Wilhelm Leibniz, Streitschriften zwischen Leibniz und Clarke (1715-1716), in Carl Immanuel Gerhardt (ed.), Die philosophischen Schriften von Leibniz (Berlin: Weidmann, 1882; reprint Hildesheim: Olms, 1978), vol. VII, 355-356.
94 See Gottfried Wilhelm Leibniz, Nouveaux Essais sur l’Entendement par l’auteur du système de l’harmonie préestablie (1703), in Die philosophischen Schriften, Band V,
Davide Poggi
126!
With Tschirnhaus95 and Wolff96 the debate became more pointed (especially with Wolff’s disciples and in primis with Darjes, who drew the equation be-tween philosophic method and mathematical method)97 and, in contrast with the assumption of the demonstrative and expository methods, which are proper to mathematical sciences (the methodo scientifica pertractatio, which was the Spinozan heritage within Wolffianism), there were firm answers from Thomasius98 and Hoffmann99 first, then from Crusius100 and Maupertuis later.101
ov, 12, 7-8, 434-435. See Locke, Essay, IV, 12, vii-viii, 643-644; IV, 12, xiv-xv, 648-649.
95 See Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, Medicina Mentis sive artis inveniendi praecepta generalia, 2nd edn. (Leipzig: Fritsch, 1695; reprint Hildesheim: Olms, 1964).
96 See Christian Wolff, Ratio praelectionum wolfianarum in Mathesin et Philosophiam universam, 2nd edn., in Jean École, Joseph Ehrenfried Hoffmann, Marcel Tho-mann, Hans Werner Arndt and Charles Anthony Corr (eds.), Gesammelte Werke (Halle: Renger, 1735; reprint Hildesheim: Olms, 1972), ii, 36; Id., Discursus Praeli-minaris de Philosophia in genere, in Gesammelte Werke, ii, 1.1, Philosophia Ratio-nalis sive Logica, methodo scientifica pertractata et ad usum scientiarum atque vitae aptata. Praemittitur Discursus Praeliminaris de Philosophia in genere, 3rd edn. (Frankfurt-Leipzig: Rengeri, 1740; freprint Hildesheim: Olms, 1983), §§ 116-132; Heinrich Wuttke (ed.), Christian Wolffs eigene Lebensbeschreibung (Leipzig: Weidmann, 1841), in Gesammelte Werke, i, 10 (Hildesheim: Olms, 1980), 121-128.
97 See Christian Thomasius, Cautelae circa precognita jurisprudentiae praecognita (Halle: Renger, 1710; reprint Hildesheim: Olms, 2006); Id., Cautelae circa prae-cognita jurisprudentiae ecclesiasticae (Halle: Renger, 1723).
98 See Joachim Georg Darjes, Introductio in artem inveniendi seu Logicam theoretico-practicam, qua analytica atque dialectica in usum et jussu auditorum suorum (Jena: Buch, 1742), Praec. §§ 200-202.
99 See Adolph Friedrich Hoffmann, Vernunft-lehre, darinnen die Kennzeichen des Wahren und Falschen aus den Gesetzen des menschlichen Verstandes hergeleitet werden, (Leipzig: Heinsius, 1737).
100 See Christian August Crusius, Weg zur Gewissheit und Zuverlässigkeit der mench-lichen Erkenntniss (Leipzig: Gleditsch, 1747), in Giorgio Tonelli (ed.), Die philoso-phischen Hauptwerke (Hildesheim: Olms, 1965).
101 Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Essai de Cosmologie, in Francois Azouvi (ed.), Œuvres de Maupertuis (Lyon: Bruyset, 1768; reprint Paris: Vrin, 1984).
Johann Nicolaus Tetens
127!
Johann Nicolaus Tetens’s102 academic program, the Gedancken über einige Ursachen, warum in der Metaphysik nur wenige ausgemachte Wahrheiten sind, als eine Einladungs-Schrift zu seinen den 13ten October auf der neuen Bützowschen Academie anzufangenden Vorlesungen,103 was composed in 1760 as a presentation of his academic courses (a year before the call for sub-missions by the Prussian Academy). It is the result of a long process of reflec-tion that the philosopher from Tetenbüll underwent during his studies in Copenhagen and in Rostock (he was one of Eschenbach’s students, and of Darjes’s too). The program celebrates the foundation of the new University of Bützow, which was one of the outcomes of the Prussian occupation of Rostock.104 There Tetens taught from 1760 to 1776 logic and metaphysics, physics (from 1763), natural law, moral philosophy and ‹doctrine of nature.›105 Since 1765, he was also headmaster of the Paedagogium.
102 See Wilhelm Uebele, Johann Nicolaus Tetens nach seiner Gesamtentwicklung be-
trachtet, mit besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zu Kant (Berlin: Reu-ther & Reichard, 1911; reprint Wurzburg: Liebing, 1970); Historische Commission bei der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften (ed.), Allgemeine Deutsche Biographie (Leipzig: Duncker & Humblot, 1894; reprint Berlin: Duncker & Humblot, 1971), XXXVII, 588-590; Jeffrey Barnouw, «Psychologie empirique et épistémologie dans les ‹Philosophische Versuche› de Tetens», Archives de Philoso-phie 46 (1983), 272-274; Paola Rumore, «L’anima dell’uomo: Psicologia e teoria della conoscenza in Tetens», in Massimo Mori e Stefano Poggi (eds.), La misura dell’uomo: Filosofia, teologia, scienza nel dibattito antropologico in Germania (1760-1915) (Bologna: Il Mulino, 2005), 72-74.
103 Johann Nicolaus Tetens, Gedancken über einige Ursachen, warum in der Metaphy-sik nur wenige ausgemachte Wahrheiten sind, als eine Einladungs-Schrift zu seinen den 13ten October auf der neuen Bützowschen Academie anzufangenden Vorle-sungen (Bützow-Wismar: Berger und Boedner, 1760), 68. There is a partial Italian translation of this essay by Raffaele Ciafardone: Johann Nicolaus Tetens, «Pensieri su alcune ragioni del fatto che in metafisica esistono soltanto poche verità stabilite», in Raffaele Ciafardone (ed.), Johann Nicolaus Tetens, Saggi filosofici e scritti minori (L’Aquila: Japadre Editore, 1983), 103-113.
104 On the history of the University of Bützow, see Hans W. Barnewitz, «Aus dem Bützower Studentenleben (1760-1789)», Meckleburgische Monatshefte 6 (1930), 65-69; Matthias Asche, Von der reichen hansischen Bürgeruniversität zur armen meck-lenburgischen Landeshochschule. Das regionale und soziale Besucherprofil der Uni-versitäten Rostock und Bützow in der Frühen Neuzeit (1500-1800) (Stuttgart: Stei-ner, 2000); Günter Camenz, Die Herzoglichen, Friedrichs-Universität und Pädago-gium zu Bützow in Mecklenburg (Bützow: Gänsebrunnen-Verlag, 2004).
105 See Uebele, Johann Nicolaus Tetens nach seiner Gesamtentwicklung betrachtet, 6-7.
Davide Poggi
128!
In the Gedancken, Tetens pleas for the use of ‹analytical› method in phi-losophy. He sees in the ‹confusion and obscurity of concepts›106 the most striking aspect of metaphysics (especially of ontology). He examines the rea-sons why the ‹certainty› of mathematical sciences seems to be an attainable ‹ideal› for philosophy. Such confusion and obscurity are the consequence not only of the failure to use the analytical-resolutive procedure but also (and mainly) of the impossibility for metaphysical concepts to find intuitive sup-port in the imagination, which is not the case for mathematics, which relies instead on signs that permit an ‹anschauende Erkenntniß.›107 The example given by Tetens is quite significant, for it invests the key notion of metaphys-ics (a term used now by Tetens as a synonym for ontology): the notion of substance.108
There is undoubtedly a strong influence of Locke’s ‹sensitization of mathe-matics›,109 which is the main reason for the certainty and the precision of mathematical demonstrations as well as the main obstacle to the realization of a ‹moral science› in the strict sense.110 That Tetens refers to it, is also a sign of the strong influence of Locke’s criticism against the concept of substance (as both innately natural and a positive concept of our minds).111
Locke’s influence is evident also in the next paragraphs of Gedancken. In §§ 12-14 Tetens in fact takes a ‹psycho-genetic› approach that is very close to that taken by Locke (whom he quotes a number of times):112
106 Tetens, Gedancken über einige Ursachen, warum in der Metaphysik nur wenige
ausgemachte Wahrheiten sind, § 6, 13. 107 Ibid.,14. 108 Ibid., § 8, 21. 109 Another proof that Locke was part of the German debate about the application of
mathematical method in metaphysics is to be found also in Georg Friedrich Meier, Beyträge zu der Lehre von den Vorurtheilen des menschlichen Geschlechts (Halle: Hemmerde, 1766). See the recent critical edition with Italian translation by Norbert Hinske, Heirich Delfosse and Paola Rumore (Pisa-Stuttgart: ETS-Frommann-holzboog, 2006). In this essay, if the mathematic-analytical method (which consists of re-taking each concept and proposition to the principles of identity and of non-contradiction) is defined as ‹useless› (analogously to what is affirmed by Locke), it is ‹useful› in as far as it clarifies complex concepts into simple concepts and avoids fallacies. See Meier, Beyträge zu der Lehre von den Vorurtheilen des menschlichen Geschlechts, § 35, A 67-70 (the pages from the original German edition; 98-101 of the quoted critical edition).
110 See Locke, Essay, II, 16, iv-vii, 205-208; IV, 3, xviii-xx, 548-552. 111 Ibid., I, 4, xviii, 95; II, 13, xvii-xx, 174-175; II, 23, i-iv, 295-297. 112 See Tetens, Gedancken über einige Ursachen, warum in der Metaphysik nur wenige
ausgemachte Wahrheiten sind, §§ 5, 11, 12.
Johann Nicolaus Tetens
129!
Es sind sich ja die Philosophen noch nicht einig über die einfachen Begriffe; und wie viele Streitigkeiten sind nicht über die Begriffe der Caussalität, des Raums, und der Zeit entstanden, die von einigen als einfache angesehen werden, von andern aber nicht. Will man die Streitigkeiten, welche hierüber entstanden, entscheiden; so ist es am besten, daß man auf die Empfindungen zurück gehe, aus welchen der bestrittene Begrif entstanden ist, und genau beobachte, was man sich vorstellet, wenn man diese Idee in den Gegenständen gewahr wird. 113
Tetens also refers to the subject of the third book of Locke’s Essay, the ‹Abuse of Words› (that is, the use of the same sign to mean different ideas, the fickle-ness in giving names to ideas, the introduction of obscure terms, the fluctua-tions between ‹technical› and ‹common› use of terms),114 for he observes that the majority of controversies about metaphysical subjects are mostly ‹logo-machies› among philosophical schools.115 Here Tetens gives proof of a truly
113 Tetens, Gedancken über einige Ursachen, warum in der Metaphysik nur wenige
ausgemachte Wahrheiten sind, § 14, 27. Locke observed in the Essay: «The know-ing precisely what our Words stand for, would, I imagine, in this as well as a great many other cases, quickly end the dispute. For I am apt to think, that Men, when they come to examine them, find their simple Ideas all generally to agree, though in discourse with one another, they perhaps confound one another with different Names. I imagine, that Men who abstract their Thoughts, and do well examine the Ideas of their own Minds, cannot much differ in thinking; however, they may per-plex themselves with words, according to the way of speaking to the several Schools, or Sects, they have been bred up in: Though amongst unthinking Men, who examine not scrupulously and carefully their own Ideas, and strip them not from the marks Men use for them, but confound them with words, there must be endless dispute, wrangling, and jargon; especially if they be learned, bookish Men, devoted to some Sect, and accustomed to the Language of it; and have learned to talk after others. But if it should happen, that any two thinking Men should really have different Ideas, I do not see how they could discourse or argue with another. Here I must not be mistaken, to think that every floating Imagination in Men’s Brains, is presently of that sort of Ideas I speak of. ‘Tis not easie for the Mind to put off those confused Notions and Prejudices it has imbibed from Custom, Inad-vertency, and common Conversation: it requires pains and assiduity to examine its Ideas, till it resolves them into those clear and distinct simple ones, out of which they are compounded; and to see which, amongst its simple ones, have or have not a necessary connexion and dependence one upon another: Till a Man doth this in the primary and original Notions of Things, he builds upon floating and uncertain Principles, and will often find himself at a loss». (Locke, Essay, II, 13, xxvii, 180-181).
114 See Locke, Essay, III, 10-11, 490-524. 115 Tetens, Gedancken über einige Ursachen, warum in der Metaphysik nur wenige
ausgemachte Wahrheiten sind, §§ 15-19, 29-39.
Davide Poggi
130!
‹eclectic› approach, for he not only looks at the English Enlightenment but also considers Leibniz and his observations about the ars combinatoria, which he explicitly quotes, envisioning the realization of the project of universal language that neither Wolff achieved.116
Tetens returns to the issues of the obscurity of metaphysical concepts and of the relationship between mathematic method and philosophy in his writ-ings of the seventies, namely, Über die allgemeine spekulativische Philosophie (1775, a year before he left Bützow for the University of Kiel as a full profes-sor of philosophy)117 and his masterpiece, the Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung (1777).118 In these texts one is able to trace a gradual dwindling of the hopeful tones with which the Ge-dancken reached their conclusion and an increasing consciousness of the fact that neither empirical observation nor the analytical method can provide a solid grounding to metaphysics. The unique grounding to be looked for is not solid, for it lies within the activity of the soul’s Vermögen. One has to wait, then, for the turning point of Kant’s transcendental idealism.119 116 See Tetens, Gedancken über einige Ursachen, warum in der Metaphysik nur wenige
ausgemachte Wahrheiten sind, §§ 21-24, 42-49. On the ars combinatoria, see Gott-fried Wilhelm Leibniz, Dissertatio de arte combinatoria, in qua ex Arithmeticae fundamentis Complicationum ac Transpositionum Doctrina novis praeceptis exstrui-tur, et usum ambarum per universum scientiarum orbem ostenditur (Leipzig: Si-mon. Fick and Seubold, 1666), in Gerhardt (ed.), Die philosophischen Schriften von Leibniz, vol. IV, 27-104; Id., Generales inquisitiones de analysi notionum et verita-tum (1686), in Louis Couturat (ed.), Opuscules et fragmentes inédits: Extraits des manuscripts de la Bibliothèque Royale de Hanovre (Paris: Bailliere, 1903; reprint: Hildesheim: Olms, 1988), 356-399.
117 Johann Nicolaus Tetens, Über die allgemeine spekulativische Philosophie (Butzow und Wismar: Berger, 1775), in Wilhelm Uebele (ed.), Neudrucke seltener philoso-phischer Werke (Berlin: Reuther and Reichard, 1913), vol. I, 1-72.
118 Johann Nicolaus Tetens, Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung (Leipzig: Weidmann, 1777; reprint Hildesheim: Olms, 1979).
119 References on literature: Jacob Peletarius, In Euclidis Elementa Geometrica De-monstrationum libri VI (Lugduni: Tornaesius et Gazeius, 1557); Jacob Peletarius, In Christophorum Clavium de Contactu Linearum Apologia (Paris: Marnef et Cavellat, 1579). Jacob Peletarius, De Contactu Linearum Commentarius (Paris: Colomb, 1581). Christophorus Clavius, Commentarii in Euclidis elementa geometrica (1574), item in sphaeram Theodosii, in Opera Mathematica V Tomis distributa (Mainz: Eltz, 1611-1612); Gottfried Wilhelm von Leibniz, Dissertatio de Arte Combinatoria (Leipzig: Fikius et Seaboldus, 1666); Gottfried Wilhelm von Leibniz, Lehr-Sätze über die Monadologie, ingleichen von Gott und seiner Existenz, seinen Eigenschaff-ten und von der Seele des Menschen etc. (Frankfurt: Meyers, 1720); Johann Gottlob Krüger, Naturlehre nebst Kupfern und vollständigem Register, mit einer Vorrede von der wahren Weltweisheit begleitet von Herrn Friedrich Hoffmann (Halle:
Johann Nicolaus Tetens
131!
Hemmerde, 1740); John Locke, Libri IV. De intellectu humano (Leipzig: Georgi, 1741); Christian Johann Anton Corvin, Institutiones philosophiae rationalis metho-do scientifica (Jena: Melchior, 1742); Baruch Spinoza, Sittenlehre: Widerleget von dem berühmten Weltweisen unserer Zeit Herrn Christian Wolf; Aus dem Lateini-schen übersetzet (Frankfurt: s.l., 1744); Albrecht von Haller, Versuch Schweizeri-scher Gedichte, 4th edn. (Gottingen: Vandenhoeck, 1748); Pierre Bayle, Dictionaire Historique et Critique, cinquième édition revue, corrigée, et augmentée avec la vie de l’Auteur, par Mr. Des Maizeaux, 5th edn. (Amsterdam: Brunel, 1750); Jean Louis Moreau de Maupertuis, Essay de Cosmologie (Berlin: Nicolai, 1750); Christi-an August Crusius, Entwurf der notwendigen Vernunft-wahrheiten, wiefern sie den zufàlligen entgegengestellt werden, 2nd edn. (Leipzig: Gleditìzsch, 1753); Charles de Marguetel de Saint-Denis Saint-Évremond, Œuvres de Monsieur de Saint Evremond, avec la vie de l’Auteur par Monsieur Des Maizeaux, 4th edn. (Pa-ris: Barbin, 1753); Johann Heinrich Tönnies, Conspectus encyclopaediae, litterarum naturalem ordinem exponens, relatus praecipue ad Francisci Baconis de Verulamio libros de dignitate et augmentis scientiarum (Kiel: Bartsch, 1753); Johann Ernst Gunner, Dissertatio philosophica continens caussam Dei, vulgo Theodiceam ratione originis et permissionis mali in mundo habita (Jena: Marggraf, 1754); Johann Andre-as Segner, Einleitung in die Natur-Lehre, 2nd edn. (Göttingen: Vandenhoeck, 1754); Hermann Samuel Reimarus, Die Vernunftlehre, als eine Anweisung zum richtigen Gebrauche der Vernunft in der Erkenntniß der Wahrheit, aus zwoen ganz natuerlichen Regeln der Einstimmung und des Wiederspruchs (Hamburg: Bohn, 1756); Alexander Gottlieb Baumgarten, Metaphysica, 4th edn. (Halle: Hemmerde, 1757); Joachim Georg Darjes, Institutiones iurisprudentiae universalis in quibus omnia iuris naturae socialis et gentium capita in usum auditorii sui methodo scienti-fica explanantur, 5th edn. (Jena: Cuno, 1757); Gottfried Profe, Philosophische Ge-danken von Sprachfehlern (Hamburg: Hofmann, 1760).
Gedancken über
einige Ursachen, warum in der Metaphysik nur wenige
ausgemachte Wahrheiten sind,
als eine Einladungs-Schrift
zu seinen
den 13ten October auf der neuen Bützowschen Academie
anzufangenden
Vorlesungen,
entworfen von
Johann Nicolaus Tetens,
Phil. D.
Bützow und Wismar, den Berger und Boedner, 1760.
Johann Nicolaus Tetens
[/] [3 – A2] §. 1.
Es hat die Metaphysik in unserm Vaterlande, besonders in diesem Jahrhun-dert, überaus viele liebbaber gefunden, und findet sie noch. Unter allen philo-sophischen Wissenschaften beschäftiget sie die mehresten und scharfsinnigs-ten Köpfe, so daß auch der Nahme der Philosophen fast den Metaphysikern eigen geworden. Doch auch schon bei den Alten machten die Lehrsäze, die heutiges Tages zu ihr gerechnet werden, den grösten Theil der Weltweisheit aus. Sie verdienet diese Aufmerksamkeit und den Fleiß, den man auf sie ver-wendet, wenigstens wenn man sich dieselbe so vorstellet, wie sie sein soll und beschrieben wird, ob sie gleich zu der Volkommenheit noch nicht gebracht ist, welche sie ihrem Zwecke gemäß besizzen muß. Ich weiß wohl, daß nicht alle so von ihr denken, aber ich weiß auch, daß sich nicht alle den Begrif da-von machen, den man sich, meiner Meinung nach, davon machen muß. Sie kömt mir immer vor als eine Wissenschaft, die in der Weltweisheit [/] [4] das ist, was die Dogmatik in der Theologie. Sie Ist eine Wissenschaft, welche nebst einer algemeinen Theorie von allen möglichen und wirklichen Dingen, die algemeinen und nothwendigen Eigenschaften der Welt, die Lehre von der Seele und von Gott, in sich begreifet, oder mit andern Worten, welche uns die algemeinsten Grundsäze der menschlichen Erkenntniß, und die übrigen theo-retischen Wahrheiten der Vernunft lehret, die zu unsrer Glückseeligkeit nothwendig sind. Die Absicht der ganzen theoretischen Philosophie ist, eine Einsicht in den Zusammenhang der Dinge zu erhalten, und Gott, sich selbst und die Welt kennen zu lernen. Die Lehrsäze von Gott, von unsrer Seele, sind aber mit der Glückseeligkeit so genau verknüpfet, daß diese jene nothwendig voraussezet. Viele Wahrheiten von dem unendlichen Wesen können hinwie-derum gar nicht oder doch nicht hinlänglich genug erwiesen werden, wenn nicht einige algemeine Wahrheiten von der Welt ausgemacht worden. Dies alles aber setzet eine algemeine Theorie von allen möglichen und wirklichen Dingen zum voraus, wenn unsre Erkenntniß die gröste Gewisheit und Deut-lichkeit erhalten soll. Man hat dahero diese angeführten Stücke in eine einzige Wissenschaft gebracht, welche mit dem Nahmen der Hauptwissenschaft oder Metaphysik beleget wird. So ist sie von dem Freiherrn von Wolf eingerichtet, den man nach der Prophezeiung eines grossen Mannes alsdenn noch mit Hochachtung nennen wird, wenn die mehresten seiner Berächter schon längs-tens werden [/] [5 – A3] vergessen sein ; und ich sehe keinen hinreichenden Grund hievon abzugehen, die Experimental-Seelenlehre von ihr zu trennen,
Davide Poggi
136
und sie in eine Wissenschaft zu verändern, die nur die nothwendigen aus selbstgemachten Begriffen hergeleiteten algemeinen Lehrsäze von jedem mög-lichen Dinge, und dessen Hauptarten, in sich enthielte. Indessen will ich mit keinem hierüber streiten. Es ist ohnedem jezt mein Endzweck nicht, den Begrif von der Metaphysik zu entwickeln, ihre Abtheilungen fest zu sezen, und ihre Grenzen und Verhältnisse gegen andere Wissenschaften zu bestim-men. Jeder Verfertiger eines neuen Systems richte sie nach seinem Gefallen ein. Dies will ich nur erinnern, das jeder, der die Verbindung der Wahrheiten kennet, und sich von der Metaphysik den Begrif machet, den ich hier gegeben, die Nothwendigkeit derselben zu einer überzeugenden Erkenntniß in der practischen Philosophie, und ihren wichtigen Einfluß in die geoffenbahrte Gottesgelahrheit, einsehen, und dem, was ich vorhin gesagt, beistimmen wer-de, daß dieselbe verdiene mit allem Fleiß von dem scharfsinnigsten Männern angebauet zu werden.
§. 2.
Nun lehrt es die Erfahrung, daß die grösten Leute auch wirklich ihr Bemühen auf die Erweiterung der Metaphysik angewandt. Aber wie weit sind wir dar-innen gekommen? Aus der im vorigen §. gegebenen Erklärung der Metaphy-sik sieht man, was darinnen vorgefunden werden [/] [6] müsse, wenn man ihr nur die Volständigkeit beilegen wolte, welche ganz unentbehrlich ist, wenn sie der Absicht, in der sie erlernt wird, ein Genüge thun soll. Die algemeine The-orie von allen möglichen und wirklichen Dingen, die nach der Abtheilung der mehresten in der Ontologie abgehandelt wird, müste algemeine, fruchtbare und ausgemachte Wahrheiten enthalten, und zwar deren so viele, daß man in den folgenden Wissenschaften von der Welt, von der Seele und von Gott, durch Verknüpfung dieser Theorie mit den hier zum Grunde gelegten Erfah-rungen, dasjenige von der Beschaffenheit dieser Gegenstände mit Gewisheit ausmachen könte, wovon eine überzeugende Erkenntniß zu unsrer Glücksee-ligkeit nothwendig ist. Alsdenn könte man in Wahrheit ihr den prächtigen Titul einer Königin der menschlichen Wissenschaften nicht versagen. Ich muß aber gestehen, daß ich diese nothwendige Volständigkeit noch bishero in der-selben nicht vorgefunden. Was die Ontologie betrift, so enthält dieselbe nur wenige fruchtbare Lehrsäze, die zugleich ausgemachte Wahrheiten sind. Wie viele Lehrsäze bleiben wohl übrig, wenn man dies jenigen abzieht, über deren Wahrheit noch gestritten wird, die wichtig und zugleich etwas mehr sind als der gemeine Mutterwiz, wenn sie in andern als kunstmäßigen Wörtern aus-
Johann Nicolaus Tetens
137
gedrücket werden ? Mit wie vielen neuen ausgemachten Wahrheiten ist die Metaphysik seit Aristotelis Zeiten bereichert ? Man nehme, ohne sich weit-läuftig in der geschichte der Weltweisheit umgesehen zu ha[/]ben [7 – A4], eines der neuesten Lehrbücher dieser Wissenschaft, und vergleiche sie mit einem alten, man wird überführet werden, daß der Anwachs dieser Wissen-schaft an ausgemachten brauchbaren Wahrheiten überaus geringe sei. In der Lehre von Gott, der Seele und der Welt, sind wir auch noch nicht viel weiter gekommen als vorher. Was in den vorigen Zeiten hypothesen oder Muthmas-sungen waren, sind es noch jezo; die alten Zweifel sind noch unaufgelöst; und die vormals streitigen Lehrsäze werden noch heut zu Tage von einigen ange-nommen, von andern verworfen. Man kan mir weder die neuen Entdeckun-gen eines Cartes, Leibniß, Wolfs und anderer, welche die Gränzen der Meta-physik erweitert haben sollen, noch die Systeme der heutigen Philosophen, in welchen alle wichtige und zur Glückseeligkeit nothwendige Wahrheiten von Gott, der Seele und der Welt, mit einer mathematischen Strenge bewiesen zu sein scheinen, entgegen setzen. Ich habe nur von dem Mangel der ausgemach-ten, das ist, der gewissen und zugleich von allen angenommenen Wahrheiten geredet. Daß aber weder die von jenen grossen Leuten erfundene, noch die von diesen demonstrirten Lehrsäze darunter gehören, beweisen die Streitig-keiten, welche über dieselbe noch bis diese Stunde geführet werden. Es sind ohnstreitig die Säze des zureichenden Grundes und der verneinten gäntzli-chen Aehnlichkeit, zwei Hauptunterscheidungssäze des Wolfischen Lehrge-bäudes, wichtige und fruchtbare Säze, wie aus der Menge andrer Lehrsäze erhellet, die durch sie bewiesen [/] [8] werden; aber von keinem Saz kan man auch weniger als von diesen sagen, daß sie ausgemachte Wahrheiten sind. Die Historie der Philosophie zeigt es im Ueberfluß, daß kein einziger Saz von Wichtigkeit in der Metaphysik sei, dessen Wahrheit oder Falschheit zu erwei-sen sich nicht scharfsinnige Männer bestrebet hätten, und grossen Theils noch bestreben, und deren jeder sich wundert, daß sein Gegner das überzeugende seines Beweises nicht einsiehet. Die Menge der Begriffe und Worterklärungen, die in die Metaphysik gebracht werden, wird niemand als eine beträchtliche Erweiterung derselben ansehen, wenn man die wahre Absicht, und Brauch-barkeit derselben kennet.
§. 3.
In der Mathematik und Naturlehre geht man täglich weiter. Von jener lehren es die Schriften der neuen Mathematikverständigen, wenn sie mit den alten
Davide Poggi
138
verglichen werden, augenscheinlich. Neuton und Leibniz würden sich jezo über die höhe wundern, zu welcher die Analysis noch nach ihrem Tode ge-bracht ist. In der sogenanten angewandten Mathematik sind neue Wissen-schaften erfunden, Z.E. die Theorie von der Music, und noch neulich die Ausmessung der Stärke des Lichts von dem tiefsinnigen Lambert; die alten Theile derselben, die Statik, Optik, Astronomie, haben fast die höchste vol-kommenheit erhalten, deren sie fähig zu sein scheinen. Was die Naturlehre betrift, so muß man freilich gestehen, daß hierinnen unsre Erkenntniß in sehr [/] [9 – A5] vielen. Stücken noch dunkel und zweifelhaft sei. Auch bestehen die grossen Entdeckungen in der Lehre vom Licht, Feuer, Schall, Electrisiren, Farben u.s.w. mehr in Erfindung der Reguln, nach welchen die Erscheinungen in der Natur erfolgen, als daß man die Ursachen dieser Wirkungen mit Ge-wisheit herausgebracht hätte. Dieses hindert aber nicht, daß sich nicht die Zahl der ausgemachten Wahrheiten in derselben zugleich sehr vermehret hät-te. Es werden immer mehrere unbekante Ursachen entdeckt, Zweifel geho-ben, wahrscheinliche Säze in gewisse verändert; und was vordem nur eine Muthmassung war, wird ein ausgemachter Lehrsaz. Die Naturlehre vor Cartesius Zeiten, und diese Wissenschaft wie sie jezo ist, verhalten sich fast gegeneinander, wie die Dämmerung und der Mittag. Die Metaphysik hinge-gen hat das Schicksal, daß in ihr wohl das Gebiet der Hypothesen und Phan-tasien, nicht aber der evidenten Wahrheiten vergrössert wird. Es geht ihr jezo noch so, wie es der Naturlehre zu Pythagoras Zeiten ging. Dieser Philosoph hatte glückliche Einfälle, welche jezo ausgemachte Wahrheiten sind; aber es waren damahls nur Muthmassungen, denen der Beweis fehlte. Seine Nachfol-ger glaubten dahero die Sache besser zu treffen und verwarfen seine Säze. So mag auch vielleicht unter den vielen Hypothesen, die in die Metaphysik ge-bracht werden, manche Wahrheit stecken. Vielleicht giebt es wirklich vier verschiedene Arten der einfachen Substanzen; vielleicht auch nur zwo. Aber wer wird dies aus[/]machen? [10] Man muß den Verstand bewundern, mit welchem diese Möglichkeit ausgedacht und verknüpft sind; nur ist zu bedau-ren, daß sie nicht länger bestehen, als biß ein andrer neue auf die Bahn bringet.
§. 4.
Wenn man dieses gesagte überlegt, so ist nichts natürlicher, als daß man nach der Ursache desselben fraget. Woher kömt es, daß in der Metaphysik der ausgemachten Wahrheiten so wenige sind? Woher entstehen die Streitigkeiten über die ersten und wichtigsten Säze derselben? und warum herscht nicht in
Johann Nicolaus Tetens
139
dieser Wissenschaft die Evidenz, die in der Mathematik angetroffen wird? Die Ursache dieses leztern ist auch die Ursache von dem erstern; denn wären in der Metaphysik die Lehrsäze so augenscheinlich richtig als die mathemati-schen, so wäre es eben so unmöglich, sie in Zweifel zu ziehen, als es unmög-lich ist, die Richtigkeit des Pythagoreischen Theorems in der Geometrie zu bestreiten. Und wenn bei einigen Lehrsäzen eine solche Evidenz unmöglich ist; warum erhalten denn diese nicht die höchste moralische Gewisheit, oder die höchste Wahrscheinlichkeit, die in der Naturlehre gefunden wird, und uns eben so gut beruhigen würde, als die apodictische Ueberzeugung? Es ist die Ontologie, wie die theoretische Mathematik, eine Wissenschaft, in welcher aus wilkürlich bestimten Begriffen die Eigenschaften der Dinge hergeleitet werden. Was ist zwischen diesen beiden für ein Unterschied, daß [/] [11] in der einen alles ausgemachte Wahrheiten sind, in der andern aber das mehreste und wichtigste zweifelhaft und streitig ist? Die übrigen Theile der Metaphy-sik, die Cosmologie, die Seelenlehre, die natürliche Gottesgelahrtheit, müssen durch die Verbindung der ontologischen Wahrheiten mit Erfahrungsäzen erbauet werden, wie die angewandte Mathematik und Naturlehre durch die Verbindung der theoretischen Mathematik mit Versuchen; warum kommen wir denn in jener seltener zur Gewisheit als in diesen?
§. 5.
Man kan aus drei Ursachen verfallen, welche hieran Schuld sind. Man kan in den Vorurtheilen der Philosophen sie suchen: Man kan es der Beschaffenhett der in dieser Wissenschaft vorkommenden Wahrheiten beimessen, daß uns die gehörige Gewisheit in der Erkenntniß fehlet: Man kan aber auch die Art zu philosophiren beschuldigen, daß sie unsre Erkenntniß nicht überzeugend mache. Ein gewisser grosser Mathematiker in Deutschland hält es für un-glaublich, daß unsre Erkenntniß von den Grössen allein so sehr deutlich sein könne, von den übrigen Dingen aber nicht, und scheinet der Vernachläßigung der mathematischen Methode die Streitigkeiten der Philosophen beizumessen. Das folgende wird zeigen, daß dieser Gedanke mehr Grund habe, als es an-fangs scheint, obgleich nach Wolfens Zeiten alle Beweise in die Form der ma-thematischen Demonstrationen sind eingekleidet worden. Indessen kan [/] [12] man doch nicht völlig sagen, daß alle Mängel der Metaphysik aus der versäumten Richtigkeit in der Methode entstünden. Die übrigen Ursachen tragen auch das ihrige bei. Es kan dies am richtigsten auf folgende Art ausge-macht werden: Man untersuche das Verfahren der Mathematiker und Natur-
Davide Poggi
140
lehrer genau, und bemerke dasjenige, was den Lehrsäzen der Mathematik die grosse Deutlichkeit und überzeugende Gewisheit zuwege bringet, und wie in der Naturlehre die Wahrheiten so befestiget werden, daß sie keinem vernünf-tigen Zweifel mehr unterworfen sind. Man kan zugleich auf die Ursachen acht geben, warum so vieles noch unbekannt, dunkel und zweifelhaft ist. Verglei-chet man hiemit das wesentliche in dem Verfahren der Methaphysiker so wohl in der Ontologie, als in den übrigen Theilen von der Welt, der Seele und Gott; so wird man entdecken, wie weit an den Fehlern in der Metaphysik die Abweichung von der allein zur Gewisheit führenden Methode Theil habe. Ist die Methode volkommen, und es bleiben doch noch einige Lehrsäze zweifel-haft; so muß entweder die Beschaffenheit der Gegenstände oder Vorurtheile daran Schuld sein, davon jenes wieder durch eine genaue Betrachtung der Begriffe ausgemacht werden kan. In der Ontologie rührt der Mangel ausge-machter Wahrheiten gröstentheils von Versäumniß des wesentlichen in der mathematischen Methode her; in den übrigen Theilen kommen noch ausser-dem die beiden lezt angeführten Stücke hinzu, welche wichtige Hindernisse sind, daß unsre Erkenntniß noch [/] [13] so verworren und ungewis ist. Ich kan und will hier nicht alle Ursachen anführen, welche die Metaphysik man-gelhaft machen, und welche die vorgeschlagene Vergleichung der Mathematik und Naturlehre mit der Metaphysik zeiget. Nur von einigen will ich meine Gedanken eröfnen, die aber, wo ich nicht sehr irre, unter die vornehmsten zu rechnen sind, und alle Aufmerksamkeit verdienen. Dies muß ich vorhero noch erinnern. Ein Logikus kan auf den Gedanken kommen, man könne durch eine genaue Prüfung der Metaphysik nach den Reguln der Vernunftleh-re eben dieselbe Fehler entdecken, ohne daß es nöthig sei, besonders auf das Verfahren in der Mathematik und Naturlehre acht zu haben. Gar recht! Alle Vernunftlehrer vom Lock biß zum Corvin zeichnen den Weg zur Gewisheit und Wahrheit. Ob aber die algemeinen Reguln so genau die Methode der Mathematiker und Naturlehrer werden kennen lehren, und uns in den Stand sezen werden, durch Vergleichung derselben mit der Methode der Methaphy-siker die Fehler der leztern zu entdecken, als diese Wissenschaften selber; daran ist sehr zu zweifeln.
§. 6.
Eine Ursache, warum in der Metaphysik so wenige ausgemachte Wahrheiten sind, ist das verworrene und dunkle in den Begriffen, aus welchen die Säze bestehen, und welches in die Beweise derselben einen Einfluß hat. In der On-
Johann Nicolaus Tetens
141
tologie hat dieses besonders statt. Die [/] [14] Begriffe in der theoretischen Mathematik hingegen besizen eine Deutlichkeit, welche in dieser Absicht volkommen ist; und dies macht, obgleich nicht allein, daß ihre Wahrheiten dem Verstande so klar und ausgemacht sind. Die Betrachtung dieses leztern wird das erste deutlicher machen. Man gehe alle Begriffe der Arithmetik und Geometrie durch, man wird finden, daß sie alle in die einfachen Ideen von der Ausdehnung, Grösse, Theil, Linie, Punct, Gränze, u.s.w. aufgelöset werden können. Man mache sich einen Begrif von einem Cylinder, oder von einem Hunderteck. So bald man dieselbe entwickelt, kömt man auf die Vorstellung von dem körperlichen Raum, von der Fläche und der Linie. Der Cylinder ist der körperliche Raum, der zwischen zwei gleiche Circulflächen eingeschlos-sen ist. Ein Hunderteck ist eine Figur, oder umgränzte Fläche, deren Umfang hundert gerade Linie ausmachen. In diesen einfachen Ideen kan freilich noch sehr vieles verworrenes vorgefunden werden; aber sie sind höchst klar, und dies ist zum Zweck genug. Wir haben eine anschauende Erkenntniß dersel-ben, indem wir sie aufs klärste mit der Einbildung uns vorstellen. Dahero wird die Gegeneinanderhaltung dieser Begriffe so leicht, und es wird dem Verstande eben so unmöglich, sich die Verhältnisse derselben anders zu den-ken als sie sind, als es der Einbildung wird, das was sie sich als rund vorstellet, zugleich als viereckt sich vorzustellen. Dahero ist auch alles so ungezweifelt richtig, wie es nicht sein würde, wenn unser Verstand in den Begriffen noch [/] [15] etwas dunkeles und verworrenes entdeckte, welches in den Beweis einen Einfluß hätte. So lange der Begrif des Unendlichkleinen in der höhern Mathematik noch nicht volkommen deutlich gemacht, und gezeigt war, daß es sein Nichts sei, welches eine Weile als eine kleine Grösse angenommen wird; so lange trugen noch viele Bedenken, die auf diesen Begrif gebaueten Rechnungen anzunehmen: jezo ist aller Zweifel gehoben. Es ist zu dieser Deutlichkeit nicht nothwendig, daß in den einfachen Ideen gar nichts verwor-renes mehr angetroffen werde. So weit kan die Deutlichkeit nicht getrieben werden und wird auch nicht getrieben in der Mathematik. Es ist genug, wenn das verworrene der Begriffe nur nicht hindert, daß die Verhältnisse derselben gegen einander aufs klärste können vorgestellet werden. Man wird mit glei-cher Evidenz erweisen können, daß zwei Linien eines Triangels grösser als die dritte sind, man mag sich die Linie als die Gränze der Fläche, oder als die Fortrückung eines Punkts verstellen. Es wird zu diesem Beweis nichts als ein klarer Begrif von der Linie erfodert. Wie sie distinkt gedacht werde, daran liegt hier nichts. Man will hier die innere Natur und Entstehungsart der Linie nicht wissen, wozu ohnstreitig ein noch deutlicher Begrif der Linie unent-behrlich wäre. Der berühmte Verfasser der Kunst zu denken sahe wohl ein,
Davide Poggi
142
daß die Evidenz der mathematischen Wahrheiten dem Verstande noch nicht die befriedigende Einsicht in dieselben gäbe; er hat aber Unrecht, wenn er dieses als einen Mangel der [/] [16] mathematischen Methode ansieht. Man kan hiebei beiläufig die Anmerkung machen: Wenn die Mathematiker ihren Begriffen die gröste Deutlichkeit beilegen, und den reinsten Verstand in den-selben suchen, so muß dies nur relative, in Absicht nemlich auf die Beweise der Säze zu verstehen sein; denn dazu sind ihre Grundbegriffe so deutlich als sie sein können; nicht aber so genommen werden, als wenn in ihren Begriffen bei Entwickelung derselben, nicht auch zulezt etwas verworrenes vorgefun-den würde, das nicht weiter entwickelt werden kann; denn dies widerstreitet der Erfahrung.
§. 7.
So ist es nicht in der Metaphysik. Wir treffen in den Begriffen noch vieles an, welches wir nur verworren uns vorstellen, und doch deutlich denken müssen, wenn die Lehrsäze nicht unrichtig bewiesen, oder zweideutig und verworren gedacht werden sollen. Seitdem die mathematische Methode in der Metaphy-sik Mode geworden, haben sich zwar die Metaphysiker besonders angelegen sein lassen, der Regul der Vernunftlehre nachzukommen, welche befiehlet kein Wort zu gebrauchen, das nicht vorhero erkläret sei, wenn die Bedeutung desselben ausserdem der geringsten Zweideutigkeit oder andern Schwierigkei-ten unterworfen ist. Man muß auch den Verstand bewundern, mit welchem einige scharfsinnige Philosophen die ersten Begriffe in der Ontologie aus ein-ander gesezt. Sie fangen von dem allereinfachsten, vom [/] [17 – B] Cogitabile, an, und bilden, nach den Reguln der Bestimmung, die mehr zusammengesez-ten Begriffe; oder sie nehmen diese, und steigen durch die Auflösung auf jene zurück. Diesem ohngeachtet lehrt die Erfahrung, daß der erforderliche Grad der Deutlichkeit noch nicht erhalten sei. Man kan dieses nicht besser, als aus denen Beweisen erkennen, in welchen die Stärke des Schlusses aus solche noch nicht hinreichend deutliche Begriffe ankömt; und dis sind gemeiniglich die Beweise der streitigen Säze. Ich will nur ein einziges anführen. Man de-monstrirt den Lehrsaz des zureichenden Grundes auf folgende Art: Ein jedes Mögliche hat entweder einen Grund, oder keinen. Hat es keinen, so ist Nichts dessen Grund; hat es aber einen Grund, so ist sein Grund Etwas; folglich ist der Grund eines jeden Möglichen entweder Nichts oder Etwas. Wäre Nichts der Grund eines jeden Möglichen, so wäre Nichts Etwas, weil ein Grund ein Etwas sein muß. Dies ist widersprechend; folglich ist der entgegengesezte Saz
Johann Nicolaus Tetens
143
wahr, daß alles Mögliche einen zureichenden Grund habe. Man hat gegen diesen Beweis verschiedenes, theils mit Grund, theils ohne Grund einge-wandt. Das fehlerhafte dieses Schlusses liegt bloß in dem verworrenen Begrif des Nichts und des Etwas. Nichts kan das widersprechende Nichts sein, aber auch das blosse Nichts. Sezet man nur eines fest, welches man wolle, und nimt Etwas als dessen entgegengeseztes an; und behält eben dieselben Begriffe durch den ganzen Beweis; so wird man den Fehler leicht finden, [/] [18] den grosse Leute hier aus Mangel der Deutlichkeit der Begriffe übersehen haben. Man glaubt oft, ein Recht zu haben, Wörter die unerklärt sind, zu gebrauchen, weil man ihre Bedeutung als algemein bekannt voraussezet. Es kan aber sehr leicht in diesen Wörtern noch etwas verworrenes stecken, welches ein anderer auswickelt, und denn entstehen unvermeidliche Streitigkeiten, die gröstentheils Logomachien werden; indem der eine mit diesen Worten eine andere Vorstellung verknüpft, als der andere. Einige beschreiben den Grund durch das, was da machet, daß etwas so und nicht anders sei. Hier ist das Wort machen noch sehr verworren. Ist die Idee, welche mit demselben ver-knüpft ist, wohl so einfach und klar, daß sie keiner weitern Erklärung bedarf? Die Wolfianer sagen nein, und daß sie hierinnen Recht haben, zeiget sich, wenn man Achtung gibt, wie dieser Begrif bei uns entstehet. Wir stellen uns A vor, wir stellen uns B vor, und erkennen, daß wenn das eine gesezet wird, das andere begreiflich sei; und alsdenn sagen wir, A habe B, oder umgekehrt, ge-macht.
§. 8.
Man darf sich nicht wundern, daß bei dem grossen Fleiß, den die Metaphysi-ker auf die Entwickelung der ersten ontologischen Begriffe verwandt, die Klagen über Undeutlichkeit noch gegründet sind. Es ist wahr, die Philoso-phen geben sich bei den ersten Begriffen so viele Mühe, genau und deutlich zu sein, daß andere, die sol[/]ches [19 – B2] Bemühen nicht anders kennen, als in so ferne es unnüz ist, ihre ganze Wissenschaft als eine Wortklauberei ansehen; und dem ohngeachtet bringen so viele es nicht dahin, wohin in der Mathema-tik es ein einziger vieleicht würde gebracht haben. Allein die Verwunderung fält weg, wenn man bedenckt, 1) daß in der Wissenschaft, welche die ersten und algemeinsten Grundsäze der menschlichen Erkentniß lehret, die Begriffe weit reiner und deutlicher sein müssen, als in der Mathematik erfordert wird. Ich habe schon im vorigen §. erinnert, daß man ben Zergliederung der ma-thematischen Begriffe zulezt auf solche komme, die undeutlich sind, und wel-
Davide Poggi
144
che nicht weiter deutlich gemacht werden dürfen, um die Richtigkeit der Säze einzusehen. Aber die Ideen, welche in der Mathematik die allereinfachesten sind, gehören in der Ontologie schon unter die zusammengesezten. Daß man in der Mathematik damit auskommen kan, rührt daher, weil man nur mit einer Art von Bestimmungen der Dinge, nemlich mit Grössen, und in der Geometrie, nur mit ausgedehnten Grössen, zu thun hat, und ihre Verhältnisse untersucher. Dieser Verhältnisse sind aber zudem sehr wenige, nemlich nur zwei, die Gleichheit und Ungleichheit mit ihren Unterarten. Viel weitläuftiger und mannigfaltiger hingegen sind die Gegenstände der Ontologie, in welcher alle mögliche Arten der Bestimmungen der Dinge, und alle mögliche Verhält-nisse derselben aufgesuchet werden sollen. Dahero alles in den Begriffen, was in Absicht auf die Grössen undeutlich bleiben konte, in der [/] [20] Metaphy-sik eben so genau entwickelt werden muß, als das, woraus die Grösse zu beurtheilen ist, in der Mathematik. Einer von den ersten Begriffen in der Ge-ometrie ist der Begrif von der stetigen Grösse. Diese wird beschrieben durch eine Grösse, deren Theile alle so zusammen hängen, daß wo der eine aufhöret, gleich der andre anfänget, und zwischen des einen Ende und des andern An-fang nichts ist, das nicht zu dieser Grösse gehöret. Hierinnen sind viele Wör-ter, wovon eine deutliche Erklärung wohl in der Mathematik, aber nicht in der Metaphysik entbehret werden kan. 2) Es sind weit mehrere Begriffe in der Metaphysik, welche man deutlich machen muß, als in der Mathematik. Eine Gegeneinanderhaltung der Lehrbücher beider Wissenschaften macht dieses klar. Es ist also natürlich, daß unter der grössern Menge der Begriffe leichter etwas übersehen werden kan, als bei einer geringen Anzahl. Wenn nun noch dies hinzu kömt, daß keiner mit den vorigen Begriffen zufrieden sein will, sondern sich nach seinem Gutdüncken neue macht, (und darinnen bestehet oft das mehreste neue eines neuen Systems); so ist leicht zu begreifen, warum die erforderliche Deutlichkeit der Begriffe noch mangelt. Ob es nöthig oder nüzlich sei, die Metaphysik mit einer solchen Menge von Wörtern zu über-schwemmen, und wie, wenn es nothwendig, die Vermehrung derselben auf eine Art geschehen könne, welche der grösten Deutlichkeit nichts schadet, gehöret eigentlich hier nicht her, und kann aus dem erkannt werden, was ich in der Folge [/] [21 – B3] von den ersten Begriffen sagen werde. Drittens ver-stehen die Mathematiker die Kunst, algemeine Begriffe, auch die von den Sinnen am entferntesten sind, durch Hülfe geschickter Zeichen der Einbil-dung als gegenwärtig vorzustellen. Dieses Hülfsmittel mangelt den Metaphy-sikern noch. Die einfachen Begriffe vom Punkt, der Linie, vom Winckel, ha-ben ihr bestimtes Zeichen, und bei jedem Begrif, der aus diesen zusammenge-sezt ist, kommen in dem Zeichen des zusammengesezten Begrifs die Zeichen
Johann Nicolaus Tetens
145
der einfachen zusammen. Dies ist die Ursache, warum ein Quadrat so leicht deutlich gedacht wird, da Sinne und Einbildungskraft, dem Verstande zu Hül-fe kommen. Weit schwerer ist es dem Verstande, in der Metaphysik den Begrif von der Substanz sich deutlich vorzustellen, weil diese Zeichen fehlen.
§. 9.
Indessen wird die Nothwendigkeit, alle Begriffe, besonders in der Ontologie, zu der höchstmöglichen Deutlichkeit zu bringen, durch die Schwierigkeiten, welche sich hiebei vorfinden, nicht gehoben. Wer dies als eine unnöthige Mü-ckensäugerei ansehen wolte, würde verrathen, daß er den Endzweck der Wis-senschaft von den algemeinen Eigenschaften der Dinge nicht kennete. Wer das, was im 7ten §. gesagt worden, überdencket, wird eingestehen, daß der Mangel der gehörigen Deutlichkeit eine Mutter so vieler verworrenen Lehrsä-ze und daher entstehender Streitigkeiten sei; und folglich verursache, daß in der Metaphysik so wenige ausgemachte Wahrheiten anzutreffen.
[/] [22] §. 10.
Hier aber entstehet eine überaus wichtige Frage, mit deren Beantwortung ich mich noch etwas beschäftigen muß. Wie weit soll die Entwickelung der Beg-riffe in der Metaphysik gehen? oder mit andern Worten, welches sind die ein-fachen Ideen, bei welchen man zuletz stehen bleiben kan und muß, aus denen die zusammengesezten Begriffe bestehen? Man kan überhaupt die Frage so beantworten, daß man biß auf die allereinfachesten Begriffe, welche schlech-terdings nicht weiter von uns entwickelt und deutlich gemacht werden kön-nen, hinauf gehen müsse. Denn dies erfordert der Endzweck der Ontologie. Es sollen in derselben die algemeinsten, die allereinfachesten, die allerdeut-lichsten Grundsäze, auf welche die menschliche Erkenntniß sich stüzet, vor-getragen werden. Dieses kan nicht geschehen, daß die Säze dabei evident wer-den, wenn nicht die Begriffe die höchstmögliche Deutlichkeit erhalten. So viel verworrenes in diesen zurück bleibet, so viel fehlet auch den darauf gebaueten Säzen an Deutlichkeit. Wenn man, zum Beweiß, nur verworren die Wür-ckung der Substanzen in der Welt in einander sich vorstellen will; so ist es genug, die Kraft zu erklären durch dasjenige, was den Grund der Wircklich-keit eines Dinges in sich enthält, und vom Grund die Erklärung zu geben, es sei dasjenige, was da machet, daß etwas so und nicht anders sei. Will man aber
Davide Poggi
146
weiter in die Be[/]schaffenheit [23 – B4] dieser Gemeinschaft der Substanzen bringen; so muß der verworrene Begrif, der dem Wort machen anhängt, vor-her zur Deutlichkeit gebracht werden. Alsdenn läßt sich erst untersuchen, ob, wenn eine Substanz in die andere agirt, dies etwas mehr sagen wolle, als, aus der einen sind die Würckungen der andern zu begreiffen.
§. 11.
Um genauer die Deutlichkeit zu bestimmen, zu welcher die Begriffe müssen gebracht werden, muß man die Natur der einfachen Begriffe untersuchen, aus welchen die zusammengesezten bestehen. Hier muß man eine Art einfacher Ideen, die nichts als einfache Empfindungen, entweder innere oder äussere, sind, unterscheiden von einer andern Art einfacher Ideen, die durch die Abs-traction erhalten werden. Jene sind Vorstellungen von Veränderungen, bei welchen nichts von einander zu unterscheidendes mit Bewustsein gemerkt wird; die Veränderung an sich mag von einer oder mehrern Ursachen gewir-cket werden und wirklich zusammengesezt sein oder nicht. So ist die Vorstel-lung von der rothen Farbe ein solcher einfacher Begrif, ferner die Vorstellung eines einfachen Schals, der Bitterkeit und andere, die Lock in seinem vortrefli-chen Buche vom menschlichen Verstande, scharfsinnig untersuchet, ob er gleich solche mit dahin rechnet, die nach genauer Untersuchung aus mercklich verschiedenen Empfindungen bestehen. Das Kennzeichen eines solchen einfa-chen Begrifs ist dieses: nach genauer [/] [24] Beobachtung der Veränderung, die in uns vorgehet, muß nichts können durch gewisse Merckmale von einan-der unterschieden werden, wie solches ben den Ideen von dieser oder iener Farbe, oder eines einfachen Schals statt findet. Es müssen die Erfahrungsbeg-riffe in der Psychologie, wenn sie die gehörige Deutlichkeit haben sollen, alle in solche einfache Empfindungen aufgelöset werden. Es ist aber auch zugleich klar, daß in diesen noch immer etwas verworrenes zurück bleibe, so einfach sie auch sind, weil sie noch immer Empfindungen sind. Und dieses lezte ist die Ursache der wichtigen Wahrheit, daß unsere Erkenntniß von den wirckli-chen Dingen, deren Begriffe uns die Erfahrung lehren muß, nur eines gewis-sen Grades der Deutlichkeit fähig sei, bei welcher noch immer vieles übrig ist, das wir nicht anders als verworren und undeutlich uns vorstellen. Die Deut-lichkeit der Erkenntnis richtet sich immer nach der Deutlichkeit der Begriffe. Es wäre zu wünschen, daß man in der Metaphysik die Erfahrungsbegriffe nur so deutlich gemacht hätte, als sie werden können; es würden der Streitigkeiten weniger und der ausgemachten Wahrheiten mehr sein. Es läßt sich aber die
Johann Nicolaus Tetens
147
Anzahl dieser beschriebenen einfachen Ideen unmöglich bestimmen, weil deren so viele sind, als Veränderungen sich in uns ereignen, in denen wir nichts zu unterscheiden im Stande sind.
§. 12.
Die andere Art der einfachen Ideen wird durch die Abstraction gebildet. Die-se enstehen [/] [25 – B5] auch zulezt aus Empfindungen, wie Lock in der an-geführten Stelle deutlich erweiset, indem die Seele gewisse Bestimmungen auch bei den einfachsten Empfindungen von den übrigen trennet, bis sie end-lich an dem Gegenstand nichts mehr gewahr wird, welches noch ferner zer-gliedert werden könte. Sie kömt auf diese Art so weit, daß sie von dem Object nichts mehr als die Vorstellung behält, daß es ein Etwas sei. Es läßt sich diese Idee nun nicht weiter entwickeln, sondern wenn sie weggenommen wird, bleibt nichts zurück. Dadurch entsteht denn die Idee vom Nichts. Und diese beiden Begriffe sind ohnstreitig einfach. Sezet man beide Ideen vom Nichts und Etwas in einen Begrif zusammen, so läßt sich selbiger nicht denken, und wir erhalten die Vorstellung vom unmöglichen, die schon eine zusammenge-sezte ist. Es giebt aber ausser diesen zweien noch andere, die sich nicht weiter auflösen lassen. So läßt sich in der Idee, Beieinandersein, Nacheinandersein, nichts unterscheiden. Was diese beide lezte betrift, so könte man ihre Ein-fachheit bestreiten dadurch, daß man sagte: man müsse erstlich A, dann B, denken, darauf sie verknüpfen; folglich wären in der Idee des Beieinanderseins verschiedene noch einfachere Ideen zu unterscheiden. Allein der Einwurf fält nach genauerer Betrachtung weg; denn nicht die Vorstellung von A, noch die Vorstellung von B, gehört zu der Idee des Nebeneinanderseins, sondern allein die Idee von der Verknüpfung, und zwar der Verknüpfung neben einander, welche von der Ver[/]knüpfung [26] nach einander unterschieden ist; aber, weil die Idee einfach ist, so können wir dies verschiedene nicht angeben.
§. 13.
Die Philosophen sind nicht einig, wie viel es dieser einfachen Begriffe in uns-rer Erkenntniß gebe. Die Anzahl der einfachen Erfahrungsbegriffe läßt sich, wie ich oben schon erinnert, nicht bestimmen; ob sich aber das Verzeichniß dieser durch die Abstraction einfach gemachter genau angeben lasse, daran ist sehr zu zweifeln. Einige führen sieben an: die Idee der Subsistenz, des Ir-
Davide Poggi
148
gendwosein, des Aussereinandersein, des Aufeinanderfolgen, der Caussalität oder des Machens, des Einheit und der Verneinung. Der berühmte Hr. Prof. Tönnies in Kiel giebt andere an, in seiner ersten disput. de organica generali, in welcher er die Natur der ersten ontologischen Ideen mit vieler Sorgfalt unter-suchet. Er rechnet hieher die allerhöchste Gattung, das Quod, mit seinen bei-den Arten, das Etwas und das Nichts, ferner die Ratio, Materie und Form, die er Nahmen nennt, und vier andere, die bei ihm Grade heissen, nemlich die Möglichkeit, Existenz, Actualität und Actus; denen er aber in seiner vierten Disput. von eben der Materie, noch zehn Verhältnisse beilegt, worunter das zugleich sein, auf einander folgen, verneinen, sezen, mit einander verknüpft sein, getrennt sein u.s.w. gefunden werden. Es gehöret zu meinem jezigen Zweck nicht, diese weiter zu untersuchen. [/] [27] Der Wolfianer wird die Caussalität und das Irgendwosein hier wohl schwerlich stehen lassen. Ich sehe auch nicht, warum das Denken hier nicht eben so wohl angetroffen werde, als das Nacheinandersein. Denn jenes ist so wohl ein von den Empfindungen abgesonderter Begrif, als dieses; und in demselben läßt sich auch eben so we-nig unterscheiden, als in dem leztern.
§. 14.
Bis auf solche einfache Ideen müssen die Begriffe in der Ontologie gebracht werden, wenn alle Undeutlichkeit, so viel als möglich ist, vermieden werden soll; und die zusammengesezten müssen aus diesen einfachen so gebildet wer-den, daß erkant werden könne, welche von diesen darinnen stecken. So lange dies nicht ist, haben wir nicht Ursache, uns über Undeutlichkeit und die daher entstehende Streitigkeiten zu verwundern. Es scheinet aber noch wenig Hof-nung zu sein, daß man es bis dahin gebracht sehe. Es sind sich ja die Philoso-phen noch nicht einig über die einfachen Begriffe; und wie viele Streitigkeiten sind nicht über die Begriffe der Caussalität, des Raums, und der Zeit entstan-den, die von einigen als einfache angesehen werden, von andern aber nicht. Will man die Streitigkeiten, welche hierüber entstanden, entscheiden; so ist es am besten, daß man auf die Empfindungen zurück gehe, aus welchen der be-strittene Begrif entstanden ist, und genau beobachte, was man sich vorstellet, wenn man diese Idee in den Gegenständen gewahr wird. [/] [28] Ich will ein Beispiel nehmen, welches in wichtige Controversien einen Einfluß hat. Es wirst jemand mit der Hand eine Kugel an die Wand. Man sagt, der Mensch mache, daß die Kugel dahin gehe. Aber was empfindet man alsdenn? Caji Arm wird auf eine gewisse Art beweget; die Kugel geht den Weg. Dazu kömt
Johann Nicolaus Tetens
149
dies: Wenn ich die verschiedene Bewegungen des Arms mir vorstelle, so sehe ich ein, oder glaube wenigstens einzusehen, wie es möglich sei, daß die Kugel an die Wand komme. Mehr denke ich nicht; aber weniger auch nicht. Denn so bald ich nicht einsehe, daß eins aus dem andern kan erkannt werden; so bald sage ich auch nicht, dieses habe jenes gemacht, wie die Erfahrung in vielen Fällen uns belehret. Wenn andere darauf bestehen, es werde zum Machen noch etwas mehr erfodert, so kömt es ihnen zu, daß sie es angeben. Wenn man auf eben die Art untersucht, wie wir durch die Empfindung zu der Idee des Raums, des Orts und der Zeit gelangen; so wird man urtheilen können, ob der Wolfianer Begriffe von diesen Dingen zu verwerfen sind oder nicht. Ue-berhaupt ist es nicht genug anzupreisen, daß man bei Beurtheilung der Begrif-fe die Empfindungen untersuchet und auseinander sezet, die man hat, wenn der zu untersuchende Begrif in der Erfahrung vorkömt. Die wahre Beschaf-fenheit des Begrifs wird alsdenn am deutlichsten entdeckt. Es hat der Herr von Maupertuis in seinem Versuch der Cosmologie auf eine vortrefliche Art den Begrif von der Kraft entwickelt; indem er gewiesen, wie [/] [29] derselbe aus den Empfindungen in uns entstehe, welches Verfahren bei ähnlichen Fäl-len zum Muster dienen kan.
§. 15.
Eine andere Ursache, daß wenige Wahrheiten in der Metaphysik ausgemacht sind, ist die Verschiedenheit in den Begriffen, welche von verschiedenen Philo-sophen mit eben denselben Worten verknüpfet werden. Die Vernunftlehrer haben schon längstens angemercket, daß eine unzähliche Menge von Streitig-keiten nichts als Logomachien sind, welche entstehen, indem dieser einen andern Begrif als jener, mit eben denselben Worten verbindet. Dies läßt sich überaus leicht begreifen, daß man glauben solte, man würde diesen Fehler, dessen Entstehungsart man so genau kennet, am ersten vermeiden können. Man braucht weiter nichts als zu bemercken; ob ein anderer, der Meinungen heget, die den unsrigen entgegen sind, nicht etwan andere Begriffe mit den Worten verknüpfe als wir. Aber die Gewohnheit, bei einem gewissen Wort diesen oder jenen Gedancken zu haben, macht, daß wir zuweilen nicht ein-mahl darauf verfallen, daß der Gegner wohl andere Vorstellungen gehabt haben könne, wenn er sich eben derselben Wörter bedienet. Es ist natürlich, daß daraus Widersprüche und Streitigkeiten entstehen, wo jede Parthei Recht hat. Könte man von den gelehrten Controversien diejenige abrechnen, die Logomachien sind, und aus dieser Quelle entstehen; die Anzahl [/] [30] der
Davide Poggi
150
übrigen würde ungemein klein sein. Dies gilt besonders in der Metaphysik, und am meisten in der Ontologie. Die Begriffe, die mit den mehresten Künstwörtern verknüpft sind, sind zusammengesezt aus einfachen. Von die-sem Inbegrif einfacher Ideen verknüpft nicht jeder gleichviel in der Vorstel-lung, die er bei einem gewissen Worte hat; der eine denckt mehr Bestimmun-gen, der andere weniger: oder der eine bringt in seine Vorstellung einfache Ideen, welche von denen einfachen Ideen, woraus ein anderer den zusammen-gesezten Begrif macht, gar verschieden sind, und doch bleibt die Benennung eben dieselbe. Dahero kan es nicht fehlen, es müssen die Prädicate solcher im Grunde verschiedener, aber mit einem und demselben Worte ausgedrückter Objecte verschieden sein; und denn entstehen Streitigkeiten, welche verursa-chen, daß keiner der bestrittenen Säze von allen angenommen, und als eine ausgemachte Wahrheit angesehen werden kann. Man darf die Beispiele nicht mühsam aufsuchen. Viele können sich den Saz, daß aus uncörperlichen und einfachen Substanzen Körper entstehen können, nicht vorstellen. Sie leugnen daher die Existenz der Monaden, und es ist ja bekannt, wie viele Streitigkeiten hierüber entstanden. Ich glaube nicht, daß jemand die Möglichkeit der Ent-stehung der Körper aus immateriellen Theilen, oder unausgedehnten einfa-chen Dingen, nach dem Begrif der Vertheidiger der Monaden, würde in Zwei-fel gezogen haben, eben so wenig als man zweifelt, daß aus Einheiten eine Vielheit werden [/] [31] könne, wenn man beliebet hätte, genauer auf die Beg-riffe Acht zu haben, welche jene mit den Wörtern, immateriel, einfach, unaus-gedehnt, verbinden. Diese Wörter bezeichnen nichts weiter, als ein Ding, in welchem sich keine aussereinander sich befindende Theile, deren jedes beson-ders für sich existiren könne, anzutreffen sind. Nun ist es mir eben so begreif-lich, wie aus solchen Dingen, die selber, jedes für sich genommen, nicht zu-sammengesezt, keine Körper, keine Materie sind, zusammengesezte, Körper, Materie entstehen können, als leicht es einzusehen, wie aus einzeln Erbsen, die jede für sich keine Menge ausmachen, ein Haufe entstehen könne. So geht es in vielen andern Fällen auch.
§. 16.
In der Mathematik hat jedes Wort seine bestimte Bedeutung, und in dieser nehmen es alle. Den Begrif, den Euclides mit den Wort Triangul, Quadrat, u.s.w. verknüpfet, dencken noch alle bei eben diesen Zeichen; und in demsel-ben noch eben dieselbe und eben so viele Theile. Dies macht allen Wortstreit unmöglich. Und weil in allen Beweisen der mathematischen Säze, keine ande-
Johann Nicolaus Tetens
151
re als solche bei allen auf eine Art bestimte Begriffe einen Einfluß haben, so sieht man die Ursache der grossen Einigkeit der Mathematik verständigen. Man findet auch wohl Controversien unter ihnen, und verschiedene, die das vorige nicht wohl bedacht, haben solche Beispiele denen entgegengesezt, die die Mathematik eine friedfer[/]tige [32] Wissenschaft genennet. Es hat der sonst grose Mathematiker Stevin sich genug gezanket, ob die Einheit eine Zahl sei. Clavius und Peletarius stritten sich, ob der Raum, den die Tangente mit dem Cirkul macht, ein Winckel sei. Solcher Beispiele finden sich einige mehr. Aber man sieht auch leicht, daß dieses bloß einige Benennungen und keine Lehrsäze betrift; denn alles, was von dem Raum, den die Tangente mit der Peripherie einschließt, gesagt wird, gilt von ihm, er mag ein Winckel genannt werden oder nicht: und dahero fällt der so gerühmte Vorzug der Mathematik, daß in derselben über keine Wahrheiten ein Streit sei, dadurch noch nicht weg. So solte es in der Metaphysik auch sein, und es könte auch so sein, be-sonders in der Ontologie. Denn es läßt sich gar nicht begreifen, wie in einer theoretischen Wissenschaft, in welcher bloß aus bestimten zum Grunde geleg-ten Begriffen die Säze hergeleitet und bewiesen werden, dergleichen die Onto-logie ist, Controversien können geführet werden, wenn jeder in denen Begrif-fen, die mit eben denselben Wörtern ausgedrücket werden, eben dieselbe und gleich viel einfache Ideen unterscheidet. Die aus den Begriffen unrichtig her-geleiteten Säze könten nichts als ein blosses Versehen sein, wovon der, der es begangen, eben so leicht zu überführen wäre, als der Rechenmeister, wenn er in den arithmetischen Operationen Fehler begangen. In den Streitigkeiten, welche die Crisis eines grossen Mathematikers über Wolfens Anfangsgründe veranlasset hat, ist die Frage nicht [/] [33 – C] sowohl von der Richtigkeit der Säze, als vielmehr, ob Wolf so müsse erkläret werden, daß ihm die Fehler können beygeleget werden, oder nicht. Dahero ist leicht zu schliessen, daß nicht nur einige, sondern alle Controversien in solchen Wissenschaften nichts als Logomachien sind. In den übrigen Wissenschaften aber, in welchen die Gegenstände der Begriffe wirckliche Dinge sind, sehe ich nicht, wie ein Streit, der keine Logomachie wäre, entstehen könne, wenn solcher nicht darüber geführet wird, ob die Begriffe mit den Gegenständen übereinstimmen, oder zu viel, oder zu wenig in sich fassen.
§. 17.
Die Streitigkeiten in der Metaphysik müßen nothwendig abgeschaffet werden, wenn diese Wissenschaft mit ausgemachten Wahrheiten bereichert werden
Davide Poggi
152
soll. Dahero dieser angeführte Fehler entweder ganz und gar gehoben werden muß, so daß von allen jedes Wort in einer Bedeutung genommen werde; oder es muß ein Hülfsmittel gebraucht werden, wodurch alle Zänckereien über Wörter gehoben werden. Das lezte ist ehe möglich, als das erste. Man erwege nur beides genauer. Wolte man in der Metaphysik das erste zu Stande brin-gen, so wäre es nothwendig, daß ein und derselbe Begrif beständig mit eben demselben Worte beleget würde. Dies würde geschehen, wenn die Worterklä-rungen alle gleich viel in sich faßten, oder die Bedeutung der Wörter einmal festgesezet würde, und keiner von dieser ein[/]mal [34] bestimten Bedeutung derselben abgienge, und daran weder durch weglassen, noch hinzusezen, noch durch beides zugleich etwas veränderte. Dies ist aber jezo unmöglich, und wird es so lange bleiben, als man sich noch uneinig ist, welches die Richt-schnur sein soll, nach welcher die Bedeutung der Wörter bestimmt und geprüfet werden soll.
§. 18.
Hiebei aber zeiget sich eine grössere Schwierigkeit, als mancher Vernunftleh-rer sich vorstellet, der die Regul vorschreibet, man solle den Redegebrauch niemals verlassen. Man seze, man wolle die Wörter in der Ontologie von neu-em bestimmen, und ihre Bedeutung fest sezen. So entstehet die Frage, welches die Richtschnur sei, nach welcher die Begriffe abgemessen werden, die man mit den Wörtern verknüpfen soll. Man soll dem Redegebrauch folgen; aber welchem? dem gemeinen, daß man aus den Fällen, in welchen das Wort im gemeinen Leben vorkömt, den Begrif absondere, der damit verknüpft ist? oder den gelehrten? so daß man bei den Wörtern die Begriffe läßt, welche vorhero in dieser Wissenschaft damit verbunden gewesen? Das eine so wohl als das andere läßt sich schwer ausüben, welches man schon daraus erkennen kan, weil alle Philosophen in den neuern Zeiten dem Redegebrauch glauben nachgegangen zu sein, und doch von einander in Bestimmung der Begriffe abgehen. Dies rührt daher. Die mehresten Wörter im gemeinen Leben, mit welchen ein bestimter Begrif verknüpfet [/] [35 – C2] ist, werden unrichtig gebraucht. Eine Eigenschaft wird oft bei gewissen Dingen vorgefunden, wenn wir bloß auf das sehen, was uns die Sinne lehren; da sie doch fehlet, wenn die Vernunft eben diese Gegenstände untersuchet. In diesem Fall erhalten sie doch den Nahmen, der nur denen zukömt, die wircklich diese Eigenschaft besißen. Es hat der berühmte Herr Prof. Profe in Altona in seinen, in diesem Jahr herausgegebenen, philosophischen Gedancken von Sprachfehlern sehr
Johann Nicolaus Tetens
153
scharfsinnig angemercket, daß die Regul, wornach der gemeine Mann die Wörter gebraucht, nicht diese sei: Gegenstände, welche die Eigenschaften an sich haben, wenn man sie philosophisch ansiehet, sollen mit den Nahmen bele-get werden, welche diese Eigenschaften ausdrücken, sondern so: Gegenstände, bei welchen man diese Eigenschaften, nach der historischen oder sinnlichen Erkenntniß gewahr wird, sollen so benannt werden, als wenn sie diese Eigen-schaften wircklich befässen. Der Gebrauch gewisser Wörter im gemeinen Le-ben lehrt dieses. Zum Beweiß: Die Sonne verliehrt ihr Licht, geht auf und unter, der Mond ist ein Licht, und viele andre. Wie soll man in diesen Fällen dem Redegebrauch folgen? Will man eben die Begriffe behalten bei dem Gebrauch der Wörter, die der gemeine Mann hat, so ist man offenbahr ge-nöthiget, vielen Dingen die Benennungen zu versagen, welche ihnen von den übrigen Menschen beigeleget werden. Man müste behaupten, es sei falsch, daß die Sonne verfinstert werde, und daß [/] [36] der Mond ein Licht sei. Ich will ein Beispiel aus der Ontologie nehmen. Gibt man auf den Gebrauch des Worts zufällig acht, so wird man finden, daß die Vorstellung damit verknüp-fet sei, es habe ein zufälliges Ding in dem vorhergehenden keinen zureichen-den Grund, und man schreibt Dingen eine Zufälligkeit zu, bei denen man das Dasein eines zureichenden Grundes in den vorhergehenden nicht gewahr wird. Will der Wolfianer diesen Begrif bei dem Wort zufällig behalten, so müste er leugnen, daß ein zufälliges Ding in der Welt gefunden würde, er müste sich also dieses Worts, als eines solchen, mit welchem kein wahrer Ge-dancke verknüpft ist, gar nicht bedienen; und wie viele Wörter würden nicht unbrauchbar werden, wenn man bei allen ähnlichen eben so verfahren wolte. Man würde auf diese Art mit dem gemeinen Mann dencken, aber nicht mit ihm reden. Oder will man die Nahmen der Gegenstände beibehalten, so ist man genöthiget, andre Begriffe mit denselben zu verbinden. Will Wolf nach seinem System den Begebenheiten der Welt eine Zufälligkeit beilegen, so muß er bei diesem Wort etwas ganz anders dencken, als der gemeine Mann. Will der Astronom sagen, die Sonne werde verfinstert, sie gehe auf, so muß er doch bei diesen Worten ganz andre Begriffe haben, als im gemeinen Leben ge-schieht. Alsdenn wird man der gemeine Regul folgen: sentimus cum doctis, loquimur cum vulgo. Welches von diesen beiden soll geschehen, wenn obge-dachte Fälle, die häufig sind, sich ereignen? Daß diese lezt[/]angeführte [37 – C3] Regul nicht algemein angenommen werde von den Philosophen, erhellet daraus, daß sehr viele gegen Wolfen bittere Klagen wegen des verlassenen Redegebrauchs führen, weil er selbiger gefolget. Und das erste kan verschie-dener Ursachen wegen auch nicht allemahl beobachtet werden, wie aus dem folgenden noch erhellen wird.
Davide Poggi
154
§. 19.
Noch viel weniger kan man sagen, daß die Philosophen wegen des gelehrten Redegebrauchs einig wären. In allen Logiken steht zwar die Regul: a recepto terminorum significatu haud est recedendum; aber man sezet hinzu, sine nece-cessitate, und diese Nothwendigkeit findet sich ihren Gedancken nach oft. Welcher Philosoph soll das Muster sein, nach welchem wir die Bedeutung der Kunstwörter fest sezen wollen? Als Aristoteles noch vorzüglich der Philo-soph genennet wurde, schienen die mehresten einig zu seyn, so wie seine Säze, also auch seine Begriffe beizubehalten. Die ein anderes System aufgerichtet, haben auch jederzeit die Begriffe verändert. Bei der jezigen Verfassung der Metaphysik ist es eben so unmöglich, einerlei Begriffe einzuführen, als es unmöglich ist, alle Philosophen mit einander zu vereinigen. Man ist viel zu eigensinnig, als daß man sich von einem jetz lebenden Metaphysiker solte vorschreiben lassen, wie man reden solle, und wen einer der schon verstorbe-nen zur Vorschrift solte genommen werden, so würde man eben so wenig sich hierüber einig werden. Denn wer solte es [/] [38] sein? Aristoteles, Cartesius, der Leibniz und Wolf? Die Gegner des Wolfischen Systems werden sich nimmer bequemen, die Begriffe desselben anzunehmen. Sie führen so viele Beschwerden darüber, daß man fast auf die Gedancken gerathen solte, als wären es bloß Bedeutungen gewisser Wörter, worinnen sie von ihnen abge-hen; und diese, die Nachfolger Wolfens, werden sich sehr sträuben, die schon verlernten Wörter der Aristotelischen Weltweisheit wieder anzunehmen. Sie können dieses auch aus gewissen Ursachen nicht. Denn ob sie gleich ihrem System nichts vergeben, wenn sie die Begriffe ihrer Gegner annehmen; so würden sie doch auf die Art Säze behaupten müssen, die sehr paradox klin-gen, und sehr leicht zu allerhand Beschuldigungen Anlas geben können. Ge-sezt, sie nennten das zufällig, was andre so nennen, nemlich das, was in dem vorhergehenden keinen zureichenden Grund hat. Was wäre daran gelegen? Aber sie müsten alsdenn behaupten, daß keine Zufälligkeit in der Welt statt finde. Wolten sie die Freiheit eben so erklären, wie andere berühmte Philoso-phen, nemlich durch ein Vermögen nach deutlicher Einsicht sich zu bestim-men, wenn gleich keine Motiven zu dieser Bestimmung vorhanden, oder nicht mehrere und nicht stärckere als zu dem entgegengesezten, so würde ihre The-orie dadurch nicht umgestossen, aber sie wären gezwungen zu sagen, es sei keine Freiheit in der Welt; ein Saz, der sehr leicht von ihren Gegnern ge-braucht werden könte, um sie verdächtig zu machen, und ihnen gefährliche [/] [39 – C4] Säze aufzubürden. Für ihre Ruhe ist es am sichersten, daß sie so reden, wie andre, und streiten ob man auch so dencken müsse. Es gewinnet
Johann Nicolaus Tetens
155
der Gegner sonsten in der That nichts, wenn man sich bequemet, mit den Wörtern eben die Begriffe zu verknüpfen, die er damit verbindet: denn man läugnet alsdenn seine Säze. Man nehme an, es sei der Begrif, den Spinoza mit dem Wort Substanz verbindet, der rechte, und man nenne eben das eine Sub-stanz, was er so genennet. Wird ihm dadurch etwas zugegeben? Im geringsten nicht. Es ist höchst irrig, wenn man glaubet, sein Gott läugnendes System werde durch den falschen Begrif von der Substanz befestiget. Es kan sein, daß er durch diesen falschen Begrif in seinen verabscheuungswürdigen Irthum verfallen; aber es liegt der Fehler eigentlich darinnen nicht. Es hat der, nun-mehro Hochwürdige Bischof in Drontheim, Herr Gunner, in seiner Theodi-cee gar richtig angemercket, daß das Versehen des Spinozä eigentlich in den fehlerhaften Schlüssen zu suchen sei, welche er aus seinem Begriffe herleitet, indem er die Säze von den Substanzen und Accidentien, die bei andern Philo-sophen vorkommen, auf seine Substanzen und Accidentien anwendet, welche doch von jenen himmelweit verschieden sind. Die Anmerckung des Baile von dem Spinozistischen System ist volkommen richtig: es sei der Grund dessel-ben eine so elende Sophisterei, daß sie kaum einem Anfänger in der Vernunft-lehre entwischen werde.
[/] [40] §. 20.
Aus diese ersiehet man mehr leicht, daß die Hofnung verlohren, die Einigkeit in den Begriffen, die bei eben den Wörtern verknüpft sind, einzuführen. Es ist dahero zu versuchen, ob man nicht, da der verschiedene Gebrauch der Wörter nicht gehoben werden kan, den daraus entstehenden Logomachien auf eine andere Art vorbeugen könne. Man hat dies durch die Worterklärungen auszu-richten gesucht, und diese haben vieles geholfen. Denn wie ich schon oben erinnert, es liegt so viel nicht daran, in welcher Bedeutung dieser oder jener ein Wort nimt, wenn er nur anzeigt, wie er es wolle genommen wissen. Es lassen sich alle seine Schlüsse eben so gut beurtheilen und Wortstreitigkeiten vermeiden, als wenn er das Wort eben so gut gebraucht als wir, wenn man nur auf den Begrif aufmerksam ist, den der Verfasser gehabt, und denselben bei Beurtheilung aller Säze vor Augen hat. Dem ohnerachtet aber lehrt doch die Erfahrung, daß aller Wortstreit noch nicht gehoben. Es sind hier zwo Hin-dernisse, welche dieses angewandte Mittel unkräftig machen. Einmahl, so werden die Worterklärungen nicht allemahl so eingerichtet, daß die verschie-dene einfache Begriffe, woraus der zu erklärende zusammengesezt ist, gehörig auseinander gesezet werden. Es trägt sich oft zu, daß die verschiedene Ideen,
Davide Poggi
156
die einen Begrif ausmachen, wiederum zusammengesezet sind, und bis auf diese lezte wird die Auflösung der Begriffe nicht fort[/]gesezt [41 – C5], damit man auf den ersten Grund der Abweichung der Begriffe eines andern von den unsrigen kommen könne. Die Natur unserer Sprache leidet es nicht, daß eine jede einfache Idee ihr besonderes Zeichen hätte, und daß diese Zeichen der einfachen Ideen in dem Zeichen eines zusammengesezten Begrifs so könten verknüpfet werden, daß aus demselben die einfachen Begriffen solten können erkant werden; dahero die Auflösung der Begriffe eines andern oft so schwer ist, daß man oft der wahren Meinung eines tiefsinnigen Weltweisen verfehlet. Dazu komt noch zweitens, daß uns wegen des häufigen Gebrauchs gewisser Wörter ihre Bedeutung so geläufig wird, daß wir bei Gewahrwerdung dieses Worts kaum uns einfallen lassen, daß eine von der unsrigen verschiedene Be-deutung damit solte verbunden sein. Irre ich nicht, so ist dies die Ursache, warum wenige von denen, die die Leibnizische Vorstellungskraft der Mona-den belachen, hinter die wahre Meinung dieses Philosophen gekommen, son-dern ich weiß nicht welche Phantasien ihm beilegen. Seine Meinung war diese. Jede Monade hatte vermöge des algemeinen Zusammenhangs gegen alle übri-ge Theile der Welt besondere Verhältnisse, die von den Verhältnissen eines jeden andern unterschieden; daher können aus einer jeden solcher einfachen Substanzen alle übrige Theile der Welt, obgleich nur von einem unendlichen Verstande, erkannt werden, d. i. wie er sich ausdrückte, jede Monade stellet die ganze Welt vor, bildet sie ab, ist ein Spiegel derselben. Nun kömt nach dem [/] [42] System der vorherbestimten Uebereinstimmung dieses hinzu, daß jede Monade alle ihre Veräuderungen, folglich auch ihre verschiedene Ver-hältnisse, durch ihre eigene Kraft wirklich macht. Ein Ding aber, welches die in ihm vorhandene Abbildungen oder Vorstellungen durch seine eigene Kraft hervorbringt, stellet sich etwas vor. Was war richtiger nach diesen Grundsä-zen, als daß die Monaden sich die Welt vorstellen musten, und also hiezu auch eine vorstellende Kraft besizen? Seine vorstellende Kraft war also nichts an-ders, als die innerliche Kraft jeder Substanz, alle ihre Veränderungen, und folglich ihre Verhältnisse gegen alle übrige Theile der Welt, woraus diese kön-nen erkannt werden, selbst zu wirken. Das Wort, vorstellende Kraft, aber macht, daß viele diese Gedanken für lächerlich angesehen, in welchen doch nichts ist, was nicht aus der Lehre von dem algemeinen Zusammenhang, und von der vorherbestimten Uebereinstimmung, nothwendig folget. Es waren die Benennungen, vis repraesentativa, speculum mundi, microcosmus, Ge-burthen des Wizes, wohin in der Analisis das Küssen der Linien, und in der Psychologie das Beschwängern des Gegenwärtigen von dem Vergangenen, woraus das Künstige gebohren wird, auch gehören.
Johann Nicolaus Tetens
157
§. 21.
Nichts könte diese fruchtbare Quelle der Wortstreite besser verstopfen, und eine Gleichheit der Begriffe mit einem Zeichen leichter einführen, [/] [43] als eine solche algemeine Sprache, auf deren Erfindung der unsterbliche Leibniz dachte. Und es ist wohl unstreitig, daß die häufigen Verwirrungen, die aus dem verschiedenen Gebrauch der Wörter in unserer gewöhnlichen Sprache herrühren, diesen grossen Mann bewogen, darauf zu sinnen. Nun ist sie frei-lich noch nicht da, und wir können daher ihren Nuzen so volkommen nicht beurtheilen; aber so viel weiß man doch, daß sie, wenn sie erfunden wäre, alle Logomachien auf einmahl aufheben würde. Jede einfachs Idee solte mit einem gewissen Zeichen beleget werden, die zusammengesezten Begriffe aber mit einem zusammengeseßten Zeichen, welches so viele einfache Zeiche in sich enthalten, als einfache Ideen den Begrif ausmachen. Das Verknüpfen der ein-fachen Zeichen solte nach gewissen algemeinen Reguln gescheben, und dieser, die auch signa primitiva genannt werden, solten nur wenige sein. Ein Begrif auf solche Art ausgedrückt, könte gleich deutlich und genau erkannt werden. Man würde jede Veränderung, welche mit einem Begrif vorgenommen würde, augenblicklich an den Zeichen erkennen, und da die primitiven Zeichen alge-mein wären, so würde gleich erhellen, ob ein Begrif mehr oder weniger, oder etwas anders in sich fasse, als ein anderer. Kämen in einem zusammengesezten Zeichen sehr viele einfache vor, so könte statt dieser aller ein einziges anderes Zeichen gebraucht werden, welches um deswillen keine Zweideutigkeit verur-sachen würde, weil man allemahl statt desselben, wenn es erfodert würde, die einfachen wieder nehmen könte, deren Stelle [/] [44] es vorhero vertreten hatte. Die Mathematiker haben in der Analysis eine solche Sprache; nur mit diesem Unterscheid, daß die primitiven Zeichen eines Begrifs nicht immer dieselben sind. In der höhern Geometrie pflegt man wohl gemeiniglich die Ordinate mit 7, die Abscisse mit x, und den Subtangenten mit ydx: dy zu be-zeichnen; aber nicht beständig. Statt der zusammengesezten Quantitäten, welche die Rechnung beschwerlich machen, setzen sie oft eine einfachere, die sie, nach geschehner Operation wieder mit denen, deren Stelle sie vertreten, verwechseln, wodurch eine grosse Reihe Schlüsse aufs gewisseste und richtigs-te in kurzer Zeit gemacht werden kan.
Davide Poggi
158
§. 22.
Die Philosophen haben gewünscht, daß diese Sprache, ihres wichtigen Nu-zens wegen, erfunden, und in die Metaphysik eigenführet sein mögte; aber bis jezo sind noch so viele Schwierigkeiten dabei gefunden worden, daß es micht nur unterblieben, sondern auch von vielen vor unmöglich gehalten worden. Der Freiheit von Wolf verstrach einmal darauf zu dencken, weil Leibniz über dieser Arbeit wegstarb, man weiß aber nicht, daß er etwas zu Stande gebracht. Leibnizens Vorsaz ging so weit, daß ich nicht weis, ob er möglich oder un-möglich sei. Er wolte eine solche algemeine Sprache einführen, die von allen Menschen gleich solte verstanden werden. Dazu war nicht nur das obener-wähnte nöthig, daß alle einfache Ideen einer Sprache mit gewissen einfachen Zeichen ausge[/]drücket [45], und aus diesen nach gewissen Reguln andere zusammengesezt würden; sondern noch überdem dieses: die einfachen Zei-chen müssen von der Beschaffenheit sein, daß aus Erblickung derselben sogleich von allen die bezeichnete Sache erkannt werden könte, oder sit müsten wesentliche Zeichen, wie einige sie nennen, sein. Ob diese lezterwähn-te Eigenschaft der Zeichen möglich sei oder nicht, weis ich nicht zu beurthei-len. Das Bemühen derer, welche dergleichen zu finden sich bestrebet, scheinet bis jezo noch vergeblich gewesen zu sein. Wir können auch nicht sagen, daß die Sprache der Mathematiker eine Probe hievon sei, denn ihre Zeichen haben die Eigenschaft nicht, daß man gleich ohne weitere Anweisung ihre Bedeu-tung erkenne; daß x die Abcisse bedeute, y die Ordinate, weiß niemand, dem es nicht ist gesaget worden: auch sind sie, wie schon vorhero erinnert, nicht beständig, und können eben so wenig unter die vorher beschriebenen wesent-lichen Zeichen gerechnet werden, als barbara, celarent, u.s.w. der Vernunft-lehrer. Läßt man dieses aber weg, und verlanget nichts mehr, als eine Sprache, welche so bald würde verstanden werden, so bald man die wenige einfache Ideen, welche mit den primitiven Zeichen verbunden, und die Reguln, nach welchen die Zusammensezung geschähe, wüste: so würde es darauf ankom-men, daß der einfachen Begriffe nur nicht in einer volständigen Sprache gar zu viel wären. Denn wäre dieses, so würde die Anzahl der einfachen Zeichen zu groß werden, als daß die gehoste Bequemlichkeit erhalten werden könte. [/] [46] Es scheinet aber wircklich diese so sehr groß nicht zu sein. Leibniz ließ aus den Wörterbüchern die sogenannten Wurzelwörter oder Grundwörter zusammensamlen; allein die Zahl der einfachen Ideen kan so groß nicht sein, als die Zahl dieser Wörter; denn bei weiten nicht alle Wurzelwörter bezeich-nen einfache Ideen. Die mehresten mit denselben verknüpfte Begriffe sind zusammen gesezt. Es würden ferner die grösten Schwierigkeiten entstehen,
Johann Nicolaus Tetens
159
wenn algemeine Reguln solten erdacht werden, nach welchen die primitiven Zeichen verbunden werden müsten, wenn nicht nur die einfachen Ideen an sich, sondern auch alle ihre verschiedene Verhältnisse bezeichnet werden son-ten.
§. 23.
Wenn aber gleich eine Sprache von dieser Art, die zugleich volständig wäre und sich auf alle Begriffe erstreckte, unmöglich wäre; so liesse sich doch viel-leich eine philosophische Sprache verfertigen, welche in der Metaphysik, be-sonders in der Ontologie, brauchbar wäre. Den schon vorhin angeführte Herr Prof. Tönnies hat in seiner dritten disput. de organica generali von einer sol-chen philosophischen Sprache die Elemente geben wollen. Seine oben im 13ten §. erzählt erste und einfache Begriffe, werden jeder mit einem besondern Zeichen belegt, denen er noch etliche andere beifüget, um die verschiedene Zeitpunkte auszudrücken. Es entstehen auf die Art der ersten Zeichen, oder Buchstaben dieser Sprache, etliche dreißig, mit welchen der Herr Professor alle ontologische Begriffe aus[/]drücken [47] will. Die Ordnung, in welcher die Zusammensezung dieser einfachen Zeichen geschehen soll, wird durch einige wenige Reguln bestimt; und die Zeichen selbst sind Consonanten der griechischen und lateinischen Sprache, welche mit Selbstlautern untermischt sind. Es ist nicht zu leugnen, daß diese Einrichtung scharfsinnig ausgedacht sei. Es würde auch zur Erlernung dieser Sprache nicht viel mehr Mühe erfor-dert, als dazu gehöret, das A B C kennen zu lernen; und der Nuzen würde dieser sein, daß man wenigstens in der Ontologie seine Begriffe so genau aus-drücken könne, daß alle einfache Ideen in denselben zugleich erkennet wür-den. Ich kan mich jezo in eine genaue Untersuchung dieser ontologischen Sprache nicht einlassen, zweifle aber, daß sie algemein werden werde. Ich will nur dies erinnern. Die Zahl der einfachen Zeichen ist noch zu groß, und könte auch vermindert werden, wenn viele der angegebenen einfachen Begriffe, die doch zusammengesezt sind, zergliedert würden. Es müste erst ausgemacht werden, welches und wie viele der einfachen Ideen sind. Auch scheinen Zwei-deutigkeiten unvermeidlich zu sein, wegen Aehnlichkeit der Zeichen, wenn noch mehr zusammengesezte Begriffe ausgedrücket werden sollen, als die sind, die der Herr Prof. zur Probe angegeben.
Davide Poggi
160
§. 24.
Man kan aber den Vortheil, welchen ein solches Verfahren gewähren würde, noch auf eine leichtere Art erhalten, wenn man es so macht, wie die Mathema-tiker. Es ist nicht nöthig, jedem ein[/]fachen [48] Begrif sein bestimtes Zeichen zu geben, sondern man kan nach seiner Bequemlichkeit bald dieses bald jenes nehmen, nur daß man, wie diese thun, es vorhero anzeige. Diese, die gleich-sam primitive Zeichen wären, könte man durch Verbindungswörter aus uns-rer Sprache mit einander verknüpfen, weil doch bei den mehresten Partikuln unsrer Sprache von allen eben dasselbe gedacht wird. Man würde auf diese Art die Begriffe eben so genau bestimmen können, als auf die vorhin ange-führte, und der Vortheil dieser leztern Methode wäre, daß wir nicht an gewis-se Zeichen gebunden, noch an gewisse Reguln der Zusammensezung. Begrif-fe, sie auch schon zusammengesezt, könten als einfach angesehen werden, und man brauchte, um sie auszudrücken, sich nicht erst zu besinnen, welche Zei-chen den einfachen Ideen, daraus sie bestünden, zukämen. Man würde also von Erlernung einer ontologischen Sprache befreit, an welche sonsten viele, obgleich vielleicht ohne Grund, sich stossen würden. Die Metaphysiker haben es auch zum Theil schon so gemacht, daß sie angefangen sich gewisser Buch-staben als Zeichen der Begriffe zu bedienen. Wenn man dies nur so weit trie-be, daß die verschiedene Ideen, woraus man einen Begrif machet, jede für sich mit einem Zeichen belegte, so wäre das, was ich verlanget, erhalten. Denen, die eine Probe davon haben wollen, um einzusehen, wie sehr die Deutlichkeit durch Gebrauch solcher Buchstaben befördert werde, will ich auf des Hrn. Prof. Crusius Entwurf der nothwendigen Vernunftwahrheiten §. 471. verwei-sen, denn es [/] [49 – D] ist die Stelle zu lang, um sie hier abzuschreiben. Nur muß man vorhero mit dieser Art sich auszudrücken, ein wenig bekannt sein; und dies ist eine leichte Sache. Es hat überhaupt der Gebrauch gewisser, bestimter, algemeiner Zeichen, an statt der Wörter unsrer Sprache seinen gros-sen Nuzen. Wir würden gewiß eine Menge Reguln in der Logik, besonders in der Lehre von den Säzen und der Umkehrung derselben, entbehren können, wenn wir das Subject und Praedicat mit ihrer Quantität durch algemeine Zei-chen auszudrucken suchten.
§. 27.
Ich komme auf eine dritte Ursache, welche in der Metaphysik den Anwachs unserer Erkenntniß hindert. Sie ist diese: man legt Begriffe zum Grunde, man
Johann Nicolaus Tetens
161
leitet aus ihnen Folgerungen her, ohne gehörig erwiesen zu haben, daß diese Begriffe nichts unmögliches in sich fassen. Die Folgen, welche hieraus entste-hen, müssen einem jeden, der die Vernunftlehre versteht, bekannt sein, daß ich nicht nöthig habe, sie hier auseinander zu sezen. Ich will nur zeigen, daß diese Fehler häufiger von den Metaphysikern begangen werden, als viele glauben.
§. 28.
Zu dem Ende muß ich von der Möglichkeit etwas voraus sezen. Man ist dar-innen einig, daß die Begriffe eines Dinges, wenn dieses möglich sein soll, nichts wiedersprechendes in sich fassen müsse; daß folglich alle Bestimmun-gen, die man in diesem Begrif sezet, mit einander übereinstimmen müssen; und wenn der Begrif eines Dinges diese Eigen[/]schaft [50] hat, ist dieses Ding wenigstens an und für sich möglich, wovon aber die hypothetische Möglich-keit eines Dinges noch unterschieden, als wozu ausserdem noch mehr erfor-dert wird. Hieraus folget unmittelbar, daß die einfache Ideen, welche den zusammengesezten Begrif ausmachen, nicht etwan in einer oder der andern Absicht mit einander übereinstimmen müssen, sondern in aller Absicht, so daß in allen innerlichen una äusserlichen Bestimmungen, der einen nichts vorkommen, welches mit etwas in den Bestimmungen des andern einen Wi-derspruch machte. Die Möglichkeit der unendlichen Theilbarkeit der Körper sich vorzustellen, ist nicht hinreichend, wenn man sich vorstelt, daß der Begrif der unendlichen Theilbarkeit mit dem Begrif der Ausdehnung gar nicht be-stehen könne; es liegt noch mehr in dem Begrif des Körpers als die Ausdeh-nung, wo man nicht des Cartesii System annimt. Man muß mit allen Bestim-mungen des Körpers die Vorstellung, daß selbiger ins unendliche in noch kleinere Theile könne aufgelöset werden, zusammensezen, und wenn denn kein Widerspruch da ist, so ist der Begrif der unendlichen Theilbarkeit des Körpers wahr, oder der Gegenstand dieses Begrifs ist möglich.
§. 29.
Diese Möglichkeit eines Dings kan man auf eine zwiefache Art beweisen. Man kan a posteriori, wie man zu reden pflegt, aus der Wirklichkeit des Dings,
Davide Poggi
162
oder seiner Wirkungen zurück schliessen, daß es möglich sei. Alsdenn erkennen wir nur die Möglichkeit einer Sache, aber [/] [51 – D2] wir sehen sie noch nicht ein, welches verschiedene Dinge sind. Es ist hiezu nicht nöthig, daß das mög-liche Ding auf eben die Art existirt, als wir es möglich gedencken. Denn wenn die Erfahrung lehrt, daß verschiedene Eigenschaften in einem Dinge beisam-men sind, so können wir richtig die Folge machen, daß ein Begrif, in welchen wir nur etliche von diesen Eigenschaften mit einander verknüpfen, nichts unmögliches in sich fassen könne. Was die Vernunftlehre von dem Beweise der Wahrheit der Begriffe, durch die Erfahrung saget, gehöret hieher. Ich darf mich hiebei nicht aufhalten. Man kan zweitens die Möglichkeit einer Sache a priori, wie man redet, oder aus dem Begriffe des Dinges selbst erweisen, und wenn dies geschicht, so lernen wir die Möglichkeit dieses Dinges einsehen. Und dieser Beweis ist es, den man in der Metaphysik nicht gehörig führet; wenn man das, was im vorigen §. beigebracht ist, gehörig überleget, so wird man leicht sehen, was erfodert werde, wenn man die Möglichkeit einer Sache so beweisen wolle, daß der Verstand diese Möglichkeit einsehen solle. Es ge-höret dazu eine volkommene Deutlichkeit des Begrifs, daß man alle einfache Ideen, woraus er bestehet, in allen ihren Bestimmungen gegeneinander halten und erkennen könne, daß nichts widersprechendes darinnen vorgefunden werde. Erkennet man dieses, so erkennet man alles was zu der Sache, welche der Gegenstand des Begrifs ist, erfodert wird; was geschehen müste, wenn dies Ding zur Wircklichkeit gebracht werden soll, woferne es ein solches ist, das nicht nothwen[/]dig [52] existiret; und komt nun dieses hinzu, daß wir die wirckende Ursachen, die jedes Theil der Sache, wenn es wircklich werden soll, voraussezet, und die Art, wie die Ursache agiren muß, um es wircklich zu machen uns auch vorstellen; so erkennen wir volkommen die Entstehungsart des Dinges. Dies lezte ist aber nicht nöthig, und auch bei Dingen, die nothwendig existiren, nicht möglich. Einige machen einen Unterscheid zwi-schen der blossen Möglichkeit, und die Art wie etwas möglich sei. Dieser Unterscheid ist gegründet, wenn die Frage, auf welche Art ist etwas möglich? so soll beantwortet werden, daß man die wirckenden Ursachen und ihre Art zu wircken, oder dieses allein mit angeben soll; wenn aber hierauf nicht gese-hen wird, so sieht der, welcher die Möglichkeit eines Dinges, das nicht nothwendig existiret, einsiehet, zugleich ein, wie es geschehen müsse wenn das Ding produciret werden sol.
§. 30.
Man kan aus der Mathesi dies gesagte mit vielen Beispielen erläutern, weil in demselben kein Begrif zum Grunde gelegt wird, dessen Möglichkeit nicht
Johann Nicolaus Tetens
163
entweder für sich evident ist, oder aufs genaueste bewiesen wird. Man will z.B. die Möglichkeit eines Quadrats darthun. Es ist dazu ein deutlicher Begrif nöthig, man muß wissen was ein Quadrat sei. Dies lehrt die Nahmenserklä-rung desselben; es ist eine Figur von vier Seiten, die einander gleich sind und recht wincklich zusammengesezt. So bald man diesen Begrif entwikelt, und sich vorstellet, was recht wincklich zusammen gesezt sei, gleiche Seiten und Figur, sagen [/] [53 – D3] wolle; so bald erkennet man auch was geschehen müsse, wenn ein Quadrat wirklich werden söll. Weil aber das Quadrat sowol als alle mathematische Figuren nicht nothwendig existiren, und folglich durch ein gewisses Verfahren wirklich gemacht werden könne, so sucht man selbiges auf. Die wirckenden Ursachen sezt man voraus, und zeiget alsdenn, daß wenn zwei gleichseitige Triangul zusammengesezet werden, so daß eine Seite beiden gemeinschaftlich wird, ein Quadrat heraus komme; und denn ist die Entste-hungsart ausgemacht. Es ist klar, daß dieses leztere nicht nothwendig sei, um einzusehen, daß das Quadrat möglich sei. Weil aber der Verstand, wenn er die Entstehungsart eines Dinges erkennet, desto gewisser einsieht, daß er sich in Absicht auf die Möglichkeit nicht betrüge; so trachtet er beständig bei den Dingen, die entstehen können, dahin, daß er die Art und Weise einsehe, wie sie möglich sind; beruhiget sich auch nicht ehe, bis er selbiges herausgebracht. Dies ist auch die Ursache, warum wir an der Möglichkeit gar nicht mehr zweiffeln, wenn wir die Entstehungsart eines Dinges einsehen, weil diese jene nothwendig voraussezet.
§. 31.
Nun laßt uns hiemit das Verfahren der Philosophen in der Metaphysik ver-gleichen. Haben sie es so gemacht, als das vorhergesagte es erfodert? Ich will bitten, daß man ein paar Lehrbücher der Metaphysik für sich nehme, und die Begriffe, welche durch die Bestimmung oder durch die Absonderung gebildet sind, beleuchte. [/] [54] Man wird finden, daß zwar kein Widerspruch in die Augen falle, auch wohl gar nicht erwiesen werden könne; aber daß dieser Widerspruch unmöglich sei, oder daß die Möglichkeit gehörig dargethan sei, wird man sehr oft vergebens suchen. In den meisten Fällen ist nur die von einigen so genante undeterminirte oder negative Möglichkeit da, welche statt findet, wenn man einen Begrif nur darum für möglich hält, weil wir zwischen dem, was wir darinnen denken, keinen Widerspruch zeigen können. Wenn ein gewisser Philosoph die Substanzen durch die Bestimmung in zwei Haupt-arten eintheilet, in Feuer- und Wasser-Substanzen, davon jene solche sind,
Davide Poggi
164
deren Kraft wesentlich zur Bewegung; diese deren Kraft wesentlich zur Ruhe bestimt sei, so frage ich, woher man einsehe, daß diese Abtheilungen möglich sind. Man antwortet, es stecke kein Widerspruch darinnen, sonsten mögte man ihn zeigen; man könne keine gewahr werden. Dieses thut man dar, indem man frägt, ob es mit dem Begrif der Substanz, oder mit dem Begrif der Kraft streite, daß sie wesentlich zur Ruhe oder zur Bewegung bestimt sei? Wenn nun keines kan erwiesen werden, so glaubt man berechtiget zu sein, diese herausgebrachten Begriffe vor volkommen möglich zu halten. Die Möglich-keiten in der Geisterlehre von den verschiedenen Arten der denkenden Wesen die man a priori bestimt, werden aus eben dem Grunde für richtig angenom-men. Dies wäre alles gut, wenn aus dem Nichtgewahrwerden eines Wider-spruchs schon die Unmöglich[/]keit [55 – D4], daß selbiges da sei, gefolgert werden könne. Wenn ein Begrif in alle seine einfache Ideen aufgelöset; wenn jedes derselben mit allen seinen Bestimmungen, die bei denselben vorkom-men, mit dem andern verglichen wird, und sie alsdenn keinen Widerspruch in sich fassen, so wird man die wahre Möglichkeit eingestehen müssen. Aber haben wir denn von den Substanzen, und von der Kraft, so volständig deutli-che Begriffe als hiezu erfodert werden? Das was wir von ihnen erkennen, ist vielleicht das allerwenigste, und wir können daraus so wenig richtig schliessen, daß Substanzen möglich sind, die wesentlich zur Ruhe bestimt sind, als jener der ein Luftschif, und eine Mondpost möglich zu sein glaubte, weil er keine Schwierigkeiten hiebei vorfand. Wolte jemand sagen, es sei gleichwohl in abs-tracto, wie man zu reden pflegt, möglich, und mehr verlange man nicht, so hiesse das eben so viel, als wenn man sagte, dafern die Substanz nichts mehr an sich hat, als ich dabei denke, und bei der Kraft nicht mehr Bestimmungen sind, als ich mir vorstelle, so läßt sich dieses mit einander zusammenreimen; aber wozu wäre dieses in der Metaphysik nüze? Man kan auch sagen, wenn bei dem Körper nichts mehr als die Ausdehnung erwogen wird, so ist es mög-lich, daß er ins Unendliche theilbahr sei; aber kan man deswegen den Saz festsezen, der Körper sei ins Unendliche theilbahr? Wenn man aus solchen möglichen Begriffen Folgerungen macht, und ganze Theorien von den ver-schiedenen Arten der Monaden und der Geister aufbauet, ist es zu [/] [56] bewunden, daß sie so wenig Beyfall finden, und von vielen höchstens als ver-nünftige Romanen abgesehen werden?
§. 32.
Man darf sich hierüber gar nicht wundern, denn 1) ist es höchst schwer die Möglichkeit der Dinge in der Metaphysik zu erweisen, wegen der vielen Be-
Johann Nicolaus Tetens
165
stimmungen die in den Dingen sich findet, und welche bey Beurtheilung der Möglichkeit desselben, wie schon oben erinnert, in Betrachtung gezogen wer-den müssen. In der Mathematik ist es ein anders; man beobachtet daselbst bloß eine Art von Eigenschaften, die Ausdehnung, welche man von den übri-gen absondert: alles was dahero unter der Bedingung, daß die Körper bloß ausgedehnt sind, ihnen zukommen kan, ist möglich; aber in der Metaphysik muß das, was möglich sein soll, mit allen Bestimmungen der Dinge überein-stimmen. 2) Es ist gar unmöglich, daß wir die Möglichkeit solcher Dinge, von denen wir nur einen symbolischen, aber keinen anschauenden Begrif haben, aus ihnen selbst, oder a priori solten einsehen können. So lange wir nur einen symbolischen Begrif einer Sache haben, dencken wir das Ding selbsten, oder seine positiven innerlichen Bestimmungen gar nicht, sondern wir stellen uns einige Verhältnisse eines Dinges gegen andere, oder einige Möglichkeiten etwas zu wircken und zu leiden vor, verknüpfen sie zusammen, daß wir einen Begrif des Dinges erhalten, wodurch wir es wohl von andere an diesen Be-stimmungen unterscheiden, aber die wahre innerliche Beschaf[/]fenheit [57 – D5] desselben uns nicht bekant machen können. So ist ja die innre Natur uns-rer Seele uns unbekant, und was wir in ihr erkennen ist dies, daß wir wissen, es sei in ihr etwas, welches Vorstellungen hervorbringet. Wie will man denn nun die Möglichkeit solcher Dinge a priori aus den Begriffen einsehen. Da man von ihnen eigentlich keine Vorstellung hat, wie kan man, da man von dem Dinge, welches dencken kan, nichts mehr kennet als dieses, daß es den-cken kan, dennoch verschiedene Arten der denckenden Dinge aus dem Beg-riffe bilden? und woher weiß man, daß die durch die Bestimmung hinzuge-sezte, oder durch die Absonderung weggelassene Merckmahle nicht den uns unbekanten Eigenschaften widerspreche? Wir schliessen wohl richtig, wenn wir eine Bestimmung in einem Dinge für unmöglich halten, so bald es mit etlichen Eigenschaften desselben, so viele uns unbekante es auch sonsten ha-ben mag, einen Widerspruch verursachet; aber aus der Uebereinstimmung mit etlichen uns bekanten, läßt sich auf die Uebereinstimmung mit dem ganzen Dinge keine Folge machen. Bei dem einzigen symbolischen Begrif, den wir von dem unendlichen Wesen haben, muß eine Ausnahme gemacht werden; als dessen Möglichkeit wir selbst aus dem Begrif erweisen können. Aber die Ur-sache ist, weil wir wissen, daß so viele Eigenschaften in Gott auch sind, den-noch keine einzige da sein könne, die etwas verneinet. Es mögen uns dahero noch so viele unbekant sein, so sind es doch lauter Realitäten, und zwar sol-che, die gar nichts verneinen[/]des [58] mit sich verknüpft haben, folglich unmöglich mit denen uns bekannten einen Widerspruch machen können. In allen übrigen Fällen sind wir dafür nicht sicher.
Davide Poggi
166
§. 33.
Die drei Fehler, von welchen ich bishero gehandelt, sind Hauptursachen, warum wir in der Metaphysik so wenige ausgemachte Wahrheiten haben. Die theoretische Mathematik ist davon frei, und dies ist ein Beweiß, daß dieselbe in der Ontologie, oder der Theorie von den algemeinen Eigenschaften aller möglichen und wirklichen Dingen auch vermieden werden können. Wir wür-den, wenn dieses geschähe, wenn alle Begriffe die gröste Deutlichkeit hätten; wenn jedes Wort seine bestimte und von allen angenommene Bedeutung hät-te; wenn wir keinen Begrif zuliessen, dessen Möglichkeit nicht erwiesen; doch wenigstens die ersten Grundsäzen der menschlichen Erkentniß erweitern und so evident machen können, als die Lehrsäze der Geometrie sind. Und wie viel hätten wir alsdenn nicht gewonnen? Ich zweifle gar nicht, daß wir alsdenn in der Lehre von der Welt, der Seele und Gott eben so glücklich sein, und die Wahrheiten zu eben der Gewisheit bringen würden als die Naturlehre durch Hülfe der Mathematik gebracht wird. Und hingegen ist es unmöglich etwas gründliches, das mehr als ein schönes Raisonniren wäre, in den genannten Wissenschaften vorzubringen, so lange die Ontologie nicht in einen bessern und volkommenern Zustande gese[/]zet [59] worden ist. Wir können uns wie Cartesius hinsezen und mit seinem Kopf und Fleiß über uns selbst, die Welt und Gott unser Nachdencken anstellen; wir werden in eben die Verwirrung und Dunckelheit gerathen, in welche er verfiel, und eben so wenig ausmachen. Dieser grosse Mann entdeckte in der Mathematik viel neues, und in der Meta-physik kam er wenig weiter, als die Alten schon gewesen; aber war dies zu bewundern, da er in jener Wissenschaft eine vortrefliche Theorie zum Grunde legen konte, und in dieser nur ein paar algemeine und jedem Menschen be-kannte Grundsäze für sich hatte? Was eine volständige Theorie ausrichten kan, wenn man Erfahrungen damit verknüpft, siehet man an den grossen Er-findungen des Neutons in der Naturlehre; und durch welches Mittel sind die Wissenschaften, die man zur angewandten Mathematik rechnet, die Mecha-nik, die Optik, die Astronomie, zu der volkommenheit gebracht, in welcher sie dem menschlichen Verstande Ehre machen, als durch die Volkommenheit der theoretischen Mathematik, die man auf die Erfahrungen anwendet? Nimmermehr würde ein Euler aus dreien Beobachtungen die Bahn der Co-meten bestimmet haben, ein Verfahren, das fast die Schrancken des menschli-chen Verstandes zu übersteigen scheint, wenn seine grosse Erkenntnis der tiefsinnigsten und genauesten Theorie ihm nicht behülflich gewesen wäre. Wer weis, was in der Metaphysik würde entdecket werden, wenn die Ontolo-
Johann Nicolaus Tetens
167
gie zu der Volkom[/]menheit [60] gebracht wäre, welche man bei der Analysis der Mathematiker antrift?
§. 34.
Indessen ist es doch gewis, daß auch die gröste Volkommenheit der Theorie, noch nicht alle Dunckelheit der Erkenntniß in der Metaphysik heben würde. In der Naturlehre bleibt auch noch viel unbekant und unausgemacht, ohne-rachtet die Mathematik in derselben zu Hülfe genommen wird. Dahero kan man auch nicht sagen, daß die angeführten Fehler, die einzigen Ursachen wä-ren, warum in der Metaphysik so wenige ausgemachte Wahrheiten sind. Die ganze Seelenlehre und Gottesgelahrheit, und zum Theil die Cosmologie, sind Wissenschaften von wirklichen Dingen, deren Würckungen wir nur erfahren, von welchen wir durch Hülfe der algemeinen Grundsäze auf die innere Be-schaffenheit derselben zurückschliessen müssen. Kennen wir nun die Wür-kungen noch nicht genau, und fehlt es uns an richtigen und volständigen Er-fahrungen: oder wenn diese da sind, sind die Ursachen dieser Wirckungen zu weit von uns entfernet, daß wir dieselbe niemals durch unser Nachdencken erreichen können; so werden wir auch mit unser besten Theorie hierinnen wenig ausmachen. Beides findet statt in der Metaphysik. Wir haben noch nicht Erfahrungen genug: zuweilen begeht man gar Erschleichungs fehler, und dies ist also die fünfte Ursache, daß die metaphysischen Wahrheiten zweifelhaft sind.
[/] [61] §. 35.
Man kan sich davon überzeugen, wenn man die Erfahrungs-Seelenlehre an-sieht. Diese ob sie gleich unter allen Theilen der Metaphysik die mehresten ungezweifelten Säze in sich fasset, hat dennoch noch viele Mängel. Wie viele Phänomäna eräugen sich nicht noch bei der Seele, welche zu erklähren die Geseze der Psychologie nicht hinreichen? Die Theorie von Nachtwandeln, von dem Vorhersehungs -Vermögen ist bloß aus Mangel hinlänglicher Erfah-rungen noch nicht zur Richtigkeit gebracht. So wissen wir zwar überhaupt, daß mit einigen Veränderungen im Körper, Veränderungen in der Seele ver-knüpft sind; aber es fehlet noch viel, daß wir genau solten allemahl angeben können, welche Veränderungen in der Seele, und in wie weit sie mit den Ver-änderungen im Körper verknüpft wären. Die Philosophen sezen gemeiniglich
Davide Poggi
168
diese lezten aus den Augen, und überlassen sie den Physiologen, da doch ohnstreitig ist, daß so lange wir nicht nach dem Beyspiel des Hrn. Prof. Krü-gers auf die Beschaffenheit des Körpers zugleich mit Acht geben, wir in der Erfahrungs-Seelenlehre niemals hinter die geheimen Wirkungen der Seele kommen werden. Wir begehen auch oft Erschleichungs-Fehler. Viele bilden sich ein, ihre Erfahrung lehre es sie, daß sie sich ohne die geringsten antrei-bende Ursachen zu etwas entschliessen können, daß die Seele in den Körper durch den physischen Einfluß würke; man könne mehr als [/] [62] eine Vor-stellung in eben denselben Augenblick in sich haben; man könne eine Vorstel-lung haben, und zu gleicher Zeit von dieser Vorstellung wieder eine andere Vorstellung haben, oder denken, und in eben dem Augenblick sich vorstellen, daß man denke, welches alles, ich mit aller mir möglichen Aufmerksamkeit auf mich selbst, nicht habe erfahren können. Zu der Erfahrungs-Seelenlehre gehöret auch der Saz, daß wir dunkle Vorstellungen haben, welche doch noch von vielen geläugnet werden. Selbst die Empfindung von dem Denken ist noch undeutlich. Nun ist es unmöglich, daß wir die Natur der wirkenden Ursachen ohne eine volständige historische Erkentniß der Wirkungen, solten erkennen können: so lange uns daher die gehörige Erfahrungen von den Wir-kungen unserer Seele fehlen, ist es nicht zu verwundern, daß wir nicht ausma-chen können ob selbige ein einfaches oder zusammengeseztes Ding sei, wenn wir unserer Erkenntniß nicht durch Hypothesen zu Hülfe kommen wollen. Man kan indessen die Wichtigkeit der Erfahrungs-Seelenlehre hieraus ersehen, und von dem Verfahren einiger Philosophen urtheilen, welche entweder die-selbe aus der Metaphysik ganz weglassen, oder nur einige wenige Erfahrungs-Säze daraus entlehnen, und doch in der schliessenden Seelenlehre die wichtigs-ten Wahrheiten Demonstriren wollen. Ist jemand nicht ungemein glücklich im Erfindung der Hypothesen, oder eigentlich im Errathen; so sehe ich nicht, wie er auf diese Art etwas heraus bringen könne.
[/] [63] §. 36.
Sechstens so können auch wohl die Wahrheiten, die wir in der Metaphysik suchen über die Sphäre des menschlichen Verstandes gesezet sein, daß wir zu einer gewissen Erkenntniß derselben nicht gelangen können. Man kan mit Gewisheit dies nicht sagen. Denn wer weis, was ausgemacht werden wird, wenn die Theorie zur Volkommenheit wird gebracht sein, und in den Erfah-rungen nichts mehr fehlen wird. Wer hätte es zu Aristotelis Zeiten nicht vor
Johann Nicolaus Tetens
169
unmöglich halten sollen, daß die Bahn der Cometen berechnet werden könne, und doch hat man es so weit gebracht.
Was niemals möglich schien, hat doch der Wiz erdacht. Man kan dahero es nicht für ganz unmöglich halten, daß wir von unsrer
Seele so viel solten kennen lernen als erfodert wird, um ihre Einfachheit oder Zusammensezung, ihre Unsterblichkeit, ihr Zustand nach dem Tode, und dergleichen mehr zu beweisen; und, wenn die volkommene Gewisheit hierin-nen nicht erhalten werden kan; so können vielleicht die Lehrsäze zu der grösten wahrscheinlichkeit gebracht werden, an welche wir uns beruhigen. Es ist kein richtiger Schluß, wenn St. Erremond an einen Freund schreibt, es sei umsonst daß er über den künftigen Zustand seiner Seele Betrachtungen an-stelle, weil die alten Philosophen vor ihm schon so viel darüber gedacht, und doch nichts ausgemacht; er werde nicht wei[/]terkommen [64]. Aber es kan auch wohl sein, daß wir bei der volkommesten Ontologie und allen mögli-chen Erfahrungen doch noch werden mit dem grossen Poeten sagen müssen:
Wie denken erst began Und Wesen fremder Art Der Seele Werkzeug sind ______________________ Dies soll ich nicht verstehen.
§. 37.
So viel ist gewiß, daß wir niemals zu einer anschaulichen Erkenntniß der Na-tur einer einzigen Substanz gelangen können, wo nicht andere Erkenntniß – Kräfte in uns geleget werden, als wir jezo besizen. Alles was wir von ihnen wissen sind gewisse Möglichkeiten etwas zu wirken, oder in sich wirken zu lassen, oder ein Etwas, das in ihnen ist, und sich thätig erweiset, welche Dinge man Vermögen, Fähigkeiten, Kräfte nennet, von deren inneren positiven Be-schaffenheit man aber keine Begriffe hat. Dahero weiß ich nicht, ob man mit einigen Philosophen sagen könne, wir wären in das innerste der Natur der Substanzen gedrungen, weil wir eins und das andere wissen, das durch sie hervorgebracht wird oder werden kan, und einige Veränderungen, die sie leiden, wenn andere Substanzen mit ihnen in Verknüpfung kommen. Indes-sen folgt doch hieraus noch nicht, daß wir die Hofnung aufgeben müssen jemals durch die Vernunft in einer gewissen Er[/]kenntniß [65 – E] der Eigen-schaften von der Welt, von unserer Seele und von Gott zu gelangen, welche
Davide Poggi
170
wir zu unserer Glückseeligkeit nothwendig wissen müssen, Denn diese Er-kenntniß erfodert nicht nothwendig eine solche anschauliche Erkenntniß der Dinge, von der ich vorher gesaget, daß sie unmöglich sei.
§. 38.
Solten nicht aber auch noch Vorurtheile den Fortgang der Metaphysik aufhal-ten? Ohnstreitig. Die Metaphysik ist eine Wissenschaft die mit der Theologie in zu genauer Verbindung stehet, als daß die Säze derselben dem, der in der Religion einem gewissen System zugethan ist, solten gleichgültig sein können. Die schuldige Sorgfalt in der Philosophie keine Lehrsäze zuzulassen, welche der Offenbahrung entgegen sind, macht, daß auch grosse Philosophen schon bei den ersten Grundsäzen auf die Offenbahrung sehen und sie so einrichten, daß ihr ganzes System der Lehre der Kirchen nothwendig gemäß werden muß. Die Römisch-Catholischen läugnen dahero in der Ontologie den Saz, daß die Accidentien ausser den Substanzen nicht existiren können. Und einige der Unsrigen nehmen ohne Beweiß gewisse Möglichkeiten an, bloß zu dem Ende, einen oder den andern Saz der Dogmatik aus der Vernunft zu erweisen. Die Neigung gegen die Offenbahrung wird aber zur Unzeit gezeiget. Heißt das nicht die Religion zum Grunde legen in der Philosophie, und hernach durch Hülfe der Philosophie die Wahrheiten der Religion gegen die Die[/]sten [66] vertheidigen wollen? Wird ein Deist der denken kan, durch eine solche Philosophie überführet werden? Er wird immer einwenden, daß wir aus Vorurtheilen schliessen, und er hat Recht. Man macht auf die Art die Philosophie samt der Theologie verdächtig, und das ohne Noth. Wegen der Offenbahrung darf man im geringsten nicht besorgt sein: man philosophire immer fort; man nehme nur keine als richtig bewiesene Grundsäze an und hüte sich vor Fehler im Schliessen, ohne darauf zu sehen, ob die Folgerungen auch mit der Lehre der Kirchen übereinstimmig sind. Sie werden es von selbsten sein, weil Wahrheit und Wahrheit niemals mit einander in einen wah-ren Widerspruch kommen können.
§. 39.
Ausser diesen, aus einem angenommenen Religionssystem herrührenden Vo-rurtheilen, sind noch andere. Ja es ist keine Art derselben, die die Logik lehret,
Johann Nicolaus Tetens
171
welche nicht zu der Verschiedenheit der Meinungen in der Weltweisheit und besonders in der Metaphysik, das ihrige beitragen solte; das Vorurtheil von dem Ansehen des Aristotelis hat verursachet, daß man in ganzen Jahrhunder-ten keinen Schritt in der Metaphysik weiter gekommen. Man muß aber den Vorurtheilen auch nicht zu viel zuschreiben. Sie können die einzige Ursache der Mängel der Evidenz in den Metaphysischen Wahrheiten nicht sein. Dies hat Cartesii Beispiel gewiesen, der alle vorgefaßte Meinungen wegwarf, und doch in die Metaphysik wenig Wahrheiten, die ausgemacht sind, einführete. [/] [67 – E2] Und in den neuern Zeiten haben viele Philosophen mit grosser Freiheit die Lehrsäze der Religion so wohl als ihrer Lehrer in der Philosophie bei seite gesezt und für sich selbst die Wahrheit gesucht, und dennoch wenig oder nichts zur Gewisheit gebracht. Zudem würden die vorgefaßten Meinun-gen auch von selbst wegfallen, wenn nur die vorhero angeführten Ursachen von dem Mangel ausgemachter Wahrheiten in der Metaphysik gehoben wür-den.
Meine höchstgeehrte Herren Mitbürger.
Ich habe diese Gedancken nicht niedergeschrieben um die Metaphysik zu verkleinern, und sie als eine Wissenschaft, in welcher die mehresten Säze un-gewiß sind, und welche also des darauf zu verwendenden Fleisses nicht wehrt sei, vorzustellen. Dies hiesse thöricht gehandelt, indem ich sie selber zu lehren gesonnen bin. Meine Absicht ist vielmehr, Sie, meine höchstgeehrteste Herren Mitbürger, aufzumuntern, daß Sie auf diese erhabene und unentbehrliche Wissenschaft alle Aufmercksamkeit wenden, und sie zu erweitern suchen. Die Erkenntniß des Irthums, sagt man ganz richtig, ist die halbe Besserung. Indem ich also die Ursachen der Ungewisheit in der Metaphysik entdecket, bin ich Ihren Bemühungen, solche zu heben, vorgegangen. Es hätte dies bei keiner bequemern Gelegenheit geschehen können als bei der jezigen, da ich die Col-legia anzeigen muß, welche ich auf dieser neuen, von unserm Durchlauchtigs-ten [/] [68] Fürsten huldreichst gestifteten Academie zu lesen gesonnen bin. Durch nichts können Sie Ihre Danckbarkeit für die hohe Gnade, womit dieser erhabene Mäcenat die Musen umfasset, mehr bezeigen, als wenn Sie Sich bestreben der weisesten Absicht dieses gnädigsten Landesvaters durch Ver-doppelung Ihres Fleisses in Erlernung der Wahrheit und Weisheit, ein Genü-ge zu thun. Ich will mich bemühen, Ihnen, meine höchstgeehrteste Herren, durch Vorlesung folgender Collegien dazu Gelegenheit zu geben. Ich werde g. G. lesen, die Logik diesen Winter, über Korvin bekanntes Lehrbuch;
Davide Poggi
172
inskünftige bin ich willens die vortrefliche Vernunftlehre des Hrn. Prof. Rai-marus zum Grunde zu legen; die Metaphysik über des Hrn. Prof. Baumgar-tens Lehrbuch, das Recht der Natur über des Herrn Hofrath Darjes instit. jurispr. univ. die philosophische Moral über eben desselben Sittenlehre. Die Naturlehre. Hierinnen soll des Hrn. G. R. Segners vortrefliche Einleitung in die Naturlehre zur Richtschnur dienen. Ich werde aber in dem ersten halben Jahr nur die sieben ersten Abschnitte davon durchgehen. Die drei lezten sezen Zuhörer voraus, die in der Mathematik mehr geübt sind; ich werde sie daher denen, die an der mathematischen Erkenntniß der Natur einen Geschmack finden, in jedem halben Jahr zu erklären erböthig sein. In Absicht der Stunden werde ich mich nach denen Herren bequemen, welche ich zu unterrichten die Ehre haben soll. Bützow, den IIten des Weinmonats, 1760.