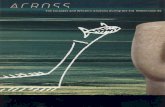Wandel und Kontinuität in Europa und im Mittelmeerraum um 1600 v. Chr.
Kultureller Austausch im südosteuropäisch-türkischen Schwarzmeergebiet vom 5. bis zum 3....
Transcript of Kultureller Austausch im südosteuropäisch-türkischen Schwarzmeergebiet vom 5. bis zum 3....
461
ARCHÄOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN ZU
KULTURGESCHICHTLICHEN VERBINDUNGEN ZWISCHEN
MITTELEUROPA, DER MITTELMEERWELT UND WESTASIEN
WÄHREND DER METALLZEITEN
Thomas Zimmermann
Kultureller Austausch im südosteuropäisch-türkischen
Schwarzmeergebiet vom 5. bis zum 3. Jahrtausend v. Chr. –
Annäherungen an ein chronologisches und
forschungsgeschichtliches Dilemma Diachrone Analysen wechselseitiger, sich über einen grösseren geographischen Raum er-streckender Kulturkontake bleiben trotz der methodischen Vielfalt unseres Faches eines der vorrangigen Aufgaben zeitgemässer Vorgeschichtsforschung. Zu einem besseren Ver-ständnis prähistorischer Lebenswelten bedarf es zweifelsohne zunächst eines gründlichen Studiums der archäologischen, geologischen, palaeoökologischen und ökonomischen Ver-hältnisse in einer Kleinregion. Der Blick auf die „grösseren Zusammenhänge“, sprich die Dokumentation und Interpretation archäologisch fassbarer Belege für den Austausch von Waren sowie die Adaption technischer und stilistischer Innovationen in einem mehrere Kulturprovinzen umfassenden Interaktionsraum, darf dennoch nicht ausser Acht gelassen werden. Erst mittels einer chronologisch wie geographisch weitgefassten Perspektive las-sen sich mögliche Ursachen und Auswirkungen sozialen und kulturellen Wandels mithilfe der uns zur Verfügung stehenden Analysewerkzeuge kritisch erörtern. Eine zu extreme Deutung verschiedener Einzelelemente überregionalen Austauschs, der sich beispielsweise in bestimmten Baustilen, Grab- oder Keramikformen niederschlägt1, ist hier freilich ebenso zu vermeiden wie die generelle Überbewertung von stilistischen Ähnlichkeiten (Stichwort Konvergenzerscheinung). Dennoch lassen sich durch solch eine makroskopische Betrachtungsweise, die ein Netz von materiellen und ideologischen Beziehungen über einen längeren Zeitraum hinweg offen legt, spannungsreiche Interaktionsmuster mehrerer kulturell heterogener Regionen heraus-arbeiten. 1 Letztendlich repräsentieren archäologische Funde und Befunde immer die Summe eines mehrere Epochen dauernden
evolutionären technischen und sozialen Neuerungs- und Adaptionsprozesses; anschaulich persifliert in einem 1936 ver-öffentlichten Beitrag zur Kulturanthropologie: „[A model householder reads] the news of the day, imprinted in charac-ters invented by the ancient Semites upon a material invented in China by a process invented in Germany [while thanking] a Hebrew deity in an Indo-European language that he is 100 percent American“ (R. H. Winthorp [Winthorp 1991] 84 nach R. Linton, The Study of Man. An Introduction [1936]).
462
Das südosteuropäisch-türkische Schwarzmeergebiet bietet sich als Modellregion für ein solches Studium interregionaler und -kultureller Kontakte an. Der ursprüngliche pontus axeinos („ungastliches Meer“), nach erfolgreicher griechischer Kolonisation in „freundli-ches Meer“ („pontus euxeinos“)2 umgedeutet, verbindet über den Seeweg nicht nur den europäischen mit dem asiatischen Kontinent: an die Küstenregionen des (nord)west- und südpontischen Gebietes grenzen mit Anatolien und Südosteuropa zudem zwei der techno-logisch innovativsten Zentren des Chalkolithikums und der Frühen Bronzezeit Eurasiens an. Gewässer jedweder Art waren sicherlich auch in der Frühzeit niemals nur trennende, mühevoll zu bändigende Hindernisse, sondern ermöglichten trotz einer Vielzahl von witte-rungsbedingten und navigatorischen Gefahren schon in vorzeitlichen Epochen den Trans-fer von Gütern und Ideen über weite Entfernungen hinweg3. Dies vorausgesetzt, sollte das west- und südpontische Gebiet zahlreiche Belege für Begegnungen europäischer wie ana-tolischer Kulturträger liefern, wobei sich der soziale Kontext, die mögliche Motivation so-wie der zeitliche Ablauf anhand gut dokumentierter archäologischer Quellen erschliessen liesse. Dieses Vorhaben wird im Falle der türkischen Schwarzmeerregion hauptsächlich durch zwei Faktoren erschwert: Der Forschungs- wie Publikationsstand ist seit der archäologischen Erschließung des türki-schen Pontusgebietes sehr unausgewogen. Über die zeitliche Stellung der prähistorischen Funde und Befunde der grössten und am umfangreichsten ausgegrabenen Siedlung İkiztepe bei Bafra an der zentraltürkischen Schwarzmeerküste, ein Schlüsselplatz zum Verständnis der pontischen Kulturverhältnisse im 4. und 3. Jahrtausend v. Chr., herrscht nach wie vor weitgehend Uneinigkeit. Der folgende Beitrag zur Festgabe des Regensburger Instituts für Vor- und Frühgeschichte will zum einen diese forschungsgeschichtlich bedingte Problematik erneut zur Diskussion stellen. Zum anderen soll trotz dieser Einschränkungen versucht werden, anhand von aus-gewählten Fundgruppen ein lebendiges Bild interregionalen Austausches vom 5. bis zum 3. vorchristlichen Jahrtausend in der südosteuropäisch-türkischen Schwarzmeeregion zu zeichnen. Somit vereint dieser Aufsatz inhaltlich zwei grundsätzliche, durch die bisherigen Regensburger Ordinarien Walter Torbrügge und Peter Schauer vertretenen seminarüber-greifende Schwerpunkte des dortigen Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichte: die kritische Quellenanalyse sowie überregionale altweltliche Kulturkontakte.
Archäologische Forschungstätigkeit entlang der türkischen Schwarz-meerküste
Ein profundes Verständnis der kupfer- und frühbronzezeitlichen Kulturverhältnisse entlang des südlichen Pontusgebietes setzt zunächst eine genaue Kenntnis der Chronologie und Stratigraphie einschlägiger Fundplätze in der Region voraus. In dieser schlichten Weisheit
2 Höckmann 2003, 138, nach Pindar, Pyth. 4,203 und Strabon 298. 3 Vgl. ebd. 139 ff.
463
liegt aber genau eines unserer Kernprobleme: Während andere Landesteile und Regionen der heutigen Türkei seit vielen Jahrzehnten im Focus vorgeschichtlichen Forschungsin-teresses stehen und sowohl durch Langzeitprojekte wie Neugrabungen und intensive Feld-begehungen nach und nach archäologisch erschlossen werden, blieb die türkische Schwarzmeerküste sowie das pontische Hinterland lange Zeit von einheimischen For-schern wie ausländischen Wissenschaftlern vernachlässigt und somit eine prähistorische terra incognita4. Die Gründe hierfür sind vielfältiger Natur: Die durch schroffe Küstenab-schnitte und dichte Bewaldung bedingte, allgemein schwere Zugänglichkeit des Gebietes, eine nur schleppende touristische Erschliessung – und damit das Ausbleiben von Grosspro-jekten zur Verbesserung der Infrastruktur in Verbindung mit evtl. notwendigen Rettungs-grabungen, eine bis in die fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts reichende Fehleinschät-zung des Beginns sowie des zeitlichen Verlaufs der prähistorischen Besiedlungsgeschichte Anatoliens5, sowie wohl auch die vermeintlich grössere antike (und moderne?) Attraktivi-tät ägäischer oder mittelmeerischer Provinzen mögen hierbei eine Rolle gespielt haben.
Abb. 1. 1 – Baklatepe, 2 – Umgebung von Sardis, 3 – Beycesultan, 4 – Yortan, 5 – Ilıpınar, 6 – Ereğli-Yassıkaya, 7 – Boyabat-Kovuklukaya, 8 – Demircihöyük/Kocagöz, 9 – İkiztepe, 10 – Dündartepe, 11 –
Tekeköy/Kavak, 12 – Umgebung von Trabzon, 13 – Oymaağaç/Göller. Wissenschaftlich geleitete Grabungen, deren Ergebnisse ein Grundgerüst für die chronolo-gische Gliederung der Region liefern könnten, beschränken sich lediglich auf eine Hand-voll Fundplätze (Abb. 1). Drei der frühesten Expeditionen zur Erhellung der prähistori-schen Besiedlungsgeschichte des zentralen türkischen Schwarzmeerraumes datieren in die
4 Vgl. die seit 1955 in loser Folge veröffentlichten Jahresberichte zur archäologischen Forschungen in der Türkei, v.a. im
Hinblick auf die geographische Verteilung prähistorischer Expeditionen (Mellink 1955 ff.; ebd. 1987 ff.; Gates 1994 ff.; Greaves/Helwing 2003).
5 Noch 1956 war in einer von Seton Lloyd verfassten Monographie zu lesen, dass die zentralanatolische Region jenseits des Taurusgebirges aufgrund des harten Winterklimas erst zu Beginn des 3. Jahrtausends v. Chr. von sesshaften Ver-bänden besiedelt wurde (Lloyd 1956, 53 f.).
464
vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts und konnten nur einen kleinen Teil der eigentlichen Siedlungsfläche erfassen. Die von Tahsin Özgüç, Nimet Özgüç und Kılıç Kökten in den Jahren 1941 und 1942 durchgeführten Sondagen konzentrierten sich auf den Dündartepe (in der einschlägigen Literatur auch als Öksürüktepe bekannt) sowie die Stationen Tekeköy und Kavak6. Die Einberufung von K. Kökten und T. Özgüç zum türkischen Militärdienst führte zur Unterbrechung des Projektes und wurde nach ihrer Entlassung nicht wieder auf-genommen7. Das Fundgut des in der Provinz Samsun gelegenen Dündartepe umfasst Kera-mik und Kleinfunde überwiegend des vierten (?) und dritten vorchristlichen Jahrtausends, einige wenige Scherben können in das erste Drittel des 2. Jahrtausends v. Chr., sprich in die noch vorhethitische Epoche eingegliedert werden. Die freigelegten Flächen waren je-doch zu klein, um weitreichendere Aussagen zur stratigraphischen Abfolge bzw. der kultu-rellen Entwicklung innerhalb des Siedlungsplatzes zu treffen. Funde und Befunde sind zu-dem nur in Ansätzen publiziert und beschränken sich auf zwei knappe, in den vierziger Jahren veröffentlichte Vorberichte8. Die dort abgebildeten Funde sind, ausgenommen von eigentümlichen quaderförmigen Tonobjekten mit flächiger Durchlochung („Tonbürs-ten“?)9, zu wenig signifikant, um diese Station regionalübergreifend zu diskutieren. Ähnlich verhält es sich mit dem Fundplatz Tekeköy, einer vorgeschichtlichen Nekropole, mit benachbartem Siedlungshügel Kavak (auch als Kaledoruğu bezeichnet), wobei –ähn-lich wie bei Dündartepe – ebenfalls im Siedlungsareal Gräber angetroffen wurden. Auch hier sind die veröffentlichten Befunde, mit Ausnahme mehrerer als Rückenstrecker bestat-teter Individuen10, auf die später noch einzugehen sein wird, wenig ertragreich. Besonders problematisch für weitergehende Erörterungen ist schliesslich die Tatsache, dass in den Vorberichten offenbar nicht zwischen Siedlungs- und Gräberinventaren getrennt wurde11, was eine stratigraphisch-chronologische Autopsie praktisch unmöglich macht. Rudiment blieben auch die von A. Erzen und L. Budde in den fünfziger Jahren durchge-führten Untersuchungen am Demirci- oder Kocagözhöyük bei Sinop12. In der nur eine Sai-son dauernden Kampagne konnten vier durch Brandhorizonte getrennte Kulturschichten festgestellt werden. Ein Teil der Keramikfunde weist deutliche Affinitäten mit west- bzw. nordwestanatolischen Waren und Formen der Stufen Troia I und II (frühes bis mittleres drittes Jahrtausend v. Chr.) auf, sodass die Ausgräber eine Wanderung nordwestanatoli-scher Kulturverbände entlang der Küste bis in die Gegend um Sinop vermuteten. Die Kür-ze der Untersuchungen sowie der abermals unbefriedigende Publikationsstand stehen je-doch einmal mehr einer tiefergehenden Analyse des Fundgutes im Wege. Angefügt werden können noch die in jüngerer Zeit durchgeführten Rettungsgrabungen in Boyabat-Kovuklukaya13 sowie im wesentlich weiter nordwestlich gelegenen Ereğli-Yassı-kaya14, die trotz des zeitlich eng gesetzten Rahmens einer Notbergung und ihrer dadurch bedingten, begrenzten Aussagekraft adäquat veröffentlicht wurden. Durch die zeitliche und räumliche Begrenzung der Kampagne ließen sich Funde und Befunde nur sehr ausschnitt- 6 Kökten/Özgüç/Özgüç 1945; Özgüç 1948b; Schoop 2005, 305 f. 7 Özgüç 1948b, 396. 8 Kökten/Özgüç/Özgüç 1945; Özgüç 1948b. 9 Kökten/Özgüç/Özgüç 1945, Taf. 66,5. 10 Ebd. Taf. 72,5.6. 11 Schoop 2005, 307. 12 Erzen 1956; Burney 1956; Yakar 1985, 244. 13 Dönmez 2004. 14 Efe/Mercan 2002; Efe/Ay 2004.
465
haft erfassen. Immerhin konnten jedoch für das 3. Jahrtausend v. Chr. anhand der früh-bronzezeitlichen Keramikfunde allgemeine typologische Beziehungen zum thrakisch-west-pontischen Gebiet herausgearbeitet werden15. Diese äusserst magere Zusammenstellung mit lediglich sechs, in den letzten 60 Jahren durch Grabungen erforschten Fundplätze, lässt sich nun mit dem für diese Region wich-tigsten, da am umfangreichsten gegrabenen und publizierten Fundplatz İkiztepe ergänzen. Die seit 1974 von Wissenschaftlern der Universität Istanbul gegrabene Großsiedlung mit Nekropole erstreckt sich über insgesamt vier (!) Erhebungen, deren stratigraphisches Ver-hältnis zueinander nach wie vor nicht befriedigend geklärt ist. Die Ergebnisse der seit 1981 unter der Leitung von Önder Bilgi durchgeführten Kampagnen im Siedlungsgelände sowie der Nekropole liegen bislang in zwei Monographien16 sowie zahlreichen Vorberichten und Aufsätzen vor17, die sich teilweise isoliert spezifischen Aspekten wie den Metallfunden aus Siedlungs- und Grabkontext widmen18. Nichtsdestotrotz wird über die chronologische Ab-folge dieses zentralen Ortes, seine kulturelle Stellung innerhalb der anatolisch-pontischen Vorgeschichte, ja die absolute Zeitstellung an sich bis in jüngste Zeit kontrovers gestrit-ten19. Die Ursachen hierfür sollen im Folgenden kurz skizziert werden: Zunächst besteht die Wohnarchitektur des İkiztepe aus Holzbauten, die lediglich durch Pfostenstellungen und Gräben nachweisbar sind, und weicht somit grundsätzlich von der traditionellen anatoli-schen Bauweise mit Kalksteinfundamenten und aufgehendem Lehmziegelmauerwerk ab20. Dies ist für europäische Archäologen bekanntermassen keinesfalls ungewöhlich, für vor-derasiatische Prähistoriker waren derartige Befunde jedoch in den siebziger Jahren des vo-rigen Jahrhunderts vollkommenes Neuland und zu diesem Zeitpunkt in keiner anderen ana-tolischen Siedlungsgrabung nachgewiesen. Dies mag zu erheblichen Unsicherheiten be-züglich der stratigraphischen Zuweisung einzelner Funde und Befunde geführt haben. Zu-dem wies Hermann Parzinger bereits 1993 auf diverse Unstimmigkeiten und Unklarheiten in der bislang vorliegenden Interpretation der komplizierten Stratigraphie von Siedlung und Gräberfeld des İkiztepe hin21. Vor allem die gewaltige Vertikalstratigraphie der Nekro-pole mit einer Mächtigkeit von bis zu 6,7 (!) m deutet auf eine sehr lange Nutzungsdauer hin, die einen weit längeren Zeitraum als die von den Ausgräbern vorgeschlagenen Jahr-hunderte des entwickelten bis späten 3. Jahrtausends umfassen muss22. Auch die Zuweisung bzw. Datierung von Keramik-Assemblagen weist etliche Diskrepan-zen auf. Beispielsweise wurde offenkundig trotz detailliert beschriebener Schichtgrabung Fundgut aus verschiedenen Arealen zusammengefasst, das typologisch wie technologisch fraglos zu trennen wäre23.
15 Efe/Mercan 2002, 364 ff. 16 Alkım/Alkım/Bilgi 1988; ebd. 2003. 17 In Auswahl Bilgi 2000; ebd. 2004; ebd. 2005b. 18 Alkım 1983a; Bilgi 1984; ebd. 1990; ebd. 2001a; ebd. 2001b; ebd. 2005a. 19 Vgl. Parzinger 1993a, 237 f.; ebd. 1993b, 219; Thissen 1993, 215 ff., Maran 2000, 188 mit Anm. 50; jüngst dazu
Schoop 2005, 307 ff. mit einer umfangreichen kritischen Neubetrachtung der İkiztepe-Befunde; ebenso Zimmermann 2005, 194 f.; ebd. 2007.
20 Alkım 1983b. 21 Parzinger 1993a, 237 f; ebd. 1993b, 219. 22 Zimmermann 2005, 193 f. mit Anm. 59. 23 Schoop 2005, 308.
466
Zur weiteren Verwirrung hat schliesslich die Publikation zahlreicher widersprüchlicher Ra-diokarbondaten24 aus verschiedenen Siedlungsschichten beigetragen, die eine absolutchro-nologisch verlässliche Zuordnung der damals beprobten Straten praktisch unmöglich macht. Mit zunehmender Schichttiefe scheinen einige der Daten jünger (!) zu werden25, was freilich der Logik einer stratigraphischen, im Falle von İkiztepe angeblich ungestörten Schichtenbildung im Grundsatz widerspricht. Aus den bisher veröffentlichten Beiträgen zur prähistorischen Nekropole von İkiztepe wird zudem ersichtlich, dass die Verstorbenen allesamt in gestreckter Rückenlage beigesetzt wurden, ein Phänomen, dass sich auch bei zwei Bestattungen aus Tekeköy beobachten lässt (supra)26. Dies steht zunächst vollkommen konträr zur „klassischen“ anatolischen Be-stattungssitte im Neolithikum wie der Frühen Bronzezeit, die fast ausschliesslich durch in Hockerstellung niedergelegte Individuen definiert ist27. Gestreckt auf dem Rücken beige-setzte Tote sind aber wiederum typisch für Kulturen des südosteuropäischen Spätneolithi-kums sowie für die Früh- und Hochkupferzeit28. Die bei einigen Grablegen, beispielsweise der Zeitstufe Varna-Hamangia festgestellte Bestreuung der Verstorbenen bzw. die allge-meine Verwendung von rotem Ocker im Grabritus29 lässt sich auch bei etlichen Bestattun-gen aus İkiztepe nachweisen30. Die notwendigen, methodischen Konsequenzen, nämlich eine Überprüfung der „frühbronzezeitlichen“ Datierung dieser Grablegen, ziehen die Aus-gräber jedoch nicht. All diese in notwendiger Knappheit zusammengefassten Kritikpunkte lässt eine Neube-trachtung kultureller Interaktion im pontischen Siedelgebiet, das den umfangreichen, pub-lizierten Bestand an Keramik und Kleinfunden des İkiztepe in eine chronologische Diskus-sion mit einbezieht, zunächst kaum möglich erscheinen31. Im Gegensatz zu dem dürren Bestand an wissenschaftlich durchgeführten Grabungen ist für das pontische Siedelgebiet eine hohe, vor allem im letzten Jahrzehnt deutlich gestiege-ne Anzahl an Surveyprojekten zu verzeichnen32. Vorrangiges Ziel dieser Projekte ist neben einer generellen Erfassung vorklassischer Siedeltätigkeit in der pontischen Koiné auch eine bessere Kenntnis der Kulturgruppen, ihrer Beziehungen zu benachbarten und womöglich auch weiter entfernten Siedelverbänden, sowie im besten Fall auch eine ungefähre Vorstel-lung der chalkolithischen und frühbronzezeitlichen Besiedlungsgeschichte des Schwarz- 24 U.a. Kunç 1986 – kritisch kommentiert von Schoop 2005, 321 f. 25 Ebd. 26 Kökten/Özgüç/Özgüç 1945, Taf. 72, 5.6. 27 Dazu bereits Özgüç 1948a, 85; dieses prozentuale Übergewicht an Hockerbestattungen hat sich auch durch die zahlrei-
chen, in den letzten Jahrzehnten neu aufgedeckten Gräberfelder nicht geändert. 28 Vgl. Lichter 2001, 45 ff.; bes. 62; 94. 29 Ebd. 61; 91. 30 Bilgi 1990, 165 ff. 31 Resigniert merkt U. Schoop nach der ausführlichen Neudiskussion des keramischen Fundgutes aus den wenigen im
Schwarzmeergebiet durchgeführten Grabungen an, dass „auf eine Zusammenfassung des Erreichten (...) an dieser Stelle mangels klarer Resultate verzichtet werden (kann). Das geringe Eigenpotential, welches die Kultursequenz des Schwarzmeergebietes in die Chronologiediskussion einzubringen vermag, rechtfertigt auch eine eigene Diskussion seiner externen Beziehungen nicht.“ (Schoop 2005, 322).
32 Zu erwähnen sind hier v.a. die unter der Leitung von Mehmet Özsait, Şevket Dönmez sowie M. A. Işın durchgeführten prähistorischen Surveys im mittleren Pontusgebiet (für einen Überblick mit weiterführender Literatur vgl. Dönmez 2006, 91 ff.; Işın 1998) sowie umfangreiche Feldbegehungen im nördlichen Zentralanatolien und pontischen Hinter-land, die von Kollegen der Ankara Universität (Tayfun Yıldırım, Tunç Sipahi) sowie Roger Matthews (ehemals British Institute of Archaeology Ankara, jetzt University College London) realisiert wurden und werden (vgl. İpek/Zimmer-mann 2007b, 49 f. mit Anm. 3; Matthews/Pollard/Ramage 1998; Matthews 2004; ebd. 2007).
467
meerraumes33. Dieses Vorhaben scheitert für die prähistorischen Epochen aber bereits daran, dass über die chronologische Verankerung eines schwarzmeerischen Chalkolithi-kums (7.-4. Jahrtausend v. Chr. [?]) sowie dessen typologische Stufengliederung mangels einer robust datierten Referenzstation nach wie vor vollkommene Unklarheit herrscht34. Aus diesem Grund können anhand der bislang gewonnenen Surveyfunde allgemeine Aus-sagen zur relativen Befunddichte in verschiedenen pontischen Siedlungskammern in vor-geschichtlicher Zeit getroffen werden. Auch eine grobe kulturhistorische Gliederung nach Keramiktypen und diagnostischen Kleinfunden mag zu realisieren sein. Weitergehende, auf Oberflächenfunden beruhende Aussagen zu (über)regionalen Beziehungen innerhalb eines klar definierten, chronologischen Rahmens sind mangels gut stratifizierter Befunde bislang nicht zu bewerkstelligen.
Vorbronzezeitliche Kulturbeziehungen im westlichen und südlichen Pontusgebiet – ein Entwurf
Angesichts dieser Unwägbarkeiten mag es äussert schwierig anmuten, kulturellen Aus-tausch mit benachbarten Schwarzmeerregionen zu skizzieren, da hierfür ein stabiles chro-nologisches Fundament zumindest auf türkischer Seite zu fehlen scheint. Dennoch soll im Folgenden anhand ausgewählter, nichtkeramischer35 Fundensembles untersucht werden, ab welchem Zeitpunkt südosteuropäisch-nordanatolische Beziehungen archäologisch fassbar sind, und welchen nachhaltigen Einfluss diese wechselseitigen Kontakte auf das Sozialge-füge der jeweiligen Kulturgruppen geübt haben könnten36. Sogenannte ringförmige Idole repräsentieren eine Fundgruppe, die Kontakte entlang der pontischen Küstenregionen in prähistorischer Zeit archäologisch veranschaulichen (Abb. 2). Die bislang ältesten, aus Edelmetall oder Kupfer gefertigten Exemplare stammen aus der berühmten, am bulgarischen Westufer des Schwarzen Meeres gelegenen kupferzeitli-chen Nekropole von Varna37. Wenn auch ein Grossteil der Grabinventare nach wie vor ei-ner umfassenden Veröffentlichung harrt, so herrscht nach anfänglicher Diskussion um die absolute Zeitstellung38 der besonders prunkvoll ausgestatteten Grablegen nicht zuletzt dank umfangreicher naturwissenschaftlicher Analysen weitestgehend Übereinkunft: Eine Datie-rung zumindest des Nekropolen-Kernbereichs in die Mitte des 5. vorchristlichen Jahrtau-sends kann nicht mehr in Abrede gestellt werden39. Mögliche, aus Knochen gefertigte Vor-
33 Dönmez 2006, 90. 34 Dönmez 2006, 66 mit Anm. 13; 92 mit Anm. 13. 35 Mögliche Beziehungen des türkischen Pontusgebietes zum benachbarten Südosteuropa wurden anhand von Keramik-
formen und -waren bereits von mehreren Autoren ausführlich diskutiert (in Auswahl Thissen 1993; Srejović 1993; Steadman 1995; zusammenfassend mit weiterer Literatur Schoop 2005, 305 ff.). Wegen der bereits erwähnten unklaren chronologischen Situation bleiben viele der dort angeführten Thesen Mutmassungen.
36 Jüngst dazu auch Lichter 2006; Verf. teilt jedoch nicht dessen Auffassung, das sich die im Fundgut beobachtbaren Analogien “auf einige wenige Einzelelemente [beschränken]” (ebd. 529) und “das Schwarze Meer im 5. und 4. Jahr-tausend eine Kulturgrenze zwischen Anatolien und dem Balkanraum bildete” (ebd.).
37 Ivanov/Avramova 2000, 38; Lichter 2001, 87 ff.; Zimmermann 2007b, 26. 38 Weisshaar 1982; Zanotti 1984/85; Weisshaar versucht die Gräber von Varna zeitlich mit der ägäischen Frühbronzezeit
zu korrelieren; seine Argumentation beruht auf stilistischen Vergleichen von Steingefässen und deren chronologischen Implikationen, die sich jedoch nach heutigem Wissenstand nicht aufrecht erhalten lassen.
39 Lichardus 1991; Todorova 1999, 245 f.; Higham u.a. 2007; die aktuellen Daten für ausgewähte Grablegen beziffern sich auf 4560-4450 BC (Higham u.a. 2007, 640 ff.).
468
Abb. 2. Fundorte anatolischer Ringidole: 1 – Baklatepe, 2 – Umgebung von Sardis, 3 – Oymaağaç/Göller, 4 – İkiztepe, 5 – Umgebung von Trabzon.
Abb. 3. Bemaltes Gefäß der klassischen Dimini-Stufe mit Muster aus Ringidolen (1) und Auswahl metallener chalkolithischer ringförmiger Idole aus (Süd)osteuropa (2-6); – 2) Progar (Zemun) – 3) Fundort unbekannt –
4) Oradea – 5) Gumelniţa – 6) Hatvan-Újtelep; nach Skafida 2008 (1) und Müller-Karpe 1974 (2-6); ohne Maßstab.
läufer dieser Ringidole lassen sich außerdem bereits in spätneolithischen Gräbern der Stufe Boian-Bolintineanu (Mitte 6. Jahrtausend v. Chr.) nachweisen40. Derartiges, aus Horten und Gräbern geborgenes metallenes Symbolgut findet sich in identi-scher Machart ebenfalls im nachfolgenden Horizont Bodrogkeresztúr (Abb. 3,2-6)41. Die jüngsten Stücke dieser Fundgruppe müssen nach derzeitigem Stand der Forschung noch 40 Lichter 2001, 45 ff.; 51 Abb. 13,1.2. 41 Makkay 1976, 251 f., hier jedoch ebenfalls mit dem Versuch einer chronologischen Anbindung an die ägäische Früh-
bronzezeit (vgl. ebenso Weisshaar 1982 [Anm. 38]).
469
vor den Beginn des Horizontes Boleráz/Cernavoda III datiert werden, enden also um etwa 3.500 v. Chr42. Die maximale Laufzeit der metallenen balkanisch-osteuropäischen Idole mit kreisrundem, flachem, breitem Körper, zentraler Durchlochung und trichterförmigem „Kopf“ lässt sich folglich mit knapp einem Jahrtausend, von etwa 4.500-3.500 v. Chr., be-ziffern43. Gestielte Knochenanhänger, als Grabbeigabe im Kontext der Schönfelder Kultur oder in Bechergräbern des 3. Jahrtausends v. Chr. geläufig, mögen als späte, formal jedoch klar unterscheidbare Derivate des metallenen Typus gelten44. Ringidole balkanischer Prä-gung sind zudem als Hort- und Einzelfunde aus dem griechisch-ägäischen Chalkolithikum bekannt45 und erscheinen als Gefäßzier auf bemalter Keramik der „klassischen“ Dimini-Phase (Abb. 3,1)46, was verdeutlicht, in welchem Umfang die Ideenwelten unterschiedli-cher Kulturverbände bereits in den vorbronzezeitlichen Epochen verwoben waren. Ein Blick nach Kleinasien lehrt nun, dass derartige „balkanoide“ Ringidole auch in mindestens zwei anatolischen Regionen präsent sind (Abb. 2 u. 4). Ein erster Schwerpunkt der Fund-verteilung liegt zweifelsohne im Küstengebiet entlang der Schwarzmeerküste sowie dem unmittelbaren Hinterland, wo abstrakte, scheibenförmige Figurinen (?) in Gold, Silber und Blei dokumentiert sind47. Zwar stammen immerhin drei Idole aus archäologisch beobachte-tem Kontext48, da es sich hierbei aber um Funde aus İkiztepe handelt, muß die von den Ausgräbern vorgenommene, sehr späte Datierung in die entwickelte anatolische Frühbron-zezeit (FBZ II, sprich etwa um 2.500 v. Chr.)49 wegen der bereits angeführten Datierungs-probleme eher abschlägig beurteilt werden. Da die chronologische Stellung der Funde aus dem balkanischen wie griechischen-ägäischen Raum als gesichert gelten muss, scheint es nicht gerechtfertigt, für die „Idole“ aus Ikiztepe – und die nordanatolisch-pontischen Ring-idole allgemein – eine etwa 1000 Jahre jüngere Zeitstellung anzunehmen. Die Fundstücke illustrieren m. E. vielmehr den Transfer von Gütern, Ideen und womöglich auch religiösen Überzeugungen entlang des west- und südpontischen Gebietes weit vor dem Beginn des 3. Jahrtausends v. Chr. Selbst unter Berücksichtigung aller Unwägbarkei-ten, die der unklaren Stratigraphie und Chronologie des İkiztepe geschuldet sind, lässt sich für die pontischen Ringidole kaum ein späterer Zeitpunkt als das späte 5. und 4. Jahrtau-send v. Chr. namhaft machen. Auch die Verwendung von Blei und Silber wiederspricht dieser These nicht, da diese Rohstoffe in Anatolien nachweislich bereits im 4. Jahrtausend v. Chr. geschürft, verhüttet und zu Schmuck verarbeitet wurden50. Zeitlich und kulturell problematischer einzuordnen ist eine Variante des „klassischen“ Ringidols mit Kopföse bzw. gebogenem oder eingerolltem „Kopf“. Aus archäologisch gesichertem Zusammenhang sind derartige Idole, aus Silber gefertigt, in Poliochni sowie mit bleiernen und goldenen Exemplaren aus dem Gräberfeld von Baklatepe, nahe der türkisch-ägäischen Küste auf uns gekommen, deren stratigraphischer Kontext und Fund-
42 Maran 2000, 185. 43 Zimmermann 2007b, 26. 44 Vgl. Behrens 1970, 30 ff.; Kytlicová 1960, 445. 45 Maran 2000; Kyparissi-Apostolika 2008, 301 f.; 306 Abb. 2; Skafida 2008, 520. 46 Skafida 2008, 520 f.; 529 Abb. 7. 47 Zimmermann 2007b, 26 ff. 48 Vgl. Bilgi 1984, 70; 95 Abb. 18,265 aus Schnitt D, Schicht 3 der Siedlung; zwei weitere Idole stammen aus Gräbern
(Bilgi 1984, 70 Nr. 266; 95 Abb. 18,266; 71 Nr. 267; 95 Abb. 18,267); siehe auch Zimmermann 2007b, 29 f. 49 Bilgi 1984, 70. 50 Vgl. Zimmermann 2005.
470
Abb. 4. Ringförmige Idole aus Anatolien: 1-3 – İkiztepe, 4-6 – Umgebung von Trabzon (nach Zimmermann 2007b, ohne Maßstab).
vergesellschaftung eine Datierung in die Frühbronzezeit I nach anatolischer Terminologie, sprich das frühe 3. Jahrtausend v. Chr. erlaubt51. Aus der Umgegend von Sardis ist ein weiteres, kontextloses Exemplar gleicher Machart bekannt52, und erscheint als Reliefverzierung auf einem in Privatbesitz befindlichen, prä-historischen Wirtschaftsgefäss aus der „Gegend von Yortan“53. Dies ist bekanntermassen keine allzu verlässliche Angabe, jedoch ist aus Yortan tatsächlich ein grösseres, zum über-wiegenden Teil beraubtes, frühbronzezeitliches Gräberfeld bekannt54. Formal ließe sich das Gefäss mit Reliefapplike jedenfalls gut mit dort geläufigen Frühbronzezeit-I-zeitlichen Ke-ramiken korrelieren. Fasst man diese Beobachtungen zusammen, so ergibt sich für das zweite, westanatolische Verbreitungszentrum der typologisch modifizierten Ringidole ein erheblich jüngerer Zeitansatz. Hier ist an eine, vom pontischen Interaktionsgebiet unabhän-gige, zeitlich später anzusetzende Vermittlung über die ägäische Inselwelt nach Westklein-asien zu denken. Zwar musste hierbei von den Navigatoren das Wagnis in Kauf genommen werden, zumindest zeitweise die offene See anzusteuern, jedoch könnten die vergleichs-weise dicht gestaffelten Inseln der östlichen Ägäis Sichtkontakt zum nächstgelegenen Fest-
51 Keskin 2008, 87 ff.; 93 Abb. 1-4. 52 Waldbaum 1983, 151-52; Taf. 58,997-99; Zimmermann 2007b, 29. 53 Höckmann 1984, 135 Abb. 7,3; ebenso Keskin 2008, 90. 54 Kâmil 1982.
471
land erlaubt haben, wie es bei der bereits früher einsetzenden küstennahen Schifffahrt ent-lang der Ufergrenzen des Schwarzen Meeres möglich war. Frühe Kupferdolche repräsentieren schliesslich eine weitere, in der Diskussion um anato-lisch-europäische Beziehungen bislang weitgehend vernachlässigte Fundgattung, die vor-bronzezeitliche Kontakte zwischen den Kulturen Südosteuropas bzw. des westlichen Schwarzmeerraumes und des türkischen Pontusgebietes illustrieren können. Die frühesten Belege für metallene, zweischneidige Stichwaffen stammen in diesem Falle nicht etwa aus dem Vorderen Orient, sondern lassen sich im hochkupferzeitlichen Horizont des südost-europäisch-balkanischen Gebietes verorten55. Gräber der Tiszapolgár und Bodrogkeresztúr-Kultur (frühes 4. Jahrtausend v. Chr.) erbrachten einfache lanzettförmige bzw. rhombisch geformte Kupferdolche, die zwei geschärfte Schneiden besitzen und dadurch klar von einem Messer zu unterscheiden sind56. Freilich ist davon auszugehen, dass diese frühen Exemplare nicht ausschliesslich im Kampfesgeschehen zum Einsatz kamen, dennoch wei-sen einige der frühen Dolchklingen, bei genauer Autopsie, typische Verformungen des Klingenblattes auf, wie sie ausschliesslich durch eine Benutzung als Stich- oder Stosswaffe hervorgerufen werden können57. In Anatolien setzt die regelhafte, flächendeckende Verwendung von Metalldolchen erst re-lativ spät mit dem Beginn des 3. vorchristlichen Jahrtausends ein, jedoch lassen sich ver-einzelte Befunde in einen älteren Zeithorizont datieren. Aus den chalkolithischen Schich-ten der westanatolischen Siedlung Beycesultan lässt sich ein versprengtes Dolchklingen-bruchstück namhaft machen, das mit weiteren, womöglich zu einem Handwerkerdepot ge-hörigen Metallgegenständen wie Ahlen oder schlanken Meisseln vergesellschaftet war und in die zweite Hälfte des 4. Jahrtausends v. Chr. datiert werden kann58. Der einzige weitere, sicher datierte Fundplatz ist die am Ostufer der Marmarasees gelegene Siedlung Ilıpınar (Abb. 5)59. Die chalkolithische Nekropole oberhalb der neolithischen Siedlung erbrachte Gräber des späten 4. Jahrtausends v. Chr., die aus Arsenkupfer gefertigte60, einfache, lan-zettförmige Dolchklingen sowie entwickelte Varianten mit Nietheftung enthielten61. Einfache, aus Arsenkupfer gefertigte Klingen sind schliesslich auch aus den einschlägigen Siedlungschichten und Gräbern des İkiztepe bekannt (Abb. 6)62. Natürlich muss auch hier die Frage gestellt werden, inwiefern die „offizielle“ Datierung dieser Funde in das spätere 3. Jahrtausend v. Chr., also die entwickelte anatolische Frühbronzezeit gerechtfertigt ist. Vielmehr ist auch in diesem Fall wahrscheinlich, dass etliche der als „frühbronzezeitlich“ bekanntgemachten Klingen einem wesentlich früheren Zeithorizont angehören. Hinsichtlich Formgebung und Machart lassen sich einige der Dolchklingen überzeugend mit den sicher stratifizierten und datierten Exemplaren aus Ilıpınar in Verbindung bringen, 55 Zimmermann 2004-2005, 252 ff.; ebd. 2007a, 24 ff. 56 Ebd. 57 Ebd. 2007a, 6 f. mit Abb. 2. 58 Lloyd/Mellaart 1962, 19; 21; 112 f. Tab; Stronach 1962, 280 ff.; 281 Abb. 8,15; Zimmermann 2005, 194 ff. mit Anm.
85. 59 Roodenberg/Thissen/Buitenhuis 1989-90, 74 ff.; Roodenberg 2001; Zimmermann 2007a, 36 ff. 60 Begemann/Pernicka/Schmitt-Strecker 1994. 61 Zimmermann 2007a, 37 Abb. 22. 62 Bilgi 1984, 42 ff.; Abb. 13; Zimmermann 2004-2005, 258 Abb. 8,1-8.
472
Abb. 5. Arsenkupfer-Dolche aus der chalkolithischen Nekropole von Ilıpınar (nach Zimmermann 2004-2005, ohne Maßstab).
die ihrerseits klare Affinitäten mit frühen karpatho-balkanischen Dolchklingen vom Typus Bodrogkeresztúr aufweisen63. Als Vermittlerregion für diese offenkundig südosteuropäi-sche Innovation mag auch in diesem Fall die west-südwestliche Schwarzmeerküste eine entscheidende Rolle gespielt haben. 63 Höckmann 1984, 133 Abb. 7,3; ebenso Keskin 2008, 90.
473
Abb. 6. Dolche der „frühbronzezeitlichen“ Nekropole von İkiztepe (nach Zimmermann 2004-2005, ohne Maßstab).
Anhand dieser beiden Fallbeispiele lässt sich verdeutlichen, dass Kulturkontakte entlang der westlichen und südlichen Schwarzmeerküsten nicht erst verstärkt ab dem 3. Jahrtau-send v. Chr. gepflegt wurden, sondern ihre Wurzeln weit in das 4., womöglich bis in das 5. vorchristliche Jahrtausend zurückreichen. Diese Kontakte – soweit dies nach derzeitiger, im Hinblick auf die chronologische Abfolge im türkischen Schwarzmeergebiet leider noch vollkommen unzureichender Kenntnislage beurteilt werden kann – hatten auf das anatoli-sche Kulturgepräge der Vorbronzezeit einen Einfluss, der weit über die blosse Adaption von Stilmerkmalen hinauszureichen scheint. Die Präsenz von Ringidolen zeugt von dem Ausgreifen südosteuropäisch-balkanischer, im weitesten Sinne religiöser Symbolwelten in die griechisch-ägäische Koiné, die anatolische Schwarzmeerküste sowie deren Hinterland im 5. und 4. Jahrtausend v. Chr. Einen späten Widerhall dieses Symbols – und den damit verbundenen religiösen Überzeu-gungen? – mag man in den modifizierten ostägäisch-westanatolischen Idolen mit gerolltem Kopf sehen, die dank fortgeschrittener Navigationstechniken nicht notwendigerweise ent-lang einer zusammenhängenden Küstenlinie wie die des südwestlichen Pontusgebietes, sondern über die ostägäischen Inselgruppen tradiert wurden. Von enormer technischer wie sozialgeschichtlicher Bedeutung ist schliesslich das Aufkommen zweischneidiger metalle-ner Stichwaffen in Anatolien, bei deren Vermittlung Südost-europa und dem Balkanraum eine führende Rolle zugesprochen werden muss. Die Funde aus Ilıpınar – und letztendlich auch İkiztepe – zeugen formal wie technisch von engen Beziehungen zu den hochkupfer-zeitlichen Kulturen des Balkanraumes. Auch hier erscheint die Schwarzmeerregion als idealer Interaktionsraum für den Austausch technischer und sozialer Innovationen in prähistorischer Zeit, dessen intensive archäologi-sche Erschliessung ein wichtiges Desiderat zukünftiger Forschungsarbeit darstellt. Bis da-hin wird man nicht umhinkommen, das forschungsgeschichtlich bedingte chronologische Dilemma der türkischen Pontusregion wiederholt zu zitieren.
474
Literaturverzeichnis
Alkım 1983a: U.B. Alkım, Einige charakteristische Metallfunde von İkiztepe. In: R.M. Boehmer/H. Hauptmann, Beiträge zur Altertumskunde Kleinasiens. Festschr. Kurt Bittel (Mainz 1983) 29-42. Alkım 1983b: H. Alkım, Ein Versuch der Interpretation der Holzarchitektur von İkiztepe. In: R.M. Boehmer/H. Hauptmann, Beitr. zur Altertumskunde Kleinasiens. Festschr. Kurt Bittel (Mainz 1983) 13-27. Alkım/Alkım/Bilgi 1988: U.B. Alkım/H. Alkım/Ö. Bilgi, İkiztepe I. Birinci ve İkinci Dö-nem Kazıları. The First and Second Seasons’ Excavations (1974-1975) (Ankara 1988). Alkım/Alkım/Bilgi 2003: U.B. Alkım/H. Alkım/Ö. Bilgi, İkiztepe II. Üçuncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci Dönem Kazıları. The third, fourth, fifth, sixth and seventh Sea-sons’ Excavations (1976-1980) (Ankara 2003). Begemann/Pernicka/Schmitt-Strecker 1994: F. Begemann/E. Pernicka/S. Schmitt-Strecker, Metal Finds from Ilıpınar and the Advent of Arsenical Copper. Anatolica 20, 1994, 203-219. Behrens 1970: H. Behrens, Der Knochenschmuck der Schönfelder Kultur – Nachahmung von südöstlichen Metallvorbildern? Ausgr. u. Funde 15, 1970, 30-33. Bilgi 1984: Ö. Bilgi, Metal Objects from İkiztepe-Turkey. Beitr. Allg. u. Vgl. Arch. 6 1984, 31-96. Bilgi 1990: Ö. Bilgi, Metal Objects from İkiztepe-Turkey. Beitr. Allg. u. Vgl. Arch. 9-10, 1990, 119-219. Bilgi 2000: Ö. Bilgi, İkiztepe Kazıları. In: O. Belli (Hrsg.), Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (1932-1999) (Ankara 2000) 111-117. Bilgi 2001a: Ö. Bilgi, Metallurgists of the Central Black Sea Region. A New Perspective on the Question of the Indo-Europeans’ Original Homeland (Istanbul 2001). Bilgi 2001b: Ö. Bilgi, Orta Karadeniz Bölgesi Protohistorik Çağ Maden Sanatının Kökeni ve Gelişim. Belleten 65, 2001, 1-35. Bilgi 2004: Ö. Bilgi, İkiztepe Mezarlık Kazıları ve Ölü Gömme Gelenekleri. Anadolu Araştırmaları 17, 2004, 25-50.
475
Bilgi 2005a: Ö. Bilgi, Orta Karadeniz Bölgesi MÖ 2. Binyıl Metal Silahları. V. Uluslarara-sı Hitiologji Kongresi Bildirileri. Çorum 02-08 Eylül, 2002. Acts of the Vth International Congress of Hititology. Çorum, September 02-08, 2002 (Ankara 2005) 119-149. Bilgi 2005b: Ö. Bilgi, Distinguished Burials of the Early Bronze Age Graveyard at İkizte-pe in Turkey. Anadolu Araştırmaları 18, 2005, 15-113. Burney 1956: C. Burney, Northern Anatolia before Classical Times. Anatolian Stud. 6, 1956, 179-203. Dönmez 2004: Ş. Dönmez, Boyabat-Kovuklukaya: A Bronze Age Settlement in the Cen-tral Black Sea Region, Turkey. Ancient Near Eastern Stud. 41, 2004, 38-82. Dönmez 2006: Ş. Dönmez, Orta Karadeniz Bölgesi’nin İlk Tunç Çağı II Öncesi Kültürel Gelişimi Üzerine Yeni Gözlemler. Recent Observations on the Cultural Development of the Central Black Sea Region before the Early Bronze Age II. In: D.B. Erciyas/E. Koparal (Hrsg.), Karadeniz Araştırmaları Sempozyum Bildirileri. Black Sea Studies Symposium Proceedings (Istanbul 2006) 89-97; 63-87. Efe/Mercan 2002: T. Efe/A. Mercan, Yassıkaya: Karadeniz Ereğli (Heraclea Pontica) Ya-kınlarından Bir İlk Tunç Çağı Yerleşmesi. 23. Kazı Sonuçları Toplantısı I (Ankara 2002) 361-374. Efe/Ay 2004: T. Efe, D.Ş.M. Ay, Yassıkaya, an Early Bronze Age Site near Heraclea Pon-tica (Kdz Ereğli) on the Black Sea Coast. In: B. Hänsel/E. Studeníková (Hrsg.), Zwischen Karpaten und Ägäis. Neolithikum und ältere Bronzezeit. Gedenkschrift für Viera Němejco-vá-Pavúková. Studia Honoraria 21 (Berlin 2004) 27-38. Erzen 1956: A. Erzen, Sinop Kazısı 1953 Yılı Çalışmaları. Türk Arkeoloji Dergisi 6, 1956, 69-72. Gates 1994: M.-H. Gates, Archaeology in Turkey. American Journal of Arch. 98, 1994, 249-278. Greaves/Helwing 2003: A. Greaves/B. Helwing, Archaeology in Turkey: The Stone, Bronze & Iron Ages, 2001. TÜBA-AR (Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeo-logy) 6, 2003, 125-157. Higham u.a. 2007: T. Higham/J. Chapman/V. Slavchev/B. Gaydarska/N. Honch/Y. Yorda-nov/B. Dimitrova, New perspectives on the Varna cemetery (Bulgaria) – AMS dates and social implications. Antiquity 81, 2007, 640-654. Höckmann 1984: O. Höckmann, Frühe Funde aus Anatolien im Museum Altessen, Essen, und in Privatbesitz. Jahrb. RGZM 31, 1984, 100-148.
476
İpek/Zimmermann 2007: Ö. İpek/T. Zimmermann, Another glimpse at “Hattian” metal-work? – A group of Bronze Age metal items from Bekaroğlu Köyü, district of Çorum, Tur-key. Anatolia Antiqua 15, 2007, 49-58. Işın 1998: M.A. Işın, Sinop Region Field Survey. Anatolia Antiqua 6, 1998, 95-139. Ivanov/Avramova 2000: I. Ivanov/M. Avramova, Varna Necropolis. The Dawn of Euro-pean Civilization (Sofia 2000). Kâmil 1982: T. Kâmil, Yortan Cemetery in the Early Bronze Age of Western Anatolia. BAR Internat. Ser. 145 (Oxford 1982). Keskin 2008: L. Keskin, Ring Idols of Bakla Tepe: the distribution of this type in Anatolia with particular references to the Aegean and the Balkans. In: O. Mnozzi/M.L. Di Mar-zio/D. Fossataro, SOMA 2005. Proceedings of the IX Symposium on Mediterranean Archaeology, Chieti (Italy), 24-26 February 2005. BAR Internat. Ser. 1739 (Oxford 2008) 87-95. Kökten/Özgüç/Özgüç 1945: K. Kökten, N. Özgüç, T. Özgüç, Türk Tarihi Kurumu adına yapılan Samsun bölgesi kazıları hakkında ilk kısa rapor. Belleten 9, 1945, 361-400. Kunç 1986: Ş. Kunç, Analyses of İkiztepe Metal Artefacts. Anatolian Stud. 36, 1986, 99-101. Kyparissi-Apostolika 2008: N. Kyparissi-Apostolika, Some Finds of Balkan (or Anatolian) Type in the Neolithic Deposit of Theopatra Cave, Thessaly. In: H. Erkanal/H. Haupt-mann/V. Şahoğlu/R. Tuncel (Hrsg.), The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age (Ankara 2008) 301-307. Kytlicová 1960: O. Kytlicová, Eneolitické Pohřebiště v Brandýsku. Das äneolithische Grä-berfeld in der Gemeinde Brandýsek. Památky Arch. 51, 1960, 442-74. Lichardus 1991: J. Lichardus, Das Gräberfeld von Varna im Rahmen des Totenrituals des Kodžadermen-Gumelnita-Karanovo-VI-Komplexes. In: J. Lichardus (Hrsg.), Die Kupfer-zeit als historische Epoche. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 55 (Bonn 1991) 167-194. Lichter 2001: C. Lichter, Untersuchungen zu den Bestattungssitten des südosteuropäischen Neolithikums und Chalkolithikums (Mainz 2001). Lichter 2006: C. Lichter, Varna und İkiztepe: Überlegungen zu transpontischen Kulturbe-ziehungen im 5. und 4. Jahrtausend. In: A. Erkanal-Öktü/E. Özgen/S. Günel u.a. (Hrsg.), Studies in Honour of Hayat Erkanal. Cultural Reflections (Istanbul 2006) 526-534.
477
Lloyd 1956: S. Lloyd, Early Anatolia. The Archaeology of Asia Minor before the Greeks (Harmondsworth 1956). Lloyd/Mellaart 1962: S. Lloyd/J. Mellaart, Beycesultan Vol I. The Chalcolithic and Early Bronze Age Levels (London 1962). Makkay 1976: J. Makkay, Problems concerning Copper Age chronology in the Carpathian basin. Copper Age gold pendants and gold discs in Central- and South-East Europe. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 28, 1976, 251-300. Maran 2000: J. Maran, Das ägäische Chalkolithikum und das erste Silber in Europa. In: C. Işık (Hrsg.), Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens und des ägäischen Bereiches: Festschrift für Baki Öğün zum 75. Geburtstag. Asia Minor Stud. 39 (Bonn 2000) 179-193. Matthews 2004: R. Matthews, Salur North: An Early Bronze Age Cemetery in North-Cen-tral Anatolia. In: A. Sogona (Hrsg.), A View From the Highlands. Archaeological Studies in Honour of Charles Burney. Ancient Near Eastern Studies Suppl. 12 (Herent 2004) 55-66. Matthews/Pollard/Ramage 1998: R. Matthews/T. Pollard/M. Ramage, Project Paphlagonia: Regional Survey in Northern Anatolia. In: R. Matthews (Hrsg.), Ancient Anatolia. Fifty Years’ Work by the British Institute of Archaeology at Ankara (Exeter 1998) 195-206. Matthews 2007: R. Matthews, An arena for cultural contact: Paphlagonia (north-central Turkey) through prehistory. Anatolian Stud. 57, 2007, 25-34. Mellink 1955: M.J. Mellink, Archaeology in Asia Minor. American Journal of Arch. 59, 1955, 231-240. Mellink 1987: M. Mellink, Archaeology in Anatolia. American Journal of Arch. 91, 1987, 1-30. Müller-Karpe 1974: H. Müller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte. Dritter Band Kupfer-zeit. Dritter Teilband Tafeln (München 1974). Özgüç 1948a: T. Özgüç, Die Bestattungsbräuche im vorgeschichtlichen Anatolien (Ankara 1948). Özgüç 1948b: T. Özgüç, Samsun hafriyatının 1941-1942 yılı neticeleri. III. Türk Tarih Kongresi 1943 (Ankara 1948) 393-419. Parzinger 1993a: H. Parzinger, Studien zur Chronologie und Kulturgeschichte der Jung-stein-, Kupfer- und Frühbronzezeit zwischen Karpaten und Mittlerem Taurus. RGF 52 (Mainz 1993).
478
Parzinger 1993b: H. Parzinger, Zur Zeitstellung der Büyükkaya-Ware: Bemerkungen zur vorbronzezeitlichen Kulturabfolge Zentralanatoliens. Anatolica 19, 1993, 211-229. Roodenberg 2001: J. Roodenberg, A Late Chalcolithic Cemetery at Ilıpınar in Northwes-tern Anatolia. In: R.M. Böhmer/J. Maran (Hrsg.), Lux Orientis. Archäologie zwischen Asien und Europa. Festschr. Harald Hauptmann (Rahden/Westf. 2001) 351-355. Roodenberg/Thissen/Buitenhuis 1989-90: J. Roodenberg/L. Thissen/H. Buitenhuis, Preli-minary Report on the Archaeological Investigations at Ilıpınar in NW Anatolia. Anatolica 16, 1989-90, 61-144. Schoop 2005: U. Schoop, Das anatolische Chalkolithikum. Eine chronologische Untersu-chung zur vorbronzezeitlichen Kultursequenz im nördlichen Zentralanatolien und den an-grenzenden Gebieten. Urgesch. Stud. I (Remshalden 2005). Skafida 2008: E. Skafida, Symbols from the Aegean World: The Case of Late Neolithic Fi-gurines and House Models from Thessaly. In: H. Erkanal/H. Hauptmann/V. Sahoglu/R. Tuncel (Hrsg.), The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age (An-kara 2008) 517-532, Srejović 1993: D. Srejović, Der Balkan und Anatolien in der mittleren und jüngeren Stein-zeit. Anatolica 29, 1993, 269-282. Steadman 1995: S.R. Steadman, Prehistoric Interregional Interaction in Anatolia and the Balkans: An Overview. Bull. of the American School of Oriental Research 299/300, 1995, 13-32. Stronach 1962: D. Stronach, Metal Objects. In: Lloyd/Mellaart 1962, 280-292. Thissen 1993: L. Thissen, New Insights in Balkan-Anatolian Connections in the Late Chal-colithic: Old Evidence from the Turkish Black Sea Littoral. Anatolian Stud. 43, 1993, 207-237. Todorova 1998: H. Todorova, Der balkano-anatolische Kulturbereich vom Neolithikum bis zur Frühbronzezeit (Stand der Forschung). In: M.R. Stefanovich (Hrsg.), James Harvey Gaul in memoriam (Sofia 1998) 27-54. Todorova 1995: H. Todorova, Die Anfänge der Metallurgie an der westlichen Schwarz-meerküste. In: A. Hauptmann/E. Pernicka/T. Rehren/Ü. Yalçın (Hrsg.), The Beginnings of Metallurgy. Proceedings of the International Conference „The Beginnings of Metallurgy“, Bochum 1995. Der Anschnitt Beih. 9 (Bochum 1999) 237-246. Waldbaum 1983: J.C. Waldbaum, Metalwork from Sardis. The Finds through 1974 (Cam-bridge 1983).
479
Weisshaar 1982: H.-J. Weisshaar, Varna und die ägäische Bronzezeit. Arch. Korrbl. 12, 1982, 321-329. Winthorp 1991: R.H. Winthorp, Dictionary of Concepts in Cultural Anthropology (West-port 1991). Yakar 1985: Y. Yakar, The Later Prehistory of Anatolia. The Late Chalcolithic and Early Bronze Age. BAR Internat. Ser. 268 (Oxford 1985). Zanotti 1984/85: D.G. Zanotti, Varna: The Necropolis and the Gold Finds. Talanta 16/17, 1984/85, 53-73. Zimmermann 2004/2005: T. Zimmermann, Early daggers in Anatolia – A necessary reap-praisal. Anodos – Studies of the Ancient World 4-5, 2004-2005, 251-262. Zimmermann 2005: T. Zimmermann, Zu den frühesten Blei- und Edelmetallfunden aus Anatolien – Einige Gedanken zu Kontext und Technologie. Der Anschnitt 57, 2005, 190-199. Zimmermann 2007a: T. Zimmermann, Die ältesten kupferzeitlichen Bestattungen mit Dolchbeigabe. Archäologische Untersuchungen in ausgewählten Modellregionen Alteuro-pas. Monogr. RGZM 71 (Mainz 2007). Zimmermann 2007b: T. Zimmermann, Anatolia and the Balkans, once again – Ring-shaped idols from Western Asia and a critical reassessment of some „Early Bronze Age“-items from İkiztepe, Turkey. Oxford Journal Arch. 26, 2007, 25-33.























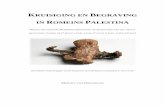





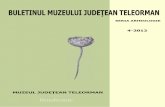





![1994. Vee en vlees in de nederzetting in Oss-Ussen (800 v. Chr – 250 na Chr) [in Dutch; Cattle and meat in the settlements of Oss-Ussen (800 BC - AD 250)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6337a9447dc7407a2703e14a/1994-vee-en-vlees-in-de-nederzetting-in-oss-ussen-800-v-chr-250-na-chr-in.jpg)