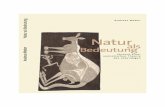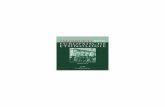Gender und Erwachsenenbildung - Zugänge, Analysen und Maßnahmen
Kulturas 7/August-September/2013. Das Magazin für Natur und Kultur in Spanien und Portugal
-
Upload
tipografos -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Kulturas 7/August-September/2013. Das Magazin für Natur und Kultur in Spanien und Portugal
Das Magazin für Natur, Kultur und Geschichte in Portugal und Spanien.
KULTURAS7
August +September2013
Miguelón in Burgos
Kulturas 7 / August+September 2013 / Intro / Seite 2 Suchen: CTRL+F
NutzungDas PDF im Querformat, ist bequem zu lesen – im PC, Notebook oder Tablet. Die Interaktion ist immer vorhanden, wo sie funtional ist, z.B. im Inhaltsverzeichnis. Oder bei Querverweisen. Einfach klicken.Diese Publikation ist für den persönlichen Gebrauch des Lesers bestimmt. Die kom merzielle Nutzung ist untersagt. Der Verkauf an Dritte ist nicht gestattet. Die Verbreitung über andere sites als www.portugal-kultur.de ist nicht erlaubt, da diese Ausgabe durchaus noch Korrekturen und Erweiterungen erfahren kann.
Die dem Leser eingeräumten Nutzungsrechte berechtigen ihn nicht dazu, Texte oder Bilder an Dritte zu verkaufen. Wenn Sie Bilder erwerben wollen, treten Sie bitte mit dem Verleger ([email protected]) in Verbindung.
Selbstverstandlich kann das Heft ausgedruckt und in privaten und öffentlichen Bibliotheken integriert werden.
Diese Veröffentlichung ist kein Heft der „akademischen” Art. Der stetige Quali täts schwund sog. akademischer Zeitschriften (Au snahmen bestätigen die Regel) ermuntert uns nicht dazu, mit solchen in einem Topf geworfen zu werden. Dennoch ermutigen wir Schü ler und Studenten dazu, aus Kulturas zu zitieren.
HeimatKulturas ist immer auf folgender WebSeite zu finden: www.portugal-kultur.de/kulturas.In 2013 ist die Verteilung der PDFs kostenlos.
Verleger, CopyrightDie Hefte von Kulturas, etwa 100 bis 120 Seiten stark, ausschließlich im digitalen Format PDF verbreitet, werden herausgegeben und gesetzt von Paulo Heitlinger; sie sind auch intellektuelles Eigentum des Verlegers. Es gibt keine gedruckte Fassung.
Gebrauchsanweisung für Kulturas
Benutzen Sie die Version 11 vom Acrobat Reader, um Kulturas zu lesen. So profitieren Sie von allen Navigations- und Interaktions- Möglichkeiten, die in diesem PDF vorhanden sind. Außerdem können Sie Ihr Exemplar mit Unterstreichungen markieren und mit Notizen versehen.Die Acrobat Reader V. 11 ist kostenlos und bei Adobe herunterzuladen.
WerbungDie letzten Seiten enthalten Werbung. Wenn Sie Publikationen, Kongresse, Lesungen, Ausstellung oder sonstige kulturelle Iniatiaven ankündigen wollen, senden Sie uns bitte rechtzeitig Texte und Bilder. Die Ver öffen tli chung im AnzeigenTeil ist kostenlos.
MitarbeiterKulturas ruft alle Interessierte auf, Nachrichten, Kommentare, Texte und Bil der einzusenden. Kulturas steht der Zusam menarbeit mit Mitarbeitern – regelmäßige oder sporadische – offen. Und hofft, bald eine breitere Palette an Mitarbeitern zu integrieren. Freiwillige, die nichts, außer Ruhm und Ehre, verdienen werden.
Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn die nächste Ausgabe erscheint? Dann schicken Sie bitte eine kurze e-mail an [email protected] mit dem Betreff «Kulturas-Abo»
Intro
Kulturas 7 / August+September 2013 / Intro / Seite 3 Suchen: CTRL+F
Das Magazin für Natur, Kultur undGeschichte in Portugal u. Spanien. Nr. 7 / August, September 2013
KULTURAS7
Schriftformen aus dem Mittelalter – ein Thema für Kulturas?
Diesmal sind wir doch gespannt, ob die vielen Seiten mit Bilddokumentation über mittelalterliche Schriften bei unseren Lesern „ankom
men”. Denn es ist gewiß ein selten ventiliertes Thema. Aber gerade die Tatsache, daß die Schriftkultur von der großen Mehrheit der Kultur zeitschriften ganz und gar ignoriert wird, hat uns dazu gereizt, dieses Thema aufzugreifen. Schriftkultur ist eben auch ein Teil der Kultur, der Geschichte und des Património eines Landes. Mehr dazu ab Seite 67. Im nächsten Heft werden wir uns den gotischen Schriften widmen. Viel Spaß beim Lesen,
Ihr Paulo Heitlinger
ThemenIntro ................................................2
Gebrauchsanweisung für Kulturas ......................... 215% mehr Wein ...........................................................4
Evolution ...................................... 12Wie wurde der Mensch Mensch? ...........................12Enzyklopädie der Evolution ...................................24Macht die Evolution Sinn? ..................................... 27Suche nach der Schönheit ......................................29
Ein Sommer für Keramik ................ 32Keramik in Spanien und Portugal... .......................33Kachelkunst, nicht nur in Blau-Weiß .................. 46Doesburg, Bill, Wollner ......................................... 49
Design ............................................49
Street Art ......................................64Fefe & die Street-Art Brasiliens ............................. 65Pixação gefällig? ....................................................... 82
Unzialen in Stein ............................ 87Unzialen, vom 11. bis zum 14. Jahrhundert ..........88
Werbung ....................................... 121Reisen auf den Spuren der Westgoten ................124Keramik in Spanien und Portugal ....................... 126
Die Wirtschaft und erst recht die Politik in Portugal verursachen beklemmende Trauermeldungen. Nur die Prognose für die Weinlese 2013 in Portugal ist optimistisch: Die Exper
ten rechnen mit einem Zuwachs von 7 bis 30% gegenüber dem Vorjahr, was einem Volumen von circa 6,7 Millionen Hektoliter entspricht. Die Schät
zung kam vom Instituto do Vinho e da Vinha (IVV). Eine Zunahme wird in allen Weinbaugebieten Portugals erwartet, mit Ausnahme der Regionen des Tejo und der Halbinsel von Setúbal.
Die verspätete Entwicklung der Wetterbedingungen im Frühjahr und im Sommer 2013 kann dazu führen, daß die vindima (Weinlese) auch eine, zwei
oder gar drei Wochen später anfängt. Ein erheblicher Zuwachs in der Weinlese wird für das Dourogebiet erwartet – zwischen 15% und 20%. Die größte Zunahme dürfte sich allerdings in den Inseln der Azoren ereignen: satte 30%.
Alles zusammengezählt, bedeutet dies: im Durchschnitt, 15% mehr Wein in Portugal.
15% mehr WeinBild auf dieser und den nächsten Seiten: Weinlese im Douro-Tal, in der Nähe von Alijó. Fotos: Birgit Wegemann und Paulo Heitlinger.
Weinlese
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 12 Suchen: CTRL+F
Wie wurde der Mensch Mensch?
Evolution
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 13 Suchen: CTRL+F
Seit 2010 besitzt die kastilische Stadt Burgos mit dem Museum der menschlichen Evolution (MEH, Museo Evolución Humana) einen Anziehungspunkt erster Güte. Besucher können sich anhand von Fundstücken aus der nahe gelegenen Ausgrabungsstätte Atapuerca auf eine Zeitreise bis in die Anfänge der Menschheitsgeschichte begeben.
In der bedeutendsten Ausgrabungsstätte des Paläolithikums in Europa finden sich zahlreiche fossile Zeugnisse der ersten menschlichen Bewohner Europas. Fos
sile, deren wissenschaftliche Untersuchungen Informationen von unschätzbarem Wert über das Leben der ältesten unserer Vorfahren bieten.
Atapuerca liegt inmitten des Korri-dors von La Bureba, einem Pass zwischen den Flüssen Ebro und Duero. Die durch die Zusammenkunft medi
terraner, atlantischer und kontinentaler Einflüsse klimatisch bevorzugte Region brachte seit jeher eine vielseitige Flora und
Schädel Nr. 5 der Sima de los Huesos, 1992 ausgegraben. Der Kiefer tauchte bei einer späteren Ausgrabung auf. Der Schädel Nr. 5 ist der weltweit besterhaltene Schädel eines Homo Heidelbergensis, der im Volksmund zu Ehren Miguel Indurains Miguelón genannt wurde.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 14 Suchen: CTRL+F
Fauna hervor. Dementsprechend reichen hier die Spuren menschlicher Besiedelung bis zu mehr als einer Million Jahre zurück.
Die Gebirgslandschaft Sierra de Ata-puerca besteht aus einem Karstkomplex mit einem weitläufigen unterirdischen System aus Galerien und Höhlen. Viele
von ihnen waren einst nach außen geöffnet und sind durch Einstürze und die Einlagerungen von Sedimenten, darunter Überreste von Tieren, Pflanzen, Teilen der Essensvorräte von menschlichen und tierischen Bewohnern, im Laufe der Jahrtausende verschlossen worden.
Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde vor allem in der Cueva Mayor geforscht. 1868 gab es die ersten Beschreibungen der Höhle. 1910 wurden die ersten Höhlenzeichnungen entdeckt.
Ende des 19. Jahrhunderts hatte man mit dem Bau einer Eisenbahnstrecke durch die Sierra de Atapuerca begonnen. Sie war für den Transport von Kohle und Eisen aus der nahen Sierra de Demanda bis ins Baskenland vorgesehen. 1910 wurde die Strecke jedoch bereits wieder stillgelegt.
Systematische Ausgrabungen in der Höhle und entlang der Eisenbahnstrecke gibt es seit dem Jahr 1964. Seit damals und bis heute traf
Galería Trinchera, Atapuerca, Spanien. Foto: Mario Modesto. Die Sierra de Atapuerca ist ein kleiner Gebirgszug nördlich von Ibeas de Juarros in der Provinz Burgos, der sich zwischen
dem Kantabrischen und dem Iberischen Gebirge von Nordosten nach Südosten erstreckt. Sie wurde wegen der archäologischen und paläontologischen Funde zum Naturschutzgebiet, zum schützenswerten Kulturgut und zum Unesco-Welterbe erklärt. Zu den Funden zählen Fossilien von drei Arten von Hominiden: Homo Antecessor, Homo Heidelbergensis und Homo Sapiens.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 15 Suchen: CTRL+F
man im Laufe der Arbeiten auf Funde von Höhlenmalereien, Überbleibsel von Begräbnisriten, Steinwerkzeuge und Tierfossilien.
1992: der Homo heidel-bergensis erscheint
Spektakuläre Entdeckungen wie der Fund einer bisher unbekannten Bärenart und jahr tausendealte menschliche Knochen sorgten dafür, daß ein Teil der Menschheits
geschichte neu geschrieben werden mußte. Im Sommer 1992 stießen die Archäologen in
der Sima de los Huesos, („Erdloch der Knochen“), auf Reste von Menschen beider Geschlechter und unterschiedlichen Alters. Darunter befand sich der berühmte Schädel von Miguelón, einem Homo heidelbergensis, und dem bisher besterhaltenen menschlichen Fund aller Zeiten.
Schwer zugänglich und tief im Innern des Berges gelegen, ist dieses Erdloch der fossilienreichste Ort der Welt. Mittlerweile brachte das EIATeam dort über 6500 hominide Fossilien ans Tageslicht, die von mindestens 28 Individuen stammen. Die Überreste sind mehr als 530.000 Jahre alt und wurden der Art Homo heidelbergen-sis zugeordnet. Es ist nicht klar, wie es zu dieser Ansammlung kommen konnte, eine Epidemie wäre eine mögliche Erklärung.
Insgesamt sind an die 200 Originalfossile aus den Fundstätten der Sierra
de Atapuerca im MEH zu sehen. Darunter stechen die Überreste des Homo Antecessor und des Homo Heidelbergensis hervor, aber auch Fossile von unserem direkten Vorfahren, dem Homo Sapiens.
Obwohl die Ausgrabungen in Atapuerca weitergehen und neue Funde zu Tage fördern, stehen einige Teile des Ausgrabungsgeländes für
Besucher offen. Eine Besichtigung der Stätte beginnt an der Trinchera del Ferrocarril. Von hier gelangt man in die Höhle Gran Dolina, der Fundstelle des Homo Antecessor. Danach folgt ein Rundgang durch die Galería und die Sima del Elefante. Foto: MEH.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 17 Suchen: CTRL+F
Allein die Funde in der Knochengrube stellen 70% der bisher in aller Welt gefundenen menschlichen Fossile dar! Weitere interessante Funde ließen den Schluss
auf die älteste Art von Kannibalismus in Euro pa zu. Ein unbenutzter Faustkeil, der Exca-libur getauft wurde und Teil einer Bestattungsgabe war, brachte den Forschern die Gewissheit, daß bereits der Homo heidelbergensis, dessen Vorkommen man auf etwa 500.000 bis 600.000 Jahre vor unserer Zeit schätzt, bereits die Fähigkeit zu symbolischen Handlungen hatte.
Die Funde von Gran Dolina: der Homo Antecessor
Schon 1994 wurde die nächste Sensation aus den Sedimenten befreit, diesmal an der Fundstelle Gran Dolina. Bald stand fest: Diese Fossilien müssen älter
als 780.000 Jahre sein – also die bis dato ältesten Europas. Daraus machten die Forscher des EIA 1997 eine neue Art: Homo antecessor.
Der „vorausgehende Mensch“, der Pionier Europas soll auch noch der gemeinsame Vorfahr von Neandertaler und Homo sapiens sein, also einen zentralen Platz im menschlichen
In der Nähe von Burgos, im Karstsystem Sierra de Atapuerca, ist in
den letzten Jahren ein enormes paläontologisches Forschungsprojekt entwickelt worden. In einem Geländeeinschnitt, der im Rahmen der Errichtung einer Eisenbahnstrecke vorgenommen wurde, hatte man seit 1978 vereinzelte Fossilien entdeckt.
Im Bild: Ausgrabungen in Gran Dolina, im Jahre 2008. Dieses Panoramabild wurde mit 3 Fotos und Hugin Software hergestellt. Die Archäologische Schicht TD-10 – wo die meisten Menschen sich befinden – wird gerade ausgegraben. Es ist eine Stätte des Homo Heidelbergensis. Etwas tiefer im Bild, dort wo sich eine frauen mit roter Jacke befindet, wurden die ersten Reste des Homo Antecessor gefunden. Foto: Mario Modesto Mata.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 18 Suchen: CTRL+F
Stammbaum einnehmen. Diese gewagte Interpretation fand allerdings von Beginn an keine Zustimmung bei Forschern im Ausland. In der Höhle Gran Dolina stießen die Archäologen auf die damals ältesten menschlichen Knochen in Europa.
Neben Steinwerkzeugen und Tierfossilien tauchten die Überreste von Hominiden auf, die vor 800.000 Jahren lebten. Damit entdeckte man eine neue Spezies Mensch, ein vorher unbekanntes Glied in der Kette der menschlichen Entwicklung, den Homo Antecessor.
Im Jahr 2008 waren die Funde in der Sima del Elefante (Elefantengrube) noch spektakulärer mit dem Kieferknochen eines etwa 20jährigen menschlichen Wesens, dessen
Alter auf 1,2 Millionen Jahre datiert wurde. Der Fund des Unterkiefers zierte im März 2008 das Cover von Nature. Und schon wieder lautete die
Das MEH-Museum versteht sich als ein Museum für Atapuerca, nicht als das Museum Atapuercas. Der Besuch der Ausgrabungsstätte soll eine
Erfahrung bleiben, die nicht durch den Museumsbesuch zu ersetzen ist. Das Museum will lediglich als „virtueller Vorsaal der Ausgrabungsstätte“ zum besseren Verständnis der Ausgrabungsstätte beitragen und anhand der Funde eine didaktische Einführung in die komplexe Welt der Entwicklungsgeschichte der Menschheit leisten. Foto: MEH.
Oben: Sehr wahrscheinlich waren einige unserer Vorfahren Kannibalen. Eine künstlerische Rekonstruktion von den bekannten holländischen Illustratoren Adrie und Alfons Kennis. http://www.kenniskennis.com
Multinationale und mul-tidisziplinäre Zusammen-arbeit bei der Suche nach den ersten Europäern
Auf der Suche nach fossilen Höhlenbärzähnen stieß man in der Sierra de Atapuerca auch auf menschliche Überreste...
Mittlerweile ist das Projekt so stark angewachsen, daß Sommer für Sommer über 100 internationale Mitarbeiter auf bis zu sechs verschiedenen Ausgrabungsstellen gleichzeitig arbeiten.
Diese Fundorte decken in ihrer Gesamtheit beinahe den kompletten Zeitraum des Pleistozäns (die geologische Epoche vor 1.7 Millionen bis vor 30.000 Jahren) ab.
Auf acht verschiedenenen Lagerstätten findet man reiches Material menschlicher Fossilien oder deren Hinterlassenschaften.Foto: MEH.
Eine Serie von Sensationen
Hatte bis 1994 noch niemand an ein höheres Alter menschlicher Besiedlungsspuren in Europa geglaubt, so mußte sich dieses Bild ab jenem Jahre drastisch
ändern. Das geologische Alter einer Fossilienlagerstätte kann man mit absoluten und mit relativen Methoden beurteilen. Unter den relativen ist die biostratigrafische Methode sehr wichtig – anhand der Präsenz oder Abwesenheit von sog. Leitfossilien lässt sich das Alter von ihnen assoziierten Funden relativ gut bestimmen.
Holländische und englische Forscher publizierten, daß es in Europa keine „gesicherten” menschlichen Vorfahren vor einer halben Million gäbe. Das
evolutionäre Verschwinden einer bestimmten Art Maulwurf, Mimomis savini, gibt exakt jenen Zeithorizont vor etwa 500.000 Jahren an, ab dem man in Europa menschliche Fossilien finden konnte.
Anfangs der 90er Jahre nutzte man einige Sedimentvorsprünge, die den Schichten TD4 und TD5 der Gran Dolina entsprechen, um jene unteren
Abschnitte dieser 18 Meter hohen Sedimentschicht zu erforschen. Dabei legten die Wissenschaftler einige plumpe Quarzitwerkzeuge frei. Das besondere daran war, daß jenes Material gemeinsam mit Fauna, welche ‚Mimomis savini‘ enthielt, ausgegraben wurde. Sollte es also doch Siedlungen menschlicher Vorfahren vor 500.000 Jahren gegeben haben? Diese Entdeckung war bereits eine Sensation, allerdings erst die erste einer für die Forschung atemberaubenden Serie an Überraschungen.... Foto: MEH.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 21 Suchen: CTRL+F
Schlagzeile: Der erste Europäer! Das EIA hatte seinen eigenen Rekord nochmals um etwa 400.000 Jahre übertroffen (wie gesagt, der Unterkiefer soll 1,2 Millionen Jahre alt sein).
...
Das Museum der Evolution des Menschen gibt dem Besucher einen sumerischen Überblick über die spektakulären Funde in Atapuerca und informiert über die einzelnen
Entwicklungs phasen des Menschen. Das Untergeschoss ist das Herzstück des Museums. Hier befindet sich eine Reproduktion der Sima de los Huesos, die in der Ausgrabungsstätte selbst aufgrund des abschüssigen Geländes nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist.
Auf dieser Etage begegnet der Besucher dem Homo Antecessor und den Fundstücken aus Gran Dolina und der Sima del Elefante.
Die Ausstellungsräume im Erdgeschoss des Museums widmen sich der der Evolutionstheorie Darwins und der Entwicklungsgeschichte des Menschen sowie den außergewöhnlichen Fähigkeiten seines Gehirns, die ihn von anderen Lebewesen unterscheiden.
Der Besuch der ersten Etage beantwortet die Frage, warum wir noch immer dem Jäger von einst gleichen und doch so verschieden von ihm sind. Man entdeckt die Meilen
Homo Antecessor, erschienen auf TD6 in Atapuerca: hier eine gut gelaunte Rekonstruktion von den bekannten holländischen Illustratoren, die Gebrüder Adrie und Alfons Kennis. http://www.kenniskennis.com
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 22 Suchen: CTRL+F
steine der kulturellen Entwicklung und erhält dann in der zweiten Etage einen Einblick in die wichtigsten Ökosysteme für die Menschheitsentwicklung: Wälder, Savannen, die Tundra und Steppengebiete der letzten Eiszeit.
Insgesamt sind an die 200 Originalfossile aus den Fundstätten der Sierra de Atapuerca im Museum zu sehen. Darunter stechen die Überreste des Homo Antecessor und des Homo
Heidelbergensis hervor, aber auch Fossile von unserem direkten Vorfahren, dem Homo Sapi-ens können bewundert werden.
Man steht vor dem berühmten, etwa 500.000 Jahre alten Schädel von Miguelón, dem Kiefer von Letizia, einem Homo Antecessor, der etwa 850.000 Jahre alt ist, oder vor dem Becken von Elvis, dem weltweit besterhaltenen Fossil eines Homo Heidelbergensis, der ebenfalls vor mehr als 500.000 Jahren gelebt hat.
Aus der Tierwelt gibt es Fossile von Löwen, Equiden den Vorfahren der Pferde – Bären und Hirschen. Aufgrund der laufenden Ausgrabungen ist das Museum in
ständigem Wandel begriffen. /
Das MEH-Museum in Burgos wurde von Architekt Juan Navarro Baldeweg (Bild unten) konzipiert. Seine Konstruktion ähnelt einer Truhe, in der sich die vier Stockwerke miteinander verbinden und sich gegenseitig ergänzen. Sowohl das Äußere, das sich in Terrassen bis an den Fluß Arlanzón erstreckt, als auch die Innenräume sollen an die Topographie der Sierra de Atapuerca erinnern. Das Gebäude ist als Prisma konstruiert – mit 60 Metern Breite, 30 Metern Höhe und 90 Metern Länge. Eine doppelte Haut aus Glas überzieht die vier Fassaden. Die Dachkonstruktion erlaubt einen senkrechten Lichteinfall, der die Räume stets lichtdurchflutet und transparent erscheinen lässt. Böse Zungen behaupten, Baldeweg hätte sich ein bißchen zu sehr an Le Corbusier angelehnt. Foto: MEH.
Juan Navarro Baldeweg. Foto: © Carlos Barajas / El Mundo.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 24 Suchen: CTRL+F
Enzyklopädie der Evolution
Ausgegraben wird in Atapuerca schon seit 1978, aber erst Anfang der 90er machte das Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) Schlagzeilen. Besonders spekta
kulär war 1992 der Fund eines fast vollständigen Schädels in der Sima de los Huesos. Der Schädel schaffte es auf das Cover von Nature und wurde zu Ehren des spanischen Radrennfahrers Miguel Indurain Miguélon getauft.
Die wissenschaftliche Bedeutung von Atapuerca steht außer Frage. Aber kaum weniger beeindruckend sind die gewaltige Popularisierungsanstrengungen, die die Forscher um ihre Funde herum aufgebaut haben.
Die Grabungen werden seit 1991 von Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro und Eudald Carbonell geleitet. Diesem Trio von KoDirektoren war schon lange vorher klar, daß ihre Forschung nur dann wirklich erfolgreich sein würde, wenn sie eine breite Öffentlichkeit erreichen würde.
Die AtapuercaForscher haben ein instrumentelles Verständnis der Medien und sagen das auch offen. Bermúdez de Castro und Carbonell bezeichnen Journalisten als „unsere
Freunde”. Auf die Frage, ob die Medien immer das schreiben, was er wolle, antwortet Carbonell: „Ja, wenn sie intelligent sind.”
Nachplappern entspricht nun nicht gerade dem Ideal eines kritischen Wissenschaftsjournalismus. Diesen Mangel an Distanz mag man kritisieren. Das tut in Spanien aber kaum jemand. Einmal – und an versteckter Stelle – schrieb die Archäologin Ángeles Querol etwas spitz über die Wissenschaftsjournalistin Alicia
Rivera von El País, daß diese immer genau das sage, was auch die Forscher des EIA sagen.
Daß sich die spanischen Medien gerne zum Sprachrohr der AtapuercaForscher machen lassen und seit 20 Jahren das hohe Lied ihrer Erfolge singen, hat aber auch einen historischen Grund. Anders als etwa in der Kunst haben die Spanier in puncto Wissenschaft einen kleinen Minderwertigkeitskomplex.
Das Gefühl, in Naturwissenschaften und Technik weit hinter anderen europäischen
Eudald Carbonell, José Maria Bermúdez de Castro und Juan Luís Arsuaga.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 25 Suchen: CTRL+F
Nationen zurückzuliegen, läßt sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Daher das Bedürfnis, aufholen zu müssen – das erklärt uns die begeisterten Berichte über Atapuerca.
Nun haben spanische Forscher es ganz nach oben und zur verdienten internationalen Anerkennung gebracht. Die Allianz zwischen EIA, Journalisten und Medien ist fest geschmiedet. Arsuaga selbst verfasst Artikel für El País. Die anderen KoDirektoren schreiben eigene Blogs bei anderen spanischen Tageszeitungen. Carbonell bei El Mundo und Bermúdez de Castro bei Público und bei Diario de Burgos.
Seit 1998 haben die drei KoDirektoren 30 populärwissenschaftliche Bücher (mit)verfasst. Auch wenn es eher die Regel als die Ausnahme ist, daß Paläoanthropologen Bücher für das große Publikum schreiben, dürfte diese Produktion doch einzigartig sein.
Zur Öffentlichkeitsarbeit des EIA gehören auch Wanderausstellungen, die durch ganz Spanien ziehen und bislang von mehreren Millionen Menschen besucht wurden; Dokumentarfilme, für die Arsuaga zum Teil selbst das Drehbuch geschrieben hat. www.atapuerca.tv.
Der krönende Schlußstein dieser multimedialen Popularisierung ist das Museum der
menschlichen Evolution MEH, das 2010 in Burgos von der spanischen Königin eröffnet wurde und das 70 Millionen Euro kostete.
Das EIA versucht mit dieser umfassenden medialen Strategie, der eigenen Arbeit öffentliche Sichtbarkeit zu verschaffen. Der hohe Bekanntheitsgrad soll wiederum die Geldgeber – in der lokalen Politik, in den Ministerien für Wissenschaft und Kultur, aber auch Sponsoren aus der Wirtschaft (Beispiel: Playmobil) – überzeugen, weiter in die Ausgrabungen zu investieren. Und nicht zuletzt werden die eigenen Forschungsergebnisse durch die mediale Präsenz auch legitimiert.
Arsuaga, Bermúdez de Castro, Carbonell und ihre Mitarbeiter haben sich als außerordentlich geschickt in der Medienarbeit erwiesen. Dies zeigt sich auch in der Wahl ihrer Metaphern. Sie sprechen immer wieder davon, daß Atapuerca eine „Enzyklopädie der Evolution“ sei, die man gleichsam durchblättern könne, eben weil dort über einen Zeitraum von über einer Million Jahren verschiedene Menschenarten lebten. Oder eine „Zeitkapsel“, in der sich unsere Vorgeschichte konserviert habe und mit der man quasi in die Vergangenheit reisen könne.
Links: http://www.evoluciona.org/
Juan Luís Arsuaga.
Lustig, oder? Eudald Carbonell posiert mit seiner Playmobil-Replik. Foto: MEH.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 26 Suchen: CTRL+F
Gehts es noch alberner? PlayEvolución. Atapuerca und der MEH in einer Playmobil-Landschaft.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 27 Suchen: CTRL+F
Nicht nur beim Anblick der täglichen Nachrichten über die unmenschlichen Grausamkeiten, die Menschen aneinander verüben können, kommen uns Zweifel über den Sinn der Entwicklung der Menscheit.
Eine bedauenswerte Enttäuschung für alle, die an den „lieben Gott” glauben: Natürlich macht die Entwicklung der Menscheit keinen Sinn – und die Frage ist sowieso falsch gestellt, weil die Evolution sich nach Gesetzmäßigkeiten
entwickelt, die abseits jeder menschlichen (oder göttlichen) Ratio liegen. Sie hat ihre eigenen, und das haben wir seit Darwin im Prinzip und im Detail kapieren müssen.
Die weltweit berühmten Paläontologen Eudald Carbonell (KoDirektor von Atapuerca, immer mit IndianaJonesHut) und der gelernte Biologe Jordi Agustí (Forscher der Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados, ICREA) dialogieren über die menschliche Entwicklung und die Zukunft der Menschheit im Buch La evolución sin sentido (Verlag Península). Darin wurden acht Gespräche zwischen den zwei Wissenschaftlern festgehalten, die zwar schon 2009 stattfanden, aber keineswegs an Aktualität verloren haben. Lesenswert!
La evolución sin sentido ist ein Dialog und Meinungsaustausch unter zwei renommierten katalanischen Wissenschaftlern. Im Jahre 2009, als das DarwinJahr gefeiert wurde, meinten die
Macht die Evolution Sinn?
Der Wissenschaftler Eudald Carbonell hat gewarnt: „Wenn die menschliche Evolution – verstanden als Prozeß der kulturellen oder sozialen Selektion - nicht unter Kontrolle gebracht wird, kann sie gefährlich werden.” Carbonell hat das Buch „La evolución sin sentido”, im Dialog mit Jordi Agustí geschrieben. Foto: Europa Press.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 28 Suchen: CTRL+F
beiden, sie sollten Beiträge und Prognosen über die unsichere Zukunft der Menscheit leisten.
Agustí und Carbonell teilen die Ansicht, daß es unmöglich sei, über die Perspektiven der Menschheit zu urteilen, ohne festzustellen, was die Menschen zu Menschen werden ließ – und zweifelsohne besitzen beide die nötigen Kenntnisse, um diese Fragestellung kompetent anzugehen. Die im Buch zusammengefaßten acht Gespräche sind deswegen auch eine Einleitung in die Evolutionsgeschichte des Homo sapiens.
Eudald Carbonell i Roura, (* 1953, Girona) erhielt seine Ausbildung in Girona, Barcelona und Paris. Er wurde 1986 im Gebiet Archäologie des Quartärs an der Universität Pierre et Marie Curie in Paris und im
Fach Geschichte an der Uni Barcelona promoviert.Seit 2012 ist er Lehrstuhlinhaber und Leiter der For
schungsgruppe Menschliche Populationsökologie des Quartärs an der Universität Rovira i Virgili in Tarragona. Er ist Direktor des Katalanischen Institutes für Menschliche Paläoökologie und Sozialevolution, IPHES.
Zusammen mit José María Bermúdez de Castro and Juan Luis Arsuaga leitet er die Ausgrabungen in Atapuerca. Die dort forschenden Archäologen erhielten 1997 den PrinzvonAsturienPreis in dem Bereich wissenschaftliche und technische Forschung. Carbonell ist auch Träger des von der katalanischen Regierung vergebenen Nationalpreises 2008 in der Sparte Philosophie und Wissenschaftskultur.
Eudald Carbonell, José Maria Bermúdez de Castro und Juan Luís Arsuaga. Foto: MEH.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 29 Suchen: CTRL+F
Suche nach der Schönheit
Die Suche nach der Schönheit war und wird eine feste Größe im Menschen bleiben”, urteilt Quionia Herrero, Veranstalterin der aktuellen Ausstellung La bel-leza, una búsqueda sin fin, die im MEH Burgos bis 2014 zu
sehen ist. Bei einer solch dünnen antropologischen Begründung war es schon hilfreich, daß das Kosmetikunternehmen L'Oreal España die merkwürdige Show mitsponsorte.
Unter den Ausstellungsstücken, ein Armreif aus Gold, der in Atapuerca ausgegraben wurde. Dann auch Spiegel aus China, Holzkämme aus Chile u.v.a.m. Im Bild: Herstellung von Perücken, Exponate aus der Sammlung.
Fotos: MEH.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 30 Suchen: CTRL+F
Haare färben – hat da jemand geschrien: „L'Oreal España”?
Kulturas 7 / August+September 2013 / Evolution / Seite 31 Suchen: CTRL+F
Käme und Spiegel, Werkzeuge der Schönheit.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Ein Sommer für Keramik / Seite 33 Suchen: CTRL+F
...ist der Titel des ersten E-Books der Kulturas-Editionen, das sich mit dem Thema Keramik sehr ausführlich beschäftigt. Es widmet sich konkret der Entwicklung der Nutzkeramik aus Ton auf der Iberischen Halbinsel. Im Vordergrund stehen Funktionalität und Ästhetik zahlreicher Formen.
Kann man die 6000jährige Entwicklung der Nutzkeramik auf spannende Art mit Bildern erzählen? Die Autoren waren sich selbst im Zweifel, ob es gelingen
könnte, den Bogen von der ersten Cardialkera-mik (4.000 Jahre v.u.Z.) bis zur Tonkunst der Gegenwart zu spannen.
Nachdem das Bildmaterial zum xten Male durchforscht wurde, fiel die JaEntscheidung. Nun sollte die Sommerpause auch dazu ausgenützt werden, die noch vorhandenen Lücken zu schließen.
Verschiedene Museen wurden zum ersten, manche zum wiederholten Male besucht. Da kam es gerade passend, daß das seit vier Jahren geschlossene Museu da Ola-
Keramik in Spanien und Portugal...
Dieses E-Book vom Kulturas-Verlag gibt es im gut lesbaren PDF-Format. Es kann auf der Website www.portugal-kultur.de bestellt werden.350 Seiten, 15 Euro. Bezahlung online per Paypal oder Banküberweisung.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Ein Sommer für Keramik / Seite 34 Suchen: CTRL+F
ria in Barcelos (Nordportugal) hurtig wieder eröffnet wurde – die Kommunalwahlen stehen an. Besonders interessant die Ausstellung, die das Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora, Spanien) bietet: eine besonders gut zusammengestellte Serie von Keramikgefäßen, welche die verschiedenartigsten Anwendungen des Tons in Spanien dokumentiert. Ebenfalls positiv ist die Tatsache, daß das Fotografieren jetzt auch im Museu da Cerâmica in Caldas da Rainha (ein ehemals wichtiges Produktions zentrum) erlaubt ist.
Entscheidend für die Bereicherung des Buches, welches auch den Status quo der Olaria und Alfareria dokumentiert, waren auch zahlreiche Begegnungen mit
noch aktiven Tonmeistern – sei es in deren Werkstätten (zum Beispiel in Moveros de Ali-ste, Nordspanien), sei es beim Verkauf auf Märkten und Messen, wie zum Beispiel in Sala-manca und in Barcelos.
Für das archäologische Material hatten wir bereits eine beachtliche Sammlung angelegt, welche wichtige Etappen der historischen Entwicklung einschließt: Cardial
keramik, GlockenbecherKultur, Gefäße aus der Bronze und Eisenzeit, Iberische Kultur, römische Periode und die faszinierende Vielfalt
des Tonhandwerks während der islamischen Zeit auf der Iberischen Halbinsel.
Alleine was die hochqualitative römische Tonproduktion angeht, werden im Ebook Objekte gezeigt, die in den Museen in Zamora, León, Sória, Braga,
Lissabon, Conímbriga, Mérida, Badajóz, Madrid, Vilamoura, Faro, Sevilla und Tarragona
vorhanden sind. Ähnlich breit ist das Spektrum der islamischen Nutzkeramik.
Warum dieses Thema? Neben der persönlichen Begeisterung, welche die Autoren beim Formen mit Ton spüren, fanden sie es nützlich, einige
(erschwingliche) Tongefäße zu sammeln. Die Schönheit der traditionellen Formen, die bis weit zurück in die islamische und römische Zeit zurückreichen, ist immer wieder faszinierend. Das weiß jeder, der mit der Hand über ein schönes Gefäß (Bilha, Cantaro, Botijo) oder einen kleinen Krug (Púcaro) gestrichen hat. Es sind geradezu sinnliche Formen...
Die Anmut der Rundungen der Gefäße, die auf einer Töpferdrehscheibe gezogen wurde, ist nur schwer mit Worten zu beschreiben – aus diesem einfachen
Grunde ist das hier vorgestellte Buch in erster Linie ein Bildband mit hunderten von Fotos. Die Texte wurden bewußt knapp gehalten, um das Essentielle zu vermitteln.
Primär galt die Aufmerksamkeit der Autoren der Funktionalität in Küche und im Lagerhaus. Doch haben sie keinesfalls ignoriert, daß Keramik immer wieder als Schmuck und Dekorationsartikel produziert wurde. Besonders spannend sind die verrückten Kreationen des por
„Hat irgend jemand gesagt, daß mein Instrument verstimmt ist?” Affe mit Hut, aus rotem Ton modelliert, zwischen 1902 und 1925. Ausgestellt im Museu da Cerâmica, Caldas da Rainha, Portugal.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Ein Sommer für Keramik / Seite 35 Suchen: CTRL+F
tugiesischen Grafikers, Illustrators, Zeitungsmachers und Keramikers Rafael Bordalo Pin-heiro, die in Caldas da Rainha aufbewahrt werden.
Aber die Kunst, erstaunliche Figürchen aus Ton zu modellieren, wurde auch von absoluten Kunstlaien beherrscht, wie z.B. die schon legendäre Rosa Ramalho (Barcelos) oder die Irmãs Flores (in Estremoz, Alentejo).
Viel zu gering ist das Interesse, welches offizielle Stellen für ein noch vor 50 Jahren so wichtiges Handwerk wie die Olaria zeigen. Die noch verbliebenen letzten Vertreter dieser Zunft stehen ganz alleine da, wenn es um die Vermarktung oder Weiterentwicklung ihrer Produkte geht.
Interessant sind die regionalen und nationalen Unterschiede, stellten wir fest. In Portugal fristen das Töpferhandwerk (Olaria) und die Nutzkeramik – ein elementarer Bestand
teil des Património, – ein tristes Schattendasein. (Ausnahmen, wie Kenner und Sammler, bestätigen die Regel). Dieses Handwerk sollte auf dynamische Art gefördert werden, mit neuen Ideen und um mehr Kunden anzusprechen.
Wenn nicht bald die Brücken zum zeitgenössischen Design geschlagen werden, stirbt dieses wunderbare Handwerk ganz aus. Auf kleiner Flamme
brennen die Keramiköfen noch in Bisalhães, Tondela, Coimbra, Leiria, Redondo, Nisa und Estremoz. Aber wie lange noch?
Anders in Spanien, wo sofort auffällt, daß das Publikum immer noch ein starkes Interesse an die erprobten Keramikformen zeigt, die zum Braten, Kochen und
Dünsten verwendet werden. Und an solche, mit denen man Wein und Speisen bei Tisch serviert. Auch merkt man, daß es einer Anzahl von spanischen Keramikfachleuten bereits gelun
gen ist, traditionelle Verfahren mit ansprechenden, modernen Design ideen zu kombinieren.
Keramik in Spanien und Portugal. 6000 Jahre Entwicklung der Nutzkeramik auf der Iberischen Halbinsel. Von Paulo Heitlinger und Birgit Wegemann. PDF im Breitformat. 350 Seiten, 15 Euro.Kulturas-Verlag, 2013. Bestellbar auf www.portugal-kultur.de
Kulturas 7 / August+September 2013 / Ein Sommer für Keramik / Seite 36 Suchen: CTRL+F
Leonel Trindade (Filho), Archäologe und Restaurator, beobachtet mit kritischem Blick das Ergebnis seiner Restauration eines Glockenbechergefäßes aus der chalkolitischen Siedlung Zambujal. Die Keramik wird im Museu de Torres Vedras gezeigt, welches den Namen seines Vaters trägt: Museu Municipal Leonel Trindade de Torres Vedras.Foto: ph.
Außer Leonel Trindade, Filho befragten die Autoren Dr. Michael Kunst (DAI, Madrid), Leiter der Ausgrabungen der chalkolitischen Siedlung Zambujal, zu der Entwicklung des sog. „Glockenbecherphänomens”. Seine Ausführungen sind Teil eines der spannendsten Kapitel des E-Books Keramik in Portugal und Spanien.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Ein Sommer für Keramik / Seite 37 Suchen: CTRL+FEin dickwandiges Keramikgefäß aus der Bronzezeit. Olhão, Algarve, Portugal.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Ein Sommer für Keramik / Seite 38 Suchen: CTRL+F
Die Römische Zeit in der Iberischen Halbinsel brachte eine erstaunliche Fülle von Keramikformen. Museu de Conímbriga, Portugal. Foto: ph.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Ein Sommer für Keramik / Seite 39 Suchen: CTRL+F
Trinkschale mit Botschaft. Gefäß aus Terra Sigillata, mit geritzter Inschrift in kursive Schrift. Museo de Zamora,
Spanien. Foto: ph.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Ein Sommer für Keramik / Seite 40 Suchen: CTRL+F
Die Honigreserven schützen.Das Prinzip ist ganz einfach, und die Römer kannten es schon: Ameisen haben eine besondere Vorliebe für Honig. Sie haben zwar einen sehr guten Geruchssinn, der sie rasch zu den Quellen heranführt, doch sie können sehr schlecht schwimmen. Also baue man eine Wasserfalle um die Öffnung eines keramischen Honigtopfes herum, damit alle Ameisen ersaufen, wenn sie versuchen, sich in den Honig zu stürzen. Die römischen keramischen Honigtöpfe – und alle weiteren, die in den nächsten zweitausend Jahren hergestellt wurden, integrieren einen Rand (der mit Wasser gefüllt) verhindert, daß die Ameisen ihn durchqueren.
Dieses schöne Exemplar steht im Museu de Braga. Foto: ph/bw.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Ein Sommer für Keramik / Seite 41 Suchen: CTRL+F
Einfache Keramik aus der islamischen Zeit im Al-Garb, unglasiert, ausgestellt im Museum von Faro, Algarve.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Ein Sommer für Keramik / Seite 42 Suchen: CTRL+F
Einfache Keramik, teilglasiert, aus dem Alentejo. Foto: bw.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Ein Sommer für Keramik / Seite 43 Suchen: CTRL+F
Zwei mit Kettchen verbundene Herzen sind mit Schlüsseln verschlossen – eine oft wiederkerende Formel in der
Volkskunst Portugals. Solche Krüge hatten eine rein dekorative Funktion und ein Verlobter verschenkte diese an seine Braut – als Liebesbeweis. Foto: ph/bw.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Ein Sommer für Keramik / Seite 44 Suchen: CTRL+F
In diesem „Pote de estilar” wurde Branntwein vorbereitet. Museu da Olaria, Barcelos, Portugal.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Ein Sommer für Keramik / Seite 45 Suchen: CTRL+F
Querubim Queiróz da Rocha hält tapfer die Stellung – er ist einer der letzten vier Töpfer, die noch im Dorf Bisalhães (bei Vila Real, Nordportugal) Tonkeramik nach der örtlichen Tradition herstellen. Er beherrscht in Vollendung die Kunst der „Schwarzen Keramik”. Foto: B. Wegemann.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Ein Sommer für Keramik / Seite 46 Suchen: CTRL+F
Kachelkunst aus Portugal und Spanien. Bildband und Dokumentation. Paulo Heitlinger. 2013.
Azulejos
Ein e-book von portugal-kultur.de
Kachelkunst, nicht nur in Blau-Weiß
Nicht nur die barocke Kachelkunst – in diesem E-Book werden auch originelle Werbetafeln, Strassenschilder und weitere zeitgenössische Anwendungen der Wandkacheln dokumentiert. Von den ersten glasierten Keramiken bis zu den Art-Déco-Azulejos in Lissabonn und Porto.
Die Wurzeln der spanischen und portugiesischen Keramiktradition reichen tief in die Fülle der über 700 Jahre währenden
islamischen Kultur (und Handwerk) auf der Iberischen Halbinsel. Nach der Reconquista waren es Mudéjares (die Mauren, die im Lande geblieben waren) die Träger der alten Techniken. Sie brachten diese zuerst nach Murcia und schließlich in die Region um Valencia.
Die älteste Art der Herstellung von Wandfliesen (Azulejos), die im AlAndalus praktiziert wurde, war die
Kulturas 7 / August+September 2013 / Ein Sommer für Keramik / Seite 47 Suchen: CTRL+F
sehr arbeitsintensive AlicatadoTechnik (Mosaikfliesen). Aus größeren Tonplatten wurden Formen unterschiedlichen Formats ausgeschnitten und dann farbig glasiert (Blau, Grün, Gelb, Schwarz). Diese kleinteilige Azulejos hat man zu komplexen Mosaikmustern zusammengesetzt. In Europa ist die AlhambraBurg in Granada ein Ort, wo man solche wunderbar schimmernde Mosaik fliesen aus kleinen Azulejos bewundern kann.
Damals wurde Andalusien von maurischen Emiren beherrscht. Die dekorierten Flächen in der Alhambra waren beeinflußt von den Arbeiten die gerade
„gegenüber”, auf der anderen Seite der Meeresenge von Gibraltar, in Maroko produziert wurden. In Portugal kann man solche AlicatadoFliesen im königlichen Sommerpalast in Sintra bei Lissabon bewundern — König Manuel I hatte sie aus Südspanien kommen lassen.
Obwohl in Valencia Christen und Muslime zusammenarbeiteten, überwiegen in der Keramik die „blauen“ Gruppen mit maurischen Themen. Der größte Teil der bei Valencia im 15. Jahrhundert hergestellten Lüsterkeramik scheint in Manises in Anlehnung an ihre Vor
gänger aus Granada und Malaga produziert worden zu sein.
Die feintonige, mit Zinnglasur überzogene und schließlich bemalte Keramik trat ihren Siegeszug durch mallorcinische Händler (wurde dementsprechend
Majolica genannt) zunächst nach Frankreich (hier schon Fayence genannt) und nach Italien an. Osten und der byzantinische Westen, deren Kenntnisse über alkalische Glasuren und Bleiglasuren die Grundlagen gaben für die weitere Entwicklung.
Ägypten und Mesopotamien waren die Schauplätze zweier bahnbrechender Entwick
lungen in der Keramik, die von dort aus nach Spanien gelangten.
Die Entwicklung einer weißen, opaken Glasur, verbunden mit der Aufglasurmalerei in Kobaltblau nehmen ihren Ursprung am Euphrat im frühen 8. Jh., während in Ägypten aus einem Gemisch aus Quarzsand, Ton und Glaspulver eine keramische Masse hergestellt wurde: die Fritte.
Das Material von dem nun vorliegenden EBook wurde in KeramikMuseen in Portugal und Spanien, aber auch auf unzähligen Besuchen – zum Beispiel in Triana,
Sevilla – gewonnen. Das Resultat ist eine einmalige Zusammenstellung über eine Kunst und ein Handwerk mit einer großen Tradition, welches keramische Kacheln für alle mögliche Zwecke geliefert hat.
Azulejos - Kachelkunst in Portugal und SpanienBirgit Wegemann und Paulo Heitlinger.450 Seiten, Format DIN A4 - querEinführungspreis: 20 Euro
Kulturas 7 / August+September 2013 / Design / Seite 49 Suchen: CTRL+F
DesignDoesburg, Bill, Wollner
Alle erweisen ihm Reverenz, alle finden ihn unhegeuer bedeutsam und wichtig, keiner mag ihn so richtig. Wenn man den langen Interviews des Designers Alexandre Wollner folgt – man findet mehrere davon online in Youtube – kann man schnell vergessen, daß man einem Brasilianer zuhört, so akademisch „schweizerisch” klingen seine Ausführungen und Ideen.
In der Ausstellung Alex Wollner Brasil. Design Visual (derzeit in der Frankfurter Kunsthalle) geben rund 120 Arbeiten des brasilianischen DesignerPapsts einen Überblick über sein lan
ges Schaffen. Für Deutsche eine erste Annäherung, für Brasilianer die xte Wiederholung.
Zwei Aspekte sollen das bereits als historisch zu bezeichnende Werk Alexandre Wollners (*1928) neue Bedeutung verleihen: einerseits sein „umfänglicher Designbegriff und seine konsequente Designhaltung”, anderseits die von Wollner vertretene Ideologie der Internationa
In den letzten Jahren hat Alexander Wollner nur noch an seinen Ewigen Ruhm gedacht. Es wiederholten sich die Bücher, Kataloge und Ausstellungen, die über seine Karriere berichten. Nun ist Frankfurt an der Reihe. Das langweilige Foto von Gui von Schmidt (2013) zeigt Wollner in seiner Luxusvilla in Brasilien.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Design / Seite 50 Suchen: CTRL+F
len Schule, die er in Deutschland gelernt und in Brasilien umgesetzt hat. Aber das, was die Freankfurter Schau eigentlich belegt, ist das Wollner eigentlich nie ein VollblutDesigner war, sondern ein als Designer getarnter ...Konkreter Künstler.
Seine ganze Praxis blieb lebenslang von einem starken Einfluss der hfg (Hochschule für Gestaltung Ulm) geprägt. In Ulm studierte Wollner von 1954 bis 1958. Was er hier lernte, setzte er dann auch konsequentbitter um: Wollners Design wurde ganz und gar unbrasilianisch: coolsachlich, ernsthaft bis langweilig, reduziert, ohne Emotion.
Zu Beginn der gestalterischen Tätigkeit Alexandre Wollners stand wiederum ein anderer großer Langweiler Pate: Theo van Doesburg (1883–1931), und sein Begriff
der Konkreten Kunst, die sich auf die Konstruktion von Bildern und Objekten ausschließlich aus geometrischen Elementen, geraden Flächen und primären Farben stützte.
Seit den 1950er Jahren war der Südosten Brasiliens einer der wichtigsten Orte dieser Bewegung außerhalb Europas. Bereits als Kunststudent am Instituto de
Arte Con tem porânea (IAC) do Museu de Arte de
Konkrete Kunst made in Brasil: Industriefarbe auf Holz, Alexandre Wollner, 1950.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Design / Seite 51 Suchen: CTRL+F
Counter-Composition VI. 1925. Theo van Doesburg. Foto: Tate Gallery.
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts führten verschiedene Umbrüche und Neuorientierungen der Bildenden Kunst zu radikalen Absagen an die bürgerlich-akademischen, althergebrachten künstlerischen Ausdrucksformen führten.
Die „Konkreten Künstler” wollten sich auch von jeder Tradition lösen und zu einer neuen Kunst gelangen, die jedoch keinerlei Bezug zur außerkünstlerischen Wirklichkeit besitzt. Der niederländische Ideologe und Künstler Theo van Doesburg war der Urvater der Konkreten Kunst und Motor dieser neuen Bewegung.
1930 formulierte er: „Konkrete Malerei, nicht abstrakte, weil nichts konkreter, nichts wirklicher ist als eine Linie, eine Farbe, eine Fläche. Sind auf einer Leinwand eine Frau, ein Baum oder eine Kuh etwa konkrete Elemente? Nein. Eine Frau, ein Baum, eine Kuh sind konkret in der Natur, aber in der Malerei sind sie abstrakt, illusorisch, vage, spekulativ; eine Fläche hingegen ist eine Fläche, eine Linie eine Linie, nicht mehr und nicht weniger.“
Die Konkreten Künstlern möchten nicht Menschen und Landschaften abbilden, sie möchten uns keine Geschichten erzählen. Vielmehr isolieren sie ihre künstlerischen Mittel und untersuchen deren Wirkung und Beziehungen zueinander. Die Konkreten Künstler bilden keine Realität ab, sondern würden gerne eine neue, eine „künstlerische Realität” schaffen.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Design / Seite 52 Suchen: CTRL+F
Composition. Theo van Doesburg. Foto: Tate Gallery.
Theo van Doesburg: Zur Grund-lage der konkreten Malerei
...2. Das Kunstwerk wird weder mit den Fingern noch mit den Nerven erschaffen. Die Erregung, das Gefühl, die sinnliche Empfindsamkeit haben die Vervollkommnung der Kunst niemals befördert. Nur der Verstand (Intellekt), dessen Geschwindigkeit noch höher ist als die des Lichts, erschafft. Lyrik, Dramatik, Symbolismus, Empfindsamkeit, Unbewusstes, Traum, Inspiration usw. sind nur ein minderwertiger Ersatz für das schöpferische Denken. In allen Bereichen menschlichen Handelns hat immer nur der Intellekt gezählt. Die Entwicklung der Malerei ist nichts anderes als die intellektuelle Suche nach der Wahrheit durch die Kultur des Visuellen. Jenseits dessen, was der Verstand erschafft, gibt es nur Barock, Fauvismus, Animalismus, Sensualismus, Sentimentalismus und jenes hyperbarocke Eingeständnis der Schwäche: Phantasie.Das anbrechende Zeitalter ist hingegen das Zeitalter der Gewissheit und daher der Perfektion. Alles ist meßbar, selbst der Geist mit seinen 199 Dimensionen. Wir sind Maler, die denken und messen.....In: AC – Numéro d’Introduction du Groupe et de la Revue Concret, 1930. (Der Text ist nicht unterzeichnet, er wird Theo van Doesburg zugeschrieben).
Kulturas 7 / August+September 2013 / Design / Seite 53 Suchen: CTRL+F
Alexandre Wollner, Konstellation e3, aus der Serie Formulierung - Interaktion – Artikulation, 2010, ein sog. „Digitaler Druck”, 50 x 50 cm. Farbig-transparente Dreiecke überlagern sich, erzeugen ein sternenartiges Gebilde - in der Plottergrafie, die Alexandre Wollner 2012 am Computer gestaltet hat:
Das Dreieck ist eine Art Leitmotiv in seinem Schaffen – so auch auf der Dose der Öl-Sardinen der Firma „Conqueiro”. Letzendlich hat Wollner nicht wirklich Grafik-Design praktiziert; er hat Werbung mit der verarmten Formsprache der „Konkrten Kunst” betrieben...
Alexandre Wollner / Konkrete Kunst
Kulturas 7 / August+September 2013 / Design / Seite 54 Suchen: CTRL+F
Max Bill. Translokation auf Rot, 1972, Sammlung Winkler. Copyright: VG Bild-Kunst, Bonn 2008. Foto: Sasa Fuis Photographie Köln
Max Bill / Konkrete Kunst
„konkrete kunst nennen wir jene kunstwerke, die auf grund ihrer ureigenen mittel und gesetzmässigkeiten – ohne äusserliche anlehnung an naturerscheinungen oder deren transformierung, also nicht durch abstraktion – entstanden sind.
konkrete kunst ist in ihrer eigenart selbständig. sie ist der ausdruck des menschlichen geistes, für den menschlichen geist bestimmt, und sie sei von jener schärfe, eindeutigkeit und vollkommenheit, wie dies von werken des menschlichen geistes erwartet werden muss.
konkrete malerei und plastik ist die gestaltung von optisch wahrnehmbarem. ihre gestaltungsmittel sind die farben, der raum, das licht und die bewegung. durch die formung dieser elemente entstehen neue realitäten. vorher nur in der vorstellung bestehende abstrakte ideen werden in konkreter form sichtbar gemacht.
konkrete kunst ist in ihrer letzten konsequenz der reine ausdruck von harmonischem mass und gesetz. sie ordnet systeme und gibt mit künstlerischen mitteln diesen ordnungen das leben. sie ist real und geistig, unnaturalistisch und dennoch naturnah. sie erstrebt das universelle und pflegt dennoch das einmalige, sie drängt das individualistische zurück, zu gunsten des individuums.”
Bill, Max. Konkrete Kunst. In: Ausstellungskatalog Zürcher Konkrete Kunst, 1949.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Design / Seite 55 Suchen: CTRL+F
Luiz Sacilotto / Konkrete Kunst
Der Brasilianer Luiz Sacilotto (1924–2003) nahm an der documenta 12 mit der hier abgebildeten Skulptur teil. Er zählt zu den
Pionieren der Konkreten Kunst in seiner Heimat. Auch vom Schweizer Max Bill inspiriert, entwickelte er in den 1950er-Jahren die Grupo Ruptura. Von Sacilotto war im Kasseler Aue-Pavillon eine einzelne, bescheiden wirkende Arbeit zu sehen: Escultura Negra von 1959, eine hängende Eisen-Skulptur.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Design / Seite 56 Suchen: CTRL+F
São Paulo schloss sich Wollner 1953 der kurz zuvor gegründeten konkretistischen Künstlergruppe Grupo Ruptura an und trat als „konkreter Maler” hervor, der bei den Kunstbiennalen in São Paulo Auszeichnungen erhielt.
Dabei übte das, was als „europäische Avantgarde” verkauft und mit der I. Biennale 1951 erstmals in Brasilien gezeigt wurde, auch nachhaltigen Einfluß auf Wollner aus. Avantgarde war damals fast alles, was mit der Abstrakten Kunst zu tun hatte, man hatte ja ganz offiziell dem Realistischen, Figürlichem und erst recht der engagierten Kunst abgeschworen.
Weitere Begegnungen schlossen sich an. Die nächste galt dem Schweizer Max Bill, auch dieser einer der emotions gehemmtesten Künst
ler und Grafiker der Nachkriegszeit. Auf der 1. Biennale von São Paulo wurde Max Bill mit seiner Skulptur Dreiteilige Einheit ausgezeichnet. Bill war in diesem Jahr noch nicht persönlich zugegen, machte aber 1953 eine Vortragsreise durch das Land. Er machte sich in Brasilien zunächst nicht populär. In „undiplomatischer Weise” hat er den Architekten Oscar Niemeyer kritisiert.
Logo für Sucorrico Brasil, ein Konzern der Fruchtsaftindustrie,Alexandre Wollner, 1972. Design im Stil der Arte Concreta.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Design / Seite 57 Suchen: CTRL+F
Heftige Anfeindungen folgten; die verhinderten aber nicht, daß brasilianische Studenten nach Ulm an die hfg kamen. Heute ein bekannter Künstler und damals einer der ersten Studenten aus Brasilien war Almir Mavignier da Silva aus Rio de Janeiro.
Etwas später folgte der junge Alexandre Wollner; 1953 wurde er von Max Bill ausgewählt, im ersten Jahrgang an der gerade neu gegründeten Hochschule für Gestal
tung Ulm zu studieren. Von 1954 bis 1958 erhielt er hier die Ausbildung, die fortan seine Entwicklung als GrafikDesigner entscheidend prägte.
Die damals hochgehaltenen Orientierungen – Benutzung des Rastergitters, wie es Josef Müller Brockmann gepredigt hatte, Benutzung steriler, sogenannter „neutralen” Typos, wie sie die Schrift Helvetica darstellte, und sterile Vereinfachung zu geometrischen, „internationalen Formen” waren die Postulate, denen sich der oft unterkühlt wirkende Wollner allzu gerne anschloß.
Die hfg Ulm war von Otl Aicher, Max Bill u.a. mit der Absicht gegründet worden, die Methoden und die positive Wirkung des Bauhauses fortzusetzen und Montage der jährlichen Ausstellung, HfG Ulm, 1954. V.l.n.r. Klaus Krippendorf,
Klaus Willy, Klaus Franck, Angela Goldring. Foto: Alexandre Wollner, 1954.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Design / Seite 58 Suchen: CTRL+F
zählte in den 1950er und 60er Jahren zu den fortschrittlichsten Ausbildungsstätten im Bereich Gestaltung. In den ersten Jahren blieb die Schule unter der Leitung von Max Bill dem Modell des Bauhauses treu, später setzte sich eine Sicht auf Design durch, die dieses als Teil des industriellen Prozesses begriff. Wollner erlebte beide Phasen, wobei vor allem letztere seine Haltung nachhaltig beeinflussen sollte.
In Ulm lernte er die weiteren dort tätigen Dozenten – Otl Aicher, Friedrich VordembergeGildewart, Josef Albers, Tomás Maldonado und Max Bense – kennen. Hier
entstanden auch seine ersten fotografischen
Petróleo-Tankstellen São Paulo, Foto:Alexandre Wollner, 1990. Oben: das Logo.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Design / Seite 59 Suchen: CTRL+F
Arbeiten, die ebenfalls Teil der Frankfurter Ausstellung sind.
Ende der 50er Jahre begann Wollner zu verstehen, daß es mit der Kunst und Malerei nicht so recht klappen würde und entschied sich für eine Laufbahn als Designer.
Warum? Wollner meint, Design schafft „Kollektives Wohlbefinden”. Das sei die Funktion von Design.
Zurückgekehrt nach Brasilien 1958, gründete Wollner gemeinsam mit Geraldo de Barros, Ruben Martins und Walter Macedo forminform, das erste Design büro
Brasiliens, mit Sitz in São Paulo. Eine weitere wichtige Figur war Karl Heinz Bergmiller (1928, Bad Tölz). Dieser studierte von 1951 bis 1953 in Ulm. Von 1956 bis 1958 arbeitete Bergmiller mit Max Bill. Dieser Deutsche kam 1959 nach Brasilien, gefördert durch ein Stipendium der brasilianischen Regierung, und ließ sich in São Paulo nieder. Auch er arbeitete eine Weile im Büro form inform mit.
Vier Jahre später, 1962, gründete Wollner seine eigene Agentur: DICV Design. Im Brasilien der frühen 60er Jahre herrschte Aufbruchstimmung, das Land wollte sich
in kurzer Zeit vom halbkolonialen Agrar zum aufstrebenden Industriestaat wandeln.
Poster für das Internationale Filmfestival Brasiliens, Alexandre Wollner und Geraldo de Barros, 1954.
Poster für die III Kunst-Biennale von São Paulo, MAC Museum für Zeitgenössische Kunst USP, Alexandre Wollner und Geraldo de Barros, 1955.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Design / Seite 60 Suchen: CTRL+F
Über Jahrzehnte hinweg begleitete Wollner die fortschreitende Industrialisierung (und Amerikanisierung) Brasiliens und verpaß´te vielen brasilianischen Unternehmen, Banken und Institutionen ihre visuelle Identität. Viele dieser Logos und Erscheinungsbilder prägten das neue Brasilien und waren über Jahrzehnte, einige sogar bis heute, in Verwendung.
Wie Karl Heinz Bergmiller, begann sich auch Wollner in der Designausbildung zu engagieren. Ab 1962 leitete er einen Typografiekurs am Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro (MAMRJ). 1963 war er einer der Gründer der ersten Hochschule für Design in Brasilien (und ganz Südamerika), der Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI, www.esdi.uerj.br), die das Ulmer Modell in Rio de Janeiro einführen sollte.
Stets hat er Briefings der Marketingabteilungen abgelehnt und stattdessen den unmittelbaren Kontakt zur Unternehmensleitung gesucht, um den Charakter des Unternehmens zu ver
stehen. Er hörte gerne „His Masters Voice” im OTon. Auffällig an Wollners Entwürfen war, daß sie jeglichen Lokal oder Nationalkolorit vermieden und stattdessen reduzierte, klare, universell gültige Formen bevorzugten. Logo für Fenícia, Handelsunternehmen,
Alexandre Wollner, 1975
Logo für Maraú, Frucht- und Saftindustrie, Alexandre Wollner, 1973.
Logo für Gustavo Halbreich, Baugesellschaft, Alexandre Wollner, 1974.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Design / Seite 61 Suchen: CTRL+F
Mit technischer Akribie hat Wollner die stilisierte Palme (Coqueiro) konstruiert, die das Logo der Sardinenmarke (unten) werden sollte. In vielen
Zeichnungen kaprizierte sich Wollner in einer besonders sterilen Anwendung des „typisch schweizerischen” Rastersystems. Au der Dose ein weißer Fisch aus Dreiecken, mit dem Logo der Firma als Auge – ein Kreis mit einer schemenhaften Palme darin.
Eine andere negative Erscheinung im mageren Spektrum der Kreativität Wollners war der Umgang mit der Schrift, die er oft manipulierte; er konnte
eine von Geburt schon häßlich aussehende Helvetica noch häßlicher aussehen lassen...
Kulturas 7 / August+September 2013 / Design / Seite 62 Suchen: CTRL+F
Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist der Begriff der Marke, die ein Qualitätsverssprechen ausdrückt und damit weitaus mehr als eine reine Herkunftsangabe
ist, für die moderne Unternehmenswelt von zentraler Bedeutung. Ebenso ist das Prinzip des
Corporate Design zu einem wirtschaftlichen wie kulturellem Momentum der technisierten Welt geworden. Alexandre Wollner hat in dieser Hinsicht nicht nur
für Brasilien ein bedeutendes Werk geschaffen, sondern sein Beitrag zur Entwicklung des modernen Corporate Design ist im weltweiten Vergleich von Relevanz.
Als Mitbegründer des ersten brasilianischen Designbüros auf Höhe der Gestaltungsmoderne, als Mitbegründer einer zeitgemäßen Designausbildung in Brasilien und als Urheber vieler brasilianischen CIs hat Wollner seinen festen Platz in der Designgeschichte erworben.
Die Frankfurter Retrospektive alex wollner brasil. design visual stellt das Wollner’sche Gestaltungsuniversum dar. „Wir wollen so detailliert wie möglich die verschiede
nen Stufen des kreativen Prozesses beschreiben, so, wie wir sie in unseren Projekten umgesetzt haben, und wir wollen aufzeigen, wie wir im Zuge der Konzeptualisierungen unsere Gedankengänge strukturiert haben”, so der inzwi
Alexandre Wollner und Geraldo deBarros, CBA Düngemittel, 1951.
IV. Biennale von São Paulo, Alexandre Wollner unter Anleitung von Max Bill, 1957.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Design / Seite 63 Suchen: CTRL+F
schen 85jährige Alexandre Wollner, der an der Konzeption der Ausstellung mitgewirkt und die Gestaltungen aus über einem halben Jahrhundert kreativen Schaffens speziell für diese Retrospektive noch einmal überarbeitet hat.
Die Ausstellung ist Teil des Programms zum Ehrengast Brasilien der Frankfurter Buchmesse 2013 und wird gefördert durch die Fundação Nacional de Artes.
Kuratoren sind Klaus Klemp und Julia Koch, in Zusammenarbeit mit Studio Wollner, São Paulo.
Paulo Heitlinger ist Dozent für Design an der Universität ULP in Porto und freier Autor. Vor drei Jahren übersetzte er Rastersysteme von Josef Müller-Brockmann ins Portugiesische.
Mehr zur Ausstellung in www.museumangewandtekunst.de
Mehr zu brasilianischen Gestaltern: Oskar Niemeyer im Heft Kulturas Nr.3, online portugal-kultur.de/kulturas/kulturas3-Maerz-2013.html
Logo für Form, Türen und Raumteiler, Deutschland, Alexandre Wollner mit Franziska Schörghuber, 1957.
Katalog: Klaus Klemp, Julia Koch, Matthias Wagner K (Hg.): «Alex Wollner Brasil. Design Visual», mit Texten von Klaus Klemp, Malou von Muralt, René Spitz, André Stolarski und Alexandre Wollner, Konzeption und Grafikdesign: Alexandre Wollner, dt./engl., 324 Seiten, Ernst Wasmuth Verlag 2013, Preis 49 Euro.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 65 Suchen: CTRL+F
Fefe & die Street-Art Brasiliens
Im Rahmen des „Ehrengastauftritts” von Brasilien bei der Frankfurter Buchmesse 2013 präsentiert die Schirn brasilianische Spray- und Graffiti-Helden. Eine Schau, die garantiert weniger langweilig wird als die Präsentation von Design-Opa Alexandre Wollner...
In Brasiliens MegaMetropolen findet sich eine der lebendigsten und künstlerisch interessantesten Szenen der urbanen Kunst – das hat sich nun auch in Frankfurt herumgespro
chen.Diese Szene unterscheidet sich sowohl
inhaltlich als auch ästhetisch wesentlich von der US und europäischen StreetArt. Nicht nur das spezifische soziale Klima in einem von zutiefst unmenschlichen Umbrüchen gekennzeichneten Landes, sondern auch eine ungeheure Vielfalt von Stilen lassen die brasilianische StreetArt aus der globalisierten und weitgehendst domestizierten Graffitikultur etwas hervortreten.
Von den brasilianischen Street-Artisten ist Fefe Talavera wahrscheinlich diejenige mit den meisten Auslandserfahrungen. Hier eine ihrer Arbeiten in Schweden.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 66 Suchen: CTRL+F
Elf Künstler/Künstlergruppen aus São Paulo und anderen Städten Brasiliens wurden eingeladen, ihre Bilder ausgehend vom Gebäude der Schirn im Frankfurter Stadtraum zu realisieren und damit den Blick auf die Stadt kurzfristig zu verändern.
Gezeigt werden figurative und abstrakte Bilder – von überdimensionalen Wandgemälden bis zu unscheinbaren ephemeren Zeichen. Bespielt werden unter anderem Frankfurter Bankentürme, Brückenpfeiler am Mainufer, die Bodenfläche der Frankfurter Hauptwache, die Matthäuskirche und das ehemalige Polizeipräsidium der Stadt.
Ein zusätzliches Highlight ist ein bemalter UBahnZug – diese als „Wholetrain“ bekannte Form des Graffitis ist eine Königsdisziplin der Szene. Eine eigens
zur Ausstellung entwickelte und mit zahlreichen Hintergrundinformationen und Künstlervideos bestückte App navigiert die Besucher auf ihrem Spaziergang durch die Frankfurter Innenstadt.
Die Ausstellung Street-Art Brazil wird gefördert von der KfW Stiftung. Sie wird zusätzlich von Funarte, dem brasilianischen Kulturministerium und dem Außenministerium unterstützt. Die Schirn Zeitgenossen fördern das
Ein gehörntes Monster von Fefe Talavera. Mehr auf http://fefetalavera.com
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 67 Suchen: CTRL+F
Werk von Alexandre Orion. Die Deutsche Bank unterstützt das Werk von Fefe Talavera (welche Ehre, Fefe!) und die Firma Caparol stellt den Künstlern hochwertige Farben zur Verfügung – das ist doch ein Angebot, oder? „Große Unterstützung” erfuhr das Projekt auch durch die Stadt Frankfurt am Main, insbesondere durch das Kultur und das Verkehrsdezernat (seltsam!), sowie durch zahlreiche institutionelle und private Eigentümer.
São Paulo gilt neben Rio de Janeiro und Curitiba als Zentrum der brasilianischen StreetArt. Seit Mitte der 80er Jahren hat sich die dortige Szene zu einer der welt
weit vitalsten entwickelt. Sie zeichnet sich durch vielfältige Eingriffe in den städtischen Raum aus; in São Paulo ist sie omnipräsent.
In Brasilien wird unterschieden zwischen Pixação (Tagging) und Graffitis, großformatigen figürlichen und abstrakten Murais (Wandmalereien), wie sie die von der Schirn eingeladenen elf Künstler malen.
Zeitlich setzt StreetArt Brazil mit Vertretern der ersten Generation der „Grafiteiros“ (Vitché, Speto und Tinho) ein. Sie begannen nach Ende der Militärdiktatur
– 1985 – mit ihren Malereien auf die Straße zu
Ein Monster von Fefe Talavera.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 68 Suchen: CTRL+F
drängen und so dem Willen zur öffentlichen Meinungsäußerung nach dem Schweigen während und nach der Zeit der Unterdrückung Ausdruck zu geben. Aus Mangel an künstlerischem Material verwendeten sie wie heute noch neben den teuren Spraydosen auch Fassadenfarbe und Farbrollen.
Auch die jüngeren Protagonisten der Szene setzen sich gelegentlich mit den aktuellen sozialen, ökonomischen und ökologischen Problemen ihrer Stadt
auseinander, doch der lange Marsch durch die Instituitionen macht sich bemerkbar. Graffittis werden mehr und mehr schick, wie es der berühmte Beco do Batman beweist.
Eine individuelle Positionierung durch eine singuläre Bildsprache gelingt nur wenigen; Fefe Talavera, eine brasilianische Künstlerin mit mexikanischen Wur
zeln, ist hier ein herausragendes Beispiel. Ihr progonostizieren wir eine weitere erfolgreiche internationale Karriere. Andere Künstler, wie der von mir geschätzte Pixação-Held Tony de Marco, ein Pixador und anerkannter FontDesigner, sind so kreativ, daß ihr Talent früher oder später die Grenzen Brasiliens überschreiten wird.
Die ungezählten Entführungen von Kindern in den 90er Jahren sind das Thema von Tinhos Arbeiten. Er stellt gefesselte, weinende oder kauernde Kinder anhand von Fotovorlagen aus Vermisstenanzeigen dar. Die Kinder blicken den Betrachter meist direkt an,
bleiben aber dennoch isoliert und einsam. Einige seiner Bildfiguren finden sich einzeln unter S-Bahngleisen, vor Garagentoren oder hinter Büschen, als würden sie sich an ebendiesem Ort in der Stadt aufhalten. Oft fügt er sie in eigens gestaltete Hintergründe mit den für São Paulo typischen Hochhäusern und Straßenverkehr ein. Das ehemalige Frankfurter Polizeipräsidium dient ihm als Fläche für seine berührenden Werke.
Vor dem Werbeverbot in São Paulo im Jahr 2007 nutzte Fefe Talavera Poster und Plakate als Interventionsflächen. Heute stellt die Künstlerin ihre Buchstaben im Holzdruck selbst her und fügt diese zu großformatigen „Monster Paintings“ zusammen. Im Bild: Fefe Talavera, São Paulo, 2006
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 70 Suchen: CTRL+F
Fefe Talavera. Glasportal der Deutsche Bank AG-Türme an der Taunusanlage, Frankfurt am Main, 2013. © SchirnKunsthalle Frankfurt 2013, Foto: Norbert Miguletz.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 71 Suchen: CTRL+F
Rimon Guimarães, Curitiba, 2011.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 72 Suchen: CTRL+F
Zwei Romantiker der Szene: Jana Joana und Vitché. Schirn Außentreppenhaus, Frankfurt am Main, 2013. © Schirn Kunsthalle Frankfurt 2013, Foto: Norbert Miguletz.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 73 Suchen: CTRL+F
Beco do Batman, das inzwischen sehr schicke Graffiti-Viertel im Stadteil Vila Madalena, São Paulo, 2013. Foto: Metrópole Projetos, Brasil.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 74 Suchen: CTRL+F
Beco do Batman, das inzwischen sehr schicke Graffiti-Viertel im Stadteil Vila Madalena, São Paulo. Foto: Nicolas de Camaret.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 75 Suchen: CTRL+F
Beco do Batman, das inzwischen sehr schicke Graffiti-Viertel im Stadteil Vila Madalena, São Paulo. Foto: Nicolas de Camaret.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 76 Suchen: CTRL+F
Speto. Frankfurt am Main, 2013Fassade der Matthäuskirche in der Friedrich-Ebert-Anlage 33. © Schirn, Kunsthalle Frankfurt 2013, Foto: Norbert Miguletz.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 77 Suchen: CTRL+F
Nunca. Fassade in Toronto, 2009. Foto: Nunca.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 78 Suchen: CTRL+F
Onesto (a.k.a. Alex Hornest). Gebäude der Sparkasse in der Neuen Mainzer Straße 59 und Fassade in derNeuen Mainzer Straße 57, Frankfurt am Main, 2013 © Schirn Kunsthalle Frankfurt 2013, Foto: Norbert Miguletz.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 79 Suchen: CTRL+F
Dem brasilianischen Ursprung seiner Bilder gab Nunca in seiner Frankfurter Arbeit Ausdruck. Auf der Brandwand des Gebäudes in der Niddastraße 64 im Bahnhofs-viertel führte er ein bereits im August 2013 in São Paulo gemaltes „Mural“ in gleichem Maßstab fort.
Eine bunte Alternative zu den blöden Wahlplakaten der Saison: Rimon Guimarães. Bauzaun am KfW-Gebäude in der Bockenheimer Landstraße 102-104, Frankfurt am Main, 2013. © SchirnKunsthalle Frankfurt 2013, Foto: Norbert Miguletz.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 82 Suchen: CTRL+F
Pixação gefällig?
Eine weitaus extremere Form der brasilianischen Graffittis als die jetzt zu bewundernden in Frankfurt/Main ist die Pixação, die ihre Wurzeln in Sao Paulo hat. Die Texte werden in einem besonderen Schrift-Stil gesprüht.
Die Pixadores lassen sich nicht auf die salonfähig gewordene StreetArt ein. Um das zu zeigen, stürmten sie 2008, nach vorheriger Inkenntnisssetung, die Fakultät der Univer
sität der Schönen Künste (Universidade de Belas Artes) in São Paulo. Der Protest richtete sich neben der universitären Einrichtung auch gegen die Galeria Choque Cultural, gegen öffentlich nutzbare GraffitiMauern (Murais de Graffiti Autorizados) und die 28. Bienal de Artes de São Paulo.
Dagegen hat der Grafiker Tony de Marco (Bild unten) eine milde, sagen wir mal, domestizierte Form der Pixação entwickelt: den Pixotosco.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Street Art / Seite 83 Suchen: CTRL+F
Der Brasilianer Tony de Marco hat eine domestizierte Form der Pixacao entwickelt: den Pixotosco.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 88 Suchen: CTRL+F
Unzialen, vom 11. bis zum 14. Jahrhundert
Auf den folgenden Seiten werden einige Erscheinungsformen der Unziale als Steinschrift dokumentiert. Die Fotos wurden ausschließlich in Portugal und Spanien gesammelt.
Die Unziale ist eine Versalschrift, die aus der ehrwürdigen Capi ta lis Quadrata der Römer entwickelt wurde – durch die Abrundung der Buchstabenformen, was
das Schreiben sehr beschleunigte. Gleichzeitig reduzierte die Unziale die
Anzahl der Striche, die für das Schreiben nötig waren, was abermals den Duktus beschleunigte. Diese runde Form der römischen Capitalis entstand recht früh, schon im Verlauf des 4. Jahrhunderts und wurde bis zum 8. Jahrhundert für den Fließtext (!) von vielen Buchmanuskripten (Codices) verwendet.
In dieser ersten Etappe wurde mit der Rohrfeder auf Pergament geschrieben; wir kennen sowohl lateinische als auch griechische/byzantinische und kyrillische Formen der
Unzialschrift. Es sind circa 300 sehr alte Manu
13. Jahrhundert. Grabinschrift für Dom Honorico. Unzialschrift. Museu Machado de Castro, Coimbra. Foto: ph.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 89 Suchen: CTRL+F
skripte, meist Teile der Bibel, in Unzialschrift erhalten. Vollständig erhalten sind beispielsweise der berühmte Codex Sinai ticus und der Codex Vaticanus.
Uncialis als SteinschriftÄhnlich wie die Capitalis Quadrata, beginnt die Unziale ihre Karriere als reine Buchschrift, doch sie wurde auch in Stein gemeisselt und in Metal geformt, wie aus den Bildern der nächsten Seiten zu entnehmen ist; Dokumentationen, die aus Portugal und Spanien stammen. Gelegentlich scheint sich die Unziale mit Formen der Visigotischen Versalie zu vermischen.
Was unmittelbar auffällt, ist daß die Formen der Uncialis in Stein oft in die Höhe getrieben werden; dadurch werden die gestreckten Buchstaben schmäler und verlieren schnell die rundliche Behäbigkeit, die sie in geschriebenen Büchern oft zeigen.
Obwohl die Unziale für die Niederschrift von Manuskripten entwickelt wurde, finden wir eine ganze Reihe von unzialen Inschriften in mittelalterlichen Monu
menten. Damit wurden meist Epitaphe, aber auch längere Dokumente in Stein gehauen.
Schaut man sich in Lissabon, Alcobaça, Évora und Coimbra um, entdeckt man eine
«Aqui jaz Dona Moor Peres e Dona Maria...» Unziale Lettern. Diese Inschrift ist im Museu Machado de Castro, in Coimbra, ausgestellt.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 90 Suchen: CTRL+F
erstaunliche Vielfalt an Varianten. Bevor die gotische Minuskel in Erscheinung tritt – unser nächstes Thema –, ist die Unziale die „typische Steinschrift” des Mittelalters.
Die hier skizzierten Stationen der Entwicklung der Unziale zeigen noch zwei bedeutende Etappen, die eine formale Ähnlichkeit, aber keine funktionale Verwandt
schaft mit der Urform zeigen. Nach dem Jahr 800 wurde sie nur noch als Auszeichnungsschrift verwendet, für prunkvolle Titel und Untertitel. Hier beginnt sie auch Farben anzunehmen; sie wird nicht nur in Rot, sondern auch oft in Blau und Grün geschrieben – besser gesagt: gemalt.
In einer dritten (kalligraphischen) Lebensphase schmückt sie als Initiale unzählige Manuskripte und Inkunabeln, welche mit karolingischen, dann mit gotischen Buch
staben geschrieben (und später, gedruckt) wurden. So erscheint sie, zum Beispiel, in der 42zeiligen Bibel von Gutenberg. Im späten Erscheinungsbild – als Initiale –, wurden die Versalformen der Unziale nicht kalligraphisch (mit einer Feder), sondern mit feinen Pinseln entworfen und behutsam farbig ausgemalt.
Enge und schlanken unzialen Lettern. Diese Inschrift ist im Museu Machado de Castro, in Coimbra, ausgestellt. Foto: ph.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 91 Suchen: CTRL+F
In dieser dritten Erscheinungsform ist die Verwendung von Farben besonders üppig; die SchmuckUnzialen dürfen als die «buntesten Buchstaben» der ganzen europäischen Schriftentwicklung gelten.
An anderer Stelle (Cadernos de Design e Tipografia, www.tipografos.net) habe ich 10 digitale Versionen der Unziale vorgestellt, welche die erstaunliche Laufbahn dieser Versalschrift nachzeichnen – ein erster Abschluß der Recherchen, die zunächst auf 2 bis 3 Wochen angelegt waren, sich dann über mehrere Jahren ausdehnten. Ich hoffe, daß diese digitalen Fonts der historischen Entwicklung der Unziale über mindestens 11 Jahrhunderten gerecht werden!
Paulo Heitlinger
Eine der Inschriften im Portikus der mozarabischen Klosterkirche San Miguel de Escalada (Provinz León, Spanien), die sich auf hier verstorbene Mönche beziehen. Die Einweihung der Kirche durch Gennadius, Bischof von Astorga, ist eindeutig auf das Jahr 951 der spanischen Ära
(913 unserer Zeitrechnung) datiert, doch wir wissen nicht, wann diese Inschrift angebracht wurde. Die klobig-quadratische Form der Buchstaben läßt jedoch vermuten, daß es sich um eine frühe Erscheinung der Unziale als Steinschrift handelt. Foto: ph.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 92 Suchen: CTRL+F
Eine der Inschriften im Portikus der mozarabischen Kirche San Miguel de Escalada (Provinz León, Spanien), die sich auf hier verstorbene Mönche beziehen. Diese Unzialschrift zeigt verschiedene ungewöhnliche Ligaturen, welche möglicherweise aus der Schreibpraxis der Visigotischen Versalschrift stammen.
Diese Kirche – sicherlich einer der schönsten Beispiele der mozarabischen Baukunst –, ist ausführlich dokumentiert in „Reisen auf den Spuren der Westgoten”, eine E-book-Edition von Kulturas.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 93 Suchen: CTRL+F
Eine der Inschriften im Portikus der mozarabischen Klosterkirche San Miguel de Escalada (León, Spanien), die sich auf dort verstorbene Mönche beziehen. Diese Unzialschrift zeigt verschiedene ungewöhnliche Ligaturen, welche möglicherweise aus der Schreibpraxis der Visigotischen Versalschrift stammen – die Schrift, die vor der Unziale in der Iberischen Halbinsel verwendet wurde.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 94 Suchen: CTRL+F
12. Jahrhundert. Detail der Inschrift auf der ersten Seite dieses Artikels. Igreja de Santa Justa. Museu Machado de Castro, Coimbra. Diese Unzialschrift zeigt eckige Formen und auch Ligaturen, die stark an die Visigotische Versalschrift erinnnern. Foto: ph.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 95 Suchen: CTRL+F
Inschrift zum Dekan Ordonius an der Seitenwand der asturischen Kirche San Salvado de Val de Diós, nahe bei Oviedo. Eine sehr kompaktierte Form der Unzialschrift, eng und hoch. Detailansicht: nächste Seite.Datum unbekannt.
Diese Kirche – ein spätes Beispiel der Baukunst der asturischen Monarchie –, ist ausführlich dokumentiert in „Reisen auf den Spuren der Westgoten”, eine E-book-Edition vom Kulturas-Magazin
1035Regelmäßíge, großformatige Unzialschrift. Mit Anklängen an der Visigotischen Versalschrift. Grabesinschrift für König Sanch0 III (el Mayor) von Navarra. Marmor. „Hier ruht Sancho, König der Pyrinäen und von Tolosa ....). Hispanische Ära: 1073. Unsere Zeitrechnung: 1035.Ursprungsoprt: San Isidóro de León.Ausgestellt im Museo de León, León, Spanien. Foto: ph.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 98 Suchen: CTRL+F
Inschrift im Museo de León. Eine Spätform der Visigotischen Versalschrift? Eine Unziale? Eine Mischform?
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 99 Suchen: CTRL+F
Eine bizarre, faszinierende Kombination: Unziale Lettern kontrastieren mit dekorativen Bändern im Mudéjar-Stil. Pátio de la Montería, Alcázar, Sevilla, Spanien. Foto: ph.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 100 Suchen: CTRL+F
1364Eine bizarre, faszinierende Kombination: Unziale Lettern kontrastieren mit dekorativen geometrischen Bändern. Inschrift aus dem Jahre 1364. Pátio de la Montería, Alcázar, Sevilla, Spanien.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 101 Suchen: CTRL+F
Inschrift mit unzialen Lettern. Museu Machado de Castro, Coimbra. Foto: ph.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 102 Suchen: CTRL+F
Unzialen in einer Steininschrift der Sé de Lisboa. Betonte Serifen, Ähnlichkeit mit der Buchschrift. Foto: ph.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 103 Suchen: CTRL+F
Unregelmäßig gravierte Unzialschrift. Epitaph für Fernão Gonçalves da Arca. Capela de Fernão Gonçalves da Arca. 14. Jahrhundert. Convento de São Domingos, Évora. Im Museu de Évora ausgestellt. Foto: ph.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 104 Suchen: CTRL+F
Monasterio de los Santos Facundo y Primitivo, Inschrift aus dem Jahre 1184. Sahagún, León, Spanien.
1184
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 105 Suchen: CTRL+F
1298Unziale Schrift, schmal laufend, wohlgeformt. Catedral de la Santa Creu, Barcelona. Diese Inschrift erinnert an den Anfang der Bauarbeiten, während der Regierungszeit von König Jaume II. Foto: Bertran de Seva....l‘obra d‘aquesta seu va ser començada les calendes de maig de l‘any del senyor 1298, regnant l‘Il·lustríssim senyor Jaume rei d‘Aragó, València, Sardenya, Còrsega i comte de Barcelona.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 107 Suchen: CTRL+F
1329Inschrift an der gotischen Kirche Santa María del Mar, Barcelona. Transkription des Textes in katalanischer Sprache: En nom de la Santa Trinitat e honor de Madona Santa Maria fo comensada la obra d’aquesta esgleya lo dia de sancta m(aria) de mars en l’ayn de MCCCXXIX regnant n’Anfós, per la gràcia de Déu rei d’Aragó qui conques lo regne de Cerdeya.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 108 Suchen: CTRL+F
Steininschrift in der Kathedrale von Córdoba.Foto: ph.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 109 Suchen: CTRL+F
Uncialis, sehr hoch und schmal. Grabinschrift des Pedro Franco. Igreja-colegiada de Santiago, Coimbra, 1197.Museu Arqueológico do Carmo, Lissabon. Foto: ph.
1197
pEtrUS.FRANcUSFAMvs
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 110 Suchen: CTRL+F
Unziale. Epitaph für Donna Maria de Arco. Igreja-colegiada de Santiago, Coimbra, 1230 (?). Die Kirche Igreja de Santiago steht in der Praça do Comércio, in Coimbra, Portugal. Ende des 12.Jahrhunderts erbaut, ist diese Kirche eines der großen Monumente im romanischen Stil. Die hier abgebildete Steininschrift wird im Museu Arqueológico do Carmo, Lissabon, gezeigt. Foto: ph.
1230
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 111 Suchen: CTRL+F
Unziale Versalien, hoch und komprimiert.Steininschrift mit der „Lauda da abadessa Doña Sancha”. 1293. Kloster Santa Maria de la Vega. Museu Arqueológico de las Astúrias, Oviedo. Foto: ph.
1293
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 112 Suchen: CTRL+F
1128Die Kirche Santa Maria da Alcáçova, die innerhalb der Mauern der Burg von Montemor-o-Velho steht, wurde Ende des 11. Jahrhunderts gegründet. Sie steht dort, wo einst eine islamische Moschee stand. Diese Inschrift mit unzialer Schrift, vom Jahre 1128, nimmt Bezug auf die Weihung der Kirche.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 114 Suchen: CTRL+F
1340Kloster Mosteiro de Alcobaça, Grabinschrift mit Unzialen. Das Wort «ALCOBACIE» wurde hervorgehoben. Verschiedene Mauern dieses Klosters zeigen noch ähnlich Grabinschriften. Die ersten Mönche, die hier angesiedelt wurden, hatten eine „kolonisierende Wirkung”, da sie Gebiete wieder bewohnen mußten, die vom ersten portugiesischen König, Afonso Henriques, radikal entvölkert worden waren. Die ursprüngliche mozarabische Bevölkerung wurde vertrieben (oder ermordet), Mönche aus Galicien wurden als neue Siedler importiert.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 115 Suchen: CTRL+F
1246Kloster Mosteiro de Alcobaça, Grabinschrift mit Unzialen. Die eindrucksvolle Zisterzienser-Abtei wurde von Afonso Henriques gestiftet. 1147 gelobte er – so die Legende –, für die Jungfrau Maria Kloster zu gründen, falls die Portugiesen siegreich aus der Schlacht von Santarém (gegen die Mauren) hervorgingen. Er hielt sein Versprechen und schenkte das Gebiet von Alcobaça für den Bau des Klosters.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 116 Suchen: CTRL+F
Grobförmige Unzialien, in Stein gemeißelt. Möglicherweise schwingt hier noch ein Einfluss der Visigotischen Versalie nach. Die Anlage von Alcobaça ist fast so alt wie Portugal selbst. Den Grundstein der Kirche legte Afonso Henrique, der erste portugiesische König, schon 1148. Das Gebiet von Alcobaça wurde dem Zisterzienserabt Bernhard von Clairvaux geschenkt, wie es (urkundlich belegt) im Jahre 1153 erfolgte. 1223 konnten Mönche in das neue Kloster einziehen und 29 Jahre später war der Bau abgeschlossen.
1323
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 117 Suchen: CTRL+F
1344Grobförmige Unzialien, in Stein gemeißelt. Inschrift im Kloster von Alcobaça. Mit der Darstellung zweier Burgen.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 119 Suchen: CTRL+F
Grobförmige Unzialien, in Stein gemeißelt. Inschrift im Kloster von Alcobaça. Mit der Darstellung eines Ritters und seines Wappens. Foto: ph.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Unzialen in Stein / Seite 120 Suchen: CTRL+F
1387Regelmäßig gestaltete Unzialschrift. Grabinschrift des Adeligen Lopo Fernandes Pacheco, in der Grabkapelle São Cosme e Sao Damião, in der Charola (Chorumlauf) der Sé de Lisboa. Foto: ph.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Werbung / Seite 121 Suchen: CTRL+F
Werbung
Inschrift mit Unzialen. Kreuzgang der Kathedrale von León, Spanien. Foto: bw.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Werbung / Seite 122 Suchen: CTRL+F
Ein Azulejo (Kachel, Wandfliese) mit der Darstellung des N aus der Unziale. Museu do Azulejo, Lissabon, Portugal.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Werbung / Seite 123 Suchen: CTRL+F
Was Sie schon immer über die „Hauptstadt des Norden Portugals” wissen wollten: Das Bekannte, das weniger Bekannte und das wirklich Interes
sante! Als Ebook zu haben!Wir haben eine breite Palette von Themen
zusammengestellt, um einen spannenden Stadtführer zu schreiben, der Sie in Porto einführt und vor Ort begleiten wird.
Mehr als 3o Reportagen und zahlreiche Bildstrecken vermitteln vielfältige Einsichten in die Menschen aus Kultur, Politik, Musik, Kunst, Kinowelt, Fuß
ball und viele andere Bereiche – die Menschen, die der Stadt Porto ihr ganz spezifisches Flair verleihen. Dazu stellen wir alle besuchenswerten Plätze, Monumente, Gebäude, Märkte, Erholungsgebiete, Stadtparks, Strände und Landschaften der Umgebung vor, die Porto zum Erlebnis machen.
Dabei ist Porto von Kulturas kein kon ventio neller CityGuide. Irreverent und unsentimental legen wir die Stadt offen – mit dem Humor und dem kritischen
Blick von Autoren, die das Stadtleben seit Jahren aktiv verfolgen. Wir liebkosen nicht, sondern bürsten kräftig gegen den Strich. Aus dem Inhalt: Die ArtDécoStadt. Die Filmprofis. Die Literaturgrößen. Die Mediengestalter und die
30 Reportagen mit Stadtbildern und Gebrauchsanleitungen zur Hauptstadt des Nordens.
Von P. Heitlinger und B. Wegemann. Ein e-book von Kulturas, im PDF-Format. 2013. 250 Seiten, 15 Euro. Zu kaufen bei www.portugal-kultur.de
Ausstellungs macher. Die Casa da Música. Die Architekturschule von Porto. Das Lebenswerk von Álvaro Siza und Souto Moura. Romanautorin Augustina BessaLuis. Manoel de Oliveira, der ewige Filmemacher. Die Rockszene Portos: Rui Veloso, Sérgio Godinho, Pedro Abrunhosa, Capicua & Co. FußballBoss Pinto Costa, u.v.m.
Natürlich auch: Portwein, Francesinhas, und die Briten von Porto.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Werbung / Seite 124 Suchen: CTRL+F
Reisen auf den Spuren der WestgotenDurch Spanien und Portugal: Städte, Monumente, Museen, Monarchen, Kunst, Kirchen, Bücher und Gesang. Eine Führung von Birgit Wegemann und Paulo Heitlinger. 1. Auflage, August 2013. Im PDF-Querformat. 400 Seiten, 500 Abbildungen. Ein neues E-book vom Verlag www.portugal-kultur.de
Die Kultur der westgotischen Ära in der Iberischen Halbinsel ist eine der am wenigsten dokumentierten. So dauerte es einige Jahre, bis die Autoren Paulo
Heitlinger und Birgit Wegemann genügend Material zusammentragen, auswerten und verstehen konnten, um das nun vorliegende Ebook fertigstellen zu können.
Und dann dachten wir, vielleicht hätten Sie Lust, diese Entdeckungen mit uns zu teilen. Und so kam es zu diesem wahrhaft „alternativen Reiseführer”.
Die Grundidee: Sie machen einen wunderschönen Urlaub, kreuz und quer durch Spanien
und Portugal, und lernen dabei einige besonders interessante Zeugnisse der westgotischen Zeit kennenlernen. Sie entdecken die mozarabische Architektur und die Bauten der frühen asturischen Könige.
Die Schwierigkeiten, einen Überblick über die Bauten, Kunstprodukte und Dokumente zu bekommen, ergeben sich aus der historischen
Entwicklung selbst. Die erste visigotische Monarchie war eine Zeit großer Unruhe und vieler Umbrüche. Sie beginnt mit den Invasionen der sog. "Barbaren”, um 409, und wird von der islamischen Beherrschung, ab 711, vernichtet. Aber nur teilweise, denn sie findet in der mozarabischen Kultur eine Fortsetzung. Die Neuformierung der Christen in den Bergen Asturiens
Kulturas 7 / August+September 2013 / Werbung / Seite 125 Suchen: CTRL+F
Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn das nächste E-book von
Kulturas erscheint? Dann schicken Sie bitte eine kurze E-mail
an [email protected] mit dem Betreff «E-books»wird schließlich in die lang anhaltende Reconquista führen, an deren Ende zwei neue Staaten enstanden sind: Portugal und Spanien.
Die vorliegende Dokumentation beschreibt und illustriert die verschiedenen Etappen dieser komplexen Evolution. Das bedeutet, daß die ganze Iberische Halbinsel – Spanien, Portugal und auch noch die balearischen Inseln – nach Spuren der Westgoten durchsucht werden mußte...
Für die Kompilierung der Texte in diesem Ebook haben wir eigene Recherchen geführt und uns auf folgende Autoren gestützt: Katherine Fischer Drew, Christoph Eger, Peter Klein, Emil Hübner, Claudio Torres und Virgilio Lopes (Campo Arqueológico de Mértola), José Mattoso, Mário Jorge Barroca, sowie auf Texte und Bilder von namhaften Museen und Bibliotheken.
Reisen auf den Spuren der Westgoten.Von Paulo Heitlinger und Birgit Wegemann. PDF im Breitformat. 400 Seiten, 15 Euro.Kulturas-Verlag, 2013. Bestellbar auf www.portugal-kultur.de
San Pedro de la Nave ist eine westgotische Kirche im Nirgendwo. Im kleinen Flecken El Campillo, in der Gemeinde San Pedro de la Nave-Almendra (Zamora), wurde die Kirche wiederaufgebaut, die dem Wasser eines Stausees weichen mußte. Der Baubeginn wird in die Regierungszeit des westgotischen Königs Egica (687-702) datiert.
Kulturas 7 / August+September 2013 / Werbung / Seite 126 Suchen: CTRL+F
Das E-Book der Kulturas-Editionen, das eine detaillierte Beschreibung der Entwicklung der Nutzkeramik aus Ton auf der Iberischen Halbinsel liefert. 500 Abbildungen auf 450 Seiten, 20 Euro.
Kann man die 6000jährige Entwicklung der Nutzkeramik auf spannende, unterhaltsame und dennoch wissenschaftlich fundierte Art erzählen? In diesem reich bebilder
ten EBook wird der Bogen von der ersten Cardial-keramik (4.000 Jahre v.u.Z.) bis zur Tonkunst der Gegenwart zu spannen. Von den Vasen der Glok-kenbecherkultur bis zu den modernen Kreationen der Terrissa aus Katalunien. Das Material wurde in verschiedenen KeramikMuseen in Portugal und Spanien, aber auch auf unzähligen Begnungen mit Oleiros und Alfareros gewonnen. Das Resultat ist eine einmalige Zusammenstellung über ein Handwerk mit einer großen Tradition, welches keramische Gefäße für alle mögliche Zwecke geliefert hat.
Inhaltsverzeichnis + Leseprobe: www.portugal-kultur.de/ebooks
Keramik in Spanien und Portugal
Dieses E-Book vom Kulturas-Verlag gibt es im gut lesbaren PDF-Format. Es kann auf der Website www.portugal-kultur.de/ebooks bestellt werden.450 Seiten. Einführungspreis: 20 Euro. Bezahlung online per Paypal oder Banküberweisung.