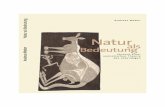Natur als Bedeutung. Versuch einer semiotischen Theorie des Lebendigen
Rechnen mit der Natur: Ökonomische Kalküle um Ressourcen
Transcript of Rechnen mit der Natur: Ökonomische Kalküle um Ressourcen
Ber. Wissenschaftsgesch. 37 (2014) 8 – 19
© 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim8
www.bwg.wiley-vch.de
DOI: 10.1002/bewi.201401672
Lea Haller, Sabine Höhler, Andrea Westermann
Einleitung: Rechnen mit der Natur: Ökonomische Kalküle um Ressourcen*
Der internationale Handel bestehe hauptsächlich im Tausch von Manufakturpro-dukten gegen Rohstoffe und Naturprodukte, schrieb der Ökonom und Staatswis-senschaftler Friedrich List 1841 in Das nationale System der politischen Ökonomie. Infolge Angebot und Nachfrage ergebe sich eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen rohstoffproduzierenden und industriegüterexportierenden Ländern, oder in den Worten Lists:
Wenn so die Länder der heißen Zone ungleich größere Quantitäten an Colonialwaaren produciren als bisher, so verschaffen sie sich die Mittel, den Ländern der gemäßigten Zone ungleich größere Quantitäten von Manufacturwaaren abzunehmen, und aus diesem größern Absatz von Manufacturwaaren erwächst den letztern die Fähigkeit größere Quantitäten von Colonialwaaren zu consumiren.1
Und immer so fort – dies allerdings zum langfristigen Vorteil für Industriestaaten. Während Frei- und Welthandelstheorien zufolge rohstoffexportierende und rohstoff-importierende Staaten gleichermaßen vom globalen Handel für ihr wirtschaftliches Fortkommen profitierten, zeigte sich List skeptisch. Er plädierte für Schutzzölle und Investitionen in die eigene Industrieinfrastruktur, um eine nachholende Entwicklung der kontinentaleuropäischen Länder oder der USA gegenüber dem Industriezugpferd England zu bewerkstelligen.
Das Rohstoffproblem betraf aber nicht nur den Fortschritt der Nationen, es ging weit über die Frage nach optimalen Handelsverhältnissen hinaus.
Begriffe wie „Knappheit“, „Gesamtvorrat“ oder „Effizienz“ zeugen von einem quantifizierenden Zugriff auf die Natur und vom Bemühen, ihren Wert für Wirtschaft, Nation und Gesellschaft mit ökonomischen Methoden zu erfassen und zu beziffern. 1873 sprach der französische Ökonom Léon Walras vom „Naturkapital“ und vereinte damit die Vorstellung einer natürlichen Umwelt mit der Vorstellung ihrer Akku-mulier-, Tausch- und Bilanzierbarkeit.2 Naturkapital bezeichnete die unzerstörbare Fruchtbarkeit des Bodens – „the original and indestructible powers of the soil“ –, von der schon der britische Ökonom David Ricardo ausgegangen war.3 Probleme der Bodenerschöpfung waren zwar bereits in der Folge der ersten großen Wirtschafts-krisen in den USA in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts diskutiert worden, und auch die Höhe der sogenannten „Grundrente“, die der Pächter eines Landes an dessen Eigentümer zahlte, bezog die Güte des Bodens mit ein. Für Preisbildungsprozesse blieb die Bodenqualität jedoch ohne Belang. Boden galt nicht als ökonomisch „knapp“ (relativ knapp), noch war zu wenig Abnutzung spürbar. So erst wurde es möglich,
* Das Themenheft geht zurück auf eine gleichnamige Sektion bei der gemeinsamen Jahrestagung der Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte mit der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik „Wissenschaft und Ökonomie“ im September 2012 in Mainz.
© 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Einleitung
Ber. Wissenschaftsgeschichte 37 (2014) 8 – 19 9
sämtliche Kapitalformen, ob Boden, Arbeitskraft oder Finanzkapital, als prinzipiell miteinander verrechenbar und substituierbar zu betrachten.
Daran wird deutlich: Gesellschaften wirtschaften nicht nur in der Natur, son-dern auch mit der Natur, und sie stützen ihre Kalkulationen wissenschaftlich und politisch ab. Diese Kalkulationen, Expertisen und Interessenlagen sind Gegenstand des vorliegenden Hefts. Seit 1700 lassen sich drei systematisch verschiedene, histo-risch aufeinanderfolgende Naturökonomien unterscheiden, ohne dass diese einan-der jeweils vollständig abgelöst hätten: Die kameralistische Natur (ca. 1700 – 1900), die geopolitische Natur (ca. 1900 – 1970) und die umweltökonomische Natur (seit ca. 1960). Sie bildeten durchaus vielfältige Überschneidungen und Interferenzen. Aber sie lassen sich schematisch sowohl in den Methoden der Berechnung und Bewertung des ökonomischen „Naturvorrats“ als auch in den Formen der aktiven Bewirtschaf-tung natürlicher Ressourcen unterscheiden. Die zentralen Fragen, die sich jeweils stellten, lauteten: Was gibt die Natur her? Wie wirtschaften wir damit? Und wem soll der Nutzen daraus zugute kommen?
Kameralistische Naturerfassung
Dass Natur ökonomisch verfasst und auch entsprechend zu registrieren und regulieren sei, ist eine Vorstellung, die sich mit der Industrialisierung im frühen 18. Jahrhundert durchsetzte. Aus dem aufklärerischen „Geist der Quantifizierung“4 entstanden wis-senschaftliche, administrative und kaufmännische Systeme der Inventarisierung und Verwaltung natürlicher Güter. Dabei wurden zunehmend standardisierte Einheiten, Metriken und instrumentelle Messverfahren genutzt – seit dem 19. Jahrhundert auch statistische Methoden –, um Tier- und Pflanzenwelt, Mineralien oder Bevölkerungen zu erfassen und zu klassifizieren.
Taxonomische Sammlungen und ihre Beschreibungen ordneten natürliche Phä-nomene nicht nur, sie erlaubten auch die Vergleichbarkeit, Überprüfbarkeit und Neuordnung der Bestände. Ihre Durchsetzung verdankte sich nicht zuletzt auch physikotheologischen Bestrebungen, die göttliche Existenz aus einer vernunftmäßi-gen und nützlichen Ordnung der Natur abzuleiten.5 Carl von Linné beschrieb diese autoritäre Ökonomie der Schöpferordnung in seiner Oeconomia Naturae von 1749.6 Wissenschaftliche Praktiken der Taxierung und ältere merkantile Praktiken der Buch-führung waren dabei eng verwandt: „taking stock“ hieß, ein Inventar der Natur zu erstellen; „to account“ bedeutete sowohl zählen als auch erzählen. Wissenschaftler und Kaufleute legten über ihre Arbeit Rechenschaft ab, indem sie möglichst exakt Buch führten.7
Die kameralwissenschaftliche Inventarisierung staatlicher Ressourcen zielte auf die Pflege und Vermehrung des Staats- und Naturhaushalts.8 Aus der Sicht der in der Staatsverwaltung tätigen Juristen, Statistiker, Ökonomen, Geologen, Agrar- und Forstwissenschaftler auf Waldbestände, Kohle- und Erzlagerstätten und Agrarflächen fielen Beobachtungs- und Interventionsfeld in eins. Ökonomisches und wissen-schaftliches Wissen über die Natur konstituierten sich gegenseitig. Eine ökonomisch organisierte Natur passte zum Gebot der zukunfts- und interventionsorientierten „Aufsicht oder Sorge vor eines anderen Sachen und Güter, damit dieselben, wo nicht verbessert, doch wenigstens auch nicht verschlimmert, und, so viel möglich, in ihrem Seyn und Wesen erhalten werden“, wie der Eintrag „Verwaltung“ in Zedlers Großem
Lea Haller, Sabine Höhler, Andrea Westermann
© 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Ber. Wissenschaftsgeschichte 37 (2014) 8 – 1910
Universallexicon lautete.9 In diesem staatsökonomischen Kontext erhielten Begriffe wie Produktivität und Ertrag ihre moderne Bedeutung.
Natur wurde zu einem Rohstoff und zur Ware. Durch den Menschen zu extrahie-rende und verarbeitende Rohmaterialien waren neben Erzen und Salzen auch Kohle und Holz sowie Flora und Fauna. Erste systematische Inventarisierungsprojekte natürlicher Güter wurden in der Land-, Vieh- und Forstwirtschaft vorgenommen. Sie dienten dazu, die Bewirtschaftung erneuerbarer Ressourcen zu intensivieren und Produkte zu verarbeiten.10 Der deutsche Kameralist Hans Carl von Carlowitz machte in seiner Arbeit Sylvicultura Oeconomica von 1713 erstmals das Prinzip der Nachhaltigkeit zur Pflege des Waldbestandes geltend.11 Als „nachhaltende Nutzung“ wollte er die Maßnahme verstanden wissen, in einem Zeitintervall nur so viele Bäume zu fällen, wie aufgeforstet werden konnten, ohne den Baumbestand langfristig zu schädigen. Carlowitz’ Überlegungen zu den selbsterneuernden Kräften der Natur entsprachen der Idee des vorsorgenden Staates, der sein Vermögen für nachkommende Generationen zu sichern und mehren suchte. Die Vorgabe des nachhaltigen forstwirt-schaftlichen Ertrages machte die Wälder zugleich zu Inventarien, die als nationales Gut verzeichnet und monetär veranschlagt werden konnten. Im 19. Jahrhundert wurde der nachwachsende Rohstoff Holz zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Forstwirtschaft unter Staatsmonopol.12
Bezeichnend für die Blüte der staatlichen Verwaltungskunst war auch die „Agricul-tural Improvement“-Bewegung in den USA Mitte des 19. Jahrhunderts, ein nationales Programm zur landwirtschaftlichen Produktivitätssteigerung unter Rückgriff auf die Agrikulturchemie Justus von Liebigs.13 Liebigs Elementaranalyse der Kohlenstoff-chemie erlaubte neue quantitative Zugänge zur Bodenbeschaffenheit. Seine „Gesetze“ zu Dauer und Höhe der landwirtschaftlichen Erträge gingen von einer unsichtbaren Kapitalbasis des Bodens aus, die bei Nichtintervention langsam aufgezehrt wird. Als kleinste stoffliche Einheit und als Währung der Tauschbeziehungen der Wissen-schaftler und Landwirtschaftler mit ihren Böden erwies sich der Nährstoff, Liebigs Kohlenstoffverbindung.
Nach Theodore Porter betreibt dieses „accounting“ eine Form der Mechanisierung des Urteils, denn durch die Zahlenförmigkeit, die Instrumente und die standardi-sierten Verfahren der Bemessung erhält das Prozedere Präzision; die Ergebnisse werden lesbar, kommunizierbar und reproduzierbar, und sie erlauben Berechnungen und Vorhersagen.14 Auch James C. Scott hat die wissenschaftliche „Lesbarkeit“ von Natur als paradigmatisch für den modernistischen Staat bezeichnet, der durch seine Verwaltungsorgane Natur in zählbare Einheiten zerlegte und sie so zu Objekten der Ordnung, Zuteilung und Besteuerung werden ließ.15
Geopolitische Kalkulationen
Um 1900 begannen die westlichen Industrienationen damit, ihre eigene Rohstoffpo-sition mit der von anderen Staaten abzugleichen. Der Blick auf das Naturinventar war nun gleichzeitig nationalistisch geprägt und global ausgerichtet: Die ökonomische Natur wurde geopolitisch gerahmt. Nationale und weltweite Rohstoffvorratsziffern wurden als Planungsgrundlage zum Ausdruck und Gestaltungsinstrument internati-onaler politischer Ordnungsverhältnisse. An Rohstoffen wurden Fragen staatlicher Souveränität und überstaatlicher Verantwortung diskutiert. Dies hatte auch Auswir-
© 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Einleitung
Ber. Wissenschaftsgeschichte 37 (2014) 8 – 19 11
kungen auf die Kalkulationsstrategien und -methoden: Erstens wurde geologisches und agronomisches Wissen zu Expertenwissen für die internationale politische Öko-nomie. Zweitens begannen sich Ökonomen mit der komplexen Frage zu beschäftigen, wie mit endlichen Ressourcen wirtschaftlich zu rechnen sei. Und drittens bemühte man sich, mittels technischer Innovationen Rohstoffe gegeneinander zu verrechnen und so die Ressourceneffizienz insgesamt zu steigern.16
Geologen und andere Rohstoffexperten versuchten seit dem Ende des 19. Jahrhun-derts, die nationalen und weltweiten Erz- und Ölvorkommen mit neuen Methoden abzuschätzen.17 Es ging nicht zuletzt darum, „sich Rechenschaft abzulegen über die eigenen Vorräte im Lande und das Maß [der Abhängigkeit durch den Erzbezug aus dem Auslande“.18 Ergänzend suchten Bergbauindustrie wie Staaten auch die interna-tionale Produktions- und Verbrauchsentwicklung systematisch zu erfassen, um über den Quotienten aus aktueller Reservehöhe und Jahresproduktion die Reichweite der ermittelten Bestände berechnen zu können. Die spektakuläre Verbilligung der inter-nationalen Transportkosten und die daraus resultierende internationale Angleichung der Rohstoffpreise trugen das ihre dazu bei, Rohstoffkalkulationen zu globalisieren.19
Infolge der Erfahrung von Rohstoffblockaden, Transportproblemen und strategi-scher Rohstoffbewirtschaftung im Ersten Weltkrieg ebenso wie durch nationalstaat-liche Friedensplanungen und die internationalen Versailler Friedensverhandlungen wuchs die Nachfrage nach solchen globalen Übersichten weiter.20 Für die „weitsichtige Behandlung internationaler Beziehungen“21 brauche es Wissen über die eigene und fremde „bergwirtschaftliche Ausstattung“ und „Rangordnung“, den „mineral factor in the world position“ eines Staates oder dessen „mineral position“.22 Der Aufbau einer entsprechenden laufenden Datenermittlung wurde angemahnt.23 Die Geologen waren ob des schwachen Inventarisierungsgrades der Erde in der Regel allerdings vorsichtig damit, die Weltrohstofflage vorschnell ein für alle Mal festzuschreiben: „The remark-able concentration of the world’s mining and smelting around the North Atlantic basin, indicated by the foregoing figures, does not mean that nature has concentrated the mineral deposits here to this extent.“24 Große Vorräte würden da gefunden, wo man nach ihnen suchte beziehungsweise die Energie für ihren Abbau aufwandte.
Mit der intensivierten quantitativen Erfassung globaler Erz- und Ölvorräte rückte die Sorge vor der Endlichkeit natürlicher Ressourcen mit neuer Dringlichkeit ins Be-wusstsein: „Contemplation of the world’s disappearing supplies of minerals, forests, and other exhaustible assets has led to demands for regulation of their exploitation.“25 In dieser Situation boten Ökonomen wie der amerikanische Statistiker und Volkswirt Harold Hotelling mathematische Modelle an, die mögliche Knappheit nicht als Frage von Naturschutz oder Außenpolitik, sondern als Frage des Preises behandelten.
Hotelling widmete sich 1931 in seinem Aufsatz „The Economics of Exhaustible Resources“ dem Problem des langfristigen, intergenerationellen Verbrauchs nichter-neuerbarer Ressourcen und behauptete, es löse sich mehr oder weniger automatisch über den Preis. Seinem auf der Variationsrechnung basierenden Modell lag die Über-legung zu Grunde, dass der Preis für eine erschöpfbare Ressource im Zeitablauf mit dem Zinssatz ansteigen müsse.26 Weil bestimmte natürliche Ressourcen zunehmender Knappheit unterlägen, so der Gedanke, könne der Preis nicht mit den Grenzkosten (den Kosten für eine zusätzliche Produktionseinheit) im freien Wettbewerb identisch sein, sondern die sich verändernde Knappheitsrente bestimme die Opportunitäts-kosten für eine zusätzliche Produktionseinheit. Hotelling ging davon aus, dass der
Lea Haller, Sabine Höhler, Andrea Westermann
© 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Ber. Wissenschaftsgeschichte 37 (2014) 8 – 1912
Besitzer eines erschöpfbaren Rohstoffes den Wert seiner künftigen Profite zu maxi-mieren sucht. Je höher der antizipierte künftige Preis für den Rohstoff, desto länger wird er die Produktion hinziehen. Produziert er allerdings allzu langsam, werden seine Profite zwar größer, sie verschieben sich aber weiter in die Zukunft. Es gebe im freien Wettbewerb eine Tendenz, dieses Dilemma optimal auszubalancieren, hin zum Maximieren der „total utiliy“, so Hotelling, wobei er vorschlug, diese totale Nützlichkeit „social value of the resource“ zu nennen.27
Das war ein Angebot der Versachlichung eines hochemotionalen Themas: Statt zu fragen, ob es gerecht sei, heute Ressourcen abzubauen und zu verbrauchen, die späteren Generationen nicht mehr zur Verfügung stehen, habe man es mit einer Si-tuation zu tun, in der es keine Verlierer gebe, da rational agierende und umfassend informierte Produzenten automatisch die optimale Produktionsrate festlegten, die den Rohstoff dann zur Verfügung stelle, wenn er den auf lange Sicht größten Nutzen bringe. Oder anders formuliert: Die den natürlichen Rohstoffen eigene Endlichkeit selbst reguliere die Produktionsrate, und mit abnehmenden Reserven förderten stei-gende Preise automatisch die Ressourcenschonung.28
Ersatzstoffforschung, Recycling und Produktgestaltung stellten weitere Verrech-nungs- und Allokationsmethoden für situativ knappe Rohstoffe oder dauerhaft effi-zienteren Rohstoffverbrauch dar. Sie zielten auf Optimierung und wurden häufig aus Autarkieüberlegungen oder als kriegswirtschaftliche Maßnahmen angestoßen. Vom U.S. Office of Strategic Services mit der Abschätzung der nationalsozialistischen Roh-stoffkapazität beauftragt, beobachtete etwa der Ökonom Edward Mason mit einigem Staunen den bis 1944 stetig steigenden deutschen Ausstoß an Waffen, Flugzeugen usw. Neben der rücksichtslosen Ausbeutung besetzter Territorien, massenhafter Zwangs-arbeit und beinahe ausschließlicher Konzentration auf kriegswichtige Industrien wurden von den Alliierten nach 1945 auch die technischen, wissenschaftlichen und organisatorischen Bedingungen der Produktionssteigerung offengelegt:
At the beginning of 1942 German locomotives required 2.3 metric tons of copper. By the middle of 1943 these requirements had been reduced to 237 kilograms, a reduction of approximately nine-tenths. […] The very difficult problem presented by shortages of ferro-alloys was reduced to manageable proportions largely by the substitution of the relatively plentiful alloys – vanadium and silicon – for the less plentiful.29
Vertrauen in die menschliche Kreativität als Ressource zur Lösung von Ressour-cenproblemen war im gesamten 20. Jahrhundert das wichtigste und häufig zutreffende Argument der Ressourcenoptimisten.30 Ein wiederkehrendes Problem blieb dabei freilich ein von William Stanley Jevons bereits 1865 für den Kohleverbrauch beobach-teter Effekt: Ein technisch effizienterer Ressourceneinsatz führte in der Regel nicht zu geringerem, sondern zu erhöhtem Verbrauch, da die Einsparungen den Anreiz zum großflächigen Einsatz der verbesserten Technik setzten.31
Auch die Frage nach der Verteilung des Profits blieb ungelöst. Mitte des 20. Jahr-hunderts fanden die Überlegungen des eingangs zitierten Friedrich List, aber auch politischer Ökonomen der Zwischenkriegszeit wie Albert O. Hirschman, die die ungleichen politischen und wirtschaftlichen Folgen der internationalen Arbeitsteilung betont hatten, Widerhall in rohstoffexportierenden Ländern an der „Peripherie des Weltwirtschaftssystems“.32 Sie interpretierten die Frage der Verfügungsgewalt über natürliche Ressourcen als Element des von den Vereinten Nationen hochgehaltenen Selbstbestimmungsrechts der Völker.33 In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren nationalisierten viele neue unabhängige Staaten und andere Entwicklungsländer ihre
© 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Einleitung
Ber. Wissenschaftsgeschichte 37 (2014) 8 – 19 13
Bodenschätze. In den 1960er Jahren wurden weltweit 32 ausländische Bergbaufir-men enteignet, zwischen 1970 und 1976 folgten weitere 48 Enteignungen.34 Solche Rechtsunsicherheiten brachten den Fluss westlicher Explorationsinvestitionen entlang der Nord-Süd-Achse ins Stocken. Mit der gewichtigen Ausnahme der Investitio-nen in die Erdölexploration zirkulierte das Kapital zur Erschließung mineralischer Rohstoffe vorerst vornehmlich innerhalb der Industrieländer.35 Nicht zuletzt durch diese fortgesetzte Erschließung konnten die Industriestaaten auch die massiven Land-schaftsveränderungen und Umweltfolgen des Bergbaus nicht ignorieren, mit denen ihre Montanregionen zu kämpfen hatten.
Umweltökonomische Modellierungen
Die Umweltära nach dem Zweiten Weltkrieg brachte Bevölkerungswachstum, Um-weltbelastung und Ressourcenknappheit in einen neuen Zusammenhang. Als die Folgen der industrialisierten Wohlstandsgesellschaften in nuklearen Deponien, to-xischen Ablagerungen von Pestiziden in der Nahrungskette und im Großstadtsmog sichtbar wurden, fand die modernekritische, naturkonservatorische Haltung des späten 19. Jahrhunderts neuen Ausdruck in Begriffen der Umwelt und des Um-weltschutzes.36 Die entstehende Umweltbewegung zweifelte die Annahme an, dass wissenschaftlich-technischer Fortschritt zwangsläufig die Möglichkeiten der Natur-beherrschung erweitern würde.
Der moderne Umweltbegriff bezeichnete die menschengemachte und zugleich den Menschen enthaltende Welt. Umweltschutz unterschied sich insofern vom Natur-schutz, als Umwelt eine durch und durch wissenschaftlich-technisch durchzogene und immer schon auf den Menschen bezogene grenzüberschreitende Natur meinte, die sich nicht einzäunen oder konservieren ließ, sondern Gestaltung erforderte. Neu waren Versuche, eine umweltökonomische Bilanz aller Ressourcenbestände und des gesamten Ressourcenverbrauchs auf globaler Ebene zu erstellen. Die Studie Die Gren-zen des Wachstums von 1972 ist nur eine der einschlägigen Studien aus der Zeit der späten 1960er und frühen 1970er Jahre, die immer detailliertere Bestandsaufnahmen gesellschaftlicher und umweltlicher Faktoren vorlegten, hochrechneten und daraus düstere Zukunftsprognosen ableiteten.37
Die Perspektive der begrenzten irdischen Kapazität bzw. ökologischen Tragfä-higkeit trug dazu bei, dass natürliche Ressourcen als absolut knapp zur Diskussion kamen. Die „Kosten“ des wachsenden Umweltverbrauchs sollten zu einem Bestandteil nationaler und globaler ökonomischer Bilanzen gemacht und den Verursachern in Rechnung gestellt werden. Die Wissenschaften der Ressourcen verbanden sich in der Suche nach allgemeinen Gleichungen, die Größen aus verschiedensten Bereichen der Umwelt und der Natur, des Sozialen und des Ökonomischen auf einen abstrakten Nenner brachten.38 Die in den 1960er Jahren entstehende Ökologische Ökonomik hatte zum Ziel, den ökonomischen Prozess in der physikalischen Welt zu verorten und Wirtschaftsweisen zu etablieren, die Umweltkosten, aber auch die Gewinne aus der Gratisnutzung natürlicher Ressourcen in die Märkte internalisierten. Dazu wurde das Naturkapital als ein kritischer Begriff wiederbelebt. Naturkapital bezeichnete jetzt nicht mehr die unerschöpfliche, sondern die erschöpfliche Natur. Dieses Kapital der natürlichen Rohstoffe galt es in den Warenpreisen abzubilden, um Naturverbrauch angemessen zu entschädigen.39 Nicht nur für traditionelle natürliche Güter wie Grund
Lea Haller, Sabine Höhler, Andrea Westermann
© 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Ber. Wissenschaftsgeschichte 37 (2014) 8 – 1914
und Boden, für Holz, Kohle und Öl oder für Mineralrohstoffe, sondern auch für „Allmenden“ wie die Ozeane, die Atemluft und die natürliche Vielfalt der Arten, die bis ins 20. Jahrhundert im Überfluss vorhanden schienen und die zu Ressourcen erst gemacht werden mussten, wurden nun Gewinn- und Verlustrechnungen gemacht.40
Die wachstumskritische Ökologische Ökonomik formulierte ein Protokonzept der Nachhaltigkeit im Gedanken der Suffizienz. Durch korrekte preisliche Abbil-dungen der Rohstoffextraktion, der Warenströme und sämtlicher Rückstände sollte der Naturkapitalbestand für zukünftige Generationen erhalten bleiben; verbraucht werden sollten allein die Zinsen.41 Demgegenüber trieb die Umwelt- oder Ressour-cenökonomik die Tradition der Inventarisierung natürlicher Rohstoffe primär mit dem Ziel voran, Wachstumsmöglichkeiten durch Effizienzgewinne zu erhalten. Suf-fizienz- und Effizienzziele lagen gleichwohl eng beieinander. Beide Ausrichtungen der Ökonomik erfassten Umwelt mit Instrumenten der mathematischen Kalkulation und des ökonomischen Kalküls, beide verbanden numerische Datenverarbeitung, Statistik und Probabilistik mit Instrumenten der Verpreisung und Verzinsung, der Ertragsrechnungen und der Kosten-Nutzen-Analysen.
Die 1980er Jahre markieren eine Zäsur im sozial-ökologischen Diskurs: Das Pro-gramm der Nachhaltigen Entwicklung, 1987 von der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung formuliert,42 war nicht in erster Linie wachstumskritisch, sondern auf nachhaltiges ökonomisches Wachstum ausgelegt. Dennoch war es in seiner in-ter- und intragenerationellen Dimension normativ. Seine Vorgaben mündeten in regionale, nationale und globale Soll-Ist-Abgleiche: Indikatorensets repräsentieren seither die immer detailreicheren Erfassungen und ausgreifenden Bemessungen aller gesellschaftlichen und umweltlichen Bereiche. Mit den neuen rechtlichen Rahmun-gen und Verfahren, zum Beispiel in der Form der Umweltfolgenabschätzungen und -verträglichkeitsprüfungen, entstand eine neue Expertenkultur, die präskriptiv und prädiktiv zugleich vorging.
Das Instrument der „Ökobilanz“ stellte die Äquivalenz quantitativer ökologischer Daten und ebenso hochaggregierter Wohlstandsindikatoren wie dem Bruttosozialpro-dukt (BSP) her, um Bestand und Verbrauch bilanzierbar zu machen. Instrumente wie die Materialflussanalyse43 oder der Ökologische Fußabdruck44 aggregierten irdische Bestände und konvertierten sie in Einheiten der Masse oder Fläche, um die „Schul-den“ des Menschen der Erde gegenüber zu visualisieren. Das Bilanzieren war auch dem Programm der Ökologischen Modernisierung aus den frühen 1980er Jahren eingeschrieben, das „Ökoeffizienz“ durch wirtschaftlichere Rohstoffnutzung und technische Innovation anstrebte und die Möglichkeit einer Versöhnung von Ökologie und Ökonomie verhieß.45
Die ökonomische Rationalität legte die Vorstellung nahe, dass sich Naturverbräuche monetär nicht nur bemessen, sondern auch begleichen ließen. Die Parität von Natur- und Finanzkapital besagte schließlich auch, dass sich Umwelteingriffe dem Prinzip der Gesamtrechnung folgend nicht nur durch eine wiederhergestellte Natur, sondern auch finanziell substituieren ließen, sofern die Kostenäquivalente korrekt beziffert seien. Solche Kompensationsinstrumente werden seit rund zehn Jahren im Handel mit Emissionen bzw. Verschmutzungsrechten für den Klimaschutz erprobt.46 Ein anderes aktuelles Beispiel betrifft die Flächeneingriffs- und Ausgleichsregelungen in der Stadt- und Landschaftsplanung sowie die Einrichtung regionaler „Flächenagenturen“, die Maßnahmen zur Kompensation von bebauten und versiegelten Flächen anbieten.47
© 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Einleitung
Ber. Wissenschaftsgeschichte 37 (2014) 8 – 19 15
Die in der Umweltpolitik der 1980er und 1990er Jahre geschaffenen neuen Märkte setzen nicht auf Knappheit, sondern auf Fülle – eine Entwicklung, die als Neolibe-ralisierung der Natur bezeichnet worden ist.48 Der Stern-Report empfahl 2006 die Ausarbeitung neuer Wohlstandsmodelle, um den Umgang mit der irdischen Natur unter Bedingungen des globalen Klimawandels zu organisieren. Die Studie deutete den Klimawandel als eine Folge von Marktversagen, könnten doch wenige Verursa-cher dessen Kosten als negative Externalität auf viele Betroffene abwälzen.49 Unter fortgesetzten Bedingungen der Unsicherheit empfiehlt die Studie das Vorsorgeprinzip des Versicherungswesens als probates Mittel gegen die Diskontierung bzw. Abzinsung der Zukunft. Erneut jedoch liegt eine Ambivalenz in der ökonomischen Strategie, Prämienzahlungen zugunsten der Umwelt der Zukunft zu leisten. Dem Stern-Modell folgend könnte es sich nämlich für Rückversicherungsunternehmen ökonomisch ‚rechnen‘, in die finanzielle Haftpflicht für zukünftige Klimaschäden zu treten, statt gegenwärtig in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren.
Ressourcenökonomie, Erdölpolitik und Biodiversitäts-Portfolio-Management – Ausblick auf die Beiträge
Die drei Beiträge des Hefts problematisieren die hier skizzierten ökonomisierenden Naturmodellierungen in konkreten Fallstudien. Ziel ist es, die Zusammenhänge von Wissenschaft und Ökonomie um die Perspektive einer wissenschaftlich-ökono-mischen Zurichtung der Natur zu erweitern. Es werden Fragen nach taxierenden, klassifizierenden und monetarisierenden Zugängen zur Natur gestellt und deren Deutungsmacht in spezifischen historischen Anwendungskontexten diskutiert. Die Wissensangebote der involvierten „Wissenschaften der Ressourcen“ Geologie, Ökologie und Ökonomie sollen auf gesellschaftliche Problemlagen, technologi-sche Entwicklungen und internationale Politik bezogen werden. Im Zentrum stehen keine innerwissenschaftlichen Methodendiskussionen oder rein wissenschaftliche Akteurslandschaften, sondern die Reichweite und der Transfer wissenschaftlicher Wissensbestände in konkreten Handlungszusammenhängen.
Andrea Westermann geht anhand der Geschichte der Rohstoffschätzungen für metallische Rohstoffe im späten 19. und 20. Jahrhundert der Frage nach, wie die Erdwissenschaften zwischen natürlicher und sozialer Welt vermittelten. Geologen griffen für die Bestimmung der Größe und Reichweite von Rohstoffvorkommen schon früh auf sozialwissenschaftliches, insbesondere ökonomisches Wissen zu-rück. Nach 1900 wurden Rohstoffvorratsziffern auf nationaler und internationaler Ebene zu politisch und wirtschaftlich neu nachgefragten Größen. Es etablierte sich über die „Bergwirtschaftslehre“ oder ‚mineral economics‘ allmählich die moderne Ressourcenökonomie, deren Schätzungen die traditionelle betriebswirtschaftliche Be-stimmung von Erzreserven für einzelne Minen oder Bergbauunternehmen ergänzten. Diese weitere Verwirtschaftswissenschaftlichung der Ressourcenschätzung wird an der Arbeit der 1951 von US-Präsident Harry S. Truman eingesetzten Materials Policy Commission für die USA herausgearbeitet. Die Ressourcen- und wenig später auch die Umweltökonomie können als kollektive Strategie aufgefasst werden, der Erde als übergroßem und holistisch begriffenem Untersuchungsgegenstand der Geowis-senschaften einen disziplinenübergreifenden, dabei gesellschaftsorientierten Ansatz zu ihrer Erfassung und Bewirtschaftung entgegenzustellen.
Lea Haller, Sabine Höhler, Andrea Westermann
© 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Ber. Wissenschaftsgeschichte 37 (2014) 8 – 1916
Lea Haller und Monika Gisler untersuchen in ihrem Beitrag das politisch diffizile Verhältnis von Knappheit und Überschuss natürlicher Ressourcen am Beispiel der Erdölsuche in der Schweiz zwischen 1930 und 1960. Denn entgegen der Suggestions-kraft ökonomischer Begriffe hat man es bei Knappheit und Überschuss nicht mit einem quantitativen Problem zu tun, sondern mit einem politischen. Mit dem Argument möglicher Knappheit ließen sich Abhängigkeitsängste und Autarkiebestrebungen bedienen. Vor allem die Lobby der infolge der Wirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre aus dem Ausland heimgekehrten Erdölgeologen machte sich das Knappheits-argument zu eigen, um Erkundungen im heimischen Untergrund zu forcieren. Um-gekehrt hätte ein Auffinden großer Erdölreserven – für das die Bedingungen in der Molassezone des Mittellandes so vielversprechend schienen, dass auch ausländische Erdölgesellschaften Konzessionen erwarben und Bohrungen abteuften – unweigerlich die Frage nach dem „Ausverkauf der Heimat“ nach sich gezogen. Die Hoffnung, auf heimisches Erdöl zu stoßen, um vom Ausland unabhängig zu werden, war nicht weit von der Angst entfernt, man könnte als zukünftiger Petroleumstaat geopolitisches Objekt fremder Gelüste werden.
Sabine Höhler untersucht anhand der Geschichte des Biodiversitätskonzeptes, wie der Erhalt der Artenvielfalt der Erde von einem konservatorischen zu einem ökonomischen Gebot wurde. Spätestens seit der Unterzeichnung der Biodiversitäts-konvention der Vereinten Nationen im Jahre 1992 gilt Diversität als Bedingung für das Überleben der Natur und des Menschen unter immer unsichereren Verhältnissen globaler Umweltveränderungen. Der Beitrag argumentiert, dass Biodiversität nicht in erster Linie um der Vielfalt Willen erhalten wird, als ein Motor, der beständig neue Vielfalt generiert und damit die Systemfunktionen der Natur antreibt. Diese Natur wird als Serviceeinrichtung betrachtet, die Ökosystemdienstleistungen und -güter für den Menschen bereitstellt. Ein Beispiel für das neue umweltökonomi-sche Biodiversitätsmanagement ist die Portfolio-Theorie, die Biodiversifizierung als eine Investmentstrategie nahelegt. Diversität sei am besten zu verwalten und zu optimieren, wenn Ökosysteme als Portfolio aufgefasst und gemäß den Regeln der Finanzwirtschaft verwaltet würden: Falls clever investiert und desinvestiert werde, könnten Risiken diversifiziert und Verluste minimiert werden, ließen sich Gewinne optimieren und eine möglichst große Reaktionsbreite des Ökosystems erzielen. Die „New Economy of Nature“, die sich dem Ziel des Naturerhalts durch marktförmige Lösungen verschrieben hatte, hat damit den kritischen Begriff des Naturkapitals erneut gewendet – in eine Ressource des Investmentbankings.
1 Friedrich List, Das nationale System der politischen Ökonomie, Stuttgart: Cotta 1841, S. 272. 2 Ralf Döring, Walras ‚erfindet‘ Naturkapital. Naturkapital in der Geschichte der Kapitaltheorie bis
zur Neoklassik, in: Tanja von Egan-Krieger, Julia Schultz, Philipp Pratap, Lieske Voget (Hrsgg.), Die Greifswalder Theorie starker Nachhaltigkeit. Ausbau, Anwendung und Kritik, Marburg: Metropolis 2009, S. 143 – 158.
3 David Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, London: John Murray 1821 [1817], S. 33.
4 Tore Frängsmyr, John L. Heilbron, Robin E. Rider (Hrsgg.), The Quantifying Spirit in the 18th Century, Berkeley: University of California Press 1990.
5 Anne-Charlott Trepp, Von der Glückseligkeit alles zu wissen. Die Erforschung der Natur als religiöse Praxis in der frühen Neuzeit, Frankfurt a.M.: Campus 2009, S. 306 – 372.
© 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Einleitung
Ber. Wissenschaftsgeschichte 37 (2014) 8 – 19 17
6 Carl von Linné, Oeconomia Naturae, Uppsala: Martii 1749; derselbe, Systema Naturae, Stockholm: L. Salvius 1758; Donald Worster, Nature’s Economy. The Roots of Ecology, San Francisco: Sierra Club Books 1977.
7 Anke te Heesen, Accounting for the Natural World: Double-Entry Bookkeeping in the Field, in: Londa Schiebinger, Claudia Swan (Hrsgg.), Colonial Botany: Science, Commerce, and Politics in the Early Modern World, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2005, S. 237 – 251.
8 Karl Heinrich Rau, Die Kameralwissenschaft. Entwicklung ihres Wesens und ihrer Theile, Heidelberg: Universitäts-Buchhandlung E.F. Winter 1825.
9 Verwaltung, in: Zedler Grosses Vollständiges Universallexicon aller Wissenschaften und Künste, Bd. 48, Halle/Leipzig: Zedler 1746, Sp. 125.
10 Torsten Meyer, Risikoperzeptionen und Sicherheitsversprechen – Wirtschaftswachstum, Rohstoffe und Technik im staatswissenschaftlichen Diskurs des ausgehenden 18. Jahrhunderts, Münster: Waxmann 1999; Marcus Popplow, Economizing Agricultural Resources in the German Economic Enlightenment, in: Ursula Klein, Emma C. Spary (Hrsgg.), Materials and Expertise in Early Modern Europe. Between Market and Laboratory, Chicago: University of Chicago Press 2009, S. 261 – 287.
11 Hannß Carl von Carlowitz, Sylvicultura Oeconomica, Oder Hausswirthliche Nachricht und Naturmäßi-ge Anweisung zur Wilden Baum-Zucht, Faksimile Reproduktion der 2. Auflage Leipzig: Braun 1732, Remagen-Oberwinter: Kessel 2009 [1713]. Henry E. Lowood, The Calculating Forester: Quantification, Cameral Science, and the Emergence of Scientific Forestry Management in Germany, in: Frängsmyr, Heilbron, Rider, The Quantifying Spirit (wie Anm. 4), S. 315 – 342.
12 Richard Hölzl, Umkämpfte Wälder. Die Geschichte einer ökologischen Reform in Deutschland 1760 bis 1860, Frankfurt a.M.: Campus 2010.
13 Emily Pawley, Accounting with the Fields: Chemistry and Value in Nutriment in American Agricultural Improvement, 1835 – 1860, Science as Culture 19 (2010), Special Issue Nature’s Accountability, hrsgg. von Sabine Höhler und Rafael Ziegler, S. 461 – 482, zur Improvement-Bewegung S. 463.
14 Theodore M. Porter, Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, Princeton, New Jersey: Princeton University Press 1995.
15 James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New Haven: Yale University Press 1998.
16 Der im frühen ,Conservation Movement‘ der USA geprägte holistische Begriff der natürlichen Ressourcen, der den Kollektivsingular des Naturkapitals pluralisierte, fand hier seine praktische Begründung. Richard Ely, Ralph H. Hess, Charles K. Leith (Hrsgg.), The Foundations of National Prosperity. Studies in the Conservation of Permanent National Resources, New York: The MacMillan Company 1917.
17 Vgl. demnächst Andrea Westermann, Historical Social Research (im Erscheinen, 2014).18 Friedrich Beyschlag, Entwurf einer neuen, wirtschaftlichen Eisenerzinventur, in: Congrès géologique
international (Hrsg.), Compte rendu de la 11e session du congrès géologique international, Stockholm 1910, Stockholm: P.A. Norstedt & Söner 1912, S. 315 – 319, hier S. 316; vgl. William P. Rawles, The Nationality of Commercial Control of World Minerals, New York: American Institute of Mining and Metallurgical Engineers 1933.
19 Kevin O’ Rourke, Jeffrey G. Williamson, Globalization and History. The Evolution of a Nineteenth- Century Atlantic Economy, Cambridge, Massachusetts: MIT Press 1999, S. 33 – 53.
20 Für Deutschland wurde darüber hinaus ganz allgemein die Verbesserung der makroökonomischen Datenlage über eine Reform der amtlichen Statistik angestrebt, vgl. Adam Tooze, Statistics and the German State 1900 – 1945, Cambridge: Cambridge University Press 2001, S. 76 – 102.
21 Charles K. Leith, International Control of Minerals, in: U.S. Geological Survey (Hrsg.), Mineral resources of the United States 1917, Washington D.C.: Government Printing Office 1918, S. 7A–16A, hier S. 16A.
22 Ferdinand Friedensburg, Die mineralischen Bodenschätze als weltpolitische und militärische Macht-faktoren, Stuttgart: Enke Verlag 1936, S. 50; George Otis Smith (Hrsg.), The Strategy of Minerals. A Study of the Mineral Factor in the World Position of America in War and Peace, New York/London: D. Appleton and Company 1919; Elmer Walter Pehrson (Hrsg.), The Mineral Position of the United States and Outlook for the Future, Washington: U.S. Government Printing Office 1946.
23 Für politische Initiativen, die auf eine laufende Übersicht über internationale Reserven und Produkti-onsziffern angewiesen waren, etwa: Thomas Holland, The Mineral Sanction as an Aid to International Security, Edinburgh/London: Oliver and Boyd 1935; Frank Macy Surface, Raymond L. Bland, Amer-ican Food in the World War and Reconstruction Period: Operations of the Organizations under the
Lea Haller, Sabine Höhler, Andrea Westermann
© 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Ber. Wissenschaftsgeschichte 37 (2014) 8 – 1918
Direction of Herbert Hoover, 1914 to 1924, Palo Alto: Stanford University Press 1931; Max Krahmann, Bergwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft. Eine Programmschrift, Berlin: Kurt Vowinckel Verlag 1928.
24 Charles K. Leith, The Economic Aspects of Geology, New York: Henry Holt and Company 1921, S. 63.25 Harold Hotelling, The Economics of Exhaustible Resources, Journal of Political Economy 39 (1931),
137 – 175, hier S. 137. 26 Hotelling, The Economics (s. Anm. 25), S. 140.27 Hotelling, The Economics (s. Anm. 25), S. 143.28 Hotellings Überlegungen wurden erst mit der aufkommenden Ressourcenökonomik ab den 1960er
Jahren und vor allem mit dem Ölpreisschock von 1973/74 breit rezipiert, als das Interesse an Modellen, die reale Preisschwankungen voraussagen konnten, rasant anstieg. Das Hotelling-Theorem stellte sich im 20. Jahrhundert als doppelt paradox heraus: Erstens nahm die verfügbare Rohstoffbasis auch mit zunehmender Förderung nicht ab, sondern zu; zweitens konnten die Preise aufgrund geopolitischer Problemlagen rasant und völlig unerwartet in die Höhe schnellen.
29 Edward S. Mason, American Security and Access to Raw Materials, World Politics 1 (1949), 147 – 160, hier S. 153.
30 Erich Zimmermann, World Resources and Industries. A Functional Appraisal of the Availability of Agricultural and Industrial Resources, New York: Harper & Brothers 1933, S. 24 – 37; Paul Sabin, The Bet: Paul Ehrlich, Julian Simon, and Our Gamble over Earth’s Future, New Haven: Yale University Press 2013.
31 William Stanley Jevons, The Coal Question: an Inquiry Concerning the Progress of the Nation and the Probable Exhaustion of Our Coal-Mines, London/Cambridge: Macmillan and Co. 1865.
32 Raul Prebisch, The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, New York: United Nations 1950, S. 1.
33 Nico Schrijver, Development Without Destruction. The UN and Global Resource Management, Bloo-mington: Indiana University Press 2010.
34 UNCTAD (Hrsg.), World Investment Report, New York 2007: http://unctad.org/en/docs/wir2007_en.pdf, S. 108.
35 John E. Tilton, The choice of trading partners: An analysis of international trade in aluminium, baux ite, copper, lead, manganese, tin, and zinc, Yale Economic Essays 6 (1966), 416 – 474; Michael Tanzer, The Race for Resources. Continuing Struggles over Minerals and Fuels, New York: Monthly Review Press 1980; Louis T. Jr. Wells, Minerals: eroding oligopolis, in: David B. Yoffie (Hrsg.), Beyond free trade: firms, governments, and global competition, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press 1993, S. 335 – 386.
36 Joachim Radkau, Die Ära der Ökologie: Eine Weltgeschichte, München: C.H. Beck 2011.37 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, William W. Behrens, The Limits to Growth.
A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, London: Earth Island 1972; Edward Goldsmith, Robert Allen, Michael Allaby, John Davoll, Sam Lawrence, A Blueprint for Survival, London: Tom Stacey 1972.
38 Science as Culture 19 (2010), 4, Special Issue Nature’s Accountability, hrsgg. von Sabine Höhler und Rafael Ziegler.
39 Inge Røpke, The Early History of Modern Ecological Economics, Ecological Economics 50 (2004), 293 – 314.
40 Kenneth E. Boulding, The Economics of the Coming Spaceship Earth, Baltimore: Johns Hopkins Press 1966; Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, Science 162 (1968), 1243 – 1248.
41 Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press 1971; Herman E. Daly (Hrsg.), Economics, Ecology, Ethics: Essays Toward a Steady-State Economy, San Francisco: W. H. Freeman and Company 1980; Wouter van Dieren (Hrsg.), Taking Nature into Account: A Report to the Club of Rome, New York: Springer 1995; Robert Constanza et al., The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital, Nature 387 (1997), 253 – 260.
42 World Commission on Environment and Development (Hrsg.), Our Common Future, Oxford/New York: Oxford University Press 1987.
43 Marina Fischer-Kowalski, Society’s Metabolism. The Intellectual History of Materials Flow Analysis, Part I, 1860 – 1970, Journal of Industrial Ecology 2 (1998), 61 – 78.
44 Mathis Wackernagel, William Rees, Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth,
Gabriola Island, British Columbia: New Society Publishers 1996.45 Arthur P.J. Mol, Globalization and Environmental Reform: The Ecological Modernization of the Global
Economy, Cambridge, Massachusetts: MIT Press 2001.
© 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Einleitung
Ber. Wissenschaftsgeschichte 37 (2014) 8 – 19 19
46 Mart A. Stewart, Swapping Air, Trading Places. Carbon Exchange, Climate Change Policy, and Natu-ralizing Markets, Radical History Review 107 (2010), 25 – 43.
47 Jens Lachmund, Greening Berlin: The Co-Production of Science, Politics, and Urban Nature, Cambridge, Massachusetts/London: MIT Press 2013.
48 Noel Castree, Neoliberalising Nature: The Logics of Deregulation and Reregulation, Environment and Planning A 40 (2008b), 131 – 152; derselbe, Neoliberalising Nature: Processes, Effects, and Evaluations, Environment and Planning A 40 (2008a), S. 153 – 173.
49 Nicholas Stern, The Economics of Climate Change. The Stern Review, Cambridge, Massachusetts: Cambridge University Press 2006.
Anschriften der Verfasserinnen: Dr. Lea Haller, Harvard University, Minda de Gunzburg Center for European Studies, 27 Kirkland Street, Cambridge, MA-02138, USA, E-Mail: [email protected] / ETH Zürich, Institut für Geschichte, Clausiusstrasse 59, CH-8092 Zürich, E-Mail: [email protected] − Sabine Höhler, KTH Royal Institute of Technology, Division of History of Science, Technolo-gy and Environment, Teknikringen 76, SE-10044 Stockholm, E-Mail: [email protected] − Dr. Andrea Westermann, Universität Zürich, Historisches Seminar, Karl Schmid-Strasse 4, CH-8006 Zürich, E-Mail: [email protected]