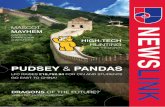Herxheim bei Landau – Bandkeramik außerhalb der Grubenanlage
Transcript of Herxheim bei Landau – Bandkeramik außerhalb der Grubenanlage
Herausgegeben vom
Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz
in Verbindung mit dem
Präsidium der deutschen Verbände für Archäologie
Sonderdruck aus
ArchäologischesKorrespondenzblatt
Jahrgang 42 · 2012 · Heft 1
Diese pdf-Datei ist nur zum persönlichen Verteilen bestimmt. Sie darf bis März 2014 nicht auf einer Homepage im Internet eingestellt werden.
This PDF is for dissemination on a personal basis only. It may not be published on the world wide web until Marach 2014.
Ce fichier pdf est seulement pour la distribution personnelle. Jusqu’à mars 2014 il ne doit pas être mis en ligne sur l’internet.
Paläolithikum, Mesolithikum: Michael Baales · Nicholas J. Conard
Neolithikum: Johannes Müller · Sabine Schade-Lindig
Bronzezeit: Christoph Huth · Stefan Wirth
Hallstattzeit: Markus Egg · Dirk Krauße
Latènezeit: Rupert Gebhard · Hans Nortmann · Martin Schönfelder
Römische Kaiserzeit im Barbaricum: Claus v. Carnap-Bornheim · Haio Zimmermann
Provinzialrömische Archäologie: Peter Henrich · Gabriele Seitz
Frühmittelalter: Brigitte Haas-Gebhard · Dieter Quast
Wikingerzeit, Hochmittelalter: Hauke Jöns · Bernd Päffgen
Archäologie und Naturwissenschaften: Felix Bittmann · Joachim Burger · Thomas Stöllner
Die Redaktoren begutachten als Fachredaktion die Beiträge (peer review).
Das Archäologische Korrespondenzblatt wird im Arts & Humanities Citation Index®
sowie im Current Contents®/Arts & Humanities von Thomson Reuters aufgeführt.
Übersetzungen der Zusammenfassungen (soweit gekennzeichnet): Loup Bernard (L. B.)
und Manuela Struck (M. S.).
Beiträge werden erbeten an die Mitglieder der Redaktion oder an das
Römisch-Germanische Zentral museum, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz, [email protected]
Die mit Abbildungen (Strichzeichnungen und Schwarz-Weiß-Fotos), einer kurzen Zusammenfassung und der
genauen Anschrift der Autoren versehenen Manuskripte dürfen im Druck 20 Seiten nicht überschreiten. Die
Redaktion bittet um eine allgemein verständ liche Zitierweise (naturwissenschaftlich oder in Endnoten) und
empfiehlt dazu die Richtlinien für Veröffentlichungen der Römisch-Germanischen Kommis sion in Frankfurt a.M.
und die dort vorgeschlagenen Zeitschriftenabkürzungen (veröffentlicht in: Berichte der Römisch- Ger ma nischen
Kommission 71, 1990 sowie 73, 1992). Hinweise für Autoren finden sich in Heft 1, 2009, S. 147ff.
ISSN 0342-734X
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages
© 2012 Verlag des Römisch-Germanischen ZentralmuseumsRedaktion und Satz: Manfred Albert, Hans Jung, Marie Röder, Martin SchönfelderHerstellung: gzm Grafisches Zentrum Mainz Bödige GmbH, Mainz
Das für diese Publikation verwendete Papier ist alterungsbeständig im Sinne der ISO 9706.
REDAKTOREN
SANDRA FETSCH
HERXHEIM BEI LANDAU –
BANDKERAMIK AUSSERHALB DER GRUBENANLAGE
In den vergangenen Jahren haben die linienbandkeramischen Funde auf der Gemarkung Herxheim
(Lkr. Süd liche Weinstraße) die Forschung zum Neolithikum nachhaltig beeinflusst. Grund dafür sind die
Untersuchungen an der für die Bandkeramik Mitteleuropas (LBK) bislang einzigartigen Grubenanlage von
Herxheim, Gewerbegebiet »West«, die im Rahmen des von der DFG geförderten Projekts »Bandkeramische
Sied lung mit Grubenanlage von Herxheim bei Landau (Pfalz)« durchgeführt werden (vgl. Zeeb-Lanz u. a.
2006; Zeeb-Lanz u. a. 2007; Zeeb-Lanz 2009; Boulestin u. a. 2009; Jeunesse 2011). Die Forschung an die -
sem Fundplatz zog bereits eine ganze Reihe von Arbeiten nach sich, die sich unmittelbar mit der Gruben-
anlage selbst oder mit Siedlungsaktivitäten im näheren und weiteren Umfeld befassen, und belebte damit
die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser frühesten Ackerbauernkultur im südlichen Rheinland-
Pfalz (z. B. Schmidt 2000; Haack 2002; Schimmelpfennig 2004; Bauer 2008; Houbre 2008; Häussler 2009).
Die bislang unpublizierte Magisterarbeit der Autorin (Fetsch 2008) behandelt das bandkeramische Material
der Gemarkung Herxheim außerhalb des Erdwerks, mit einem Schwerpunkt auf der Keramik und der aus
ihrer Analyse resultierenden relativchronologischen Einordnung von Funden und Fundstellen.
Belege für die Siedlungsaktivitäten frühneolithischer Menschen auf der Herxheimer Gemarkung waren
schon vor Beginn der jüngsten Forschungen hinlänglich bekannt, da ehrenamtliche Mitarbeiter der Gene-
ral direktion Kulturelles Erbe (GDKE), Amt Speyer 1, seit etwa 40 Jahren regelmäßig Prospektionen durch-
führen und Bautätigkeiten beobachten. Die von ihnen zusammengetragenen Lesefunde bilden einen ele -
men taren Bestandteil des Materials für die bereits erwähnte Magisterarbeit. Einen weiteren lieferte die
Grabung der GDKE Speyer im Gewerbegebiet »West« von 1995 bis 2001 (vgl. Tschocke 2001; Münzer /
Bern hard 2003). Diese Maßnahme deckte etwa 300-400m vom Rand der Grubenanlage entfernt eine
stellenweise dichte Streuung bandkeramischer Befunde auf (in den Ortsakten der GDKE ist das Areal als
Fundstelle [FS] 17 geführt). Zentrales Thema dieses Beitrags sind die Untersuchungsergebnisse der Ma -
gister arbeit zu den Siedlungsaktivitäten an FS17, mit einem Ausblick auf die direkte Umgebung.
GEOGRAPHISCHE LAGE UND TOPOGRAPHIE
Die Gemeinde Herxheim liegt in der pfälzischen Rheinebene mit einer Distanz zum Rhein von etwas mehr
als 10km. In westlicher Richtung erhebt sich, ca.15km entfernt, der von Buntsandstein geprägte Mittel -
gebirgszug des Pfälzer Waldes. Eine Reihe von Lössrücken, sogenannten Riedeln, die sich vom Pfälzer Wald
in Richtung Rhein erstrecken, charakterisiert die Morphologie der Landschaft im Rheintal und auch die der
Gemarkungsfläche. Hier schneidet zwischen einem mächtigeren Riedel im nördlichen Bereich und einem
schwächer ausgeprägten im Süden die flache Talwanne des im Laufe der vergangenen Jahrhunderte begra-
digten Klingbaches ein (Abb.1). Kleinräumig sorgen zwei in Nord-Süd-Richtung verlaufende Bäche für die
Entwässerung des größeren, nördlichen Riedels, der zwischen dem westlichen Ortsrand und der Gruben-
anlage befindliche Schambach und weiter westlich der Quodbach. Heute werden die Lössflächen sowie ein
Anteil des Klingbachtals als Äcker genutzt. Weite Teile der Schwemmflächen sind hingegen von Wald
15Archäologisches Korrespondenzblatt 42 · 2012
bedeckt. Das bebaute Ortsgebiet erstreckt sich vom nördlichen Lössrücken bis in den Auebereich. Auf dem
südlichen, kleineren Riedel liegt der Ortsteil Hayna mit seinen angrenzenden Ackerflächen.
Die Region bietet sowohl durch die fruchtbaren Lössböden als auch durch vorteilhafte klimatische Bedin-
gungen sehr gute Voraussetzungen für eine landwirtschaftliche Nutzung. Dies dürfte der ausschlag -
gebende Faktor für eine nahezu kontinuierliche Besiedlung durch viele vor- und frühgeschichtliche Phasen
seit dem Beginn des Neolithikums gewesen sein (Münzer / Bernhard 2003, 164). Die infolgedessen zu
erwartende Erosion hat auch die Ausgrabungsfläche Gewerbegebiet »West« deutlich geprägt. Erosions-
rinnen (Häußer 2001, 63) 2 und ein bis zu 1,3m mächtiges Kolluvium am Fuß des leicht nach Südosten
abfallenden Grabungsareals reduzieren die Befundmächtigkeit und die Menge der überlieferten bzw.
grabungstechnisch erfassbaren Befunde. Auch der bis in die Neuzeit im unmittelbaren Umfeld der band-
16 S. Fetsch · Herxheim bei Landau – Bandkeramik außerhalb der Grubenanlage
Abb. 1 Streuung der bekannten archäologischen Fundstellen auf der Gemarkung Herxheim (Lkr. Südliche Weinstraße) (weiße Linie). – A Fundstelle 14. – B Fundstellenkomplex 02/22/23. – C Fundstelle 17. – Helle Flächen: Löss; dunkle Flächen: Niederterrassen, Aue- undSchwemmbereiche; schraffiert: bebaute Flächen (oben Herxheim, unten Ortsteil Hayna). – Eingezeichneter Ausschnitt: Detail für Abb. 8. –(Graphik S. Fetsch).
keramischen Hinterlassenschaften erfolgte Tonabbau dürfte sowohl bei Veränderungen des Landschafts -
reliefs als auch bei der Befunderhaltung eine wichtige Rolle gespielt haben 3.
Die meisten archäologischen Funde konzentrieren sich heute auf die Westhälfte des nördlichen Lössrückens
– ein Verteilungsmuster, das wohl zu einem erheblichen Teil eine Folge der Fundüberlieferung und Ge -
ländezugänglichkeit ist, denn die Flächen höchster Fundstellendichte korrelieren mit den regelmäßig
gepflügten und gut begehbaren Äckern sowie mit den bebauten Arealen (Abb.1).
ÜBERSICHT FUNDSTELLE 17
Die ca.1,8ha große Ausgrabungsfläche Gewerbegebiet »West« wurde von 1995 bis 2001 im Vorfeld von
Bautätigkeiten untersucht. Die bandkeramischen Gruben machen in der Gesamtmenge der archäologi-
schen Befunde nur einen verhältnismäßig geringen Anteil aus, umfassen allerdings auch Abschnitte der
Grubenanlage (Münzer / Bernhard 2003, Abb.112). Aufgrund des noch laufenden DFG-Projektes können
die das Erd werk betreffenden Aspekte lediglich ansatzweise in die Interpretation einfließen. Die geringe
räumliche Dis tanz von knapp 0,5km zwischen den beiden Fundstellen sollte jedoch nicht außer Acht
gelassen werden.
FS17 liegt am westlichen Rand der heute überbauten Dorffläche, am leicht geneigten Südhang, auf
ca.130m ü.NN, im Übergangsbereich des nördlichen Lössrückens in die Klingbachtalaue. Etwa 150m
südwestlich tritt das leicht schwefelhaltige Wasser der Quelle »Eierbrünnel« aus. Die Entfernung zum Kling-
bach beträgt heute ca. 375m, die Distanz zum Quodbach im Westen und zum Schambach im Osten liegt
ebenfalls <1km .
BANDKERAMISCHE BEFUNDE
Zur Identifikation bandkeramischer Gruben diente in erster Linie die verzierte Keramik. Befunde, die auf -
grund relativ charakteristischer unverzierter Ware oder wegen ihrer Lage in Relation zu anderen archäo -
logischen Strukturen (z. B. die Befunde 4566 oder 4323 und 4324) als wahrscheinlich bandkeramisch ange-
sprochen werden können, sind im Plan (Abb. 2) mit einer hellgrauen Kontur dargestellt 4. Die Erosion führte
dazu, dass viele Gruben nur noch wenige Zentimeter tief erhalten waren. Man kann davon ausgehen, dass
weitere Befunde vollkommen zerstört wurden. Betrachtet man die Verteilung der Gruben in der Fläche, so
zeigt sich, dass einige offenbar zusammenhanglos über das Areal streuen; die meisten konzentrieren sich
jedoch auf einen Bereich von ca.70×70m, der in Abbildung 2 dargestellt ist.
Die Gruben bilden hier u. a. vier weitgehend parallele, Südost-Nordwest orientierte Achsen (Ausrichtung
zwischen 30 und 40° West), deren mittlerer Abstand je ca. 10-12m beträgt. Diese Gruben weisen überwie-
gend unregelmäßige Umrisse und sehr unterschiedliche Größen auf. Ihre Form und die Abstände sprechen
dafür, dass es sich um teilweise voneinander abgesetzte Reste hausbegleitender Längsgruben handelt.
Weitere Strukturen, die dem Grundriss dieser Gebäude zuzuordnen sind, lassen sich nicht eindeutig greifen.
Die im Plan aufgrund ihrer runden bzw. ovalen Form an Pfostengruben erinnernden Befunde 4326 und
4389 sind mit einem Durchmesser von 1,40m bzw. 1,10×0,80m für Pfostengruben allerdings verhältnis-
mäßig groß. Pfostenstandspuren sind bei beiden Gruben nicht dokumentiert und auch ihre Lokalisation
oder Anordnung erlaubt keine sichere Identifikation als Pfostengruben.
Nördlich der Längsgrubenreihen befindet sich in ca. 20m Abstand zur östlichsten der Reihen ein größerer
Grubenkomplex, bestehend aus elf unregelmäßig geformten Gruben, die sich gegenseitig überlappen, und
17Archäologisches Korrespondenzblatt 42 · 2012
acht weiteren, die in unmittelbarer Nähe südlich davon streuen 5. Zu diesem Komplex gehören auch drei
Kesselgruben (Befunde 4109, 4243 und 4246). Die übrigen Befunde verteilen sich entweder vereinzelt oder
in kleinen unstrukturierten Grüppchen über die Fläche. Nahe dem westlichen Gebäude ist eine Schlitzgrube
dokumentiert (Befund 4478).
Die Distanzen zwischen den Längsgrubenreihen sprechen für eine Hausbreite von ca. 5-6m und für einen
Abstand zwischen den Häusern von etwa 10m. Die Hauslänge ist, da Pfostenstellungen fehlen, nur sehr
vage an den Resten der Längsgruben abzuschätzen. Angesichts letzterer wäre auch ein trapezförmiger
Grundriss vorstellbar, da sich der Abstand der zusammengehörigen Grubenreihenpaare nach Norden hin
etwas zu verjüngen scheint. Allerdings kann dieser Eindruck durch die rudimentäre Befunderhaltung ver -
fälscht sein. Für das östliche Gebäude ist eine Länge von >15m anzunehmen. Orientiert man sich für die
Abschätzung der Maße beim westlichen Bau an den Befunden 4381 und 4352, würde sich eine Länge von
ca.30m ergeben. Die Befundlage erlaubt keine weiteren Rückschlüsse auf die Innengliederung der
Gebäude oder auf Wandkonstruktionen.
Trotz einiger nicht zu klärender Fragen wurde anhand der interpretierbaren Strukturen ein Rekonstruktions-
vorschlag für Gebäudegrundrisse eingefügt (vgl. Abb. 2). Dabei wurde um die Häuser ein Aktionsradius
von 25m ergänzt, wie ihn Boelicke (1982, 18-19) anhand der Untersuchung des Fundplatzes Langweiler 8
18 S. Fetsch · Herxheim bei Landau – Bandkeramik außerhalb der Grubenanlage
Abb. 2 Übersichtsplan der band -keramischen Befunde von FS17 in derGemarkung Herxheim (Lkr. SüdlicheWeinstraße) aus der Grabungs -kampagne 2001 mit angedeutetenHausgrundrissen und Aktionsradien(schraffiert: Kesselgruben; hellgrau:wahrscheinlich bandkeramischeBefunde). Vereinzelt streuen nochweitere Gruben außerhalb desdargestellten Bereichs von FS17. –(Graphik F. Haack / S. Fetsch).
(Kr. Düren) für bandkeramische Höfe vorschlug. Diese Skizze dient in erster Linie der Veranschaulichung des
geringen Abstands zwischen den beiden Gebäuden. Die Darstellung bleibt zu großen Teilen hypothetisch,
da selbst die Position der Häuser zwischen den Längsgruben aufgrund deren rudimentären Erhaltung nicht
sicher bestimmt werden kann. Allerdings wird offenkundig, dass sich die Aktionsradien beider Bauten,
sofern man so etwas annehmen möchte, deutlich überschneiden. Eine derart enge Bebauung konnte auch
für die Siedlungsrekonstruktionen aus dem Neckarraum nicht nachgewiesen werden, obwohl die Abstände
dort, nach Angabe von Lindig (2002, 192), merklich unter jenen liegen, die für das Rheinland belegt sind 6.
Da aus diesen Gründen eine parallele Nutzung beider Gebäude unwahrscheinlich ist, wäre eine Deutung
des Fundortes als zweiphasiger Hofplatz naheliegend 7. Angesichts der großen räumlichen Nähe stellt sich
sogar die Frage, ob möglicherweise ein zeitlicher Hiatus zwischen den beiden Bauten bestand.
BANDKERAMISCHES FUNDMATERIAL DER GEMARKUNG HERXHEIM
Der detaillierten Interpretation der Strukturen soll nun eine kurze Zusammenfassung der Quellenlage, Fund-
aufnahme und -auswertung des in der Magisterarbeit bearbeiteten Materials vorangestellt werden. Ein
Groß teil der etwa 80 bandkeramischen Gruben von FS17 wurde im Jahr 2001 ausgegraben, einzelne schon
1996 und 1999. Das Inventar aus diesen Befunden wird durch Lesefunde ergänzt, die sowohl beim Anlegen
des Baggerplanums als auch bei Feldbegehungen vor den Grabungen zutage kamen. Die ehrenamtlichen
Mitarbeiter der GDKE hatten zwar eine beträchtliche Menge archäologischer Funde diverser Zeitstufen,
jedoch nur vier verzierte bandkeramische Scherben von FS17 zusammengetragen.
Die übrigen Fundstellen der Gemarkung, die zum Vergleich herangezogen werden, sind nahezu ausschließ-
lich durch Lesefunde repräsentiert. Lediglich einige wenige Scherben konnten im Rahmen von Baumaßnah -
men an FS23 grob dokumentierten Befunden zugeordnet werden (vgl. Brandherm 1999, 23). Um weiter-
führende Vergleiche zur Hofstruktur von FS 17 zu ermöglichen, reichen diese Informationen jedoch nicht
aus 8.
Der Fokus der Arbeit lag insbesondere auf der Keramik, da die verzierten Fragmente auch bei den Lese-
funden eine sichere kulturelle Einordnung zulassen. Statistische Untersuchungsmöglichkeiten sind sowohl
durch die Kleinteiligkeit und starke Verwitterung eben jener Lesefundscherben als auch durch deren feh -
lende Zuweisung zu Befunden deutlich eingeschränkt. Im Rahmen der Magisterarbeit wurden zwar einige
Seriationen und Korrespondenzanalysen für das gesamte hier bearbeitete Fundmaterial durch geführt 9, was
rein technisch auch für kleine Samples möglich ist; aus statistischer Sicht wäre es jedoch äußerst frag-
würdig, diese Ergebnisse als Grundlage einer verlässlichen Chronologie zu nutzen. Wenngleich sich die
gerne strapazierte Statistik somit als Basis für eine Datierung der Herxheimer Lesefundstellen als weit -
gehend ungeeignet erwies, so zeichneten sich doch bereits bei der Aufnahme sehr deutliche chronologisch
bedingte Unterschiede im Verzierungsrepertoire der materialreichen Fundstellen ab, die durchaus Aussagen
zur Belegungsdauer der einzelnen Siedlungsareale anhand der Typologie erlauben 10. In einem Fall konnte
auch die Datengrundlage für eine tragfähigere Korrespondenzanalyse zusammengestellt werden, indem
Befunde von FS 17 zusammen mit jenen, die Jeunesse / Lefranc / van Willigen (2009, 62f.) 11 verwendeten,
kombiniert wurden. Auf die jeweiligen Ergebnisse wird im Folgenden unter den entsprechen den Ab schnit -
ten näher eingegangen.
Neben der Keramik wurden für die Magisterarbeit die menschlichen Überreste aller bandkeramischen Fund-
stellen einer detaillierten anthropologischen Ansprache unterzogen, um Hinweise auf reguläre Bestattun -
gen oder auf menschliche Überreste mit Manipulationsspuren zu erhalten, wie sie in den Deponierungen
der Grubenanlage vorliegen (vgl. Zeeb-Lanz u. a. 2007, 260ff.; Orschiedt / Haidle 2009; Boulestin u. a.
19Archäologisches Korrespondenzblatt 42 · 2012
2009). Da von sämtlichen bandkeramischen Fundstellen auch Siedlungsspuren anderer Zeitstufen belegt
sind, lassen sich menschliche Knochen ohne 14C-Datierung zwar nicht sicher chronologisch einordnen, die
erwähnten Fragestellungen sind dennoch größtenteils durch eine anthropologisch-archäologische Bewer-
tung zu beantworten, da charakteristische Manipulationsspuren an Knochen in diesem Fall ein recht deut-
licher Indikator für eine frühneolithische Datierung sind.
Die Überreste menschlicher Skelette kamen außerhalb der Grubenanlage bei Weitem nicht mit der gleichen
Frequenz zutage wie im unmittelbaren Kontext des Erdwerks. An insgesamt sechs Fundstellen konnten
menschliche Überreste nachgewiesen werden – außer bei FS17 ist nur bei FS 23 die Datierung sicher, denn
die bei Bauarbeiten angeschnittene Grube mit menschlichen Knochen beinhaltete daneben ausschließlich
bandkeramisches Material.
Die Skelettreste von FS 17 fanden sich entweder als singuläre Stücke oder als Ansammlung fragmentierter
Knochen in Gruben. An einem Stirnbein (Os frontale) sind deutliche Schnittspuren zu erkennen, wie sie an
den Schädeln und Knochen aus der Grubenanlage häufig vorkommen (Abb. 3). Auch das isolierte Os fron-
tale von FS23, das eine leichte Brandschwärzung aufweist, findet aufgrund dieser Besonderheit Parallelen
in den dortigen Deponierungen.
Die übrigen Knochen zeigen keine derartigen Auffälligkeiten. FS02 wurde bereits in den 1960er Jahren als
bandkeramische Körperbestattung in den Fundberichten der Pfalz vorgestellt (Kaiser / Kilian 1968, 28), die
Datierung der Knochen erfolgte durch die Vergesellschaftung mit charakteristischen Keramikscherben. Die
Zugehörigkeit der beiden Fundgruppen zum gleichen Befund konnte jedoch nach der Einlieferung durch
einen Baggerfahrer nicht mehr fachlich überprüft werden. Hinter der Bestattung verbergen sich allerdings
mindestens zwei adulte Individuen (Fetsch 2008, 161ff.). Von FS14 liegen trotz sonst großer Fundmengen
lediglich einige Kinderzähne (Altersstufe Infans II) vor, von FS43 nur ein isolierter Zahn. Die Knochen von
FS22 könnten – obwohl sie bei zwei separaten Aktionen aufgelesen wurden – zu demselben Individuum
(Altersstufe Infans II) gehören.
Im Hinblick auf die Steingeräte und Tierknochen wurde im Rahmen der Magisterarbeit nur eine erste Inven-
tarisierung durchgeführt. Durch die wiederkehrende Nutzung der Stellen, meist sogar schon durch Siedler
nachfolgender neolithischer Gruppen, ist kaum eine Zuordnung auf typologischer Basis möglich.
20 S. Fetsch · Herxheim bei Landau – Bandkeramik außerhalb der Grubenanlage
Abb. 3 Herxheim (Lkr. Südliche Weinstraße). Os frontale von FS17 mit charakteristischem postmortalen Bruchmuster (Detail 1) undSchnittspuren (Detail 2). – (Foto S. Fetsch).
DIE ZUSAMMENSETZUNG DER GRUBENINVENTARE DER FUNDSTELLE 17
Die Funde der Grabung ließen keine besonders markanten Zusammensetzungen der Grubeninventare
erkennen. Weder gibt es Konzentrationen von bestimmten Materialgruppen in bestimmten Befundtypen
noch in bestimmten Bereichen. Lediglich Trends zeichnen sich ab, bei deren Beurteilung allerdings zu
beachten ist, dass die Erosion zu einem großen Verlust führte, der die heute sichtbaren Mengenverhältnisse
verzerrt haben kann. Die wenigen Silices (sieben Stücke mit sicherer Befundzuweisung) kommen nur in
Gruben vor, die zum westlichen Haus gehören (Befunde 4292, 4354 und 4391), und im Bereich des
Grubenkomplexes (Befunde 4078, 4107 und 4117). Dies führt zu einem relativ ausgewogenen Verhältnis
zwischen den verschiedenen Fundmaterialgruppen beim westlichen Haus. Beim östlichen Haus lassen sich
hingegen nur wenige Steine 12 und zudem kaum Hüttenlehm nachweisen. Stattdessen liegen relativ große
Mengen an Keramik und Tierknochen vor. In den Befunden des Grubenkomplexes sind wiederum mehr
Steine und Hüttenlehm enthalten, allerdings seltener Tierknochen. In den freien Gruben dominiert die
Keramik, meist vergesellschaftet mit geringen Mengen an Tierknochen und/oder Steinen. Die Schlitzgrube
beinhaltete erwartungsgemäß wenige Funde 13, die Kesselgruben eher viele, vor allem Keramik, aber auch
jeweils etwas Steinmaterial und wenig Hüttenlehm sowie – mit einer Ausnahme – einige Tierknochenfrag-
mente. Bezüglich der Verteilung der Menschenknochen ist ebenfalls keine klare Systematik erkennbar. Die
entsprechenden Befunde, keiner davon ein Grab im konkreten Sinne, kamen etwas abseits der Gebäude
zutage. Eine größere Menge der Knochen stammt aus einer unregelmäßigen Grube (Befund 4162), die im
nordwestlichen Umfeld des großen Grubenkomplexes liegt. Die Gruben mit solitären Menschenknochen-
fragmenten befinden sich im südlichen Umfeld des Grubenkomplexes (Befund 4120) bzw. westlich der
Gebäude (Befund 4294).
INTERPRETATIONSANSÄTZE ZU FUNDSTELLE 17
Wie bereits erwähnt, bieten die Befunde Hinweise auf zwei Hausgrundrisse. Dass mit einer Belegung von
FS17 erst ab der fortgeschrittenen mittleren oder der jüngeren LBK zu rechnen ist, zeigte sich schon bei der
Keramikaufnahme (Abb. 4). Die Motive finden Parallelen in den Stufen IVa-V nach Jeunesse / Lefranc / van
Willigen (2009, 73ff.).
Für diesen Datierungsansatz sprechen im Übrigen auch unabhängig von der Keramik dezente Hinweise. Zu
nennen wären die geringe Größe der Ansiedlung 14 und der Beleg vereinzelter Menschenknochen in den
Grubeninventaren (vgl. Lindig 2002, 182). Weiter würde, wenn der Grundriss der Gebäude tatsächlich
trapezförmig angelegt war, dies ebenfalls für eine Datierung in eine jüngere Phase sprechen (Birkenhagen
2003, 118).
Auch wenn die versuchsweise durchgeführte Seriation der Befunde von FS17 angesichts der geringen
Menge des zugrunde liegenden Materials statistisch nicht valide ist, lenkte sie den Fokus doch auf Unter-
schiede in der Motivverteilung, die bei der Aufnahme nicht gleich ersichtlich waren. Diese Diskrepanzen
deu ten sich zudem bei der aufgrund der größeren Fundmasse etwas stabileren Korrespondenzanalyse der
Gruben von FS 17 zusammen mit den Jeunesse’schen Befunden an (Abb. 5) 15. Nicht nur die zu den beiden
Längsgrubenpaaren gehörenden Strukturen sind im Koordinatensystem leicht voneinander abgesetzt, son -
dern vor allem der östlich gelegene Grubenkomplex und die Gebäude fallen auseinander 16.
Die für diese Separierung »verantwortlichen« Verzierungen sind nach den Berechnungen »normale« Ein -
stiche, von Einstichen flankierte Wülste und Furchenstichmotive. Die »normal« gereihten Einstiche domi-
nieren im Grubenkomplex. Von Einstichen flankierte Wülste kommen sowohl beim Grubenkomplex als
21Archäologisches Korrespondenzblatt 42 · 2012
auch bei dem östlichen Haus vor, die Furchenstichmotive prägen hingegen das Bild beim westlichen Ge -
bäude (vgl. Abb. 4).
Deutet man diese Verteilung chronologisch, so wäre in Anlehnung an die Motivabfolge bei Jeu nesse /
Lefranc / van Willigen (2009, Abb.12-14) der Grubenkomplex die älteste und das westliche Haus die
jüngste Struktur. Die Unterschiede sind jedoch gering, sodass eher eine Überlappung als ein Hiatus ange-
22 S. Fetsch · Herxheim bei Landau – Bandkeramik außerhalb der Grubenanlage
Abb. 4 Herxheim (Lkr. Südliche Weinstraße). Auswahl von Keramikgefäßen der FS17: Die beiden linken Gefäße stammen aus Gru -ben, die zum östlichen Haus gehören, und die beiden rechten aus Gruben, die dem westlichen Haus zuzuweisen sind; das mittlere Ge -fäß wurde im Grubenkomplex gefunden. – (Zeichnungen S. Fetsch). – M. 1:4.
Abb. 5 Herxheim (Lkr. Südliche Weinstraße).Korrespondenzanalyse der Gruben von FS17 mitReferenzbefunden (hellgrau), die von Jeunesse /Le franc / van Willigen (2009, 62f.) für die Erstel -lung der vorläufigen Chronologie der PfälzerKeramik verwendet wurden. – Die Platzierungder schwarz beschrifteten Gruben von FS17belegt die Datierung der Fundstelle in diejüngere und jüngste LBK. – (Graphik S. Fetsch).
nommen werden kann. Wesentlich deutlicher zeigt die Korrespondenzanalyse hingegen, dass die Befunde
von FS17 ausnahmslos im Umfeld der jüngeren und jüngsten Stufen 17 platziert und die Motive am Ende
der typologischen Entwicklung einzuordnen sind. Auch die Resultate der Statistik bieten keine Anhalts-
punkte dafür, die sonstigen Gruben nach einem bestimmten Schema – z. B. im Sinne der von Boelicke
(1988, 300ff.) beschriebenen Systematik – den Gebäuden zuzuweisen.
Geht man davon aus, dass der östliche Grubenkomplex tatsächlich vor dem Bau der Häuser angelegt
wurde, was sich in der Korrespondenzanalyse andeutet, wäre es vorstellbar, dass er im Zusammenhang mit
den Baumaßnahmen entstand. Es könnte sich dabei um einen Lagerplatz der »Bauarbeiter« gehandelt
haben, an dem sie kochen, Vorräte aufbewahren (wovon die Kesselgruben zeugen) und Werkzeuge her -
stellen konnten. Möglicherweise stand an diesem Ort ein kleineres, einfacher konstruiertes Gebäude, was
die Hüttenlehmbrocken in den Gruben erklären würde 18. Betrachtet man den Grubenkomplex nicht als
eigenständige Struktur, wäre er eher mit dem direkt westlich danebenliegenden Bau in Verbindung zu
bringen, da hier auch vermehrt Überschneidungen im Motivrepertoire anzutreffen sind. Eine äquivalente
Struktur, die dem zweiten Haus zugeordnet werden kann, ist jedoch nicht vorhanden. Letztlich ist nicht
ganz auszuschließen, dass der Bereich während der kompletten Belegungszeit des Hofplatzes genutzt
wurde.
Bei der Interpretation der Langhäuser sind verschiedene Szenarien vorstellbar: Geht man von Zweiphasig-
keit aus, könnte der ältere Bau schon weitgehend verfallen gewesen sein, als der jüngere errichtet wurde,
sodass die große Nähe nicht störte. Dabei impliziert die parallele Ausrichtung, dass zumindest noch Reste
des älteren Gebäudes sichtbar waren. Alternativ könnte die Bausubstanz dieses älteren Hauses für den
Neubau genutzt worden sein, sodass der geringe Abstand von Vorteil gewesen wäre. Der Abtrag hätte
gleichzeitig auch das Problem der dichten Bebauung relativiert (vgl. Lindig 2002, 192).
Dass die räumliche Nähe der Gebäude nicht dem im Rahmen des Hofplatzmodells (Boelicke 1982, Abb. 3)
angenommen Aktionsradius von 25m widersprechen muss, zeigen ethnologische Beispiele aus Nigeria,
beschrieben von Strien / Gronenborn (2005, 135). Auch wenn sich diese Darstellung einer Weiter- und
Wiedernutzung einer einstmals aufgegebenen Siedlung nicht direkt auf die Situation in Herxheim über-
tragen lässt, bietet es doch einen Hinweis darauf, dass bei aufgelassenen Siedlungsstrukturen selbst die
ehemaligen Innenräume der Gebäude schon nach wenigen Jahren als Nutzfläche für sonstige alltägliche
Aktivitäten verwendet werden. Geht man davon aus, dass kein Hiatus zwischen den Belegungszeiten der
einzelnen Bauten besteht, könnte man – Zweiphasigkeit vorausgesetzt – bei einer Hausgeneration von
25 Jahren (Stehli 1989, 75f.) eine Nutzungsdauer des Platzes von mindestens 50 Jahren annehmen 19.
WEITERE BANDKERAMISCHE SIEDLUNGSSPUREN DER GEMARKUNG HERXHEIM
Die Untersuchung der Lesefundstellen zeigt neben FS17 noch mindestens zwei Areale mit mehrphasigen
Ansiedlungen. Die Fundstellen 02, 22 und 23 bilden wohl eine zusammenhängende Siedlungsfläche mit
einer Ausdehnung von ca.400m Länge in West-Ost- und ca.250m in Nord-Süd-Richtung 20, also einem
Areal von ca.10ha – Größenverhältnisse, die für einen Weiler (nach Lüning 1997, 43) sprechen würden.
Trotz der in den Fundberichten als Bestattung angesprochenen Knochenfunde von FS02 (Kaiser / Kilian
1966, 28) und trotz der menschlichen Knochenfragmente der Fundstellen 22 und 23 gibt es keine Hinweise
auf ein reguläres Gräberfeld. Einzelne Skelettelemente, wie das Os frontale (FS23), kommen in Abfall-
gruben bandkeramischer Siedlungen immer wieder vor 21. Die Kinderknochen von FS22 wären, sofern sie
wirklich bandkeramisch sind, innerhalb einer Siedlung selbst unabhängig von einem Bestattungsplatz nicht
ungewöhnlich (vgl. Lindig 2002, 181f.; Simoneit 1997, 104ff.). Auch primäre, reguläre Körperbestattun -
23Archäologisches Korrespondenzblatt 42 · 2012
gen, die bei FS02 vorzuliegen scheinen, können innerhalb eines Siedlungsareals in der Bandkeramik vor -
kommen (vgl. Orschiedt 1999, 161).
Bei FS14 erstreckt sich die Fundstreuung über eine Fläche von >15ha; damit bildet sie nach dem bisherigen
Stand der Forschung das größte Siedlungsareal der Gemarkungsfläche außerhalb der Grubenanlage.
Befunde sind für FS 14 nur anhand von sich im Luftbild vage abzeichnenden Strukturen belegt. Sowohl
Fundmenge als auch Ausdehnung lassen annehmen, dass es sich hier ebenfalls um mehrere Höfe, also auch
um einen Weiler handelt.
Auf die übrigen Fundstellen soll im Rahmen dieses Beitrages nicht differenziert eingegangen werden, da
von ihnen bislang nur wenige Scherben vorliegen und daher noch keine verlässliche Einordnung möglich
ist 22. Generell befinden sich alle bisher bekannten bandkeramischen Fundstellen der Gemarkung Herxheim
im Löss; FS17 liegt auf relativ geringer Höhe ü.NN im Übergangsbereich des Lössrückens zu den fluviatilen
Sedimenten der Klingbachaue. Die Gruppe der Fundstellen 02/22/23 befindet sich weiter östlich in
vergleichbarer Entfernung zum Bach, allerdings etwas erhöht in Spornlage oberhalb der Talauen von Kling-
bach und Schambach (in diesem Bereich ist die Geländemorphologie durch den Tonabbau verändert). FS14
liegt weiter abseits, ebenfalls etwas erhöht auf dem Lössrücken oberhalb des Schambaches. Damit sind die
bisher sicher nachgewiesenen bandkeramischen Siedlungsaktivitäten ausnahmslos auf den größeren, nörd-
lichen Riedel konzentriert, innerhalb eines Areals von etwa 9km2 bei ca.130-160m ü.NN, auf leicht ab -
schüssigem Gelände. Die Hänge neigen sich in südöstlicher, südlicher bis westlicher Richtung. Die maximale
Entfernung zum nächsten Gewässer beläuft sich heute auf 650m (FS14). Bei FS17 ist die Distanz zum
nächsten natürlichen Wasservorkommen am geringsten, lediglich 150m beträgt der Abstand zur Quelle.
Auch der Bach ist bei gleicher Entfernung deutlich besser zu erreichen als an den Fundstellen 02/22/23, da
24 S. Fetsch · Herxheim bei Landau – Bandkeramik außerhalb der Grubenanlage
Abb. 6 Herxheim (Lkr. Südliche Weinstraße). Gefäßauswahl von FS14 mit typischen Motiven der älteren und mittleren LBK. – (Zeich -nungen S. Fetsch). – M. 1:4.
Abb. 7 Herxheim (Lkr. Südliche Weinstraße). Gefäßauswahl der Fundstellen 02/22/23 vor allem mit typischen Motiven der älteren bisjüngeren LBK (oben links FS02, darunter und daneben FS22 und rechts zwei Gefäße von FS23). – (Zeichnungen S. Fetsch). – M. 1:4.
keine Spornlage vorliegt. Die Grubenanlage nimmt eine mehr oder weniger zentrale Position zwischen
diesen drei größeren Fundarealen ein.
Das relativchronologische Verhältnis der Fundstellen ist recht klar anhand der Keramikverzierung zu
erkennen. Auch wenn die durchgeführten statistischen Untersuchungen aufgrund der kleinen zugrunde
liegenden Samples kaum aussagefähig sind, so bieten sie doch keine Anhaltspunkte dafür, die typologisch
erstellte Ansprache anzuzweifeln (vgl. Fetsch 2008, 121ff.). Demnach wurde FS14 zuerst genutzt, haupt-
sächlich in der älteren und mittleren LBK (Abb. 6). Viele der späten Verzierungstypen wie die Riefen- oder
Furchenstichmotive sowie tremoliert gestochene und schnurartige Dekore sind kaum nachweisbar. Diese
Beobachtung führt zu dem Schluss, dass zum Ende der mittleren Bandkeramik die Besiedlung dieser Fläche
weitgehend abgebrochen sein dürfte.
Die Fundstellen 02/22/23 zeigen nach den typologischen Merkmalen eine etwas spätere Belegung, ab
Stufe IIb (Abb. 7). In diese älteste dokumentierte Nutzungsphase des Areals könnte, nach den wenigen
zugehörigen Scherben zu urteilen, auch die Bestattung (FS02) fallen. Die Siedlungsaktivitäten sind anhand
des Verzierungsdekors bis in die jüngere LBK weiterzuverfolgen, wobei eine mögliche zeitliche Staffelung
in Betracht zu ziehen ist, während sich der genutzte Bereich sukzessive nach Osten verlagerte. Die flom-
bornzeitlichen Motive und die der mittleren LBK sind im weiter westlich liegenden Teil (FS02 und FS22) zu
finden und die Motive des östlichsten Abschnitts – von FS 23 – datieren tendenziell eher in die mittlere und
jüngere Phase. Demnach spricht nichts gegen die Verbindung der Fundstellen 02/22/23 zu einem zu sam -
men gehörenden Siedlungsareal. Dessen Nutzung dürfte dann vom entwickelten Flomborn bis in die Phase
der jüngeren LBK angedauert haben.
Zu den durch nur wenige Scherben repräsentierten Stellen sei hier für die Gesamtinterpretation angemerkt,
dass auch diese keinen Hinweis auf eine andauernde Besiedlung der leichten Anhöhe des nördlichen
Riedels nach der mittleren und beginnenden jüngeren LBK lieferten. Im Gegensatz dazu sind in den
flacheren, auenahen Bereichen, außer bei der Grubenanlage, keine Aktivitäten vor der fortgeschrittenen
mittleren oder jüngeren LBK belegt.
RESÜMEE
In Herxheim konnte – auch außerhalb des Areals der bandkeramischen Grubenanlage – eine kontinuier-
liche Siedlungsaktivität vom frühen Flomborn bis in die jüngere, wahrscheinlich auch jüngste Stufe der LBK
nachgewiesen werden (Abb. 8). An drei Stellen lassen sich bislang Ansiedlungen erkennen, bei denen es
sich zumindest um mehrphasige Hofplätze, teilweise wohl um Weiler handelte. Sie weisen zeitlich versetzte
Belegungsphasen auf: Die älteste und höchst gelegene Siedlungsstelle (FS14) dürfte ab dem frühen Flom-
born bis zur fortgeschrittenen mittleren oder beginnenden jüngeren LBK genutzt worden sein. Wenig
später – in der Stufe IIb – setzen die Nachweise für ein weiteres Siedlungsareal (Fundstellen 02/22/23) ein,
das wohl bis zur jüngeren LBK belegt war. Erst zum Ende der mittleren bzw. zu Beginn der jüngeren LBK,
wahrscheinlich ab Stufe IVa, fängt die Nutzung der Siedlungsfläche bei FS17 an.
Welche Ursachen hinter den Siedlungsverlagerungen stehen, ist anhand des hier bearbeiteten Materials
nicht zu bestimmen. Die Forschungsergebnisse des DFG-Projekts »Bandkeramische Siedlung mit Gruben-
anlage von Herxheim bei Landau (Pfalz)« könnten in Zukunft die Hintergründe weiter beleuchten. Zwei
naheliegende Auslöser, die sich gegenseitig wohl eher bedingen als ausschließen, sollen noch kurz an -
geschnitten werden.
Zum einen könnte die Aufgabe des angestammten Siedlungsplatzes an FS14, später eventuell auch an den
zusammengehörenden Fundstellen 02/22/23, zugunsten der – wassernäheren – Neugründung an FS17
25Archäologisches Korrespondenzblatt 42 · 2012
26 S. Fetsch · Herxheim bei Landau – Bandkeramik außerhalb der Grubenanlage
Abb. 8 Phasenkartierung der LBK-Fundstellenauf der Gemarkung Herxheim (Lkr. SüdlicheWeinstraße). – Die Einordnung in die vor läufi -gen Stufen der Pfälzer Bandkeramik (nachJeunesse / Lefranc / van Willigen 2008) erfolgtweitgehend anhand typologischer Aspekte derVerzierungsmotive. – Dunkle Punkte: Nutzungsicher; helle Punkte: Nutzung läuft aus, oderchronologische Einordnung vage (bei Fund -plätzen mit geringer Fundmenge); weiß: keinBeleg für die Nutzung der Fundstelle in der je -weiligen Phase (Kartenausschnitt vgl. Abb.1). –(Graphik S. Fetsch).
a b
d
f
c
e
g
mit klimatischen Veränderungen korrelieren. Diese These würde weiter gestützt, wenn sich belegen ließe,
dass FS17 erst spät in der jüngeren/jüngsten LBK angelegt und nur noch etwa 50 Jahre genutzt wurde.
Dann wäre die Besiedlung der Stelle zeitlich zur Deckung zu bringen mit der von Schmidt / Gruhle / Rück
(2004, 303) beschriebenen Verminderung von Niederschlägen ab 5020 v.Chr. Zum anderen könnte sich
auch eine Orientierung hin zur Grubenanlage vollzogen haben. Eine Korrelation des Abbruchs in der Be -
legung der umgebenden Siedlungen mit einer Zunahme der Bevölkerung innerhalb des Erdwerks würde
diese These noch weiter untermauern.
Der Eindruck, es müsste zum Ende der LBK mit einem Rückgang der Bevölkerungszahl gerechnet werden,
da nur noch der kleine Einzelhof neben der Grubenanlage bestand und die beiden Weiler aufgegeben
wurden, kann täuschen. Dieser Aspekt ist nur zu bewerten, wenn auch die Größe der Siedlung innerhalb
des Erdwerkes zur entsprechenden Zeit berücksichtigt würde; diese ist aber aufgrund der starken Erosion,
vor allem im südöstlichen Teil der Anlage, nicht mehr sicher zu bestimmen.
Für FS17 selbst können die Siedlungsprozesse anhand der gut dokumentierten Grabung detaillierter re -
konstruiert werden. Die Befunde und ihre Datierung weisen auf der Fläche einen wahrscheinlich zwei phasi -
gen Hofplatz aus, der einige Charakteristika der jüngeren/jüngsten LBK in sich vereint und wahrscheinlich
noch parallel zur Endphase der Grubenanlage bewohnt wurde.
Die Einblicke, die das Gesamtmaterial in die Siedlungsprozesse während der LBK bietet, zeigen ganz klar,
dass sich das Geschehen außerhalb des Erdwerks nicht von dem anderer Fundplätze abhebt. Es lassen sich
nur wenige dezente Entsprechungen zu den Funden der Grubenanlage erkennen, beispielsweise das Schä-
delfragment mit eindeutigen Schnittspuren entlang der Mittelachse des Os frontale und das Schädelbruch-
stück mit Brandschwärzung. Eine weitere Parallele könnte die Dauer der Besiedlung bis in die jüngste Stufe
der LBK darstellen, die aufgrund der Datenlage zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. Dies muss
allerdings insofern relativiert werden, als der einzige Platz, an dem unter Umständen jüngstbandkeramische
Aktivitäten stattfanden, der Einzelhof in der nächsten Umgebung der Grubenanlage ist. Auf der gesamten
übrigen Gemarkungsfläche war die Besiedlung zu dieser Zeit – soweit bislang nachweisbar – bereits ab -
gebrochen.
27Archäologisches Korrespondenzblatt 42 · 2012
Anmerkungen
1) Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, DirektionLandesarchäologie, Außenstelle Speyer (früher Landesamt fürDenkmalpflege Rheinland-Pfalz, Abteilung Bodendenkmal-pflege, Amt Speyer).
2) Vgl. auch Münzer / Bernhard 2003, Abb.112. Bei dem brei-ten, im Plan sichtbaren unregelmäßigen Streifen, der im öst-lichsten Bereich die Grubenanlage schneidet, sich dann relativparallel zum Gebäude der Neumühle hinzieht und schließlicheinen leichten Bogen nach Nordwesten beschreibt, handelt essich um eine solche Erosionsrinne. Für den Hinweis sei MichaelMünzer herzlich gedankt.
3) Archäologisch bietet der Fund einer römischen Töpferei einenHinweis auf die Nutzung lokaler Tonvorkommen (Tschocke2001, 69). Auch in der jüngsten Zeit wurde dieser Ton nochabgebaut, z. B. zur Verarbeitung in der Ziegelei Speth, wobeidas Fundmaterial von FS02 zutage kam.
4) Auf Abb. 2 werden nur die bandkeramischen Gruben ge -zeigt. Zur Übersicht über die gesamten Befundsituation vgl.Münzer / Bernhard 2003, Abb. 112.
5) In den folgenden Überlegungen wird dieser Komplex tenden-ziell als eine Einheit betrachtet, deren Einzelteile zueinander in
zeitlicher oder funktionaler Relation standen. Dass es sich umein rein zufälliges Konglomerat von Gruben handelt, ist je -doch nicht auszuschließen.
6) Zwischenräume von mind. 16m für unterschiedlich datieren -de Gebäude und 45m für gleichzeitige Gebäude.
7) Der Begriff des Hofplatzes wird hier vorrangig verwendet, dasich eine »lokale Abfolge von Höfen« (Lüning 1997, 43) er -kennen lässt. Die Fundstelle weist nicht die charakteristischeKombination von Gruben und Gebäuden auf, die Boelicke(1982) bei der Beschreibung des Hofplatzmodells zugrundelegte.
8) Einige der Inventare wurden von Jeunesse / Lefranc / van Wil-ligen (2009, 63) zur Erstellung der vorläufigen pfälzischenPhasengliederung verwendet (HerxAL02, HerxAL03) und bie-ten damit Anhaltspunkte für die Datierung der Fundstelle.
9) Dazu wurde das Programm WINBASP 5.4 angewendet. Aufweitere Informationen zu diesen statistischen Verfahren sollan dieser Stelle nicht eingegangen werden, die Thematik wur -de z. B. bei Zimmermann (1997), Strien (2000) und Kerig(2008) intensiv behandelt (vgl. auch Fetsch 2008, 70f.).
10) Für die Region Südpfalz existiert bislang kein stabiles chrono-logisches Schema. Für die Untersuchungen an der Gruben -anlage wurde von Jeunesse / Lefranc / van Willigen (2009)eine vorläufige Chronologie – in Anlehnung an das ursprüng-liche System von Meier-Arendt (1966, 23f.) – erstellt, diejedoch nach Aussage der Autoren selbst mit einigen Ein-schrän kungen zu betrachten ist (Jeunesse / Lefranc / van Wil-ligen 2009, 63). In der Magisterarbeit der Autorin werdenzudem methodische Probleme dieser Analyse diskutiert(Fetsch 2008, 76ff.). Als Konsequenz daraus wurden dieMotive der Jeunesse’schen Referenzgruben für die Magister -arbeit nach dem SAP-System (SAP = Siedlungsarchäologieder Aldenhovener Platte; s. Nockemann 2007) neu aufge -nommen, woraufhin sich erwartungsgemäß die jüngere und jüngste Stufe weniger deutlich voneinander absetzten (Fetsch2008, 80). Unabhängig von diesen Einschränkungen ist dieAbfolge der Verzierungstypen, die sich bei Jeunesse / Le -franc / van Willigen (2009) ergab, weiterhin durch Vergleichemit anderen bandkeramischen Chronologien, u. a. der Nach-barregionen wie des Neckarmündungsgebiets (Lindig 2002)und des Elsasses (Lefranc 2007), als weitgehend sicher einzu-schätzen. Daher wird in diesem Beitrag auch die vorläufigeStufengliederung der Pfalz als Einteilungsgrundlage verwen-det. Lediglich von einer differenzierten Gliederung in die Stu-fen IV-V wird bis zur Vorlage neuer umfassender Ergebnisseabgesehen.
11) Den Autoren und Andrea Zeeb-Lanz sei an dieser Stelle für dieBereitstellung des Materials als Grundlage für einen Vergleichherzlich gedankt.
12) Es wird bewusst der Begriff Steine verwendet, da sich in denGruben nur äußerst selten Steingeräte befunden haben, son-dern nahezu ausnahmslos unmodifizierte Sandsteinbrocken,Kalksteinstücke oder kleine Flussgerölle.
13) Das Phänomen der geringen Mengen an Fundmaterial in die-sem Befundtyp wurde bereits bei van der Velde (1973) be -schrieben.
14) Anmerkungen zu einer derartigen Entwicklung finden sich beiLindig (2002, 194) und bei Heide (2001, 169).
15) Die Nummern in Abb. 5 entsprechen den Befunden von Jeu -nesse / Lefranc / van Willigen (2009, 62f.) wie folgt: 11 Dann -09. – 12 Dann05. – 22 Dann1968. – 31 Edesh38. – 41 Es -singGK1. – 42 Essing09. – 43 Essing10. – 44 Essing22. – 45 Es sing24. – 51 Frank20. – 61 Fuss1958. – 71 Grossf01. –72 Grossf04. – 73 Grossf08. – 74 Grossf23. – 75 Grossf37. –76 Grossf39. – 77 Grossf42. – 81 HerxAL02. – 90 Herx1637. –
91 Herx333. – 92 Herx343. – 93 Herx352. – 94 Herx656. – 95 Herx676. – 96 Herx177. – 97 Herx1318. – 98 Herx1572. –99 Herx1660. – 101 Land01. – 102 Land02. – 111 Obrig3. –112 Obrig9. – 113 Obrig 10. – 114 Obrig13. – 121 Wach01. –122 WachIII/5. – 131 Zeis1966. – Die leicht abweichende Platzierung der Befunde im Diagramm besonders in den Stu-fen VI-V entstand durch die Neuaufnahme der Motive mit demSAP-System. Zur Vorgehensweise bei der Durchführung derKor respondenzanalyse vgl. Fetsch 2008, 138ff.
16) Die Aussagekraft der Resultate, vor allem der chronologischenStaffelung von Längsgruben und Grubenkomplex, wird durchmehrere Aspekte eingeschränkt: Zum Ersten enthalten dieInventare der Gruben nur maximal acht weitgehend sicheransprechbare Motive, und kleine Stichproben führen leicht zuextremen Ergebnissen; zum Zweiten sind etliche Befundewegen der zu geringen Mengen bestimmbarer Motive nicht indie Berechnung eingeflossen; zuletzt könnte der geringe Ab -stand zwischen den beiden Gebäuden eine Vermischung derAbfälle und somit der Inventare begünstigt haben.
17) Zur Bewertung der Ergebnisse vgl. Anm. 10.
18) Die Anlage eines derartigen kleinen Nebengebäudes vor demBau des eigentlichen Hauses, das als Lagerstelle von Vorräten,als Werkstatt und als Schutz vor Witterungseinflüssen für dieBauarbeiter genutzt wurde, konnte die Autorin in Nordafrikabeobachten. Das Gebäude wurde dort nicht als Schlafplatzverwendet, da das alte Haus nicht weit vom Neubau entferntstand. Trotzdem machte man sich die Mühe, ein Nebenhauszu errichten. Nach Abschluss der Bauarbeiten wurde es zueiner Lagerkammer und/oder zu einem Viehstall umfunktio-niert.
19) Strien / Gronenborn (2005, 142) setzen eine geringfügig kür-zere Dauer für eine Hausgeneration an. In den letzten Jahrenwurden jedoch auch zunehmend Argumente für eine deutlichlängere Nutzung der bandkeramischen Häuser vorgebracht(vgl. Schmidt u. a. 2005, 161f.).
20) Diese drei Stellen sind aufgrund der Lage in verschiedenenAckerflächen, die durch Feldwege getrennt sind, in den Orts-akten separat gelistet, liegen aber in direkter Nachbarschaft.
21) Wie auch für FS17 in vier Fällen belegt (vgl. auch Lindig 2002,182. – Orschiedt 1999, 161f. – Krause 1999, 24ff.).
22) Wie das Beispiel von FS17 zeigt, ist nicht auszuschließen, dasssich auch hinter diesen wenigen Lesefundscherben weiterebandkeramische Hofplätze verbergen. Ihre vorläufige Datie-rung ist Abb. 8 zu entnehmen.
28 S. Fetsch · Herxheim bei Landau – Bandkeramik außerhalb der Grubenanlage
Literatur
Bauer 2008: S. Bauer, Untersuchungen an manipulierten Skelett -resten der jüngsten Bandkeramik: Die Menschenknochen ausden Konzentrationen 9-11 der Grubenanlage von Herxheim [un -publ. Magisterarbeit Univ. Hamburg 2008].
Birkenhagen 2003: B. Birkenhagen, Studien zum Siedlungswesender westlichen Linearbandkeramik. Saarbrücker Beitr. Altkde. 75(Bonn 2003).
Boelicke 1982: U. Boelicke, Gruben und Häuser: Untersuchungenzur Struktur bandkeramischer Hofplätze. In: Siedlungen der Kultur mit Linearkeramik in Europa. Internationales KolloquiumNové Vozokany 17.-20. November 1981 (Nitra 1982) 17-28.
1988: U. Boelicke, Die Gruben. In: U. Boelicke / D. von Brandt /J. Lüning / P. Stehli / A. Zimmermann, Der bandkeramische Sied-lungsplatz Langweiler 8, Gemeinde Aldenhoven, Kr. Düren.Beitr. Neolithische Besiedlung Aldenhovener Platte 3 = Rhein.Ausgr. 28 (Bonn 1988) 300-394.
Boulestin u. a. 2009: B. Boulestin / A. Zeeb-Lanz / Ch. Jeunesse / F.Haack / R.-M. Arbogast / A. Denaires, Mass cannibalism in theLinear Pottery Culture at Herxheim (Palatinate, Germany). Anti-quity 83, 2009, 968-982.
Brandherm 1999: D. Brandherm, Fundberichte aus der Pfalz, Vor-geschichte 1976-1979. Mitt. Hist. Ver. Pfalz 97, 1999, 7-126.
Fetsch 2008: S. Fetsch, Linienbandkeramische Fundplätze der Ge -markung Herxheim, Kr. Südliche Weinstraße [unpubl. Magister-arbeit Univ. Mainz 2008].
Haack 2002: F. Haack, Die bandkeramischen Knochen-, Geweih-und Zahnartefakte aus den Siedlungen Herxheim (Rheinland-Pfalz) und Rosheim (Alsace) [unpubl. Magisterarbeit Univ. Frei-burg i.Br. 2002].
Häußer 2001: A. Häußer, Herxheim bei Landau, Lkr. SüdlicheWein straße, Gewerbegebiet »West«. Die Ausgrabung derjüngst bandkeramischen Siedlung mit Grabenwerk. Arch. Pfalz.Jahresber. 2000 (2001), 63-68.
Häussler 2009: E. Häussler, Untersuchungen linienbandkerami-scher Siedlungsplätze in der Pfalz. Die Siedlungen Kaiserslautern»Rittersberg« und Haßloch »Am Kirchenpfad« [unpubl. Magis -ter arbeit Univ. Heidelberg 2009].
Heide 2001: B. Heide, Das ältere Neolithikum im westlichenKraich gau. Internat. Arch. 53 (Rahden/Westf. 2001).
Houbre 2008: A. Houbre, La Ceramique Rubanée de Herxheim(Palatinat, Allemagne) [unpubl. Masterarbeit Univ. Strasbourg2008].
Jeunesse 2011: Ch. Jeunesse, Enceintes à fossé discontinu et en -ceintes à pseudo-fossé dans le Néolithique d’Europe centrale etoccidentale. In: A. Denaire / Ch. Jeunesse / Ph. Lefranc (Hrsg.),Nécropoles et enceintes danubiennes du Ve millénaire dans leNord-Est de la France et le Sud-Ouest de l’Allemagne. Actes dela table ronde internationale de Strasbourg organisée par l’UMR7044 (CNRS et Université de Strasbourg). Monogr. Arch. GrandEst 5 (Strasbourg 2011) 31-71.
Jeunesse / Lefranc / van Willigen 2009: Ch. Jeunesse / Ph. Lefranc /S. van Willigen, Die pfälzische Bandkeramik: Definition und Pe -rio disierung einer neuen Regionalgruppe der Linearbandkera-mik. In: Zeeb-Lanz 2009, 61-78.
Kaiser / Kilian 1968: K. Kaiser / L. Kilian, Fundberichte aus der Pfalzfür die Jahre 1956-1960. Mitt. Hist. Ver. Pfalz 66, 1968, 5-135.
Kerig 2008: T. Kerig, Hanau-Mittelbuchen. Siedlung und Erdwerkder bandkeramischen Kultur. Materialvorlage – Chronologie –Versuch einer handlungstheoretischen Interpretation. Universi-tätsforsch. Prähist. Arch. 156 (Bonn 2008).
Krause 1999: R. Krause, Die bandkeramischen Siedlungsgrabun-gen bei Vaihingen an der Enz, Kreis Ludwigsburg (Baden-Würt-temberg). Ein Vorbericht zu den Ausgrabungen von 1994-1997.Mit Beiträgen von Rose-Marie Arbogast, Sybille Hönscheidt,Jörg Lienemann, Stephan Papandopoulos, Manfred Rösch, Isa-belle Sidéra, Hans W. Smettan, Hans-Christoph Strien undKatrin Welge. Ber. RGK 79, 1999, 5-105.
Lefranc 2007: Ph. Lefranc, La céramique du Rubané en Alsace:Contribution à l’étude des groupes régionaux du Néolithiqueancien dans la plaine du Rhin supérieur. Rhin, Meuse, Moselle 2(Strasbourg 2007).
Lindig 2002: S. Lindig, Das Früh- und Mittelneolithikum im Neckar-mündungsgebiet. Universitätsforsch. Prähist. Arch. 85 (Bonn2002).
Lüning 1997: J. Lüning, Wohin mit der Bandkeramik? Programma-tische Bemerkungen zu einem allgemeinen Problem am BeispielHessen. In: C. Becker / M.-L. Dunkelmann / C. Metzner-Ne bel -sieck / H. Peter-Röcher / M. Roeder / B. Teržan (Hrsg.), Chro nos.Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen Nord- undSüdosteuropa. Festschrift für Bernhard Hänsel. Internat. Arch.Stud. Honoraria 1 (Espelkamp 1997) 23-57.
Meier-Arendt 1966: W. Meier-Arendt, Die bandkeramische Kulturim Untermaingebiet. Veröff. Amt Bodendenkmalpfl. Regierungs -bez. Darmstadt 3 (Bonn 1966).
Münzer / Bernhard 2003: M. Münzer / H. Bernhard, Herxheim beiLandau, Kreis Südliche Weinstraße, Gewerbegebiet »West«.Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit und Römerzeit. Arch. Pfalz. Jah-resber. 2001 (2003), 164-168.
Nockemann 2007: G. Nockemann, Merkmalskatalog für die Auf-nahme von bandkeramischer Keramik aus dem Rheinland nachAufnahmesystem SAP-Projekt [unpubl. Katalog, Köln 2007].
Orschiedt 1999: J. Orschiedt, Manipulationen an menschlichenSkelettresten: Taphonomische Prozesse, Sekundärbestattungenoder Kannibalismus? Urgesch. Materialh. 13 (Tübingen 1999).
Orschiedt / Haidle 2009: J. Orschiedt / M. N. Haidle, Hinweise aufeine Krise? Die menschlichen Skelettreste von Herxheim. In:Zeeb-Lanz 2009, 41-52.
Schimmelpfennig 2004: D. Schimmelpfennig, Die Artefakte ausSilikatgestein vom bandkeramischen Fundplatz Herxheim beiLandau in der Pfalz [unpubl. Magisterarbeit Univ. Köln 2004].
Schmidt 2000: K. Schmidt, L’enceinte Rubanée de Herxheim (Pala-tinat, Allemagne). Études des Fossés. Mémoire de D. E. A. [un -publ. Diplomarbeit Univ. Strasbourg 2000].
Schmidt / Gruhle / Rück 2004: B. Schmidt / W. Gruhle / O. Rück,Klimaextreme in bandkeramischer Zeit (5300 bis 5000 v.Chr.) –Interpretation dendrochronologischer und archäologischer Be -funde. Arch. Korrbl. 34, 2004, 303-307.
Schmidt u. a. 2005: B. Schmidt / W. Gruhle / O. Rück / K. Freck -mann, Zur Dauerhaftigkeit Bandkeramischer Häuser im Rhein-land (5300-4950 v.Chr.) – Eine Interpretation dendrochronologi-scher und bauhistorischer Befunde. In: D. Gronenborn (Hrsg.),Klimaveränderung und Kulturwandel in neolithischen Gesell-schaften Mitteleuropas, 6700-2200 v.Chr. RGZM – Tagungen 1(Mainz 2005) 151-170.
Simoneit 1997: B. Simoneit, Das Kind in der Linienbandkeramik:Befunde aus Gräberfeldern und Siedlungen in Mitteleuropa. In -ternat. Arch. 42 (Rahden/Westf. 1997).
Stehli 1989: P. Stehli, Zur relativen und absoluten Chronologie derBandkeramik in Mitteleuropa. In: J. Rulf (Hrsg.), Bylany Seminar1987. Collected papers (Prag 1989) 69-78.
Strien 2000: H.-Ch. Strien, Untersuchungen zur Bandkeramik inWürttemberg. Universitätsforsch. Prähist. Arch. 69 (Bonn 2000).
Strien / Gronenborn 2005: H.-Ch. Strien / D. Gronenborn, Klima-und Kulturwandel während des mitteleuropäischen Altneolithi-kums (58./57.-51./50. Jahrhundert v.Chr.). In: D. Gronenborn(Hrsg.), Klimaveränderung und Kulturwandel in neolithischenGesellschaften Mitteleuropas, 6700-2200 v.Chr. RGZM – Tagun-gen 1 (Mainz 2005) 131-149.
Tschocke 2001: D. Tschocke, Herxheim bei Landau, Lkr. SüdlicheWeinstraße, Gewerbegebiet »West«. Die Grabungen 1999 und2000. Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit und Römerzeit. Arch. PfalzJahresber. 2000 (2001), 69-74.
van de Velde 1973: P. van de Velde, Rituals, Skins and Homer: theDanubian »Tan-Pits«. Analecta Praehist. Leidensia 6, 1973, 50-65.
Zeeb-Lanz 2009: A. Zeeb-Lanz (Hrsg.), Krisen – Kulturwandel –Kontinuitäten. Zum Ende der Bandkeramik in Mitteleuropa. Bei-träge der internationalen Tagung in Herxheim bei Landau (Pfalz)vom 14.-17. Juni 2007. Internat. Arch., Arbeitsgemeinschaft,Sym posium, Tagung, Kongress 10 (Rahden/Westf. 2009) 61-78.
29Archäologisches Korrespondenzblatt 42 · 2012
Zeeb-Lanz u.a. 2006: A. Zeeb-Lanz / R.-M. Arbogast / F. Haack / M.N. Haidle / Ch. Jeunesse / J. Orschiedt / D. Schimmelpfennig / K.Schmidt / S. van Willigen, Die bandkeramische Siedlung mit»Grubenanlage« von Herxheim bei Landau (Pfalz). Erste Ergeb-nisse des DFG-Projektes. In: H.-J. Beier (Hrsg.), Varia neolithica IV.Beitr. Ur- u. Frühgesch. Mitteleuropa 43 (Langenweißbach 2006)63-81.
Zeeb-Lanz u. a. 2007: A. Zeeb-Lanz / F. Haack / R.-M. Arbogast /M. N. Haidle / Ch. Jeunesse / J. Orschiedt / D. Schimmelpfennig,Außergewöhnliche Deponierungen der Bandkeramik – Die Gru-benanlage von Herxheim. Germania 85, 2007, 199-274.
Zimmermann 1997: A. Zimmermann, Zur Anwendung der Kor -respondenzanalyse in der Archäologie. In: J. Müller / A. Zimmer -mann (Hrsg.), Archäologie und Korrespondenzanalyse: Beispiele,Fragen, Perspektiven. Internat. Arch. 23 (Espelkamp 1997) 9-15.
30 S. Fetsch · Herxheim bei Landau – Bandkeramik außerhalb der Grubenanlage
Sandra FetschRömisch-Germanisches ZentralmuseumForschungsinstitut für ArchäologieErnst-Ludwig-Platz 255116 [email protected]
Zusammenfassung / Abstract / Résumé
Herxheim bei Landau – Bandkeramik außerhalb der Grubenanlage Die bandkeramischen Fundstellen der Gemarkung Herxheim außerhalb der Grubenanlage, von denen Lesefunde undGrabungsmaterial vorliegen, waren 2008 Gegenstand einer Magisterarbeit. Basierend auf der umfassenden Keramik-bewertung erfolgten die relativchronologische Einordnung dieser Fundstellen und darauf aufbauend eine Modellierungder Siedlungsprozesse, die sich wahrscheinlich über die gesamte Dauer der Bandkeramik im linksrheinischen Gebieterstreckten. Der Schwerpunkt der Analysen liegt auf einem 2001 ausgegrabenen zweiphasigen Hofplatz im unmittel-baren Umfeld der Grubenanlage. Dieser datiert, nach dem Motivrepertoire zu urteilen, an das Ende der Bandkeramikund war möglicherweise noch zu einem Zeitpunkt belegt, an welchem bislang, abgesehen von der Grubenanlage, inder Südpfalz keine Siedlungsaktivitäten mehr nachgewiesen sind.
Herxheim near Landau – pottery of the LBK (Linear Pottery culture) outside the pit enclosureApart from the famous pit enclosure of Herxheim/Palatinate several early Neolithic settlement sites, known only fromsurveys and few excavations, have been identified in the general area. The associated pottery indicates that these settle ments persisted during the entire period of the western LBK culture (west of the river Rhine). Using correspon-dence analysis it was possible to develop a relative chronological order of the pottery allowing for further interpre -tations of settlement processes. A two-phase farmyard (Hofplatz) near the pit enclosure – excavated in 2001 – is de -scribed in detail. The repertoire of motifs from this site showed characteristics of the final LBK. It is possibly that thisfarmyard was occupied until the end of the final LBK, for which time in the southern Palatinate settlement activitieshad as yet only been documented at the pit enclosure of Herxheim.
Herxheim près de Landau – céramique rubanée à l’extérieur de l’enceinteLes sites archéologiques situés à l’extérieur de l’enceinte rubanée de Herxheim/Palatinat, ont livré du matériel de pro-spection et de fouille qui a fait l’objet d’un mémoire de master en 2008. Une étude détaillée de la céramique a per-mis la datation relative des sites et une interprétation des processus d’occupation qui semblent d’avoir persisté pen-dant toute la durée du Rubané pour la rive gauche du Rhin. Cet article résume les résultats principaux de ce mémoirede master en insistant sur la présentation d’une cour (Hofplatz) occupée pendant deux phasese et située près de l’en-ceinte mise au jour en 2001. D’après les décorations de la céramique, ce site date de la fin du Rubané. Peut-être lacour était-elle encore occupée pendant la dernière étape de cette phase, le seul site documenté pour cette périodepour le Sud du Palatinat est l’habitat de l’enceinte de Herxheim.
Schlüsselwörter / Keywords / Mots clés
Rheinland-Pfalz / Linearbandkeramik / Siedlungsentwicklung / Keramikanalyse / Chronologie Rhineland-Palatinate / Linear Pottery / development of occupation / analysis of pottery / chronologyRhénanie-Palatinat / céramique rubanée / développement de l’habitat / analyse de la céramique / chronologie
ISSN 0342-734X
Clemens Pasda, Kulturentwicklung oder kulturspezifische Lebensweise?
Ein Beitrag zur Ethnographie des Paläolithikums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sandra Fetsch, Herxheim bei Landau – Bandkeramik außerhalb der Grubenanlage . . . . . . . . . . . . . . . 15
Gérard Cordier, Le dépôt de l’âge du Bronze final de l’Étang,
commune de Saint-Germain-sur-Vienne (dép. Indre-et-Loire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Roy van Beek, Arjan Louwen, Urnfields on the move: testing burial site-settlement relations
in the eastern Netherlands (c.1100-500 BC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Abolfazl Aali, Thomas Stöllner, Aydin Abar, Frank Rühli, The Salt Men of Iran:
the salt mine of Douzlākh, Chehrābād . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Raymund Gottschalk, Miniaturen in Frauenhand – zu den sogenannten Mithrassymbolen . . . . . . . . . 83
Audronė Bliujienė, Ernestas Vasiliauskas, People from the crossroads
of the Mūša-Lielupe river basin in the eastern Baltic region
during the Late Roman and Migration Periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Coriolan Horaţiu Opreanu, Ein Frauengrab aus der Völkerwanderungszeit
von Cluj-Polus (Rumänien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Thomas Knopf, Tilmann Baum, Thomas Scholten, Peter Kühn,Landnutzung im frühen Mittelalter? Eine archäopedologische Prospektion
im Mittleren Schwarzwald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
INHALTSVERZEICHNIS
Das Archäologische Korrespondenzblatt versteht sich als eine aktuelle wissenschaftliche Zeitschrift zu Themen der vor-und frühgeschichtlichen sowie provinzialrömischen Archäologie und ihrer Nachbarwissenschaften in Europa. Neben deraktuellen Forschungsdiskussion finden Neufunde und kurze Analysen von überregionalem Interesse hier ihren Platz.Der Umfang der Artikel beträgt bis zu 20 Druckseiten; fremdsprachige Beiträge werden ebenfalls angenommen. Unabhängige Redaktoren begutachten die eingereichten Artikel.
Kontakt für Autoren: [email protected]
Abonnement beginnend mit dem laufenden Jahrgang; der Lieferumfang umfasst 4 Hefte pro Jahr; ältere Jahrgängeauf Anfrage; Kündigungen zum Ende eines Jahrganges.
Kontakt in Abonnement- und Bestellangelegenheiten: [email protected]
Preis je Jahrgang (4 Hefte) für Direktbezieher 20,– € (16,– € bis 2007 soweit vorhanden) + Versandkosten (z.Z. Inland5,50 €, Ausland 12,70 €)
HIERMIT ABONNIERE ICH DAS ARCHÄOLOGISCHE KORRESPONDENZBLATT
Name, Vorname ________________________________________________________________________________________
Straße, Nr. ________________________________________________________________________________________
PLZ, Ort ________________________________________________________________________________________
Sollte sich meine Adresse ändern, erlaube ich der Deutschen Post, meine neue Adresse mitzuteilen.
Datum ______________________ Unterschrift _____________________________________________________
Ich wünsche folgende Zahlungsweise (bitte ankreuzen):
� bequem und bargeldlos durch Bankabbuchung (innerhalb von Deutschland)
Konto-Nr. ________________________________________ BLZ __________________________________________
Geldinstitut ________________________________________________________________________________________
Datum _________________________ Unterschrift __________________________________________________
� durch sofortige Überweisung nach Erhalt der Rechnung (Deutschland und andere Länder)Ausland: Nettopreis net price prix net 20,– €Versandkosten postage frais d’expédition 12,70 €Bankgebühren bank charges frais bancaires 7,70 €
Bei Verwendung von Euro-Standardüberweisungen mit IBAN- und BIC-Nummer entfallen unsere Bankgebühren (IBAN: DE 08 5519 0000 0020 9860 14; BIC: MVBM DE 55), ebenso wenn Sie von Ihrem Postgirokonto überweisen oder durch internationale Postanweisung zahlen.Das Römisch-Germanische Zentralmuseum ist nicht umsatzsteuerpflichtig und berechnet daher keine Mehrwertsteuer.
If you use the European standard money transfer with IBAN- and BIC-numbers there are no bank charges from our part (IBAN: DE 08 5519 0000 0020 9860 14; BIC: MVBM DE 55). This is also the case if you transfer the money from a post office current account or with an international post office money order.The Römisch-Germanische Zentralmuseum does not pay sales tax and therefore does not charge VAT (value added tax).
L’utilisation de virement SWIFT avec le numéro IBAN et SWIFT supprime nos frais bancaires (IBAN: DE 08 5519 0000 0020 9860 14; SWIFT: MVBM DE 55); ils peuvent aussi être déduits en cas de réglement postal sur notre CCP (compte courant postal) ou par mandat postal international.Le Römisch-Germanische Zentralmuseum n’est pas imposable à la taxe sur le chiffre d’affaires et ne facture aucune TVA (taxe à la valeur ajoutée).
Senden Sie diese Abo-Bestellung bitte per Fax an: 0049 (0) 61 31 / 91 24-199
oder per Post an:
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Archäologie,Archäologisches Korrespondenzblatt, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz, Deutschland
BESTELLUNG DES ARCHÄOLOGISCHEN KORRESPONDENZBLATTS
3/2
012
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de
NEUERSCHEINUNGEN
RGZM – Tagungen, Band 111. Auflage 2011,
322 S. mit 11 Abb., 4 Tab.,21×29,7cm,Softcover, fadengeheftet
ISBN 978-3-88467-165-8€ 49,–
Falko Daim · Detlef Gronenborn · Rainer Schreg (Hrsg.)
Strategien zum ÜberlebenUmweltkrisen und ihre Bewältigung
Krisenbewältigung ist zum Dauerthema geworden. Aktuelle Debatten umKlimawandel und Umweltkrise werfen die Frage auf, wie Menschen frühermit Krisen umgegangen sind, welche »Strategien zum Überleben« – so derTitel einer Tagung am RGZM im September 2008 – sie entwickelt haben.Die hier vorgelegten Beiträge von Archäologen und Naturwissenschaftlernverschiedener Disziplinen thematisieren methodische und konzeptionelleAnnäherungen an das Phänomen »Krise«. Konkrete Fallstudien aus demJungneolithikum und dem Spätmittelalter zeigen die Forschungssituation inder Prähistorischen und Historischen Archäologie auf.
RGZM – Tagungen, Band 101. Auflage 2011,
416 S. mit 192 z.T. farb. Abb., 12 Tab.,21×29,7cm, Softcover, fadengeheftet
ISBN 978-3-88467-164-1€ 68,–
Dieter Quast (Hrsg.)
Weibliche Eliten in der FrühgeschichteFemale Elites in Protohistoric EuropeAusgehend von Grabfunden und den reichen Mooropferplätzen Südskandi-naviens gewinnt die Elitenforschung in der Archäologie seit einigen Jahrendeutlich an Interesse. Allerdings hat sie sich dabei bislang fast ausschließlichauf Männer konzentriert. Dies ist verwunderlich, denn bereits in der Zeit, inder erstmals im nord- und mitteleuropäischen Barbaricum eine deutlicheHierarchisierung innerhalb des Bestattungsritus’ zum Ausdruck gebrachtwird – bei den sogenannten Fürstengräbern der Lübsow-Gruppe des1./2. Jahrhunderts n.Chr. –, spielen Frauen eine wichtige Rolle. Bei einemgroßen Teil der bestatteten Personen handelt es sich nicht um »Fürsten«,sondern um »Fürstinnen«. Ausgehend von den archäologischen Quellen diskutieren die Beiträge desvorliegenden Bandes die z. T. recht unterschiedlichen wissenschaftlichenZugänge zum Thema »Weibliche Eliten« und deren allgemeine Bedeutungbei der Entstehung und Struktur frühgeschichtlicher Eliten. Die Themen-schwerpunkte liegen in den Bereichen »Hierarchien und Selbstdarstellungweiblicher Eliten«, »Weibliche Eliten in Kult, Religion und Jenseits« sowie»Vernetzung weiblicher Eliten«. Dabei bietet die internationale und dia -chrone Betrachtungsweise neue Impulse für die Forschung.
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de
NEUERSCHEINUNGEN
Monographien des RGZM, Band 981. Auflage 2011,
288 S. mit 89 Abb., 32 Taf.,21×29,7cm,Hardcover, fadengeheftet
ISBN 978-3-88467-188-7€ 72,–
Aleksandr I. Ajbabin
Archäologie und Geschichte der Krim im FrühmittelalterObwohl die Archäologie und Geschichte der byzantinischen Krim ein gutuntersuchtes Thema ist, wurden die Forschungsergebnisse jenseits des russischen Sprachraums nur schwach rezipiert. Die hier vorgelegte Mono -graphie des international renommierten Archäologen Aleksandr I. Ajbabin,die aus einem gemeinsamen Projekt des RGZM und der Ukrainischen Aka-demie der Wissenschaften hervorgegangen ist, soll dabei helfen, diesenwesentlich vom Spannungsverhältnis von Steppenvölkern und Byzanti -nischem Reich geprägten Raum neu und verstärkt wahrzunehmen. Diegründ lich überarbeitete und erweiterte Übersetzung des erstmals 1999 inrussischer Sprache erschienenen Werkes präsentiert dem deutschen Publi-kum eine umfassende Übersicht über das teilweise schwer zugänglichpublizierte Fundmaterial und seine Chronologie.
Monographien des RGZM, Band 891. Auflage 2011,
133 S. mit 8 Abb., 32 Farbtaf.,21×29,7cm,Hardcover, fadengeheftet
ISBN 978-3-88467-157-3€ 42,–
Stefan Albrecht · Michael Herdick (Hrsg.)
Im Auftrag des KönigsEin Gesandtenbericht aus dem Land der Krimtataren Die Tartariae descriptio des Martinus Broniovius(1579)
Die Tartariae descriptio des polnischen Gesandten Martinus Broniovius ausdem Jahre 1579 gilt als eine der ersten ausführlichen Darstellungen derKrim, ihrer gesellschaftlichen Struktur und Topographie, insbesondere aberder Höhensiedlung Mangup. Der hier erstmals in lateinisch-deutscher Aus-gabe und mit einem ausführlichen Kommentar vorgelegte Reisebericht desBroniovius gibt Auskunft über diese Region und kann helfen, konkretehistorische Akteure oder Orte zu identifizieren. Er lässt Kontinuitäten undDiskontinuitäten erkennen und hinterfragen und vermag auf einer struk -turgeschichtlichen Ebene analoge Interpretationsmodelle bereitzustellen. Darüber hinaus ist die Tartariae de scriptio Orientalisten eine wichtige Quellefür die Erforschung des Krim khanats.
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de
NEUERSCHEINUNGEN
Monographien des RGZM, Band 93306 S. mit 237 Abb., 6 Tab., 1 CD als Beil.,
21×29,7cm,Hardcover, fadengeheftetISBN 978-3-88467-173-3 (RGZM)
€ 60,–
Allard W. Mees
Die Verbreitung von Terra Sigillata aus den Manufakturen von Arezzo, Pisa, Lyon und La GraufesenqueIn den letzten Jahrzehnten des 1. Jahrhunderts v.Chr. gründeten einige inArezzo arbeitende Sigillata-Großproduzenten in Gallien Filialbetriebe fürden dortigen Absatzmarkt. Schon bald verdrängten diese die Mutterfirmenaus dem Geschäft. Diesen Prozess dokumentieren 230 Verbreitungskarten.Die Ausgründungen in Gallien werden in Zusammenhang mit der Entwick -lung der wirtschaftlichen Großräume dargestellt. Sie führten zu einer Trans-formation dieser ursprünglich italischen Industrie, die sich auch in einemgeänderten rechtlichen Status der Töpfer und Töpfereien in Gallien mani -festiert. Darüber hinaus wurden die Transportkosten mittels GIS-Anwen-dungen ermittelt und in Karten dargestellt. Datierte Fundorte ermöglicheneine zeitliche Einordnung der behandelten Töpfer.
Monographien des RGZM, Band 971. Auflage 2011,
174 S. mit 53 teils farb. Abb.,21×29,7cm,Hardcover, fadengeheftet
ISBN 978-3-88467-185-6€ 45,–
Thomas Schmidts
Akteure und Organisation der Handelsschifffahrt in den nordwestlichen Provinzen des Römischen ReichesIn der Antike wurde der Warentransport, wann immer dies möglich war,über Wasserwege abgewickelt – so auch in den von Mittelmeer, Atlantikund Nordsee umgebenen nördlichen Provinzen des Römischen Reiches.Hier bot ein dichtes Netz von Flüssen ideale Voraussetzungen für dieBinnenschifffahrt. Eine Reihe von Akteuren der Handelsschifffahrt kennenwir aus Inschriften. In den nördlichen Provinzen handelt es sich über -wiegend um Schiffseigner, die sich im Binnenland als nauta und an der gallischen Mittelmeerküste als navicularius bezeichnen. Die gallischen navi-cularii waren auch im westlichen Mittelmeerraum an Transporten zur Ver-sorgung der Hauptstadt Rom beteiligt. Die Studie untersucht ausgehendvom Inschriftenbestand die mit der Handelsschifffahrt befassten Berufs-gruppen und ihre Vereinigungen.
1. Auflage 2011, 356 S. mit 246 meist farb. Abb.,
21×28cm,Hardcover, fadengeheftetISBN 978-3-88467-186-3
€ 34,–
Benjamin Fourlas · Vasiliki Tsamakda
Wege nach ByzanzPublikation anlässlich der Ausstellung »Wege nach Byzanz« im Landesmuseum Mainz, vom 6. November 2011 bis zum 5. Februar 2012
Für das mittelalterliche Europa nahm Byzanz – das christianisierte und grä-zisierte oströmische Reich – in vielerlei Hinsicht den Status einer nach -ahmenswerten »Leitkultur« ein. Dennoch wird das byzantinische Erbe, dasin der orthodoxen Kirche und der griechischen Sprache bis heute lebendigist, in Westeuropa meist nicht als wesentlicher Teil der kulturellen IdentitätEuropas wahrgenommen. Der Titel »Wege nach Byzanz« ist mehrdeutig zuverstehen: Einerseits sind mit den »Wegen« tatsächliche Annäherungen andas Byzantinische Reich und seine Kultur gemeint (z. B. über Pilger- undHandelswege, diplomatische Kontakte, Kreuzzüge), andererseits geistes-und rezeptionsgeschichtliche Zugänge. Breiten Raum nehmen die »Wegeder Forschung« ein. Hier werden die Quellen, methodische Grundlagenund Erkenntnismöglichkeiten über die byzantinische Kultur thematisiert.Das Buch ist als Begleitband und Katalog zur gleichnamigen Ausstellung imLandesmuseum Mainz konzipiert. Die Einträge zu den über 100 Exponatenvermitteln Einblicke in zentrale Aspekte der byzantinischen Kultur jenseitsder geläufigen Klischees.
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de
NEUERSCHEINUNGEN
Monographien des RGZM, Band 92268 S. mit 270 meist farb. Abb.,
21×29,7cm,Hardcover, fadengeheftetISBN 978-3-88467-172-6 (RGZM)
€ 76,–
Ljudmila Pekarska
Jewellery of Princely KievThe Kiev Hoards in the British Museum and The Metropolitan Museum of Art and Related Material
In the capital of Kievan Rus’, princely Kiev, almost 70 medieval hoards havebeen discovered to date. The hoards contained gold and silver jewellery ofthe ruling dynasty, nobility and the Christian Church. They were unique toKiev and their quantity and magnificence of style cannot be matched by anything found either in any other former city of Rus’, or in Byzantium. Mostof the objects never had been published outside the former Soviet Union.During the 17th-20th centuries, many medieval hoards were gradually un -earthed; some disappeared soon after they were found. This book providesa complete picture of the three largest medieval hoards discovered in Kiev:in 1906, 1842 and 1824, and traces the history and whereabouts of otherlost treasures. Other treasures took pride of place in some of the world’stop museums. This publication highlights the splendid heritage of medievalKievan jewellery. It illustrates not only the high level of art and jewellerycraftsmanship in the capital, but also the extraordinary religious, political,cultural and social development of Kievan Rus’, the largest and most power ful East Slavic state in medieval Europe.
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de
NEUERSCHEINUNGEN
RGZM – Tagungen, Band 51. Auflage 2011,
310 S. mit 15 Farb- u. 157 sw-Abb.,21×29,7cm,Softcover, fadengeheftet
ISBN 978-3-88467-178-8€ 45,–
Alessandro Naso (ed.)
Tumuli e sepolture monumentali nella protostoria europeaAtti del convegno internazionale, Celano, 21-24 settembre 2000
Grabhügel und monumentale Grabformen sind in mehreren europäischenGebieten vorhanden und haben immer wieder das Interesse der Forschunggeweckt, insbesondere was die vorrömische Zeit betrifft. Die Denkmälerverschiedener Regionen Italiens und einiger europäischer Länder werdenhier erstmals gesammelt vorgestellt. Die Abfolge der einzelnen Beiträgeerfolgt nach geographischen Kriterien. Oberitalien ist durch die nord-öst-lichen und nord-westlichen Gebiete bis hin zur Emilia-Romagna vertreten.Mittelitalien wird repräsentiert durch das nördliche und südliche Etrurien,das südliche Latium und Kampanien. Unteritalien ist durch Beiträge überApulien, das in Daunien und Peuketien aufgeteilt ist, Kalabrien, Sizilien undSardinien vertreten. Als Vergleiche werden vorgeschichtliche Grabhügel sobedeutender europäischer Nationen wie Deutschland und Spanien mit ein-bezogen. Die Dokumentation der Denkmäler, die hier z. T. das erste Malvorgestellt wird, bildet einen originellen Beitrag, der sich daran beteiligensoll, gemeinsame und unterschiedliche Charakteristika der europäischenEliten der Vorgeschichte bestimmen zu können.
Monographien des RGZM, Band 90302 S. mit 151 z. T. farb. Abb.,
15 Plänen, 4 Listen, 23 Taf.,21×29,7cm,Hardcover, fadengeheftet
ISBN 978-3-88467-158-0€ 86,–
Frank Gelhausen
Siedlungsmuster der allerødzeitlichen Federmesser-Gruppen in Niederbieber, Stadt NeuwiedDer Ausbruch des Laacher See-Vulkans um 11000 v.Chr. hat mit einermäch tigen Bimsdecke die Landschaft am Mittelrhein versiegelt. In einerunvergleichlichen Momentaufnahme blieben so das Geländerelief, dieReste von Vegetation und Fauna erhalten, dazu viele Hinweise auf die Nutzung der Region durch den Menschen. Der Fundplatz Niederbieber istdabei für archäologische Untersuchungen von herausragender Bedeutung.Hier konnte auf einer ca.1000m2 großen Fläche eine beträchtliche Zahl vonFundkonzentrationen freigelegt werden, die Einblick in die sonst kaum zufassenden Siedlungsprozesse der späteiszeitlichen Federmesser-Gruppener möglichen. Der Autor hat in seinem Buch die Funde und Befunde deszentralen Flächenteils von Niederbieber analysiert. Die Ergebnisse seinerUntersuchungen liefern neue Erkenntnisse über die vor Ort ausgeführtenTätigkeiten, die Belegungsdauer der Fundkonzentration sowie die Lebens-weise der Menschen am Ende der Eiszeit.
Neuerscheinungen
Monographien des RGZM
St. Albrecht u. M. Herdick (Hrsg.) Im Auftrag des Königs. Ein Gesandtenbericht aus dem Land der Krimtataren – Die Tartariae descriptio des Martinus Broniovius (1579) Band 89 (2011); 133 S. mit 8 Abb., 32 Farbtaf.ISBN 978-3-88467-157-3 42,– €
F. GelhausenSiedlungsmuster der allerødzeitlichenFedermesser-Gruppen in Niederbieber, Stadt NeuwiedBand 90 (2011); 302 S. mit 151 z. T. farb. Abb., 15Plänen, 4 Listen, 23 Taf.ISBN 978-3-88467-158-0 86,– €
L. PekarskaJewellery of Princely Kiev – The Kiev Hoards in the British Museum and The MetropolitanMuseum of Art and Related MaterialBand 92 (2011); 268 S. mit 270 meist farb. Abb.ISBN 978-3-88467-172-6 76,– €
A. W. MeesDie Verbreitung von Terra Sigillata aus den Manufakturen von Arezzo, Pisa, Lyonund La GraufesenqueBand 93 (2011); 306 S. mit 237 Abb., 6 Tab., 1 CD als Beil.ISBN 978-3-88467-173-3 60,– €
Th. SchmidtsAkteure und Organisation der Handelsschifffahrtin den nordwestlichen Provinzen des Römischen ReichesBand 97 (2011); 174 S. mit 53 teils farb. Abb.ISBN 978-3-88467-185-6 45,– €
RGZM – Tagungen
A. Naso (ed.)Tumuli e sepolture monumentali nella protostoria europea – Atti del convegnointernazionale, Celano, 21-24 settembre 2000Band 5 (2011); 310 S. mit 15 Farb- u. 157 sw-Abb.ISBN 978-3-88467-178-8 45,– €
D. Quast (Hrsg.)Weibliche Eliten in der Frühgeschichte – Female Elites in Protohistoric EuropeBand 10 (2011); 416 S. mit 192 z. T. farb. Abb., 12 Tab.ISBN 978-3-88467-164-1 68,– €
F. Daim, D. Gronenborn u. R. Schreg (Hrsg.)Strategien zum Überleben – Umweltkrisen und ihre BewältigungBand 11 (2011); 322 S. mit 11 Abb., 4 Tab.ISBN 978-3-88467-165-8 49,– €
Mosaiksteine. Forschungen am RGZM
D. Gronenborn (Hrsg.)Gold, Sklaven und Elfenbein –Mittelalterliche Reiche im Norden NigeriasBand 8 (2011); 120 S. mit 129 meist farb. Abb. Alle Texte in deutscher und englischer Sprache.ISBN 978-3-88467-177-1 20,– €
Populärwissenschaftliche Reihe
E. KünzlMonumente für die Ewigkeit –Herrschergräber der Antike(2011); 136 S., 150 meist farb. Abb.ISBN 978-3-88467-176-4 24,95 €
Ältere Publikationen sind in der Regel ebenfalls noch lieferbar. Unser komplettes Publikations -
verzeichnis finden Sie im Internet auf unserer Homepage (www.rgzm.de) oder können es beim
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Forschungsinstitut für Archäologie, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz, Tel.: 06131/ 9124-0, Fax: 06131/ 9124-199, E-Mail: [email protected], kostenlos anfordern. Seinen Autoren gewährt der Verlag des RGZM einen
Rabatt von in der Regel 25% auf den Ladenpreis.