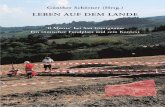Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen
-
Upload
rwth-aachen -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen
Raban von Haehling • Andreas Schaub (Hrsg.)
Römisches Aachen
Archäologisch-historische Aspekte zu Aachen
und der Euregio
Sonderdruck aus
Bibliograische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliograie; detaillierte bibliograische Daten
sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrubar.
1. Aulage 2013
© 2013 Verlag Schnell & Steiner GmbH, Leibnizstr. 13, D-93055 Regensburg
Umschlaggestaltung: Uschi Ronnenberg, Aachen und Anna Braungart, Tübingen
Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau
Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Berlin
ISBN 978-3-7954-2598-2
Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages
ist es nicht gestattet, dieses Buch oder Teile daraus auf fotomechanischem
oder elektronischem Weg zu vervielfältigen.
Weitere Informationen zum Verlagsprogramm erhalten Sie unter:
www.schnell-und-steiner.de
Umschlagabbildung: Rekonstruierte römische Säulen-Arkadenarchitektur in Aachen
T R E U H A N D
Steue
rber
ater
vere
id. Buc
hprü
fer
Inhalt
Raban von Haehling
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Johannes Heinrichs
Der Raum Aachen in vorrömischer Zeit (ca. 200 – 1 v. Chr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
David Engels
Nullus enim fons non sacer.
Überlegungen zur Nutzung der Aachener Quellen in vorrömischer Zeit . . . . . . . . . 97
Andreas Schaub
Aachen in römischer Zeit aus archäologischer Sicht – Versuch einer Neubewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Jens Köhler
Aachen und die römischen hermalbäder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Andreas Schaub
Tempel für Kybele und Isis in Aachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Helga Scholten
Urbanität und Romanisierung – eine siedlungs historische Einordnung Aachens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Jörg Fündling
Grenzland – aber welches?Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Dietmar Kottmann
Beobachtungen zum römischen Wegenetz im Aachener Umland . . . . . . . . . . . . . . . 343
Karl Leo Noethlichs
Das Umfeld des römischen Aachen anhand von Inschriten der Nachbarsiedlungen in der Belgica und Germania Inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Titus Panhuysen
Eine kurze Geschichte Maastrichts – von der Römerzeit bis ins Mittelalter . . . . . . . 369
Alain Vanderhoeven
Die römische Stadt Tongeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Glossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Farbabbildungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Abbildungsnachweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Herausgeber und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Jörg Fündling
Grenzland – aber welches?
Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit
des römischen Aachen
Auf oder an einer Grenze – wenn nicht gleich an zwei oder drei – zu liegen ist über lange Epochen der Geschichte Aachens hinweg geradezu ein Markenzeichen der Stadt gewor-den. Die unschuldige Frage „Wo lag Aachen in der Römerzeit?“, geographisch leicht zu beantworten, führt uns mitten in ein größeres Problem der römischen Provinzial-geschichte, zu dem das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, und in die Ausläufer einer Kontroverse, die in vergangenen Forschergenerationen nicht immer so rein sachlich fundiert war, wie es den Beteiligten wohl vorkam: zur Wahl standen und stehen ja eine ‚belgische‘ und eine ‚germanische‘ Zuordnung.1
Die Debatte um die territoriale Zugehörigkeit Aachens und seiner näheren Umge-bung etwa von der Geul (/Gueule/Göhl) bis zur Inde ist im Sinne der Geschichtspolitik also nicht ganz unverfänglich. Zumindest vorstellbar ist eine Verwandtschat mit jenem berühmten Bronzeadler auf dem Dach der Pfalzkapelle, den mal der spätkarolingische König von West-, mal der ottonische Herrscher in Ostfranken so drehte, dass er dem Reich des anderen zu drohen schien… eine in Zeiten deutsch-französischer ‚Erbfeind-schat‘ gern ausgeschlachtete Szene. Wir leben in glücklicheren Jahren und dürfen frei von Annexionsängsten wie –wünschen als gute Europäer experimentieren, wohin wir Aachen während der Hohen Kaiserzeit sinnvollerweise blicken lassen.2
1 Für die Fragestellung und die Gelegenheit, mit ihr zu ringen, bin ich Prof. Dr. Raban von Haeh-ling überaus dankbar. Wie so ot habe ich auf den Scharfsinn von Jens Bartels (Zürich) zu-rückgreifen können. – Grundlegend für das Folgende sind namentlich die Beiträge in ho-mas R. Kraus (Hrsg.), Aachen von den Anfän-gen bis zur Gegenwart. Band I: Die natürlichen Grundlagen. Von der Vorgeschichte bis zu den Karolingern, Aachen 2011.
2 Der Überfall König Lothars von Westfranken auf Otto II. im Sommer 9l8, der den Kaiser
uchtartig aus Aachen vertrieb, war politisch nur ein Augenblickserfolg; Ereignis und Adler-
szene berichtet Richer von Reims, Historia 3,l1 (ed. R. Latouche, vol. II. Paris ²19k4); ein Echo mit mehreren Veränderungen (so steht der Ad-ler, bei Richer in vertice palatii, nun in orientali parte der Palastaula): hietmar von Merseburg, Chron. 3,8 ed. W. Trillmich (FSGA Bd. 9.) Darmstadt l1992, S. 92. Die schon bei Richer vorgezeichnete Konkurrenz der Galli und Ger-mani, faktisch ein bloßer Streit um den Besitz von Lotharingien, sah sich in der Hochzeit des Nationalismus – und nicht zufällig während der belgischen Besatzungszeit– mit grellen Farben ausgemalt; vgl. unten 3. b) mit Anm. 38.
298 · Jörg Fündling
Klare Verhältnisse herrschen vor der Ablösung der militärisch geprägten Territorien links des Rheins als (spätere Doppel-)Provinz Germania, die etwa mit dem Oberbefehl des Drusus (12–9 v. Chr.) begann und mit der oiziellen Bildung der beiden germani-schen Provinzen ihren Abschluss erreichte – nach gängiger Ansicht spätestens um 85 n. Chr., möglicherweise aber bereits zur Zeit des Tiberius. Rechtlich gehörte Aachen bis dahin zur noch jungen Gallia Belgica – ihrerseits geschafen zwischen Agrippas Statt-halterschat 2l und Augustus’ Gallienaufenthalt 1k–13 v. Chr.3 Klarheit besteht eben-falls für die Spätantike seit Diocletian (284/5–305): Die Zugehörigkeit der gesamten Region zur Provinz Germania II mit Verwaltungssitz in der Colonia Claudia Ara Agrip-
pinensium (CCAA, Köln) steht außer Frage (Abb. 1). Für die beiden dazwischenliegen-den Jahrhunderte stehen zwei Antworten zur Wahl: die Gallia Belgica, Hinterland der Rheingrenze, mit Durocortorum (Reims) als Sitz des Statthalters oder die stark vom Militär geprägte Germania inferior mit der Hauptstadt Köln4
Die Entscheidung zwischen beiden Provinzen ist bei näherem Hinsehen untrennbar von der Frage, welcher politische Charakter der Aachener Siedlung zukam. Das Umland jedenfalls wurde sehr früh in groß ächigen civitates organisiert: spätestens 1k–13 v. Chr., vielleicht sogar schon während Agrippas zweiter Statthalterschat in Gallien (20–18) ist die Konstitution der civitas Tungrorum anzusetzen, deren Hauptort Tongeren bereits um 10 v. Chr. einen planmäßigen Straßengrundriss erhielt. Für das oppidum Ubiorum
an der Stelle des küntigen Köln, dessen Einwohner Agrippa aufs linke Rheinufer ver-p anzte, gilt dieselbe Zeitstufe.5
3 Zur Anfangsphase römischer Präsenz im Aache-ner Raum Klaus Scherberich, Historische Vor-aussetzungen für die Gründung von Aachen/Aquae Granni, in: Kraus (Hrsg.), Aachen I (wie Anm. 1), S. 230–243. Errichtung der Germania inferior um 85 (jedenfalls zwischen 82 und 90): vgl. etwa Werner Eck, Köln in römischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen des Imperium Romanum (Geschichte der Stadt Köln 1), Köln 2004, S. 21l–221.; K. L. Noethlichs, Aquae Granni im 2. und 3. Jh.: von Domitian bis Diokletian. Historische Voraussetzungen und Hintergründe, in: Kraus (Hrsg.), Aachen I (wie Anm. 1), S. 301–323, dort S. 302 entsprechend der communis opi-nio (Existenz zweier germanischer Heeresbezirke mit quasiprovinzialem Status von ca. 14 n. Chr. bis in domitianische Zeit).Vgl. jetzt Frank M. Ausbüttel, Die Gründung und Teilung der Pro-vinz Germania, in: Klio 93 (2011), S. 392–410 (mit reichhaltiger Literatur), der mit starken Argu-menten für die Einrichtung einer linksrheini-schen Provinz Germania um 1k v. Chr. und deren Teilung als Neuordnung nach der Varusschlacht (10–14 n. Chr.) plädiert.
4 Gründung der Tres Galliae: vgl. Cass. Dio 53,22,5 für den terminus post quem 2l v. Chr. mit Marie-hérèse Raepsaet-Charlier, Les Gaules et les Ger-manies, in: Claude Lepelley (Hrsg.), Rome et l’intégration de l’Empire, 44 av. J.-C.-2k0 ap. J.-C.Tome 2: Approches régionales du Haut-Em-pire romain, Paris 1998, S. 143–195 (dt.: Gallien und Germanien, in: Claude Lepelley [Hrsg.], Rom und das Reich 44 v. Chr. – 2k0 n. Chr. Die Regionen des Reiches, München/Leipzig 2001 [ND Hamburg 200k], S. 151–210); dort S. 153. Die spätantike Germania secunda (Germania II) schloss die Tungri (zu deren vorheriger Provinz-zugehörigkeit vgl. unten) ausdrücklich ein: Ammian 15,11,l; Not. Dign. occ. 42,43. Marie- hérèse Raepsaet-Charlier, La cité des Tongres sous le Haut-Empire. Problèmes de géographie historique, in: BJ 194 (1994), S. 50 nannte 29l als wahrscheinliches Datum dieser Zuordnung.
5 Einrichtung der civitates: Marie-hérèse Raep-saet-Charlier, Cité et municipe chez les Tongres, les Bataves et les Canninéfates, in: Ktèma 21 (199k), S. 251–2k9; dort S. 254 (Überblick für die Rheinzone und die nördliche Belgica). Da-
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 299
Der Einzugsbereich einer civitas deckte sich mit dem Territorium eines oder mehre-rer vorrömischer (respektive neu entstandener oder von den Römern neu angesiedelter) Stämme. Hauptort und Verwaltungssitz konnte eines der Dörfer oder Städtchen ohne eigenen Rechtscharakter (vici) innerhalb des civitas-Territoriums sein. Allerdings ent-stand in den meisten Fällen früher oder später ein ausgeprägtes Zentrum mit den Infra-
tierung des oppidum Ubiorum als Stadt zwi-schen 20 und 10 v. Chr.: etwa Hartmut Galste-rer, Von den Eburonen zu den Agrippinensiern. Aspekte der Romanisierung zwischen Rhein, Maas und Mosel, in: Alma Mater Aquensis. Be-richte aus dem Leben der Rheinisch-Westfäli-schen Technischen Hochschule Aachen 24 (198l/88), S. 138; mit ergänztem Apparat, leich-ten Änderungen und neuem Schluss ab S. 140 (= S. 125 neu) abgedruckt als „Von den Eburonen zu den Agrippinensern. Aspekte der Romanisa-
tion am Rhein, in: KJ 23 (1990), S. 11l–12k (frz.: Des Éburons aux Agrippiniens: aspects de la romanisation en Rhénanie, in: CCG 3 (1992). Festlegung der civitas-Grenzen spätestens mit dem gallischen census von 12. v. Chr. (a.a.O. 13l). Zur Vorgeschichte des Stammes und zu Grundfragen der Fundauswertung Johannes Heinrichs, Ubier im Oppidum Ubiorum. Me-thodische Überlegungen zu einem Desiderat – und zu Funden von der Kölner Rheininsel, in: KJ 43 (2010), S. 315–331.
Abb. 1: Grenzen der spätantiken Germania II nach Heinz Günter Horn
300 · Jörg Fündling
strukturmerkmalen einer Stadt, weiter aufgewertet durch eine Form der römischen Stadtverfassung, also zum municipium, mit latinischem Bürgerrecht und einer politi-schen Führung aus römischen Vollbürgern, oder sogar zur colonia, deren Träger sich komplett aus römischen Bürgern zusammensetzten (wie es mit Köln im Jahre 50 n. Chr. geschah). Die civitas-Bevölkerung als Ganzes nahm wohlgemerkt nicht automatisch an diesem Aufstieg teil: ihre große Mehrheit verblieb im Status von „Nichtbürgern“ (pere-
grini) neben dem Kreis der privilegierten Städter und hatte weiterhin nur Rechte als civitas-Bürger. Nur wurde die civitas als politische Einheit – falls sie als solche über-haupt neben einem Zentralort mit römischem Stadtrecht fortexistieren konnte, was un-klar ist – in solchen Fällen mit der Zeit von der juristisch und steuerrechtlich begünstig-ten ‚Konkurrenz‘ absorbiert. Flächendeckend war diese ‚Verstädterung‘ aber keineswegs, und ‚klassische‘ civitates gallorömischen Typs mit mehr oder weniger klar deiniertem Hauptort bestanden neben den stadtzentrierten Formen weiter.k
Deutlich häuiger als zur Annahme einer eigenen civitas mit Sitz in Aachen – über dessen römisches Bild bis vor kurzem wenig bekannt war, das eine solche Vermutung stützen konntel – hat die Forschung dazu geneigt, den Bezugspunkt in einem der zwei nächstgelegenen urbanen Zentren zu suchen. Wer vor dieser Alternative steht, muss außerdem noch die Entscheidung trefen, ob man Aachen zum Gebiet des keltisch-germa-nischen Stammes der Sunucer zählt, dessen mutmaßliches Hauptheiligtum nahe Korneli-münster ergraben wurde, und auf welcher hierarchischen Ebene man diesen Stamm in der ethnisch-politischen Gliederung der weiteren Umgebung ansiedeln will. (Abb. 2)
Folgende – unbequem zahlreiche – Möglichkeiten resultieren daraus:1. Der engere Aachener Raum, in diesem Fall im Territorium der Sunucer, war Teil-
gebiet der civitas Ubiorum und wurde von deren Hauptort, der CCAA, aus verwaltet, zählte also auf jeden Fall zur Germania inferior.
k Zum Fall der CCAA vgl. nur Christoph B. Rü-ger, Germania inferior. Untersuchungen zur Territorial- und Verwaltungsgeschichte Nieder-germaniens in der Prinzipatszeit (Beihete BJ 30), Köln/ Graz 19k8, S. lk–l8; tendenziell ge-gen eine parallele ubische Verwaltungsinstitu-tion Eck, Köln (wie Anm. 3), S. 152–1k1. Die Weiterentwicklung der territorialen Ordnung auf Lokalebene ist in vielen Fällen kaum belegt und problematisch; vgl. nur Friedrich Vitting-hof, Die politische Organisation der römischen Rheingebiete in der Kaiserzeit, in: Convegno internazionale Renania Romana (Atti dei con-vegni dell’ accademia nazionale dei Lincei 23), Rom 19lk, S. l3–94; jetzt in: Friedrich Vitting-hof, Civitas Romana. Stadt und politisch-sozi-ale Integration im Imperium Romanum der
Kaiserzeit (Hrsg. Werner Eck), Stuttgart 1994, S. kk–88. Zur Gemeindeverfassung Hartmut Galsterer, Wie funktioniert eine römische Stadt? Die administrative Infrastruktur römi-scher Gemeinden, in: KJ 43 (2010), S. 25l–2k5.
l Vgl. nun Andreas Schaub, Archäologische Be-funde in Aachen und Burtscheid, in: Kraus (Hrsg.), Aachen I (wie Anm. 1), S. 251–300 [zi-tiert als: Schaub 2011a]; ders., Die Stadtentwick-lung des römischen Aachen im 2. und 3. Jahr-hundert aus archäologischer Sicht, in: Kraus (Hrsg.), Aachen I (wie Anm.1), S. 324–38l [= Schaub 2011b]; ders., Aachen von der spätrömi-schen bis in die frühmittelalterliche Zeit aus archäologischer Sucht, in: Kraus (Hrsg.), Aa-chen I (wie Anm. 1), S. 405–423 [= Schaub 2011c].
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 301
2. Er war Teilgebiet der civitas Tungrorum mit dem späteren municipium Atuatuca
(Tongeren) als Hauptort8, womit er – so die Mehrheitsmeinung bis in jüngere Zeit – entweder zur Gallia Belgica gehörte oder – dies die Mehrheit der letzten 15 Jahre – ebenfalls zur Germania inferior. Die Grenze zum Gebiet der Sunucer wird aus dieser Sicht in vielen, aber nicht allen Fällen knapp östlich von Aachen gezogen.
3. Aachen selbst bildete einen Teil und in diesem Fall vielleicht den Hauptort einer – vermuteten, aber nicht belegten – civitas (Sunucorum?), deren Provinzzugehörigkeit wiederum zu diskutieren bleibt.
Die Hilfe eindeutiger Belege bleibt uns dabei bis auf weiteres versagt. Als würdiger Auf-takt zu einer langen Kette von Zweifelsfällen sei auf eine 19k1 am Aachener Dom ent-deckte Inschrit verwiesen, die einen Statthalter der Belgica erwähnen dürte, aber über-
8 Zu Atuatuca/ Tongeren vgl. den Beitrag von Alain Vanderhoeven im vorliegenden Band.
Abb. 2: Topographie der Aachener Umgebung nach R. J. A. Talbert
302 · Jörg Fündling
dies eventuell noch die Germania inferior nennt. Diese mutmaßliche Bauinschrit blieb so irritierend unvollständig, dass es ohne weiteres möglich war, sie für die weitere Debatte um die Zuordnungsfrage zu übergehen. Ein interpretativer Schnellschuss in den „Aachener Nachrichten“ erkannte in ihr allerdings den Grenzstein beider Provin-zen, womit unser Problem gelöst wäre – eine mögliche Verschleppung des Steins einmal außer Acht gelassen, hätte die Klappergasse zur Belgica und die Krämerstraße zur Germania inferior gehört.9
Dass römische Provinzgrenzen so gut wie gar nicht markiert wurden, ist in der Tat eine unverzeihliche Nachlässigkeit, unter der wir heute noch zu leiden haben. Leider ist es aber so, und uns bleibt nichts übrig, als Indizien zu sammeln, angefangen mit der kleinsten ethnisch–sozialen (und territorialen?) Einheit, die in unmittelbarer Nähe Aachens bekannt ist, dem Stamm der Sunucer.
1. Die Sunucer – Ein Stamm sucht klare Verhältnisse
1.1 Ist Aachen sunucisch?
Die antiken Zeugnisse zur Existenz der Sunuci – erzählende Quellen wie epigraphische Überlieferung – sind äußerst überschaubar. Für den militärischen Stellenwert des Stam-mes geben sie einige Anhaltspunkte; sein ungefähres Siedlungsgebiet kann nur indirekt erschlossen werden. Seit den Tagen, in denen die Forschung „der Sunuci etwa in der Nähe von Jülich“ ohne vorzeigbare Details gedenken musste, sind immerhin Fort-schritte erzielt worden. Die heute gültige Grundposition leitet sich hauptsächlich aus mehreren Arbeiten von Harald von Petrikovits ab. Danach wäre die civitas-Grenze der Tungrer zu ihren östlichen Nachbarn in der mittelalterlichen Diözesangrenze des Bis-tums Tongeren (später Maastricht, noch später Lüttich) zum Erzbistum Köln zu suchen. Diese iel bei Aachen mit dem Lauf der Wurm zusammen. In Petrikovits’ Altertums-band der Rheinischen Geschichte erscheinen die Sunucer folgerichtig unter den civitates
der Germania inferior und der Stammesname ist zwischen Geul und Ert eingetragen, entsprechend dem Kernbereich der wenigen Inschritenfunde mit dem Namen der
9 Inschrit: AE 19lk, 511; über die vielen Unwäg-barkeiten Werner Eck, Ein fragmentarischer epigraphischer Text aus Aachen, in: Epigraphi-sche Studien 11, Köln/ Bonn 19lk, S. 43–4l. Vgl. den Zweifel bei Werner Eck, Die Struktur der Städte in den nordwestlichen Provinzen und ihr Beitrag zur Administration des Reiches, in: Werner Eck/Hartmut Galsterer (Hrsg.), Die Stadt in Oberitalien und den nordwestlichen Provinzen des römischen Reiches. Deutsch-ita-lienisches Kolloquium, Mai 1989 (Kölner For-
schungen 4), Mainz 1991, S. l3–84, jetzt in: Werner Eck, Die Verwaltung des Römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit Band 2, Basel/ Berlin 1998, S. 2l9–29k, bes. S. 292f., ob Aachen nicht doch Teil der Germania inferior war. Vor-schlag einer Neulesung als Aufmerksamkeit des niedergermanischen exercitus für den Nach-barstatthalter: Noethlichs, Aquae Granni (wie Anm. 3), S. 312f. Grenzstein: E. Quad ieg, Aa-chener Nachrichten Nr. 109 (Mai 19k1), S. 14, zitiert nach Eck a.a.O.
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 303
Göttin Sunux(s)al „etwa zwischen Zülpich und Aachen“; später bescheinigte ihnen Petri kovits „einen gewissen Schwerpunkt im Indetal“. In der Aachener lokalhistori-schen Literatur wies Erich Stephany 19k0 das engere Stadtgebiet „einem keltisch-belgi-schen Volksstamm“ mit der Wurm als Grenze zu den Ubiern zu; der Domkapitular meinte die Tungrer – die Sunucer ordnete er entweder stillschweigend den Ubiern unter oder sie entgingen der Aufmerksamkeit seiner stark geraten Chronik.10
In vielen Details bleiben gleichwohl unwillkommene Ermessensspielräume oder zwingen bekannte antike Regelungen zum Nachdenken. Christoph B. Rüger etwa sie-delte auf seiner sehr detaillierten Karte von 19k8 (Abb. 3) das Sunucer-Gebiet „im Wes-ten der Ubier, zumindest westlich der Rur, doch wohl sogar noch halbwegs zwischen Rur und Ert“ an – genauer im Zwickel zwischen Wurm und Rur, wobei es westlich ei-nen schmalen Streifen jenseits der Wurm sowie Teile des Ostufers der Rur inklusive Jülich (Iuliacum) einschließt. Für seine Abgrenzung der Sunucer von den Ubiern stützte Rüger sich auf in den Arbeiten Leo Weisgerbers angewandte linguistische Kriterien und zog „eine Linie, die in einem Bogen von Münstereifel über Zülpich in Richtung Düren und von dort zum Ertknie bei Morken-Harf verläut.“ Aachen selbst scheint dabei auf der Grenze der Sunuci zum pagus Catual(inus?) zu liegen, der für das 2. und 3. Jh. belegt ist. Die Provinzgrenze selbst setzte Rüger als Ostgrenze der civitas Tungrorum einige
Kilometer westlich der Maas an und ließ sie von dort aus durch einen Punkt unmittel-bar südlich von Aachen verlaufen. Eine exakte Festlegung erschwere die mögliche Exis-tenz eines tractus Arduinnae im späteren Bergbaugebiet der Nordeifel und der Arden-nen, einer mutmaßlichen kaiserlichen Domäne, die beiderseits der Provinzgrenze
10 „der Sunuci…“: Ernst Stein, Die kaiserlichen Beamten und Truppenkörper im römischen Deutschland unter dem Prinzipat, Wien 1932, S. 5. Konservierte civitas-Grenzen: Harald von Petrikovits, Die Wohnsitze der Germanen am linken Niederrhein nach antiken Quellen. Rhei-nische Vorzeit in Wort und Bild 1 (1938), S. 83–90; ders., Rheinische Geschichte 1,1: Altertum (Hrsg. Franz Petri, Georg Droege). Düsseldorf ²1980, S. 112–114. Die für diese heorie gele-gentlich zitierte, leichter zugängliche Arbeit: ders., Reichs-, Macht- und Volkstumsgrenze am linken Niederrhein im 3. und 4. Jahrhundert n. Chr., in: Harald von Petrikovits/Albert Steeger (Hrsg.), Festschrit für A. Oxé zum l5. Geburts-tag, Darmstadt 1938, S. 220–240 = ders., Bei-träge zur römischen Geschichte und Archäolo-gie 1931 bis 19l4 (BJ Beihet 3k), Bonn 19lk, S. k9–88, beschätigt sich u. a. mit der fakti-schen Nordgrenze des von Rom noch gesicher-ten Provinzgebietes, die von Petrikovits entlang der großen Fernstraße bei Heerlen ausmachen wollte (a.a.O., S. l8), aber nicht mit den Diöze-
sangrenzen. „etwa zwischen…“: von Petriko-vits, Rheinische Geschichte (s. o.), S. 112; Karte: S. 113 Abb. 21. Eng daran angelehnt Heinz Cüp-pers, Beiträge zur Geschichte des römischen Kur- und Badeorts Aachen, in: Aquae Granni. Beiträge zur Archäologie von Aachen (Rheini-sche Ausgrabungen 22), Köln 1982, S. 1–l5; dort S. 4: Tungri im Westen „wenigstens bis zur Wurm“, die als Grenz uss diene, „[u]nter der Voraussetzung, daß die späteren Diözesangren-zen älteren Stammesgrenzen entsprechen“; „ei-nen gewissen…“: Harald von Petrikovits, Ger-mani cisrhenani, in: Heinrich Beck (Hrsg.), Germanenprobleme in heutiger Sicht (RGA Erg.-Bd. 1.), Berlin/ New York 198k, S. 88–10k; zitiert nach: Harald von Petrikovits, Beiträge zur römischen Geschichte und Archäologie II. 19lk–1991, Köln/ Bonn 1991, S. 321–333; dort S. 32k. „einem keltisch-belgischen…“: Erich Ste-phany, Die Jahre bis 1250, in: Bernhard Poll (Hrsg.), Geschichte Aachens in Daten, Aachen ²19k3, S. 23–43; dort S. 23. Sunuxsal: zur Kult-verbreitung vgl. Eck, Köln (wie Anm. 3), S. 49kf.
304 · Jörg Fündling
gelegen haben müsse; dort hätten „zumindest teilweise“ weitere Sunucer außerhalb des eigentlichen Stammesgebietes gesiedelt.11
Gleich die erste Beikarte, die im gern konsultierten Handbuch Die Römer in Nord-rhein-Westfalen den Grenzverlauf der Germania inferior zeigt, warnt in ihrer Legende „Provinzgrenze (vermutet)“ (Abb. 4). Dort wechselt die civitas- und Provinzgrenze zu den Tungri um Atuatuca genau auf der Lutlinie zwischen Aachen und Tongeren auf das Westufer der Maas; sie ähnelt durch einen historischen Zufall damit der heutigen niederländisch-belgischen Grenze durch Limburg (einem Artefakt des Londoner Proto-kolls von 1839, das aus strategischen Erwägungen einen – damaligen – Kanonenschuss weit westlich der Maas verläut).12
Sicher ist die Zugehörigkeit von Coriovallum (Heerlen) und Valkenburg zur Colonia
Ulpia Traiana, da an beiden Orten Inschriten von Xantener Magistraten gefunden wurden, dazu die Existenz des ebenfalls nicht tungrischen pagus Catualinus knapp westlich der Maas. An diese Linie anschließend ixierte Marie-hérèse Raepsaet-Char-lier, wieder von den späteren Diözesangrenzen ausgehend, den Schnittpunkt der tung-rischen Gebietsgrenze mit der Maas entweder bei Maastricht oder etwas nördlich davon. Anschließend verlaufe die Linie nach Südwesten, und „le cours de la Gueule pourrait donner une frontière acceptable“, weil der Bach die Zone der Sunuxsal-Kultfunde und also das Sunuci-Gebiet „entre Wurm, Rur et Ert“ ausspart (Abb. 5). Von der Geul bis zur Our liege die Grenze etwa entlang der Wasserscheide zwischen Rhein und Maas weiter nach Südosten bis Süden. Damit hätten wir ein sunucisches Siedlungsgebiet „von der Göhl […] bis Zülpich“ vor uns, in das Aachen eindeutig gehörte – anders als im älteren Modell des Ehepaares Raepsaet-Charlier, nach dem Aachen noch tungrisch war, Varnenum(?)/ Kornelimünster hingegen schon ubisch (wohl mit den Sunucern als ubi-scher Teileinheit); die dortigen Weihungen an Sunux(s)al machen diesen Tempelbezirk zu einem der wenigen Fixpunkte bei der territorialen Festlegung.13
11 Rüger, Germania inferior (wie Anm. k), Karte: S. 3k; „im Westen…“: S. 99; „eine Linie…“: S. 82; pagus Catualinus: S. 40; tractus Arduinnae: S. 42–44, „zumindest…“: S. 100.
12 Karte: Jürgen Kunow, Die Militärgeschichte Niedergermaniens, in: Heinz Günter Horn (Hrsg.), Die Römer in Nordrhein-Westfalen, Stuttgart 198l, S. 2l–109; dort S. l0, Abb. 39 (vgl. auch S. 140, Abb. lk und die späteren Bei-karten mit identischem Verlauf).
13 Bistums- analog civitas-Grenze: dem folgte schon Marcel-Édouard Mariën, L’empreinte de Rome. Belgica antiqua, Antwerpen 19l4, S. 59 mit 4l4f. (Karte). Marie-hérèse et Georges Raepsaet-Charlier, Gallia Belgica et Germania Inferior. Vingt-cinq années de recherches histo-riques et archéologiques, in: ANRW II 4, Berlin/New York 19l5, S. 14k katalogisierten Aquae
Granni als Teil der civitas Tungrorum, Varne-num dagegen a.a.O., 220 bei den Ubiern; ebenso noch Wolfgang Spickermann, Germania Infe-rior. Religionsgeschichte des römischen Ger-manien II (Religion der Römischen Provinzen 3), Göttingen 2008, S. 4k: Kornelimünster/Var-nenum liege „auf der Grenze zwischen den civitates der Tungri und der Ubii als zentrales Heiligtum eines oder mehrerer pagi“; es sei ein ‚Grenzheiligtum‘ mit Ähnlichkeiten zu „zentrale[n] Kultanlagen in Randlage“. Neuerer detaillierter Vorschlag: Raepsaet-Charlier, La cité des Tongres (wie Anm. 4),S. 43–59; zum Grenzverlauf S. 5k. „von der Göhl…“: Wilfried Maria Koch, Aachen in römischer Zeit, in: ZAGV 98/99 (1992/93), S. 11–20; dort S. 1l; Jules E. Bogaers, Civitates und Civitas-Hauptorte in der nördlichen Germania inferior, in: BJ 1l2
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 305
Abb. 3: Fläche und Territorien der Germania inferior: die Maasgrenze nach Christoph B. Rüger
306 · Jörg Fündling
Damit steht das römische Aachen nach Ansicht der Literatur nur mit einem Fuß im sunucischen Stammesgebiet. Varnenum/ Kornelimünster, so gut wie fraglos im Gebiet der Sunucer gelegen, kann entweder in dessen Innerem gesucht oder als sakrale Markie-rung von dessen äußerster Westgrenze gewertet werden; in diesem Fall wäre Aachen noch tungrisch im engeren Sinne gewesen. Inschriten mit sunucischem Bezug oder sonstige klare Indizien fehlen dort bis auf weiteres.14
(19l2), S. 310: „Vielleicht gehörte ein kleiner Teil der niederländischen Provinz Limburg, na-mentlich der östlichen Gegend von Süd-Lim-burg, zu der civitas Sunucorum“. Die Einengung durch Coriovallum und Valkenburg einerseits, die entlang der Geul vermutete Tungrer-Grenze andererseits lässt dafür auf niederländischem Boden aber höchstens einige wenige Quadrat-kilometer rund um Vaals, Wittem und Simpel-veld übrig. Für die Zuweisung zu Tongeren min-destens für „Aachen in der Gründungsphase“ Schaub 2011b, S. 385. Zu Varnenum vgl. zusam-menfassend Andreas Schaub, Das Umland von
Aquae Granni, Kornelimünster und Umgebung, in: Kraus (Hrsg.), Aachen I (wie Anm. 1), S. 424–440; dort S. 425–432.
14 Die erste Siedlergeneration des römischen Aachen stellt sich archäologisch aus aktueller Sicht am ehesten als „bereits stark romani-siert[e]“ Gallier, ja als gezielt angesiedelter „Ro-manisationsfaktor“ dar (Schaub 2011a, S. 29k. u. S. 298). Falls den Sunucern damit also keine neue Führungsschicht implantiert werden sollte, bestand womöglich ein gewisses soziales Spannungsverhältnis zu den schon länger in der Region seßhat Gewordenen.
Abb. 4: Die „Rüger-Linie“ mit Warnhinweis nach Heinz Günter Horn
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 307
Abb. 5: Grenzen der civitas Tungrorum nach Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier
308 · Jörg Fündling
b) Aachen als möglicher sunucischer Hauptort
Wäre Aachen von Sunucern besiedelt gewesen, sagt dies noch nichts über die relative Bedeutung des Ortes im Stammesgefüge aus. Der sunucische „Vorort kann Aquae Granni (Aachen) gewesen sein“, urteilte Petrikovits recht vorsichtig. Teils wird das als plausible Vermutung akzeptiert, andere Stimmen verweisen auf unser bislang gefähr-lich dürtiges Wissen über (sonstige) sunucische Siedlungen. Neben Varnenum/ Korne-limünster und (möglicherweise) Aachen sind die weiteren Orte von Bedeutung noch gar nicht erkundet, beispielsweise der nicht ergrabene vicus bei Düren-Mariaweiler (Marco-
durum?). Varnenum selbst wäre zumindest als kultisches Zentrum des Stammes leicht vorstellbar.15
Etwas verwirrend liest sich das Urteil von Wilfried Maria Koch, eventuell sei „Aachen eine civitas, wenn auch kein civitas-Hauptort“ gewesen, und zwar „keine römische civitas, sondern eine Siedlung der Sunucer“ ohne urbane Merkmale oder bedeutende spätantike Folgesiedlung, „ein einheimischer vicus mit einer unbekannten Rechtsstel-lung“, der im Siedlungsgefüge der Sunucer hinter dem vicus bei Kornelimünster mit seinen ca. 150 000 m² zurückgestanden habe. Gemeint ist wohl: Vielleicht bildeten die Sunucer eine civitas, jedoch ohne einen charakteristischen Hauptort mit urbanen Zügen, sondern nur mit dem Kult- und Siedlungszentrum Varnenum (?) bei Korneli-münster sowie Aachen und seinem für die Sunucer an sich wenig relevanten Badebe-trieb. Im Licht der seitdem bekannt gewordenen Funde erscheint das römische Aachen mit einer nachgewiesenen Bebauung auf jenseits von 200 000 m² und einer hohen Chance auf Siedlungskontinuität mehr als ebenbürtig zur Siedlung Varnenum im Osten und präsentiert sich deutlich urbaner als zuvor.1k
15 „Vorort“: von Petrikovits, Rheinische Ge-schichte (wie Anm. 10), S. 112–114; vgl. Bogaers, Civitates (wie Anm. 13), S. 310 „zu der civitas Sunucorum, deren Hauptort nicht bekannt ist.“ Zum Stammesgefüge der Sunucer vgl. vor allem den Beitrag von Johannes Heinrichs in diesem Band. Der Autor schloss in der Diskussion im Anschluss an seinen Vortrag den vicus von Ma-riaweiler als Vorort nicht aus. Vgl. Johannes Heinrichs, RGA 19 (2001), S. 2l0–2l2, s.v. Mar-codurum; ders., Ein vicus der frühen und mitt-leren römischen Kaiserzeit bei Düren- Mariaweiler (Marcodurum): Topographie, sied-lungsgeschichtlich relevante Lesefunde (Mün-zen und Fibeln), Orts- und Regionalgeschichte, in: KJ 39 (200k), S. l–110; dort S. 2l: „ein sunu-kisches Pendant zum […] benachbarten ubi-schen Iuliacum“ in der Funktion „als Grenzort […] beim Flußübergang […] einer Regional-straße.“ Hartmut Galsterer, Römische Koloni-sation in Rheinland, in: Werner Eck/Hartmut
Galsterer (Hrsg.), Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des Römi-schen Reiches. Deutsch – italienisches Kollo-quium im Italienischen Kulturinstitut Köln (Kölner Forschungen 4) Mainz 1991, S. 9–15; dort S. 4: der Stamm sei „vielleicht um das Hei-ligtum der Göttin Sunuxal in Kornelimünster“ formiert. Spickermann, Germania Inferior (wie Anm. 13), S. 4k: Kornelimünster/Varnenum sei „zentrales Heiligtum eines oder mehrerer pagi“ der Ubier; vgl. S. 113, Anm. 238 gegen die Ver-wendung des für Zentralgallien geprägten Be-grifes conciliabula, der eine reine Marktfunk-tion impliziere (so schon Hartmut Wolf, Krite-rien für latinische und römische Städte in Gallien und Germanien und die `Verfassung´ der gallischen Stammesgemeinden, in: BJ 1lk [19lk], S. 102f., Anm. 1kl).
1k Koch, Aachen (wie Anm. 13), S. 11–20; „Aachen eine …“: S. 18; „keine römische …“: S. 19. Folgt man der von Eck, Köln (wie Anm. 3), S. 312 auf
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 309
c) Eigenständigkeit oder Teilverband?
Die Etymologie des Stammesnamens Sunuci bereitet massive Schwierigkeiten und hat weit divergierende Deutungen erfahren, die allesamt keine historisch verwertbare Zuge-hörigkeit zu einer übergeordneten Gruppe bieten. Insgesamt wird der Stamm unter die nach einer prominenten Caesar-Stelle benannten Germani cisrhenani gerechnet, taucht aber keineswegs in sämtlichen Listen dieser Gruppe auf. Caesar kennt – oder nennt – ihn noch nicht. Ot sind sie als Rest der 53 und 51 v. Chr. durch den proconsul zwar als politische Einheit, nicht aber – wie Caesar behauptete – auch physisch restlos vernichte-ten Eburonen angesprochen worden. Caesars Hauptschlag richtete sich dabei ofen-sichtlich gegen das eburonische Gebiet westlich der Maas, dessen König sein Wider-sacher Ambiorix war, doch litt der Ostteil des Siedlungsgebietes ebenfalls stark unter den Vergeltungsaktionen und zahlreiche Einwohner verließen ihn dauerhat. Die sunu-cische Ethnogenese speiste sich aber auch aus weiteren Quellen.1l
Im literarischen Erstbeleg, der Stammesliste der Naturalis historia, gebraucht Plinius der Ältere für die Sunucer (wie für die meisten anderen gentes der Umgebung) nicht das Wort liberi, was aber nur das Fehlen dieses einen Privilegs bedeutet und nicht etwa auf besondere Strafmaßnahmen wegen der Vorgänge um den Bataveraufstand von k8/k9 hinweist. Überhaupt ‚erholte‘ sich das Ansehen der in die Revolte verwickelten Stämme in römischen Augen bemerkenswert rasch; so zumindest wird ihre fortgesetzte massive Rekrutierung für die römischen auxilia gedeutet, die natürlich auch Unruhepotential in Gestalt kamp rätiger Männer abschöpte. Zerstörungsspuren, die sich mit dem Auf-stand verbinden ließen, fehlen in den Aachener Bodenbefunden bislang; da Iulius Civi-lis das Sunucergebiet kamp os an sich brachte, wenn wir Tacitus folgen, ist damit auch nicht unbedingt zu rechnen.18
die Siedlungen außerhalb der CCAA ange-wandten Schätzmethode, hätten wir für das rö-mische Aachen mit ca. 100 Einwohnern pro Hektar, also mindestens 1k00 Ansässigen zu rechnen. Die Flächenangabe von 20–30 ha und analog 2000–3000 Einwohnern bei Schaub 2011a, S. 2k5; 2011b, S. 38l bezieht gegenüber Kochs Schätzung die Neufunde ein (vgl. a.a.O. S. 25l, Abb. 10; S. 2k2, Abb. 12). Angesichts der früheren Grabungs- und Auswertungsbedin-gungen, besonders der massiven Dokumentati-onslücke im Südwesten des Stadtkerns, dürten die Untergrenzen langfristig noch ansteigen. Für eine genauere Einwohnerschätzung je nach Funktionen der Einzelgebäude ist die Befund-lage vorerst zu lückenhat. Siedlungskontinui-tät: Schaub 2011c, v. a. S. 420f.
1l Vgl. den Artikel von Hermann Reichert, RGA 18 (2004), S. 483–494, s.v. Linksrheinische Ger-
manen; dort S. 493, Nr. 10; von Petrikovits, Ger-mani cisrhenani (wie Anm. 10), S. 325f. zu den Sunucern. Ex-Eburonen: vgl. nur Galsterer, Von den Eburonen (wie Anm. 5), S. 118; Eck, Köln (wie Anm. 3), S. 43; 2l4. Verbund (confoedera-tio): Johannes Heinrichs, Zur Verwicklung ubi-scher Gruppen in den Ambiorix-Aufstand d. J. 54 v. Chr. Eburonische und ubische Münzen im Hortfund Fraire-2, in: ZPE 12l (1999), S. 2l5–293; dort S. 289f. Anhang 1. Abwanderung: a.a.O., S. 288, Anm. 52; S. 289f. Zur Stammes-struktur der Region bis ca. 51 v. Chr. Scherbe-rich, Historische Voraussetzungen (wie Anm. 3), S. 231–233 mit Lit.
18 Liste: Plinius nat. 4,10k. Folgen des Bataverauf-standes: Raepsaet-Charlier, Cité et municipe (wie Anm. 5), S. 2k3f. mit weiteren Beiträgen. Zu regionalen Auswirkungen Scherberich, His-torische Voraussetzungen (wie Anm. 3), S. 243.
310 · Jörg Fündling
Aus den mageren Quellen über die Sunuci, klagte schon Rüger, „ist für die Verwal-tungsgeschichte des Stammes nicht der geringste Aufschluß zu gewinnen.“ Immerhin deuteten die Ereignisse um Civilis „ein eigenes, gegen CCAA und Ubii abgegrenztes Territorium“ an: „eine[n] pagus, der ähnlich dem pagus Catualinus eine keltische ‚civi-tas im Kleinen‘ war.“ Wir hätten es damit mindestens für Teile der Provinzgeschichte mit einer direkt dem Statthalter unterstellten Einheit auszugehen, die nicht die civitas-Schwelle erreichte.19
Häuiger wurde nach dem Vorschlag Hartmut Galsterers eine Abhängigkeit der Sunucer von den Ubiern angenommen. Danach würde es sich um einen schwächeren (Teil-)Stamm handeln, der – wie etwa die Baetasii den Cugernern mit ihrem Hauptort Xanten – „zunächst lose den Ubiern angeschlossen wurde und spätestens im zweiten Jahrhundert in der nunmehrigen Kolonie aufging.“ Das juristische Verhältnis hierbei könnte eine attributio an die CCAA gewesen sein. 20 Als Zusatzargument für die vermu-tete Zeit des endgültigen (juristischen) Untergangs nannte Galsterer wenig später das Auslaufen der – ohnehin wenigen – bekannten Inschriten, die den Stammesnamen be-legen. Nicht nur hier drang die Perspektive des wohl besten Kenners der Kölner römi-schen Epigraphik durch, der sein Unbehagen über das numerisch wie im Erhaltungs-zustand ot bescheidene Aachener Fundmaterial nicht verschwieg: „Völlig unklar sind weiterhin Status und staatsrechtliche Zugehörigkeit des Ortes“. Zu ergänzen wäre, dass die fehlende Auskuntsfreude auch an reicher mit Inschriten bedachten Orten der römischen Nordwestprovinzen ins Auge fällt – so wie die allgemein sehr niedrige Neigung, überhaupt Inschriten zu setzen. Wolfgang Spickermann zählte die Aachener Weihinschrit des VIvir Augustalis Candidinius Gaius, analog zu den Funden aus Varnenum, als Spur eines Kölner Augustalen – nicht die einzig mögliche Deutung, da der Sitz des Kollegiums ungenannt ist.21
19 „ist für die…“, „eigenes Territorium“, „Viel-leicht…“: Rüger, Germania Inferior (wie Anm. k), S. 100.
20 Zum Begrif attributio: Adrian Nicholas Sher-win-White, he Roman Citizenship, Oxford ²19l3, S. 35k–359. Sunucer attribuiert: Galsterer, Von den Eburonen (wie Anm. 5), Zitat: 1988, S. 13k (1990, S. 118 statt attributio „lose den Ubi-ern angeschlossen“). Vgl. weiter Galsterer, Rö-mische Kolonisation (wie Anm. 15), S. 13: attri-butio an die CCAA, „bis die Sunuci im 2. Jahr-hundert anscheinend in der Kolonie Köln aufgingen.“ Ähnlich schon Tilmann Bechert, Römisches Germanien, Zürich 1982, S. 39: Tungrer und Ubier grenzten „im Umfeld von Aachen“ aneinander, wobei die Sunuci „als un-bedeutender Stamm“ keinen eigenen civitas-Charakter aufwiesen. Im Anschluß an Galsterer Raepsaet-Charlier, La cité des Tongres (wie
Anm. 4), S. 5k; Heinrichs, vicus (wie Anm. 15), S. 2l. Vgl., weniger dezidiert, Bechert, Römi-sches Germanien (s. o.), S. 39: Die Westgrenze der Germania inferior laufe „entlang der Maas bis Maastricht und dann in unbekanntem Ver-lauf nach Südosten“. Wohl im selben Sinn sprach Spickermann, Germania Inferior (wie Anm. 13), S. 14 von der civitas der „Ubii/Sunuci“. Ofen auch Eck, Köln (wie Anm. 3), S. 59.
21 Hartmut Galsterer, Das römische Aachen – An-merkungen eines Althistorikers, in: ZAGV 98/99 (1992/93), S. 21–2l; Verlust der Identität im 2. Jh.: S. 23f.; dürtiger Inschritenbestand: S. 21; „Völlig unklar…“: S. 23. Für eine Inkorpo-ration in die CCAA „[i]rgendwann nach l0 n.Chr.“ auch Scherberich, Historische Voraus- setzungen (wie Anm. 3), S. 243. Epigraphische Zurückhaltung: Eck, Verwaltung (wie Anm. 9), S. 291–29k. Zur Inschrit des Candidinius (CIL
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 311
An anderer Stelle fand der Stamm Fürsprecher der Autonomie, wenngleich auch sie sichtlich mit Zweifeln zu kämpfen hatten. So bemerkte Heinz Günter Horn in Die Römer in Nordrhein-Westfalen, die Provinz Germania inferior zähle unter ihren mutmaßlich fünf civitates – ofensichtlich zur Zeit der Einrichtung – „vielleicht die civitas der Sunuci, deren Verwaltungsmittelpunkt möglicherweise in Aquae Granni-Aachen zu suchen ist.“ Ein Nachzählen der Namen zeigt allerdings, dass Horn die potentielle Verwaltungseinheit in seiner Addition auf fünf nicht mitrechnete. Die begleitende Provinzkarte immerhin nennt einen civitas-Hauptort Aquae Granni. Die Zahl derer, die mehr oder weniger fest von einer sunucischen civitas ausgehen, ist gleichwohl klein geblieben.22
Schwer zu gewichten bleibt die Existenz einer cohors I Sunucorum unter den römi-schen auxilia. Zur Aufstellungszeit war der Stamm ofenbar groß genug, eine Kohorte von 500 Mann im wafenfähigen Alter zu tragen, nur ist die demographische Hochrech-nung auf die Gesamtgröße kaum möglich. Die bisherigen Belege stammen aus Militär-diplomen der Jahre 122–12l, in denen die Kohorte (wir wissen nicht, wie lange schon) zum britannischen Provinzheer gehörte, sowie aus einer Inschrit zwischen 19l/98 und 209, dank der die Einheit für die severische Zeit in Segontium (Caernarvon) auszu-machen ist.23
Verlockend, aber nicht belegbar ist die Annahme, dass die Aufstellung dieser Kohorte samt ihrer Verwendung in ‚Übersee‘ eine avische Straf- und Vorsichtsmaßnahme sein könnte, weil Iulius Civilis die iuventus des Stammes seiner Armee einreihte, als die Ereignisse sich gegen ihn zu wenden begannen (Tac. hist. 4,kk: iuventute eorum per
cohortes composita). Die Übersetzung, Civilis habe die kampfähigen Sunucer „in Kohorten gegliedert“, ist nach der Grammatik und Tacitus’ Sprachgebrauch unumgäng-lich. Sachlich hätte viel für eine Verteilung auf die schon bestehenden Kohorten der Aufständischen gesprochen, die dem Wortlaut zufolge (occupatisque Sunucis) eher
XIII l834) vgl. Spickermann, Germania Inferior (wie Anm. 13), S. 213f.; Noethlichs, Aquae Granni (wie Anm. 3), S. 31lf. Überlieferungs-spektrum der Augustales-Inschriten und Hin-weis auf die mögliche Existenz von VIviri in Ton-geren oder Aachen selbst: Schaub 2011b, S. 3l4f.
22 Heinz Günter Horn, Das Leben im römischen Rheinland, in: ders., Die Römer in NRW (wie Anm. 12), S. 139–31l; „vielleicht die …“: S. 142; Karte: S. 140, Abb. lk. Vgl. Koch, Aachen (wie Anm. 13), S. 11–20: eventuell eine civitas (S. 18). Dezidiert für diese Deutung Bogaers, Civitates (wie Anm. 13), S. 310.
23 coh. I Sunucorum: Géza Alföldy, Die Hilfstrup-pen der römischen Provinz Germania inferior (Epigraphische Studien k), Düsseldorf 19k8, S. 8k zählte sie unter „Die in Niedergermanien
aufgestellten Kohorten“ auf. Belegt in Britan-nien am 1l. Juli 122 (CIL XVI k9) und 124 (1k. September? vgl. CIL XVI l0). Das neue Diplom AE 199l, 1ll9 vom 20. August 12l erweitert dieses kleine bekannte Zeitfenster geringfügig (Johannes Nollé, Militärdiplom für einen in England entlassenen ‚Daker‘, in: ZPE 11l [199l], S. 2k9–2lk; Margaret Roxan/Paul Holder, Ro-man Military Diplomas V [BICS Suppl. 82], London 2003, S. 4l0–4l2 Nr. 240.). Der termi-nus post quem für CIL VII 142 = RIB 430 aus Caernarvon ist abhängig vom Datum der Erhe-bung Caracallas zum Augustus sowie Getas zum Caesar, dessen Ansatz um einige Monate schwankt; vgl. Dietmar Kienast, Römische Kai-sertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiser-chronologie. Darmstadt ²199k, S. 1k2 u. S. 1kk.
312 · Jörg Fündling
widerwillige Helfer vorfanden und beim nächsten Zusammenstoß mit romtreuen Kräten eine Desertion der Sunucer en bloc riskierten. Für die Frage, ob von römischer Seite womöglich zwei oder mehr Kohorten ausgehoben wurden, besagt der Vorfall jedenfalls nichts; die Ordnungszahl I bedeutet, wie Parallelfälle zeigen, keineswegs sicher die Existenz weiterer Auxiliarkohorten desselben Stammes.24
Zur Aufstellungszeit der cohors I Sunucorum – irgendwann vor 122 – hoben sich die Sunucer also zumindest ethnisch als deinierbare Einheit ab. Das Fortbestehen der Ko-horte über das Jahr 200 hinaus besagt natürlich nichts für den ‚Mutterstamm‘, der nach Formierung der Einheit üblicherweise nur noch wenig mit deren Ergänzung zu tun hatte. Dennoch war zumindest Petrikovits der Aufassung, dem Stamm, eben weil er Truppen gestellt habe, „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ den Charakter einer civitas „im Verwaltungssinn“ zusprechen zu können; dieses Phänomen wollte Galsterer auf ande-rem Weg durch die attributio erklären.25
Hinreichende Klarheit ist also aus dem direkt auf die Sunucer bezogenen Material nicht zu gewinnen. Dass Aachen, vor dessen Haustür sie bezeugt sind, zu ihnen gehörte, ist leicht vorstellbar, ein ‚tungrisches‘ Szenario nach jetzigem Stand aber nicht ganz ausgeschlossen; sogar die Unterordnung der Sunucer unter die Tungrer, nicht die Ubier, ist theoretisch möglich, hat aber die Präsenz von Kölner (?) Augustalen in Varnenum
gegen sich, denen kein ähnlich starker Ortsbezug Richtung Westen gegenübersteht. Über Gesamtzahl und Rangfolge der sunucischen Siedlungen kann derzeit nur speku-liert werden.
24 Übersetzung: Joseph Borst (Hrsg.), P. Cornelius Tacitus, Historiae/ Historien lateinisch-deutsch, München/ Zürich 51984, S. 4l5; ähn-lich liest OLD 3l9, s.v. compono k. Vgl. auch Heinz Heubner, P. Cornelius Tacitus, Die Histo-rien. Band IV: Viertes Buch, Heidelberg 19lk, S. 151: „nachdem ihr Landsturm zu Kohorten formiert war“. Zur gedämpten Kamp ust man-cher Abtrünniger vgl. auch Tac. hist. 4,kk,3: per-culsis civitatum animis vel sponte inclinantibus. Die „Sunukerkohorten“ bei Rüger, Germania inferior (wie Anm. k), S. 100 beziehen sich of-fenkundig auf die taciteischen cohortes, nicht etwa auf auxilia. Ralf Urban, Der ‚Bataverauf-stand‘ und die Erhebung des Iulius Classicus (Trierer Historische Forschungen 8), Trier 1985, S. l2 spricht trefend von einer faktischen „Un-terwerfung“ der Sunucer durch die Rebellen; vgl. den ausgeprägten Brandhorizont in Als-dorf-Mariaweiler – wohl dem Marcodurum in Tac. hist. 4,28,2 – um l0 n. Chr., dem eine Ver-
lagerung des gesamten vicus folgte (Heinrichs, vicus [wie Anm. 15], S. 19).
25 civitas „im Verwaltungssinn“: von Petrikovits, Rheinische Geschichte (wie Anm. 10), S. 114. Aufstellungszeit: John Spaul, Cohors². he evi-dence for and a short history of the auxiliary infantry units of the Imperial Roman Army (BAR International Series 841), Oxford 2000, S. 248 schlug vor, Petillius Cerialis habe die ein-zige bekannte Kohorte l1 n. Chr. aus dem Auf-gebot des Civilis – sicher nur Teile davon – for-miert und nach Britannien verlegt, wo der (nicht näher datierbare) Ziegelstempel der Ko-horte RIB 2491.9k aus der Legionsziegelei der legio XX Valeria Victrix in Holt ihren ersten Arbeitseinsatz markiere. An eine Schafung der Einheit unter Traian dachte Michael G. Jarrett, Non-Legionary Troops in Roman Britain. Part One: he Units, in: Britannia 25 (1994), S. 35–ll; dort S. kk, Nr. 50.
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 313
2. Die Tungrer
Die Provinzzugehörigkeit Aachens und seiner Umgebung ist etwas klarer zu bewerten, sobald wir uns etwas weiter umsehen. Für die niedergermanische Provinzhauptstadt Köln besteht natürlich Gewissheit; die Zuweisung des Tungrergebietes dagegen ist widersprüchlich überliefert und dank wiederholten Neufunden umstritten.
a) Quellenlage vor dem municipium-Fund
Die erzählenden Quellen, die Auskünte zum territorialen Status der Tungrer geben, lassen sich an drei Fingern einer Hand aufzählen. Zwei von ihnen sehen den Stamm und seine civitas in der Belgica. Von ihnen fällt das schon erwähnte Zeugnis Plinius des Älteren (n.h. 4,10k: a Scaldi incolunt [sc. Galliam] … introrsus… Tungri, Sunuci, Frisia-
vones, Baetasi …; „von der Schelde aus bewohnen Gallien… im Innern… die Tungrer, Sunucer, Frisiavonen, Baetasier…“) in eine Zeit, da die beiden germanischen Provinzen zumindest faktisch, wenn nicht sogar schon förmlich als getrennte Einheiten existier-ten. Überdies hat Plinius den Vorteil, die Region dank seiner Feldzugsteilnahme 4l und 5l/58 n. Chr. als Schritsteller und Militär zu kennen, die Belgica möglicherweise sogar als ihr Procurator von ca. l4 bis lk, unmittelbar vor Abschluss der Naturalis historia. Im frühen 2. Jh. ordnet auch der Geograph Ptolemaios (2,9,9) den tungrischen Hauptort Atuatuca der Belgica zu.2k
Für Verwirrung sorgte seit langem, dass die dritte Stimme zum Problem, Hyginus (agr. 8k), zur Zeit des Augustus von den Tungrern als von in Germania ansässig spricht – falls der Ausdruck zeitgenössisch korrekt war (und schon eine Provinz Germania
bestand), womöglich in einem ethnisch-kulturellen, nicht im territorialen Sinn: die Tungrer gehörten ja zu den problematischen Germani cisrhenani. Solange Hyginus erst in traianische Zeit datiert wurde, lieferte er insbesondere der deutschsprachigen For-schung ein scheinbar besonders tragkrätiges Argument, das über die ein ussreiche Arbeit von Ernst Stein noch nach außen wirkte, als ihm die chronologische Grundlage bereits entzogen war und die meisten Spezialisten wieder nach Westen statt nach Osten zeigten. Der Inschritenfund AE 194k, 95 passte zur Belgica-hese, ohne sie aber ab-schließend zu bestätigen.2l
2k Plinius d. Ä.: Ronald Syme, Pliny the Procura-tor, in: HSPh l3 (19k9), S. 201–23k = Roman Pa-pers II (19l9), S. l42–ll3; Germ. Inf.: S. 205–208 = S. l4k–l48; Belgica (plausibel, aber unbelegt): S. 213f., S. 22kf. = S. l52–l54; S. lk5. Vgl. PIR² P 493. Zweifel an der Aktualität der Angaben bei Scherberich, Historische Voraussetzungen (wie Anm. 3), S. 243. Provinzbildung: s.o. Anm. 3.
2l Raepsaet-Charlier, La cité des Tongres (wie Anm. 4), S. 43–59; zur Hyginus-Stelle S. 44–4k. Folgenreich Stein, Die kaiserlichen Beamten (wie Anm. 10), S. 1l, der die Germania inferior mit dem territorialen Bestand der spätantiken Germania II kurzerhand gleichsetzte.
314 · Jörg Fündling
Ein neues Argument, die Provinzzuordnung der Tungri ofenzuhalten, lieferte eine vieldeutige Inschrit des Procurators Q. Domitius Marsianus aus Bulla Regia unter Marc Aurel (AE 19k2, 183).28 Dort hieß es, Marsianus sei ad census in Gallia accipien-
dos provinc(iae) Belgicae per regiones Tungrorum et Fris‹i›avonum et Germaniae inferi-
oris et Batavorum eingesetzt worden. Das Formular dieser Verwendung „zum Abhalten einer Steuerschätzung“ in gleich zwei Provinzen ist ofensichtlich durcheinandergera-ten. Neben civitates, die unstrittig der Germania inferior angehörten, wird die Belgica
eigens erwähnt; der einzige sonstige civitas-Name ist aber eben jener der Tungri, und falls auch sie auf die germanische Seite gehörten, wieso ist dann eigens von der Belgica
die Rede? Entweder müsste nach dieser Annahme der Steinmetz gleich mehrere Terri-torien in der Germania inferior ausgelassen haben oder (die epigraphisch leichtere Vorstellung) es wäre von einer Schätzung der gesamten Belgica sowie großer Teile des Rheinlands die Rede. Nach wie vor neigte die Forschung überwiegend dazu, die Tungri
in der Belgica zu suchen.29
b) Das municipium-Argument
Neue Bewegung kam in den Zuordnungsstreit, als Mitte der 1990er-Jahre der Beweis autauchte, dass Atuatuca in der zweiten Hälte des 2. Jhs. n. Chr. den Status eines municipium besaß (AE 1994, 12l9). In der übrigen Belgica ist zwar noch nicht für jeden civitas-Hauptort der rechtliche Status geklärt – zu Bavay etwa fehlen klare Angaben – aber in den unstrittig belgischen Territorien sind bislang keine Municipien belegt. Die
28 Zur Inschrit Hans-Georg P aum, Une lettre de promotion de l’empereur Marc-Aurèle pour un procurateur ducénaire de Gaule Narbonnaise, in: BJ 1l1 (19l1), S. 349–3kk; ausführlich Benoı̂t Rossignol, Cens, mines et patrimoine, intégrité, zèle et expérience: Domitius Marsianus et ses missions administratives en Gaule durant le règne de Marc Aurèle, in: François Chausson (Hrsg.), Occidents romains. Sénateurs, chevali-ers, militaires, notables dans les provinces d’Occident. Paris 2009, S. 2ll–298, der die cen-sitor-Funktion gegen 1l5/lk n. Chr. ansetzt (a.a.O. S. 288f.).
29 Klassisch zur Abgrenzung der Germania infe-rior: Rüger, Germania inferior (wie Anm. k), S. 32–41; v. a. S. 38: „Die Tungrer […] gehörten nicht zum Militärsprengel der Prinzipatszeit“; dieser erfasse nur „das linke Maasufer mit der Straßenverbindung Niederrhein-Tongern und das Venn-Vorland zwischen Aachen und Zül-pich.“ Schwebender Provinzstatus wegen AE 19k2,183: Bogaers, Civitates (wie Anm. 13), S. 32k–332. Umgekehrt Edith Mary Wightman,
Gallia Belgica, London 1985, S. 54: „[AE 19k2,183] makes it reasonably clear that the Tungri were in Belgica“; Harald von Petrikovits, Bemerkungen zur Westgrenze der römischen Provinz Niedergermanien, in: Martin Claus/Werner Haarnagel/Klaus Raddatz (Hrsg.), Stu-dien zur europäischen Vor und Frühgeschichte. Festschrit für Herbert Jankuhn, Neumünster 19k8, S. 115–119, jetzt in: ders., Beiträge zur rö-mischen Geschichte und Archäologie 1931 bis 19l4 (Beihete BJ 3k) Bonn 19lk, S. 4l3–4l8; hier S. 11k = S. 4l5: „kein Zweifel“ an der Zuord-nung zur Belgica. Problem, falls die Tungri nicht zur Belgica zählen: Raepsaet-Charlier/Raepsaet-Charlier, Gallia Belgica et Germania Inferior (wie Anm. 13), S. 5kf. Auswahl der Stimmen zur Grenzdebatte. Vgl. Raepsaet-Charlier, La cité des Tongres (wie Anm. 4), S. 43–59 (den letzten Aufsatz, in dem die Auto-rin für die Belgica optierte), dort S. 43f. Anm. 2–3. Als weiter ofen behandelt die Frage Rossi-gnol, Cens (wie Anm. 28), S. 281.
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 315
Zahl der Germania-‚Partei‘ vergrößerte sich schnell und macht unter den Provinzial-historikern, die sich geäußert haben, die klare Mehrheit aus. Wie diese Germaniciani
aber ohne weiteres einräumen, tritt damit an die Stelle des Widerspruchs zu Hyginus ein Widerspruch zu Ptolemaios. Die civitas erst nach dessen Zeit gegen 120 n. Chr., jedoch vor Entstehung der Inschrit von der Belgica zur Germania inferior wechseln zu lassen, womöglich gerade anlässlich der Aufwertung (die ja weitaus älter sein kann!), ist ein unattraktiver Ausweg, der an zu vielen Unwägbarkeiten hängt. Beide Seiten leiden nach wie vor unter dem Dissens der antiken Literatur.30
„Wider still and wider shall thy bounds be set“? Niedergermanien war und ist territo-rial kein Schwergewicht, mit oder ohne die Tungrer, und das Schweigen der Quellen über belgische municipia verdient in der Tat alle Aufmerksamkeit. Das Argument des Muni-zipalstatus läut andererseits Gefahr, Züge eines Zirkelschlusses anzunehmen: Wir ken-nen kein municipium in der Belgica; Atuatuca erweist sich auf einmal als municipium, also liegt es fortan nicht mehr in der Belgica, und wieder kennen wir kein municipium
dort. Ein gewollter oder aus gedankenloser Tradition entstandener Verzicht Roms gerade auf diese Stadtrechtsform in dieser Provinz – das wäre der nötige Denkansatz – ist schwer verständlich. Umgekehrt scheint es überzogen, wie manche Belgiciani positive Belege für eine solche Praxis zu verlangen: falls es sie je gegeben haben sollte, beruhte sie mit Sicher-heit auf usus, aber keiner Rechtsnorm, keinem Kaiserbrief, der eine Inschrit wert gewe-sen wäre. Kurios erscheint allerdings, dass die Tungrer, sonst ofenbar gute und schlag-krätige Reiter, anders als viele Stämme der Germania inferior in den kaiserlichen
30 AE 1994,12l9: Erstpublikation Willy Vanvin-ckenroye, Een Romeinse votiefaltaar te Tonge-ren, in: Limburg l3 (1994), S. 225–23l. Rechts-status: vgl. nur Hilde Draye, Die Civitates und ihre Capita in Gallia Belgica während der frü-hen Kaiserzeit, in: AncSoc 2 (19l1), S. kk–lk. Meinungswandel: namentlich Marie-hérèse Raepsaet-Charlier, Municipium Tungrorum, in: Latomus 54 (1995), S. 3k1–3k9; die hese akzep-tiert u. a. von Hartmut Galsterer, Romanisation am Niederrhein in der frühen Kaiserzeit, in: homas Grünewald (Hrsg.), Germania inferior. Besiedlung, Gesellschat und Wirtschat an der Grenze der römisch-germanischen Welt (RGA, Ergänzungsband 28), Berlin/ New York 2001, S. 19–35: er optiere „doch eher für eine Zugehö-rigkeit zu Germanien“ (S. 31f.); ebenso Tilmann Bechert, Wirtschat und Gesellschat in der Provinz Germania inferior. Zum Stand der For-schung, in: Grünewald (Hrsg.), Germania infe-rior (s. o.), a.a.O., S. 1–18; dort S. 2: die Provinz-grenze inklusive der Tungri reiche bis in „die Flusslandschat der Maas“; Eck, Köln (wie Anm. 3), S. l41 mit Anm. 13. Jedoch warnte
Peter Rothenhöfer, Die Wirtschatsstrukturen im südlichen Niedergermanien. Untersuchun-gen zur Entwicklung eines Wirtschatsraumes an der Peripherie des Imperium Romanum (Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen l), Rahden/Westfalen 2005, S. 11: „Zwingend ist die Zugehörigkeit der Tungrer zur Germania inferior allerdings nicht. Im fol-genden soll diese civitas dem eigentlichen Un-tersuchungsraum auch nicht zugeschlagen wer-den.“ Die Begleitkarte S. 9 zählt die Tungrer unter Vorbehalten zur Belgica. Vorsichtig auch Vanvinckenroye, votiefaltaar (s. o), S. 232. Quel- lendilemma: Alain Vanderhoeven, Aspekte der frühesten Romanisierung Tongerens und des zentralen Teiles der civitas Tungrorum, in: ho-mas Grünewald/Sandra Seibel (Hrsg.), Konti-nuität und Diskontinuität. Germania inferior am Beginn und am Ende der römischen Herr-schat. Beiträge des deutsch-niederländischen Kolloquiums in der Katholieke Universiteit Nijmegen (2l. bis 30.0k.2001), Berlin/New York 2003, S.119.
316 · Jörg Fündling
Gardeformationen (den Germanici corporis custodes, später den equites singulares
Augusti) nicht vertreten sind. Sie allein wären in diesem Fall nicht als Germanen behan-delt worden; leichter fällt es, mit Michael P. Speidel die Konsequenz zu ziehen, dass sie gar nicht zur Germania inferior gehörten. Für die Qualität der Debatte spricht, wie ofen auch die Vertreter der Gegenposition auf solche Schwachstellen hinweisen.31
Alles in allem scheint sich die Quellenlage durch den Fund von AE 1994,12l9 in die-ser Hinsicht nicht entscheidend verbessert zu haben, anders als für die Stadtgeschichte von Tongeren selbst. Einiges spricht weiterhin dafür, die Belgica, um ihr erstes verbürg-tes municipium bereichert, bis zur Geul reichen zu sehen – womit die Frage, wie Aachen einzuordnen ist, ofen und virulent bleibt.
3. Die wandernden Grenzen
a) Kontroverse Karten – Karten ohne Kontroversen
Für die Bearbeiter des „Corpus inscriptionum Latinarum“ stand es Anfang des 20. Jhs. nicht zur Debatte, wohin die Aachener Inschriten gehörten. Wie selbstverständlich er-schienen die wenigen Einträge 190l im Teilband 2.2 zur Germania inferior, die Lemmata des Nachtrags von 191k an entsprechender Stelle (übrigens unter der Rubrik „Ubii“) im vierten Teilband. Im Indexband 5 zeigt sich Aachen auf der zweiten Karte knapp jenseits der Linie, die die belgisch-germanische Provinzgrenze markiert (Abb. k). Dies war die erste ernsthate Konkurrenz zum Vorschlag Heinrich Kieperts von 1882, der sich seit 1884 als Beikarte zu heodor Mommsens Römischer Geschichte rasch weit verbreitet hatte: einer von der Westerschelde aus weit nach Süden und Westen ausbiegenden Grenze (Abb. l), der gegenüber sechs Jahrzehnte später im CIL eine Linie in ungefähr westsüd-westlicher Richtung stand, die dicht nördlich von Maastricht die Maas kreuzte. Es ist ein ausnehmend kurioser Befund, dass das CIL gerade im für mangelnde Deutschtümelei ganz sicher nicht berühmten Jahr 1943 eine Karte abdruckte, die die Grenze einer Pro-vinz mit dem Wort „Germania“ im Titel gegenüber Kiepert um ein ganzes Stück zurück-nahm. Nach dem Neufund in Tongeren bewegt sich die Forschungsmehrheit wieder zu einer modiizierten Kiepert-Linie mit etwas stärkeren Ausschwüngen, wie die Karten-beigabe von Raepsaet-Charliers Überblicksaufsatz zu den Nordwestprovinzen zeigt (Abb. 8). Eine ältere, etwas kuriose Variante mit einem Sprung in der markanten Nord-Süd-Linie bot die Geschichtsredaktion des „Times Atlas“ seit 1982 (Abb. 9).32
31 Belege für Municipalpolitik verlangt: Robert Nouwen, Atuatuca Tungrorum, the First Known Municipium of Gallia Belgica?, in: ZPE 115 (199l), S. 2l8–280, mit Verweis auf das Rek-rutierungsargument bei Michael P. Speidel, Ri-ding for Caesar. he Roman Emperors’ Horse Guards, London 1994, S. 39. Spickermann, Ger-
mania Inferior (wie Anm. 13), S. 14f., bemerkte, die Tungrer gehörten „am ehesten“ zur Germ. inf., warnte aber im selben Atemzug (S. 14 Anm. k1), das sonstige Fehlen bekannter municipia in der Belgica sei kein zwingendes Argument.
32 Aachener Inschriten: CIL XIII l834–l843 und 12005–1200la; vgl. A. Domaszewski, CIL XIII
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 317
Abb. 6: Provinzgrenze der Belgica und Germania inferior nach CIL XIII.5, Karte 2
2.2: Inscriptiones Germaniae inferioris. Berlin 190l, 51l; CIL XIII 4: Addenda ad partes pri-mam et secundam. Berlin 191k, 135. Die Karte von K. Kretschmer: CIL XIII 5: Indices. Berlin 1943, tab. II. Kiepert: heodor Mommsen, Rö-mische Geschichte. Fünter Band: Die Provin-zen von Caesar bis Diocletian. Mit zehn Karten
von H. Kiepert, Berlin k1909, Karte III im An-hang. Mit Verweis auf Spuren des Militärs (s. u.) für die CIL-Linie von Petrikovits, Bemerkun-gen zur Westgrenze (wie Anm. 29), S. 118f. Die gängigsten Schulatlanten folgten im wesentli-chen diesen beiden Möglichkeiten: auf der Kie-pert-Linie Großer historischer Weltatlas. I. Teil:
318 · Jörg Fündling
Eine nordöstliche Provinzgrenze der Belgica zu zeichnen bleibt „ein heikles Unter-nehmen“. Bis in die Gegenwart bestätigt die Literatur diese Warnung. Über die Stan-dardmonographien und -karten werden die drei tradierten Grenzvorschläge mal in energisch durchgezogenen Linien, mal gestrichelt und mit warnenden Fragezeichen, stets aber in verwirrender Konkurrenz weitergetragen (Abb. 10). Mitunter begegnen gar
Vorgeschichte und Altertum, München (Baye-rischer Schulbuchverlag) k19l8, S. 45 oben, „Deutschland zur Römerzeit (etwa 150 n. Chr.)“; Kurt Stade, „Das Römische Weltreich seit Cae-sar und Augustus“, in: Walter Leisering (Hrsg.), F. W. Putzger, Historischer Weltatlas. Berlin 9919l8, S. 2kf. Auf der CIL-Linie, „Germanien und Raetien zur Römerzeit“, in: Hans-Erich
Stier/Ernst Kirsten/Wilhelm Wühr(Hrsg.), Großer Atlas zur Weltgeschichte. Braunschweig (ND München 1990), S. 3l. ‚Gezackte‘ Kiepert-Linie: Geofrey Barraclough (Hrsg.), he Times Concise Atlas of World History. London k1994; benutzter ND: Atlas der Weltgeschichte. Augs-burg 199l, S. 30f., Nr. 3 „Römisches Reich 14–280 n. Chr.“.
Abb. 7: Gallisch-germanische Provinzgrenzen nach H. Kiepert 1884
Aachen
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 319
Abb. 8: Neuere Mehrheitsposition: revidierte Provinzgrenze zu Lasten der Belgica nach Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier
zwei konkurrierende Verläufe im selben Buch. Im Rückblick ist jedoch beruhigend, wie niedrig die emotionale Temperatur der Kartenzeichner geblieben ist. Die Linie, die am stärksten zugunsten der Belgica ausfällt, stammt zwar aus dem doppelsinnig Belgica
antiqua betitelten Prachtband (Abb. 10), der sicher auch die Absicht verfolgte, der nicht nur von außen bedrohten belgischen Identität Spielraum zur Verlängerung in die römi-sche Vergangenheit zu eröfnen. Statistisch gesehen indet sich umgekehrt die Tendenz, die Germania inferior relativ weit nach Westen reichen zu lassen, vor 1994 hauptsächlich
320 · Jörg Fündling
bei deutschen Forschern. Die Germania inferior erschien stärker ‚deutsch‘ als die Gallia
Belgica, wie umgekehrt die Belgica womöglich zur Rückprojektion eines National-gefühls einlud, das die verheerenden deutschen Überfälle von 1914 und 1940 stimuliert haben. Wissenschatlich bemäntelte Gebietsansprüche, gar Annexionsphantasien sind aber gerade nicht zu verzeichnen; alle drei Hauptvorschläge stammen von deutschen Zeichnern, mag die Grenze der CIL-Karte auch mehr Anklang bei französischen Ge-lehrten gefunden haben als die Kiepert’sche Westvariante.33
Mitunter spielte das alte Denkmuster noch in jüngerer Zeit einem durchaus wohl-re ektierten Forscher einen Streich. Für Heinz Cüppers stand es in den 1980ern fest, dass die Tungri im Westen „wenigstens bis zur Wurm“ siedelten und „in der Prinzipats-zeit der Provinz Belgica zugeordnet“ waren. Aachen, dessen römerzeitlich relevanter Kern natürlich damals wie heute westlich der Wurm lag, wäre damit klar und deutlich der Belgica zugewiesen – aber wenige Seiten später schlug der Autor, sicher unbewusst, eine Volte und sprach von der architektonischen „Sonderstellung Aachens im Gebiet der Germania inferior“!34.
b) Nationale Untertöne? Ein Beinahe-Exkurs in die Heimathistoriographie
Es lohnt sich, das hema der Provinzgrenze jenseits der Fachdiskussion dort zu ver-folgen, wo es potentiell identitätsstitend wirken konnte – und das in einer Situation, die abgeklärte Diskussionsbeiträge gerade nicht begünstigte. Die eigentlich zutiefst inner-römische Angelegenheit kam in einem Buch zur Sprache, das erklärtermaßen „die
33 Bogaers, Civitates (wie Anm. 13), S. 332; analog Werner Hilgers, Deutsche Frühzeit, Berlin 19lk, S. l8. Tilmann Bechert, Die Provinzen des Rö-mischen Reiches. Einführung und Überblick, Mainz 1999, übernahm die Karten des Lexikons der Alten Welt für Gallien (S. 12k, Abb. 15k; vgl. LAW Sp. 1019f., Abb. k9) und Germanien (S. 192 Abb. 22l), die beide die „Kiepert-Linie“ zeigen; auch im Text ordnete Bechert a.a.O., S. 193 die Tungrer a.a.O., S. 193 im Text der Germania in-ferior zu – doch die Vorsatzkarte „Das Römische Reich Mitte des 2. Jh. n. Chr.“ zeigt den seit Rü-ger, Germania inferior (wie Anm. k), S. 3l ver-trauten Grenzverlauf knapp westlich der unte-ren Maas und setzt Tongeren klar in die Belgica. Belgica antiqua: Mariën, L’empreinte (wie Anm. 13), S. 10 konstatierte zwar einen gewissen Ei-gencharakter jener Gebiete der Provinz, die dem heutigen Belgien entsprechen, gegenüber z. B. dem Trierer Raum, doch wenn sein Vorwort ein Feindbild aufweist, dann höchstens den unzu-reichenden Schutz der Bodendenkmäler und die Raubgräberei. Pate standen vielleicht die mittel-
alterlichen „Präigurationen“ des modernen Bel-gien in Henri Pirenne, Histoire de Belgique (l Bde. Bruxelles 1900–1932); so bezeichnet von Walter Prevenier: Pirenne, Henri, in: Rüdiger vom Bruch/Rainer A. Müller (Hrsg.), Histori-kerlexikon. Von der Antike bis zur Gegenwart, München ²2002, S. 254f. Zum hema einschlä-gig ist innerhalb des rezeptionsgeschichtlichen Bandes Athena Tsingarida/Annie Verbanck-Pi-érard (Hrsg.), L’Antiquité au service de la Mo-dernité? La réception de l’antiquité classique en Belgique au XIXe siècle. Bruxelles 2008, neben der Einführung der Herausgeberinnen (a.a.O. S. 9–1l) v.a. der Beitrag von Sébastien Dubois, Les références à l’Antiquité dans la construction de l’identité nationale belge (a.a.O. S. 119–15k), besonders zum Ethnizitätsstreit und der ‚nie-derdeutschen‘ Zuordnung Belgiens mit antiken Argumenten (a.a.O. S. 140–143). – Karten in der Frankophonie: vgl. Bild 10.
34 Cüppers, Beiträge (wie Anm. 10), S. 4: „wenigs-tens…“; Belgica: S. 4, Anm. 18; „Sonderstellung Aachens…“: a.a.O., S. 11.
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 321
tiefen, starken Wurzeln aufzusuchen“ beabsichtigte, „die unsere Grenzlande mit Volk und Staat verbinden“: der von Albert Huyskens herausgegebenen, bis heute nicht ersetz-ten Aachener Heimatgeschichte von 1924. Umstände und Ziele der Publikation hätten eine ausführliche Erörterung verdient, als das hier geschehen kann; sie waren jedenfalls alles andere als politikfern.35
Symptomatisch gespalten ist die Vorgehensweise des Beitragsautors Carl Schué, eines Gymnasialprofessors, der die gallorömische Antike vorzustellen hatte. Relativ vorsich-tig näherte sich Schué der Frage, ob Aachen zu den Tungrern oder den – zögernd als Teil
Abb. 9: „Gezackte“ Grenze nach Geoffrey Barraclough
35 „die tiefen…“: Albert Huyskens, Vorwort, in: ders. (Hrsg.), Aachener Heimatgeschichte. Aa-chen 1924,S. III.
322 · Jörg Fündling
der Ubier begrifenen – Sunucern gehört habe, und entschied mit Blick auf die Diöze-sangrenze an der Wurm für die Tungrer. Beide Stammesgebiete seien – zweifellos stand wieder Hyginus im Hintergrund – aber gleichermaßen „Bestandteil der germanischen Provinz“ gewesen, die bis über die Maas hinaus weit nach Westen gereicht habe. Für
Abb. 10: Germania inferior weit westlich der Maas: Karte in der Kiepert-Tradition nach John F. Drinkwater
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 323
Schué bildete diese Zugehörigkeit das Sprungbrett, um das Bild eines vom Militär der Germania inferior geprägten Zentrums inmitten eines beeindruckend dichten Straßen-sterns zu entwerfen.3k
Von einer Germanien (im römischen Sinn) zugeordneten Garnisonsstadt konnte man, auch wenn Schué einen neutralen Ton anschlug und sich auf solide Forschungsergeb-nisse berufen konnte, unmöglich ohne Blick auf den Tag und die Stunde schreiben. Der Charakter Aachens als Standort belgischer Besatzungstruppen während Niederschrit und Drucklegung – wie auch als logistischer Knotenpunkt hinter der Front im Ersten Weltkrieg – und als Ziel von Abtrennungsplänen darf nicht vergessen werden. Ungleich stärker politisierte sich die Geschichtswahrnehmung unter der Feder des Herausgebers und Hauptautors Albert Huyskens, der besonders die spätkarolingischen Kämpfe um Aachens Besitz als nationale Ehrensache nahm, so gut er es mit Rücksicht auf die belgi-sche Zensurbehörde konnte. Schué hingegen unterließ es überwiegend, seinen Aufsatz in Richtung eines ‚Volkstumskampfes‘ zu lenken. An einigen Stellen erinnerte er sich, dass die Betonung des germanischen Elements unter den Provinzialen höchst erwünscht war, aber die „hochstehende, eigenartige gallisch-germanisch-römische Mischkultur, deren Träger, meist Gallier oder auch Germanen, […] trotz weitgehender Romanisierung in Sprache und Sitte, doch im Grunde vielfach an heimischer Anschauung und Übung fest-hielten!“ – sie gab im kämpferischen Sinn wenig her und war nach kaum bemäntelter Ansicht des Autors überwiegend gallisch. An „einem keltisch-römischen Grenzland, freilich schon mit starkem germanischem Einschlag“, führte kein Weg vorbei, auch wenn man es unter den Karolingern „ein deutsches Land“ werden ließ.3l
Ein direkter Vergleich mit Huyskens’ eigenem Vorgehen, soot sich eine Frontstellung nach Westen anbot, ist instruktiv. Im Vorfeld der geplanten Feiern zum Rheinland-jubiläum von 1925 erwärmte sich der Stadtarchivar für die und an der Passage Richers von Reims, die wir zu Beginn kennenlernten. Huyskens quittierte sie mit der Fanfare, 923 sei „der Kampf um Lotharingien bis zur napoleonischen Zeit zugunsten Deutsch-lands entschieden worden. Der Adler auf der Pfalzkapelle blickte nun wieder trutzbereit nach Westen.“ Die Blamage für Otto II., aus deren Anlass Richer den Adler einführt, wurde sorgfältig als Episode gekennzeichnet, deren letztendlicher Ausgang (ein sieg-reicher Vorstoß bis vor Paris, der Zeitgenossen an ver ossene deutsche Triumphe erin-nern musste) den Krönungsort Aachen „in besonderem nationalem Lichte“ hervortre-ten lasse und „das Eigentum des deutschen Reiches“ an ihm wie so ot gegen „die fortdauernden Ansprüche der französischen Könige“ bewahrt habe.38
3k Provinzfrage: Carl Schué, Die vorrömische und römische Zeit an Hand der Funde und Über-reste, in: Huyskens, Heimatgeschichte (wie Anm. 35), S. 100–111, dort S. 101f.
3l „hochstehende…“: Schué, römische Zeit (wie Anm. 3k), S. 10l; „einem keltisch-römischen…“: S. 109.
38 Zitate: Albert Huyskens, Aachens Geschichte von den Karolingern bis zur Gegenwart, in: ders. (Hrsg.), Aachener Heimatgeschichte (wie Anm. 35), S. 1–8l; dort S. 12f. Zur zeittypisch verfrühten Unterstellung einer deutschen, res-pektive französischen Identität seit (mindes-tens) 919 vgl. nur Karl Ferdinand Werner,
324 · Jörg Fündling
Auf mittlere Sicht sollte Schués Vorgehensweise das Geschichtsbild nachhaltiger bestimmen als Huyskens’ Freund-Feind-Denken. Ein antiquarisches Interesse, weite Teile des Aachener Straßennetzes in die Römerzeit zurückzudatieren, blieb nach der katastrophalen Selbstdemontage des Nationalismus auf deutschem Boden unverfäng-lich. Tatsächlich war nach den Kriegszerstörungen bis 1944 (und den Kahlschlägen des Wiederaubaus) der Straßenverlauf so ziemlich das einzige ächendeckend intakte
Deutschland A: Begrif, geographisch-histori-sche Problematik, in: LMA 3 (198k), Sp. l82–l89; Carlrichard Brühl, Deutschland – Frank-reich. Die Geburt zweier Völker, Köln 1990. Huyskens leitete parallel zur Drucklegung des Bandes die Vorbereitungen zur Ausstellung von 1925, deren Hauptzweck es war, nach den separatistischen Unruhen die Untrennbarkeit des besetzten Rheinlands vom übrigen Deutschland einzuschärfen, und deren endgül-tige Gestalt bis ins Detail durch Huyskens’ di-rekte Eingrife bestimmt war. Vgl. Rüdiger Haude, „Kaiseridee“ oder „Schicksalsgemein-schat“. Geschichtspolitik beim Projekt „Aa-chener Krönungsausstellung 1915“ und bei der „Jahrtausendausstellung 1925“ (ZAGV Beih. k), Aachen 2000, v. a. S. 15l–1l8 zum Rhein-land-hema; S. 134–13k; S. 152–154. Zu Huys-kens’ späterer Rolle im „Dritten Reich“ vgl. die Studie von Herbert Lepper, Der „Aachener Geschichtsverein“ 1933–1944, in: ZAGV 101 (199l/98), S. 2kl–302, die Huyskens in diesem Partialbereich als „Vertreter und Verfechter des gehaßten liberalistischen Wissenschatsver-ständnisses“ anspricht, mit dem weit schärfe-ren Urteil von Stefan Krebs/Werner Tschacher, „Im Sinne der rassischen Erneuerung unseres Volkes“ – Albert Huyskens, die Westdeutsche Gesellschat für Familienkunde und das Aa-chener Stadtarchiv im Nationalsozialismus, in: ZAGV 109 (200l), S. 215–238. Huyskens’ ein-schlägige rassenideologische Äußerungen und seine Hilfsdienste beim Aufspüren nicht regist-rierter jüdischer Vorfahren von Aachener Bür-gern (vgl. etwa a.a.O., S. 22l; S. 230–233; S. 238) kontrastieren mit den immerhin vier Seiten, die der Aachener jüdischen Gemeinde und ihrem damaligen Rabbiner Dr. Heinrich Jaulus in der Heimatgeschichte von 1924 eingeräumt wur-den („Die Geschichte der Aachener Juden“, in: Huyskens (Hrsg.), Aachener Heimatgeschichte (wie Anm. 35), S. 215–218). Jaulus’ zuversicht-
lich gehaltenes Schlusswort, Antisemitismus sei in Aachen höchstens ein Randphänomen, war verfrüht, mag aber eher auf tatsächlichen Eindrücken als auf Zweckoptimismus beruht haben – als Demonstration patriotischer Ge-schlossenheit unter dem Druck der Besatzung war die Einbeziehung der Juden zu dieser Zeit sicher durchaus willkommen. Wie und durch wen sie ins Konzept des Geschichtsbandes ge-langte, wäre noch zu erforschen. Die populäre Darstellung von Will Hermanns, Aachen. Erz-stuhl des Reiches. Lebensgeschichte der Kur– und Kronstadt Aachen, Ratingen 1951; ND o. O. u. o. J. [Aachen 2000], beruht an der chrono-logisch entsprechenden Stelle deutlich auf Huyskens’ Erzählstruktur und schrieb deren zweifache Adlerdrehung weiter aus. Selbst in der nachkriegstauglichen Variante überlebte der Vogel, „den Karl der Einfältige nach Osten hatte drehen und drohen lassen“ (S. 4l), und dessen erneuter Richtungswechsel von „ganz Deutschland zur Tilgung der dem Kaiser und dem Reich angetanen Schmach“, der „List und Tücke“ Lothars (S. 53), durch einen Feldzug bis vor die Tore von Paris so gründlich gerächt worden sei, dass „das Rhein-Maas-Land […] nunmehr auf Jahrhunderte vor den Franzosen Ruhe hatte.“ (S. 54). Die Konzeption des Bandes reicht vermutlich in die Zeit vor 1945 zurück, wie das ähnlich betitelte Bändchen Aachen, Erzstuhl des Reiches. Chronik einer Krönungs-stadt, Berlin 193l, nahelegt. Die Lothar-Epi-sode samt verrücktem Adler fehlt bezeichnen-derweise in Walter Kaemmerer (Hrsg.), Aache-ner Quellentexte (Veröfentlichungen des Stadtarchivs Aachen Bd. 1) Aachen 1980, in dessen Auswahl die ‚große‘ politische Ge-schichte von 89k bis zum Spätmittelalter aus-schließlich als Serie von Königskrönungen er-scheint, während der jahrzehntelange Streit um Lotharingien nach 8l1 (a.a.O., S. 92) geradezu pointiert ausgeblendet wird.
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 325
Stück Stadtgeschichte, auf das sich ein Kontinuitätsgefühl stützen konnte. Die zugehö-rigen Häuser gab es nicht mehr.39
In den Publikationen der Nachkriegszeit wird die Provinzfrage selten explizit ange-sprochen, auch weil sie sich endgültig entpolitisiert hatte; die Versuchung, sich bis zum letzten Tropfen Tinte um eine römische Grenze vor, in und hinter Aachen zu schlagen, war gering, auch wenn – oder gerade weil – in der Fachwelt nun gleich mehrere Varian-ten auf dem Tisch lagen. Jedoch deuten die Linien, die fast immer zwischen dem her-menbau und dem Militär der Germania inferior gezogen wurden, auf eine implizite Ein-gemeindung in diese Provinz hin. Die Zeitverzögerung bei der Rezeption neuerer Forschungsansätze spielte auch ihre Rolle: Kurz vor dem erneuten Meinungsumschwung der Provinzialforschung, wohin die Tungrer gehörten, vertrat der neue Dumont-Reise-führer über Aachen die gründlich antiquierte Vorstellung aus Steins Tagen, sie seien der Germania inferior sicher – und wurde dann plötzlich wieder aktuell. Andere Publika-
39 Straßenzüge: Schué diskutierte das Straßen-netz, für das er die Interpretation von Joseph Hagen, Römerstraßen der Rheinprovinz (Erläu-terungen zum Geschichtlichen Atlas der Rhein-provinz 8), Bonn ²1931 übernahm – also die Gleichsetzung von gleich neun Ausfallstraßen des mittelalterlich-modernen Aachen mit römi-schen Trassen – deutlich eingehender als die Frage des Verwaltungsstatus; das hohe identii-katorische Potential gerade dieser Zeichnung und der sie begleitenden Wegbeschreibungen spiegelt sich noch in beider Übernahme in Karl-Heinz Pelzer, Urbs Aquensis. Ein Geschichts-bild der Stadt Aachen. Erzählungen, Berichte und Urkunden, Aachen 1959, S. 14–1k, einem für den Heimatkundeunterricht gedachten Le-sebuch, das Signale der Kontinuität setzte. Ähn-lich programmatisch, noch quellenferner und auf der Ebene der lokalen Deutungshoheit über die Stadtgeschichte verkündete in der Gegen-richtung Georg Holländer, Aachen, Orte und Wege. Dom und Altstadtkern, Aachen 198k, S. 5kf. als geschworener Feind „eines lokalpoli-tischen Traditionsdenkens“ (S. 5l) seine hese einer bis zur Unkenntlichkeit veränderten Stadtstruktur im allgemeinen und eines römi-schen hermenkomplexes im Sommerbetrieb „als jahreszeitlich bedingte Kirmes, nicht als dauerhat gebaute Siedlung“ im Besonderen (ebd.); Permanenz und Anzeichen geregelter Bebauung seien ein Konstrukt der Archäologie. Die Provinzzugehörigkeit, für die Kontinuitäts-frage unergiebig, fehlt im knappen Überblick
von Dieter P. J. Wynands, Kleine Geschichte Aachens. Aachen ³1990, S. 10–13. Aus „editi-onsstrategischen“ Gründen war eine Darstel-lung, die sich nicht zu ofensichtlich und an-greibar mit Grenzfragen befasste, 1924 ver-mutlich ganz willkommen. Die Wortfamilie „Grenze“ bekam in jenen Jahren einen äußerst appellativen, nämlich konfrontativen Charak-ter, soweit man sich ihrer in und um Aachen bediente: „Grenzland-Kampbahn“, das 1924 begonnene, erst 1930 mühsam fertiggestellte „Haus Grenzwacht“, das als Wachturm immer-hin vorstellbare Hochhaus am Hauptbahnhof; vgl. etwa Franz Reif, Die Jahre 1919 bis 19k4, in: Poll (Hrsg.), Geschichte Aachens (wie Anm. 8), S. 299–259, dort S. 334 (1930 Febr. 14), im sport-lichen Bereich die Umbenennung des (katholi-schen) „Jünglingsvereins Sankt Jakob 1908 Aa-chen“ in „DJK Westwacht 08“ (http://www.djk.de/3_sport/fachbereiche/fussball/berichte/aa-chen200l.pdf, S.3; letzter Zugrif k.5.2012). In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hielt das „Grenzland-Bewusstsein“ sich bis in die 50er-Jahre, doch verblasste die Abwehrhaltung spür-bar; vgl. die Beispiele von Matthias Pape, Um-brüche. Die Region Aachen vom Roer-Départe-ment zur Städteregion, Aachen 2009, S. 194. Mittlerweile ist der Begrif anscheinend so gut wie außer Kurs gekommen, mit Ausnahme sei-nes karikaturistischen Echos als Deutschlands „Westzipfel“, eines Markenzeichens des Aache-ner Kabarettisten Wendelin Haverkamp.
326 · Jörg Fündling
tionen aus jüngeren Jahren gingen wesentlich behutsamer vor; in ihren Augen bildet das stärkste Argument nach wie vor der Charakter als „Militärbad“. Als etwas Wesentliches erscheint die Frage nirgendwo; mit Blick auf den Alltag des römischen Aachen ist das eine völlig adäquate Gewichtung.40
Wenn wir zur Einschätzung des Aachener Status aus altertumswissenschatlicher Sicht zurückkehren, bleibt – nachdem die Vielstimmigkeit der Forschung einstweilen nur festgestellt, nicht aufgelöst werden kann – methodisch noch ein Blick auf die römer-zeitlichen Strukturmerkmale der Stadt und ihrer Umgebung übrig. Dass sie Indizien für eine Ausrichtung entweder auf die Belgica oder die Germania inferior ergeben, ist zumindest vorstellbar.
4. Mögliche Kriterien für Aachens Provinzzugehörigkeit
a) Zollstation Aachen?
Die praktische Relevanz einer Provinzgrenze innerhalb des Römischen Reiches ist ein schlecht erforschtes Gebiet. Wo sie nicht mit einer Zollgrenze zusammeniel und Abga-ben fällig wurden, scheint der Bedarf an Kontrollstellen gering – aber die Germaniae
bildeten zollpolitisch ja gerade einen Gesamtbezirk mit den drei Galliae einschließlich der Belgica; an seinen Rändern wurde die 2,5 %-Abgabe der XL Galliarum fällig. Im allgemeinen Finanzwesen unterstanden die Belgica und beide Germanien dem gemein-samen Procurator in Trier, für die Einziehung der Erbschatssteuer von 5 % gilt dasselbe unter Hinzutreten der Gallia Lugdunensis. Die Einheit in inanziell-iskalischer Hin-sicht ist markant ausgeprägt.41
Wirtschatlich hatte die gesamte Gallia Belgica letzten Endes den Charakter einer ‚Etappe‘ für die beiden Rheinprovinzen mit ihren Grenzarmeen, auf deren Bedürfnisse
40 Keine Äußerung: z. B. Stephany, Jahre bis 1250 (wie Anm. 10). Tungri Teil der Germania infe-rior: Gabriele M. Knoll, Aachen und das Drei-ländereck. Fahrten rund um die Karlsstadt und ins Maasland nach Lüttich und Maastricht, Köln 1993, S. 12, die das heutige Tongeren „zum zweitwichtigsten Ort der Provinz Niedergerma-nien nach Köln“ macht. Ausgespart blieb das hema in Ingeborg Monheim, Aachen. Ein Stadtführer, Aachen 51989, S. 18–20. Vorsichtig auch Michael Römling, Aachen. Geschichte ei-ner Stadt, Soest 200l, S. 19f. unter Verweis auf Bechert, Römisches Germanien (wie Anm. 20), S. 39; „obwohl selbst für die Zugehörigkeit von Aachen zur Provinz Germania Inferior der letzte Beweis nicht erbracht ist“ (Römling a.a.O., S. 24), bleibe die Tatsache, dass haupt-
sächlich die Rheinlegionen die Bäder genutzt hätten.
41 Zoll und Finanzverwaltung: Werner Eck, Pro-vinz – ihre Deinition unter politisch–adminis-trativem Aspekt, in: Henner von Hesberg (Hrsg.), Was ist eigentlich Provinz? Zur Be-schreibung eines Bewußtseins (Schriten des Archäologischen Instituts der Universität zu Köln), Köln 1995, S. 15–32, jetzt in: Werner Eck, Die Verwaltung des Römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit Band 2, Basel/ Berlin 1998, S. 1kl–185, hier 182f.; 2004, S. 2kl–2l2. Sitz in Trier: vgl. etwa Rudolf Haensch, Capita provin-ciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwal-tung in der römischen Kaiserzeit (Kölner For-schungen l), Mainz 199l, S. l4–lk.
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 327
ihre ökonomische Struktur stark zugeschnitten war, teils über die Versorgungsfunktion ihrer Agrargebiete, teils in Hinsicht auf den Durchgangshandel. Nicht zufällig wurde sie durch einen direkt vom Kaiser ernannten legatus Augusti pro praetore verwaltet, auch als sie (wie die beiden anderen, stärker entwickelten Teile der tres Galliae) längst einen ‚zivilen‘ Charakter angenommen hatte. Für das tägliche Leben und die materielle Kultur können wir also (von der zum Verwechseln ähnlichen ethnischen Zusammensetzung der Einwohner ganz abgesehen) an der Verwaltungsgrenze zwischen Belgica und ger-manischen Provinzen keinerlei markanten Übergang erwarten. Passierscheine sind in der antiken Literatur kein hema.
Auf der anderen Seite stand bis vor einigen Jahren die hese Alfred von Domaszews-kis, das Römische Reich habe in Gestalt der Beneiziarier über eine Art Straßenpolizei verfügt, und steht die Tatsache, dass aus Aachen sehr wahrscheinlich die – fragmentari-sche – Inschrit eines [---]da[.]ius oder [---]da[.]tus, beneiciarius consularis, vorliegt. Beides zusammen führte in der älteren Literatur zur Annahme eines permanenten „Straßenpostens“, der die Wichtigkeit Aachens als Verkehrsknotenpunkt beweise. In der wegweisenden Untersuchung Joachim Otts, die eine Abkehr von der Straßenwacht-hese vollzog, wurde die Aachener Inschrit statt dessen einem Grenzposten zugeord-net, wie er – paarweise auf beiden Seiten des Übergangs – aus ungeklärten Gründen sogar an Orten belegt ist, wo (wie zwischen Belgica und den beiden Germaniae) nur eine Provinz-, aber keine Zollgrenze verlief. Das Pendant auf der ‚Gegenseite‘ – wo auch im-mer diese gelegen hätte – ist nicht bekannt, die Funktion lediglich aus der vermuteten Randlage Aachens erschlossen.42
Damit besteht die Möglichkeit, dass der hier belegte Beneiziarier mit einer Grenze nichts zu tun hatte. Tatsächlich ist diese Deutung ungleich plausibler, nicht zuletzt, weil man ihn als Grenzer eher mit einer statio an der großen Fernstraße erwarten würde als in Aachen, von wo aus allenfalls eine Nebenstrecke, etwa nach Maastricht, weiterge-führt haben kann. Zu den von Ott neu erschlossenen Tätigkeitsfeldern der Beneiziarier
42 Straßenpolizei: Alfred von Domaszewski, Die Beneiziarierposten und die römischen Stra-ßennetze, in: Westdeutsche Zeitschrit 21 (1902), S. 158–211. Inschrit: CIL XIII l835 = Egon Schallmayer (Hrsg.), Der römische Wei-hebezirk von Osterburken I: Corpus der grie-chisch-lateinischen Beneiciarier-Inschriten des römischen Reiches (Forschungen und Be-richte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 40), Stuttgart 1990, S. 50, Nr. 45. Revision: Joachim Ott, Die Beneiciarier. Unter-suchungen zu ihrer Stellung innerhalb der Rangordnung des römischen Heeres und zu ih-rer Funktion (Historia ES 92), Stuttgart 1995, S. 120–129. Einordnung Aachens in „Typ B: ent-lang der Außengrenzen der Provinzen“ auf
Karte 2, Nr. 10; zum Typus a.a.O., S. 138f. Gegen die ältere Literatur über den Straßenwächter (für die Lokalrezeption in Aachen entscheidend Schué, römische Zeit [wie Anm. 3k], S. 102) ver-trat Dorothee Strauch, Römische Fundstellen in Aachen, in: ZAGV 100 (1995/9k), S. l–128, dort S. 34f. Die Möglichkeit, „daß er zur Kur dort weilte“; der an zahlreichen Orten gut belegte Brauch der Beneiziarier, Weihinschriten zum Dienstende zu setzen, verringert die Wahr-scheinlichkeit für diese Variante. Keine spezii-schen Funktionsvorschläge bei Jocelyne Nelis-Clément, Les beneiciarii: militaires et adminis-trateurs au service de l’Empire (Ier s. a.C. – VIe s. p.C.) (Ausonius – Publications 5), Paris 2000, S. 150.
328 · Jörg Fündling
gehört die Überwachung des Einzugs von Steuern und Abgaben, insbesondere auch im Zusammenhang mit Bergbautätigkeit, wie Ott in anderem Kontext plausibel vermutete – so könnten sie „innerhalb der Bergwerksverwaltung als polizeiliche Untersuchungs- und Vollzugsorgane“ mit Kontrollaufgaben gewirkt haben, aber auch als Kontrolleure der Metallablieferung in Betrieben unter direkter staatlicher Regie sowie drittens „in der Buchführung“. Schließlich sei es möglich, dass beneiciarii im Dienst des Statt halters (wie der Aachener Fall) als Aufpasser ihres Chefs fungiert hätten, auch an Orten, wo sozusagen keine ständige Planstelle für einen ihrer Kameraden bestand. „Datius“ (wie der verstümmelte Name manchmal aufgelöst wird) könnte damit im Breiniger Berg-werksbezirk seinen Aufsichtsp ichten nachgegangen sein und sich entschieden haben, eine Weihung in Aachen vorzunehmen – wobei man sich fragen darf, warum dann nicht im nahen Varnenum, und die Antwort bei den im Aachener Tempelbezirk reprä-sentierten Gottheiten suchen müsste. Noch eher kann er aber seine Funktion in Aachen selbst ausgeübt haben, über das die Bergbauprodukte zumindest teilweise abtranspor-tiert wurden.43
b) Spuren des Militärs – die Bäder?
Wäre es möglich, Aachen als Militärstandort nachzuweisen, ließe sich die Stadt ohne weiteres der Germania inferior zuordnen. Tatsächlich fehlt dieser Nachweis – was zu-nächst überrascht, wenn wir auf die zahlreich gefundenen Ziegelstempel der niederger-manischen Rheinarmee blicken. An sich belegen sie zunächst aber nur, dass beim Bau der Heilbäder Material aus Militärziegeleien in großen Mengen verwendet wurde, und machen dadurch plausibel, dass die Bauten zumindest unter entscheidender Mithilfe der niedergermanischen Armee errichtet wurden, mit einiger Wahrscheinlichkeit sogar ganz in deren Regie wie bei vielen andere Infrastrukturmaßnahmen auch. Der Versuch der älteren Literatur, die Baukommandos von gleich drei Legionen auf einmal an der Münstertherme arbeiten zu lassen (hätte hinterher nicht mitbaden dürfen, wer nicht mitgebaut hatte?), war dennoch eine Überinterpretation. Im Übrigen wurden Legi-onsziegel auch an Private verkaut und erscheinen an ganz zivilen Orten. Mit Recht hat Andreas Schaub daher diese Argumentationslinie zurückgewiesen.44
43 Steuereinzug: Ott, Beneiciarier (wie Anm. 42), S. 154f.; Bergwerksverwaltung, Lieferkontrolle, Buchführung, Aufpasser: S. 155. Zum frühen Interesse Roms am Bergbau und dessen mögli-chen Implikationen für Aachens Entstehung vgl. Scherberich, Historische Voraussetzungen (wie Anm. 3), S. 238 u. S. 240–242.
44 Zu den hermenkomplexen nun Schaub 2011a, S. 2ll–282; 2011b, 32k–341 mit provisorischer Bauchronologie S. 34kf.; Übersicht der in Aa-chen gefundenen Legionsstempel: Noethlichs,
Aquae Granni (wie Anm. 3), S. 303f.; Schaub 2011b, S. 3kl–3k9 mit S. 3k8, Abb. l0. Gleichset-zung von Stempeln mit Bautrupps: Hans Christ, Das karolingische hermalbad der Aachener Pfalz, in: Germania 3k (1958), S. 119–132; bes. S. 123f. Besonders ein ussreich von Petrikovits, Westgrenze (wie Anm. 29), S. 118: die nachge-wiesene Größe des Badebezirks und die Militär-ziegel „haben Sicherheit darüber erbracht, daß Aquae Granni in der Provinz Niedergermanien lag. […] Für Aachen wird man vermuten dür-
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 329
Die altvertraute Vorstellung vom reinen „Militärbad“ Aachen, ausschließlich von und für Soldaten, ist ohnehin überzeichnet, so sicher die Schlüsselrolle der Bäder schon im Moment des Siedlungsbeginns mittlerweile ist. 45 In solcher Nähe zur Rheingrenze wäre es umgekehrt auch ohne Belege sicher, dass Militärangehörige die Bäder massiv frequentierten; die Weihinschrit des Centurio L. Latinius Macer aus Burtscheid – wo Ausgrabungen im März 2010 endlich ein großes Badebecken angeschnitten haben – passt in dieses Schema und deutet wegen der Herkuntslegion IX Hispana in Richtung Germania inferior. 4k
Andererseits verwirrt die wiederentdeckte Weihung der Iulia Tiberina in diesem Zusammenhang – falls sie zusammen mit ihrem Mann Q. Iulius [..]avus, einem akti-ven centurio der legio XX Valeria Victrix, in Aachen war und dies, wie der Fundort inmitten der ‚Bücheltherme‘ nahelegt, der Bäder wegen, wieso haben die beiden nicht die weitaus kürzere Reise vom Legionsstandort Deva (Chester) in Britannien zu den dortigen Heilbädern von Aquae Sulis (Bath) unternommen? Tiberinas Stein weist zu-dem überdeutlich auf die Gefahr hin, dass soziale und inanzielle Voraussetzungen unseren Eindruck verzerren und das scheinbare ‚Zielpublikum‘ der Aachener Bäder geographisch wie der Herkunt nach zu sehr einengen: Armeeangehörige, gerade die
fen, daß das Heer die hermen für eigene Zwe-cke erbaut hat.“ Ebenso Kaemmerer, Aachener Quellentexte (wie Anm. 38), S. 2.Vgl. nun Dirk Schmitz, Militärische Ziegelproduktion in Nie-dergermanien während der römischen Kaiser-zeit, in: KJ 35 (2002), S. 339–3l4; zu Aachen S. 348 Abb. k (leg. X Gemina; Ziegelproduktion ca. 85–102/104 n.Chr.); S. 351, Abb. 8 (leg. I Mi-nervia; 82/83–3. Jh.); S. 353, Abb. 9 (leg. VI Vic-trix; ca. l1–122); S. 355, Abb. 10 (tegularia trans-rhenana; ca. l1–?); S. 3k0, Abb. 13 (leg. XXX Ulpia Victrix; 122–3. Jh.); S. 3k2, Abb. 15 (vexil-latio exerc. Germ. inf.; ca. 180 – Mitte 3. Jh.?); vgl. die Fundnachweise S. 3kl–3l4. Eine umfas-sende Studie zur zivilen Verwendung der Legi-onsziegel (vgl. nur Schmitz a.a.O., S. 354; S. 3kk) bleibt ein Desiderat. Resümee gegen eine Zu-ordnung auf dieser Basis: Schaub 2011b, S. 384f.
45 Zur Fragwürdigkeit der verengten Aufassung vom „Militärbad“ vgl. Schaub 2011a, S. 251 so-wie den Beitrag von Andreas Schaub in diesem Band; diferenziert spricht Scherberich, Histori-sche Voraussetzungen (wie Anm. 3), S. 238 von der Armee als „Hauptzielgruppe“ zum Bauzeit-punkt. Vgl. Schaub 2011a, S. 2ll–281; S. 298 zum aufeinander abgestimmten Baugeschehen der ersten Phase rund um die Quirinusquelle am Hof. Schon John F. Drinkwater, Roman
Gaul. he hree Provinces, 58 BC–AD 2k0, London/ Canberra 1983, S. k8 beschrieb Aachen als „non-military development“ im „hinterland of Germania Inferior“ nach dem Muster zahl-reicher weiterer gallischer Ortschaten. Auch Spickermann, Germania Inferior (wie Anm. 13), S. 83 verwies auf die Wendung l(oco) p(ublice) d(ato) in der Weihinschrit CIL XIII 12005 und den „ausgesprochen öfentliche[n] Charakter des Kultplatzes“. Burtscheid: vgl. horsten Karbach, „Römer badeten in Burt-scheid“/„Römertherme taucht in Burtscheid auf“, in: Aachener Zeitung Nr. l0 vom 24.3.2010, S. 1 und 1l mit ersten Presseberichten.
4k Zum Inschritenbestand vgl. den Beitrag von Karl Leo Noethlichs in diesem Band. Generell dürtiges Repertoire in der Belgica: vgl. Marie-hérèse Raepsaet-Charlier, Aspects de l’ono-mastique en Gaule Belgique, in: Cahiers du Centre Gustave Glotz k (1995), S. 20l–22k; dort S. 208 zum bekannten Bestand an Personenna-men. Macer-Stein: AE 19k8, 323; Indiz für Germ. inf. auch laut Herbert Nesselhauf/Harald von Petrikovits, Ein Weihaltar für Apollo aus Aachen-Burtscheid, in: BJ 1kl (19kl), S. 2k8–2l9. Vgl. Noethlichs, Aquae Granni (wie Anm. 3), S. 311.
330 · Jörg Fündling
der oberen Ränge, waren eher als andere sowohl reich genug als auch der Gewohnheit epigraphischer Selbstdarstellung verhatet, womit sie überproportional häuig In-schriten hinterließen. 4l
Die belegte Anwesenheit von Militärangehörigen – wie auch der Neufund eines mut-maßlichen Baulagers in der Prinzenhofstraße 2011 – kommt übrigens keiner regulären Truppenpräsenz gleich. Eine aktive Einheit als Garnison, sei sie auch noch so klein, ist für Aachen gar nicht zu vermuten. Sie hätte mit dem Markthügel ein Terrain am Ende eines verkehrsgeographischen ‚Nebengleises‘ der Antike gewählt. Auf drei Seiten lagen die sumpigen Niederungen der Wurm und ihrer Zu üsse, jenseits davon stieg das Ge-lände außer im Osten so rasch an, dass ein Feind das hypothetische Lager problemlos hätte einsehen können, während der dicht bewaldete Höhenzug rund um den Aachener Talkessel die Fernsicht nahm und die Annäherung von Gegnern massiv erleichterte. Im Licht dieser Befunde kann man die drei Phantomlegionen nur bewundern, die mit Papier und Bleistit im Namen Caesars oder auch des frühen Augustus auf den Markt-hügel verschoben worden sind – sie haben ofenkundig in mehrstöckigen Kasernen ge-haust und vor ihrem Abzug die Tausende verräterischer Gegenstände oder Bodenbefunde restlos entfernt. Römische Gründlichkeit!48
4l Wiederauindung der Tiberina-Inschrit: And-reas Schaub, Das archäologische Jahr 200k in Aachen, in: ZAGV 109 (200l), S. 1–1l (dort S. 11–15) und Titelbild; vgl. Noethlichs, Aquae Granni (wie Anm. 3), S. 313f.; Schaub 2011b, S. 35kf. Der Beitrag von L. Guido, I Numina Di-vorum Augustorum e la legio XX Valeria Vic-trix: una nuova iscrizione di Aquisgrano, in: Latomus k8 (2009), S. k44–k5k, vertritt eine Frühdatierung der Inschrit auf die Zeit vor Claudius’ Britannieninvasion von 43 (a.a.O. S. k50), um so in die Zeit zu kommen, als die Legion auf dem Kontinent stationiert war. Da-für muss er die im 2.–3. Jh. n. Chr. massenhat für die Nordprovinzen belegte Weiheformel in honorem domus divinae zu einem besonders frühen Einzelfall erklären (a.a.O. S. k4lf.; theo-retisch möglich, statistisch gesehen unwahr-scheinlich) und für die Isisweihung einen ähn-lichen Avantgardecharakter unterstellen (a.a.O. S. k53–55). Angesichts der deutlich in die Breite entwickelten Buchstaben der sorgfältig ausge-führten und spatiierten Capitalis Quadrata kommen auch Nichtepigraphikern starke Zwei-fel, ob es sinnvoll ist, auf eine formale, inhaltli-che und optische Ausnahme zu plädieren; im späten 2. oder frühen 3. Jh. erschiene der Stein weit weniger exotisch. – Der Valeria Victrix war
zu einem unbekannten Zeitpunkt auch die cohors I Sunucorum zugeordnet (s.o. Anm. 23); ein Zusammenhang mit dem Besuch von Iulius [..]avus bleibt aber rein spekulativ.
48 Allenfalls punktuell treten militärische Klein-funde auf (Schaub 2011a, S. 298, vgl. 2011b, S. 3kl–3k9).Die Fundlage ist zusammengefasst in: Strauch, Römische Fundstellen (wie Anm. 42), S. l–128; Christoph Keller, Archäologische Forschungen in Aachen. Katalog der Fundstel-len in der Innenstadt und Burtscheid (Rheini-sche Ausgrabungen 55), Mainz 2004, S. 32–4l. Einiger Resonanz erfreut sich noch immer die Geschichtsphantasie von Axel Hausmann, Aa-chen zur Zeit der Römer. Der goldene Schnitt, Aachen 1994, die auf der Grundlage von Pro-portionsüberlegungen und Privatetymologien formuliert wurde (dagegen schon Keller, Fund-stellen ebd., S. 32). Methodische Devise ist das Schlusswort: „Zumindest könnte es sich aber so ereignet haben, und wer weiß schon[,] wie etwas wirklich war! Geschichte ist […] der Phantasie ofen.“ (S. 1l2). Hausmanns Ausgangsidee folgt der Lieblingsargumentation zu vieler Hobby-historiker: Wenn ein lang gesuchter Ort wie das caesarische Legionslager von Atuatuca 54/53 v. Chr. (Caes. Gall. 5,24,5. 2k–3l; k,32,3. 3k,1–42,3) oder der Schauplatz der Varusschlacht
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 331
unter anderem in der heimischen Gegend ver-mutet wurde, warum soll er nicht genau da lie-gen, wo ich wohne? (a.a.O., S. 31: „dann liegt es eigentlich auch nahe, mitten in Aachen an den heißen Quellen nach ihm zu forschen.“) Der Name Atuatuca sei „überwiegend zur Bezeich-nung von Quellen benutzt“ worden (ebd.; zur mutmaßlichen wirklichen Bedeutung vgl. den Beitrag von Johannes Heinrichs im vorliegen-den Band). Quellen gibt es anscheinend nir-gendwo außer in Aachen (Gegenvorschläge werden zumindest nicht gemacht), also ist die Lokalisierung perfekt. Auf dieser Basis entwirt Hausmann einen monumentalen Ausbauplan des Octavian und Agrippa, begonnen 39 v. Chr. (a.a. O. S. 50f.), nach dem ein Winterlager für drei komplette Legionen (plus auxilia) „[a]ls sichtbares äußeres Zeichen […] für seinen allei-nigen Anspruch auf das Erbe Caesars“ (S. 8) oder „als Symbol der Vergöttlichung Caesars und seines Adoptivsohnes“(S. 102) für nicht ge-nannte Betrachter quer zu den „versumpten Bächen“ des Aachener Talkessels (a.a.O., S. 34 als Trinkwasserspender gelobt, S. 104 als Re-genab uss) als exaktes Quadrat in die Land-schat gesetzt wird (S. l3, Bild 11). Die zugewie-sene Fläche geht auf drei Seiten beachtlich über den Umfang der inneren Stadtmauer hinaus und erreicht auf der Südwestseite die äußere; große Teile dieses Areals bestanden mindes-tens bis weit ins Mittelalter aus Sümpfen. Die Belegschat bilden – wie sollte es anders sein – die späteren ‚Varuslegionen‘ XVII–XIX (a.a.O., S. 50; S. 59), die von 39 v. Chr. bis 9 n. Chr. jeden Winter nach Aachen verlegt worden seien (S. 119), auch nach dem Beginn der rechtsrhei-nischen Expansion – Varus sei vor dem Auf-bruch an die Wurm in einen Hinterhalt gelockt worden (S. 131). Die Varusschlacht wiederum erklärt, wieso wir von dieser gigantischen Mili-tärbasis kein Wort in den Quellen inden: Aa-chen samt seiner Funktion wird nach der Kata-strophe vom Senat wie ein böser Kaiser mit der damnatio memoriae belegt (S. 133f.), ist aber bis zum „Ende der Feldzüge des Germanicus“ wei-ter in Gebrauch (S. 13l), danach nur noch „Rüstungszentrum und […] Badeort“ (S. 138). Immerhin: „Weiterhin wurden in Aachen klei-nere Truppenkontingente und auch schon ein-mal ganze Legionen für jeweils einige Jahre stationiert“ (S. 15k), darunter (wegen AE 19k8,
S. 323) die legio IX Hispana „zur Ausrüstung“ um 43 oder auch 115 (S. 1kk). Sie alle haben sich gehütet, verräterische Spuren wie z. B. Grab-steine zu hinterlassen. Die bequeme Übersicht bei Yann Le Bohec, Die römische Armee, Stutt-gart 1993 (ND Hamburg 2009), S. 182f. zeigt sehr schön, dass eine Legion in augusteischer Zeit ein Lager von 1l–18 Hektar Fläche benö-tigte – also etwas größer als der nachgewiesene Umfang der römischen Siedlung auf dem Markthügel. Das Hausmannsche Dreifachlager hätte also, knapp gerechnet, einen halben Qua-dratkilometer eingenommen und sich selbst mit einem hochwassersicheren, weniger absur-den Grundriss die Jakobstraße hinauf bis etwa zur Linie der späteren äußeren Stadtmauer zie-hen müssen. Vgl. etwa Aquae Granni (wie Anm. 10), Tafel k0; dort gezeigt ist der von Leo Hugot, Ausgrabungen und Forschungen in Aa-chen, in: a.a.O., S. 115–1l3, dort S. 1l0–1l3 ge-schätzte Siedlungsumfang von gut 20 ha. Über die Probleme, 15 000 bis 18 000 Mann und ihre Lasttiere – Auxiliartruppen und zivile Bewoh-ner der canabae nicht gerechnet – aus den Mit-teln der näheren Umgebung zu versorgen (zum Wasservorrat Hugot a.a.O., S. 1k3–1k8), ist da-mit noch nichts gesagt. In der von Hausmann a.a.O. errechneten Versorgungszone für 30 000 Mann (!) mit einer spurlos verschwundenen Zenturiation (a.a.O., S. 150) wird das Getreide von Bauern angebaut, die fasten, und von Och-sen ins Lager gebracht, die nichts fressen; in die Rechnung gehen sie jedenfalls nicht ein. Um auf die nötige Zahl an Höfen zu kommen, wird der mittelalterliche Bestand an Ortsnamen, er-gänzt aus beherzter (Privat-)Etymologie oder wiederum mit dem Zirkel, geschlossen zu villae rusticae erklärt (vgl. a.a.O.,, S. 10l–109) – dass Hausmann dank dieser Rückprojektion der mittelalterlichen Verhältnisse zwangsläuig bei den Dimensionen des „Aachener Reiches“ lan-det, wertet er umgekehrt als Beweis: „Das ist sicher auch kein Zufall!“ (a.a.O., S. 109). Stra-ßenverbindungen, „Wachttürme“ und „Signal-türme“ in märchenhater Dichte (S. 118; Karte S. 11k Fig. 2k), liefert wiederum die Etymologie, teils aus der (in der Literaturliste a.a.O., S. 1l3 fehlenden) älteren Aachen-Literatur entnom-men, teils Eigenprodukt, das mit der Entste-hung von Namen z. B. im Mittelalter gar nicht erst rechnet (S. 192–19k).
332 · Jörg Fündling
c) Verkehrsgeographie
Das imposante Bild des römischen Aachen als Drehkreuz des Fernverkehrs stellt sich, wie gesehen, heute bescheidener dar. Als Anbindung ans Fernstraßennetz nachgewiesen ist bisher allein die Strecke Aachen-Weiden, auf der ungefähren Linie der späteren Jüli-cher Straße. Aachen war somit an die Fernstraße Boulogne-Bavay-Tongeren-Köln ange-schlossen, eindeutig als Nebenstrecke, wenn nicht gar Sackgasse. Weitere Anbindungen über Nebenwege sind immerhin wahrscheinlich. Zusätzlich ist außerdem der Lauf der Wurm, vielleicht auch des Johannisbachs und der Pau als – wohl saisonaler – Wasserweg für ache Lastkähne denkbar. Auf jeden Fall blickte die römische Siedlung verkehrstech-nisch notgedrungen nach Norden bis Nordosten – wie die Eifel als Hauptverkehrshin-dernis im Süden lag auch die Fernstraße quer zur Provinzgrenze und stand in keinerlei notwendigem Zusammenhang zur administrativen Gliederung aller Ebenen.49
Von Aachen selbst aus war zweifellos die Umgebung angebunden, insbesondere die von W. M. Koch so bezeichnete „Wirtschatsachse“ über Schönforst und Brand bis nach Breinig, der mit Varnenum identiizierte Tempelbezirk von Kornelimünster mit seiner Siedlung (zu dem von Brand her eine Straße führte, die weiter zum Breiniger Berg-werksdistrikt lief). Eine Nordwestverbindung nach Coriovallum (Heerlen) zur Fern-straße als Pendant für die Jülicher Strecke wird – nach dem Muster vieler weiterer Sied-lungen neben einer Hauptstraße – in jüngeren Publikationen plausibel angenommen, ebenso eine Straße nach Maastricht.50
49 Verkehrszentrum Aachen: Voll entwickelt in Hagen, Römerstraßen (wie Anm. 39), mit einer Straße Köln-Merzenich-Eschweiler, die über Weiden und in einer Parallelstrecke über Eilen-dorf nach Aachen geführt habe, und ihrer Fort-setzung über Melaten nach Maastricht (S. 240–245), der tatsächlich belegten Verbindung Jülich(?)-Weiden-Aachen, fortgesetzt nach Lüt-tich (S. 245f.), einem Seitenweg nach Stolberg (S. 251f.), einem verzweigten Straßensystem ins Hohe Venn einerseits, nach Würselen und Als-dorf andererseits (S. 253f.). Hagen betont ei-gens, nicht alle Vorschläge der Heimatkundler aufgenommen zu haben! Bezug auf Hagen mit Warnung vor fehlenden Belegen: Cüppers, Bei-träge (wie Anm. 10), S. 15.Vgl. Schaub 2011a, S. 258–2k3 mit S. 259, Abb. 11. Maßgeblich für das Fernstraßennetz jetzt Michael Rathmann, Die Reichsstraßen der Germania inferior, in: BJ 204 (2004), S. 1–45 (v.a. die Überblickskarte 5 auf S. 22; Meilensteine des Abschnitts Köln-Tongeren: a.a.O. S. 35–40 Nr. 1l–24); ergän-zend ders., Ein neuer Meilenstein für die Ger-mania inferior, in: ZPE 1l4 (2010), S. 2k4–2kk.
Schibarkeit: Schaub 2011a, S. 2k3f. Vgl. nun auch den Beitrag von Dietmar Kottmann in diesem Band. Zu einer Transportmöglichkeit in Aachens weiterer Umgebung vgl. Leon Mar-quet, Transports d’autrefois. La navigation sur l’Ourthe moyenne, in: Ardenne et Famenne 2 (19k8/k9), S. 203–230. Die Ourthe – nach dieser Studie bis La Roche schibar – führt wohlge-merkt deutlich mehr Wasser als Wurm und Inde. Wegen nachantiker Veränderungen in Lauf und Einzugsbereich der Bäche steht die Hydrologie dieser Zeit noch am Anfang.
50 „Wirtschatsachse“: Koch, Aachen (wie Anm. 13), S. 14f. Straße Brand-Varnenum-Breinig: ebd., S. 15–1l. Die römerzeitliche Querung des Hohen Venns, die vielfach vermutet wird, gibt seit langem Rätsel auf und hat keine klare Rich-tung; am ehesten eine Verbindung Maastricht-Trier sahen darin Raepsaet-Charlier/Raepsaet-Charlier, Gallia Belgica et Germania Inferior (wie Anm. 13), S. klf. Weitere erschlossene Ver-bindungen: Rothenhöfer, Wirtschatsstruktu-ren (wie Anm. 30), S. 28, Abb.4 „Vici und die wichtigsten Verbindungsstraßen im südlichen
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 333
d) Rohstoffe und verarbeitendes Gewerbe
Der Breiniger Bergwerksdistrikt war eindeutig von überregionaler Bedeutung; am Schlangenberg bei Breinigerberg, in Gressenich und Wenau baute man Blei, Eisen und vermutlich auch schon Galmei ab; hinzu kam die Gewinnung von Eisenerz aus diver-sen kleinen Vorkommen nahe Walheim und Brand sowie beim vicus Schönforst. Als Handelsgut über Entfernungen jenseits von ca. k0 km kommt auch die Steinkohle in Frage, die in Flusstälern der Aachener Region ausbeißt – entlang der Wurm, der Inde, am Münster- und Wehebach. Hier ist wahrscheinlich die Quelle der römerzeitlichen Steinkohlefunde am Rhein und in den nördlichen Niederlanden zu suchen; für solche Lieferungen ist der Transport über Wasser naheliegend. Rothenhöfer verzeichnet eine respektable Ansammlung von acht Steinbrüchen im Münsterländchen, wo Schiefer und Blaustein, vor allem aber Kohlenkalk gewonnen wurde. Die Aachener Schichten dieses Gesteins sind von den Vorkommen im Maastal kaum zu unterscheiden; min-destens eine dieser beiden Herkuntsregionen lieferte bis zur Maasmündung, wie das Nehalennia-Heiligtum von Colijnsplaat belegt, und sogar über See nach London. Hinzu kam der Nievelsteiner Sandstein bei Herzogenrath, der vielleicht ebenfalls bis nach Colijnsplaat gelangte. Weiter zu nennen wäre die Bruchsteingewinnung für die zahlreichen bei Walheim gefundenen Kalköfen, die zusammen ein regelrechtes „Kalk-produktionszentrum“ ergeben; ob es über die anliegenden vici und Agrarbetriebe hinaus von Bedeutung gewesen ist, muss ofenbleiben – über die Hauptfaktoren für weiträumige Verbreitung, „die Nähe zu den Absatzregionen und die Anbindung an das Wasserwegenetz“, sollte auf alle Fälle weiter diskutiert werden. Denkbar, aber nicht nachgewiesen ist die Gewinnung von Walkererde am Schneeberg zur Wollverar-beitung. 51
Um die ‚Industrie‘ ist es in Aachen selbst, von Töpferöfen, Spuren kleinerer metall- und glasverarbeitender Betriebe und Beinschnitzerei für den lokalen Bedarf abgesehen, schlecht bestellt; Rothenhöfer nahm Erz- und Keramikfunde in der Siedlung von Schönforst, darunter eine ca. 125–150 aufgenommene, doch bald wieder abgebrochene Produktion von terra sigillata, als mögliches Indiz für „eine bereits bestehende Ver-teilerfunktion des Regionalzentrums Aachen für Metallprodukte“, deren Handels-kontakte die Töpfer hätten nutzen wollen. Klare Belege für die Herstellung weiträumig gehandelter Fertigwaren in und um Aachen fehlen, sieht man von August Voigts
Niedergermanien“. Im Begleittext ist sogar von „Anbindung des Stolberger Bergbaubezirks […] nach Westen, Osten und auch Norden“ die Rede, allerdings ziehen die zwei im Bild sicht-baren Straßen nach NW und NO.
51 Erzbergbau: Rothenhöfer, Wirtschatsstruktu-ren (wie Anm. 30), S. 35; S. 84f.; S. 90f.; S. 94f.; S. 9k–99; aus der dort aufgeschlossenen Literatur vgl. besonders August Voigt, Gressenich und
sein Bergbau in der Geschichte. Eine historisch-lagerstättenkundliche Untersuchung, in: BJ 155/5k (1955/5k), S. 318–335 mit Taf. 42f.; zur Rö-merzeit S. 321–331. Kohle: Rothenhöfer a.a.O., S. 101f. Stein: S.102 mit Abb. 20; Export: S. 110 mit Anm. 2l3 (Kohlenkalk), S. 115 mit Anm. 25k (Sandstein). Kalkbrennerei: a.a.O., S. 112 mit Abb. 23; Liste der Fundorte: S. 115; Standortfak-toren: S. 11k. Walkererde: S. 189, Anm. k35.
334 · Jörg Fündling
Vorschlag ab, diverse Metallgegenstände und namentlich die bekannten Hemmoorer Eimer als Gressenicher Produkte anzusehen.52
In jedem Fall liegt die bevorzugte Exportrichtung zum Rhein hin, wie man bis tief ins Hinterland der beiden germanischen exercitus unabhängig von der Provinzzugehörig-keit erwarten muss. Eine Nutzung des Fluss- und Bächesystems als Wasserstraßen ist sehr wahrscheinlich; auch dies lenkt den Blick aber nur ganz allgemein nordwärts. Ganz außer Betracht bleiben muss ein Wirtschatsfaktor ersten Ranges, die Produktion und der eventuelle Export landwirtschatlicher Produkte, dazu der etwaige Holzhandel – die Bodennutzung in Aachens unmittelbarer Umgebung ist bislang nicht systematisch untersucht worden.53
e) Handel und Berufe
Einheimische Händler sind generell schwer zu identiizieren, weil sie sich längst nicht immer epigraphisch zu erkennen geben. Ein möglicher Vertreter dieser Sparte, der in Aachen bezeugte Bataver Maddgarisianus, verdeutlicht abermals die stark zur unteren Rheingrenze hin ausgerichteten Wirtschatsbeziehungen. Umgekehrt begegnet im ‚Ausland‘ lediglich die Sunucerin Cominia Apra auf einer Bonner Weihinschrit für Sunuxsal.54 Ein für den gesamten gallischen Zollbezirk typisches Fundstück ist ein Stempel des Augenarztes [S]aturn[ius] aus dem Elisengarten. Nicht zuletzt die Tempel-
52 Örtliche Betriebe: sehr detailliert Schaub 2011b, S. 3ll–383. Schönforst, „Verteilerfunktion“: Ro-thenhöfer, Wirtschatsstrukturen (wie Anm. 30), S. 139. Vgl. Voigt, Gressenich (wie Anm. 51), S. 32k–331; zu den Töpfereien und weiteren Kleinbetrieben im Innenstadtbereich Keller, Fundstellen (wie Anm. 48), S. 43f. Heiko Steuer, RGA 14 (1999), S. 3l8–380, s.v. Hemmoorer Ei-mer, referiert lediglich die gängigere Hypo-these, Köln als Produktionsort anzusprechen.
53 Mustergültig für die Problematik der archäolo-gisch schwer fassbaren Wirtschatszweige ist Werner Eck, Das römische Köln: Wie deckt eine Provinzstadt ihren Bedarf?, in: Emanuele Papi (Hrsg.), Supplying Rome and the Empire. he Proceedings of an International Seminar Held at Siena – Certosa di Pontignano on May 2–4, 2004 on Rome, the Provinces, Production and Distribution (JRA Suppl. k9), Portsmouth (R. I.) 200l, S. 209–218, zur Land- und Forstwirtschat S. 214–21l.
54 Maddgarisianus: CIL XIII l833. Vgl. Lothar Wierschowski, Handels- und Wirtschatsbezie-hungen der Städte in den nordwestlichen Pro-vinzen des römischen Reiches, in: Eck/Galste-
rer (Hrsg.), Die Stadt in Oberitalien (wie Anm. 15), S. 121–139, dort S. 133; ders., Cugerner, Ba-etasier, Traianenser und Bataver im überregio-nalen Handel der Kaiserzeit nach den epigra-phischen Zeugnissen, in: Grünewald (Hrsg.), Germania inferior (wie Anm. 30), S. 409–430; dort S. 423f. mit Tabelle 1–2. Cominia und ihr Bruder Apuleius Severus: Hans Lehner, Römi-sche Steindenkmäler von der Bonner Münster-kirche, in: BJ 135 (1930), S. 1–48; dort S. 23, Nr. 5k = Herbert Nesselhauf, 2. Nachtrag zu CIL XIII. in: BRGK 2l (193l), S. 51–134; dort Nr. 199): Wierschowski a.a.O., S. 134. – Zum Handel generell: Harald von Petrikovits, Römi-scher Handel am Rhein und an der mittleren und oberen Donau, in: Klaus Düwel (Hrsg.), Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa (Abhandlungen d. Akademie d. Wissenschaten in Göttingen, Philosoph.-Histor. Klasse, 3. Folge, Nr. 143), Göttingen 1985, S. 299–33k, jetzt in: Harald von Petriko-vits, Beiträge zur römischen Geschichte und Archäologie II. 19lk–1991, Köln/ Bonn 1991, S. 283–310.
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 335
55 Manfred Clauss, Ein Augenarztstempel aus Aa-chen, in: Epigraphische Studien 11 (19lk), S. 41f. Vgl. Catherine Salles, Les cachets d’oculiste, in: Revue archéologique du Centre 21 (1982), S. 22l–240; Ernst Künzl, Zum Verbreitungsge-biet der Okulistenstempel, in: ZPE k5 (198k), S. 200–202. Sarkophag des [Li]cinius Fuscus: CIL XIII l83k; zum Getreidehandel Eck, Köln (wie Anm. 3), S. 42l–429. Parallelen Noethlichs, Aquae Granni (wie Anm. 3), S. 31k.
5k Zitat: Rothenhöfer, Wirtschatsstrukturen (wie Anm. 30), S. 11, Anm. k. Eine Auswahl von Pro-vinzwechseln: Eck, Provinz (wie Anm. 41), S. 1l4f. Lingonen: Charles-M. Ternes, Die Pro-vinz Germania Superior im Bilde der jüngeren Forschung, in: ANRW II 5,2, Berlin/New York 19lk, S. l21–1248; dort S. l40–l42 mit Anm. 32 (civitas Lingonum von 89 bis ca. 150 bei Germ. sup., spätestens 22k wieder zur Belgica).
weihung der Iulia Tiberina für Isis und Mater Magna würde bestens zum Bild einer Stadt passen, in welcher der Handel ein wichtiger Geschätszweig war. Hier ist außer den Bodenschätzen insbesondere an Getreide des Köln-Aachener Raumes zu denken, das unter anderem der in Aachen bestattete negotiator frumentarius C. Licinius Fuscus weiterverkaute.55
5. Grenzfall Aachen? Zur Möglichkeit einer Statusveränderung
Am Ende des Rundblicks steht zunächst einmal kein entscheidender Gewinn an Klar-heit. Indizien oder gar schlagende Beweise gibt es für die Provinzzugehörigkeit nicht; die Frage stellt sich überhaupt nur unter der Voraussetzung, dass man die Tungrer wei-terhin zur Belgica rechnet. Eine weitere Komplikation sei nicht verschwiegen: „die Mög-lichkeit […], dass es im Verlauf der mittleren Kaiserzeit zu einer Veränderung des Pro-vinzzuschnitts gekommen sein könnte.“ An der Grenze der Schwesterprovinz Germania
superior zur Belgica ist nachweislich genau das mit dem Territorium der Lingonen ge-schehen; schon öter ist darauf verwiesen worden, dass die Festlegung der Provinzgren-zen keineswegs für die Ewigkeit bestimmt, wenn auch in der Praxis relativ starr war.5k
Ein etwaiger Gebietstransfer von Aachen und/oder dem Territorium der Sunucer be-rührt mittelbar die Frage der territorialen Selbständigkeit als civitas. Es erscheint denk-bar, wenngleich alles andere als zwingend, dass Aachen seine Provinz- und womöglich auch die Gebietszugehörigkeit gewechselt haben könnte.
a) Civitas Sunucorum, municipium Sunucorum?
In einem möglichen Szenario könnte Aachen den Tungrern abgenommen und mit dem angestammten Sunucer-Gebiet zusammengelegt worden sein, in einem anderen der ganze Stamm aus ubischer Oberhoheit unter die tungrische wechseln – oder umgekehrt. Nicht ganz so phantasievoll wäre es, mit der Abtrennung einer eigenen civitas zu einem unbekannten Zeitpunkt zu rechnen, eher optimistisch, dieser Abtrennung gar noch eine stadtrechtliche Aufwertung folgen zu lassen. Die schütteren Belege für Municipien in den germanischen Provinzen sind lückenhat und lassen Platz für die Vermutung,
336 · Jörg Fündling
5l „daß im römischen …“: Vittinghof, Civitas Ro-mana (wie Anm. k), S. 80–8l; Zitat S. 84; zu-stimmend Raepsaet-Charlier, Gallien und Ger-manien (wie Anm. 4), S.1l1. So schon Rüger, Germania inferior (wie Anm. k), S. 8l: „Bei den großen Lücken in der Dokumentation ist viel-leicht sogar noch mit weiteren de iure-Städten in der Germania inferior zu rechnen.“ (Vgl. a.a.O., S. 89f.; S. 92 zu Noviomagus/ municipium Batavorum, belegt durch CIL XIII 91k5 vom Jahr 1k2, und S. 92 zu Forum Hadriani, für das Rüger eine Rechtsverleihung durch Marc Aurel erwog.) Heterogenität: Raepsaet-Charlier, La cité des Tongres (wie Anm. 4), S. 58. Municipia und ius Latii in Konkurrenz zur Einteilung nach civitates: Brigitte Galsterer-Kröll, Latini-sches Recht und Municipalisierung in Gallien und Germanien, in: Estibaliz Ortiz de Urbina/ Juan Santos (Hrsg.), Teoría y práctica del or-denamiento municipal en Hispania. Actas del Symposium de Vitoria-Gasteiz, 22–24 de No-viembre de 1993. (Veleia, ser. Acta 3 / Revisiones de Historia Antigua 2), Vitoria 199k, S. 11l–129; dort v. a. S. 125–12l.
58 Municipien zwischen 138 und 180: Raepsaet-Charlier, Cité et municipe (wie Anm. 5), S. 2k5–2k8. Bauzeit der porticus „in der zweiten Hälte des 2. Jahrhunderts“, 1981 ergänzt um „oder zu
Beginn des 3. Jahrhunderts“: Joachim Kramer, Zur römischen Säulenarkadenwand aus Aachen im Rheinischen Landesmuseum Bonn, in: Aquae Granni (wie Anm. 10), S. 1l5–1l9; dort S. 1l8; vgl. Schaub 2011b, S. 35l–3k0. Für Ende des 2. Jhs. als Termin, zu dem der Badebezirk „ausgebaut und monumentalisiert“ wurde, Spi-ckermann, Germania Inferior (wie Anm. 13), S. 81f.; severisch: Schaub 2011b, S. 38kf.
59 Die Hofnung, zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Schatten der Ubier herauszuinden, kann trügen, wie uns die Jahrzehnte seit dem Frank-furter Skandalbeschluss von 19k3 gelehrt ha-ben, die (1.) Fußball-Bundesliga ohne den TSV Alemannia Aachen zu starten. (Zur Verstri-ckung der CCAA siehe u. a. Hermann J. Wes-kamp [Kölnische Rundschau], in: Franz Creutz [Hrsg.], Der Tivoli-Rückblick. Alemannia Aa-chen 1949–1999, Aachen 2000, S. 128 mit dem Zitat der communis opinio, „Franz Kremer, der Präsident des 1. FC Köln, habe bei dieser Ent-scheidung mitgemischt, um den Seinen die un-liebsame Konkurrenz gleich vor der Haustür vom Leib zu halten.“ Vgl. Franz Creutz [Hrsg.], Spiele, die man nie vergißt! Alemannia in den k0er Jahren, Aachen 199k, S. 139.) Womöglich mehr als eine bloße Kuriosität ist, dass Aachen auf der Nordrhein-Westfalen-Karte bei Eck,
„daß im römischen Germanien mehr civitates Municipalrecht hatten, als wir wissen“, wie sich durch den Neufund in Tongeren bestätigt hat… oder auch nicht. Die wohl-dokumentierte Heterogenität des Tungrer-Gebiets hätte einen späteren Neuzuschnitt jedenfalls erleichtert, so wie die relative Geringschätzung des in anderen Reichsteilen so begehrten Status gegenüber dem civitas-Begrif es nachhaltig erschwert, die Verbreitung des Municipalrechts zu verfolgen.5l
Für eine ganze Anzahl Municipien der näheren und weiteren Umgebung – Tongeren, das muncipium Batavorum und das der Canninefaten mit Sitz in Forum Hadriani/ Voorburg – weisen die spärlichen Quellen relativ klar auf Einrichtungsdaten unter Antoninus Pius oder Marc Aurel hin. Wer – auf der Spitze einer ganzen Pyramide aus Hypothesen – für Aachen eine analoge Karriere vom Hauptort zur Stadt annehmen will, sollte sich nicht unbedingt auf diese Zeit konzentrieren. Der wohl severerzeitliche Bau der porticus am Hof deutet eine interessante Möglichkeit ab den letzten Jahren des 2. Jhs. an.58
Strukturelle Argumente für die nachträgliche Einrichtung einer eigenen civitas mit dem Hauptort Aachen sind allerdings so rar, dass es für Lokalpatrioten taktisch beinahe klüger wäre, sie gegen alle Kölner Begehrlichkeiten von vornherein als unabhängige Einheit zu statuieren.59 Dringender urbanistischer Bedarf nach einem weiteren Zent-
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 337
Köln (wie Anm. 3), S. 20 als einzige Großstadt ohne Flächenausdehnung eingetragen ist; nicht der Autor, wohl aber das etwas unbescheiden proklamierte Reihenkonzept der Geschichte der Stadt Köln steht vielleicht dahinter. (Vgl. den früheren Direktor des damals noch unzer-störten Stadtarchivs, Hugo Stehkämper, in: Eck, Köln (wie Anm. 3), S. XXII: „Keine andere deut-sche Stadt kann eine ähnlich alte, reiche, große Geschichte aufweisen. Das geschichtliche Erbe Kölns ist mehr als üppig.“).
k0 Cerialis: Umgekehrt von Eck, Köln (wie Anm. 3), S. 208f. als derjenige benannt, der vermutlich die Sunucer zur CCAA geschlagen habe. Ange-
sichts des höchst angreibaren Verhaltens der Agrippinenser (musterhat dargestellt a.a.O., S. 200–20l) wäre eine Belohnung der zeitweise abtrünnigen Kolonie mehr als überraschend; wenn sie sich als Opfer des Civilis hinstellen konnten, dann ebenso gut die Sunucer, und ein Verzicht auf kollektive Bestrafung – wie Ceria-lis ihn eindeutig übte – ist noch nicht dasselbe wie eine regelrechte Aufwertung der ubischen civitas.
k1 Hauptquellen: Cass. Dio l5 (lk), 4,1–8,4; da-nach Herodian 3,5,1–3,8,l (zur starken Umge-staltung des Ablaufs beim von Dio fast restlos abhängigen Herodian vgl. Martin Zimmer-
ralort bestand in der Gegend nicht gerade. Damit verbleiben Motive der Tagespolitik. Auch wenn Aachen selbst nicht nach einer Statushebung zu rufen schien, bliebe der Wunsch einer höheren Stelle nach Statusminderung der bisherigen Mutterstadt durch die Ausgliederung und infrastrukturelle Aufwertung Aachens ein plausibler Vorgang. Gab es ein Motiv für irgendeinen Kaiser, Köln oder Tongeren durch Entzug eines Teils ihrer Gebiete zu bestrafen? Nach dem Bataveraufstand unbedingt, nur waren alle Betei-ligten, auch die Sunucer, in die Revolte verstrickt. Die folgende Aubauphase war ver-mutlich kein passender Moment, neue Verwaltungseinheiten zu schafen. Gesucht wird also eine Chance für beide Städte nach k8/k9, sich in Rom unbeliebt zu machen. Eine solche Gelegenheit existiert.k0
b) Der Bürgerkrieg in Gallien 196/97
Das Krätemessen, das sich um die Nachfolge des Commodus und des Übergangskai-sers Pertinax im Lauf des Jahres 193 n. Chr. entspann, hinterließ Septimius Severus als reichsweit anerkannten Herrscher – mit seinem bisherigen Rivalen Clodius Albinus, dem Statthalter Britanniens, unter dem Titel eines Caesar in seiner ehemaligen Provinz. Spätestens 19k kam es zum Bruch dieses Arrangements und zum militärischen Zusam-menprall, der mit Albinus’ Niederlage und Tod bei Lyon am 19. Februar 19l endete. Der verlustreichen, von Severus nur knapp gewonnenen Entscheidungsschlacht vorausge-gangen war ein Versuch der Albinianer, aus dem besetzten Gallien an den Rhein vorzu-stoßen, der in der Belagerung von Trier und einem Sieg über den mutmaßlichen Statt-halter der Germania inferior, Virius Lupus, gipfelte. Der Schlachtort ist nicht bekannt; da Albinus nach unseren Kenntnissen an regulären Truppen nur das britannische Pro-vinzheer zur Verfügung stand – drei Legionen und ungewöhnlich starke Auxiliarver-bände – wäre es plausibel, in den Siegern über Lupus zugleich die Akteure der (dann sicher späteren) Belagerung zu sehen. Ein technisch kunstgerechter Stadtangrif kam ohne Legionäre nicht aus; ebenso unentbehrlich mussten sie aber als Kerntruppen gegen Lupus sein, wo mit einem Gefecht gegen schwere Infanterie zu rechnen war.k1
338 · Jörg Fündling
mann, Kaiser und Ereignis. Studien zum Ge-schichtswerk Herodians [Vestigia 52], München 1999, zum Albinus-Krieg S. 189–193); Hist. Aug. Sev. 10,1–13,9 (die Angaben der HA-Vita Clodii Albini sind Fiktion). Nach wie vor unver-zichtbar: Johannes Hasebroek, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Septimius Severus, Heidelberg 1921, S. 81–109, ein Kommentar zur vita Severi der Historia Augusta. Lupus besiegt: Cass. Dio l5 (lk), k,2; vgl. Werner Eck, Die Statthalter der germanischen Provinzen vom 1.–3. Jahrhundert, in: Epigraphische Studien 14, Köln 1985, S. 188f. Nr. 40. Zum Kriegsverlauf Anthony R. Birley, Septimius Severus. he Afri-can Emperor, London 19l1, S. 189–195 (Lupus: S. 190); ²1988, S. 11l–120; Matthäus Heil, Clo-dius Albinus und der Bürgerkrieg von 19l, in: Hans-Ulrich Wiemer (Hrsg.), Staatlichkeit und politisches Handeln in der römischen Kaiser-zeit (Millennium-Studien 10), Berlin/ New York
200k, S. 55–85; zur Strategie S. l0f. Trier bela-gert: CIL XIII k800 = ILS 419 (vgl. AE 195l, 123) für Claudius Gallus, den Legaten der Mainzer legio XXII Primigenia, der die Stadt mit einer vexillatio verteidigte (Robert Saxer, Untersu-chungen zu den Vexillationen des römischen Kaiserheeres von Augustus bis Diokletian [Epi-graphische Studien 1 = BJ Beih. 18], Köln/ Graz 19kl, S. 4lf. Nr. 84; Géza Alföldy, Die Legionsle-gaten der römischen Rheinarmeen [Epigraphi-sche Studien 3 = BJ Beih. 22], Köln/ Graz 19kl, S. 49f. Nr. k0. Überholt PIR² C 8l8). Die Chro-nologie der Ereignisse ist fast völlig unklar; die Kämpfe können durchaus schon vor Jahresende begonnen haben. So oder so fand ein unge-wöhnlicher Winterfeldzug statt; vielleicht sorgte erst das Eintrefen von Severus und sei-ner Hauptarmee für den Abzug des Belage-rungscorps von Trier nach Süden zum bedroh-ten Lugdunum.
Der ‚heiße‘ Krieg begann mit der Landung der britannischen Truppen in Gallien, die spätestens vor Beginn der Herbststürme 19k (oder schon 195?) den Kanal überquert haben dürten. Sie bewegten sich teils nach Süden in die fast entmilitarisierte Tripel-provinz hinein, teils ostwärts den Rheinarmeen entgegen. Ein Gefecht größerer Teile der Albinianer (darunter mit einiger Wahrscheinlichkeit die cohors I Sunucorum) gegen Teile des niedergermanischen Heeres, die ihnen entlang der Straße Reims-Köln oder – wenn der Vormarsch zum Rhein gleich von den Ausschifungshäfen an der Kanalküste ausging – auf der Route Boulogne-Bavay-Köln den Weg verlegten, ließe sich mit dem Weitermarsch auf Trier gut vereinbaren.
Wahrscheinlich lag die Initiative bei Albinus, nicht bei Lupus. Der hronaspirant war verzweifelt knapp an schweren Truppen, wenngleich gut versorgt mit schnell bewegli-chen auxilia. Nur der Statthalter der Hispania Tarraconensis, L. Novius Rufus, war an-scheinend auf seiner Seite, doch hetiger Widerstand in der eigenen Provinz hinderte ihn an jeder größeren Unterstützung. Immerhin konnte Albinus sich Hofnungen ma-chen, durch rasches, überzeugendes Autreten wenigstens Teile des niedergermanischen exercitus kamp os auf seine Seite zu ziehen. Severus’ eigene Usurpation hatte sich auf die pannonischen Legionen gestützt, die bei der Neuaufstellung der aufgelösten Prätori-aner zweifellos bevorzugt worden waren; mit dem Neid ihrer germanischen Kameraden zu rechnen war im Licht historischer Erfahrungen vernüntig. Für nennenswerte Unter-stützung fehlt aber jede Spur; das Kalkül ging nicht auf. Der taktische Sieg über Lupus entsprach einer strategischen Niederlage – Albinus’ Ziel, das Militär der Provinz an sich zu bringen, war außer Sicht.
Auf einen längeren Feldzug gegen die Rheinlegionen konnte sich Albinus aus Zeit- und Krätemangel nicht einlassen; er musste seine Ressourcen für die Entscheidungs-
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 339
k2 Zur Stärke der britannischen auxilia um 200 und danach (geschätzt auf 9 alae, 35 Kohorten) Jarrett, Troops in Roman Britain (wie Anm. 22), S. ll. Landetermin „im Sommer oder Herbst 19k“: Hasebroek, Untersuchungen (wie Anm. 5k), S. 9k; schon 195: Birley, African Emperor (wie Anm. k1), S. 118 (zustimmend Zimmer-mann, Kaiser und Ereignis [wie Anm. k1], S. 192, Anm. 202). Eck, Köln (wie Anm. 3), S. 540 suchte den Schlachtort „wahrscheinlich außerhalb der Provinz“ des Lupus; das erscheint plausibler als Hasebroeks Annahme a.a.O., Al-binus habe „Germania inferior unterworfen“, wozu er Köln und zwei befestigte Legionslager hätte einnehmen oder doch einschließen müs-sen. Novius Rufus: CIL II 4125; Hist. Aug. Sev. 13,l. Prätorianer: Dio l5,1,1f.; 2,4f. (Übergang zu einer Rekrutierung „aus allen Provinzar-meen gleichermaßen“); Herodian 2,14,5 (Auf-stellung der neuen Garde aus „den besten“ der in Rom anwesenden Truppen). Severus’ Legi-onsprägungen gingen jedenfalls fest von der
Loyalität der Rheinarmeen aus. Vgl. Charles R. Whittaker, Herodian. Books I–IV, Cambridge, Mass./London 19k9, S. 20k, Anm. 1 zu Hero-dian 2,10,1. Keine Kämpfe z. B. auf Kölner Ge-biet: Eck, Köln (wie Anm. 3), S. 540, allerdings ofenbar in der – hier nicht vertretenen – An-nahme, dass Lupus’ Niederlage Teil des unmit-telbaren Vorstoßes auf Trier war.
k3 Notgedrungene Unterstützung für Albinus: Drinkwater, Roman Gaul (wie Anm. 45), S. 81. Anmarschweg der Severianer: Hasebroek, Un-tersuchungen (wie Anm. k1), S. 95. Strafen nach Nigers Tod: Cass. Dio l5,8,4; Hist. Aug. Sev. 9,l. Feldzug ca. 208 unter C. Iulius Septimius Casti-nus: CIL III 104l1–104l3 = ILS 1153; für ca. 205 optierte Alföldy, Legionslegaten (wie Anm. k1), S. 51, Nr. k2 (vgl. S. 111–114 zu Castinus’ stark militärischem Proil). Saxer, Vexillationen (wie Anm. k1), S. 48f., Nr. 8k–88 sieht einen Einsatz gegen Albinus-Anhänger „vermutlich im Wes-ten des Reiches“, Gallien als Schauplatz vermu-tet Eck, Köln (wie Anm. 3), S. 541.
schlacht gegen Severus zusammenhalten und sich damit begnügen, Lupus in die Defen-sive gedrängt zu haben. Mit großer Sicherheit näherten sich seine Kräte daher nach dem Sieg nicht weiter der Rheinlinie, jedenfalls auf diesem Weg. Ob das Vorgehen gegen Trier den Versuch weiter südlich mit dem Heer der Germania superior wiederholen oder dieser Armee lediglich den Weg durchs Moseltal nach Zentralgallien versperren sollte, ist kaum zu entscheiden.k2
Bevor Severus’ Hauptmacht eintraf, die der Kaiser durch die Burgundische Pforte nach Gallien führte, blieb damit als letzte Möglichkeit für Clodius Albinus, seine Kräte zu verstärken, die Aushebung von Rekruten. Welchen Bereich genau er im Winter 19k/9l kontrollierte, ist völlig unklar; die Tungrer mögen dazugehört haben, doch bis zum gut befestigten, vom niedergermanischen Heer gedeckten Köln reichte sein Arm jedenfalls nicht. Aus der Sicht des Siegers Severus, der bei Lyon fast sein Leben verlor und nach seiner Rückkehr mit aller Härte gegen vermeintliche Albinus-Sympathisanten in Rom vorging, war weder die materielle Unterstützung des Feindes (wie unwillig auch immer) noch eine schleppende Hilfe für die eigene Seite auf die leichte Schulter zu nehmen. Strafen und Belohnungen waren die Folge, so wie es unmittelbar zuvor den Städten des Ostens, voran Byzanz, nach dem Sieg über Pescennius Niger ergangen war. Die Reak-tionen der Betrofenen dürfen wir zum Teil aus der Strafaktion ableiten, die der Legat der Bonner legio I Minervia mit Detachements (vexillationes) aller vier Rheinlegionen noch um 208 gegen defectores et rebelles, „Abtrünnige und Aufrührer“, unternahm.k3
Wem es im gallisch-germanischen Bereich oder im zu Albinus abgefallenen Spanien gelang, sich loyal zu zeigen, dem drohten wenigstens keine Kapitalstrafen, wie im Fall
340 · Jörg Fündling
k4 Severus’ Rache in Rom: vgl. Géza Alföldy, Septi-mius Severus und der Senat, in: BJ 1k8 (19k8), S. 112–1k0; ders., Eine Proskriptionsliste in der Historia Augusta, in: Johannes Straub (Hrsg.), Bonner Historia-Augusta-Colloquium 19k8/ 19k9 (Antiquitas 4.l), Bonn 19l0, S. 1–12. Hin-richtung zahlreicher Gallorum proceres und Einzug ihres Grundvermögens: Hist. Aug. Sev. 12,1.3. Lugdunum: Herodian 3,l,l. Census in Gallien als Strafmaßnahme: Drinkwater, Ro-man Gaul (wie Anm. 45), S. 81f. mit Anm. 55.
k5 Raster: Schaub 2011a, S. 2k8; S. 298–300 (vgl. S. 2kk, Abb. 13 und die S. 2ll–l9 zusammenge-stellten ältesten Bebauungsdaten, einsetzend ab 3 v. Chr (mit ersten Steinfundamenten wohl ab Mitte des 1. Jh. n. Chr.: Schaub 2011b, S. 325). Einstweilen isoliert ist der Neufund des Frag-ments eines ACO-Bechers, der je nach Ge-brauchslänge eine bis zu anderthalb Jahrzehnte
frühere römische Präsenz signalisieren könnte; Pressebericht: Oliver Schmetz, Wenn die Ar-chäologen ihre Zeitmaschine anwerfen. Aache-ner Zeitung Nr. 111 (12.5.2012), 3. Vgl. auch den Beitrag von Andreas Schaub im vorliegenden Band. Die Funde römischer Architekturfrag-mente sind u. a. durch ein bedeutendes spolium in der Klostergasse ergänzt worden; Vorbericht: Donata Maria Kyritz, Archäologische Baube-gleitung in der Aachener Innenstadt, in: Harald Koschik (Hrsg.), Archäologie im Rheinland 2005, Köln 200k, S. 109–111, dort Abb. 9k. Für eine eventuelle Hauptortfunktion („[n]icht völ-lig auszuschließen“) angesichts der „ausgepräg-ten Urbanität“ Schaub 2011b, S. 385 mit Ver-weis auf die Porticus und die Candidinius-In-schrit (a.a.O. S. 35l–3k0 mit S. 350, Abb. 5l; S. 3l3–3l5).
der abtrünnigen Lokalaristokraten, oder das Schicksal des niedergebrannten Lugdu-
num. Vielleicht wurde er sogar von den Steuerbeamten verschont, die zumindest für Teile Galliens die Abgaben neu – und kaum zum Vorteil der Geschätzten – festlegten. Von den Turbulenzen um und nach Albinus könnten einige Orte im Gegenteil proitiert haben: Gebietsverkleinerung und die Loslösung vormals abhängiger Einheiten zählten zu den klassischen Strafmitteln in dieser Hinsicht. Eine territoriale Veränderung auch auf Provinzebene – etwa eine Überweisung von Randbereichen der Belgica an die Germania inferior – wäre in diesem Zusammenhang zwar denkbar, dann aber aus rein praktischen Überlegungen.k4
c) Ausblick: Stadtbild im Wandel
Durch das Bild des römischen Aachen, das sich dank den jüngsten Ergebnissen und Neubewertungen der Archäologie abzeichnet – das Bild einer veritablen Kleinstadt auf einem schon in augusteischer Zeit geplantem Raster, eventuell mit Merkmalen und Gebäu-den einer urbanen Infrastruktur – würde die Aachener Region zum ersten Mal als kleinste sinnvolle Einheit einer Verwaltungsgliederung glaubhat. Wenn dieser Schritt überhaupt je getan wurde, dann anscheinend erst spät. Jedenfalls wurden im Aachen des ausgehen-den 2. oder frühen 3. Jhs. ganz beachtliche Mittel verbaut – die in dieser Form einmalige porticus, eventuell Teil einer Forumsanlage, ist durchaus erklärungsbedürtig.k5
Eingrife der severischen Dynastie sind als Erklärung dieser Vorgänge nicht aus-zuschließen; wenn sie mit einer administrativen Veränderung Hand in Hand gingen, wären sie um einiges erklärlicher. Insbesondere für die afrikanischen Provinzen sind Aufwertungen zahlreicher Orte, meist zum munizipalen Status, gut bezeugt; im gal-lisch-germanischen Raum war die Hochzeit solcher Statusgewinne schon vorbei, aber
Grenzland – aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen · 341
kk Severische Rechtsverleihungen in Nordafrika: Sherwin-White, he Roman Citizenship (wie Anm. 20), S. 254; 2l5f. Cass. Dio ll (l8),15,k spricht von Gebeten Caracallas zu Apollo-Grannus, Asklepios und Sarapis sowie „persön-licher Anwesenheit“ (παρουσία) des Kaisers in deren Heiligtümern. In einem Vortrag von Emil Krüger (referiert in: Heinrich Savelsberg, Be-richt über die Hauptversammlung, in: ZAGV 51 [1929], S. 42k–4kk; dort S. 4k2f.), wurde daraus sehr bestimmt gefolgert: „Das kann nur heißen, daß er in Aachen selbst gewesen ist und dort die Heilquellen benutzt hat.“ Die hese, Caracalla habe „den Gott hier in Aachen(-Burtscheid?) aufgesucht“, bezeichnete noch Kaemmerer, Aa-chener Quellentexte (wie Anm. 34), S. 13 vor-sichtig als „nicht abwegig“, räumte allerdings die Vielzahl bekannter Kultorte in Germanien und im Donauraum ein. Ein guter Kandidat wäre z. B. das raetische Faimingen (Phoebiana) mit seinem monumentalen Grannus-Tempel
(Johannes Eingartner/Pia Eschbaumer/Gerhard Weber, Der römische Tempelbezirk in Faimin-gen-Phoebiana. Faimingen-Phoebiana 1 [Li-mesforschungen 24], Mainz 1993; vgl. Gerhard Weber, Von Holz zu Stein. Zum Bauwesen in den Nordwestprovinzen, in: Ludwig Wamser [Hrsg.], Die Römer zwischen Alpen und Nord-meer. Zivilisatorisches Erbe einer europäischen Militärmacht, Mainz 2000, S. 81–8l; dort S. 8kf. mit Abb. kk). Auch das seit 2003 ergrabene große Heiligtum im Kochertal hatte zweifellos überregionale Bedeutung (Klaus Kortüm, Der Apollo-Grannus-Tempel bei Neuenstadt a.K., in: Landesamt für Denkmalp ege Stuttgart [Hrsg.] Archäologische Ausgrabungen in Ba-den-Württemberg 2009, Stuttgart 2010, S. 1k9–1l4). Porphyr: Zu einer spätantiken Einordnung tendiert Schaub 2011c, S. 40l mit Abb. 83 – möglich wäre natürlich auch, dass das Frag-ment zur karolingischen Bauausstattung ge-hörte.
Nachzügler in die Funktion eines Hauptortes oder in die Reihen der Municipien sind nicht ausgeschlossen. Vor Zeiten war es unter Heimatkundlern eine Selbstverständlich-keit, das Interesse Caracallas für Apollo-Grannus, das Cassius Dio überliefert, auf den Aachener Quellbezirk zu beziehen; solche Gedanken scheinen nun von unerwarteter Seite neue Nahrung erhalten haben. Von einem Kaiserbesuch kann nach wie vor nicht die Rede sein, doch sollte der Porphyrrest im Bereich der ‚Münstertherme‘ tatsächlich ohne spätere Verlagerung in situ erhalten sein, muss er sich auf jeden Fall einer kaiser-lichen Spende – etwa Caracallas oder auch seines Vaters – verdanken. Sie mit einer Auf-wertung des Rechtsstatus zu verbinden wäre eine elegante Lösung; auch große Förderer der Legionen wie die Severer hätten ein ordinäres „Militärbad“ wohl nicht so ganz bei-läuig mit Porphyrinkrustationen ausgestattet – ein repräsentativerer Kontext innerhalb der Anlage, etwa das Dekor eines Kultortes, wirkt wahrscheinlicher.kk
Das Zeitfenster für eine nachhaltig erfolgreiche Urbanisierung ist allerdings eng. Sollte die hier vorgeschlagene Spekulation zutrefen, war Aachen, ohne es zu wissen, eigentlich schon zu spät dran. Die Severerdynastie selbst sorgte dafür. Durch die egali-sierende Wirkung der constitutio Antoniniana von 212 – so gut wie alle freien Reichs-bewohner waren fortan römische Vollbürger – verlor der Status als municipium oder colonia schlagartig seine Bedeutung als Tor zum Bürgerrecht; diese Nivellierung führte zur Renaissance des vorher geringer geschätzten civitas-Titels, der im gallisch-germa-nischen Reichsgebiet durch die Stadtprivilegierungen nie völlig zurückgedrängt wor-den war. Ein Aachener municipium in letzter Stunde wäre also um den erwarteten Aufschwung zum Teil geprellt worden. Generelle Dezentralisierung ist ein anderes Charakteristikum, das wir zumindest in Zentralgallien in Gestalt der politischen
342 · Jörg Fündling
kl Ereignisse seit Diocletian: Raban von Haehling, Aachen von der spätrömischen bis in die früh-mittelalterliche Zeit (4.–8. Jahrhundert). Histo-rische Voraussetzungen und Hintergründe, in: Kraus (Hrsg.), Aachen I (wie Anm. 1), S. 388–404. Übersicht zur Frage der Zerteilung von ci-vitates: Brigitte Galsterer/Hartmut Galsterer, Romanisation und einheimische Traditionen, in: Hans-Joachim Schalles/Henner von Hes-berg/Paul Zanker (Hrsg.), Die römische Stadt im 2. Jahrhundert n. Chr. Der Funktionswandel des öfentlichen Raumes. Kolloquium in Xan-ten vom 2. bis 4. Mai 1990, Köln/ Bonn 1992, S. 3ll–389; dort S. 384–38k. Constitutio An-toniniana: Sherwin-White, he Roman Citizen-ship (wie Anm. 20), S. 280–28l. Unruhen im Sunucergebiet: fassbar z. B. in der von Hein-richs, vicus (wie Anm. 15), S. 2kf. erschlossenen und plausibel mit dem Beginn der fränkischen Überfälle verbundenen Zerstörung des vicus bei Alsdorf-Mariaweiler (datiert „258 oder we-nig später“), die diesmal endgültig war. Aachen, wo die Siedlungskontinuität erwiesen ist, proi-tierte anscheinend von seiner deutlich weniger
exponierten Lage, vielleicht sogar noch beim großen Frankeneinfall von 2l5; eine Zerstö-rungsspur vermutete Andreas Schaub in der Aufgabe des 2011 angeschnittenen hypokaus-tierten (Bade-?) Raums am Markt (Pressebe-richte: Robert Esser, Archäologen entdecken beheizten Pool unterm Markt, in: Aachener Zeitung 2k.8.2011; aro. [Andreas Rossmann], Älter als Köln?, in: Frankfurter Allgemeine Zei-tung Nr. 114 [1k.5.2012], S. 31; vgl. Schaub 2011b, S. 341f.) . Die Notitia Galliarum kennt Ende des 4. Jhs. nur noch die civitates der Tungri und der Agrippinenses (Not. Gall. 8 = Notitia dignita-tum p. 2kl Seeck); man müsste also das Einge-hen des hypothetischen municipium durch Be-völkerungsschwund oder ähnliches annehmen, da ein permanenter Gebietsverlust (wie im Fall Xantens) mitten auf der vitalen Straßenverbin-dung zwischen den beiden noch bestehenden Verwaltungszentren kaum vorstellbar ist. Spä-tantiker Siedlungsrückgang ist bisher nur in Gestalt einer möglichen Au assung Burtscheids zu beobachten: Schaub 2011c, S. 405, S. 409.
Zersplitterung von civitates fassen können – hier allerdings insbesondere in der Spä-tantike; ein civitas-Hauptort Aachen als Spaltprodukt einer größeren Einheit wäre dem Zug der Zeit um einiges voraus und müsste obendrein vor dem späten 4. Jh. bereits wieder seinen Status verloren haben, als für die Germania Secunda überhaupt nur noch Tongeren und Köln als civitates genannt werden und der Norden der Provinz bereits verloren war. Auch die Phase relativer Ruhe für die linksrheinischen Gebiete näherte sich im frühen 3. Jh. ihrem Ende.kl
Ob wirklich in einem Statuswechsel der Grund für die Ausschmückung des öfent-lichen Raumes in Aachen zu suchen ist, bleibt damit einstweilen ofen. Dasselbe gilt – wir mögen es bedauern oder die Chance zur weiteren Diskussion ergreifen – für die übrigen Fragen, unter welchen Rahmenbedingungen das Leben in der Stadt verlief. Was das kaiserzeitliche Aachen politisch-administrativ darstellte, ist bis auf Weiteres nicht in Stein gemeißelt.
Farbabbildungen · 439
Farbabb. 29: Vorgeschlagene Provinzgrenzen der Germania inferior im Überblick
Colonia Ulpia Noviomagus
(Nijmegen)
Colonia Agrippinensis (Köln)
Bonna (Bonn)
Mogontiacum
(Mainz)
Bagacum (Bavay)
Augusta Treverorum
(Trier)
Divodurum
(Metz)
Argentorate
(Straßburg)
Andematunum
(Langres)
Colonia Augusta
Raurica (Augst)Vesontio
(Besancon)
Avaricum
(Bourge)
Agedincum
(Sens)
Lutetia
(Paris)
Durocortorum
(Reims)
Samarobriva
(Amiens)
Nemetacum
(Arras)
(Cassel)
Gesoriacum
(Boulogne)
Autricum
(Chartres)
Traiectum
(Maastricht)Atuatuca
Tungrorum
(Tongeren)
Aquae
Granni
(Aachen)
Colonia Ulpia Traiana
(Xanten)
Cenabum
(Orléans)
Germanien
Niedergermanien
Ob
ergerm
anien