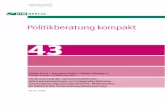Gelehrte Räte im Dienst des Markgrafen und Kurfürsten Albrecht. Qualifikation und Tätigkeiten in...
-
Upload
tu-darmstadt -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Gelehrte Räte im Dienst des Markgrafen und Kurfürsten Albrecht. Qualifikation und Tätigkeiten in...
JAHRBUCH
DES HISTORISCHEN VEREINS FÜR MITTELFRANKEN
Hundertzweiter Band
Ansbach 2014
SELBSTVERLAG DES HISTORISCHEN VEREINS
FÜR MITTELFRANKEN
KURFÜRST ALBRECHT ACHILLES
(1414-1486)
KURFÜRST VON BRANDENBURG BURGGRAF VON NÜRNBERG
herausgegeben von
Mario Müller
Ansbach 2014
SELBSTVERLAG DES HISTORISCHEN VEREINS
FÜR MITTELFRANKEN
SusE ANDRESEN
GELEHRTE RÄTE IM DIENST
DES MARKGRAFEN UND KURFÜRSTEN ALBRECHT
Qualifikation und Tätigkeiten in fürstlichem Auftrag
. Abstract
Die mindestens 64 universitätsgebildeten Berater Albrechts von Brandenburg wurden überwiegend mit auswärtigen Angelegenheiten betraut, bei denen Verhandlungen zur Lösung von Konflikten jeder Art sowie die Ehen seiner Kinder im Vordergrund standen. Im Innern nahmen sie Einfluss auf Rechtsprechung und Verwaltung. Zwei Drittel von ihnen waren promovierte Juristen.
1. Qualifikation der universitätsgebildeten Berater, S. 153.-2. Universitätsgebildete Berater in Albrechts Diensten, S. 158.- 3. Kanzler, S. 161.- 4. Gesandte, S. 163.- 5. Statthalter, S. 165.-6. Rechtsprechung, S. 166.
In nicht dagewesenem Umfang ist im vorliegenden Band über den Politiker, Landesherrn, Dynasten und Familienvater Markgraf und Kurfürst Albrecht von Brandenburg und seine Stellung im Gefüge des spätmittelalterlichen Reiches zu erfahren. Der folgende Beitrag beleuchtet diese Felder aus der Perspektive der von Albrecht bestellten Räte und Getreuen, der Berater, Gesandten und Unterhändler und greift die Frage auf, in wie weit das Agieren des Fürsten eigentlich das Handeln seiner Räte war.t Im Mittelpunkt stehen diejenigen Räte, die eine Universität besucht haben und in den septem Artes liberales oder auch im Gebiet der Jurisprudenz, der Medizin oder der Theologie Fachwissen erworben haben. Wie lange sie nachweisbar dort studierten und ob sie diese Zeit mit oder ohne eine Promotion beendeten, ist dabei nicht erheblich. Die Räte sind im Wortsinn universitätsgebildet, was mit der im Titel gewählten Bezeichnung »gelehrt« synonym verwendet wird. 2 Diese Perspektive erlaubt zugleich Einblicke in die Wege, auf denen das an den Universitäten erworbene Wissen- vor allem das juristische- in
1 Schubert: Zusammenfassung (1999), S. 243. 2 Mit der Konzentration auf die Universitäten als Ausbildungsstätten sind die als Notare
Tätigen, sofern sich deren Ausbildung auf die Kanzleien beschränkte, nicht mit eingeschlossen.
151
den Regierungs- und Verwaltungsangelegenheiten eines weltlichen lli.irstcnhofes des 15. Jahrhunderts Eingang fand. 3
Der erste Abschnitt dieses Beitrages ist der Qualifikation gewidmet, welche die Berater bei der Indienstnahme in der Regel bereits mitbrachten. Der zweite Abschnitt wendet sich den Aufgaben und Einsatzorten im Auftrag Albrechts zu, sowohl in inneren wie auch in äußeren Angelegenheiten.
Während Albrechts langer Herrschaft von 1440 bis 1486, bis 1470 zunächst als Markgraf des Ansbacher Unterlandes und danach auch als Kurfürst der Mark Brandenburg, lassen sich rund 390 Berater feststellen.4 Von diesen haben 64 nachweislich eine Universität besucht, was einem Anteil von gut 16 % entspricht. 5 Unter den zollerischen Fürsten des 15. Jahrhunderts liegt Albrecht damit an der Spitze. Die Zahl der Berater seines Vaters, Kurfürst Friedrichs I., umfasst mindestens 112 Berater, gelehrt waren unter diesen wohl nur 17 (11 %). Sein Bruder Kurfürst Friedrich II. dürfte knapp 200 Berater gehabt haben, von denen 26 eine Universität besucht hatten (14 %).
Die Kenntnis der Lebenswege dieser 64 universitätsgebildeten Berater ist sehr unterschiedlich. Während Personen wie Peter Knorr oder Hertnidt vom Stein weithin bekannt sind, 6 begegnen von einigen anderen lediglich ihre Namen in einem einzigen Zusammenhang, ohne dass nähere Informationen über Inhalt oder Dauer der Tätigkeit zu eruieren waren. So ist von dem Doktor des kanonischen Rechts und im Bistum Bamberg mehrfach bepfründeten Priester Otto von Lichtenfels bisher nur bekannt, dass Albrecht ihn 1442 zum Rat und Diener bestellte, ohne das sich Hinweise auf seine Tätigkeiten fanden. 7 Der Anwalt Heinrich Schockler erhielt 1478 von Albrecht ein
3 Der vorliegende Beitrag ist ein Ausschnitt aus der an der Universität Bern abgeschlossenen Dissertation zu den gelehrten Räten des Markgrafen und Kurfürsten Albrecht von Brandenburg und seiner direkten Verwandten während des 15. Jahrhunderts. Sie entstand im Rahmen des internationalen Forschungsprojektes Repertorium Academicum Germanicum (RAG), in dem der Transfer des an der Universität vermittelten Wissens in der spätmittelalterlichen Gesellschaft im Mittelpunkt steht. Für ergänzende Informationen zu den gelehrten Räten im Nachgang zur Tagung zu Albrecht in Ansbach im September 2011 von verschiedener Seite danke ich herzlich.
4 Spangenberg: Hof- und Zentralverwaltung der Mark Brandenburg (1908), S. 85ff. 5 Die nicht belegten Zahlenangaben können meiner Dissertation >>Strategen am Hof.
Gelehrte Räte im Einsatz für den Kurfürsten Albrecht von Brandenburg« (Bern 2009) entnommen werden. Die überarbeitete Fassung wird voraussichtlich 2015 im Druck erscheinen.
6 Vgl. die Arbeiten von Kist: Peter Knorr (1953), S. 350-364. - Ders.: Peter Knorr (1968), S. 159-176.- Sottili: Peter Knorr (1979), S. 55-62.- Thumser: Hertnidt vom Stein (1989).Ders.: Hertnidt vom Stein (1993), S. 1-16. - Seyboth: Die Markgraftümer Ansbach und Kulmbach (1985) und andere mehr.
7 Kist: Die Matrikel der Geistlichkeit des Bistums Bamberg (1965), Nr. 3935. -Wendehorst: Das Stift Neumünster in Würzburg (1989), S. 523, 694f. - Staatsarchiv Ni.irnberg,
152
Empfehlungsschreiben für den Kaiser, aus dem zu erfahren ist, dass Schockler an unserm hove dienstlich und im vast geheim und aneme gewesen ist. Nur vermuten lässt sich, dass es sich um den 1470 in WienJura studierenden dominus Henricus SchockZer de Nouocivitate handelt8 und wiederum bleibt unklar, mit welchen Angelegenheiten Albrecht ihn betraute. So gering die Informationen zu den einzelnen Beratern auch sind, sie geben dennoch zumindest Auskunft über die fachliche Qualifikation der von Albrecht beauftragten Berater und gelegentlich auch über den Zeitraum der Indienstnahme.
1. Qualifikation der universitätsgebildeten Berater
Der erste Abschnitt zur Qualifikation der gelehrten Berater ist drei Faktoren gewidmet, welche für die Auswahl als Berater am Fürstenhof- nicht nur am zollerischen- bestimmend waren. Neben der universitären Ausbildung spielte sowohl die geographische als auch die soziale Herkunft eine Rolle. Hinsichtlich der geographischen Herkunft ist eine deutliche Konzentration auf die zollerischen Herrschaftsgebiete zu erkennen. Die Region Franken und die Mark Brandenburg bilden die zwei Schwerpunkte. Das ist auch nicht anders zu erwarten, da fürstliche Berater traditionell aus der Landschaft rekrutiert wurden. Vom dem Maß, in dem die eingesessenen Führungsschichten beim Landesherrn Gehör fanden, hing die Anerkennung seiner Herrschaft wesentlich ab.
Der größere Teil der 64 gelehrten Berater Albrechts stammte aus den südlichen Gebieten. In Franken und seiner weiteren Umgebung waren mindestens 42 oder 80 % beheimatet, während nur sieben bei den Immatrikulationen an den Universitäten Heimatorte im Norden angaben. Unter den übrigen 15 aus verschiedenen Regionen des Reiches stehen mit sechs Beratern die Regionen von Thüringen und Sachsen an erster Stelle. Sie befinden sich zwischen Franken und der Mark. In diese Landschaften hinein wurden Beziehungen sowohl von Norden als auch von Süden gepflegt, welche die Reisen von Angehörigen der zollerischen Höfe zwischen den Territorien erleichtert haben dürften.
Bei näherer Betrachtung fällt die Zugehörigkeit der Mehrzahl der Herkunftsorte im Norden zum märkischen Territorium auf, während viele der Heimatorte im Süden nicht zu den zollerischen Landen gehörten, sondern außerhalb lagen. Die Gelehrten aus den fränkisch-zollerischen Städten
Repertorium 134 II, fol. 113v, 117 I, fol. 6.- Repertorium Germanicum, Bd. 5 (2004), Nr. 3623,7449.
8 Priebatsch: Politische Correspondenz, Bd. 3 (1898), S. 434. - Universitätsarchiv Wien, Matricula Facultatis Juristarum Studii Wiennensis, J2, 1442-1557, fol. 21v.
153
allein deckten den fürstlichen Bedarf nicht; die geographische Beschränktheit der burggräflichen Herrschaft machte die Gewinnung von Gefolgschaft aus benachbarten Territorien notwendig. Dies zeigt sich nicht nur anhand der Herkunft der gelehrten Räte, sondern findet eine Parallele in der Gründung des fränkischen Zweiges des Schwanenritterordens, in den der Adel der gesamten Region eingebunden werden sollte.9 In der Zugehörigkeit der Herkunftsorte der gelehrten Berater kommt ein struktureller Unterschied beider Regionen zum Ausdruck; die Landesherrschaft in der Mark Brandenburg war im mittleren 15. Jahrhundert bereits in einem Maß geschlossen, welches in dieser Form von keinem der miteinander konkurrierenden fränkischen Landesherren dieser Zeit erreicht wurde.
Wie die geographische, so hatte auch die soziale Herkunft einen Einfluss auf die Auswahl der gelehrten Räte. Mit einem Anteil von gut zwei Dritteln bürgerlicher und nur knapp einem Drittel adliger gelehrter Berater lag Albrecht unter den Kurfürsten aus der eigenen Familie im Mittelfeld, wie die Daten der folgenden Tabelle zeigen. Ob der Anteil von 69 % bürgerlichen Räten einem überdurchschnittlichen Wert entspricht, muss vorerst offen bleiben, da nicht von allen Beratern die soziale Herkunft bestimmt werden konnte.
Kurfürsten von Anzahl Bürgerliche
Brandenburg gelehrter Räte Adlige
Friedrich I. 17 4 (24 %) 11 (65 %)
Friedrich II. 26 9 (35 %) 17 (65 %)
Albrecht 64 20 (31 %) 44 (69 %)
Johann 29 13 (45 %) 15 (52%)
Tabelle: soziale Herkunft der gelehrten Berater der Kurfürsten der Mark Brandenburg
Die Anteile im Einzelnen hingen sicherlich von den Präferenzen der Landesherren ab, aber nicht ausschließlich. Sie sind auch Ausdruck der Akzeptanz der universitären Ausbildung innerhalb einer Großlandschaft. Zwischen Franken und der Mark finden sich signifikante Unterschiede,10 die von folgenden Zahlen bestätigt werden. Unter den Beratern Albrechts aus der Mark Brandenburg, Sachsens und Schlesiens lag der Anteil der adligen mit mindestens vier von sieben höher als unter denen aus Franken mit acht von 42.
9 Kruse/ Paravicini/ Ranft: Ritterorden und Adelsgesellschaften (1991), S. 325. 10 Moraw: Über Entwicklungsunterschiede und Entwicklungsausgleich (1987), S. 583-
622; der gleiche Beitrag in: Über König und Reich (1995), S. 293-320, im Besonderen zu den Universitäten S. 604-608.
154
I! ll i I t l:
Während sich die Zahlen der adligen und bürgerlichen gelehrten Räte Kurfürst Friedrichs II. noch die Waage hielten, zeigen die entsprechenden Zahlen von Kurfürst Johann einen starken Trend hin zu mehr adligen universitätsgebildeten Beratern. Von seinen 19 Räten aus den besagten nördlichen Gebieten standen 13 adligen nur sechs bürgerliche gegenüber.
Der Anteil der Adligen unter den Räten Albrechts lässt sich zu denen anderer Landesfürsten des mittleren 15. Jahrhunderts unter Fokussierung auf die markgräflichen Juristen in Relation setzen. Unter den 36 Rechtsgelehrten Albrechts befanden sich 22 (61 %) bürgerlicher und mindestens 13 (36 %) adliger Herkunft. Damit war der Anteil der Adligen deutlich höher als der anderer Landesherren, bei den württernbergischen Grafen ließ sich zwischen 1450 und 1482 ein Viertel nachweisen, bei den Landgrafen von Hessen zwischen 1420 und 1500 waren es 28 %.11 Im Herzogturn Bayern sind zwischen 1380 und 1520 dagegen nur 13 adlige Rechtsgelehrte nachweisbar, was einem Anteil von 11 % entsprichtP Auch wenn der Adel in den einzelnen Territorien des Reiches erhebliche Unterschiede aufwies, zeigen diese Zahlen doch eine Tendenz an: Relativ zur Gesamtzahl der juristischen Berater standen in markgräflichen Diensten die meisten von adligem Stand.
Umfang und Inhalt der universitären Ausbildung wirkten in einem für das 15. Jahrhundert typischen Maß als dritter Faktor auf die Auswahl der Berater. Die universitäre Ausbildung begann die Mehrzahl der Berater nachweislich mit dem Studium der Artes. Die Dauer der Studien insgesamt fiel sehr unterschiedlich aus. Der kleinere Teil von nur elf Räten beschränkte sich wahrscheinlich auf die erste Ausbildungsstufe. Von fünf fanden sich Immatrikulationen an einer oder mehreren Universitäten des Reiches, aber keine Promotionen. Von zwei weiteren ist nur die erste Graduierung, die zum Bakkalar der Artes überliefert, drei weitere erwarben auch die zweite, den Magister der Artes liberales. Der weitaus größte Teil von 53 Beratern aber setzte das Studium an einer der drei höheren Fakultäten fort. Von diesen wählte mit 36 wiederum die Mehrzahl (67 % aller gelehrten Berater) die juristische Richtung, während zehn sich für Medizin entschieden und sieben für Theologie.
Für einen Landesherrn des 15. Jahrhunderts ist diese Verteilung und besonders der große Anteil der Juristen typisch, nicht nur im diachronen Vergleich mit den anderen zollerischen Kurfürsten der Mark Brandenburg,
11 Diese Zahlen wurden ermittelt auf der Basis von Kothe: Der fürstliche Rat in Württemberg (1938).- Lange-Kothe: Zur Sozialgeschichte des fürstlichen Rates in Württemberg (1941), S. 237-267.- Stievermann: Die gelehrten Juristen der Herrschaft Württemberg (1986), S. 229-271, besonders S. 255.- Für Hessen nach Hesse: Amtsträger der Fürsten im spätmittelalterlichen Reich (2005) und Demandt: Der Personenstaat der Landgrafschaft Hessen (1981).
12 Lieberich: Die gelehrten Räte (1964), S. 136 Anm. 62 und S. 149, Anm. 96.
155
sondern auch im synchronen Vergleich zu anderen Territorialherren des Reiches. Kurfürst Friedrich I. hatte 76 %, Friedrich II. 56 % und Johann 52 % Juristen, während etwa die sächsischen Herzöge mindestens 54 % verpflichteten, Herzog Ludwig der Reiche von Bayern-Landshut 62 % und Herzog Albrecht IV. von Bayern-München 69 % Y Betrachtet man allerdings die Menge der Universitätsbesucher des 15. Jahrhunderts, so wird deutlich, dass zum einen die geringe Zahl der Berater ganz ohne Promotionen und zum anderen der Anteil der Fachrichtungen durch eine ganz gezielte Auswahl der Berater zustande kommt. Von den ca. 200.000 Universitätsbesuchern absolvierten nur 15 bis 20 % zum Abschluss eine Promotion, für etwa 80 % blieb ein mehr oder weniger intensives Artes-Studium ohne formale Prüfung das einzige überhaupt.14
Die Ausbildung der größten Gruppe der Berater Albrechts, der Juristen, umfasste sowohl das kanonische als auch das kaiserliche Recht. Allerdings konnte man den Schwerpunkt auf eine Richtung legen und entsprechend promoviert werden, wobei die doppelte Promotion mit größerem Renommee, aber zugleich auch mit größerem Aufwand verbunden war, sowohl finanziell als auch zeitlich. Musste oder wollte man sich auf eine Richtung beschränken, so wurde das Kirchenrecht lange Zeit bevorzugt, bedingt durch den Hauptarbeitsbereich der Juristen im Reich, die kirchlichen Angelegenheiten.15 Erst im Verlauf des 15. Jahrhunderts ist eine allmählich steigende Tendenz zu beobachten, »nur« im kaiserlichen Recht abzuschließen und damit verbunden auch nicht mehr eine Laufbahn oder Versorgung innerhalb der Kirche anzustreben, sondern durch die juristische Tätigkeit selbst ein Auskommen zu finden.
Von den 36 juristisch geschulten Beratern Albrechts wurde die Hälfte in beiden Richtungen promoviert, zehn beschränkten sich auf die Promotion im kanonischen und fünf im kaiserlichen Recht, von zweien ist die Richtung nicht bekannt. Mit der gegenüber denen des kaiserlichen Rechts doppelten Zahl von Promovierten des Kirchenrechts bestätigt die Gruppe der zollerischen Berater die lang anhaltende Bedeutung der Kanonistik, was weiter durch den Umstand unterstützt wird, dass drei der fünf Legisten erst nach der Jahrhundertmitte mit dem Studium begannen.16
13 Zu den wettinischen Herzögen siehe Streich: Zwischen Reiseherrschaft und Residenzbildung (1989), S. 591.- Zu Ludwig dem Reichen von Bayern-Landshut siehe Lieberich: Die gelehrten Räte (1964), S. 127ff.- Zu Albrecht IV. von Bayern-München siehe ebd. die biographische Übersicht ab S. 153.
14 Schwinges: Artisten und Philosophen (1999), S. 2. 15 Moraw: Gelehrte Juristen im Dienst der deutschen Könige (1986), S. 144. 16 Hertnidt vom Stein 1441, Hermann Reinsperger 1445, Anselm von Eyb 1458, Johann
Pfotel1460 und Antonius Grünwald 1473.
156
Die große Zahl der Doktoren beider Rechte unter den Beratern Albrechts ist in der Tendenz auffällig, denn sie wird nur von dem etwas später, von 1467 bis 1508 regierenden bayerischen Herzog Albrecht IV. mit 48 % annähernd erreicht,17 viele andere hatten deutlich weniger als die Hälfte an in beiden Rechten promovierten Juristen.18 Albrechts Bevorzugung solcher Doktoren könnte mit dem Prestige der doppelten Promotion zusammenhängen, welches von den Beratern auch auf den Auftraggeber zurück wirkte.
Als Studienorte boten sich im Laufe des 15. Jahrhunderts die nach und nach zahlreicher werdenden Universitäten des Reiches anP Dennoch waren die schon früh, nämlich 1409 und 1392 gegründeten hohen Schulen von Leipzig und Erfurt die von Albrechts Beratern am häufigsten besuchten. An dritter Stelle steht, gemessen an den Besucherzahlen, bereits die italienische Universität Padua, gefolgt von Wien, Bologna, Rostock, Pavia, Heidelberg, Ingolstadt, Siena und Prag. Jeweils nur einzelne Besuche ließen sich in Freiburg, Würzburg, Köln und Greifswald sowie in Perugia und Ferrara beziehungsweise in Paris nachweisen.
Auf diese Rangfolge hatten mehrere Faktoren Einfluss. Zunächst besuchten die Berater Albrechts-wie die Gelehrten des Reiches im 15. Jahrhundert allgemein - für das Artes-Studium ganz überwiegend eine hohe Schule in der näheren oder weiteren Umgebung der Heimat, zu der die Familien mehr oder weniger direkt Beziehungen unterhielten, an denen vielleicht sogar ältere Verwandte schon studiert hatten. Aber nicht nur die geographische Lage, sondern auch die Studienkosten beeinflussten die Nachfrage, gerade in Leipzig waren die Aufwendungen geringer als an anderen Orten. Auch die jeweilige soziale Position der Universitätsbesucher hatte Einfluss, Erfurt etwa wurde von zahlreichen Adligen aufgesucht.20 Wenig begünstigt durch die geographische Lage in Bezug auf Franken war Rostock. Die dortige Universität wurde nur von märkischen Räten besucht und die Orte Köln, Freiburg oder Greifswald waren durch ihre randliehe Lage wenig nachgefragt. Der Lehrbetrieb an der Universität Würzburg dagegen war nur von kurzer
17 Die Zahlen sind aus der Zusammenstellung von Lieberich: Die gelehrten Räte (1964), ab S. 153 abgeleitet. Die Qualifikationen im Einzelnen hat Ettelt-Schönewald: Kanzlei, Rat und Regierung Herzog Ludwigs des Reichen von Bayern-Landshut (1996) zusammengestellt.
18 Die wettinischen Herzöge hatten gut 40 % in beiden Rechten promovierte Juristen, was aus den Angaben von Streich: Zwischen Reiseherrschaft und Residenzbildung (1989) und Hesse: Amtsträger der Fürsten im spätmittelalterlichen Reich (2005) zu ermitteln ist. Zwischen 1450 und 1482 hatten die württembergischen Grafen 30 % doppelt promovierte Juristen, dies ergibt sich aus den Zahlen bei Kothe: Der fürstliche Rat in Württemberg (1938) und Lieberich: Die gelehrten Räte (1964).
19 Verger: Grundlagen (1993), S. 65-68. 20 Schwinges: Erfurts Universitätsbesucher im 15. Jahrhundert (1995), S. 209.
157
Dauer und Prag hatten die Magister aus dem Reich mit dem Erstarken der hussitischen Bewegung mehr und mehr den Rücken gekehrt. 21
Wie das artistische Studium absolvierten viele Gelehrte aus dem Reich auch das der Theologie an den hohen Schulen im Reich, so auch die im Dienst von Albrecht nachweisbaren Theologen. Anders verhielten sich die angehenden Juristen und Mediziner. Um die aktuellen Fragen und Kommentare zur Rechtsprechung und zur Heilkunde möglichst authentisch kennen zu lernen, war der Weg über die Alpen der aussichtsreichste. An den oberitalienischen Universitäten erwarb man nicht nur das wesentliche Rüstzeug, man knüpfte auch Kontakte zu späteren Weggefährten und Kontrahenten. Unter den von Albrecht zu Rate gezogenen Fachgelehrten begaben sich von den 36 Juristen mindestens 30 und von den zehn Medizinern mindestens vier an eine oder mehrere Universitäten südlich der Alpen. Besonders die Vertreter dieser beiden Fachrichtungen tragen zu den hohen Besuchszahlen von Padua (15 Besucher), Bologna (zehn) und Pavia (neun) bei.
2. Universitätsgebildete Berater in Albrechts Diensten
Wie gezeigt, war die Anzahl von 64 universitätsgebildeten Beratern während des 15. Jahrhunderts absolut gesehen hoch. Gemessen an den 46 Regierungsjahren Albrechts von 1440 bis 1486 relativiert sie sich allerdings. Die Jahre des ersten Auftretens der Räte im Dienst Albrechts zeigen eine Verteilung über das ganze 15. Jahrhundert hinweg. 22 Sie traten nach und nach in den fürstlichen Dienst. Während Johann Lochner sen. den Markgrafen bereits 1435 auf seiner Jerusalempilgerfahrt begleitete,23 finden sich unter den ersten Räten 1441 Peter Knorr sowie 1442 Otto von Lichtenfels, Berthold Sliner, Johannes Kautsch und Heinrich Übelein und im Jahr darauf Johannes von Eyb. 24 Die drei letztgenannten standen bereits in Diensten von Albrechts Vater Kurfürst Friedrich I., Sliner wohl in denen Markgraf
21 Wegele: Geschichte der Universität Wirzburg (1882), S. 19 und Moraw: Prag. Die älteste Universität in Mitteleuropa (1999); der gleiche Beitrag auch bei Moraw: Gesammelte Beiträge zur deutschen und europäischen Universitätsgeschichte (2008), S. 96f.
22 Zum ersten Auftreten der gelehrten Berater siehe die Tabelle am Ende. 23 Röhricht: Deutsche Pilgerreisen nach dem heiligen Lande (1967), S. 109. 24 Zu Peter Knorr und Otto von Lichtenfels siehe Staatsarchiv Nürnberg, Repertorium
134 II, fol. 113ff. -Zu Johannes Kautschund Heinrich Übelein siehe Kremer: Die Auseinandersetzungen um das Herzogtum Bayern-Ingoistadt (2000), S. 70.- Zu Bertbold Sliner siehe Keil: Bertold Slyner (1995), S. 6.- Zu Johannes von Eyb siehe Krcmer: Die Auseinandersetzungen um das Herzogtum Bayern-Ingoistadt (2000), S. 294.
158
Johanns. 25 Albrecht übernahm bei seinem Herrschaftsantritt 1440 nicht nur Räte vom Vater, sondern auch 1470 mit der Kurfürstenwürde eine Reihe auch gelehrter Räte des Bruders, Friedrichs II. Zu ihnen gehörten neben den Bischöfen der märkischen Diözesen etwa auch Nickel Pfuhl oder Sigmund von Rothenburg. 26 Auf diese Weise trug nicht nur die lange Regierungszeit, sondern auch die Konzentration der vom Vater ursprünglich auf vier Brüder verteilten Herrschaft in Albrechts Hand ab 1470 zur großen Zahl universitätsgebildeter Räte bei. Dennoch lassen sich nicht pro Jahr proportional viele in seinen Diensten nachweisen, bedingt zum einen durch die allgemein große Nachfrage nach gelehrten Räten und zum anderen durch die tendenziell steigende Praxis der Berater, sich nur eine begrenzte Zeit einem Dienstherrn zu verpflichten und diesen auch zu wechseln. Auch die Albrecht eng verbundenen langjährigen Berater Peter Knorr, Hertnidt vom Stein oder Georg von Absberg wechselten zwischenzeitlich zu anderen Dienstherren. Peter Knorr ist zum Beispiel im Jahr 1448 als Rat der Herzöge Heinrich von Bayern-Landshut und Wilhelms III. von Sachsen nachweisbar. Hertnidt vom Stein war ebenfalls unter anderem Rat Wilhelms III. von Sachsen, während Georg von Absberg 1471 württembergischer Landhofmeister wurde und erst 1486 nach Ansbach in die Dienste Markgraf Friedrichs des Älteren und Sigmunds zurückkehrteY Diese Wechsel dürften neben dem Ableben der Räte der wichtigste Grund für die regelmäßig auftretenden neuen Berater se1n.
Albrecht erteilte den gelehrten Räten die Aufträge nicht kontinuierlich, sondern konzentrierte sie in bestimmten Jahren. Nach den genannten Ratsnachweisen zu Beginn seiner Herrschaft findet sich zwischen 1452 und 1464 jedes Jahr mindestens ein neuer Gelehrter. Eine zweite Häufung ist ab 1470 zu beobachten und eine dritte ab 1478. Diese Konzentrationen lassen sich zu einem guten Teil mit den politischen Ambitionen Albrechts erklären, in die auch die Eheschließungen der Kinder integriert wurden. In den späten fünfzigerJahrenbegann der Konflikt um die Zuständigkeit des Kaiserlichen
25 Jobannes Kautsch als Beisitzer 1437, siehe Altmann: Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1896), Nr. 11909.- Heinrich Übelein als Kurienprokurator 1422, siehe Wendehorst: Das Stift Neumünster in Würzburg (1989), S. 520. - Johannes von Eyb als Rat, siehe Repertorium Germanicum, Bd. 4 (1957), Nr. 4411.- Bertold Sliner als Arzt Markgraf Johanns, siehe Keil: Bertold Slyner (1995), S. 6.
26 Zu Nickel Pfuhl siehe Riede!: Codex diplomaticus Brandenburgensis, Bd. III/2 (1860),
S. 74, Nr. 72. 27 Zu Peter Knorr siehe Ette!t-Schönewald, Rat und Regierung Herzog Ludwigs des
Reichen (1996), S. 480 und Streich: Zwischen Reiseherrschaft und Residenzbildung (1989), S. 612. - Zu Hertnidt vom Stein siehe Priebatsch: Politische Correspondenz, Bd. 2 (1897), S. 455, Nr. 485.- Zu Georg von Absberg siehe Most-Kolbe: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Friedrich III., Abt. 8/1 (1973), S. 545, Z. 19.
159
Landgerichts Burggrafturns Nürnberg, als dessen Landschreiber zwischen 1455 und 1460 Georg Spengler bezeugt ist und seit 1463 Lorenz Schaller.28 Um 1459 warb Albrecht von Eyb in Bamberg um Unterstützung des Markgrafen in dieser Angelegenheit. 29 1461 waren Balthasar von Modschiedel und Stephan Scheu in Landshut zu Verhandlungen, 1463 vertrat wiederum Stephan Scheu den Markgrafen am Kaiserhof.3°
Eine Gesandtschaft mit Martin Heiden und Stephan Scheu überbrachte dem Kaiser im Juni 1470 die Abdankung Kurfürst Friedrichs IIY und mit dem Herrschaftsantritt Albrechts wurde dem ältesten Sohn Johann der Präzeptor Johann Stocker nach Cölln gesandt.32 Ebenfalls noch 1470 bemühte sich Lorenz Thum als Kurienprokurator in Rom um die Absolution Albrechts. 33 Auf dem Regensburger großen Christentag 1471 erschien Albrecht mit großem Gefolge, in welchem sich auch eine Anzahl gelehrter Räte befand. 34 Als Beisitzer des Cöllner Kammergerichtes findet sich 1476 Liborius von Schlieben,35 der zwei Jahre später als Gesandter entscheidend zum Ausgleich im Konflikt um das Herzogtum Schlesien-Glogau beitrug, an dem auch J ohann Ffotel und Sigmund von Rotherrburg 1479-1481 mitwirkten.36 Ffotel war seit Dezember 1476 wiederholt nach Prag gereist, zunächst um die Eheschließung zwischen Wladislaw II. von Böhmen und Albrechts Tochter Barbara vorzubereiten und dann, im Sommer 1480 in Begleitung unter anderem von den gelehrten zollerischen Beratern Christian von Hayn, Martin Heiden, Erasmus Brandenburg, um den böhmischen König zur Heimholung seiner Braut zu bewegenY
Wie diese Beispiele zeigen, waren die Aufgaben der universitätsgebildeten Räte am zollerischen Hof vielfältig. Sie lassen sich in innere und äußere Angelegenheiten unterscheiden. Zu den inneren gehörten die Gerichtsbarkeit, die
28 Zu Georg Spengler siehe Staatsarchiv Nürnberg, Kaiserliches Landgericht, Repertorium 119.- Zu Lorenz Schallersiehe Knod: Deutsche Studenten in Bologna (1899), Nr. 3268.
29 Herrmann: Albrecht von Eyb (1893), S. 234. 30 Landshut: Bachmann: Briefe und Acten zur österreichisch-deutschen Geschichte im
Zeitalter Kaiser Friedrichs III. (1885), S. 84, Nr. 65.- Kaiserhof: ders.: Urkunden und Actenstücke zur Österreichischen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrichs III. und König Georgs von Böhmen (1879), S. 354, Nr. 266.
31 Priebatsch: Politische Correspondenz, Bd. 1 (1894), S. 132, Nr. 54 32 Riede!: Codex diplomaticus Brandenburgensis, Bd. III/1 (1859), S. 506, Nr. 359. 33 Priebatsch: Politische Correspondenz, Bd. 1 (1894), S. 175,231-233. Albrecht war nach
der Heirat seiner Tochter Ursula mit Heinrich von Münsterberg, dem Sohn des böhmischen Königs Georg Podiebrad, exkommuniziert worden.
34 Most-Kolbe: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Friedrich III., Abt. 8/1 (1973), S. 530. 35 Riede!: Codex diplomaticus Brandenburgensis, Bd. I/19 (1860), S. 403, Nr. 315. 36 Priebatsch: Politische Correspondenz, Bd. 2 (1897), S. 596, Nr. 654. 37 Ebd., Bd. 2 (1897), S. 270, Nr. 254, S. 630, Nr. 681, S. 642, Nr. 692.
160
Erziehung und Ausbildung des Nachwuchses genauso wie die noch kaum angesprochene Verwaltung. Als Inhaber der klassischen Hofämter konnten keine graduierten Räte nachgewiesen werden und in der lokalen Verwaltung nur wenige, was den Gepflogenheiten in den benachbarten Territorien Bayern-Landshut, Sachsen, Hessen und Württemberg entspricht.38 Im Amt des Kanzlers dagegen begegnen nicht nur überwiegend, sondern ausschließlich graduierte Juristen.
3. Kanzler
Der erste der Kanzler, der das juristische Studium mit einer Graduierung beendet hatte, war vermutlich Peter Knarr, der zwischen Dezember 1446 und 1454 nachzuweisen ist. 39 Aus seiner Amtszeit sind die ersten Serienakten überliefert, die den Krieg mit Nürnberg 1449/50 betreffen. Er wirkte prägend auf eine neue Praxis der schriftlichen Dokumentation. Im Jahr 1457 dann ist Hertnidt vom Stein Kanzler Albrechts. 1473 bezeichnet der Kurfürst ihn als unsern alten canzler.40 Bereits 1459 folgte ihm Balthasar von Modschiedel,41
der wie Hertnidt vom Stein zwei Jahre lang dieses Amt bekleidet zu haben scheint, wie sein am 3. September 1461 ausgestellter Bericht vom Nördlinger Städtetag nahelegt.42 In diesem September hatte Albrecht vielleicht zwei Kanzler, da Papst Pius II. in einem Schreiben an Albrecht vom 5. des Monats den Job zum Riet als solchen bezeichnet. Letzterer war zuvor Kanzler des Mainzer Erzbischofs Dieter von Isenburg gewesen und stand noch im April 1463 in Albrechts Diensten. Nach einer Lücke von drei Jahren datiert der erste Nachweis eines weiteren Kanzlers, Georg von Absberg, vom September 1467.43 Als solcher begleitete er Albrecht im Herbst 1470 nach Graz zur Belehnung mit der Kurfürstenwürde, nachdem er zuvor mit Ludwig von Eyb in der Mark Brandenburg die Situation des Cöllner Hofes und der märkischen Finanzen erkundet hatte. Im April1471 war er bereits als Landhofmeister in württembergischen Diensten.44
38 Hesse: Amtsträger der Fürsten im spätmittelalterlichen Reich (2005), S. 481. 39 Zum 12.12.1446 siehe Repertorium Germanicum, Bd. 5 (2004), Nr. 99. 40 Priebatsch: Politische Correspondenz, Bd. 1 (1894), S. 520. 41 Bachmann: Briefe und Akten (1885), S. 39, Nr. 44. 42 Ebd., S. 199, Nr. 136. 43 Bachmann: Urkunden und Actenstücke (1879), S. 435, Nr. 325. Für das Datum 1460 bei
Wagner: Kanzlei- und Archivwesen der fränkischen Hohenzollern (1885), S. 21 und Jordan: Reformation und gelehrte Bildung in der Markgrafschaft Ansbach-Bayreuth (1917), S. 62ließen sich keine Quellen finden.
44 Most-Kolbe: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Friedrich III., Abt. 8/1 (1973), S. 623, Z. 18.
161
Von Absberg dürfte der letzte Kanzler Albrechts in Ansbach gewesen sein, denn bis 1486 trägt kein Rat diesen Titel mehr, zumindest nicht in Schreiben aus der Feder des Kurfürsten oder anderer zollerischer gelehrter Räte. Erst Albrechts Söhne Friedrich der Ältere und Sigmund ernannten den nicht promovierten Johann Völker 1486 zum Kanzler. In markgräflichen Diensten tritt dieser aber bereits deutlich früher in Erscheinung, erstmals im Juli 1469 mit dem Titel Sekretär. Noch 1481 wird er von Hertnidt vom Stein so bezeichnet45 und folglich war er zu Albrechts Lebzeiten anscheinend nicht Kanzler. Verwirrend scheint allerdings, dass Völker 1479 vom Nürnberger Rat, 1482 von den Grafen von Württemberg und auch drei Jahre später vom Hauptmann auf dem Gebirge Sebastian v. Seckendorf in den jeweiligen Schreiben als Kanzler angeredet wird.46 Daraus kann geschlossen werden, dass Völker formal nicht Kanzler war, aber nach dem Eindruck Außenstehender dessen Aufgaben wahrnahm. Dies und die bis zu Georg von Absberg geschlossene Reihe von Doktoren der Jurisprudenz in diesem Amt sprechen dafür, dass Kurfürst Albrecht nur Gelehrte zu Kanzlern ernannte. Mit dieser Praxis bewegte er sich im Kreis der politisch bedeutenden Landesherren seiner Zeit. Auch die Kanzler des Erzbischofs von Mainz waren seit 1436 alle graduiert, diejenigen der erbländischen Kanzlei Kaiser Friedrichs 111. waren fast alle promoviert und auch am burgundischen Hof finden sich im 15. Jahrhundert nur gelehrte Kanzler.47
Die relativ kurzen Amtszeiten der Kanzleivorsteher von etwa zwei Jahren waren ebenfalls nicht ungewöhnlich; solche kurzen Verweilzeiten sind auch am anhaltischen Hof und dem des Mainzer Erzbischofs zu beobachten. Ihre Mobilität bescherte diesen Gelehrten ein großes Beziehungsnetz, was sie für Kontaktpflege und Verhandlungen im Auftrag der jeweiligen Dienstherren nutzen konnten. Für die längeren Pausen zwischen den einzelnen Amtsinhabern lassen sich ebenfalls Parallelen finden, es gab sie etwa in der Reichshofkanzlei Kaiser Friedrichs 111. oder wiederum beim Mainzer Erzbischof.48
Dennoch ist zu fragen, ob nicht die starke Stellung Ludwigs von Eyb am Ansbacher Hof eine gewisse Konkurrenz für die Kanzler mit sich brachte.
45 Lenckner: Der brandenburgische Kanzler Johann Völker aus Crailsheim (1966), S. 186 und Priebatsch: Politische Correspondenz, Bd. 3 (1898), S. 128 zu 1481.
46 Zu 1479: Priebatsch: Politische Correspondenz, Bd. 2 (1897), S. 531.- Zu 1482: ebd., Bd. 3 (1898), S. 233.- Zu 1485: ebd., Bd. 3 (1898), S. 424.
47 Heinig: Kaiser Friedrich 111. (1997), S. 576.- Ringel: Studien zum Personal der Kanzlei des Mainzer Erzbischofs Dietrich von Erbach (1980), S. 223, 225.- Schnerb: L' Etat bourguignon 1363-1477 (1999), S. 243.
48 Schrecker: Das landesfürstliche Beamtenturn in Anhalt (1906), S. 82.- Ringel: Studien zum Personal der Kanzlei des Mainzer Erzbischofs Dietrich von Erbach (1980), S. 218, 225. - Heinig: Kaiser Friedrich III. (1997), S. 655.
162
Vergleicht man die Ansbacher Situation mit der am Cöllner Hof, so fallen die wesentlich längeren Amtszeiten der märkischen Kanzler auf. Friedrich Sesselmann war seit 1445 in diesem Amt und sein Nachfolger Sigmund Zerer ist erst 1483, nach dem Tod Sesselmanns, erstmals in dieser Funktion genannt. Er hatte das Amt bis 1509 inne.49 Die lange Amtsdauer könnte zum einen Reaktion auf die geringere Verfügbarkeit von Gelehrten in der Mark sein, zum anderen wird sie - während der Regierungszeit Kurfürst Albrechts -durch die geographische Entfernung des Landes zum Machtzentrum in Franken begründet sein. An der Peripherie dürfte die personelle Kontinuität ein Garant für stabile Verhältnisse gewesen sein.
Zum weiteren Personal der Kanzleien in Ansbach und Cölln gehörten Sekretäre, Protonotare und Schreiber. Soweit sichtbar, wurden diese Bezeichnungen auch synonym gebraucht. Mit Albrecht Klitzing und Johann Völker finden sich zwei Universitätsgebildete, während die Ausbildung der übrigen innerhalb der Kanzlei stattgefunden zu haben scheint.
Gemeinsam ist den Kanzlern Albrechts nicht nur die Graduierung, sondern auch ihr Einsatz als Gesandte in wichtigen landespolitischen Angelegenheiten. Als Vorsteher der Kanzlei am Ort der Residenz und zugleich als führende Diplomaten hatten sie eine bedeutende Funktion an der Schnitt~ stelle von inneren und äußeren Angelegenheiten. Mit einem umfangreichen Wissen über die herrschaftlichen Verhältnisse konnten sie verhandeln und erfüllten zugleich Aufgaben der Repräsentation. Mit dieser Kombination von Amt und Tätigkeiten befindet sich Albrecht wiederum unter den führenden Landesherren seiner Zeit, entsprach es doch den Gepflogenheiten seit dem mittleren 15. Jahrhundert, kanzleierfahrene gelehrte Räte mit Gesandtschaften zu betrauen. 50
4. Gesandte
Neben den Kanzlern wurde eine ganze Reihe weiterer gelehrter Berater regelmäßig bei juristisch-politischen Fragen in auswärtigen Angelegenheiten hinzugezogen. Sie berieten Albrecht nicht nur, sondern waren wie die Kanzler als Unterhändler dafür verantwortlich, bei und mit den fürstlichen Nachbarn, dem Kaiser und an der römische Kurie die Interessen der Zollern innerhalb und außerhalb des Reiches auszuloten und zu vertreten. Die Mehrzahl hatte kein Amt am Hof inne und hielt sich die meiste Zeit
49 Holtze: Die ältesten märkischen Kanzler und ihre Familien (1894), S. 189, 197.- Riedel: Codex diplomaticus Brandenburgensis, Bd. 111/2 (1860), S. 293.
50 Zu den Maßstäben, die Kaiser Friedrich 111. gesetzt hat, Heinig: Römisch-deutscher Herrschethof und Reichstag im europäischen Gesandtschaftssystem (2003), S. 236f.
163
auch nicht am Residenzort auf. Wichtiger war ihre Präsenz am Ziel des Auftrages, am Hof des Verhandlungspartners oder an Orten, an denen andere Gesandte anzutreffen waren. Verhandlungsanweisungen und aktuelle Informationen erhielten sie auf dem Korrespondenzweg, wie die reichhaltig überlieferten und vorzüglich edierten Schreiben von Albrecht und an ihn zeigenY Mit Verhandlungsmandaten wurden vorzugsweise Juristen betraut und auch unter den gelehrten Gesandten Albrechts finden sich mehr als zwei Drittel Rechtsgelehrte, aber auch Mediziner wie Johann Meurer und Konrad Schwestermüller. Theologen dagegen sind als Diplomaten am wenigsten deutlich sichtbar.
Wie in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts üblich, wurden die Diplomaten anlassbezogen entsandt. Im Reich waren, im Gegensatz etwa zu italienischen Verhältnissen, noch keine stehenden Gesandtschaften etabliert. Die ständige Präsenz von Vertrauten war dennoch hilfreich und wurde unter anderem durch die Mehrfachverpflichtung der Räte möglich, aber auch durch das etwa an der päpstlichen Kurie fest etablierte Prokuratorenwesen. 52 Albrechts Bemühungen, vor allem zum Hof Kaiser Friedrichs III. und zur Kurie möglichst kontinuierlichen Kontakt zu halten, zeigen sich gerade auch durch seine Praxis der Indienstnahme Gelehrter. Johann Keller oder Martin Heiden standen bald nach ihren Rechtsstudien in seinen Diensten und wechselten nach einer gewissen Zeit an den Kaiserhof. 53 Von ihnen erbat sich Albrecht konkrete Informationen über die dortigen Verhältnisse. Verbindungen nach Rom unterhielt Albrecht einerseits mittels wiederholter Gesandtschaften zur Gewährung von Privilegien und andererseits durch Kurienprokuratoren. Unter seinen gelehrten Räten befanden sich mindestens fünf, beginnend bei Heinrich Ubelein, bereits 1422/31 im Dienst Friedrichs I., Stephan Scheu 1459, Albrecht von Eyb 1461, Andreas Inderklingen 1463/64 und 1470 sowie Lorenz Thum 1469/70, vielleicht auch Hermann Reinsperger 1463.54
51 Vgl. Priebatsch: Politische Correspondenz, 3 Bde. (1894-1898).- Bachmann: Urkunden und Actenstücke (1879).- Ders.: Briefe und Akten (1885).- Ders.: Urkundliche Nachträge zur österreichisch-deutschen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrichs III. (1892) und andere mehr.
52 Ständige Gesandtschaften begegnen zuerst in oberitalienischen Kommunen, siehe Reitemeier: Diplomatischer Alltag im Spätmittelalter (2003), S. 139.- Kintzinger: Voyages et messageries (2008), S. 201 mit weiterer Literatur. - Heinig: Römisch-deutscher Herrscherhof (2003), S. 232.
53 Johann Keller ist 1465 als kaiserlicher Fiskalprokurator tätig. Mader: Johann Keller (1991), S. 13. Martin Heiden ist 1477 als kaiserlicher Gesandter nach Lothringen bezeugt. Heinig: Kaiser Friedrich III. (1997), S. 412.
54 Zu H. Übelein siehe Wendehorst: Das Stift Neumünster in Würzburg (1989), S. 520.Zu St. Scheu siehe Borchardt: Die geistlichen Institutionen in der Reichsstadt Rotbenburg ob der Tauber (1988), S. 582, Nr. 270.- Zu A. von Eyb siebe Repertorium Germanicum, Bd. 8 (1993), Nr. 86.- Zu A. Inderklingen siehe ebd., Nr. 165, 2765.- Zu L. Thum siehe Priebatsch: Politische Correspondenz, Bd. 3 (1898), Nr. 175.
164
!
t
I I ~
Von Friedrich Sesselmann ist bekannt, daß er während seines Romaufenthaltes im Jahr 1447 an der Kurie das Amt des Pönitentiarieschreibers bekleidete.55 Eine Reihe weiterer Gelehrter wurde mit Ehrentiteln ausgezeichnet. Als Apostolische Kubikulare sind Georg Heßler 1455/56 und Albrecht von Eyb 145856 genannt und wiederum Georg Heßler (1466) wurde, wie auch Hertnidt vom Stein (1474/80) und Albrecht Klitzing (1483), als Apostolischer Protonotar tituliert. 57 Zum Jahr 1478 ist Erasmus Brandenburg erstmals als Apostolischer Subdiakon belegt. 5H Die guten Kontakte zu den maßgeblichen Kreisen in der Umgebung des Papstes, die hinter diesen Ehrentiteln stehen, erleichterten den Räten nicht nur die eigene Ausstattung mit einträglichen Pfründen, sondern dienten auch der bevorzugten Berücksichtigung der Interessen ihrer Dienstherren. Für Albrecht dürften auch diese Ehrentitel eine Rolle gespielt haben, da sie seine Räte aufwerteten. Wie die akademischen Titel, so verhalfen auch sie zu mehr Reputation, da Albrecht nur wenige hohe geistliche Würdenträger wie Bischöfe mit Gesandtschaften beauftragte und dennoch um die möglichst standesgemäße Repräsentation seiner Person und Herrschaft bemüht sein musste. 59
5. Statthalter
Die Zeiträume, in denen die markgräflichen Räte, Amtleute und Diener vor besonderen Anforderungen standen, waren die Abwesenheiten des Landesherrn. Markgraf und Kurfürst Albrecht setzte in diesen Zeiten Statthalter ein. Am Ansbacher Hof übten temporär bis zu 15 Personen die Regierungsgeschäfte aus. Wie das Itinerar am Ende dieses Sammelbandes zeigt, reiste Albrecht zu verschiedenen Versammlungen der Fürsten des Reiches, im Jahr 1459 zu einem Fürstentag nach Mantua, und er führte vom Rhein aus den Reichskrieg gegen Karl den Kühnen. Die längste Zeit an einem Stück hielt sich Albrecht außerhalb Frankens während seiner Aufenthalte in der Mark Brandenburg auf, die er als Kurfürst dreimal besuchte.
55 Repertorium Germanicum, Bd. 6 (1985/89), Nr. 1304. 56 Heinig: Kaiser Friedrich III. (1997), S. 709. - Scherg: Franconica aus dem Vatikan
(1909), s. 26. 57 Heinig: Kaiser Friedrich III. (1997), S. 712.- Archivio Secreto Vaticano, Registro Vati
cano, Bd. 602, fol. 208vs.- Priebatsch: Politische Correspondenz, Bd. 3 (1898), S. 270, Nr. 972. 58 Priebatsch: Politische Correspondcnz, Bd. 2 (1897), S. 351, Nr. 355. 59 Die Bischöfe der märkischen Bistümer zählten dazu, aber keine aus fränkischen Diö
zesen. Lutter: Politische Kommunikation an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit (1998), S. 192. Zur Repräsentation des Herrschers durch den Gesandten siehe Autrand/ Contamine: Naissance de Ia Francc (2005), S. 103.
165
Unter den Statthaltern befanden sich regelmäßig gelehrte Berater. Im Sommer 1450 war mit Peter Knarr mindestens ein Gelehrter darunter, 60 während 1471 neben Knarr auch der Abt des Zisterzienserklosters Heilsbronn Peter Wegel als Gelehrter teilnahm. 61 In der Mark Brandenburg wurde dem jungen Markgrafen Johann ein Regentschaftsrat aus zehn Personen zur Seite gestellt, 62 von denen drei eine Universität besucht hatten, nämlich der Kanzler Friedrich Sesselmann, Nickel Pfuhl und der brandenburgische Bischof Dietrich von Stechow. Die eingesetzten gelehrten Berater gehörten zu den engen Vertrauten des Fürsten und waren nicht nur in der Minderzahl, sondern ihre Anwesenheit am Hof war offensichtlich nicht andauernd nötig. Der Heilsbronner Abt sollte 1476 beispielsweise schriftlich um Rat gefragt werden und Peter Knarr dürfte als Pfarrer von St. Lorenz in Nürnberg im Jahr 1471 in gleicher Weise zur Verfügung gestanden haben wie auch die Bischöfe von Lebus und Brandenburg. Diese Räte wurden also von den Statthaltern nur in besonderen Fragen hinzugezogen, die täglichen Geschäfte konnten von den übrigen Amtsträgern bewältigt werden.
6. Rechtsprechung
Neben der Tätigkeit als Statthalter bildete die Rechtsprechung einen weiteren Aufgabenbereich mit Beteiligung von gelehrten Räten. Sie folgte zum einen einer je eigenen Tradition in den Landesteilen und weist außerdem eine recht unterschiedliche Überlieferungsdichte aufY Im weitgehend selbständig regierten Kulmbacher Landesteilleitete der Hauptmann ob dem gebirg das Hofgericht. Die Hofgerichtsbücher setzen 1466 ein, gelehrte Beisitzer erscheinen in den kontinuierlich geführten Protokollen erst ab 1507.64
60 Rübsamen: Das Briefeingangregister des Nürnberger Rates (1997), S. 111, Nr. 1475, 1488. 61 Die Mehrzahl waren Amtleute und Vögte, wie Hans von Absberg Amtmann zu Uffen
heim, Sebastian von Seckendorf, gen. Nolt als Amtmann zu Schwabach, später Hausvogt auf der Plassenburg, Heinz von Kindsberg als Hausvogt zu Ansbach, Werner Lutz als Vogt zu Kirchheim,Jakob Protzer, Bürger zu Nördlingen, Sixt (von Ehenheim) und der Landkomtur Melchior von Neueneck. Priebatsch: Politische Correspondenz, Bd. 1 (1894), S. 294.
62 Ebd., Bd. 1 (1894), S. 124. Siehe auch Böcker: Die Festigung der Landesherrschaft durch die hohenzollernschen Kurfürsten (1995), S. 209.
63 Sowohl in der Mark Brandenburg als auch im Kulmbacher Landesteil gibt die Überlieferung ab 1470 einen recht guten Einblick in die Rechtspraxis.
64 Selbst der ab 1466 tätige Hofgerichtsschreiber Mattbias Thaimann hatte vermutlich keine Universität besucht. Staatsarchiv Bamberg, C 51 Hofgericht, Bde. 1-4. Siehe hierzu auch Stölzel: Die Entwicklung des gelehrten Richterturns in deutschen Territorien (1872), S. 260.
166
Vom Hofgericht in Cölln sind aus der Zeit zwischen 1473 und 1489 mehr als 200 Schiedssprüche und gerichtliche Entscheidungen überliefert. 65 In nur 34 von ihnen sind Räte oder Beisitzer namentlich genannt. Dreizehn verschiedene Gelehrte wirkten an 27 Entscheidungen in den insgesamt 18 Jahren mit. Somit dürfte die Beteiligung von universitätsgebildeten Beratern insgesamt gering gewesen sein. Allerdings lassen sich Zeichen der Anwendung gelehrten Rechts finden. Zum einen wurde das Kammergericht im Jahr 1459 als Appellationsinstanz für die übrigen Gerichte des Landes eingerichtet und zum anderen bestand die Möglichkeit, ein Urteiltrotz Abwesenheit, in contumaciam, des Angeklagten zu fällen. 66 Diese durch Kurfürst Friedrich II. gutgeheißenen Neuerungen wurden auch nach 1470 beibehalten. In Franken hatte Albrecht ebensolche Modernisierungen in der Rechtsprechung eingeführt, vielleicht auf Empfehlung von Hertnidt vom Stein, der im Mai 1457 als Kanzler nachweisbar ist. 67 Wiederum gibt die Appellation an das Hofgericht Hinweise auf die Rezeption römischen gelehrten Rechts, die erste bekannte datiert vom September 1457. Vier Monate später wurde eine Ordnung des Appellationswesens erlassen und im Januar 1470 erneuert. 68 In wie weit Gelehrte konkret an der Ansbacher Gerichtspraxis Teil hatten, ist aufgrund der ungleich ungünstigeren Überlieferung der Ansbacher Gerichte kaum zu klären. 69 Die vorhandene Überlieferung nennt kaum Namen der Urteiler. In seiner Funktion als Beisitzer des Reichshofgerichtes hatte Albrecht selbst bereits 1442 direkte Erfahrungen mit der Anwendung gelehrten Rechts und der Rolle von juristisch gebildeten Urteilern gesammelt. In den Jahren 1455 und 1456 führte er den Vorsitz des königlichen Kammergerichts und beeinflusste damit auch die Auswahl der Beisitzer. 70
Was die über das Ansbacher Land und die eigenen Untertanen ausgreifenden Rechtsprechung des Kaiserlichen Landgerichts Burggrafturns Nürnberg angeht, so scheint es fraglich, ob hier regelmäßig Gelehrte teilnahmen.
'' 5 Schappcr: Die Hofordnung von 1470 (1912), S. 185-187. '''' Stölzel: Die Entwicklung des gelehrten Richtcrtums; Bd. 2 (1901), S. 565. '' 7 Riede!: Codex diplomaticus Brandenburgcnsis, Bd. Il/5 (1848), S. 28, Nr. 1788. ''' Zum 10.9.1457 siehe Staatsarchiv Nürnbcrg, Fürstentum Ansbach, Kaiserliches Land
gericht, Rcp. 119 ad, 16.01.1458. DieOrdnung ist nicht überliefert, nur der Eintrag im Repertorium von 1557. Zu 1470: Staatsarchiv Nürnberg, Fürstentum Ansbach, Kaiserliches Landgericht, Rep. 119 ad, 29.01.1470. Die Ordnung ist ebenfalls nicht überliefert.
1'9 Protokollbücher des Hofgerichtes sind nicht auffindbar und wohl auch nicht übedie fert. Die schriftlichen Zeugnisse setzen sich im wesentlichen aus im Original und abschriftlich erhaltenen Spruchbriefen des Hofgerichtes, Konzepten des Landrichters zu Urteilen, Protokollen von Gerichtsverhandlungen in Ansbach sowie Notariats-Instrumenten im Original und in Kopie und darüber hinaus verschiedene Gerichtssachen betreffende Korrespondenz zusammen.
70 Lechner: Reichshofgericht und königliches Kammergericht im 15. Jahrhundert (1907), S. 87, 143.- Heinig: Kaiser Friedrich lli. (1997), S. 101.
167
Ist auch Peter Knorr 1445 und 1452 als Beisitzer genannt, so mussten die Tabelle: Universitätsgebildete Berater
Richter, Urteilerund Anleiter seit der 1447 verfassten Reform doch zwin- Markgraf und Kurfürst Albrechts von Brandenburg
gend adligen Standes sein, die Nürnberger Beisitzer wurden ausgegrenzt. 71
Geographische So- Stand: Erster Nach der Wiederaufnahme der Gerichtstätigkeit begegnet 1497 wieder ein Promo- Vorname Name
gelehrter Urteiler, der bereits 1472 in Albrechts Diensten stehende Johann tionsgrad Herkunft: ziale geist- Nach-
Pfotel. 72 Einzig der Landschreiber blieb traditionsgemäß bürgerlicher Her- Universitäts- Franken Her- lieh wets besucher (linksbündig) kunft: (G),
kunft und war in der Stadt Nürnberg ansässig. Der von 1440 bis 1453 amtie- (Univ.bes.) Mark Bdg. Adel weit-rende Johann Ulmer hatte keine Universität besucht, der Nachfolger Georg (rechtsbündig) (A), lieh Spengler hatte (ab 1455) in Leipzig studiert. Ab 1463, dem Jahr, in welchem weitere (mittig) Bürger (W) das Gericht weitestgehend außer Funktion gesetzt wurde, versah der erste (B)
promovierte Jurist dieses Amt, Lorenz Schaller. 73 In dieser Besetzung kann man die Absicht des Markgrafen erkennen, den Anspruch auf das Gericht Dr. utr. iur. Georg v. Absberg Absberg A w 1460
aufrecht zu erhalten und zugleich mit einer neuen Qualität und Kompetenz Dr. utr. iur. Busso v. Alvens- Kalbe, Altmark A G 1473
auszustatten. leben
Der Anteil von gut 16 % Gelehrten unter den markgräflichen Räten und Dr. med. Georg Bramherger Regensburg B w 1473
Getreuen verteilt sich nicht gleichmäßig auf die Tätigkeitsfelder. Der Haupt-Mag. art. Erasmus Brandenburg Zwickau B G 1475
einsatzhereich der gelehrten Berater war das Gesandtschaftswesen und den Dr. utr. iur. Albrecht v. Eyb Sommersdorf A G um 1459
Schwerpunkt bildete die politische Positionierung der Zollern als Reichs-Dr. utr. iur. Anselm v.Eyb Sommersdorf A G 1463
fürsten sowohl gegenüber dem Kaiser als auch den anderen Gliedern des Rei-Dr. utr. iur. Johannes V. Eyb S om rnersdorf A G 1443
ches. Die gelehrten Räte wirkten aber auch hier ganz überwiegend zusam-Univ.bes. Wcdigo Gans zu Putlitz A G 1472
men mit den nicht gelehrten Adligen, die zu den engen Vertrauten Albrechts Putlitz zu zählen sind. Mit ihren Beziehungen bildeten die universitätsgebildeten Dr. leg. Antonius Grünwald Ni.irnbcrg B w 1481 Räte einen wichtigen, aber eben nur einen Ausschnitt im Netzwerk des Zol-
DLutr.iur. Christian v. I layn Mciningen A w 1480 lern. Maßgebliche Unterstützung hatte er von einer viel größeren Zahl nicht
Dr. utr. iur. Martin Heiden Dachsbach A w 1470 universitätsgebildeter Personen erhalten.
Dr. utr. 1ur. Grcoor I Ieimburg Schweinfurt B w 1469 h
Dr. utr. iu r. Johann v. Heldburg Hcldburg, Thür. A G 1454
Dr. utr. iur c;corg IIci\lcr Wür/.burg B G 1459
Dr. med. Nikolaus Horn Dct tclbach B w 1458
Dr. decr. Kilian I!orn Dertelbach B G 1481
I )r. decr. Andrcas lndcrklm- Ochsenfurt G 1460 "Cll h
Lic. dccr. Johanncs Kautsch Kulmbach B G 1442
Iic. utr. iur Johallm·s Kcllc1 Ni.irnbcrg B w 1464
Lh1v.bcs. Albrecht Klitzing Demenhin G 1467
Dr dccr. Pctcr 1\. norr Kulmbach B G 1441
Dr. theol. Clcmcn s Lassow Brandenburg ' G 1481
lk dccr. Otto Lichten- Lichtenfels A G 1442 71 Staatsarchiv Nürnberg, Rep. 119, Nr. 225, fol. 146 v, 306r.- Leiser: Beiträge zur Rezep- fcls
tion des gelehrten Prozesses in Franken (1977), S. 99. Dr. utr. iur. Joharm I ~och ncr, Nü1 B G 1447 72 Siehe Drechsel: Ansbacher Beamtenkartei (1953-1959). run. 73 Knod: Deutsche Studenten in Bologna (1970), Nr. 3268.
168 169
Promo- Vorname Name Geographische So- Stand: Erster Promo- Vorname Name Geographische So- Stand: Erster
tionsgrad Herkunft: ziale geist- Nach- tionsgrad Herkunft: ziale geist- Nach-
Universitäts- Franken Her- lieh wets Universitäts- Franken Her- lieh wets
besuch er (links bündig) kunft: (G), besucher (links bündig) kunft: (G),
(Univ.bes.) Markßdg. Adel weit- (Univ.bes.) Mark Bdg. Adel weit-
(rechtsbündig) (A), lieh (rechtsbü ndig) (A), lieh
weitere (mittig) Bürger (W) weitere (mittig) Bürger (W)
(B) (B)
Dr. med. Johannes Lochner, Nürnberg B w 1435 Dr. den joh.1nn Stocker I lof B G 1469
sen. Dr. den. Emmcram Straui\ Niirdlingcn B G 1481
Lic. theol. Peter Mangsdorf Lehnin B G 1481 Dr. dccr. Lorcnz. Thum hchst:itt B G 1470
Dr. med. Konrad Mengler Kitzingen B w 1475 Dr. mcd. .Johanncs Trost er A mbcrg B? w 1451
Dr. med. Johannes Meurer Frankfurt/0. B w 1476 Lic den. llcinrich Übelein B:t\"ITLllh B G 1442
Dr. utr. iur. Balthasar v. Mod- Modschiedel A G 1459 B.1cc. art. .Jolnnn Völker C:ratlshci m B w 1469
schiedel Dr thcol. Pctt't Wege] Franken B G 1466
Dr. theol. Konrad Mülner Nürnberg B G vor .11" l. Ad.1m Wciss Schw.1l"Hh B G 1484 1461 l.ic. dccr. Jolnnn Di n kc·ishtdll B G 1452
Dr. med. Se bald Mülner Nürnberg B w 1480 Dr. iUJ A nd rcas Wurn1 c;u nz.cnluuscn B G 1486 Dr.leg. Johann Pfote! Roth B w 1472 l h dcc'L Sig!llund Zer er llof B w 1474 Dr. utr. iur. Nikolaus Pfuhl Strausberg B w 1470 niv.bcs. Eitclfritz Gt.' I leehingen A w 1472 Lic.leg. Johannes Polraus Kronach B (?) 1477 Zo'lcrn Dr.leg. Hermann Reinspergcr Nürnberg B G 1471 Dr. theol. Mattbias Rem Weinsberg B G 1454 Dr. utr. iur. Job zum Riet Straßburg (?) A G 1461 Mag. art. Sigmund Rotherrburg Freienstadt A w 1473 Dr. utr. iur. Lorenz Schall er Nürnberg B w 1463 Bacc. art. Stephan Scheu, sen. Rotherrburg B W/G 1453 Univ.bes. Balthasar v. Schlieben, Baruth A G 1479
sen.
Dr. utr. iur. Liborius v. Schlieben Stülpe A G 1476
Jurist Heinrich Schockler Neustadt(?) B (?) 1478 Dr. med. Stephan Schütz Nürnberg B w 1484 Dr. med. Konrad Schwester- Thüringen(?) B w 1474
müller
Dr. theol. Johann Seiler Neustadt(?) B G 1481 Dr. utr. iur. Friedrich Sesselmann Herzogenaurach B G 1447 Dr. theol. Hieronymus Sesselmann Herzogenaurach B G 1472 Dr. med Benhold Sliner (?) B (?) 1442 Univ.bes. Georg Spengler Donauwörth B w 1455 Univ.bes. Dietrich v. Stechow Stechow A G 1470 Dr.leg. Hertnidt v. Stein zu Ostheim A G 1457
Ostheim
170 171
20
Literatur (Auszug aus dem Gesamtverzeichnis) Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten
vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen
und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, Hildesheim/Tübingen
1916-2004.
Kürzel: Repertorium Germanicum (1916-2004)
Altmann, Wilhelm (Bearb.): Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410-1437) XI, 1.2, Innsbruck
1896 (Regesta Imperii).
Kürzel: Altmann: Regesta Imperii (1896)
Autrand, Françoise u. Philippe Contamine: Naissance de la France: Naissance de sa
diplomatie. Le Moyen Age, in: Histoire de la diplomatie française, hg. von Villepin,
Dominique de, Paris 2005, S. 39-156.
Kürzel: Autrand/Contamine: Naissance (2005)
Bachmann, Adolf (Hg.): Briefe und Acten zur österreichisch-deutschen Geschichte im
Zeitalter Kaiser Friedrichs III., Wien 1885 (Fontes rerum Austriacarum: Abt. 2,
Diplomataria et acta, 44).
Kürzel: Bachmann: Briefe und Akten (1885)
Bachmann, Adolf (Hg.): Urkunden und Actenstücke zur österreichischen Geschichte im
Zeitalter Kaiser Friedrichs III. und König Georgs von Böhmen (1440-1471), Wien
1879 (Fontes rerum Austriacarum: Abt. 2, Diplomataria et acta, 42).
Kürzel: Bachmann: Urkunden (1879)
Bachmann, Adolf (Hg.): Urkundliche Nachträge zur österreichisch-deutschen Geschichte im
Zeitalter Kaiser Friedrichs III., Wien 1892 (Fontes rerum Austriacarum: Abt. 2,
Diplomataria et acta, 46).
Kürzel: Bachmann: Nachträge (1892)
Böcker, Heidelore: Die Festigung der Landesherrschaft durch die hohenzollernschen
Kurfürsten und der Ausbau der Mark zum fürstlichen Territorialstaat während des 15.
Jahrhunderts, in: Brandenburgische Geschichte, hg. von Materna, Ingo u. Wolfgang
Ribbe, Berlin 1995, S. 169-230.
Kürzel: Böcker: Landesherrschaft (1995)
Borchardt, Karl: Die geistlichen Institutionen in der Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber
und dem zugehörigen Landgebiet von den Anfängen bis zur Reformation,
Neustadt/Aisch 1988 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte.
Reihe 9, Darstellungen aus der fränkischen Geschichte, Bd. 37).
Kürzel: Borchardt: Rothenburg (1988)
Demandt, Karl Ernst: Der Personenstaat der Landgrafschaft Hessen im Mittelalter: Ein
«Staatshandbuch» Hessens vom Ende des 12. bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts,
Marburg 1981 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, 42).
Kürzel: Demandt: Personenstaat (1981)
Drechsel, Ida: Ansbacher Beamtenkartei, hg. von Rechter, Gerhard, Nürnberg 1953-59.
Kürzel: Drechsel: Beamtenkartei (1953-59)
Ettelt-Schönewald, Beatrix: Kanzlei, Rat und Regierung Herzog Ludwigs des Reichen von
Bayern-Landshut (1450-1479), München 1996 (Schriftenreihe zur bayerischen
Landesgeschichte, 97).
Kürzel: Ettelt-Schönewald: Ludwig der Reiche (1996)
21
Heinig, Paul-Joachim: Kaiser Friedrich III. (1440-1493). Hof, Regierung und Politik, Köln,
Weimar, Wien 1997 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters.
Beihefte zur J. F. Böhmer, Regesta Imperii, 17).
Kürzel: Heinig: Friedrich III. (1997)
Heinig, Paul-Joachim: Römisch-deutscher Herrscherhof und Reichstag im europäischen
Gesandtschaftssystem an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, in: Gesandtschafts-
und Botenwesen im spätmittelalterlichen Europa, hg. von Schwinges, Rainer C. u.
Klaus Wriedt, Ostfildern 2003 (Vorträge und Forschungen 60), S. 225-263.
Kürzel: Heinig: Herrscherhof (2003)
Herrmann, Max: Albrecht von Eyb und die Frühzeit des deutschen Humanismus, Berlin 1893.
Kürzel: Herrmann: Albrecht von Eyb (1893)
Hesse, Christian: Amtsträger der Fürsten im spätmittelalterlichen Reich. Die Funktionseliten
der lokalen Verwaltung in Bayern-Landshut, Hessen, Sachsen und Württemberg 1350-
1515, Göttingen 2005 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 70).
Kürzel: Hesse: Amtsträger (2005)
Holtze, Friedrich: Die ältesten märkischen Kanzler und ihre Familien, in: Forschungen zur
brandenburgischen und preußischen Geschichte 7 (1894), S. 479-531.
Kürzel: Holtze: Märkische Kanzler (1894)
Jordan, Hermann: Reformation und gelehrte Bildung in der Markgrafschaft Ansbach-
Bayreuth, Leipzig 1917 (Quellen und Forschungen zur bayerischen
Kirchengeschichte, 1).
Kürzel: Jordan: Bildung Ansbach/Bayreuth (1917)
Keil, Gundolf: Bertold Slyner, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon 9,
hg. von Stammler, Wolfgang u. Karl Langosch, Berlin, New York 1995, S. 6-7.
Kürzel: Keil: Bertold Slyner (1995)
Kintzinger, Martin: Voyages et messageries. Diplomatie in Frankreich zwischen Familiarität
und Funktion, in: Aus der Frühzeit europäischer Diplomatie. Zum geistlichen und
weltlichen Gesandtschaftswesen vom 12. bis 15. Jahrhundert, hg. von Märtl, Claudia
u. Claudia Zey, Zürich 2008, S. 191-229.
Kürzel: Kintzinger: Voyages et messageries (2008)
Kist, Johannes: Die Matrikel der Geistlichkeit des Bistums Bamberg. 1400-1556, Würzburg
1965 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte IV. Reihe.
Matrikel fränkischer Schulen und Stände, 7).
Kürzel: Kist: Geistlichkeit Bamberg (1965)
Kist, Johannes: Peter Knorr, in: Bericht des Historischen Vereins für die Pflege der
Geschichte des ehemaligen Fürstbistums Bamberg 92 (1953), S. 350-364.
Kürzel: Kist: Peter Knorr I (1953)
Kist, Johannes: Peter Knorr, in: Fränkische Lebensbilder 2, hg. von Pfeiffer, Gerhard,
Würzburg 1968 (Neue Folge der Lebensläufe aus Franken VII A), S. 159-176.
Kürzel: Kist: Peter Knorr II (1968)
Knod, Gustav C.: Deutsche Studenten in Bologna (1289-1562). Biographischer Index zu den
Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis, Aalen 1970, Berlin 1899: Berlin
1899.
Kürzel: Knod: Bologna (1970)
22
Kothe, Irmgard: Der fürstliche Rat in Württemberg im 15. und 16. Jahrhundert, Stuttgart 1938
(Darstellungen aus der württembergischen Geschichte, 29).
Kürzel: Kothe: Fürstlicher Rat Württemberg (1938)
Kremer, Renate: Die Auseinandersetzungen um das Herzogtum Bayern-Ingolstadt 1438-1450,
München 2000.
Kürzel: Kremer: Auseinandersetzungen (2000)
Kruse, Holger, Werner Paravicini u. Andreas Ranft: Ritterorden und Adelsgesellschaften im
spätmittelalterlichen Deutschland. Ein systematisches Verzeichnis, Frankfurt (Main),
Bern 1991 (Kieler Werkstücke. Reihe D: Beiträge zur europäischen Geschichte des
späten Mittelalters, Bd. 1).
Kürzel: Kruse et al.: Ritterorden und Adelsgesellschaften (1991)
Lange-Kothe, Irmgard: Zur Sozialgeschichte des fürstlichen Rates in Württemberg im 15. und
16. Jahrhundert, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 34 (1941),
S. 237-267.
Kürzel: Lange-Kothe: Württemberger Räte (1941)
Lechner, J.: Reichshofgericht und königliches Kammergericht im 15. Jahrhundert, in:
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 7 (Erg.-Bd.) (1907),
S. 44-186.
Kürzel: Lechner: Reichshofgericht (1907)
Leiser, Wolfgang: Beiträge zur Rezeption des gelehrten Prozesses in Franken, in:
Rechtshistorische Studien. Hans Thieme zum 70. Geburtstag, Köln, Wien 1977, S. 96-
118.
Kürzel: Leiser: Rezeption (1977)
Lenckner, Georg: Der brandenburgische Kanzler Johann Völker aus Crailsheim, in:
Württembergisch Franken (50) NF 40 (1966), S. 185-191.
Kürzel: Lenckner: Johann Völker (1966)
Lieberich, Heinz: Die gelehrten Räte. Staat und Juristen in Baiern in der Frühzeit der
Rezeption, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 27 (1964), S. 120-189.
Kürzel: Lieberich: Bayerische gelehrte Räte (1964)
Lutter, Christina: Politische Kommunikation an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Die
diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik Venedig und Maximilian I.
(1495-1508), Wien, München 1998 (Veröffentlichungen des Instituts für
Österreichische Geschichtsforschung, 34).
Kürzel: Lutter: Politische Kommunikation (1998)
Mader, Bernhard: Johann Keller (ca. 1435-1489). Reichsfiskalat und Herrschaftspraxis unter
Kaiser Friedrich III. Ms. Diss. Phil., Mannheim 1991.
Kürzel: Mader: Johann Keller (1991)
Moraw, Peter: Gelehrten Juristen im Dienst der deutschen Könige des späten Mittelalters
(1273-1493), in: Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, hg.
von Schnur, Roman, Berlin 1986, S. 77-147.
Kürzel: Moraw: Gelehrte Juristen (1986)
Moraw, Peter: Prag. Die älteste Universität in Mitteleuropa, in: Stätten des Geistes, hg. von
Demandt, Alexander, Köln 1999, S. 12-146 Gesammelte Beiträge zur deutschen und
europäischen Universitätsgeschichte. Strukturen - Personen - Entwicklungen, S. 79-
100.
Kürzel: Moraw: Prag (1999)
23
Moraw, Peter: Über Entwicklungsunterschiede und Entwicklungsausgleich im deutschen und
europäischen Mittelalter, in: Hochfinanz, Wirtschaftsräume, Innovationen. Festschrift
für Wolfgang von Stromer 2, hg. von Bestmann, Uwe, Franz Irsigler u. Jürgen
Schneider, Trier 1987, S. 583-622 Über König und Reich, hg. v. Rainer Chr.
Schwinges, Sigmaringen, 1995, S. 293-320.
Kürzel: Moraw: Entwicklungsunterschiede (1987)
Most-Kolbe, Ingeborg u. Helmut Wolff (Hg.): auDeutsche Reichstagsakten unter Kaiser
Friedrich III. Achte Abteilung 1468-1471, 2 Bde., Göttingen 1973/1999/2001
(Deutsche Reichstagsakten. Ältere Reihe, 22).
Kürzel: Most-Kolbe/Wolff: Reichstagsakten 22 (1973/1999/2001)
Priebatsch, Felix (Hg.): Politische Correspondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles, 3 Bde.,
Leipzig 1894-1898 (Publicationen aus den Kaiserlich Preußischen Staatsarchiven, 59,
67 und 71).
Kürzel: Priebatsch: Correspondenz (1894-1898)
Reitemeier, Arnd: Diplomatischer Alltag im Spätmittelalter: Gesandte in den englischen
Beziehungen zu Frankreich und zur Hanse, in: Gesandtschafts- und Botenwesen im
spätmittelalterlichen Europa, hg. von Schwinges, Rainer C. u. Klaus Wriedt,
Ostfildern 2003 (Vorträge und Forschungen 60), S. 135-169.
Kürzel: Reitemeier: Gesandte (2003)
Riedel, Adolph Friedrich (Hg.): Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der
Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellen für die Geschichte der Mark
Brandenburg und ihrer Regenten., Berlin 1839-69.
Kürzel: Riedel: CDB (1839-69)
Ringel, Ingrid Heike: Studien zum Personal der Kanzlei des Mainzer Erzbischofs Dietrich von
Erbach (1434-1459), Mainz 1980 (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen
Kirchengeschichte, 34).
Kürzel: Ringel: Kanzlei Mainz (1980)
Röhricht, Reinhold: Deutsche Pilgerreisen nach dem heiligen Lande, Aalen 1967.
Kürzel: Röhricht: Pilgerreisen (1967)
Rübsamen, Dieter (Hg.): Das Briefeingangregister des Nürnberger Rates für die Jahre 1449-
1457, Sigmaringen 1997 (Historische Forschungen, 22).
Kürzel: Rübsamen: Briefeingangsregister Nürnberg (1997)
Schapper, Gerhard: Die Hofordnung von 1470 und die Verwaltung am Berliner Hofe zur Zeit
Kurfürst Albrechts im historischen Zusammenhange behandelt, Leipzig 1912.
Kürzel: Schapper: Hofordnung (1912)
Scherg, Theodor J.: Franconica aus dem Vatikan. 1464-1492, in: Archivalische Zeitschrift 16
(1909), S. 1-156.
Kürzel: Scherg: Franconica I (1909)
Schnerb, Bertrand: L' État bourguignon 1363-1477, Paris 1999.
Kürzel: Schnerb: État bourguignon (1999)
Schrecker, Ulrich: Das landesfürstliche Beamtentum in Anhalt von seinen ersten Anfängen
bis zum Erlaß bestimmter Verwaltungsverordnungen (ungefähr 1200-1574), Breslau
1906 (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, 86).
Kürzel: Schrecker: Anhalt (1906)
24
Schwinges, Rainer C.: Artisten und Philosophen, in: Artisten und Philosophen, hg. von
Schwinges, Rainer C., Basel 1999 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für
Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 1), S. 1-6.
Kürzel: Schwinges: Artisten und Philosophen (1999)
Schwinges, Rainer C.: Erfurts Universitätsbesucher im 15. Jahrhundert. Frequenz und
räumliche Herkunft in: Erfurt. Geschichte und Gegenwart hg. von Weiß, Ulman,
Weimar 1995 (Schriften des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von
Erfurt 2), S. 207-222.
Kürzel: Schwinges: Erfurt (1995)
Seyboth, Reinhard: Die Markgraftümer Ansbach und Kulmbach unter der Regierung
Markgraf Friedrichs des Älteren (1486-1515), Göttingen 1985 (Schriftenreihe der
Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 24).
Kürzel: Seyboth: Markgraftümer (1985)
Sottili, Agostino: Peter Knorr rettore della Facoltà giuridica pavese, in: Annali dell'Istituto
storico italo-germanico in Trento 5 (1979), S. 55-62.
Kürzel: Sottili: Peter Knorr rettore (1979)
Spangenberg, Hans: Hof- und Zentralverwaltung der Mark Brandenburg im Mittelalter,
Leipzig 1908 (Veröffentlichungen des Vereins für die Geschichte der Mark
Brandenburg, 11).
Kürzel: Spangenberg: Hof- und Zentralverwaltung (1908)
Stievermann, Dieter: Die gelehrten Juristen der Herrschaft Württemberg im 15. Jahrhundert,
in: Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, hg. von Schnur,
Roman, Berlin 1986, S. 229-271.
Kürzel: Stievermann: Württemberg (1986)
Stölzel, Adolf: Die Entwicklung der gelehrten Rechtsprechung untersucht auf Grund der
Akten des Brandenburger Schöppenstuhls, Berlin 1901.
Kürzel: Stölzel: Gelehrte Rechtsprechung (1901)
Stölzel, Adolf: Die Entwicklung des gelehrten Richtertums in deutschen Territorien. Eine
rechtsgeschichtliche Untersuchung mit vorzugsweiser Berücksichtigung der
Verhältnisse im Gebiete des ehemaligen Kurfürstenthums Hessen, Stuttgart 1872.
Kürzel: Stölzel: Gelehrtes Richtertum (1872)
Streich, Brigitte: Zwischen Reiseherrschaft und Residenzbildung. Der wettinische Hof im
späten Mittelalter, Köln 1989 (Mitteldeutsche Forschungen, 101).
Kürzel: Streich: Reiseherrschaft (1989)
Thumser, Matthias: Hertnidt vom Stein, in: Fränkische Lebensbilder 15, Würzburg 1993
(Neue Folge der Lebensläufe aus Franken VII A), S. 1-16.
Kürzel: Thumser: Hertnidt vom Stein II (1993)
Thumser, Matthias: Hertnidt vom Stein (ca. 1421-1491), Bamberger Domdekan und
markgräflich-brandenburgischer Rat. Karriere zwischen Kirche und Fürstendienst,
Neustadt an der Aisch 1989 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische
Geschichte IX. Reihe. Darstellungen aus der fränkischen Geschichte, 38).
Kürzel: Thumser: Hertnidt vom Stein I (1989)
Verger, Jacques: Grundlagen, in: Geschichte der Universität in Europa 1, hg. von Rüegg,
Walter, München 1993, S. 49-80.
Kürzel: Verger: Grundlagen (1993)
25
Wagner, Friedrich: Kanzlei- und Archivwesen der fränkischen Hohenzollern von Mitte des
15. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, in: Archivalische Zeitschrift 10 (1885), S. 18-
53.
Kürzel: Wagner: Kanzlei Hohenzollern I (1885)
Wegele, Franz Xaver von: Geschichte der Universität Wirzburg, Würzburg 1882.
Kürzel: Wegele: Wirzburg (1882)
Wendehorst, Alfred: Das Stift Neumünster in Würzburg 1989 (Germania sacra. Die Bistümer
der Kirchenprovinz Mainz. Das Bistum Würzburg, NF 26).
Kürzel: Wendehorst: Neumünster (1989)