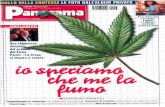Fotografische Gedächtnisse. Ein Panorama medienwissenschaftlicher Fragestellungen
-
Upload
uni-marburg -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Fotografische Gedächtnisse. Ein Panorama medienwissenschaftlicher Fragestellungen
JENS RUCHATZ
Fotografische Gedächtnisse. Ein Panorama medienwissenschaftlicher
Fragestellungen
I. Wozu eine Medienwissenschaft des Gedächtnisses?
Wenn ich mit der Frage einsteige, wozu Medienwissenschaft überhaupt erforder-lich sei, so ist dies keineswegs nur kalkulierte Provokation, sondern durchaus ernst gemeint. Denn man wird wohl zugestehen müssen, dass sich Medienwissen-schaft kaum auf einen exklusiven Gegenstand oder zumindest eine ureigene Me-thode stützen kann.1 Beschäftigt man sich etwa mit den Konsequenzen des Buchdrucks für die Literatur, dann bewegt man sich zugleich auf dem Gebiet der Literaturwissenschaft – das trifft nicht zuletzt auf die Medientheorie des Litera-turwissenschaftlers Marshall McLuhan zu, dessen Thesen sich nicht von ungefähr auf literarische Quellen stützen.2 Auch die Operation, die vermutlich den Kern medienwissenschaftlicher Arbeit ausmacht, nämlich der Medienvergleich, ist längst vielerorts gang und gäbe. Man kann konstatieren, dass der Unterschied, den ein jeweiliges Medium macht, sich nur im diachronen oder synchronen Ver-gleich ergibt.3 Immer schon, wenn neue Optionen das etablierte Gefüge der Me-dien in Unordnung brachten, wurde das neue Medium über Bezugnahme auf vergleichbare Medien zugleich identifiziert und in das System integriert. Das betrifft paradigmatisch schon den von Platon angestellten Vergleich von Oralität
_____________ 1 Man könnte hier auch das von Joseph Vogl und Lorenz Engell vorgeschlagene erste medientheo-
retische „Axiom“ zur Begründung heranziehen, „daß es keine Medien gibt, keine Medien jeden-falls in einem substanziellen und historisch stabilen Sinn“ (dies.: „Vorwort.“ In: Claus Pias et al. [Hrsg.]: Kursbuch Medienkultur. Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard. Stuttgart: DVA 1999, 10). Es ließe sich daraus folgern, dass es ohne Gegenstand Medien auch keine Medienwis-senschaft geben könne – oder aber, dass deren vordringlichste Aufgabe sei, ihren Gegenstand zu-nächst selbst zu konstruieren und sodann die Tragfähigkeit und Produktivität des Konstrukts zu belegen.
2 So wird etwa Shakespeares Werk als Kompendium für medienwissenschaftliche Studien empfoh-len; vgl. Marshall McLuhan: Die magischen Kanäle. Understanding Media. Dresden/Basel: Verlag der Kunst 1994, 24-26.
3 Vgl. Jürgen Fohrmann: „Der Unterschied der Medien.“ In: Transkriptionen 1, März 2003, 2-7.
Jens Ruchatz 84
und Literalität,4 aber gleichermaßen die hier als Referenzmedium in den Mittel-punkt gestellte Fotografie, die zu älteren visuellen Medien in Kontrast tritt. In diesem Zusammenhang ziehe ich nicht in Zweifel, dass es Sinn macht, ‚Medien‘ im Vergleich zu untersuchen, sondern vielmehr dass dieser Sachverhalt schon per se ein eigenes Fach oder gar eine eigene Disziplin erforderte oder begründete.
Es steht also zu prüfen, welche spezifische Leistung eine Medienwissenschaft erbringen kann, was sie beispielsweise zur Frage nach den Medien des kollektiven Gedächtnisses beizusteuern vermag: Meines Erachtens kann es nur darum gehen, jene Kompetenz einzubringen, die aus der Spezialisierung auf eine bestimmte Art von Fragestellung erwächst. Als Medienwissenschaftler operiert man eben nicht nur manchmal, sondern konstitutiv im Modus des Medienvergleichs und kann dabei auch ausdifferenzierteste Vergleichoptionen erproben, die – sagen wir ein-mal –Techniken des Wahrnehmens, Speicherns und Übertragens voneinander abheben. Im Unterschied etwa zur Literaturwissenschaft betreibt eine in diesem Sinn verstandene Medienwissenschaft nie einzelmedienimmanente Analyse, son-dern kontrastiert stets Formen, Praktiken und Effekte in Abhängigkeit von dem, was jeweils als Medien zugrunde gelegt wird.5 Sie definiert sich demnach auch nicht – was lange als bequemer Ausweg erschien – durch die Zuständigkeit für diejenigen Bereiche der Kulturproduktion, die nicht bereits von anderen Fächern abgedeckt werden, namentlich Film und Fernsehen, sondern beobachtet, wie diese Medien im Zusammenhang zu anderen stehen. Medialität ist das, was sich als gemeinsame komparative Plattform zwischen Medien ergibt. In genau diesem Sinn kann es nur einen differenztheoretischen, einen offenen Medienbegriff ge-ben, der nicht einen fest umrissenen Kanon von Medien kennt, sondern einrech-net, dass das, was als die Medien angesprochen wird, auf dem Weg des Vergleichs überhaupt erst erzeugt wird.6
Kultur ist der Bereich, den die Medienforschung aus guten Gründen bisher als ihr Kerninteresse betrachtet hat.7 Wenn Kultur stets eine Kultur der Unter-_____________ 4 Vgl. Irmela Schneider: „Zur Konstruktion von Mediendiskursen. Platons Schriftkritik als Paradig-
ma.“ In: Angela Krewani (Hrsg.): Artefakte/Artefiktionen. Transformationsprozesse zeitgenössischer Litera-turen, Medien, Künste, Architekturen. Heidelberg: Winter 2000, 25–38.
5 Etwas spezifizieren lässt sich die Art des Vergleichs dadurch, dass dabei von dem Medium als „loser Kopplung“ von Elementen ausgegangen wird, in das sich – selektiv und durch das verfüg-bare Elementrepertoire restringiert – Formen als strikt gekoppelte Elemente einprägen. Wahr-nehmbar wäre dabei nur die jeweils aktualisierte enge Kopplung der Form, das Medium hingegen nur indirekt – etwa auf dem Weg des Vergleichs – zu erschließen. Zu dieser Medium/Form-Unterscheidung vgl. Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1997, 190-202.
6 Vgl. ausführlicher Jens Ruchatz: „Konkurrenzen – Vergleiche. Die diskursive Etablierung des Felds der Medien.“ In: Irmela Schneider & Peter Spangenberg (Hrsg.): Medienkultur der 50er Jahre(= Diskursgeschichte der Medien nach 1945. 1). Opladen: Westdeutscher Verlag 2002, 137-153.
7 Zur Konvergenz von Medien- und Kulturwissenschaft vgl. Hartmut Böhme, Peter Matussek & Lothar Müller: Orientierung Kulturwissenschaft. Was sie kann, was sie will. Reinbek: Rowohlt 2000, 179-
Fotografische Gedächtnisse 85
schiede ist, nach Dirk Baeckers Konzeption also dort entsteht, wo bestimmte kollektive Praktiken und Formen durch Vergleich mit andersartigen als kontin-gent gesetzt werden,8 dann hätte sich die anvisierte Medienwissenschaft damit zu beschäftigen, welche dieser Varianzen auf den Gebrauch unterschiedlicher Me-dien zurückzurechnen sind. Dabei ist zunächst einmal egal, ob man diese Konse-quenzen dem intentionalen Zugriff auf medial eröffnete Möglichkeiten oder der determinierenden Kraft einer als zweite Natur auftretenden Technik zuschreibt.9
Das von mir angekündigte „Panorama medienwissenschaftlicher Fragestel-lungen“ wird sich folglich auf dem Terrain einer vergleichenden Kulturwissen-schaft bewegen und dabei transdisziplinär verfügbares Wissen organisieren, das sich produktiv machen lässt, um am Exempel der Fotografie ein mögliches Ver-hältnis von Medien und Gedächtnis auszumalen. Für diesen Überblick wird es also darum gehen, verschiedenste Texte als medienwissenschaftliche Beiträge zu lesen, die sich mit der medialen Verfasstheit – kollektiver wie individueller – Gedächtnisse beschäftigen. Einen unhintergehbaren Nexus von Medien und kollektiven Gedächtnissen hat Aleida Assmann beobachtet, wenn sie in An-schluss an Pierre Nora feststellt, „daß weder Kollektivseele noch objektiver Geist hinter dem Gedächtnis der Gruppe steckt, sondern die Gesellschaft mit ihren Zeichen und Symbolen. Über die gemeinsamen Symbole hat der einzelne teil an einem gemeinsamen Gedächtnis und einer gemeinsamen Identität.“10 Lokalisiert man kollektive Gedächtnisse in Zeichen, dann kommen unweigerlich Medien ins Spiel, erfordert jedes aktualisierte Zeichen doch ein Medium, auf dessen Basis es sich als Form überhaupt erst konstituieren kann. In kleinen, homogenen Grup-pen, die einen Erfahrungshorizont teilen, der nicht ständig untereinander kom-munikativ abgeglichen werden muss, mag Mediengebrauch zur Sicherung der kollektiven Identität auf wenige Anlässe beschränkt bleiben. Große Kollektive, die nicht mehr unmittelbar interagieren können, müssen hingegen verstärkt medi-alen Aufwand betreiben, um sich eine gemeinsame Vergangenheit zu verschaffen, auf deren Fundament die gegenwärtige Identität der Gruppe sich begründen lässt. Berücksichtigt man darüber hinaus die „konstitutionelle Medialität“ auch indivi-
202; Siegfried J. Schmidt: Kalte Faszination. Medien, Kultur, Wissenschaft in der Mediengesellschaft. Wei-lerswist: Velbrück 2000.
8 Vgl. hierzu Dirk Baecker: Wozu Kultur? Berlin: Kadmos 2001 [2000]. Die radikal differenztheoreti-sche Konzeption von Medien lässt sich mit der analogen Konzeption von Kultur engführen.
9 Auch wenn man Medien als wesentliches Fundament von Kultur ansieht, wäre es meiner Ansicht nach falsch, Medien selbst außerhalb der Kultur zu stellen, unterliegen sie doch selbst in Genese wie Implementierung und Ausformung kulturellen Faktoren. Technik mag im einzelnen wie insge-samt als System nicht vollständig kulturell verfügbar sein – sie zeitigt unkalkulierbare Folgen, kul-turelle Ansprüche reiben sich an ihrer Materialität – und doch ist sie nicht Gegenspieler, sondern Mitspieler der Kultur.
10 Aleida Assmann: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: Beck 1999, 132.
Jens Ruchatz 86
dueller Gedächtnisse, wie Vittoria Borsò unlängst angemahnt hat,11 dann sind wir endgültig bei der universalen Aussage angelangt, dass Gedächtnis immer etwas mit Medien zu tun hat, wie auch Kultur immer etwas mit Medien zu tun hat – und letztendlich nicht viel schlauer als zuvor, wenn wir uns nicht an die Erfor-schung konkreter Fälle begeben. Ich möchte gleichwohl zunächst auf der allge-meinen Ebene verbleiben, dabei aber einen anderen Weg einschlagen und von den Medien statt von der individuellen wie kulturellen Erfordernis der Identitäts-sicherung ausgehen.
II. Externalisierung
Grundsätzlich scheint es zwei unterschiedliche Modelle zu geben, Medien auf Gedächtnis zu beziehen: Externalisierung und Spur. Externalisierung ist die traditi-onelle und gewissermaßen wörtliche Konzeption von Medien als Gedächtnis. Ein Medium wird dabei selbst als Gedächtnis oder zumindest als Träger von Ge-dächtnisinhalten angesehen. Diese Annäherung äußert sich sinnfällig in der ‚Wanderung‘ von Metaphern, in der sich Medien und das so genannte natürliche Gedächtnis wechselseitig erhellen. Beziehen wir uns auf das Beispiel der Fotogra-fie, so ist hier an vorderster Stelle die berühmte Formulierung des Bostoner Arz-tes und Schriftstellers Oliver Wendell Holmes anzuführen, der 1859 formuliert, bei der Fotografie handele es sich um einen Spiegel mit Gedächtnis, einen „mir-ror with a memory“.12 Noch konkreter zur Analogie des menschlichen und des fotografischen Vermögens bekennt sich Sigmund Freud in Das Unbehagen in der Kultur: Der Mensch habe mit der „photographischen Kamera [...] ein Instrument geschaffen, das die flüchtigen Seheindrücke festhält,“ wie mit dem Fonografen einen Apparat, der Analoges für das Akustische leiste, und somit „im Grunde Materialisationen des ihm gegebenen Vermögens der Erinnerung, seines Ge-dächtnisses“ konstruiert.13
Im selben Maße wie die Fotografie als gedächtnisförmiges Bildmedium kon-zipiert worden ist, hat man das menschliche Gedächtnis durch die Linse der Fo-tografie betrachtet. „Nach 1839“, dem Jahr der Publikation des fotografischen
_____________ 11 Vgl. Vittoria Borsò: „Gedächtnis und Medialität. Die Herausforderung an die Alterität. Eine
medienphilosophische und medienhistorische Perspektivierung des Gedächtnis-Begriffs.“ In: Dies. et al. (Hrsg.): Medialität und Gedächtnis. Interdisziplinäre Beiträge zur kulturellen Verarbeitung europäi-scher Krisen. Stuttgart: Metzler 2001, 23-53, 25.
12 Oliver Wendell Holmes: „The Stereoscope and the Stereograph.“ [1859] In: Beaumont Newhall (Hrsg.): Photography. Essays & Images. London 1980, 53-62, 54. Die Rede vom Spiegel ist hier nicht nur eine Metapher für exakte ‚Repräsentation‘, sondern bezieht sich auf die reflektierende metalli-sche Oberfläche der Daguerreotypien.
13 Sigmund Freud: „Das Unbehagen in der Kultur.“ [1930] In: Ders.: Gesammelte Werke. Hg. von Anna Freud. Bd. 14. London/Frankfurt a.M.: Imago/Fischer 1948, 419-506, 449-451.
Fotografische Gedächtnisse 87
Verfahrens, so analysiert Douwe Draaisma in seiner Ideengeschichte der Ge-dächtnisforschung, „wurde das menschliche Gedächtnis eine lichtempfindliche Platte, präpariert für die Aufnahme, Fixierung und Reproduktion visueller Erfah-rung.“14 Nicht weniger aufschlussreich ist die populäre Floskel vom „fotografi-schen Gedächtnis“, das alles – selbst unbedeutende Details – verlässlich aufzu-bewahren vermag. Die Psychologie folgt dieser metaphorischen Rede nur ungern, sondern spricht dort, wo sie sich mit dem ominösen Phänomen beschäftigt, dass Wahrnehmungseindrücke beim erinnernden Abruf wieder als Wahrnehmungs-eindrücke erlebt werden, lieber von eidetischen Bildern.15 Zugleich hat die expe-rimentelle Psychologie aber die Fotografie – wie die anderen Speichermedien auch – zu einem Kontrollorgan gemacht, vor dessen materieller Stabilität sich das menschliche Erinnerungsvermögen nicht nur überhaupt erst erweisen kann, son-dern in einem gewissen Sinn auch beweisen muss.16
Parallel zum Argument, dass sich Medien und ‚natürliches‘ Gedächtnis ge-genseitig Modell stehen, lässt sich das Konzept der Externalisierung – in funktio-nalistischer Hinsicht – auch kultur- und menschheitsgeschichtlich untermauern. Eine entsprechende These knüpft sich bereits an den Umbruch von Mündlichkeit zur Schriftlichkeit, seit dem Wissen, das bislang neuronal gebunden für den Wie-dergebrauch bereitgehalten werden musste, nun materiell gespeichert diachron wie synchron kursieren kann. Die Folgen sind vielfach diskutiert worden. Für den französischen Anthropologen André Leroi-Gourhan, beispielsweise, ist die tech-nische „Exteriorisierung“ des Wissens die Grundlage für die kulturelle Evolution des Menschen schlechthin: Kenntnisse werden akkumulierbar und so erst im Vergleich verschiedener Perspektiven kritisierbar.17 Aus kulturhistorischer Warte wird mit der Verfügbarkeit externer Speicher die Ausdifferenzierung eines ‚Funk-tionsgedächtnisses‘ angesetzt, dass sich per Selektion aus einem weitaus größeren
_____________ 14 Douwe Draaisma: Die Metaphernmaschine. Eine Geschichte des Gedächtnisses. Darmstadt: Primus 1999,
124. 15 Vgl. Norma E. Cutts & Nicholas Moseley: „Notes on Photographic Memory.“ In: The Journal of
Psychology 71,1 (1969), 3-15, 5: „The general conclusion of the present writers is that there is no such thing as photographic memory in the literal sense of taking a snapshot of a page and filing it in the mind like a photographic print which can be examined at will“; Eric Schwitzgebel: „How Well Do We Know our Own Conscious Experience? The Case of Visual Imagery.“ In: Journal of Consciousness Studies 9 (2002), Nr. 5/6, 35-53, 44: „[…] eidetic imagery, sometimes popularly (but in the view of many theoreticians inaccurately) referred to as ‚photographic memory‘“ .
16 Zu einer psychologischen Perspektive auf Medien des kollektiven Gedächtnisses vgl. den Beitrag von Gerald Echterhoff in diesem Band.
17 Vgl. André Leroi-Gourhan: Hand und Wort. Die Evolution von Technik, Sprache und Kunst. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1980, 273-295 u. 321-332. Implizit werden orale, tendenziell speicherfreie Gesell-schaften damit als defizitär beschrieben; vgl. hier Erhard Schüttpelz: „Das ungeschriebene Gesetz der mündlichen Gesellschaft. Eine Variante der Schrift vor der Schrift.“ In: Claudia Liebrand & Irmela Schneider (Hrsg.): Medien in Medien (= Mediologie. 6). Köln: DuMont 2002, S. 138-153.
Jens Ruchatz 88
Möglichkeitsraum des ‚Speichergedächtnisses‘ speisen kann.18 Die Geschichte medialer Gedächtnisse ist in diesem Sinn die Geschichte des externalisierten Wissens.
Fotografien, die ferne Welten oder vergangene Ereignisse und Lebenswelten zeigen, scheinen sich in dieses Szenario genauso einzufügen wie Knipseraufnah-men, die zur Erinnerung an Urlaubsreisen aufgenommen werden. Sie erleichtern die Akkumulation und Zirkulation von Wissen. Es gibt allerdings ein gewisses Widerstreben, die analogen Aufzeichnungsmedien Fotografie, Fonografie und Film in die Geschichte der Gedächtnismedien einzugliedern: in den einschlägigen Darstellungen folgt auf die Epoche der Buchkultur üblicherweise unmittelbar das Zeitalter der elektronischen Gedächtnisse.19 Das derart implizierte Unbehagen scheint daraus zu resultieren, dass die analogen Medien nicht ohne weiteres als Externalisierung von Gedächtnisbeständen angesprochen werden können. Ge-danken, die schriftlich oder in Druckform strukturiert und verbreitet werden – seien es Einkaufszettel, Vorlesungsskripte, Memoiren oder Gedichtbände –, lassen sich ohne viel Mühe als gedächtnisförmig auffassen. Wie aber verhält sich die Sachlage bei den analogtechnischen Medien, die physikalische Reize aufzeich-nen, ohne dass menschliche Subjektivität interveniert? Will man dabei im Bild der Externalisierung bleiben, so wäre hier nicht nur das Behalten, sondern auch das Wahrnehmen externalisiert. Siegfried Kracauer hat diesen Unterschied zwischen dem fotografischen und dem menschlichen Gedächtnis wie folgt beschrieben: „Die Photographie erfaßt das Gegebene als ein räumliches oder zeitliches Konti-nuum, die Gedächtnisbilder wahren es, insofern es etwas meint.“20 Die Fotografie unterscheidet sich vom menschlichen Gedächtnis also nicht allein darin, dass sie – wie das Speichermedium Schrift vor ihr – das einmal Eingespeicherte unverän-derlich bewahrt, sondern mehr noch darin, dass sie den Menschen schon bei der Einspeicherung – bei der Selektion des Erinnernswerten – zu umgehen scheint.
Zu Recht wird immer wieder daran erinnert, dass Motiv, Augenblick und Bildausschnitt, Belichtungsdauer und Blendenöffnung, Objektiv und Filmmaterial von der Person gewählt werden, die den Apparat bedient. Es bleibt dennoch dabei, dass das Bild selbst nicht vom Fotografen erzeugt wird, sondern von der chemischen Schicht und der Konstellation der auf sie treffenden Lichtstrahlen. In Kooperation mit der Fotochemie wird das Bild gewissermaßen von dem abgebil-deten Ereignis erzeugt, so wie ein Fuß im ‚Medium‘ Sand einen Abdruck hinter-
_____________ 18 Vgl. Aleida Assmann & Jan Assmann: „Das Gestern im Heute. Medien und soziales Gedächtnis.“
In: Klaus Merten et al. (Hrsg.): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswis-senschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag 1994, 114-140, 121-127.
19 Vgl. kritisch hierzu Hartmut Winkler: Medien – Speicher – Gedächtnis [1994]. www.uni-paderborn.de/~winkler/gedacht.html (Stand: 28.10.2003).
20 Siegfried Kracauer: „Die Photographie.“ In: Ders.: Das Ornament der Masse. Essays. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1977 [1963], 21-39, 25.
Fotografische Gedächtnisse 89
lässt. Das Bestreben insbesondere der Kunstfotografen geht dahin, so vertraut mit diesen Prozessen zu werden, dass sie das komplette Bildergebnis bereits vor dem Motiv ‚prä-visualisieren‘ können.21 Weil aber die Bildgenese selbst ohne menschlichen Zugriff abläuft, bleiben zumindest zwei Dinge, die kein Fotograf vollständig meistern, unter Kontrolle bringen kann: das ist zum einen die Fülle der Details, die sich ins Bild einschreiben, einfach weil sie da sind, ob sie der Fotograf beachtet oder nicht, zum anderen die Zeitspanne der Belichtung, die erst nach der Entscheidung abzudrücken einsetzt, so dass man nie mit letzter Gewissheit kalkulieren kann, was sich während der Öffnung des Verschlusses im Bildfeld wirklich zuträgt. In diesen Unkalkulierbarkeiten und Zufälligkeiten, die jeder Erwartungssicherheit entgegenlaufen, offenbart sich deutlich ein Unter-schied zwischen manuell-kognitiver und analog-registrierender ‚Einspeicherung‘.
III. Spur
Für den spezifischen Vergangenheitsbezug analogtechnischer Bilder, der diese dauerhaft an die singuläre Situation ihrer Entstehung rückbindet, scheint mir als zweiter Typ medialen Gedächtnisbezugs das Konzept der ‚Spur‘ angemessen. Das Medium ist dabei – anders als im Fall der Externalisierung – keineswegs selbst Spur, sondern nur eine technisierte und standardisierte Möglichkeit, dauerhafte Spuren zu erzeugen. Das spezifische Verhältnis der Spur zur Vergangenheit be-steht darin, dass sie nicht als Repräsentation, sondern als Resultat vergangenen Geschehens angesehen wird. Sie zeigt insofern genau jenes singuläre, punktuelle Ereignis an, das sie hervorgebracht hat.
Weil Spuren im Gang der Ereignisse grosso modo unintendiert hervorgebracht werden, gelten sie als unvermittelte und damit besonders authentische Zeugnisse des Vergangenen. Doch jede Spur ist schon, sobald sie identifiziert und gedeutet wird, aus der Sphäre des Authentisch-Ursprünglichen in die Kultur zurückge-kehrt. Mag dasjenige, was man als Spur ansieht, selbst direktes Ergebnis vergan-genen Geschehens sein, so mobilisiert die ‚Lesbarmachung‘ von Spuren der Ver-gangenheit ein Höchstmaß gegenwärtigen Wissens. Im Gegensatz zu konventionellen Zeichen, die in einem bestimmten erwartbaren Rahmen auftau-chen, muss eine Spur zunächst einmal überhaupt als ‚Bedeutungsträger‘ identifi-ziert und von einer Umgebung abgehoben werden, die nicht als Spur gelten soll. Grundsätzlich ist eine solche Unterscheidung nur möglich, wenn ein bestimmtes Erkenntnisinteresse als Leitlinie verfügbar ist, denn was als Spur, was als Hinter-grund fungiert, ist relativ. Spuren sind also weit davon entfernt, unschuldige
_____________ 21 Zur Idee der ‚Prä-Visualisierung‘ vgl. Jens Ruchatz: „Die Chemie der Kontingenz. Zufall in der
Fotografie.“ In: Natalie Binczek & Peter Zimmermann (Hrsg.): Eigentlich könnte alles auch anders sein.Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König 1998, 199-223, 221.
Jens Ruchatz 90
Überbleibsel der Vergangenheit zu sein, sondern werden – im Sinne einer konsti-tutiven Nachträglichkeit – aus den Interessen und mit den Verfahren der jeweils interpretierenden Gegenwart erst erzeugt.
Spuren, das ist der zweite Einwand gegen die Authentizitätsemphase, werden zwar nicht durch einen Code erzeugt, sie müssen aber erst durch einen Code oder funktional äquivalentes Wissen lesbar gemacht werden. Richtiggehende Lektüre-codes sind von spezialisierten Spurenlesern nur in Ausnahmefällen erstellt wor-den. So erlernen Jäger beispielsweise, aus Trittspuren routinemäßig die Art und typischen Eigenschaften eines Tieres zu erkennen. Diese Kodifizierung des Wis-sens ist jedoch nur möglich, weil dabei von der absoluten Einzigartigkeit des gefolgerten Ereignisses abgesehen wird. Auch Spurenlesen im strengen Sinn, d.h. die Rekonstruktion des einmaligen und spezifischen Geschehens, das die jeweilige Spur hervorgebracht hat, kommt nie darum herum, die Singularität des Ereignis-ses zu normalisieren, ist man für die Deutung doch stets auf verallgemeinertes Wissen angewiesen, das sich auf den spezifischen Fall anwenden lässt.
Fotografische Spuren nehmen hier in gewissem Sinne eine Sonderstellung ein, denn ihr Spezifikum kann darin gesehen werden, dass sie – in Peirce’scher Terminologie gefasst – nicht allein ein vergangenes Ereignis indexikalisch anzeigen, sondern dieses zugleich ikonisch abbilden.22 Genau genommen geht eine Fotogra-fie auf zwei gekoppelte, aber nicht aufeinander abbildbare Ereignisse zurück: einerseits das Auslösen, das sich nur vermittelt in das Bild einschreibt, anderer-seits das Geschehen vor dem Objektiv, das als zweiter ‚Ursprung‘ auf dem Bild fixiert wird.23 Genau dies formuliert Roland Barthes mit seiner berühmten Fest-stellung, der Wesenskern, das noema, einer Fotografie bestehe in dem Bewusstsein, „cela a été là“ – oder „[e]s ist so gewesen“, wie es in der deutschen Übersetzung heißt.24 Doch auch, wenn die Fotografie den Informationsgehalt der Spur iko-nisch anreichert, bleibt die ‚Lesbarkeit‘ allzu oft blockiert, denn das auf dem Bild Sichtbare ist in aller Regel nur aufwändig zu rekonstruieren. Damit gilt auch hier: Das absolut Konkrete, das der Spur eigentlich anhaftet, wird im Prozess der Deutung unausweichlich relativiert – es sei denn, der Spurenleser war selbst Zeu-ge des Geschehens und gebraucht die fotografische Spur lediglich als Anlass zur Erinnerung.
Auch wenn der Authentizitätsanspruch von Spuren kulturell zu relativieren ist, bleiben sie unter dem Gesichtspunkt der Zeitlichkeit doch eine beunruhigen-
_____________ 22 Zur Anwendung der Peirce’schen Zeichentypologie auf die Fotografie vgl. Philippe Dubois: Der
fotografische Akt. Versuch über ein theoretisches Dispositiv. Amsterdam/Dresden: Verlag der Kunst 1998, 27-57.
23 Genau genommen verweist der fotografische Abzug natürlich noch auf ein drittes Ereignis: die Herstellung des Abzugs, die im Prinzip das Fotografieren noch einmal unter anderen Parametern wiederholt.
24 Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1985, 126.
Fotografische Gedächtnisse 91
de Erscheinung. In diesem Sinn hat Barthes die Fotografie als „anthropologische Revolution“ charakterisiert, „da das Bewußtsein, das sie impliziert, ohnegleichen ist. Die Fotografie bewirkt nicht mehr ein Bewußtsein des Daseins der Sache (das jede Kopie hervorrufen könnte), sondern ein Bewußtsein des Dagewesenseins.“ Die Botschaft der Fotografie liefere somit eine irreale, „eine unlogische Verquickung zwischen dem Hier und dem Früher“.25 Die Spur verklammert Abwesendes und Anwesendes, insofern die Anwesenheit des fotografischen Bildes – selbst bei der Sofortbildkamera – die Abwesenheit des Abgebildeten impliziert: Was man auf einer Fotografie sieht, ist immer schon vergangen. Durch die ikonische Verge-genwärtigung des Abwesenden wird der Widerspruch von gewusster Vergangen-heit und wahrgenommener Gegenwart, die der Spur an sich eignet, noch einmal auf die Spitze getrieben.
Es ist diese mediuminhärente Verknüpfung von Vergangenem mit der Ge-genwart, die die Fotografie im Sinne der Spur als Gedächtnismedium beschreib-bar macht. Über das ‚surplus‘ der ikonischen Repräsentation vergegenwärtigt die Fotografie ein Ereignis in einem Bild, das indexikalisch in der Vergangenheit geerdet ist. Weil dies freilich ausdrücklich unter Umgehung von Subjektivität abläuft und sich somit vom menschlichen Erinnerungsvermögen abhebt, ist die Frage gestattet, inwiefern hier noch von Gedächtnis gesprochen werden kann. Angefangen mit Platons Schriftkritik ist diese Diskrepanz mehr oder minder gegen alle Speichermedien, denen Gedächtnisfunktionen verliehen wurden, ein-gewandt worden. Die Leistung von Gedächtnismedien kann aber nur darin be-stehen, irgendetwas anders als der Mensch zu machen – und sei es nur eine grö-ßere Menge Informationen zuverlässiger abzulegen und bereitzuhalten. Allerdings kann Fotografie nicht nur als Spur, sondern auch als Externalisierung gedächtnis-artig funktionieren. Im Gegensatz zum Gros der Spuren, die unintendiert als Nebenprodukt von Ereignissen abfallen, werden Fotografien nämlich in der Regel absichtsvoll erzeugt und dabei so konzipiert, dass sie einem imaginierten Erinnerungsbild zumindest nahe kommen. Ist die Spur eher materieller Aufhän-ger und Anlass von Erinnerung, nämlich der Rekonstruktion der Ursprungssitua-tion, so akzentuiert das Konzept der Externalisierung tendenziell eine bereits angeeignete, subjektivierte Erinnerung.
Die analogen Aufzeichnungsmedien – allen voran die Fotografie – führen folglich das Moment der Spur ein, ohne den traditionellen Modus der Externali-sierung aufzukündigen. Meiner Ansicht nach spannt sich das Feld medialer Ge-dächtnisse überhaupt zwischen den beiden Polen Externalisierung und Spur auf. Dabei wäre zu überlegen, ob das Moment der Spur – wenn auch nur als Ziel – nicht bereits älteren Medien innewohnt. Darüber hinaus ist jede medial aktuali-
_____________ 25 Roland Barthes: „Die Rhetorik des Bildes.“ In: Ders.: Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn.
Kritische Essays III. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1990, 28-46, 39.
Jens Ruchatz 92
sierte Form – jeder Text, jedes Foto, jeder Film – Spur zumindest in selbstrefe-rentieller Hinsicht: jedes konkrete mediale Kommunikationsereignis trägt an sich die Merkmale eines bestimmten Zeitpunkts der Medien- und Kulturgeschichte.26
So steht auch für die Zukunft zu vermuten, dass die Digitalisierung, die als Ende der analogtechnischen Aufzeichnung und damit auch deren Gedächtnischa-rakters verhandelt wird, das Moment der Spur nicht völlig zum Verschwinden bringen wird. Ein digitales Bild, so die technizistische Argumentation, sei nicht mehr in der Lage, die Referenz auf ein spezifisches fotografiertes Ursprungser-eignis zu garantieren, denn, was zwar noch wie eine Fotografie aussehe, könne vom Computer einfach aus verschiedensten Daten errechnet worden sein.27 Die-ses Argument verwechselt allerdings die technischen Bedingungen der Bildgenese mit den sozialen Praktiken des Mediengebrauchs. Zum einen ist die ‚Authentizi-tät‘ der Fotografie als unmanipulierbare Spur der Vergangenheit überschätzt und insbesondere vor der Folie der digitalen Fotografie massiv übertrieben worden; zum anderen bringt die simple Einführung digitaler Fotografie nicht von selbst bereits den konstatierten Vertrauensverlust in das fotografische Bild hervor.28
Fotografien wurden von jeher montiert, retuschiert oder koloriert, und eine digi-tale Aufnahme wird nicht per se als manipuliert angesehen, nur weil sie leichter zu manipulieren ist. Zu rechnen wäre am ehesten noch mit einer Umgewichtung der fotografischen Gedächtniskonzeption von der Spur hin zur Externalisierung. Eine solche Transformation ist heute jedoch kaum großflächig vollzogen.
Im Folgenden möchte ich zeigen, wie Fotografie als Gedächtnismedium zwi-schen Externalisierung und Spur changiert, je nach der Ausrichtung der Kontex-te, in die sie eingelagert wird. Dabei werde ich die Funktion der Fotografie zu-nächst im Rahmen öffentlicher Archive und Gedächtnisse, anschließend im Rahmen privater Erinnerungstätigkeit darlegen.
_____________ 26 Dies hat Hartmut Winkler sehr schön am Beispiel der Sprache dargestellt: jeder einzelne Sprechakt
trägt an sich die Spuren des Systems Sprache und wirkt umgekehrt selbst als unscheinbarer Akt wieder zurück auf das Gesamtsystem: Jeder flüchtige Sprechakt wird von der Sprachstruktur auf-bewahrt; vgl. Hartmut Winkler: Docuverse. Zur Medientheorie der Computer. München: Boer 1997, etwa 148 u. 164-172; Sybille Krämer: „Das Medium als Spur und als Apparat.“ In: Dies. (Hrsg.): Medien – Computer – Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue Medien. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1998, 73-94.
27 Solch ein Bild, so Martin Lister, „may be based on knowledge of, but not caused by, the action of light reflected by a particular object. But what it does refer to is other photographs“. (Ders.: „Photog-raphy in the age of electronic imaging.“ In: Liz Wells [Hrsg.]: Photography. A Critical Introduction.London/New York: Routledge 1997, 249-291, 260)
28 Vgl. hierzu ausführlicher Jay David Bolter & Richard Grusin: Remediation. Understanding New Media.Cambridge, Mass./London: MIT Press 1999, 105-112; Jens Ruchatz: „Realismus als dauerhaftes Problem der Fotografie. Zuschreibung versus Technikontologie.“ In: Christian Filk et al. (Hrsg.): Die dunkle Seite der Medien. Ängste, Faszinationen, Unfälle. Frankfurt a.M. et al.: Lang 2001, 180-193.
Fotografische Gedächtnisse 93
IV. Öffentliche Gedächtnisse
Schon früh in der Geschichte des Mediums erhofft man sich von der Fotografie die Bereicherung der kulturellen Archive. Als der Physiker Dominique François Arago 1839 die Leistungen des neuen Abbildungsverfahrens vor der französi-schen Deputiertenkammer preist, um für den staatlichen Ankauf des Patents zu werben, weist er unter anderem darauf hin, wie nützlich die Fotografie für Napo-leons ‚archäologischen‘ Ägyptenfeldzug gewesen wäre:
[J]edem wird die Idee einleuchten, daß die Kenntnis des fotografischen Verfahrens im Jahre 1798 uns eine große Zahl der geheimnisvollen Tafeln überliefert hätte, welche die Habgier der Araber oder der Vandalismus gewisser Reisender für immer der ge-lehrten Welt entzogen haben.29
Hätte man die Fotografie gehabt, so das Argument, dann hätte man mit wenig Aufwand ein komplettes Inventar aller ägyptischen Hieroglyphen anlegen kön-nen, und zwar „wirkliche Hieroglyphen“ statt der „fiktiven und konventionellen Zeichen“, die Napoleons Zeichner für die Description de l’Égypte geliefert hatten. Noch bevor das Medium in die Praxis einzieht, werden hier die beiden entschei-denden Eigenschaften benannt, die Fotografie bis in die Gegenwart zu einem bevorzugten Archivmedium gemacht haben: einfache Handhabung, Schnelligkeit und Preisgünstigkeit einerseits, technisch verbürgte Genauigkeit andererseits.
Bemerkenswerter scheint allerdings, dass die Fotografie quasi als Äquivalent der Realität akzeptiert wird, das den Verlust der Originale mühelos verschmerzen lässt. Die Bewahrung der Materie ist nicht mehr zwingend erforderlich, wenn die sichtbare Form gespeichert wird. Diese Feier der ikonischen Spur als perfekte Simulation hat zwanzig Jahre später der bereits genannte Holmes auf die Spitze getrieben:
Die Form ist in Zukunft von der Materie getrennt. In der Tat ist die Materie in sicht-baren Gegenständen nicht mehr von großem Nutzen, ausgenommen sie dient als Vorlage, nach der die Form gebildet wird. Man gebe uns ein paar Negative eines se-henswerten Gegenstandes, aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen – mehr brauchen wir nicht. Man reiße dann das Objekt ab oder zünde es an, wenn man will.30
_____________ 29 Dominique François Arago: „Bericht über den Daguerreotyp.“ [1839] In: Wolfgang Kemp (Hrsg.):
Theorie der Fotografie I. 1839-1912. München: Schirmer/Mosel 1980, 51-55, 51. 30 Oliver Wendell Holmes: „Das Stereoskop und der Stereograph.“ [1859] In: Wolfgang Kemp
(Hrsg.): Theorie der Fotografie I. 1839-1912. München: Schirmer/Mosel 1980, 114-119 [= auszugs-weise deutsche Übersetzung von Holmes: „The Stereoscope“ (Anm. 12)]. Es sei ergänzt, dass Holmes seine radikale Utopie auf die stereoskopische Fotografie bezieht, die über die zweidimen-sionale Information hinaus noch die Illusion des Raums gibt. Bekannt ist freilich auch die umge-kehrte Strategie, auf Basis von Fotografien dreidimensionale Wirklichkeit zu rekonstruieren. Ohne eine lückenlose fotografische Dokumentation wäre es beispielsweise nicht möglich gewesen, das St. Petersburger Bernsteinzimmer zu rekonstruieren.
Jens Ruchatz 94
Ein Gedächtnis, das materielle Form angenommen hat, dominiert demnach die Materialität der Dinge. Es ist erstaunlich, wie nah an diesem Verfahren in einigen Bereichen praktisch gearbeitet worden ist. Die französische Commission des monu-ments historiques gibt 1851 die so genannte mission héliographique in Auftrag, um in ganz Frankreich im Verfall befindliche oder zu restaurierende Baudenkmäler zu dokumentieren;31 Charles Marville fotografiert ab 1858 auf eigene Initiative die alten Pariser Stadtviertel, bevor sie dem Modernisierungsfuror von Charles Haussmann zum Opfer fallen; in den kolonialisierten Territorien sammeln die europäischen Ethnologen neben Artefakten und Beschreibungen auch zahlreiche Fotografien, um durch die Modernisierung bedrohte Kulturen noch einmal in ihrer Ursprünglichkeit festzuhalten. Die Fotografen arbeiten als Archivare für die Archäologen und Historiker von morgen.
Angesichts einer reichhaltigen Produktion fotografischer ‚Quellen‘, von de-nen einige gezielt für die Historiker der Nachwelt, die meisten aber für die Zeit-genossen angefertigt wurden, stellt sich die Frage, welche Aussagekraft ihnen in Bezug auf die Vergangenheit zugebilligt wird. Produktiv ist hier vor allem die bis heute gängige Sortierung der Quellen in Tradition und Überrest, die von Johann Gustav Droysen begründet, in der heute geläufigen Form aber am wesentlichsten durch Ernst Bernheims einflussreiches Lehrbuch der historischen Methode geprägt worden ist: „[A]lles, was unmittelbar von den Begebenheiten übriggeblieben und vorhanden ist,“ heißt es da, „nennen wir Überreste; alles, was mittelbar von den Begebenheiten überliefert ist, hindurchgegangen und wiedergegeben durch menschliche Auffassung, nennen wir Tradition.“32 Die Überreste unterteilt Bern-heim noch einmal in Überreste im engeren Sinne, faktische Überbleibsel der histori-schen Ereignisse, sowie Denkmäler oder Monumente (z.B. juristische Urkunden), die Informationen für zeitgenössische Nutzer aufbewahren, aber nicht an die Nach-welt gerichtet sind. Überreste sind als Quellen zu bevorzugen, insofern sie „un-zweifelhafte Zeugnisse der Thatsachen an sich darstellen.“ Für die „Thatsächlich-keit eines Ereignisses“ gebe es „keine festere Gewähr [...], als wenn die Berichte darüber mit den untrüglichen Spuren des Ereignisses selbst in Einklang stehen.“33
Garantieren Überreste die Tatsächlichkeit, so erfordert ihre Interpretation ihrer-seits Wissen, das nur aus Traditionsquellen bezogen werden kann.34
Es dürfte sich mittlerweile zwischen den Zeilen angedeutet haben, warum diese quellenkritische Unterscheidung hier interessiert: Gerade weil sie analog zur
_____________ 31 Vgl. Anne de Mondenard: „La Mission héliographique: mythe et histoire.“ In: Études photographiques
2 (1997), 60-81. 32 Ernst Bernheim: Lehrbuch der Historischen Methode und der Geschichtsphilosophie. 3. Aufl. Leipzig: Dun-
cker & Humblot 1903, 230. 33 Ebd., 490 u. 492. Die Fotografie erwähnt Bernheim in seinem ganzen Handbuch interessanterwei-
se nur, wo es um die verlässliche Dokumentation von Quelleneditionen geht. 34 Vgl. ebd., 561f.
Fotografische Gedächtnisse 95
Differenz von Externalisierung und Spur gebaut ist, scheint sie mir Aufschluss zu bieten, woher die immer wieder beklagten Probleme mit der Fotografie als histo-rischer Quelle herrühren. Die Fotografie macht offenkundig Schwierigkeiten, weil sie weder auf der einen noch auf der anderen Seite eindeutig zu verorten ist. Zu-gestanden, Bernheim weist mehrfach darauf hin, dass ein und dieselbe Quelle in verschiedenen Zusammenhängen einmal als Tradition, das andere Mal als Über-rest fungieren kann. Eine Fotografie kann jedoch für ein und dieselbe Fragestel-lung zugleich Überrest im engeren Sinn, Denkmal und Tradition sein: Fotografien sind intentional hergestellte Spuren eines Ereignisses und stehen daher auf der Kippe zwischen objektiver und subjektiver Verweisung.35
Doch wie nachvollziehbar ist der subjektive Einschlag überhaupt, wenn – wie im Falle der inkriminierten ‚Wehrmachtsausstellung‘ – ‚Täterfotos‘ zu ‚Opferfo-tos‘ werden können, Erinnerungsbilder an Landsertage sich in der rückblickenden Betrachtung so mühelos in einen erschütternden Beleg für soldatische Brutalität und Kriegsverbrechen verwandeln, anders gesagt: wenn die individuelle Perspek-tive scheinbar widerstandslos durch eine kollektive überschrieben wird?36 Wie kommt es andererseits, dass sich der fotografischen Interpretation des abgebilde-ten Ereignisses zum Trotz nicht geradewegs erschließt, was überhaupt passiert ist, wer was wann getan hat?37 Die Genese einer Spur zu rekonstruieren bleibt einem also auch bei der Fotografie nicht erspart – und zwar in Hinsicht auf das Abge-bildete wie den Abbildenden. Erst mit der Einlagerung der Fotografie in einen erläuternden Kontext kann bedeutsam werden, was auf einer gegebenen Fotogra-fie zu sehen ist.
Dass das Thema der Fotografie als Quelle neuerdings vermehrt auf die Ta-gesordnung geraten ist, hängt vor allem mit der umstrittenen Ausstellung Vernich-tungskrieg – Verbrechen der Wehrmacht (1995ff.) zusammen. Zweifellos wurde hier berechtigte Kritik an einem relativ sorglosen, in jedem Fall methodisch unzurei-chenden Umgang mit fotografischen Quellen geübt: einige der Fotografien zeig-ten nachweislich Verbrechen, die nicht von der Wehrmacht selbst verübt worden
_____________ 35 Cornelia Brink: Ikonen der Vernichtung. Öffentlicher Gebrauch von Fotografien aus nationalsozialistischen
Konzentrationslagern nach 1945. Berlin: Akademie Verlag 1998, 10, stellt diesen „Doppelcharakter der Fotografie“ beispielsweise an den Anfang ihrer Untersuchung zum Gebrauch historischer Foto-grafien: „Sie gelten als Abdruck der ‚Wirklichkeit‘ und als deren Interpretation.“
36 Vgl. Michael Sauer: „Fotografie als historische Quelle.“ In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 53 (2002), 570-593, 588-590; Brink: Ikonen (Anm. 35), 148-151; Detlef Hoffmann: „Private Fotos als Geschichtsquelle.“ In: Fotogeschichte 2,6 (1982), 49-58.
37 Was die Interpretation erschwert ist nicht nur der Status als Spur, sondern auch der fotografische Zeitschnitt, der die Platzierung einer Szene in einem Handlungsablauf nicht einzuschätzen erlaubt. Als realienkundliche Quelle (wie bestimmte Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgesehen haben) ist sie dagegen weitaus bequemer zu benutzen denn als ereignisgeschichtliche. Vgl. hierzu Sauer: „Fotografie“ (Anm. 36), 572-575; Jens Jäger: Photographie: Bilder der Neuzeit. Einführung in die historische Bildforschung (= Historische Einführungen. 7). Tübingen: edition diskord 2000, 72-75.
Jens Ruchatz 96
waren, einige Orte waren falsch zugeschrieben usw.38 Eine einwandfreie Beschrif-tung der Bilder erscheint umso notwendiger, als man davon ausgehen kann, dass Fotografien – als Spuren und Überreste – dazu tendieren, das ihnen Zugeschrie-bene zu authentifizieren.39 Die Vehemenz der Kritik hängt aber kaum damit zusammen, dass hier ein ansonsten vollkommen unüblicher Umgang mit den Quellen vorgenommen worden wäre, sondern vielmehr damit, dass nicht primär auf eine nach allen Seiten hin abgesicherte wissenschaftliche Geschichtsschrei-bung, sondern auf Einwirkung in das nationale Gedächtnis abgezielt wurde. Als zentrales Mittel, um diesen Schritt zu vollziehen, diente die Fotografie, die als technischer ‚Augenzeuge‘ Täter, Opfer und die Brutalität der Verbrechen an-schaulich machte.
In der Rezeption der Ausstellung wird immer wieder auf die besondere emo-tionale Beteiligung der Besucher hingewiesen, die auf den massiven Einsatz von fotografischen Bildern zurückgeführt wird.40 Vor diesem Hintergrund wird dann oft nicht mehr die im Einzelfall irreführende Beschriftung, sondern der Eigen-wert der Bilder an sich moniert. So vermerkt der Historiker Michael Sauer deut-lich missbilligend: „Die Ausstellungsmacher haben Fotografien nicht wirklich als Quellen, sondern – durch ihre massenhafte Verwendung und durch spezielle Arrangements – als Mittel zur Erzeugung von Betroffenheit und zur emotionalen Überwältigung eingesetzt.“41 Es ist demnach schlechterdings illegitim, – mit „all-zu einfachen und volkspädagogischen Intentionen“ – ein Publikum durch die anschauliche Vorführung von Gräueltaten zu einer emotionalen Reaktion auf das gesehene Geschehen herauszufordern. Lediglich als historische Quelle, beschnit-ten um möglichen suggestiven Eigenwert und eingerückt in einen verbal geregel-ten Kontext, scheinen Fotografien zur Geschichtsdarstellung legitim. Damit wird zum einen die überkommene mediale Hierarchie weiter getragen, die Bilder nur
_____________ 38 Vgl. exemplarisch den Diskussionsbeitrag Krisztián Ungváry: „Echte Bilder – problematische
Aussagen. Eine quantitative und qualitative Analyse des Bildmaterials der Ausstellung ‚Vernich-tungskrieg – Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944‘.“ In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 50 (1999), 584-595. Einen differenzierten Überblick zur Debatte bietet Miriam Y. Arani: „Und an den Fotos entzündete sich die Kritik. Die ‚Wehrmachtausstellung‘, deren Kritiker und die Neukonzep-tion. Ein Beitrag aus fotohistorisch-quellenkritischer Sicht.“ In: Fotogeschichte 22 (2002), Heft 85/86, S. 97-124.
39 Der klassische Text für dieses Argument ist Roland Barthes: „Die Fotografie als Botschaft.“ In: Ders.: Sinn (Anm. 25), 11-27, 21-24. Vgl. des weiteren Helmut Lethen: „Versionen des Authenti-schen. Sechs Gemeinplätze.“ In: Hartmut Böhme & Klaus Scherpe (Hrsg.): Literatur- und Kulturwis-senschaften. Positionen, Theorien, Modelle. Reinbek: Rowohlt 1996, 205-231.
40 Vgl. z.B. Petra Bopp: „Wo sind die Augenzeugen, wo ihre Fotos?“ In: Hamburger Institut für Sozialforschung (Hrsg.): Eine Ausstellung und ihre Folgen. Zur Rezeption der Ausstellung „Vernichtungs-krieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“. Hamburg: Hamburger Edition 1999, 198-230, 198-207.
41 Sauer: „Fotografie“ (Anm. 36), 579. Kritisch zu dieser Art von Kritik Arani: „Und an den Fotos“ (Anm. 38), 99f.
Fotografische Gedächtnisse 97
als sprachlich gebändigte Illustrationen akzeptiert, zum anderen die von Pierre Nora beklagte Kluft zwischen der wissenschaftlichen Historiografie und sozial belebten ‚Gedächtnisorten‘42 erneut zementiert. Es ist wohl kein Zufall, dass die quellenkritisch optimierte Neufassung der ‚Wehrmachtausstellung‘ sich wieder auf das sichere Terrain einer schriftzentrierten Pädagogik zurückgezogen hat.43
Gleichwohl lässt sich beobachten, dass im 20. Jahrhundert die kollektiven Vorstellungen von der Vergangenheit zunehmend durch visuelle Medien mitfor-miert werden. Als ikonische Spur – visuell suggestiv wie technisch verifiziert – taugt die Fotografie besonders dazu, affektiv aufladbares Geschehen eindrücklich zu machen. Für die ältere Vergangenheit, die bereits in den Geschichtsbüchern Einzug gehalten hat, regulieren noch die Fachhistoriker den Bilderkanon, der sich als kollektives Bildgedächtnis ausprägen soll. Die Schule ist vermutlich die wich-tigste Institution, um nicht nur das national verbindliche Geschichtswissen, son-dern auch die zugehörigen Bilder im Gedächtnis von Individuen zu implementie-ren.44 Neben dem von den Geschichtsbüchern repräsentierten kulturellen Gedächtnis, gibt es aber eine dezentrale Kollektivierung von fotografischen Ge-schichtsbildern, die sich aus der massenmedialen Zirkulation heraus als besonders einprägsam erweisen und so quasi unter der Hand zu kollektiven Wissensbestän-den werden. Gerade die Vorstellungen über zeitgeschichtliche Ereignisse werden vielfach von Bildern geprägt, die nicht systematisch als Dokument für die Archi-vierung produziert wurden, sondern als aktuelle, zeitnahe Reportagefotografie zur massenhaften Verbreitung durch Presse und Fernsehen. Auch wenn Barthes ‚Schockphotos‘ als größtenteils wirkungslos einstuft, scheinen besonders viele Bilder dieser Gattung – etwa Kriegsbilder aus Vietnam – haften geblieben zu sein, ohne dass dafür deren Urheber, Ort, Zeit und dargestellte Personen exakt be-kannt sein müssten.45
_____________ 42 Vgl. Pierre Nora: Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Frankfurt a.M. 1998 [Berlin 1990]; sowie den
Beitrag von Patrick Schmidt in diesem Band. 43 Es ist ermutigend, dass auch dieser defensive Umgang mit Bildern nicht uneingeschränkten Beifall
fand; vgl. Klaus Hesse: „‚Verbrechen der Wehrmacht – Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944‘. Anmerkungen zur Neufassung der ‚Wehrmachtsausstellung.‘ In: Geschichte in Wissen-schaft und Unterricht 53 (2002), 594-611, bes. 600-602.
44 Zu Fotos in Geschichtsbüchern für die Schule vgl. Jürgen Hannig: „Bilder, die Geschichte ma-chen. Anmerkungen zum Umgang mit ‚Dokumentarfotos‘ in Geschichtslehrbüchern.“ In: Geschich-te in Wissenschaft und Unterricht 40 (1989), 10-32. Eine radikaleres Verfahren zur Regulierung des kul-turellen Bildgedächtnisses kann man auch in der stalinistischen Praxis sehen, in Ungnade gefallene Protagonisten der Revolution per Retusche aus historischen Aufnahmen zu entfernen, vgl. Alain Jaubert: Fotos, die lügen. Politik mit gefälschten Bildern. Frankfurt a.M.: Athenäum 1989.
45 Zu denken ist hier beispielsweise an Robert Capas Tod eines spanischen Legalisten (1936), das – verse-hen mit der typographischen Anklage „Why?“ – in den 1970er und 1980er Jahren Jugendzimmer zierte. Als Anhänger der „Botschaft ohne Code“ kann Roland Barthes an dieser Art von Fotogra-fie keinen Gefallen finden, für die der Fotograf „das Grauenvolle, das er uns darbietet, fast immer überkonstruiert und durch Kontraste oder Annäherungen die intentionale Sprache des Schreckens
Jens Ruchatz 98
Es bliebe freilich zu untersuchen, wie hier die Verzweigung in Speicher- und Funktionsgedächtnis geregelt wird, wie es also dazu kommt, dass einige wenige unter der Unmenge verfügbarer Reportagebilder ausgesondert, immer wieder abgedruckt und damit möglicherweise im Bildgedächtnis von Gesellschaften46
etabliert werden. Wenn man solche fotografischen ‚Ikonen‘ befragt, wird man es wohl nicht mit dem Ikonischen und Indexikalischen der Fotografie schlechthin bewenden lassen können, sondern zentral der in diese Bildordnung eingeschrie-benen symbolischen Dimension Rechnung tragen müssen, die Kultur und techni-sches Bild verknüpft.47 Cornelia Brink hat anhand von Aufnahmen aus den Kon-zentrationslagern aufgezeigt, wie im Rahmen der Umerziehung der Deutschen ‚Ikonen‘ gezielt lanciert wurden, die im Rahmen verschiedener Ausstellungen und Buchpublikationen ihren Erziehungsauftrag erfüllen sollten.48 Mit dem Begriff der fotografischen Ikone verbinden sich neben einem „hohen Bekanntheitsgrad eine besondere emotionale Wirkung auf den Betrachter, die einige Autoren wie-derum in ihrer vermeintlichen Authentizität und/oder Symbolisierungskraft er-kennen.“49 Solche Bilder können zu zentralen Angelpunkten kollektiver Erinne-rung werden.
V. Private Erinnerung
Der Hang des Mediums Fotografie, zur Bildung – historischer – Archive zu rei-zen, sticht wohl noch deutlicher im Bereich der privaten Fotografie hervor. Das meint selbstverständlich nicht die halböffentliche Praxis der Fotoamateure, die nach tendenziell ‚zeitlosen‘ Kunstwerken strebt. Im quantitativ überschaubaren Bereich des Knipsens geht es hingegen vermutlich um nichts anderes, als die eigene Existenz zu beobachten und zu historisieren: „Im Grunde“, schreibt der Volkskundler Konrad Köstlin, „sind wir zu Historikern unserer selbst geworden.
dem Faktum hinzufügt.“ Weil dieses Pathos unsere Einschätzung vorweg nehme, tauge sie ledig-lich „zum Skandal des Grauens, nicht zum Grauen selbst.“ Roland Barthes: Mythen des Alltags.Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1964, 55-58.
46 Zum kollektiven Bildgedächtnis vgl. den Beitrag von Rolf Reichardt in diesem Band. 47 Vgl. Dubois: Der fotografische Akt (Anm. 22), 45 u. 50f. 48 So stellt Brink: Ikonen (Anm. 35), 10, die Ausgangsfrage: „Welche gesellschaftlichen Kontexte
waren notwendig, um aus der fotografischen Repräsentation der Konzentrationslager Dauerspu-ren entstehen zu lassen?“ Eine ähnliche Frage hinsichtlich der Herausbildung ‚medialer Gedächt-nisse‘ verfolgte jüngst Habbo Knoch: Die Tat als Bild. Fotografien des Holocaust in der deutschen Erinne-rungskultur. Hamburg: Hamburger Edition 2001. Als amüsantes Komplement dazu erzählt Barry Levinsons Film Wag the Dog (1997) davon, wie man aus ergreifenden Bildern einen fiktiven Krieg produzieren kann. Die kollektiv anschlussfähige Symbolik ist hier das dramatische Einzelschicksal eines jungen Mädchens.
49 Ebd., 233.
Fotografische Gedächtnisse 99
Wir selbst produzieren die Quellen zur Geschichte unseres Lebens.“50 In einer Popularisierung der Praxis des Tagebuchführens werden so auch die privaten, zukunftsoffenen ‚Archive‘ systematisch mit Fotografien gefüllt – mit ‚Denkmä-lern‘ in Bernheims Sinn, denn die in den Fotoalben versammelten Privataufnah-men adressieren die Lebenden, den Fotografen selbst, und dürften nur selten gezielt an die Nachwelt adressiert sein.
Ob der Adressat dieser Selbstdarstellung vor allem der Knipser selber ist oder eher die Familie wird verschieden nuanciert. In seiner bekannten Untersu-chung über Fotografie als „illegitime Kunst“ hat Pierre Bourdieu die Familie als Fokus der fotografischen Aktivität von Privatleuten identifiziert. Die Fotografie bezeuge bildlich die Integration der Gruppe, um ihrerseits weitere Integration zu erzeugen. Diese gruppenbezogene Funktion äußere sich deutlich darin, dass die Kamera vorwiegend zu Familienfesten, Freundestreffen oder im Urlaub heraus-geholt werde.51 Das Fotoalbum, in dem sich selbst geknipste und von Fachfoto-grafen angefertigte Bilder mischen, stabilisiert demzufolge das kollektive Ge-dächtnis der Familie.
Der Fotohistoriker Timm Starl vertritt dagegen die Position, dass das private Foto primär die Sache des Knipsers selbst sei. Schlagend ist natürlich das Argu-ment, dass auch Personen ohne engere familiäre Bindung private Fotoalben füh-ren. Darüber hinaus erweist eine statistische Auszählung von in einigen Amateur-alben versammelten Motiven keine eindeutige Betonung der familiären Ereig-nisse.52 Für Starl fungieren die Aufnahmen der Knipser als radikal subjektiveErinnerungsmarken, die sich nicht einmal für die nächsten Verwandten vollstän-dig erschließen, denn entscheidend ist nicht, wie die Bilder etwas zeigen, ja nicht einmal, was im einzelnen auf ihnen zu erkennen sein mag, sondern allein
an welche Gegebenheiten sie erinnern. [...] Selbstverständlich können andere – Fami-lienmitglieder, Freunde, Bekannte – Aufnahmen ansehen und Alben durchblättern, und auch in ihnen werden Erinnerungen wach, erwachsen aus Bildern Geschichten. Doch diese bleiben anekdotisch und verbinden sich nicht zu einem lebensgeschichtli-
_____________ 50 Konrad Köstlin: „Photographierte Erinnerung? Bemerkungen zur Erinnerung im Zeitalter ihrer
technischen Reproduzierbarkeit.“ In: Ursula Brunold-Bigler & Hermann Bausinger (Hrsg.): Hören, Sagen, Lesen, Lernen. Bausteine zu einer Geschichte der kommunikativen Kultur. Festschrift für Rudolf Schenda zum 65. Geburtstag. Bern et al.: Peter Lang 1995, 395-410, 399.
51 Vgl. Pierre Bourdieu et al.: Eine illegitime Kunst. Die sozialen Gebrauchsweisen der Photographie. Frankfurt a.M.: Europäische Verlagsanstalt 1981, 31.
52 Timm Starl: Knipser. Die Bildgeschichte der privaten Fotografie in Deutschland und Österreich. Berlin: Koeh-ler & Amelang 1995, 142-147. Der Unwillen Starls, Reisebilder, sofern sie keine Personen enthal-ten, als Familienbilder anzuerkennen, scheint mir indes zweifelhaft: Auch wenn die Familie nicht im Bild ist, knüpfen sich an das gemeinsam Gesehene kollektive Erinnerungen. Dies gilt für die Betrachtung der Urlaubsbilder im Album wie den gemeinsam verbrachten Diaabend.
Jens Ruchatz 100
chen Zusammenhang. Der Knipser dagegen betrachtet die eigene Konstruktion, die einzig enthält, was er als konstitutiv für seine Existenz erachtet.53
Die logische Folgerung aus dieser These, die sich bei der Betrachtung priva-ter Fotos schnell bestätigen wird, ist dann, dass diese Bilder für den uneingeweih-ten Betrachter kaum etwas ergeben. Das Eigentliche ist auf ihnen nicht zu se-hen.54 Zwar werden die Bilder zum Zwecke der Erinnerung angefertigt, sie sind aber noch nicht komplette Erinnerung, müssen es auch gar nicht sein, weil sie vom intendierten Betrachter, selbst wenn sie technisch nicht gelungen sein soll-ten, ohne weiteres kontextuell ergänzt werden können.55 Als Bilder eines Augen-blicks, einer gewesenen Situation, sind sie Anker für an ihnen ansetzende Erinne-rungsprozesse. Die Funktion des Bildes als Spur steht im Vordergrund, wenngleich eine gelungene Externalisierung – das gut getroffene Bild – zweifellos bevorzugt wird. Demnach setzt die Erinnerung das Foto voraus, dominiert es aber letztlich. „Der Wert des Photos“, erkennt schon der Katalog zur ersten deutschen Ausstellung privater Erinnerungsbilder, „ist allein abhängig von der Intensität der Erinnerung.“56 Als vom erinnernden Mediennutzer entworfenes Gesamtkonzept scheint der Kosmos des Fotoalbums mit seiner Auswahl von Bildern, ihrer chronologischen Ordnung und ihrer Beschriftung wieder näher am Pol der Externalisierung – zumal sich für den Urheber des Albums vermutlich seine individuelle Fassung der Lebensgeschichte zunehmend auf die von ihm geschaffene mediale Veräußerlichung ausrichtet oder darin zumindest stabilisiert.
Auch wenn Knipserfotografien sich nur ihrem Erzeuger voll erschließen, dem Uneingeweihten ihre eigentliche Bedeutung verbergen, so sind den privaten Bilderwelten doch decodierbare kollektive Ordnungen eingezeichnet. Erhellend scheint mir in dieser Hinsicht die von der Medienwissenschaftlerin Patricia Hol-land eingeführte Unterscheidung von ‚Nutzern‘ (user) und ‚Interpreten‘ (reader)
_____________ 53 Ebd., 23. 54 Zu welchen Verwicklungen es führen kann, wenn ein Fremder sich die Identität einer Familie
anhand von deren Fotografien anzueignen glaubt, demonstriert Mark Romaneks Film One Hour Photo (2002).
55 Die kulturkritische Ausspielung des mechanischen Bildes gegen die echte, lebendige Erinnerung übersieht, dass das Knipserbild gar nicht beansprucht, die komplette Signifikanz des Ereignisses sichtbar in sich zu tragen; vgl. hierzu auch die Überlegungen von Catherine Keenan: „On the Rela-tionship between Personal Photographs and Individual Memory.“ In: History of Photography 22 (1998), 60-64.
56 Heinrich Riebesehl: Photographierte Erinnerung. Ausstellungskatalog Kunstverein Hannover 1975, 21. Beschrieben wird aber auch das umgekehrte Phänomen – die Auslöschung der authentischen Er-innerung durch das technische Bild. So schreibt Barthes: Die helle Kammer (Anm. 24), 102, die Fo-tografie werde „sehr schnell Gegen-Erinnerung. Einmal sprachen Freunde über Kindheitserinne-rungen [...]; ich aber hatte gerade meine alten Photos angesehen und besaß keine mehr.“
Fotografische Gedächtnisse 101
privater Fotografien.57 Während Nutzer die ikonischen, vor allem aber die indexi-kalischen Verweisungen des fotografischen Bildes mobilisieren, um ihre individu-ellen Erinnerungen abzurufen, interessiert sich der wissenschaftliche Interpret vor allem für die symbolische Ebene, also die in die Bilder eingeschriebenen kulturel-len Codes. Es wäre zwar sträflich, von den oftmals stereotypen Posen und Anläs-sen der Knipserbilder 1:1 auf eine analoge Stereotypie des damit Erinnerten zu schließen; dennoch deuten die im kollektiven Querschnitt auffindbaren Gemein-samkeiten geradezu idealtypisch auf die kollektive Durchformung der individuel-len Gedächtnisse. Obwohl bar von ästhetischen Normierungen wird eine extreme Ähnlichkeit der Knipserbilder untereinander festgestellt.58 Das betrifft beispiels-weise bestimmte stereotype Posen, die auf Bildern zur Selbstdarstellung einge-nommen werden – wobei dies kaum als ureigene Entwicklung der eher zwanglo-sen Knipserfotografie zu werten ist, sondern als Erbe der auf Repräsentativität setzenden Atelierfotografie, die denjenigen, die sich keinen eigenen Apparat leis-ten können, bis ins 20. Jahrhundert zur Verfügung steht.59
Mehr noch gilt dies aber für die Auswahl der Anlässe, die fotografisch do-kumentiert werden. Die Parallelität betrifft nicht allein zeitgeschichtliche Erfah-rungen, die sich – wie beispielsweise die Weltkriege – erwartungsgemäß in allen Alben einer Generation wieder finden, sondern grundsätzlich die Wertigkeit der Lebensbereiche und -stationen, die bildlich dokumentiert werden. Nur bei kleinen Kindern ist mehr oder weniger das ‚ganze‘ Leben – vom Essen bis zum Stuhl-gang, vom Urlaub über den Alltag bis hin zum Schlafen – fotografiewürdig.60 Mit dem Eintritt in das Schulalter werden jedoch fast nur noch herausgehobene Er-eignisse, Feiern, Urlaub, vor allem aber die großen rites de passage dokumentiert: Erster Schultag, Abschlussfeier, Hochzeit, Kindertaufen, Begräbnisse. Eine sol-che Kanonisierung von fotografiewürdigen Ereignissen gilt nicht nur für Europa, sondern ist – freilich mit partiell anderen Stationen – ebenso in Afrika anzutref-fen61 und vermutlich auch anderswo. Bei diesen Passageriten, im besonderen bei
_____________ 57 Patricia Holland: „,Sweet is it to scan …‘ Personal photographs and popular photography.“ In: Liz
Wells (Hrsg.): Photography. A critical introduction. London/New York: Routledge 1997, 104-150, 107. 58 Vgl. Starl: Knipser (Anm. 52), 23f.: „Was die Gestaltung der Aufnahmen angeht, verfolgt der
Knipser ein einfaches Konzept. Person, Sache, Ereignis sollen möglichst im Mittelpunkt der Auf-nahme stehen, doch ist dies nicht Bedingung. [...] Deshalb ähneln sich die Aufnahmen von Knip-sern – auch jene von professionellen Fotografen und Fotokünstlern, wenn sie privat fotografieren und es ihnen lediglich ums Erinnern geht.“
59 Riebesehl: Photographierte Erinnerung (Anm. 56), 23-32, belegt anschaulich die verblüffende Stabilität bestimmter Posen über Jahrzehnte hinweg. Vgl. in dieser Hinsicht auch Helmut Höges Zusam-menstellung „Frauen am Geländer“. In: Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (Hrsg.): Dia/Slide/ Transparency. Materialien zur Projektionskunst. Berlin: NGBK 2000, 19-29.
60 Vgl. Köstlin: „Photographierte Erinnerung?“ (Anm. 50), 405. 61 Vgl. Tobias Wendl: „‚God never sleep.‘ Fotografie, Tod und Erinnerung.“ In: ders./Heike Beh-
rend (Hrsg.): Snap me one! Studiofotografen in Afrika. München et al.: Prestel 1998, 42-50.
Jens Ruchatz 102
Hochzeiten, ist das Fotografiert-Werden heute ein integraler Bestandteil des Ab-laufs selbst, ohne den die Feier nicht komplett ist. Die Fotografie spiegelt also nicht nur die Bedeutung des Ereignisses, sondern erzeugt sie mit, in dem sie die Erinnerungswürdigkeit des Geschehens signalisiert.62 In der Aktualität des Ge-schehens wird schon die künftige Erinnerung mitbedacht. Mit diesem Memorial-auftrag versehen sind die Hochzeitsbilder geradezu eine idealtypische ‚Traditions‘-Quelle, andererseits bleiben sie doch wieder als Spur auf die Anreicherung mit Bedeutung angewiesen. Selbst die von professionellen Fotografen angefertigten Erinnerungsbilder, die ebenso haltbar wie die Ehe sein sollen, können vielleicht einen Teil der Inszenierung einfangen, aber weder die Liebe des Brautpaars noch die gelungene Feier in angemessener Form wiedergeben. Für die Gäste des Fes-tes, unter denen diese Bilder später verteilt werden, sind sie vermutlich eher als Komponente des Ereignisses bedeutsam, sodass sich Sinnfülle wiederum erst in der ergänzenden Rezeption einstellt. Darüber hinaus – und hier scheint eine ganz andere Lesart bedient zu werden – dienen die Hochzeitsporträts auch als Reprä-sentation nach außen, die im Wohnzimmer präsentiert und an entferntere Ver-wandte versandt werden.63
Parallel zur visuellen Chronik der eigenen Existenz im Knipseralbum existiert im privaten Bereich eine ältere, da vor die Knipserfotografie zurückreichende Memorialfunktion von Fotografie. So heißt es in einem amerikanischen Foto-handbuch von 1863:
In the order of nature, families are dispersed, by death or other causes; friends are severed; and the ‚old familiar faces‘ are no longer seen in our daily haunts. By helio-graphy, our loved ones, dead or distant, our friends and acquaintances, however far removed, are retained within daily and hourly vision. To what extent domestic and social affections and sentiments are conserved and perpetuated by these ‚shadows‘ of the loved and valued originals, every one may judge.64
Als ultimatives Erinnerungsbild in diesem Sinn spielt das Porträt auf dem Toten-bett – die letzte Möglichkeit, das Antlitz der geliebten Person sicherzustellen – bis ins 20. Jahrhundert hinein eine wichtige Rolle.65 Fotografien fungieren in diesem
_____________ 62 Vgl. Köstlin: „Photographierte Erinnerung?“ (Anm. 50), 403: „Es ist bereits die Situation, die
durch die Photographie als anders, als besonders definiert wird. [...] Sie macht die Situationen zu besonderen Anlässen.“
63 Zum Hochzeitsbild vgl. Bertrand Mary: La photo sur la cheminée. Naissance d’un culte moderne. Paris: Éditions Métailié 1993, 143-153; Bourdieu: Eine illegitime Kunst (Anm. 51), 31-34.
64 Marcus Aurelius Root: „The Camera and the Pencil (1863).“ In: Vicki Goldberg (Hrsg.): Photogra-phy in Print. Writings from 1816 to the Present. Albuquerque: University of New Mexico Press, 148-151, 148: In dieser Funktion greift die Fotografie die Tradition der Porträtminiatur auf, demokrati-siert sie aber: „The cheapness of these pictures brings them within reach, substantially, of all.“ Vgl. auch Mary: La photo (Anm. 63), 141.
65 Vgl. Jay Ruby: Secure the Shadow. Death and Photography in America. Cambridge, Mass./London: MIT Press 1995; Mary: La photo (Anm. 63), 153-167. Hiermit wird die im 19. Jahrhundert aufgekomme-
Fotografische Gedächtnisse 103
Kontext als Ersatz für das „vermißte Zusammenleben“66, wie es Heinrich Riebe-sehl schön formuliert hat. In dieser zweiten Funktion zeigt sich besonders, in welchem Umfang die Memorialfunktion einer Fotografie durch den Rahmen ihrer Verwendung bestimmt wird. Eine Fotografie wird, so meine These, nicht als Gedächtnis geboren, sondern erst bei der Betrachtung als Spur des Vergangenen gedeutet. Erinnerung ist dann gewissermaßen die Kontextualisierung, die eine Fotografie auf ihren Zeitindex hin betrachtet.
Das Porträt des geliebten Menschen, das man auf den Kaminsims stellt oder im Geldbeutel bei sich trägt, verweist zwar auf etwas Abwesendes (denn nur in Ausnahmefällen wird man es gemeinsam mit der abgebildeten Person betrach-ten), aber dieses Abwesende wird gerade nicht primär als Vergangenes angesehen – die Betrachtung geht bei dieser Sorte von Erinnerungsbild gerade darüber weg, dass das Bild einen bestimmten Moment der Vergangenheit darstellt, sondern be-greift es als gegenwärtig möglich. Bei eigens für diesen Zweck vorgesehenen Fotogra-fien wird schon bei der Aufnahme darauf Acht gegeben, das ‚zeitarme‘ Ideal und nicht das Ereignishafte, den radikal temporalisierten Augenblick hervorzuheben.67
Kurz: Es geht hier lediglich darum, eine räumliche, nicht eine zeitliche Distanz zu überwinden – es sei denn die Spanne bis zum nächsten Zusammentreffen. Die zeitliche Dimension kann freilich beim selben Bild schon bald wieder ins Spiel kommen, wenn dasselbe Bild nun an verblasste Jugend oder eine vergangene Liebe erinnert. Auch wenn jede Fotografie auf einen bestimmten Augenblick des Ursprungs rückführbar ist, so bleibt ihre Betrachtung doch relativ unabhängig davon. Erst wenn eine Differenz zur eigenen Gegenwart beobachtet, stilistisch im Foto angezeigt oder kontextuell – sei es im Album oder durch Beschriftung – markiert wird, gerät der Zeitindex zur leitenden Komponente der Nutzung.
VI. Gedächtnismedien
Was ein Medium zum Gedächtnismedium macht, lässt sich also keineswegs aus einer Deutung der ihm zugrunde liegenden Materialität erschließen. Fotografien sind weder Spuren noch Externalisierungen in einem starken Sinn; sie werden als solche genutzt oder eben nicht. Spur und Externalisierung sind demnach Modi, Fotografien – oder andere mediale Formen – als eine bestimmte Art des Verwei-sens zu betrachten. Zwar kann man für jedes bezeichnete Medium bevorzugte
ne Tradition der Totenmaske popularisiert; vgl. Bernhard Kathan: „Totenmaske und Fotografie. Zur Verhäuslichung des Todes.“ In: Fotogeschichte 20,78 (2000), 15-26.
66 Riebesehl: Photographierte Erinnerung (Anm. 56), 24. Mary: La photo (Anm. 63), 168, spricht nicht weniger pointiert von einer „gestion des absences“.
67 Zur in dieser Hinsicht fundamentalen Zeitlogik von Pose und Momentaufnahme vgl. Thierry de Duve: „Pose et instantané, ou le paradoxe photographique.“ [1974] In: Ders.: Essais datés. I. 1974-1986. Paris: Éditions de la Différence 1987, 13-52.
Jens Ruchatz 104
Typen des Verweisens annehmen, die in der Regel zur Anwendung kommen, aber dennoch nie letztgültig festgelegt sind, so wie die Historiker ein und dieselbe Quelle wahlweise als Tradition oder als Überrest deuten können: Eine autobio-grafische Schrift kann auch als Spur des Unbewussten der Zeit oder des Verfas-sers aufgefasst werden so wie ein Foto umgekehrt als gelungene Externalisierung eines inneren Bildes oder einer vergangenen Wahrnehmung. In diesem Sinn ist Gedächtnishaftigkeit, etwa die Aufbewahrung von zeitlich indizierten Daten, an sich nur eine Funktion, die einem Medium neben anderen zugesprochen werden kann.
So unterliegt auch die Einbindung medialer Texte und Formen in kollektive oder individuelle Gedächtnisse der Pragmatik. Wenn man an der Halb-wachs’schen Denkfigur festhalten will, kann man durchaus behaupten, dass priva-te Fotoarchive durch und durch von kollektiven Organisationsprinzipien struktu-riert sind. Am sinnfälligsten zeigt sich diese Durchdringung vielleicht in der Art, in der bürgerliche Fotoalben in den 1860er und 1870er Jahren geführt wurden. In ihrer jeweils besonderen Mischung aus Bildern der Familie und des Freundeskrei-ses einerseits, einer jeweils individuellen Auswahl von gekauften Porträts promi-nenter Zeitgenossen andererseits konnte sich jeder hinreichend Wohlhabende auf eigene Art an das kollektive Bildarchiv anschließen.68 Zweifellos hängt das, was als kollektives Gedächtnis postuliert wird, aber auch davon ab, was sich bei einer zunehmenden Zirkulation von potentiell Erinnerungswürdigem überhaupt noch in die individuellen Gedächtnisse einzuprägen vermag. Diese Selektion läuft na-türlich nicht idiosynkratisch ab, sondern stets in Bezug auf die durch die individu-ellen Bewusstseinsgeschichten vorgegebenen Raster – und damit auch wieder in Bezug auf kollektive Vorgaben.
Was man mit der Medialität der Fotografie und der nachfolgenden Bildme-dien aber zweifelsfrei verbinden wird, ist eine zunehmende visuelle Komplemen-tierung und Korrektur der sprach- und schriftgebundenen Erinnerungskultur. Bildliche Darstellungen, die bewusst historisches Geschehen dokumentieren oder sich auch nur so auf ihre Gegenwart so beziehen, dass sie rückblickend als visuel-le Dokumente für die Kultur und Lebensweise ihrer Entstehungszeit betrachtet werden, gibt es natürlich schon lange, aber nie zuvor in solch einer für jeden zugänglichen Fülle. Sowohl auf die eigene als auch auf kollektive Vergangenheit kann man sich nicht mehr nur als sprachlich enkodierte, sondern auch als visuell aufgezeichnete beziehen. Die Debatte um die ‚Wehrmachtausstellung‘ kann vor diesem Hintergrund auch als Rückzugsgefecht gegen eine solche mediale Umstel-
_____________ 68 Vgl. z.B. Matthias Bickenbach: „Das Dispositiv des Fotoalbums: Mutation kultureller Erinnerung.
Nadar und das Pantheon.“ In: Jürgen Fohrmann et al. (Hrsg.): Medien der Präsenz: Museum, Bildung und Wissenschaft im 19. Jahrhundert (= Mediologie. 3). Köln 2001, 87-128, besonders 103 u. 115.
Fotografische Gedächtnisse 105
lung der kollektiven Erinnerung betrachtet werden.69 So darf man gespannt sein, wie unsere so stark visuell aufgezeichnete Gegenwart künftig erinnert werden wird und ob die Generationen, die in eine so stark bildgeprägte Kultur hineinge-wachsen sind, künftig auch retrospektiv mehr Geschichtsbilder entwerfen werden.
_____________ 69 Wie erfolgreich Bildmedien Vorstellungen über die Vergangenheit instituieren, kann man bei-
spielsweise darin sehen, dass es schon eine eigene Authentizität entwickelt, die entlegenere Ver-gangenheit schwarz-weiß darzustellen – und damit nur ein eigentliches technische Handicap als historische Wahrnehmungsweise aufzuladen.