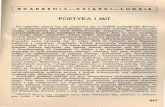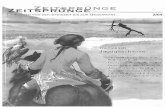Erzählen mit losen Enden. Die Bilderraeume des Meisters von Waltensburg (2015)
Transcript of Erzählen mit losen Enden. Die Bilderraeume des Meisters von Waltensburg (2015)
Unter dem Namen Waltensburger Meister wirdeine Gruppe von dreidimensionalen, begehbarenBilderräumen im nördlichen Graubünden zu-sammengefasst.1 Die Geschichte solcher Bilder -räume wurde bislang einseitig von Beispielen hergeschrieben, die einen hohen Grad an Homo -genität und Systematisierung anstreben: In derersten Hälfte des 14. Jahrhunderts waren dies die
großen Zyklen der mittelitalienischen Wand -malerei in Assisi, Padua, Florenz oder Rom. Vondieser „Avantgarde“ aus gesehen, fiel den Werkendes Waltensburger Meisters die Rolle einer Pro-vinzkunst zu, die wichtige Neuerungen spät undnur partiell übernahm und den Gestaltungs-willen der großen Lösungen vermissen ließ. Inmeinem Beitrag möchte ich dieses Zentrum-
139David Ganz
Abb. 1 Waltensburg, Pfarrkirche, Inneres Richtung Altar
Erzählen mit losen EndenDie Bilderräume des Meisters von WaltensburgDavid Ganz
Peripherie-Denken kritisch hinterfragen unddafür plädieren, die Möglichkeiten der Vertei-lung von Bildern im Kirchen raum offener undflexibler zu denken. Das Fallbeispiel, mit dem ichargumentiere, ist das namengebende Hauptwerkder Pfarrkirche Waltensburg, in deren Zentrumein Passionszyklus mit ungewöhnlichemBaumuster steht (Abb. 1).2
Offene Ränder
An der Nordwand der Waltensburger Kirchestoßen auf irritierende Weise zwei Bildkomplexeaneinander: der im Westen einsetzende Zykluszur Passion Christi und ein Heiligenprogramm,das den Ostteil der Kirche einnimmt (Abb. 2).Die beiden Komponenten der Ausmalung ver-
weisen auf verschiedene Zeitstufen im Kosmosder christlichen Heilsordnung. An der Fugezwischen ihnen kommt es zu eigentümlichenVerwerfungen: Unterschiedliche Bildhöhen,Figurenmaßstäbe und Rahmenornamente pral -len hier aufeinander. Über die Bildstreifen derPassionserzählung schiebt sich oben das Über-format einer monumentalen Versammlung vonHeiligen, darunter schließen auf geringererHöhe Ereignisse aus den Heiligenviten an. Mitihren Vor- und Rücksprüngen betonen die rotenRahmenstreifen noch die formalen Diskre -panzen zwischen den beiden Bereichen undlassen den Kompositcharakter ihrer Verbindunghervortreten.3
Die Heterogenität ist nicht das Ergebnis unter -schiedlicher Ausstattungsphasen, wie man zu-erst vermuten könnte. Beide Bildkomplexe
140 Erzählen mit losen Enden
Abb. 2 Waltensburg, Pfarrkirche, Fresken der Nordwand mit Übergang zwischen Passionszyklus und Heiligen-programm
gehören einer gemeinsamen Kampagne an, diein der Forschung dem Waltensburger Meisterzugeschrieben wird. Das macht die Bereitschaft,die verschiedenartigen Bildzonen so direkt auf-einanderstoßen zu lassen, noch irritierender:Weshalb wurde das Rahmenwerk um die Bildernicht stabiler und regelmäßiger ausgeführt?Weshalb keine breitere Bordüre an dieser Stelle,wie sie die Wandbilder horizontal gliedert undeinfasst? Ähnliche Unebenheiten, nun aber im Wortsinn,lassen sich an der Ecke zur Eingangswand be-obachten: Oben startet der Passionszyklus miteiner Ansammlung von Gebäuden, daruntereine Kirche, ein Haus, zwei hoch aufragendeTürme (Abb. 3). Unten läuft die Erzählung mitder Grablegung Christi aus, als Füllsel sind zweider charakteristischen Ornamentplatten desMeisters in den verbleibenden Zwischenraumeingeschoben (Abb. 4). Auch hier eine offene Rah-mensituation also, die nun aber auf einer Wand-fläche voller Vor- und Rücksprünge platziertwurde. Die hervorkragenden Steine sind Spureneines Vorgängerbaus, die bei der Errichtung desneuen Kirchleins im 14. Jahrhundert stehengelassen wurden. Bei einer Betrachtung des Bildesvon unten ergibt sich eine dreidimensionale, starkreliefhafte Wirkung der Fresken (Abb. 5).4 Ineinigen Bereichen führt dies zu erheblichen Ver-zerrungen der gemalten Formen. An anderenStellen bezogen die Künstler sie in ihre Kom-position ein, platzierten Dachvorsprünge odereinen Engel auf den hervortretenden Steinen usw.Auch diese Vorge hensweise gibt Anlass zu Fragen:Warum haben die Freskanten darauf verzichtet,die Mauerreste abzutragen, warum haben sie sichauf diese Störfaktoren malerischer Bildpro-duktion eingelassen?Die Ränder des Waltensburger Passionszyklussind Zonen unordentlicher, unregelmäßigerMalerei. Es wäre einfach, dies der Ungeschick-lichkeit eines provinziellen Künstlers anzulastenund sie damit als bildliches Rauschen abzutun.Mein Beitrag macht einen anderen Vorschlag:Die Unordnung an den Rändern soll als Teil
einer künstlerischen Strategie ernstgenommenwerden, die Brüche der christlichen Heils-geschichte sichtbar und im Kirchenraum erfahr-bar zu machen. Die Naht zwischen den Pas -sions bildern und dem Heiligenzyklus ist Teileiner losen Koppelung von Bildern im Raum, dieden gängigen Vorstellungen einer sakralen Bild-ordnung widerspricht.
Die Passion Christi malen
Im Zentrum der Waltensburger Ausmalung stehtdie Leidensgeschichte Christi. Die Konzentrationauf diesen Abschnitt des Christuslebens kommtnicht sonderlich überraschend in einer Epoche,die wie keine andere in den Ereignissen desLeidens und Sterbens Christi das Zentrum des
141David Ganz
Abb. 3 Waltensburger Meister, Stadtdarstellung zuBeginn des Passionszyklus. Waltensburg, Pfarrkirche
christlichen Heilsversprechens vermutete. Nichtmehr das Kreuzigungsereignis allein, sondern diegesamte Fülle des Christus widerfahrenenLeidens galt dem späten Mittelalter als Pforte zuSeelenheil und Erlösung. Unablässig undgewissermaßen auf allen Kanälen wurde das Pas-sionsgeschehen aufgerufen und reaktualisiert: inPredigten, musikalischen Darbietungen, thea-tralischen Aufführungen, in meditativer Ver-senkung, in Gebeten und nicht zuletzt auch inBildern.Ihrem passionserfahrenen Publikum boten dieWaltensburger Fresken eine Zusammenstellungder bekannten Hauptereignisse: Abendmahl,Fußwaschung, Gebet am Ölberg, Gefangen-nahme, Verhör, Geißelung, Dornenkrönung,Kreuztragung, Kreuzigung, Kreuzabnahme undGrablegung (Abb. 12).6 Auf Erweiterungen
durch selten dargestellte oder apokryphe Hand-lungsmomente wurde verzichtet. Das Anliegender Bilder war es vielmehr, die kanonischenStationen der Leidensgeschichte im Hier undJetzt des Kirchenraumes vor Augen zu stellen,„ante oculos ponere“, wie es in vielen Medi -tationsanleitungen heißt.7 Das Ziel eines solchenEvidenzeffekts bekundet sich am deutlichsten inder Kreuzigungsszene, in der alles um das Sehenkreist (Abb. 6): Mit Johannes und Maria,Stephaton und Longinus sowie dem Haupt-mann hat sich eine größere Gruppe von Be-trachtern vor Christus versammelt. Der Ausrufdes Hauptmanns – „Wahrhaftig, dieser Menschwar Gottes Sohn“ (Mk 15,39) –, der Hinweis desLonginus auf das eigene, durch das Blut des Ge-kreuzigten geheilte Auge und das in die BrustMariens gebohrte Schwert veranschaulichen die
142 Erzählen mit losen Enden
Abb. 4 Waltensburger Meister, Grablegung Christi und Ornamentfeld. Waltensburg, Pfarrkirche
enorme Wirkmacht des Anblicks Christi: dieschmerzvolle Stimulation der compassio, dieÖffnung verschlossener Augen und die Erkennt-nis der göttlichen Heilstat. Die Betrachter desGekreuzigten sind exempla für die Macht derBilder, die segensreiche Fülle des Leidens in denKirchenraum hinein verlängern zu können.Gerade in der narrativen Fassung einer mehrtei-ligen Bilderfolge ist der Zyklus aber weit mehr alsein Medium der Immersion. Das permanenteUmkreisen des Passionsgeschehens, dem christ -liche Westeuropäer des Spätmittelalters aus-gesetzt waren, hatte auch seine verstörendenSeiten. Gewalt und Schmerz, Verrat und Trauerluden die Leidensgeschichte mit einer beun -ruhigenden Dynamik auf, welche die Grenzenzwischen Opfer und Täter, Mensch und Gott,Vergangenheit und Gegenwart fragwürdig er-
scheinen ließ. Jede narrative Darbietung des Pas-sionsgeschehens war immer auch Stellung -nahme zu den schwierigen Fragen nach demVerhältnis von göttlicher Vorbestimmung undmenschlicher Schuld, von Historizität und un-abgeschlossener Aktualität dieser Geschichte.Eine erste Vorstellung davon, wie sich derWaltensburger Zyklus diesbezüglich positioniert,gibt das schon erwähnte Einstiegsbild (Abb. 3und 5): Als bildliche Abbreviatur einer Stadt lässtdas Nebeneinander der Gebäude an Jerusalemdenken, an den Ort, in dem Christus litt, starbund bestattet wurde, den Ort aber auch, in demdie Bevölkerung den auf einer Eselin Ein-reitenden begeistert empfing und feierte. DerEinzug nach Jerusalem ist das Ereignis, das demletzten Abendmahl in vielen Bildzyklen voraus-geht.8 In Waltensburg fehlen die Akteure. Allein
143David Ganz
Abb. 5 Waltensburg, Pfarrkirche, Ecke West- und Nordwand in Untersicht
die dunklen Toröffnungen evozieren das histo -rische Geschehen von Ankunft und Begrüßung.Es fehlen aber auch spezifische Landmarken, dieden Erinnerungsort Jerusalem im Imaginariumdes späten Mittelalters auszeichneten: dieGrabeskirche mit der Anastasis-Rotunde, dasTemplum Salominis usw.9 Was das Bild zeigte,ließ sich ebenso gut auf jede beliebige Siedlungdes mittelalterlichen Europa beziehen, unddamit auch auf den Anbringungsort der Bilder,das kleine Dorf Waltensburg. Hier greift nun dashohe, um nicht zu sagen gebirgige Relief desMalgrundes ein, das die materielle Verankerungdes Bildes in der Waltensburger Kirche starkmacht. Das Dort der heiligen Stadt Jeru salemund das Hier der Kirche in Grau bünden be-ginnen sich zu überlagern. Die plastisch hervor-tretenden Steine der Kirchen wand sind gewis -
sermaßen das Gegenstück zu den Steinen, diechristliche Pilger an den heiligen Stätten auf-sammelten und als Ortsreliquien zurück nachEuropa brachten.10
Nicht zuletzt rücken die Unebenheiten des Bild-grundes die räumliche Situation im Kirchen -raum ins Bewusstsein: Wer auf das Bild desStadttors blickt, steht selbst an einer Schwelle,dem Eingangsbereich der Kirche. Der Einzug indie Kirche soll in Erinnerung an den Einritt nachJerusalem wahrgenommen werden.11 Der un-konventionelle Einstieg über die menschenleereBühne ist ein Appell an alle Kirchenbesucher, diegesamte Passion als ein immer wieder zu ak-tualisierendes Geschehen zu betrachten unddabei selbst nach der eigenen Rolle zu fragen.
144 Erzählen mit losen Enden
Abb. 6 Waltensburger Meister, Kreuzigung. Waltensburg, Pfarrkirche
Muster der Bildanordnung. Waltensburg undPadua im Vergleich
Der Raum, in dem der Waltensburger Meister ar-beitete, war eine kurz zuvor errichtete Saalkircheüber einem leicht schiefwinkligen Grundriss(Abb. 1). Fenster gab es nur auf Südwand, siewaren schmaler als die heute vorhandenen Öff-nungen. Das Presby terium im Osten war kleinerals heute, vielleicht nur eine Nische.12 Aus diesemGrund war der östliche Teil des Saals für denKlerus reserviert und durch Schwellenelementeabgegrenzt – die Nahtstelle zwischen Passions-zyklus und Hei ligenprogramm zeigt den Verlaufdieser Grenze heute noch gut sichtbar an.Wie an anderen Orten Graubündens setzte dieAusmalung bereits auf der Außenseite der Kircheein, in diesem Fall auf der dem Dorf zugekehrten
Südwand (Abb. 7). Hier fanden verschiedeneEinzelbilder in loser Anordnung ihren Platz: einChristophorus- und ein Kreuzigungsbild, dieAnbetung der Könige und einige Heilige.13 ImInneren dagegen blieb die Südwand weitgehendunbemalt (Abb. 8). Nur im Osten und imNorden verdichteten sich die Fresken desWaltensburger Meisters zu wandfüllenden Bild-komplexen (Abb. 9, 12). Mit dieser ungleich-mäßigen Verteilung reagierte die Platzierungder Wandbilder auf die räumlichen Strukturendes Kir chenraums, wobei sie deren Asym-metrien und Grenzverläufe noch verstärkte.Während die Zone des Klerus ein symmetrischausbalanciertes Bildprogramm erhielt, walteteim Laienraum radi kale Asymmetrie: Die zu-sammenhängende Ausmalung der Nordwandbesitzt kein Pendant auf der Südwand. Die Ver-
145David Ganz
Abb. 7 Waltensburg, Pfarrkirche, Ansicht von Süden
teilung der Bilder zeugt von einer Bereitschaftzur Schaffung von Ungleichgewichten, die dasin Sakralräumen wirksame Gefüge von Raum-achsen und Raumzonen unterminiert.Der Punkt, auf den ich an dieser Stelle hinaus-möchte, wird deutlicher, wenn man die großenBilderräume der italienischen Trecento-Malereizum Vergleich heranzieht, an denen die Kunst-geschichte ihre Maßstäbe zur Beurteilung mo -numentaler Raumausmalungen geschult hat.14
Die von Giotto 1303–1305 ausgemalte Arena-Kapelle in Padua etwa bietet sich wegen ihrervergleichbaren Raum-Disposition als Beispielan: Auch in Padua steht eine durchfensterteSüdwand einer fensterlosen Nordwand gegen-über (Abb. 10). Die erhebliche Asymmetrie derbeiden Seitenwände wird von Giotto durch einstarkes Rahmensystem aus vertikalen und hori -
zontalen Bändern überspielt. Die gemalten Rah-menleisten sorgen für den Eindruck einer aus -gewogenen Verteilung von Bildern auf beidenWänden und für eine tektonische Verspannungder Bilder im Raum.15
Die Vorliebe für solche ausponderierten, tekto-nisch gefügten Rahmensysteme war keinen reinformalästhetischen Überlegungen geschuldet.Die regelmäßige Anordnung der Bilder visua -lisierte den Anspruch, die Ordnung der gött-lichen Heilsgeschichte modellhaft nachstellen zukönnen. Der gesamte Kapellen- oder Kirchen -raum wurde zu einem visuell-räumlichenModell für die Notwendigkeit einer von Gottverfügten Struktur, in der auch die Betrachterihren Platz finden konnten. Giottos PaduanerAusmalung ist ein schlagendes Beispiel für diesesOrdnungsversprechen: Die Szene des göttlichen
146 Erzählen mit losen Enden
Abb. 8 Waltensburg, Pfarrkirche, Inneres der Südwand
Ratschlusses der Menschwerdung Christi amChorbogen und das Weltgericht an der Ein-gangswand (Abb. 11) fungieren hier als überge-ordnete Klammer von Anfang und Ende derHeilsgeschichte. Die Erzählung des Marien- undChristuslebens an den Längswänden zirkuliertzwischen diesen beiden Polen.16
Erzählen im Boustrophedon. Die Bewegungs-linien des Passionszyklus
Der Passionszyklus des Waltensburger Meistersverteilt sich auf zwei übereinander platzierteBildstreifen. Die Erzählung setzt im oberen Re-gister neben dem Kircheneingang ein, läuft dannRichtung Osten, um kurz vor Erreichen derChorwand umzubiegen und im unteren Register
wieder zur Eingangswand zurückzukehren. Nachdem Namen eines in der Antike gebräuchlichenSchreibmusters sprechen wir von einem Bou -stro phedon (Abb. 12).17
In der Dekoration mittelalterlicher Kirchen -räume ist das Boustrophedon-Muster eher eineSeltenheit, wie Marylin Aronberg Lavins in ihrervergleichenden Untersuchung zeigt: In denmeisten Kirchen starteten erzählende Bild-erfolgen beim Altar und liefen dann in gleich-bleibender Orientierung rings um das gesamteLanghaus (wrap around). Wurde dem ersten Re-gister ein zweites hinzugefügt, waren die beidenBildstreifen in der Regel gleichsinnig orientiert(double parallel).18 In beiden Fällen stand derGesichtspunkt einer ausgewogenen Verteilungder Bilder auf beiden Seitenwänden im Vorder-grund. Das Waltensburger Boustrophedon hin-
147David Ganz
Abb. 9 Waltensburg, Pfarrkirche, Chorbogen
gegen ermöglicht eine ungleiche Verteilung derBilder auf die Wände. Überdies liegt sein Wende-punkt nicht am Ende, sondern „mitten“ auf derWand – an einer Stelle, an der wir uns im 14.Jahrhundert irgendeine Form von Grenzmar -kierung vorstellen müssen (als Schwelle zwi -schen Laien- und Klerikerraum). Diese Beson -
derheit erhöht noch einmal das Gewicht desRichtungswechsels zwischen oberem und un -terem Bildstreifen.Die Anordnung der Passionserzählung nach demseltenen Muster des Boustrophedon brachtespezifische narrative Strukturoptionen ins Spiel.Ganz abstrakt lassen sie sich so charakterisieren:
150 Erzählen mit losen Enden
Abb. 12 Waltensburger Meister, Passionszyklus. Waltensburg, Pfarrkirche
Abb. 13 Waltensburger Meister, Abendmahl. Waltensburg, Pfarrkirche
Zum einen bieten sie die Möglichkeit, die Hand-lung so zu organisieren, dass sie zu einem vonBeginn an feststehenden Ausgang führt – eineErzählung, die ein hohes Maß an Geschlos -senheit aufweist.19 Zum anderen eröffnen sie dieMöglichkeit, die Handlung in einem Peripe -tiemoment umschlagen zu lassen – eine Er-zählung, die von diesem Richtungswechsel ausmehrere Fortsetzungen denkbar erscheinen lässt.Zwei durchaus widersprüchliche Optionen also,die der Waltensburger Zyklus beide aufgreift.Genau aus dieser Gegenläufigkeit bezieht erseinen narrativen Spannungsreichtum.Das Moment der göttlichen Vorbestimmung derLeidensgeschichte wird durch die Überein-anderstellung von Abendmahl und Kreuz -tod/Grablegung betont (Abb. 12). Oben ist dieVer rats ankündigung dargestellt, in der Christussein Vorwissen um den Ausgang der Geschichtemitteilt: Einer der Zwölf wird ihn verraten (Abb.
13). Nur dank dieses Vorwissens kann das Aus-teilen von Wein und Brot schon in diesemMoment zu einem Akt der Memoria erklärtwerden, der an den bevorstehenden Tod Christierinnern soll („Tut dies zu meinem Gedächtnis!“,Lk 22,19). Während die Jünger im Bild noch er-regt diskutieren, lässt das Bild die Betrachter amVorauswissen Christi partizipieren, indem esJudas eine unübersehbare Außenseiterpositiongibt. So kann auch die Bildnachbarschaft vonAbendmahl, Kreuztod und Begräbnis alsSichtbar machung des göttlichen Heilsplans ver-standen werden.Nach zwei Seiten wird diese zyklische Schließungder Waltensburger Passionsbilder wieder relati-viert. Nach außen setzen die offenen Enden einFragezeichen, wo denn nun eigentlich Anfangund Ende der Passion zu lokalisieren sind. Nachinnen fällt in der Zusammenschau von oberemund unterem Register die uneinheitliche Glie-
151David Ganz
Abb. 14 Waltensburger Meister, Passionszyklus, Ausschnitt. Waltensburg, Pfarrkirche
derung der Waltensburger Ausmalung ins Auge:Während das Abendmahl (mit der benachbartenFußwaschung) auf beiden Seiten durch Rah-menleisten begrenzt wird, fehlt eine solcheUnterteilung zwischen Kreuzigung, Kreuz-abnahme und Grablegung (Abb. 12). Auch derübrige Zyklus ist ohne Einteilung in Bildfeldergestaltet. Mit Ausnahme des Abendmahls (demRaum des göttlichen Vorauswissens) ist der Pas-sionszyklus eine „entrasterte“ Erzählung, welchedie einzel nen Szenen ohne Segmentierung dichtaneinander geschoben präsentiert und so ihreÜber gänge verschwimmen lässt.20
In der Begrifflichkeit des Wiener Kunsthisto -rikers Franz Wickhoff könnte man von einer Re-aktivierung des „kontinuierenden Stils“ spre -chen, einer Erzählform, die Wickhoff an denspätantiken Miniaturen der Wiener Genesis be-obachtete. In einer berühmten Unterscheidunggrenzte Wickhoff die älteren, schon in derarchaischen und klassischen Kunst der Antike
vertretenen Erzählmodi des „komplettierenden“und des „distinguierenden“ Stils vom „Inein-andergleiten“ der Wiener Miniaturen „in kon-tinuierlich sich reihenden Zuständen“ ab.21
Interessanterweise finden sich unter den vonWickhoff diskutierten Bildern einige, die eben -falls nach dem Schema des Boustrophedon ge-baut sind (Abb. 15). Der Zug Jakobs mit seinerFamilie (Gen 32, 22–28) auf Seite 23 führt nichtüber den Fluss, sondern dem gekrümmten Ver-lauf der Brücke folgend in den unteren Bild-streifen, in dem Jakob mit dem Engel ringt,während die Familie schon weiterreist. Dabeigehen die verschiedenen Phasen der Handlung soineinander über, dass sie sich gar nicht in strenggetrennte Szenen auseinanderdividieren lassen:„Imaginäre Vor- und Rückblicke, mimisch-ge-stische Querverweise und sogar zeitlich umge-kehrte Bewegungsabläufe“ binden die Stationender erzählten Geschichte eng zusammen.22
152 Erzählen mit losen Enden
Abb. 15 Jakob zieht mit seiner Familie über den Fluss Jabbok, Wiener Genesis, um 550. Wien, ÖNB, Cod. Vin-dob. Theol. Graec. 31, p. 23
Auch der Waltensburger Meister hat das Erzählenohne Grenzlinien als Möglichkeit einer Ver-dichtung zeitlich und räumlich getrennt zudenkender Ereignisse begriffen, wie wir sie in derEreignisfolge Gebet am Ölberg, Gefangennahmeund Verhörszene beobachten können (Abb. 14).Die Akteure der drei Szenen bewegen sich inner-halb eines Bildkontinuums. Die energische Aus-holbewegung Petri mit dem Schwert dringt weit inden Raum der Ölbergszene ein. Dort kontrastiertsie mit der Rechten Gottes, der Christus vomHimmel herab anspricht. Weiterhin scheint derSegen, den der gefangene Christus dem verletztenMalchus spendet, auch dem schlafenden Jünger amrechten Rand der Ölbergszene zugute zu kommen. Die Verkettung getrennter Handlungsmomentelässt den Eindruck entstehen, dass die Geschichtegleichsam unaufhaltsam auf ihr vorbestimmtesEnde zusteuere, auf Kreuzigung, Kreuzabnahme
und Grablegung. Immer wieder sind es Blicke,die sich von einem Ereignis auf das nächsterichten und so ein Erkenntnispotenzial inner-halb der Geschichte andeuten. An die Stelle eineräußeren, prästabilisierten Ordnung der Ge-schichte, für die das Raster aus gerahmten Bild-feldern steht, tritt eine innere Verklammerung,die Unterschiede in Raum und Zeit kollabierenlässt und so gewissermaßen ein paradoxesGefüge der Heilsnotwendigkeit hervorbringt –eine Verlagerung von einer äußeren Ordnung desErzählens zur Binnenstruktur der erzählten Ge-schichte also. Damit gerät die Logik des Heils-plans aber auch in einen Konflikt mit anderenKräften, die ihre eigene Dynamik innerhalb desgemalten Geschehens entfalten. Dieser Konfliktwird insbesondere in der letzten Szene desoberen Bildstreifens sichtbar. An der Scharnier-position des Boustrophedon befindet sich in
153David Ganz
Abb. 16 Waltensburger Meister, Christus vor Pilatus. Waltensburg, Pfarrkirche
Waltensburg die Darstellung eines Entweder-Oder: Der gefangene Christus wird seinemRichter vorgeführt, der das Urteil über den An-geklagten spricht (Abb. 16). Schon in der Erzählung der Evangelien eignetdem Prozess der Verurteilung Christi eine eigeneDramatik, die durch das Passieren mehrererRichterinstanzen und das lange Zögern desPilatus erhöht wird. Dieses langwierige Hin undHer kann in anderen Bilderfolgen der Zeit in einedichte Folge einzelner Handlungsschritte ge-staltet werden.23 In Waltensburg bleibt es beieiner Szene, die nun aber durch die Position amScharnier zwischen den Registern in ihrerBedeutung erheblich aufgewertet wird. Erzähllogisch ist die Position der Gerichtsszenemit Bedacht gewählt: Sie trennt einen ersten Teilder Passionsgeschichte, in dem Christus von
seinen Jüngern verraten und im Stich gelassenwird, von einem zweiten, in dem Christus kör-perlich misshandelt und schließlich getötet wird.Bis zum Verhör ist Christus lediglich ein Ge-fangener. Der untere Bildstreifen erzählt das kör-perliche Leiden Christi, beginnend mit derEntkleidung an der Geißelsäule. Die Anordnungder Szenen legt den Eindruck nahe, dass dasLeiden und Sterben Christi vom Urteil des Pon -tius Pilatus, dem als obersten Richter über Chris -tus eingesetzten Statthalter, abhängt.24 Das Dreh -moment des Boustrophedon fordert ge radezu zuder Schlussfolgerung auf, dass an diesem Punktauch ein anderer Verlauf der Geschichte vorstell-bar und möglich wäre. Was wäre, wenn Pilatusden Angeklagten freigesprochen hätte?
154 Erzählen mit losen Enden
Abb. 17 Waltensburger Meister, Kreuztragung. Waltensburg, Pfarrkirche
Die Gegenwart der Passion
Gerade in seiner kritischen Phase rund um denWendepunkt des Pilatus-Urteils wird das Pas-sionsgeschehen in einer Perspektive erzählt, diemit Elementen einer Aktualisierung durchsetztist. Die Soldaten, die Christus verhaften, tragenzeitgenössische Waffen und Rüstungen, der rö-mische Statthalter mittelalterliche Herrschafts-zeichen (Lilienkrone, Zepter und Königsmantel).Dazu gehört auch, dass einige der Gegner Christiin den Szenen des Verhörs, der Dornenkrönungund der Kreuztragung durch spitze Hüte alsJuden gekennzeichnet werden (Abb. 14). DerJudenhut war ein zeitgenössisches Kleidungs-stück, das der äußerlichen Unterscheidung vonJuden und Nicht-Juden diente.25 Wie HorstRupp hervorhebt, kommt damit ein im christ -
lichen Europa des späten Mittelalters verbreiteterAntijudaismus ins Spiel.26 Durch die Darstellungvon Akteuren mit Judenhut wurde das dar-gestellte Geschehen in die Gegenwart verlängertund die Schuldfrage als offenes, unbewältigtesProblem ausgegeben, für das man die Juden alsdie Anderen, die Glaubensfeinde des Christen -tums verantwortlich machen konnte.27 Christ -liche Passionsbilder wirkten regelmäßig an ei -nem Diskurs der Ausgrenzung mit, der leicht zuphysischer Gewalt gegenüber der jüdischenBevölkerung führen konnte.Im jüngsten Beitrag zum Waltensburger Meisterhat Horst Rupp den Antijudaismus sehr starkgewichtet und ihn zur primären Stoßrichtungdes Zyklus erklärt.28 In dieser Hinsicht vertreteich eine andere Bewertung: Vergegenwärtigt mandas Spektrum bildlicher Diffamierung und
155David Ganz
Abb. 18 Waltensburger Meister, Martyrium des Sebastian. Waltensburg, Pfarrkirche
Schuldzuweisung, das christlichen Malern desspäten Mittelalters zu Gebote stand, dann bewegtsich der Waltensburger Zyklus eher in einemmoderaten Bereich.29 So sind die Juden unterden Gegnern Christi deutlich in der Minderheit,nur einer von ihnen ist bei der Dornenkrönungaktiv an körperlicher Gewalt gegenüber Christusbeteiligt. Umgekehrt sind weder Pilatus nochseine Berater bildlich als Juden ausgewiesen.30
Während andere Künstler den Akteuren mitJudenhut gerne hässliche, fratzenhafte oderbetont vulgäre Gesichtszüge verliehen und sie sokörperlich wie ethisch diskriminierten, machtder Meister von dieser Möglichkeit nur in einemFall Gebrauch (die Figur an der Spitze der Kreuz-tragung).31 Die beiden Juden an der Seite deskreuztragenden Christus entsprechen ganz demSchönheitsideal der Zeit (Abb. 17).In meiner Sicht ist der Hinweis auf die Mitschuldder Juden daher nur eines von mehreren An-geboten des Waltensburger Zyklus, die Passionals unabgeschlossene Geschichte zu lesen. Mehrals auf die jüdische „outgroup“ zielt die Er-zählung auf die Angehörigen der christlichen„ingroup“, repräsentiert durch die Soldaten inzeitgenössischer Rüstung und Bewaffnung, vorallem aber durch den thronenden Pilatus, dereinem christlichen Herrscher der Zeit und seinerhöfischen Entourage zum Verwechseln ähnlichsieht. Die Scharnierfigur des schlecht urteilendenRichters fungiert als warnendes Exemplum derUngerechtigkeit. Auch in zeitgenössischenTraktaten zur Rechtsprechung wurde Pilatus(etwa im Gegensatz zu Salomo) als negativesModell angeführt.32
Nach mittelalterlichem Rechtsverständnis hattemenschliche Jurisdiktion ihren Fluchtpunkt imgöttlichen Urteil beim Weltgericht.33 Auf diesenZusammenhang wird in der Darstellung derDornenkrönung angespielt (Abb. 14). Frontalthronend und in Herrscherkleider gehüllt, antizi -piert die bildliche Inszenierung den Auftritt Christials Weltenrichter am Jüngsten Tag. Was innerhalbder Geschichte ein Geschehen der Verspottungund Verhöhnung durch die Soldaten ist, wird nach
außen hin, für die Betrachter der Fresken, inver-tiert. Schlecht beratener und allwissender, mensch-licher und göttlicher Rich ter werden über dieRegister hinweg miteinander konfrontiert, zu-sammengebunden durch die Entblößung desrechtlosen Christus-Körpers in der Geißelung.34
Durchlässige Bildgrenzen. Passion undHeiligenprogramm
Wenn Pilatusurteil und Geißelung die Wende-punkte der Waltensburger Leidensgeschichtesind, dann sind sie zugleich auch deren loseEnden. Ich komme hier auf die eingangs an-gesprochene Nahtstelle zwischen den Bildkom-plexen des Passionszyklus und des Heiligen -programms im Osten der Kirche zurück (Abb. 2).Von letzterem sind wegen der späteren Er-weiterung des Presbyteriums und einer Über-malung des 15. Jahrhunderts nur Fragmenteerhalten, weswegen es in der Diskussion zuWaltensburg nur eine marginale Rolle gespielt hat(Abb. 9, 19).35 Im ursprünglichen Zustand müssenwir uns eine monumentale Reihe der zwölf Apo-stel und einiger Lokalheiliger vorstellen, die sichsymmetrisch geordnet an der Ostwand und denangrenzenden Teilstücken der Nord- undSüdwand entlang zog, zentriert höchstwahr-scheinlich auf eine Christusfigur in der Mittel-position. Im schmaleren unteren Register warenweitere Heilige (Süden) und ein zelne Ereignisseaus Heiligenviten dargestellt (Norden). Wie schonmehrfach angesprochen, legte sich dieser Teil derAusmalung als bildliche Folie hinter die im Spät-mittelalter abgegrenzt zu denkende Zone derGeistlichkeit mit dem liturgischen Brennpunktdes Altars. Die Versammlung der Heiligen rief denGedanken der christlichen Kirche als communiosanctorum mit den Aposteln als Gründerfigurenin Erinnerung.Mit Wolfgang Kemp lässt sich die Kombinationder beiden Bildkomplexe in eine längere, bis indie Spätantike zurückreichende Traditionchristlicher „Bildsysteme“ stellen.36 Darunter
156 Erzählen mit losen Enden
versteht Kemp Bildprogramme wie die Mai -länder Elfenbeintafeln (Abb. 20) oder die Bil -derdecke von Zillis, die eine erzählende und eineüberzeitliche Bildordnung ausdifferenzieren undin ein Verhältnis wechselseitiger Ergänzungstellen. Erst die Kombination beider, so Kemp,mache es möglich, die beiden Hauptfrageninnerhalb einer menschlichen Kultur zu beant-worten: „Was geschah und wie geschah es?“ und„Wie ist alles geordnet?“37.In Waltensburg erscheinen die beiden Bereicheüber die unregelmäßige, schwache Rahmunghinweg in ein Verhältnis wechselseitiger An-steckung versetzt, das den Systemcharakter ihrerKombination unterläuft. Zuerst zum unteren Re-gister, in dem die Durchlässigkeit der Grenze amaugenfälligsten ist (Abb. 18). Die Aufnahmenarrativer Darstellungen in das ansonsten reinrepräsentative Programm von Heiligen ist
ersichtlich durch die Nachbarschaft zu den er-zählenden Passionsbildern motiviert. Und un-übersehbar ist dabei der Gedanke leitend, dasMartyrium des römischen Soldaten Sebastian imPfeilregen numidischer Bogenschützen geradezuzwillingshaft an die Peinigung Christi an derGeißelsäule anzugleichen.38 Das Konzept einersolchen Angleichung ist nicht neu, da Heiligegrundsätzlich auf den Spuren Christi wandeln –die „Legenda Aurea“ erklärt den NamenSebastian aus dem Verb sequi/folgen.39 So um-fassend wurde die Nachfolge Christi aber nurselten ausgelegt, sie erstreckt sich in diesem Fallja nicht nur auf die Ähnlichkeit zwischen denbeiden körperlich entblößten Figuren, sondernauf das gesamte szenische Gefüge.Die Ansteckung des einen Bildmusters durch dasandere hatte in den Augen der Kirchgängermehrere Effekte: Erstens stattete sie den gegen
157David Ganz
Abb. 19 Waltensburger Meister, Luzius, Rufinus und Apostel. Waltensburg, Pfarrkirche
die Pest und andere Notlagen als Beschützerangerufenen Sebastian mit einem Maximum anFürbittemacht aus. Zweitens erinnerte sie daran,dass diese Macht auf einer gelungenen Christus-imitation basierte, Christus also als Urbild allerHeiligen fungierte.40 Drittens aber suggerierte dieKnickstelle des Boustrophedon einen zeitlichenAnschluss: Als sei das Sebastiansmartyriumgewissermaßen eine alternative Fortsetzung derPassionsgeschichte. Das Verhältnis zwischen denbeiden Szenen ließ sich ja auch im Sinne einesRollenwechsels deuten: Der Heilige im Pfeilregenwar ein ehemaliger Soldat aus der LeibgardeKaiser Diokletians, er gehörte der gleichenGruppe an wie die beiden Peiniger Christi.Ein vergleichbares Umkehrmoment ist auch imoberen Register präsent (Abb. 19). Ganz an denRand der Heiligenversammlung ist der heiligeLucius gerückt, der Patron des Bistums Chur, zudem Waltensburg gehörte. Der frühmittel-
alterlichen Vita zufolge war Lucius König vonBritannien, der zum Christentum konvertierteund dieses dann im Alpenraum predigte, bevorer das Martyrium erlitt.41 Als Begleiter der Apo-stel repräsentiert Lucius die Ausdehnung derchristlichen Kirche in diejenige Diözese, der auchWaltensburg unterstand. Das entscheidende Ele-ment ist in meinen Augen aber das Herrschafts-zeichen der Krone, das auf das königliche Amtvor der Bekehrung anspielt. Sie macht Lucius zurchristlichen Gegenfigur des gekrönten Pilatusder Verhörszene. In der Nachbarschaft mit demVerhör verkörpert Lucius die Möglichkeit einerKonversion, einer Wende zu einem Leben nachChristus, die Pilatus mit seinem Urteil aus-schlägt.Mit den Interferenzen zwischen den benach-barten Bildkomplexen stellt sich die Frage derUnabgeschlossenheit der Passion noch einmalneu: Die überzeitliche Ordnung der communitassanctorum weist Anschlussstellen auf, die an eineFortsetzung, aber auch an andere Verläufe derLeidensgeschichte Christi denken lassen. Wie einzusätzlicher Hinweis auf diese Spielräume wirktdie Gotteshand, die genau im Kreuzungspunktder Bildkomplexe ansetzt und in die Szene desMartyriums hineinragt (Abb. 18). Innerhalbdieses Bildfeldes zeigt die Hand eine göttlicheIntervention in den Gang der Geschichte an. Obsie auch für eine göttliche Ordnung der Bilderim Kirchenraum stehen kann, bleibt dagegenoffen.
Der Meister von Waltensburg und die Topo-graphie der Kunstgeschichte
Künstler wie der Meister von Waltensburg habenin der klassischen Topographie der Kunstge -schichte einen marginalen Platz. Zuständig fürihre Bearbeitung ist traditionell eine Forschung,die in regional eingegrenztem Rahmen operiert.Diese Aufgabenteilung basiert auf Denkmusterneiner Grenzziehung zwischen Haupt- undNebenwerken, zwischen großen Meistern und
158 Erzählen mit losen Enden
Abb. 20 Buchdeckel aus Elfenbein, spätes 5. Jh.Mailand, Museo del Duomo
Künstlern der zweiten Reihe, zwischen künst-lerischen Zentren und Peripherie. Die Schöp -fungen der Randfiguren müssen gewis ser-maßen immer mit den Hauptsträngen der Ent-wicklung verrechnet werden, ihre Leistung kannbestenfalls darin bestehen, empfänglich zu seinfür die im Zentrum hervorge brachten Trends.42
Im frühen 21. Jahrhundert erscheint es geboten,diese Denkmuster zu revidieren. Methodischkann eine solche Neubestimmung an die ak-tuelle Debatte darüber anschließen, wie Kunst-geschichte in einem globalen Kontext zubetreiben sei. Kategorien wie Zentrum, Meisteroder Hauptwerk sind in diesem Zusammenhangals Elemente „eurozentrischer“ oder „kolonialer“Narrative der Kunstentwicklung verabschiedetworden.43 Solange diese Diskussion nur auf eineAusweitung kunsthistorischer Arbeit über denwestlichen Rahmen hinaus zielt, hat sie den pa-radoxen Nebeneffekt, den Westen oder Europazu einem einheitlichen Territorium zu erklären,dessen Geschichte sich linear erzählen lässt.44
Demgegenüber gilt es, den Blick für die He -terogenität europäischer Kunstproduktion neuzu schärfen. Die Kunstgeschichte muss sichfragen, welchen Stellenwert sie den vielen Zo-nen der innerwestlichen Peripherie zugestehenmöchte. Für diese Aufgabe einer Neuvermessungder kunsthistorischen Topographie scheint mirder Meister von Waltensburg ein fruchtbaresFallbeispiel. Dabei kann es nicht darum gehen,die Wandbilder des Künstlers zu bisher unter -schätzten Meisterwerken zu erklären. Mit dieserArgu mentation bewegte man sich innerhalb derherkömmlichen Krite rien, was wenig aussichts-reich wäre. Auch der entgegengesetzte Versucheiner gleichmäßigen Kartierung aller Monu -mente wäre wenig erfolgversprechend. NeueErkenntnisse verspricht die selektive Beschäfti -gung mit bisher peripheren Zonen überall dort,wo sich ein anderer Blick auf die Phänomene imZentrum eröffnet. Eine Perspektive wäre dabeidie der interkulturellen Transferprozesse, fürderen Untersuchung eine Transitregion wie dermittelalterliche Alpenraum ein lohnendes Feld
darstellt. In meinem Beitrag habe ich einenanderen Ansatz verfolgt: Er zielte auf einen Ver-gleich zwischen dem Waltensburger Bilderraumund den viel bekannteren Raumausmalungendes italienischen Trecento. Die Wandbilder in derWaltensburger Kirche sind in einer solchenGegenüberstellung ein prägnantes Beispiel dafür,dass das Zusammenwirken von Bild, Erzählungund Raum im Spätmittelalter komplexer gedachtwerden muss, als dies bisher der Fall war.
Anmerkungen
1 Zum Begriff des Bild-Ensembles vgl. Ganz/Thürlemann2010, zu Fragen des bewegten Betrachters vgl. Ganz/Neuner 2013.
2 Der Name Waltensburger Meister wird hier im Sinneeiner wissenschaftlichen Konvention verwendet, zu einemÜberblick über die zugeschriebenen Werke und derenDatierung folge ich Reichel 1959 und Raimann 1985, 31–89. Ich lasse ausdrücklich offen, ob es sich um eineeinzelne Künstlerpersönlichkeit oder um ein Werkstatt-kollektiv handelt.
3 Zu einer Diskussion der Kategorie des Rahmens jenseitsdes Tafelbildes vgl. Duro 1996; Körner/Möseneder 2008;Körner/Möseneder 2010.
4 Die dreidimensionale Wirkung hervorgehoben bei Rupp2014a, 168. Dagegen betont Reichel 1959, 11, noch den„flächigen Charakter“ des Bildes.
5 Vgl. u. a. Schupisser 1993; Derbes 1996; MacDonald/Ridderbos/Schlusemann 1998; Seegets 1998.
6 Zur spätmittelalterlichen Bildtradition der Leidens-geschichte vgl. Derbes 1996; Marrow 2008.
7 Vgl. Schupisser 1993.8 Vgl. Reichel 1959, 11 f.; Raimann 1985, 414; Rupp 2014a,166–168.
9 Zu mittelalterlichen Bildtraditionen Jerusalems vgl. u.a.Hoffmann/Wolf 2012; Donkin 2012; Kühnel/Noga-Banai/Vorholt 2014.
10 Wiederholt diskutiert wurde in den letzten Jahren dasspätantike Steinreliquiar der Sancta Sanctorum in Rom(6. Jh.), das beschriftete Steine und gemalte Szenen derzugehörigen Ereignisse barg, vgl. Reudenbach 2005; Nagel2012, 116–132.
11 Ein im Hinblick auf die semantische Verknüpfung desKirchenraumes mit Jerusalem naheliegender Gedanke, vgl.Sauer 1902. Zu einer ähnlichen Parallelisierung von Durch-queren des Portals im Realraum und Eintreten im gemaltenRaum vgl. Neuner/Pichler 2005 am Beispiel von TintorettosVerkündigung in der Scuola di San Rocco in Venedig.
12 Die Baugeschichte ist nur summarisch aufgearbeitet, vgl.
159David Ganz
Raimann 1985, 409.13 Vgl. Raimann 1985, 419–423. Allgemein zu den Bildern
an den Außenwänden der Kirchen vgl. Boscani Leoni2008, zu Waltensburg ebd., 389 f.
14 Zu einem Überblick vgl. Lavin 1990.15 Nicht von ungefähr entwickelte Theodor Hetzer seinen
Begriff des Bildes als Bau an diesem Werk, vgl. Hetzer1996.
16 Vgl. Kemp 1996; Jacobus 2008.17 Vgl. Boscani Leoni 2008, 206.18 Zur Terminologie Lavin 1990, 6–9. Die Kategorie des
Boustrophedon bleibt bei Lavin insofern vage, als sie auchRichtungswechsel zwischen Kapellenwänden daruntersubsumiert („aerial boustrophedon“).
19 Der Literaturwissenschaftler Clemens Lugowski hat dafürden Begriff „Ergebnismoment“ geprägt, vgl. Lugowski1976, 24–30.
20 Zum Wegfall der Rahmung vgl. Reichel 1959, 11;Raimann 1985, 39–40.
21 Wickhoff 1912, 126.22 Clausberg 1984, 21.23 Eine der ausführlichsten Darstellungen des Prozesses
überhaupt gibt Duccio auf der Rückseite der Maestà fürden Dom von Siena (1308–1312), vgl. Lubbock 2006, 17–38. Allgemein zur Tendenz einer narrativen Anreicherungdes Prozesses Hourihane 2009, 255–289.
24 Die Identität der thronenden Figur wird in der Literaturkontrovers diskutiert (Pilatus oder Herodes), zuletzt hatsich Horst Rupp noch einmal dezidiert für Herodes aus-gesprochen, Rupp 2014a, 172. Mit Blick auf die Text-referenzen und die Bildtradition scheint mir dieIdentifizierung als Pilatus aber nicht zweifelhaft. Sowohlin Texten wie in Bildern ist Pilatus und nicht Herodes die
Schlüsselfigur im Prozess gegen Christus, seine Dar-stellung mit Herrscherinsignien entspricht dem gängigenRepertoire. Vgl. die ausführliche Diskussion in Hourihane2009.
25 Vgl. Mellinkoff 1993, Bd. 1, 65–73, 91–94; Lipton 1999,15–19.
26 Vgl. Rupp 2014a, besonders 170–180.27 Vgl. Cohen 1997.28 Vgl. Rupp 2014a.29 Vgl. Mellinkoff 1993, Bd. 1, 111–227; Strickland 2003,
105–155; Jung 2008.30 Wie Hourihane 2009, 289–293, betont, trägt Pilatus auf
vielen Bildern der Zeit einen Judenhut.31 Vgl. u. a. Faü 2005; Fabbri 2007; Merback 2008;
Kessler/Nirenberg 2011.32 Zum Pilatus-Urteil als juristischem Exemplum vgl.
Hourihane 2009, 272–295.33 Zum Weltgericht als juristischem Exempe vgl. Jacob 1994. 34 Diese Kontrastierung bereits angesprochen in Rupp
2014a, 174.35 Vgl. Reichel 1959, 26–33; Raimann 1985, 417–419.36 Vgl. Kemp 1994.37 Vgl. Kemp 1989, 124.38 Vgl. Rupp 2014a, 172–174.39 Vgl. Voragine 1969, 127.40 Zu solchen Verhältnissen der Postfiguration in christ -
lichen Bildprogrammen vgl. Mohnhaupt 2000, 139–149.41 Zu Luzius vgl. Boscani Leoni 2008, 269–270.42 Beispielhaft für diese Tendenz die Darstellung von
Raimann 1985.43 Vgl. u. a. Elkins 2007; Zijlmans/Damme 2008.44 Ähnlich argumentiert Kapustka 2014 für die Kunst Ost-
europas.
160 Erzählen mit losen Enden