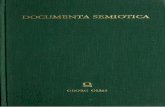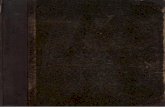Die Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters
Transcript of Die Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters
GEISTESWISSENSCHAFTLICHES ZENTRUMGESCHICHTE UND KULTUR OSTMITTELEUROPAS E.V.AN DER UNIVERSITÄT LEIPZIG
Forschungen zur Geschichte und Kulturdes östlichen Mitteleuropa
Herausgegeben vonWinfried EberhardAdam LabudaChristian LübkeHeinrich OlschowskyHannes SiegristPetr SommerStefan Troebst
Band 50
Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa
Franz Steiner Verlag
Herausgegeben von Martina Maříková und Christian Zschieschang
Gedruckt mit Unterstützung des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig.Das dieser Publikation zugrunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundes-ministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01UG0710 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015Druck: Laupp & Göbel GmbH, NehrenGedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier. Printed in Germany.ISBN 978-3-515-10999-4
Umschlagabbildung: Die Ölmühle im Freilichtmuseum Veselý kopec (Ostböhmen, Bez. Chrudim), Aufnahme: Lucie Galusová
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.................................................................................................................... 7
Wassernutzung im Mittelalter
Tomáš KlimekThe Perception of Rivers and other Watercourses in the Czech Middle Ages...... 13
Nadine SohrDie Elbe als Wirtschaftsfaktor im nordwestlichen Böhmen im Spiegel urkundlicher Quellen des Hoch- und Spätmittelalters .......................................... 41
Barbora KocánováAlles hängt vom Wetter ab: die Voraussage der Witterung in lateinischen Quellen des Mittelalters ................................................................ 49
Jaroslav JásekAn Attempt at an Outline of the Historical Development of Water Supply and Sewerage of Medieval Settlements in the Czech Lands ................................ 57
Mühlen in Landschaft, Wirtschaft und Wahrnehmung
Winfried SchichDie Bedeutung der Wassermühle für die zisterziensische Klostergemeinschaft im 12. und 13. Jahrhundert ................................................................................... 77
Lenka PanuškováDie Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters ................................................... 99
Sascha BütowMühlen, Dämme und Flutarchen im Spreewald – Die Nutzung von Wasserwegen am Mittellauf der Spree im 15. und 16. Jahrhundert............. 119
Jaroslava ŠkudrnováDie Rosenberger Wassermühlen an der Schwelle der Neuzeit ........................... 131
Stanisława SochackaDie Namen der Wassermühlen in Schlesien ....................................................... 163
Monika Choroś, Łucja JarczakSchlesische Orts- und Flurnamen mit dem Glied Mühle/młyn .......................... 173
6 Inhaltsverzeichnis
Christian ZschieschangZur Benennung von Mühlen im Mittelalter ........................................................ 193
Sachrelikte mittelalterlicher Mühlen
Jens BertholdMühlen im Befund – Eine Übersicht zu archäologischen Erscheinungsformen von Wassermühlen .............................................................................................. 235
Gerson H. JeuteZur Verbreitung der hochmittelalterlichen Mühle aus archäologischer Sicht ..... 269
Wolfgang CzyszMühlsteinhauer im bayerischen Inntal ................................................................ 279
Lucie Galusová, Martina MaříkováDie Baugestalt der Wassermühlen im mittelalterlichen Böhmen und Mähren ... 309
Farbabbildungen ................................................................................................. 325
Vorwort
Mühlen faszinieren. Die frühen Reibe- und Handmühlen mögen als alltägliche, kräftezehrende Haushaltsgeräte diese Faszination noch nicht ausgestrahlt haben; als aber Maschinen aufkamen, die sich anderer Energieressourcen bedienten als der menschlichen Muskelkraft – der, wie man es heute nennt, erneuerbaren Energien Wind und Wasser – werden sie dem Bewohner der ländlich geprägten Regionen Mitteleuropas als Wunderwerke erschienen sein, und er wird es kaum möglich ge-halten haben, dass es in diesen klappernden und quietschenden hölzernen Konst-ruktionen mit rechten Dingen zuging. Entsprechenden Respekt wird ihm der Müller eingeflößt haben, der diese Technik bediente und offenbar – mit wessen Hilfe auch immer – beherrschte. Die Wind- oder Wassermühle war in ihrer „Bedeutung eines technologischen Basis- oder Kernsystems“1 ein besonderes Objekt in der agrarisch geprägten Siedlungslandschaft, ein früher Vorreiter der später rapide zunehmenden Technisierung der Lebenswelt.
Die Faszination setzte sich fort, als nicht nur „verwunschene“ Ruinen und pit-toreske Landschaftsbilder, sondern auch oft abseits gelegene und, abgesehen von den produktionsbedingten Geräuschen, still anmutende Mühlen den Erwartungen der Romantiker entsprachen. In Liedern, Märchen und Sagen, seien sie dem Munde des Volkes entnommen, künstlerisch nachbereitet oder gänzlich dem Hirn des ro-mantiksuchenden Poeten entsprungen, tauchten sie als beliebte Handlungsorte und Topoi auf. Dies bildete den Nährboden für eine Sicht auf die Mühle, die quasi den Kontrapunkt setzte zu dem, was sie schon immer gewesen ist. Denn eigentlich han-delte es sich um ein technisches Instrument zur Nutzbarmachung des Landes und seiner Erträge, zur Verarbeitung seiner Produkte – beileibe nicht nur Getreide und Stammholz – sowie um ein Mittel zur Steigerung von Einkünften und Macht, wozu eine Hebung der Prosperität eines Landes mittels technischer Umgestaltungen letzt-lich führte. Dieser sehr prosaische Kontext könnte ebenfalls als Faszination apost-rophiert werden, und zwar in einem Sinne, der heute Technikgläubigkeit genannt wird – die Vorstellung, dass mit technischen Maßnahmen alles verbessert und er-reicht werden kann.
Dieser technikgläubigen Faszination, die wohl eine Kontinuande im Umgang mit Mühlen ist, wurde der genannte Kontrapunkt just in dem Moment gegenüber-gestellt, als sie sich anschickte, mehr als jemals zuvor in die Landschaft einzugrei-fen, als die Nutzung der Wasser- und Windkraft als nicht mehr ausreichend erschien und die mächtigen Kohlelagerstätten zunehmend erschlossen wurden, so dass bald eine Industrielandschaft entstanden war. In dieser musste die Wind- und Wasser-mühle, sofern sie nicht umgebaut, abgerissen oder in ruinösem Zustand missachtet wurde, tatsächlich den Anschein einer naturverbundenen, oasenartigen Idylle ha-ben, ein Image, das der alten Mühle letztlich bis heute zukommt und von dem sie nunmehr im Kontext eines prosperierenden Ausflugs- und Tourismuswesens profi-tiert.
1 Bayerl, Günter: Technik in Mittelalter und Früher Neuzeit, Stuttgart 2013, S. 116.
8 Vorwort
Mit der Thematik des vorliegenden Bandes hat dies freilich nur wenig zu tun. Es wäre jedoch noch anzuschließen, dass auch in der Wissenschaft Mühlen für Faszination sorgen, ihre Erforschung allerdings auch mit Problemen verbunden ist. So ist die massenhafte Existenz von Wasser- und evtl. auch Windmühlen für die wirtschaftlichen Grundlagen der Siedlungslandschaften, wie sie im hohen Mittelal-ter in den Siedlungslandschaften Ostmitteleuropas aufgebaut wurden, strukturell unabdingbar. Tatsächlich finden sich diese Mühlen auch in der Nähe beinahe jedes Ortes, allerdings – und das ist die große Crux – auf den Meßtischblättern der mo-dernen Landesvermessung, in der baulichen Gestalt der Neuzeit und frühestens in frühneuzeitlichen Quellen. Unmittelbar für das Mittelalter oder gar für die anzuneh-mende Entstehungszeit vom 12. bis zum 14. Jahrhundert bleiben die einschlägigen Quellen meist wortkarg. Auch die Archäologen sind hier in keiner vorteilhafteren Situation.
Will man also zur Gewässernutzung im Mittelalter forschen, wie es am GWZO mit der Projektgruppe „Usus aquarum: Mühlenbau, Wasser und Verkehr im hoch-mittelalterlichen Landesausbau Ostmitteleuropas“ in den Jahren 2011–2013 getan wurde (und in einem nachfolgenden Projekt 2014–2016 auch weiterhin getan wird), lässt sich nicht einfach in eine üppige Fülle der Quellenüberlieferung eintauchen; vielmehr muss zwar nicht gerade nach der Nadel im Heuhaufen, aber nach aussage-kräftigen Dokumenten und Befunden gesucht werden. Diese sind durchaus zu fin-den, aber sie bedürfen der Einordnung in einen umfassenderen wissenschaftlichen Kontext, was wir mit der Tagung, welcher die Beiträge dieses Bandes entsprungen sind2, versucht haben. Hierfür durften wir am 12. und 13. April des Jahres 2013 eine größere Zahl von Wissenschaftlern im GWZO als Vortragende und Diskutanten begrüßen. Dass sich insgesamt beinahe 50 Personen an der Veranstaltung beteilig-ten, zeigt, dass es sich um eine Thematik handelt, die nicht nur einen kleinen Kreis akademischer Forscher anspricht, sondern eben immer noch fasziniert. Für ihre Re-debeiträge, von denen die überwiegende Zahl hier zum Druck kommt3 und für die anregenden Diskussionen ist allen Beteiligten herzlich zu danken.
Es lag dabei in der Natur der Sache, dass die Beiträge den ursprünglich beab-sichtigten Fokus auf Böhmen und Mähren weit überschreiten, ja sogar nicht einmal innerhalb des ostmitteleuropäischen und mittelalterlichen Rahmens blieben. Hier-bei ist nicht zu vergessen, dass es nicht ausschließlich um Mühlen, sondern allge-mein um die Wassernutzung geht. Gerade diese Grenzüberschreitungen machen aber aus unserer Sicht die vorliegende Sammelschrift besonders wertvoll, weil sie die relativ wenigen aussagekräftigen, dabei aber sehr vielgestaltigen Quellen und Befunde aus dem östlichen und dem westlichen Mitteleuropa zusammenführen und miteinander in Beziehung setzen. In diesem Sinne wurde einer thematisch orien-
2 Die Beiträge von Lenka Panušková und Jaroslava Škudrnová gehen auf Projektvorträge am 5.6.2013 bzw. 10.7.2013 im GWZO zurück. Wir haben sie aufgrund ihrer thematischen Affini-tät hier mit aufgenommen.
3 Der Vortrag von Matthias Hardt mit dem Titel „Wasserwirtschaft des Klosters Broda“ wird im Rahmen der in Vorbereitung befindlichen Publikation der interdisziplinären Tagung „Klöster und Stifte in Mecklenburg“ (Rostock, 14.–16.10.2010) erscheinen.
9Vorwort
tierten Anordnung der Beiträge – so knifflig und diskussionswürdig sie im Detail oft sein mag – der Vorzug gegenüber einer alphabetischen Reihenfolge gegeben.
Ein besonderer Dank gilt Lucie Galusová, die als Dritte im Bunde unserer Pro-jektgruppe einen großen Anteil an der Organisierung und Durchführung der Tagung hatte, aber nach dem Auslaufen des Projekts aufgrund anderer Verpflichtungen an der Drucklegung leider nur in geringem Maße mitwirken konnte. Im Kontext der Tagung ist zu danken Helmut Notzke vom Arbeitskreis Mühlen Sachsen-Anhalt e. V., Katrin Reschke von der Dölitzer Wassermühle, Petra Mücke und Dagmar Sommer von der Landesschule Pforte sowie der Familie Schäfer als Eigentümer und Betreiber der Mühle Zeddenbach bei Freyburg/Unstrut. Sie alle haben dafür gesorgt, dass die Tagung nicht nur aus wissenschaftlichen Vorträgen bestand, son-dern auch eine praktische Komponente erhielt, indem sie uns Mühlen vom Mittel-alter bis zur industriellen Zeit nahebrachten. Später dann unterstützte uns Doris Wollenberg maßgeblich bei der Redaktion der eintreffenden Manuskripte. Im Grunde trug sie die Hauptlast dieses Arbeitsschrittes und versah dies mit großer Umsicht, mit Konsequenz und Geduld. Auch Christoph Mielzarek nahm an der Fertigstellung des Bandes tatkräftigen Anteil. Schließlich danken wir Sarah-Vanessa Schäfer vom Verlag Franz Steiner für die reibungslose und professionelle Bearbei-tung des Satzes.
Dass das GWZO Publikationen dieser Art ermöglicht, ist nicht selbstverständ-lich hinzunehmen, sondern beruht auf dem stetigen Einsatz seines Direktors, Prof. Dr. Christian Lübke, des zuständigen Fachkoordinators für mittelalterliche Ge-schichte und Archäologie, Prof. Dr. Matthias Hardt, den Mitarbeiterinnen der Ver-waltung des GWZO und den Verantwortlichen der geldgebenden Gremien, in die-sem Falle des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das die Herstellung und Drucklegung dieses Bandes finanzierte.
Im Sommer 2014Martina Mařiková und Christian Zschieschang
Lenka Panušková
Die Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters*
Einleitung
Die theologische Exegese im Mittelalter bediente sich häufig der Allegorie; im Rahmen der sogenannten Quadriga – der vierfachen Bibelauslegung – war die al-legorische Interpretation die bedeutendste.1 Sie findet ihre Begründung in der Hei-ligen Schrift selbst: In seinem Brief an die Galater 4, 242 erläutert der Apostel Pau-lus am Beispiel von Sarah und Hagar die allegorische Bedeutung des Alten für die Geschehnisse des Neuen Testaments. Demnach sollten die Handlungen und Ak-teure des Alten Testaments allegorisch als Vorbilder bzw. Typen Christi aufgefasst werden. Infolgedessen wurde die Allegorie zum notwendigen Kernpunkt der mit-telalterlichen Typologie. Bei der Allegorie handelt es sich verallgemeinert betrach-tet um eine nicht wörtliche Auslegung einer Sache, die aufgrund eines inneren Zu-sammenhangs auf eine höhere Wahrheit hinweist. Dieses Prinzip wurde sowohl von den literarischen Gattungen als auch der darstellenden Kunst aufgenommen. Die im Mittelalter besonders geschätzte Mühlenallegorie liefert dafür einen vorzüglichen Beweis. Sie hatte eine zweifache Bedeutung, die auch in den darstellenden Künsten zum Ausdruck kam. Demzufolge lassen sich zwei verschiedene Bildtypen der Mühlenallegorie unterscheiden.3 In dem älteren Bildtypus entwickelt die Mühlen-allegorie eine Polarität zwischen der alttestamentlichen Synagoge und der neutesta-mentlichen Ecclesia – Kirche. Laut Peter Heimann4 blieb dieser Typus auf das 12.
1 dahan, Gilbert: Les usage de l´allégorie dans l´exégèse médiévale de la Bible: exégèse monas-tique, exégèse universitaire. In: L’allégorie dans l’art du Moyen Age. Formes et fonctions. Héritages, créations, mutations. Hg. v. Christian heCk. Turnhout 2011, 25–35. Allegoria, Anagogia, Historia und Tropologia waren in der Exegese die Hauptprinzipien für die Auslegung des Worts Gottes. Selbst die höchsten Kirchenautoritäten warnten vor einer wörtlichen Ausle-gung der Bibel, denn vieles in der Heiligen Schrift lässt mehrere Interpretationen zu, die im typologischen Einklang des Alten und Neuen Testaments verfließen. – D. h. das Alte und Neue Testament sind typologisch verbunden – die Ereignisse im AT galten als Vorbilder der neutes-tamentlichen Geschichten, demzufolge gibt es keine Opposition darin, wenn eine Bibelge-schichte mehrfach ausgelegt wird, denn alles weist auf das Jüngste Gericht und auf das endzeit-liche Heil des Menschen.
2 „Scriptum est enim quoniam Abraham duos filios habuit unum de ancilla et unum de libera sed qui de ancilla secundum carnem natus est qui autem de libera per repromissionem quae sunt per allegoriam dicta haec enim sunt duo testamenta unum quidem a monte Sina in servitutem ge-nerans quae est Agar.“ (Galater 4, 22–24).
3 heimann, Peter: Mola Mystica: Wandlungen eines Themas mittelalterlicher Kunst. In: Zeit-schrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 39 (1982), 229–250.
4 Ebd., 229.
* Dieser Beitrag entstand mit der Unterstützung des Drittmittelprojektes Imago/Imagines: Das Kunstwerk und die Veränderungen seiner Funktion in den mittelalterlichen böhmischen Län-dern, Nr. GA ČR 13-39192S/2013–2017.
100 Lenka Panušková
Jahrhundert beschränkt. Der zweite Typus taucht hingegen erst an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert auf (1399–1400) und war vor allem in der Tafelmalerei verbreitet. Im Fokus dieser Allegorie stehen die Menschwerdung Christi und die Transsubstantiationslehre, die bei dem älteren Typus nicht vorkommt.5
Mein Ziel ist es, diese Unterscheidung weiter herauszuarbeiten und mich näher mit den Interpretationsmöglichkeiten zu beschäftigen, um die sich ändernde Funk-tion dieses Motivs in der mittelalterlichen Kultur aufzuzeigen.
Die Mahlarbeit in der Bibel: Das Manna und das Corpus Christi
Zwar gibt es nur zwei Bibelstellen, in denen die Mühle bzw. das Mahlen erwähnt wird, diese wurden jedoch bereits mehrfach von Theologen und Exegeten aufge-griffen und in einen typologischen Kontext gestellt.
Im Numeri, dem vierten Buch Mose,6 wird die Verarbeitung von Manna, dem Himmelsbrot, mithilfe von Mühle und Mörser geschildert. An anderen Stellen des Pentateuchs erfahren wir, dass Gott das Manna vom Himmel zu seinem Volk Israel sandte, um dessen Hunger zu stillen. Im Neuen Testament dient das Motiv der Him-melsspeise zur Hervorhebung des Opfers Christi. Jesus nennt sich selbst „das Brot des Lebens“, das ewiges Leben schenkt. Die typologische Parallele findet ihren Höhenpunkt im Abendmahl, als Christus das Brot und den Wein an seine Jünger verteilte als seinen Leib und sein Blut. Damit sollte die Menschheit ihren Anteil am Himmel wiedergewinnen, der durch den Ungehorsam Adam und Evas verloren ging. Die allegorische Beziehung zwischen dem täglichen materiellen Brot und dem spirituellen, ewiges Leben spendenden Brot, d. h. zum Leib Christi, liegt auf der Hand. Vor allem im 14. und 15. Jahrhundert, einer Zeit der besonders intensiven Corpus-Christi-Frömmigkeit, gewann diese allegorische Verknüpfung an Populari-tät, sowohl in der Literatur als auch in der darstellenden Kunst, und zwar im Bild einer mystischen Mühle.
Die neutestamentliche Verheißung des Jüngsten Gerichts
Darüber hinaus muss noch eine der neutestamentlichen Parabeln genannt werden, die den Tag des Jüngsten Gerichts schildert, an dem der Menschensohn offenbart wird. Hier führt Christus das Bild von zwei Getreide mahlenden Frauen an,7 von
5 Im weiteren Verlauf dieses Beitrags möchte ich zeigen, dass dem ersten Typus vor allem die Komplementarität beider Testamente im Sinne der paulinischen Typologie immanent ist.
6 „Circuibatque populus et colligens illud frangebat mola sive terebat in mortario coquens in olla et faciens ex eo tortulas saporis quasi panis oleati.“ (Numeri 11, 8).
7 Die Parabel Christi wurde sowohl von Lukas als auch von Matthäus in ihr Evangelium aufge-nommen: „Dico vobis illa nocte erunt duo in lecto uno unus adsumetur et alter relinquetur duae erunt molentes in unum una adsumetur et altera relinquetur duo in agro unus adsumetur et alter relinquetur.” Lk (17, 34–35)
101Die Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters
denen eine im Himmel angenommen, die zweite aber abgewiesen wird. Schon die Kirchenväter8 sahen darin das typologische Verhältnis von Ecclesia und Synagoge, indem der Synagoge das Weizenmahlen misslang, denn sie schüttete den nassen Weizen in den Trichter, so dass das Korn kaum von den Spelzen zu trennen war. Anders erging es der Ecclesia, die den in der ewigen Sonne getrockneten Weizen mahlte und deren von allen Sünden freies Opfer von Gott angenommen wurde. Der Benediktiner und einer der hervorragendsten Gelehrten der mittelalterlichen Kir-che, Rupert von Deutz (um 1070–1129), befasste sich eingehend mit diesem Gleichnis in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium.9 Er deutete das Wei-zenkorn (frumenti granum) als Hinweis auf Christus und dessen Opfer. Rupert war der Ansicht, aus dem von Gottes Hand gemahlenen Mehl könne das Brot gebacken werden, das den Menschen ewiges Leben schenkt. Weiterhin deutet er die beiden Mahlsteine als Allegorien des Alten und Neuen Testaments. Der untere Stein steht demnach für die alttestamentlichen Prophezeiungen, die sich mit der Ankunft Christi erfüllen. Der obere Stein versinnbildlicht die Evangelisten, die christolo-gisch gedeutet werden.
Im Hortus Deliciarum10, dem klassischen Werk für den theologischen Diskurs des Mittelalters, das unter der Leitung von Herrad von Landsberg (Äbtissin 1167–
„Sicut enim erant in diebus ante diluvium comedentes et bibentes nubentes et nuptum tradentes usque ad eum diem quo introivit in arcam Noe et non cognoverunt donec venit diluvium et tulit omnes ita erit et adventus Filii hominis tunc duo erunt in agro unus adsumetur et unus relinque-tur duae molentes in mola una adsumetur et una relinquetur. Vigilate ergo quia nescitis qua hora Dominus vester venturus sit.” (Mt 24, 37–42) Zwar wiederholen beide Evangelisten das Bild der beiden mahlenden Frauen und den Hinweis auf das bevorstehende Jüngste Gericht, den-noch betont Matthäus die Mahnung Christi an die Menschen, wachsam und stets auf die An-kunft Gottes vorbereitet zu sein. Obwohl diese Mahnung im Lukasevangelium nicht enthalten ist, wird das Motiv der beiden schlafenden Männer oft als Hinweis auf eben jene Wachsamkeit gedeutet. Siehe weiter im Text, Seite 102.
8 Ambrosius von Mailand: In Lucam, In: Patrologiae cursus completus, Series Latina. Hg. v. Jacques-Paul miGne, Bd. 1–221. Paris 1844–1865, hier Bd. 15, 1779: „Sed tamen quid molant istae duae mulieres, requirendum est […]. In hoc ergo pistrino vel Synagoga, vel anima ob-noxia delictis, triticum molendo madefactum, et gravi humore corruptum, non potest interiora ab exterioribus separare; et ideo relinquitur, quia ejus similago displicuit. At vero sancta Eccle-sia, vel anima nullis maculata contagiis delictorum, quae tale triticum molet quod solis aeterni calore sit torridum, quod Deus quemadmodum voluit, sic vestivit, et angeli ab omni purgamen-torum labe mundarunt, bonam similaginem de penetralibus hominum Deo offerens, sacrificii sui libamenta commendat.”
9 Commentarium in Mattheum, PL 168, 1556C-D: „Haec prophetica quasi mola inferior po-nenda est, et coepta jam evangelica narratio Dominicae passionis superponenda quasi mola superior, ut agente manu Domini, circumacta volucri cursu, fructuosum frumenti granum salu-briter nobis teramus, et de optima ejus medulla candidissimae farris panem in usum vitae aeter-nae conficiamus. Tale frumenti granum Christus est, qui de semetipso dicit: ‚Nisi granum fru-menti cadens in terram, mortuum fuerit, ipsum solum manet, si autem mortuum fuerit, multum fructum affert (Joan. XII).‘ Tale, inquam, granum est, ut molendo nunquam dissipetur, eoque integro permanente diffundi aut dissilire nunquam desinet medulla ejus. Nunc interim finis hic sit libelli hujus, et sequentem cum jam dicto prophetiae capitulo, reparatis post lassitudinem viribus, exordiamur.“
10 Die Originalhandschrift wurde leider 1870 bei einem Brand infolge eines Bombenangriffs auf die Bibliothek in Strassburg zerstört. Jedoch fertigte Christian Maurice Engelhardt 1818 eine
102 Lenka Panušková
1195) kompiliert wurde, erscheint das neutestamentliche Gleichnis in seiner vollen Narrativität. Es enthält eine Szene von einer an der Mühle stehenden Frau zwischen den Darstellungen schlafender und auf dem Feld arbeitender Männer. Es liegt also auf der Hand, dass der Bildzyklus beide biblischen Berichte komplementär behandelt, obgleich der Darstellung beider Frauen eine deutlich größere Bedeutung zukommt, denn die Handschrift wurde primär für das Nonnenkloster St. Odilien und dessen Angehörige angefertigt. Sie sollte den Kanonissen zur Belehrung und die Meditation bzw. Kontemplation dienen.11 Was sich an dem Bild als besonders bemerkenswert erweist, ist die technisch sehr präzise Zeichnung einer Wasser-mühle, der schon Vitruv im letzten seiner „Zehn Bücher über Architektur“ eine ausführliche Beschreibung widmete. Aus dem Vergleich des Vitruvschen Textes mit der Mühlenzeichnung geht hervor, dass der technologische Aufbau des mittelalter-lichen Mahlwerkes grundsätzlich seiner antiken Konstruktion entsprach:12 Am Ende einer Wasserradwelle ist ein senkrecht gestelltes Zahnrad, auch Kammrad genannt, angebracht, das sich mit dem Schaufelrad in dieselbe Richtung dreht. Das Kammrad greift mit seinen Zähnen in das Stockgetriebe der vertikalen Mahlgangs-spindel ein, womit der Läuferstein des Mahlganges gedreht wird. An das in der Seitensicht abgebildete untere Gerüst mit dem Wellbaum soll eine obere Konstruk-tion mit dem Bodenstein und dem Mühleisen anknüpfen; die allerdings unsichtbar bleibt, weil sie in der Draufsicht dargestellt ist, während der Trichter mit dem Rüt-telstock (rotabulum) von der Seite abgebildet ist. Wie schon der Wortbezeichnung des Rüttelstockes zu entnehmen ist, wird mit seiner Hilfe der Trichter in eine rüt-telnde, d. h. schnelle Hin- und Her-Bewegung gebracht, um eine gleichmäßige Mahlgutzufuhr zu ermöglichen. Das Beutelwerk, das eigentlich allen bekannten mittelalterlichen Mühlendarstellungen gemein ist, fehlt hier jedoch. Trotzdem gilt die technologische Skizze als die älteste und zugleich authentischste Abbildung einer Wassermühle.
Doch zurück zum eigentlichen Thema. Im Grunde genommen handelt es sich hier um eine in der mittelalterlichen Kunst sehr seltene Ikonografie; andere neutes-tamentliche Parabeln des Jüngsten Gerichts wurden viel häufiger bildlich umge-setzt, z. B. Lazarus im Schoß Abrahams usw. Doch war dieses Gleichnis mit seinem allegorischen Hinweis auf die Ecclesia und Synagoge im Laufe des 12. Jahrhun-derts recht populär und seine Aufnahme in Herrads Hortus könnte direkt von Rupert von Deutz beeinflusst worden sein. Denn Ruperts exegetische Gedanken wurden darin mehrfach berücksichtigt. Ebenso muss das Bild der beiden Frauen, die Pola-rität zwischen zwei Seelen, besonders aber die Darstellung derjenigen, die von Gott
Kopie der Miniaturen an, die als Grundlage für eine Rekonstruktion der Handschrift Anfang des 20. Jahrhunderts diente.
11 GriFFiths, Fiona J.: The Garden of Delights: Reform and Renaissance for Women in the Twelfth Century. Philadelphia 2007.
12 Das Folgende nach maGer, Johannes / meissner, Günther / orF, Wolfgang: Die Kulturge-schichte der Mühlen. Leipzig 1988, 15–16. Zur Kenntnis von Vitruvs De Architectura im Mit-telalter siehe sChuler, Stephan, Vitruv im Mittelalter: Die Rezeption von „De Architectura“ von der Antike bis in die frühe Neuzeit. Wien 1999, besonders 151–164.
103Die Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters
angenommen wird, ein erstrebenswertes Vorbild für die frommen Kanonissen ge-wesen sein.
Das 12. Jahrhundert liefert uns noch ein anderes Beispiel für eine Abbildung der zitierten neutestamentlichen Parabel. Es handelt sich um eine I(gitur)-Initiale im Homiliar aus Verdun,13 mit der eine Homilie von Maximus Taurinensis (ca. 420) zum ersten Adventssonntag beginnt.14 Der Autor befasst sich hier mit der Frage der Wiederkunft Christi, indem er mehrere Ankündigungen aus dem Neuen Testament aufzählt, darunter auch die besprochene Stelle aus dem Matthäusevangelium. Im Gegensatz zur Auffassung im Hortus Deliciarum ist hier das ikonografische Schema deutlich allegorisch umgedeutet und wird mit einem unmittelbaren Hinweis auf die endzeitliche Erhöhung der Gerechten im Himmel und der Verdammung der Sünder im Leviathan versehen. Die Polarität zwischen dem Schoß Christi, dem Paradies oben und der Hölle der Verdammten unten, wird durch die Vertikalität des Buchsta-bens besonders eindringlich. Zwischen Himmel und Hölle liegen zwei Männer: Jener, der im Himmel angenommen wird, erfährt eine Visio Paradisi. Die Tonsur und auch die Beischrift Petrus erlauben es, den Mann einerseits als Darstellung Petri, des ersten Bischofs von Rom, zu identifizieren, andererseits den Heiligen als Vorbild einer seligen und nachahmenswerten Lebensweise zu betrachten. Die an-dere schlafende Figur hat im Gegensatz zu Petrus geschlossene Augen und lässt sich als Nero als dem Prototypen aller Sünder identifizieren. In Bezug auf die Exe-gese wird dadurch die gute und die böse, sündige Seele, bzw. das Christentum als Ecclesia versus Heidentum, exemplarisch personifiziert. Dasselbe gilt für die dar-unter stehenden Frauen, zwischen denen zwei Mahlsteine liegen. In diesem Fall werden Glaube und Unglaube mit den Personifikationen der Ecclesia mit Kreuzstab und einer ein Böcklein tötenden Synagoge mit verhüllten Augen dargestellt. Dem-zufolge können die Mahlsteine mit dem typologischen Paar der Ecclesia und Syna-goge gleichgesetzt werden, bzw. auf die Beziehung des Alten und Neuen Testa-ments hinweisen. Damit kann eine Brücke zur mystischen Bedeutung bzw. zur al-legorischen Auslegung beider Mahlsteine geschlagen werden. Während also die Mühlendarstellung im Hortus Deliciarum allegorisch als Bild des erwarteten Jüngsten Gerichts anzusehen ist, sind es vor allem die Frauengestalten, bzw. der
13 Verdun, Bibliothéque Municipale, Ms. 121, um 1175, Fol. 1r.14 Zur Persönlichkeit Maximi und seiner Homiletik siehe merkt, Andreas: Die Verkündigung
eines Bischofs der frühen Reichskirche im zeitgeschichtlichen, gesellschaftlichen und liturgi-schen Kontext. Brill 1997 (Vigilae Christianae, Supplements, Vol. 40). Das Bild der beiden mahlenden Frauen muss bis in das späte Mittelalter sehr populär gewesen sein, denn noch 1552 will der protestantische Pfarrer Johannes Winnigstedt einen Teil einer Mühlenallegorie gelesen haben, wie er im Vorwort seines Mühlenlieds erwähnt: „[er] ein teil hat genommen aus einem Sermon des hl. Maximi, welcher der siebende Bischoff zu Mentz ist gewesen/ vnd hat solchs gepredigt vber das siebende Capittel Luce. Denn werden zwene malen mit einander in einer Mülen […]“ Zitiert nach ryeClausen, Harald: Hostienmühlenbilder im Lichte mittelalterli-cher Frömmigkeit. Stein am Rhein 1981, 27. Rye-Clausen meint jedoch, es handele sich um den hl. Maximus, den Bischoff von Mainz, der 387 gemartert wurde. Von ihm ist jedoch kein Werk erhalten. Umso mehr stellt sich hier die Frage, ob die beiden Heiligen in der spätmittel-alterlichen Tradition verwechselt wurden, bzw. ob Winnigstedt selbst sich verschrieben hat.
104 Lenka Panušková
Engel in der oberen Bildecke, die diese Allegorie zum Ausdruck bringen. Die Mühle spielt hier nur eine Nebenrolle als reales Attribut.
Die Mühlenallegorie in Sugers anagogischem Fenster
Zum aktiven Bedeutungsträger entwickelt sich die Mühlendarstellung in anderen Beispielen des 12. Jahrhunderts, deren Inhalt ebenfalls stark typologisch geprägt ist. Kein Wunder, denn im Laufe des 12. Jahrhunderts erreichte die Vorliebe für typologische Parallelismen ihren Höhenpunkt. Die Concordia Veteris et Novi Testamenti kommt vortrefflich im Programm des sogenannten anagogischen Fensters in der Kathedrale von Saint Denis zum Ausdruck, das vom damaligen Abt Suger15 entworfen wurde, sowie im Säulenkapitel der Kathedrale Saint Madeleine in Vé-zelay.
Zwar wurde Sugers Fenster am Ende des 18. Jahrhunderts schwer beschädigt, das ikonografische Konzept ist uns jedoch in Form der Rechenschaftsberichte über-liefert, die Suger unter dem Titel De rebus in administratione sua gestis von 1146 bis 1149 verfasste.16 Er behandelt darin die Chorfenster, von denen das dritte den Übergang vom Materiellen zum Immateriellen versinnbildlichen sollte.17 Prinzipi-ell entspricht dieser Gedanke dem Vorgang der Emanation, die der neuplatonischen Philosophie entstammt.18 Demnach können die theoretischen Grundlagen der goti-schen Architektur und der Kathedrale als ihrer Inkarnation in der neuplatonischen Lehre gesucht werden, mit der Abt Suger19 persönlich sehr gut vertraut war. Das ikonografische Konzept des anagogischen Fensters entstammt demzufolge auch
15 Abt von Saint-Denis von 1122 bis zum seinen Tod in 1151.16 panoFsky, Erwin: Abbot Suger: On the Abbey Church of St.-Denis and Its Art Treasures. Princ-
eton 21979 1[1946].17 „Vitrearum etiam novarum preaclaram varietatem, ab ea prima quae incipit a Stirps Jesse in
capite ecclesiae usque ad eam quae superest principali portae in introitu ecclesiae, tam superius quam inferius magistrorum multorum de diversis nationibus exquisita depingi fecimus.“ Zitiert nach panoFsky (wie Anm. 16), 72. Zum anagogischen Fenster siehe hoFFmann, Konrad: Sugers „anagogisches Fenster“ in St. Denis. In: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 30 (1968), 57–88.
18 Demnach ist die visuelle, materielle Welt nur eine Emanation aus dem Ganzen, die jedoch von niedrigerer Qualität ist. Je weiter entfernt das emanierte Sein vom transzendenten Ganzen steht, desto mehr verliert es an Vollkommenheit, die dem Ganzen eigen ist. Eine christianisierte Deu-tung der neuplatonischen Lehre wurde von dem Konvertiten Pseudo-Dionysos Aeropagita (Ende 5. bis Anfang 6. Jahrhundert) in dem Traktat „Über die himmlische Hierarchie“ [De co-elestis Hierarchia] zusammengefasst. Es zählte zu den einflussreichsten Schriften, sowohl bei den frühchristlichen Kirchenvätern, z. B. dem Heiligen Augustinus, als auch später zur Zeit der sogenannten karolingischen Renaissance, besonders bei Johannes Scotus Eriugena, und dann im Rahmen der Renaissance des 12. Jahrhunderts.
19 Der Pseudo-Dionysios Aeropagita war für Suger und die ganze Abtei von größter Bedeutung, denn die Identifikation des Heiligen Märtyrers Denis († ca. 250) mit dem konvertierten Neupla-toniker Pseudo-Dionysios lässt sich ungefähr in das 9. Jahrhundert datieren. Zu dieser Zeit glaubte man, dass es sich bei dem Heiligen Denis und dem in der Apostelgeschichte erwähnten Dionysios Aeropagita um dieselbe Person handelte. Die Identität dieser drei Personen war in der Kommunität der dortigen Mönche dermaßen verwurzelt, dass ihr Bruder, der Scholastiker Peter Abelard, gezwungen wurde, den Konvent zu verlassen, als er versuchte, sie zu bestreiten.
105Die Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters
dem christianisierten Neuplatonismus. Doch selbst den Übergang vom Materiellen zum Immateriellen definiert die Anagogie an sich, die zusammen mit der Historia, Allegoria und Tropologia die Quadriga der biblischen Exegese bildete.20
Die Anagogie lieferte also zweifelsohne die Grundstruktur für das Bild-programm, zumindest des dritten Fensters, das Suger folgendermaßen beschrieb: „Paulum Apostolum molam vertere, Prophetas saccos ad molam apportare repra-esentat. Sunt itaque eius materiae versus isti:‚Tollis agendo molam de furfure, Paule, farinam.Mosaicae legis intima nota facisFit de tot granis verus sine furfure panisPerpetuusque cibus noster et angelicus.‘Item in eadem vitrea, ubi aufertur velamen de facie Moysi:‚Quod Moyses velat, Christi doctrina revelat.Denudant legem, qui spoliant Mosen.‘In eadem vitrea super arcam Foederis:‚Foederis ex arca Christi cruce sistitur ara;Foedere maiori vult ibi vita mori.‘Item in eadem, ubi solvunt librum leo et agnus:‚Qui Deus est magnus, librum solvit Leo et Agnus.Agnus sive Leo fit caro iuncta Deo.‘“21
Weil sich dieser Aufsatz mit der Erforschung der Allegorie der mystischen Mühle beschäftigt, beschränke ich mich lediglich auf die Analyse des anagogischen Fens-ters, jedoch unter Einbeziehung einiger Details zweier anderer Fenster, die meiner Meinung nach für das adäquate Verständnis des Ganzen von Bedeutung sind.
Die Rekonstruktion des anagogischen Fensters aus dem 19. Jahrhundert zeigt im zentralen Medaillon die Szene mit der Paulus-Mühle, welche von Paulus selbst gedreht wird und zu der zwei Propheten Kornsäcke bringen. Im Vergleich zur Müh-lendarstellung in der Hortus Deliciarum-Handschrift wird die Mühle hier von Men-schenkraft in Bewegung gesetzt. Der eigentliche Mahlvorgang ist jedoch als Erklä-rung der alttestamentlichen Prophezeiung der Erklärung des Gesetzes Mose (Mosaicae legis) zu verstehen. Letzteres offenbart sich durch die Arbeit Pauli.22 In der zitierten Beschreibung heißt es weiter, dass aus dem Überfluss an Getreide das wahre Brot zubereitet wird, unser und der Engel ewiges Mahl, das panis angelorum. Der eucharistische Kontext ist offensichtlich, wenn aus dem offenbarten und gesprochenen Wort ein wahrer Mensch – Christus – wird, der gekommen ist, um zum Brot der ganzen Menschheit zu werden.23 Die metaphorische Ausdeutung der
20 dahan (wie Anm. 1), 1.21 Zitiert nach panoFsky (wie Anm. 16), 74.22 Die Anwesenheit des Heiligen Paulus an der Mühle ist kaum zufällig, weil Dionysius, der
Heilige Denis, gemäß der mittelalterlichen Hagiographie zu den Athenern gehörte, die durch das Predigen Pauli in der griechischen Stadt zum Christentum bekehrt wurden.
23 Gerade zur Zeit Sugers begann man, die eucharistische Lehre systematisch zu formulieren, bis der eucharistische Kult seinen Höhenpunkt am Anfang des 14. Jahrhunderts erreicht hatte, als das Corpus-Christi-Fest (Fronleichnam) offiziell in den kirchlichen Kalender eingeführt wurde. Siehe: ruBin, Miri: Corpus Christi: The Eucharist in Late Medieval Culture. Cambridge 1991.
106 Lenka Panušková
Offenbarung des Gesetzes, das Mose von Jahve auf Sinai erhielt, erfolgt im Medail-lon, das sich heute über der Mühlenallegorie befindet und in dem die symbolische Entschleierung des Gesichts Mose dargestellt ist. Diese Entschleierung des Alten Testaments in der Gestalt von Moses wird im obersten der Medaillons fortgeführt: Die zentrale Christusfigur krönt mit ihrer Rechten die Ecclesia, während sie mit ihrer linken Hand die Augen der Synagoge enthüllt. Das alttestamentliche Gesetz wird also offenbart in der vollen Gnade des Heiligen Geistes, der hier in Form sei-ner sieben Gaben durch sieben Tauben symbolisiert wird.
Das Corpus Christi, bzw. das Todesopfer Christi, das die Entschleierung der Synagoge überhaupt erst ermöglichte, ist Thema des gegenüberliegenden, untersten Medaillons. In seinem Zentrum befindet sich die Quadriga Aminadabs, der Trium-phwagen, in dem die Bundeslade nach Jerusalem zurückgebracht wurde. Das alttes-tamentliche Symbol für den Bund Gottes mit seinem Volk Israel ist hier der Altar, auf dem das Kreuz Christi aufgestellt ist, dessen Querbalken in den Händen Gott-vaters ruhen. Generell wird die thronende Gestalt Gottes mit dem Kruzifix als Gna-denstuhl bezeichnet und ikonografisch als Darstellung der Heiligen Trinität gedeu-tet, obgleich hier die dritte Gestalt des Dreieinigen Gottes, die Taube des Heiligen Geistes, fehlt. Daher muss hier nicht unbedingt die Darstellung der Trinitätslehre beabsichtigt gewesen sein; vermutlich geht es vielmehr darum, die Komplementa-rität des Alten und Neuen Bundes zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, der alttes-tamentliche Jahve, der mit seinem Volk den Bund geschlossen hat, ist immer der-selbe Gott geblieben, der am Kreuz gestorben ist und damit einen neuen Bund mit dem Volk bzw. der ganzen Menschheit geschlossen hat. Dabei ist es der gekreuzigte Leib Christi und sein vergossenes Blut, die zum ewigen Mahl sowohl des Men-schen als auch der Engel werden. Die Anwesenheit aller vier Evangelisten in ihrer zoomorphen Form gibt der ganzen Szene einen apokalyptischen Charakter, der sich im folgenden Medaillon wiederholt. Hier wird das Buch von Lamm und Löwe ge-öffnet, zwei im Mittelalter üblichen Symbolen Christi. Der Doppelvers von Suger,24 mit dem er die Szene erklärt, endet nämlich mit dem allegorischen Hinweis auf die Inkarnation Christi, die im Prolog des Johannesevangeliums am deutlichsten zum Ausdruck kommt: „Et verbum caro factum est.“
Der allegorische Inhalt des anagogischen Fensters birgt noch viele weitere theologische Anspielungen und Hinweise und weist konkrete Beziehungen mit den beiden anderen Glasfenstern auf, die als Ensemble sowohl im aktuellen geistlich-politischen als auch geschichtlichen Kontext der Zeit tief verwurzelt sind. Es dürfte verständlich sein, dass die Breite dieses Programms an dieser Stelle kaum dargelegt werden kann. Abschließend sollen aber einige Grundgedanken zusammengefasst werden.1. Die Paulus-Mühle bildet den logischen zentralen Ausgangspunkt, sowohl für
das obere als auch das untere Medaillonpaar.2. Obwohl es sich bei dem heutigen Fenster um eine moderne Rekonstruktion
handelt, lässt sich das Konzept des Bildprogramms anhand von Sugers Be-
24 „Qui Deus est magnus, librum solvit Leo et Agnus. Agnus sive Leo fit caro iuncta Deo.“ Zitiert nach panoFsky (wie Anm. 16), 74.
107Die Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters
schreibung nachvollziehen. Der Hauptgedanke besteht in der anagogischen In-terpretation, denn es findet ein Übergang vom Materiellen zum Immateriellen statt.
3. In der Sprache der einzelnen Szenen wird dem alttestamentlichen Symbol eine neutestamentliche Allegorie entgegengesetzt – der Ecclesia steht die Synagoge mit verbundenen Augen/Augenbinde gegenüber.
4. Der Vermittler dieser Entschleierung ist Christus bzw. sein Opfer am Kreuz, durch das der neue Bund mit den Menschen geschlossen wurde, durch den der Mensch seine Teilhabe am ewigen Mahl zusammen mit den Engeln wiederer-langt hat.
Die Paulus-Mühle in Vézelay
Ähnlich wie das anagogische Fenster wird üblicherweise auch die Mühlenallegorie von Vézelay erklärt, in der eine mit einem Getreidesack beladene Figur abgebildet ist, die als Moses gedeutet wird. Demnach handelt es sich um den Apostel Paulus, der das gemahlene Mehl in einem anderen Sack auffängt. Der Kontext dieses Reli-efs kann hier leider nicht ausführlicher behandelt werden. Was aber auffällt, ist das offensichtliche Fehlen eines Antriebs, mit dem die Mühlsteine in Bewegung gesetzt werden. Im Unterschied zu Sugers Paulus-Mühle findet der Mahlprozess in Vé-zelay keine Beachtung; es handelt sich demnach nicht um eine tatsächlich funktio-nierende Mühle, ganz im Gegenteil – im Vordergrund befindet sich nur ein Trichter, in den der Prophet Moses das Korn schüttet. Auf der anderen Seite des Trichters steht Paulus bereit, um das Mehl aufzufangen. Der Prozess der Getreideverarbei-tung, der Verwandlung, bleibt den menschlichen Augen verborgen und geheimnis-voll wie die Transsubstantiation – die Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi, die täglich am Altar vollzogen wird. Hiermit gelangen wir zum nächs-ten und zugleich letzten Teil meines Aufsatzes, nämlich zur Transsubstantiations-lehre und der damit untrennbar verbundenen Darstellung der Hostienmühle.
Die Hostienmühle als Allegorie der transsubstantiatio
Wie bereits erwähnt, wurden die Grundsätze der Eucharistie in der Zeit zwischen 1150 und 1350 sehr lebhaft diskutiert. Als Streitpunkt erwies sich dabei die Darstel-lung der Transsubstantiation. Die Realpräsenz Christi in der Hostie wurde ständig hervorgehoben, um die Argumente jener Gegner zu entkräften, die nur an ihren symbolischen Wert glaubten. So traten immer neue Berichte über die von der eu-charistischen Hostie verursachten Wunder auf, die von blutenden oder sich in das Fleisch Christi verwandelnden Hostien erzählten.
108 Lenka Panušková
Eucharistische Wunderberichte
In dieser geistlich besonders exaltierten Epoche wurde auch das wundertätige Er-eignis aus dem Leben Gregor des Großen erneut aufgegriffen: Gemäß der Legende hatte eine Frau, die für die Messe Brot gestiftet hatte, bei den Wandlungsworten des Papstes gelacht, weil sie nicht daran glauben konnte, dass das von ihr gebackene Brot zum Leib Christi würde. Als sich aber auf Gregors Gebete hin das Sakrament in den blutigen Finger Christi verwandelte, sei die Zweiflerin von der Tatsache der Transsubstantiation überzeugt worden. Obwohl dieser Bericht über die wunder-same Gregorsmesse in allen Papstviten aufgegriffen wurde, so auch in der populä-ren Legenda Aurea von Jacobus de Voragine, entwickelte sich eine selbstständige Bildikonografie erst um 1400. Doch der neue Bildtypus unterscheidet sich stark von der schon seit dem 8. Jahrhundert tradierten Legende, als statt des Fingers Christi ein Bild des Imago pietatis, des im Sarkophag stehenden Schmerzensmannes, vor dem Papst erscheint. Die Anregung zu dieser ikonografischen Abänderung ist un-trennbar mit einer Ikone des Imago pietatis verbunden, die am Ende des 14. Jahr-hunderts in die Kirche von Santa Croce in Gerusalemme in Rom gelangte. Mit der Erscheinung des Vera Icon Christi vor Gregor dem Großen wurde diese Mosaiki-kone legitimiert und authentifiziert. Das eucharistische Wunder aus dem Leben Gregors hat in seiner veränderten Variante dazu beigetragen, die Echtheit dieses Bildes zu bestätigen. Die neue Ikonografie wurde in der Folge von Rompilgern bis nach Deutschland getragen, wo nach ihren Erzählungen und Beschreibungen erste Darstellungen der Gregorsmesse bzw. der Gregorserscheinung entstanden.25
Diese Umstände, unter denen sich aufgrund eines hagiographischen Berichts ein neues ikonografisches Motiv entwickelte, dessen Deutung stark vom aktuellen Diskurs geprägt war, zeigen uns, dass eine aktualisierte Lesung der alten Tradition Auswirkungen auf die bildliche Darstellung hatte. Denn das Thema der Transsubs-tantiation wurde hier erstmalig in der darstellenden Kunst aufgegriffen. Demselben Prozess unterlag meiner Meinung nach auch die Darstellung der Mühlenallegorie. Indem man den Mahlvorgang, also die Verarbeitung von Getreide zu Mehl, aus dem die Hostien gebacken wurden, thematisierte, stellte man freilich die Transsubstan-tiationslehre in den Vordergrund. Des Weiteren kam das Thema der Hostienmühle zumindest während des gesamten 14. Jahrhunderts häufig in den vernakularen Volksliedern zum Ausdruck. Die Beziehung der Texte zu den Hostienmühlenbil-dern untersuchte kürzlich Hans Rye-Clausen.26 Er schlussfolgerte, dass sich das Visuelle und das Textuelle27 gegenseitig beeinflussten, wobei die Urquelle dieser
25 In den spätmittelalterlichen Quellen wird der Bildtypus immer als Erscheinung (visio, apparitio) bezeichnet; der heutige Begriff ist erst im 19. Jahrhundert entstanden, als man begann, sich systematisch mit der mittelalterlichen Ikonografie zu befassen. Erst später wurde die Vision am Altar dargestellt, indem das ganze wundertätige Ereignis zur Darstellung einer von Gregor gefeierten Messe geworden ist mit dem Hinweis auf die mystische transsubstantio. Siehe Gormans, Andreas / lentes, Thomas (Hrsg.): Das Bild der Erscheinung: Die Gregorsmesse im Mittelalter. Berlin 2007 (KultBild Bd. 3).
26 ryeClausen (wie Anm. 14).27 Schon im 13. und das ganze 14. Jahrhundert hindurch wurden immer wieder neue Lieder, Ge-
109Die Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters
Metapher noch in frühchristlicher Zeit zu suchen ist. Die Allegorie wurde schon damals typologisch aufgebaut, als man den gemahlenen Weizen mit dem gekreu-zigten Leib Christi gleichgesetzte.28 Auf diese Weise wurden die Worte Christi selbst als Brot des ewigen Lebens29 wieder aufgegriffen. Obwohl das Brotmotiv verhältnismäßig oft in den frühen exegetischen Texten auftritt, datieren die ersten bekannten Darstellungen von Hostienmühlen erst um 1400. Als vollentwickelte Komposition treten sie zu dieser Zeit in einem böhmischen Graduale auf. Obwohl der eigene Entwicklungsprozess der theologisch umgedeuteten Allegorie kunstge-schichtlich kaum zu verfolgen ist, kann dennoch behauptet werden, dass er zeit-gleich zur Entwicklung der allegorischen Mühlendichtung verlief, wobei das ältere typologisch konnotierte Thema modernisiert bzw. aktualisiert wurde, um den zeit-genössischen Debatten gerecht zu werden.30
Die Mühlenallegorie im Graduale des Zisterzienserklosters Gnadenthal31 stammt erst aus dem Ende des 14. Jahrhunderts, einer Zeit, in der die auf das Cor-pus Christi bezogene Frömmigkeit ihren siegreichen Weg in der spätmittelalterli-chen Gesellschaft antrat. Es ist kein Zufall, dass die Darstellung einer mystischen Mühle in die Anfangsinitiale A(d te Domine) eingesetzt wurde, mit der der Messge-sang zum ersten Adventssonntag eingeleitet wird. In der Mitte des Buchstabens befindet sich die Mühlenkonstruktion; der zentrale Bereich ist für den Betrachter durch drei Fenster einsehbar, so dass der innere Mechanismus – das Mühlrad mit Kurbel und Spindel – sichtbar ist. Oben auf der steinernen Konstruktion liegt der
dichte und andere literarische Fassungen aufgeschrieben oder mündlich tradiert, in denen die Mühle, Korn, Mehl und Brot allegorisch Bezug auf die Bibel nahmen. All das sind natürlich Motive, die untrennbar mit dem Corpus Christi und der Errichtung dieses neuen Festes zu ei-nem kirchlichen Feiertag verbunden sind. Der Messkanon sowie die Gesamtheit der liturgi-schen und paraliturgischen Vorschriften, die eine ordnungsgemäße Feier dieses Festes gewähr-leisten sollten, wurden auf der Basis älterer Bullen aus dem 13. Jahrhundert neu formuliert, wobei vieles aus den schon länger tradierten Gebeten, Hymnen und Homilien in die neue Litur-gie übernommen wurde.
28 Siehe ryeClausen (wie Anm. 14), 23.29 „Ego sum panis vitae patres vestri manducaverunt in deserto manna et mortui sunt. Hic est
panis de caelo descendens ut si quis ex ipso manducaverit non moriatur. Ego sum panis vivus qui de caelo descendi. Si quis manducaverit ex hoc pane vivet in aeternum et panis quem ego dabo caro mea est pro mundi vita.“ (Joh 6, 48–52).
30 Rye-Clausen spekuliert dennoch darüber, dass schon in der Zeit der Karolinger gewisse Mahl- oder Mühlenbilder existiert hätten, in denen die in der Exegese thematisierte Gegenüberstel-lung vom Alten und Neuen Testament mit dem Verweis auf das Mühlensteinpaar zum Ausdruck gebracht wurde, bzw. die den lebendigen Meinungswechsel in Fragen der Eucharistie vermit-telten. Dies wird von den ältesten illuminierten griechisch-byzantinischen Oktateuchen be-zeugt, in denen die im Westen nur selten auftretende Szene zweier mahlender Frauen verhält-nismäßig oft erscheint, welche eine Bildparabel des Jüngsten Gerichts ist.
31 Heute Luzern, Zentral- und Hochschulbibliothek, P.19, fol 1r. Zur Beschreibung und Bibliogra-phie siehe studničková, Milada: Das Luzerner Graduale. In: Karl IV., Kaiser von Gottes Gna-den: Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburg 1310–1437. Hg. v. Jiří Fajt. München- Berlin 2006, Kat. 185, 524–525. Es wird angenommen, dass die Handschrift für ein Zisterzi-enserkloster in Böhmen zusammengestellt wurde, wobei die Illuminationen dem Meister der Antwerper Bibel (Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, M 15), einem der führenden Prager Illuminatoren, zugeschrieben werden.
110 Lenka Panušková
Mühlstein mit dem Trichter. Wie bereits angedeutet, wird hier die Mühle als theo-logische Metapher eingesetzt. In der oberen Sphäre überbringt der Erzengel Mi-chael seine Botschaft an die Jungfrau Maria, die vor einer Architektur am Lesepult kniet. Die Verkündigungsszene wird ergänzt durch die Taube des Heiligen Geistes, die zu Maria fliegt, sowie durch ein Medaillon mit dem segnenden Gottvater ganz oben über der Initiale. Dazwischen schütten vier männliche Gestalten mit Symbol-köpfen – die vier Evangelisten – das Getreide in den Trichter. In der nächsten Zone stehen an beiden Seiten der Kurbel jeweils sechs Apostel und vor der Mühle knien die Kirchenväter, die gemeinsam einen Messkelch erheben, in dem das nackte Christuskind steht. Die ganze Komposition wird von einer Gruppe kniender Gläu-biger angebetet,32 die die einzelnen Stände der damaligen Gesellschaft repräsentie-ren. Die Aufteilung der Komposition in mehrere Zonen erinnert an eine Visio-Dar-stellung, die die irdische Versammlung gerade empfängt und an der sie gleichzeitig teilnimmt – dem Geheimnis der Inkarnation Gottes und seiner Verwandlung in das ewige Leben spendende Mahl. Den typologischen Kontext der Inkarnations- und Transsubstantiationslehre legen die Halbgestalten der alttestamentlichen Propheten fest, die von den aus Akanthusranken gebildeten Medaillons der Komposition zu-schauen.33 Im Initialschaft erkennt man eine zweite Abbildung des Heiligen And-reas, der ebenfalls die Kurbel betätigt. Vor ihm kniet ein Stifter, der ein Kirchenmo-dell in den Händen hält. Aufgrund der Verbindung des Stifters mit dem Apostel Andreas behauptete Mojmír Frinta, es handele sich hier um Ondřej von Dubá, dem höchsten Richter des Königreichs Böhmen.34 Allerdings kann diese Behauptung nicht bestätigt werden, denn das an den Füßen des Stifters liegende Wappenschild ist ebenso leer wie alle Spruchbänder, die die Figuren in ihren Händen halten. Es ist
32 In der Mitte kniet ein König, hinter ihm eine Frau und zwei Männer, wahrscheinlich Repräsen-tanten des Bürger- und Bauerntums. Ihnen steht der geistliche Stand – eine Gruppe von vier Mönchen – als Gegengewicht zur säkularen Welt gegenüber. In der Diskussion, die meinem Vortrag folgte, bemerkte Dr. Christian Forster, dass es sich nicht um Zisterzienser, sondern um Benediktiner handelt. Milada Studničková führt allerdings an, dass die Darstellung der Zister-zienser in schwarzen Kutten keine Besonderheit ist und im Martyrologium von Gerona vor-kommt. Siehe StuDničkoVá (wie Anm. 31, 525).
33 Drei von ihnen lassen sich als Jesaja, Ezechiel und Jeremia identifizieren. In ihren Texten pro-phezeiten sie die Menschenwerdung Christi, seine Passio und Auferstehung. Der vierte Pro-phet stellt höchstwahrscheinlich einen der zwölf kleinen Propheten dar, und zwar Jona, den Propheten der Auferstehung Christi. In den Seitenbordüren finden wir noch jeweils zwei Me-daillons – links mit Gregor dem Großen und dem Heiligen Hieronymus, rechts mit zwei heili-gen Jungfrauen Dorothea und Katharina von Alexandrien. Ganz unten auf dem Folio befindet sich vermutlich die Heilige Elisabeth von Thüringen, die besonders wegen ihrer Barmherzig-keit verehrt wurde, da sie die Bettler speiste und die Nackten bekleidete.
34 Frinta, Mojmír: The Master of Gerona Martyrology and Bohemian Illumination. In: Art Bulle-tin 46 (1964), 283–306. Die Anwesenheit des Heiligen Andreas könnte hingegen auf den König selbst verweisen sowie auf die Zisterzienserabtei Zbraslav (Aula regia, Königssaal), in der die Reliquien des heiligen Apostels aufbewahrt und verehrt wurden. Hier wollte Wenzel der IV. begraben werden. Die Identifikation des Stifters ist jedoch nur von geringer Bedeutung für die ikonografische Darlegung der Allegorie. Darüber hinaus kommt in diesem Zusammenhang noch die Möglichkeit in Betracht, dass man überhaupt nicht beabsichtigte, die Spruchbänder zu beschreiben.
111Die Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters
naheliegend, dass man beabsichtigte, Teile des Credo in die Spruchbänder der Apo-stel und den Gruß Ave Maria in jenes des Erzengels einzusetzen. Demzufolge könn-ten die Bänder der Propheten die entsprechenden Prophezeiungen zum Vorschein bringen. Ob die Inschriften im Falle des Königs und des ersten Mönches auf kon-krete historische Gestalten hinweisen sollten, muss unbeantwortet bleiben. Was aber außer Zweifel steht, ist die ikonografische Verbindung des Themas mit dem ersten Adventssonntag wie im Falle der I-Initiale mit der Darstellung des Jüngsten Gerichts im Verduner Homiliar.35 So wird hier im Einklang mit dem Beginn der Adventszeit der Moment der Inkarnation Christi zum Ausdruck gebracht. Das bleibt bei allen spätmittelalterlichen Mühlendarstellungen ein konstanter Bestandteil, denn die Inkarnation selbst ist der Ausgangspunkt für den Tod Christi am Kreuz und war schon von Anfang an mit dem CorpusChristiFest untrennbar verbunden.
Eine spätere Nachahmung der allegorischen Mühlenszene im Luzerner Gradu-ale liefert uns die Erfurter Miniatur. Diese wurde erst nachträglich im 15. Jahrhun-dert wieder in ein Graduale36 des Augustiner-Chorfrauen-Stifts Neuwerk in Erfurt hinzugefügt und enthält zahlreiche Texte. Diese ganzseitige Illumination leitet das Temporale ein, das übereinstimmend mit dem Luzerner Graduale mit dem Ad te levavi-Gesang beginnt. Im Grunde bleibt die Komposition hier bis auf wenige Ab-weichungen erhalten.37 Die Evangelisten schütten aus vasenähnlichen Gefäßen Spruchbänder statt Getreide in den Mühltrichter. Sie sind mit den Evangelienversen versehen, die die Einigkeit Gottvaters mit dem Sohn offenbaren und die Mensch-werdung des Sohnes betonen.38 Auf dem Mühlstein selbst, der in der Draufsicht dargestellt ist, folgt der Prolog des Johannesevangeliums mit den Worten: „Et Deus erat verbum.“ Den Höhenpunkt bildet ein über die Spindel abgewickeltes Spruchband: „Et verbum caro factum est.“ Darunter steht das Christuskind im gol-denen Messkelch, den auch hier die vier Kirchenväter mit der Elevatio-Geste erhe-ben. Interessanterweise enthalten die Spruchbänder der Apostel kein Credo, son-dern verschiedene Aussagen über die Inkarnation des Wortes, womit die Einigkeit Gottvaters mit dem Wort Christus ausgedrückt wird. Dieselben Inschriften weisen auch die Spruchbänder der Kirchenväter auf, die außerdem die Menschwerdung Christi im Schoße Mariä zum Ausdruck bringen.
Die Texte weisen also daraufhin, dass der wahre und einzige Gott zum Men-schen geworden ist und dass sein realer Leib und reales Blut uns zur Nahrung ge-geben wird, damit auch wir Anteil an seinem himmlischen Ruhm haben können. Im
35 Siehe Seite 103 in diesem Text.36 Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. St. Peter perg. 44, f. 9r. Die Handschrift stammt
ursprünglich aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.37 In diesem Fall sind die Betrachter nicht in die Szene integriert; es gibt auch keine Hinweise auf
die Stifter. Des Weiteren fehlen die Medaillons mit den Prophetenbüsten, während die Wolke Gottes in der oberen Miniaturzone zwischen dem Erzengel und Maria abgebildet ist. Die A-Initiale auf dem nächsten Blatt (f. 9v) zeigt dann die ikonografisch übliche Szene der Verkün-digung.
38 Im ersten Spruchband handelt es sich um den Prolog des Johannesevangeliums: „In principium erat verbum“ (Joh 1, 1), dann folgen „Quod in ea natum est“ (Mt 1, 20), „Videamus hoc ver-bum“ (Luk 2, 15) und schließlich „Hic est Filius meus“ (Verklärung Christi auf dem Berg Ta-bor; Mk 9, 6).
112 Lenka Panušková
Prinzip geht es hier um die sakrale Geburt des menschlichen Leibes Christi wäh-rend der heiligen Messe im Moment der Elevatio – der Erhebung der Hostie und des Kelches.39
Viel anschaulicher ist die Incarnatio mit der Transsubstantiatio in der Wand-malerei in Eriskirch am Bodensee (um 1420/30): Die Gottesmutter Maria führt den kleinen Christusknaben zum Trichter, wobei die Mühle teilweise von den Aposteln, teilweise von Engeln angetrieben wird, die statt einer Kurbel ein Wasserrad in Be-wegung setzen. Die Übertragung der Handlung auf Maria ist kein Zufall – die Kir-che wurde zu Mariä Himmelfahrt geweiht und ist bis heute ein wichtiger Wall-fahrtsort. Der eucharistische Aspekt der Malerei wird durch ihre Anbringung am Altar gegenüber dem marianischen Gnadenbild betont.40 In der Loffenauer Wand-malerei (um 1445)41 erscheint sogar Gottvater, wie er seinen zu Tode gemarterten Sohn in den Trichter legt, was als Beweis der exaltierten spätmittelalterlichen Eu-charistieverehrung angeführt werden kann. Die Betonung der Leiden Christi durch die Pieta patris, das Motiv also, in dem der Vater seinen gekreuzigten Sohn im Schoß hält, ist einerseits auch hier mit der Weihe dieser Kirche zum Heiligen Kreuz verbunden, andererseits wird dadurch der eucharistische Kontext stark hervorgeho-ben. Im Gegensatz zur Eriskircher Wandmalerei nimmt die Szene die ganze Nord-wand des ursprünglichen mittelalterlichen Chores, also der Seite des Sakraments-hauses, ein.
Je weiter die Darstellungen in das 15. Jahrhundert hineinreichen, desto ausge-prägter ist die Allegorie mit einem immer deutlicheren eucharistischen Kontext, wie das Glasfenster des Berner Münsters bezeugt. Ferner überwindet das Thema seine Beschränktheit auf das Kloster und erreicht nun einen großen Kreis von Be-trachtern in Pfarr- und Stadtkirchen.
Einen besonderen Charakter hat das Thema jedoch im heutigen Norddeutsch-land. In unmittelbarer Nähe des Zisterzienserklosters Doberan wurde es in den Al-tarschreinen von Doberan, Retschow, Rostock und Tribsees umgesetzt. Allgemein lässt sich das Schema der Darstellung vom Gnadenthaler Graduale42 ableiten. Auf
39 Wahrscheinlich entstand auf der Grundlage dieser Miniatur fast 100 Jahre später ein Tafelbild für den Erfurter Dom, das gemäß der Jahreszahl auf dem abgebildeten Mühlstein 1534 fertig-gestellt wurde. Ganz unten in der linken Bildecke ist hinter den Heiligen Gregor und Hierony-mus der Stifter des Bildes dargestellt. Rye-Clausen möchte in ihm einen Domherren sehen. Siehe ryeClausen (wie Anm. 14), 119.
40 Rye-Clausen bemerkt zwar, dass sich die Wandmalerei nicht auf der Evangelienseite befindet, auf der üblicherweise das Sakramentshaus steht, sondern auf der Epistelseite. Diese Tatsache spielt jedoch keine entscheidene Rolle dafür, dass die allegorische Szene hier unmittelbar mit der liturgischen Elevatio zusammenhängt. Darüber hinaus wird damit eine Unitas der himmli-schen und irdischen Liturgie hergestellt. ryeClausen (wie Anm. 14), 57–59.
41 Hier stehen auf beiden Seiten der Kurbel die Bischöfe, von denen der erste links eine Tiara auf dem Kopf trägt. Damit könnte der Heilige Petrus als erster Papst kenngezeichnet sein. Dem-nach neigt man dazu, die Bischöfe als die zwölf Apostel zu identifizieren. Sowohl im Gna-denthaler Graduale wie auch in der Loffenauer Wandmalerei stehen sich in der unteren Bild-zone die religiöse und profane Macht gegenüber. Der Papst und der Kaiser als Hauptvertreter beider Mächte vereinigen sich in der Elevatio-Geste, indem sie den Kelch gemeinsam erheben.
42 Derselben Zeit entstammt die Zeichnung der Mettener Biblia Pauperum (heute München, Bay-erische Staatsbibliothek, Clm 8201, f. 37r, ca. 1414), die der bömischen Buchmalerei des 15.
113Die Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters
dem Schnitzaltar in Tribsees ist jedoch statt der üblichen Kurbelmühle eine Wasser-mühle43 abgebildet, die von den Aposteln in Gang gesetzt wird. Die Inschriften, die die Allegorie vervollständigen und die auf den Moment der Inkarnation und Trans-substantiation hinweisen, enthalten dieselben Zitate wie die bereits erwähnte Erfur-ter Miniatur.
Allen Darstellungen von Hostienmühlen ist die authentische Abbildung des Mühlenwerkes gemein, sieht man von einigen technischen Details wie z. B. dem Trichter, dem oberen Mahlstein, der Spindel zur Übertragung der Drehbewegung auf das Zahnrad und schließlich dem Zahnrad selbst ab, das von den an der Kurbel stehenden Aposteln betätigt wird. Meines Erachten nach sind die inneren Teile des Mahlwerkes für den Betrachter immer sichtbar.44 Gehörte also diese Darstellungs-weise zum eigentlichen Sinn der Mühlenallegorie? Es ist eben der Verwandlungs-prozess an sich, der die Mühle zu einem geeigneten Symbol machte. Durch das Zusammenwirken der einzelnen Bestandteile der Mühle wird das Getreide zu Mehl gemahlen. Auch hier handelt es sich um eine Substanzverwandlung, die mit der Transsubstantiation während der Messe vergleichbar ist, wobei die Verwandlung selbst den Augen der Menschen verborgen bleibt. Ebenso bleibt auch die Transsub-
Jahrhunderts stilistisch unbestritten ähnelt. Auch hier bleiben die Spruchbänder unbeschriftet; es fehlt jedoch die unterste irdische Zone mit den Vertretern der weltlichen Macht. Erwähnens-wert ist die Tatsache, dass diese Sammelhandschrift für das Benediktinerkloster Metten ange-fertigt wurde. Siehe suCkale, Robert: Klosterreform und Buchkunst: Die Handschriften des Mettener Abtes Peter I., München Bayerische Staatsbibliothek, Clm 8201 und Clm 8201d. München 2012.
43 Der Altarschrein in Tribsees stellt eine besondere Ausnahme dar, denn er ist das einzige Bei-spiel für eine geschnitzte Hostienmühle. In der ursprünglichen Zisterzienserkirche stand der Schrein auf der Mensa des Hauptaltars und war damals nur den Mönchen zugänglich. Das ikonografische Programm enthält dementsprechend anspruchsvolle theologische Andeutungen auf die Gesamtidee der Heilsgeschichte. Über dem zentralen Schrein befindet sich das augusti-nische Caelum caeli mit dem segnenden Schöpfer, der von zwei Engeln in seiner allmächtigen Herrlichkeit gepriesen wird. Zugleich gehört er zu der Verkündigungsszene, die auf der inneren Flügelseite, auf der linken Hand Gottes, abgebildet ist. Gegenüber knien Adam und Eva im Höllenschlund und erwarten demütig ihr Heil, das im menschgewordenen Logos zu erhoffen ist. Den mittleren Teil des Schreines nimmt die Mühlendarstellung ein: Darin sind die Evange-listen dargestellt, wie sie das Wort in den Trichter schütten, das schließlich unten in Form des im Kelch stehenden Christuskindes von den vier Kirchenvätern aufgefangen wird. Der kosmo-logisch-eschatologische Aspekt wird noch durch die Hervorhebung des Christuskindes vor dem Zahnrad betont, denn Christus scheint somit in einer kreisförmigen Mandorla eingeschlos-sen zu sein. Während die Mittelfelder der Flügel noch zur Mühle gehören – hier befinden sich die Mühlräder mit den Apostelfiguren, die vom Wasser aus Paradiesflüssen angetrieben werden – erteilen ein Priester und ein Bischof die Kommunion an einen Mönch und den Kaiser, der seine Krone abgelegt hat. Auch die Spruchbänder tragen die Worte der Kommunion: „[Aser pinguis panis eius] et praebibit delicias regibus.“ Die Antwort des Kaisers lautet: „Domine non sum dignus ut intres sube tectum meum.“ Das Retabel von Tribsees bezeugt also eine unver-zichtbare Beziehung des Mühlenmotivs zur Liturgie.
44 Die einzige Ausnahme stellt die Mühle auf dem Tafelaltar der Barfüßer in Göttingen dar. Der zentrale Teil der Mühle, der das Mühlenwerk verbirgt, ist als ein diesseitiges Ensemble abge-bildet, so dass nur der tatsächlich äußere Teil – der Trichter – sichtbar bleibt. sChawe, Martin: Zur „Alltagsseite“ des Göttinger Barfüßeraltares von 1424, Ergebnisse einer Untersuchung. In: Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte 27 (1988), 63–84
114 Lenka Panušková
stantiation unseren Sinnen, selbst unserem Verstand verborgen, weil sie genauso wie die Inkarnation Gottes ein Geheimnis des Glaubens ist. Als Hüterin dieses Ge-heimnisses errichtete Christus die Kirche und betraute die Apostel mit der Aufgabe, seine Lehre in die ganze Welt zu verbreiten und seinen Worten zu folgen. Die Hauptaufgabe der Kirche sollte jedoch darin bestehen, die Leiden Christi ständig in Erinnerung zu rufen, indem sein Opfer bei jeder Messe am Altar verwirklicht wird. Martin Schawe, der sich ausführlich mit dem Göttinger Barfüßeraltar beschäftigte, nimmt daher an, die Mühle sei ein Symbol für die Kirche. Sein Erfinder soll auf die frühchristlichen Autoren zurückgegriffen haben, um ein „sinnfälliges Bild der Kir-che, ihrer Autoritäten und ihres Alleinanspruchs der Heilsvermittlung zu ent-werfen.“45 Der Mahlmechanismus, dessen einzelne Bestandteile nur zusammen arbeiten können, soll die Einigkeit der Kirche zum Ausdruck bringen. Und in der Tat, wenn in einigen Darstellungen andere Figuren abgebildet werden, sind diese in zwei sich gegenüberstehenden Gruppen angeordnet. Diejenigen, die aufgrund ihrer Weihe einem Orden oder der Kirche angehören, befinden sich zur Rechten Gottes, also auf der Seite, auf der der Heilige Petrus die Gruppe von Aposteln an der Kurbel anführt. Die weltlichen Personen stehen oder knien mit dem Kaiser auf der Seite der Jungfrau Maria. Letztlich haben beide Gruppen denselben Anteil am corpus mysticum, dem mystischen, d. h. eucharistischen Leib Christi.46
45 Ebd., 65.46 Zu dieser Metapher siehe de luBaC, Henri: Corpus Mysticum: L’Eucharistie et l’Église au
moyen âge, étude historique. Paris 2009.
115Die Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters
1. Herrada von Landberg, Hortus deliciarum, Zwei mahlende Frauen, Illustration zu Lc 17, 34–35 – Illustration aus: Rosalie Green (ed.), Herrad of Hohenbourg: Hortus Deliciarum. Reconstruction, (Studies of the Warburg Institute 36), London – Leiden 1979, Fol. 112r, Pl. 69
117Die Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters
3. Sugers Anagogisches Fenster, heutiger Zustand, Saint-Denis, Abteikirche, Chorumgang (linke Seite) + Detail der Paulus-Mühle, nach 1140 – Illustration aus Louis Grodecki, Les vitraux allegoriques de St. Denis, (Art de France I), 1961, S. 197, Abb. 122
8. Eucharistische Mühle, Wandmalerei, Heiligen-Kreuz-Kirche, Loffenau, um 1445 – Illustration aus: ryeClausen, Harald: Hostienmühlenbilder im Lichte mittelalterlicher Frömmigkeit. Stein am Rhein 1981, Abb. 4
118 Lenka Panušková
9. Mettener Biblia Pauperum, München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 8201, Fol. 37r, um 1414 – Illustration aus: ryeClausen, Harald: Hostienmühlenbilder im Lichte mittelalterlicher Frömmigkeit. Stein am Rhein 1981, Abb. 1
327Farbabbildungen
2. I–Initiale, Homiliar, Verdun, Bibliothéque Municipale, Ms. 121, um 1175, Fol. 1r – Illustrations aus Franz Ronig, Die Buchmalerei des 11. und 12. Jahrhunderts in Verdun, in: Aachener Kunstblätter, 38, 1969, S. 7–255, S. 254, Abb. 142
Farbabbildungen zum Beitrag Panušková
330 Farbabbildungen
6. Erfurter Graduale, Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. St. Peter perg. 44, f. 9r
331Farbabbildungen
7. Eucharistische Mühle, Wandmalerei, Mariä-Himmelfahrts-Kirche, Eriskirch, um 1420/30 – Illustration aus: ryeClausen, Harald: Hostienmühlenbilder im Lichte mittelalterlicher Frömmig-keit. Stein am Rhein 1981, Abb. 3
10. Mühlenallegorie, Altarschrein, Zisterzienser Klosterkirche, Tribsees, um 1450