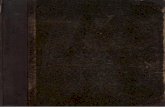Die Nacht der Volkssouveränität: Slavoj Žižek, Walter Benjamin und die Deutung der...
-
Upload
uni-leipzig -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Die Nacht der Volkssouveränität: Slavoj Žižek, Walter Benjamin und die Deutung der...
1
Axel Rüdiger
Die Nacht der Volkssouveränität: Slavoj Žižek, Walter Benjamin und die Deutung
der Französischen Revolution bei Georg Forster
(Das Manuskript erscheint in: Rebekka A. Klein, Dominik Finkelde (Hg.): Souveränität und Subversion:
Figurationen des Politisch-Imaginären. Freiburg i. Br. 2015, S. 183-215.)
In der Nacht sind alle Katzen grau beziehungsweise, wie Hegel formuliert, „alle Kühe schwarz“1. Diese
Alltagsweisheit lässt sich mit etwas Fantasie auch auf die Beziehung zwischen Slavoj Žižek und Georg
Forster übertragen. Denn obwohl Forster das hegelianische Motiv der ‚Nacht der Welt‘ in seiner histori-
schen Anthropologie vorwegnimmt – wo er von der „Nacht des Ungrundes“ spricht,2 die das menschli-
che Subjekt prägt –, ist Žižek bei seinem großen philosophischen Unternehmen, die Philosophie Hegels
mit Hilfe der Psychoanalyse Jacques Lacans zu aktualisieren, dieser Spur bisher noch nicht nachgegan-
gen.3 Dies ist auch kein Wunder, da die Philosophiegeschichte bei der Auswahl ihrer Heroen bekanntlich
sehr selektiv vorgeht. Manche Kühe bleiben eben auch in der Nacht der Ideengeschichte schwarz. Wenn
aber in der Folge etwas Licht in diese Nacht gebracht werden soll, dann erweist sich der jakobinische
Philosoph und Augenzeuge der Französischen Revolution Forster vielleicht als eine Art verschwundener
Vermittler, der dieses Thema erstmals konsequent auf das Verhältnis von Souveränität und Revolution
anwandte und dabei das Problem der konstitutiven Grundlosigkeit einer revolutionären Ordnung aufwarf,
die als ‚Nacht‘ der Volkssouveränität beschrieben werden kann. Man könnte vielleicht sagen: Forster
scheint durch die Texte von Hegel und Benjamin hindurch, auf die Žižek immer wieder referiert. Der
Aufsatz ist daher nicht zuletzt in der Hoffnung geschrieben, mit Hilfe von Forsters historischer Perspek-
tive für den Leser ebenso Licht in Žižeks subtile philosophische Argumentation zu bringen wie umge-
kehrt, die philosophische Größe Forsters durch Žižeks Texte hindurch zu lesen.
1. Das Ende der (Volks-)Souveränität?
Dass die Souveränität in Theorie und Praxis auf keinem festen Grund mehr steht, kann heute fast schon
als ein politischer Allgemeintopos gelten. So wird der Verfall staatlicher Souveränität seit geraumer Zeit
vor dem Hintergrund der ökonomischen Globalisierung der Märkte und der damit verbundenen Deterri-
torialisierung des Kapitalismus diskutiert. In Europa kommt die Kritik am methodischen Nationalismus
1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, in: Werke in 20 Bänden. Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, Bd. III, Frankfurt/M. 1986, 22. 2 Vgl. Georg Forster, Leitfaden zu einer künftigen Geschichte der Menschheit, in: Georg Forsters Werke. Kleine
Schriften zur Philosophie und Zeitgeschichte, Bd. VIII, hg. v. der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1974, 185-193, hier 186. 3 Stellvertretend für die zahlreichen Publikationen Žižeks zu diesem Thema sei hier nur Slavoj Žižek, Die Nacht der
Welt. Psychoanalyse und Deutscher Idealismus, übers. v. I. Charim, Frankfurt/M. 1998, genannt.
2
im Kontext der Debatten über die Delegation staatlicher Souveränitätsrechte auf die Europäische Union
hinzu. Darüber hinaus wird die Emanzipation vom souveränen Staat gern von neoliberalen Globalisie-
rungsdiskursen aufgegriffen, die damit die Demontage staatlich etablierter Sozialstandards zum Zweck
der Profitmaximierung geschickt mit dem Versprechen einer Befreiung von bürokratischer Herrschaft
verbinden. Potentielle Kritik etwa aus dem libertären Spektrum wird auf diese Weise sehr erfolgreich in
die neoliberale Herrschaftsstrategie integriert. Vor diesem Hintergrund wird der Begriff der souveränen
Herrschaft heute oft als ‚Zombie-Kategorie‘ (Ulrich Beck) abgetan, oder zur anachronistischen ‚Seman-
tik-Alteuropas‘ (Niklas Luhmann) gezählt, der nun endlich vom Rumpf der politischen Theorie entfernt
gehört (Michel Foucault), damit er, jenseits des Anachronismus marxistischer ‚Vodoo-Politik‘, durch die
zeitgemäßen Konzepte der Mikro- und Subpolitiken ersetzt werden kann.4 Es scheint also, als ob der
Dualismus souveräner Herrschaft inklusive seines abgründigen Antagonismus zwischen Herrschenden
und Beherrschten im relativistisch-pluralistischen Differenzparadigma der ausdifferenzierten (Post-)
Moderne keinen Platz mehr hat. An die Stelle von mechanischen Kausalitäts- und Steuerungsmodellen
sowie essentialistisch-archaischen Klassenkampfszenarien traten mehr oder weniger subjektlose Diffe-
renzmodelle, die heuristisch auf den ersten Blick zwar den Vorteil haben, komplizierte partikulare Wech-
selwirkungsprozesse besser als das marxistische Basis-Überbau-Schema beschreiben zu können, darüber
allerdings die umkämpfte Universalität und Subjektivität des Politischen aus den Augen verlieren, durch
die radikale soziale und politische Umbrüche und Alternativen überhaupt erst möglich werden. Denn für
sich genommen erlaubt das heute in allen politischen Richtungen verbreitete Differenzparadigma nur
eine beliebige Variation des Bestehenden, ohne noch die Frage einer radikalen Alternative im Sinne ei-
nes souveränen politischen Aktes aufwerfen zu können. Insofern haben sich ganz unterschiedliche und
vom normativen Anspruch auch durchaus gegensätzliche Ansätze in den Antinomien der postmodernen
Vernunft verfangen.
Besonders problematisch ist hierbei die Tatsache, dass die Kritik an der staatlichen Souveränität auch die
revolutionäre Volkssouveränität als reale politische Größe suspendiert, die seit der Französischen Revo-
lution die normative Grundlage der demokratischen Verfassungsstaaten bildet. Ohne die praktische
Wirksamkeit dieser Volkssouveränität tritt die moderne Demokratie aber zwangsläufig in ein postdemo-
kratisches Stadium ein, in welchem die Demokratie auf eine legale Staats- und Zwangsordnung reduziert
wird und ihre dynamische Funktion als revolutionärer Antrieb der Politik verliert. Autoren wie Alain
Badiou, Slavoj Žižek und Jacques Rancière haben deshalb darauf hingewiesen, dass die legale Demokra-
tie unter diesen Umständen zu einem Hindernis für die demokratisch-emanzipatorische Bewegung ge-
worden ist und nach Alternativen zu der Verflechtung von postdemokratischer und neoliberaler Souverä-
nitätskritik sucht. Dies geht einher mit dem Versuch, die antiquierte ‚Zombietheorie‘ des Marxismus
4 Vgl. hierzu mit detaillierten Nachweisen und zahlreichen weiteren Textbeispielen Hubertus Niedermaier, Das
Ende der Herrschaft? Perspektiven der Herrschaftssoziologie im Zeitalter der Globalisierung, Konstanz 2006, 7ff.
Auch Hans Boldt, Art. Staat und Souveränität IX.-X., Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland VI, Stuttgart 1990, 129-153, hier 152, konstatiert, dass schon vor gerau-
mer Zeit „die ‚Souveränität‘ zum historischen Begriff erklärt [wurde], dessen Gebrauch nunmehr als anachronis-
tisch gilt.“
3
nach ihrem realpolitischen Scheitern in Osteuropa so zu reformulieren, dass der relationale und kontin-
gente Charakter des Politischen nicht auf Kosten von dessen universaler und revolutionärer Dimension
anerkannt wird.
Die einseitige Dekonstruktion souveräner Herrschaft zugunsten der Ausdifferenzierung von sozialer
Komplexität in der politisch-sozialen Theorie der Gegenwart wird hierbei als ein politischer Angriff auf
diejenige Instanz gedeutet, die Jacques Lacan als ‚Herren-Signifikant‘ bezeichnet hat und ohne welche
die Welt in einen atonalen Zustand verfällt, in dem die chaotische Vielfalt der Wirklichkeit ohne Bedeu-
tungsordnung bleibt.5 Dies entspricht im Groben dem, was klassische Souveränitätstheoretiker zwischen
Thomas Hobbes und Immanuel Kant unter dem Rückfall in den Naturzustand als einem Zustand jenseits
von Ordnung verstanden haben, in dem allein das chaotische (Un-)Recht des Krieges und der Stärke
herrscht. Für Žižek ist diese Demontage der „Handlungsmacht des anordnenden Herren-Signifikanten
[…] ein augenfälliges Merkmal der postmodernen Welt“6. Der Widerstand gegen diese Strategie gestaltet
sich aber vor allem dadurch als schwierig, weil sie ideologisch sehr erfolgreich die politisch-libertären
Werte von Demokratie und Freiheit vereinnahmt, was ihr erlaubt, jegliche Kritik undifferenziert in eine
autoritäre oder gar totalitäre Ecke zu drängen.7 Žižek und Badiou plädieren dafür, diesen ideologischen
Vorwurf trotz seiner Popularität auszuhalten, um den hinter dieser Strategie verborgenen Exzess der ka-
pitalistischen Profitinteressen überhaupt ernsthaft kritisieren zu können. Nur so könne die (post-) demo-
kratische Atonalisierung mit der umfassenden Deregulierung der kapitalistischen Märkte in Verbindung
gebracht werden, die mittlerweile insbesondere auf den internationalen Finanzmärkten so offensichtlich
für soziale Verwerfungen gesorgt hat, dass sie nicht nur den demokratisch verfassten Sozialstaat zerstö-
ren, sondern die Welt auch in ein neues kriegerisches Zeitalter stürzen. Ein Ausweg aus dieser Situation
kann für Žižek und Badiou unter diesen Umständen nicht mehr in der Rückkehr zur liberalen Demokratie
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestehen, sondern allein in der Reaktivierung einer revolutio-
nären Volkssouveränität, die politisch mit der legalistischen Reduktion der Demokratie bricht.
5 Der leere ‚Herren-Signifikant‘ bezeichnet Bedeutung als solche und ermöglicht damit überhaupt erst die differen-
tielle Ordnung zwischen verschiedenen Signifikanten. Die vom ‚Herren-Signifikanten‘ bedeutete Differenz ist die
grundlegende Differenz zwischen Bedeutung und Nicht-Bedeutung, die als reflexive Nullstelle notwendig ist, um
die differentielle Vielfalt von Bedeutung freizusetzen. Die soziale Praxis, in der ein ‚Herren-Signifikant‘ artikuliert
wird, lässt sich nicht vollständig auf Vernunft und Wissen zurückführen und steppt die symbolische Ordnung der Signifikanten an einen kontingenten Punkt, von dem aus im Anschluss retroaktiv eine Bedeutungsordnung herge-
stellt wird. Vgl. u.a. Slavoj Žižek, Der Erhabenste aller Hysteriker. Psychoanalyse und die Philosophie des deut-
schen Idealismus, übers. v. I. Charim, Wien 21992, 215-218. 6 Slavoj Žižek, Gewalt. Sechs abseitige Reflexionen, übers. v. A.L. Hofbauer, Hamburg 2011, 37. 7 Für Alain Badiou, Logiken der Welten. Das Sein und das Ereignis (Transpositionen 34), unter Mitarb. v. A.
Schubbach, übers. v. H. Jatho, Zürich 2010, 446, ist „[d]ie moderne, stets mit einem Lob der demokratischen Be-
wegung geschmückte Apologie der ‚Komplexität‘ der Welt […] in Wirklichkeit nur der Wunsch nach einer allge-
mein gewordenen Atonie.“ Ganz ähnlich ist für Slavoj Žižek, Das ‚unendliche Urteil‘ der Demokratie, in: Demo-
kratie? Eine Debatte, hg. v. G. Agamben, Berlin 2012, 116-136, hier 125, „unschwer zu erkennen, dass innerhalb
des liberaldemokratischen Horizonts die ‚terroristische‘ Seite der Demokratie – die gewaltsame egalitäre Erhebung
der ‚Überzahl‘, des ‚Teils, der nicht teilhat‘ – nur als deren ‚totalitaristische‘ Verzerrung erscheinen kann.“ Žižek befindet sich damit in einer demokratietheoretischen Tradition, die zurückreicht bis auf Arthur Rosenberg, Demo-
kratie und Sozialismus, Frankfurt/M. 1988, der 1938 den Legalismus des liberalen Demokratieverständnisses für
die Erfolge des Faschismus auf dem europäischen Kontinent verantwortlich machte.
4
Damit wiederholt sich auf überraschende Weise ein Krisenszenario wie es auch am Ursprung der revolu-
tionären Volkssouveränität in der Französischen Revolution bestanden hat. Die politische Ausstreichung
der Volkssouveränität aus der staatlich-legalistischen Demokratie der Gegenwart wiederholt gewisser-
maßen das Trauma der Geburt des politischen Subjekts am Beginn des demokratischen Zeitalters inso-
fern, wie bereits Emmanuel Joseph Sieyès wusste, jede Subjektivierung eines universalen emanzipatori-
schen Agenten aus der Tilgung seines konkreten Inhalts und seiner Reduktion auf den Status eines for-
malen ‚Nichts‘ resultiert.8 Wenn die Wiederholung des Traumas, das ein Subjekt durch die erneute Be-
raubung seines substantiellen Inhalts in der Gegenwart durchlebt, wie Žižek meint, die Möglichkeitsbe-
dingungen für die Entstehung eines neuen politischen Subjekts freisetzt, dann ist jedoch die gegenwärti-
ge Situation nicht total aussichtslos.9 Und gerade deshalb scheint es nicht umsonst zu sein, die histori-
schen Bedingungen der traumatischen Geburt des demokratischen Subjektes noch einmal konsequent auf
die gegenwärtigen Bedingungen seiner politischen Austilgung zu beziehen. Nichts anderes steckt hinter
Žižeks engagierter Relektüre Hegels und des Deutschen Idealismus, in der die Geburtsprobleme des mo-
dernen politischen Subjekts vor dem Hintergrund seiner aktuellen Krise philosophisch artikuliert werden.
Aus dieser Sicht kann es nicht genügen, eine kritische Gegenlektüre zur reaktionären Misere der Gegen-
wart auf die Werke von Karl Marx zu beschränken, sondern man muss konsequent wieder von vorn be-
ginnen, d.h. von einem Anfang, aus dem heraus sich auch Marx‘ dialektisches Denken neu erschließt.
Für Žižek war es vor allem Hegel, der den Geist der (gescheiterten) Französischen Revolution in die
Philosophie einführte. Hier soll lediglich daran erinnert werden, dass der große Inspirator für Žižeks He-
gel der Jakobiner, Philosoph und wissenschaftliche Begleiter James Cooks Georg Forster war.10
2. ‚Göttliche Gewalt‘ und das Ereignis der Volkssouveränität
Auf dem Höhepunkt der Französischen Revolution im Winter 1793/94 teilte Forster aus Paris dem über
den Verlauf der Revolution zunehmend beunruhigten deutschen Publikum folgende Beobachtung über
den Zusammenhang von revolutionärer Gewalt und öffentlicher Meinung mit:
„Als Necker dieses große, nicht zu berechnende Mobil der Volkskraft anregte, wußte er nicht,
was er that. Die ersten Anfänge der Bewegung waren aber wegen des Umfangs, der Masse und
des Gewichts so unmerklich, daß Klügere als er, sich täuschten, und diese ungeheure Triebfeder
umspannen zu können, sich vermaßen. Allein wie bald entwand sie sich aus ihren ohnmächtigen
Händen! – Es entstand ein chaotisches Ringen der Elemente; es erfolgten die heftigsten Konvul-
8 Vgl. Emmanuel Joseph Sieyès, Politische Schriften 1788-1790. Mit Glossar und kritischer Sieyès-Bibliographie
(Ancien Régime, Aufklärung und Revolution 5), hg. v. E. Schmitt/R. Reichardt, München 21981, 119.126-130. Die
Ausstreichung der Volkssouveränität als reales politisches Subjekt und ihre Reduktion auf ein formelles legalisti-
sches Prozedere findet sowohl durch die praktische Beschränkung auf die Wahl von Repräsentanten als auch durch
die theoretische Verkürzung auf parlamentarische Deliberation statt. Dies eint in der deutschen politischen Theorie
so unterschiedliche Positionen wie Martin Kriele, Einführung in die Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimitäts-
grundlagen des demokratischen Verfassungsstaates WV-Studium 35), Opladen 21981 und Ingeborg Maus, Über
Volkssouveränität. Elemente einer Demokratietheorie, Berlin 2011. 9 Vgl. Slavoj Žižek, Was ist ein Ereignis?, übers. v. K. Genschow, Frankfurt/M. 2014, 99f. 10 Den besten biographischen Überblick zu Forster bietet Ludwig Uhlig, Georg Forster. Lebensabenteuer eines
gelehrten Weltbürgers (1754-1794), Göttingen 2004.
5
sionen, die furchtbarsten Erschütterungen. Kleinere gegenstrebende Bewegungen wurden von
den größeren, allgemeineren verschlungen; so gab es denn eine gleichartige Bewegung, oder mit
andern Worten: der Wille des Volks hat seine höchste Beweglichkeit erlangt, und die große
Lichtmasse der Vernunft, die immer noch vorhanden ist, wirft ihre Strahlen in der von ihm vers-
tatteten Richtung.“11
Forster, der zum Zeitpunkt dieser Beobachtung im Pariser Exil seine akademische Karriere als Kultur-
anthropologe, Naturwissenschaftler und Philosoph ebenso hinter sich gelassen hatte wie sein Engage-
ment als aktiver jakobinischer Politiker im Dienste der Mainzer Republik, beschreibt hier die revolutio-
näre Entwicklung der öffentlichen Meinung zu einer allgemeinen und unwiderstehlichen materiellen
Gewalt, in der sich der souveräne Volkswille über jeden Widerstand hinwegsetzt und dabei selbst eine
apriorisch gedachte Vernunft in seine Bahnen zwingt. Letzteres muss selbstverständlich als ein kritischer
Seitenhieb auf den Kantianismus gelesen werden, der zu diesem Zeitpunkt die kritische Philosophie und
das mit der Revolution sympathisierende Publikum in Deutschland dominierte. Dabei nimmt Forster
nicht nur die Idee der Krümmung apriorischer Vernunftschemata wie Raum und Zeit – fast analog zu
Einsteins Relativitätstheorie – durch eine unwiderstehliche Gravitationskraft vorweg, er antizipiert auch
inhaltlich Benjamins Konzept der ‚göttlichen Gewalt‘ –, was hier von besonderer Bedeutung ist, weil
beide Momente auch in Žižeks Theoriegebäude eine wichtige Rolle spielen.12
Bei Benjamin, der Forsters
Texte kannte, speist sich die Metaphorik der Göttlichkeit aus dem Gegensatz zur ‚mythischen Gewalt‘,
worunter die instrumentelle ‚Rechtsgewalt‘ insbesondere des Staates verstanden wird.13
Die ‚göttliche
Gewalt‘, die von Žižek zur Ordnung des Ereignisses gerechnet wird, ist sich dagegen Selbstzweck, wes-
halb sie auf ein grundloses ‚Nichts‘ verweist.14
Von daher steht sie in einer Analogie sowohl zur theolo-
gischen creatio ex nihilo als auch zur deontologischen Ethik, die Forster mit Immanuel Kant teilte, die
gleichfalls ohne eine besondere empirische Triebfeder gewissermaßen aus dem ‚Nichts‘ kommt.15
Im
Gegensatz zur ‚mythischen‘ Staatsgewalt bezieht sich die ‚göttliche Gewalt‘ eines revolutionären Ereig-
11 Georg Forster, Parisische Umrisse, in: Georg Forsters Werke. Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe, Bd. X/1,
hg. v. der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1990, 593-637, hier 596f. (Hervorhebung im Original). 12 Am ausführlichsten setzt Žižek sich mit Benjamins Unterscheidung von ‚göttlicher‘ und ‚mythischer Gewalt‘
auseinander in Žižek, Gewalt, 157-178 (wie Anm. 6). Zur Bedeutung der Relativitätstheorie für Žižeks Hegel-
Interpretation siehe u.a. Slavoj Žižek, Denn sie wissen nicht, was sie tun. Genießen als ein politischer Faktor, übers.
v. E.M. Vogt, Wien 1994, 288ff. Forster greift hier höchstwahrscheinlich auf den englischen Naturphilosophen John Michell (1724-1793) zurück, der 1784 einen Zusammenhang zwischen der Gravitationskraft und der Bewe-
gungsform des Lichts behauptet hatte sowie als erster die Existenz ‚Schwarzer Löcher‘ (dark stars) beschrieb.
Michell war es auch, der bereits 1768 den Begriff der ‚Parallaxe‘ verwandte. Vgl. John Michell, On the means of
discovering the distance, magnitude, &c. of the fixed stars: in consequence of the diminution of the velocity of their
light, London 1784. 13 Vgl. Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt, in: Gesammelte Schriften. Aufsätze, Essays, Vorträge, Bd. II,
Frankfurt/M. 21989, 179-203, insbesondere 199ff. „Was revolutionäre Freiheit und wie sehr auf Entbehrung ange-
wiesen sie ist“, schreibt Walter Benjamin, Deutsche Menschen. Eine Folge von Briefen, in: Gesammelte Schriften.
Kleine Prosa, Baudelaire-Übertragungen, Bd. IV, 1, Frankfurt/M. 1991, 149-233, hier 160, über den von ihm ge-
schätzten Forster, „hat damals schwerlich einer wie Forster begriffen, niemand wie er formuliert.“ 14 Vgl. Žižek, Gewalt, 175 (wie Anm. 6). 15 Wie Kant lehnt Forster jeglichen empirischen Utilitarismus in der Moral als Quelle der Korruption ab. Zum revo-
lutionären Potential von Kants Ethik und ihren Grenzen siehe Alenka Zupančič, Das Reale einer Illusion. Kant und
Lacan, übers. v. R. Ansén, Frankfurt/M. 2001.
6
nisses deshalb auf keine positive Letztbegründung, sondern definiert sich als der abwesende Grund der
Volkssouveränität, der einzig und allein auf seine Nichtigkeit verweist.
Diese Spannung ist auch schon jener politischen Differenz implizit, die Sieyès zwischen dem pouvoir
constituant und dem pouvoir constitué eingeführt hat, in der die göttlichen Attribute staatlicher Souverä-
nität (potestas constituens, norma normans, creatio ex nihilo) politisch auf das fragile Kollektivsubjekt
des Volkes übertragen werden.16
Der authentische Charakter eines solchen Übertragungsaktes erweist
sich aber erst mit der Transformation der ‚mythischen‘ und daher korrupten Staatsgewalt in eine ‚göttli-
che‘ und daher ethische Revolutionsgewalt, wobei letzterer nicht mehr die positive Identität eines überle-
genen und vollkommenen Herrschaftssubjekts, sondern eine politische Subjektivität zugrunde liegt, die
vom Mangel einer konstitutiven Abwesenheit gekennzeichnet ist. Der souveränitätstheoretische Mythos
der fest und vollständig gegründeten Staatsgewalt in der Hand eines positiven Subjekts der Fülle weicht
hier einer aus dem ‚Nichts‘ kommenden Gewalt, deren authentisches Subjekt weder eine positive Person,
Klasse oder Ethnie ist, sondern wie der ‚Dritte Stand‘ (tiers état) von Sieyès nur eine vom Mangel ge-
zeichnete kollektive Person sein kann, deren fragile Identität durch eine politische Subtraktion bestimmt
ist.17
In der Beschreibung von Sieyès erscheint der Dritte Stand als der unterdrückte und aus der Politik
ausgestrichene ‚Rest‘, der übrig bleibt, wenn der privilegierte Teil von der Gesamtgesellschaft abgezogen
wird. Sieyès’ pouvoir constituant markiert zwar ähnlich wie die natura naturans Spinozas eine ontolo-
gisch-metaphysische Differenz, anders als diese basiert sie aber auf dem Prinzip der generativen Abwe-
senheit.18
Forster arbeitet diese Theorie von Sieyès weiter aus, wenn er konsequent darauf besteht, dass sich die
revolutionäre Gewalt des Volkes nicht instrumentalisieren lässt, da sie ein Selbstzweck sei. Die blindwü-
tigsten Exzesse der Revolution führt er auf die verschiedenen Versuche zurück, diese Gewalt einem em-
pirisch-utilitaristischen Kalkül zu unterwerfen, denen Forster entweder Naivität oder Korruption, meis-
tens allerdings jedoch beides unterstellt. 1793 ist für Forster klar, dass jeder Versuch, den Prozess der
Revolution in den positiven Rahmen eines vorhandenen philosophischen Systems oder einer bekannten
staatlichen Verfassungsordnung zu pressen und hieraus politische Urteile und Handlungsstrategien abzu-
leiten, die Eskalationsspirale nur noch weiter voran schraubt:
„Die Revolution hat alle Dämme durchbrochen, alle Schranken übertreten, die ihr viele der bes-
ten Köpfe hier und drüben bei Ihnen, in ihren Systemen vorgeschrieben hatten. Zuerst schwellte
sie über den engen Kreis, den ihr Mounier wohlmeinend anweisen wollte. C’est une tête de
16 Vgl. Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes – Ein Grenzbegriff des Verfas-
sungsrechtes, in: Zum Begriff der Verfassung. Die Ordnung des Politischen, hg. v. U.K. Preuß. Frankfurt/M. 1994,
58-80, hier 62. 17 Im Anschluss an Badiou und Rancière bestimmt Slavoj Žižek, Der Mut, den ersten Stein zu werfen. Das Genie-
ßen innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, übers. v. E.M. Vogt, Wien 2008, 103 die politische Logik der Sub-
traktion als Alternative zur repressiv-staatlichen Logik der Purifikation (Säuberung) innerhalb der modernen „Pas-
sion des Realen“. „Anders als die Säuberung, die vermittels einer gewaltsamen Beseitigung aller Hüllen die Isolati-
on des Kerns des Realen anstrebt, beginnt die Subtraktion mit der Leere, mit der Reduktion (‚Subtraktion‘) jegli-
chen bestimmten Inhalts und versucht dann, eine minimale Differenz zwischen dieser Leere und einem Element herzustellen, das als ihr Platzhalter fungiert.“ (ebd.). 18 Vgl. hierzu die Kritik des Spinozismus bei Slavoj Žižek, Körperlose Organe. Bausteine für eine Begegnung zwi-
schen Deleuze und Lacan, übers. v. N.G. Schneider, Frankfurt/M. 2005, 55-67.
7
bronze, coulée dans un moule anglois, sagten wir, weil er so hartnäckig an seiner Nachahmung
der Englischen Konstitution hangen blieb; und damit war ihm das Urtheil gesprochen. Manche,
auch gemäßigte Staatsmänner, gingen in ihrer Nachgiebigkeit schon weiter, und glaubten noch
an die Möglichkeit einer guten Verfassung außerhalb jenes Bezirkes. Als aber auch die Herku-
lessäulen, trotz der stolzen Inschrift: non plus ultra, von dem brausenden Orkan umgestürzt la-
gen, da verkündigte ihre beleidigte Eitelkeit schon das jüngste Gericht. Andere harrten länger
aus; aber seitdem ihre letzten Ableiter, den sie im Föderalsystem gefunden zu haben glaubten,
durch einen Blitzstrahl vom Berge zerschmettert worden ist, kommen auch sie mit der Babyloni-
schen Hure schon aufgetreten. Die öffentliche Meinung ist alle diese Stufen hinangestiegen, und
auf jeder höheren hat sie den Irrthum erkannt, den die Täuschung des falschen Horizonts verur-
sachte. Jetzt bleibt sie bei der allgemeinsten aller Bestimmungen stehen: einer Bestimmung, die
freilich den Hafen so lieblich nicht vormahlt, wo das Staatsschiff wohlgemuth einlaufen und ab-
takeln soll, wobei es sich aber doch mit jener mystischen Losung aus den neuen Ritterzeiten ei-
nes geheimen Ordens: in silentio et spe fortitudo mea, auf offnem Meer, und selbst mit etwas be-
schädigten Masten und Segeln, noch ganz bequem einherschwimmen läßt.“19
Anschaulicher kann das Scheitern der ‚mythischen Gewalt‘ im Angesicht ‚göttlicher Gewalt‘ kaum be-
schrieben werden. Die Unfähigkeit vieler Politiker, den ‚göttlichen‘ Ereignischarakter der revolutionären
Gewalt zu erkennen und zu akzeptieren, endete freilich deshalb für diese mitunter tragisch und trieb den
gewaltsamen Prozess der Revolution nur noch weiter voran. Forster spricht in diesem Kontext vom ei-
genartigen Verhalten jener „Halbweisen, die ihr [der Revolution; A.R.] voranliefen und sie zuerst in Be-
wegung brachten, plötzlich stille zu stehen und sich zu ärgern, daß sie, wie eine Schneelawine, mit be-
schleunigter Geschwindigkeit dahinstürzt, stürzend an Masse gewinnt, und jeden Widerstand auf ihrem
Wege vernichtet“.20
Erkannt und repräsentiert kann die ontologische Naturgewalt der Revolution für
Forster allein von der öffentlichen Meinung werden: „Die öffentliche Meinung ist also bei uns in Absicht
auf die Natur der Revolution jetzt so weit im Klaren, daß man es für Wahnsinn halten würde, ihr Einhalt
thun oder Grenzpfähle stecken zu wollen. Eine Naturerscheinung, die zu selten ist, als daß wir ihre
eigenthümlichen Gesetze kennen sollten, läßt sich nicht nach Vernunftregeln einschränken und bestim-
men, sondern muß ihren freien Lauf behalten.“21
Was Forster hier klar problematisiert und in Worte zu fassen versucht, ist der Ereignischarakter der Fran-
zösischen Revolution, der sich erst jetzt endgültig mit dem modernen Revolutionsbegriff verbindet. Ein
Ereignis zeichnet sich nach Žižek vor allem dadurch aus, dass es erst rückwirkend und zirkulär die eige-
nen Voraussetzungen schafft, der es eigentlich bedarf, um ins Sein zu treten und dort präsent zu bleiben.
„In einer ersten Annäherung erscheint das Ereignis also als Effekt, der seine Gründe zu übersteigen
scheint – und der Raum eines Ereignisses ist derjenige, der von dem Spalt zwischen einem Effekt und
19 Forster, Umrisse, 594f (wie Anm. 11) (Hervorhebung im Original). 20 Ebd., 596 (Hervorhebung im Original). 21 Ebd., 595.
8
seinen Ursachen eröffnet wird.“22
Dies ist der Grund, warum die Revolution die politische Zeit zu einer
dialektischen Zeitschleife krümmt, die retroaktiv ihre eigenen Voraussetzungen setzt.23
Bisher hatte der
Revolutionsbegriff immer noch die politische Vollendung eines Zyklus aus Aufstieg und Niedergang
bezeichnet, der nicht notwendig mit einer substantiellen Veränderung der Seinsordnung verbunden war,
so dass die Revolution noch nicht konsequent vom bloßen Regierungswechsel oder Staatsstreich ge-
schieden war. Erst jetzt durch die konsequente Verbindung von Revolutions- und Ereignisbegriff wurden
Revolutionen als ‚Lokomotiven der Geschichte‘ (Karl Marx) denkbar, die zugleich eine säkulare Form
der Providenz etablieren.24
So verträgt sich Forsters naturalistische Revolutionsdeutung sehr wohl mit
der messianischen Überzeugung, „daß unsre Revolution, als Werk der Vorsehung, in dem erhabenen
Plan ihrer Erziehung des Menschengeschlechts gerade am rechten Ort steht […]; denn sie ist die größte,
die wichtigste, die erstaunenswürdigste Revolution der sittlichen Bildung und Entwickelung des ganzen
Menschengeschlechts.“25
Gerade weil Forster die ‚göttliche Gewalt‘ und die deontologische Pflichten-
ethik im Begriff der Revolution konvergieren lässt, kann er diese als einen universalistischen ethischen
Akt von der korrupten und an ein partikularistisches Machtinteresse gebundenen Revolte und dem
Staatsstreich unterscheiden.26
Insofern sich die Revolution als Selbstzweck aber jedem utilitaristisch-
instrumentellen Kalkül entzieht, muss das unbedingte Bekenntnis Forsters zur Revolution als ein Akt
gelesen werden, der auf jede Begründung im ‚großen Anderen‘ der symbolischen Ordnung verzichtet.
Der wesentliche Unterschied zwischen Forster und den von ihm erwähnten politischen „Halbweisen“, –
zu denen neben dem Bankier Jacques Necker, dem Marquis de Lafayette, dem Girondisten Jacques Pier-
re Brissot auch der Jakobiner Georges Danton und viele andere zu rechnen sind –, die der Revolution
22 Žižek, Ereignis, 9 (wie Anm. 9) (Hervorhebung im Original). 23 Hierin besteht der rationale Kern des in der deutschen Staatslehre oft diskutierten ‚Böckenförde-Dilemmas‘, vgl.
Ernst-Wolfgang Böckenförde, Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht,
Frankfurt/M. 1976, 60. Die Tatsache, dass der demokratisch-säkulare Verfassungsstaat „von Voraussetzungen
[lebt], die er selbst nicht garantieren kann“ (ebd.), kündet aber weniger von der traditionell-religiösen Substanz
legitimer Herrschaft als von dem revolutionären Ereignis, das dem demokratischen Staat im Innersten eingeschrie-
ben ist. Der Versuch der legalistischen Austilgung der Revolution aus der demokratischen Ordnung geht folglich
notwendig einher mit der Auslöschung dieses Ereignischarakters und reduziert den reinen ‚Rechtsstaat‘ letztlich nur
noch auf eine staatlich-mechanische Zwangsordnung. Ohne das jakobinische ‚Unrechtsregime‘ verliert der ‚Rechts-
staat‘ seine emanzipatorische Legitimität. Gegen Böckenförde sollte daher mit Žižek und Badiou darauf bestanden
werden, dass sich dieses Dilemma nur dann christlich auflösen lässt, wenn der christliche Akt am Kreuz atheistisch
interpretiert wird und das Christentum als radikaler Repräsentationsmodus eines Ereignisses fungiert, der in allen
revolutionären Bewegungen wiederholt und aufgehoben wird. Vgl. u.a. Slavoj Žižek, Die Puppe und der Zwerg. Das Christentum zwischen Perversion und Subversion, übers. v. N.G. Schneider, Frankfurt/M. 2003, insbesondere
64-93. 24 Vgl. Karl Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850, in: Werke. Karl Marx, Friedrich Engels, Bd.
VII, Berlin 1982, 9-107, hier 85. Zur Transformation des Revolutionsbegriffes siehe Karl-Heinz Bender, Revoluti-
onen. Die Entstehung des politischen Revolutionsbegriffes in Frankreich zwischen Mittelalter und Aufklärung,
München 1977; Karl Griewank, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff. Entstehung und Entwicklung, Hamburg 31992
sowie Reinhart Koselleck, Revolution als Begriff und als Metapher. Zur Semantik eines einst emphatischen Worts,
in: Ders., Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache, Frank-
furt/M. 2010, 240-251. 25 Forster, Umrisse, 600f (wie Anm.11). 26 „Wenn der Khan oder der Visir seinen Sultan bekriegt, wenn Pugatschew in Rußland einen Aufruhr stiftet, so sind diese Revolutionen, was auch immer ihr Erfolg seyn mag, für das Menschengeschlecht unfruchtbar; denn die
Absicht ihrer Urheber ist bloß persönlicher Eigennutz, und die Beförderung der Humanität kann ihnen nicht einmal
Vorwand und Mittel seyn.“ (ebd., 605).
9
zunächst voranliefen, um dann innezuhalten und von derselben überrollt zu werden, besteht mithin darin,
dass diese entweder überhaupt keinen Sinn für den außerordentlichen Ereignischarakter der Revolution
hatten (Necker und Lafayette) oder diesen nicht vollständig und in seiner letzten Konsequenz zu akzep-
tieren vermochten (Brissot und Danton).
3. Vom legalen ‚Begehren‘ des Glücks zum revolutionären ‚Trieb‘ der Würde
Wenn Forster die Revolution konsequent als ein Ereignis beschreibt, dann kommt er dabei inhaltlich
Žižeks Definition des Realen sehr nahe, für den ein reales Ereignis die „traumatische Begegnung mit
einem göttlichen Ding“27
beziehungsweise einer ‚göttlichen Gewalt‘ im Sinne Benjamins beinhaltet. Die
Kategorie des Realen gehört neben dem Symbolischen und dem Imaginären zu den grundlegenden Di-
mensionen, in denen sich der Mensch nach der Theorie Lacans bewegt. Das Reale ist bei Žižek „nicht
einfach die externe Realität“, sondern etwas Unmögliches, „das weder direkt erfahren noch symbolisiert
werden kann“.28
Verstanden als „ein traumatisches Zusammentreffen zwischen extremer Gewalt, die
unser gesamtes Bedeutungsuniversum destabilisiert“,29
scheint der Begriff des Realen tatsächlich direkt
mit Forsters Revolutionsbeschreibung zu konvergieren. Dabei erweisen sich Forster wie Žižek als radika-
le Materialisten, die den mechanischen Materialismus allerdings zugunsten einer dialektischen Version
hinter sich lassen. Denn obwohl Forster die Revolution als ein sittliches Ereignis innerhalb der göttlichen
Ordnung der Vorsehung vorstellt, so ist ihre „bewegende Kraft“ dennoch „nichts rein Intellektuelles,
nichts rein Vernünftiges; sie ist die rohe Kraft der Menge.“30
Und er fährt fort:
„In so fern, wie Vernunft ein vom Menschen unzertrennliches Prädikat ist, in so fern hat sie frei-
lich auf die Revolution ihren Einfluß, wirkt mit in ihre Bewegung, und bestimmt zum Theil ihre
Richtung; aber präponderieren kann sie nicht, und wenn – wie wir doch nicht in Abrede seyn
wollen? – die Revolution einmal im Rathe der Götter beschlossen war, durfte sie es auch nicht,
weil ihre Präponderanz an und für sich nur die Revolution hemmen, nie sie treiben und vollbrin-
gen kann. Ich würde sie die ächte vim inertiae nennen, wenn ich es mit einem Physiker zu thun
hätte; denn einmal überwunden von der Stoßkraft, dürfte dennoch in ihr selbst der Grund jener
langen Dauer liegen, womit die Revolutionsbewegung so manchen unerfahrnen Beobachter in
Erstaunen setzte.“31
Der „Rat der Götter“, in dem die Revolution beschlossen wurde, lässt sich hier klar dem Register des
Realen innerhalb eines Ereignisses zurechnen. Einerseits bezieht sich diese theologische Metapher auf
den fiktiven Rahmen, in dem sich die revolutionäre Veränderung vollzieht,32
und andererseits benötigt
27 Žižek, Ereignis, 123 (wie Anm. 9). 28 Ebd., 120. 29 Ebd., 120f. 30 Forster, Umrisse, 596 (wie Anm. 11). 31 Ebd. (Hervorhebung im Original). 32 Dies korrespondiert wiederum mit Žižeks Definition des Ereignisses: „In seiner grundlegendsten Definition ist
ein Ereignis nicht etwas, das innerhalb der Welt geschieht, sondern es ist eine Veränderung des Rahmens, durch
den wir die Welt wahrnehmen und uns in ihr bewegen. Ein solcher Rahmen kann manchmal direkt als eine Fiktion
10
sie Forster dazu, um das ebenso gewaltige wie unmögliche Ausmaß des revolutionären Ereignisses erfas-
sen zu können. Der spirituelle Aspekt des Göttlichen tritt hier, wie Žižek in Bezug auf die Definition
eines realen Ereignisses bemerkt, hinter den „zerstörerische[n] Aspekt des Göttlichen“ zurück, der „die
brutale Explosion von Wut mit ekstatischer Glückseligkeit vermischt“.33
Wenn Forster dabei gleichzeitig
darauf insistiert, dass es nicht die Vernunft ist, die die Revolution antreibt, dann deckt sich seine Argu-
mentation auch überraschend weitgehend mit dem Begriff des ‚Triebes‘ – einem weiteren Schlüsselbe-
griff von Žižek, den er aus der Psychoanalyse von Freud und Lacan entnimmt. Weit entfernt davon, ein
Instinkt zu sein, bezeichnet der ‚Trieb‘ dort die Nullstufe der menschlichen Bedürfnisökonomie, die nicht
nur das bloße Leben reproduziert, sondern auf einen unmöglichen Überschuss an Lebensgenuss gerichtet
ist, und dadurch immer wieder den normalen Ablauf der Ordnung revolutioniert und aus den Angeln
hebt. Insofern verweist der ‚Trieb‘ gerade auf den revolutionären und qualitativen Einschnitt, der den
Menschen vom Tier beziehungsweise ‚Kultur‘ von ‚Natur‘ unterscheidet. Obwohl der ‚Trieb‘ also gerade
kein animalischer Instinkt ist, bezeichnet er doch auch keine intentionale Einstellung, die wie das Begeh-
ren auf ein konkretes Objekt gerichtet wäre, sondern vielmehr eine selbstreferenzielle und repetitive Be-
wegung, die unaufhörlich um die reale Lücke in der menschlichen Bedürfnisstruktur (imbecillitas) kreist,
in der das Subjekt gefangen ist. In diesem Sinne funktioniert der ‚Trieb‘ gleichsam wie ein ‚untotes‘
perpetuum mobile, das einmal im Menschen in Bewegung gesetzt automatisch weiterläuft und seine Be-
friedigung auch gegen den subjektiven Willen und sogar auf Kosten seiner subjektiven Träger fordert.
„Der Trieb“, so formuliert Žižek, „ist buchstäblich eine Gegenbewegung zum Begehren, er strebt nicht
etwa nach der unmöglichen Fülle, um dann, weil er gezwungen ist, auf sie zu verzichten, an einem Parti-
alobjekt als deren Rest hängenzubleiben – der Trieb ist, ganz wörtlich, genau der ‚(An-)Trieb‘ dazu, die
Allkontinuität, in die wir eingebettet sind AUFZUBRECHEN, ein radikales Ungleichgewicht in ihr her-
beizuführen“.34
Im politischen Kontext bedeutet dies, dass die anthropologische Annahme eines solchen ‚Triebs‘ genau
dann mit dem ‚göttlichen‘ Charakter revolutionärer Gewalt inklusive deren inkonsistenter Subjektivität
konvergiert, wenn letztere im Gegensatz zur ‚mythischen‘ Staatsgewalt und deren positiv-begründeter
Subjektivität des Begehrens betrachtet wird. Der aus dem ‚Nichts‘ kommende materialistisch-reale
‚Trieb‘ (die abgründige Lücke in der menschlichen Bedürfnisstruktur) steht dann dem ‚mythisch‘ fixier-
ten Begehren in einer staatlich verfassten Sozialordnung gegenüber. „Göttliche Gewalt“ ist für Žižek
deshalb „der Ausdruck des reinen Triebes, des Untoten, des Exzesses des Lebens, der das ‚bloße Leben‘
schlägt, welches vom Gesetz beherrscht ist.“35
Insofern korrespondiert der ‚Trieb‘ mit dem merkwürdi-
gen Mangelsubjekt der unbegründeten Volkssouveränität, das mit sich selbst niemals identisch ist; wäh-
vorgestellt werden, die uns dennoch befähigt, die Wahrheit in einer indirekten Art und Weise zu sagen.“, Žižek,
Ereignis, 16 (wie Anm. 9) (Hervorhebung im Original). 33 Ebd., 123. Wenn Žižek in diesem Zusammenhang auf Hiob referiert, dem der „Gott des Realen – das Ding“ er-
schienen ist, d.h. „ein launischer, grausamer Herr, der schlicht keinen Sinn für universale Gerechtigkeit hat“ (ebd., 28), dann konvergiert auch dies mit Forsters materialistischer Beschreibung der revolutionären Gewalt. 34 Slavoj Žižek, Parallaxe, übers. v. F. Born, Frankfurt/M. 2006, 63 (Hervorhebung im Original). 35 Žižek, Gewalt, 172 (wie Anm. 6).
11
rend sich die staatlich-legale Ordnung über das Begehren auf eine Subjektivität gründet, deren Mängel-
wesen durch ein objektives Supplement verdrängt und ausgefüllt wird.
Wenn sich Žižek hierbei auf Marx’ Theorie des Warenfetischismus beziehen kann, worin die Ware als
Objekt des kapitalistischen Begehrens den subversiven ‚Trieb‘ ersetzt, so findet sich dieser Zusammen-
hang auch bei Forster bereits angelegt. Bei diesem fällt die Kritik am legalen Begehren mit der Kritik des
ideologischen Glücksbegriffs zusammen, wie es sowohl dem paternalistischen Polizeistaat als auch dem
kapitalistischen Marktsystem zugrunde liegt. Dem legalen Begehren des Glücks, das für Forster in die
von La Boétie, Rousseau und anderen beschriebene ‚freiwillige Knechtschaft‘ führt, wird ein „Bildungs-
trieb“ gegenübergestellt, der eben nicht auf das legal erzeugte Glücksbegehren, sondern auf die revoluti-
onäre „Menschenwürde“ gerichtet ist.36
In diesem Sinne betrachtet Forster die Französische Revolution
als einen politischen Prozess, in welchem das legal fixierte Glücksbegehren notgedrungen durch die sitt-
liche Würde des ‚Bildungstriebes‘ überwunden wird. Dies ermöglicht die Konvergenz des Terrors nack-
ter physischer Gewalt und der sublimen Spiritualität der Tugend in der jakobinischen Rhetorik.37
Wie bei
Žižek überkreuzen sich im Begriff des ‚Triebs‘ somit der bedeutungslose Materialismus der Natur mit
sublimer kultureller Sittlichkeit; wodurch eine philosophische Konstellation generiert wird, die Žižek als
dialektischer Materialismus beschreibt. Forster rekurriert hierzu auf Herders Theorie der Sprachgenese
und die Zivilisationstheorie der Spätaufklärung, die sich aus kulturellen Differenzen zwischen der ebenso
authentischen wie abwesenden civilisation (modus operandi) und dekadenter civilité (opus operatum)
speist.38
Die hierin involvierte Bildungsidee ist alles andere als ein steriler Idealismus, da der ‚Bildungs-
trieb‘, der den Menschen aus dem Tierreich heraus treibt, auch ein materieller Vorgang der Gewalt ist.
Insofern kann Forster „das Bewußtseyn eines abstrakten Ich“ jenseits jeder Harmonielehre auf den ge-
waltsamen und antagonistischen „Trieb“ zurückführen.39
Bei Žižek markiert der ‚Trieb‘ den Abgrund im Subjekt als etwas Fremdes beziehungsweise Reales und
trennt das Subjekt damit ebenso von sich selbst wie es dieses beständig über sich selbst hinaustreibt,
36 Georg Forster, Über die Beziehung der Staatskunst auf das Glück der Menschheit, in: Georg Forsters Werke.
Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe, Bd. X/1, hg. v. der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1990,
591. Zum Konzept des ‚Bildungstriebes‘ siehe Forster, Leitfaden, 187 (wie Anm. 2), sowie ders., Die Kunst und
das Zeitalter, in: Georg Forsters Werke. Kleine Schriften zu Kunst und Literatur. Sakontala, Bd. VII, hg. v. der
Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin 21990, 17. 37 Ganz ähnlich deutet Žižek, Gewalt, 172 (wie Anm. 6), die Verschränkung von Theologie und revolutionärer
Gewalt bei Benjamin: „Die ‚theologische‘ Dimension, ohne die für Benjamin die Revolution nicht siegreich sein kann, ist die Dimension des Exzesses des Triebs, des ‚Zuviel‘.“ 38 Zum Zusammenhang von Zivilisationstheorie und Französischer Revolution siehe Michael Sonenscher, Sans-
Culottes. An Eighteenth-Century Emblem in the French Revolution, Princeton 2008. Sonenscher weist ausdrücklich
auf die Analogie von Zivilisations- und Bildungsbegriff hin: „Civilisation was something like the opposite of civili-
ty, because civility involved hypocrisy, politeness, and simulated morality, while civilisation itself was real. In this
usage, civilisation meant something nearer to the German word Bildung, with its emphasis upon the way that hu-
man culture could, progressively, enable more of what, spiritually, was inside human nature to come to be mirrored
on the outside.” (ebd., 191). 39 Georg Forster, James Cook, der Entdecker, in: Georg Forsters Werke. Kleine Schriften zur Völker- und Länder-
kunde, Bd. V, hg. v. der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1985, 191-302, hier 195. Ganz ähnlich
heißt es bei Johann Gottlieb Fichte, Das System der Sittenlehre nach den Principien der Wissenschaftslehre, Je-na/Leipzig 1798, 153: „Es entsteht durch diese Reflexion auf den Trieb zuförderst ein Sehnen – Gefühl eines Be-
dürfnisses, das man selbst nicht kennt. Es fehlt uns, wir wissen nicht woran. – Hierdurch schon, als durch das erste
Resultat der Reflexion, ist das Ich unterschieden von allen andern Naturprodukten.“
12
ohne dass es sich von diesem entfremdeten ‚Trieb‘ befreien könnte. „Dieser Trieb ist das, was ‚im Sub-
jekt mehr ist als es selbst‘: Obwohl das Subjekt ihn niemals subjektivieren oder als eigenes annehmen
kann, indem es sagt ‚Ich bin es, der dies will‘, operiert er dennoch mitten im Kern des Subjekts.“40
Be-
merkenswerterweise entwickelt Forster in diesem Kontext das Motiv der anthropologischen ‚Nacht des
Ungrunds‘, auf welche die Philosophie bei der vergeblichen Suche nach der menschlichen Seele letztlich
stoßen muss. In der programmatischen Passage, in der Forster diesen Zusammenhang 1789 entwickelt,
heißt es:
„Sie [die Philosophie; A.R.] stehet am Rande jenes kritischen Abgrunds, den Milton’s Satan
einst durchwanderte. Die Substanzen sagt man, fliehen sie stärker, je eifriger sie ihnen nach-
forscht; sie hat nicht nur die Seele ganz aus dem Gesichte verloren, sondern sogar der Körper
soll ihr neulich abhanden gekommen sein. Wenn es so fortgehet, und alles um sie her verschwin-
det, so läuft sie wirklich Gefahr, im großen idealischen Nichts sich selbst zu verlieren, wofern
nicht das uralte Chaos sie eben so freundschaftlich wie den Höllenfürsten lehrt, in jener ‚Uner-
meßlichkeit ohne Grenzen, Ausdehnung und Gegenstand, wo Zeit und Raum unmöglich sind,‘ –
sich zu orientiren! Doch zurück von dieser Nacht des Ungrunds, des Zwists und der Verwirrung,
wohin vielleicht keiner von meinen Lesern weder einem gefallenen Engel noch einem exaltirten
Denker Lust zu folgen hat.“41
Das ‚Licht der Vernunft‘ der Aufklärung wird hier, wie das Beispiel Hegels, – der diese Reflexion Fors-
ters offenkundig rezipierte –, zeigt, durch die „Nacht des Ungrunds“ beziehungsweise in der Fassung
Hegels durch die „Nacht der Welt“ verdunkelt beziehungsweise relativiert. Žižek schlussfolgert: „Das
Subjekt ist nicht länger das Licht der Vernunft, das dem nicht transparenten, undurchdringlichen Stoff
(der Natur, der Tradition usw.) gegenübergestellt ist; sein innerster Kern, die Geste, die den Raum für
das Licht des lógos öffnet, ist absolute Negativität, die ‚Nacht der Welt‘, der Punkt des schieren Wahn-
sinns, in dem phantasmagorische Erscheinungen von Partialobjekten ziellos umherstreifen.“42
Damit
wird aber nicht nur das intellektualistische Paradigma der Aufklärung aufgehoben, in der Fassung von
Forster wird die abgründige „Nacht der Welt“ darüber hinaus zum Paradigma einer jakobinisch-
radikaldemokratischen ‚Real-Politik‘. Um dies zu sehen, braucht man nur die Textpassage von 1789 auf
die eingangs zitierte Bemerkung in den Parisischen Umrissen beziehen, wonach die unberechenbare
Gewalt beziehungsweise der „Wille des Volkes“ die „Strahlen“, die „die große Lichtmasse der Vernunft
[…] wirft[,] […] in der von ihm verstatteten Richtung“ ablenkt.43
Es wird dann deutlich, wie Forster das
Subjekt der Volkssouveränität analog zu jedem wirklichen Subjekt nicht als einen rein intelligiblen Ak-
40 Žižek, Ereignis, 131f (wie Anm. 9). 41 Forster, Leitfaden, 186 (wie Anm. 2). 42 Slavoj Žižek, Die Tücke des Subjekts, übers. v. E. Gilmer, Frankfurt/M. 2001, 51. Während Slavoj Žižek, Less
than nothing. Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism, London 2012, 166f, in diesem Kontext von der
„Kantian revolution“ im Verhältnis von Vernunft und Wahnsinn spricht, war es vor Schelling und Hegel wiederum
Georg Forster, Über den gelehrten Zunftzwang [Vorrede zur deutschen Übersetzung von Volney, Die Ruinen] in: Georg Forsters Werke. Kleine Schriften zu Philosophie und Zeitgeschichte, Bd. VIII, hg. v. der Deutschen Akade-
mie der Wissenschaften, Berlin 1974, 232, der die „absolute Wahrheit“ mit dem „Wahnsinn“ identifiziert hat. 43 Forster, Umrisse, 596f (wie Anm. 11).
13
teur begreift, da ihnen der ‚göttliche‘ Wahnsinn als ebenso konstitutiver wie abgründiger ‚Trieb‘ inne-
wohnt; ein Exzess der Einbildungskraft, der dem unvorstellbaren Übergang von der ‚Natur‘ zur ‚Kultur‘
eine Analogie mit dem traumatisch-revolutionären Übergang vom untertänigen zum demokratischen
Subjekt der Selbstbestimmung setzt. Aus der Perspektive Žižeks ist Forsters Anthropologie folglich voll-
ständig analog zu dessen Revolutionstheorie: Ebenso wie der Exzess der wahnsinnigen Negativität und
der nicht-identischen Andersheit erst den Raum für das menschliche Cogito öffnet, ist auch der sittlich-
politische Fortschritt der Menschheit von der Negativität revolutionärer Gewalt abhängig.44
Auf die „rohe Kraft der Menge“ und das „Mobil der Volkskraft“ in der Revolution bezogen, erlaubt es
die Perspektive des ‚Triebs‘ daher, die revolutionäre Gewalt einerseits durchaus als abstoßend und wahn-
sinnig grausam zu empfinden, diese aber andererseits dennoch zugleich auch als obsessiven Operator
‚realer‘ beziehungsweise ‚göttlicher‘ Gerechtigkeit im Sinne einer unberechenbaren Volkssouveränität
enthusiastisch ‚genießen‘ zu können.45
Dieses paradoxe Konzept des ‚Triebs‘ gestattet es insoweit über-
haupt erst, eine ‚real-politische‘ Haltung gegenüber dem göttlichen ‚Ding‘ beziehungsweise der Gewalt
eines realen Ereignisses einzunehmen und eröffnet Forster die Möglichkeit, die revolutionäre Gewalt in
eine repräsentative Theorie der öffentlichen Meinung und des demokratischen Republikanismus zu integ-
rieren. Für sich genommen ist die physische Materialität der „göttlichen Gewalt“ laut Žižek nur ein sinn-
loses „Zeichen ohne Bedeutung“ oder allenfalls ein bloßes „Insignium der Ungerechtigkeit der Welt“, die
selbst unmittelbar noch keiner politischen Haltung entspricht und daher auch kein „Mittel [darstellt], um
die Regel des Gesetzes aufzustellen [die gesellschaftliche Rechtsordnung; A.R.].“46
Forster teilt diese
Ansicht, wenn er die revolutionäre Gewalt des Volkes in ihrer Unmittelbarkeit nur in der materialisti-
schen Metaphorik von Naturkatastrophen vorstellt (Vulkanausbruch, Erdbeben, Schneelawine, Seesturm
etc.).47
Es kommt daher alles darauf an, das reale Ereignis über die Einnahme einer politischen Haltung
in ein symbolisches Ereignis zu übersetzen, was bei Žižek letztlich bedeutet, das sinnlose Chaos der Ge-
walt mit der Etablierung eines neuen ‚Herrensignifikanten‘ zu verbinden.48
Wenn Forster genau dies tut,
kann er die Revolution sowohl als ‚Griff zur Notbremse‘ (Benjamin) als auch als dialektische ‚Lokomo-
tive der Geschichte‘ (Marx) konzeptualisieren. Damit entkommt er der falschen Alternative, die die Be-
gegnung mit einem realen Ereignis ebenfalls eröffnet und die Žižek folgendermaßen formuliert: „entwe-
der Abstand halten, oder von dem Ding verbrannt werden“.49
Wie aber kann man sich engagiert und par-
44 Vgl. Žižek, Ereignis, 94f (wie Anm. 9); ders., Less than nothing, 330f (wie Anm. 42). Hieraus leitet sich auch die
Geschichtszeichentheorie des späten Immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten, in: Immanuel Kant: Werke, hg. v.
W. Weischedel, Bd. IX, Darmstadt 1983, 357f, ab, der 1798 ebenfalls die Möglichkeit erwägt, wie sich der sittliche
Fortschritt der Menschheit durch die empirische Gewalt der Revolution hindurch offenbart – obgleich diese bei ihm
nur aus der Perspektive des unbeteiligten Beobachters möglich sein soll, was als Abgrenzung gegenüber Forster
verstanden werden kann. 45 Der ‚Genuss‘ (jouissance) des Triebes steht bei Žižek wie bei Lacan der Befriedigung durch das Begehren ge-
genüber. Vgl. u.a. Žižek, Parallaxe, 414-421 (wie Anm. 34), sowie Fabio Vighi, On Žižek’s Dialectics. Surplus,
Subtraction, Sublimation, London 2010, 23-30. 46 Žižek, Gewalt, 173 (wie Anm. 6). 47 Vgl. Forster, Umrisse, 594ff (wie Anm. 11). 48 Vgl. Žižek, Ereignis, 136 (wie Anm. 9). 49 Žižek, Parallaxe, 63 (wie Anm. 34). Über diese falsche Alternative kommt der Kantianismus, der das revolutio-
näre Ereignis nur von einer distanzierten Beobachterperspektive genießen kann, nicht hinaus.
14
teilich in ein Ereignis einmischen, ohne sich verantwortungslos in ein sinnloses Abenteuer zu stürzen,
von dem man im schlimmsten Fall ebenso sinnlos zerstört wird? Dies ist die große Frage revolutionärer
‚Real-Politik‘, die gleichsam das „Machiavell’sche Moment des Politischen“ markiert, die nach Forster
auch noch Max Weber, Georg Lukács und Walter Benjamin beschäftigt hat.50
4. Der öffentliche Kredit und die Volkssouveränität
Wie Forster oben betonte, war der Schweizer Bankier Jacques Necker derjenige, der als königlicher Ge-
neraldirektor der Finanzen den revolutionären Prozess in Gang setzte, was wohl meint, dass er wesent-
lich an der Einberufung der Generalstände beteiligt war. Obgleich es sich hierbei, wie Forster hinzusetzt,
nur um einen unbewussten ‚Anstoß‘ handelte, ist das Faktum doch wesentlich.51
Was war geschehen?
Die königliche Souveränität hatte bei der Sicherung des öffentlichen Kredits versagt, so dass mit der
Einberufung der Generalstände an die souveräne Einheit der Nation appelliert werden musste, um dem
Monarchen ein neues Mandat für eine effektivere und gerechtere Besteuerung auszustellen und dadurch
den befürchteten Staatsbankrott zu vermeiden. Die dabei notwendig unterstellte Idee der Volkssouveräni-
tät, in der das gesamte Volk als Bürge für den öffentlichen Kredit fungiert, sollte jedoch weiterhin mög-
lichst nur fiktiv bleiben, so dass reale politische Veränderungen verhindert oder nur in geringem und
kontrolliertem Maße zugelassen werden müssten.52
Zum Verhängnis wurde der Monarchie aber zwischen
1789 und 1792 weniger ihre übersteigerte, als vielmehr ihre mangelnde Souveränität. Und dies betraf
neben der fehlenden finanziellen Souveränität vor allem ihre faktische Abhängigkeit von den oberen
Ständen, deren Steuerprivilegien sie nicht in Frage zu stellen vermochte. Obwohl Ludwig XVI. die abso-
lute Staatsgewalt also im Namen der ganzen Nation ausübte, musste seine Regierungspraxis keineswegs
souverän, sondern vielmehr beschränkt und letztlich korrupt erscheinen. Aus diesem Widerspruch leite-
ten die Repräsentanten des Dritten Standes die Bildung einer einheitlichen Nationalversammlung mit
einer egalitären Abstimmung nach Köpfen statt nach Ständen ab, wodurch diese zum Ort einer allgemei-
50 Obwohl Oliver Marchart sowohl Žižek als vermutlich auch Forster des ‚emanzipatorischen Apriorismus‘ be-
schuldigen würde, passt seine Beschreibung dieses Moments hier dennoch: „Das Machiavell’sche Moment des
Politischen ist recht verstanden, ein Moment des politischen Realismus im doppelten Sinne: im Lacan’schen Sinne
eines Realen als Name für die Unüberbrückbarkeit des Abgrunds der ontologischen Differenz; und im Sinne der
gewöhnlichen politischen Realität, in die man nicht handelnd eingreifen kann, ohne sich in unterschiedlichem Gra-
de die Hände schmutzig zu machen.“ Oliver Marchart, Die politische Differenz. Zum Denken des Politischen bei
Nancy, Lefort, Badiou, Laclau und Agamben, Berlin 2010, 251. Zu Webers ‚Verantwortungsethik‘ siehe Max We-ber, Politik als Beruf, in: Gesammelte politische Schriften, hg. v. J. Winckelmann, Tübingen 51988, 545-560. 51 Mit Žižek, Tücke, 64 (wie Anm. 42), könnte man hier von einem Fichte’schen ‚Anstoß‘ reden, womit „der ur-
sprüngliche Impuls, der die schrittweise Selbstbeschränkung und Selbstbestimmung des anfänglich leeren Subjekts
in Gang setzt“, gemeint ist. 52 Die Tatsache, dass der öffentliche Kredit an die strikte Wirksamkeit der Souveränität gebunden ist, war in der
politischen Theorie des 18. Jahrhunderts eine bekannte Tatsache. Als Beispiel lässt sich die Bemerkung Burkes in:
Edmund Burke/Friedrich von Gentz (Hg.), Über die Französische Revolution. Betrachtungen und Abhandlungen
(Philosophiehistorische Texte), Berlin 1991, 214, zitieren: „Es läßt sich aber keine Disposition über das Staatsver-
mögen denken, die unbeschränktere Macht voraussetzt als die Verpfändung der öffentlichen Einkünfte. Die Einfüh-
rung periodischer und vorübergehender Abgaben reicht lange nicht an diesen Souveränitätsaktus.“ Zum Zusam-
menhang von Souveränität und öffentlichem Kredit im 18. Jahrhundert sind grundlegend Istvan Hont, Jealousy of Trade. International Competition and the Nation-state in historical Perspective, Cambridge (Mass.) 2005 und Mi-
chael Sonenscher, Before the Deluge. Public Debt, Inequality, and the intellectual Origins of the French Revolution,
Princeton 2007.
15
nen und ungeteilten Souveränität werden sollte, die nun mit der Volkssouveränität faktisch identisch ist.
Einerseits berief man sich auf das parlamentarische Repräsentationsprinzip (‚no taxation without
representation‘) und andererseits ging es Theoretikern wie Sieyès um eine reale Begründung von Souve-
ränität, die zur Sicherung des öffentlichen Kredits mittels ökonomischer Reformen als zwingend not-
wendig erachtet wurde. Politisch berief sich Sieyès dazu für den Dritten Stand auf den durch das Ancien
Régime unterschlagenen politischen Anteil, der diesem aufgrund seiner ökonomischen Potenz in der
Gesellschaft zukam. Hierzu kehrt er den omnipotenten Anspruch der monarchischen Souveränität ein-
fach um, so dass aus dem absolutistischen Überschuss an Macht ein Mangel wird.
Sieyès’ berühmte Formel dafür lautet: „1. Was ist der Dritte Stand? ALLES. 2. Was ist er bis jetzt in der
politischen Ordnung gewesen? NICHTS. 3. Was verlangt er? ETWAS ZU SEIN.“53
Der Wille des Drit-
ten Standes, etwas zu werden, entspringt hier direkt aus der Kluft zwischen seinem universalen Sein als
produktive Substanz der Gesellschaft und seiner politischen Nichtigkeit. Diese Nichtigkeit markiert letzt-
lich nur seine Unterdrückung gegenüber den oberen Herrschaftsständen. Wichtig ist hierbei, dass der
Dritte Stand bei Sieyès nicht für eine konkrete soziale Entität beziehungsweise eine positive Gruppe mit
empirisch klar umrissener Objektivität steht, sondern lediglich für ein heterogenes Konglomerat, dessen
gemeinsame Identität allein darin besteht, den unterdrückten Rest zu bilden, der quer zum ordentlichen
Repräsentationsmodus des Ancien Régime steht. Dieser Rest, der mit Jacques Rancière auch als ‚Teil
ohne Anteil‘ beschrieben werden kann,54
tritt schon bei Sieyès als eine teilende Kraft auf, die die gege-
bene Ordnung unterbricht, d.h. er kann nicht einfach zur bestehenden Ordnung hinzuaddiert werden,
ohne die gesamte Ordnung zu verändern. Insofern musste sich die dreigliedrige Ständeversammlung mit
der Realisierung der politischen Forderungen des Dritten Standes notwendig in die einheitliche National-
versammlung transformieren. Mit der Aktivbürgerverfassung von 1791 entstand aber wiederum ein neu-
er ‚Teil ohne Anteil‘, der den Besitzbürgern und der Finanzaristokratie gegenüberstand, für den sich
1792 zunächst kurzfristig der Begriff der ‚Sansculotten‘ einbürgerte, der aber bald nach der Revolution
vom republikanischen Begriff des ‚Proletariats‘ verdrängt wurde.
Der ‚Anstoß‘, den die Sicherung des öffentlichen Kredits für die Revolution und die politische Realisie-
rung der Volkssouveränität darstellte, hatte aber zunächst keineswegs revolutionäre oder gar uneigennüt-
zige Absichten. Ganz im Gegenteil dominierten in der ersten Phase der Revolution unzweifelhaft die
korrupten Interessen der Gläubiger der Staatsschuld, die weder an einem Staatsbankrott noch an einem
Schuldenschnitt interessiert waren – denn in beiden Fällen wäre die Finanzaristokratie der große Verlie-
rer gewesen. Während es diesen 1788/89 darum ging, einen geordneten Staatsbankrott beziehungsweise
Schuldenschnitt durch den König zu verhindern, sahen sie sich am Ziel, als die Nationalversammlung
1789 die Schulden des Königs uneingeschränkt anerkannte und übernahm. Mit der Säkularisierung der
53 Sieyès, Politische Schriften, 119 (Hervorhebung im Original; wie Anm. 8). 54 „Wer ohne Anteil ist – die Armen der Antike, der dritte Stand oder das moderne Proletariat -, kann in der Tat nur
am Nichts oder am Ganzen Anteil haben. Aber auch durch das Dasein dieses Anteils der Anteillosen [la parte des
sans-part], dieses Nichts, das Alles ist, existiert die Gemeinschaft als politische Gemeinschaft, das heißt als eine von einem grundlegenden Streit geteilte, durch einen Streit, der sich auf die Zählung seiner Teile bezieht, selbst
noch bevor er sich auf ihre ‚Rechte‘ bezieht.“ Jacques Rancière, Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, übers.
v. R. Steurer, Frankfurt/M. 2002, 22.
16
Kirchengüter und der Ausgabe verzinsbarer Schuldverschreibungen (Assignaten), die bald als Papiergeld
zirkulierten, erfolgte dann auch keineswegs eine Konsolidierung des Schuldenproblems, sondern es setz-
te vielmehr eine neue Spekulationswelle ein, die das Schuldenproblem im Kontext des bald darauf be-
ginnenden Krieges mit der antifranzösischen Koalition unter Führung Englands (1792) schließlich zu
einer schweren Geldkrise steigerte, die die soziale Not des Volkes extrem weiter verschärfte. Einer der
schärfsten Kritiker dieser liberalen Phase der Revolution war Edmund Burke gewesen, der die Revoluti-
on schon 1790 – und vor diesem Hintergrund nicht ganz zu Unrecht – als einen coup d’etat der Finanz-
oligarchie kritisierte, den diese mit Hilfe von willfährigen Advokaten und korrupten Intellektuellen im
Parlament ins Werk gesetzt hätten.55
Obwohl Burke zweifellos die alte Monarchie mit dem Landadel und
der Geistlichkeit als deren Hauptstützen idealisierte, traf seine ökonomische Analyse des ersten Revolu-
tionsjahres durchaus einen wichtigen Punkt. Gerade weil die Finanzoligarchie die Volkssouveränität
gegen die staatliche Souveränität mobilisiert hatte, würde sie nicht in der Lage sein, auf ihrem korrupten
Interesse eine stabile Verfassung zu begründen. Burke verglich diesen Versuch deshalb mit „den ver-
zweifelten Flügen der tollkühnen Luftschiffer“,56
die ihre Ordnung auf dem ‚Nichts‘ einer simulierten
Volkssouveränität und der Spekulation auf hohe Renditen aufbauen wollten. Seine berühmte Prophezei-
ung, wonach Frankreich nur „in Feuer und Blut gereinigt und wiedergeboren werden“57
könne, sollte
jedenfalls in Erfüllung gehen.
Der Terror der ‚göttlichen Gewalt‘ wurde insofern von Burke bereits 1790 angekündigt. Tatsächlich
kehrte sich der uneingelöste Überschuss der Volkssouveränität über die staatliche Souveränität der Mo-
narchie zunächst gegen das Ancien Régime, um sich dann aber schnell auch gegen die Herrschaft der
liberalen Finanzoligarchie in der ersten Phase der Revolution zu wenden. Die von Forster 1793/94 be-
schriebene revolutionäre Gewalt korrelierte und unterminierte, mit Žižek und Badiou gesprochen, letzt-
lich jenen Machtexzess, den die Repräsentanten souveräner Macht über die Repräsentierten immer aus
ihrem freien Mandat ableiteten.58
Schon deshalb bildet die Volksrevolution notwendig die andere Seite
der staatlichen Souveränität; sie sind beide durch einen konstitutiven Exzess an Macht bestimmt. Im
Falle der revolutionären Gewalt liegt „[d]er ‚totalitaristische Exzess‘“, wie Žižek deutlich macht, aber
„auf Seiten des ‚Anteils der Anteilslosen‘, nicht auf Seiten der hierarchischen Gesellschaftsordnung“.59
Das Volk, verstanden als der ausgeschlossene ‚Rest‘, besitzt dann, wie Žižek gegen Claude Lefort fol-
55 „Da diese beiden Klassen von Menschen, die Geldbesitzer und die Gelehrten, bei allen neuerlichen Verhandlun-
gen in Frankreich die Oberhand gehabt zu haben scheinen: so dient uns ihre Verbindung und ihr politisches System
dazu […] aus begreiflichen Ursachen, die allgemeine Wut zu erklären, mit welcher man über alles Grundeigentum
der geistlichen Korporationen herfiel, und die auffallende Sorgfalt, mit welcher man, ganz den ausgehängten Prin-
zipien zuwider, das Interesse der Geldbesitzer und Staatsgläubiger, das in dem Schatten des Throns aufgewachsen
war, in Schutz nahm. Aller Unwillen gegen Vermögen und Macht wurde mit ausstudierter Kunst auf eine andre
Klasse von Reichen geleitet.“, Burke/ Gentz, Französische Revolution, 221 (wie Anm. 52). 56 Ebd., 391. 57 Ebd., 392. Sonenscher, Deluge, 9.34-41 (wie Anm. 52), zeigt, dass diese Prophezeiung des Terrors im 18. Jahr-
hundert keineswegs originell war, da sie im politökonomischen Schrifttum bezüglich der ungelösten Risiken des
Staatskredits ausgiebig diskutiert worden war. Insofern kann man in der Tat behaupten, dass der jakobinische Ter-ror lange vor der Revolution angekündigt wurde. 58 Vgl. Savoj Žižek, Auf verlorenem Posten, übers. v. F. Born, Frankfurt/M. 2009, 177. 59 Ebd., 179.
17
gert, „die Macht und die volle Souveränität, das heißt seine Vertreter besetzen nicht nur zeitweise die
Leerstelle der Macht, sondern es ‚dreht‘ den Ort der staatlichen Repräsentanz in seine Richtung.“60
Wäh-
rend Leforts Modell einer temporären Besetzung des leeren Orts der Macht ein instrumentelles und mit-
hin staatlich begründetes Modell politischer Gewalt bleibt, das man mit Benjamin dem pathologisch-
korrupten Paradigma der ‚mythischen Gewalt‘ zurechnen muss, ist die von Forster beschriebene jakobi-
nische Revolutionsregierung, die Žižek als Prototyp einer ‚Diktatur des Proletariats‘ interpretiert, ein
politischer Repräsentationsmodus, der sich gerade durch seine abgründige Repräsentation ‚göttlicher
Gewalt‘ einer staatlichen Begründung entzieht. Während Leforts Demokratietheorie deshalb dem Para-
digma der liberalen Demokratie als einer legalistisch bestimmten Staatsform verhaftet bleibt, unterstellt
Žižek mit Forster und Benjamin hingegen, dass eine sich auf die revolutionäre Volkssouveränität beru-
fende Demokratie niemals vollständig in einer legalen Staatsordnung aufgehen kann und genau deshalb
einen Bezug behält zum Messianischen beziehungsweise Ereignishaften. Der revolutionäre pouvoir
constituant geht, mit Sieyès gesprochen, niemals in der legalen Verfassungsordnung des pouvoir
constitué auf, sondern bleibt darin ein unordentliches Moment, das sich als Selbstzweck gegen jegliche
legale Instrumentalisierung sperrt. „Insofern ist Politik [beziehungsweise das Politische; A.R.], gerade im
demokratischen Zeitalter, unser aller Schicksal.“61
Man sollte in diesem Zusammenhang an Arthur Rosenberg erinnern, der 1938, angesichts des Scheiterns
zahlreicher Demokratien vor der Bedrohung des Faschismus, gegen ihre Reduktion auf die legalistisch-
staatliche Variante der liberalen Demokratie polemisierte. Für Rosenberg ging die liberale Pazifizierung
der Demokratie auf Kosten ihrer revolutionären Grundlagen, so dass die liberale Demokratie, wie alle
legalen Staatsordnungen, die sich als „Hort der Legalität“ verstehen, die „demokratische Bewegung“ des
pouvoir constituant im Namen des politischen Friedens unterdrücken und kriminalisieren musste, wenn
sie – was sie per definitionem tun muss – den legalen Rahmen überschreitet.62
Damit verliert die Demo-
kratie aber nicht nur ihren ontologischen Emanzipationscharakter, sie wird auch wehrlos gegen die legale
Instrumentalisierung durch die politische Reaktion. „Das Missverständnis, als wäre die Demokratie die
Verkörperung der Gewaltlosigkeit, ist in neuerer Zeit nur dadurch entstanden, dass man die Demokratie
im ganzen mit einem speziellen Typ der Demokratie, nämlich mit der liberalen Demokratie […], ver-
wechselte.“63
5. Revolutionäre Volkssouveränität: Der neue Herrensignifikant
Genau an diesem Punkt kommen wir auf den Moment der revolutionären ‚Real-Politik‘ beziehungsweise
den ‚Machiavell’schen Moment des Politischen‘ (Marchart) zurück, der sowohl Forster als auch Žižek
umtreibt. Wie lässt sich das reale und traumatische Ereignis der Revolution so in ein symbolisches Er-
eignis übersetzen, dass die dabei auftretenden Destruktivkräfte möglichst weitgehend und langfristig in
60 Ebd. Vgl. hierzu auch Žižek, Der Mut, 106f. (wie Anm. 17). 61 Böckenförde, Verfassungsgebende Gewalt, 66 (wie Anm. 16). 62 Rosenberg, Demokratie, 306 (wie Anm. 7). 63 Ebd., 308. Diese Einsicht verband ursprünglich das Projekt der ‚radikalen Demokratie‘ von Chantal Mouffe und
Ernesto Laclau mit Žižeks politischer Philosophie.
18
politische Produktivkräfte transformiert werden? Den Dreh- und Angelpunkt hierfür sieht Žižek in der
Freisetzung eines neuen Herrensignifikanten. „Dieser ereignishafte Moment ist derjenige, in dem der
Signifikant – eine physische Form, die eine Bedeutung repräsentiert – mit dem Signifikat in eins fällt, in
seine Bedeutung, und der Signifikant Teil des Objekts wird, das er bezeichnet.“64
Zur Veranschaulichung
kann an dieser Stelle Forsters tautologische Definition der Revolution herangezogen werden, die in der
Tat nichts anderes beschreibt als das symbolische Ereignis der Etablierung eines neuen Herrensignifikan-
ten. Sie lautet:
„Die Revolution ist – vorausgesetzt, daß Sie nach unserer generalisirten Definition lüstern sind –
ist die Revolution. Ihnen dünkt das wohl zu einfach? oder es scheint wohl gar ins Platte zu fal-
len? Einen Augenblick Geduld! Lange genug haben wir uns gesträubt, das Kind bei seinem rech-
ten Nahmen zu nennen; aber wer kann für Gewalt? Daß sich alles Kopf über Kopf unter wälzt, ist
ein vollgültiger Beweis, daß der Nahme der Sache entspricht; und wer mag wissen, ob mit dieser
Bewegung nicht die Exegetik eines Deutschen Schriftstellers noch künftig gerettet werden kann,
der von dem großen Worte behauptet hat, daß es eigentlicher auf die Wiederbringung, als auf die
Zerstörung aller Dinge gemünzt seyn soll?“65
Die Revolution wird hier ganz im Sinne Žižeks als neuer Herrensignifkant eingeführt, dessen
Unbegründbarkeit in der tautologischen Rhetorik artikuliert wird.66
Die inhaltliche Leere der Tautologie
ist zunächst einmal dazu geeignet, die Grundlosigkeit der Revolution als neuen Herrensignifikanten mit
der Grundlosigkeit der ‚göttlichen‘ Revolutionsgewalt zu verbinden. Daneben ist sie zugleich ein „Name
für den ‚absoluten Widerspruch‘“ und den „Selbstbezug des Allgemeinen“, den Hegel später als philoso-
phische „Identität der Gegensätze“ entwickelt.67
Forsters politischer Bezugspunkt für diesen Überset-
zungsakt des realen Ereignisses der Volksrevolution in ein repräsentativ-symbolisches Ereignis ist das
Dekret über die Errichtung der Revolutionsregierung vom 10. Oktober 1793.68
Er wertet dieses Dekret
als eine unmittelbare und unbedingte Identifikation der Regierung mit der Revolution, was sich aus der
Perspektive von Benjamin und Žižek als endgültiger Bruch mit der ‚mythischen‘ Staatsgewalt darstellt.
Anstatt wie bisher die Revolution instrumentalisieren, lenken oder eindämmen zu wollen, bekennt sich
die jakobinische Revolutionsregierung uneingeschränkt und inklusive aller Exzesse zu dieser Revolution.
Forster hält dies fest, wenn er schreibt: „Das neulich erlassene Dekret des Nationalkonvents, daß die
Regierung in Frankreich bis zum Frieden revolutionär bleiben soll, ist der eigentlichste Ausdruck der
öffentlichen Meinung, daß die Revolution sich so lange fortwälzen müsse, bis ihre bewegende Kraft ganz
aufgewendet seyn wird.“69
64 Žižek, Ereignis, 136 (wie Anm. 9). 65 Forster, Umrisse, 595 (wie Anm. 11) (Hervorhebung im Original). 66 Vgl. hierzu auch Axel Rüdiger, „Die Revolution ist […] die Revolution“ – Georg Forster über Sprache, Politik
und Aufklärung, in: Georg-Forster-Studien 17 (2012), 121-170. 67 Žižek, Denn sie wissen nicht, 45ff (wie Anm. 12). 68 Das Dekret ist abgedruckt in: Revolution im Zeugenstand. Frankreich 1789-1799, Bd. II (Gesprochenes und
Geschriebenes), hg. v. W. Markov, Leipzig 1982, 521f. 69 Forster, Umrisse, 596 (wie Anm. 11) (Hervorhebung im Original).
19
Aus der Sicht Forsters wird damit die instrumentelle Eskalations- und Katastrophenpolitik der liberalen
Vorgängerregierungen gestoppt, die gerade dadurch, weil sie die Revolution parallel zu ihren Finanzex-
perimenten im Zaum halten wollten, die destruktive Gewalt immer weiter entfacht hatten. Statt die Revo-
lution für die Gläubigerinteressen der Staatsschuld zu instrumentalisieren und das dabei entstandene so-
ziale Konfliktpotential durch einen Krieg nach außen abzuleiten, hat sich die jakobinische Revolutions-
regierung unter Führung Robespierres aus Forsters Sicht zu der realpolitischen Einsicht durchgerungen,
die Souveränität, die notwendig ist, um die rasche Entwertung des Papiergeldes aufzuhalten und die Sta-
bilisierung des öffentlichen Kredits durchzusetzen, als revolutionäre Volkssouveränität zu akzeptieren.
Dies könnte freilich auch als Kapitulation der Politik vor der Gewalt gedeutet werden, und in der Tat fügt
die Regierung der revolutionären Gewalt des Volkes mit diesem politischen Akt buchstäblich nichts wei-
ter hinzu, als deren repräsentative Anerkennung. Diese ‚minimale Differenz‘ aber, welche der revolutio-
nären Gewalt nur die repräsentative Anerkennung hinzufügt, ist wie Žižek immer wieder betont, die ent-
scheidende Voraussetzung für den Durchbruch und die Dauer einer neuen emanzipatorischen Ordnung,
was im konkreten Fall von 1793 die demokratische Freisetzung realer Volkssouveränität im doppelten
Sinne revolutionärer ‚Real-Politik‘ bedeutet, d.h. die Anerkennung des realen Charakters der Volkssou-
veränität im lacanschen Sinne sowie die Bereitschaft, jenseits des idealistischen Purismus in die
‚schmutzige‘ Realität der Politik einzugreifen.70
Der entscheidende politische Akt besteht demnach nicht
in der spontanen Revolte, sondern in dem symbolischen Moment danach, in dem durch die Kreation
eines neuen Herrensignifikanten die diffuse und orientierungslose Revolte retroaktiv als sittliche Revolu-
tion anerkannt und gesetzt wird. Dies allein ist die Voraussetzung dafür, dass die alte Herrschaftsordnung
des Ancien Régime durch eine neue Ordnung ersetzt werden kann.
In Forsters tautologischer Definition realisiert die revolutionäre Diktatur die Macht des Volkes durch die
Etablierung einer unmöglichen Identität zwischen der Regierung und den Regierten. Sie gibt der Gewalt
der demokratischen Explosion, die gerade aus der Kluft zwischen Regierung und Regierten resultierte,
einen neuen Namen, wobei diese antagonistische Kluft durch die Revolutionsregierung zwar proviso-
risch überbrückt, nicht aber vollständig geschlossen wird.71
Die hierdurch erzeugte Volkssouveränität
unterscheidet sich von der staatlichen Souveränität erstens durch ihre radikale Kontingenz und zweitens
dadurch, dass sie den Widerspruch zwischen Regierung und Regierten nicht zu unterdrücken, zu leugnen
oder zu legalisieren sucht, sondern ihm eine möglichst freie politische Bewegungsform öffnet. Die Quali-
tät einer Regierung bemisst sich unter diesen Bedingungen daran, wie der preußische Publizist Friedrich
Buchholz wenig später im Anschluss an Forster und Sieyès formuliert, ob es ihr gelingt, die demokrati-
70 Diese ‚minimale Differenz‘ verkörpert, laut Slavoj Žižek, Der Mut, 105 (wie Anm. 17), sowohl die politische
Differenz zwischen den funktionalen Teilen der ‚ordentlichen‘ Gesellschaft‘ und dem ‚Teil ohne Anteil‘ als auch
die ‚reine Differenz‘ zwischen „dem Platz und dem, was diesen Platz einnimmt“ beziehungsweise dem „Grund und
der Gestalt“. Letztere bezeichnet zugleich „das Nicht-Soziale innerhalb des Feldes des Sozialen“, in der der die
Null gemäß der Logik der Signifikanten als Eins zählt (ebd.). Die Tatsache, dass „das Ereignis der Ordnung des
Seins nicht äußerlich, sondern innerhalb der ‚minimalen Differenz‘ angesiedelt (ist), die der Ordnung des Seins
selbst innewohnt“, verweist hierbei auf die politische Logik der Subtraktion, die das Gegenteil der staatlichen Ge-walt der Säuberung (Purifikation) ist (ebd., 141). 71 Zur Interpretation der Volkssouveränität als unmögliche Identität zwischen Regierten und Regierenden vgl. Jodi
Dean, The Communist Horizon, London 2012, 95ff und Žižek, Posten, 245f (wie Anm. 58).
20
sche Revolution in Permanenz zu repräsentieren, was bei Buchholz mit dem Organisationsbegriff zu-
sammenfällt.
„Gut ist nämlich diejenige Regierung, die, indem sie den Antagonismus des Selbsterhaltungs-
und Geselligkeitstriebes, welcher die Staaten schafft, nie aus dem Auge verliert, unablässig da-
rauf bedacht ist, ihn zum Vortheil der ganzen Gesellschaft zu leiten. Eine solche Regierung setzt,
[…], den Zustand der Revoluzion als permanent voraus (weil er es wirklich ist) und richtet sich
in allen ihren Operazionen nach dieser Voraussetzung; d.h. sie selbst wird revoluzionär, um,
durch ein ewiges Organisiren oder Benutzen aller auf eine bessere Anordnung der Sozialverhält-
nisse abzweckenden Ideen, gewaltsame Explosionen zuvorzukommen.“72
Anstatt also den gefährlichen und unberechenbaren Antagonismus zu unterdrücken, empfiehlt Forster der
Revolutionsregierung buchstäblich, nichts zu tun; einen Sachverhalt, den er im Gleichnis einer Kutsche
ausdrückt, deren Pferde durchgebrannt sind. Den Passagieren rät er in diesem Fall, still in der Kutsche
sitzen zu bleiben.73
Auch wenn die Politik der Revolutionsregierung somit jenseits jeder Pseudoaktivität
nur als eine passive ‚Bartleby-Politik‘ erscheint, so fügt sie dabei doch der unwiderstehlichen Gewalt des
Volkes eine minimale – gleichsam nichtige – symbolische Dimension hinzu, ohne welche diese politisch
völlig folgenlos bleiben müsste und in einem blindwütigen Exzess verpuffen würde.74
Denn erst diese
minimale repräsentative Zugabe transformiert die sinnlose (‚Natur‘-)Gewalt der Menge zur legitimen
Gewalt des Volkes. Wie Žižek gegen anarchistische Politikmodelle betont, bringt diese rein symbolische
Dimension der Politik den realen Effekt der Volkssouveränität erst zur Geltung.
Jenseits der puren Notwendigkeit ist dies für Forster zugleich ein Akt der „Nächstenliebe und Vater-
landsliebe“, ohne welche allerdings die Gefahr besteht, „auf dem Ocean der Teleologie den Kompaß [zu]
verlieren“.75
Denn schließlich ist die menschliche „Moralität […] keinem Gesetz unterworfen“ mit Aus-
nahme des Imperativs des Johannesevangeliums: „uns zu lieben untereinander“.76
Oder mit den Worten
von Žižek ausgedrückt:
„Es gibt keine ‚objektiven‘ Kriterien, die es uns erlauben einen Akt der Gewalt als göttlich zu
bestimmen. Für einen außen stehenden Beobachter ist es bloß ein Gewaltausbruch, doch dieser
kann für die, die sich ihm überantworten, göttlich sein. Es gibt keinen großen Anderen, der die
72 Friedrich Buchholz, Darstellung eines neuen Gravitazionsgesetzes für die moralische Welt, Berlin 1802, 71f.
Buchholz (1768-1843) ist mehr noch als Forster ein vergessenes Opfer der deutschen Geistesgeschichte, dem seine
Treue zur Französischen Revolution zum Verhängnis wurde. Vgl. Rütger Schäfer, Friedrich Buchholz – ein verges-sener Vorläufer der Soziologie. Eine historische und bibliographische Untersuchung über den ersten Vertreter des
Positivismus und des Saint-Simonismus in Deutschland (Göppinger Akademische Beiträge, Nr. 59), Göppingen
1979 sowie zuletzt Iwan-Michelangelo D’Aprile, Die Erfindung der Zeitgeschichte. Geschichtsschreibung und
Journalismus zwischen Aufklärung und Vormärz, Berlin 2013. 73 „Ich sah einst die Pferde mit einer Landkutsche Reißaus nehmen, und den Kutscher vom Bocke fallen. Einige
Straßenjungen stellten sich an den Weg und schimpften auf die Passagiere. Einer von diesen sprang aus dem Wa-
gen, und stürzte den Hals ab; die übrigen waren klüger: sie blieben sitzen, und dachten, wir wollen warten, bis der
Koller vorüber ist.“, Forster, Umrisse, 595 (wie Anm. 11). 74 „Der Akt Bartlebys ist genau insofern gewaltsam, als er diese obsessive Aktivität durchbricht – in ihm über-
schneiden sich nicht nur Gewalt und Gewaltlosigkeit (Gewaltlosigkeit erscheint als die größte Gewalt), sondern
auch Akt und Inaktivität (Nichtstun ist der radikale Akt). In ebendieser Überschneidung von Gewalt und Gewaltlo-sigkeit liegt die ‚göttliche‘ Dimension.“ Žižek, Das ‚unendliche Urteil‘, 136 (wie Anm. 7). 75 Forster, Umrisse, 610.606 (wie Anm. 11). 76 Forster, Zunftzwang, 228f (wie Anm. 42).
21
göttliche Natur dieses Akts versichert. Das Risiko, diesen Akt als einen göttlichen zu lesen und
ihn als solchen anzunehmen liegt einzig beim Subjekt. Die göttliche Gewalt ist das Werk der
Liebe des Subjekts.“77
Und daher muss man „die Idee, es gäbe eine Garantie durch die histori-
sche Teleologie fallen lassen.“78
Die konservative, heute von der Schule François Furets repräsentierte Interpretation verkennt dagegen
diese Situation, die Lenin in der Formel der ‚Jakobiner mit dem Volke‘ zusammengefasst hat, wenn sie
das symbolische Ereignis der jakobinischen Volkssouveränität einfach mit der absolutistischen Staats-
souveränität gleichsetzt und beide damit als tendenziell totalitär disqualifiziert.79
Tatsächlich folgt die
Jakobinerdiktatur aber der Logik der Subtraktion und geht damit über die staatliche Gewalt und ihre
Säuberungslogik hinaus, was neben Forster auch Fichte und dem jungen Friedrich Schlegel nicht verbor-
gen geblieben ist.80
„Die Erscheinungen unter dem Joch des Despotismus“, schreibt Forster, „können denen, die sich
während einer republikanischen Revolution ereignen sehr ähnlich sehen, und die letzteren sogar
einen Anstrich von Fühllosigkeit und Grausamkeit haben, den man dort wohl hinter einer sanfte-
ren Larve zu verbergen weiß; doch sind sie schon um deswillen himmelweit verschieden, weil
sie durch ganz verschiedenartige Kräfte bewirkt werden, und von der öffentlichen Meinung
selbst einen ganz verschiedenen Stempel erhalten. Eine Ungerechtigkeit verliert ihr Empörendes,
ihr Gewaltthätiges, ihr Willkührliches, wenn die öffentliche Volksmeinung, die als Schiedsrich-
terin unumschränkt in letzter Instanz entscheidet, dem Gesetze der Nothwendigkeit huldigt, das
jene Handlung oder Verordnung oder Maßregel hervorrief.“81
Das symbolische Ereignis der Durchsetzung der revolutionären Volkssouveränität als neuen Herrensigni-
fikanten besteht also gerade in der Umkehrung des alten Signifikanten der Souveränität, wofür der libe-
ral-konservative Blick Furets aber blind bleibt.82
Die neuartige souveräne Autorität der diktatorischen Revolutionsregierung von 1793/94 ruht daher auf
keiner festen staatlichen Grundlage, sondern allein auf jener radikalen politischen Kontingenz, die die
77 Žižek, Gewalt, 175 (wie Anm. 6). 78 Ebd., 159. 79 Vgl. u.a. François Furet, 1789 – Vom Ereignis zum Gegenstand der Geschichtswissenschaft, hg. v. D. Groh,
übers. v. T. Schoenbaum-Holtermann, Frankfurt/M.1980. Gänzlich konträr hierzu sieht Žižek, Gewalt, 174 (wie
Anm. 6), den Widerspruch zwischen ‚totalitärer‘ Staatsgewalt und diktatorischer Volkssouveränität eher im Kon-
flikt zwischen Danton und Robespierre am Werk: „Für den Jakobiner Danton war der revolutionäre Staatsterror eine Art Präventivaktion, die dazu diente, sich nicht an den Feinden zu rächen, sondern um die direkte ‚göttliche‘
Gewalt der Sansculotten zu verhindern, dem Volk selbst also. Mit anderen Worten: Lasst uns tun, was das Volk von
uns erwartet, damit es das Volk nicht selbst tun muss “. 80 Der 1796 noch stark unter dem Einfluss Forsters stehende Schlegel führt dazu die Differenz zwischen einem
legalen „Quasistaat“ und einem legitimen „Staat“ ein, die „durch eine unendliche Kluft voneinander geschieden
[sind], über welche man nur durch einen Salto mortale hinübergelangen kann“. Dieser republikanische „Salto
mortale“ zum sittlichen Staat bezeichnet exakt den politischen Status der jakobinischen Revolutionsregierung. „Die
transitorische Diktatur aber ist eine politische mögliche Repräsentation – also eine republikanische, vom Despotis-
mus wesentlich verschiedne Form.“ Friedrich Schlegel, Versuch über den Begriff des Republikanismus veranlaßt
durch die Kantische Schrift ‚Zum ewigen Frieden‘, in: Friedrich Schlegel: Werke in zwei Bänden, Bd. 1, Berlin
1980, 53-74, hier 59 u. 61. 81 Forster, Umrisse, 597 (wie Anm. 11). 82 Zu dieser eigentümlichen Umkehrung des Signifikanten im Moment eines politischen Ereignisses vgl. Žižek,
Ereignis, 138f (wie Anm. 9).
22
symbolische Repräsentation des realen Antagonismus, der zwischen Herrschenden und Beherrschten
besteht, zulässt. Den Effekt dieses symbolischen Ereignisses einer unbegründeten und kontingenten
Volkssouveränität jenseits der traditionellen Staatsgewalt beschreibt Forster in der Metaphorik des
‚Wunders‘. So erzeugt die Verbindung der „unwiderstehliche[n] Einheit des Volkswillens“ mit der neuen
„Repräsentantenvernunft“ eine „öffentliche Meinung“, deren moralische Macht politische „Wunder thun
kann.“83
Das Wunder der Revolution löst als neuer Herrensignifikant aber nicht nur das christliche Wun-
der ab, es erneuert dieses auch, indem es die Reformation vollendet und die Religion auf diese Weise
dialektisch aufhebt. So spricht Forster vom „Wunder“ des „sanfte[n] Tod[es] des Priesterthums und sei-
ner Hierarchie“, an dessen Stelle „als Vollendung der protestantischen Reformation“ nun „das echte an-
spruchslose Christenthum des Herzens und des Geistes“ trete.84
Als ein politisches Wunder gilt Forster
die neue Souveränität der politischen Repräsentanten selbst, die nun völlig ohne Staatsgewalt auskommt.
„Ohne Auszeichnung, ohne irgend etwas Äußeres, das die Sinne besticht, ohne Vorzug, und selbst ohne
Autorität außer ihrem Versammlungssaale, ohne prätorianische Wache, endlich noch des Vorrechts der
Unverletzlichkeit beraubt, herrschen die Repräsentanten des Volkes durch die öffentliche Meinung ohne
Widerrede über vier und zwanzig Millionen Menschen.“85
Diese Wunderkraft der öffentlichen Meinung verleiht aber nicht nur souveräne Autorität ganz ohne An-
wendung äußerer Gewalt, sie vollbringt auch gesellschaftspolitische Wunder, die keine Staatsgewalt so
je hätte durchsetzen können. Denn das größte und wichtigste Wunder, welches Forster auf das Ereignis
der revolutionären Volkssouveränität zurückführt, ist die politische Suspendierung der kapitalistischen
Spekulation und die Wiederherstellung des öffentlichen Kredits. „Man hielt es beinahe für unmöglich“,
schreibt Forster, „das Agiotage zu tödten; die Strenge der Gesetze und das allgemeine Gefühl der Nation,
das sich gegen den Eigennutz der Kaufleute empörte, brachten gleichwohl die Assignate wieder in Kre-
dit.“86
Auf diese Weise habe die „öffentliche Meinung […] der Habsucht, der Gewinnsucht, dem Geitze,
mit Einem Worte, der ärgsten Knechtschaft, zu welcher der Mensch hinabsinken konnte, der Abhängig-
keit von leblosen Dingen, einen tödtlichen Streich versetzt.“87
Ohne diese wunderbare Transformation
wäre es schlicht nicht möglich gewesen, die notwendigen „Finanzoperationen des National-Convents“
durchzusetzen, für die sowohl das Verbot von „Wechsel- und Aktienhandel“ als auch eine „Zwangsan-
leihe […] bei den Kapitalisten und Rentirer[n]“ unerlässlich war.88
Insofern suspendiert die Volkssouve-
ränität, mit Žižek gesprochen, das kapitalistische Begehren (Marx’ Warenfetischismus) zugunsten des
revolutionären Triebs und verbindet auf diese Weise demokratische Repräsentation mit universaler Sou-
veränität. Wie Letzteres geschehen könne, war das große Rätsel der politökonomischen Debatten des 18.
83 Forster, Umrisse, 597f (wie Anm. 11). 84 Ebd., 607f. Mit Žižek, Less than nothing, 105 (wie Anm. 42), kann darauf hingewiesen werden, dass Forsters
tautologische Revolutionsbestimmung natürlich der göttlichen Offenbarung aus der biblischen Dornbuschszene
nachgebildet ist („Ich bin, der ich bin“), wobei diese zwar säkularisiert wird, aber den subversiven Inhalt des jü-
disch-christlichen Ereignisses bewahrt. 85 Forster, Umrisse, 611 (wie Anm. 11). 86 Ebd., 610. 87 Ebd., 608 (Hervorhebung im Original). 88 Ebd.
23
Jahrhunderts gewesen, die sich um das republikanisch-demokratische Potential des öffentlichen Kredits
bemühten.89
Da Forster bereits am 10. Januar 1794 starb, wissen wir nicht, wie sein Urteil über den weiteren Verlauf
der Jakobinerdiktatur und die Entwicklung der Französischen Revolution ausgefallen wäre. Es sollte aber
klar geworden sein, dass seine politisch engagierte Form des Philosophierens Spuren hinterlassen hat, die
in den heutigen Debatten um die Aktualisierung der Volkssouveränität bewahrt und fortgeführt werden
müssen. So sperrt sich Forsters originelle Verknüpfung von revolutionärer Volkssouveränität mit der
‚Nacht des Ungrundes‘ gegen die staatlich-legalistische Neutralisierung der Volkssouveränität, wie sie
im aktuellen System der liberalen Demokratie vorherrscht. Die im lacanschen Sinne reale Dimension der
Volkssouveränität verweist auf ein revolutionäres Ereignis, das heute aus dem Demokratieverständnis
weitgehend getilgt ist, so dass die Volkssouveränität nur noch als fiktive Formel innerhalb von Wahlen
und parlamentarischer Deliberation geduldet wird. Diese Ausstreichung des politischen Subjektes als
reale Größe aus der Politik in Kombination mit dem globalen Aufstieg des neoliberalen Finanzkapitalis-
mus wiederholt jedoch die politische Situation von 1789. All dies spricht für die Aktualität von Forsters
politischem Denken, dessen Erbe vermittelt über Hegel, Marx und Benjamin in den postfundamentalisti-
schen Politiktheorien von Žižek, Badiou und Rancière weiterlebt. Für Benjamin zumindest war Forster
unter seinen Zeitgenossen „fast als einziger Deutscher vorbestimmt, die Europäische Erwiderung auf die
Zustände, welche sie veranlassten, von Grund auf zu verstehen.“90
89 Vgl. hierzu Sonenscher, Before the Deluge (wie Anm. 52). 90 Benjamin, Deutsche Menschen, 160 (wie Anm. 13).