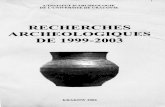Die Gegenstände hinter dem Kopf des Saturnus auf dem Denar des Sufenas
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Die Gegenstände hinter dem Kopf des Saturnus auf dem Denar des Sufenas
! Quae monetalis Sufenas super umerum et post cervicem Saturni posuerit, quidque in prioribus monetis post eiusdem dei caput vel cervicem aut in manu dextra videamus. Germanice.
Die Gegenstände hinter dem Kopf des Saturnusauf dem Denar des Sufenas
1Denar (3.67 g)
2Denar (3.91 g)
Ein gewisser Sufenas amtierte als Münzmeister um das Jahr 57 v. Chr. und prägte auf Geheiß des Senates einen Denar (Abb. 1-2), dessen Rückseite hinreichend erklärt, von dem aber
http://independent.academia.edu/FXRyan
die Vorderseite bislang nicht enträtselt worden ist.1 Dort wird an die wohl im Jahre 81 erfolgte erste Ausrichtung der sullanischen Siegesspiele2 durch den Neffen Sullas erinnert: SEX• NONI• PR• L — •V — • — P• F, d.h., Sex. Noni(us) pr(aetor) l(udos) V(ictoriae) p(rimus) f(ecit). Da jener erste Spielgeber erst gut zwanzig Jahre früher als Praetor amtierte,3 war der Münzmeister wohl dessen Sohn;4 Hollsteins Erkenntnis, daß der Münzmeister seinen Vor- und Gentilnamen weglassen konnte, weil er mit dem Prätor gleichnamig war,5 läßt dieses Ergebnis nur noch wahrscheinlicher erscheinen. Die übrigen Nachrichten aus dieser Zeit über einen Sufenas, Nonius, oder M. Nonius scheinen sich alle auf ein und denselben Mann zu beziehen, der aller Wahrscheinlichkeit nach schon im Jahre 56 die Ädilität oder die Prätur innehatte;6 demnach ist der Münzmeister anderweitig nicht bekannt. Der bärtige Saturnuskopf ist mit einem Attribut versehen, das Mommsen ohne nähere Erklärung “Harpe” bezeichnete; Grueber hielt es nicht für erklärungsbedürftig, gab aber seine Auffassung davon preis, als er “the small conical-shaped object” besprach: “in connection with the harpa it might relate to the unmanning of Uranus by his son Cronos”; bei Crawford heißt es wieder harpa ohne weiteren Kommentar.7 Schon Babelon, dessen Werk aus heutiger Sicht weitgehend überholt ist, hatte jedoch einen Schritt in die richtige Richtung getan, indem er auch eine Alternativdeutung vorschlug: “la faux ou harpè.”8 Hollstein trat als Erster (und, soweit wir
Die Gegenstände hinter dem Kopf auf dem Denar des Sufenas
2
1 M. H. CRAWFORD, Roman Republican Coinage (Cambridge 1974) 1.445, hatte ihn ins J. 59 gesetzt; da er zwar noch nicht im großen Mesagne-Schatzfund, aber schon im Sustinenza-Schatzfund vertreten ist, hat man ihn inzwischen ins J. 57 gesetzt: so C. HERSH-A. WALKER, The Mesagne Hoard, ANSMN 29 (1984) Table 2 u S. 134; H. B. MATTINGLY, The Mesagne Hoard and the Coinage of the Late Republic, NC 155 (1995) 106-107.
2 Zum Jahre vgl. F. BERNSTEIN, Ludi publici. Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung der öffentlichen Spiele im republikanischen Rom (Stuttgart 1998) 317: “Selbst wenn kein expliziter Beleg vorliegt, wird man doch davon ausgehen können, daß diese Spiele bereits im Jahre 81 unter die ludi publici stati(vi) aufgenommen wurden.”
3 H. B. MATTINGLY, The Denarius of Sufenas and the ludi Victoriae, NC 1956, 192-93, löste die Abkürzung PR mit PR(aeneste) auf und sah in den ludi Victoriae die sonst für Praeneste bezeugten quästorischen Spiele; gegen die daraus für den Spielgeber resultierende Quästur wendete W. HOLLSTEIN, Die stadtrömische Münzprägung der Jahre 78-50 v. Chr. zwischen politischer Aktualität und Familienthematik (München 1993) 247 u. A. 21, zu Recht ein, “daß PR in direkter Verbindung mit einem Namen immer als Prätor gelesen werden muß”; außerdem sind die beiden Schlußfolgerungen MATTINGLYs, Sufenas 201, die Siegesspiele “were to be given annually at Praeneste by one of the urban quaestors” und “at first...were limited to a day of circenses,” nicht miteinander vereinbar, denn aus römischer Sicht durfte nur ein Imperiumsträger das Startsignal geben: reine Zirkusspiele, wie die sullanischen Siegesspiele es anfangs waren (Vell. 2.27.6: felicitatem diei...Sulla perpetua ludorum circensium honoravit memoria), gehörten dann ebenso wenig in das Aufgabenbereich eines Quästors wie in das eines Ädilen; vgl. F. X. RYAN, Die Apollinarspiele zur Zeit der Republik, Aevum 80 (2006) 88-90.
4 CRAWFORD, RRC 1.445, hielt den Spielgeber für “an ancestor of the moneyer”, während HOLLSTEIN, Stadtröm. Münzpr. 246, ihn als dessen Vater betrachtete.
5 HOLLSTEIN, Stadtröm. Münzpr. 245-46: “Zu fragen ist außerdem, ob der Münzmeister überhaupt den Vornamen Marcus trug. Der Denar selbst bestätigt das jedenfalls nicht. Dessen Rs. nennt aber den Vater des Münzmeisters Sex Nonius, und zwar im Abschnitt.... Vermutlich sind wie häufig praenomen und nomen gentile auch auf der Vs. zu SVFENAS zu denken.”
6 Der Münzmeister (Sex. Nonius) Sufenas ist also nicht mehr entweder als Pr. 55 (so CRAWFORD, RRC 1.445, der ihn “M. Nonius Sufenas” nannte), oder als Tr. Pl. 56 (so HOLLSTEIN, Stadtröm. Münzpr. 245) anzusehen; auch sein älterer Zeitgenosse M. Nonius Sufenas war weder Pr. 55 noch Tr. Pl. 56; s. F. X. RYAN, The Date of Catullus 52, Eranos 93 (1995) 113-21.
7 TH. MOMMSEN, Geschichte des römischen Münzwesens (Berlin 1860) 625; H. A. GRUEBER, BMCRR (London 1910) 1.470 A. 2; CRAWFORD, RRC 1.445.
8 E. BABELON, Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine vulgairement appelées monnaies consulaires (Paris 1886) 2.256.
wissen, als Einziger) für eine vergleichbare Alternative ein: “Ohne auf die griechische Mythologie zurückgreifen zu müssen, ist das Attribut Saturns, der den Römern als Gott des Ackerbaus galt, sicherlich besser mit falx und somit als Erntegerät beschrieben.”9 Dabei stützte er sich nicht auf andere Münzen, sondern auf vier literarische Quellen: falcifer...deus (Ov. Fast. 1.234); quod ipse agrorum cultor habetur, nominatus a satu, tenensque falcem effingitur, quae est insigne agricolae (Fest. 202L, s.vv. opima spolia); Saturnus cum obunca falce custos ruris, ut aliquis ramorum luxuriantium tonsor (Arnob. Nat. 6.12); falx messoria scilicet, quae est attributa Saturno (Arnob. Nat. 6.25). Ohne gleich auf diese Stellen näher eingehen zu wollen, sei darauf verwiesen, daß das auf einem Denar des Stadtquästors Nerius im Jahre 49 wiederkehrende Attribut (Abb. 3) dem Zweck diente, die Betrachter der Münze den Kopf als den eines bestimmten Gottes erkennen zu lassen; kaum ein Römer hätte ein Erntegerät verkannt,10 viele aber ein Entmannungswerkzeug schon, und es kommt hinzu, daß der Wirkungsbereich jenes Gottes keinem einzigen in der damaligen Gesellschaft lebenden Menschen entkommen sein kann, während der Angriff des Kronos auf Uranos sonst keine Spuren in Rom hinter sich ließ. Gehen wir also zunächst davon aus, daß der Münzmeister sein Geschäft verstand und den Gott des Landbaus durch ein Erntegerät zu erkennen gab.
3Denar (3.95 g)
Die Probe aufs Exempel bestätigt unsere Erwartung. Wer hier ein Sichelschwert (im Englischen “scimitar”) zu finden glaubt, der kann die von dem Münzmeister verfolgte Abischt nicht durchschauen. So schrieb Crawford zum Porträt auf dem Denar des Sufenas: “The reason for the moneyer’s choice of the head of Saturn is obscure”; Woytek äußerte sich ähnlich zu den Vorderseitenbildern von Sufenas und Nerius: “Wie ein Sichelschwert auf diesen beiden Prägungen der späten Republik zum Attribut des Saturn werden konnte, ist a priori nicht ganz
Juni 2014
3
9 HOLLSTEIN, Stadtröm. Münzpr. 247.10 Im Gegensatz zu B. WOYTEK, Zum Attribut des Gottes Saturn in der Münzprägung der Römischen
Republik, Appendix 2 (S. 546-549) in: Arma et Nummi. Forschungen zur römischen Finanzgeschichte und Münzprägung der Jahre 49 bis 42 v. Chr. (Wien 2003), einem sehr tüchtigen Numismatiker, der trotzdem tatsächlich behauptete, daß das auf den Denaren von Sufenas und Nerius dargestellte Instrument “nicht wie ein Erntegerät (welcher Art auch immer), wie Hollstein meint,” aussähe.
klar.”11 Die alte Forschungsmeinung, der Saturnuskopf belege für Sufenas die Stadtquästur,12 wurde von Hollstein revidiert: “Die Münzmeister waren den Quästoren direkt unterstellt, so daß sie mit Saturn wahrscheinlich auf das eigene Prägeamt aufmerksam machen wollten.”13 Die Prämisse teilen wir zwar nicht, aber der Schluß könnte trotzdem gültig sein, denn das gemünzte (wie das ungemünzte) Geld war im aerarium Saturni aufgehoben. Da aber die Münzstätte mit dem Tempel der Iuno Moneta verbunden war, sollten wir uns zumindest die Frage vorlegen, ob Sufenas mit dem Saturnuskopf nicht auf den Tempel des Gottes—die Darstellung eines Tempelgebäudes wäre in den 50er Jahren keine Neuerung mehr in der republikanischen Münzprägung gewesen—, sondern auf die Wirkung desselben anspielen wollte, d.h., ob das Attribut auch in die Interpretation mit einzubeziehen wäre. Der erste Denar, auf welchem der Saturnuskopf auftaucht (Abb. 4), hilft uns weiter: auch damals (um das Jahr 10314) war der Prägebeauftragte kein Stadtquästor, und auch damals galt die Rückseite einem Sieg. Die beiden Seiten fügen sich zusammen zu einem Ganzen, das besagt: die siegreiche Beendigung des Krieges macht(e) den Weg frei für den Pflanzenbau. Es fehlte nicht viel, und die Münzmeister hätten ausgerufen: “Schmeidet eure Lanzen um zu Winzermessern.”
4Denar (3.92 g)
Um in die Gedanken des Münzmeisters Sufenas weiter einzudringen, müssen wir uns mit dem von ihm ins Münzbild gebrachten Erntegerät näher beschäftigen. Denn das Objekt, das hinter dem Saturnuskopf auf dem Denar des L. Memmius Gal. platziert ist, sieht jedenfalls anders aus als “der längliche Gegenstand”15 auf den Denaren von Sufenas und Nerius. Die gebogene und gezähnte Klinge war ein zweites Mal (um die drei Jahre später) in Nahaufnahme zu sehen (Abb. 5), und inzwischen16 in der Hand des wagenlenkenden Gottes, also nur aus der Ferne (Abb. 6), aber gerade dieses Stück, worauf der Griff des Objektes nicht erkennbar ist,
Die Gegenstände hinter dem Kopf auf dem Denar des Sufenas
4
11 CRAWFORD, RRC 1.446; WOYTEK, Attribut 549.12 Dazu s. HOLLSTEIN, Stadtröm. Münzpr. 248: “Doch müßte dann unbedingt ein Q gesetzt sein, das jedoch
fehlt.”13 HOLLSTEIN, Stadtröm. Münzpr. 248.14 Datierung nach H. B. MATTINGLY, Roman Republican Coinage c. 150-90 BC, in: Coins of Macedonia
and Rome: Essays in Honour of Charles Hersh (London 1998) 154.15 So HOLLSTEIN, Stadtröm. Münzpr. 247.16 Nach MATTINGLY, Coinage 154, prägte L. Saturninus um d. J. 101.
liefert den Nachweis, daß es sich hierbei um zwei ganz verschiedene Objekte handelt.17 Die Grifflänge wirkte sich zudem darauf aus, wie das jeweilige Attribut ins Münzbild aufgenommen wurde, denn offenbar ist dasjenige auf den Denaren von Sufenas und Nerius als geschultert zu denken, während dasjenige auf den früheren Vorderseiten gleichsam als Teil einer Montage ins Münzfeld gesetzt ist. Deren unterschiedliche Beschaffenheit und die täuschend ähnliche Form des Schwertes auf Münzen, die Perseus mit dem Medusenhaupt zeigen (Abb. 7), verleiteten Woytek zu dem falschen Schluße, daß Sufenas und Nerius dem Gott ein Sichelschwert als
5Denar (3.96 g)
6Denar (3.94 g)
Juni 2014
5
17 Trotzdem benannte CRAWFORD (RRC 1.320, 323, 330) auch dieses frühere Attribut jeweils harpa; BABELON, Monn. 2.214, ebenfalls beschrieb das andersartige Objekt auf dem Denar des L. Memmius Gal. mit den gleichen Worten, die er bei Sufenas gebrauchte: “la faux ou harpè”; F. CATALLI, La monetazione romana repubblicana (Roma 2001) 180, 234, gab beide Male harpa an, und R. ALBERT, Die Münzen der Römischen Republik (Regenstauf 2003) 138, 167, seinerseits durchweg “Harpa.” In ähnlicher Weise beschrieb F. BARATTE, Saturnus, LIMC 8.1 (1997) 1079-80, der das Gerät auf einer Nachahmung der Typen von L. Memmius Gal. (RRC 349/1) fälschlich als ein Messer einstufte (“un couteau recourbé à dents”), dasjenige auf den Denaren des Saturninus, wie diejenigen von Sufenas und Nerius, als “harpé.” MOMMSEN, Münzw. 576, der ja das Attribut auf dem Denar des Sufenas “Harpe” bezeichnete, brachte dabei wenigstens zum Ausdruck, daß es sich von dem auf dem Denar des L. Memmius Gal. unterscheidet, das er lediglich als “Sichel” beschrieb.
Attribut beigab.18
7Æ 37 mm (25.30 g)
Jeder indes, der auch nur das ABC von landwirtschaftlichen Geräten versteht, erkennt unschwer in dem Attribut auf den früheren Denaren eine Sichel (im Englischen “sickle”), in dem auf den späteren hingegen eine Sense (im Englischen “scythe”), die übrigens im Französischen “faux” heißt.19 Sie sind also beide doch Erntegeräte. Es stellt sich dann die Frage, welchem der Name falx zukommt. So unwahrscheinlich es auch klingt, lautet die Antwort: beiden. Tatsächlich bezeichneten die Römer viele verschiedene Geräte als falces. Woytek wußte dies und machte mehrere namhaft, scheint aber fälschlich angenommen zu haben, einmal, daß die falces alle Sicheln waren,20 zum anderen, daß nur eine einzige Art falx21 für das Attribut infrage kommt.22 Doch eine der vier von Hollstein zitierten Belegstellen widerlegt beide Annahmen: Saturnus cum obunca falce custos ruris, ut aliquis ramorum luxuriantium tonsor (Arnob. 6.12);
Die Gegenstände hinter dem Kopf auf dem Denar des Sufenas
6
18 WOYTEK, Attribut 546-48. Als er aber auf die Denaren von Saturninus verwies, worauf der Gott “die Sichel” hält, um zu zeigen, “daß man sich Kronos/Saturn in der republikanischen Zeit durchaus wehrhaft vorstellte” (S. 549 A. 14), widersprach er sich selbst, indem er neben seinen existierenden Kategorien Sichel/falx und Sichelschwert/harpe eine dritte aufstellt, nämlich die der zur Waffe tauglichen Sichel, ohne sich dessen bewußt gewesen zu sein; diese dritte Kategorie, die dem griechischen Kastrationsmythos besser zu entsprechen scheint, macht aber die zweite Kategorie gegenstandslos.
19 Die Sichel heißt französisch “la faucille”; “faux” leitet sich von falx, “faucille” hingegen—und logischer Weise—von der Verkleinerungsform falcula ab; s. K. D. WHITE, Agricultural Implements of the Roman World (Cambridge 1967) 85.
20 “Grundsätzlich darf...die Tatsache, daß in der Antike Sicheln gänzlich verschiedenen Aussehens nebeneinander existierten, nicht verwundern: Bei falces handelte es sich laut Ausweis der literarischen Quellen um eine Gattung von Arbeitsgeräten, die je nach spezifischem Verwendungszweck sehr stark diversifiziert war” (WOYTEK, Attribut 548). WHITE, Implements 76, erkannte unter Geräten, die zumeist falces genannt waren, neben drei Arten von Sicheln und der einen Art Sense sechs Arten von “billhooks” (Häpen) und zwei von “vine-dresser’s knives” (Hippen).
21 Jedenfalls bis auf die Zähnung; er meinte, der Gott sei auf den Denaren des Saturninus “mit einer schmalen, gebogenen Klinge in der erhobenen Rechten” zu sehen, ließ aber die Bezeichung falx sowohl für den ungezähnten als auch für den gezähnten Typ gelten (WOYTEK, Attribut 547).
22 Er fragte sich aber trotzdem nicht, was für welche, sondern gab sich damit zufrieden, “Erntegeräte” jeweils schlicht “Sichel,” falx oder sogar harpe zu benennen (WOYTEK, Attribut 547, 549).
da hier von Zweigen die Rede ist, kommt man kaum umhin, die obunca falce als eine falx arboraria und damit als eine Häpe (im Englischen “billhook”) einzustufen.23
Wir wollen nicht ausschließen, und wir brauchen auch nicht zu leugnen, daß der eine oder andere Büchernarr in den dargestellten falces eher Entmannungs- als Erntegeräte erblickte. Dies trifft aber erst recht auf das Memmius-Gerät zu: Woytek selbst machte auf eine Hesiodstelle (Theog. 179-180) aufmerksam, in welcher das Kastrationsinstrument als gezähnt beschrieben ist.24 Nach der Erfindung der Sense stand nichts im Wege, auch sie als das Kastrationsinstrument aufzufassen: Macrobius benannte zwar das Instrument nicht, identifizierte aber Kronos und Chronos ausdrücklich, erwähnte dann die Kastration und beschrieb ein wenig später das Attribut lediglich als eine falx (Macrob. Sat. 1.8.6: hunc aiunt abscidisse Caeli patris pudenda; 9: falcem ei quidam aestimant attributam quod tempus omnia metat exsecet et incidat); freilich übersetzt R. A. Kaster (Loeb ed. 2011) “Some judge that the sickle was attributed to him,” wegen der Verschmelzung mit Chronos erscheint es aber wahrscheinicher, daß eine Sense hier in Rede steht,25 die vielleicht auch bei der schon erwähnten Kastration nützlich wurde. Es kann sein, daß unser Büchernarr das Memmius-Gerät ἅρπη, das Sufenas-Gerät hingegen δρέπανον bezeichnet hätte, denn der Versuch Woyteks, auch das spätere Gerät harpe zu benennen, erscheint nicht mehr haltbar gegenüber der Erkenntnis, daß auch es ein Erntegerät war;26 dies würde aber nichts an der Tatsache ändern, daß die allerallermeisten Betrachter hier wie dort falces sahen. Der Altertumswissenschaftler von heute, der es sicht leicht machen und nur eine Bezeichnung verwenden will, darf also dem Vorschlag, das aus dem Griechischen entlehnte Wort harpe zu benutzen,27 nicht folgen, sondern muß beim lateinischen Wort falx bleiben, so vage es auch ist. Das Erntegerät, das hinter dem nach links gerichteten Saturnuskopf auf dem Avers des L. Memmius Gal. zum ersten Mal in der Denarprägung erscheint, werden so gut wie alle Römer nicht nur als eine falx im allgemeinen, sondern auch als eine falx messoria im besonderen erkannt haben, und das heißt, als eine ganz normale Sichel:28 der Knauf der römischen Sichel, der weder hier noch auf dem Avers von Piso und Caepio zu sehen ist, war sowieso kurz, die schneidende Kante der Klinge entweder gezähnt oder ungezähnt;29 wenn man berücksichtigt, daß eine gezähnte Klinge—nach White zu urteilen—nur bei den eigentlichen Sicheln vorkam, muß man es für sehr wahrscheinlich halten, daß die Prägebeauftragten der Deutlichkeit halber die Klinge mit Zähnung versehen ließen: schon auf den ersten Blick war klar zu erkennen, was für eine falx abgebildet war. Die andere von Hollstein auf das Sufenas-Gerät bezogene Arnobiusstelle nennt statt dessen das Memmius-Gerät ausdrücklich: falx messoria...quae est
Juni 2014
7
23 H. BRYCE-H. CAMPBELL (Edinburgh 1886) übersetzten den Anfang: “Saturn with his crooked sickle, like some guardian of the fields”; da er aber eine “gekrümmte Häpe” (“crooked billhook”) in der Hand hielt, haben wir unter ruris vielmehr “des Landes” (“the country”) zu verstehen.
24 WOYTEK, Attribut 547.25 WHITE, Implements 98, sagt ohne weiteres: “On Saturn the scythe-bearer see Macrobius, Saturae 1.7-8.”26 Jedenfalls nach WHITE (Implements 73) zu urteilen setzten die glossatores zwar die genauere Bezeich-
nung falx messoria mit ἅρπη gleich, gaben das Wort falx aber sonst mit δρέπανον wieder.27 So WOYTEK, Attribut 549.28 Vgl. WHITE, Implements 81: “The ordinary sickle (f. messoria), often referred to simply as falx.”29 Siehe WHITE, Implements 80: “The sickle...consists of a smooth curved blade, equipped with a smooth
or serrated cutting edge, attached to a short handle.”
attributa Saturno (Arnob. 6.25).30 Das Adjektiv bezeichnet das, was zur Arbeit eines Schnitters (messor) gehört. Die von Hollstein zitierte Festusstelle scheint ebenfalls eher auf die Sichel zu passen, unter anderem auch weil Kulturpflanzen hervorgehoben werden (202L: quod ipse agrorum cultor habetur, nominatus a satu), worunter Nahrungspflanzen leichter vorzustellen sind als Futterpflanzen; das Gesagte trifft auf eine weitere Festusstelle zu (432L, s.v. Saturno: et is culturae agrorum praesidere videtur), auch wenn die fragliche falx bald den Säer (202L: tenensque falcem effingitur, quae est insigne agricolae), bald den Gott der Aussaat (432L: quo etiam falx est ei insigne) symbolisiert. Das zum ersten Mal in der römischen Münzprägung auf dem Avers des Sufenas gezeigte Erntegerät war bei der damaligen Wirtschaftsstruktur unschwer erkennbar: es ist eine falx faenaria.31 Das Adjektiv bezeichnet das, was mit Heu (faenum) zu tun hat. Es ist gut möglich, daß die übrige von Hollstein angeführte Stelle tatsächlich auf die Sense zu beziehen ist. Bei der Vielzahl der falces sind die Worte falcifer...deus (Ov. Fast. 1.234) zunächst ganz undeutlich, und man nimmt keinen Anstoß an “the sickle-bearing god” (J. G. Frazer, Loeb ed. 1931) oder “der sicheltragende Gott” (F. Bömer, Heidelberg 1957). Was Saturnus machte nach seiner Ankunft (Fast. 1.240: hospitis adventum...dei), erfahren wir hier nicht, wohl aber, wie es am Ort der künftigen Stadt aussah: hic, ubi nunc Roma est, incaedua silva vivebat, | tantaque res paucis pascua bubus erat (Fast. 1.243-244); bei incaedua silva denkt man eher an Beile als wieder an die falx arboraria, aber bei pascua legt sich die falx faenaria nahe. Laut Macrobius führte Ianus die Verehrung des Saturnus ein: simulacrum eius indicio est, cui falcem, insigne messis, adiecit (Sat. 1.7.24). Kaster übersetzte “a sickle, the symbol of the harvest,” und bei falcem, insigne messis kann man gar nicht anders, als an die falx messoria, die urtypische Sichel, zu denken, aber die schlichte falx weiter unten (Sat. 1.8.9: falcem ei quidam aestimant attributam quod tempus omnia metat exsecet et incidat), wie wir gesehen haben, scheint doch eine Sense zu sein, und das wird dann auch hier zutreffen. Schließlich wurde auch das Heu geerntet.32
Es erhebt sich jetzt die Frage, warum Sufenas die Sichel fallenließ, um mit einer Sense aufzuwarten. Damit legte er nämlich höheren Wert auf die Heu- als auf die Kornernte. Einen Hinweis scheint uns die Rückseite zu liefern, worauf die erste Veranstaltung der sullanischen Siegesspiele thematisiert wird: am Anfang waren sie reine Zirkusspiele, gingen also ohne Pferde gar nicht vonstatten; somit erscheint es berechtigt, den Wechsel von der Sichel zu der Sense, also von “reaping sickle” zu “mowing scythe”33 und damit letztlich vom Essen zum Fressen als durch die Reversthematik bestimmt zu verstehen. Sufenas scheint daher die Sense mit Bedacht ins Münzbild gerückt zu haben. Das konische Objekt bildet ein Rätsel, das seiner Lösung noch harrt. Nach Mommsen war darin “vielleicht ein Geldtopf oder ein Hut” zu sehen; nach Babelon, “un objet indéterminé
Die Gegenstände hinter dem Kopf auf dem Denar des Sufenas
8
30 Siehe auch Apul. Met. 6.1: falces...messoriae, Ulp. Dig. 33.7.8.pr.: corbes falcesque messoriae, Pallad. 1.43.1-2: falces...messorias.
31 Siehe Cato Agr. 10.3: falces faenarias, Varro LL 5.137: falces fenariae, Ulp. Dig. 33.7.8.pr.: falces fenariae, Pallad. 1.43.1-2: falces...faenarias.
32 Man muß sich also hüten, vom messoria auf messis zu schließen, bzw. über das Adjektiv das Nomen zu definieren, wie WHITE, Implements 75, es tat: “the f. messoria (from messis the corn harvest)”; s. Varro RR 1.50.1: messis proprio nomine dicitur in iis quae metimur, maxime in frumento.
33 Definiert nach WHITE, Implements 74.
qui est peut-être un vase à mettre de l’argent”; Grueber beschrieb es als “conical stone (baetylus)” und erklärte: “it may be intended to represent the conical stone, baetylus, which Rhea gave Cronos (Saturn) to swallow in place of the infant Zeus”; davon beeinflußt glaubte Crawford ein “oval object” zu sehen und merkte an: “presumably the stone given to Saturn in lieu of the infant Zeus.”34 Letzteres konnte Hollstein leicht widerlegen: “Kann denn wirklich ein Gegenstand, wie hier der baetylus, der zur Täuschung eines Gottes benutzt wurde, als Zeichen gerade für diesen Gott verwendet werden?”35 Übersehen oder -gangen ist der Vorschlag Mattinglys: “The conical object on Sufenas’s obverse may be one of the wooden eggs (ova) used to mark the laps in the circus”;36 ein Ei ist aber doch oval, nicht kegelförmig. Dargestellt ist laut Woytek “ein nicht mit Sicherheit identifizierter Gegenstand, vielleicht ein Stein,” er vermutete darin aber einen andersartigen als davor angenommen: “Könnte es sich etwa um einen Wetzstein zum Schärfen einer Klinge...handeln?”;37 man müßte dann aber auch erklären, warum bei der Unmenge der echten Waffen auf republikanischen Münzen, deren Klingen bzw. Spitzen ja nicht für stumpf zu halten sind, ein Schleifstein stets fehlt. Hollstein selbst machte keinen Vorschlag: “unbestimmter Gegenstand.”38
Wir vermuten in dem (jedenfalls auf besseren Exemplaren) konischen Objekt das Ergebnis der Arbeit, die man mit der Sense verrichtete, nämlich einen Heuhaufen. Denn wir wissen, daß die Römer das geerntete Heu anhäufteten, wobei sich der Heuhaufen nach oben immer mehr verengte: in metas exstrui conveniet easque ipsas in angustissimos vertices exacui (Col. 2.18.2). Das für Heuhaufen von keinem Geringeren als Columella verwendete Wort war mithin meta, was ja auch die Wendemarke im römischen Zirkus bezeichnete. Das dürfte kein Zufall sein. Die Sense war ohne weiteres erkennbar und brauchte keinen Zusatz um entweder klar oder komplett zu sein; Sufenas nutzte jedoch die Zweideutigkeit des Wortes meta sehr geschickt aus, um eine weitere Verbindung zwischen den Münzseiten herzustellen. Es ist dann auch vorstellbar, daß Sufenas, der Großneffe Sullas, anhand der Vorderseite das sullanische Rom mit der Regierungszeit des Saturnus gleichstellen wollte, also mit dem glücklichsten Zeitalter (Macrob. Sat.1.7.26: regni eius tempora felicissima feruntur, cum propter rerum copiam tum et quod nondum quisquam servitio vel libertate discriminabatur), wie die Rückseite letztlich dem Glück des Schlachttages galt (Vell. 2.27.6: felicitatem diei, quo Samnitium Telesinique pulsus est exercitus, Sulla perpetua ludorum circensium honoravit memoria). Der meta begegnen wir wieder in der kaiserzeitlichen Münzprägung, auch in Nahaufnahme (Abb. 8).
Juni 2014
9
34 MOMMSEN, Münzw. 625; BABELON, Monn. 2.256; GRUEBER, BMCRR 1.470; CRAWFORD, RRC 1.445 u. A. 1. Auch BARATTE, Saturnus 1079, der GRUEBER sonst folgte, beschrieb “un objet ovale”; ebenfalls CATALLI, Monetazione 234, aber ohne weiteren Kommentar: “un oggetto ovale.” ALBERT, Münzen 167, sagt lediglich “Stein.”
35 HOLLSTEIN, Stadtröm. Münzpr. 247-48. Trotzdem finden wir noch bei BARATTE, Saturnus 1079, die Vermutung “peut-être la pierre présentée au dieu à la place de Jupiter nouveau-né.”
36 MATTINGLY, Sufenas 201 A. 5.37 WOYTEK, Attribut 546 u. A. 1.38 HOLLSTEIN, Stadtröm. Münzpr. 244.
8Aureus (7.30 g)
Frz. Xav. Ryan a.d. XII Kal. Iul. anno a.C. MMXIV divulgavit. Rerum Naturae Musaeque gratias.
Post aliquot dies tres errores typographici et unus in ordine verborum ab eodem correcti sunt. Sexto anno alius error typographicus remotus est.
Abbildungsnachweis1 RRC 421/1 CNG Electronic Auction 315, lot 320 20 Nov. 20132 — CNG Electronic Auction 297, lot 341 27 Feb. 20133 RRC 441/1 CNG Electronic Auction 326, lot 438 7 May 20144 RRC 313/1b CNG Electronic Auction 327, lot 882 28 May 20145 RRC 330/1b CNG Electronic Auction 286, lot 280 5 Sept. 20126 RRC 317/2 CNG Auction 96, lot 703 14 May 20147 Cf. SNG France 1710 CNG Auction 93, lot 931 22 May 20138 RIC 144 NAC Auction 49, lot 217 21 Oct. 2008
Die Gegenstände hinter dem Kopf auf dem Denar des Sufenas
10










![Au bord du Gauge "Auf Flügeln des Gesanges" [Op.34 No.2]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6334f143b9085e0bf5094244/au-bord-du-gauge-auf-fluegeln-des-gesanges-op34-no2.jpg)