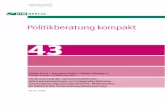Bruneck im Laufe der Zeiten
Transcript of Bruneck im Laufe der Zeiten
DER SCHLERN � 11H
eft
Wissenschaft Geschichte
Bruneck im Laufe der ZeitenErkenntnisgewinn durch den Bau eines Modells von Bruneck 1570 – Von Carlo Sansone
Die Idee zu diesem Forschungs-projekt entstand bei einem Ge-spräch im Vereinsvorstand des
Vereins für Kultur- und Heimatpflege Bruneck, wo man überlegte, welchen Beitrag man zur 750-Jahr-Feier der Stadt Bruneck leisten wolle. Die Idee zum Mo-dellbau hatte der Bildhauer C. Piffrader, recherchiert und gebaut hat das Modell dann der Autor dieser Zeilen.
Das Modell ist ganz aus Holz ge-baut. Grundlage ist ein AutoCad-Plan der Gemeinde Bruneck, im Maßstab 1:250 mit Plotter ausgedruckt, der in der West-Ost Achse den Bereich Kreu-zung Reischacherstraße westlich der Ur-sulinen bis einschließlich Ansitz Teisegg wiedergibt und in der Nord-Süd Achse den Schlossberg bis ca. Kapuzinerplatz.
Die materielle Basis ist eine Plat-te von verleimtem Sprerrholz, 2 cm Durchmesser und einer Fläche von 270 cm x 171cm. Darauf wurden die Hö-henschichten aus Pappelsperrholzplatten mit je 0,4 cm = 1 m Höhenunterschied gelegt. Da es nicht von allen Punkten der Stadt Kotenmessungen gibt, musste anhand der vorhandenen und der Orts-kenntnis interpoliert werden um die en-sprechenden Isohypsen zu bekommen.
Um das Ganze transportabel zu er-halten wurden nur gewisse Höhenplat-ten verleimt und zwar nach praktischen Gesichtspunkten. Auch die Gebäude wurden nur teilweise mit anderen Struk-turen verleimt, so z.B. Nachbarhäusern oder anliegenden Türmen oder Mau-ern. Gebäudegruppen wurden in Fich-tenholz ausgeschnitten, die Dächer in Balsaholz. Kriterium für die Definition der Häuserblöcke war der Wunsch, die möglichen Bauphasen der Stadt nach-stellen zu können.
Auf Bemalung oder Behandlung mit Lack wurde verzichtet.
Die Bauzeit des Modells betrug 9 Monate. Vorausgegangen waren in-tensive urbanistische und historische Studien. Grundlage für das Modell ist die älteste heute bekannte Darstellung Brunecks von 1570. Da wegen des Be-trachtungswinkels und möglicher Un-genauigkeiten bei der Darstellung nicht alle Punkte der Stadt genau einsehbar sind, wurden auch die drei nachfol-genden Bilder zu Rate gezogen und schließlich auch noch Lokalaugen-scheine vor Ort durchgeführt. Die oben genannten anderen Bilder sind die ano-nyme Planansicht von 1581, jenes von Mathias Burglechner von ca. 1620 und jenes über dem Hauptaltar der Kapu-zinerkirche in Bruneck, das auch nicht lange nach 1630 entstanden sein dürfte.
Zwei Aspekte überraschten beim Bau des Modells besonders:Zum einen die großen Höhenunter-
schiede zwischen verschiedenen Punk-ten der Stadt. Dies ist eine Tatsache, die einem wegen der dichten Verbauung des Geländes im Alltag kaum auffällt. So überwindet man vom Ragentor zum Ursulinentor immerhin ein Gefälle von 3 Metern. Interessant war auch festzu-stellen, welche Gebäude auf derselben Isohypse liegen.
Zum anderen die bedeutende Rolle, die Wasser für die Stadt spielte, ganz an-ders als heute. Da waren zum einen die 7 Brücken, der Stadtgraben, der erhöhte Wasserrunst auf seinem fast 1 Kilometer langen Weg zu dem Stadttor, das heute Florianitor heißt und der unterwegs ei-nige Mühlen speiste, die 2 Kanäle, die orographisch rechts in Außerragen Bad-häuser, dann Handwerksbetriebe und noch einmal Mühlen mit Wasser versa-hen und der Mühlbachl-Kanal, der un-terhalb der heutigen Kapuzinerbrücke
Versuch der Skizze einer historischen Urbanistik Brunecks bis 1571.
11H
eft
DER SCHLERN �
Geschichte Wissenschaft
gegen Westen bog und unter anderem die Öhlersäge bewässerte. Bis auf Gra-ben und Wasserrunst sind alle anderen Wasserbauten noch auf dem Kataster-plan von 1858 zu sehen.
Im Urzustand sieht man einen Fluss, die Rienz, der von Osten kommend,
wegen des Vorhandenseins eines Fels-kopfs aus permischem Kalk, den Wort-berg, eine sanfte Schleife nach NW zieht. Hier am Eingang des Stadtge-bietes ist die Rienz eingebettet in das kleine Tal zwischen der Erhöhung der Kachlerfelder, die sich gegen N hin zur Feuerwerhalle wieder absenken und dem sanfteren Anstieg nach S entlang des Reischacherbaches.Eine Engstelle entsteht dann, wo der Fluss fast den Schlosshügel streift, nämlich zwischen Ragentor und Rienztor. Durch die Wen-dung des Flusses nach NW entsteht hier eine Terrasse, fast ein Ausläufer des Wortberges, wo sich später der Haupt-teil der Altstadt ansiedelt, bis hin zu ein-schließlich dem heutigen Rathausplatz und Autobusbahnhof, hinter denen die Terrasse dann nach N wieder steil zum Flussbett abfällt. Der Höhenunterschied zwischen Ragenhaus und dem Plarerbo-den hinter dem Rathaus ist 18 Meter. Makrophase 01: Vor 950–1050In diesem Phasenbündel entsteht das Gehöft, die Mühle und die Kapelle in Ragen.
Zur Zeit der Urkunde der edlen Frau Swanahilt, also zwischen 950 und 1050 ist die Terrasse nordwestlich des Wort-berges, die nun Unterragen heißt1, noch unbewohnt. Im Osten des Hügels lie-gen hingegen ein Küchenmaierhof, das spätere Ragenhaus und Sitz der Minis-terialien zu Ragen, und vermutlich die
uns heute in ihrer gotischen Bauform bekannte Hannesmühle2, Wasserlei-tungen und auch schon eine Kapelle3.Makrophase 02: ca, 1050–1250In diesem Phasenbündel kommen noch die zwei Gebäude in Unterragen dazu: der Hohe Zorn und das Paradeishaus mit Brücke.
Das Haus Hoher Zorn ist das heu-tige Haus Nr. 6 am Graben und das Pa-radeishaus ist heute Stadtgasse Nr.13, östlich an das Haus der Bäckerei Frisch anschließend. Diese beiden Häuser sind, als die Stadt erbaut wird, exempt, d.h. sie unterstehen nicht dem Stadt-gericht, sondern dem Oberamtspfleger, ein Privileg, das nur Gebäuden zuteil wird, die schon vor der Stadtgründung vorhanden sind4. Die alte Straße wird hier, vermutlich entlang des Fußes des Kühbergls von St.Lorenzen her, südlich oder nördlich am Hohen Zorn vorbei, zur Rienzbrücke geführt haben, deren ein Brückekopf das Paradeishaus ist. 50 Meter westlich vom Hohen Zorn erhebt sich ein weißer Felsen aus der Terrasse. Hier wird einige Jahrhunderte später ei-ne Kapelle und dann darauf die Neukir-che, heute Ursulinenkirche errichtet.
Das Paradeishaus war von dem Ge-schlecht der A Porta/Zu Porth bewohnt und der um die Erforschung der Stadt-geschichte sehr verdiente Historiker Hubert Stemberger erzählte, er habe bei den Umbauarbeiten 1970 hier im Kel-lergeschoss ein zugemauertes Tor beob-achtet5. Man kann sich hier also vermut-lich einen Wohnturm als Brückenkopf vorstellen, in dem eine Wache saß. H. Stemberger vermutet, dass in den ers-ten Jahrzehnten der Stadt, vielleicht bis 1270 oder 1280 dies die einzige Brücke über die Rienz war6.
Die Urlandschaft mit den Höhenstufen.
Die Urlandschaft
DER SCHLERN � 11H
eft
Wissenschaft Geschichte
Vielleicht steht auf dem Wortberg7 in dieser Zeit auch schon ein kleiner Turm, der Vorläufer des heutigen Schlosses.Makrophase 03: 1250–1336In diesem Phasenbündel entstehen die Burg mit ihren Verbindungsmauern zur Stadt-mauer, die Stadtmauer, die Stadtgasse und der Graben, die Paradeisbrücke wird zum Rienztor verlegt.
Erzbischof Bruno beschließt die Gunst der Stunde zu nutzen und seine Ämter aus Aufhofen in eine zu erbauen-de Stadt zu verlegen8. Meinhard II sitzt gefangen auf der Burg Hohenwerfen dem alten Graf Albrecht von Tirol sind wegen der Sippenhaft die Hände gebunden. Der geistliche Würdenträger beauftragt also einen uns unbekannten Architekten und es entsteht der Plan für eine befestigte Stadt, welche einerseits durch die natür-liche Topographie im Osten geschützt ist durch die Engstelle zwischen Rienz und Wortberg und andererseits von einer mächtigen Stadtmauer mit Wassergra-ben, das Ganze wird beherrscht von einer Burg. Im Westen von Unterragen wird ein Torturm, das Gänsetor, errichtet, da-nach säumen zwei Häuserzeilen die alte Durchgangsstraße Richtung Osten, beim Paradeishaus der Herren Zur Porth führt
eine Brücke über die Rienz. Nach einer Hypothese enden hier auch vorläufig die zwei Häuserzeilen und es gibt möglicher-weise auch ein Tor nach Osten, analog dem heutigen Ragentor, aber weiter west-lich. Leider konnten während der Ver-legung der Fernheizrohre im April und Mai 2004 an dieser Stelle der Stadtgasse wegen der vielen Störungen im Boden keine entsprechenden Beobachtungen gemacht werden.
Die Hypothese, dass sich die Stadt in dieser Phase nach Osten nur bis zu aus-schließlich dem Webhofer-Haus erstreck-te, hat den verteidigungstechnischen Haken, dass hier das Gefälle außerhalb des Ragentores noch ansteigt, etwaige Feinde von außen also nach unten an-greifen konnten, während sich die Stadt-bewohner von unten nach oben hätten verteidigen müssen. Dazu kommt noch das Problem, dass die Stadt von hier aus mit einer Mauer mit der Burg verbunden werden musste. Davon sind bis jetzt we-der bauliche Spuren noch urkundliche Hinweise gefunden worden.
Auf dem Wortberg errichtet Bischof Bruno einen frei stehenden Bergfried und Richtung Westen zwei selbstständi-ge Wohntrakte9.
Im Hintergrund links die Rienzbrücke, im Vordergrund links die Baderbrücke, in der Bildmitte Schlipftor und gedeckte Brücke; entlang der Stadt-mauer links der Runst auf Stützen. Bei der Schlipfbrücke fließt das Wasser vom Runst in den Graben. In die-ser frühen Phase ist das einzige Haus an der Stadtmauer der Hohe Zorn, rechts im Bild, dahinter der Ball-hausplatz.
Oberragen und Unter-ragen mit Hohem Zorn rechts, in der Mitte Paradeishaus mit Brücke, links Ragenhaus und Hannesmühle, im Hintergrund auf dem Wortberg ein Turm.
11H
eft
DER SCHLERN �
Geschichte Wissenschaft
In dieser Phase wird die Stadtmau-er fertig gebaut. Es stehen noch keine Häuser an ihrer Innenseite, ausgenom-men das Haus Zum Hohen Zorn.
Ebenfalls fertig ist die Verbindungs-mauer mit der Burg10 und der Stadtgra-ben ist ausgehoben11. Da er im Osten keine Verbindung mit der Rienz hat und nicht von dieser gespeist wird, lei-tet man das Wasser über einen Runst ein. Die Einleitung erfolgt oberhalb der Hannesmühle in Oberragen, viel-leicht sogar aus dem Reischacherbach, der ungefähr die gewünschte Wasser-menge führt. Unterwegs zum Schlipf, wo der Runst endet und den Stadtgra-ben speist12, betreibt das Wasser auch noch einige Mühlen, so jene unterhalb des Pintabühels, welche bis zur groß-en Überschwemmung 1882 bestanden. Der Runst verläuft hier auf Stützpfos-ten in einiger Höhe über dem Boden, der Rienz entlang nach NW, unter der heutigen Rienzbrücke durch und biegt beim heutigen City Hotel Hinterhuber nach W Richtung Schlipftor ab, welches wieder fast auf der gleichen Isohypse wie der Einlauf oberhalb der Hannes-mühle liegt, das Wasser wird daher nicht allzu schnell geflossen sein. Die Stützpfosten sind auf fast allen Bildern zu sehen, besonders gut bei Matthias Burglechner um 1620, aber auch noch auf G.v.Pfaundlers „Bruneck“, 181513. Vermutlich werden dann mit dem Zu-schütten des Grabens 1830 auch zumin-dest Teile des Wasserrunstes entfernt.
Spätestens beim Bau des Runstes wird auch die Rienzbrücke vom Para-deishaus, wo sie ziemlich tief liegt, an das fast 2 m höher gelegene heutige Ri-enztor verlegt. Dadurch kann der Runst unter der Brücke hindurch verlaufen. Auch dies würde eine sehr frühe hypo-thetische Verlegung des Ragentores nach Osten nahelegen, also allerspätestens in die erste Hälfte der Amtszeit von Erzbi-schof Albert von Enn (1324–1336).
Zwischen Stadtmauer und Graben lagen, wie sonst auch üblich ca. 2,5 Me-ter14. Der Graben selbst ist an die 9 bis
10 Meter breit15 und wird von zwei Brü-cken überquert: im Nordwesten beim Schlipftor eine gedeckte Holzbrücke und im Westen beim Gänsetor eine weitere.
Der Grund dafür, dass man den Graben nicht von der Rienz speisen lassen will ist nicht ganz klar, vielleicht will man der Willkür eines möglichen Hochwassers keine Angriffsfläche bie-ten. In dieser Phase biegt der Graben beim heutigen Café Klostereck nach Sü-den und endet unterhalb der Burgmau-er an der Felswand. Beim Neubau zum Pädagogischen Gymnasium stieß man bei der Fundamentierung im Zwinger außerhalb der Stadtmauer auf ein 9 Me-ter tiefes Schlammloch16.
Vor dem Ragentor liegt der Pfeffer-graben, ein vermutlich künstlicher Tro-ckengraben, der ebenfalls mittels Zug-brücke überwunden wird. Von Norden her, der Rienzseite hätte man leicht in den Graben einsteigen können, deshalb schließt ihn hier eine Mauer ab.
Einmal im Jahr durfte man diesen Graben betreten, nämlich bei der Jahr-tagsstiftung eines Brunecker Bürgers zu Ostern bei der der Kirchenpropst das Fleisch von zwei Ochsen, und etwas Pfef-fer an die Einwohner verteilt wurde17.
Die fertige Stadtmauer mit dem Haus Zum Hohen Zorn links, davor der Graben; im Hintergrund links die gedecktze Schlipfbrü-cke über den Graben und rechts am Hang die Rainkirche mit dem an ihrer Nord-seite stehenden Kirch-turm; die zwei Häuser-zeilen der Stadtgasse, im Vordergrund Gän-setor mit Graben und Zugbrücke, der Ball-hausplatz ist im Osten begrenzt durch das Neustifter Amtshaus mit dem Ziehbrunnen davor. Neu- bzw. spä-tere Usrulinenkirche und Turm fehlen noch.
DER SCHLERN � 11H
eft
Wissenschaft Geschichte
Mit der Fertigstellung der Stadtmau-er und der Tore steht auch deren Befesti-gung mit Fallgittern und Zugbrücken18.
Zwischen Hohem Zorn und Gän-setor, an der breitesten Stelle der Stadt liegt der Ballhausplatz, wo die durch-kommenden Waren gewogen, verzollt und gelagert werden.
Möglicherweise bestehen schon die oder einige Häuser der Oberstadt19.
Die einzige Kirche innerhalb der Stadtmauern ist die Kirche zum Hl. Geist und den beiden Johannes, vulgo Rainkirche20. Sie gehört dem üblichen Typus der Saalkirche an und hat an ihrer Nordseite einen Kirchturm mit spitzpyramidenförmigem Helmdach, der noch stark an romanische Vorbilder erinnert21.
In Oberragen befindet sich um die romanische Unserfrauenkirche herum der Friedhof von Bruneck, dessen Vorhanden-sein die Grabplatte von Jacob Kirchmayr zu Ragen schon um 1300 bezeugt22.
Makrophase 04: 1336–1427Im Nordosten wird Außerragen ausgebaut, im Westen die Neukirche errichtet und die Stadtbefestigung erweitert.
Seit 1356 lässt sich das Brunecker Wappen mit dem Bergfried auf drei Hügeln nachweisen23. Wie man manch-mal hört, soll es sich bei dem Turm auf dem Wappen um den späteren Ursu-linenturm handeln. Dieser wird aber erst mehr als hundert Jahre später er-baut. Die drei Hügel sind die drei wei-ßen Hügel aus permischem Kalk, die in Bruneck und Umgebung einzigartig sind: Wortberg, der Felskopf unter der Neukirche und die später Kühbergl be-nannte Erhebung.
1358 wird das Armen- und Siechen-haus in Außerragen gegründet24, 1381 die dazugehörige Spitalkirche geweiht und dem Patrozinium des Hl. Geis-tes unterstellt25. Spätestens ab diesem Datum ist also auch die Rainkirche in Katharinakirche umgewidmet. Auf allen vier ältesten Bildern ist die kleine Spi-talkirche ohne Turm dargestellt.
Die Unserfrauenkirche ist 1381 im damals neuen gotischen Stil26 umgebaut worden und wird im selben Jahr, wie die Spitalkirche von Bischof Friedrich von Erdingen geweiht27. Es ist eine Saal-kirche mit einem hohen Turm mit Rau-tendach auf viereckiger Basis an seiner Nordseite, einen Turm der Art, wie wir sie von vielen Dörfern auch heute noch kennen. Um die Kirche herum befindet sich immer noch der Friedhof, daneben steht der Widum28. 1413 wird an die Sa-kristei eine Kapelle angebaut29.
Das heutige Rienztor führt also nach Außerragen, wo sich rechter Hand jetzt das obere Badhaus befindet, auf dem
Im Vordergrund links das Spital, gleich rechts daneben die kleine Hl.Geistkirche ohne Turm; weiter rechts, neben der Brücke, das untere Badhaus. Rechts im Hintergrund die Katharinakirche, noch mit nordseitigem Turm. Gleich darunter der Durchgang, der Schloss und altes Rat-haus verbindet.
Brücken: flussabwärts: ganz links der Toten-steg, die Pintabühel-brücke, die Rienzbrü-cke, die Baderbrücke; über den Graben die gedeckte Schlipfbrücke.
11H
eft
DER SCHLERN �
Geschichte Wissenschaft
Bild von 1570 leider nicht genau zu erkennen30. Über eine zweite kleinere Brücke überquert man noch den nörd-licheren der 2 Kanäle, die hier vorbei- und weiter zu den Handwerksbetrieben an den Plarer unterhalb des heutigen Kapuzinerplatzes fließen. Linker Hand liegt vor der Hl.Geistkirche das Gebäu-de des Stadtmetzgers31, gegenüber das Gasthof Weißes Lamm32 und dahinter das Armen und Siechenhaus. Schließ-lich steht ungefähr an der Stelle des heutigen Michael Pacher Hauses das Zollhaus33.
Nur wenige Meter weiter flussauf-wärts sieht man auf dem Bild von 1570 eine weitere Brücke, die zwar hier nur als brauner Strich auszumachen ist, der die Rienz etwa am Fuß des Pintabü-hels quert und wegen der Schadstelle auf dem Bild von 1581 hier auch keine genauere Betrachtung zulässt, auf dem Bild von Matthias Burglechner aller-dings ganz deutlich zu sehen ist. An Brücken über die Rienz gibt es noch den Totensteg, der bei der Hannesmüh-le in Oberragen die Rienz überquert.
Erst, aber immerhin schon ab 1382 ist die Hintergasse bewohnt durch „Gilte aus dem Haus in der hinteren Gasse“34.
Bischof Ulrich von Wien (1396–1417) gibt 141135 Erlaubnis, in der Unterstadt eine Kapelle zur Hl. Drei-faltigkeit, zu bauen, vielleicht in der Fel-senhöhle südwestlich des Hohen Zorns, in dem was einige Jahrzehnte später, nämlich 1427, die Krypta der Neukir-che36 wird, heute Ursulinenkirche. Makrophase 05: 1427 bis 1570In diesem Phasenbündel wird die Oberstadt weiter ausgebaut, der Ansitz Bartlmä von Welsperg erbaut, die Ansitze Ansiedl und Teisegg, und Pfarrkirche sowie dieHannes-mühle erneuert.
Als Turm der Neukirche wird in den folgenden Jahrzehnten ein Stadtturm dazugebaut37 mit einem Rautendach auf achteckigem Grundiss und gedecktem Wehrumgang. Es ist interessant, dass auf allen drei ersten Darstellungen der Turm der Neukirche auf der falschen, nämlich
Oben der Pfef-fergraben ohne Schutzmauer,unten die Verteidigungsan-lage.
Die Neukirche mit dem Turm und den Resten der ursprüng-lichen Stadtmauer im Westen. Dazu die neue Verteidigungs-mauer die mit dazu-gehörigem Torturm einen äußeren Zwin-ger bildet.
der Nordseite dargestellt ist, eine bau-technische Unmöglichkeit.
Da die Stadtbefestigung an dieser Stelle nun durch den Bau der neuen Kirche einen Schwachpunkt hat, wird von einer Stelle der Verbindungsmau-er zur Burg, einige Meter südlich des Gänsetores eine zweite, kleinere Mauer
DER SCHLERN 10 11H
eft
Wissenschaft Geschichte
parallel zur ursprünglichen Stadtmauer nach Norden gezogen und mit einem Torturm versehen. Da man den Platz vor der Neukirche für den neuen Zwin-ger braucht, wird bei dieser baulichen Erweiterung auch dieser Teil des Gra-bens zugeschüttet, die entstehende freie Grünfläche unterhalb der Verbindungs-mauer auf der einen Seite und der heu-tigen Reischacherstraße auf der anderen
Seite als Gärten an die Bürger verpach-tet und verkauft38.
Man wird also davon ausgehen kön-nen, dass die Umbauarbeiten an der Stadt, die von Erzbischof Ulrich Putsch bezeugt sind sich nicht auf eine Erwei-terung der oberen Stadtgasse zum heu-tigen Ragentor beziehen39, sondern auf die Erweiterung der Stadtverteidigung hier im Westen der Stadt.
Fürstbischof Christof von Schrofen-stein (1517–1518) erweitert zum dritten Mal die Burg und fügt die heutige Ring-mauer40, den Zwinger und den oberen Teil des Bergfriedes hinzu41.
Zwischen Ansitz Mayrhauser und heutigem Eltern-Kind-Zentrum be-findet sich in der Peunte das Haus der Beginen, eine ordensähnliche Organi-sation von Frauen, die sich um kranke Menschen kümmern42.
Spätestens jetzt dürfte auch die Ba-derbrücke über die Rienz, heute Ka-puzinerbrücke, existiert haben. Gleich neben dem östlichen Brückenkopf steht das untere öffentliche Badhaus, an-schließend die Hl.Geistkirche und das Armen- und Siechenhaus.
Bruneck hat jetzt 5 Tortürme, 2 Kirchen innerhalb der Stadtmauer, die Neukirche und die in Katharinenkirche umgewidmete Rainkirche sowie die 2 Kirchen außerhalb der Stadtmauer, die neue Hl.Geistkirche und die Unserfrau-enkirche, heute Pfarrkirche. Zu dieser Zeit wird auch die Verbindungsmauer Messerturm – Ragentor erstellt oder ausgebaut. Um bei geschlossenen Stadt-toren von der Stadtgasse zur Burg zu gelangen gibt es außer der Treppe hinter dem Rathaus, heute Gasserhaus, noch eine schmale Passage und eine Treppe zwischen heutigem Athesia Buch Haus und Unterrainer, den Bischofs- oder Unterfraunerschlupf43.
Die Rainkirche ist sowohl auf dem Bild von 1570, als auch auf dem von 1581 in der ursprünglichen Form darge-stellt. Erst Burglechner zeichnet sie 1620 schon als mit auf dem Gewölbe aufge-setzten Turm44. Das Bild vom Hoch-
Der äußere und innere Ursulinentorturm, das Kloster und die Kirche. Nach 1��1.
Von links: Pfeffergra-ben, Bishofsschlupf, rechts im Hintergrund Treppenmauer vom Rathaus zur Burg.
11H
eft
DER SCHLERN 11
Geschichte Wissenschaft
altar der Kapuziner, auf dem auch die Kapuzinerkirche dargestellt ist, dessen Grundstein Fürstbischof Hieronymus Otto Agricola 1626 legt45, zeigt hingegen noch die alte Rainkirche mit norseitigem Turm. Man muss also davon ausgehen, dass der Maler des Kapuzinerbildes eine ältere Vorlage benutzt hat.
Während alle bergseitigen Stadtgas-senhäuser nach Süden zu einen Garten unter den Wortbergfelsen hatten und diese bergesitig mit einer Mauer ab-geschlossen waren, hatte das Rathaus, heute Gasserhaus, als einziges einen bergseitig offenen und von Seitenmau-ern gesäumten Zugang zur Burg.
Interessant ist in diesem Zusammen-hang auch, dass auf dem Bild von 1570 sehr wohl die nördliche Häuserzeile der Hintergasse entlang der Stadtmauer am Graben von den Ursulinen bis zum Flori-anitor existiert, nicht aber die Fortsetzung der Hintergassenhäuser vom Schlipf bis zur Rienz. War hier die Stadtmauer die Nordseite der eigentlichen Stadtgassen-häuser oder hat der Maler diesen nörd-lichen Teil der Hintergasse aus einem un-bekannten Grund weggelassen?
Das nächste Bild, jenes von 1581 zeigt dann die vollständige Häuserzeile der Hintergasse.
In der Oberstadt steht nun auch der von Schlosshauptmann Bartlmä Ritter von Welsberg erbaute Ansitz46, heu-te Palais Sternbach, mit seinen damals zinnengeschmückten Giebeln und den 2 angebauten Halbtürmen oder Rund- und ebensolchen vier übereck ange-brachten Erkern.
Die Pfarrkirche ist hier von der Art des in unserem Raum üblichen Typus der gotischen Saalkirche und hat an sei-ner Nordseite einen Kirchturm mit Rau-tendach auf viereckigem Grundriss. Der Neubau durch den Pfalzner Steinmetz-meister Valentin Winkler von 151547 muss nach dem Neubau des Chores we-gen Geldmangels unterbrochen werden, deshalb präsentiert sich die Kirche noch auf dem Bild von Burglechner 1620 mit dem neuem riesigen Chor am Langhaus
Aus dem Hochaltarbild der Kapuzinerkirche: die alte Rainkirche.
Im Bild von 1��0 fehlt die Hintergassenzeile.
von 1381, das offenbar damals, parallel mit dem Turm schon in gotischem Stil erbaut worden war.
Auf dem Bild von 1570 ist die Kir-che leider hinter dem Turm verborgen.
Um die Kirche läuft eine in einem Rechteck angelegte Begrenzungsmauer, in der sich der Friedhof befindet. In seinem SW-Eck steht die Sebastianskapelle48.
DER SCHLERN 12 11H
eft
Wissenschaft Geschichte
Einige Unklarheiten gibt es mit den halbrunden und runden Türmen an und vor den Stadtmauern. H. Stemberger nennt an der Grabenseite einmal den „teutschen Turm“49, dann noch einen weiteren zwischen Schlipf und Rienz50. Letzteren beobachtet dieser Historiker bei Tinkhauser51, der in einem Stich Bruneck im 13. Jh. nachzeichnet. Dieser Turm dürfte wohl jener sein, den der Ar-chäologe Dr. R. Lunz bei seiner Ausgra-bung des Hölzlgartens 2002 ans Licht brachte und könnte allerdings auch erst bei der Auffüllung des Grabens 1830 ab-gerissen worden sein, so dass J.N. Tink-hauser ihn genauso wie den „teutschen Turm“ noch persönlich gesehen hat und ihn dann in seine Rekonstruktion von „Bruneck im 13. Jh.“ eingefügt hat. Tatsache ist, dass diese beiden Türme weder auf den Bildern von 1570, 1581 noch auf jenem Burglechners zu sehen
sind. Wohl ist aber auf letzterem Bild, und erst hier, der Kälberkopf zu sehen. Es fehlen hier aber immer noch besagte zwei anderen Halbtürme. Auch die Da-tierung des Kälberkopfes ist unklar. H. Stemberger schreibt, dieser Rundturm existierte schon 1527, allerdings unter der Bezeichnung „Pulferturm“52. Wegen des Fehlens des Kälberkopfes auf den ersten zwei Bildern muss es aber frag-lich erscheinen, ob mit „Pulferturm“ wirklich der Kälberkopf gemeint ist. Daraus würde sich dann ergeben, dass der Kälberkopf zwischen 1581 und 1620 entstanden ist, das „Türmle an der Zielstatt“ im Zwinger53, der „teutscher Turm“, und der halbrunde Turm am Hölzl Haus nach 1620, womit noch der „Pulferturm“ zu finden bliebe. Der Bau der halbrunden Türme würde so zeit-lich analog zum Bau vieler Rundtürme in Kärnten auf die Zeit der Türkenbe-drohung weisen.
Interessant ist auch, dass auf dem Bild von 1571 zwei der Tortürme ihre Firste senkrecht zur Stadtgasse haben, so Schlipf- und Gänsetor, die zwei ande-ren, nämlich Ragen und Rienztor haben ihre First parallel zum Verlauf der Stadt-gasse. Das äußere Ursulinentor hat kein Dach, sondern nur einen Zinnenkranz. Messer- und Gaisturm wenden ihre Firs-te ebenfalls senkrecht zur Verbindungs-mauer zwischen Burg und Stadt. Was die Dachformen betrifft, haben nur das Rienztor, der Messer- und der Gaistrum ein richtiges Walmdach, wie wir es heu-te sehen, Gänse-, Schlipf-, und Ragentor hingegen ein einfaches Satteldach.
Während Rienz- und Schlipftor wie richtige Türme aussehen, mit Fenstern im oberen Stockwerk, scheinen Ragen- und Gänsetor wie erhöhte, vielleicht verdoppelte Mauern mit einem Dach, jedenfalls ohne Fenster. Was ist beim Bild von 1581 anders?
Messer- Gais-, Rienz- und hier auch Ragenturm haben nun Walmdächer, diesmal aber alle parallel zu den unter ihnen liegenden Mauern, Schlipf- und Gänsetor bewahren ihr Satteldach, und
Pfarrkirche mit früh-gotischem Langhaus und spätgotischem Presbyterium, rechts der Ansitz von Bartlmä Ritter von Welsperg, heute Palais Stern-bach.
Die oberen Türme mit ihren Walm- und Sat-teldächern und den Firstachsen. Bild 13b: die unteren Türme.
??????Bild fehlt
11H
eft
DER SCHLERN 13
Geschichte Wissenschaft
auch die senkrechte Firstausrichtung zur Stadtgasse.
Bei Burglechner schließlich hat nur noch das Gänsetor ein Satteldach senk-recht zur Stadtgasse, die anderen drei Stadttore tragen jetzt ein pyramiden-förmiges Helmdach, Messer- und Gais-turm ein Walmdach parallel zur Ver-bindungsdmauer, also wie auf dem Bild von 1581. Ob es sich hier um reale, in relativ kurzer Zeitfolge erfolgte Bauver-änderungen handelt, oder um darstelle-rische Ungenauigkeiten ist, ohne paral-lele bautechnische Untersuchungen an den Objekten, nicht feststellbar.
Quellen:Franz-Heinz von Hye, Wappen in Tirol
– Zeugen der Geschichte, Handbuch der tiroler Heraldik, Schlern-Schriften 321, 2004.
Walter Landi/Markus Peskoller, Bruneck, in: Tiroler Burgenbuch, IX. Band Pustertal, 181-210, 2003.
Johann Nepomuk Tinkhauser‘s Brunecker Chronik 1834, Bearbeitet und kommen-tiert von H. Stemberger, 1981.
Hubert Stemberger, Bruneck und Umge-bung, 1988.
Rudolf Tasser, Aus der Geschichte der Stadt Bruneck, in: Brunopolis, Bruneck in Bil-dern 1256-2006, 15 – 50, 2006.
Joseph. Weingartner, Die Kunstdenkmäler Südtirols, Band 1, Eisacktal, Pustertal, La-dinien 1998.
Darstellungen:a) „Stadt Bruneck Anno 1��0“; unbe-kannter Künstler, Privatbesitz.b) „Abcontrafettür der Stadt Braunögg sambt des gerichts Michelspürg negst anrainnenten flöckchen und guettern“; unbekannter Künstler, 1��1; Tempera auf Leinwand, �� x 102 cm; Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Kartographische Sammlung, Inv.-Nr. K IX/��.c) „Gesamtansicht der Stadt von Nor-den“ aus : Matthias Burglechner, Tiroler Adler, 3. Teil, 2. Abt.; um 1�20; Aquarell, �1,� x ��,� cm; Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Inv.-Nr. W 231/�.
a), b), c) auch im Katalog zur Ausstellung vom 2�.0�.200�–1�.10.200� im Stadtmu-seum Bruneck: Brunopolis, Bruneck in Bildern 12��-200�, 200�.
d) Bild vom Hochaltar der Kapuzinerkir-che, z.B. in H.Stemberger, Bruneck und Umgebung, 1���, 11�.
1 H.Stemberger, op.cit., 22. Heute Unterstadt genannt.
2 H.Stemberger, Bruneck und Umgebung, �2. Der Autor bezeichnet die Hannesmühle als schon 120� zum Maierhof Ragen gehörig und Wir kennen das Gebäude heute in seiner go-tischen Form, vor 1�20 entstanden, Datum des Freskos aus der Hand des Malers von St. Sigmund an der Außenmauer; ibidem.
3 Aus dem 12. Jh. ist uns ein Alram von Ragen als Maier bei der Kirche bekannt. Diese Mai-er werden bald Kirchmayr zu Ragen genannt. H.Stemberger, op.cit., S. 22.
� Dem Oberamtspfleger unterstanden Besit-zungen außerhalb der Stadt. H.Stemberger, op. cit., �2 f.
� H. Stemberger, op.cit., �3.� H. Stemberger, op.cit., 2�.� Der alte Name Wortberg oder Wartberg wür-
de darauf hinweisen. Siehe auch Duden, Her-kunftswörterbuch, 1��3, „Warte“: Ort der Aus-schau.
� Erstes bischöfliches Amtshaus und möglicher-weise auch erstes Rathaus der neuerbauten Stadt ist das Haus Zum Hohen Zorn, in das der Bischof 12�� den bischöflichen Amtmann und Richter verlegt. H. Stemberger, op.cit., �� und J.Weingartner, Die Kunstdenkmäler Süd-tirols, Band 1, Eisacktal, Pustertal, Ladinien, 1���, �12. Hier bleibt es dann bis 1���, wo es aus unbekannten Gründen in das spätere Kirchbergerhaus verlegt wurde; H. Stember-ger, op. cit. �0.
� J.Weingartner, op.cit., �2�. Im Jahr 12�1 wird die Burg „castrum Bruneke“ genannt; R. Tas-ser, op.cit., 2� und Walter Landi, Markus Pes-koller, Bruneck, in: Tiroler Burgenbuch , IX. Band, Pustertal, 2003, 1��.
10 1330, unter Erzbischof Albert von Enn (132�–133�); H.Stemberger, op.cit., S. 2�. Dieser er-weitert auch die Burg; J.Weingartner, op.cit., �2�. R.Tasser erwähnt, dass 1333 erstmals von „Bruneck in der stat“ die Rede ist, Zei-chen, dass die Ringmauer um die zwei Häu-serzeilen nun vollendet ist. Zitat „Bruneck in der stat“ aus Franz Huter, Die Anfänge von Bruneck, in: Der Schlern 30, 1���, 2�� f.
11 1331; H.Stemebrger, op.cit. �2.12 Der Name „Schlipf“ für den Torturm des heu-
tigen Florianitors und das anliegende Haus wird laut H. Stemberger, op.cit., �1 auf eine schlüpfrige Stelle zurückgeführt. Die Schlüpf-rigkeit dieser Stelle kommt wohl daher, dass sich hier der Sturz des Runstwassers in den Graben ereignet und so die Stelle immer feucht ist. Das wird auch der Grund dafür sein, dass die Brücke beim Schlipf über den
Anschrift: Carlo Sansone, P. v. Sternbachstr. 20, I-39031 Bruneck
DER SCHLERN 1� 11H
eft
Wissenschaft Geschichte
Graben eine gedeckte Brücke ist. Man muss sich die Brücke ähnlich jener, die am Weg durch die Rienzschlucht zur Lamprechtsburg führt, oder jener bei St.Lorenzen oder der über den Eisack nach Kastelruth, vorstellen.
13 G. v. Pfaundler, „Bruneck“, 1�1�, Feder, Aqua-rell, 12,� x 1�,3 cm; Innsbruck, Tiroler Landes-museum Ferdinandeum, Bibliothek, Inv.-Nr. W �23� in: Brunopolis, ��.
1� In Friesach sind es sogar bis zu � m.1� Siehe Beschreibung der Grabung des be-
kannten Archäologen Dr. R. Lunz im Jahr 2002 in der Ausstellung im Untergeschoss der Hypo Bank Tirol, Hölzl Haus und R.Lunz, Brunecker Stadtgraben im Profil, Dolomiten Nr. 2��, �.11.2002, S. �.
1� Nach freundlicher Mitteilung der Arbeiter, die die Betoninjektionen vornahmen.
1� Der „Gemain Oblath“. Der Brauch besteht vom 1�. bis ins 1�. Jh., wonach eine Datierung des Pfeffergrabens in die Zeit der Fertigstellung der Stadtmauer möglich ist. H. Stemberger, op.cit., �� ff.; R. Tasser, op.cit., 2�.
1� H.Stemberger, op.cit., ��.1� Weingartner stuft sie aber im Umkehrschluss
als jünger als jene der Stadtgasse ein. Letz-tere haben nämlich in ihren Kellerräumen regelmäßige Steinlagen mit ausgestrichenen Mörtelfugen. J. Weingartner, op.cit., �22.
20 13�0 von Niklas Stuck, vielleicht ein Enkel Freydank Stuck des Kämmerers von Erzbi-schofs Bruno (12�0 -12��) gestiftet. H. Stem-berger, op. cit., 11�. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Bischof Andergassen 13�2 oder 13�2 in Längenfeld im Ötztal ei-ne Kirche zur Hl. Katharina von Alexandrien weiht; http://www.similaun.net/laengenfeld2.htm. Freydank Stuck war vermutlich von Bi-schof Bruno aus Schwaben mitgebracht wor-den; H.Stemberger, op. cit., 30 .
21 Einen ganz ähnlichen Kirchturm hat z.B. die Kirche von Untermoi im Gadertal. J. Wein-gartner, datiert die dortige Kirche allerdings in das 1�. Jh.; J.Weingartner, op.cit., �23,
22 H.Stemberger, op. cit., 22 und 110. Erst 1�33 wurde der Friedhof an die heutige Stelle ver-legt.
23 Franz-Heinz von Hye, Wappen in Tirol – Zeu-gen der Geschichte, Handbuch der Tiroler He-raldik, Schlern-Schriften 321, 200�, 13�.
2� Gründer ist Heinrich Stuck, vielleicht ein Bru-der des Nikolaus, des Erbauers der Rainkir-che. H. Stemberger, op.cit., 30. 13�� stirbt die Brunecker Linie mit Leonhard dem Stuck aus, er wird in der Rainkirche begraben. H. Stemberger, op.cit., 120. 13�0 macht Nikolaus Stuck unter Erzbischof Johann Ribi von Lenz-berg (13��–13��) noch eine größere Spende zur Erhaltung der vier Priester der Rain- und Frauenkirche; H. Stemberger in: http://www.provinz.bz.it/mpacher/Geschichte.htm. Wenn die Linie der Brunecker Stuck aber schon zwei Jahre vorher ausgestorben ist, fragt man sich ob dieser Nikolaus Stuck derselbe sein kann, wie der Stifter der Rainkirche. Jedenfalls fühlt man sich hier fast als Zuschauer bei einem Wettbewerb in der Verrichtung „guter Taten“ zwischen verschiedenen Zweigen der Fami-lie.
2� H. Stemberger, op. cit., 120. Die Umwidmung nimmt Erzbischof Friedrich von Erdingen
(13��–13��), vormals Bischof von Chur vor. 13�� verleiht der Erzbischof der Stadt ein Pri-vilegium. Am St.Luzientag schenkt Konrad der Stuck, Inhaber der Herrschaft Buchenstein und vielleicht Bruder des inzwischen verstor-benen Stifters der Spitalkirche Heinrich und der Rainkirche Konrad, der Kirche eine grö-ßere Stiftung. 1��0 stattet Erasmus Söll dann die Spitalkirche mit einem eigenen Benefizi-um aus; H. Stemberger, 30 und 32 f.
2� Der Terminus „gotisch“ scheint hier ange-sichts des Turmes treffender, als das von an-deren als romanisch bezeichnete Langhaus; zu „romanisch“ siehe R.Tasser, op.cit., 3� und seine Fußnote ��), die auf Karl Wolfsgruber, Zur Kirchengeschichte von Bruneck, in: Brun-ecker Buch, Festschrift zur �00-Jahr-Feier der Stadterhebung, Schlern-Schriften 1�2, Inns-bruck 1���, 2�-��, speziell �2, verweist.
2� H.Stemberger, op. cit., 100; J. Weingartner, op.cit., �12. Es stehen hier die Steingusspie-tà von 1�00, das Michael Pacher oder seiner Schule zugeschrieben Kruzifix und die Kreuz-tragung von 1��0 von Hans von Judenburg. Diese drei Werke haben sich bis in die heu-tige Pfarrkirche herübergerettet und sind uns deshab allen bekannt. Vermutlich in diese oder die nächste Phase gehört auch noch das marmorne Muttergottesrelief in einer Nische der W-Wand ober der Rampe des Hannesmül-lerhauses.
2� 13�0 erbaut; H. Stemberger, op. cit., �1. Im selben Jahr erhält die Stadt von Kaiser Karl IV. das Privileg, einen Samstagmarkt ab-halten zu dürfen; R. Tasser, op. cit., 1�. Dort auch Hinweis auf: Südtiroler Landesarchiv, Stadtarchiv Bruneck, Urkunde von 13�0 VIII 13, Urkundenverzeichnis Nr. 33. 13�1 erhält dann die Stadt auch noch die Hohe Gerichts-barkeit durch ein Privileg desselben Kaisers. H.Stemberger, op.cit., 2�.
2� Dazu wird eine „ewige Kaplanei“ gestiftet, später als „Welspergisches Benefizium“ be-kannt; H. Stemberger, op.cit., 31.
30 Im Jahr 1�00 beschließt jedoch der Stadtrat, die inzwischen vernachlässigten Betreiber der Bäder aufzufordern, diese „nach altem Herkommen einzuhalten.“ H. Stemberger, op. cit., 3� f. Man kann also, wie H. Stemberger suggeriert, wohl davon ausgehen, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon ein gewisses Alter hatten.
31 1��� erwähnt als zum „Spitale gehörig“. H. Stemberger, op. cit., ��.
32 Wappentier der Brixner Bischöfe. Das Gasthaus ist erst 1��� erwähnt mit Ja-kob Puol, „Gastgöb zum weissen lammp“; H.Stemberger, op.cit., 2�.
33 Dies bezeichnet die Grenze zum Territorium der Görzer Grafen. Ab 1�00 verfällt dann das Erbe der Görzer wegen Aussterbens der Linie mit Leonhard von Görz an die Habsburger. Dies ist der Grund für den Besuch Kaiser Ma-ximilians I. 1�00 in Bruneck, der einen Lokal-augenschein seiner neuererbten Besitzungen im Pustertal vornimmt.
3� H.Stemberger, op. cit., �2.3� J.Weingartner, op. cit., �1�. Weingartner
meint die heutige Ursulinenkirche von 1�2� gehe auf die ausgebaute ursprüngliche Ka-pelle zurück.
11H
eft
DER SCHLERN 1�
Geschichte Wissenschaft
3� Die Neukirche wird entweder unter Bischof Berthold von Bückelsburg (1�1�–1�2�) oder Ulrich Putsch (1�2�–1�3�) errichtet.
3� J.Weingartner datiert den Turm auf die 2. Hälfte des 1�. Jh. Das würde bedeuten, dass er nach dem Kirchenbau errichtet wurde, viel-leicht in Doppelfunktion als Wach- und als Kirchturm; J. Weingartner, op. cit., �1�. An der S-Seite des Turmes, vom Krippenzimmer aus, sieht man noch einen Fuß des Christopho-rusfreskos des ürsprünglich frei stehenden Turmes.
3� Nach R. Tasser, op.cit., S. 2�, erst im 1�. Jh. Er führt dies auf den fehlenden Bedarf an Grundstücken außerhalb der Stadt zurück; siehe Fußnote 2�, ibidem. Diese Mauer wird dann in der ersten Hälfte des 1�. Jh. abgebro-chen. H. Stemberger, op.cit., S. ��.
3� Das Fresko an der Ostseite des Ragentores da-tiert im übrigen ins Jahr 13��; H.Stemberger, op.cit., ��. Die Kreuzigungsszene wurde also während der Amtszeit von Erzbischof Fried-rich von Erdingen (13��–13��) erstellt.
�0 Nach R. Tasser, op. cit., S. 20, wird ein Groß-teil der Zwingermauer um die Burg von Bishof Albert von Enn (132�–133�) errichtet.
�1 J. Weingartner, op.cit., S. �2�.�2 Ab 1�30 bezeugt. H. Stemberger, op. cit., 32.�3 Freundliche Mitteilung von Herrn Erich Holzer
aus St. Sigmund.�� H. Stemberger erwähnt in op. cit., S. 11�: „Im
Jahre 1��0 übernahm der Brunecker Bürger Stephan von Wenzl die Verpflichtung den ins Stocken geratenen Turmbau auf eigene Ko-sten weiterzuführen. [...] Herr von Wenzl [...] ließ den Turm so auf das Gewölbe setzen, daß er in seiner ganzen Schwere darauf ruht.“ Da der Turm in dieser Form schon �0 Jahre vorher bei Burglechner dargestellt wird, kann dies wohl nicht auf den Plan des Herrn von Wenzl zurückgehen; er muss älteren Datums sein.
�� Nach J. Weingartner, op.cit., �1�, ist es das Jahr 1�2�, Weihe: 1�31.
�� Um 1�00. H. Stemberger, op. cit., S. �1. �� J. Weingartner, op. cit., �12.�� Von Ulrich von Gebenstorf 1��� erbaut; H.
Stemberger, op.cit., S. 112. Sein Grabstein ist der erste, wenn man vom Widum zum Fried-hof geht. Allerdings gibt H. Stemberger, op. cit., S. 31, auch 1�0� als Gründungsdatum an.
�� Den er als mit dem „Bau des Klosters abge-brochen“ vermutet; H. Stemberger, op.cit., S. �2.
�0 H. Stemberger, op.cit., S. �2. �1 J. N. Tinkhauser, Brunecker Chronik 1�3�, Be-
arbeitet und kommentiert von H. Stemberger, 1��1, ��. Da die Ansicht den Blick von Nor-den her zeigt, sieht man nicht, ob Tinkhauser auch das Türmle an der Zielstatt in das 13. Jh. zurückdatiert, das ebenfalls auf den Bildern von 1��0 und 1��1 fehlt, wo die Ansicht aus Nordwesten wiedergegeben wird.
�2 H. Stemberger, op.cit., �2. Hier schreibt der Historiker, dass man in den Urkunden diesen Turm 1��1 noch einmal als „Pulferturm am Kälberkopf“ antrifft. Stemberger nimmt an, dass mit Kälberkopf, so wie mit Schweins-kopf, eine Wasserwehre gemeint ist. Dadurch kommt er wohl zum Schluss, dass der Name
Kälberkopf von der Wiere auf den Turm über-gegangen ist. Demnach müsste Kälberkopf der Name einer Wasserwehre oder des Was-serrrunstes zum Schlipf sein. Leider gibt der Autor keine Vergleichsbeispiele an.
�3 Der Halbrundturm an der Nordostecke der Burgzwingermauer ist von Erzbischof Ul-rich Putsch (1�2�–1�3�) errichtet worden; R.Tasser, op.cit., 3�, Fußnote �0 und W. Landi und M. Peskoller, op.cit., 1�2. Vom Bau dieses Halbrundturmes an der Burg kann man nicht notgedrungen darauf schließen, dass dieser geistliche Würdenträger auch das „Türmle an der Zielstatt“, d. h. an der Raingasse, errich-tet hat. Es würde zwar Sinn machen, diesen Bau als Teil der von diesem Erzbischof vor-genommenen Befestigungsmaßnahmen um die Neukirche zu betrachten, doch findet sich davon keine Spur auf den vier hier betrach-teten Darstellungen. Eine Datierung dieses Rundturmes müsste man also ziemlich spä-ter, vielleicht erst nach 1�00 ansetzen. Mit der oben erwähnten Datierung von 13�� des Freskos von Ulrich Svaigel an der Außenseite des Ragentores wird die Vermutung hinfällig, dieses Tor sei von Ulrich Putsch im Zuge der Erweiterung der Stadtgasse erbaut worden. Dr. R. Tasser erwähnt in op.cit., 30, dass Bi-schof Ulrich Putsch „die Stadtgasse verlän-gert und zwei neue Stadttore angelegt“ habe, gibt aber leider seine Quelle nicht an. Aus der Datierung des Ragentorfreskos und auch den weiter oben erwähnten Baumaßnahmen, einmal schon früher zur Erhöhung der Rienz-torbrücke und zum anderen zur Verbesserung der Stadtverteidigung im Westen durch Ulrich Putsch ergibt sich zwingend, dass mit Verlän-gerung der Stadtgasse nicht eine solche nach Osten gemeint sein kann, sondern nur die nach Westen.