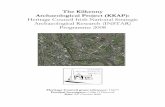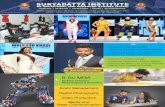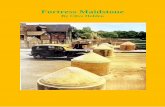Annual Report of the Austrian Archaeological Institute 2014
Transcript of Annual Report of the Austrian Archaeological Institute 2014
HerausgeberÖsterreichisches Archäologisches InstitutFranz Klein-Gasse 1A-1190 Wienwww.oeai.at
© 2014 ÖAI
Für den Inhalt verantwortlich: Sabine LadstätterRedaktion: Barbara Beck-BrandtSatz und grafische Gestaltung: Andrea SulzgruberDruck: Holzhausen Druck GmbHAlle Abbildungen, sofern nicht anders angegeben: © Copyright by ÖAI.ISSN 2309-1207
Die in den Texten verwendeten personenbezogenen Ausdrücke beziehen sich gleichermaßen auf Frauen und Männer.
Das Österreichische Archäologische Institut ist eine nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
3
Zentrale Wien
Direktorin: Priv.-Doz. Mag. Dr. Sabine LadstätterStellvertretender Direktor: Univ.-Doz. Mag. Dr. Stefan GrohVerwaltungsleiterin: Ulrike Lang
Wissenschaftliches Personal
Dr. Maria Aurenhammer Mag. Dr. Lisa Peloschek, MSc (FWF)Mag. Barbara Beck-Brandt Mag. Chiara Reali (FWF/TRF)Mag. Julia Dorner (TRF) Mag. Laura Rembart (FWF)MMag. Serpil Ekrem (OeNB/TRF) Mag. Konstantia Saliari (FWF/TRF)Dr. Karl Herold Prof. Dr. Peter Scherrer (karenziert)Mag. Susanne Heimel (TRF) Dr. Florian Schimmer, M.A. (FWF)Mag. Dr. Christoph Hinker Mag. Ulrike Schuh (TRF)Mag. Florian Jaksche Mag. Helmut Schwaiger (FWF/TRF)Mag. Denise Katzjäger (FWF) Mag. Dr. Helga SedlmayerPriv.-Doz. Mag. Dr. Michael Kerschner Mag. Dr. Martin SeyerMag. Thomas Koch (FWF/Praktikum) Priv.-Doz. Mag. Dr. Martin SteskalDr. Andrew Leung (TRF) DI Gilbert WiplingerMag. Daniel Oberndorfer (TRF) Mag. Banu Yener-Marksteiner (TRF)Mag. Dr. Andrea Pülz (FWF) Mag. Lilli Zabrana, MSc
Wissenschaftliche Hilfskräfte
Klaus Freitag (TRF) Sandra Mayer (TRF)Mag. Astrid Hassler (FWF) Romina Weitlaner (TRF)
Nichtwissenschaftliches Personal
Mag. Dr. Isabella Benda-Weber Filiz Öztürk, MAMaria Bodzenta Cornelia Panzenböck, BAEbru Garip (Lehrling) Katharina Parisot (Lehrling)Mag. Katharina Hasitzka, MSc Mag. Astrid PircherDipl.Ök. Gudrun Krakhofer Melek Ündemir (TRF)
David Zänger (Lehrling)
Praktikant(inn)en
Mag. Jessica Erci, MSc Mag. Dr. Alexandra von MillerIsabella Greisinger, MSc, BSc Walter SaibelPhilip Haupt Mag. Reinhold SchachnerDimitri Jilin Jasmin Scheifinger, BAMag. Manuela Leibetseder Mag. Luise SchintlmeisterDI Petra Mayrhofer Mag. Bettina Schwarz, BAMag. Barbara Wolf
5
I. Forschungen In der TürkeI
i.1 ephesos
Die Grabungskampagne in Ephesos fand von 3. März bis 1. Dezember 2014 unter der Gesamtleitung von S. Ladstätter und der Stellvertreterinnen Ö. Vapur sowie F. Öztürk statt. Die Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 22 Nati-onen betrug 195, im Grabungshaus wurden 8.320 Übernachtungen verzeichnet. Vonseiten der türkischen Regierung wurden als Kommissare Herr Nejat Atar und Herr Kamuran Akyüz entsandt. Die Administration der Grabung lag in Händen von H. Schwaiger, die Koordination der privat finanzierten Projekte übernahm A. Pircher. Wie schon in den letzten Jahren wurden die geodätischen Arbeiten von C. Kurtze unter der Mithilfe von D. Jilin und die fotografische Dokumentation von N. Gail aus-geführt.
Der Schwerpunkt der Grabungskampagne lag einerseits auf Ausgrabungen auf dem Çukuriçi Höyük und in der spät antiken Residenz südlich der Marienkirche, ergänzt durch kleinere Grabungsprojekte im Hamam 4 und im Serapeion. Verstärkt wurden die Feldforschungen im Bereich der Bauforschung. Die Prospektion um-fasste Geophysik (Georadar, Geoseismik und Geomagnetik), Paläogeografie und den Oberflächensurvey.
Traditionellerweise haben Restaurierung und Konservierung in Ephesos einen hohen Stellenwert. 2014 gelang der Abschluss der Restaurierungsarbeiten am sog. Hadrianstempel, die Arbeiten im Hanghaus 2 wurden weitergeführt, die res-tauratorische Analyse im Serapeion abgeschlossen und die Mauerkonsolidierung fortgesetzt.
Durch den Ausbau der Labors im Grabungshaus können analytische Untersu-chungen nun verstärkt vor Ort durchgeführt werden. Dazu zählt die archäozoologi-sche Auswertung von Knochenmaterial wie auch die mikroskopische Analyse von Holzkohle.
Ephesos, Grabungsflächen 2014 (Plan C. Kurtze)
Jahresbericht 2014
6
I.1.1 Grabungen
I.1.1.1 Çukuriçi HöyükDie vom ERC (»Prehistoric Anatolia« [Projektnr. 263339]) geförderten und von OREA/Österreichische Akademie der Wissenschaften mit Unterstützung des ÖAI durchgeführten Ausgrabungen auf dem Çukuriçi Höyük wurden 2014 in den Schnit-ten M1 und N6 fortgesetzt, wobei Schnitt M1 Richtung Süden erweitert wurde, um das frühbronzezeitliche Gebäude 14 komplett freizulegen.
Die Arbeiten in Schnitt M1 konnten insofern abgeschlossen werden, als die wichtigsten Fragen geklärt und Kontexte aus verschiedenen Phasen ausgegraben wurden. Die Ausgrabungen in Schnitt N6 sind hingegen nicht abgeschlossen. Zwar wurden ältere neolithische Siedlungsphasen erreicht (Phasen ÇuHö XI und XII), deren flächige Ausgrabung würde allerdings noch weitere Zeit benötigen. Die äl-teste Phase ÇuHö XII konnte zudem nur in einem sehr kleinen Ausschnitt freigelegt werden.
Die Analysen zur Gesamtstratigrafie des Tells wurden abgeschlossen, eben-so konnten komplexe stratigrafische, sedimentologische und geomorphologische Prozesse des Hügelaufbaus geklärt werden. Für die abschließende absolute und relative Chronologie aller Siedlungsphasen sind die Ergebnisse der Radiokarbonda-tierungen und ihrer Modellierungen sowie der Fundauswertung abzuwarten.
Schnitt M1 umfasste insgesamt 349 m² mit 13 × 22 m und eine Erweiterung Richtung Süden von 9 × 7 m. Die frühbronzezeitliche Bebauung der Phase ÇuHö IV ist nun vollständig freigelegt und konnte in ihren verschiedenen Erneuerungen und Umbauten abschließend untersucht werden. Noch offene Fragen der Bebauungs-abfolge wurden anhand eines detaillierten Bauphasenplans dokumentiert. Durch die Erweiterung des Grabungsschnitts Richtung Süden konnten auch die Räume 43 und 55 ausgegraben werden, womit auch das Gebäude 14 vollständig erfasst wurde. Es handelt sich um einen – zumindest in der letzten Bauphase – dreigliedrigen Bau von rund 13 × 5 m, der aus einem zentralen Hauptraum mit je einem kleineren Anbau an seiner Nord- und Südseite besteht. Die Ausgrabung der übereinanderliegenden Nutzungshorizonte in Gebäude 14 brachte u. a. mehrere neue Öfen zur Metallver-arbeitung sowie eine große Muschelgrube zum Vorschein. Zu den Öfen wurden verschiedene Fußböden freigelegt und dokumentiert.
Ephesos, Çukuriçi Höyük. Sondagenplan mit den untersuchten Flächen M1 und N6 (Plan M. Börner)
Zentrale Wien
7
Ephesos, Çukuriçi Höyük. Die frühbronzezeitliche Bebauung (Foto N. Gail)
Ephesos, Çukuriçi Höyük. Neolithische Strukturen (Foto N. Gail)
Die Ausgrabungen der neolithischen Reste konzentrierten sich 2014 auf ver-schiedene Areale mit Fragestellungen zu detaillierten Abfolgen innerhalb einzelner Häuser ebenso wie zu Abfolgen mehrerer Siedlungsphasen und deren komplexen Ablagerungsprozessen.
Im Bereich der übereinanderliegenden Hauskomplexe 6 und 12 konnten Kom-plex 6 vollständig ausgegraben und wesentliche Elemente der Bauabfolgen der Komplexe 12, 6 und 21 geklärt werden.
Schließlich wurden die Quadranten I–O/52 – 54 als Tiefschnitte intensiv weiter ausgegraben, um die nächstälteren Siedlungsphasen, ÇuHö XI–XII, freizulegen und
Jahresbericht 2014
8
den gesamten Tell-Aufbau studieren zu können. In diesem Areal konnte die nächstältere Siedlungsphase ÇuHö XI (älter als 6600 v. Chr. [?]) komplett freigelegt werden.
Schließlich wurde in den Quad-ranten I 52 – 54 weiter abgetieft, um die älteste Besiedlungsphase des Çukuriçi Höyük auf dem gewachse-nen Boden zu finden. Dabei wurden zunächst mehrere übereinanderlie-gende Gruben (vermutlich ÇuHö XI) ausgegraben, die vor allem mit Mu-scheln und Knochen verfüllt waren. In diesem kleinen Areal von 2 × 6 m wurde schlussendlich auch die erste Siedlungsphase ÇuHö XII erreicht. Die Oberfläche der ältesten Phase
ÇuHö XII konnte nur in diesem kleinen Ausschnitt freigelegt und dokumentiert wer-den. Aufgrund der Ergebnisse aus den zuvor durchgeführten Bohrungen ist anzu-nehmen, dass die anthropogenen Ablagerungen dieser ältesten Ansiedlung in rund 10 cm Höhe auf dem darunterliegenden gewachsenen Boden erhalten sind.
Die Bearbeitung der Keramik hatte 2014 mehrere Schwerpunkte. Im Fokus der neolithischen Keramikaufnahme standen geschlossene Komplexe der Siedlungs-phase ÇuHö X. Eine vorläufige morphologische Typologie und makroskopische Charakterisierung der Keramikfabrikate wurde erstellt. Die Keramikscherben der älteren Phase ÇuHö XI wurden gesichtet und statistisch ausgenommen, ausgewähl-te Ensembles und Stücke gezeichnet und für Publikationen digital aufgenommen.
Parallel dazu konnten die Überprüfung und noch fehlende Dokumentation (Typen und Waren) des frühbronzezeitlichen Ensembles aus Raum 1 der Phase ÇuHö III abgeschlossen werden. Dazu wurden die 384 charakteristischen Fragmente unter-sucht und dokumentiert. Die Aufnahme aller frühbronzezeitlichen Fragmente von Pithoi konnte ebenfalls beendet werden.
Insgesamt wurden 676 Kleinfunde in die ERC-Projektdatenbank aufgenommen, weitere 104 Kleinfunde wurden korrigiert oder ergänzt. Alle Objekte wurden in Ka-tegorie, Material, Maßen und Gewichten beschrieben und ein großer Teil auch ge-zeichnet und fotografiert.
Insgesamt wurden 211 Perlen aus Stein, Keramik und Muscheln aufgenommen und untersucht. Die überwiegende Mehrheit dieser neolithischen Perlen ist aus Stein hergestellt, vor allem aus graugrünem Schiefer. Die Tonperlen sind von zy-lindrischer, runder oder bikonischer Form, Muschelperlen entweder scheibenförmig oder naturbelassen mit einfacher Durchlochung.
Während der Kampagne 2014 wurden 34 neue metallurgische Artefakte gefun-den. Dazu gehören ein Gussfragment, Lehmziegel eines Ofens zur Metallprodukti-on, zwei Dolche bzw. deren Fragmente, eine Pfeilspitze, Meißel, Nadeln, Halbfer-tigprodukte und ein Bleifragment.
Untersucht wurden während der Kampagne 2014 geschlagene Steingeräte aus verschiedenen Ensembles der Phasen ÇuHö IX–XII aus Schnitt N6. Ein wesentli-cher Fokus lag besonders auf der typologischen und technologischen Varianz aus Kernen, Spitzen und Kratzern. Rund 2.500 Artefakte wurden in die ERC-Daten-bank eingegeben, Teile davon gezeichnet und auch fotografiert. Bereits beprobte und analysierte Geräte aus Obsidian wurden mittels pXRF (Röntgen fluoreszenzspektrometer) gemessen, um die Methode für zukünftige zerstörungsfreie Untersu-chungen zu testen. Die gesamte Lithik aus den neolithischen Grabungen von 2014 in Schnitt N6 umfasst rund 4.500 Stück, wovon rund 80 % Obsidian, 19 % Feuerstein und rund 1 % Quarz darstellt.
Ephesos, Çukuriçi Höyük. Frühbronzezeitliche Kera-mik (Foto N. Gail)
Zentrale Wien
9
Ausgewählte Ensembles an geschlagenen Steingeräten neolithischer Zeitstel-lung aus anderen Rohstoffen als Obsidian wurden untersucht, um eine exakte Roh-materialkategorisierung vornehmen zu können. Dafür wurden 634 Artefakte makros-kopisch und mikroskopisch analysiert. Um die notwendige Basis für geochemische Untersuchungen zu schaffen, wurde dafür die »Multi Layered chert sourcing ap-proach (MLA)« angewandt.
Weiters wurden über 12.400 Knochenfunde mit einem Gewicht von mehr als 57 kg aufgenommen. Die Funde stammen hauptsächlich aus dem neolithischen Hauskomplex 3 und den darunterliegenden Befunden. Etwa 40 % des Materials ist nicht genauer zu bestimmen. 35 % stammen von Haustieren und etwa 3 % von Wildtieren, rund 17 % sind Muscheln und Schnecken, der Rest Fische, wenige Vögel und Seeigel.
Bei der Grabung 2014 konnten vor allem aus Schnitt M1 (Spätchalkolithikum, Frühe Bronzezeit) gut erhaltene und reichhaltigere Holzkohleproben geborgen und bestimmt werden.
Projektleitung: B. Horejs (OREA/ÖAW); Mitarbeit: E. Baysal, M. Börner, S. Bosch, M. Brami, M. Brandl, T. Bratschi, C. Britsch, M. Bundschuh, S. Eder, B. Eichhorn, E. Endarova, U. Ermiş, A. Galik, I. Gatsov, K. Güler, D. Gyurova, H. C. Küchel-mann, M. Martinez, M. Mehofer, B. Milić, D. Moser, P. NedelchevaMegalla, N. Nol-de, F. Ostmann, A. Petrović, M. Röcklinger, J. Schlegel, H. C. Schwall, T. Urban, L. Vangelov, R. Yazıcı. Kooperationen: Veterinärmedizinische Universität Wien, Ins-titut für Anatomie; Vienna Institute for Archaeological Science (VIAS); Universität Wien; Technische Universität Wien, Institute of Chemical Engineering; Martin-Lut-her-Universität Halle-Wittenberg, Institute for Geosciences; Johann-Wolfgang-Go-ethe-Universität Frankfurt a. M., Archaeobotanic Studies; Curt-Engelhorn-Zentrum Mannheim und Universität Tübingen; T. Urban und Partner (Birkenwerder, D); Kno-chenarbeit (Bremen, D); Universität Köln, Radiocarbon Laboratory; New Bulgarian University, Sofia, Department of Archaeology
I.1.1.2 ArtemisionIn der Kampagne 2014 wur-den zwei Sondagen mit einer Länge von insgesamt etwa 22 m und einer Breite von ca. 2 m angelegt (Sondage 1/14 und 2/14).
An der östlichen Seite des festgelegten Arbeitsbereichs (Sondage 1/14), wo sich an-hand älterer Grabungsunter-lagen eine Hallenarchitektur vermuten ließ, wurde ein etwa 10 m langer (West-Ost) und 2 m breiter (Nord-Süd) Schnitt angelegt. Nach dem Abtrag der obersten Schicht, die im Wesentlichen aus von den älteren Ausgrabungen hierhin verlagertem Gra-bungsaushub sowie aus vom Hang abgerutschtem Material bestand, wurde eine mächtige Alluvialschicht ange-troffen. Etwa 1 m unter dieser Alluvialschicht kam ein aus großen Bruchsteinen und vielen Spolien bestehendes, Nord-Süd gerichtetes Trockenmauerwerk zutage. Diese Mauer ist sehr unregelmäßig gesetzt und war nur noch in einer einzigen
Ephesos, Artemision. Alluviale Ablagerungen im Areal des Artemisions (Foto N. Gail)
Jahresbericht 2014
10
Lage erhalten. Dieses Mauerwerk befindet sich genau an der Stelle, an der auch die erwähnte Halle zu vermuten wäre.
Die Grabungsarbeiten wurden daraufhin auf der westlichen Seite der Sondage fortgeführt. Hier wurde unter der Alluvialschicht bzw. unter der Mauer eine Schicht angetroffen, die nur bis ca. 1,30 m westlich der Mauer reichte. Am Profil unter der Mauer sind Gruben zu erkennen, in 0,83 m Abstand voneinander, aber auf gleicher Achse befindlich und zur selben Schicht gehörend. Nachdem die Auffüllschicht, die sich unter besagter Schicht befand, und in der vermischtes Material zu finden war, ausgegraben worden war, konnte ein nur fragmentarisch erhaltener Laufhorizont freigelegt werden. Unter diesem wiederum befand sich eine Ausgleichsschicht, aus der einige Fragmente kaiserzeitlicher Keramik geborgen werden konnten. Nach Ab-trag dieser Ausgleichsschicht wurde ein Fußbodenniveau erreicht. Nach sehr frag-mentarisch erhaltenen Marmorteilen und erhaltenen Abdrucken von Marmorplatten zu schließen, ist hier von einem Plattenboden auszugehen. An der östlichen Seite dieses Bodens konnte auch dessen Substruktion stellenweise freigelegt werden. Dabei kam eine Unterkonstruktion zutage, die aus einer Estrichschicht mit einer Steinlage aus kleinen Bruchsteinen und Marmorbruchstücken sowie einer Lage Zie-gelmehl (?) besteht, auf der die Marmorplatten gelegt waren.
Anschließend an die Ausgrabungen von 1994 wurde östlich der Sekos-Funda-mentmauer, Richtung Westen verlaufend, ein 2 m (Nord-Süd) breiter und 12 m (Ost-West) langer Schnitt (Sondage 2/14) angelegt. Hier konnte festgestellt werden, dass der Tempel in diesem Bereich von wiederholten Steinberaubungen betroffen gewesen war, wozu offenbar tiefe Gruben angelegt und später wieder aufgefüllt worden waren, sodass innerhalb der aktuellen Sondage nur noch wenige ungestörte Schichten anzutreffen waren.
Nachdem eine dünne Humusschicht abgetragen worden war, wurde eine Schot-terschicht, die von Terrainausgleichen voriger Ausgräber herrührt, freigelegt. Unter dieser wiederum wurde eine sich im Laufe der Zeit abgelagerte Erdschicht ergra-ben. An der Ost- und Westseite der Sohle dieser Schicht befand sich eine deutliche Konzentration größerer Spolien und unbearbeiteter Steine. Darüber hinaus konnte an der Westseite ein eiserner Opferspieß geborgen werden. Genau an dieser Stelle ist auch eine Steinsetzung am Nordprofil zu erkennen, die aus einer Spolie und drei weiteren Bruchsteinen besteht, aber bislang nicht näher interpretierbar ist.
Ephesos, Artemision. Römische Hofpflasterung östlich des Artemistempels (Foto N. Gail)
Zentrale Wien
11
An der östlichen Sondagenseite fand sich ein aus größeren Bruchsteinen und Spolien trockengebauter, quadratischer (1 × 1 m) Brunnen. Um die Brunnenstruktur im Ganzen freilegen zu können, wurde die Sondage zunächst an ihrer Nordseite um 3 m² erweitert. Da der Brunnen und die dazugehörige Baugrube den gesamten Bereich, in dem sonst Mauerstrukturen vom Ostende des Artemistempels zu erwar-ten gewesen wären, stören, können an dieser Stelle keine weiteren Erkenntnisse zur Tempelarchitektur erwartet werden. Im Zuge des Aushubs der Brunnenverfül-lungen wurden mittelalterliche Keramik, ein möglicherweise zur Oberkonstruktion des Brunnens gehöriges Holzbrett sowie ein Eisenfragment, das sich unter der Brunnenmauer fand, geborgen. Unter dem Steinkranz des Brunnens, der an Süd , Ost und Westseite 0,60 – 1,10 m Tiefe erreichte und an der Nordseite nur noch aus einer Lage bestand, konnte die einstige Brunnen-umfassung, die aus Holzbalken bestand und an allen vier Seiten erhalten ist, dokumentiert werden.
Östlich des Brunnens wurde ein von der Brunnenbaugrube teilweise gestörtes Laufniveau freigelegt, welches wiederum an seiner Westseite von einer großen Grube gestört worden war. Die Störung dürfte mit Stein-beraubungen zu erklären sein. Aus der Verfüllung dieser Grube wurde neben Keramikscherben, die von ihrer Zeitstellung von der Archaik bis in das Mittelalter reichen, eine in das 7. Jahrhundert v. Chr. zu datierende Statuette (Pothia Theron aus Elfenbein) geborgen. Hinzu kommen ein gelötetes Elektronobjekt und ein ebenfalls in das 7. Jahrhundert zu da-tierendes Miniaturgefäß aus Glas.
Unter dem durch den Brunnenbau gestörten Laufniveau konnten eine homogene Ablagerungsschicht und darunter ein weiteres Fußbodenni-veau, welches das insgesamt älteste in der Sondage darstellt, freigelegt werden. Dieser Boden, der aus kleinen Steinen besteht und auf dem sich eine Art (dünner) gelber Lehmverputz (?) befindet, zieht möglicherweise auch weiter unter die Grube. Hier sind in zwei Bereichen erhaltene Teile des Bodens zu erkennen gewesen. Zwischen diesen wurde zudem noch eine Steinsetzung, die eventuell zu dem Boden gehörte und als Unterbau diente, freigelegt. Der Boden ist an der nördlichen Seite durch eine Schuttschicht und an der Westseite von der oben genannten Grube gestört.
Ephesos, Artemision. Osmanischer Brunnen (Foto N. Gail)
Ephesos, Artemision. Keramikfragment (Foto N. Gail)
Jahresbericht 2014
12
An der westlichen Seite von Sondage 2, an Stellen, wo sich Fundamente der östlichen SekosMauer befinden sollten, ist eine andere Entwicklung zu beobach-ten. Hier ist auf den erhaltenen Spuren des Fußbodens, wo sich die Fläche ab-senkt, eine aus kleinen Bruchsteinen, Keramik und Ziegeln bestehende Verfüllung festzustellen gewesen. Diese Verfüllung diente offensichtlich der Nivellierung oder dem Unterbau für den jüngeren, befestigten Boden, der sich darüber befindet. Der aus befestigten Bruchsteinen und Ziegelbruchstücken bestehende Boden ist nur in einem kleinen Bereich erhalten geblieben, da er wiederum von obengenannter Grube gestört wurde. Etwa auf diesem erreichten Niveau des älteren Bodens sind die Grabungsarbeiten eingestellt worden.
Projektleitung: S. Ladstätter, M. Kerschner; Mitarbeit: N. KulBerndt, A. Muşat, M. Streinu, R. Yazıcı
I.1.1.3 SerapeionIn der Kampagne 2014 wurden am und im Serapeion drei Grabungsschnitte (Son-dagen 01, 02 und 03) angelegt.
Sondage 01 wurde am Fuß der Freitreppe, an der nordöstlichen Ecke des Tem-pels festgelegt. Auf einer Fläche von etwa 5 × 3 m war es Ziel, die Unterkante und den Erhaltungszustand der Treppenstufen sowie deren Übergang zu einer möglichen Steinpflasterung vor dem Tempel zu dokumentieren. Die Grabungsar-beiten zeigten rasch, dass es in diesem Bereich keinen zu erfassenden Fußboden aus Stein gab. Etwa 0,5 m unter dem heutigen Gehniveau wurde in der nördlichen Hälfte der Sondage 01 das anstehende Felsgestein erfasst. Der natürliche Felsen wies deutlich sichtbare Bearbeitungsspuren auf, die auf eine Nutzung als Steinbruch deuten. Entlang der Treppe war dieser anstehende Felsen nicht erfasst worden, da-für wurde eine massive Aufschüttung durch Bruch- und Abschlagsteine festgestellt, die noch unterhalb des Treppenfundaments weiterläuft.
Mit Sondage 02 wurde versucht, entlang der untersten Stufen der Schautreppe einen zentralen, von der Tempeltür zum Eingang des Hofs im Norden führenden Weg festzustellen. Die Fläche der Sondage wurde mit 7 m² entlang der Treppe abgesteckt. Auch hier wurden keine Hinweise für einen ehemaligen Steinboden oder eine befestigte Straße gefunden. Wie schon in Sondage 01 lag etwa 0,5 m unter dem heutigen Gehhorizont das anstehende Festgestein. Die Oberkante des Felsgesteins korrespondierte mit der untersten Stufe der Schautreppe des Tempels und schloss fast genau an diese an.
Ephesos, Artemision. Elektronblech (Foto N. Gail)
Ephesos, Artemision. Miniaturkrug aus Glas (Foto N. Gail)
Zentrale Wien
13
Die Sondage 03 wurde an der Nordostecke der Cella angelegt, um die genauen Ausmaße und den Verlauf der Kanalrinnen innerhalb der Cella und deren Verbin-dung zu den Wandnischen zu erfassen. Es zeigte sich, dass der Kanal auf Höhe des Zugangs zum östlichen Korridor nach Westen abbog und schließlich unter dem Portal des Tempels nach Norden entwässerte.
Parallel zu den Grabungsarbeiten wurden der noch antik erhaltene Boden inner-halb des Tempels sowie auch die Oberkante der Tempelmauern und der Cellawände gründlich gereinigt.
Der Abtransport und das Versetzen der in der Cella aufgestell-ten Architekturteile wa-ren notwendig, um den Cellaboden und den östlichen Korridor voll-ständig fotogrammet-risch erfassen zu kön-nen. Die 38 Bauteile des Tempels wurden systematisch und für spätere Bauuntersu-chungen gut zugäng-lich östlich des Sera-peions aufgestellt.
Im Verlauf der Reinigungsarbeiten wurden mindestens drei nicht mehr vollstän-dig erhaltene und z. T. schon zerstörte Ziegelplattengräber vorgefunden. Zwischen diesen klar als christlich anzusehenden Gräbern wurden die Umrisse von fünf wei-teren Gräbern erkannt. Alle diese Gräber waren in Ost-West-Orientierung in den antiken Fußboden eingesetzt worden.
Projektleitung: S. Ladstätter; Mitarbeit: T. Koch, R. Yazıcı
Ephesos, Serapeion. Blick auf Freitreppe und Pronaos mit den Son-dagen 2014 (Foto N. Gail)
Ephesos, Serapeion. Gewachsener Fels mit Steinbruchspuren (Foto T. Koch)
Jahresbericht 2014
14
I.1.1.4 Spät antike Residenz südlich der MarienkircheDie Ziele der auch 2014 von der Gesellschaft der Freunde von Ephesos (GFE) finanziell unterstützten Grabungen in der spät antiken Residenz waren die Klärung des östlichen Abschlusses des Komplexes sowie der Funktion dieses Bereichs. Aufgrund von in den Jahren 2011 – 2013 freigelegten Befunden waren nähere Auf-schlüsse für die Nachnutzung des Gebäudes und dieses Areals zu erwarten. Des
Weiteren sollte durch die Freilegung von Räumen im Nordwesten des Baus das Verhältnis zwischen den Wirtschaftsräumen, die sich zur Stra-ße im Norden hin öffneten, und dem Inneren des Hauses geklärt werden.
Basierend auf den Ergebnissen der geophysikalischen Messungen wurde im südöstlichen Bereich des Komplexes eine Sondage mit den Maßen 18 × 20 m angelegt (Son-dage 1/14). Nach dem Entfernen der rezenten Schichten wurde dieser Gra-bungsbereich raumweise in mehrere Sondagen untergliedert (So 4 – 8/14, So 10 – 11/14).
Im Bereich der Sondage 2/14 (9 × 5,50 m) waren bereits 2013 alle Schichten bis auf die Oberkante des Versturzes und der teilweise sicht-baren Mauerkronen abgenommen worden. Vereinzelt waren bereits da-mals Mauerabschnitte in Sturzlage zu erkennen. Das Grabungsareal liegt unmittelbar südlich der Pressanlage (Raum 16) und ist mit dieser durch eine Türöffnung verbunden.
Die ältesten Befunde gehören der Nutzungsphase des spät antiken Hau-ses an. Es handelt sich um einen aus massiven Marmorplatten gebildeten
Boden. Teilweise lassen sich hier Reparaturen aus anderem Material (z. B. Kalk-tuffplatten) beobachten. Durch ein oder mehrere Erdbeben senkte sich der Mar-morbelag in den einzelnen Räumen. Lediglich in den Randbereichen der gut funda-mentierten Mauern verblieben die Marmorplatten auf ihrem ursprünglichem Niveau. In Raum 17a fanden sich Reste von Ziegelaufmauerungen entlang der Wände, die möglichweise als Arbeitsbereiche gedient hatten. Raum 17b und 17a waren mit einer Türöffnung verbunden. Raum 17b weist im Befund keine Besonderheiten auf, der in der Nordostecke nicht mehr intakte Bodenbelag ist vermutlich auf die Erdbebenzerstörung zurückzuführen. Raum 17c ist nur vom Hausinneren betretbar (über den Hof/Raum 1). Hier haben sich mehrere Einbauten erhalten, die entwe-der mit hauswirtschaftlichen Aktivitäten in Verbindung zu bringen sind oder der Weiterverarbeitung von noch nicht bestimmbaren Produkten dienten. Es handelt sich hierbei um einen Schacht sowie den Beginn eines nach Norden hin verlau-fenden Kanals. Nach der Zerstörung im 7. Jahrhundert war ein Teil des Bereichs der Sondage 2 über den einplanierten Schuttansammlungen genutzt worden; die Zusetzung der Verbindungstür zu Raum 1 und die Lehmstampfböden sind dieser Phase zuzuordnen. Über diesen Befunden konnten weitere Versturzschichten frei-gelegt werden, die das Ende der Nutzung dieses Gebäudeteils – möglicherweise in mittelbyzantinischer Zeit – darstellen.
Ephesos, spät antike Residenz südlich der Marienkirche. Son-dagenplan 2014 (Plan H. Schwaiger)
Zentrale Wien
15
Auch bei Sondage 3/14 (7,80 × 3 m) waren bereits 2013 die Oberkante der Mauern und eine flächige Versturzschicht frei-gelegt worden. Als frühester Be-fund, der der Nutzungsphase des spät antiken Raumes 15 zuzuord-nen ist, konnte eine Abfolge von Lehmstampfböden freigelegt wer-den. Die Böden weisen vor allem eine hohe Dichte an Münzen auf. Teilweise fanden sich in den Bö-den Reste verlegter Ziegelplatten, die möglicherweise als Auflager oder Unterbauten für nicht mehr erhaltene Aufbauten dienten. Im Westen des Raums war ein Kanal angelegt worden, der bereits in Raum 17c ergraben werden konn-te; er entwässerte nach Norden zur Straße hin. Im Zuge der Erdbebenzerstörung sanken auch in diesem Raum das Fußbodenniveau und die östliche Kanalwange um ca. 35 cm ab. Dieser Zerstörungsbefund zeigt sich auch an der Südmauer, die ebenso zur Raummitte hin abgesackt ist. In den Zerstörungsschichten konnte eine massive Konzentration von Tierknochen festgestellt werden, die wohl auf einen verarbeitenden Betrieb im Obergeschoss hinweisen, in dem Beinobjekte herge-stellt worden waren. Über diesen unteren Versturzschichten fanden sich weitere Lehmstampfböden, die auf die mit-telalterliche Nachnutzungsphase hinweisen. Da von diesen jedoch nur noch wenige Reste erhalten sind, sind keine weiterreichenden Aussagen zu treffen.
Im Bereich der Sondage 1/14 wurde im Nordwesten ein 7,40 × 5,40/7,70 m großer Schnitt (Son-dage 4/14) angelegt, dessen Aus-maße von den raumbegrenzen-den Mauern definiert werden. In der spät antiken Phase war dieser Raum (20) mit dem Hof (1) verbun-den und bildete mit den im Süden angrenzenden Räumen (21 und 22) eine durchgehende Einheit. Weitere Befunde aus dieser spät-antiken Nutzungsphase wurden nicht ergraben. Nach jetzigem Kenntnisstand waren nach der Zerstörung des 7. Jahrhunderts die sich im Raum befindlichen Schutt und Versturzschichten planiert und in der Nachnutzungsphase mehrere Einbauten errichtet worden. Es handelt sich dabei um aufgemauerte Arbeitsplattformen entlang der Wände sowie einen Schacht, der im Süden über die gesamte Raumbreite verlief. Mittig im Westen finden sich die Reste einer gemauerten Herdstelle, die jedoch in einer späteren Nutzungspha-se abgetragen wurde. Diesen unterschiedlichen Nutzungsphasen ist auch eine Abfolge mehrerer Böden zuzuweisen. Es sind Lehmstampfböden, kombiniert mit Ziegel- und Steinplattenböden. Zu dieser Nachnutzungsphase gehört auch die sich
Ephesos, spät antike Residenz südlich der Marienkirche. Deformierte Böden und abgesackte Mauern als Zeichen einer Erdbebenzerstörung (Foto N. Gail)
Ephesos, spät antike Residenz südlich der Marienkirche. Mittel-byzantinische Bebauung (Foto N. Gail)
Jahresbericht 2014
16
im Norden befindliche Schwelle, die im Vergleich zu den bereits in den vergange-nen Jahren ergrabenen spät antiken Räumen auf wesentlich höherem Niveau liegt. Die endgültige Zerstörung dieses Bereichs lässt sich in Form einer Schutt- bzw. Versturzschicht fassen.
Sondage 5/14 liegt östlich des bereits 2012 ausgegrabenen Raums 11. In der letzten spät antiken Ausstattungsphase war ein Ziegelplattenboden verlegt, der von einer im Südosten des Raums angelegten Grube teilweise zerstört wurde. Eine tiefer liegende Versturzschicht ist der Zerstörung des 7. Jahrhunderts zuzuweisen. Wie bereits in Sondage 4/14 zu beobachten, wurde diese z. T. einplaniert; im Nordbe-reich der Sondage waren noch die Reste eines Lehmstampfbodens zu fassen, der auf demselben Niveau liegt wie jener im benachbarten Raum 22. Dieser Befund kann ebenso der Nachnutzung zugeschrieben werden. Die endgültige Zerstörung zeigt sich in einer höher liegenden Versturzschicht.
Östlich an Sondage 5/14 anschließend wurde in Raum 22 (Sondage 6/14) ein Lehmstampfboden freigelegt. Dieser Befund bildet eine zusammenhängende Lauf-fläche mit den benachbarten Sondagen 5/14 und 8/14 (Räume 21 und 25) und ist als Aktivitätsbereich während der letzten fassbaren Phase der Nachnutzung des Komplexes zu interpretieren. Über diesem Boden findet sich eine ebenfalls in den angrenzenden Grabungsbereichen fassbare Zerstörungsschicht.
Raum 24 weist aufgrund einer wohl schon in der spät antiken Nutzungspha-se vorgenommenen baulichen Veränderung eine Besonderheit auf: Es existiert in der spätesten Nutzungsphase kein Zugang – während die Mauern im Norden und Süden wohl zur ursprünglichen Grundrissgestaltung zu zählen sind, begrenzt eine
Mauer im Westen eine aus den Räumen 24 und 25 bestehende Einheit. An diese West-mauer angesetzt, konnte eine Aufmauerung freigelegt werden, deren Funktion noch nicht gänzlich geklärt ist; möglicherweise handelt es sich um eine weitere Arbeitsplattform. In einer weiteren Phase wird im Osten der Sondage eine zusätzliche Mauer eingezogen und trennt Raum 24 von Raum 25 ab. Wie anhand der später eingebrachten Lehmstampfböden und der vereinzelt noch fassbaren Setzungen aus Ziegelplatten zu erschließen ist, wird der Raum wohl von oben über eine Leiter oder hölzerne
Treppe betretbar gewesen sein. Im Zuge der Nutzung dieses Bereichs wurden eine kaiserzeitliche marmorne Tischstütze mit Löwenkopf und Pranke sowie ein Kapitell deponiert. Hier markiert ebenfalls eine Versturzschicht die letzte fassbare Nutzung.
Sondage 8/14 umfasst Raum 25. Im Südwesten befindet sich eine Aufmaue-rung, die sich wegen ihrer gering erhaltenen Höhe funktional nicht einordnen lässt. Gleichzeitig in Verwendung mit dieser Struktur war auch ein Lehmstampfboden, der im Bereich der Wände eine Kalkmörtelauflage aufweist. Dieser Befund ist möglicher-weise mit Bauaktivitäten in Verbindung zu bringen. Auch in Sondage 8/14 endet die Nutzung mit der Zerstörung des mittelalterlich genutzten Komplexes.
Sondage 9/14 wurde im Norden des Komplexes in Raum 13 angelegt. Dieser Raum wurde zum Großteil bereits 2013 ausgegraben (So 6/13) und konnte während der aktuellen Kampagne zur Gänze freigelegt werden. Gleichzeitig mit der Errichtung des spät antiken Komplexes im 5. Jahrhundert wird ein Nord-Süd verlaufender Kanal entlang der Westmauer des Raums eingetieft, der bis in den Hof (Raum 1) zu verfol-gen ist und ebenfalls nach Norden hin entwässerte. Besonders hervorzuheben sind Teile der Kanalabdeckung, die z. T. aus wiederverwendeten dekorierten Bauteilen bestehen. Aufgrund einer Inschrift kann zumindest eines dieser Architekturelemente einem nicht zu identifizierenden Kirchenbau zugewiesen werden. Die darüberliegen-den Lehmstampfböden wiesen – wie bereits bei der Grabung 2013 beobachtet – ein hohes Aufkommen an Münzen auf. Partiell wurden auf diesen Böden Bereiche mit
Ephesos, spät antike Residenz südlich der Marienkirche. Gürtel-schnalle (Foto N. Gail)
Zentrale Wien
17
Ziegelplatten ausgelegt, die in der Re-gel als fester Untergrund für nicht mehr erhaltene Konstruktionen zu interpretie-ren sind. Teilweise ist jedoch auch da-von auszugehen, dass die Bodenplatten von Ziegelplattenböden beim Einbrin-gen neuer Böden entfernt wurden, um diese Elemente wiederzuverwenden. In diesem Bereich liefert der Zerstörungs-horizont des 7. Jahrhunderts auch einige Hinweise auf die Bodendekoration des Obergeschosses. So haben sich etliche Elemente eines opus sectile-Bodens er-halten, und zahlreiche Fragmente von Wandmalereien erlauben Rückschlüsse auf die Wanddekoration.
Im Bereich der Sondage 10/14 konn-ten die Räume 26, 27 und 28 freigelegt werden. Ursprünglich müssen die Räume 27 und 28 als eigenständige Einheit kon-zipiert gewesen sein, wobei hier vor allem die verstärkten Mauerecken besonders auffallend sind. In einer späteren Nutzungsphase werden in Raum 26 Binnenmau-ern durchwegs in Ziegelbauweise eingezogen, die dadurch im Süden des Raums eine halbrunde Struktur mit einer Öffnung ergeben. Diese war schräg gegenüber den übrigen Mauern orientiert und dürfte überwölbt gewesen sein. Nach Norden hin besteht eine Verbindung zum Raum/Hof 23. Zeitgleich oder danach wird in die Ostmauer von Raum 26 eine Öffnung zu Raum 27 durchgebrochen, in dem eben-falls ein durchgehender Plattenboden verlegt wird, von dem sich jedoch nur noch im Osten Reste des einstigen Kalktuffbelags erhalten haben. Durch eine wenige Zentimeter hohe Aufmauerung wird dieser Bereich wiederum von Raum 28 im Osten abgetrennt, wobei in diese Mauer ein Gerinne nach Osten hin integriert wurde. Hier konnte Wasser aus dem Rauminneren abfließen. Scheinbar kommt es gegen Ende der Nutzung in diesem Bereich noch zu einigen Umbauten, von denen noch Kalk-mörtelansammlungen in den Ecken zeugen. Eine nähere funktionale Zuweisung ist jedoch aufgrund des mangelnden Erhaltungszustandes nicht möglich.
Bei Aufgabe dieses Bereichs werden Teile des Platten-bodens ausgerissen und es kommt zur Zerstörung, von der noch eine massive Schuttschicht zeugt.
Im nordöstlichen Teil der neuen Grabungsfläche, Son-dage 11/14, konnte ein mit Mauern eingefasster Bereich (23) mit trapezoidalem Grundriss freigelegt werden. Aufgrund der Raumgröße (10,00/8,60 × 8,00 m) ist wohl eher von einem offenen Hof auszugehen, der möglicherweise z. T. über-dacht war. Annähernd zentral finden sich ein eingelassener Pithos (Dm ca. 80 cm) und die Reste eines Ofens, der später verfüllt wurde. Ursprünglich befand sich im Nordosten ein breiter Durchgang zu anschließenden, noch nicht freigeleg-ten Bereichen. Einzelne Baufugen in der Westmauer bele-gen auch Verbindungen zum eigentlichen Wohnkomplex der spät antiken Residenz. Nach der Abmauerung dieser Verbin-dungen entstand im Südwesten von Sondage 11/14 ein wohl zu diesem Hof gehöriger Raum (Raum 26), der im Zuge späterer Baumaßnahmen jedoch räumlich abgetrennt wurde. Ebenso wurde der Durchgang im Nordosten ver-kleinert und der Nordmauer eine teilweise aus Spolien bestehende, aufgemauerte Bank vorgeblendet. Diese Befunde stammen sämtlich aus der letzten Nutzungs-phase, zu der auch der nahezu im gesamten Bereich erhaltene Lehmstampfboden
Ephesos, spät antike Residenz südlich der Marienkirche. Bearbeitete untere Wildschweinhauer aus der Beinwerkstatt (Foto N. Gail)
Ephesos, spät antike Residenz südlich der Marienkirche. Byzantini-sche Backhaube (Foto N. Gail)
Jahresbericht 2014
18
gezählt werden muss. Im Zuge der Zerstörung dieses Bereichs wird der Hof mit Schutt verfüllt. Eine rezente Grube im Nordosten zeugt wohl von Grabungsarbeiten aus der Zeit des 19. Jahrhunderts, die für den Bereich der Verulanushallen in den Grabungstagebüchern mehrmals belegt sind, jedoch nicht genauer verortet werden können.
Zusammenfassend lässt sich Folgendes aussagen: Im Nordwesten und Nor-den des Komplexes konnten im Zuge der Grabungen weitere Wirtschaftsräume und Tabernen freigelegt werden. Diese gehören in ihrer Ausgestaltung zu einer der letzten Bauphasen der spät-antiken Residenz vor deren Zerstörung im 7. Jahrhundert. Einer-seits handelt es sich um Bereiche (Raum 17 und 18), die zu einer bereits 2013 ausgegrabenen Pressanlage gehören (Raum 16), andererseits um Geschäftslokale oder Handwerkseinrichtungen (Raum 15), die vom eigentlichen Wohnhaus selbst unabhängig sind. Raum 13 (Sondage 9/14) konnte vollständig ausgegraben werden, hier zeigt sich eine Bestätigung des Befundes aus dem Jahr 2013 (Sondage 6/13) – ein Geschäftslokal/eine Taberne, wo wohl – anhand der großen Münzvorkommen zu schließen – Handel betrieben wurde.
Im südöstlichen Grabungsbereich wurden Befunde freigelegt, die aus der Zeit der Nachnutzung des Areals nach der Zerstörung des 7. Jahrhunderts stammen. Es handelt sich teilweise um Räu-me, die in wirtschaftlicher Verwendung waren (Raum 20), und sol-
che, die möglicherweise auch erneut zu Wohnzwecken genutzt wurden (Räume 21, 22, 24 und 25). Jene Bereiche, die ganz im Osten der Grabungsfläche liegen, wurden einerseits wirtschaftlich (Raum 23 als Hof) und andererseits – so aufgrund ihrer Ausgestaltung anzunehmen – zumindest teilweise repräsentativ (26, 27 und 28) genutzt. Eine exakte Bauabfolge kann in diesem Bereich jedoch nur durch wei-tere Grabungen geklärt werden.
Projektleitung: S. Ladstätter, H. Schwaiger; Mitarbeit: E. Baudouin, S. Demir, A. Dolea, U. Ermiş, F. Fichtinger, I. Ganciu, K. Güler, U. İnce, B. Kalfa, J. Krämmer, L. Sack, J. Scheifinger, M. Vukov
I.1.1.5 Hamam 4Die Ausgrabungen im Hamam 4 konzentrierten sich auf die 2013 begonnene Frei-legung des Wasserdepots sowie die südlich ansetzenden kleinen Baderäume im Gebäudeinneren. Alle Arbeiten konnten 2014 abgeschlossen werden.
Teile des Tonnengewölbes des Wasserdepots an der Nordseite des Hamams wurden in ihrer Versturzlage mit 3-D-Scan dokumentiert und anschließend mit einem Kran gehoben. Nachdem die darunterliegenden natürlichen Ablagerungen entfernt worden waren, kam nahe dem Boden eine Versturzschicht aus Ziegeln und Bruch-steinen zum Vorschein. Darunter folgte eine Schicht aus dicht gepresstem Ziegel-schutt mit Mörtel. Diese Gewölbeversturzschicht befand sich auf einer dünnen Lage aus Flugerde. Nach Abnahme dieser Schichten wurde der Beckenboden aufge-deckt, dessen dicke hydraulische Putzlagen unversehrt erhalten sind. Vorhandene Risse im Boden und in den Wänden zeigen deutliche Spuren von Reparaturen.
Das Wasserdepot musste also schon während seiner Benutzungsphase Schä-den erlitten haben, die ausgebessert worden waren, bis das Gewölbe – möglicher-weise durch ein Erdbeben – endgültig einstürzte.
Die ehemalige Wasserzuleitung konnte in der Südostecke aufgedeckt werden. In der gegenüberliegenden Nordwestecke befand sich auf ungefähr gleicher Höhe ein Ableitungsrohr. Durch je ein Rohr in Bodennähe wurde das Wasser vom Depot in die Räume 5 und 6 geleitet und dort weiter verteilt. In Bodenmitte des Wasser-beckens wurde die runde Ausnehmung des Präfurniums (oberer Dm 2,5 m) aufge-
Ephesos, spät antike Residenz südlich der Marienkirche. Keramik-stöpsel mit der Darstellung der drei Magier (Foto N. Gail)
Zentrale Wien
19
deckt. Auf einer ca. 0,3 m tie-fer liegenden Abstufung zum Auflagern des Kupferkessels sind im Mörtel auch noch die Abdrucke der Kesselnieten zu sehen. Auf dieser Stufe fanden sich Fragmente eines großen Gefäßes.
Unter der bis fast auf Bodenniveau reichenden Schicht aus Flugerde befand sich am Boden des Präfur-niums eine weiche, weiß-graue Ascheablagerung von 1 – 4 cm Dicke. Die kleinen Steinsäulchen, die die Öff-nungen der Heizkanäle von-einander abgrenzten, sind noch teilweise in situ erhalten. Die Heizkanäle selbst sind mit verschiedenen Ablagerungen verfüllt, und im Bodenbereich sind schwarze Rußablagerungen sichtbar. Diese Kanäle und die Öffnung des Präfurniums nach außen, die sich mittig in der Nordmauer befand und jetzt eingestürzt ist, wurden aus statischen Gründen nicht untersucht. Das gesamte Wasserdepot wurde nach Ende der Grabung mittels 3-D-Scan und Fotogrammetrie dokumentiert.
Um detailliertere Informa-tionen über das Hypokaust-system zu erhalten, wurde in Raum 4 eine weitere Son-dage (2/14) angelegt. In die-sem Raum war nur noch in der Nordwestecke ein winzi-ger Fußbodenrest aus Mar-mor mit darunterliegendem Estrich erhalten. Der übrige Boden war im obersten Be-reich mit einer lockeren Erd-schicht verfüllt, vermischt mit kleinen Bruchsteinen, Ziegel-schutt und Mörtel. Darunter folgten etwas kompaktere Versturzschichten mit Bruch-steinen sowie eine Konzen-tration von Bruchsteinen im Türbereich. Darunter war ein Nutzungshorizont anzuneh-men, da unter einer Lage aus flachen Steinen eine organische Schicht folgte, die möglicherweise aus der Haltung von Tieren in diesem Raum resultiert.
In einer lehmigen Schicht unter dem Nutzungsniveau wurden die Oberkanten der beiden großen Hypokaustpfeiler mittig im Raum aufgedeckt. Beide Pfeiler waren aus regelmäßigen Ziegellagen aufgemauert, wobei der östliche Pfeiler oben mit zwei großen Steinquadern abgeschlossen worden war, und der westliche Pfeiler in der obersten Lage aus kleinen, teilweise auskragenden Bruchsteinen besteht. An der Nordwand wurden zwei kleine, quadratische Pfeiler vorgemauert. An den anderen Wänden springt der Fundamentbereich etwas vor. In den weiteren Schichten sind die vielen kleinen Bruchstücke von Marmorplatten des Bodenbelags und die große Menge an Ziegelbruch auffallend, wobei in den unteren Bereichen die Verrußung stark zunimmt. Dies lässt vermuten, dass der Hypokaustbereich mit Ziegelgewölben
Ephesos, Hamam 4. Ansicht des Wasserdepots (Foto N. Gail)
Ephesos, Hamam 4. Nord-Süd-Schnitt (Scan C. Kurtze)
Jahresbericht 2014
20
ausgestattet war, da die Ziegel kaum von der teilweise zerstörten Kuppel stammen können, zumal nur in den Schichten oberhalb der Hypokaustpfeiler auch Fragmente der Lichtöffnungen gefunden wurden.
Im westlichen Bereich des Raums, ca. 90 cm unter dem Fußbodenniveau, ka-men zwei Mühlsteine in einer Erd-Ziegelschutt-Schicht zutage. In der darunterlie-genden dicken Ascheschicht, die sich über die gesamte Fläche erstreckte, wurde die Grabung beendet.
Die nächste Sondage zur Klärung der Boden- und Hypokaustfrage befand sich in Raum 3 (Sondage 3/14). Hier sind entlang der Nord- und Ostwand schmale Streifen des Marmorfußbodens erhalten. Der darunterliegende Estrich ist vor dem Türbereich und in der Raummitte von der Nord- bis zur Südmauer erhalten. Er liegt auf großen Schieferplatten auf, die in zwei bis drei Lagen übereinander die Zwi-schenräume zwischen den Nord-Süd gerichteten, kammartig angeordneten Hypo-kaustmauern überbrücken.
In den Bereichen, an denen der Estrich nicht erhalten ist, wurde die oberste Schuttschicht entfernt. Daraufhin wurden weitere Schichten bestehend aus kleinen Bruchsteinen und Ziegelbruchstücken abgenommen, die als Reste des Estrichs in-terpretiert werden müssen. Unter den darunterliegenden verstürzten Schieferplatten befand sich feine Flugerde. Es folgte eine stärkere, lehmige Schicht und darunter eine dicke, grauschwarze Ascheschicht, innerhalb derer die Grabung beendet und danach alles mittels 3-D-Scan dokumentiert wurde.
In Raum 1 wurde die Fehlstelle im Estrichboden im Südostbereich des Raums untersucht (Sondage 4/14). Unter der zuoberst gelegenen Schuttschicht aus locke-rer Erde, gemischt mit Bruchsteinen und Ziegelbruch, folgte eine weitere Versturz-schicht, bestehend aus Bruchziegeln und Steinen sowie Versturzteilen des Estrichs. Schichten von Flugerde befanden sich vor allem unter den verstürzten Bodenplatten und Steinen. Unter dem umliegenden noch erhaltenen Estrichboden wurden die Hohlräume des Hypokaustsystems sichtbar. Zwei annähernd quadratische Steinla-gen mit rötlichem Mörtel dazwischen bilden in diesem Bereich die untersten Reste der Hypokaustpfeiler. Nach Erreichen der Oberkante der Ascheschicht wurde die Grabung auch in dieser Sondage beendet und der Befund 3-D-gescannt.
Im Lauf der Grabung konnte auch festgestellt werden, dass die Hypokaustbe-reiche der Räume 3 und 4 sowie die der Räume 1 und 4 miteinander in Verbindung standen.
Projektleitung: S. Ladstätter; Mitarbeit: P. Mayrhofer, R. Yazıcı
I.1.2 Feldforschung/Bauforschung
I.1.2.1 Obere AgoraIm Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekts wurden 2014 die Untersuchungen der Oberen Agora von Ephesos wieder aufgenommen. Um die z. T. unbefriedigende Dokumentation der Altgrabungen aus den 1960er und 1970er Jahren zu ergänzen, wurde in der Kampagne 2014 gemäß der Planung eine umfassende und gründliche Reinigung des Südostpropylons und der Verbindung desselben zum Bereich der Oberen Agora sowie von einzelnen Abschnitten der Südstoa vorgenommen. Dafür war es u. a. nötig, eine größere Zahl von Bauteilen, die auf dem Stufenunterbau am Westende der Halle gelagert waren, von dort auf die Fläche der Agora selbst zu verbringen. Die Reinigungsarbeiten schritten von Osten nach Westen fort. Sie legten die Strukturen jeweils soweit frei, wie das die alte Grabung bereits getan hatte bzw. bis zum jüngsten erkenn-baren antiken Horizont. Diesen Arbeiten folgten eine umfassende tachymetrische Einmessung, Beschreibung sowie fotografische und zeichnerische Aufnahme der Einzelbefunde.
Zentrale Wien
21
Im Süden der oberen Agora erhob sich die sog. Südstoa, eine zweischiffige Hal-le, die sich in ihrer gesamten Länge zum Platz öffnete und bei ihrer Errichtung von geschlossenen Zungenmauern im Osten und Westen begrenzt war. Die Rückwand nimmt im Osten eine Länge von 152,79 m und eine Tiefe bis zur Vorderkante der vorderen Stufe von 14,73 m ein. Im Inneren der Halle lief an der gesamten Rück-wand und den beiden Seitenwänden eine marmorne Sitzbank um. Die Innenecke ist im Südwesten, ebenso sind weite Bereiche der Sitzbank im Westen und Osten erhalten.
In dieser Kampagne konnten 61 Architekturelemente, die im Be-reich der Südstoa lagen, inventarisiert und in Bauteildepots geordnet, erste Bauteile auch zeichnerisch dokumen-tiert werden. Zu Beginn der Kampag-ne wurde mit der Erweiterung eines westlich des sog. Domitiansplatzes vorhanden Steindepots begonnen. Die versetzten Bauteile wurden im südwestlichen Bereich der beschrie-benen Fläche bereits in Bauteilgrup-pen geordnet und nummeriert. Ins-gesamt wurden 116 Steinblöcke in verschiedenen Bereichen erfasst und nummeriert. 38 davon konnten zeich-nerisch erfasst werden.
Im sog. Westchalcidicum konnten mindestens drei größere Bauphasen erfasst werden. Der älteste Bauteil dieses Abschnitts bildet hierbei die Ostmauer der Kammern, die im Bereich der mittleren und südlichen Kammer nach Osten zurückspringt und dort bis an den Sockelbau des Westendes der Südstoa reicht. Die Umfassungswände des sog. Westchalci-dicums hingegen bilden eine eigene Bauphase und wurden aus dem Material des Panayırdağ errichtet. In der südlichsten Kammer des sog. Westchalcidicums befin-den sich drei Räume, von denen der letzte im 20. Jahrhundert noch ein Dach hatte.
Ephesos, Obere Agora. Schematischer Grundriss-plan (Plan C. Kurtze)
Ephesos, Obere Agora. Ostpropylon (Foto N. Gail)
Jahresbericht 2014
22
Hier haben sich an den angrenzenden Wandteilen noch Mörtel- und Dach-ziegelreste erhalten. Ein komplett erhaltener Ziegel weist die Prägung einer Ziegelei aus Izmir auf.
Projektleitung: T. Schulz-Brize (Hochschule Regensburg), D. Steuer-nagel (Universität Regensburg); Mitar-beit: O. Başaran, B. Biederer, P. Brize, H. Çamtepe, C. Gmeiner, A. Hohlhei-mer, S. Kreil, S. Langer, D. Musall, T. Neufeld, M. Schmid
I.1.2.2 Bauaufnahme SerapeionFinanziert von der Ephesus-Founda-
tion konnte die Bauaufnahme des Serapeions abgeschlossen werden. Basierend auf Scans erfolgte eine umfangreiche Bauaufnahme der in situ befindlichen Mau-ern und Fußböden der Cella, Apsis, Vorhalle und der Korridore. Insgesamt wurden ein Grundriss als Gesamtplan des Tempels und sechs Schnitte in der gesamten Quer- und Längsrichtung des Tempels mit den Ansichten sämtlicher Wände im Maß-stab 1 : 50, zusätzlich wichtige Details – wie die Nischen in der Cella – im Maßstab 1 : 20 gezeichnet. Zudem wurden alle Details des Tempels in der üblichen Weise beschrieben und fotografiert.
Die Wände der Cella waren bis zur Höhe der Nischen mit hohen monolithischen Orthostatenplatten verkleidet. Entsprechende Stiftlöcher sind an den Wänden er-halten. Die Standflächen und der rote Mörtel hinter diesen Platten ermöglichen die genaue Rekonstruktion ihrer Position und Dimensionierung. Über den Orthostaten folgte eine weitere Plattenreihe, die bis zur Oberkante der ersten Wandlage der
Nischen und damit leicht über das Niveau des Wasserspiegels in den Nischen reichte. Auch die Wandver-kleidung innerhalb der Nischen und der Apsis kann genau rekonstruiert werden.
Im Estrich der Nischen sind hori-zontale Bettungen für Tonrohre er-halten, die an der Vorderseite der Nischen vertikal umbogen. Entspre-chend sind unterhalb der Nischen jeweils senkrechte Schlitze in die Wandquader eingearbeitet. Von hier aus wurde das Wasser in den umlau-fenden Kanal der Cella geleitet. Die Nischen sind mit einem wasserfesten, roten Mörtel auf dem Grund und an den Wandungen ausgestrichen. Die-ser ruht auf einer vielschichtigen Un-terkonstruktion, bestehend aus einer hohen Rollschicht, einer Ziegelschicht
und mehreren Mörtellagen. In einer der Nischen der Westwand ist die Standspur einer Statuenbasis zu erkennen. Somit sind in den Nischen Wasserbassins mit Statuenbasen zu rekonstruieren.
Ephesos, Serapeion. Rekonstruktion der Fassade (T. Schulz-Brize)
Ephesos, Obere Agora. Ansicht der Südstoa von Osten (Foto N. Gail)
Zentrale Wien
23
Besonders interessant ist die Wasserzufuhr in diese Nischen. Die Apsis wurde über eine Wasserleitung hinter der Rückwand in einem Niveau von etwa 70 cm un-terhalb des anstehenden Mauerwerks gespeist. Diesen Befund legte bereits G. Wil-berg im Rahmen der alten Ausgrabungen frei. Ein weiterer Wasserkanal ist im Osten unterhalb des Treppenhauses sichtbar, der die Nischen auf der Westseite mit Wasser versorgte. Ein entsprechender Kanal ist auch an der Ostseite zu erwarten.
Das Wasser lief innerhalb der Cella an allen vier Seiten in einem offenen Kanal um und floss unter der Türschwelle in einem geschlossenen Kanal ab. Die Wandun-gen und der Boden des offenen Kanals bestanden aus dünnen, weißen Marmor-platten, gebettet in einen wasserun-durchlässigen, roten Mörtel mit einer entsprechenden Unterkonstruktion. Die Marmorplatten sind in einigen Be-reichen erhalten, im Nordosten sind sie in ihrer gesamten Höhe zu sehen.
Der Fußboden der Cella bestand ursprünglich aus Marmorplatten, die z. T. sekundär in den zahlreichen Grä-bern als Grababdeckungen wieder-verwendet wurden. Die noch in situ erhaltenen Kalkstein- und Tonplatten sind der frühchristlichen Bauphase zuzuordnen. Außerdem wurde der marmorne Plattenbelag mit dem Fu-genverlauf im Pronaos dokumentiert. Dabei konnten auf der Oberkante der Euthynterie der Türwand Ritzlini-en entdeckt werden, ebenso auf den Plinthen der Frontsäulen. Diese Ritz-linien zeichnen die Mittelachsen der Säulen und damit auch die Stoßfugen der Architravblöcke vor. Diese Vorzeichnung ist als Reißboden im Pronaos zu verstehen – ein interessantes Detail zum Bauablauf des Tempels.
Ephesos, Serapeion. Nische in der Cella des Tempels (Foto N. Gail)
Ephesos, Serapeion. Ziegelplattengrab in der Cella (Foto T. Koch)
Ephesos, Serapeion. Rekonstruierter Schnitt durch den Innenraum (T. Schulz-Brize)
Jahresbericht 2014
24
Vor dem Treppenpodest des östlichen Stiegenhauses ist eine marmorne Stufe erhalten, die an ihrer Rückseite eine Inschrift trägt. Dieses Bauteil ist folglich sekun-där im Tempel verbaut, vergleichbar mit den Stufenblöcken der Freitreppe. Oberhalb des Treppenpodests endet die Rückwand des östlichen Stiegenhauses. Hier zeich-net sich eine kleine Tür an der Rückwand des Tempels ab. Oberhalb dieses Befunds liegt im Verschutt ein Türsturz, der wohl dieser Tür zugewiesen werden kann.
Die gesamte Ausstattung der Apsis konnte dokumentiert werden, mit den bei-den Postamenten, den Eckkapitellen und allen erhaltenen Wandfriesen. Auf dieser Basis kann auch in diesem Bereich die genaue Anordnung der Architekturelemente rekonstruiert werden.
Für die abschließende Rekonstruktion des Tempels wurde die Vollständigkeit der Dokumentation vor Ort überprüft und ergänzt, u. a. die Bauteile des Hauptportals, die Pilasterkapitelle und Wandarchitrave.
Projektleitung: T. Schulz-Brize (Hochschule Regensburg); Mitarbeit: T. Brand-meier, C. Ruppert, A. Zeitler
I.1.2.3 Odeion im ArtemisionDie Auswertung und Analyse der Feldarbeiten 2009 – 2011 des Projekts zur ein-zig sichtbaren römischen Ruine innerhalb des heiligen Bezirks, dem Odeion im Artemision, konnten im Jahr 2014 abgeschlossen werden. Die Projektziele, durch eine Bauaufnahme kombiniert mit punktuellen archäologischen Sondierungen eine Funktionszuweisung sowie eine Datierung des Gebäudes zu erlangen, können als erfüllt betrachtet werden. Der Bau, der zuvor als ›Tribüne‹ bezeichnet worden war, konnte aufgrund enger bautypologischer Vergleiche und spezifischen Fundmate-rials als Odeion aus der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. identifiziert werden.
Die Ausrichtung des Gebäudes, das etwa 175 m südwestlich des Artemistem-pels liegt, orientiert sich mit geringer Abweichung an jener des Tempels, wobei die Westfassade die Gebäuderückseite bildet, während die Cavea nach Osten orientiert ist. Die Nordfassade des Odeions verfügt als Schauseite über eine repräsentative Blendbogengliederung, im Gegensatz zur geschossübergreifenden Pilastergliede-rung der Süd- und Westfassade. Die Fassadengestaltung ist nur im gut erhaltenen unteren Geschoss, das durch ein umlaufendes Gurtgesims aus Kalksteinblöcken nach oben horizontal abgeschlossen wurde, sicher zu rekonstruieren. An keiner Stelle ist die Gebäudesubstanz darüber hinaus erhalten, weshalb die Rekonstrukti-on des oberen Geschosses hypothetisch bleiben muss. Vergleichbare Bauten las-sen auf ein umlaufendes Fensterband unter dem hölzernen Dachstuhl schließen, das die Belichtung und Belüftung der Cavea gewährleistete.
Der heute sichtbare Teil des hoch verschütteten Gebäudes hat einen rechtecki-gen Grundriss und misst etwa 40 × 24 m. An seiner Süd-, West- und Nordseite weist der Bau neun tonnengewölbte Kammern auf, von denen sechs zugänglich sind. Das Mauerwerk der Substruktionen besteht durchwegs aus einem opus caementitium-Kern, der mit lagerechten Bruchsteinen (opus vittatum) verkleidet ist. In der halb-kreisförmigen Cavea teilt ein umlaufender Gang den Zuschauerraum in zwei Ränge, deren unterer Bereich auf radial angeordneten konischen Kammer substruktionen ruht. Es konnten insgesamt 13 Sitzreihen rekonstruiert werden, woraus sich ein Fas-sungsvermögen von 850 Sitzplätzen errechnen lässt. Die Erschließung der Cavea erfolgte durch fünf Radialtreppen, die den Zuschauerraum in vier Cunei unterteilten. Unmittelbar an die Orchestra schließt gegen Osten die erhöhte Bühne an, die 2011 in einem kleinen Bereich freigelegt werden konnte. Die Orchestra war mit einem geometrischen opus sectile-Paviment ausgelegt, welches ein Raster aus quadrati-scher Felderrahmung mit eingeschriebenen Kreisen zeigt. Die Rekonstruktion des Bühnengebäudes konnte vorläufig nur hypothetisch vorgenommen werden, da Feld-arbeiten in diesem Bereich nicht möglich waren.
Zentrale Wien
25
Die Auswertung des keramischen Fundma-terials aus dem Fundamentbereich belegt eine Errichtung des Odeions im Artemision in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. Eine Umbauphase ist mit dem Einbau einer Latrine in einer der Substruktionskammern Mitte des 2./Anfang des 3. Jahrhunderts n. Chr. belegt. Mög-licherweise ist auch der opus sectile-Boden der Orchestra dieser späteren Ausstattungsphase zuzuordnen, da der Dekor enge Parallelen zu Pavimenten der Hanghäuser zeigt, die in die Mit-te des 2. Jahrhunderts n. Chr. datieren. Mehr-phasige Wandmalereifragmente im Bereich vor der Bühne, die aller Wahrscheinlichkeit nach vom Bühnengebäude stammen, deuten ebenfalls auf mehrere Renovierungen und Ausstattungspha-sen des Gebäudes hin, wie auch stilistisch zu-sammengehörige Bauornamentik- und Skulpturfragmente, die aus dem Bereich vor der Bühne geborgen wurden.
Die Aufgabe des Gebäudes im 5./6. Jahrhundert n. Chr. konnte durch das ke-ramische Fundmaterial bestimmt werden, welches aus den Zerstörungsschichten direkt über dem opus sectile-Paviment der Orchestra stammt. Diese Schichten be-stehen vorwiegend aus Dachziegeln und sind daher mit dem Einsturz des ziegel-gedeckten Daches in Verbindung zu bringen. Ascheanhäufungen lassen auf eine Brandzerstörung schließen, welcher der hölzerne Dachstuhl zum Opfer fiel.
Ein Odeion im Artemision ist nicht explizit schriftlich überliefert, jedoch ist die Existenz musischer Agone im Rahmen der heiligen Spiele für die Artemis in Ephe-sos in der Kaiserzeit durch Siegesnennungen eines Enkomiendichters, eines Rhetors, eines Choraules, dreier Komödianten sowie eines Kitharoden belegt. H. Engelmann vermutete daher schon früher die Ausrichtung des musischen Teils der Artemisia innerhalb des Heiligtums. Nachdem das untersuchte Gebäude als typologisch beispielhaftes frühkaiserzeitliches Odeion dem spezialisierten römi-schen Bautypus einer überdachten Konzerthalle entspricht, deren Verwendung als Austragungsort für musische Agone mehrfach überliefert ist, kann das bisher als ›Tribüne‹ bezeichnete Gebäude innerhalb des Temenos nunmehr als Odeion im Artemision angesprochen werden.
Das abschließende Manuskript zum Odeion im Artemision konnte mit Ende 2014 fertiggestellt werden und wird in der Reihe »Forschungen in Ephesos« erscheinen.
Projektleitung: S. Ladstätter; wissenschaftliche Bearbeitung: L. Zabrana; Mitar-beit: I. Adenstedt, F. Fichtinger, N. Gail, J. Struberİlhan. Kooperationen: G. Forsten-pointner (Archäozoologie, Veterinärmedizinische Universität Wien); W. Prochaska (Montanuniversität Leoben); H. Taeuber (Epigrafik, Universität Wien)
I.1.2.4 Domus am PanayırdağDie Arbeiten im Feld dienten der Aufarbeitung der baulichen Befunde im Hauptge-bäude der Domus. Ein für die Endpublikation vorbereiteter Katalog der Mauern und ein Katalog der erhaltenen Bauteile des Gebäudes wurden um fehlende Informati-onen ergänzt und in fraglichen Punkten überprüft. Neben dieser Vervollständigung der schriftlichen Dokumentation wurden einige der großen Architekturteile gedreht, um fehlende Ansichten vermessen, zeichnen und fotografieren zu können. Abge-schlossen wurde ferner die Keramikbearbeitung.
Darüber hinaus konnte die Arbeit im Feld dazu genutzt werden, um einige Be-funddetails zu kontrollieren. Dank der Überprüfung der baulichen Zusammenhänge wurden sowohl im nördlichen Peristylhof als auch im Repräsentationstrakt im Süden
Ephesos, Odeion im Artemision. Rekonstruktion (I. Adenstedt)
Jahresbericht 2014
26
des Gebäudes Erkenntnisse zu wesentlichen Fragen der Baugeschichte gewonnen, die zuvor noch nicht ausreichend geklärt waren. So konnten anhand der Baube-funde etwa die Hinweise darauf verdichtet werden, dass das südliche Peristyl des Hauses in einer ersten Form bereits vor dem anliegenden Apsidensaal bestanden hatte. Bei dem großen Saal dürfte es sich also um einen nachträglichen Umbau des Repräsentationstraktes im Süden der Domus handeln.
Projektleitung: S. Ladstätter; Projekdurchführung: C. Baier, Ö. Vapur
I.1.2.5 Kirche in PamucakDer Gebäudekomplex befindet sich auf einer Anhöhe im heutigen Pamucak, südlich der Einmündung des Hafenkanals von Ephesos. Zuoberst dieses Hügels haben sich die Grundmauern einer dreischiffigen, geosteten Kirche erhalten, welcher im Wes-ten ein Narthex vorliegt. Von außen zu erreichen war die Kirche wahrscheinlich von Nordwesten über eine Rampe oder große Treppenanlage, von der sich Stützmau-ern, die den Hügel hinaufführen, erhalten haben; diese sind jedoch stark verschüttet.
Zentral unterhalb des Mittelschiffs befindet sich eine ca. 11 × 6 m große, in den Fels geschlagene Kammer, welche zusätzlich architektonisch durch Ziegelmauer-werk strukturiert und über eine kleine, überwölbte Treppe mit dem südlichen Sei-tenschiff der Kirche verbunden ist.
An der Ostseite um den Hü-gel führend und zugleich den Fels nutzend, befindet sich ein zwei-geschossiger Gewölbegang von etwa 55 m Länge. Während sich vom oberen Geschoss kaum noch Reste erhalten haben, ist das unte-re stellenweise bis in sein Gewölbe nachvollziehbar. Im Norden ist ein zusätzlicher Raum von ca. 13 × 5 m an den Gang angeschlossen. Hier befindet sich zudem eine gro-ße Treppe, welche außen zum nördlichen Seitenschiff der Kirche hochführt. Die Treppe selbst weist an ihrer Ostseite noch drei Stu-fen einer weiteren Treppe auf, die wahrscheinlich in das zweite Ge-schoss des Gewölbegangs führte.
Neben einer ausgiebigen Sich-tung des Gebäudekomplexes wur-den vorrangig die obertägig anzu-treffenden Bauteile innerhalb und außerhalb des Bauwerks inventari-siert und kartiert. Unter den knapp 250 aufgenommenen Stücken konnten sowohl antike – ursprüng-
lich wohl als Spolien verbaute Bauteile – als auch hauptsächlich eigens in der Spät-antike angefertigte Architekturglieder identifiziert werden, welche möglicherweise Rückschlüsse auf die Gesamtarchitektur gestatten. Die vorhandenen spät antiken Bauteile sind zwar eher schlicht gestaltet, dafür insgesamt recht vielfältig vertreten, sodass sich bereits verschiedene Ordnungen abzeichnen.
Projektleitung: T. Schulz-Brize (Hochschule Regensburg); Mitarbeit: S. Schlos-ser, K. Sewing
Ephesos, Kirche in Pamucak. Schematischer Grundriss der Kirche (C. Kurtze)
Zentrale Wien
27
I.1.2.6 Die Nekropolenlandschaft von EphesosInnerhalb des 2013 am ÖAI eingerichteten Forschungsschwerpunktes »Antike Se-pulkrallandschaften« wurden 2014 die Forschungen zu den Nekropolen von Ephe-sos auf unterschiedlichen Ebenen weitergeführt:
Neben dem Vorantreiben der Publikationsprojekte lag der Schwerpunkt der Arbeiten vor Ort auf der Sichtung von Knochenmaterial unterschiedlicher Gra-bungsplätze in Ephesos, das zur weiteren wissenschaftlichen Analyse aufbereitet und beprobt wurde. Insgesamt wurden 275 Proben für DNA- und Isotopenana-lysen entnommen. Berücksichtigt wurden dabei nicht nur die Fundkomplexe aktueller Grabungen (Hafennekropole 2005 – 2010 und Damianosstoa 2013), sondern auch Altgrabungen aus den Bereichen Hang-haus 2, Tetragonos Agora, Obere Agora, Byzantinischer Palast, Stadion, Oktogon, Domus am Panayırdağ, Marienkirche, sog. Lukasgrab, Türbe beim Artemision und İsa Bey Hamam. Abgesehen von die-ser topografischen Streuung wurde aus chronologischer Sicht versucht, die ge-samte Dimension ephesischer Geschichte in historischer Zeit zu erfassen, also einen diachronen Querschnitt von der Archaik bis in das Mittelalter zu erhalten. Forschungsfragen, die durch die Analyse der beprobten Knochen geklärt werden sollen, behandeln Themen wie Herkunft, Migration, Verwandtschaftsverhältnisse und Essgewohnheiten.
In Vorbereitung der Publikation der Nekropolen von Ephesos wurden einige inner-städtische Grabbauten sowie Grabhäuser der Ost-, Südost- und Westnekropole noch-mals gesichtet. Zur Vervollständigung der Endpublikation der attischen Sarkophage aus Ephesos (C. Kintrup) wurden ausgewählte attische Sarkophage für petrografi-sche Analysen durch W. Prohaska beprobt. H. Taeuber und V. Hofmann nahmen eine nochmalige Autopsie von Grabinschriften, die bei den Surveys der Jahre 2010 – 2012 gefunden wurden, vor, um auch dieses Manuskript abschließen zu können.
Projektleitung: M. Steskal. Kooperationen: E. Hagelberg und G. Bjørnstad (Anthropologie, Universität Oslo); H. Brückner (Paläogeografie, Universität Köln); K. Scheelen und J. Nováček (Anthropologie, ℅ Universität Göttingen); S. S. Seren (Geophysik, ZAMG Wien); H. Taeuber (Epigrafik, Universität Wien); N. Zimmermann (Wandmalerei, ÖAW); A. Galik, G. Forstenpointner und G. E. Weissengruber (Ar-chäozoolgie, Veterinärmedizinische Universität Wien); M. Richards (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology Leipzig, Department of Human Evolution)
I.1.2.7 Türkische Stadt AyasolukIm Sommer 2014 wurden ein erster gemeinsamer Besuch zu den aydınidischen Monumenten Selçuks sowie ein Besuch der islamischen Badehäuser von Tire un-ternommen. Ziel war es, sich besonders mit dem der Region eigenen Hamam-Typus bekanntzumachen, aber auch mit der Beziehung der Hamams von Selçuk zu ande-ren islamischen und vorislamischen Bauten innerhalb des Stadtbilds. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf den İsa Bey Hamam gelegt, der das Kernstück einer englischsprachigen Aufsatzpublikation über die mittelalterliche islamische Badekul-tur Südwestanatoliens werden soll. Ein Vergleich mit den Bädern in Tire machte es möglich, den bislang nur zögerlich als Filzwerkstatt identifizierten Bauteil auch wirk-lich als solchen zu bestimmen. Darüber hinaus weisen die historischen Recherchen darauf hin, dass die Identifizierung mit İsa Bey als Stifter des Hamams nicht haltbar ist. Ein dem İsa Bey zugeschriebenes handschriftliches Kompendium in Arabisch, Persisch und Türkisch, das die Handschriftenbibliothek von Tire in Form einer digi-
Ephesos, Damianosstoa. Blick in den Sarkophag
Jahresbericht 2014
28
talen Kopie zur Verfügung stellte, wird derzeit übersetzt und bearbeitet, um weitere geschichtliche Hintergrundinformationen zu erhalten.
Projektleitung: N. Ergin (Koç Universität Istanbul); Mitarbeit: C. Arıkan, S. N. Ars-lan, S. Yalman Okurer, Ö. Yıldız
I.1.2.8 Değirmendere-AquäduktDie Aufbereitung der Daten für das GIS-Projekt und de-ren Eingabe und Korrektur sowie die Manuskripterstel-lung standen 2014 im Vordergrund. Das GIS-Projekt konnte für den internen Gebrauch auf einem externen Server online gestellt werden, sodass nun alle an der Publikation beteiligten Projektmitarbeiter Zugriff auf alle Daten haben.
Projektleitung: G. Wiplinger; Mitarbeit: N. Birkle, G. Jansen, P. Kessener, R. Kreiner, A. Nießner, A. Wulz. Kooperation: C. Paschier (Johannes-Gutenberg-Univer-sität Mainz); M. Placidi (Centro Ricerche Speleo Archeo-logiche Sotteranei di Roma)
I.1.3 Prospektion
I.1.3.1 GeophysikDie Prospektion mittels geophysikalischer Methoden wurde auch 2014 konsequent fortgesetzt. Die Messflächen umfassten das Areal des Artemistempels, das Areal um den Hamam 4, die Ostnekropole mit einer Fläche entlang der Damianosstoa sowie unmittelbar vor dem Magnesischen Tor, die Bereiche westlich und östlich des Serapeions, die Hangfläche am Panayırdağ zwischen Oberer Agora und sog. Freu-denhaus sowie große Flächen im nördlichen Hafengebiet zwischen Olympieion und römischem Hafenbecken. Eine weitere Messfläche befand sich im Pamucak entlang der spät antiken (?) Kaianlagen.
Im Bereich des Artemistempels konnte die vollständige Beraubung des antiken Bauwerks eindrucksvoll nachgewiesen werden. Bis in eine Tiefe von 2 m ließen sich keinerlei bauliche Reste mehr erkennen. Im direkten Umfeld des Hamams 4 konnte ein kleiner Steinbau, mittelalterlich oder neuzeitlich, entdeckt werden, sonst dürfte das direkte Umfeld des Bads unbebaut gewesen sein. In der Ostnekropole konnten wie bereits auch in den letzten Jahren Grabreihen sowie die Straße (Damianosstoa) entdeckt werden. Vor dem Magnesischen Tor sind die Weggabelung sowie ein pro-minenter Grabbau zu sehen. Besonders aufschlussreich waren die Messungen um das Serapeion. Während im Osten Peristylhäuser zu sehen sind, die – vergleichbar mit dem Hanghaus 2 – sich auf eine Straße hin öffnen, sind die Flächen westlich des Tempels nur locker bebaut. Sehr deutlich zutage trat hier auch die 22 m breite Weststraße, zu deren beiden Seiten sich eine Tabernenreihe erstreckte. Abschlie-ßend soll noch auf die Messungen im Hafengebiet eingegangen werden: Es zeigt sich hier eine äußerst dichte Bebauung, die insbesondere im Nordwesten durch neuzeitliche landwirtschaftliche Aktivitäten bereits weitgehend abgetragen ist.
Geoseismische Untersuchungen im Bereich des Serapeions erbrachten den Nachweis, dass das Bauwerk auf sehr solidem Untergrund steht. Nahezu das ge-samte Temenos ist auf gewachsenem Fels gebaut und zeigt eine nur sehr geringe Überschüttung.
Projektleitung: S. Ladstätter, S. S. Seren (ZAMG); Mitarbeit: E. Bayırlı, F. R. Se-ren, M. Drahor (Seismik)
Ephesos, DeğirmendereAquädukt. GIS-Projekt, interaktive Übersichtskarte, Beispiel Arapdere-Brücke
Zentrale Wien
29
I.1.3.2 PaläogeografieAm Fuß des Küçük Tepe galt es, im Rahmen des Projekts zum vorhellenistischen Ephesos (M. Kerschner) den raumzeitlichen Wandel der antiken Küste zu klären. Trotz zahlreicher flächendeckender Steinsetzungen im Untergrund sowie massi-ver Siedlungsschichten erfolgten fünf Bohrungen bis in eine Tiefe von 16 m. In der nördlich des Hügels gelegenen Bohrung wurde das anstehende Gestein in einer Tiefe von 4 m angetroffen. Dieses Areal hat das holozäne Meer niemals erreicht. Im Westen der Erhebung hingegen wurden Sedimente einer Felsküste (litorale Fa-zies) mit bis zu 4 cm großen Geröllen, Seegras und mariner Makrofauna erbohrt.
Ephesos, geophysikali-sche Messflächen 2014 (S. S. Seren)
Ephesos, Geophysik. Im Georadar sichtbare Bebauungsstrukturen beid-seitig des sog. Serapeions (S. S. Seren)
Jahresbericht 2014
30
14C-Datierungen müssen klären, wann dieser Bereich verlandete. Die litoralen Schichten enthielten mehrere Fragmente geometrisch-archaischer Keramik. Etwa 100 m nord und nordöstlich wurde bis in 6,80 m bzw. 16 m Tiefe ein sumpfiges, küstennahes Milieu nachgewiesen, welches durchgehend zahlreiche Spuren von Siedlungstätigkeit aufweist (Keramik- und Knochenfragmente, Oliven-, Trauben-, Feigen- und Pinienkerne, ein Getreidekorn, mehrere Haselnussschalen). Keramik-fragmente aus den unteren Metern waren unbestimmbar, weswegen die frühesten
Nutzungsphasen dieses Areals 14C-datiert werden müssen. Es konnte der Nachweis geführt werden, dass sich im westlichen Bereich des Küçük Tepe einst eine Meeresbucht befunden hat-te, die wahrscheinlich in geometrisch-archaischer Zeit eine ideale Hafensituation bot.
Die Bohrungen im Artemision (Projekt Vorhellenistisches Ephe-sos, M. Kerschner) sollten die Mächtigkeit der Schwemmschich-ten erfassen, die sich über den Tempelfundamenten abgelagert hatten und diese letztendlich verschütteten. Alle weisen feinkör-nige Alluvien auf, die immer wieder von gröberen Schotter- und Schuttlagen unterbrochen werden. Die präholozänen Sedimen-te wurden 4,50 m unter der Geländeoberfläche erreicht. In den beiden westlich gelegenen Bohrungen konnte 30 cm unter dem Bohrniveau ein römischer Fußboden nachgewiesen werden. An 12 Proben aus den homogenen feinkörnigen Schwemmschichten sollen OSL-Alter ermittelt werden, um die Chronologie der alluvi-alen Ablagerungen zu erfassen.
Die Bohrung in der spät antiken Residenz südlich der Mari-enkirche wurde bis 7 m unter Geländeoberfläche abgeteuft. Die unteren Meter weisen Sedimente einer marinen Bucht mit nied-rigenergetischem Sedimentationsmilieu auf. Darüber sind glim-merreiche Sedimente des Küçük Menderes abgelagert. Die Dis-kordanz bei 4,62 m unter Geländeoberfläche (u. GOF) (abrupter Übergang von mariner zu fluvialer Fazies) stützt die Vermutung, dass im Untergrund bei einem Extremereignis, z. B. einem Erd-
beben, eine Bodenverflüssigung (Liquefaktion) stattgefunden hat. Das Areal wurde frühestens in römischer Zeit besiedelt.
Eph 390 wurde als Ergänzung zu früheren Bohrungen nordwestlich des Vedius-gymnasiums abgeteuft, um den Verlauf der Küste in diesem Bereich zu präzisieren. Das anstehende Gestein und die Transgressionsfazies wurden nicht erreicht, da aufgrund der Randverwerfung im Bereich der Südflanke des Küçük MenderesGra-bens der Fels sehr steil abfällt. An der Basis des Profils wurden brackischmarine Ablagerungen erbohrt, die von lagunären Sedimenten überlagert werden. Mittels 14C-Datierungen soll der Zeitraum der Verlandung rekonstruiert werden.
Im Jahr 2013 erfolgten mehrere Bohrungen in nördlicher, südlicher, westlicher und östlicher Richtung um die Erhebung in Pamucak, die bestätigt haben, dass diese Erhebung einst eine Insel war. An der Westseite steht der verwitterte Glimmerschie-fer bei 3,40 m u. GOF an, an der Ostseite dagegen erst bei 7 m u. GOF. Während im Westen litorale Sedimente folgen, überlagern an der Ostseite marine Sedimente das Anstehende. Im Süden und Südosten der Erhebung finden sich deutlich weniger Relikte anthropogener Steinsetzungen.
Im südlichen Bereich des Hafenbeckens erfolgte eine 15 m tiefe geschlossene Bohrung, die überlappend im Abstand von 80 cm gebohrt wurde und im Labor in Köln geöffnet und analysiert wird. Eine weitere 7 m tiefe Bohrung wurde etwas weiter östlich im Hafenbecken erbohrt, um die Hafensedimente in einer offenen Bohrung erfassen zu können.
Aus mehreren Gewässern wurden rezente Wasser- und Sedimentproben ent-nommen, um die moderne Mikrofauna aus Süß-, Brack- und Salzwasser mit der Mi-krofauna aus den Bohrkernen zu vergleichen und dadurch die paläogeografischen Interpretationen zu präzisieren.
Ephesos, Paläogeografie. Probenent nahme für Thermo lumineszenz-analysen im Artemision (F. Stock)
Zentrale Wien
31
Mehrere Blei- und Sinterproben aus Brunnen, Kanälen und Latrinen des Hang-hauses 2 und einem byzantinischen Wohnhaus sollen helfen, die Quellen der ent-deckten hohen Bleikonzentration im hellenistisch-römischen Hafenbecken zu iden-tifizieren.
Projektleitung: H. Brückner (Universität zu Köln); Mitarbeit: S. Halder, M. Keller, A. Pint, R. Rauhut, F. Stock
I.1.3.3 DrohnenbefliegungIm Rahmen einer von der Firma Drone-Adventures kostenlos durchgeführten, viertätigen Drohnenbefliegung wurden insgesamt 25 Flüge mit 5.000 Bildern über Ephesos durchgeführt, ungefähr 20 km² konnten abgedeckt werden. Die Auflösung beträgt 3 – 10 cm/pixel. Auf Basis der gewonnenen Daten können nun 3DModelle (Punktwolken), 2-D-Orthofotos und Geländemodelle erstellt werden.
Projektleitung: S. Ladstätter, C. Kurtze; Mitarbeit: A. Gribovskiy, A. Habersaat
Ephesos, Drohnenbeflie-gung 2014. Luftaufnahme der Oberen Agora (© Drone-Adventures)
Ephesos, Drohnenbeflie-gung 2014. Luftaufnahme des Hafenbeckens (© Drone-Adventures)
Jahresbericht 2014
32
I.1.3.4 GeodäsieGeodätische Arbeiten erfolgten bei dem Bühnengebäude des Theaters, dem Sera-peion, auf der Oberen Agora und an den mittelalterlichen Monumenten in Selçuk. Hinzu kamen verschiedene Ad-hoc-Arbeiten, wie z. B. die fotogrammetrische Er-fassung von Gewölbefragmenten, die 3-D-Befundaufnahme des eingestürzten Ge-wölbes, der 3-D-Laserscan eines komplexen Befundes beim Hamam 4 und eine dreidimensionale Vermessung für die Ausgrabungen an der spät antiken Residenz. Weiterhin wurden die CAD-Auswertearbeiten der 3-D-Scans von der Oberen Agora (Domitiansgasse, Südstraße, Fontäne, Memmiusbau etc.) und der Aufnahme des Depotgebäudes vorangetrieben.
Projektleitung: C. Kurtze; Mitarbeit: D. Jilin
Ephesos, Geodäsie 2014. Scan des Depots des Grabungshauses (Ansicht) (C. Kurtze)
Ephesos, Geodäsie 2014. Scan des Depots des Gra-bungshauses (Grundriss) (C. Kurtze)
Zentrale Wien
33
I.1.3.5 OberflächensurveyDie Survey-Aktivitäten verteilten sich auf eine Frühjahrskampagne, im Rahmen derer das keramische Material aus 2013 analysiert wurde, sowie eine Feldkampa-gne im Herbst 2014; durchgeführt und teilfinanziert von der Universität Wien. Im Zentrum stand die Region im Süden bzw. Südosten des Magnesischen Tors bis hin zu den nördlichen Aus-läufern des modernen Ortes Acarlar. Es handelt sich also um eine Zone, die zum un-mittelbaren vorstädtischen Gebiet von Ephesos gehört. In der Antike fanden hier unterschiedliche Aktivitäten statt: Zwar ist davon auszu-gehen, dass das Areal über-wiegend landwirtschaftlich genutzt wurde, doch führte nicht nur die Hauptverbin-dungsstraße nach Magne-sia am Mäander hier durch, sondern es umfasste auch Teile der Südost-Nekropole. Im Surveygebiet liegt zudem die bedeutende neoli-thisch-frühbronzezeitliche Siedlung des Çukuriçi Höyük.
Es wurden insgesamt 41 Areale mit einer Gesamtfläche von ca. 300.000 m² begangen.
Der Survey bestand in einer systematischen Begehung nach Einzelfeldern, die sich im Wesentlichen an modernen Nutzungsgrenzen orientierte, sodass sowohl Geomorphologie als auch weitere Faktoren wie Bodensicht innerhalb eines Sur-veyareals nahezu identisch waren. Das Vorgehen folgte den Regeln eines intensi-ven Surveys, da der Suchvorgang in Dauer und Flächenabdeckung weitestgehend standardisiert war. Zudem wurden die unterschiedlichen Bewuchsverhältnisse be-rücksichtigt, sodass stark unterschiedliche Fundzahlen aufgrund von differierenden Sichtbarkeiten arithmetisch bearbeitet werden können. Die einzelnen Felder wurden nicht flächendeckend begangen, sondern es wurden einzelne Trakte im Abstand von regelhaft 10 m angelegt. Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin suchte einen Streifen von 2 m Breite ab. Bei einer regulären Länge von 50 m pro Trakt ergibt dies eine Suchfläche von 100 m² (= 1 a). Die effektive Abdeckung des tatsächlich abgesuch-ten Geländes innerhalb der einzelnen Suchfelder beträgt somit ca. 20 %.
Sämtliche Artefakte (Keramik, Ziegel, Glas, Metall, bearbeiteter Stein) sowie Mu-scheln und sonstige Tierreste wurden mithilfe von Handclickern gezählt. Ins Depot verbracht wurden nur ausgewählte Stücke von Keramik und bearbeitetem Marmor. Diese Sammelprozedur orientierte sich methodisch an dem Chronotype-System des Sydney Cyprus Survey Project und des Eastern Korinthia Archaeological Survey.
Methodisch ist die Begehung als intensiver ›off site-Survey‹ anzusprechen. Dies bedeutet im Einzelnen:
▪ Durch den Survey wurde ein bestimmtes Areal in einheitlicher Methode voll-ständig abgesucht.
▪ Der Survey ist nicht auf spezifische Fundstätten konzentriert, sondern ver-sucht ein möglichst großes Gebiet im Umland von Ephesos zu erfassen.
Aufgrund dieser Charakteristik ergibt sich auch der Zweck der Begehung: So sol-len anhand des an der Oberfläche registrierten archäologischen Materials Hinweise für die Nutzung des unmittelbaren Umlands von Ephesos gefunden sowie Aussagen über die zeitliche Stellung und den Charakter dieser Aktivitäten ermöglicht werden. Außerdem soll überprüft werden, inwieweit sich die Ausdehnung der Stadt im Ober-flächenmaterial niederschlägt. Schließlich sollte die Kampagne 2014 dazu dienen, grundlegende Surveymethoden zu erproben und Verfahren für zukünftige Feldbe-
Ephesos, Oberflächensurvey 2014. Blick auf die östliche Vorstadt von Ephesos (Foto G. Schörner)
Jahresbericht 2014
34
gehungen zu entwickeln. Dieses Ziel konnte erfüllt werden, da sich die angewandte Prozedur aufgrund ihrer Genauigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität und Schnelligkeit als sehr gut für off site-Surveys geeignet erwies.
Bereits beim jetzigen Stand, an dem noch keine Bearbeitung des Fundmaterials und detaillierte Auswertung der gesammelten Daten erfolgen konnte, zeigt sich, dass der Survey erfolgreich in der Erfassung unterschiedlicher ArtefaktHäufigkeiten war: Areale mit nur sehr geringen Fundzahlen wechseln ab mit Feldern, auf denen extrem viel Material festgestellt werden konnte. Während in einzelnen Feldern vor allem im Nordwesten des Surveyareals an die 10.000 Artefakte (Keramik, Ziegel, Marmorfragmente etc.) registriert werden konnten, sind andere Felder im Osten nahezu fundleer. Für eine genauere Betrachtung ist jedoch von Funddichten pro m² auszugehen, wobei noch zwischen verschiedenen Fundgattungen differenziert werden kann: Sowohl die Verteilung der Ziegel- als auch der Keramikfragmente belegt, dass vor allem die Felder innerhalb oder dicht an der Stadtmauer die mit Abstand höchsten Werte aufweisen. In Feld ESuS 8-1 wurde dabei eine Keramik-dichte von 7,79/m² respektive eine Ziegeldichte von 3,53/m² erreicht, was einem Ar-tefaktaufkommen von über 110.000 Artefakten/ha entspricht. Vergleichbare Dichten an Ziegelfragmenten konnten in der unmittelbaren Nachbarschaft dieses Felds und in Nähe des Magnesischen Tors festgestellt werden, doch wurde auf keinem annä-hernd so viel Keramik gefunden. Nur die Felder mit Ziegel- und Keramik-Maxima weisen relevante Mengen von Marmor- und Muschelfunden auf.
Die weiteren Surveyareale sind deutlich weniger fundreich. Allein Feld 30 im Bereich des Sarıkaya zeigt eine massive Ziegelkonzentration, während das Scher-benaufkommen spärlich bleibt. Interessant ist zudem die signifikante Zunahme von Keramik im äußersten Süden des Surveygebiets.
Grundsätzlich ist nach der Interpretation der Fundverteilungen zu fragen. Das Ergebnis bestätigt eindeutig den Zusammenhang zwischen Stadtmauerverlauf und Funddichte. Die Stadtmauer scheint also nicht nur eine Linie im Gelände gewesen zu sein, sondern antike Lebensrealität widergespiegelt zu haben. Sicher besteht ein Bezug zur Existenz der SüdostNekropole, wie auch das Auffinden von Fragmenten von Inschrifttafeln während des Surveys belegt, die nach H. Taeuber am ehesten in einen sepulkralen Kontext zu setzen sind. Wohl auf Grabbauten geht die hohe Zie-gelkonzentration in Feld 30 zurück. Ob jedoch die hohe Funddichte im Westen des
Ephesos, Oberflächensurvey 2014. Survey-flächen (G. Schörner)
Zentrale Wien
35
Surveygebiets allein auf die Existenz von Grabbauten zurückgeführt werden kann, erscheint fraglich, da sehr materialreiche Zonen auch innerhalb der Stadtmauer registriert werden konnten. Zudem spricht Fundmaterial wie Reste von Pressen und Mühlen aus Basalt nicht für eine sepulkrale Nutzung. Nur die genauere Auswertung der Keramikfunde sowie ein Vergleich mit Fundassemblagen aus Grabkontexten können zu sichereren Ergebnissen führen.
Ebenso charakteristisch wie die hohen Funddichten in Mauernähe ist die rasche Verringerung des Fundaufkommens nach Osten in Richtung der heutigen Straße nach Ortaklar/Magnesia. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass die antike Ober-fläche durch Schwemmland überlagert wurde. Da jedoch antike Scherben etc. nicht vollständig fehlen, kann nicht von einer vollständigen Überdeckung ausgegangen werden. Geht man von den aktuellen Surveyfunden aus, so ist für Ephesos an-scheinend kein weitreichender, mehrere Quadratkilometer umfassender ›Artefakt-Teppich‹ wie im Umkreis beispielsweise klassischer Städte in Böotien festzustellen, doch sind für weiterreichende Schlüsse weitere Surveys im Umfeld notwendig sowie post-depositionelle Ereignisse (Verlagerungen, Überdeckungen) auszuschließen.
Projektleitung: G. Schörner (Universität Wien); Mitarbeit: S. Defant, E. Fleischer, F. Hladky, B. Hopfensperger, K. Kainz, S. Mühling, F. Oppitz, R. Schachner, H. Schörner, J. Struberİlhan, E. Vlcek, Z. Yılmaz
I.1.3.6 RohstoffsurveyEin geologischer Survey diente dazu, verfügbare Tonrohstoffe der näheren Umge-bung des Çukuriçi Höyük zu identifizieren. Durch petrografische Analysen insbeson-dere der neolithischen und chalkolithischen Keramik konnten für die Region bislang unbekannte Tonpasten definiert werden, deren vermutlich regionale Herkunft es zu klären galt. Ein wesentliches Ziel des Surveys war es, die nähest gelegenen, in Frage kommenden Gesteinsformationen zu kartieren, die mit den nichtplastischen Einschlüssen der Keramik assoziiert werden können, um eine lokale oder regionale Provenienz der verwendeten Rohstoffe zur Diskussion zu stellen. Diese spezifi-schen Gesteine umfassten u. a. Amphibolit, Andesit/Vulkanite, Eklogit, und Talk. Zudem erschien sinnvoll, Sandproben von Flussläufen zu nehmen, da diese die Geologie des Hinterlandes reflektieren und somit Auskunft über die anstehenden Gesteinsformationen geben können.
Insgesamt konnten durch den Survey 41 GIS-Punkte eingemessen werden, die sich geografisch auf das Gebiet zwischen Yeniköy im Norden, Kuşadası im Süden und Selatin im Osten verteilen. Diese bezeichnen Orte von Interesse, an denen Ton- oder Lehmvorkommen, relevante Gesteine oder Flussläufe erkannt wurden. Vielfach bezeichnen sie ebenfalls Stätten, an denen geologische Proben genom-men wurden. In Summe wurden 9 Gesteins- und 22 Lehm- oder Sandproben für weiterführende Analysen ausgewählt.
Ephesos, Rohstoffsurvey 2014. Übersicht über einen Teil des im Zuge des geo-logischen Surveys unter-suchten Gebiets (Foto © Google Earth, Bearbeitung C. Kurtze)
Jahresbericht 2014
36
Einer detaillierten Untersuchung wurden das Arvalya Tal und Ausläufer des Bülbüldağ westlich des Çukuriçi Höyük unterzogen. Die lokale Geologie ist in beiden Fällen zumeist durch die Anwesenheit von Glimmerschiefern, Milchquarz, Marmor und sporadisch Sandstein und Kalkstein geprägt, dementsprechend set-zen sich auch die anstehenden Tonrohstoffe/Verwitterungslehme zusammen. Letz-
tere Kalksteine finden sich vermehrt beim Ausgang des Arvalya Tals im Norden, Richtung Pamuçak. Der anstehende Glimmerschiefer kann teilweise zu Chlo-rit umgewandelt sein, u. a. bei Messpunkt 19. Mess-punkt 19 ist des Weiteren durch seine Assoziation mit Amphibolit gekennzeichnet, und es konnte ein interes-santer Tonaufschluss identifiziert werden. Der Ton an jener Stelle ist sehr plastisch und damit bestens für eine Verwendung in der Keramikproduktion geeignet. Er ist durch Einschlüsse von Glimmerschiefer, Quarz-Glimmerschiefer und Quarz – soweit makroskopisch erkennbar – gekennzeichnet. Dieser Ton scheint nach einer ersten Einschätzung in seiner Zusammensetzung dem petrografischen Profil des am Çukuriçi Höyük be-
stimmten sog. petrografischen Hauptfabrikats zu entsprechen. Aufgrund der Nähe dieses Tonvorkommens zum Çukuriçi Höyük (ca. 2 km) könnte eine Herkunft des Petrofabrics aus der Region um Messpunkt 19 westlich von Acarlar durchaus plau-sibel sein.
Geröllführende Bäche südöstlich von Selçuk spiegeln die Geologie der Land-schaft wider. In einem ausgetrockneten Bachbett, das Messpunkt 32 entspricht, konnten Fragmente von Serpentinit, Peridotit, Glimmerschiefer, Milchquarz, Mar-mor und vereinzelt Amphibolit erkannt, eine Sandprobe aufgesammelt werden. Der Ursprung des Rinnsals ist in den Bergen im Südosten von Selçuk zu veror-ten, was sich mit den dort angetroffenen Gesteinsformationen (Messpunkte 20
und 21) deckt. Serpentinit kann hier vereinzelt in Talk umgewandet sein (Mess punkt 20), wenngleich nicht in solcher Form ausgeprägt wie östlich von Sirinçe (Mess punkt 31).
Die Erkenntnisse des Surveys bil-den einen wesentlichen Bestandteil der Interpretation der petrografischen Analyseergebnisse, um mögliche loka-le Keramikerzeugnisse von regionalen Produkten zu differenzieren. Generell sind alle in der Keramikproduktion ver-wendeten Tonrohstoffe in der unmittel-baren oder näheren Umgebung des Çukuriçi Höyük anzutreffen, abgesehen von mit Eklogit und Vulkaniten angerei-cherten Tonpasten, die im Zuge der geologischen Feldstudie vornehmlich zwischen Sirinçe und Selatin angetrof-fen wurden. Die geplante Untersuchung des aufgesammelten geologischen
Probenmaterials mittels Petrografie und Schwermineralanalysen wird genauere Aussagen erlauben, inwieweit die aufgefundenen Rohstoffe tatsächlich jenen der prähistorischen Handwerker entsprechen.
Projektleitung: B. Horejs (OREA, ÖAW); wissenschaftliche Bearbeitung: L. Pelo-schek, D. Wolf (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
Ephesos, Rohstoffsurvey 2014 (Foto L. Peloschek)
Ephesos. Rohstoffsurvey 2014. Tonaufschluss bei Messpunkt 19 (Foto L. Pe-loschek)
Zentrale Wien
37
I.1.3.7 MarmorsurveyIm Rahmen der laufenden Untersuchungen der ephesischen Marmore wurden von verschiedenen gut datierten Bauwerken Marmorproben gezogen. Bei den Proben handelt es sich um Fragmente von Marmor, die von nichtsichtigen Stellen und von Bruchflächen entnommen wurden. Unter anderem wurden der Memmiusbau, der Polliobau, der Domitiansbrunnen, das Serapeion, die Celsusbibliothek, das Trajans-nymphäum und die Obere Agora beprobt.
Das Ziel der Untersuchungen ist es festzustellen, ob und wie sich die Verwen-dung von Marmor und die Herkunft der Marmorteile im Lauf der Zeit verändert haben. Es zeichnet sich nach den bisher vorliegenden Ergebnissen der Trend ab, dass mit Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr. Importmarmore (z. B. aus Prokonnesos) in die Stadt kamen. In hellenistischer Zeit und in der frühen Kaiserzeit scheinen hauptsächlich ephesische Marmore verwendet worden zu sein.
Im Rahmen des Projekts zum vorhellenistischen Ephesos (M. Kerschner) wurde die geologische Zu-sammensetzung der sog. gelben Böden, die als Au-ßenniveaus zu den Tempeln des 7. Jahrhunderts im Artemision angelegt wurden, untersucht.
Projektleitung: W. Prochaska (Montanuniversität Leoben); Mitarbeit: H. Kaltenböck, F. Reiner
I.1.4 Konservierung/Restaurierung
I.1.4.1 HadrianstempelDank einer großzügigen finanziellen Unterstützung durch die Kaplan-Foundation konnten 2014 die res-tauratorischen Arbeiten am sog. Hadrianstempel abgeschlossen werden. Der Arbeitsumfang der Res-taurierung beinhaltete eine partielle Demontage und Wiederaufbau des Bauwerks, die Neuverklebung ge-brochener Marmorblöcke, die Reinigung sämtlicher Oberflächen, die Festigung geschädigten Marmorge-füges, die reduzierte Ergänzung von Fehlstellen so-wie die Sanierung des vorhandenen Bruchsteinmau-erwerks und der Betonelemente. Die Verbesserung der Standfestigkeit des Bauwerks wurde über eine Stahlringkonstruktion erreicht.
Die durchgeführten Arbeiten bestanden in einer gründlichen Freilegung und Rei-nigung mit Hammer und Meißel. Entfernt wurden hierbei zementgebundene, zu harte Mörtel und schadhafte Kalkmörtel der 60er Jahre, eingeschwemmte Erde sowie Nägel und Pflanzen. Besonders intensiv gestalteten sich diese Arbeiten im Bereich der Maurerkronen, welche bis zu zwei Steinlagen tief ihren Verband verloren hatten. Im Zuge dieser Freilegungsarbeiten wurde an der Außenseite der Westwand eine halbrunde Nische mit einem Fragment eines Mosaiks entdeckt. Die Nische ist von ihrer Ausrichtung her dem angrenzenden Komplex des Variusbads zugewandt.
Nach der Freilegung erfolgte der Antrag von Mauermörtel zum Schließen der Fehlstellen. Zur Anwendung kam hierfür ein Kalkmörtel mit hydraulischen Zuschlä-gen (Puzzolane) und lokalem Sand. Für die farbliche Anpassung an das römische Original wurde der Mörtel mit Ziegelmehl versehen. Die losen Steine der Mauerkro-ne wurden analog des überlieferten Bestands wieder aufgemauert. Partiell wurde das Bruchsteinmauerwerk ebenfalls erhöht, um ein Abfließen von Regenwasser zu ermöglichen und um Lackenbildung zu verhindern.
Ephesos, Hadrianstempel. Abbau des Gebäudes (Foto M. Pliessnig)
Jahresbericht 2014
38
Eine Spezialaufgabe bezüglich des Bruchsteinmauerwerks, aus dem sämtliche Wände der Cella und die vorspringenden Anten gefertigt sind, bestand in der Einrichtung einer an den Hadrianstempel anschließenden spät antiken Ziegelmauer im Osten. Diese drohte umzufallen und wurde mittels einer Holz-konstruktion und Wagenhebern wieder in ihre ursprüngliche Po-sition gedrückt. Die Stabilisierung erfolgte mit Ziegeln und dem Antrag von Mauermörtel.
Im Zuge der Restaurierung wurden die vier Podeste vor dem Tempel und das gesamte Gebälk bis zu den Kapitellen abgebaut. Grund für diese Tätigkeit waren der weit fortgeschrittene Grad an Korrosion von Eisenarmierungen und -verbindungen sowie der schlechte Zustand der Polyesterklebungen. Der Abbau erfolgte mit großer Unterstützung des Ephesos Museums Selçuk, wel-ches dafür Gerät und Personal zur Verfügung stellte. Insgesamt wurden 57 Steinteile – das entspricht 50 Werkblöcken – abge-baut und auf die Arbeitsplattform transferiert.
Die Haupt- und arbeitsintensivste Aufgabe im Rahmen der Restaurierung bestand in der Konservierung der originalen Mar-moroberflächen. Der Arbeitsumfang umfasste die Freilegung, Reinigung, Verklebung, Festigung, Ergänzung und Fotodoku-mentation. Aufgrund der Bedeutung werden die einzelnen Ar-beitsschritte getrennt voneinander beschrieben.
Den Beginn der Arbeiten bildete die grobe mechanische Frei-legung mit Hammer und Meißel. In diesem Arbeitsgang wurden sämtliche zement-gebundenen Ergänzungsmassen sowie Eisenelemente der 1960er Jahre entfernt. Besonders zeitintensiv gestaltete sich diese Tätigkeit im Falle des Architravs 040A, welcher an der Unterseite mit zwei Eisenbahnschienen stabilisiert worden war. Der zweite Schritt der Freilegung wurde mit dem pneumatischen Mikromeißel, dem Skalpell und Glasfaserradierern durchgeführt. Dieser Arbeitsschritt diente der Entfernung kleinster oder dünn aufliegender Reste von Polyester und Mörtel sowie der Dünnung von dicken Krustenbildungen über geschädigtem Marmorgefüge. Die an die Freilegung anschließenden Reinigungsverfahren entfernten den biogenen Bewuchs (Flechten, Algen, Pilze) und reduzierten Staub- und Schmutzkrusten. Zur Anwendung kamen diverse Nassreinigungsverfahren (Hochdruck- und Heißdampf-reiniger) sowie der Mikrosandstrahler. Darüber hinaus erfolgte die Behandlung mit Biozid (Preventol), um die vorhandenen Mikroorganismen abzutöten und eine rasche Wiederbesiedlung zu vermeiden. Den Abschluss der Reinigung bildete ein
partieller Antrag von Wasserstoffperoxid zur Homogeni-sierung der gereinigten Oberflächen und Erzielung eines einheitlichen Erscheinungsbildes.
Sämtliche historischen Klebungen der Anastylose mit Polyester wurden im Zuge der Restaurierung auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft und mussten mit einer Aus-nahme gelöst und neu verklebt werden. Für die Neuver-klebungen wurden die Bruchflächen mit dem Mikromeißel mechanisch gereinigt, anschließend wurde mit punktuell angetragenem Epoxidharz (Araldit und Akemie) und unter der Einbringung von Glasfaserdübeln neu verklebt. Insge-samt 13 Werkblöcke wurden derart behandelt. Neben der Zusammenfügung großer Teile war aber auch eine Ver-klebung einer großen Anzahl kleinerer Bruchstücke not-wendig. Besonders betroffen war erneut Architrav 040A,
wo sich im Grenzbereich der Eisenbahnschienen eine Vielzahl von Bruchstücken durch die Korrosion der Schienen vom Steinuntergrund gelöst hatte. Hier erfolgte die Verklebung ebenfalls mit Epoxidharz.
Ephesos, Hadrianstempel. Abbau der Bogenblöcke (Foto M. Pliessnig)
Ephesos, Hadrianstempel. Festigungsmaßnahmen mittels Injektionen (Foto N. Gail)
Zentrale Wien
39
Für die Festigung gestörten Marmorgefüges – Zonen mit Zuckerkorrosion – kam Nanokalk zum Einsatz (CaLoSil E25). Das Medium wurde mit der Spritze bis zur Sät-tigung des geschädigten Areals aufgetragen. Je nach Ausmaß des Schadens wurde diese Behandlung im Laufe mehrerer Tage bis zu zehnmal wiederholt, der Gesamt-verbrauch an Festigungsmedium für die Konsolidierung betrug 43 l. Im Anschluss daran wurden die gefestigten Areale noch mit einer sog. Schlämme nachbehandelt. Dabei handelt es sich um eine cremige Masse auf Kalkbasis, die mit dem Pinsel in die Oberfläche einmassiert wurde. Sie hat die Funktion das Oberflächenrelief zu verringern und zu glätten und dadurch höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber den Witterungseinflüssen zu gewährleisten. Oberflächlich sichtbare Rissstrukturen wur-den mit einer eigens dafür entwickelten und farblich angepassten Injektionsmasse geschlossen. Der Antrag erfolgte mit der Spritze oder mit der Spachtel. Die Notwen-digkeit der Rissinjektion betrifft die Verhinderung des Eindringens von Regenwasser in das Innere des Werkblocks.
Die letzte Maßnahme im Bereich der Marmorsteine umfasste verschiedene Arten von Ergänzungen. Im Allgemeinen wurde ein sehr reduziertes Konzept umgesetzt, der Großteil an Ergänzungen ist kleinflächig und dient der Sicherung von Bruchflä-chen kleiner Ausbrüche und der Schließung von Fehlstellen in der Umgebung von Rissen. Die Zusammensetzung sämtlicher Mörtel ist Marmormehl mit hydraulischem Kalk und Weißzement.
Darüber hinausgehende größere Ergänzungen wurden im Bereich statisch wichtiger Zonen, z. B. von Auflage oder Stand-flächen, gemacht. Des Weiteren wurden sämtliche Löcher auf der Oberseite der Werkblöcke – etwa Hebelöcher – konse-quent geschlossen, um dort eine Ansammlung von Wasser und Schmutz zu vermeiden.
Eine Sonderstellung im Rahmen der Ergänzungen nimmt die Komplettierung der Gesimssteine ein: Es wurde in abstrakter Form die Oberkante inklusive der über die Fassade vorspringen-den Elemente mit der Tropfnase rekonstruiert. In Zukunft sollte das auftreffende Regenwasser nicht mehr über die fragile plas-tische Dekoration der Fries- und Architravzone rinnen, sondern von der Tropfnase abgleiten. Die Lebensdauer der dekorativen Oberflächen sollte sich mit der Reduktion dieses wesentlichen Verwitterungsfaktors verlängern.
Der zweite Schwerpunkt der Arbeiten am Hadrianstempel bestand in der Sanierung der Betonelemente, welche im Zuge der Anastylose 1957/1958 der antiken Bausubstanz hinzugefügt worden waren. Durchgeführt wurden Freilegungsarbeiten in der Umgebung freiliegenden Eisens bis in eine Tiefe von 2 cm un-ter die Nullfläche des Betons. Des Weiteren wurden sämtliche Areale mit Betonabplatzungen oder intensivem Rissnetz durch Bewehrungskorrosion geöffnet. Danach wurden die korrodier-ten Eisen von ihren Korrosionsprodukten befreit (Drahtbürsten, Mikrosandstrahlgerät, Rostumwandler) und mit einem Rostschutzlack gestrichen.
Die Reinigung der Betonoberflächen geschah mit dem Hochdruckreiniger und im Falle der rötlichen Krustenbildungen der Regenschattenzonen mit dem Sandstrahl-gerät. Im Anschluss erfolgte die Applikation von Ergänzungsmörtel, der Antrag eines Porenfüller, einer Schlämme und eine abschließende Hydrophobierung.
Eine besondere Aufgabe bestand in der Herstellung einer rechteckigen Aus-arbeitung im Bereich der Hinteransichten der Türlaibungen. Diese Ausarbeitung entspricht dem Angelpunkt der ehemaligen Holzflügeltür der Cella, wie sie im westli-chen Rest der Türlaibung vorhanden ist. Die Rekonstruktion einer Orthostatenplatte der Vorhalle war eine weitere Herausforderung. Die Platte zeigte einen Baumangel und musste ausgetauscht werden. Die neue Platte wurde analog der Rekonstruk-tionen der 60er Jahre aus Beton hergestellt, das Bewehrungsgitter besteht aus
Ephesos, Hadrianstempel. Reinigung der Marmor-blöcke (Foto M. Pliessnig)
Jahresbericht 2014
40
rostfreiem Stahl. Die Oberfläche wurde nach der Ausschalung mit dem Zahneisen überarbeitet.
Die letzte Spezialaufgabe war die Ergänzung der nordwestlichen Ecke der Vorhalle, wo die Verbin-dung zwischen Portalwand und Ante auf Höhe des Frieses fehlte. Die Rekonstruktion dieses Bereichs erfolgte analog der angrenzenden Flächen in Beton. Die Mischung ent-sprach im Wesentlichen derjenigen der Orthostatenplatte, und auch die Bewehrung wurde aus rostfreiem Stahl hergestellt.
Der Wiederaufbau des abgebau-ten Gebälks und der Podeste erfolg-te nach deren Restaurierung auf der
Arbeitsplattform. Erneut erfreute sich das Projekt großer Unterstützung des Ephesos Museums Selçuk in Form von Gerät und Personal. Zum Einsatz kamen ein manuell zu bedienender Portalkran und ein Teleskopstapler.
Sämtliche Marmorblöcke wurden an ihren vorgesehenen Platz zurückgeho-ben und untereinander mit Klammern und Dübeln aus rostfreiem Stahl verbun-den. Die Verklammerung erfolgte in der Regel von der Oberseite her mit Rundstahl (14 – 16 mm) und Bandstahl (4 mm, 2 cm). Dübel finden sich zwischen Kapitellen und Architrav, der Verbindung des Gebälks mit den Antenwänden, im Bereich des Bogens und unterhalb des Eckgeisons. Die Metallelemente wurden mit Epoxidharz oder Zementmörtel eingebettet.
Besondere Beachtung im Rahmen des Wiederaufbaus galt der Verbesserung der Bogenkonstruktion, welche im vorgefundenen Zustand drei keilförmig nach unten geöffnete Fugen zeigte. Zu diesem Zweck wurden Schablonen von den Bogensteinen angefertigt und deren Form mit der realen Situation vor Ort verglichen. Zur Optimierung wurde schließlich der östliche Bogenansatz, eine Rekonstruktion aus Beton, um 4 cm gekürzt. Als Distanzhalter zwischen den Bogensteinen fungie-ren Bleiplättchen in den vier Ecken. Keilförmige Fugen konnten beim Wiederaufbau vermieden werden, alle Stoßfugen haben vollflächigen Kontakt.
Ephesos, Hadrianstempel. Abbau des Schlusssteins mit der Büste der Schick-salsgöttin Tyche (Foto M. Pliessnig)
Ephesos, Hadrianstempel. Friesblock vor und nach der Restaurierung (Foto N. Gail)
Zentrale Wien
41
Sämtliche Fugen der Konstruktion wurden mit mineralischen Mörtelmassen geschlossen. Zur Anwendung kamen Systeme aus hydrauli-schem Kalk mit Marmorsand. Der Mörtel wur-de über mehrere Tage feucht gehalten und die Oberfläche nach dem Anziehen abgekratzt.
Die horizontale Fläche des Portalgesimses wie auch die Fehlstellen des Horizontalgesim-ses der Fassade erhielten zur Verbesserung des Wasserabflusses ein Bleidach.
Im Rahmen des Restaurierungsprojekts wur-den auch Statik und Standfestigkeit des Bau-werks überprüft. Laut statischem Gutachten wurde der Horizontalschub des Bogens nicht ausreichend abgefangen und die Verbindung von Fassade und restlichem Baukörper war mangelhaft. Um diesen Zustand zu verbessern, einigte man sich auf die Einbringung einer an einer Stelle offenen Ringstahlkonstruktion.
Die Stahlkonstruktion verläuft in der Lagerfu-ge zwischen Architrav- und Frieszone und be-steht aus einem 2 cm starken und zwischen 25 und 50 cm breiten Blech aus rostfreiem Stahl. Es beginnt an den jeweiligen Bogenansätzen und verläuft von dort aus über die Anten nach hinten zur Portalwand. Die Verbindung zwischen den beiden Anten passiert an der Hinterseite der Portalwand. Die Kon struktion besteht aus mehreren miteinander verschweißten Teilen.
Die Verbindung von Blech und Bauwerk erfolgte mit Dübeln in die Architravzone von Fassade, Ante und Portalwand. Am Bogenansatz verlaufen die Dübel ebenfalls nach oben, um den Horizontalschub des Bogens aufzunehmen. Des Weiteren muss-ten für die statische Konstruktion zwei neue Steine auf die Portalwand aufgesetzt und ein Werkblock auf der Westseite (102A) komplettiert werden. Die Rekonstruktion der neuen Steine erfolgte in Marmor, diejenige des Werkblocks 102A in Anlehnung an das Konzept der Anastylose der 1960er Jahre mit einem zementgebundenen Mörtel. Um es widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse zu machen und es farblich besser in die Ruinenlandschaft zu integrieren, wurde das Blech abschließend noch gestrichen.
Den Abschluss der Restaurierung bildeten die Arbeiten am Boden. Begonnen wurden diese mit Freilegungsarbeiten, im Zuge derer sämtliche zementgebundenen, sehr harten Massen der Anastylose entfernt und das Beleuchtungssystem ausge-baut wurden. Entfernt wurde auch der gesamte Sand, und die historische Substanz wurde zur Gänze freigelegt. Nach Sichtung des Bestands wurde in der Cella ein Geotextil vollflächig ausgelegt und erneut mit Sand aufgeschüttet. Die Konstruktion aus Marmorblöcken vor der Nordwand der Cella wurde verfugt. Der rötliche Mörtel unter dem originalen Marmorboden in der nordöstlichen Cellaecke wurde mit Na-nokalk gefestigt.
Im Bereich der Vorhalle wurden die erhaltenen antiken Steinplatten verklebt, Risse wurden geschlossen, Ränder stabilisiert und schließlich der Fugenraum mit Mörtel aufgefüllt. Die großen Fehlstellen erhielten eine erneute Verfüllung mit Sand. Die Steinplatten sind jedoch allgemein in einem sehr schlechten Erhaltungszustand und können nur durch ein Betretungsverbot vor Zerstörung geschützt werden.
Projektleitung: M. Pliessnig; Mitarbeit: M. Ban, D. Hvězda, S. İlhan, M. Kulhanek, D. Macounová, B. Rankl, V. Topal
Ephesos, Hadrianstempel nach der Restaurierung im September 2014 (Foto N. Gail)
Jahresbericht 2014
42
I.1.4.2 Zustandserfassung SerapeionDie Tätigkeit der von der Ephesus Foundation finanzierten Restaurierungskampa-gne 2014 am Gebäudekomplex des sog. Serapeions in Ephesos bestand in dem Abschluss der Zustandserfassung der erhaltenen Marmorblöcke des monumentalen Tempels. Insgesamt wurden 58 Werkblöcke untersucht, mit den 155 Werkblöcken von 2012 und 2013 ergibt das eine Gesamtzahl von 212 Stück. Damit konnte 2014 die Begutachtung sämtlicher erhaltener größerer Blöcke des Serapeions erfolgreich beendet werden.
Im Allgemeinen offenbart sich der Erhaltungszustand der Marmorblöcke breit gefächert, und es finden sich stark geschädigte Fragmente bis hin zu sehr gut erhal-tenen vollständigen Blöcken. Als wesentliche Schadensbilder wurden Risssysteme und großteilige Verluste an Gesteinssubstanz festgestellt, die maßgeblich mit dem historischen Zusammensturz des Bauwerks in Verbindung stehen. Positiv fiel im Rahmen der Untersuchung der gute Zustand des Marmorgefüges auf. Laut den gemessenen Laufzeiten der Ultraschallwellen beschränken sich Entfestigungser-scheinungen, wie die für Marmor typische Zuckerkorrosion, ausschließlich auf dem oberflächennahen Bereich, im Inneren sind die Werkblöcke hingegen als ›gesund‹ und ohne Schädigung zu bezeichnen.
Abgeleitet von diesen Erkenntnissen ergibt sich für die zentrale Fragestellung – ob die Werkblöcke in Form einer Anastylose wieder verwendet werden können – eine grundsätzlich optimistische Einschätzung. Ausschlaggebend ist hierfür der gute Erhaltungszustand des Marmorgefüges. Neben diesem allgemeinen positiven Befund wurden im Rahmen der Untersuchung aber auch einzelne Problemzonen festgestellt. Es sind dies die monumentalen Säulenschäfte, die Ebene der Architrave sowie die Türlaibung und der Türsturz. Das Ausmaß nichtgeeigneter Blöcke beläuft sich nach den bisherigen Erkenntnissen auf 68 % im Bereich der Säulenschäfte und 32 % in der Architravzone.
Projektleitung: M. Pliessnig; Mitarbeit: D. Hvězda, M. Kulhanek, B. Rankl
I.1.4.3 Wandmalerei Hanghaus 2Ein Kernprojekt der Ephesus Foundation ist die nachhaltige Konservierung und Restaurierung der Fresken im Hanghaus 2. Im Jahr 2014 wurde in den Wohn-einheiten 2 (SR 27) und 6 (36b. 31a. 31b–c) gearbeitet. Nach ei-ner sorgfältigen Oberflächenreini-gung erfolgten die Arbeitsschritte Konsolidierung, Entfernung alter Füllungen und Ersetzen durch Mörtelfüllungen sowie Retuschen. Die neuen Füllungen basieren auf einem Kalkmörtelgemisch, das mithilfe chemischer Analysen in seiner Zusammensetzung der antiken Substanz nahekommt. Mikroorganismen wurden mit ei-
ner Preventol-3 %-Lösung in destilliertem Wasser behandelt, die mit Wasserfarben aufgetragenen Retuschen dienen der Lesbarkeit der Schmuckoberflächen. Eine besondere Herausforderung stellten bei früheren Restaurierungen verwendete Ac-rylharze dar, die vorsichtig entfernt werden mussten. Als ausgesprochen proble-matisch erwies sich die Reinigung im Hof SR 27. Hier waren die Wandmalereien durch eine Schädigung und Verkrustung der Oberflächen, aber auch unsachgemä-
Ephesos, Hanghaus 2. Gereinigte und konservierte Wand-malereien in der Wohn-einheit 6 (Foto N. Gail)
Zentrale Wien
43
ße ältere Restaurierungen stark in Mitleidenschaft gezogen und mussten mehrfach behandelt werden.
Projektleitung: G. Fulgoni, S. Gianoli; Mitarbeit: S. Battistello, E. Bertolini, V. Besta, J. Chalupka, M. Diascorn, F. Ghizzoni, T. Karafotias, G. Kocatepe, A. Mariani, B. Özcan, S. Sarzi Amadé, M. Tavasci, L. Vecchi
I.1.4.4 Wandmalerei spät antike Residenz südlich der MarienkircheDie Konservierung der Wandmalereien in der spät antiken Residenz konzentrierte sich auf die West-, Süd- und Nordmauer des Apsidensaals. In einem ersten Schritt wurden die Oberflächen mit einer weichen Bürste gereinigt und anschließend fol-gende konservatorische Schritte gesetzt: Behandlung der Mikroorganismen, Fes-tigung der Putzschichten, Ecken und der bemalten Oberflächen, Reinigung sowie Füllungen von Fehlstellen.
Projektleitung: S. Ladstätter; Projektdurchführung: P. Lascourrèges
I.1.4.5 Marmorsaal Hanghaus 2Im Marmorsaal wurden die Arbeiten unterbrochen und erst ab September 2014 wie-der aufgenommen. Gezielt wurde an den Platten der zweiten Zone gearbeitet, um diese im Jahr 2015 zu versetzen. Ferner wurden die Arbeiten an den gut erhaltenen opus sectile-Platten aufgenommen.
Projektleitung: S. Ladstätter; Projektdurchführung: S. İlhan
I.1.4.6 Konservierung/DepotDie dringend anstehende Renovierung des Restaurierungslabors in Ephesos wurde im Rahmen einer Begehung mit G. Kleinecke und W. Prenner, beide Naturhistori-sches Museum Wien, besprochen.
Die Metallfunde auf Basis von Kupferlegierungen wurden ausschließlich trocken-mechanisch gereinigt und freigelegt. Die trockenen Erdschichten wurden unter dem Mikroskop mit dem Skalpell reduziert, um die Qualität der Oberfläche und das Vorhandensein einer stabilen Patina zu prüfen. Anschließend wurden die Objekte mit rotierenden Bürsten unterschiedlicher Stärke (weiches bis hartes Ziegenhaar, weicher Eisendraht) gereinigt. Soweit die Lesbarkeit der Oberfläche noch von Kor-rosionsausblühungen beeinträchtigt war, wurde diese wiederum mit dem Skalpell unter mikroskopischer Vergrößerung reduziert. Insbesondere die Münzfunde mit nur mäßig gut erhaltenen Prägebildern verlangten ein mehrmaliges Überarbeiten mit Skalpell und Bürste. Abschließend wurden die Objekte mit Ethanol und Watte-stäbchen gereinigt und entfettet sowie mit einem Schutzüberzug aus dem Polyme-thylmethcrylat Paraloid B44 (5 – 7 % in Aceton) versehen.
Die Kupferfunde vom Çukuriçi Höyük wurden gesondert behandelt, um nach-folgende metallurgische Untersuchungen nicht zu beeinflussen. Erdauflagen und Korrosionsprodukte wurden ausschließlich mit dem Skalpell entfernt und für Ana-lysezwecke in Probenbehältern aufbewahrt. Werkzeug und Arbeitsplatte wurden nach jedem Fund gereinigt, um eine Kontamination der Proben auszuschließen. Abschließend erfolgte lediglich eine Reinigung mit weichen rotierenden Ziegenhaar-bürsten und Ethanol. Für den Schutzüberzug mit Paraloid B44 wurde eine maximale Konzentration von 5 % gewählt, um allzu starken Glanz zu vermeiden.
Auf den Einsatz des Korrosionsinhibitors Benzotriazol wurde nach einer Evalu-ierung der Münzfunde des Jahres 2013 verzichtet, da sowohl behandelte als auch
Jahresbericht 2014
44
unbehandelte gleichermaßen stabil geblieben sind. Lediglich an ein paar nichtver-schweißten Objekten fanden massive korrosive Veränderungen statt.
Auf die Bearbeitung neuer Eisenfunde wurde 2014 gänzlich verzichtet, da es sich sowohl bei der bislang gebräuchliche Freilegung mit rotierenden Schleifkörpern als auch bei der Anwendung des Korrosionsumwandlers Ferstab um Notlösungen handelte, die nicht den Standards in der Konservierung entsprechen. Mit der Aus-sicht auf die baldige Anschaffung von Mikrofeinstrahlgeräten, mit denen sich eine wesentlich höhere Oberflächenqualität erzielen lässt, wurde beschlossen, die Eisen-objekte zur Behandlung für die Kampagne 2015 zurückzustellen.
Eine Evaluierung der unbehandelten Funde aus der Grabung des Jahres 2013 zeigte, dass das Einschweißen des Eisens mit Trockenmittel seinen Zweck optimal erfüllt: an keinem Stück konnten korrosive Veränderungen festgestellt werden. Es wurde demnach lediglich das bereits erschöpfte Silikagel ausgetauscht, die Eisen-objekte wurden wieder verschweißt. Die grabungsfrischen Objekte wurden sofort nach der Bergung an der Luft getrocknet und ebenso mit dem Trockenmittel Silica-gel Neoblue verschweißt.
Weiters wurde das im Jahr 2013 zu Testzwecken entsalzte Objekt evaluiert. Ein eiserner Beschlag mit zwei Nägeln war über vier Wochen in einem Bad aus 0,5M-Natronlauge entsalzt und anschließend lediglich mit einem Überzug aus Paralo-id B44 versehen worden – als Alternative zur Behandlung mit Korrosionsumwand-lern. Auch dieses Objekt ist unter den trockenen Bedingungen in der Verpackung über den Lagerungszeitraum von sieben Monaten stabil geblieben.
Ein hohes Maß an korrosivem Zerfall trat hingegen bei Funden auf, die zwar mit Ferstab behandelt worden waren, jedoch offen im Depot gelagert wurden. Die verbleibenden Eisenkerne in den Objekten hatten wieder zu korrodieren begonnen, was zu zahlreichen Brüchen und großflächigen Verlusten an originaler Oberfläche führte. Funde dieser Art mussten erneut einer konservatorischen Behandlung unter-zogen werden. Der alte Überzug und die Acrylharzlage des Korrosionsumwandlers wurden in Bädern aus Aceton abgelöst, Korrosionsausblühungen mit rotierenden Bürsten mechanisch entfernt, die Oberflächen anschließend mit Ethanol entfet-tet und erneut mit Ferstab behandelt. Abschließend erfolgte das Aufbringen eines Schutzüberzugs aus Paraloid B44 (7 % in Aceton). Die abgeplatzten Schollen der Oberfläche konnten größtenteils wieder zugeordnet und ebenso mit Paraloid B44 fixiert werden. Durchgehende Brüche mussten hingegen mit Epoxidharz geklebt werden. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der ausschlaggebende Fak-tor bei der Stabilisierung der Eisenfunde die richtigen Lagerungsbedingungen sind. Es muss daher unbedingt eine regelmäßige Wartung der eingeschweißten Objekte erfolgen, um die Dichtheit der Schweißnähte und die verbleibende Wasseraufnah-mekapazität des Trockenmittels zu kontrollieren. Auf die Verwendung von Ferstab könnte zukünftig verzichtet werden, sofern die zeitlichen Kapazitäten für eine Ent-salzung des Eisens (1 – 3 Monate) gegeben sind.
Um das Entstehen gesundheitsschädlichen Staubs weitestgehend zu vermei-den, wurden die Bleifunde in Bädern aus Ethanol mit Pinseln gereinigt und störende Korrosionsauflagen anschließend im feuchten Zustand mit dem Skalpell entfernt. Abschließend wurde ein Schutzüberzug aus Paraloid B44 (7 – 8% in Aceton) auf-gebracht.
Die Konservierung der Glasfunde 2014 beschränkte sich abgesehen von we-nigen Ausnahmen auf die Reinigung der Oberflächen mit einem EthanolWasserGemisch (1 : 1 Vol) und Wattestäbchen sowie auf die Festigung mit Paraloid B 44 (7 % in Aceton). Bezüglich der Lagerung von Glasfunden fiel auf, dass die Verpa-ckung von mehreren Stücken in einem Kunststoffbeutel bzw. die Lagerung mehrerer solcher Beutel in einer Kiste zu Schäden führt. Das stark verwitterte Glas reagiert trotz Festigung sehr empfindlich auf mechanischen Druck. Die Verpackung und Endlagerung im Depot sollte deshalb zukünftig nicht platzsparend, sondern eher großzügig mit ausreichend Supportmaterial und Zwischenlagen erfolgen.
Zentrale Wien
45
Bei den Keramikfunden wurden vor allem restauratorische Maßnahmen ge-troffen, um die archäologische Aufarbei-tung des Materials zu ermöglichen. Die Oberflächen und Bruchkanten waren größtenteils mit Kalksinterkrusten be-legt, welche erstens die zeichnerische Dokumentation und zweitens die Rekon-struktion von Gefäßen durch Verklebung der Scherben behinderten. Der Sinter wurde deshalb nasschemisch in Bädern von 5 %-iger Ameisensäure entfernt. Die Keramik wurde zuerst für mehrere Minuten in Leitungswasser gelagert, um die Poren komplett aufzufüllen, und an-schließend in die Säure gelegt. Mit Kunst-stoffbürsten wurde die Reduzierung des Sinters beschleunigt, die Objekte wur-den so schnell wie möglich wieder ge-hoben. Die durchschnittliche Einwirkzeit lag bei etwa 1 min. Anschließend galt es, die Säure so vollständig wie möglich zu entfernen, was mit wechselnden Bädern aus Leitungs- und deionisiertem Wasser für mindestens 24 Stunden bewerkstel-ligt werden sollte. Während der Be-handlung wurden regelmäßig pH-Wert und Leitfähigkeit der Lösung gemessen, um den Endpunkt der Dekontamination und Entsalzung bestimmen zu können. Die Trocknung der Funde erfolgte an der Raumluft und wurde mit Gewichts-kontrolle verfolgt. Um die Stabilität der anschließenden Klebung zu gewährleis-ten, mussten die Bruchflächen gefestigt werden. Hierfür wurde Paraloid B44 in Aceton (5 %) verwendet. Als Klebeme-dium diente das Polyvinylbutyral Mowital B30H in Aceton (30 %).
Da die Behandlung mit Säuren oft auch die Oberfläche oder die Matrix der Keramik verändert, wurde bei jenen Stü-cken, die für eine archäometrische Un-tersuchung in Frage kamen, mindestens 5 g an Probenmaterial zurückbehalten. Bei relativ vollständigen Gefäßen bot sich das Aufbewahren ganzer Scherben an, die an einer offenen Bruchkante ge-kennzeichnet und mitverklebt wurden.
Auf Ergänzungen wurde weitestgehend verzichtet – nur in Ausnahmefällen muss-te aus stabilisatorischen Gründen eine Gipsergänzung gesetzt werden. Keramische Kleinobjekte, die nicht ohne optische Beeinträchtigung beprobt werden konnten, wurden lediglich mechanisch mit dem Skalpell unter dem Mikroskop entsintert.
Objekte aus Bein kamen bei allen Ausgrabungen gleichermaßen in Form von Werkzeugen und Haarnadeln vor. Sie wurden mit einem Ethanol-Wasser-Gemisch (1 : 1 Vol.) bzw. Ethanol-Wasser-Ammoniak-Gemisch (24 : 75 : 1 Vol.) und Wattestäb-chen gereinigt, etwaige Schlieren aus Kalksinter wurden mit dem Skalpell unter dem
Ephesos, Konservierung. Glasfunde aus der spät-antiken Residenz südlich der Marienkriche vor und nach der Reinigung (Foto D. Oberndorfer)
Jahresbericht 2014
46
Mikroskop entfernt. Klebungen wurden mit Paraloid B44 (30 % in Aceton) vorgenom-men. Eine Festigung erwies sich lediglich im Fall der Elfenbeinfigurine als notwendig.
Während der Analyse von Holzkoh-leproben kamen mehrere Stücke mit un-deutlich sichtbaren Bearbeitungsspuren zum Vorschein und wurden nach der Holzbestimmung als Artefakte ins Kon-servierungslabor gebracht. Die Reinigung erfolgte unter dem Mikroskop mit diversen Pinseln und Druckluft aus dem Blasebalg. Die Fragmente waren völlig ausgetrocknet und dementsprechend spröde und fragil. Um den Erhalt der Form zu gewährleis-ten, musste zeitgleich eine Festigung er-folgen. Als Festigungsmedium wurde Pa-
raloid B44 gewählt. Da das Einlegen in Bäder zur Volltränkung möglicherweise zu einer Zerstörung der Strukturen geführt hätte, wurde lediglich eine 5 %-ige Lösung des Harzes in Ethylacetat mit der Spritze aufgebracht. Es konnte so ein ausreichender Festigungseffekt erzielt werden, ohne das Erschei-nungsbild durch übermäßigen Glanz zu beeinflus-sen. Etwaige Brüche wurden mit Paraloid B44, 30 % in Aceton, geklebt. An einigen der Stücke war nach der Behandlung eindeutig eine intentionelle Formge-bung oder Verzierung der Oberfläche zu erkennen.
Ein geborgenes Holzbrett musste vor dem eigent-lichen Konservierungsverfahren von anhaftenden Lehmauflagen befreit werden. Da das Holz aufgrund des abgebauten und wassergesättigten Zustands sehr empfindlich auf Druck und mechanische Be-anspruchung reagierte, wurden die Erdreste an der Oberfläche mit einem sanften Wasserstrahl entfernt. Nur partiell erfolgte die Entfernung stärker anhaften-der Reste durch weiche Bürsten. Um das Brett vor
dem Austrocknen zu schützen und wasserlösliche, schädliche Verbindungen zu lösen, wurde es nach der Bergung in ein Bad aus entionisiertem Wasser eingelegt. Da bei der Untersuchung von Fragmenten mittels pXRF ein erhöhter Eisengehalt im Holz festgestellt wurde, musste ein Konzept zur Entfernung der Eisenverbin-dungen erstellt werden. Als eine durchführbare Möglichkeit wurde die Entfernung bzw. Reduktion der Eisenverbindungen durch den Komplexbildner Ethylendiamin-tetraessigsäure (EDTA) gewählt. Dieser Komplexbildner formt mit den Eisenatomen stabile Komplexverbindungen, die anschließend durch Wasser aus der Holzstruktur herausgelöst werden können. Hierfür wurde das Brett in eine EDTA-Lösung (4 % in entionisiertem Wasser) eingelegt. Nach der erfolgten Entsalzung muss die Lö-sung durch entionisiertes Wasser getauscht werden, um die Komplexverbindungen aus dem Holz zu lösen. Als konservierende Maßnahme soll das Objekt schließlich mit Polyethylenglycol (PEG) unterschiedlichen Molekulargewichts getränkt werden. Durch die Tränkung soll das Wasser in der Holzstruktur sukzessive durch PEG ersetzt werden. Dies gewährleistet u. a. die Dimensionsstabilität des Holzes wäh-rend der anschließenden Trocknung und Lagerung. Die vollständige Tränkung des Objekts mit PEG wird etwa ein Jahr in Anspruch nehmen.
Ephesos, Konservierung. Tondeckel aus der spät-antiken Residenz südlich der Marienkirche vor und nach der Restaurierung (Foto D. Oberndorfer, N. Gail)
Zentrale Wien
47
Da auch während der Abwesenheit der Restauratoren in den Wintermonaten die Lösungen gewechselt werden müssen, wurde ein Mitarbeiter entsprechend einge-schult.
Projektleitung: S. Heimel, D. Oberndorfer; Mitarbeit: E. Geijer, K. Länger, E. Şimşek, M. Vukov
I.1.4.7 Klimamessung/Hanghaus 22014 wurden die sechs Datenlogger, die seit 2012 zur Erfassung der Klimaverhält-nisse im Depot verwendet worden waren, abgebaut und im Hanghaus 2 installiert. Dort wurde die Position der Datenlogger so gewählt, dass die klimatischen Verhält-nisse nahe dem Mauerwerk aufgezeichnet werden. Als Referenz dient ein östlich des Gebäudekomplexes im Außenbereich installiertes Gerät.
Die Aufzeichnung der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit erfolgt alle 30 min. Um ein möglichst aussagekräftiges Bild der klimatischen Verhältnisse im Hanghaus 2 zu erhalten, sollen die Daten für mindestens ein Jahr aufgezeichnet werden.
Projektdurchführung: D. Oberndorfer
I.1.4.8 Sieben-Schläfer-CoemeteriumFür das von der American Foundation of Ephesus finanzierte Konservierungspro-jekt des Sieben-Schläfer-Coemeteriums wurden die Grundlagen geschaffen, sodass 2015 mit der konkreten Planung begonnen werden kann.
Projektleitung: R. Nardi (Centro di Conservazione Archaeologica, Rom); Mitar-beit: A. Bramberger, N. Zimmermann (DAI Rom), C. Zizola
I.1.5 Depotarbeiten/Analytik
I.1.5.1 AnthropologieVon den insgesamt 65 untersuchten Individuen kommen 63 aus dem Friedhofsbe-reich des sog. Byzantinischen Palasts der Grabungen 2007 – 2009. Die 2014 unter-suchten menschlichen Überreste stammen aus den beiden Ossuarien Grab 8 und 9, den Knochendeponien 1 – 4, der sog. Knochenkonzentration sowie einem Grab-haus in Sondage 24. Weiterhin wurden noch Lesefunde aus der Oberflächennähe sowie sämtliche bisher nicht aufgenommenen menschlichen Skelettelemente von diesem Friedhof ausgewertet. Die aus diesen Objekten stammenden menschlichen Überreste repräsentieren bis auf wenige Ausnahmen keine vollständigen Skelet-te in situ. Vielmehr wurden offenbar die Knochen aus etwa bei Neubestattungen gestörten Gräbern gesammelt und gemeinsam mit denen aus anderen, ebenfalls gestörten Gräbern wiederbestattet. Häufig in diesen Ossuarien vertreten waren vor allem die großen Langknochen wie Oberarm, Schienbein und Oberschenkel-knochen, aber auch Schädel. Deutlich unterrepräsentiert erscheinen Rippen sowie kleinere Knochen wie Wirbel, Hand- und Fußknochen. Die selektive Auslese und Präferenz bestimmter, eher größerer Skelettelemente entspricht interessanterweise dem Bild europäischer Beinhäuser, in denen sich auch heute noch vor allem gesta-pelte Oberschenkel und Schädel finden. Die Wiederbestattung dieser ausgesuchten Skelettelemente auf dem Friedhof des ›Byzantinischen Palasts‹ erfolgte wohl wie auch hier nach der Devise pars pro toto.
Die makroskopische und paläopathologische Aufnahme der Skelette vom Fried-hof des sog. Byzantinischen Palasts konnte 2014 abgeschlossen werden. Sowohl
Jahresbericht 2014
48
Männer als auch Frauen waren vertreten. Anzumerken ist, dass im Gegensatz zu den bisher untersuchten Skeletten aus der römischen Hafennekropole und dem Friedhof um die anonyme Türbe im Artemision der Geschlechtsdimorphismus der untersuchten byzantinischen Skelette eher gering ausgeprägt war. Auffallend hoch war die Anzahl eher älterer Individuen ab dem maturen bis hin in das senile Alter. Entsprechend hoch war auch die Häufigkeit alterstypischer Pathologien wie de-generative Veränderungen der Wirbelsäule, ausgefallene Zähne sowie Varikosen der Stämme der tiefen Venen. Wie auch bei den Skeletten aus den vollständigen Gräbern fanden sich an den Gebissen Hinweise auf vermehrten Fleischkonsum. Möglicherweise könnten sowohl das oftmals reifere Lebensalter als auch der häufi-gere Genuss von Fleisch ein Hinweis darauf sein, dass die Bestatteten vom Friedhof am ›Byzantinischen Palast‹ einer höheren gesellschaftlichen Schicht entstammten.
Den Abschluss bildete die Untersuchung der Skelette aus dem römerzeitli-chen Sarkophag von der Damianosstoa, welcher im letzten Jahr am Osthang des Panayırdağ vor Antikenraub gerettet wurde. Die meisten Skelette aus dem Sarko-phag befanden sich bereits bei ihrer Freilegung und Bergung in einem dislozierten und nichtzusammenhängenden Zustand. Vor der eigentlichen Untersuchung muss-ten die geborgenen Skelettelemente den unterschiedlichen, nach und nach in dem Sarkophag bestatteten Individuen zugeordnet werden. Es ließen sich bereits min-destens sieben Erwachsene sowie vier Kinder identifizieren. Ein wesentlicher Teil der Langknochen der Erwachsenen konnte bereits aus z. T. kleinen und kleinsten Fragmenten rekonstruiert und den einzelnen sieben Individuen zugeordnet wer-den. Viele dieser Langknochen, aber auch der dazugehörigen Schädel tragen nicht nur alte Bruchränder durch die häufige Neubelegung des Sarkophags in antiker Zeit, sondern auch frische, von scharfen Werkzeugen (Schaufel [?]) stammende Schnittmarken und Brüche waren an den Knochen aus den oberen Schichten zu beobachten, die wohl durch das Werkzeug der Raubgräber entstanden sind. Glück-licherweise ließen sich nach der Sicherung des Sarkophags die zwei auch nament-lich in einer Inschrift erwähnten Primärbestattungen weitgehend in situ bergen und auf Grundlage der archäologisch-anthropologischen Fundsituation auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zuordnen. Es handelt sich zum einen um eine etwa 45 – 60 Jahre alte, sehr zierliche Frau mit einer Körpergröße von etwa 155 – 160 cm, welche als Erste in den Sarkophag gelegt worden war. Ihr folgte wohl wenige Jahre später ein 60 – 70 Jahre alter, kräftig gebauter Mann, der mit einer Körpergröße von etwa 165 – 170 cm etwas größer als viele andere römerzeitliche Ephesier war.
Projektleitung: M. Steskal; Mitarbeit: G. Bjørnstad, J. Nováček, K. Scheelen
I.1.5.2 ArchäobotanikDie Zerstörung der spät antiken Residenz südlich der Marienkirche durch ein Bran-dereignis ließ vor allem für die Archäobotanik ein reiches Fundensemble erwarten, weshalb aus allen Bereichen Bodenproben für archäobotanische Analysen entnom-men wurden. Die Pflanzenreste wurden noch während der Grabung mittels Flotation von der Matrix getrennt. Leider erbrachte die Analyse der traditionellen Großreste (Samen und Früchte) nur wenig bereits Bekanntes, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass bisher weder Speicher noch Abfalldeponien ergraben wurden.
Die Holzkohlenanalyse bzw. Anthrakologie hingegen stützt sich auf ein reiches Fundmaterial. Anhand einer Vielzahl diagnostischer Merkmale (vor allem mikrosko-pische Gewebs- und Zellwandstrukturen) können auch sehr kleine Holzkohlenfrag-mente von nur wenigen Millimetern Kantenlänge bestimmten Gehölzen zugeordnet werden. So unterschiedliche Materialien wie Konstruktionshölzer, Möbelstücke oder Brennholz erschließen sich somit der archäologischen Bearbeitung und mit ihnen auch Fragen zur Land- und Forstnutzung sowie zur Nutzung von Werkstoffen der Spät antike.
Zentrale Wien
49
Das im Grabungshaus von Ephesos eingerichtete archäobotanische Labor mit Spezialmikroskop ermöglicht die schnelle und treffsichere Bearbeitung des aus Flotationsproben oder direkter Entnahme stammenden Holzkohlenmaterials. 2014 wurden über 2.000 Holzkohlenfragmente vor allem aus den Grabungskampagnen 2012 und 2013 analysiert.
Die Ergebnisse bieten durchaus bereits Sensationelles: Neben den vermutlich vor allem in der Dachkonstruktion verwendeten Hölzern, vor allem Eiche, Kiefer und Tanne oder Zeder, fanden sich zahlreiche durch Schnitzereien verzierte Holzkohlen-stücke, die aus Walnuss- und Eibenholz gefertigt sind und vermutlich von Mobiliar stammen. Kommende Untersuchungen werden klären, ob die Eibe während der Spät antike überhaupt im Golf von Izmir vorkam, oder ob dieses langsam wüchsige und deshalb teure Holz aus dem Fernhandel stammt. Die Rolle weiterer Hölzer (z. B. Ölbaum, Esche, Linde und Ulme) als Werkstoffe für besondere Objekte im Haushalt ist noch weiter aufzuklären.
2014 konnte erstmals auch feucht erhaltenes Holz des geöffneten seldschuki-schen Brunnens am Artemision untersucht werden. Die Balken ließen sich aufgrund ihrer hervorragenden Erhaltung noch eindeutig als Eiche identifizieren. Ihr Fund lässt ähnlich gut erhaltenes Pflanzenmaterial in der Brunnenverfüllung erwarten. Es könnte hier also ein einzigartiges vegetationsgeschichtliches Archiv vorliegen.
Projektleitung: U. Thanheiser (VIAS, Universität Wien); Mitarbeit: A. Heiss
I.1.5.3 Archäometrie
Archäometrische Analysen zur neolithischen bis frühbronzezeitli-chen Keramik und potenziellen Tonrohstoffen des Çukuriçi HöyükFortgesetzt wurden archäometrische Keramikanalysen im Zuge des FWF-Projekts 25825 »Wechselwirkungen prähistorischer Protech-niken in Handwerk und Gewerbe. Rohstoffquellen, technologische Entscheidungen und Einflüsse auf dem Çukuriçi Höyük«, die sich im Jahr 2014 vordergründig auf die wissenschaftliche Auswertung von 377 keramischen Dünnschliffen konzentrierten. Mit dieser Anzahl an Dünnschliffen sind nun alle bislang identifizierten Warengruppen der Phasen ÇuHö X bis ÇuHö III abgedeckt und eine erste Ein-schätzung über Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der Auswahl und Verarbeitung von Tonrohstoffen gewährleistet. Aus diachroner Perspektive lässt sich festhalten, dass lediglich die Verwendung ei-ner Tonpaste epochenübergreifend vom späten Neolithikum bis in die Frühbronzezeit nachweisbar ist. Es handelt sich um das bereits 2013 vorgestellte sog. petrografische Hauptfabrikat, das durch eine dichte Anreicherung mit grobkörnigen Glimmerschieferfragmenten charakterisiert ist. Eine Gegenüberstellung der technologischen Merkmale prähistorischer Gefäßkeramik aller am Tell nachgewie-senen Siedlungsphasen lässt die Tendenz einer Spezialisierung im Handwerkssektor in der frühen Bronzezeit erkennen. Während zu-vor nur in Ausnahmefällen eine bewusste Manipulation des Rohtons durch den Töpfer nachweisbar ist, wird dies am Beginn des 3. Jahr-tausends v. Chr. zur Regel. Mit Marmorsplittern und Marmormehl ge-magerte Keramik erfreut sich ebenso wie mit Sand gemagerte und durch das Mischen zweier Tonsorten definierte Keramik Popularität.
Fokussiert man auf die Ausbeutung von Tonrohstoffen der geo-logischen Landschaft um den Çukuriçi Höyük, so offenbart sich im Neolithikum eine Präferenz von zu Serpentinit assoziierten Ton-sedimenten für die Produktion keramischer Gefäße. Hierunter kann u. a. ein symptomatisches Keramikfabrikat subsumiert werden, das
1
2
3
1 Çukuriçi Höyük, archäo-metrische Analysen. Kera-mikfabrikat mit Asbestfa-sern (Foto L. Peloschek)
2 Çukuriçi Höyük, archäometrische Analysen. Aktinolithschiefer und vulkanische Gesteins-partikel (vulkanisches Glas) in neolithischem Keramikfragment (Foto L. Peloschek)
3 Çukuriçi Höyük, archäometrische Analysen. Beispiel eines chalkolithi-schen Keramikfabrikats mit Andesiteinschlüssen (Foto L. Peloschek)
Jahresbericht 2014
50
durch die Anwesenheit von Asbestfasern – ein Verwitterungsprodukt von Serpen-tinit – gekennzeichnet ist. Deutlich dominanter im neolithischen Fundspektrum tritt ein Keramikfabrikat in Erscheinung, das eine hohe Quantität an Aktinolithschiefer enthält, wobei sich in wenigen Fällen vulkanische Gesteinspartikel (vulkanisches Glas, Andesit [?]) beigemengt finden. Während Aktinolith aus der Umgebung, etwas entlang der modernen Straße nach Meryemana, bekannt ist, lassen sich Vulkanite genannter Lithologie nicht mit der natürlichen Geologie der Landschaft vereinba-ren. Es mag demnach naheliegen, die intentionelle Beimengung von vulkanischen Gesteinspartikeln zu einem lokalen Tonrohstoff zu vermuten.
Prinzipiell lässt sich im Chalkolithikum jedoch eine neue Orientierung am Kera-miksektor erkennen. Feinkörnige Tonpasten kommen in der lokalen Keramikproduk-tion häufiger zum Einsatz als zuvor. Signifikant ist jedoch die Erkenntnis, dass ein deutlicher Anstieg von Keramikfabrikaten zu verzeichnen ist, die nicht mit der loka-len Geologie kompatibel zu sein scheinen. Keramik aus vulkanogen beeinflussten Gebieten, ersichtlich durch eingelagerte Fragmente von Granit, Andesit und silizium-haltigen umgewandelten Vulkaniten, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Eine Her-kunft aus dem Gebiet um Izmir und die ÇeşmeHalbinsel könnte in Betracht gezogen werden. Zur Diskussion bleibt zu stellen, ob die Zunahme jener Keramikfabrikate als Reflex neu entstandener weitreichender kultureller Kontakte gewertet werden darf.
Projektleitung: B. Horejs (OREA, ÖAW); wissenschaftliche Bearbeitung: L. Pe-loschek
Archäometrische Keramikanalysen in EphesosBezüglich des keramischen Materials aus Ephesos ist vordergründig auf die umfas-sende Evaluierung und Auswertung von 119 Proben geometrischer und archaischer Zeitstellung aus den Ausgrabungen auf der Tetragonos Agora im Dünnschliff zu verweisen. Basierend auf ihrer Zusammensetzung konnten die Keramikartefakte insgesamt 22 petrografischen Fabrikatsgruppen (Petrofabrics) zugeordnet wer-den. Neben unzähligen lokalen und regional zu verortenden Tonpasten wurden ferner mehrere als Importwaren zu wertende Gefäße identifiziert. Eine genauere Herkunftsbestimmung konnte in Bezug auf Mortaria durchgeführt werden, die sich aufgrund der Anwesenheit von Mikrofossilspezies, Pyroxenen, aber auch Horn-
stein und Radiolarit plausibel mit einer Herkunft aus Zypern vereinbaren lassen. Eine beträchtliche Quantität der beprobten Fundstücke kann mit vulka-nisch beeinflussten geologischen Landschaften in Beziehung gesetzt werden. Als diagnostische Ge-steinseinschlüsse sind Andesit, vulkanisches Glas, Bimsstein, möglicherweise aber auch Rhyolith und Dazit zu nennen. Aus geologischer und kulturhisto-rischer Perspektive kann auf eine Herkunft aus der weiteren Region um Izmir und weiter nach Norden bis Phokaia oder Pergamon geschlossen werden. Gezielte Röntgenfluoreszenzanalysen am Fitch Laboratory der British School in Athen und der Ab-gleich der hierdurch gewonnenen Analyseergebnis-se mit publizierten Referenzdaten legt aber nahe, dass mehrere Gefäße aus der Umgebung von Per-
gamon stammen dürften. Dazu zählen u. a. lydisierende Gefäßformen.Um lokal ephesische petrografische Referenzgruppen zu definieren, wurden
ausgewählte Keramikfragmente aus der Verfüllung des archaischen Töpferofens der Tetragonos Agora im Dünnschliff analysiert. Da es sich jedoch durchgehend um Feinkeramik handelte, in welcher sich lediglich feine Quarz- und Muskowitpartikel eingelagert fanden, konnte keine aussagekräftige petrografische Signatur dieser Produktionsstätte erstellt werden.
Ephesos, archäometri-sche Analysen. Zwei der beprobten dünnwandigen Kochtöpfe (Foto L. Pelo-schek)
Zentrale Wien
51
Einen wesentlichen Forschungsschwerpunkt des Jahres 2014 bildete die erstmalige umfassende archäometrische Klassifikation und Beprobung der Küchenware aus Ephesos, die im Rahmen eines Dissertationsvorhabens von J. Erci bearbeitet wird. Chronologisch von späthellenistischer bis spät-antiker Zeit angesetzt, wird mittels naturwissenschaftlicher Untersuchungen zu klären sein, inwieweit sich diachron ein Wechsel der Handelsbeziehun-gen von Ephesos nachzeichnen lässt und sich damit ebenfalls kulturelle Ein-flüsse ändern. Dem gegenüberzustellen ist die lokale Keramikproduktion, wobei aufzuzeigen sein wird, ob im Laufe der Jahrhunderte Tonrohstoffres-sourcen oder Produktionsmodi in der Herstellung dieser Alltagskeramik eine Änderung erfuhren. Die Auswahl der relevanten Objekte orientierte sich an bereits publizierten Fundkomplexen aus dem Hanghaus 2 (Wohneinheiten 1, 2, 4 und 6), dem sog. Lukasgrab, dem Vediusgymnasium und einem Schachtbrunnen am sog. Staatsmarkt von Ephesos. Formtypologisch re-präsentiert finden sich hierbei neben Kochtöpfen auch Kasserollen, Koch-pfannen, Schüsseln, Krüge oder Teller.
Methodisch bildete das Mikroskopieren der Gesamtheit von 362 Fundstücken im frischen Bruch eine wesentliche Komponente, um makroskopische Fabrikatsgruppen zu bil-den. Die anhand Charakter, Quantität, Form, Größe und Sor-tierung der anwesenden nichtplastischen Einschlüsse gebil-deten 30 Fabrikatsgruppen vermittelten bereits einen ersten Eindruck über das zu erwartende Spektrum an keramischen Lokal- und Importwaren. Bei den Lokalprodukten dominiert ein farblich orangerotes, stark glimmerhaltiges (Glimmer-schiefer) Fabrikat, das in Ephesos ab prähistorischer Zeit bekannt ist. Einer vorläufigen Einschätzung nach wird dieser lokal leicht verfügbare Tonrohstoff auch im Späthellenismus bis in die Spät antike konstant u. a. für die Produktion von Küchenware eingesetzt.
In der Spät antike jedoch scheint sich hierzu eine kalkhal-tige Variante dieses Tons zu reihen oder gewinnt beträchtlich an Bedeutung, was jedoch noch analytischer Bestätigung be-darf. Als Importe angedachte Gefäße sind zumeist durch ihre Grobkörnigkeit charakterisiert und aufgrund ihrer für Ephesos unbekannten, oftmals mit vulkanogen beeinflussten Gebie-ten assoziierten Einschlüssen sowie der Abwesenheit der für Ephesos symptomatischen Glimmerschiefer zu identifizieren. Basierend auf den makroskopischen Fabrikatsgruppen konn-ten 124 relevante Keramikfragmente ausgewählt werden, von denen Dünnschliffe hergestellt wurden. Ihre Auswertung wird weitere Aufschlüsse über die Herkunft und technologischen Eigenheiten (z. B. in Bezug auf die Hitzeleitfähigkeit) dieser Keramikware geben und eine Rekonstruktion essenzieller Aspekte des ephesischen Alltagslebens (z. B. Kochprozesse) sowie des gezielten Handelns mit funktionaler Keramik erlauben.
Nachdem von M. Kerschner und H. Mommsen (Bonn) seit geraumer Zeit Neu-tronenaktivierungsanalysen (NAA) an vorhellenistischer Keramik aus Grabungen im Stadtgebiet von Ephesos durchgeführt werden, konnten im Zuge der Kampag-ne 2014 ergänzend petrografische Dünnschliffe dieser Referenzproben angefertigt werden. Dies erlaubt, Stücke mit sicher nachgewiesener Herkunft nun ebenfalls in ihren Mineral- und Gesteinsbestandteilen zu charakterisieren, was ohne geochemi-sche Verifizierung für Feinkeramik kaum zu bewerkstelligen wäre. Von jeder bislang durch Kerschner und Mommsen definierten und vorgelegten ›Herkunftsgruppe‹ wur-den, nach Möglichkeit, drei Keramiken für die Präparation als Dünnschliff ausge-wählt und diese hergestellt. Keramik unterschiedlicher Provenienz aus Produktions-
Ephesos, archäometrische Analysen. Herstellung von Dünnschliffen in der Res-taurierungswerkstatt des ÖAI in Selçuk (Foto L. Peloschek)
Jahresbericht 2014
52
zentren der ionischen Landschaft konnte als Resultat erfasst werden, dazu zählen beispielsweise Produktionen in Teos, Mi-let oder Samos. Als wichtigstes Resultat kann wohl die Zuweisung der ›Herkunfts-gruppe L‹ zu einem Produktionszentrum mittels petrografischer Analysen gelten, was bislang anhand der NAA nicht mög-lich war und somit die Bedeutung inter-disziplinärer Studien und der Anwendung unterschiedlicher analytischer Techniken unterstreicht. Geochemische Messun-gen an den Keramikfragmenten mithilfe eines portablen Röntgenfluoreszenz-spektrometers (pXRF) wurden an allen beprobte Keramikfragmenten vorgenom-men, um die Aussagekraft und Gültigkeit dieser neuen zerstörungsfreien Analyse-methode an bereits zuvor im Labor unter-suchten Keramikartefakten zu testen. Die Auswertung dieser Daten ist noch nicht abgeschlossen.
Die Methode des pXRF wurde ebenfalls in Bezug auf große Keramikensembles angewandt. Als Keramikgattung wurde die Graue Ware mit schwarzem Überzug aus Ephesos hierfür ausgewählt. Diese Gattung eignet sich einerseits aufgrund ihrer Feinkörnigkeit, andererseits dank des Vorliegens petrografischer Daten (aus dem Jahr 2012, durchgeführt von L. Peloschek) für eine systematische Messreihe. 95 keramische Artefakte konnten damit in ihrer elementaren Zusammensetzung de-finiert werden, vordergründig gestellt durch die bekannten sog. Grauen Platten. Die Interpretation der Analyseergebnisse ist abzuwarten. Testmessungen an schwarzen oder seltener rötlichen Überzügen wurden ebenfalls vorgenommen.
Das pXRF kam ebenfalls für restauratorische Belange zum Einsatz. Es handelte sich primär um Fragen der Materialidentifikation. Metallische Überreste in byzantini-schen Gusstiegeln konnten als Blei ausgewiesen oder der Eisengehalt in Holzresten bestimmt werden, was eine wesentliche Entscheidungshilfe für einzuleitende kon-servatorische Erhaltungsmaßnahmen darstellte.
Projektleitung: S. Ladstätter; wissenschaftliche Bearbeitung: L. Peloschek, J. Erci; Mitarbeit: F. Reiner (Montanuniversität Leoben)
I.1.5.4 ArchäozoologieDer Schwerpunkt der Aufarbeitung von Tierknochen lag auf dem Material aus der spät antiken Residenz südlich der Marienkirche, dem Odeion im Artemision, der Domus auf dem Panayırdağ und aus dem Hamam 4.
Mit der Analyse von insgesamt 1.085 Tierresten aus dem Odeion im Artemision, von denen sich 841 wenigstens bis zum Gattungsniveau bestimmen ließen, wur-den die archäozoologischen Forschungen an Fundkontexten aus dem Odeion im Artemision zum Abschluss gebracht. Die frühesten Fundgruppen sind hinsichtlich ihrer stratigrafischen Zuordnung mit den Baumaßnahmen im 1. Jahrhundert v. Chr. in Zusammenhang zu bringen, der Deponierungszeitraum der biogenen Abfälle ist aber früher anzusetzen. Nur wenige Funde stammen aus dem Fundamentgaben im Eingangsbereich, 12 Knochen von Haussäugetieren (vor allem Ziegen und Schafe) sowie 7 essbare Herzmuscheln stellen aber eine zu kleine Probe dar, um Inter-pretationen zu erlauben. Etwas aussagekräftiger sind trotz immer noch geringer
Ephesos, archäometrische Analysen. Beispiel eines lokal ephesischen Kera-mikfabrikats im frischen Bruch (Foto J. Erci)
Ephesos, archäometrische Analysen. Portable XRF-Messungen an den Über-zügen der sog. Grauen Ware aus Ephesos (Foto L. Peloschek)
Zentrale Wien
53
Fundzahl (n = 134) die aus den tiefsten Bauhorizonten der Kammer 5a stammenden Befunde. Gekennzeichnet durch die reichliche Einmengung hochwertiger älterer Keramik (archaisch bis hellenistisch), wird der Fundkomplex von den Knochen klei-ner Wiederkäuer dominiert, die überwiegend die fleischtragenden Teile der Glied-maßen repräsentieren. Daneben finden sich größere Mengen von Austernschalen beträchtlicher Größe (n = 55), die durch rechte und linke Klappen in ausgeglichenem Mengenverhältnis vertreten sind. An Wildtierresten liegen jeweils ein Knochen von Fuchs, Feldhase und Höckerschwan vor. Aufgrund der Zusammensetzung dieser Fundvergesellschaftung kann das ihr zugrundeliegende Konsumverhalten einer sozial höher gestellten Verbrauchergruppe oder auch einer besonderen Konsumsi-tuation zugeordnet werden. Bankette im rituellen Umfeld des Artemisions sind hier keineswegs auszuschließen.
Aus dem Bereich der Orchestra des Odeions stammen biogene Abfälle, deren Deponierung kurz vor der Aufgabe und teilweisen Zerstörung des Gebäudes im 5./6. Jahrhundert n. Chr. angesetzt werden kann. Unter den Haussäugetieren do-minieren Rind und Schwein deutlich, beide Arten sind vor allem durch sehr kleine Individuen repräsentiert. Einige wenige Knochen stammen aber auch von großen Rindern, die wohl als Arbeitsochsen interpretiert werden können. Unter den Ske-lettelementen dominieren zwar die Stammknochen (Rippen und Wirbel), Selekti-onsmuster, wie sie für organisierte Fleischverarbeitung typisch sind, können aber nicht definiert werden. Der zusammengewürfelte Eindruck, den diese Fundverge-sellschaftung vermittelt, ist wohl auf die Durchmengung mehrerer, unterschiedlich entstandener Abfalldeponierungen zurückzuführen. Mit Ausnahme weniger, wahr-scheinlich von Wildschweinen stammender Knochen, finden sich kaum Wildtierres-te, der Oberarmknochen eines Halsbandfrankolins stellt aber einen Erstnachweis für Ephesos dar.
Darauffolgende stratigrafische Einheiten, die als umgelagerte Schuttschichten gedeutet und in das 6./7. Jahrhundert n. Chr. datiert werden, liefern weitere biogene Reste, die sich in ihrer Zusammensetzung nicht erkennbar von den darunterliegen-den Abfalldepots unterscheiden.
Zwischen den früh- bis mittelbyzantinischen Fundvergesellschaftungen und den anschließenden, als spätbyzantinisch angesprochenen Schichten zeigt sich ein abrupter Befundhiatus, der sich primär im plötzlichen Fehlen der bis dahin häufig angetroffenen Schweineknochen manifestiert, aber auch im Erhaltungszustand der Knochen und den typischen Zerlegungsspuren seinen Ausdruck findet.
Innerhalb des verfügbaren Zeitrahmens war nur eine kursorische Durchsicht der Tierreste (n = 828) aus der Domus am Panayırdağ möglich. Mehr als 50 % des Fundguts (n = 420) bildeten Schalen von Mollusken, die fast ausschließlich von jeweils außerordentlich großen Austern, Purpurschnecken und auch Tritons-hörnern stammen. Unter den Resten der terrestrischen Tierarten finden sich 25 % Geflügelknochen, vor allem von Haushühnern stammend. Insgesamt ergibt sich ein beinahe identisches Bild mit den Tierresten aus der Sondage 6 des sog. Byzantini-schen Palasts, was möglicherweise eine soziale Gleichstellung und vielleicht auch Nahebeziehung der die beiden Residenzen nutzenden Amtsträger impliziert. Eine möglichst detaillierte Aufnahme dieses Befunds, jedenfalls mit morphometrischen, wenn möglich aber auch strukturanalytischen Methoden ist für die nächste Arbeits-kampagne geplant.
Finanziert von der Veterinärmedizinischen Universität Wien konnte im Grabungs-haus ein archäozoologisches Labor für die reiche Vergleichssammlung eingerichtet werden, die in Zukunft auch Gastwissenschaftern geöffnet werden soll.
Projektleitung: G. Forstenpointner (Veterinärmedizinische Universität Wien); Mit-arbeit: G. Weissengruber
Jahresbericht 2014
54
I.1.5.5 EpigrafikBei der Freilegung der spät antiken Residenz südlich der Marienkirche wurde ein sekundär als Kanalabdeckung verwendeter Türsturz entdeckt, der ein Zitat aus Ps. 92, 5 trägt: »Deinem Haus gebührt Segen, o Herr ...«
Im Serapeion wurden sieben weitere Architravblöcke mit teilweise abgearbei-teten Inschriften aufgenommen, die sekundär als Stufen verbaut worden waren. Davon gehören zwei zu der schon bekannten griechischen Titulatur Kaiser Trajans; die anderen fünf sind lateinisch und enthalten Textteile wie [pr]ovinciae und [a]quar[um?], die wohl zur Titulatur des Stifters zu rechnen sind.
Von der Oberen Agora stammen zwei neue Fragmente, wovon eines offensicht-lich zu der Serie von Ehrenbeschlüssen gehört, die mehrere Städte der Provinz Asia anlässlich der Verleihung der Neokorie unter Domitian an Ephesos widmeten. Vom Namen der Polis ist nur die Endung ΙΩΝ erhalten.
Projektleitung: H. Taeuber (Universität Wien); Mitarbeit: V. Hofmann, C. Samitz
I.1.5.6 GlasforschungDer Schwerpunkt der Glasbearbeitung lag auf dem Material aus der spät antiken Residenz südlich der Marienkirche. Bisher wurden 662 diagnostische Gasfragmente (Gefäßglas) der Grabungskampagnen 2011 und 2012 dokumentiert. Das Material umfasst einfache Schalen und Schüsseln (teilweise mit Schliffrillen oder geomet-rischem Schliffdekor), Unguentarien (Tränenfläschchen), Fragmente von Nuppen-gläsern (aufgelegte Nuppen in Blau), Böden von Trinkgläsern (Stängelgläser [?]) und Lampenfüße (Polycandela). Die Fischapplike eines Konchylienbechers und ein kleines Objekt (Anhänger [?]) in Form einer Maske aus blauem Glas zählen zu den besonderen Stücken. Die Gläser weisen hauptsächlich eine durchscheinende hellbläuliche bzw. bläulich grüne Farbe auf. Einige farblose, d. h. entfärbte Stücke sind ebenfalls vorhanden. Beachtlich sind die großen Mengen von z. T. sehr gut erhaltenem Fensterglas. Die dunkelgrünen und dunkelgelben Fensterglasfragmente besitzen eine Stärke von ca. 0,2 – 0,4 cm. Die originalen Maße der Fensterscheiben lassen sich anhand der erhaltenen Bruchstücke rekonstruieren.
Im Rahmen archäometrischer Untersuchungen wurden 82 Proben von der Un-teren Agora und der Türbe im Artemision für naturwissenschaftliche Analysen ent-nommen.
Projektleitung: S. Ladstätter, J. Henderson (Universität Nottingham); Mitarbeit: L. Schintlmeister
Ephesos, Epigrafik. Spätantike Inschrift aus der Residenz südlich der Marienkirche (Foto N. Gail)
Zentrale Wien
55
I.1.5.7 Kleinfundbearbeitung und Keramikforschung
Aufarbeitung der vorhellenistischen Funde aus den Grabungen im ArtemisionM. Gitzl nahm im Rahmen ihrer Diplomarbeit »Das Gelände des Hofaltars im Arte-mision in archaischer Zeit: Chronologie und Funktionsanalyse anhand der Keramik-funde« die Keramik und Kleinfunde aus den Sondagen 1050 und 1060 auf, die unter dem spätklassischen Hofaltar angelegt worden waren. H. Bulut dokumentierte die im Zuge der Neuordnung des Depots gefundenen Fragmente korinthischer Keramik.
Aus den laufenden Grabungen im Artemision wurden sechs Befunde aus der westlichen Sondage 2 unter dem archaischen Dipteros 1 bearbeitet, die vorwiegend archaische Funde enthielten. Sie stammen aus einer Grube, die vermutlich zur Entnahme von Steinen in byzantinischer bis seldschukischer Zeit angelegt wurde. Die Mehrheit der Keramik- und Kleinfunde datieren in das 7. Jahrhundert v. Chr. und stammen daher von der Einfüllung zwischen den Streifenfundamenten des spätarchaischen Dipteros 1, der ab ca. 580/570 v. Chr. errichtet wurde. Während spätarchaische Keramik vollständig fehlt, gibt es eine geringe Anzahl klassischer Keramikfragmente, die bei der Verlegung der Fundamente des spätklassischen Di-pteros 2 im dritten Viertel des 4. Jahrhun-derts v. Chr. unter die Erde gelangten. Die dritte Gruppe an Keramikfunden stammt aus der Phase des Steinraubs. Aus dem-selben Kontext stammen zwei Kleinfunde aus wertvollem Material: ein Elektronblech konischer Form und eine fragmentierte El-fenbeinstatuette einer Potnia theron in dä-dalischem Stil.
Projektleitung: M. Kerschner; Mitarbeit: J. Felser, M. Gitzl, S. Insulander, A. Muşat, M. Streinu. Kooperationen: H. Bulut (Universität Muğla)
KeramikforschungDer Schwerpunkt der Keramikforschung lag auf einer kontextuellen Aufarbeitung des Materials aus der spät antiken Residenz südlich der Marienkirche. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Erforschung der mittelalterlichen und neuzeitlichen Ke-ramik, insbesondere vom Odeion im Artemision, dem İsa Bey Hamam sowie dem Hamam 4.
Projektleitung: S. Ladstätter; Mitarbeit: D. AkarTanrıver, H. Bulut, P. Doeve, E. Fındık, M. Gitzl, H. Gonzalez Cesteros, T. Hintermann, İ. Önol, S. Palamutçu, J. Struber-Ilhan, E. Tzavella, S. Vroegop, J. Vroom, A. Waldner
Byzantinische Tracht- und Schmuckobjekte, Kleinfunde und ihre Werkstätten Nachdem die Fundaufnahme in Ephesos im Rahmen des FWF-Projekts P 22941-G19 mit der Kampagne 2013 beendet worden war, konnte 2014 der Schwerpunkt auf die Auswertung des Materials gelegt werden. Insgesamt wurden an die 1.100 Ob-jekte aus Ephesos und Umgebung aufgenommen, die der byzantinischen Periode zugerechnet werden können. Die Funde sind alle fotografiert und zum Großteil gezeichnet, außerdem wurden die Objekte aus Bunt- und Edelmetall hinsichtlich ihrer Herstellung untersucht und an rund 700 Objekten Metallanalysen durchgeführt.
Eine Fragestellungen betrifft die typologischen Unterschiede der einzelnen Ob-jektgruppen in der früh- und mittelbyzantinischen Zeit und, im weiteren Verlauf, die Falsifizierung oder Verifizierung der verbreiteten Meinung bezüglich des reduzierten Fundmaterials ab dem 7. Jahrhundert in Quantität und Qualität.
Ephesos, Artemision. Potnia Theron – archa-ische Elfenbeinfigurine (Foto N. Gail)
Jahresbericht 2014
56
Die Analyse des Fundmaterials hat bisher gezeigt, dass im frühby-zantinischen Ephesos die für diese Periode typischen Funde an Gerä-ten und Ausstattungsobjekten des täglichen Lebens wie Waagen und Gewichte, diverse Haushaltsge-genstände, Beleuchtungskörper, Handarbeitsgeräte, Werkzeuge und Spielsteine, aber auch Trachtgegen-stände wie Fibeln, Mantelschließen und Gürtelschnallen gut repräsen-tiert sind. Hervorgehoben seien die Schnallen, die als Massenprodukte
nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in den Provinzen gefertigt wurden. So be-legen im Hanghaus 2 gefundene Gussformen und Halbfabrikate eine lokale Produk-tion auch für Ephesos. Zeitgleiche Siedlungen im übrigen Anatolien wie Anemourion oder Elaiussa Sebaste in Kilikien, wo verschiedene Objektgruppen von Werkzeugen und Geräten Hinweise auf unterschiedliche Handels- und Handwerksbetriebe wie Fischerei, Schafzucht und Wollverarbeitung geben, weisen vergleichbares Fund-material auf.
Beim erhaltenen Fundmaterial aus mittelby-zantinischer Zeit kann zunächst ein allgemeiner Rückgang in der Quantität festgestellt werden; auch sind bestimmte Formen und Techniken nicht mehr vorhanden oder wurden nicht mehr ange-wendet. Daneben treten nun aber neue Typen und Verzierungstechniken in Erscheinung, die vor al-lem in Bezug auf das verwendete Material und die Herstellungstechnik jedoch keineswegs auf eine gegenüber der frühbyzantinischen Epoche ›ver-armte Kultur‹ oder auf mindere Qualität weisen. Erinnert sei hier beispielsweise an den Schmuck
aus Edelmetall und Glas, der aus Gräbern (sog. Byzantinischer Palast, Marien-kirche) stammt. Diese Funde weisen nämlich zum einen auf den hohen sozialen Status der Bestatteten, zum anderen belegen sie aber auch das Vorhandensein und die Zugänglichkeit dieser wertvollen Materialien während der mittelbyzantinischen Periode.
Projektleitung: A. M. Pülz; wissenschaftliche Bearbeitung: B. Bühler, D. Z. Schwar-cz (herstellungstechnologische Untersuchungen, VIAS Wien), M. Mehofer (ras-terelektronische Untersuchungen der Werkstattfunde, VIAS Wien), M. Schreiner, M. Melcher (Metallanalysen). Kooperation: Efes Müzesi Selçuk (C. Topal, F. Kat), Antikensammlung des KHM Wien (G. Plattner, M. Laubenberger), Institut für Na-turwissenschaften und Technologie in der Kunst an der Akademie der bildenden Künste in Wien, Vienna Institute for Archaeological Science
I.1.5.8 NumismatikIm Rahmen der Münzbearbeitungskampagne 2014 wurden insgesamt 1.677 Mün-zen bearbeitet und aufgenommen.
Eine Besonderheit vor allem der Fundmünzen aus der spät antiken Residenz südlich der Marienkirche ist die sogar für ephesische Verhältnisse extrem hohe An-zahl an unbestimmbaren Münzen. Da aufgrund der genauen Dokumentation selbst kleinste Bronzefragmente gefunden wurden, liegt eine große Menge an Objekten vor, bei denen nicht einmal mit Sicherheit festgestellt werden kann, ob es sich dabei
Ephesos, ›Byzantinischer Palast‹. Miniaturschnalle mit kreuzförmigem, festem Beschläg, Kupferlegie-rung; Grabungshausdepot (ID 1164) (Foto N. Gail)
Ephesos, ›Byzantinischer Palast‹. Monogrammfin-gerring, Kupferlegierung; Ephesos Museum Selçuk Inv. 18/7/07 (Foto N. Gail)
Zentrale Wien
57
um Reste von Münzen handelt, geschweige denn, dass eine numismatische Bestim-mung möglich wäre. Die Ansprache und Katalogisierung dieser Objekte wird für die Endauswertung noch interessant werden, da natürlich die grundsätzlichen Zahlen an Fundmünzen durch diese Unsicherheiten beeinflusst werden. Trotzdem scheint bereits festzustehen, dass gerade aufgrund der sorgsamen Dokumentation bei den Münzen aus der spätantiken Residenz die zahlenmäßig mit weitem Abstand größte Materialgruppe die Kleinkupfermünzen (Minimi) des Zeno (474 – 475, 476 – 491) so-wie Anastasius I. (476 – 491) sind. Methodisch bereitet dies ein nicht unerhebliches Problem, da die entsprechenden Ausgaben dieser beiden Prägeherren oft nicht von-einander unterschieden werden können. Da nun Zeno üblicherweise noch zu den römischen Kaisern gezählt wird, während mit Anastasius I. die byzantinische Münz-geschichte beginnt, ergibt sich, dass eine klare und deutliche Trennung zwischen den beiden numismatischen Kategorien »Rom/Dominat« und »Byzanz« sachlich oftmals nicht möglich ist; in der detaillierten Auswertung des Fundmünzbestands nach Prägeperioden lässt sich der Höhepunkt an Belegen im letzten Viertel des 5. Jahrhunderts natürlich problemlos nachvollziehen.
Der Schwerpunkt an Stückbelegen liegt eindeutig in der Spät antike.
Dieses Gesamtbild ist für Ephesos alles andere als unüblich, wie etwa die Bearbeitung der Fundmünzen von der Kuretenstraße 2005 und 2006 bereits gezeigt hat. Ein wichtiger Unterschied des Bestands von 2014 ist freilich, dass sich – anders als an der Kuretenstraße – in erheblichen Mengen auch Münzen der Zeit nach Kaiser Heraclius (610 – 641) fanden: Zu nennen sind neben meh-reren Folles des Constans II. (641 – 668) vor allem einige skyphaten spätbyzanti-nischen Bronzemünzen sowie insgesamt immerhin 32 Mangır der BeylikEpoche sowie des Osmani-schen Reichs, wobei die Prägungen des Letzteren bis Mehmed II. (1451 – 1481) reichen dürften.
Das Münzstättenspektrum verhält sich wie er-wartet: Bei den Münzen des Hellenismus und den kaiserzeitlichen Provinzialprägungen dominiert die lo-kale Münzstätte von Ephesos. Bei den wenigen prin-zipatszeitlichen Reichsausgaben sind neben Münzen aus Rom gallische Beischläge stark vertreten, ein für Ephesos bereits früher in Ansätzen erkennbares Phänomen, das sicher von erheblichem Interesse ist. Im Dominat sind Cyzicus – die moneta publica der dioecesis Asiana – sowie die östliche Hauptstadt Constantinopolis am stärksten belegt, während in der byzantinischen Periode die letztgenannte Münzstätte dominiert. Bei den türkischen Prägungen sind Aus-gaben aus der Münzstätte Ayasoluk und dem nahe gelegenen Tire zu nennen, wobei hier die Bestim-mungen noch präzisiert werden müssen.
Alle Münzen sind Bronzeausgaben, mögen auch die Antoniniane des späteren 3. Jahrhunderts als Sil-bersudprägungen ausgebracht worden sein. Das Ge-samtgewicht aller 2014 bearbeiteten Münzen beläuft sich auf 3.804,92 g, mithin etwa 12 römische Pfund; in der materialstärksten Periode Zeno/früher Anasta-sius I. hätte dies etwas mehr als einem Solidus von 4,55 g Gold entsprochen.
Projektdurchführung: N. Schindel (Österreichische Akademie der Wissenschaf-ten, Institut für Kulturgeschichte der Antike)
Ephesos, 40-Nummi-Stück des byzantinischen Kaisers Constans II. (Foto N. Gail)
Ephesos, chronologische Verteilung der Münzfunde 2014 (N. Schindel)
Jahresbericht 2014
58
I.1.6 Skulpturen
Die Bearbeitung der Skulpturen aus dem Theater (Cavea, Erotenfries) und der Funde aus dem Odeion im Artemision wurde fortgesetzt. Bei einem Kurzaufent-halt in Ephesos wurde die Dokumentation der Funde aus dem Odeion nochmals kontrolliert.
Projektleitung: M. Aurenhammer. Kooperation: G. Plattner (KHM Wien)
I.1.7 Depotorganisation
Im Zuge der Depotreorganisation konnte die Ordnung der Altfunde abgeschlossen werden. Ferner wurde die erste Etappe der Neuordnung des Artemisiondepots vor-genommen, in dem die Funde aus den Grabungen des ÖAI 1965 – 1994 und ab 2014 gelagert werden. Dabei wurden die Funde in neue, verschließbare Behältnisse umgepackt, die ein Verstauben verhindern. Die Neuordnung bewirkt eine deutliche Verdichtung in der Lagerung bei verbesserter Übersichtlichkeit, sodass zusätzlicher Regalraum gewonnen werden konnte. Insgesamt wurden im Artemision 244 Fund-kisten neu geordnet.
Der Ausbau des Labors wurde durch die Anschaffung von Spezialinstrumenten (Mikroskopen, portables XRF) weitergeführt.
Projektleitung: S. Ladstätter, M. Kerschner; Mitarbeit: J. Felser, K. Güler, S. In-sulander, E. Özütürk, E. Şimşek
I.1.8 Wissenschaftliche Veranstaltungen
Den Auftakt bildete der Ephesos-Tag im März 2014, der am Österreichischen Kul-turforum in Istanbul stattfand und von einer Posterausstellung begleitet wurde, die im Anschluss daran auch beim Annual Congress der European Association of Ar-chaeologists in Istanbul gezeigt wurde.
Ephesos, Evaluierung durch ICOMOS/UNESCO im Rahmen des Aufna-hemverfahrens in die Liste der Welterbestätten (© Gemeinde Selçuk)
Zentrale Wien
59
Im September 2014 erfolgte die Evaluation des Weltkulturerbeantrags durch die UNESCO in Ephesos. Das Grabungshaus organisierte einen Abendempfang, ferner stellte die Grabungsleiterin durch Führungen und Vorträge die aktuelle Situation und die Planungen in Ephesos vor.
Im Oktober 2014 wurden die neuesten Forschungsergebnisse im Rahmen eines Çukuriçi Höyük on-site-Workshop einem internationalem Publikum zur Diskussion vorgestellt.
Im November 2014 fand eine Studentenexkursion des Seminars »Cultural He-ritage Management« an der Koç University in Selçuk statt. Die konkreten Konzept-vorschläge für eine museale Nutzung des İsa Bey Hamams werden Anfang 2015 in Form eines Dossiers vorgelegt, welches dann als Ausgangspunkt für das Restau-rierungsprojekt und die Museumsplanung dienen kann.
I.1.9 Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit
Im Jahr 2014 konnten durch die finanzielle Unterstützung von Sponsoren sechs Pro-jekte in Ephesos realisiert werden. Die Ephesus Foundation setzte ihr langjähriges Projekt im Hanghaus 2 fort. Ein italienisch-griechisches Restauratorenteam reinigte unter Mitarbeit türkischer Praktikanten weitere vier Räume (Stiegenaufgang 36b, Peristylhof 31a und SR 27, Kultraum 31b–c) und stabilisierte die Schmuckoberflä-chen, um eine langfristige Erhaltung des Wanddekors zu sichern. Zudem finanziert die Stiftung seit Mitte 2014 die Stelle eines türkischen Facharbeiters, der ganzjährig ein Monitoring der Wandmalereien durchführt und bei Problemen frühzeitig eingrei-fen kann.
Den zweiten Schwerpunkt der Ephesus Foundation bilden die wissenschaftli-che Bearbeitung und der (Teil-)Aufbau des sog. Serapeions. Eine Grabung vor der Freitreppe des Tempels brachte Aufschluss über das Fundament und das antike Hofniveau. Bei der Reinigung des Fußbodens und einer Sondage in der Cella konn-ten außerdem weitere Erkenntnisse über die Verläufe und Durchflüsse der Kanäle gewonnen werden. Nachdem die vierjährige Bauforschung und Zustandserfassung des Tempels 2014 abgeschlossen wurden, kann 2015 mit der Detailplanung für einen Teilaufbau und eine museale Präsentation des Giebels begonnen werden.
Ephesos, Hanghaus 2. Restaurierung der Wand-malerei (Foto N. Gail)
Jahresbericht 2014
60
Die Gesellschaft der Freunde von Ephesos unterstützte wie bereits in den letzten Jahren die archäologische Erforschung der spät-antiken Residenz südlich der Marienkirche und finanzierte die Fortsetzung der geophy-sikalischen Messungen zur Vervollständigung des Stadtplans der antiken Stadt.
Im Herbst 2014 konnte die vom J. M. Kap-lan Fund (USA) finanzierte Konsolidierung und Restaurierung des Hadrianstempels entlang der Kuretenstraße im Herbst abgeschlossen werden.
Für die Restaurierung des Sieben-Schlä-fer-Coemeteriums konnte durch die Unterstüt-zung der Ephesus Foundation, Inc. (USA) die Phase 1 des Projekts, eine Machbarkeitsstu-die, begonnen werden. Neben einer seismolo-gischen Analyse werden bis Frühjahr 2015 ein Bericht über die nötigen Restaurierungsmaß-nahmen sowie Entwürfe für ein neues Besu-cherkonzept vorgelegt werden. Zudem sicher-te die Ephesus Foundation USA die Mittel für Phase 2 des Projekts zu, die den Antrag für die Genehmigung durch die türkische Denk-malschutzbehörde umfasst.
Auch die 2013 begonnene Zusammenarbeit mit dem ersten Forschungsförderungsportal Österreichs, inject-power <www.inject-power.at>, wurde fortgesetzt. Das Internetportal bie-tet die Möglichkeit, private Spender für ÖAI-Projekte zu interessieren, mit ihnen via Blog und Kommentarfeld in Kontakt zu treten und Spendengelder gezielt einzuwerben.
Neben der finanziellen Unterstützung wur-den auch Sachmittel bzw. Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. So unterstützten DB Schenker Arkas und Hausner Moving Services das ÖAI beim Transport neuer Schränke für die archäozoologische Vergleichssammlung. Die von der Veterinärmedizinischen Univer-sität Wien bereitgestellten Schränke wurden nach Ephesos gebracht und ermöglichten im österreichischen Grabungshaus die Einrich-tung eines auf türkischem Boden bisher ein-zigartigen archäozoologischen Labors. Zudem spendete die Österreichische Apothekerkam-mer eine umfassende Reiseapotheke für die Archäologen in Ephesos.
Wir danken allen Sponsoren und Spendern sehr herzlich für ihre Unterstützung!
Koordination: A. Pircher
Ephesos, Serapeion. Blick in die gereinigte Cella (Foto N. Gail)
Ephesos, Serapeion. Grabungsabschnitte vor der Treppe (Foto N. Gail)
Ephesos, Sponsoring durch die Österreichische Apothekenkammer (Foto N. Gail)
Zentrale Wien
61
i.2 Das Heiligtum der artemis Kithone von Milet (türkei)
2014 konnte die Bearbeitung der archäozoologischen Überreste aus den Grabun-gen im Heiligtum der Artemis Kithone und der nachfolgenden Siedlung auf der Ostterrasse des Kalabaktepe abgeschlossen werden. Dokumentiert wurden mehr als 8.320 Tierknochen und Muschelschalen aus geschlossen Fundkontexten des 7.–5. Jahrhunderts v. Chr., wobei die Muscheln mit 89 % deutlich überwiegen. Die restlichen 11 % setzen sich aus Haustieren sowie eini-gen wenigen Vögeln und Wildtieren zusammen.
Bei den Molluskenfunden handelt es sich um den umfangreichsten Fundkomplex mariner Fauna, der bisher aus einem griechischen Heiligtum bekannt wurde. Die Deponierungen gehören unterschiedli-chen Bauphasen an, die sich von der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts bis zur Zerstörung des Temenos durch die Perser 494 v. Chr. erstrecken. Am häufigsten vertreten ist die essbare Herzmuschel (Cerastoderma glaucum), gefolgt von der Auster (Ostrea edulis), die erst in Schichten der zweiten Hälfte des 6. Jahrhun-derts v. Chr. auftritt. Daneben kommen auch Meeres-schnecken vor, unter denen Pupurschnecken (He-xaplex trunculus und Bolinus brandaris) überwiegen.
Projektleitung: M. Kerschner; Mitarbeit: J. Jans-sen. Kooperationen: Grabungsleitung: P. Niewöhner (University of Oxford); C. Berns (Ruhr-Universität Bochum); O. Dally (Zentrale des Deutschen Archäologischen Institutes Berlin); A. Galik (Institut für Pathobiologie und Anatomie der Veterinärmedizinischen Universität Wien)
i.3 teos (türkei): Wirtschaft und Handel der nordionischen Polis von ca.800 – ca.400v.Chr.
Bearbeitet wurden die Keramikfunde aus der Grabung auf der Akropolis von Teos. Die Fun-de aus der untersten, direkt über dem gewach-senen Fels liegenden Schicht einer Sondage, die im August 2014 zwischen den Fundamenten des Tempels und des Altars ausgegraben wurde, enthielt einen homogenen Keramikbefund, der in die Jahrzehnte von ca. 630 – 590 v. Chr. datiert. Das Spektrum der Gefäßformen spricht für einen Heiligtumskontext: Trinkschalen überwiegen bei Weitem, während nur sehr wenige Amphoren und Kochgeschirr vorkommen. Vermutlich handelt es sich um eine Deponierung von Gefäßen, die zuvor bei Opfermahlen verwendet worden waren. Dar-aus lässt sich erschließen, dass das nördliche Areal der Akropolis spätestens ab dem späten 7. Jahrhundert v. Chr. sakral genutzt wurde.
Projektleitung: M. Kerschner; Mitarbeit: S. Güngönül, N.-M. Voss. Kooperation: M. Kadıoğlu (Ankara Üniversitesi)
Milet, Heiligtum der Arte-mis Kithone. Muschelfunde aus dem Heiligtum (Foto A. Galik)
Teos, Akropolis. Kalotten-schale oder -schüssel des nordionischen Tierfriesstils (Foto S. Gülgönül)
Jahresbericht 2014
62
i.4 limyra (türkei)
Die Grabungskampagne unter der Leitung von M. Sey-er und Z. Kuban dauerte vom 4. August bis 24. Sep-tember 2014. Als Vertreter der türkischen Regierung wurde Herr Osman Fatih Özdel von der Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü entsandt.
I.4.1 Geophysik
Die in der Kampagne 2013 begonnenen geophysika-lischen Prospektionen wurden 2014 fortgesetzt. Die Messungen wurden bei unterschiedlichsten Boden-verhältnissen mittels Georadar durchgeführt. Dabei wurde in sechs Teilbereichen eine Fläche von insge-samt 13.458 m² prospektiert. Die Messflächen ›Ost-
stadt 2014‹ und ›Garten 2014‹ schließen dabei unmittelbar an bereits im Jahr 2013 untersuchte Areale an, wodurch die Ergebnisse nun in einem breiteren Kontext interpretiert werden können.
I.4.1.1 ›Nördliche Oststadt‹Dieses Areal umfasst Parzelle 70 und einen Ausschnitt der Straße durch Saklı su köyü südlich des römischen Theaters. Die Fläche lässt mehrere Strukturen erken-nen, die sich allerdings nur unscharf abzeichnen. In ihrem südlichen Bereich befinden sich Mauerreste von Gebäuden, deren Orientierung annähernd mit jener des hellenistischen Ptolemaions übereinstimmt. Sie sind demnach offensichtlich dem älteren, wahrschein-lich bereits in hellenistischer Zeit gegründeten Stra-ßenraster verpflichtet. Nördlich von diesen Strukturen sind zwei Straßenverläufe zu erkennen.
I.4.1.2 ›Insel‹Diese Messfläche besteht aus zwei Teilflächen in der byzantinischen Oststadt Limyras im Bereich der sog. Grabungsinsel. Besonders die Messungen auf der größeren, östlich der byzantinischen Stadtmauer gelegenen Fläche sind aussagekräftig. Hier sind meh-rere Strukturen von Gebäuden sowie ein Abschnitt der byzantinischen Stadtmauer zu erkennen. Die Stadtmauer, die im nördlichen Bereich der untersuch-ten Fläche liegt, lässt sich ca. 15 m in nordsüdlicher Richtung verfolgen, biegt danach scharf nach Westen ab und verläuft bis zum westlichen Arm des Limyros-Flusses.
Das Areal war relativ dicht verbaut, wobei die Ge-bäude im zentralen und nördlichen Bereich unter-schiedliche Ausrichtungen aufweisen. Während die Bauten im zentralen und südlichen Bereich der Mess-
fläche dem älteren Straßenraster folgen, nähern sich jene im nördlichen Teil in der Orientierung dem Verlauf der dominanten Säulenstraße an, die südöstlich des Ptolemaions in einem großen Bogen die gesamte Oststadt durchläuft.
Limyra. Lage der Messflä-chen 2014 für das Geora-dar (S. S. Seren)
Limyra, nördliche Oststadt. Amplitudenflächenplan und archäologische Interpreta-tion im Tiefenbereich von 0,5−1,1 m (S. S. Seren)
Zentrale Wien
63
I.4.1.3 ›Garten‹Die Messfläche ›Garten‹ erstreckt sich im Bereich der byzantinischen Oststadt von den Grabungsdepots im Süden bis zum Arm des Limyros, der die ›Grabungsinsel‹ im Osten begrenzt.
Dieses Areal ist ebenfalls dicht verbaut, wobei die hier befindlichen Strukturen jenen im Bereich ›Insel‹ stark ähneln. Auch hier sind mehrere Bauten in zahlreiche kleinere Räume unterteilt, und auch hier lassen sich verschiedene Ausrichtungen der Gebäude feststellen. Es lässt sich allerdings kein abrupter Richtungswechsel erkennen, da sich die Bauten in einem Bogen der Orientierung der Säulenstraße annähern, die die Grabungsinsel im Osten begrenzt. Diese Annäherung lässt da-rauf schließen, dass dieser Straße, die durch die gesamte Oststadt verläuft, eine große urbanistische Bedeutung zukam, da sie das städtebauliche Gefüge in ihrer unmittelbaren Umgebung maßgeblich beeinflusste. Unter den Gebäuden in dieser Messfläche sticht eine ovale Struktur von ca. 9,7 × 3,7 m besonders hervor. Über ihre Funktion können zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch keine näheren Aussagen getroffen werden.
I.4.1.4 ›Oststadt‹Die übrigen Messflächen in der byzantinischen Oststadt ergänzen die bereits im Jahr 2013 prospektierten Flächen in diesem Stadtteil Limyras. Sie führten zu einem besseren Verständnis der Grundrisse der einzelnen Gebäude und der in die byzan-tinische Stadtmauer integrierten Nordthermen. Bei einer auffallend starken Mauer im
Links: Limyra, ›Insel‹. Amplitudenflächenplan und archäologische Interpretation im Tiefen-bereich von 0,4−1,1 m (S. S. Seren)
Rechts: Limyra, ›Garten‹. Amplitudenflächenplan und archäologische Interpretation im Tiefen-bereich von 0,3−0,8 m (S. S. Seren)
Jahresbericht 2014
64
südöstlichen Bereich des untersuchten Areals handelt es sich aufgrund der Bauweise als ca. 1 m starkes, zweischaliges Mauerwerk möglicherweise um einen Abschnitt der hellenistischen Stadtmauer Limyras.
Die Ergebnisse der geophysikalischen Prospektion in der byzantinischen Oststadt lassen eindeutig erken-nen, dass dieser Bereich eine privilegierte Wohnge-gend darstellte. Entlang der Hauptstraße befinden sich in lockerer Abfolge repräsentative Villen, große freien Flächen sowie öffentliche Bauten wie z. B. die gewaltigen Südthermen (s. u. I.4.2). Der Befund hier steht in krassem Gegensatz zu den Messergebnissen des Jahres 2013 in der Weststadt und in den Berei-chen ›Insel‹ und ›Garten‹, wo fast ausschließlich dich-te, kleinteilige Verbauung vorherrscht.
Wissenschaftliche Auswertung: M. Seyer, S. S. Se-ren (ZAMG); Messung: S. S. Seren; Mitarbeit: E. Bayırlı, F. Seren
I.4.2 Südthermen
Die Arbeiten des Jahres 2014 hatten das Ziel, die im Jahr zuvor begonnenen Untersuchungen zur Bau-aufnahme zu vervollständigen und deren Ergebnisse zu konkretisieren. Durch gezielte Reinigungsmaß-nahmen konnten der Grundriss vervollständigt und zusätzliche Schnittzeichnungen durch das Gebäude angefertigt werden.
Dabei hat sich die Deutung als Thermenanlage großteils spät antiker Zeitstellung bestätigt. Außerdem
konnten die Aussagen zur relativen Chronologie der Bauabfolge verfeinert werden: Kern der Anlage ist der südliche Bereich (Räume VI–X), in dem zahlreiche Reste von Wandabstandhaltern – eine Eigenart der lykischen Thermenarchitektur – auf die Beheizbarkeit der Räume hinweisen. Dieser Teil der Thermen lässt sich als sog. Reihentypus rekonstruieren, der ebenfalls in den Thermenanlagen Lykiens
überwiegt. Im Osten schließen wahrschein-lich Räumlichkeiten zur Versorgung der Ther-men an (Räume XI–XII). Der nördliche Be-reich (Räume I–IV) ist insgesamt jünger und stand über zumindest zwei Durchgänge mit dem südlichen Areal in Verbindung. Hier sind repräsentativere Räumlichkeiten, wie etwa ein Vestibül (Raum II) und eine Wandelhalle (Raum III), zu vermuten.
Dieses Gebäude, das als ›Südthermen‹ von Limyra bezeichnet wird, ist dem Reper-toire der lykischen und kleinasiatischen Ther-menanlagen spät antiker Zeit hinzuzufügen.
Projektleitung: M. Seyer; Mitarbeit: K. Se-wing, C. Kurtze (Geodäsie)
Limyra, Südthermen. Grundriss mit Bauphasen (K. Sewing)
Limyra, Oststadt. Amp-litudenflächenplan und archäologische Interpreta-tion im Tiefenbereich von 0,8−1,2 m (S. S. Seren)
Zentrale Wien
65
I.4.3 Thermen am römischen Theater
Die Forschungen an der kleinen Badeanlage west-lich des römischen Theaters wurden 2014 mit den an thro pologischen Arbeiten sowie der Keramikauf-nahme weitergeführt.
Projektleitung: M. Seyer; Mitarbeit: S. Mayer, U. Schuh
Anthropologie 2014 wurden insgesamt 15 Gräber untersucht, die jedoch die Überreste von mindestens 18 Individuen beinhalteten. Die untersuchten Skelette stammen sowohl von Kindern als auch von erwachsenen Individuen, von einem Neugebore-nen bis hin zum Skelett einer 60 – 70jährigen Frau, deren Knochen Rückschlüsse auf ein ereignisreiches Leben ermöglichen. Obwohl derzeit noch keine zusammen-fassenden Aussagen über die Demografie der Population getroffen werden können, kann bereits postuliert werden, dass über die Hälfte aller Individuen, die auf dem Friedhof in der Ruine der ehemaligen Theatertherme in Limyra bestattet wurden, Kinder oder Jugendliche waren. Überraschenderweise sind unter diesen subadulten Individuen nicht nur Kleinkinder im Alter von unter 5 Jahren, sondern viele dieser subadulten Individu-en starben im Alter zwischen 5 und 14 Jahren – ein Zustand, der für eine mittelalterliche Population recht ungewöhnlich ist. Der Grund für diesen vorzeitigen Tod lässt sich nicht sicher klären. Möglicherweise handelte es sich um wiederholte Epidemien oder Perioden von Hungersnot, die zu einem Anstieg an durch Nahrungsmangel bedingten Krankheiten führ-te. Besonders häufig fanden sich Spuren solcher Krankheiten, wie z. B. Skorbut oder Anämie, bei den Kinderskeletten von Limyra, aber auch einige Erwachsenenskelette wiesen entsprechende Kno-chenveränderungen auf.
Insgesamt war der Gesundheitsstatus der in der Theatertherme bestatteten Men-schen nicht gut. Schon die Zähne von Kindern und Jugendlichen zeigen häufig Kariesläsionen, die des Öfteren zu apikalen Abszessen und Zahnverlust führten. Die Gelenke und Wirbelsäulen der Erwachsenen und Jugendlichen sind oftmals arthrotisch oder arthritisch verändert – ein Hinweis auf schwere körperliche Über-belastung bereits im jungen Alter. Unproportional häufig ließen sich Frakturen an den Knochen der unteren Extremitäten nachweisen, von denen manche sehr wahr-scheinlich durch ein Überfahren des Fußes, z. B. mit einem Wagenrad, verursacht worden waren.
2015 sollte die anthropologische und paläopathologische Aufnahme der bisher ausgegrabenen Skelette aus der Theatertherme in Limyra abgeschlossen werden, sodass eine zusammenfassende statistischpaläodemografische sowie epidemio-logische Auswertung der Befunde erfolgen kann.
Wissenschaftliche Bearbeitung: J. Nováček und K. Scheelen (Institut für Anato-mie und Zellbiologie, Universitätsmedizin Göttingen)
Keramik Neben der Weiterführung der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Fundmaterials der Grabung in den Thermen am Theater wurden von 132 Fragmenten von Ge-fäß und Baukeramik aus den Grabungen der Jahre 2002−2004 in der Weststadt
Limyra, Südthermen. Wandabstandhalter (Foto R. Hügli)
Limyra, Thermen am Theater. Grab 372, Unter-kiefer einer Frau mit zwei apikalen Abszesse an den Zahnwurzeln des ersten Mahlzahns (Foto K. Scheelen)
Jahresbericht 2014
66
Limyras sowie in den Thermen am Theater der Jahre 2007−2010 Proben für ar-chäometrische Analysen genommen. Mit diesen Untersuchungen soll das Spektrum des bereits analysierten Materials erweitert und auf eine aussagekräftigere Basis gestellt werden. Durch das untersuchte Material konnte erstmals in Limyra lokale/regionale Keramik definiert und die Herkunft des Rohmaterials lokalisiert werden.
Wissenschaftliche Bearbeitung: B. Yener-Marksteiner
I.4.4 Forschungsschwerpunkt zur Urbanistik in Limyra
Neben den geophysikalischen Untersuchungen und der Bauaufnahme des sog. Bischofs palasts wurde mit der bauhistorischen Aufnahme eines Torbogens knapp südlich des Ptolemaions begonnen. Die wissenschaftliche Bearbeitung der bei den Grabungen der Jahre 2011 und 2012 getätigten archäologischen Funde wurde fortgesetzt.
Projektleitung: M. Seyer; Mitarbeit: S. Mayer, U. Schuh
I.4.4.1 Torbau am PtolemaionIn der Kampagne 2014 wurde mit der Untersuchung der Reste eines Torbaus be-gonnen, der bereits im Jahr 2000 südlich des Ptolemaions an der Westseite der dort befindlichen spät antiken Kirche freigelegt worden war. Ziel der Kampagne war die Vorbereitung eines Projekts, das eine steingerechte Rekonstruktion des Ge-bäudes sowie dessen Analyse im städtebaulichen Kontext in Limyra zum Inhalt hat. Dem Monument kommt eine große stadtgeschichtliche Bedeutung zu, da seine Errichtung mit einer partiellen Änderung der bis dahin offensichtlich einheitlichen Orientierung des Stadtplans verbunden war. Von großem Interesse ist in diesem Zusammenhang auch die Datierung des Bauwerks, für die neben einer Einordnung der Architekturornamentik in erster Linie Hinweise aus der Analyse der Inschrift zu erwarten sind.
Die Kampagne 2014 widmete sich einerseits einer Untersuchung der in situ erhaltenen Reste. In diesem Rahmen wurde die vorhandene Do-kumentation überprüft und eine vorläufige Bau-beschreibung angefertigt. Andererseits wurde ein Überblick über die vorhandenen Bauglieder, die dem Torbau mit Sicherheit zugeschrieben werden können, angestrebt. Die im Anschluss an die Ausgrabung erfolgte erste Aufnahme der Architekturelemente kann nicht ohne weitere Überprüfung für eine steingerechte Rekonstruk-tion verwendet werden, weshalb eine Autopsie an den originalen Bauteilen unerlässlich war, die zu einer provisorischen Rekonstruktion einer Bo-genhälfte führte. Alle identifizierten Stücke wur-den in einem vorläufigen Bauteilkatalog erfasst, zusätzlich wurden Arbeitsfotos angefertigt. Zur Kontrolle und Ergänzung wurden von ausgewähl-
ten Baugliedern mittels fotogrammetrischer Methoden 3-D-Modelle erstellt. Eben-falls für ausgewählte Architekturelemente wurden professionelle Fotos angefertigt.
Wissenschaftliche Bearbeitung: A. Leung, U. Quatember
Limyra, Torbau beim Ptolemaion. Provisorische Rekonstruktion einer Bogenhälfte (A. Leung)
Zentrale Wien
67
I.4.4.2 Architektur in der OststadtEine zweitägige Begehung der archi-tektonischen Ruinen in der Oststadt hatte das Ziel, erste Kenntnisse über diesen städtischen Bereich zu ge-winnen und zu evaluieren, ob eine systematische Vermessung des Be-standes möglich wäre. Im Zuge frü-herer Feldforschung waren lediglich die markantesten Gebäude kartiert worden. Die in römischer Zeit ent-standene Oststadt war in der Spät-antike anscheinend dicht bebaut. Im Rahmen der kurzen Feldforschung 2014 wurde das Augenmerk sowohl auf In-situ-Bauwerke als auch auf verstreut liegende architektonische Teile gerichtet, die allesamt umfas-send dokumentiert wurden.
Im Zuge der Vorarbeiten wurden neue Daten bezüglich der urbanistischen Glie-derung der Stadt generiert. So konnten Aufschlüsse über die Säulenstraße gewon-nen werden, die über den gesamten östlichen Bereich von West nach Ost führte. In der Oststadt etwa sind noch einige Werkblöcke des Stylobats zu erkennen, welche eine Lokalisierung der Stelle erlauben, an der die Straße einen Bogen machte. An einigen Stellen erscheinen die ursprünglichen Stylobatblöcke in der Spät antike durch Mauern ersetzt worden zu sein, während sowohl die südliche Säulenhalle als auch die Straße selbst zu diesem Zeitpunkt überbaut wurden. Außerdem erlaubt die Dokumentation von Maueroberflächen, die Orientierung und Ausrichtung einiger spät antiker/frühbyzantinischer Insulae zu definieren, z. B. im südöstlichen Bereich der Oststadt und in dem Gebiet nordwestlich der sog. Bischofskirche.
Mehrere Mauern konnten neu dokumentiert und im Zusammenhang mit schon zuvor erkannten Strukturen gebracht werden, wie den großen kaiserzeitlichen Ther-men, dem sog. Bischofspalast oder der sog. Bischofskirche und der gut erhaltenen spät antik/frühbyzantinischen Struktur an der Südseite der Säulenstraße. Mauer-reste in der Umgebung beweisen, dass jeder dieser Bauten ursprünglich ein viel größerer Komplex gewesen sein muss, als bisher angenommen. Darüber hinaus konnten einige bislang nicht bekannte Gebäude identifiziert werden. So weisen als Spolien eingebaute Bogensteine in der Nordmauer des ›Bischofspalasts‹ darauf hin, dass ein kaiserzeitlicher Triumphbogen in der Nähe gestanden haben könnte. Ebenso deuten in der frühbyzantinischen Stadtmauer eingebaute Spolien auf frü-here Gebäude. Ferner indizieren mehrere architektonische Teile im Zentrum der Oststadt noch nicht identifizierte öffentliche Anlagen, während ein großer ArchitravFries-Block mit kreuzverziertem Zahnschnitt und zwei weitere Werkblöcke mit sti-lisiertem Rankenfries vom Bereich westlich der römische Thermenanlage zu einer Kirche gehört haben könnten.
Schon nach dieser kurzen Untersuchung und trotz der Tatsache, dass einige Bereiche der Ruinen aufgrund des dichten Pflanzenwuchses und des Wasserlaufs kaum zu sehen oder zu erreichen sind, ist klar, dass eine systematische Dokumen-tation der architektonischen Reste sowie eine genaue Kartierung mittels Theodolit die Kenntnis der antiken Stadt samt ihren städtischen Gebäude deutlich erweitern würden. Eine künftige Prospektion könnte neben den Grabungen und geophysi-kalischen Vermessungen einen wichtigen ergänzenden Beitrag zur Erforschung Limyras leisten.
Wissenschaftliche Bearbeitung: I. Uytterhoeven
Limyra, Blick von der Nordwestecke der Bischofskirche, im Hinter-grund die Südthermen (Foto I. Uytterhoeven)
Jahresbericht 2014
68
I.4.4.3 Spät antike/frühbyzantinische Keramik 2014 wurden die Untersuchungen der vorwiegend spätrömischen Keramik, die 2011 und 2012 an dem West- und Osttor ausgegraben worden war, fortgesetzt. Während 2013 das Augenmerk auf dem Osttor lag, stand 2014 das Westtor im Fokus, um ein ausgeglichenes Bild zu erhalten und zu untersuchen, ob die beiden Tore eine
ähnliche Bau- und Nutzungsgeschichte aufwiesen. Von der Depotliste wurden die-jenigen Funde mit höherer stratigrafischer Relevanz und/oder ausreichender Qualität oder Quantität ausgewählt; diese wurden analysiert und quantifiziert – alle Scherben wurden gezählt und abgewogen. Dies führ-te zur Auswahl von WT7, dem nördlichen Bereich der Westtor-Grabungen, für eine umfassende Untersuchung. Hier war der Grabungsschnitt am wenigsten gestört und bot ausreichende Qualität, Quantität und Vielfalt an Befunden.
Die Forschung 2014 verstärkt die vorläu-figen Beobachtungen von 2013: Errichtung, Nutzung und Aufrechterhaltung der beiden
Torbereiche geht hauptsächlich auf spätrömische Zeit zurück. Weil die 2014 unter-suchte Keramik aber lediglich in der Nähe des Westtors ausgegraben wurde, kann kein direkter Zusammenhang mit dem Westtor hergestellt werden. Umso bemer-kenswerter ist es allerdings, dass ein Teil der keramischen Funde aus typologischen Gründen in das 4./5. Jahrhundert datiert werden kann. Das wirft Licht auf einen Zeit-raum, der in der Geschichte Limyras bis jetzt kaum untersucht wurde. Einige Gefäße sind relativ gut erhalten, mitunter in großen Fragmenten: Anscheinend wurden sie kurz nach ihrer Verwendung weggeworfen, was auf eine beschränkte Weiterverwen-dung deutet. Ferner ist es möglich, dass diese in der Nähe des Westtors hergestellt worden waren. Bruchstücke mehrerer Gefäße – teilweise anpassend – wurden in verschiedenen Stratigrafieschichten gefunden – ein Umstand, der darauf weist, dass mindestens ein Teil der Stratigrafie nicht sukzessive entstand, sondern auf eine einzige oder einige wenige Deponierung(en) zurückzuführen ist. Eine Möglichkeit ist, dass die Keramik dieser Zeitstellung im Zuge der Errichtung des Tors und der Befestigungsmauer der Weststadt weggeschafft wurde. Eine andere Begründung wäre, dass das Westtor früher als das Osttor konzipiert worden war. Das Vorhan-densein spätrömischer Keramik lässt jedoch auf alle Fälle darauf schließen, dass dieses Areal zu dieser Zeit auch benutzt wurde.
Die Arbeit im Jahr 2014 konnte die Arbeitsthesen von 2013 bezüglich des Ke-ramikspektrums von Limyra präzisieren und wird auch durch die archäometrischen Analysen (L. Peloschek) unterstützt. Die untersuchten stratigrafischen Einheiten stellen ein ziemlich gleichmäßiges Funktionsmuster des 4.–7. Jahrhunderts n. Chr. dar. Der Großteil besteht aus Tafel- und Kochgeschirr sowie Amphoren und Gebrauchswaren, was einem häuslichen Kontext entspricht. Das Kochgeschirr stammt vorwiegend aus Südlykien, während der Großteil des offenen Tafelge-schirrs aus Zypern und Lykien-Pamphylien, von der Westküste der Türkei und aus Tunesien importiert wurde. Die Amphoren kommen zumeist aus Kilikien und Zypern sowie der südlichen Levante. Amphoren aus dem 4.–5. Jahrhundert n. Chr. aus dem Schwarzmeerraum – vor allem die sog. Karotten-Amphoren – bilden ei-nen verhältnismäßig großen Anteil an den Importen aus weiter Entfernung. Zudem lässt sich postulieren, dass der Ton, der für Gefäße mit einem breiten Funkti-onsspektrum (z. B. Einhenkelgefäße, Krüge, Öllampen bzw. Baustoffe aus Ton) verwendet wurde, aus dem Großraum östlich von Limyra stammt. Wenn künftige Rohstoffanalysen diese Vermutung bestätigen, impliziert dies nicht nur eine rege Töpferindustrie während der gesamten römischen Kaiserzeit, sondern auch dass
Limyra, spätantike Kera-mik. Diagramm mit der relativen Scherbenanzahl pro Funktionskategorie, basierend auf absoluter Scherben anzahl der Ke-ramik der Stratigrafischen Einheiten 91, 95, 105, 105A und 106 aus Schnitt WT7 (n = 1,610) (P. Bes)
Zentrale Wien
69
Limyra einen beträchtlichen Anteil an spezifischen Funktionskategorien lokal be-wirtschaftet hat. Zusammen mit dem Kochgeschirr könnte das Verhältnis regionaler Waren bei 40 – 45 % liegen.
Wissenschaftliche Bearbeitung: P. M. Bes
I.4.5 Geowissenschaftliche Untersuchung zur Verwitterung lykischer Felsengräber
Im Rahmen des Projekts »Impact of salt and moisture on weathering of historic stonework«, das den Einfluss und das Zusammenwirken von Feuchte und Sal-zen bei der Verwitterung kulturhistorisch bedeutender Steinmonumente untersucht, konnten auch Verwitterungsprozesse an lykischen Felsgräbern in Limyra begut-achtet werden. Diese Untersuchungen konzentrierten sich vornehmlich auf Gräber der Nekropole II. Das marine Kalkgestein der Gräber weist unterschiedlich starke Verwitterungserscheinungen auf. Es finden sich Formen der Karstverwitterung, wie kleinräumige Oberflächenvertiefungen (surface pitting), Oberflächenschwund (back weathering), Karrenbildung (Loch-, Rinnen- und Rillenkarren) und Risse.
Es wurden folgende geowissenschaftliche Anwendungen und Messmethoden herangezogen: (1) Kartierung von Verwitterungserscheinungen; (2) Elektrische Wi-derstandstomografie (ERT); (3) Handheld Moisture Meter (tragbare Feuchtemessge-räte); (4) ›Paper pulp poultices‹ (zur Bestimmung des Salzgehalts an Gesteinsober-flächen) und laboranalytische Auswertung der Salze (IC – IonenChromatografie). Die Untersuchung an den Felsengräbern hatte folgende Schwerpunkte: (1) Salz- und Feuchteverteilung an der Steinoberfläche und ihre Beziehung zu Verwitterungs-erscheinungen; (2) fotogrammetrische Ermittlung von Rückverwitterungstendenzen der Gesteinsoberfläche mithilfe des Programms »Structure for Motion«; (3) Charak-terisierung von Salzen; (4) Lage und Ausbildung der Lösungserscheinungen.
Projektleitung: O. Sass; Mitarbeit: I. Egartner
Limyra, Grab des Ermmẽneni (Grab II/151). Kartierung von Verwitte-rungserscheinungen (Plan K. Schulz, Kartierung I. Egartner)
Limyra, Gräber II/151 und 152. Karstverwitterung und Risse im Gestein (Foto I. Egartner)
Jahresbericht 2014
70
I.4.6 Restaurierung, Denkmalpflege und Site Management
I.4.6.1 Sarkophag des XñtaburaNach der Erstellung des architektonischen und stati-schen Konzepts diente die Kampagne 2014 vornehm-lich einer Kartierung der Schäden am Bau durch ein Team von vier Restauratoren. Mit Erstellung des Pro-jektantrags zur Restaurierung des wertvollen Monu-ments konnte im Herbst 2014 begonnen werden.
Projektleitung: M. Seyer, M. Pliessnig, K. Schulz, Mitarbeit: D. Hvezda, M. Kulhanek, J. Lehner, B. Rankl
I.4.6.2 Stadtmauer der byzantinischen OststadtDer 2012 begonnene und 2013 weitergeführte teilweise Wiederaufbau der schlecht erhaltenen Stadtmauern der byzantinischen Oststadt konnte in der Kampagne 2014 zu einem vorläufigen Ende gebracht werden. Wie in den vorigen Jahren wurden jeweils zwei Mauerscharen wiedererrichtet, wobei 2014 das Areal nahe der Süd-ostecke der Stadt sowie der nördliche Bereich der Ostmauer fertiggestellt werden konnten. Für das für diese Maßnahme notwendige Steinmaterial wurden Original-blöcke verwendet, die im unmittelbaren Versturzbereich der Mauer lagen. Diese Maßnahme des partiellen Wiederaufbaus der Mauer erwies sich nicht nur als not-wendig, um die ehemaligen Grenzen der Stadt wieder deutlich sichtbar zu machen, sondern versteht sich auch als Beitrag zur Erhaltung und Denkmalpflege, da die
Wurzeln mehrerer Bäume den antiken und byzantinischen Baube-stand bereits zu zerstören drohten. Während dieser Arbeiten konn-ten mehrere in die Stadtmauer verbaute oder aus dieser geborgene Architektur und Reliefblöcke erstmals fotografiert, gezeichnet und wissenschaftlich dokumentiert werden.
Projektleitung: M. Seyer; Mitarbeit: C. Aydın, M. Tosun
I.4.7 Çocukların Limyrası – Die Kinder von Limyra
Seit 2011 findet parallel zur LimyraGrabung der Workshop »Çocukların Limyrası – Das Limyra der Kinder« im Dorf Saklısu statt. Initiiert von Z. Kuban und ihren Studentinnen und Studen-ten der Architektur und Architekturgeschichte an der Technischen
Universität Istanbul kommen in diesem Workshop die Kinder des Dorfes für zehn Tage zusammen, um über die Ruinen, das Dorf, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu sprechen. Dieser Workshop beabsichtigt eine behutsame Heranführung der Dorfbewohner an die Ruinen und deren Bedeutung.
Im Jahr 2014 waren 50 Kinder im Alter von 5 – 12 Jahren mit Feuereifer bei der Sache. Sie setzten sich in mehreren Gruppen auf kreative Weise mit Themen wie »Geschichte und Ruinen von Limyra« oder »Das Dorf Saklı Su und seine Um-gebung« auseinander. Diese Gruppen entwickeln im Rahmen des Workshops mit Modellbau, Tanz, Film und Animation, Ausflügen, Werkarbeiten, Malen, dem Entwurf von Masken und Marionetten Aufführungen und künstlerische Werke, die jeweils Ende der Woche den Eltern und Dorfbewohnern, Interessenten aus der näheren Umgebung der Ortschaft sowie Lokalpolitikern präsentiert werden. Im römischen Theater wurde wie jedes Jahr ein Stück aufgeführt, das Bezug zur Geschichte und den historischen Hinterlassenschaften Limyras hatte.
Limyra, byzantinische Mauer der Oststadt. Frag-ment eines korinthischen Kapitells (Foto R. Hügli)
Limyra, Sarkophag des Xñtabura. Schäden am Hyposorion (Foto M. Seyer)
Zentrale Wien
71
Zwischenzeitlich konnte auch ein Malbuch zu Limyra publiziert werden, nach dessen Vorbild weitere Objekte und Spiele mit bleibendem Effekt hergestellt werden sollen.
Projektleitung: Z. Kuban; Mitarbeit: H. Aktur, O. Cebeci, C. Ekici, H. B. Hamurişçi, C. Hızlı, S. İzgi, C. Kaçar, Y. Kaya, İ. Kosova, C. Metin, S. İ. Öker, Ö. Özden, S. Paşaoğlu, M. Pekduraner, D. Saygı, S. E. Taşkıran, C. Tokgöz, S. Türkkan, H. Ünlü, B. Üzümkesiçi
I.5FeldforschungenamYalakBaşı (Bonda tepe)
Die 2013 begonnenen Feldforschungen auf dem im Bonda Tepe-Gebiet gelege-nen Yalak Başı wurden 2014 im Rahmen der diesbezüglichen Kooperation zwi-schen dem ÖAI, dem Archäologischen Museum Antalya (vertreten durch M. De-mirel), der Kommission für Alte Geschich-te und Epigraphik (AEK) des DAI und dem Institut für Klassische Archäologie der LMU München durchgeführt. An der Kampagne nahmen neben O. Hülden als Leiter drei studentische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teil; außerdem wurde das Team durch C. Kurtze verstärkt, der erneut für die Vermessungsarbeiten und das 3-D-Laserscanning verantwortlich zeichnete. Als Vertreter des türkischen Ministeriums für Kultur und Tourismus in Ankara fungierte Tahir Demiryürek (Archäologisches Museum Antalya). Die Finan-zierung erfolgte aus Mitteln des ÖAI und der AEK des DAI.
Ziele der Arbeiten im Jahr 2014 waren die abschließende Befundaufnahme und vollständige Vermessung der schwerpunktmäßig hellenistisch-kaiserzeitlichen Siedlung auf dem Yalak Başı. Beide Zielsetzungen sind erreicht worden, weshalb nunmehr ein aktueller, alle oberflächlich noch sichtbaren Baureste umfassender Gesamtplan sowie eine detaillierte Dokumentation zu jedem einzelnen dieser teil-weise sehr gut erhaltenen Befunde vorliegen. Bei der derzeit laufenden Auswertung zeichnet sich bereits eine einigermaßen klare relativchronologische Ordnung der einzelnen Gebäude und Baukomplexe ab und gleichermaßen lassen sich diverse Bauphasen voneinander scheiden. Darüber hinaus können eindeutige funktionale
Limyra, Workshop im Rahmen des Projekts »Das Limyra der Kinder« (Foto C. Tokgöz)
Bonda Tepe, Yalak Başı. Blick über einen der aus-gedehnten, der Verarbei-tung von Oliven dienenden Wirtschaftskomplexe der Siedlung (Foto O. Hülden)
Jahresbericht 2014
72
Bestimmungen der einzelnen Bauten und Komplexe vorgenommen werden, wo-durch Einblicke in das private und öffentliche Leben in der Siedlung sowie in die dort praktizierten Wirtschaftsweisen möglich sind. Dazu wird noch im Jahr 2015 eine Publikation auf den Weg gebracht werden.
Die jetzt in der Siedlung auf dem Yalak Başı abgeschlossenen Arbeiten sollen als Blaupause für weitere, ebenso detaillierte Untersuchungen in den übrigen durch die Aktivitäten von T. Marksteiner vor einigen Jahren bereits bekannt gemachten Siedlungen des Bonda Tepe-Gebiets dienen. Außerdem soll das zwischen den Sied-lungsplätzen gelegene, stark landwirtschaftlich genutzte Gebiet in die Forschungen einbezogen werden. Aufgrund der nicht ganz einfachen Geländesituation und der damit verbundenen logistischen Probleme ist für Sommer 2015 eine kleinere Kam-pagne avisiert, die der Vorbereitung dieses längerfristigen Forschungsvorhabens dienen soll.
Leitung: O. Hülden, B. Marksteiner-Yener; Mitarbeit: C. Kurtze (Geodäsie), L. B. Balandat, K.-L. Link, M. F. Rönnberg
i.6 Dülük Baba tepesi bei Doliche (türkei)
Seit 2001 führt die Forschungsstelle Asia Minor im Seminar für Alte Geschichte der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster unter der Leitung von Engelbert Win-ter am Dülük Baba Tepesi/Gaziantep Grabungen durch. Seit 2014 ist das ÖAI im Rahmen einer Kooperation in die Feldforschungen eingebunden, wobei der Schwer-punkt auf der Untersuchung einer Klosteranlage liegt.
In der heidnischen Antike befand sich auf dem Gipfelplateau des Dülük Baba Tepesi das zentrale Heiligtum des Iupiter Dolichenus, dessen Kult ab dem 2. Jahr-hundert im gesamten Römischen Reich Verbreitung fand. Etwa in der Mitte des 3. Jahrhunderts wurde das Heiligtum zerstört und die Kultausübung fand ein jähes
Ende. Frühestens ab dem 6. Jahrhundert sind im Bereich des Ostplateaus Struk-turen zu fassen, die man wohl als Reste einer Klosteranlage interpretieren kann. Aufgrund epigrafischer Funde darf in ihr das Kloster des hl. Salomon zu sehen sein.
Mit Aufnahme der Arbeiten wurden südlich der bislang freigelegten Wirt-schaftsbereiche des Klosters Untersu-chungen durchgeführt, um bereits ange-schnittene Räume vollständig freizulegen und deren funktionale Einordnung zu klä-ren sowie diese in chronologischen Zu-sammenhang mit den übrigen Strukturen zu setzen.
Die ältesten Befunde lassen sich im Westen des Schnitts 14-05 fassen: ein na-hezu quadratischer Raum mit einer leicht nach Norden versetzten Zisternenöffnung in seiner Mitte. Als Boden diente eine Abfolge von Lehmstampfböden; der einzige Zugang befand sich im Südwesten. Einige Befunde im Raum selbst stehen mögli-cherweise in Zusammenhang mit einer Hebevorrichtung für die Zisterne.
In einer nächsten Phase wurde auf höherem Niveau östlich des Raums mit Zis-terne unter Berücksichtigung bereits existierender Mauerzüge ein langrechteckiger Raum angebaut, wobei hier ein deutlicher Höhenunterschied zwischen Rauminne-rem und dem südlich anschließenden (Außen-)Bereich festzustellen ist. Um diesen überwinden zu können, wurde bereits bei Errichtung der Südmauer im Osten eine
Doliche, Dülük Baba Tepe-si. Laserscan der freigeleg-ten Befunde (H. Schwai-ger, C. Kurtze)
Zentrale Wien
73
Dol
iche
, Dül
ük
Bab
a Te
pesi
. Ü
berb
licks
plan
. Im
Ost
en d
er
Gra
bung
sbe-
reic
h 20
14 (r
ot
mar
kier
t) (©
Fo
rsch
ungs
stel
le
Asi
a M
inor
)
Jahresbericht 2014
74
Treppe vorgesehen. Im Inneren auf einem Lehmstampfboden verlegte Ziegelplat-tenfragmente dienten möglicherweise als Auflager für eine hölzerne Konstruktion, von der sich aber nichts mehr erhalten hat. Im weiteren Verlauf der Nutzung dieses Raums wurden weitere Lehmstampfböden eingebracht und das Niveau somit suk-zessive erhöht. Aufgrund der relativ geringen Menge an signifikantem Fundmaterial ist beim momentanen Bearbeitungsstand keine weitergehende Interpretation mög-lich, auf jeden Fall wird der Raum aber in funktionalem Zusammenhang mit den umliegenden Wirtschaftsbereichen zu sehen sein.
Im Rahmen der letzten fassbaren Bauphase war der östlichste Teil dieser Raum-gruppe errichtet worden, der jedoch nicht vollständig freigelegt werden konnte. Er-neut kam es zu einer Erhöhung des Nutzungsniveaus; als Bodenbelag fanden wie-derverwendete Basaltplatten Verwendung. Der bislang einzige Zugang lässt sich im Süden nachweisen, der – anhand von Einarbeitungen in der steinernen Schwelle ersichtlich – ursprünglich eine Türkonstruktion aufwies. Während der Raumnutzung kam es zu Reparaturmaßnahmen am Pflaster, wovon unterschiedliches Baumaterial zeugt. Als letzte nachweisbare Bauaktivität lässt sich die Zusetzung des Durchgangs
durch eine Trockenmauer fassen; somit kann aufgrund der momentanen Befundlage davon ausgegangen werden, dass noch ein weiterer Zu-gang existiert haben muss.
In weiterer Folge scheinen die Strukturen in diesem Be-reich verlassen worden und sukzessive verfallen zu sein. Die jüngsten Befunde lassen darauf schließen, dass nach der Aufgabe des Klosters das verfügbare Baumaterial verar-beitet worden war, zumal die Schuttschichten einen sehr hohen Anteil an Kalksteinab-schlag aufweisen.
Doliche, Dülük Baba Tepesi. Überblick über die Schnitte 14-05 und 14-11 von Norden (Foto H. Schwaiger)
Doliche, Dülük Baba Tepesi. Schnitt 14-05 von Südwesten (Foto H. Schwaiger)
Zentrale Wien
75
Durch die Anlage des Schnitts 14-11 sollte die nachantike Be-bauungsstruktur im Bereich des einstigen Hauptzugangs zum Hei-ligtum geklärt werden.
Die ältesten Befunde zeigen eine dichte Bebauung, die aus mehreren Elementen besteht. In der Nordhälfte des Schnitts verläuft eine West-Ost orientier-te Mauer, die sich anhand ihrer Position und Ausrichtung in ein übergeordnetes Bebauungs-schema einordnen lässt. An sie wurde im Süden eine Struktur angesetzt, die als Futterkrippe zu interpretieren ist. Der Trog selbst wurde aus einer Steinset-zung unter Verwendung großer, z. T. wiederverwendeter Kalksteinblöcke gebildet. Auf Seite der Standfläche der Tiere weisen die Blöcke drei Lochungen auf, mithilfe derer Seile befestigt werden konnten. Als Bodenbelag sind in diesem Bereich noch Reste von wohl wiederver-wendeten Basalt- und Kalksteinplatten zu fassen.
In einer späteren Nutzungs-phase wurden diese Strukturen aufgegeben, aufgehendes Mau-erwerk wird teilweise abgetra-gen. Durch Einschüttungen von Schuttmaterial wurde nahezu der gesamte Bereich erhöht und somit ein neuer Laufhorizont geschaf-fen. Im Südosten war ein Raum errichtet worden, der jedoch nur teilweise freigelegt werden konn-te. Auch hier sind Unterschiede im Hinblick auf die Nutzungshori-zonte im Inneren und Äußeren zu beobachten: die Mauern wurden gegen die erwähnte Schuttein-füllung gesetzt, über eine in die Westmauer integrierte zweistufige Treppe gelangte man in das tiefer liegende Innere des Raums.
Im Zuge größer angelegter Veränderungsmaßnahmen wurden sämtliche noch aufgehende Strukturen niedergelegt und der gesamte Bereich erneut planiert. Im Nordbereich des Schnitts sind noch Reste eines Basalt/Kalksteinpflasters erhalten, das dieser Bauphase zuzuordnen ist. Diese Aktivität ist im Zusammenhang mit der spätesten Bauphase von Schnitt 14-05 zu sehen.
Nach Aufgabe der Strukturen zeigt sich in diesem Grabungsbereich die gleiche Befundsituation, die auch in Schnitt 14-05 festgestellt werden konnte: kleinteiliger Kalksteinbruch und -abschlag weisen auf die Wiederverwendung des Baumaterials für spätere Siedlungsaktivitäten.
Projektleitung: E. Winter; Mitarbeit: B. Kalfa, H. Schwaiger. Kooperation: Westfä-lische Wilhelms-Universität Münster, Seminar für Alte Geschichte, Forschungsstelle Asia Minor
Doliche, Dülük Baba Tepesi. Schnitt 14-11 von Südosten (Foto H. Schwaiger)
Doliche, Dülük Baba Tepesi. Schnitt 14-05: Raum mit Zisterne von Westen (Foto H. Schwaiger)
Jahresbericht 2014
76
II. ZenTraleuropäIsche archäologIe (Zea)
Die Forschungsaktivitäten des Fachbereichs Zentraleuropäische Archäologie er-streckten sich 2014 auf folgende Fragestellungen und Regionen:
II.1 Die Geschichte der Legio II Italica und spätantoninisch/frühseverische Fortifi-kationsarchitektur (Enns, Mauer bei Amstetten; Ober- und Niederösterreich)
II.2 Römische Militäranlagen in der Germania Magna (Engelhartstetten, Kolln-brunn, Ruhhof; Niederösterreich)
II.3 Ostnorische Limeskastelle (Mautern an der Donau, Zwentendorf an der Do-nau; Niederösterreich)
II.4 Interaktionen mit der Bernsteinstraße (Izola, Slowenien)II.5 Forschungen zur Urbanistik von Aquileia (Aquileia, Italien)
ii.1 Die Geschichte der legio ii italica und spätantoninisch/frühseverische Fortifikationsarchitektur
II.1.1 Forschungen zum Legionslager, zur Zivilstadt und zu den Canabae von Enns-Lauriacum (Oberösterreich)
Im Zuge eines Forschungsschwerpunkts zu den Militärlagern der Legio II Italica in Ločica, Albing und Enns werden sowohl die Lagergrundrisse als auch deren Einbin-dung in das antike Siedlungsgebiet erforscht. Die drei Militärlager der Legio II Italica
wurden bis 2013 mit geophysikalischen Messungen (Georadar und Magnetik) flächig untersucht. 2014 wurde vom Le-gionslager in Enns unter Einbeziehung aller Pläne von Altgrabungen aus den Archiven des ÖAI und neueren Untersu-chungen des Bundesdenkmalamt (BDA) ein aktualisierter Gesamtplan generiert. Mit dieser Plangrundlage ist es nunmehr möglich, einen fundierten Vergleich mit den Befunden von Albing und Ločica durchzuführen. Ein Ziel der Forschungen ist es, die neu gewonnenen Informatio-nen zur Bebauungsintensität im Inneren aller drei Legionslager (Ločica, Albing, Enns) zu bewerten und den Bezug der Militärlager zu ihrer direkten Umgebung darzustellen. Anhand einer detaillierten Analyse der Baustrukturen und Diskussi-on der chronologischen Abfolge aller drei Legionslager soll die Geschichte der Le-gio II Italica neuerlich beleuchtet werden.
Im Rahmen einer von S. Groh be-treuten Masterarbeit am Institut für Klas-sische Archäologie der Universität Wien (K. Freitag) werden in Kooperation mit
dem BDA und dem Oberösterreichischen Landesmuseum – auch in Hinblick auf eine geplante oberösterreichische Landesausstellung 2018 – die römerzeitlichen Siedlungsräume von Enns-Lauriacum untersucht. Abseits anlassbedingter Sondie-rungen bildet eine zusammenfassende Darstellung der archäologischen Befunde ein Forschungsdesiderat. Anhand geophysikalischer Surveys sowie der Auswertung
Fundplätze mit For-schungsaktivitäten des Fachbereichs Zentraleuro-päische Archäologie 2014 (Grafik H. Sedlmayer)
Zentrale Wien
77
von Grabungsbefunden sollen Aussagen zur Lage, der Ausdehnung sowie der inneren Struktur der Sied-lungszonen gewonnen werden. Die Untersuchungen sollen des Weiteren die forschungsgeschichtlich be-dingte Trennung von Canabae legionis, ›Töpfervier-tel‹, Vicus und Zivilstadt klärend behandeln.
Bereits für das späte 1. Jahrhundert n. Chr. ist römi-sche Besiedlung entlang der Limesstraße belegt und in der Forschung ein Vicus postuliert. Die im letzten Viertel des 2. Jahrhunderts n. Chr. erfolgte Verlegung der Legio II Italica nach Enns-Lauriacum bewirkte die Erschließung neuer Siedlungsräume. Einerseits ent-standen die Canabae legionis im Norden des Militärla-gers, andererseits die – vermutlich von Caracalla zum Munizipium erhobene – Zivilstadt im Westen. Der als ›Töpferviertel‹ bezeichnete Siedlungsabschnitt befin-det sich südwestlich der Zivilstadt. Mittels strukturellen Vergleichen sollen Funktion und Grenzen der einzelnen Siedlungsräume diskutiert werden.
Eine Kartierung durchgeführter archäologischer Maßnahmen in einem Geogra-fischen Informationssystem (GIS) ermöglichte eine Begrenzung der zu prospektie-renden Flächen auf einen etwa 2 km großen Umkreis, als dessen Mittelpunkt das Legionslager zu nennen ist (›Leugengrenze‹).
Ab Juli 2014 erfolgten geophy-sikalische Messungen auf einer Fläche von 55,21 ha mit Magnetik und 2,74 ha mit Radar. Ziel der Pro-spektionen 2014 war es, die Gren-zen und den Aufbau der Besied-lung festzustellen. Dabei gelang es vor allem im Norden des Legions-lagers bisher nicht bekannte Sied-lungsstrukturen in Holz-Erde-Bau-weise nachzuweisen. Entlang der westlichen Ausfallstraße der Porta decumana konnten Strukturen der Zivilstadt prospektiert werden. An ausgewählten Stellen wurden die Forschungen mit Georadar inten-siviert. Befunde, über denen sich rezente Aufschüttungen befinden, konnten mit den Magnetikmessun-gen nicht ausreichend identifiziert werden. Hier lieferten die Messun-gen mit Radar supplementäre Er-kenntnisse.
Eine im Dezember 2014 im Zuge von Surveys erfolgte Kartierung weiterer Fund-stellen ergänzte die geophysikalischen Untersuchungen. Das Ergebnis lässt eine 1,5 km große Ausdehnung der Canabae nördlich des Lagers vermuten.
Für 2015 sind die Prospektion dieser Flächen, die Auswertung der geophysika-lischen Messdaten und die archäologische Interpretation der bisher erfolgten Maß-nahmen in Enns vorgesehen.
Projektleitung: S. Groh; Mitarbeit: K. Freitag, V. Lindinger, I. Repetto, A. Steinin-ger, M. Westerkam. Kooperation: Bundesdenkmalamt; Oberösterreichisches Lan-desmuseum, Linz
Enns-Lauriacum. Die Flächen der geophysika-lischen Messungen 2014 (Grafik V. Lindinger)
Enns-Lauriacum. Magne-tische Prospektion in den Canabae des Legionsla-gers (Foto K. Freitag)
Jahresbericht 2014
78
II.1.2 Forschungen zum Auxiliarkastell von Mauer bei Amstetten (Niederösterreich)
Der Grundriss des Auxiliarkastells von Mauer bei Amstetten ist zum überwiegenden Teil nur aus Grabungen der Jahre 1907 – 1910 bekannt. Das ca. 10 km südlich des Donaulimes am Fluss Url situierte Militärlager sticht durch seine massive Fortifi-kation mit vorspringenden Türmen und seine bislang noch nicht geklärte Innenbe-bauung hervor; Befunde aus dem Kastellvicus fehlen. Überregionale Bekanntheit erlangte der Fundplatz durch das Auffinden des Inventars eines Iupiter DolichenusHeiligtums im Jahre 1937, knapp südlich außerhalb der Lagermauern.
Von Oktober bis November 2014 wurden im Kastellinneren und auf seinen um-gebenden Arealen geophysikalische Prospektionen mit Magnetik auf 9,6 ha und mit Georadar auf 1,3 ha Fläche vorgenommen. Anhand der Messdaten sollten die
bereits ergrabenen Innenbauten und die Fortifikation verifiziert sowie weitere Strukturen im Lagerinneren als auch in dessen Vorfeld untersucht werden. Die Ergebnisse der Prospektionen erlauben es, ein neues Bild von diesem Fundplatz zu zeich-nen. Auf den bislang untersuchten Flächen finden sich keine Strukturen, die als Kastellvicus zu interpretieren wären, doch dürfte sich am gegenüberliegenden Ufer der Url, in Abetzberg, ein Werkplatz mit mehreren Brennöfen (Ziegelei [?]) befinden. Die Prospektionsbefunde im Inneren der Befestigung evozieren eine lagemäßige Korrektur der bislang publizierten Pläne und bezeugen ein dicht verbautes Areal mit Gebäuden streifenför-miger Grundrisse. Zur Befestigungsanlage des Kastells haben sich neue Erkenntnisse ergeben. Letztere sind inhaltlich eng mit den Fragestellungen zur Entwicklung der mittel- bis spätkaiser-zeitlichen Fortifikationsarchitektur verwoben, die hinsichtlich der Stationierung der Legio II Italica in Noricum und der Abfolge ihrer drei Militärlager innerhalb weniger Jahrzehnte (Ločica, Albing, Enns) im Rahmen eines ZEA-Schwerpunktprojekts erforscht werden.
Projektleitung: S. Groh; Mitarbeit: K. Freitag, V. Lindinger, I. Repetto, A. Steininger
Mauer bei Amstetten. Die Flächen der geophysikali-schen Messungen 2014) (Grafik V. Lindinger)
Mauer bei Amstetten. Geophysikalische Pros-pektion mit Radar (Foto V. Lindinger)
Zentrale Wien
79
ii.2 römische Militäranlagen in der Germania Magna (niederösterreich)
Im Jahr 2014 wurden die Feldforschungen in den temporären Militärlagern von Ruhhof und Kollnbrunn fortgesetzt und beendet. Zusammen mit den Ergebnissen der Aktivitäten in Engelhartstetten kann nun ein neues Bild von der Morphologie und Zeitstellung der drei temporären Lager gezeichnet werden.
In Ruhhof galt es, die geophysikalischen Prospektionsdaten des Jahres 2014 zu ve-rifizieren und mit stratigrafischen Befunden sowie Funden zu verdichten. Dies erfolgte im August 2014 mit der Freilegung einer der fünf Toranlagen mit Clavicula (256 m²), 21 Ramm-kernsondierungen im westlichen, südlichen und östlichen Lagergraben sowie einer flächi-gen Metalldetektorprospektion (9,8 ha: in Ko-operation mit dem Archäologischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften), die sich, mit Ausnahme des nördlichen Lagers, über die Toranlagen und den gesamten Befes-tigungsgraben erstreckte. Anhand der archäologischen Grabung konnte erstmals für das Gebiet nördlich der Donau die Existenz von Clavicula-Torkonstruktionen bei temporären Lagern verifiziert werden; von einem anzunehmenden, innen liegenden Vallum wurden keine Reste gefunden. Im Zuge der archäologischen Rammkernson-dierungen, die bis in 2 m Tiefe vorgenommen wurden, konnte das Grabenprofil an drei Seiten des temporären Lagers kontrolliert und die Magnetisierung der Graben-verfüllungen mittels Suszeptibilitätsmessungen untersucht werden. Die archäologi-schen Schichten unterscheiden sich hierbei vom geologischen Untergrund durch deutlich höhere Werte der Magnetisierbarkeit.
Der die archäologischen Sondagen begleitend vorgenommene Metalldetektor-Survey sah vor, die Grabenareale mittels eines 30 m breiten Korridors und die Toran-lagen jeweils auf rund 55 m weiten Flächen zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt auf die Prospektion und gezielte Aufsammlung von Buntmetallen gesetzt wurde.
Abschließend wurde im Oktober 2014 auch in den zugänglichen Grabenab-schnitten des temporären Lagers von Kollnbrunn, wiederum in Kooperation mit dem Archäologischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, ein intensiver Metalldetektor-Survey auf einer Fläche von 6,5 ha durchgeführt. Im Zuge des Surveys wurden, abhängig vom Bewuchs und der Zustimmung der Grundeigen-tümer, vier unterschiedlich breite und lange Geländestreifen im West- und Mittelteil des Militärlagers untersucht.
Diese Feldforschungen wa-ren für die chronologische Ein-ordnung der temporären Lager von Ruhhof und Kollnbrunn in die mittlere Kaiserzeit von be-sonderer Bedeutung. Die Un-tersuchungen im Bereich der Lagergräben und Toranlagen von Ruhhof erbrachten in der Kombination archäologischer Grabungen und Metalldetek-torprospektionen wichtige Da-ten zur Nachnutzung des La-gerareals nach dem Abzug der römischen Truppen. In Kolln-brunn war es mittels eines Me-
Temporäres Militärlager in Ruhhof. Die Grabung 2014 in einer Calvicula-Toran-lage (Foto V. Lindinger)
Temporäres Militärlager in Ruhhof. Archäologische Rammkernprospektion (Foto V. Lindinger)
Jahresbericht 2014
80
talldetektorsurveys erstmals möglich, datierendes Fundmaterial festzustel-len. Die Bearbeitung der Artefakte wird bis 2015 fortgesetzt werden, un-ter Einbindung aller entlang der Auf-marschrouten des 1. und 2. Jahrhun-derts n. Chr. an den Flüssen March und Thaya vorliegenden, bislang publizierten signifikanten römischen Funde militärischen Charakters.
Projektleitung: S. Groh, H. Sedl-mayer; Mitarbeit: K. Elschek, K. Frei-tag, K. Herold, J. Kubíny, F. Lindinger, V. Lindinger, I. Repetto, U. Scha-chinger, A. Steininger. Kooperation: Archäologisches Institut der Slowa-kischen Akademie der Wissenschaf-ten; Urgeschichtemuseum Niederös-terreich in Asparn/Zaya
ii.3 Ostnorische limeskastelle (niederösterreich)
Auf Einladung des Instituts für Kulturgeschichte der Antike (ÖAW) wurden für die in Vorbereitung befindliche Neuauflage des »Limesführers« die Beiträge zu den ostnorischen Kastellen Favianis-Mautern an der Donau, Asturis-Zwentendorf an der Donau und Comagenis-Tulln an der Donau verfasst.
Für den Fundplatz Mautern an der Donau erfolgte in Hinblick auf zwei Präsentati-onen bei internationalen Tagungen eine Neubewertung sowohl mittelkaiserzeitlicher als auch spät antiker bis frühmittelalterlicher Befunde.
Eine detaillierte Analyse des 2002 erstmals publizierten geschlossenen Komple-xes eines Contuberniums in der Retentura des Kastells Favianis wurde unter Be-rücksichtigung von in jüngerer Zeit vorgelegten Vergleichsspektren vorgenommen. Das größtenteils erhaltene Inventar eines Papilio von 15,2 m², der als Küche, Auf-enthalts- und Schlafraum für wahrscheinlich sieben Soldaten diente, ist in Hinblick auf die Zahl der in einer Brandschicht erhaltenen Funde (93 NMI) und auf die unter-schiedlichen Funktionsbereiche, denen diese Artefakte zuzuordnen sind, einzigartig in der Forschungslandschaft römischer Kastelle. Die Ergebnisse der Auswertung wurden auf Einladung der Université de Poitiers präsentiert.
Auxiliarkastell Favianis-Mautern an der Donau. Versturzsituation im Be-reich des Papilio (Raum B) einer Kaserne des Kastells (Grafik S. Groh – H. Sedl-mayer)
Temporäres Militärlager in Kollnbrunn. Die Flächen des Metalldetektorsurveys 2014 (Grafik V. Lindinger)
Auxiliarkastell Favianis-Mautern an der Donau. Teile des Kochgeschirrs aus dem Inventar des Papilio (Raum B) einer Kaserne des Kastells (Grafik H. Sedlmayer)
Zentrale Wien
81
Im Rahmen einer von S. Groh betreuten Masterarbeit an der Universität Wien wurde von A. Gorbach die Bearbeitung des Fundmaterials aus dem spät antiken Gräberfeld West von Zwentendorf an der Donau im Jahr 2014 abgeschlossen. Eine in großen Teilen erfasste Nekropole des 4. Jahrhunderts n. Chr. am Westrand des Kastellvicus zeichnet sich durch zahlreiche beigabenführende Bestattungen aus. Deren Abfolge konnte innerhalb der Laufzeit von rund 100 Jahren in drei Phasen gegliedert werden. Diese Daten werden einen Teil der umfassenden Analyse des spät antiken Bestattungsplatzes von Zwentendorf bilden. Erste Ergebnisse einer komparativen Studie zu den Fundplätzen Mautern und Zwentendorf an der Donau zwischen Spät antike und Frühmittelalter konnten unter besonderer Berücksichti-gung der Daten zum Begräbniskult bei einem Workshop in Wien präsentiert werden.
Projektleitung: S. Groh, H. Sedlmayer; Mitarbeit: A. Gorbach, U. Schachinger. Kooperation: Bundesdenkmalamt
ii.4 interaktionen mit der Bernstein-straße
II.4.1 Die Villa maritima von San Simone-Simonov zaliv (Slowenien)
Im Rahmen einer Forschungskoopera-tion mit dem Institute for Mediterranean Heritage, Science and Research Centre of Koper, University of Primorska, Slo-wenien (I. Lazar) fanden in den Jahren 2008 – 2011 archäologische Feldfor-schungen in der Villa maritima von Izola in Slowenien statt. Die Untersuchungen bezogen sich auf Teilbereiche des Haupt-gebäudes sowie einer Portikus, die den Hafen flankierte. Anhand der Befundab-folgen und des aussagekräftigen stratifizierten Fundmaterials liegt nunmehr erst-mals eine exakte Chronologie für eine Villa maritima am Caput Adriae vor. Be-merkenswert ist die kurze Laufzeit des Villenkomplexes, die sich auf die Zeit der iulisch-claudischen Dynastie einschränken lässt. Eine Nachnutzung in der mittleren und späten Kaiserzeit ist für Teilbereiche, insbesondere die erwähnte Portikus, zwar indiziert, jedoch von deutlich bescheidenerem Aus-maß. Eine detaillierte Analyse der Bauausstattung, vor allem der Mosaiken, und eine Auswertung signifikan-ter Fundgruppen (Amphoren, Lampen, Glasgefäße) konnte im Jahr 2014 abgeschlossen werden.
Eine Implementierung der Ergebnisse älterer Gra-bungen (1922 – 1994) und der geophysikalischen Messdaten in einen neuen Gesamtplan ergibt erst-mals ein vollständiges Bild dieser Meeresvilla. Be-sonderes Augenmerk wurde auf die Georeferenzie-rung und Rektifizierung aller verfügbaren Bild und Plandokumente zur Bauausstattung der untersuchten Räume gelegt. Im Zuge der Bearbeitung gelang es, einen steingerechten Befundplan zu zeichnen und das Mosaikenprogramm des südöstlichen Hauptgebäudes sowie der südlichen Portikus zu rekonstruieren. Die Schwarz-Weiß-Mosaiken bezeugen, wie auch die Grabungsbefunde, ein zweiphasiges Bauprogramm, wobei die südliche Portikus in einer zweiten Phase errichtet wurde. Die Mosaikausstattung lässt Affinitäten zu den
Izola. Die Bucht am Caput Adriae mit der Villa von San Simone, die sich auf einer im Mittelteil des Bil-des sichtbaren Landzunge befindet (Foto S. Groh)
Izola. Teile des Fußboden-mosaiks im Hauptgebäude der Villa von San Simone (heute Archäologisches Museum Koper) (Foto S. Groh)
Jahresbericht 2014
82
frühen geometrischen Schwarz-Weiß-Mosaiken von Aquileia und den Fundplätzen am Caput Adriae der ersten dekorativen Phase des ausgehenden 1. Jahrhunderts v. Chr. und beginnenden 1. Jahrhunderts n. Chr. erkennen, die hinsichtlich ihres de-
korativen Repertoires von mittelitalischen Ein-flüssen geprägt sind.
Im Zuge der Forschungen des Jahres 2014 wurde zudem die Hafenanlage der Villa neu be-wertet. Hierfür wurden alle publizierten Daten zu den Häfen der istrischen Meeresvillen ge-sammelt und unter Berücksichtigung nautischer Faktoren kartiert. Die daraus resultierende Sys-tematisierung, die alle typologischen Kriterien der baulichen Installationen berücksichtigt, lässt deutlich erkennen, dass die Hafenanlage von San Simone-Simonov zaliv zu den aufwendigs-ten und bestausgebauten im Kontext römischer Meeresvillen zählt. Die Ergebnisse dieser Stu-die wurden bei einem internationalen Kolloqui-um in Montpellier präsentiert.
Projektleitung: S. Groh, H. Sedlmayer; Mitarbeit: V. Lindinger, G. Petrucci. Ko-operation: Institute for Mediterranean Heritage, Science and Research Centre of Koper, University of Primorska, Slowenien
ii.5 Forschungen zur Urbanistik von aquileia (italien)
Im Jahr 2014 wurden die 2011 begonnenen Forschungen im Westteil des Stadtge-biets von Aquileia fortgesetzt. In Kooperation mit dem Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia) werden Aspekte zur Urbanistik sowie zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte von Aquileia im
westlichen Suburbium untersucht.Im Rahmen eines 2012 bewilligten FWF-
Projekts (P 25176-G19 »Urbanistic Studies in Aquileia [Italy]« – Projektleitung S. Groh) wur-den 2014 ein Survey mit der Aufsammlung von Oberflächenfunden sowie archäologische Rammkernsondierungen vorgenommen. Der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbei-ten lag in der Aufnahme und Inventarisie-rung des umfangreichen Fundmaterials der Surveys 2013 – 2014 (F. Schimmer, P. Do-nat, R. Weitlaner). Die Fundbearbeitun-gen erstreckten sich darüber hinaus auf die Aufnahme der Fundmünzen (U. Schachinger), die Restaurierung der Metallfunde (L. Lun), die Reinigung des Fundmaterials aus dem Survey sowie Depotarbeiten.
II.5.1 Feldaktivitäten
II.5.1.1 SurveyIm Jahr 2013 erfolgte der Survey im westlichen Suburbium von Aquileia, auf beiden Seiten des ›Canale Anfora‹, 2014 sah das Projektdesign einen Survey innerhalb der Stadtmauern im Bereich des Circus vor. Die Erfahrungswerte des Surveys 2013 und
Izola. Die Hafenanlage der Villa von San Simone. Zu erkennen ist die anti-ke Mole, an der sich die Wellen bei Niedrigwasser brechen (Foto S. Groh)
Aquileia. Das westliche Suburbium (Foto F. Schim-mer)
Zentrale Wien
83
die immense Menge an Oberflächenfunden hat-ten zur Folge, dass Artefakte nicht auf der ge-samten geplanten Fläche, sondern nur in einem Sample von 20 % (60 aus 300 Grids) auf insge-samt 6.000 m² aufgelesen wurden. Der Survey-bereich wurde dabei in 12 Felder à 25 Quadran-ten/Grids unterteilt, wobei ein Grid einer Fläche von 10 × 10 m bzw. 100 m² entsprach. Innerhalb der Flächen wurde für den Metalldetektorsur-vey ein Random Sample-Raster von 15 Grids (60 %) und für den KeramikOberflächensurvey ein Raster von 5 Grids (20 %) gewählt.
Die paläografischen Untersuchungen bzw. Rammkernsondierungen des Jahres 2013 bezeugen über dem Werkstattviertel und der Arena des Circus massive Aufschüttungen und Planierungen aus der Spät antike. Das Oberflä-chenmaterial kann demnach nur Aussagen zur jüngsten Deponierungsphase liefern.
II.5.1.2 Archäologische Rammkern - sondierungen
Im Rahmen des FWF-Projekts wurde 2014 ein benzinbetriebener Bohrhammer angeschafft, um archäologische Rammkernsondierungen im Untersuchungsareal durchzuführen. Die-se Prospektionen erfolgten mit halboffenem, 7,5 cm weitem Bohrgestänge, dem Schlaghammer Cobra TT sowie dem hydrau-lischen HebeSystem Eitelkamp ZGM 98. Anhand der Bohrprofile sollten die Be-funde der geomagnetischen Prospektionen entlang des ›Canale Anfora‹ verifiziert und Aussagen zur Stratigrafie der interpretierten Baustrukturen getätigt werden. Die Sedimente der Bohrkerne wurden geputzt und fotografiert. Danach wurden stratigrafische Einheiten (SE) unter Berücksichtigung ihrer Textur, Farbe (Munsell Soil Color Charts), Korngröße und ihrer Einschlüsse definiert. Die archäologischen Rammkernprospektionen unterscheiden sich von den paläogeografischen Studien dahingehend, dass nur bis zur Untergrenze der archäologischen Schichten abgetieft wird und die Beschreibung sowie Analyse der anthropogenen Sedimentation nach archäologischen Kriterien erfolgt. Der paläografische Aufbau des Gebiets ist nach den Bohrungen 2013 bekannt, was jedoch fehlte, waren detaillierte Studien zur archäologischen Schichtabfolge.
In einem weiteren Schritt erfolgten Messungen der magnetischen Suszeptibi-lität aller definierten stratigrafischen Einheiten mit einem Bartington MS2 (Sensor MS2E) und der Software Bartington Multisubs v244 d. Die Werte der magnetischen Suszeptibilität geben die Magnetisierbarkeit von Materie in einem externen Magnet-feld an, d. h., archäologische Schichten bezeugen im Vergleich zum geologischen Untergrund zumeist deutlich erhöhte Werte. Die Kombination dieser drei nicht oder nur wenig invasiven Methoden der Feldarchäologie – Geophysik – Survey – Ramm-kernprospektion – erlaubt ein Maximum an Aussagen zur diachronen Entwicklung eines großräumigen Siedlungsgebiets, ohne invasive archäologische Grabungen durchführen zu müssen.
Die Ergebnisse der Rammkernprospektionen gewähren eine sehr präzise Zuwei-sung des Oberflächenmaterials zu primären und sekundären Fundkontexten, wobei sich zeigte, dass der überwiegende Teil der Funde einen direkten Bezug zu den in der magnetischen Prospektion erkannten Baustrukturen aufweist.
Aquileia, Feldaktivitäten 2014. 1 Die Lage des For-schungsgebiets 2 Metalldetektorsuvey 3 Survey mit der Aufsamm-lung von Oberflächenfun-den am ›Canale Anfora‹ und im Bereich des Circus 4 Archäologische Ramm-kernsondierungen (Grafik V. Lindinger)
Jahresbericht 2014
84
II.5.1.3 FundbearbeitungIm Dezember 2014 konnte die Fundaufnahme in Aquileia zu einem Abschluss gebracht werden, sodass nun das Gesamtvolumen des bearbeite-ten Fundmaterials zu beziffern ist. Demnach be-läuft sich die Fundzahl des Surveys am ›Canale Anfora‹ auf etwa 77.550 Stück mit einem Ge-samtgewicht von 1,9 t. Hiervon entfallen rund 70 % auf das Nord- und 30 % auf das Südfeld der Prospektionsflächen. Der größte Fundanfall ist im Westteil des Nordareals zu beobachten, während die Funddichte auf dem Südareal nach Südwesten abnimmt.
Die Fundmenge des Metalldetektor- und des Oberflächensurveys im Bereich des Circus ent-spricht ungefähr jener des Nordfelds am ›Ca-
nale Anfora‹, jedoch war der Fundanfall im Circus-Areal pro Grid im Durchschnitt etwa doppelt so hoch.
Was die Metallfunde betrifft, so erbrachten die Metalldetektorsurveys am ›Ca-nale Anfora‹ und im Gebiet des Circus insgesamt 292 Münzen. Hiervon stammen 204 Prägungen vom ›Canale Anfora‹ und 88 aus dem Bereich des Circus. Die Münzen wurden im Juli 2014 von U. Schachinger bestimmt. Demnach umfasst das Münzspektrum vorwiegend römische Prägungen von der Republik bis in das späte 4. Jahrhundert n. Chr., daneben eine kleine Gruppe neuzeitlich bis rezenter Exem-plare. Die Restaurierung der Münzen und sonstigen Metallfunde des Surveys im Circus war bereits im Mai 2014 durch L. Lun erfolgt.
Bezüglich der quantitativen Verteilung der Fundkategorien bestätigte die weitere Fundbearbeitung das sich bereits 2013 abzeichnende Bild, wonach den weitaus größten Anteil des am ›Canale Anfora‹ geborgenen Materials die Gefäßkeramik stellt. Andere Fundgruppen, wie Glasgefäße, Baumaterial und Metallobjekte, liegen nur in vergleichsweise geringer Menge vor (da der Metalldetektorsurvey ›gesampelt‹ erfolgte, ist der Anteil der Metallfunde auf die Gesamtfläche bezogen entsprechend höher zu veranschlagen).
Ein ähnliches Verteilungsmuster deutet sich bei den Funden des Circus-Bereichs an. Inner-halb der Gefäßkeramik ist auch dort eine klare Dominanz von Transport amphoren zu konsta-tieren, möglicherweise jedoch etwas weniger stark ausgeprägt als am ›Canale Anfora‹.
Die Zusammensetzung des Terra-Sigillata-Spektrums vom ›Canale Anfora‹ lässt sich nach aktuellem Bearbeitungsstand im Wesentlichen auf den Survey im Circus übertragen. Hier wie dort stammt der weitaus größte Anteil der Sigil-latagefäße aus Nordafrika und ist der mittleren bis späten Kaiserzeit zuzuordnen. Vertreten sind Gefäße der Produktionen A und A/D, am häufigsten jedoch zentraltunesische Sigillata C sowie nordtunesische Sigillata D. Daneben fin-den sich u. a. italische Sigillatagefäße aus der Padana und aus Mittelitalien, einschließlich
Formen der Tardopadana, sowie südgallische und östliche Sigillata B. Spätrepub-likanisch-frühkaiserzeitliche ›Ceramica a vernice nera‹ macht nur einen geringen Anteil der Feinkeramik aus. Bemerkenswert sind einige Fragmente mittelkaiserzeit-licher korinthischer Reliefbecher.
Aquileia. Archäologische Rammkernsondierungen am ›Canale Anfora‹ (Foto V. Lindinger)
Aquileia. Der Survey im Bereich des Circus (Foto V. Lindinger)
Zentrale Wien
85
Gemeinsam ist den beiden Fundspektren auch der chronologische Hiatus im mittleren 5. Jahrhundert n. Chr. Inwieweit das Material aus dem Bereich des Circus und jenes vom ›Canale Anfora‹ römische Funde aus der Zeit nach 450 beinhaltet, bleibt vorerst offen.
Ausschließlich im Bereich des ›Canale Anfora‹ wurden runde, gelochte Be-schwerer aus Ton für Fischernetze gefunden, die sich wohl mit dem antiken Kanal oder dem nahen ›Westhafen‹ in Verbindung bringen lassen.
Projektleitung: S. Groh. Mitarbeit: Fundbearbeitung: F. Schimmer, P. Donat, R. Weitlaner, L. Lun, U. Schachinger. Feldaktivitäten: K. Freitag, M. Guttmann, F. Hladky, V. Lindinger, T. Leleković, I. Repetto, F. Schimmer, A. Steininger, R. Weit-laner. Kooperation: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia
Aquileia. Surveys am ›Canale Anfora‹ und im Bereich des Circus. Fundanfall in kg (Grafik V. Lindinger)
Aquileia. Surveys am ›Canale Anfora‹ und im Bereich des Circus. Münzfunde nach Stückzahl (Grafik V. Lindinger)
Jahresbericht 2014
86
ZWeiGstelle atHen
Leitung: Dr. Georg LadstätterWissenschaftliche Bedienstete: Dr. Walter Gauß
Dr. Christa SchauerVerwaltung: Sabine KabourelisPraktikantin: Manuela Leibetseder, B. phil, MA
Isabella Greisinger, MSc, BSaMit Projektabwicklung betraut: Univ.-Prof. Dr. Veronika Mitsopoulos-Leon
I. FeldForschungsprojekTe
i.1 lousoi (achaia)
Die Arbeiten 2014 in Lousoi umfassten eine Vermessungs- (27. April bis 3. Mai 2014) sowie eine Aufarbeitungskampagne (1. Juni bis 12. Juli 2014).
I.1.1 Siedlungsraum Lousoi: digitale Karte und digitales Geländemodell
Im Rahmen der Kampagne wurden grundlegende konzeptionelle Arbeiten für die geodätische Erfassung der Gesamttopografie des Siedlungsraums von Lousoi erar-beitet. Dazu wurden intensive Begehungen sowohl der archäologisch untersuchten topografischen Abschnitte des Stadtzentrums, der hellenistischen Wohnsiedlung und des extraurbanen Artemisheiligtums als auch der geomorphologischen Gege-benheiten der angrenzenden Talsohle mit periodischer Sumpf- und Seenbildung, der Sinklöcher zur Wasserentsorgung und der rahmenden Felsformationen, welche alle die spezifische Siedlungsform von Lousoi determinieren, unternommen. Diese Aktivitäten verstehen sich als Grundlage für die geplante Neuvermessung des Sied-lungsraums, woraus eine aktuelle digitale Karte und ein digitales Geländemodell generiert werden sollen.
Im Rahmen der Vermessungskampagne wurde auch der in situ erhaltene Un-terbau des Artemistempels in Form eines 3-D-Laser-Scans erfasst, aus den Ortho-fotos wurden der maßstäbliche Grundriss und probeweise ausgewählte Schnitte generiert.
Projektleitung: G. Ladstätter, C. Kurtze
I.1.2 Die Keramik geometrisch-archaischer Zeit aus dem Heiligtum der Artemis Hemera: Kult und Vernetzung eines frühen peloponnesischen Heiligtums
Im Rahmen Publikationsvorhabens wurde das bislang von C. Schauer erarbeitete digitale Archiv zu diesem Fundmaterial, welches in den Grabungen 1986 – 1999 im Artemisheiligtum geborgen wurde, an A. von Miller übergeben (s. auch I.1.4).
Die Arbeiten am Material, das im Depot von Kato Lousoi gelagert ist, umfassten die vollständige Sichtung und statistische Erfassung der Keramikfragmente. Zu den 1.146 bereits inventarisierten Gefäß(fragment)en wurden 2014 weitere 1.667 diag-nostische Stücke erfasst. Parallel wurden bedarfsweise Scherben gewaschen, auf
ZWEIGSTELLE ATHEN
87
Anpassungen überprüft, abschließend wurde das Material kontextbezogen gelagert und ca. 50 Gefäße wurden für die erforderliche Restaurierung vorbereitet.
Basierend auf diesen Arbeiten wurde ein FWF-Antrag zur Finanzierung der ab-schließenden Bearbeitung dieses umfangreichen Fundkomplexes vorbereitet.
Ziel dieser Forschungen ist die Vorlage dieses Materials unter formtypologischen, chronologischen sowie funktionalen, auf das Heiligtum bezogenen Aspekten zu-sammen mit ergänzenden archäometrischen Untersuchungen. Das quantitativ und qualitativ breite Keramikspektrum repräsentiert aussagekräftiges komplementäres Material zu den von V. Mitsopoulos-Leon vorgelegten Votivfunden und ermöglicht weiterführende Aussagen zum Kult der Artemis von Lousoi; diese parallel durchge-führte Beurteilung von Keramik- und Votivmaterial erweist sich als paradigmatisches Fallbeispiel für ein Heiligtum und lässt entscheidende Rückschlüsse auf Kult, Litur-gie sowohl spezifisch zum Artemisheiligtum als auch generell zu den arkadischen Heiligtümern erwarten. Die vergleichende Betrachtung des Keramikspektrums des überregional frequentierten extraurbanen Artemisheiligtums mit der synchronen Ke-ramik des Versammlungsorts der lokalen Elite im Bereich des späteren, hellenis-tischen Stadtzentrums ermöglicht darüber hinaus gerade über die Leitformen der Keramik weitreichende funktionsanalytische Aussagen.
Nach derzeitiger Einschätzung kann das aus den systematischen Grabungen geborgene Keramikmaterial erstmals auch aus keramologischer Sicht eine tragfä-hige Grundlage zur generellen Beurteilung der geometrisch archaischen Epoche Nordwest-Arkadiens liefern. In dieser überregionalen Betrachtungsweise ermöglicht das Fundmaterial Aussagen zur gesamten geometrisch archaischen Keramik- und Kultkoiné der angrenzenden Kulturlandschaften Arkadiens und Achaias.
Projektleitung: G. Ladstätter; Mitarbeit: A. von Miller
I.1.3 Untersuchungen zur Architektur des frühhellenistischen Artemistempels
Aufbauend auf den Untersuchungen der Jahre 2012 und 2013 wurde 2014 das umfangreiche zeichnerische und fotografische Dokumentationsmaterial des Arte-mistempels bearbeitet. Weitergeführt wurden die Digitalisierung der Zeichnungen und die Aufbereitung des Fotokatalogs. Die inhaltlichen Untersuchungen konzent-rierten sich auf die übergreifende Einordnung der differenzierten bauornamentalen Werkstücke zur chronologischen und formanalytischen Bestimmung des Tempels.
Im Depot von Kato Lousoi wurden die Arbeiten an den dort gelagerten Bauglie-dern fortgesetzt. Nach Abschluss der Kampagne war die Gesamtheit der ca. 350 aussagekräftigen Bauglieder in einem Daten-, Maßskizzen- und Fotokatalog auf-genommen; ein großer Teil dieses Materials ist bereits in maßgerechten zeichneri-schen Aufnahmen dokumentiert.
Folgende Einzelstudien zur Wiedergewinnung der Architektur des Artemistem-pels wurden durchgeführt:
Ca. 100 Werkstücke sehr unterschiedlicher Erhaltung der dorischen (Halb-)Säu-len aus Marmor wurden formal und statistisch erfasst. Die unterschiedlichen Serien von Verbindungseinrichtungen an den Lagerflächen ermöglichen selbst bei schlech-ter Erhaltung eine klare Zuweisung entweder zu den Säulen der Frontordnung oder zu den Halbsäulen mit angearbeiteten Pilastern der Cella-Innenordnung. Zusam-men mit den zuweisbaren Kapitellen sind aus diesen Säulenfragmenten die jewei-lige Höhe der Ordnungen und damit die Bauhöhe des Tempels wiederzugewinnen.
Von den dorischen Marmorkapitellen der Hallen haben sich etwa 60 z. T. stark fragmentierte Werkstücke erhalten. Dieser Zustand resultiert aus der Wiederverwen-dung dieser Bauglieder in einer Abfolge von Kirchenbauten in der Form, dass die im neuen Bauverband ›störenden‹ Kapitellecken abgeschlagen und die verbleibenden ›Kerne‹ der Kapitelle mit minimaler Zurichtung vermauert wurden. Aus aufwendigen Anpassungs und Auflegeversuchen auf Basis von 1 : 1Musterzeichnungen ließen
Jahresbericht 2014
88
sich 16 ›Kapitellindividuen‹ bestimmen, was mit der aus dem erhaltenem Grundriss abzuleitenden Säulenstellung korrespondiert.
Erfasst wurden darüber hinaus alle im Depot gelagerten profilierten Werkstücke aus Marmor und Kalkstein, die explizit nicht den jeweiligen Ordnungen zuzuwei-sen sind. Daraus resultiert einerseits die Wiedergewinnung von Detailformen der Ausstattung des Tempels, so z. B. die Durchbildung der Kultbildbasis. Anderer-seits gelang es, bislang fünf großdimensionierte, halbkreisförmige Basen (scholiae) hellenistischer Zeit zu identifizieren, welche auf eine zusätzliche architektonische Ausstattung des Heiligtums weisen. Dieser Befund ist insofern bemerkenswert, als diese ca. 5 m im Durchmesser aufweisenden Kleinarchitekturen als typisches hel-lenistisches Weihverhalten im Areal des Heiligtums unterzubringen sind.
Mit Erfassung des Gesamtbestands der erhaltenen Bauglieder ist nun ergänzend zum in situ erhaltenen Unterbau eine solide Grundlage für die weiteren abschließen-den Untersuchungen zur Wiedergewinnung der Architektur des frühhellenistischen Artemistempels geschaffen respektive zu dessen chronologischer, formaler und übergreifender bautypologischer Einordnung.
Projektleitung: G. Ladstätter; Mitarbeit: V. v. Eickstedt
I.1.4 Untersuchungen zum Fundmaterial der Grabungen im Stadtzentrum
Während der Aufarbeitungskampagne konzentrierte sich die Publikationsvorberei-tung der Befunde und Funde aus dem ›hellenistischen öffentlichen Zentrum‹ auf die Sichtung und Dokumentation sämtlicher Scherben aus den 22 Grabungsflächen der Reinigung im Jahr 2000 und der Grabungen 2001 – 2004 im Bereich der Halle. Dazu kam die Sichtung der Kleinfunde aus den Grabungen 2000 – 2006, die während der Kampagnen von der damaligen Grabungsleiterin V. Mitsopoulos-Leon aufgenom-men worden waren.
Da bei den Grabungen in der Halle das Hauptaugenmerk auf der Architektur der Hallenfundamente und den Resten einer östlich der Halle lokalisierten späthellenis-tisch-frührömischen Keramikwerkstatt lag, wurde der Untergrund nur stichproben-artig untersucht. Es zeigte sich dabei bald, dass für die Errichtungszeit der Halle aussagekräftige Keramik fast gänzlich fehlte.
In mehreren Flächen war beiderseits der Fundamente, vor allem jedoch an der innerhalb der Halle gelegenen Seite, eine deutliche Splittschicht zu beobachten, die von G. Ladstätter als Abschlagsschicht von der Errichtung der Halle interpretiert wird. Die Keramik in und unterhalb der Splittschicht wurde jeweils getrennt gesammelt. Für die Datierung der Halle ergaben sich daraus keine entscheidenden Hinweise. Wenige Indizien liefern der Boden eines hellenistischen importierten Kraters mit kan-tig ansetzendem Fuß, der über der Splittschicht gefunden wurde, ein fragmentierter Napf, von dem ein Teil in der Fundamentgrube und ein Teil in der umgebenden Erde lag, sowie ein größerer Teil eines Bechers (K 4/02) mit profiliertem schmalem Fuß, der vermutlich hellenistisch ist, zu dem jedoch keine unmittelbare Parallele bekannt ist. Der fragmentierte Becher lag in der Splittschicht direkt neben dem Fundament und ist sicher im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an seinem Fundort deponiert worden. Profilierte Füße ähnlich wie bei K 4/02 treten an hellenistischen Kantharoi des 3. Jahrhunderts auf, sodass der bisher singuläre Becher sich möglicherweise in diese Zeit setzen lässt. Aus dem Bereich der Fundamentgrube stammt ferner ein größeres Wandfragment eines weiteren wohl hellenistischen Bechers.
Für die Planierung des Terrains zur Vorbereitung des Bauplatzes der Halle ist vorwiegend Erde mit archaischem Fundmaterial, in geringem Maß auch Erde mit geometrischen Scherben benutzt worden. Dieselbe Erde wurde offenbar nach Er-richtung der Fundamente in die Fundamentgruben wieder eingefüllt. Eine hellenis-tische oder klassische Benutzung des Areals vor Errichtung der Halle ist aufgrund der bisherigen Grabungsergebnisse nicht festzustellen.
ZWEIGSTELLE ATHEN
89
Jedoch wurden in den Tiefschnitten unter der Halle Funde und vermutlich auch Niveaus angetroffen, die eine Werkstatttätigkeit schon in archaischer Zeit belegen. Nach der vorläufigen Arbeitshypothese könnte es sich um umgelagertes Material einer Ziegelwerkstatt handeln, was jedoch mit archäometrischen Methoden und ge-gebenenfalls durch eine Nachgrabung zu überprüfen wäre. Aus den Schichten unter der Halle, die archaische Scherben enthielten, stammen jedenfalls keilförmige sowie dreiarmige Brennofenstützen, außerdem mehrere handgeformte unregelmäßige To-nobjekte, die ebenfalls als Brennofenstützen gedient haben könnten, dazu verbrann-te und verglaste Tonbrocken, die vermutlich von einer Ofenauskleidung stammen. In den Schichten, die archaische Keramik enthielten, wurden zudem immer wieder zahlreiche Dachziegelfragmente beobachtet. In der Beschreibung der unteren der ausgegrabenen Schichten wurden schwach gebrannte, teilweise aufgelöste Ziegel erwähnt; ihre Verteilung ist in den Zeichnungen der entsprechenden Plana zu erken-nen. Am auffallendsten unter den Dachziegelfragmenten ist ein in den Grabungsbe-richten bereits wiederholt erwähntes Palmettenantefix (TKa 1/01) mit Ansatzspuren eines lakonischen Kalypters. Zwei Fragmente scheibenförmiger Akrotere oder Ante-fixe archaischer Zeit stammen aus späteren, nicht datierenden Kontexten.
Auch für die Produktion und Zeitstellung der teilweise freigelegten späthelle-nistisch-frühkaiserzeitlichen Töpferwerkstatt östlich der Halle zeigt sich nach der Aufarbeitungskampagne 2014 durch Anpassungen einiger Scherben aus verschie-denen Fundjahren nun ein klareres Bild. Die Werkstatt wurde, wie ihre Lage direkt vor der Front der Halle und der stratigrafische Kontext zeigen, erst nach Aufgabe der Repräsentationsarchitektur des öffentlichen Zentrums eingerichtet. Neben klei-nen Brennofenstützen mit L-förmigem Querschnitt aus ihrem Inventar können der Werkstatt drei Fehlbrände zugewiesen werden: eine kleine Schale mit Resten eines roten Überzugs, eine Kanne und ein konvexer Becherrand, die belegen, dass die Werkstatt einfaches Tafelgeschirr herstellte.
Projektleitung: G. Ladstätter; Mitarbeit: C. Schauer (Keramikbearbeitung), K.-V. v. Eickstedt (Fotografie)
1Lousoi, hellenistisches öffentliches Zentrum. Becher K 4/02 aus der Splittschicht neben dem Hallenfundament (Foto K.-V. v. Eickstedt)
2Lousoi, hellenistisches öffentliches Zentrum. Archaische Gefäß-fragmente (Foto K.-V. v. Eickstedt)
3Lousoi, hellenistisches öffentliches Zentrum. Ar-chaische Brennofen stützen aus den Aufschüttungen unter der Halle (Foto K.-V. v. Eickstedt)
4Lousoi, hellenistisches öffentliches Zentrum. Antefix TKa 1/01 (Foto K.-V. v. Eickstedt)
1
2
3 4
Jahresbericht 2014
90
I.1.5 Keramik und Kleinfunde aus der Grabung Phournoi/Häuser
V. Mitsopoulos-Leon arbeitete 2014 an der Erstellung des Manuskripts, in dem das gesamte Fundspektrum aus den Grabungen in den hellenistischen Häusern des Flurbereichs Phournoi vorgelegt werden soll. Dabei handelt es sich um ein reich-haltiges, differenziertes Keramikspektrum, welches u. a. Tafelgeschirr, Kochgefä-ße, Deckel, Unguentarien, Lampen beinhaltet, um zahlreiche Artefakte aus Bronze, Eisen, Blei, Marmor und Bein sowie um großformatiges Mobiliar wie Badwannen, Hestien, Becken und Ständer.
Zusammen mit diagnostisch erhaltenen Grundrissen der Hausarchitektur, wo-nach sich die jeweiligen funktionalen Raumeinheiten wie Oikos, Andron, Baderäume, Höfe und Werkstatteinrichtungen klar definieren lassen, liefert die Analyse dieses Fundmaterials neben der chronologischen Einschätzung grundlegende Hinweise zu den Funktionsabläufen hellenistischer Wohnkultur für Lousoi und für die erweiterte Region, die in dieser Hinsicht bislang archäologisch kaum erschlossen ist.
i.2 aigeira (achaia)
I.2.1 Grabung und Aufarbeitung am sogenannten Sattel
Im Rahmen des Forschungsschwerpunkts »Spätbronzezeitliches Aigeira« wurden 2014 die Grabungen im Bereich des sog. Sattels und östlichen Akropolisabhangs fortgeführt. Sie konzentrierten sich auf die Bereiche A–F, wo neue Erkenntnisse zur Geschichte der spätbronzezeitlichen Siedlung gewonnen werden konnten.
Die Grabungen im Innenbereich eines spätbronzezeitlichen Gebäudes (Be-reich F) wurden fortgesetzt und abgeschlossen. Hier war bereits 2013 die bislang beste stratigrafische Abfolge für die gesamte spätbronzezeitliche Siedlung festge-stellt worden. Im Jahr 2014 wurden überwiegend Schichten aus einer frühen Phase von Spät Helladisch (im Folgenden SH) IIIC Früh freigelegt, die unter dem untersten Fußboden aus getretenem Lehm liegen. Zu den bedeutendsten Funden zählen u. a. das Fragment eines FH II-zeitlichen Gefäßes, eine kleine, durchbohrte Perle aus Bergkristall und das Randstück eines figürlich bemalten mykenischen Skyphos, das den Kopf eines Stiers oder einer Ziege zeigt. Nach der bisherigen stratigrafischen Auswertung entsprechen die zeitlich jüngsten Funde unter dem Fußboden den Fun-den aus der Siedlungsphase IA auf der Akropolis.
Sicher zu den wichtigsten Ergebnissen gehört der klare Nachweis eines offenen Hofbereichs (Bereich E) unmittelbar südlich des eben erwähnten spätbronzezeitli-chen Gebäudes. Im Zentrum des Hofs liegt eine mehrfach erneuerte Herdstelle, die von einer Anzahl kleiner Gruben umgeben ist. Sie sind mit zerscherbter Keramik, Tierknochen und Asche verfüllt, wahrscheinlich Abfall, der von verschiedenen Rei-nigungen der Herdstelle stammen dürfte.
Zwei klar unterscheidbare verbrannte Fußböden aus getretenem Lehm können der Herdstelle zugeordnet werden. Auf dem oberen der beiden Böden, der beson-ders starke Brandspuren zeigt, lagen zahlreiche aussagekräftige Fragmente von Keramik, u. a. mehrere Fragmente eines Pithos mit plastischen Bändern und Siegel-abdrucken sowie eine Anzahl von zerbrochenen mykenischen Terrakotta-Figurinen und Mahlsteinen. Die vorläufige zeitliche Einordnung des Fußbodenhorizonts in eine fortgeschrittene Phase von SH IIIC Früh stimmt mit dem gegenwärtigen Verständnis der Siedlungsphase IB auf der Akropolis gut überein. Der stark verbrannte Zustand des Bodens und die große Anzahl der auf ihm liegenden zerbrochenen Gegenstände deuten darauf hin, dass es sich hier um die Brandzerstörung der Siedlungsphase Aigeira-Akropolis-IB handelt, die auf der Akropolis seit den Grabungen der 1970-iger Jahre und seit 2013 auch am Sattel eindeutig nachgewiesen ist.
Bei den Ausgrabungen im Bereich der spätbronzezeitlichen Befestigungsmauer (Bereiche A–C) wurde eine komplizierte stratigrafische Abfolge mit einer Anzahl von
ZWEIGSTELLE ATHEN
91
übereinanderliegenden Mauern und Fuß-bodenhorizonten aus getretenem Lehm festgestellt. Die Funktion der Mauern, die alle unter der Befestigungsmauer verlau-fen, ist derzeit noch nicht klar.
Auf einem SH IIIC Spät-zeitlichen Fußbodenhorizont im Bereich B, von dem Teile bereits 2012 freigelegt worden waren, wurde ein kugelförmiges Gewicht (ca. 52 g) aus Hämatit gefunden. Aus gesicherten archäologischen Kontexten sind in dieser späten Phase der Bronze-zeit Funde von Gewichten außergewöhn-lich und bislang nur aus der spätbronze-zeitlichen Nekropole von Perati (Attika) bekannt.
Im Bereich C wurde eine besonders aufschlussreiche Abfolge von Fußbo-denhorizonten ergraben. Unmittelbar auf dem untersten Boden aufliegend, wurde eine Ansammlung von mindestens zehn spätbronzezeitlichen Gefäßen gefunden, die allesamt stark zerscherbt sind. Aus-grabung und Restaurierung sind noch nicht abgeschlossen und sollen 2015 fortgesetzt werden, doch ist bereits jetzt klar, dass es sich um einen sehr bedeu-tenden Fund handelt; zu den restaurier-baren Gefäßen gehören Fein- und Trink-keramik (Kratere, hochfüßiger Skyphos, Tasse), Gebrauchskeramik (Hydrien, Kanne, Krug), Kochkeramik (Kochtopf) sowie handgemachte und geglättete (HGK/HMB) Keramik.
Am südlichen Abhang der Akropolis (Bereich D) wurde unmittelbar westlich der vermutlich spätklassisch/hellenistischen Mauer zur Feststellung ihres weiteren Ver-laufs ein Schnitt angelegt. Bis zum Grabungsende konnte jedoch ihre Fortsetzung nicht geklärt werden. Unter den wenigen überwiegend späten Funden aus diesem Bereich sind die Fragmente chalkolitischer Keramik besonders auffallend. Wahr-scheinlich handelt es sich hier um von der Akropolis abgerutschtes Material.
Eine erste systematische Durchsicht der früheisenzeitlichen Funde aus den neu-en Grabungen durch F. Ruppenstein (Frei-burg) legt nahe, dass zwischen den spä-testen bronzezeitlichen und den frühesten eisenzeitlichen Straten ein Hiat anzuneh-men ist. Gegenwärtig können nur wenige Fragmente der mittelgeometrischen Zeit zugewiesen werden, während ein be-trächtlicher Anteil spätgeometrisch ist.
Projektleitung: W. Gauß; Mitarbeit: H. Birk (Esslingen), S. Kalabis (Ferdinan-deum Innsbruck), C. Klein (Cincinnati), S. Müller (Universität Trier), C. Regner, H. Staub (München), T. Ross (Toronto),
Aigeira, ›Sattel‹. Plan der Ausgrabung (W. Gauß, H. Birk)
Aigeira, ›Sattel‹. Hofbe-reich mit Herdstelle (Foto W. Gauß)
Jahresbericht 2014
92
J. B. Rutter (Dartmouth College), F. Ruppenstein, A. Becker, I. Kühnrich-Chatterjee (Universität Freiburg), R. Smetana (Universität Salzburg), N. Theocharis (Athen); Lehrgrabung: L. Drake, C. Drummer, I. Erbes, U. Maihöfer, C. Reisinger, C. Schmid (Universität Erlangen). Kooperation: H. Stümpel, W. Rabbel, C. Klein, C. Milde, I. Wehner, M. Proksch, K. Rusch (Universität Kiel); Teilfinanzierung: Institute of Aegean Prehistory (INSTAP), Mediterranean Archaeological Trust (MAT)
I.2.2 Fragen zur archaischen Architektur von Aigeira
Als überschaubarer Materialkomplex wurden über das Jahr 2014 die Befunde und Funde zur archaischen Architektur von Aigeira zusammengestellt und aufgearbeitet.
Neben den aus den Grabungen W. Alzingers vorgelegten und in der Folge z. T. kontrovers beurteilten In-situ-Befunden auf der Akropolis und den von A. Bam-mer in Berichtsform vorgestellten archaischen Baugliedern der Grabung Zaoussis ist die dorische archaische Sakralarchitektur in Aigeira vor allem mit fünf diagnostisch erhaltenen Kapitellen belegt, die als Streufunde geborgen werden konnten. Die Ana-lyse und Einordnung dieser zeittypischen Sandsteinkapitelle zeigt, dass Aigeira für den gesamten Verlauf des 6. Jahrhunderts v. Chr. in die Koiné der Entwicklung der dorischen Monumentalarchitektur eingebunden war, für welche die Aigeira unmittel-bar benachbarten Regionen der Korinthia und Delphi – neben anderen – besondere Impulse lieferten.
Das Fehlen von Kanneluren, der vergleichsweise kleine untere Durchmesser und die spezifischen Verbindungselemente am Unterlager der beiden ältesten ai-geiretischen Kapitelle weisen generell auf eine frühe Stufe dorischer Architektur mit Steinkapitellen über Holzsäulen. Die formalen Spezifika des breit ausladenden Echinus und der scharfkantig geschnittenen Rille zwischen Echinus und Abakus finden ihre Parallelen in den vielleicht ältesten dorischen Kapitellen aus dem frühen 6. Jahrhundert v. Chr., die sich in Tiryns und Delphi erhalten haben. Die drei weiteren Kapitelle belegen die stufenweise Entwicklung dieser Bauglieder von der Mitte bis zum Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr.
Bemerkenswert bleibt, dass in Aigeira für das 6. Jahrhundert v. Chr. bislang fünf verschiedene Sakralbauten nachzuweisen sind, die im erweiterten Akropolisbereich und im Areal des späteren hellenistischen Stadtzentrums mit dem Theater zu veror-ten sind. Für die Baugestalt dieser Tempel ist zumindest aus den In-situ-Baubefun-den auf der Akropolis ein kleiner prostyler Naiskos zu argumentieren, mit welchem
1
2 3
4
Aigeira, ›Sattel‹. Spät-bronzezeitliche Funde aus verschiedenen Grabungs-bereichen
1Skyphos mit figürlicher Bemalung
2Gewicht aus Hämatit
3Fragment eines Pithos mit Siegeleindrücken
4Tasse mit linearer Be-malung (Foto W. Gauß, digitale Nachbearbeitung R. Smetana)
ZWEIGSTELLE ATHEN
93
wohl eines der jüngeren Kapitelle der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. zu verbinden ist. Aus den bislang archäologisch erschlossenen Arealen erscheinen archaische Ringhallentempel für Aigeira zunächst unwahrscheinlich.
Projektbearbeitung: G. Ladstätter
I.2.3 Aufarbeitung der Altfunde der Grabungen 1972 – 1996
Im Jahr 2014 wurde die Bearbeitung und abschließende Auswertung der Funde und Befunde aus den Grabungen W. Alzingers (Theater, Naiskoi, Tycheion, Palati und Akropolis) fortgesetzt.
Im Zuge des Dissertationsprojekts von A. Tanner (Zürich) zur Architektur der hel-lenistischen Naiskoi konnte die Bauaufnahme der Grundrisse ergänzt und vervoll-ständigt werden. Damit steht erstmals eine steingerechte Aufnahme (M. 1 : 25) der drei Gebäude für die weitere Auswertung zur Verfügung. Nach einem Vergleich der Fotos und Pläne aus den Grabungen O. Walters (1916 und 1925) mit dem heutigen Bestand wurden zudem einige Strukturen östlich und westlich der Naiskoi D und E, die heute noch als Abarbeitungen des anstehenden Felsens erkennbar sind, neu in den Gesamtplan des Theaterbereichs aufgenommen. Auch konnte anhand des Fotos einer in den Felsen geschlagenen Treppe eine überwachsene Struktur südlich des Theaters als eben diese Treppe identifiziert werden; sie liegt heute außerhalb des eingezäunten archäologischen Geländes.
Ein Schwerpunkt der bauforscherischen Arbeiten 2014 lag in der Beschreibung von Naiskos E und der Anfertigung von Schnitten mit Innenansichten, wobei die zeichnerische Aufnahme unter Zuhilfenahme des 2013 erstellten 3-D-Modells des Gebäudes erfolgte. Die Überprüfung des Baubestands mit der Dokumentation O. Walters erbrachte wertvolle Erkenntnisse über den früheren Zustand der Ge-bäude. So konnte festgestellt werden, dass Steinblöcke der obersten Lage des
Aigeira, Plan des Theater-bereichs mit den Naiskoi D, E und F (Bauaufnahme A. Tanner, digitale Gestal-tung H. Birk, W. Gauß)
Jahresbericht 2014
94
Naiskos D nach 1925 entfernt und wohl für den Bau der umliegenden ›Rosinenpflü-cker-Häuser‹ verwendet worden waren.
Zur Klärung noch offener Fragen, die den Baubeginn, Bauveränderungen oder den Nutzungszeitraum der drei hellenistischen Naiskoi betreffen, wurde die Kon-textualisierung jener Fundgattungen fortgesetzt, die sofort nach ihrer Auffindung vom restlichen keramischen Kontext getrennt und demzufolge ohne Angabe der entsprechenden Kontextnummer aufbewahrt wurden (etwa Münzen, Terrakotten, Lampen, sonstige Kleinfunde und herausragende Einzelfunde). So wurde damit begonnen, die Messprotokolle und Inventarlisten zu den Münzfunden auszuwerten, mit dem Ziel, erstmalig einen genauen Verteilungsplan der Münzfunde im Bereich des Theaters und der Naiskoi zu erstellen.
Im Rahmen des Dissertationsprojekts von M. Leibetseder (Salzburg) wurde mit der systematischen Aufnahme der sog. Grauen Ware späthellenistischer und frührömischer Zeit aus dem Theaterbereich (Theater, Naiskoi, Tycheion) und Palati begonnen. Bei den in Aigeira vertretenen Formen überwiegen Teller und Platten mit Steilrand, Variationen der Form Conspectus 1.1, ebenfalls relativ zahlreich vertreten sind Schalen mit geradem oder ausschwingendem Rand, die meist mit Rädchen-dekor verziert sind. Ein wahrscheinlicher Fehlbrand könnte das erste Indiz für eine lokale Herstellung der ›Grauen Ware‹ in Aigeira sein. Die Klärung der Frage, in wel-chem zeitlichen Ausmaß und Umfang eine lokale Keramikherstellung nachgewiesen werden kann, ist für die Beurteilung von Aigeira in hellenistischer und römischer Zeit von großer Bedeutung.
A. Heiden (DAI Athen) hat im Jahr 2014 mit der Untersuchung der Dachkeramik von der Akropolis aus den Grabungen W. Alzingers begonnen. Es handelt sich hier um mindestens 82 Dachterrakotten, zum größten Teil Elemente eines korinthischen Daches, das den Tempel auf der Akropolis gedeckt hat. Dazu gehören Fragmente der Giebelsima, von Traufziegeln, Firstziegel mit Palmetten, Antefixe und zahlreiche korinthische Ziegelfragmente. Es handelt sich um ein spätarchaisches Dach bester Qualität aus einer korinthischen Werkstatt.
Aigeira, Tycheion. Henkelfragment einer Keramiklampe mit Rekon-struktionszeichnung (FG 02164-005) sowie Frag-mente von Glanztonke-ramik-Tellern (FG 02597-001. FG 03258-001) aus dem sog. Tycheion von Aigeira (Grafik M. Eicher)
Aigeira, ›Graue Ware‹ aus verschiedenen Kon-texten (Foto W. Gauß, digitale Nachbearbeitung M. Leibetseder)
ZWEIGSTELLE ATHEN
95
Im Bereich des Tycheions wurde von C. Hinker (ÖAI Wien) mit M. Eichner die wissenschaftliche Bearbeitung der Transportamphoren fortgesetzt und die Aufnah-me von Tonlampen und Terra Sigillata begonnen (alle Funde aus den Grabungen des ÖAI 1972 und 1981 – 1988).
Parallel zur Feldkampagne konnten insgesamt 274 vorwiegend fragmentarisch erhaltene Keramiklampen, Terra Sigillata, sog. Terra Sigillata-Imitationen und Trans-portamphoren hellenistischer bis spät antiker Zeitstellung identifiziert und dokumen-tiert werden. Die gewonnenen Daten umfassen die zeichnerische Dokumentation von Fundstücken als Grundlage für die grafische Darstellung und die Aufnahme relevanter Parameter (Erhaltungszustand, Maße etc.) als Grundlage für die aus-führliche Beschreibung und Katalogisierung dieser Funde. Die beschriebene ar-chäologische Aufbereitung der Funde ist Voraussetzung für die in Zusammenhang mit den ausgewählten Fundgattungen aus dem Tycheion von Aigeira angestrebte Interpretation der Quellen im Rahmen einer handelsgeschichtlichen Studie. Diese Studie soll auf den für regionale und überregionale Studien besonders sensiblen Importwaren (Amphoren, Terra Sigillata, Lampen) basieren. Die Berücksichtigung mehrerer Materialgattungen bietet dabei die Möglichkeit, die aus unterschiedlichen keramischen Importwaren bestehende Materialbasis einer kombinierten Auswer-tung zu unterziehen, die nicht durch die Beschränkung auf eine Fundkategorie limitiert ist und einen repräsentativen Querschnitt für die Siedlung Aigeira bietet. Zu ermittelnde Fundspektren aus dem Bereich Tycheion können in diesem Zusam-menhang mit dem aktuellen Publikationsstand anderer Fundorte, besonders am Korinthischen Golf (Korinth, Patras, Sikyon etc.), verglichen werden. Diese Vorge-hensweise soll es ermöglichen, über das zu ermittelnde Typenspektrum an Kera-miklampen, Terra Sigillata und Transportamphoren aus dem Tycheion von Aigeira wirtschaftshistorische Rückschlüsse, primär zur genannten Region, zu ziehen. Erste Ergebnisse wurden im Rahmen des 15. Österreichischen Archäologentags in Innsbruck präsentiert.
Die in den Jahren 2013 und 2014 durchgeführten Dokumentationsarbeiten an ausgewählten Fundgruppen sollen 2015 mit einer voraussichtlich letzten Kampagne abgeschlossen werden. Damit besteht nun die Möglichkeit, Fundgruppen aus der »Altgrabung Tycheion« vorzulegen.
Projektleitung: W. Gauß; Mitarbeit: H. Birk, M. Eichner, A. Heiden (DAI Athen), C. Hinker (ÖAI Wien), M. Leibetseder, R. Smetana (Universität Salzburg), S. Kalabis (Ferdinandeum, Innsbruck), A. Tanner (ETH Zürich)
I.2.4 Geophysikalische Untersuchungen
Die 2012 begonnenen geophysikalischen Untersuchungen (Kooperationsprojekt mit der Christian-Albrechts-Universität Kiel, Institut für Geowissenschaften, Abteilung für Geophysik) wurden 2014 fortgesetzt. Ziel der aktuellen Untersuchung war es, ne-ben der Erschließung von neuen Flächen Nachmessungen an bereits festgestellten Anomalien vorzunehmen. Da in Aigeira die Bodenbedingungen für geomagnetische Untersuchungen ungünstig sind, wurden in diesem Jahr vor allem zeitaufwendigere Messungen mit Georadar (GPR) und Geoelektrik durchgeführt, die in den vergan-genen Jahren zu besseren Ergebnissen geführt hatten, sowie erstmalig auch seis-mische Untersuchungen.
Bei den Messungen 2013 im Bereich des Theaters hatte sich außerhalb des umzäunten archäologischen Geländes eine deutliche Anomalie als rechtwinklige Struktur von 6 × 10 m Größe abgezeichnet. Die Nachmessungen führten nun zu der Erkenntnis, dass es sich hier mit großer Wahrscheinlichkeit nicht um ein (antikes) Gebäude handelt, sondern um eine oberflächennahe Ansammlung von Steinen. Diese könnten die letzten Reste des Unterbaus einer Filmkulisse aus den Jahr
Jahresbericht 2014
96
1980 sein, als in Aigeira Dreharbeiten zu einer Serie über Alexander den Großen stattfanden (»The Search for Alexander the Great«, Regie P. Sykes).
Im Bereich der Akropolis und der tiefer liegenden Plateaus und Hänge wurden an vier verschiedenen Stellen Messungen vorgenommen. Größere Gebiete wurden besonders am Fuß des steilen Hangs oberhalb der modernen Straße geomagne-tisch kartiert. Hier sollte an leicht zugänglichen Stellen des sonst stark mit Macchia überwachsenen Hangs untersucht werden, ob sich Reste einer antiken Bebauung/Nutzung nachweisen lassen. Abgesehen von kleineren Anomalien in einem Oliven-hain waren die Messergebnisse in diesem Bereich bislang unauffällig.
Wichtige Erkenntnisse lieferten die Messungen im Bereich des Akropolisabhangs und des unmittelbar östlich liegenden Plateaus. Am südlichen Akropolishang wurden im Bereich der Grabungsfläche D (s. I.2.1) geoelektrische Messungen vorgenom-men, um in Verbindung mit den Grabungen den Verlauf der vermutlich spätklas-sisch/hellenistischen Mauer und eines höher liegenden Mauerzugs festzustellen. Die Messungen zeigen klar, dass sich die Mauer weiter nach Westen fortsetzt, im Grabungsbereich konnte sie allerdings bis zu einer Tiefe von etwa 1 m unter dem Grabungsniveau nicht nachgewiesen werden. Die relativ scharfe Abbruchkante der Mauer und die ca. 2 m große Lücke könnten auf eine massive Zerstörung der Mauer in diesem Bereich hinweisen oder aber auf einen Durchlass. Weitere Untersuchun-gen und die Fortführung der Grabungen sollen hier Klarheit bringen.
Im Bereich des östlichen Plateaus wurden weitere GPR-Messungen durchge-führt und die Verbindung zu den Grabungsflächen der 1970iger Jahre hergestellt. Die Radargramme im 6 – 12 und 16 – 26nsBereich zeigen dabei zahlreiche line-are Anomalien. Diese gehören mit großer Wahrscheinlichkeit zur Fortsetzung der spätklassisch/hellenistischen Befestigungsmauer. Andere Anomalien, wie etwa eine gekrümmte Struktur, könnten zur spätbronzezeitlichen oder früheisenzeitlichen Bebauung gehören und sollen weiter untersucht werden. Im östlichen Teil des Pla-teaus – hier reichen die Felsen bis knapp unter die heutige Oberfläche – konnten zahlreiche, z. T. übereinanderliegende lineare Anomalien festgestellt werden. Bei
Aigeira. Geomagnetische Messfläche oberhalb der modernen Straße (Vorlage mit freundlicher Genehmi-gung H. Stümpel, C. Klein, Christian-Albrechts-Univer-sität Kiel, Institut für Geo-wissenschaften, Abteilung für Geophysik)
ZWEIGSTELLE ATHEN
97
den tiefer liegenden Strukturen könnte es sich um die Reste der spätbronzezeitli-chen Besiedlung handeln.
Auf einem tiefer liegenden Plateau südlich der Akropolis wurde in der Magnetik und mit GPR eine Anzahl kleinflächiger, viereckiger bis ovaler Strukturen festgestellt, deren Interpretation noch aussteht. Die ebenfalls durchgeführten geoelektrischen und seismischen Messungen sollen hier Rückschlüsse über die Beschaffenheit der Anomalien liefern, die Auswertung der Daten ist noch nicht abgeschlossen.
Projektleitung: W. Gauß; Mitarbeit: H. Birk, A. Tanner (Universität Zürich); Kooperation: H. Stümpel, W. Rabbel, C. Klein, C. Milde, I. Wehner, M. Proksch, K. Rusch (Universität Kiel, Institut für Geowissenschaften, Abteilung für Geophysik); Teilfinanzierung: Institute of Aegean Prehistory (INSTAP)
Aigeira. Geoelektrik im Bereich des südlichen Ab-hangs der Akropolis (Plan H. Birk und W. Gauß; geophysische Messdaten mit freundlicher Genehmi-gung H. Stümpel, C. Klein, Christian-Albrechts-Univer-sität Kiel, Institut für Geo-wissenschaften, Abteilung für Geophysik)
Aigeira. Georadar im Be-reich des ›Sattels‹ (Vorlage mit freundlicher Genehmi-gung H. Stümpel, C. Klein, Christian-Albrechts-Univer-sität Kiel, Institut für Geo-wissenschaften, Abteilung für Geophysik)
Jahresbericht 2014
98
I.3StratigrafischesKooperationsprojektÄgina-Kolonna
In Ägina-Kolonna wurden am sog. Südhügel 2014 keine Grabungen durchgeführt. Die Arbeiten konzentrierten sich auf die Aufarbeitung der Stratigrafie der sog. prä-historischen Innenstadt westlich des spätarchaischen Tempels. Aus den Grabungs-bereichen Areal 1 – 9 und Areal 19, aus denen eine große Menge Früh Helladisch (FH) III-zeitlicher Keramik stammt, wurden die Auszähllisten ausgewählter Kontex-te überprüft und insbesondere durch Angaben zu den makroskopischen Gruppen vervollständigt. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird eine detaillierte Analyse aller FH III- bis mittelbronzezeitlicher Funde aus der Innenstadt möglich sein. Dadurch
sollte es gelingen, selbst geringe Veränderungen in der Zusammensetzung der Kontexte entsprechend darzustellen, etwa den höheren Anteil einer makro-skopischen Gruppe bei bestimmten Gefäßformen. Diese Erkenntnisse können für die abschließende stratigrafische Beurteilung und zeitliche Einordnung der Kontexte von großer Bedeutung sein. Mithilfe multivariabler Analysen sollen auch das erstmalige Auftreten importierter Keramik und die Übernahme neuer formspezifischer oder herstellungstechnischer Merkmale in die lokale Keramikproduktion besser he-rausgearbeitet werden.
Im Rahmen des Ägina-Projekts wurden in eingeschränktem Umfang zudem zwei Teilprojekte fortgesetzt:
Das Teilprojekt »Late Bronze Age and Early Iron Age Aeginetan ›Cooking Ware‹ Pottery« wird gemeinsam mit E. Kiriatzi (FITCH Laboratory, British School at Athens), M. Lindblom (Universität Uppsala), B. Lis (Polnische Akademie der Wissenschaften) und J. Morisson (Universität Leicester) durchgeführt und vom Institute of Aegaean Prehistory (INSTAP) gefördert. Projektziel ist die detaillierte Charakterisierung der Scherbenqualität und der Herstellungstechnologie der äginetischen Kochtopfware der späten Bronzezeit und der frühen Eisenzeit. Die Arbeiten des Jahres 2014 kon-zentrierten sich auf die petrografische Beschreibung der in den vergangenen Jahren genommenen Proben. Darüber hinaus wurden in Zusammenarbeit mit P. Polychro-nakou-Sgouritsa (Universität Athen) rund 100 Proben von den Ausgrabungen in Lazarides/Ägina für petrografische Untersuchungen ausgewählt. Die Funde stellen eine wichtige Bereicherung des lokal-äginetischen Keramikrepertoires der späten Bronzezeit dar.
Das Teilprojekt »Premycenaean Vesselshapes in the Central Aegean« wird ge-meinsam mit M. Lindblom (Universität Uppsala) durchgeführt. Ziel des Projekts ist es, eine einheitliche Formentypologie für den zentralen Bereich der Ägäis (mit Aus-nahme Kretas) von der Früh Bronzezeit III bis zur Spät Bronzezeit I zu erstellen. Ne-ben der Aufnahme weiterer Gefäßformen vor allem von der südlichen Peloponnes konzentrierten sich die Arbeiten auf die Erstellung eines GIS-basierten Verzeichnis-ses der prähistorischen Fundplätze.
Projektleitung: W. Gauß
Ägina-Kolonna. FH III-zeit-liche Schüssel mit Schul-terhenkel (›Bass Bowl‹) aus Grabungsareal 2 (Foto W. Gauß, digitale Nachbe-arbeitung R. Smetana)
ZWEIGSTELLE KaIro
99
ZWeiGstelle KairO
Leitung: Mag. Dr. Irene Forstner-MüllerWissenschaftliche Bedienstete: Dr. Pamela RoseVerwaltung: Leila Masoud, BAMit Projektabwicklung betraut: Univ.-Prof. Dr. Manfred Bietak
Nachdem die durch das BMWFW erteilte Weisung zur Sperre der Feldprojekte des ÖAI in Ägypten mit 14. März 2014 aufgehoben worden war, konnten die Arbeiten des Instituts in Tell el-Dab‘a und Assuan zeitverzögert wieder aufgenommen werden.
I. FeldForschungsprojekTe
i.1 tell el-Dab‘a
In Tell el-Dab‘a fanden 2014 zwei Kampagnen statt: Im Frühjahr gab (9. März bis 15. Mai 2014) es eine Grabungs- und Aufarbeitungskampagne, im Herbst (7. Septem-ber bis 2. November 2014) wurde eine Aufarbeitungskampagne durchgeführt. Der Schwerpunkt der Forschungen lag auch heuer auf der Untersuchung der antiken Landschaft.
I.1.1 Grabung
Der aktuelle archäologische Forschungsschwerpunkt liegt auf der Lokalisierung und Untersuchung der Häfen und Anlegestellen innerhalb der Stadt. Seit der späten 12. Dynastie war Avaris eine wichtige Hafenstadt, in der Ramessidenzeit bildete es den südlichen Teil von Piramesse, in dem sich der Hafen der Stadt befand.
2013 wurden nordwestlich des Grabungshauses in einem Gebiet, das sich noch heute in der Landschaft als Depression abzeichnet und in welchem der Haupthafen von Avaris vermutet wird, archäologische Untersuchungen begonnen. Das Areal ist mit dem Hauptarm des Nils durch zwei Kanäle, einem im Norden und einem im Süden, verbunden. In der geophysikalischen Prospektion ist diese Niederung als natürliches oder künstliches Becken zu erkennen. Die Untersuchungen am Rand des Hafenbeckens wurden im Frühjahr 2014 fortgesetzt und der 2013 angelegte 10 × 4 m große Suchschnitt am nördlichen Beckenrand wurde in seinem südlichen Bereich weiter untersucht. Insgesamt konnte eine dichte Siedlungsabfolge vom Späteren Mittleren Reich bis in die Ramessidenzeit mit einem Hiatus während der früheren 18. Dynastie festgestellt werden.
Die bisher früheste Belegung des Platzes datiert in das späte Mittlere Reich (13. Dynastie). Damals wurde in R/IV ein Kanal errichtet. Aus seiner Verfüllung wur-de eine Reihe Siegelabdrucke, und zwar sowohl ägyptische Stempelsiegelabdrucke mit Beamtennamen als auch vorderasiatische Rollsiegel, geborgen, was Anlass zu der Vermutung gibt, dass in der Nähe ein Umschlagplatz für Waren bestand, die mit Schiffen angeliefert wurden.
In der folgenden Phase wurde das Areal mit Häusern und Gräbern locker bebaut und war offenbar Teil der Wohnstadt. Darüber, in der letzten Phase der 13. Dynastie, lag eine Schicht von dicht aneinander gebauten Speichern, deren Inneres teilweise mit Ziegelpflaster ausgestattet war. Dieser Speicherbereich war im Süden durch eine massive ältere Mauer aus sandigen Lehmziegeln begrenzt, die eine Stärke von über 3 m erreichte und entlang des nördlichen Beckenrandes verlief. Die Mauer war im Magnetometerbild als negativ magnetische Anomalie zu erkennen. Detailliertere Untersuchungen sollen 2015 folgen.
Jahresbericht 2014
100
Die bereits 2013 festgestellte jüngere massive Mauer – mindestens 500 m lang und ca. 2 m breit – wurde während der 15. Dynastie errichtet und bestand bis zum Ende der Zweiten Zwischenzeit als Landmarke.
Weiters wurde der Bereich westlich der beiden großen Grabanlagen, die von dieser Mauer durch eine Straße getrennt sind, untersucht. Nach dem Ende der 15. Dynastie wurde dieses Areal aufgelassen und erst in der 19. Dynastie wieder besiedelt, als Avaris die südliche Vorstadt von Piramesse geworden war und dieser Bereich als Hafen genutzt wurde.
Die archäologischen Ergebnisse bestätigen weitgehend die historische Über-lieferung, dass Avaris vom Mittleren Reich bis zum Beginn der 18. Dynastie ein wichtiges Handelszentrum und in der 19. Dynastie der Hafen der Hauptstadt Ägyp-tens war.
Eine weitere Fragestellung ist, ob der Marinestützpunkt der früheren 18. Dynas-tie, Peru Nefer, in Memphis oder in Avaris lag. Die Arbeiten im Areal R/IV erbrachten einstweilen keinen Nachweis für eine Nutzung des Areals während der 18. Dynastie.
Ein Schwerpunkt der Herbstkampagne 2014 lag auf der Untersuchung der fune-rären Anlagen des Areals R/IV, durchgeführt von U. Matic. Die Tierknochen dieses Bereichs wurden von G.-K. Kunst und K. Saliari bearbeitet. Auffallend ist, dass – im Gegensatz zu anderen Arealen von Tell el-Dab’a – hier gehäuft eine große Anzahl an Fischen vorgefunden wurde. Die Fundkategorie der Kleinfunde und Makrolithik wurde von S. Prell inventarisiert. Die Silices dieses Areals wurden von C. Jeuthe im Rahmen eines DAAD-Stipendiums untersucht.
Projektleitung: I. Forstner-Müller; Mitarbeit: S. Baumert, C. Cateloy, N. Gail (Foto-grafie), A. Hassler, C. Jeuthe, G.K. Kunst, C. Langer, U. Matic, V. Michel, S. Müller,
Tell el-Dab’a. Übersichts-plan mit geophysikalischer Prospektion und Satelliten-bild, R/III und R/IV in rot markiert (Plan A. Hassler und M. Weißl)
ZWEIGSTELLE KaIro
101
S. Prell, C. Reali, K. Saliari, D. Schmid. Kooperationen: T. Herbich (Universität War-schau und der Polnischen Akademie der Wissenschaften); J.-Ph. Goiran (Universi-tät Lyon, UMR 5133 Archéorient); L. Schmitt (CNRS und der Universität Straßburg UMR 7362); VIAS; IFAO; Universität Wien; Universität Heidelberg
I.1.2 Geoarchäologischer Survey
Die Studie zur Erforschung der Flussarme und der Häfen von Avaris wurde 2014 fortgesetzt.
Dieser umfangreiche geoarchäologische Survey beruht auf Bohrungen im Stadt-gebiet von Avaris und an verschiedenen Punkten des komplexen, vielfach verzweig-ten Kanalsystems des Pelusischen Nilarms. Im Rahmen dieses Projekts wurde ein dreijähriges Dissertationsstipendium für C. V. Villette an der Universität Straßburg initiiert (Finanzierung FWF-Projekt Nr. 25804-G19, Universität Straßburg, École pra-tique).
Projektleitung: I. Forstner-Müller; Mitarbeit: A. Hassler, C. V. Vittori. Kooperatio-nen: T. Herbich (Universität Warschau und Polnische Akademie der Wissenschaf-ten); J.-Ph. Goiran (Universität Lyon, UMR 5133 Archéorient); L. Schmitt (CNRS und Universität Straßburg UMR 7362).
I.1.3 Aufarbeitung
Die Aufarbeitung des Jahres 2014 konzentrierte sich auf das Material des Areals R/III. Bei diesem Bereich, der in den Jahren 2011 und 2012 durch archäologische Grabungen untersucht worden war, handelt es sich um einen neuralgischen Punkt innerhalb der Stadt, der für das Verständnis der Entwicklung der Hauptstadt Avaris während der späteren Zweiten Zwischenzeit von großer Bedeutung ist. Zwei durch Straßen getrennte Stadtviertel ließen sich unterscheiden. Während der westliche Block als Verwaltungsbezirk angesprochen werden kann, handelt es sich bei der Be-bauung im Osten um einen domestischen Stadtteil mit dichter Wohnbebauung. Die Besiedlung dieses Stadtteils begann im Westen mit Beginn der 15. Dynastie. Erst im Laufe der Zweiten Zwischenzeit dehnt sich die Stadt allmählich nach Osten aus.
In diesem Areal fanden sich über 1.000 Siegelabdrucke aus ungebranntem Ton, darunter eine Reihe von Abdrucken, die den Namen von König Chajan tragen, mög-licherweise einer der Namen des Königs Apophis. Die Siegelabdrucke des west-lichen Viertels, des Verwaltungsbezirks, werden von C. Reali im Rahmen einer Dissertation an der Universität Wien bearbeitet. Der Schwerpunkt des Jahres 2014 lag auf der Untersuchung der Rückseiten dieser Versiegelungen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Aufarbeitung des Areals R/III lag auf der Unter-suchung der Keramik im Hinblick auf ihre Kontexte. Diese wird durch V. Michel im Rahmen einer Dissertation (Universität Heidelberg) durchgeführt.
Tell el-Dab’a. Übersichts-foto des Schnittes am Hafenbecken, Areal R/IV (Fotos U. Matic, A. Hass-ler, Zusammenstellung A. Hassler)
Jahresbericht 2014
102
Die Aufnahme der Tierknochen dieses Areals wurde von G.-K. Kunst und K. Sa-liari abgeschlossen. Es konnten hier vor allem Rinder, gefolgt von Schafen/Ziegen und Schweinen, aber auch Vögel und Fische festgestellt werden.
S. Prell dokumentierte und zeichnete die Fundkategorie der Kleinfunde und Ma-krolithik.
Projektleitung: I. Forstner-Müller; Mitarbeit: S. Baumert, C. Cateloy, N. Gail (Foto-grafie), A. Hassler, C. Jeuthe, G.K. Kunst, C. Langer, V. Michel, S. Müller, S. Prell, C. Reali, K. Saliari, D. Schmid. Kooperationen: VIAS; IFAO; Universität Wien; Uni-versität Heidelberg
i.2 Hisn el-Bab
I.2.1 Grabungen
Die Kampagne in Hisn al-Bab, Assuan, fand vom 15. September bis 5. Dezem-ber 2014 statt. Die Ausgrabungen konzentrierten sich auf das Areal der römischen Festung, die 2012 entdeckt worden war.
Eines der Ziele dieser Kampagne war es, die Architektur und den Grundriss der römischen Festung, die nur durch ihre östliche Mauer und Teile der nördlichen und
südöstlichen Mauern bekannt ist, zu untersuchen. Es wurde festgestellt, dass die südöstliche Mauer weiter nach Südwesten reichte, als bisher angenommen (Areal 16). Da dieser Teil etwas anders ausgerichtet ist, handelt es sich wahrscheinlich um eine spätere Ergänzung, die, wie die darunterliegende Keramik zeigt, im oder nach dem 6. Jahrhun-dert n. Chr. gebaut worden war. Der Anbau könnte bis direkt an eine Bastion der römischen Festung gestoßen sein, jedoch ist dieses Areal durch Raub-gruben zerstört. Am westlichen Ende der Nordseite wurde eine Flügelwand freigelegt, die aber nicht weiter untersucht werden konnte, da sie unter einem frü-hen mittelalterlichen Turm ver-läuft.
Tell el-Dab’a, Tonversiege-lung aus R/III. Rückseite (l.): Abdruck eines gefloch-tenen Deckels aus Gras oder Schilf; Vorderseite (r.): geschlungene und verknotete Schnur, die den Deckel des Behälters festhält (Foto C. Reali)
Hisn el-Bab. Plan der 2014 ausgegrabenen Bereiche innerhalb der römischen Festung (Grafik P. Collet)
ZWEIGSTELLE KaIro
103
Ein weiteres Ziel war es, die Nutzung des von den Festungsmauern umschlosse-nen Areals zu untersuchen. Hier wurden die Untersuchungen in dem Küchen- oder Vor-ratsareal beendet (Areal 1), das zum Groß-teil während der Kampagne 2012 bereits freigelegt worden war. Es wurden weitere Schichten zerbrochener Keramik und von Pflanzenresten gefunden wie auch in einer Ecke des Raums ein gut erhaltener und mit Asche gefüllter Ofen aus Stein und Lehm.
Neue Schnitte wurden angelegt, um die Überreste der Strukturen entlang der süd-östlichen Mauer der römischen Festung freizulegen, jedoch waren diese Strukturen stark abgetragen. Es war klar, dass hier die natürliche Topografie des Geländes verändert worden war: der Felsuntergrund war absichtlich so geformt worden, dass Stufen entstanden, durch die sie zugänglich gemacht wurden. Unter anderem gab es Spuren einer Struktur, die im Westen den Teil eines Raums mit mehreren Schichten an Lehmböden bildete und in ihrem Osten ein offenes Areal mit zahlreichen Reihen von Pfostenlöchern. Weitere Reihen von Pfostenlöchern und -strukturen wurden auch in vielen anderen Arealen der Aus-grabungsstätte festgestellt, wie auch Spuren von Unterholzabdeckungen, die als Wände für derartige Konstruktionen dienten.
Über die Grabung war Tierkot verteilt; in einem Bereich wurde dieser in Zusammen-hang mit Bodeneinlassungen gefunden. Die-se Einlassungen bestanden aus Seilen, die am Boden in kleinen Gruben mit Steinen be-schwert waren, sodass sie nicht losgerissen werden konnten. Diese Einlassungen dien-ten zum Anbinden großer Tiere, eine genau-ere Bestimmung war bisher nicht möglich. Jedenfalls war Tierhaltung ein wichtiger Be-standteil der Nutzung des Platzes.
Es konnte eine große Anzahl an Vorrats-einrichtungen festgestellt werden. Diese befanden sich hauptsächlich in den offenen Bereichen der Strukturen, manche nutzten die kleinen Vertiefungen zwischen den Felsblöcken, andere waren als Gruben angelegt. Eine tiefe und schmale Spalte enthielt mindestens acht Amphoren oberägyptischen Ursprungs aus dem späten 6. bis frühen 7. Jahrhundert. Der Spalt wurde aufgrund seiner geringen Breite höchst-wahrscheinlich gezielt für die Aufbewahrung solcher Gefäße genutzt. Künstlich an-gelegte Gruben aus Steinen und mit Lehm verkleidet wurden über die gesamte Ausgrabungsstätte verteilt gefunden: einige davon enthielten Spuren von Sorghum, Hir-se, Linsen und anderen Lebensmitteln. Die-se Gruben häuften sich besonders um eine zentrale Felsnase, einige waren durch eine Innenwand in zwei Teile getrennt. Ähnlich tiefe und unterteilte Gruben wurden bei der östlichen Mauer der mittelalterlichen Festung gefunden, und gleichfalls in einer rezenten Raubgrube innerhalb des Torturms dieser Festung, aus einer Schicht unter dem Turmfundament. Diese Gruben hatten die gleiche Ausrichtung wie die Ersteren und enthielten die Überreste eingeschlemmter Schichten.
Hisn el-Bab. Gruppe von Vorratsgruben mit Unter-teilung in Areal 13 (Foto M. Lehmann)
Hisn el-Bab. Pfeile 2 und 3 in situ in Areal 9. Die eiser-ne Pfeilspitze des oberen Pfeils ist erhalten geblie-ben (Foto P. Rose)
Hisn el-Bab. Offener Be-reich mit einer Reihe von Pfostenlöchern in Areal 10 (Foto M. Lehmann)
Jahresbericht 2014
104
Die bisher untersuchte Keramik erlaubt eine Datierung in das späte 6. bis frühe 7. Jahrhundert n. Chr.; bisher wurde keine signifikant frühere oder spätere Keramik gefunden.
Eine der interessantesten Entdeckungen wurde unmittelbar außerhalb der östlichen Mauer der frühen Festung gemacht. Die dort vorgefundenen Schichten enthielten große Mengen an zerbrochenen menschlichen Knochen, die nicht mehr im Knochenverbund waren, sowie Fragmente von hölzernen Pfeilschäften. Eiser-ne Pfeilspitzen wurden im unteren Bereich der Schichten geborgen, die unterste Schicht enthielt sowohl vollkommen erhaltene intakte Pfeile (Spitze, Schaft und Federn) wie auch Abdrucke im Boden von bereits in der Antike entfernten Pfeilen. Weiters fanden sich Fragmente vermutlicher Bogensehnen, das Fragment eines Kompositbogens sowie der Fingerschutz eines Bogenschützens aus Stein. Eine Erst analyse des Skelettmaterials lässt auf mindestens elf Erwachsene schließen – einschließlich eines Individuums mit einer schweren Kopfverletzung. In diesem Areal sind die Folgen eines Konflikts, in dem Bogenschießen eine wichtige Rolle gespielt hatte, zu sehen. Es bleibt jedoch noch zu untersuchen, wer die Kontrahen-ten waren. Die wenige aus diesem Kontext stammende Keramik datiert ebenfalls in das späte 6./frühe 7. Jahrhundert.
Die wissenschaftliche Untersuchung der Keramik und der archäobotanischen Überreste wurde fortgesetzt, eine Studie über das fragmentierte Glas begonnen. Erste Resultate weisen darauf hin, dass die Glasgefäße des Küchen-/Vorratsareals von besonderem Interesse zu sein dürften, da sie ungewöhnlich und außergewöhn-lich dünn sind. Darüber hinaus erfolgte eine Erstuntersuchung der Münzen durch H.-C. Noeske.
Das gesamte Gebiet wurde von einem Team der Technischen Universität Wien gescannt, eine architektonische Analyse begonnen.
Die Forschungen in Hisn elBab werden vom FWF finanziert (Projektnr. P 24589G21).
Projektleitung: P. Rose; Mitarbeit: A. Clapham, P. Collet, M. Harrison, J. Hughes; M. Doering, G. StyhlerAydın, T. Mitterecker (3DScanning, Technische Universi-tät Wien); M. Lehmann, G. Owen (Fotografie), G. Pyke, D. Rosenow, N. Warner. Kooperationen: B. Palme (Universität Wien, Institut für Alte Geschichte und Alter-tumskunde, Papyrologie und Epigraphik); M. Döring (Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege, Technische Universität Wien); Schweizerisches Institut für Ägyptische Bauforschung und Altertumskunde in Kairo
I.2.2 Restaurationsprojekt
Die Konservierung und Festigung von Kernbereichen der frühen mittelalterlichen Befestigungsanlage Hisn el-Bab wurde an den Stellen vorgenommen, an denen erhebliche Stürze im Steinmauerwerk die Stabilität der gesamten Struktur gefähr-deten, und wo gelegentliche Besucher der Festung das gefallene Mauerwerk als Zugang ins Innere der Festung verwendeten und dadurch weiteren Schaden ver-ursachten. Im inneren Südtor wurde die östliche Wand des Raums wiedererrichtet, um den weiteren Einsturz des Mauerwerks der Wand weiter oben zu verhindern; dies wird die weitere Arbeit im Torbereich in einer zukünftigen Grabungskampagne erleichtern. Zusätzlich wurden kleine Eingriffe vorgenommen, um die Bereiche der Ringmauer aufzufüllen, wo Stücke des Mauerwerks fehlten, um so den weiteren Einsturz zu verhindern. Die Arbeiten wurden mit den Materialien, die vor Ort im Ausgrabungsgelände vorhanden waren, ausgeführt, unter Leitung von N. Warner durchgeführt und durch eine Zuwendung des »Antiquities Endowment Fund of the American Research Center in Egypt« finanziert.
ZWEIGSTELLE KaIro
105
i.3 Kulturanthropologische Fallstudie in verlassenen nubischen Dörfern in Oberägypten–KulturelleFormierungsprozesseundderenTransformationzu archäologischen Befundkontexten
Das Projekt beschäftigt sich mit der materiellen Kultur zweier verlassener nubischer Dörfer in Oberägypten, deren Errichtung und Aufgabe eng mit dem Bau des briti-schen Dammes südlich von Aswan und den nachfolgenden Überflutungen um 1900 verbunden sind.
Die geplante Feldkampagne im Frühjahr 2014, welche aufgrund der vorüber-gehenden Schließung der Zweigstelle Kairo bereits als Ersatztermin für die ab-gesagte Herbstkampagne 2013 disponiert war, musste wegen bestehender Sicher-heitsbedenken wiederum auf Herbst 2014 verschoben werden und konnte schluss-endlich von 14. November bis 5. Dezember 2014 abge-halten werden. Der Projekt-abschluss in Form einer Ma-nuskripterstellung im Jahr 2015 ist durch die finanzi-elle Unterstützung des ÖAI sowie des Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nati-onalbank (Projektnr. 15559) gesichert.
Der Schwerpunkt der Bauforschung lag bereits im Jahr 2012 in der Erstel-lung eines detaillierten Sied-lungsplans als Grundlage für alle weiteren räumlichen und funktionellen Analysen. Im Zuge dieser Arbeiten wur-den die bestehenden Räume einzelnen Wohneinheiten zugeordnet, wonach die zusammengehörigen Strukturen mit GPS dokumentiert wurden. Neben der Sied-lungsanalyse als Ausgangspunkt im Jahr 2012, die sich mit Erschließungsmus-tern, Verkehrsflächen und diversen Verteilungsschemata auseinandersetzt, wurde schließlich im November 2014 eine detaillierte Bauaufnahme ausgewählter reprä-sentativer Hauseinheiten vorgenommen. Um einerseits eine zerstörungsfreie Auf-nahme zu gewährleisten sowie andererseits die Dauer der Feldarbeiten möglichst kurz zu halten, wurden mit einem FARO Laser Scan 3-D-Daten generiert, die im Zuge der Nachbearbeitung zu 2-D-Grundriss- und Schnittzeichnungen aufbereitet wurden. Die produzierten Plangrundlagen der Bauaufnahme wurden schließlich vor Ort korrigiert, ergänzt und überarbeitet.
Die archäologischen Untersuchungen, die im November 2014 von S. Ekrem vor-genommen wurden, konzentrierten sich auf Kartierungen des Fundmaterials, das an der Oberfläche sichtbar war. Innerhalb der vorselektierten Wohneinheiten für eine detaillierte architektonische Bauaufnahme wurde das oberflächlich sichtbare Fund-material auf Basis maßstabsgerechter Laserscanplots des jeweiligen Raums in der Bodenaufsicht kartiert, dokumentiert und bewertet. Die kontrollierte Oberflächenkar-tierung von Fundmaterial soll hinsichtlich der Verteilung unterschiedlichen Materials erfasst werden und die Basis weiterer Interpretationen bilden. Die Datensammlung soll bezüglich der Frage analysiert werden, was in einer systematisch verlassenen Siedlung zurückbleibt und inwieweit die Befund- und Fundinventare überhaupt auf die Lebensumstände der Bewohner schließen lassen. Darüber hinaus soll der Frage nachgegangen werden, in welchem Maß die Verteilung und die Art des Fundma-
Rekonstruktion eines historischen Fotostand-punkts mit Überlagerung der Originalaufnahme von Marques & Fiorillo (zwi-schen 1902 und 1912), Blick vom teilweise überfluteten Dorf AlĞūwānī Richtung Philae (Fotomontage C. Kurtze)
Jahresbericht 2014
106
terials an der Oberfläche als Basis für eine räumliche Funktionsanalyse zulässig ist. Eine erste Analyse der Fundinventare zeigt deutlich, dass eine Funktionszuweisung des Fundorts meist nur anhand der zusätzli-chen Information der erhaltenen Architektur korrekt vorgenommen werden kann. Eine ausschließlich Interpretation aufgrund des vorgefundenen Fundmaterials ist ausge-sprochen fehleranfällig und beruht auf ei-nem zufällig angetroffenen Fundensemble,
das verschleppte Artefakte genauso beinhaltet wie tatsächlich primär deponierte. Die Unterscheidung und Bewertung derselben wurde im vorliegenden Fallbeispiel durch die weitgehend erhalten Architektur wesentlich erleichtert.
Weiters wird ausgewähltes Fundmaterial detailliert bearbeitet, um wichtige Fra-gen zu lokalen und importierten Produkten und Handelsbeziehungen zu beantwor-ten (Glas, Metall, Porzellan etc.). In den Dörfern finden sich häufig Hinweise auf Herkunftsort und Herstellungszeitraum in Form gut datierbarer Handelsmarken und Firmenstempel der Produzenten, die einen Nutzungszeitraum von 1870 – 1949 vor-geben. Neben zahlreichen Soda, Softdrink und Medizinflaschen sowie anderen Glaskonserven fanden sich überraschenderweise zahlreiche Flaschen, deren In-halt durch die erhaltene Bodenprägung als alkoholisches Getränk teurer Marken-firmen identifiziert werden kann (Gordon’s Dry Gin, John Dewar’s Scotch Whiskey, Walkers Kilmarnook Whiskey, Martini Vermouth, Asmara Zibib). Die ursprünglich verhandelten Produkte, deren Verpackungsfragmente innerhalb der untersuchten Dörfer gefunden wurden, sind nicht gezwungenermaßen mit den Bewohnern der verlassenen Siedlung in Zusammenhang zu bringen. Zum einen liegt direkt östlich der untersuchten Dörfer seit 1897 der südlichste Endpunkt der staatlich ägyptischen Bahnstrecke (Kairo–Luxor–Assuan–Shellal), an dem auf Dampfschiffe gewechselt werden musste, um die Fahrt nach Wadi Halfa in den Sudan fortzusetzen. Somit fanden die genannten Markenprodukte mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-lichkeit ihren Weg in diese Gegend mit der Bahn. Zum anderen muss auf den Umstand umfassenden Recyclings von Abfallprodukten hingewiesen werden. Es ist
daher davon auszugehen, dass die Verpackungen verschiedenster robuster Materialien, wie vor allem Glas und Metall, systematisch gesammelt und wie-derverwertet wurden, eine übliche Vorgangsweise, die von Nachkommen der umgesiedelten Familien in den sozialanthropologischen Interviews mehr-fach betont wurde.
Zuletzt bildete der Besuch Yusuf Masris, ei-nes 91-jährigen ehemaligen Schiffers, der im Jahr 1923 auf der gegenüberliegenden Insel Heysa geboren worden war, einen Höhepunkt der sozialanthropologischen Feldforschungen im November 2014. Er kam in Begleitung von N. El-Shohoumi in beide verlassene Dörfer und konnte zahlreiche Fragen zur Architektur, Funktionsnut-zung und zum Fundmaterial beantworten.
Projektleitung: I. Forstner-Müller, wissenschaftliche Bearbeitung: L. Zabrana; Mit-arbeit: N. El-Shohoumi, S. Ekrem, F. Fichtinger, C. Kurtze. Kooperationen: Schwei-zerisches Institut für Ägyptische Bauforschung und Altertumskunde in Kairo
Glasflaschenfragment Gordon’s Dry Gin, London mit Bodenprägung eines Eberkopfes (1914 – 1920) (Foto L. Zabrana)
Yusuf Masri, Jahrgang 1923, beim Besuch des Dorfes AlĞūwānī bei Hisn al-Bab (Foto C. Kurtze)
ZWEIGSTELLE KaIro
107
1.4Assuan/Syene–StudienzumantikenWohnbau
Im Jahr 2014 konzentrierten sich die Arbeiten im Rahmen des FWF-Projekts (P 23866) »Antike Wohnkultur in Syene/Elephantine, Oberägypten« u. a. auf die Aufar-beitung der grabungstechnisch und stratigrafisch erfassten Schichten, die zu einem Abschluss gebracht werden konnte.
In Areal 1 fokussierten sich die Arbeiten auf Haus 5, um dessen Raumkonzeption und die Bauabfolge der Wohnräume zu klären. Die Errichtung des Hauses ist an-hand der Keramik in die spätptolemäische/frühe Kaiserzeit zu datieren. Der Grund-riss des Hauses setzte sich aus mehreren rechteckigen Räumen im Westen und Norden sowie einem Stiegenhaus und einem großen offenen Hof im Osten zusam-men. Die Aufgabe des Wohnhauses, durch einen Einsturz der Zwischendecke for-ciert, begann mit der vollständigen Auflassung des Erdgeschosses und der Aufgabe der bestehenden Raumkonzeption des Obergeschosses. Die Nutzung des Hauses in diesem Bauzustand ist bis in das späte 4. Jahrhundert n. Chr. nachweisbar. Schließlich dürfte auch das Obergeschoss zugunsten der Errichtung eines neuen Gebäudes aufgegeben worden sein, da Straten, die als Nutzungshorizonte oder Gehniveaus interpretiert werden könnten, hier gänzlich fehlen. Die Befunde zeugen
Syene. Ensemble von lokalem Tafelgeschirr aus römischer und spät antiker Zeit (Foto N. Gail)
Syene, Areal 2. Baupha-senplan der Wohnbebau-ung (T. Koch)
Jahresbericht 2014
108
von massiven Auffüllungen bis zur Oberkante der erhaltenen Mauerkronen. Diese älteren Strukturen wurden sowohl teilweise abgetragen als auch als aufgehendes Mauerwerk für die Konstruktion neuer Wohngebäude weiter verwendet.
In Areal 2 wurden in der frühen Kaiserzeit die bereits bestehenden Grundstücks-grenzen und Gebäudegrundrisse durch die Konstruktion neuer Wohngebäude mas-siv verändert. Aufgrund der Zusammensetzungen der Befunde und deren stratigrafi-schen Abfolge in den Räumen und Höfen war es möglich, Niveau- und Gehhorizonte übereinzustimmen, welche sich über mehrere Raumeinheiten erstreckten, bevor
diese durch eine Umgestaltung der Häuser aufgegeben worden waren. Die jeweilige Gebäudestruktur veränderte sich vorwiegend im Bereich der Höfe der einzelnen Häuser.
Die im Westen vorgelagerte Hofanlage war in zwei Häusern (Haus 15 und 17) zu erfassen. Über diese Hofanlagen konnten die Wohntrakte der Häuser von der Gasse aus betreten werden und fungierten als Wirtschafts-trakte. Im 2. Jahrhundert n. Chr. wurden diese Hofanlagen verkleinert und durch bauliche Strukturen in mindestens zwei Raumeinheiten aufgeteilt, die weiterhin von der Gasse aus zu betreten waren. Diese Umgestaltung ging vermutlich mit einer Änderung der Nutzfläche oder einer Änderung in der Nutzung der Höfe einher.
Der Anstieg des Bodenniveaus in den Höfen erfolgte stetig und im ge-samten Hofbereich beinahe einheitlich. Diese Materialakkumulation bedingte die Zusetzung sowohl von Zugängen der Häuser zur Gasse hin als auch zwischen den einzelnen Hofabteilen. Ab diesem Zeitpunkt gab es deutli-che stratigrafische Unterschiede zwischen den nun mittels durchgehenden Mauern voneinander getrennten Hofbereichen. Um die unterschiedlichen Höhen der Gehniveaus auszugleichen und die einzelnen Höfe miteinander zu verbinden, mussten innerhalb eines Hofabschnitts Treppen errichtet wer-den. Die intensive Bautätigkeit im Bereich der Hofanlagen beinhaltete auch eine Verstärkung und Erhöhung der Außenmauern der Wohnhäuser. Das Gehniveau stieg in allen Bereichen mehr oder minder immer gleichzeitig an, sodass weder in den Gassen noch in den offenen Hofanlagen eine Anpas-sung notwendig war.
Die Nutzung der spätesten Bauphase der Häuser des untersuchten Be-reichs ist in der späten Kaiserzeit zu fassen. Einige Befunde lassen sich allerdings auch schon in die Spät antike datieren.
Bei der Bearbeitung des keramischen Fundmaterials aus spätptolemäi-scher/römischer Zeit von Syene und der spät antiken Keramik aus den Gra-bungen von Elephantine stand neben der Auswertung der einzelnen Gattun-gen und Typen auch die Auswertung der 2013 bestimmten Fabrikatsgruppen im Vordergrund. Insbesondere lag der Fokus hier auf dem für die Region typischen Pink Clay und seine Verwendung in römischer bis spät antiker Zeit.
Zwar wurde Pink Clay schon ab spätptolemäisch/frührömischer Zeit für die Herstellung von Gefäßen verwendet, beschränkte sich allerdings in rö-mischer Zeit noch auf einige wenige Warengruppen. Darüber hinaus wurde der Pink Clay in dieser Zeit meist noch intentionell mit Nilschlamm gemischt. Erst in spät antiker Zeit dominieren Gefäße, die aus reinem Pink Clay her-gestellt wurden. Insgesamt sind vier verschiedene Tonpasten festzustellen, die aufgrund ihrer Zusammensetzung differenziert werden können, wobei die Unterschiede durch den Abbau des Tons aus anderen Tonressourcen bedingt oder auf eine unterschiedliche Tonaufbereitung im Zuge der Kera-mikproduktion zurückzuführen sind.
Hauptsächlich wurde der Pink Clay für die Herstellung von Tafelgeschirr verwendet, das sowohl in römischen als auch in spät antiken Fundkontexten jeweils mit einem sehr hohen Anteil zu finden ist und dessen Formenreper-toire sich an den gängigen Feinwaren aus dem Mittelmeerraum orientiert.
Syene. Pink Clay (a–d) und Mixfabrikate (e–f) im Dünnschliff (Foto L. Pelo-schek)
ZWEIGSTELLE KaIro
109
Wegen seiner großen Feuerfestigkeit und guten Wärme-leitung wurde der Pink Clay ebenfalls für die Produktion von Kochgeschirr verwendet. Vor allem Kasserollen und Kochteller wurden aus dem typischen Pink Clay herge-stellt, was ab frührömischer Zeit bis in die Spät antike zu beobachten ist.
Um den lokalen Kaolinton oder die lokalen Tonvor-kommen detaillierter zu charakterisieren, wurde im Fe-bruar 2013 ein geologischer Survey durchgeführt, der 2014 zu Ende gebracht werden konnte. In der Region von Assuan finden sich zahlreiche Vorkommen an Ka-olinton, die aufgrund unterschiedlichster Verunreinigun-gen variierende Farbtöne aufweisen. Die geologischen Proben sollen nun dabei helfen, diese unterschiedlichen Vorkommen genauer zu differenzieren, um Rückschlüs-se auf die Herkunft der verschiedenen Tonpasten ziehen zu können. Dafür wurden während des kurzen Surveys insgesamt 43 Ton-, Sand- und Gesteinsproben von ver-schiedenen Plätzen in der Region um Assuan genom-men. Diese Probenplätze liegen geografisch zwischen der Assuan-Brücke im Norden und dem Staudamm im Süden und wurden bereits in der ersten Begehung 2013 lokalisiert.
Projektleitung: S. Ladstätter, I. Forstner-Müller; wissenschaftliche Bearbeitung: J. Dorner, A. Galik, D. Katzjäger, T. Koch, L. Peloschek, L. Rembart; Mit-arbeit: N. Gail (Fotografie). Kooperation: C. v. Pilgrim und W. Müller (Schweizerisches Institut für ägyptische Bauforschung und Altertumskunde, Kairo)
II. WeITere akTIvITäTen der ZWeIgsTelle kaIro
Trainingsworkshop Restauration und Konservierung für Restauratoren und Restauratorinnen des Islamischen Museums in Kairo
Am 25. Jänner 2014 richtete eine Autobombe schwere Schäden an der Fassade und an Artefakten des Islamischen Museums in Kairo an. Nach einem UNESCO-Aufruf um Unterstützung leistete die Zweigstelle Kairo gemeinsam mit der Österreichi-schen Botschaft Kairo Hilfe im Rahmen eines Trainingsworkshops für Restaurierung von Metallobjekten.
Die Maßnahme stellt eine schnelle und unbürokratische Möglichkeit dar, im Rah-men des Dialogs, um den das BMeiA, die österreichische Botschaft und das ÖAI bemüht sind, Solidarität mit Ägypten zu zeigen und Unterstützung gerade im Bereich des Schutzes islamischer Kulturgüter zu leisten.
Syene. Oben: Proben-entnahme aus der West-bank (Foto L. Rembart); unten: Moderner Abbau von Kaolinton im Wadi Kasara (Foto L. Pelo-schek)
Jahresbericht 2014
110
WISSenSChAFTlIChevOrTrÄge2014(von Institutsangehörigen und projektgebundenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Forschungspro-jekten des ÖAI)
Forschungen in der türkei
M. Aurenhammer, Eroten, Masken und Gladiatoren. Zur Skulpturenausstattung des Theaters von Ephe-sos, Gesellschaft der Freunde Carnuntums, Wien, 23. 4. 2014.
H. Brückner, Holocene sealevel fluctuations and their consequences for ancient settlements – exam-ples from the Aegean Sea and the Black Sea, MEDBLACKS 2014. Internationaler Workshop in the framework of TurkishGerman Science Year 2013 – 2014 »Implications of Late Quaternary Sea Level Changes on the Mediterranean and Black Sea Coasts«, Congress Centre of Işık University, Şile, Istanbul, 31. 8.–6. 9. 2014.
H. Brückner, Auf den Spuren Heinrich Schliemanns – geoarchäologische Forschungen im östlichen Mit-telmeerraum und im Schwarzmeergebiet, Ostschweizerische geographische Gesellschaft (OGG), Pädagogische Hochschule St. Gallen, 8. 12. 2014; Geographische Gesellschaft Bern (GgGB), 9. 12. 2014; Geographisch-Ethnographische Gesellschaft Zürich, 10. 12. 2014; Geographisch-Ethnologi-sche Gesellschaft, Basel, 11. 12. 2014.
H. Brückner – F. Stock, Verlandet, verlagert, vergessen – das Schicksal der Häfen von Ephesos, Ephe-sos-Tag am Österreichischen Kulturforum, Istanbul, 28. 2. 2014.
H. González Cesteros, Ánforas hispanas en los mercados orientales. III Congreso Internacional de la SECAH, Instituto Catalán de Arqueología-Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, 12. 12. 2014.
V. Hofmann, Ein In-Cognitus und neue Grabtituli aus Ephesos, Epigraphisch-Papyrologische Werkstatt, Wien, 15. 12. 2014.
M. Kerschner, Die Tempel der Artemis, Vortragsreihe »Prominente Denkmäler in Ephesos«, KHM Wien, 26. 3. 2014.
M. Kerschner, Die erste Blütezeit von Ephesos – Die Stadt und ihr Heiligtum in archaischer Zeit, Ephesos-Tag am Österreichischen Kulturforum, Istanbul, 28. 2. 2014.
M. Kerschner, The Artemision of Ephesos – a polis sanctuary under changing rule from Kroisos to Alexan-der, Convegno »Santuari mediterranei tra Oriente e Occidente nel I millenio a. C. Interazioni e contatti culturali«, Villa Giulia, Rom, 21. 6. 2014.
M. Kerschner, Die erste Blütezeit von Ephesos – Die Stadt und das Artemision in der archaischen Epo-che, Festvortrag im Rahmen der Jahresversammlung der Gesellschaft der Freunde von Ephesos, Haus der Industrie, Wien, 23. 10. 2014.
M. Kerschner, What comes after Panconstructivism? In Search of New Foundations for Research in the Early Iron Age in the Mediterranean Region, Gründungstreffen des Forschungsnetzwerkes »Early TransMediterranean Transfers c. 900 – c. 500 BC. Sanctuaries as places of encounters and ex-change«, Atrium – Zentrum für Alte Kulturen, Innsbruck, 15. 11. 2014.
Z. Kuban, Children’s Limyra, European Association of Archaeologists 20th Annual Meeting, Istanbul, 10. – 14. 9. 2014.
Z. Kuban, Das Limyra der Kinder, BTU Cottbus-Architekturfakultät, 5. 12. 2014.S. Ladstätter, Ephesos. Funde des Jahres 2013, Ephesos-Tag am Österreichisches Kulturforum, Istanbul,
28. 2. 2014.S. Ladstätter, La Maison à terrasse 2: un joyau d’habitat urbain d’epoque romaine à Ephèse, Universität
Nancy, 20. 3. 2014.S. Ladstätter, Hanghaus 2, Vortragsreihe »Prominente Denkmäler in Ephesos«, KHM Wien, 9. 4. 2014.S. Ladstätter, Ephesos, Panel III – Archaeological site excavations and their impact on the cultural heri-
tage road of Anatolia, Pera Museum, Istanbul, 15. 5. 2014.S. Ladstätter, Efes, Arkeolojik Alanlarda Koruma ve Alan Yönetimi Semineri, Kültür Üniversitesi, Istanbul,
16. 5. 2014.S. Ladstätter, Efes 2013, The 36th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry,
Gaziantep, 2.–6. 6. 2014.S. Ladstätter, Der Schleier lichtet sich – neue Erkenntnisse zur mittelbyzantinischen Zeit in Ephesos,
RGZM Mainz, 7. 7. 2014.S. Ladstätter, The Rise and Fall of the Imperial Cult Temples at Ephesos, Universität Wien, 8. 7. 2014.S. Ladstätter, Ephesos, Izmir Dialogue Forum, Izmir, 18. 10. 2014.S. Ladstätter, Ephesos 2014, Jahresversammlung der Gesellschaft der Freunde von Ephesos, Haus der
Industrie, Wien, 23. 10. 2014.S. Ladstätter, Ephesos. Die Stadt und die neuen Ausgrabungen, Griechische Archäologische Gesell-
schaft, Athen, 12. 11. 2014.
Vorträge
111
S. Ladstätter, Ephesos. Ein archäologisches Traditionsunternehmen im 21. Jahrhundert, Humanistische Gesellschaft Krems, 17. 11. 2014.
S. Ladstätter, Suddenly Supranational. The Augustan Pottery Market in Asia Minor, Colloque international »Auguste et l’Asie Mineure«, Bordeaux, 21. 11. 2014.
S. Ladstätter, Archäologie und Tourismus in Ephesos, Internationale Konferenz »Heritage in Context II«, DAI Istanbul, 28. 11. 2014 (Vortrag vorgelesen).
S. Ladstätter, Is There Any Roman Identity Left in Byzantine Ephesos? An Archaeological Perspective, Workshop »Transformations of Romanness – Archaeological Perspectives (400 – 900 CE)«, ERC Advanced Grant ›SCIRE‹ project »Being Roman after Rome«, Österreichische Akademie der Wis-senschaften, Wien, 28. 11. 2014.
S. Ladstätter – M. Kerschner, The Artemision of Ephesos as space for the manifestation of political power: from Kroisos to Augustus, Convegno »Santuari mediterranei tra Oriente e Occidente nel I millenio a. C. Interazioni e contatti culturali«, Villa Giulia, Rom, 18.–21. 6. 2014.
L. Peloschek, Verteilungsmuster von Keramikfabrikaten und deren Relevanz für die Rekonstruktion von Aktivitäten in der frühbronzezeitlichen Siedlung des Çukuriçi Höyük, 4. interner ERC-Workshop »Space and Function«, Institut für Orientalische und Europäische Archäologie Wien, 21. 2. 2014.
L. Peloschek, Cross-Craft Interactions at EBA 1 Çukuriçi Höyük (Western Anatolia). Petrographic and Geochemical Analysis of Domestic and Metallurgical Ceramic Assemblages, Fitch-Wiener Seminar Series, Fitch Laboratory der British School, Athen, 19. 3. 2014.
L. Peloschek, Processing and Manipulation of Clay Raw Materials in Ephesos. Archaeometric Ceramic Analyses of the Austrian Archaeological Institute, Dokuz Eylül Universität, Torbalı, 14. 5. 2014.
P. Sänger, Eine neue ungewöhnliche Ehreninschrift für einen ephesischen Ringer, Nikephoros-Tagung, Graz, 26.–28. 6. 2014.
C. Samitz, Fast neue Inschriften aus Ephesos, Epigraphisch-Papyrologische Werkstatt, Wien, 15. 12. 2014.
G. Schörner, Survey in den ›suburbia‹ von Ephesos und Metropolis: Fragestellungen – Methoden – erste Ergebnisse, 15. Österreichischer Archäologentag, Innsbruck, 28. 2. 2014.
G. Schörner, Forschungen im Jahr 2013, Forschungskolloquium Institut für Klassische Archäologie, Uni-versität Wien, 12. 3. 2014.
G. Schörner, Surveys in the Suburbia of Ephesos and Metropolis, International Mediterranean Survey Workshop, Wien, 3. 5. 2014.
M. Seyer, The Archaeology of the Jewish Building in Limyra with its Water-Installation, Workshop »The Menorot of Limyra and Judaism in Asia Minor«, Wien, 22.–23. 1. 2014.
M. Seyer, Limyra – Die Ergebnisse der Kampagne 2013, Theater Spielraum Wien, 12. 5. 2014.M. Seyer, Limyra 2013, The 36th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry,
Gaziantep, 2.–6. 6. 2014.M. Seyer, The Survey on Toçak Dağı, The 36th International Symposium of Excavations, Surveys and
Archaeometry, Gaziantep, 2.–6. 6. 2014.M. Seyer, A Jewish Building in Limyra, 2014 International Meeting, Society of Biblical Literature, Wien, 9.
7. 2014.K. Sewing, Der sog. Bischofspalast in Limyra (öffentliche Präsentation der Masterarbeit), OTH Regens-
burg, 23. 7. 2014.M. Steskal, Topografie des Todes. Die Nekropolen von Ephesos im Lichte neuer Forschungen, Instituts-
abend, ÖAI Athen, 7. 3. 2014.M. Steskal, Das Vediusgymnasium in Ephesos – Badeluxus und Bildungszentrum, Vortragsreihe »Promi-
nente Denkmäler in Ephesos«, KHM Wien, 7. 5. 2014.M. Steskal, Leben und Sterben in Ephesos. Archäologie des Todes in einer römischen Metropole, Archäo-
logische Gesellschaft Innsbruck, 27. 5. 2014.M. Steskal, Defying Death in Ephesus. Strategies of Commemoration in a Roman Metropolis, Symposium
»Cityscapes and Monuments of Remembrance in Western Asia Minor«, Universität Aarhus, 31. 10. 2014.
F. Stock – A. Pint – A. Balk – M. Knipping – H. Laermanns – H. Brückner, Coastline changes and human impact in the Roman harbour of Ephesos, Turkey, 32. Jahrestagung des Arbeitskreises »Geographie der Meere und Küsten«, Wilhelmshaven, 3. 4.– 6. 4. 2014.
F. Stock – M. Knipping – A. Pint – H. Delile – S. Wulf – H. Laermanns – S. Ladstätter – H. Brückner, Reading the geo-bioarchives of Ephesos: Human-environment interactions in Western Turkey during the last 8 millennia, European Geosciences Union General Assembly 2014, Wien, 27. 4.– 2. 5. 2014.
F. Stock – A. Pint – S. Wulf – H. Laermanns – A. Balk – M. Knipping – H. Brückner, Sedimentological, geochemical, microfaunal and palynological evidence for vegetation change and human impact in the Ephesia, Western Turkey, Jahrestagung AK Geoarchäologie und AG Paläopedologie, Aachen, 29. 5.–31. 5. 2014.
F. Stock – A. Pint – S. Wulf – H. Laermanns – M. Knipping – H. Brückner, Reading the geo-bio-archives of Ephesos, Western Turkey, covering the last 8 millennia, Graduate School of Geosciences (GSGS) Research Conference, Köln, 4. 7. 2014.
H. Taeuber, Die Bauinschrift aus dem Serapeion. Internationaler Workshop des ÖAI, Wien, 27.–28. 1. 2014.
H. Taeuber, Ephesische Graffiti als Zeugnisse des Lebensgefühls in der hohen Kaiserzeit, Internationale Tagung »Epigraphik und Neues Testament«, Universität Wien, 20.–22. 4. 2014.
H. Taeuber, Zugang zu einer entfernten Welt. Die Graffiti des Hanghauses 2 in Ephesos, Graduate School »Distant Worlds« der Universität München, Workshop der Focus Area »Organization of Coexis-
Jahresbericht 2014
112
tence«: Neuere Forschungen zu Raumkonzepten in römischer und nachrömischer Zeit, München, 6.–9. 9. 2014.
H. Taeuber, Gladiatoren im Theater von Ephesos, Epigraphisch-Papyrologische Werkstatt, Wien 10. 11. 2014.
J. Vroom, Most exciting times: What happened in the Eastern Mediterranean afte Antiquity, GRONIN-GEN – Crasis Lecture, Universität Groningen, 17. 2. 2014.
G. Wiplinger, GISProject of the Değirmendere Aqueduct at Ephesus, Centro Ricerche Speleo Archeo-logiche Sotteranei di Roma, Rom, 25. 6. 2014.
G. Wiplinger, Der hadrianische und antoninische Değirmendere Aquädukt von Ephesos – 10 Jahre nach dem Ephesos-Symposium, Symposium »De aquaeductu atque aqua urbium Lyciae Pamphyliae, Pi-sidiae«, Antalya, 1. 11. 2014.
L. Zabrana, Ein Odeion für die Artemis von Ephesos. Neue Forschungsergebnisse zum Artemision in römischer Zeit, ÖAI Zentrale Wien, 19. 5. 2014.
L. Zabrana, The Artemision in the Roman Era – New Results of Research within the Sanctuary of Artemis, Society of Biblical Literature, International Meeting, Universität Wien, 8. 7. 2014.
Zentraleuropäische archäologie
S. Groh, Bernsteinstraße und Peripherie. Methodische Ansätze zur Untersuchung von Infrastruktur und Siedlungsmustern in Westpannonien und Südnoricum, Workshop »Infrastruktur und Besiedlungsent-wicklung NW-Noricum«, Außenstelle des OÖ. Landesmuseum, Leonding, 7. 3. 2014.
S. Groh, Die Bernsteinstraße: Handelsroute und via militaris. Interdisziplinäre Ringvorlesung, Institut für Archäologie und Zentrum Antike, Karl-Franzens-Universität Graz, Graz, 11. 3. 2014.
S. Groh, Das römische Militär in Österreich. Baumonumente und Ausrüstungsgegenstände vom Donauli-mes, Verein der Freunde des Kunsthistorischen Museums, KHM Wien, 2. 7. 2014.
S. Groh, Neue österreichische Forschungen in Aquileia bei Grado, Tavola rotonda »Scavi archeologici austriaci in Italia«, Italienisches Kulturinstitut Wien, 15. 10. 2014.
S. Groh, Der größte römerzeitliche Fundplatz des Burgenlandes an der Bernsteinstraße: Die Militärlager und der Vicus von Strebersdorf/Frankenau-Frakanava, Oberpullendorf, 16. 10. 2014.
S. Groh, Schätze vom Donaulimes im KHM – Jupiter Dolichenus aus Mauer an der Url, Verein der Freun-de des Kunsthistorischen Museums, KHM Wien, 22. 10. 2014.
S. Groh, Unsterbliche Römer in der Antikensammlung des KHM, Verein der Freunde des Kunsthistori-schen Museums, KHM Wien, 12. 11. 2014.
S. Groh – V. Lindinger – F. Schimmer – P. Donat, Lost in Space … and Artefacts: The Aquileia Survey, »International Mediterranean Survey-Workshop«, Wien, 2. 5. 2014.
S. Groh – F. Schimmer – P. Donat, Forschungen im westlichen Suburbium von Aquileia. Erste Ergeb-nisse eines Surveys im Bereich des Westhafens (FWF-Projekt P25176-G19), 15. Österreichischer Archäologentag, Innsbruck, 1. 3. 2014.
S. Groh – F. Schimmer – P. Donat, Urbanistic Studies in Aquileia, Projekttag zum Wissensvermittlungs-programm »Ich bin … an european citizen«, IC »Don Lorenzo Milani«, Aquileia, und Max-Beckmann-Oberschule, Berlin/Aquileia, 13. 5. 2014.
S. Groh – H. Sedlmayer, Infrastrutture lungo la Via dell‘Ambra in Pannonia: le stationes di Nemescsó e Sorokpolány (Ungheria), Convegno internazionale di Studi »Statio amoena: sostare e vivere lungo le strade romane tra antichità e alto medioevo«, Università degli Studi di Verona, 4. 12. 2014.
C. Hinker, Ein Brandhorizont aus der Zeit der Markomannenkriege in Flavia Solva. Archäologischer Be-fund und historische Interpretation, 15. Österreichischer Archäologentag, Innsbruck 28. 2. 2014.
M. Mackensen – F. Schimmer, Buchpräsentation »M. Mackensen – F. Schimmer (Hrsg.), Der römische Militärplatz Submuntorium/Burghöfe an der oberen Donau. Archäologische Untersuchungen im spät-römischen Kastell und Vicus 2001 – 2007, Münchner Beiträge zur Provinzialrömischen Archäologie 4 (Wiesbaden 2013)«, Mertingen, 6. 2. 2014.
F. Schimmer, Straßensicherung im Limes-Hinterland – Römische Wachttürme des 3. Jhs. n. Chr. an Verkehrsrouten in Nordafrika und in den NW-Provinzen, Ludwig-Maximilians-Universität München, 4. 12. 2014.
S. Schmid, Das norische Donaukastell von Arelape/Pöchlarn, 15. Österreichischer Archäologentag, Inns-bruck, 28. 2. 2014.
H. Sedlmayer, NMI >10 000: Strategien archäologischer Fundbearbeitung in Favianis-Mautern und Carnuntum-Petronell (Niederösterreich), Fachgespräch der Abteilung für Archäologie des Bundes-denkmalamtes in Kooperation mit dem Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie der Uni-versität Wien, »Massenfunde – Fundmassen. Strategien und Perspektiven im Umgang mit Fundkom-plexen aus Denkmalschutzgrabungen«, Kartause Mauerbach, 21. 8. 2014.
H. Sedlmayer, Traditionen und Zäsuren zwischen Spät antike und Mittelalter: Die Fallbeispiele Mautern und Zwentendorf an der Donau (Niederösterreich), Workshop »Transformations of Romanness – Archaeological Perspectives (400 – 900 CE)«, ERC Advanced Grant SCIRE project »Being Roman after Rome«, Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 28. 11. 2014.
V. Selke – F. Schimmer, Auxiliarkastell und Vicus von Submuntorium/Burghöfe in der frühen und mittleren Kaiserzeit, Symposium »Der Übergang vom Militärlager zur Zivilsiedlung in der archäologischen Hin-terlassenschaft«, Innsbruck, 23. 10. 2014.
Vorträge
113
Forschungen in Griechenland
W. Gauß, Arbeitsschwerpunkte 2011 – 2013, 15. Österreichischer Archäologentag Innsbruck, 27. 2.–1. 3. 2014.
W. Gauß und Mitarbeiter, Die Grabungen am sog. Sattel. Neue Forschungen zum bronzezeitlichen Aigeira, 15. Österreichischer Archäologentag Innsbruck, 27. 2.–1. 3. 2014.
W. Gauß, The Aigeira Survey Project, International Mediterranean Survey Workshop (IMS), Ephesos Museum Wien, 2.–3. 5. 2014.
W. Gauß, Aigeira vom Neolithikum zur Kaiserzeit, Institut für Geowissenschaften der Universität Kiel, 28. 5. 2014.
W. Gauß und Mitarbeiter, Aigeira 2014, Bericht zu Grabung und Aufarbeitung, Aigeira-Workshop, ÖAI Wien, 12. 12. 2014.
G. Ladstätter, Annäherung an die archaische dorische Sakralarchitektur von Aigeira, Aigeira-Workshop, ÖAI Wien, 12. 12. 2014.
ForschungeninÄgyptenundimSudan
I. Forstner-Müller – J.-Ph. Goiran – T. Herbich – L. Schmitt – C. Schweitzer, Newest Results on the Work of the Austrian Archaeological Intitute in Tell el-Dab‘a, Les conferences de l’IFAO »Avaris and its Harbours«, Kairo, 12. 2. 2014.
I. Forstner-Müller, Investigating an Egyptian Delta Site: The Survey of Tell el-Dab’a/Avaris, International Mediterranean Survey Workshop, Wien, 3. 5. 2014.
I. Forstner-Müller, Tätigkeitsbericht des Österreichischen Archäologischen Instituts/Zweigstelle Kairo, SÄK München, 22. 6. 2014.
I. Forstner-Müller, The Recently Discovered Khayan Sealings from the Earlier 15th Dynasty in Tell el-Dab’a and their Implications for the Chronology of the Second Intermediate Period, Workshop »The Hyksos King Khayan – New Insights on the Chronolgy of the 13th and 15th Dynasties«, Wien, 4. 7. 2014.
I. Forstner-Müller, Von Häfen und Kanälen, Forschungen in Avaris, Institut für die Kulturen des Alten Ori-ents (IANES), Abteilung Ägyptologie, Tübingen, 7. 7. 2014.
I. Forstner-Müller, Key Note Lecture: Avaris, Capital of the Hyksos, and Beyond. Recent Research in Tell el-Dab‘a, EES: London Study Day. Dynasties in Decline: The Second Intermediate Period in Ancient Egypt, The Brunei Gallery Lecture Theatre, London, 11. 10. 2014.
I. Forstner-Müller, Agency and Emergence. Archäologische Erschließung von antiker und moderner Landschaft in Ägypten, MAJA, München, 12. 12. 2014.
D. Katzjäger – L. Peloschek – L. Rembart, The Multiplicity of Aswan Pink Clay-Pottery (Roman Times to Late Antiquity). Synchronising Shape Repertoire, Clay Pastes and Firing Properties, 29th Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores, LVR-Römermuseum Xanten, 21.–26. 9. 2014.
L. Peloschek – D. Katzjäger, Archaeological and Mineralogical Profile of Pink ClayPottery from Late Antique Elephantine (Upper Egypt), LRCW 5. Fifth International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry, Alex-andria, 6.–10. 4. 2014.
L. Rembart – L. Peloschek, The Influence of the Hellenistic World on the Local Ceramic Production in Sy-ene/Upper Egypt, 9th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Universität Basel, Basel, 9.–13. 6. 2014.
P. Rose, Recent Discoveries at Hisn al-Bab, 13th International Conference for Nubian Studies, Universität Neuchâtel, Schweiz, 1.–6. 9. 2014.
P. Rose, Hisn al-Bab and Qasr Ibrim: a site on the verge of destruction, UNESCO International Confer-ence »The Southern Gates of Egypt: Archaeology, Community Development and Conservation«, Nubia Museum, Assuan, 22.– 23. 3. 2014.
L. Zabrana, Verlassene nubische Dörfer in Oberägypten – Materielle Kultur in sozialanthropologischen Feldstudien, 48. Koldewey Tagung 2014, Erfurt, 31. 5. 2014.
L. Zabrana, Abandoned Nubian Villages in Upper Egypt – Material Culture in Social Anthropological Field Studies, 13th International Conference for Nubian Studies, Universität Neuchâtel, 5. 9. 2014.
varia
S. Ladstätter, Knochenarbeit Archäologie, ZOOM Kindermuseum, Wien, 16. 2. 2014.S. Ladstätter, Vom Kartoffelacker zur römischen Villa, Österreichische Akademie der Wissenschaften,
Wien, 25. 2. 2014. S. Ladstätter, Archäologie im Dienste von Politik, Wirtschaft und Militär, Universität Klagenfurt, 5. 9. 2014.S. Ladstätter, Knochen, Steine, Scherben, Maria Saaler Gespräche, 28. 10. 2014.S. Ladstätter, Ähnlich und doch ganz anders. Ein Streifzug durch die deutsch-österreichischen Beziehun-
gen in der Archäologie, Humboldt Universität, Berlin, 25. 11. 2014.M. Steskal, Verborgen unter der Erde. Was Scherben und Knochen erzählen, KinderUni OÖ, Steyr, 27.
8. 2014.G. Wiplinger, Laudatio zur Verleihung der FrontinusMedaille an Prof. Dr. Ünal Öziş, Antalya, 1. 11. 2014.
Jahresbericht 2014
114
WISSenSChAFTlIChePOSTer2014(von Institutsangehörigen und projektgebundenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Forschungspro-jekten des ÖAI)
Forschungen in der türkei
L. Ehlers – F. Stock – B. Horejs – H. Brückner, Reconstructing the Palaeogeographies of a Neolithic-Bronze Age Settlement Mound at Ephesos, Turkey, European Geosciences Union, General Assem-bly 2014, Wien, 27.4.–2. 5. 2014 und Jahrestagung AK Geoarchäologie und AG Paläopedologie, Aachen, 29.– 31. 5 .2014.
F. Stock – M. Knipping – A. Pint – H. Laermanns – H. Brückner, Human impact on the environment in the Ephesia, Turkey – an eight thousand year-long battle, Open PAGES Focus 4 Workshop »Towards a more accurate quantification of humanenvironment interactions in the past«, 3.–7. 2. 2014.
F. Stock – M. Knipping – A. Pint – S. Wulf – H. Brückner, Human-environmental interactions during the last 8 millennia: The example of the ancient city of Ephesos, Western Turkey, Jahrestagung des Ar-beitskreises Geomorphologie (AK Geomorphologie), Kiel, 2.–4. 10. 2014.
F. Stock – M. Knipping – A. Pint – H. Brückner, Human-environment interactions during the last 8000 years in the environs of the ancient city of Ephesus, Western Turkey, American Geophysical Union (AGU), San Francisco, 15. 12.–19. 12. 2014.
G. Wiplinger, The Hadrianic and Antonine Değirmendere Aqueduct at Ephesus, Symposium »De aque-ductu atque aqua urbium Lyciae Pamphyliae et Pisidiae«, 31. 10.–9. 11. 2014.
Zentraleuropäische archäologie
S. Groh, Nouvelles recherches sur le système fluvial et les installations portuaires d’Aquilée (Italie), Col-loque international »Les ports dans l’espace méditerranéen antique«, CNRS/Laboratoire »Archéolo-gie des Sociétés Méditerranéennes«, Montpellier, 22. 5. 2014.
S. Groh – H. Sedlmayer, La villa maritima de Simonov zaliv (Izola, Slovénie) – structure avec grande ins-tallation portuaire artificielle, Colloque international »Les ports dans l’espace méditerranéen antique«, CNRS/Laboratoire »Archéologie des Sociétés Méditerranéennes«, Montpellier, 22. 5. 2014.
S. Groh – H. Sedlmayer, Regards sur la vie quotidienne en campement militaire: l’inventaire d’un contu-bernium dans le contexte de la culture matérielle du limes romain sur le Danube (Autriche), Colloque International »Les mobiliers archéologiques dans leur contexte, de la Gaule à l›Orient méditerranéen: fonctions et statuts«, Université de Poitiers, 27. 10. 2014.
S. Groh – H. Sedlmayer, Forschungen des Österreichischen Archäologischen Instituts in Niederöster-reich, »News from the Past«, Stadtmuseum St. Pölten, 4. 6. 2014 – 5.4. 2015.
Forschungen in Griechenland
L. Berger – W. Gauß, Wandel oder Umbruch? Ägina Kolonna am Übergang von FH II zu FH III, Internati-onale Tagung in Halle: 2200BC. Ein Klimasturz als Ursache für den Verfall der Alten Welt?, 7. Mittel-deutscher Archäologentag, Halle a.d. Saale, 23.–26.10.2014.
ForschungeninÄgyptenundimSudan
I. Forstner-Müller, Activities of the Austrian Archaeological Institute Cairo Branch, Österreichtag Azhar Park, Kairo, 7. 11. 2014.
Veranstaltungen, lehrtätigkeiten, auszeichnungen
115
WISSenSChAFTlICheverAnSTAlTungen2014Am 13. 1. 2014 war Michael Schultz (Institut für Anatomie und Embryologie, Universität Göttingen) mit dem Vortrag »Krankheiten des Kindesalters in der Vorzeit« Gast am ÖAI Wien.
»Das ›anatolisch‹ geprägte Kultbild der Artemis von Ephesos: ein Trugschluss und seine Folgen« war Thema des Vortrags von Helga Bumke (Seminar für Klassiche Archäologie, Universität Halle-Wittenberg) am 20. 1. 2014 am ÖAI Wien.
Von 22.−23. 1. 2014 veranstaltete das ÖAI gemeinsam mit dem Institut für Judaistik der Universität Wien den internationalen Workshop »The Menorot in Limyra and Judaism in Asia Minor«, der von der Universität Wien, der Kulturabteilung der Stadt Wien sowie der Gertnergroup gefördert wurde. Zehn Wissenschafter/-innen aus vier Ländern nahmen mit Vorträgen an dieser Veranstaltung teil, um einen im Jahr 2012 in Limyra entdeckten und bisher teilweise freigelegten jüdischen Bau in breitem wissenschaft-lichem Kontext zu diskutieren.
Am 27. 1. 2014 war die Zweigstelle Athen Ort des von der Vereinigung der Österreicher in Griechenland organisierten Vortrags von Walter Puchner (Universität Athen) »Südosteuropäische Literaturen zwischen Wien und Kreta in der Neuzeit«.
Vom 27.–28. 1. 2014 organisierte das ÖAI einen internationalen Experten-Workshop zu dem sog. Sera-peion in Ephesos mit rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Neben den aktuellen Forschungsergeb-nissen, insbesondere der Bauforschung, wurden auch mögliche Strategien für einen Wiederaufbau des Tempels diskutiert und Erfahrungen bei Wiederaufbauten (Anastylosen) ausgetauscht.
Auf Einladung der Österreichischen Botschaft in Athen nahm Georg Ladstätter am 18. 2. 2014 an dem vom Kulturbauftragten Gerhard Eissl organisierten Treffen »Kultur-Netzwerk« teil und präsentierte die Aktivitäten der Zweigstelle Athen des ÖAI.
Am 28. 2. 2014 lud das Österreichische Kulturforum in Istanbul (Avusturya Kültür Ofisi) zum 6. EphesosTag. Mit Vorträgen und einer Posterausstelllung wurden die Forschungsergebnisse des Jahres 2013 erstmals in der Türkei präsentiert.
Am 5. 3. 2014 referierte Julian Henderson (Department of Archaeology, University of Nottingham) am ÖAI Wien über »Tracing cultural contact along Silk Road: en example from ancient glass studies«.
Von 26. 3. bis 21. 5. 2014 veranstaltete das ÖAI in Kooperation mit dem Kunsthistorischen Museum den Vortragszyklus »Prominente Denkmäler in Ephesos«. Wissenschafter/-innen des ÖAI informierten die interessierte Öffentlichkeit über neueste Forschungsergebnisse.
Am 7. 3. 2014 fand der jährliche Institutsabend/open meeting an der Zweigstelle Athen statt: Neben dem Jahresbericht 2013 des Zweigstellenleiters Georg Ladstätter galt der Festvortrag von Martin Steskal (ÖAI Wien) der Nekropolenforschung in Ephesos.
Johannes Preiser-Kapeller (Institut für Mittelalterforschung, Abteilung für Byzanzforschung an der Ös-terreichischen Akademie der Wissenschaften) war am 23. 4. 2014 mit dem Vortrag »Topografien der Verflechtung. Möglichkeiten und Grenzen der archäologischen und historischen Netzwerkanalyse« Gast am ÖAI Wien.
Am 12. 5. 2014 war das »Theater im Spielraum« (Wien) Ort des jährlichen Limyra-Abends. Der Gra-bungsleiter, Martin Seyer berichtete über das Forschungsjahr 2013.
Vom 2. bis 3. 5. 2014 organisierte Stefan Groh (ZEA) gemeinsam mit dem KHM Wien den »International Mediterranean Survey Workshop« im Kunsthistorischen Museum Wien. Im Rahmen der zweitägigen Ver-anstaltung beschäftigten sich rund 19 Referate internationaler Vortragender mit aktuellen Surveys und Surveymethoden im Mittelmeerraum.
Am 13. 5. 2014 fand in Aquileia (I) der Projekttag zur Wissensvermittlung des FWF-Forschungsprojekts »Urbanistic Studies in Aquileia« (Leitung S. Groh, ZEA) statt.
»Der erste römische Kaiser und das organisierte Vergessen« war Thema des vom ÖAI Wien organisierten Vortrags von Martin Zimmermann (Historisches Seminar, Alte Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München) am 16. 6. 2014 am KHM Wien.
Am 4. 7. 2014 referierte Josef Wegner (University of Pennsylvania, Egypt Section) über »A New Royal Necropolis of the Second Intermediate Period at Abydos« am Institut für Klassische Archäologie der Uni-versität Wien. Organisiert wurde der Vortrag vom ÖAI Kairo und derm Oriental Institute Chicago.
Jahresbericht 2014
116
Von 4. bis 5. 7. 2014 veranstaltete das ÖAI Zweigstelle Kairo gemeinsam mit dem Oriental Institute Chi-cago und finanzieller Unterstützung der Österreichischen Forschungsgesellschaft (ÖFG) am ÖAI Wien den Workshop »The Hyksos King Khayan – New Insights on the Chronology of the 13th and 15th Dynas-ties«. Im Rahmen des Workshops wurden die Ergebnisse der neuen Entdeckungen in Ägypten erstmals auch nicht nur einem hochkarätigem Fachgremium, sondern auch einer breiteren Fachkollegenschaft präsentiert.
Am 8. 7. 2014 war die Universität Wien Veranstaltungsort für das International Meeting of the Society of Biblical Literature zu dem Thema »Ephesian Temples: Sacred Sites and Practices«.
Die Jahresversammlung der Gesellschaft der Freunde von Ephesos fand am 23. 10. 2014 im Haus der Industrie in Wien statt. Festvortragender war Michael Kerschner (Wien).
Am 24. 10. 2014 nahm Georg Ladstätter (ÖAI Athen) auf Einladung der Österreichischen Botschaft in Athen an der Honorarkonsulartagung teil und präsentierte die Aktivitäten der Zweigstelle Athen des ÖAI.
Die Zweigstelle Kairo des ÖAI nahm am 7. 11. 2014 auf Einladung der Kulturabteilung der Österreichi-schen Botschaft erstmals am »Österreichtag« im Azharpark von Kairo teil. Ziel war, die Aktivitäten des Instituts einer interessierten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Ein Poster wurde angefertigt, Brot nach altägyptischen Rezepten gebacken und verteilt. Die Kinder konnten in einer Sandkiste eine archäologi-sche Ausgrabung nachspielen.
Am 14. und 15. 11. 2014 fand im Atrium – Zentrum für Alte Kulturen der Universität Innsbruck das Grün-dungstreffen des Forschungsnetzwerkes »Early Trans-Mediterranean Transfers ca. 900 – ca. 500 BC« statt, das von M. Kerschner (ÖAI Wien) gemeinsam mit E. Kistler (Institut für Archäologien der Universität Innsbruck) organisiert wurde. Ziel dieses Treffens, an dem 11 Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus 8 Ländern teilnahmen, war es, gemeinsame Methoden und Rahmenbedingungen zu diskutieren, die es in Zukunft ermöglichen sollen, den interkulturellen Transfer von Gütern, Wissen, Technologien sowie von kulturellen und religiösen Bräuchen und Normen besser und leichter nachvollziehbar zu machen, um auf diese Weise die Interaktionen innerhalb der frühen Mittelmeerwelt in ihrer Komplexität und ihrer Differenziertheit erfassen zu können.
Am 12. 12. 2014 fand die Weihnachtsfeier der Vereinigung der Auslandsösterreicher in Griechenland in den Räumlichkeiten der Zweigstelle Athen des ÖAI statt.
Am 12. 12. 2014 war das ÖAI Wien Ort des Workshops »Aigeira 2014«, in dem die Ergebnisse und offenen Fragen der Forschungen des Jahres 2014 diskutiert wurden.
lehrTÄTIgKeITen2014S. Groh, Interdisziplinäre Ringvorlesung »Raetia, Noricum, Pannonia« – Neue provinzialrömische For-
schungen und Grabungsergebnisse in Österreich«, Universität Graz, Sommersemester 2014.C. Hinker, Ausgewählte Fundstellen der Provinzialrömischen Archäologie, Universität Graz, Sommerse-
mester 2014.C. Hinker, Wirtschaft, Staat, Gesellschaft (Provinzialrömische Archäologie): Zur Aussagekraft provinzial-
römischer Kleinfunde, Universität Innsbruck, Wintersemester 2014/2015.S. Ladstätter, Ephesos. Archäologie einer Großstadt, Universität Wien, Wintersemester 2014/2015.L. Peloschek, Naturwissenschaftliche Methoden (Archäometrie), Universität Wien, Wintersemester
2014/2015.
AuSzeIChnungen2014Am 11. Juni 2014 wurde Karl Herold das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Öster-reich verliehen.
BiBliografie
117
BiBliOGraFie 2014Die Bibliografie umfasst die im Jahr 2014 erschienenen Publikationen von Institutsangehörigen und Pro-jektmitarbeiterinnen und mitarbeitern sowie Publikationen, welche mit finanzieller Unterstützung des ÖAI erfolgt sind.
MonografienundSammelbändeimverlagdesÖAI
O. Harl, Hochtor und Glocknerroute. Ein hochalpines Passheiligtum und 2000 Jahre Kulturtransfer zwi-schen Mittelmeer und Mitteleuropa. Mit Beiträgen von Günther Dembski, Paola Càssola Guida, Frie-derike Harl, Raimund Kastler, Klaus Oeggl, Christian Rohr, Helga Sedlmayer, Markus J. Wenninger, Gerhard Winkler und Herwig Wolfram, SoSchrÖAI 50 (Wien 2014).
C. Hinker, Ein Brandhorizont aus der Zeit der Markomannenkriege im südostnorischen Munizipium Flavia Solva, ZEA 4 (Wien 2014).
M. Kerschner – I. S. Lemos (Hrsg.), Archaeometric Analyses of Euboean and Euboean Related Pottery. New Results and their Interpretations. Proceedings of the Round Table Conference held at the Aus-trian Archaeological Institute in Athens 15 and 16 April 2011, ErghÖJh 15 (Wien 2014).
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien 82, 2013 (2014).
MonografienundSammelbändeherausgegebenoderverfasstvonMitarbeiter(inne)ndesÖAIinanderenverlagen
A. Colella – A. Lange – M. Seyer (Hrsg.), The Menorot of Limyra and Judaism in Asia Minor. Archaeology, Visual Culture, and Literature, Journal of Ancient Judaism 5, 2, 2014.
MonografienundSammelbändeherausgegebenmitderÖsterreichischenAkademiederWissen-schaften
Ägypten und Levante 22/23, 2012/2013 (2014).Ägypten und Levante 24, 2014 (2014).H. Thür – E. Rathmayr (Hrsg.), Das Hanghaus 2 in Ephesos. Die Wohneinheit 6. Baubefund, Ausstattung,
Funde. Mit Beiträgen von I. Adenstedt, G. Forstenpointner, A. Galik, S. İlhan, K. Koller, S. Ladstät-ter, U. Quatember, E. Rathmayr, M. Schätzschock, V. Scheibelreiter-Gail, N. Schindel, A. Sokolicek, H. Taeuber, H. Thür, B. Tober, A. Waldner, G. Weissengruber, N. Zimmermann, FiE 8, 9 (Wien 2014).
Beiträge in Zeitschriften, reihen und sammelbänden
Forschungen in der Türkei
M. Aurenhammer, Die ephesische Replik des lysippischen Eros, in: C. Şimşek – B. Duman – E. Kenakçı (Hrsg.), M. Büyükkolancı’ya Armağan. Essays in Honor of Mustafa Büyükkolancı (Istanbul 2014) 29 – 40.
M. Aurenhammer – G. Plattner, Der Eroten-/Satyrfries vom Theater in Ephesos, in: E. Trinkl (Hrsg.), Akten des 14. Österreichischen Archäologentages am Institut für Archäologie der Universität Graz 2012, VIKAGraz 11 (Wien 2014) 47 – 62.
C. Baier, Attolitur monte Pione. Neue Untersuchungen im Stadtviertel oberhalb des Theaters von Ephe-sos, ÖJh 82, 2013, 23 – 68.
S. Fünfschilling, Glass from the Byzantine Palace at Ephesus in Turkey, in: D. Keller – J. Price – C. Jackson (Hrsg.), Neighbours and Successors of Rome. Traditions of Glass Production an Use in Europe and the Middle East in the later 1st Millennium AD (Oxford 2014) 137 – 146.
S. Groh – S. Ladstätter – A. Waldner, Neue Ergebnisse zur Urbanistik in der Oberstadt von Ephesos. Intensive und extensive Surveys 2002 – 2006, ÖJh 82, 2013 (2014) 93 – 194.
A. G. Heiss – U. Thanheiser, A Glimpse of Mediterraneanisation? First Analyses of Hellenistic and Roman Charcoal Remains from Terrace House 2 at Ephesos, and their Possible Implications for Vegetation Change, Woodland Use, and Timber Trade, in: G. Verstraeten – B. Notebaert – H. De Brue u. a., Open PAGES 2014 Focus 4 workshop, Katholieke Universiteit Leuven (Leuven 2014) 28 – 29.
M. Kerschner, Euboean Imports to the East Aegean and East Aegean Productions of Pottery in Euboean Style: New Evidence from Neutron Activation Analyses, in: M. Kerschner – I. S. Lemos (Hrsg.), Ar-chaeometric Analyses of Euboean and Euboean Related Pottery: New Results and their Interpreta-tions. Proceedings of the Round Table Conference held at the Austrian Archaeological Institute in Athens 15 and 16 April 2011, ErghÖJh 15 (Wien 2014) 109 – 140.
M. Kerschner, Euboean or Levantine? Neutron Activation Analysis of Pendent Semicircle Skyphoi from Al Mina, in: M. Kerschner – I. S. Lemos (Hrsg.), Archaeometric Analyses of Euboean and Euboean Related Pottery … ErghÖJh 15 (Wien 2014) 157 – 167.
M. Kerschner – I. Lemos, Introduction, in: M. Kerschner – I. S. Lemos (Hrsg.), Archaeometric Analyses of Euboean and Euboean Related Pottery … ErghÖJh 15 (Wien 2014) 7 – 9.
M. Kerschner – I. Lemos, Production, Export and Imitation of Euboean Pottery: A Summary of the Results of the Workshop on the Provenance of Euboean and Euboean Related Pottery and Perspectives for
Jahresbericht 2014
118
Future Research, in: M. Kerschner – I. S. Lemos (Hrsg.), Archaeometric Analyses of Euboean and Euboean Related Pottery … ErghÖJh 15 (Wien 2014) 191 – 194.
M. Kerschner – F. Stock – J. C. Kraft – A. Pint – P. Frenzel – H. Brückner, The palaeogeographies of Ephe-sos (Turkey), its harbours, and the Artemision – a geoarchaeological reconstruction for the timespan 1500 – 300 BC, in: M. Engel – H. Brückner (Hrsg.), Geoarchaeology. Exploring terrestrial archives for evidence of human interaction with the environment, Zeitschrift für Geomorphologie 58, Suppl. Issue 2 (Stuttgart 2014) 33 – 66.
Z. Kuban, Children’s Limyra, in: 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 10 – 14 September 2014 Istanbul (Istanbul 2014) 153 f. (abstract).
S. Ladstätter – J. Haldon – N. Roberts – A. Izdebski u. a., The Climate and Environment of Byzantine Anatolia. Integrating Science, History and Archaeology, Journal of Interdisciplinary History, 45, 2, 2014, 113 – 161.
S. Ladstätter – L. Zabrana, The shelter construction for Terrace House 2 in Ephesos: A unique museum and scientific workshop, in: E. Korka (Hrsg.), Protection of archaeological heritage in times of eco-nomic crisis (Cambridge 2014) 234 – 242.
S. Ladstätter – A. Waldner, Ephesus – local vs. import: The early Byzantine fine ware, in: H. Meyza (Hrsg.), Late hellenistic to medieval fine wares of the Aegean cost of Anatolia (Warschau 2014) 49 – 58.
S. Lösch – N. Moghaddam – K. Grossschmidt – D. U. Risser – F. Kanz, Stable Isotope and Trace Element Studies on Gladiators and Contemporary Romans from Ephesus (Turkey, 2nd and 3rd Ct. AD) – Im-plications for Differences in Diet, PLOS One <http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0110489> (20. 10. 2014).
A. Naso, Amber for Artemis. Preliminary Report on the Amber Finds from the Sanctuary of Artemis at Ephesos, ÖJh 82, 2013, 259 – 278.
A. M. Pülz, Das Fundmaterial der frühbyzantinischen und mittelbyzantinischen Zeit am Beispiel der Stadt Ephesos: Ein Überblick, forum archaeologiae 73/XII/2014 <www.farch.net>.
P. Scherrer, Hunting the Boar – the Fiction of a Local Past in Foundation Myths of Hellenistic and Roman Cities, in: B. Alroth – C. Scheffer (Hrsg.), Attitudes towards the Past in Antiquity Creating Identities. Proceedings of an International Conference held at Stockholm University, 15 – 17 May 2009, Acta Universitatis Stockholmiensis 14 (Stockholm 2014) 113 – 119.
M. Seyer, Ein Gebäude mit jüdischen Elementen in Limyra, in: R. Gross – S. Hansen – M. Lenarz – P. Rahemipour (Hrsg.), Im Licht der Menora. Jüdisches Leben in der römischen Provinz, Katalog zur Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt (Frankfurt 2014) 246−257.
M. Seyer, Limyra 2012, KST 35, 1, 2013, 404 – 418.M. Seyer, Limyra 2013, News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas 12, 2014, 73−80.M. Seyer – H. Lotz, A Building with Jewish Elements in Limyra/Turkey – A Synagogue?, in: A. Colella –
A. Lange − M. Seyer (Hrsg.), The Menorot of Limyra and Judaism in Asia Minor: Archaeology, Visual Culture, and Literature, Journal of Ancient Judaism 5, 2, 2014, 142−152.
M. Seyer – H. Lotz – P. Brandstätter, The Survey on Toçak Dağı, News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas 12, 2014, 224−229.
M. Seyer – H. Lotz – P. Brandstätter, Eine befestigte Höhensiedlung auf dem Gipfel des Toçak Dağı: Neue Forschungen im Umland von Limyra (Lykien), Forum Archaeologiae 71/VI/2014 <http://www.farch.net>.
F. Stock – A. Pint – B. Horejs – S. Ladstätter – H. Brückner, In search of the harbours – New evidence of Late Roman and Byzantine harbours of Ephesus, Quaternary International 312, 2013, 57 – 69.
H. Taeuber, Graffiti und Steininschriften, in: H. Thür – E. Rathmayr (Hrsg.), Das Hanghaus 2 in Ephesos. Die Wohneinheit 6. Baubefund, Ausstattung, Funde, FiE 8, 9 (Wien 2014) 331 – 344.
H. Taeuber, Einblicke in die Privatsphäre. Die Evidenz der Graffiti aus dem Hanghaus 2 in Ephesos, in: W. Eck – P. Funke (Hrsg.), Öffentlichkeit – Monument – Text. XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae 27.–31. Augusti MMXII, Akten CIL, Auctarium series nova 4 (Berlin 2014) 487 – 489.
S. Y. Waksman, Long-term pottery production and chemical reference groups: examples from Medieval Western Turkey, in: H. Meyza (Hrsg.), Late Hellenistic to Medieval Fine wares of the Aegean Coast of Anatolia. Their production, imitation and use (Warschau 2014) 107 – 125.
A. Waldner – S. Ladstätter, Keramik, in: H. Thür – E. Rathmayr (Hrsg.), Das Hanghaus 2 in Ephesos. Die Wohneinheit 6. Baubefund, Ausstattung, Funde, FiE 8, 9 (Wien 2014) 435 – 588.
S. Wefers – A. Cramer, 3D visualization of sheath folds in Ancient Roman marble wall coverings from Ephesus, Turkey, Journal of Structural Geology 67, 2014, 129 – 139 <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsg.2014.07.005>.
S. Wex – C. W. Passchier – E. A. de Kemp – S. İlhan, 3D visualization of sheath folds in Ancient Ro-man marble wall coverings from Ephesos, Turkey, Journal of Structural Geology 67, 2014, 129 – 139 <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsg.2014.07.005>.
Zentraleuropäische Archäologie
S. Groh, Neues zur Urbanistik des Munizipiums AndautoniaŠčitarjevo (Pannonia Superior, Kroatien), VAMZ 46.1, 2013, 89 – 113.
S. Groh – O. Láng – H. Sedlmayer – P. Zsidi, Neues zur Urbanistik der Zivilstädte von Aquincum-Buda-pest und CarnuntumPetronell, ActaArchHung 65, 2014, 361 – 404.
S. Groh – H. Sedlmayer (mit einem Beitrag von P. Kiss – S. Renhart), Ein italisch geprägtes Grabinventar mit dem Beinrelief eines Eros aus der nördlichen Nekropole von Savaria-Szombathely, Pannonien (Ungarn), ÖJh 82, 2013 (2014) 195 – 226.
BiBliografie
119
S. Groh – H. Sedlmayer, Der größte römerzeitliche Fundplatz des Burgenlandes an der Bernsteinstraße, in: O. Gruber – J. Schermann – F. Stifter (Hrsg.), 25 Jahre Verein zur Erhaltung der Römischen Bern-steinstraße (Stoob 2014) 42 – 47.
B. Komoróczy – M. Vlach – C. M. Hüssen – L. Lisá – Z. Lendáková – S. Groh, Projekt interdisciplinárního výzkumu římských krátkodobýchtáborůvestřednímPodunají (Interdisciplinary research project of the Roman temporary camps in the Middle Danube region), in: B. Komoróczy (Hrsg.), Sociální diferenciace barbarských komunit ve světle nových hrobových, sídlištních a sběrových nálezů, Ar-cheologie barbarů 2011 (Soziale Differenzierung barbarischer Gemeinschaften im Lichte der neuen Grab, Siedlungs und Lesefunde, Archäologie der Barbaren 2011) = Archeologický Ústavakademie věd České Republiky, Brno V.V.I (Brünn 2014) 341 – 370.
H. Sedlmayer, Fibeln und Ausrüstungsgegenstände, in: O. Harl, Hochtor und Glocknerroute, SoSchrÖAI 50 (Wien 2014) 71 – 88.
H. Sedlmayer, Säumer oder Fuhrleute? Zum Warentransport im hochalpinen Noricum aus dem Blick-winkel der Fundbearbeitung, in: O. Harl, Hochtor und Glocknerroute, SoSchrÖAI 50 (Wien 2014) 293 – 300.
H. Sedlmayer, Funde aus dem Bereich der Großen Thermen (sog. Palastruine), in: F. Humer – G. Kre-mer – E. Pollhammer – A. Pülz (Hrsg.), A. D. 313 – Von Carnuntum zum Christentum, Katalog des NÖ Landesmuseums NF 517 (Bad Vöslau 2014) 160 – 163.
H. Sedlmayer, Rezension: Florian Schimmer, Amphoren aus Cambodunum/Kempten. Ein Beitrag zur Handelsgeschichte der römischen Provinz Raetien, Münchner Beiträge zur provinzialrömischen Archäologie Band 1. Dr. Ludwig Reichert, Wiesbaden 2009, in: Germania 90, 2012 (2014) 245 – 248.
Forschungen in Griechenland
W. Gauß – R. Smetana – J. B. Rutter – J. Dorner – P. Eitzinger – C. Klein – A. Kurz – A. Lätzer-Lasar – M. Leibetseder – C. Regner – H. Stümpel – A. Tanner – C. Trainor – M. Trapichler, Aigeira 2012. Bericht zu Aufarbeitung und Grabung, ÖJh 82, 2013, 69 – 91.
Forschungen in Ägypten und im Sudan
I. ForstnerMüller, Avaris, its Harbours and the Peru Nefer Problem, EgA 45 (Autumn 2014) 32 – 35.I. ForstnerMüller, Neueste Forschungen in Tell elDab’a, dem antiken Avaris, Sokar 29, 2014, 30 – 45.I. Forstner-Müller – P. Rose, Grabungen des Österreichischen Archäologische Instituts Kairo in Tell el-
Dab‘a/Avaris: Das Areal R/III. Erster Vorbericht (Herbst 2010 bis Frühjahr 2011), AegLev 22/23, 2014, 55 – 66.
I. Forstner-Müller – D. Raue, Contacts between Egypt and the Levant in the 3rd Millenium B.C., in: F. Höflmayer – R. Eichmann (Hrsg.), Egypt and the Southern Levant in the Early Bronze Age, Orient-Archäo-logie 31 (Rahden/Westfalen 2014) 57 – 68.
Varia
I. Benda-Weber, The Habits of the Emperors as Different Expressions of Political Power, in: C. Alfaro Giner – J. Ortiz Gracia – M. J. Martínez Garcia (Hrsg.), Luxury and Dress. Political Power and Ap-pearance in the Roman Empire and its provinces (València 2013) 133 – 150.
I. Benda-Weber, Krokotos and crocota vestis: Saffron-coloured clothes and muliebrity, in: C. Alfaro Giner – M. Tellenbach – J. Ortiz (Hrsg.), Production and Trade of Textiles and Dyes in the Roman Empire and Neighbouring Regions. Actas del IV Symposium Internacional sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en el mundo antiguo (València, 5 al 6 de noviembre, 2010), Purpurae Vestes IV (València 2014) 129 – 142.
L. Peloschek, Funktionell oder rituell? Technologische Charakterisierung spätklassisch-hellenistischer Keramik aus der Nekropole von Aphendrika (Zypern), in: E. Trinkl (Hrsg.), Akten des 14. Österreichi-schen Archäologentages am Institut für Archäologie der Universität Graz vom 19. bis 21. April 2012. VIKAGraz 11 (Wien 2014) 315 – 322.
MITglIederdeSÖAIIm Jahr 2014 betrauerte das Österreichische Archäologische Institut das Ableben seiner Mitglieder
Luisa BertacchiFerdinand Maier
DanKsaGUnGDas ÖAI dankt allen, die seine Forschungen über LOGO INJECT POWER unterstützen.