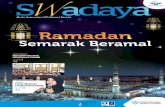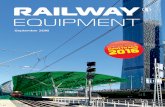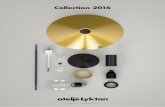Abstractband FowiTa 2016
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Abstractband FowiTa 2016
FORSTWISSENSCHAFTLICHE TAGUNG 2016
FREIBURG IM BREISGAU
ABSTRACTS
FAKULTÄT FÜR UMWELT UND NATÜRLICHE RESSOURCEN INSTITUT FÜR FORSTWISSENSCHAFTEN
PROFESSUR FÜR WALDBAU
ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG
Forstwissenschaftliche Tagung 2016 Freiburg im Breisgau Abstracts (Stand: 1. Sept. 2016) Gleichzeitig erschienen in: Berichte Freiburger Forstliche Forschung 2016, Heft 100 ISSN 1436-1566 Die Herausgeber: Martin Kohler, Germar Csapek und Jürgen Bauhus, Professur für Waldbau an der Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg Druck: Universitätsdruckerei Freiburg Bestellung an: Professur für Waldbau Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Tennenbacherstr. 4 79085 Freiburg Tel. 0761/203 3678 Fax: 0761/203 3781 e-mail: [email protected] Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Gedruckt auf 100 % chlorfrei gebleichtem Papier
Das Wissenschaftliche Komitee der FowiTa 2016
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Fakultät für Umwelt- und Natürliche Ressourcen
Prof. Dr. Jürgen Bauhus Professur für Waldbau
Prof. Dr. Marc Hanewinkel Professur für Forstökonomie und Forstplanung
Prof. Dr. Friederike Lang Professur für Bodenökologie
Dr. Martin Kohler Professur für Waldbau TU Dresden Fakultät Umweltwissenschaften
Prof. Dr. M. Roth Institut für Forstbotanik und Forstzoologie Professur für Forstzoologie Georg-August-Universität Göttingen
Prof. Dr. Michael Bredemeier Sektion Waldökosystemforschung im CBL Technische Universität München Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Prof. Dr. Martin Moog Lehrstuhl für Forstliche Wirtschaftslehre Als Vertreter der Forstlichen Versuchsanstalten im DVFFA:
Prof. Konstantin von Teuffel Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Freiburg
Inhaltsverzeichnis
Keynotes ........................................................................................................................ . 1
Vorträge Session 1: Baumarten im Klimawandel .......................................................................... . 7 Session 2: Genetik der Gehölze im Klimawandel .......................................................... . 15 Session 3: Forstliches Risikomanagement unter sich ändernden Umweltbedingungen...................................................................................... . 20 Session 4: Auswirkungen von Extremwetterlagen auf Wälder: Schadensabschätzung und -bewertung ............................................................ 24 Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Kimawandel ....................................... . 32 Session 6: Lichte Wälder ................................................................................................. . 41 Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität ......................... .45 Session 8: Funktionelle Bedeutung von Totholz ............................................................... 54 Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtschafteten Wäldern ........... 59 Session 10: Nährstoffkreisläufe und Nährstoffverluste in naturnahen Waldökosystemen und Wirtschaftswäldern.................................................... . 69 Session 11: Wasserbezogene Dienstleistungen des Waldes ................................................ 78 Session 12: Angepasste Forsttechnik als Voraussetzung für nachhaltige Forstwirtschaft .................................................................................................. 83 Session 13: Nutzungsintensität als Stellschraube zur Lösung von Zielkonflikten ............... 91 Session 14: Urbanisierung und Forstwirtschaft (nur Postersession) 00 Session 15: Wald als Restholzspeicher für die Bioökonomie .............................................. 96 Session 16: Kurzumtriebsplantagen und Agroforstsysteme als zusätzliche Quelle von Holzressourcen und Ökosystemdienstleistungen ..................................... 100 Session 17: Holzbasierte Produkte und Werkstoffe ........................................................... 105 Session 18: Nachhaltiges Bauen mit Laubholz .................................................................. 110 Session 19: Holz in der Bioökonomie: Old School oder Trendsetter? .............................. 114 Session 20: Aktuelle Entwicklungen bei Datenerfassung, Auswertung und Modellierung in der Forstwirtschaft ............................................................... 118 Session 22: Ableitungen aus Großrauminventuren für die Waldbewirtschaftung: die Bodenzustandserhebung Wald .................................................................. 128 Session 23: Forstliche Großrauminventuren als Impulsgeber für die Waldbewirt-
schaftung: Bundeswaldinventur & Co ............................................................ 136 Session 24: Welche Evidenzbasis hat und braucht die Naturgemäße Waldwirtschaft? ..... 144 Session 25: Large-area forest monitoring in international forest related processes ........... 151 Session 26: Potential and outlook for the German contribution to international forest science and forest practice .................................................................... 155 Session 27: Internationale und EU-waldrelevante Politiken: Perspektiven der Forstpolitikforschung ............................................................................... 159
Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle und gesellschaftlichem Anspruch .......................................................................... 166 Session 29: Marktverhalten von Holzanbietern: Ergebnisse von Befragungen,
Experimenten und agentenbasierter Modelle ................................................. 174
Poster Session 1: Baumarten im Klimawandel ........................................................................... 179 Session 2: Genetik der Gehölze im Klimawandel ........................................................... 188 Session 3: Forstliches Risikomanagement unter sich ändernden Umweltbedingungen....................................................................................... 194 Session 4: Auswirkungen von Extremwetterlagen auf Wälder: Schadensabschätzung und -bewertung ........................................................... 201 Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Kimawandel ....................................... 203 Session 6: Lichte Wälder ................................................................................................. 230 Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität ........................ 234 Session 8: Funktionelle Bedeutung von Totholz ............................................................. 240 Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtschafteten Wäldern ......... 242 Session 10: Nährstoffkreisläufe und Nährstoffverluste in naturnahen Waldökosystemen und Wirtschaftswäldern.................................................... 249 Session 11: Wasserbezogene Dienstleistungen des Waldes .............................................. 254 Session 12: Angepasste Forsttechnik als Voraussetzung für nachhaltige Forstwirtschaft ................................................................................................ 255 Session 13: Nutzungsintensität als Stellschraube zur Lösung von Zielkonflikten ............. 267 Session 14: Urbanisierung und Forstwirtschaft ................................................................. 270 Session 15: Wald als Restholzspeicher für die Bioökonomie ............................................ 276 Session 16: Kurzumtriebsplantagen und Agroforstsysteme als zusätzliche Quelle von Holzressourcen und Ökosystemdienstleistungen ..................................... 283 Session 17: Holzbasierte Produkte und Werkstoffe (nur Vorträge)000 Session 18: Nachhaltiges Bauen mit Laubholz .................................................................. 292 Session 19: Holz in der Bioökonomie: Old School oder Trendsetter? .............................. 294 Session 20: Aktuelle Entwicklungen bei Datenerfassung, Auswertung und Modellierung in der Forstwirtschaft ............................................................... 297 Session 22: Ableitungen aus Großrauminventuren für die Waldbewirtschaftung: die Bodenzustandserhebung Wald .................................................................. 308 Session 23: Forstliche Großrauminventuren als Impulsgeber für die Waldbewirt-
schaftung: Bundeswaldinventur & Co ............................................................ 310 Session 24: Welche Evidenzbasis hat und braucht die Naturgemäße Waldwirtschaft? (nur Vorträge) 00 Session 25: Large-area forest monitoring in international forest related processes ........... 312 Session 26: Potential and outlook for the German contribution to international forest science and forest practice .................................................................... 315
Session 27: Internationale und EU-waldrelevante Politiken: Perspektiven der Forstpolitikforschung (nur Vorträge) 000 Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle und gesellschaftlichem Anspruch .......................................................................... 318 Session 29: Marktverhalten von Holzanbietern: Ergebnisse von Befragungen
Experimenten und agentenbasierter Modelle (nur Vorträge)
Vorstellung des neuen Graduiertenkollegs an der Universität Freiburg „Erhaltung der Waldbiodiversität in vielfältig genutzten Landschaften Mitteleuropas (ConFoBi) ...... 324
Keynotes
1
Keynote 1
Evidence-informed forestry - just good practice?
Gillian Petrokofsky1
1Long-term Ecology & Resource Stewardship, Department of Zoology, University of Oxford, [email protected] Evidence is a much-used (and misused) word in policy and practice, and evidence-based movements have gained strength in many subjects in recent years, following decades of success in medicine. Systematic reviews, as powerful evidence synthesis tools, emerged in environmental conservation only a decade ago to address questions of great complexity, where many of the possible land management actions are controversial and/or expensive. In such cases it is vital that actions are informed by the best available evidence and not simply by the assertions or beliefs of special interest groups or even ill-defined 'experts'. The rigorous approach to evidence inclusion in systematic reviews often highlights deficiencies in primary research, such as badly-reported or missing methodological details, which result in substantial gaps in reliable knowledge available for decision-makers. Systematic reviews and systematic maps are central to the Evidence Based Forestry (EBF) initiative, which was launched in 2013 with funding by the UK’s Department for International Development and led by the Center for International Forestry Research (CIFOR) in collaboration with five partner research institutions: the World Agroforestry Centre, the French Agricultural Research Centre for International Development, the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center, the International Union of Forest Research Organizations, and the University of Oxford. These institutions have key roles in generating high quality evidence for policy processes in forestry and landscape management. After three years the initiative has undertaken 23 systematic reviews and systematic maps on a wide range of landscape management topics in developing countries. An important tenet of systematic reviews and maps is the involvement of stakeholders, which can be defined as broadly as ‘humans and their organisations involved in landscape dynamics’. Stakeholder engagement in reviews is necessarily somewhat limited. Taking this involvement a logical step forward, three crowd-sourcing projects are discussed that were undertaken to determine whether it is practical and useful to engage with greater numbers of such stakeholders to (i) prioritise a policy-relevant research agenda for forestry in the UK and Ireland- the "Top Ten Questions for Forestry" (T10Q), (ii) suggest high-priority questions for systematic reviews for forestry and land-use decision-making globally- the “Top 20 Questions for Forestry” (T20Q), and (iii) determine whether British private forest owners and managers are managing for resilience- the British Woodlands Surveys. Contrary to some early scepticism, there was more wisdom in these crowds than tyranny.
Keynotes 2
Keynote 2
Mögliche Folgen des Klimawandels für Wälder und deren Biodiversität
Thomas Hickler1
1Professor for Quantitative Biogeography, Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F) and Department of Physical Geography at Goethe-University Frankfurt, [email protected] Der Klimawandel bedingt für die Forstwirtschaft sowohl Chancen als auch Risiken. Bei einer mäßigen Erwärmung können in einigen Gebieten durchaus die Chancen überwiegen. Allerdings ist die große Spannbreite der Klimaprojektionen eine große Herausforderung. Allzu oft wurden Anpassungsstrategien anhand weniger Klimaprojektionen entwickelt, ohne die gesamte Spannbreite der möglichen Klimaentwicklung zu berücksichtigen. Eine engere Zusammenarbeit mit Klimamodellierern und eine Auseinandersetzung mit den Annahmen in Klimamodellen und der Unsicherheit in Bezug auf verschiedene Aspekte der Ergebnisse wäre deshalb sinnvoll. Beispielsweise kann keineswegs sicher davon ausgegangen werden, dass die Sommer in Zukunft überall in Deutschland trockener werden. Wegen der großen Spannbreite der Klimaprojektionen sollte Risikostreuung, d.h. keine einseitige Fokussierung auf bestimmte Arten oder Provenienzen, die Antwort sein. Natürliche Verjüngung bietet hierzu, in Verbindung mit Pflanzung von verschiedenen Baumarten und Provenienzen, die besten Voraussetzungen. Die Folgen einer extremeren Klimaveränderung, die zurzeit keineswegs ausgeschlossen werden kann bzw. von vielen Klimaforschern sogar als wahrscheinlich angesehen wird (global 2,5-4 Grad oder mehr Erwärmung), werden jedoch oft unterschätzt. Bei einer starken Klimaveränderung sind großflächige Verschiebungen der Vegetationszonen zu erwarten, für welche ich Beispiele in Zentraleuropa und global vorstellen werde. Bei einer solchen Erwärmung hätte die Gemeine Fichte vielerorts in Deutschland wohl kaum eine Zukunft, oder sie würde zumindest zu einem Hochrisikobaum werden. Für die Projektion von Klimafolgen steht zurzeit eine Vielzahl von Waldmodellen zur Verfügung, die sich in ihrem Aufbau und ihren Annahmen stark unterscheiden. Kein Modell kann jedoch die Wirklichkeit abbilden, sodass man die Ergebnisse solcher Modelle immer nur als einen Aspekt in die Entwicklung von Anpassungsstrategien einfließen lassen und sich dabei der spezifischen Modellannahmen bewusst sein sollte. Beispielsweise werden die möglichen pflanzenphysiologischen Effekte einer erhöhten CO2-Konzentration in der Atmosphäre in bestimmten Wissenschaftskreisen lebhaft diskutiert (geringere Transpiration bei Laubbäumen und erhöhte Photosynthese), während sie in der klassischen Forstwirtschaft eher weniger Beachtung finden. Ich werde den derzeitigen Wissenstand zur sogenannten „CO2-Düngung“ und Implikationen für die Interpretation von Modellergebnissen kurz zusammenfassend darlegen. Für die biologische Vielfalt in Wäldern kann der Klimawandel durchaus positive Effekte haben. Auch eine stärkere Nutzung unserer Wälder u.a. für Bioenergie, von Naturschützern oft verteufelt, kann sich positiv auf die Biodiversität und das Landschaftsbild auswirken, wenn dadurch Strukturvielfalt geschaffen wird.
Keynotes
3
Keynote 3
Nachhaltige Waldnutzung. Zur Bedeutung eines ökologischen Konzepts für die Forstwirtschaft
Eberhard Schockenhoff1
1Professor für Moraltheologie, Theologische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Der Vortrag stellt zunächst unterschiedliche Theorien der gegenwärtigen Umweltethik dar, in deren Rahmen der Auftrag der forstwirtschaftlichen Landschaftspflege und Wald-bewirtschaftung erörtert wird. Dabei macht er die Argumente stark, die für einen anthropozentrischen Ansatz, der die Verantwortung des Menschen für seine natürlichen Lebensbedingungen hervorhebt, gegenüber einem biozentrischen oder einem physiozentrischen Modell der ökologischen Ethik sprechen. Nach einem kurzen Zwischenblick auf die Enzyklika von Papst Franziskus 'Laudato si', die allgemein als eine starke politisch-moralische Unterstützung für das Anliegen des Weltklimagipfels von Paris gewertet wurde, erörtert der Vortrag aktuelle ethische und politische Kontroversen um die Fragen der Waldnutzung- und Bewirtschaftung. Dabei geht es um die Grundfrage, ob der Wald nur aus landschaftspädagogischen Gründen erhalten werden soll oder ob auch die Prinzipien einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung - auch um andere landschaftspflegerische Anliegen zu finanzieren - maßgeblich bleiben sollen.
Keynotes 4
Keynote 4
Future of European Forest-Based Sector
Lauri Hetemäki1,2
1Assistant Director, European Forest Institute (EFI), [email protected] 2Adjunct Professor, Faculty of Agriculture and Forestry, University of Helsinki A number of recent studies have indicated major structural changes taking place in the global forest products markets. The forest-based sector, particularly in Western Europe and North America, are facing perhaps the largest structural changes for more than a century, due to the combined effect of:
• the changing global competitive advantages, with a remarkable share of forest industry investments going to fast-growing markets in Asia and low-cost production regions such as South America
• the declining demand for communication paper products and stagnating demand for a number of other forest products in many OECD countries
• record long economic downturn, particularly in Western Europe, and its impacts on the structure of the forest products industries
• the emerging bioeconomy and new products and services that are expected to provide new opportunities and diversify the industry
Given these trends, the forest-based sector can be said to be in a phase of ‘creative destruction’. This implies that some economic activities or sectors are declining, and maybe eventually vanishing, while at the same time, new technologies, products and business models are emerging. These types of changes may take place in market economies constantly, yet the scale and intensity of the forest sector trends in the 2000s seem exceptional, when compared to the trends of the past century.
The keynote illustrates what these changes more precisely are, and how they are likely to impact the European forest-based bioeconomy development in the coming decade or so. The purpose of the keynote is to provide an overview on how the European forest-based bioeconomy development in changing, and give an outlook for the coming decade or so. In addition, it will analyse the implications of the ongoing structural changes on research, by comparing the needs for further research efforts and to which direction current research is headed.
Keynotes
5
Keynote 5
Biodiversität im Wandel – Big Questions, Big Problems, Big Data
Holger Kreft1
1 Professor und Leiter der Arbeitsgruppe Biodiversität, Makroökologie und Biogeographie, Georg-August-Universität Göttingen, [email protected] Die biologische Vielfalt unseres Planeten ist weltweit einem rasanten Wandel unterworfen. Viele Arten und Ökosysteme sowie deren Funktionen und Dienstleistungen sind gefährdet. Der Verlust von Lebensraum sowie großräumigen Änderungen der biotischen und abiotischen Umwelt (z.B. durch gebietsfremde Arten oder Stoffeinträge) führen zu zum Teil unumkehrbaren Veränderungen. Der Druck auf Biodiversität wächst - angetrieben durch eine wachsende Weltbevölkerung und einen steigenden Pro-Kopf-Verbrauch - fortlaufend. Geschwindigkeit und Ausmaß dieses Wandels sowie die möglichen negativen Konsequenzen für die Menschheit stehen in erheblichem Gegensatz zu dem, was wir über Biodiversität wissen. Viele zentrale Fragen der Biodiversitätsforschung bleiben unbeantwortet: Wie viele Arten gibt es auf unserem Planeten? Wie ist Biodiversität verteilt? Welche Faktoren steuern Biodiversität? Wie beeinflusst der Mensch die Biodiversität? Die Beantwortung dieser Fragen erfordert einen Ansatz, der den räumlichen und zeitlichen Horizont einer einzelnen ökologischen Feldstudie bei Weitem übersteigt. In den letzten Jahren ist ‚Big Data‘ zu einem Schlagwort und einem neuen Paradigma in der Ökologie und Biodiversitätsforschung geworden. Die Mobilisierung und Aggregation von Biodiversitätsdaten in globalen Datenbanken, wachsende Computerleistung, effiziente Algorithmen und statistischen Analyseverfahren aber auch Metaanalysen, Fernerkundung und konzertierte Datenaufnahmen in großen Forschungsverbünden stehen für neuartige Big Data-Ansätze in der Ökologie. Der Vortrag gibt einen Überblick über das wachsende Feld Big Data Ecology und ergründet kritisch, welche Beiträge zu den großen Fragen der Ökologie zu erwarten sind.
Vorträge Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel
7
Untersuchung des 1961 angelegten Douglasien-Provenienzversuch im Revier Kranichfeld (Thüringen) unter ertragskundlichen und
dendrochronologischen Aspekten
Christin Carl1, Anka Nicke2 und Gottfried Jetschke 3
1Fachhochschule Erfurt, Leipziger Straße 77, 99085 Erfurt, [email protected] 2Fachhochschule Erfurt, Leipziger Straße 77, 99085 Erfurt, [email protected] 3Universität Jena, Dornburger Straße 159, 07743 Jena, [email protected] Schlagworte: Douglasie, Provenienzversuch 1961, Dendrochronlogie Ist die Douglasie (Pseudotsuga menziesii) ein Exot oder ist sie eine wichtige Alternativlösung im Hinblick auf den Klimawandel? Dass die Douglasie als Alternativlösung herangezogen wird, zeigen große bundesweite Verbundprojekte, wie „FitForClim“. Bei der Flächensuche für dieses Projekt stieß ThüringenForst auf die 1961 angelegte Douglasien-Versuchsfläche im Revier Kranichfeld. 26 verschieden Provenienzen aus Kanada, Washington und Oregon, sowohl Küsten- als auch Inlandsprovenienzen, stocken auf dieser Fläche. Für die Analyse dienen zum einen die ertragskundlichen Untersuchungen als Basis für die Plusbaumauswahl (FitForClim). Zum anderen zeigen die dendrochronologischen Untersuchungen die Reaktionen der einzelnen Provenienzen auf das lokale Klima. Wenn die Provenienzen aufgrund der ertragskundlichen Untersuchungen als besonders vital eingestuft werden, weisen diese Provenienzen dann zudem eine höhere Vitalität in Bezug auf extreme Witterungsereignisse (Weiserjahre) auf? In diesem Vortrag werden die Waldwachstumskunde und die Klimachronologie der Douglasie zum ersten Mal in Thüringen zusammen dargestellt. Darüber hinaus werden die Wuchseigenschaften und die klimatischen Bedingungen von Pseudotsuga menziesii in der nordamerikanischen Heimat vergleichend herangezogen. Die Ergebnisse zeigen die Dominanz der Küstenherkünfte aus Washington und Oregon, sowohl in der Höhe, im Durchmesser und in Bezug auf die Dendrochronolgie. Die klimatischen Bedingungen in Nordamerika sind bei den Provenienzen aus Kanada, die das geringste Wachstum aufweisen, nahezu identisch mit den klimatischen Bedingungen in Kranichfeld. Dem gegenüber finden die dominanten Küstenprovenienzen aus Washington und Oregon in ihrer Heimat deutlich höhere Niederschläge und höhere Temperaturen vor. Zudem weist das gesamte Kollektiv der Douglasie andere Reaktionen auf extreme Witterungsereignisse, als die einheimischen Baumarten, auf. Pseudotsuga menziesii hat kein „Gedächtnis“ und reagiert im selben Jahr auf konvektive Veränderungen in der Erdatmosphäre. Diese Ergebnisse sind die Basis um das Wissen zur Douglasie zu erweitern und der forstlichen Praxis bei den Entscheidungsfindungen zu helfen. Wenn die Douglasie (Pseudotsuga menziesii), vor allem im Zuge des Klimawandels, an Bedeutung für die Wirtschaftswälder in Thüringen und Deutschland gewinnt, sollten Ergebnisse solcher wertvollen, schon frühzeitig angelegten Versuchsanlagen in die Saat-/ Pflanzgutüberlegungen mit einfließen!
Vorträge Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel 8
Rein- und Mischbestände von Fichte, Buche und Douglasie auf gleichem Standort: Vergleichende Analyse von Kennwerten der
Bodenfruchtbarkeit, Sickerwasserchemismus und Waldernährungszustand
Jörg Prietzel1 und Maike Cremer2
1TU München, Lehrstuhl für Bodenkunde, Emil-Ramann-Str. 2, 85354 Freising, [email protected] 2TU München, Lehrstuhl für Bodenkunde, Emil-Ramann-Str. 2, 85354 Freising, [email protected] Schlagworte: Baumarteneffekt, Mischungseffekt, Bodenfruchtbarkeit, Sickerwasserchemie Angesichts der in weiten Teilen Deutschlands zunehmenden Labilität von Fichtenreinbeständen werden diese Bestände vielerorts in Mischbestände mit Laubholz, insbesondere Buche, umgewandelt. Desweiteren wird die raschwüchsige, gegenüber Sommertrockenheit weniger anfällige Douglasie für Waldbesitzer zunehmend attraktiv. Auch hier wird aus naturschutzfachlichen und Waldschutzaspekten die Begründung von Mischbeständen mit Buche empfohlen. Neben Stabilitätsaspekten sprechen auch potentielle Synergieeffekte (Nutzung unterschiedlicher Ressourcen) sowie die mögliche Abmilderung nachteiliger ökologischer Effekte von Nadelholzreinbeständen (Bodenversauerung; Nitrat im Bodensickerwasser) für Mischbestände von Fichte oder Douglasie mit Buche. Im Gegensatz zu Fichten-Buchen-Mischbeständen existieren allerdings für Buchen-Douglasien-Mischbestände keinerlei einschlägige Daten.
Wir untersuchten für drei Standorte in Bayern (Spessart, Oberschwaben, Münchner Schotterebene) wichtige Kenngrößen der Bodenfruchtbarkeit (Gehalte und Vorräte an Humus, Stickstoff und austauschbaren Basenkationen), den Sickerwasserchemismus sowie den Ernährungszustand aneinander angrenzender Rein- und Mischbestände von Buche, Fichte und Douglasie. Für alle Standorte zeigte sich, dass Douglasien-Reinbestände den Oberboden relativ zu Buchenreinbeständen weniger versauern und an austauschbaren Kationen verarmen als Fichtenreinbestände. Gleiches gilt für Nadelholz-Buchen-Mischbestände im Vergleich zu Nadelholzreinbeständen; dabei versauern Buchen-Douglasien-Mischbestände den Oberboden weniger als Buchen-Fichten-Mischbestände. Im Unterboden waren keine Baumarteneffekte nachweisbar. Auch Baumarteneffekte auf die Bodenhumus- und Stickstoffausstattung beschränkten sich auf den Oberboden. An allen Standorten waren die Boden-C- und N-Vorräte unter den Nadelholz-Buchen-Mischbeständen und v.a. unter den Nadelholzrein-beständen höher (Fi > Dgl) als unter reiner Buche. Auf den reichen Standorten in Südbayern war unter den Nadelholzreinbeständen die Nitratkonzentration im Sickerwasser relativ zur Buche deutlich, unter den Mischbeständen mäßig erhöht. Unsere Ergebnisse bestätigen die positive Wirkung einer Beimischung von Buche zu Fichte auf wichtige Kenngrößen der Bodenfruchtbarkeit relativ zu Fichten-Reinbeständen. Zusätzlich konnte erstmals gezeigt werden, dass Douglasien-Buchen-Mischbestände hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf diese Kenngrößen positiver zu bewerten sind als Fichten-Buchen-Mischbestände.
Vorträge Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel
9
Die Buche im Klimawandel: Rezente Zuwachsrückgänge in Nord- und Mitteldeutschland und Mechanismen der Trockenstressantwort
Christoph Leuschner1, Jorma Zimmermann, Florian Knutzen
1Pflanzenökologie, Universität Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Dendrochronologie, Niederschlagstransekte, Trockenheit, C-Allokation
Dendrochronologische Untersuchungen in Buchenrein- und mischbeständen im Ostharz und in der Lüneburger Heide zeigen, dass herrschende Buchen seit den 1970er bis 1980er Jahren verbreitet von langfristigen Zuwachsrückgängen betroffen sind, wenn die Jahresniederschläge unter etwa 650 mm bzw. die Sommerniederschläge (April – September) unter 350 mm liegen. Untersuchungen entlang von Niederschlagsgradienten erlauben es, diese Schwellenwerte relativ präzise zu definieren. Die Rückgänge korrespondieren mit abnehmenden Niederschlägen im Hochsommer sowie steigenden Sommertemperaturen in den letzten Dekaden. Warme und trockene Sommer könnten den radialen Holzzuwachs jedoch auch indirekt über veränderte Kohlenstoffallokation im Baum beeinflussen: Negative Weiserjahre waren in vielen Fällen auch Mastjahre der Buche. Strahlungsreiche und trockene Hochsommer sind entscheidende Auslöser einer Vollmast im folgenden Jahr, nicht dagegen Trockenheit. Trotz eines erheblichen Anpassungspotenzials der Buche auf der Ebene der C-Allokation und der hydraulischen Architektur erreicht Fagus im norddeutschen Tiefland eine vitalitätsmindernde Trockengrenze, die mit dem Klimawandel an Bedeutung gewinnen dürfte und in der Anbauplanung Berücksichtigung finden sollte.
Vorträge Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel 10
Cavitation fatigue? – Effects of repeated drought stress on Fagus
sylvatica and Picea abies
Benjamin Hesse, Martina Tomasella, Christian Blanck, Rainer Matyssek, Karl-Heinz Häberle1
1Lehrstuhl für Ökophysiologie der Pflanzen, Technische Universität München, 85350 Freising-Weihenstephan, [email protected]
Schlagworte: Fagus sylvatica, Picea abies, xylem vulnerability, repeated drought stress
Longer, more intense, and probably annually occuring drought periods are predicted for Central Europe in the next decades. The vulnerability of the xylem is a crucial trait of forest tree species to survive severe drought stress. There are findings that the xylem vulnerability of affected trees will increase due to repeated drought events (“cavitation fatigue”). This hypothesis had been tested in potted seedlings of Norway spruce and European beech in a greenhouse experiment (tree’n’ing, IGSSE water). Two treatments in 2014 (well-watered control and drought stressed) were split each into another two groups in 2015, resulting into four different treatments (CC, CD, DC and DD). The reactions of the trees were documented by measurements of the percentage loss of wood conductivity (PLC), predawn and minimum leaf water potential and the maximum specific hydraulic conductivity throughout the experiment and the following recovery period. Additionally, anatomical xylem traits of the different treatment groups were analyzed at the final harvest. In neither of the two species cavitation fatigue was observed. In contrary, in both species plants exposed to repeated drought stress seemed to perform better than the plants exposed to drought for the first time. Regarding spruce, both drought stressed groups of the second year did not differ in any of the analyzed parameters (no drought adaptation) and recovered within one week after rewatering. Regarding beech, there was a tendency towards less and smaller vessels built in the wood in the year following drought stress interpreted as anatomical drought adaptation. However, in beech loss of conductivity was irreversible and the seedlings did not survive. The results of the greenhouse experiment are compared with new findings (2016) from a rainfall exclusion experiment with mature trees of the same tree species in a forest stand (KROOF) and are discussed with respect to the future perspectives of these species.
Vorträge Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel
11
Modellierung der klimatischen Standorteignung forstlich relevanter Baumarten
Ulrike Märkel1, Klara Dolos2, Fabian Faßnacht3 und Sebastian Schmidtlein4
1Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Geographie und Geoökologie, Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe, [email protected]
2Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Geographie und Geoökologie, Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe, [email protected]
3Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Geographie und Geoökologie, Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe, [email protected]
4Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Geographie und Geoökologie, Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe, [email protected] Schlagworte: Standorteignung, Klimawandel, Artverbreitung, Wachstum
In Anbetracht der erwarteten Klimaveränderung haben Forstpraktiker die schwierige Aufgabe, einzuschätzen, welche Baumarten nicht nur aktuell sondern auch in Zukunft für die jeweiligen Standorte geeignet sein werden. Mithilfe von klimaabhängigen Modellen, die verschiedene walddynamische Prozesse berücksichtigen, können diese Einschätzungen unterstützt werden. Die Artverbreitung spiegelt das Zusammenspiel aller demographischer Prozesse, einschließlich der Etablierung, wider. Jedoch ist die Baumartenverbreitung in Mitteleuropa stark von menschlichem Wirtschaften überprägt, was bei einer ökologischen Interpretation zu verfälschten Rückschlüssen führen kann. Prognosen von Artverbreitungsmodellen werden zurzeit vor allem als Hinweis auf Risiko und weniger auf die Produktivität eines Standortes interpretiert. Das Wachstum bzw. die Produktivität einer Baumart gibt ebenfalls einen wichtigen Hinweis auf die Standorteignung. Ein klimaabhängiges Wachstumsmodell dient daher als Proxy für Produktivität und wird anstatt statischer Ertragstafeln genutzt. Beide Informationen zusammen, die jeweils einen eigenen Aspekt der Standorteignung darstellen, können zu einer kombinierten Ableitung der Standorteignung beitragen. Auf Basis der Bundeswaldinventurdaten wurden Modelle für Baumwachstum und Artverbreitung für die sechs häufigsten Baumarten in Deutschland entwickelt. In einem weiterführenden Schritt wurde aus der Artverbreitung und dem Wachstum eine kombinierte Standorteignung abgeleitet. Auf der Grundlage dieser Modellansätze wurden Szenarien für die Veränderung von Wachstum und Artverbreitung unter zukünftigen Klimabedingungen erstellt. Dieser Ansatz geht wegen seiner gleichzeitigen Berücksichtigung von Risiko und Produktivität bei der Einordnung der Standorteignung über bestehende Verfahren zur Bestimmung der aktuellen und zukünftigen Standorteignung von Baumarten hinaus und liefert einen Beitrag zur Sicherung der nachhaltigen Forstwirtschaft. Die Ergebnisse können bei waldbaulichen Planungen als unterstützende Entscheidungshilfe genutzt werden. Durch die Modellierung der einzelnen Prozesse mit verschiedenen Ansätzen unter der Nutzung des umfassenden Datensatzes der Bundeswaldinventuren trägt diese Studie zum Verständnis der Ökologie der deutschen (Wirtschafts-)Wälder bei.
Vorträge Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel 12
Bestandesstruktur und Bodenwasserhaushalt zweischichtiger Kiefernbestände
Hans Küchenmeister1, und Sven Martens2
1Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e.V., Brauhausweg 2, 03238, Finsterwalde, [email protected] 2Staatsbetrieb Sachsenforst, Bonnewitzer Straße 34, 01796 Pirna OT Graupa, [email protected]
Schlagworte: pleistozäne Sandböden, Schirmdichte, Wasserverfügbarkeit, Anbauwürdigkeit
Das pleistozäne Tiefland im Norden Sachsens und im Süden Brandenburgs gehört zu den trockensten Regionen Deutschlands. Die hier vorherrschenden Kiefernreinbestände sollen entsprechend der Ausprägung von Relief und Boden durch naturnähere Laub- bzw. Mischwälder ersetzt werden, um insbesondere gegebene Waldschutzrisiken zu mindern. Der beim Umbau favorisierte Voranbau verspricht günstige verjüngungsökologische Bedingungen und einen anhaltenden Wertzuwachs des Kiefernschirms. Mit Blick auf die limitierte Wasserverfügbarkeit vieler Standorte ist die waldbauliche Steuerung der Konkurrenzverhältnisse zweischichtiger Bestandesstrukturen erfolgsbestimmend. In einem Forschungsvorhaben wird aktuell die Etablierung jetzt 18-26 Jahre alter Traubeneichen, Rotbuchen, Roteichen, Winterlinden und Hainbuchen auf sechs Versuchsflächen verglichen, die sich hinsichtlich Schirmdichten, Nachlichtungsregime und Standortsverhältnissen unterscheiden. Ziel ist es, die Wirkung des Kiefernschirmes und der ermittelten bodenphysikalischen und bodenchemischen Kenngrößen auf den Unterstand zu quantifizieren. In einem nächsten Schritt soll die, sich unter den gegebenen Witterungs- und Boden-bedingungen, sowie nicht zuletzt auch der Bestockungsstruktur, ergebende Verdunstung und Wasserverfügbarkeit bilanziert werden. Hierfür werden: (1) über eine Kombination unterschiedlicher Verfahren der Blattflächenindex für die zweischichtigen Bestände hergeleitet und mit ertragskundlichen Kenngrößen in Verbindung gesetzt und (2) das Wasserhaushaltsmodell COUPMODEL anhand langjähriger Messreihen von Bodenwasserparametern kalibriert und der Wasserhaushalt simuliert. Neben den unterschiedlichen Etablierungsgraden weisen insbesondere die 2006 beobachteten Trockenstresssymptome auf Grenzbereiche für den Anbau dieser Baumarten auf armen bis ziemlich armen, trockenen Standorten hin. Zudem können die beobachteten Bedingungen des Bodenwasserhaushaltes vereinzelt auch auf weitere Baumarten, die in den Versuchen angebaut wurden, so Berg- und Spitzahorn, Douglasie, Küstentanne, Mehlbeere, Elsbeere, Vogelkirsche, übertragen werden. So weist gerade die ausbleibende Etablierung anspruchsvollerer Baumarten auf Grenzwerte der Anbaueignung hin. Dagegen unterstützen die aufgestellten Wasserhaushaltsmodelle vor allem die waldbauliche Bewertung der Verjüngungsverfahren, wenn sich die ohnehin prekäre Wasserversorgung in absehbarer Zeit weiter verschlechtert.
Vorträge Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel
13
Einzelbaumbasierte, standort- und behandlungssensitive Überlebenszeitmodelle für Fichte, Kiefer, Buche und Eiche
Sebastian Schoneberg1 und Matthias Schmidt1
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Abteilung Waldwachtum, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Risikomodellierung, Klimasensitiv, Einzelbaumebene, generalisiertes lineares Regressionsmodell
Eine nachhaltige und multifunktionale Forstwirtschaft erfordert eine realistische Prognose der Waldentwicklung. Als wichtige, für die Waldentwicklung bestimmende Faktoren lassen sich unter anderem abiotische und biotische Risiken unterscheiden. Die Risikoeinschätzung ist schwierig abzubilden. Dies ist sowohl mit dem hohen Anteil stochastischer Komponenten als auch in der eingeschränkten Verfügbarkeit geeigneter Parametrisierungsdaten begründet. Die Erfassung standortbedingter Risiken gewinnt aktuell dadurch an Bedeutung, dass sich nicht nur das Waldwachstum sondern auch die Risiken als Folge des Klimawandels verändern werden. Der projizierte Klimawandel ist im Vergleich zu den langen forstlichen Produktionszeiträumen relativ dynamisch. Daraus folgt, dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt Maßnahmen berücksichtigt werden müssen, um zukünftige Risiken durch eine Klimaveränderung zu minimieren. Datengrundlage sind Stichprobenpunkte der Waldzustandserhebung (WZE) der Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Hessen. Ein Vorteil dieses relativ großen Gebietes ist, dass viele Kombinationen an prognostizierten Standortseigenschaften bereits enthalten sind. Hierdurch verringert sich der Anteil für den bei prognostizieren Klimaszenarien extrapoliert werden muss erheblich. Die WZE weist gegenüber anderen forstlichen Inventuren den Vorteil kürzerer Inventurintervalle auf, da die Stichprobenpunkte in vielen Fällen jährlich erfasst werden. Eine hohe zeitliche Auflösung ist die Voraussetzung für eine möglichst genaue Erfassung von risikobedingten Ausfällen und deren Ursachen Für die Einschätzung wichtiger biotischer und abiotischer Risiken werden baumartenspezifische, standort- und behandlungssensitive Überlebenszeitmodelle auf Einzelbaumebene entwickelt. Nur die gleichzeitige Betrachtung aller Faktoren wie der Baumart, der Dendrometrie sowie von Standorteffekten ermöglicht dabei die Ableitung stabiler und plausibler Modelleffekte. Der Einzelbaumansatz bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Risiken für unterschiedlich strukturierte und gemischte Bestände zu schätzen. Methodisch werden diese Modelle durch generalisierte lineare und cox-hazard Modelle mit zeitveränderlichen Kovariablen, nicht linearen Modelleffekten sowie Zufallseffekten realisiert. Ein Schwerpunkt stellt die Modellierung der Autokorrelationen, zwischen Risiken dar.
Vorträge Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel 14
Baumarteneignung unter Klimawandel in Baden-Württemberg: Modellierungsgrundlagen
Axel Albrecht1, Konstantin v. Teuffel1
1FVA Baden-Württemberg, Wonnhaldestr. 4, 79100 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Artenverbreitung, Mortalität, Wachstumstrends, Modellierungsebenen
Dies ist der zweite von zwei Teilbeiträgen zum Thema Baumarteneignung unter Klimawandel in Baden-Württemberg und bezieht sich überwiegend auf Projekte an der FVA Baden-Württemberg. Als naturwissenschaftlicher Fachvortrag befasst er sich mit den Modellierungsgrundlagen und Techniken, die die verschiedenen Aspekte der Baumarteneignung quantitativ abbilden. Die wesentlichen vorgestellten Teilaspekte der zu dynamisierenden Baumarteneignung sind der Wasserhaushalt, die Baumartenartenverbreitung, klimawandelbedingte Mortalitätsrisiken und Wachstums- und Produktivitätstrends. Dabei wird auf das Verhältnis zwischen klimadynamischen und statischen standortskundlichen Parametern eingegangen und wie diese als einzelne fachliche Layer in die aggregierte Baumarteneignung einfließen. Neben der Aggregationsebene „Baumarteneignung“ wird auch auf die Ebene der klimawandelbedingten Vulnerabilität von Waldökosystemen eingegangen, was eine etwas andere Sichtweise auf das Thema Baumarteneignung und Baumartenwahl liefert. Es werden nicht nur die bisherigen Ergebnisse der Klimafolgenforschung sondern auch die laufenden Projekte und noch in Angriff zu nehmende Arbeiten präsentiert.
Vorträge Session 2: Genetik der Gehölze im Klimawandel
15
Genetische Untersuchungen wichtiger Baumarten in den Randgebieten der natürlichen Verbreitung
Monika Konnert1, Eva Cremer1und Barbara Fussi1
1Bayerisches Amt für forstliche Saat- u. Pflanzenzucht (ASP), Forstamtsplatz 1, 83317 Teisendorf, [email protected]
Schlagworte: Genetische Diversität, Randgebiete, Hauptbaumarten
In einem Forschungsvorhaben zur „Spezifizierung der Schwellenwerte für den klimagerechten Anbau von Waldbaumarten durch die Untersuchung von marginalen Vorkommen“ wurden auch genetische Aspekte berücksichtigt. Dafür wurden 48 Populationen der Weißtanne (Abies alba), Buche (Fagus sylvatica), Fichte (Picea abies), Kiefer (Pinus sylvestris) und Traubeneiche (Quercus petraea) aus den Randgebieten der natürlichen Verbreitung genetisch untersucht. Die Ergebnisse wurden verglichen mit denen weiterer Populationen aus dem europäischen Verbreitungsgebiet, um sie in einen breiteren europäischen Kontext einordnen zu können. Bei allen fünf Baumarten sind die Herkünfte von der Iberischen Halbinsel (Spanien) genetisch am wenigsten variabel und setzen sich je nach Baumart mehr oder weniger deutlich von den anderen Herkünften ab. Andererseits haben die osteuropäischen Herkünfte aus Rumänien und Bulgarien im Allgemeinen eine höhere Vielfalt und Diversität und bilden auch aufgrund ihrer genetischen Strukturen eine eigenständige Gruppe. Am ausgeprägtesten ist dieses Muster bei Weißtanne und Buche. Damit werden die vor allem durch die Rückwanderungsgeschichte bestimmten genetischen Variationsmuster der fünf Baumarten in ihrem Verbreitungsgebiet durch diese Untersuchungen bestätigt. Auch die Populationen aus den Randgebieten fügen sich in dieses Muster. Bei der genetischen Vielfalt und Diversität als Maße für die genetische Variation innerhalb der Populationen, sind die Unterschiede zwischen den Randpopulationen und den Populationen im Optimum der Verbreitung relativ gering. Bei Fichte und Kiefer wurde aber eine geringere genetische Variabilität vor allem am südwestlichen Rand der natürlichen Verbreitung festgestellt.
Vorträge Session 2: Genetik der Gehölze im Klimawandel 16
Genetische Variation der Trockenstressreaktion von Koniferen: wie groß ist das Potenzial für Züchtung und lokale Anpassung?
Silvio Schüler1, Jan-Peter George1, Sandra Karanitsch-Ackerl2, Konrad Mayer2, Raphael T. Klumpp3, Michael Grabner2
1Institut für Waldgenetik, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Wien, Österreich, E-Mail: [email protected] 2Institut für Holztechnologie und Nachwachsende Rohstoffe, Universität für Bodenkultur Wien, Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln an der Donau, Österreich, E-Mail: [email protected] 3Institut für Waldbau, Universität für Bodenkultur Wien, Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien, Österreich
Schlagworte: Trockenstress, genetische Variation, Nadelbäume, Anpassung
Die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald werden nicht nur durch höhere Temperaturen bestimmt, sondern vor allem durch die Zunahme an klimatischen Extremereignissen, wie zum Beispiel Trockenperioden. Wie die vergangenen Jahrzehnte gezeigt haben, sind Nadelbaumarten von derartigen Ereignissen besonders betroffen. Aufgrund der weiten geographischen Verbreitung der Arten und ihrem Vorkommen in unterschiedlichen Klimazonen kann allerdings davon ausgegangen werden, dass die meisten Arten lokale Anpassungen an Trockenstressereignisse und eine innerartliche genetische Variation der Stressreaktion aufweisen. Zur Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel durch Züchtungsmaßnahmen oder den Transfer von besser geeignetem Saatgut ist daher ein besseres Verständnis der genetischen Variation und ihrer geographischen Verbreitung unverzichtbar. In der hier vorgestellten Studie wurde die genetische Variation der Trockenstressreaktion von Fichte, Weißtanne, Lärche und Douglasie in vier Herkunftsversuchen im Osten Österreichs untersucht. Der Nordosten Österreichs ist gekennzeichnet durch ein kontinental geprägtes, pannonisches Klima mit warmen Sommern, geringen Niederschlägen und häufigen Trockenperioden. Seit den 1970er Jahren wurden in dieser Region zahlreiche Herkunftsversuche angelegt, die seitdem mehrere intensive Trockenperioden erlebt haben. Für die vorliegende Arbeit wurden für jede Baumart 9-16 Herkünfte mit 10-30 Bäumen pro Herkunft mittels Röntgendensitometrie untersucht und der Wachstumverlauf vor, während und nach drei intensiven Trockenperioden charakterisiert. Nach dem „standardized precipitation index“ SPI müssen die Trockenereignisse von 1993/94, 2000 und 2003 als schwere bis extreme Trockenheiten eingeschätzt werden. Von den vier Baumarten zeigt die Douglasie die mit Abstand höchste Resistenz und die Weißtanne die höchste Recovery nach den Trockenereignissen. Fichte und Lärche weisen die höchste Variation zwischen den Herkünften und Stabilität auf, während die Herkünfte der Douglasie nur geringe Unterschiede zeigen. Der Grad der genetischen Bestimmtheit variiert signifikant zwischen Herkünften und Arten, wobei die Trockenreaktion der meisten Herkünfte keine oder nur sehr geringe genetische Bestimmtheit aufweisen und andere Herkünfte eine sehr hohe Bestimmtheit. Schlussfolgerung: die genetische Variation von Fichte und Lärche ist höher als die von Douglasie und Weißtanne und kann als Grundlage für gezielte Anpassungsmaßnahmen genutzt werden.
Vorträge Session 2: Genetik der Gehölze im Klimawandel
17
Klimabasierte Verwendungszonen für züchterisch verbessertes Vermehrungsgut der Douglasie
Katharina Liepe1 und Mirko Liesebach1
1Thünen Institut für Forstgenetik, Sieker Landstraße 2, 22927 Großhansdorf, [email protected]
Schlagworte: Douglasie, Klima, Verwendungszonen, Züchtung
Für die Begründung zukünftiger Baumgenerationen ist die Anpassungsfähigkeit an klimatische Verhältnisse von großer Bedeutung. Forstliches Vermehrungsgut sollte eine hohe genetische Vielfalt aufweisen um bei Saat oder Pflanzung Waldproduktivität und –gesundheit zu gewährleisten. Voraussetzung dafür ist die Kenntnis der Ausprägung unterschiedlicher Genotypen, sowie der treibenden klimatischen Faktoren, welche über lange Zeiträume hinweg maßgeblich zur lokalen Anpassung beigetragen haben. Aufgrund klimatischer und standörtlicher Verhältnisse sind in der Vergangenheit Herkunftsgebiete für die Erzeugung forstlichen Vermehrungsgutes ausgewiesen worden. In Zukunft soll durch züchterische Verbesserung Vermehrungsgut erzeugt werden, welches für größere Regionen geeignet ist. Dafür werden gezielt Genotypen gesucht, ausgewählt und auf Versuchsflächen getestet. Die Douglasie (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) ist in Deutschland mittlerweile zu einer wichtigen Wirtschaftsbaumart geworden. Aufgrund höherer Trockenheitstoleranz im Vergleich zur Fichte sowie der Möglichkeit einer erfolgreichen Mischung mit Buche, eignet sie sich besonders als Ersatzbaumart im sich ändernden Klima. Bezüglich der Anpassung nimmt sie eine Sonderstellung ein, da sie erst im 18. Jahrhundert in Europa eingeführt wurde. Die Auswirkungen langfristiger Anpassungsprozesse konnten daher nur eingeschränkt beobachtet werden. Die Ausweisung von Verwendungszonen für Zuchtmaterial orientiert sich deshalb primär an klimatischen Unterschieden. Biologisch relevante Klimadaten wurden mittels einer Hauptkomponentenanalyse (eng. Principal Component Analysis) in unabhängige Dimensionen zusammengefasst. In einem Klusteransatz wurden diese anschließend in vier klimatisch relativ homogene geographische Regionen - die Verwendungszonen - gegliedert. Zu ihrer baumartenspezifischen Validierung dienten auf Versuchsflächen beobachtete Unterschiede in Wachstum und Resistenzen. Aufgabe des Projektes FitForClim ist die Erzeugung von züchterisch verbessertem Vermehrungsgut für großräumige Verwendungszonen. Auf deutschlandweit vorhandenen Versuchsflächen wird eine wuchs- und qualitätsorientierte Auswahl von Plusbäumen durchgeführt. Durch ihre vegetative Vermehrung wird die Grundlage für Klonarchive und Samenplantagen geschaffen. Eine Anpassung der Verwendungszonen an prognostizierte Klimaänderungen sollte weiterhin möglich sein.
Vorträge Session 2: Genetik der Gehölze im Klimawandel 18
Eine Chance für die Fichte – hochwertig, leistungsfähig, nachgefragt
Katharina Volmer1
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Abt. Waldgenressourcen, Prof.-Oelkers-Str. 6, 34346 Hann. Münden, Email: [email protected]
Schlagworte: Vermehrungsgut, Klimawandel, Fichte, Züchtung
Nachhaltig, regional, schnellwüchsig, keine universelle Substituierbarkeit, alle diese Aspekte machen die Fichte zu einer der ökonomisch bedeutsamsten Baumarten der deutschen Forstwirtschaft. Dabei spaltet die Fichte wie keine andere Baumart die Meinungen in der Fachwelt. Für die einen bildet sie die ökonomische Basis für die anderen ist sie ökologisch unhaltbar, unnatürlich und zu klimasensitiv. Um auch unter sich ändernden Klimabedingungen auf für den Fichtenanbau geeigneten Standorten qualitativ hochwertiges Fichtenholz regional und nachhaltig zu erzeugen, bedarf es vitaler Bäume mit hohem Anpassungspotenzial. Diese Bäume zu finden und für die Forstpflanzenzüchtung zu nutzen, ist eines der Ziele des deutschlandweiten Verbundprojekts FitForClim. Insbesondere die Fichte mit Daten aus 60 Jahren Versuchswesen im Bereich Züchtung, besitzt hierfür eine einzigartige Selektionsgrundlage. Die züchterische Bearbeitung von Waldbäumen liegt in Deutschland bisher weit hinter vielen anderen Ländern. Durch die Zusammenarbeit von vier Züchtungseinrichtungen Deutschlands (Sachsenforst – SBS, Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht – ASP, Thünen Institut für Forstgenetik und Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt – NW-FVA) kann auf eine umfangreiche Datensammlung und ein großes genetisches Potenzial zugegriffen werden. Neben der Erzeugung von vitalem und anpassungsfähigem Vermehrungsmaterial ist eine überdurchschnittliche Wuchsleistung ein wichtiges Selektionskriterium. Durch ein Zusammenspiel von hochwertigem Vermehrungsgut und Anbauempfehlungen für spezifische standörtliche und klimatische Verhältnisse kann mittels dynamisierter Verwendungszonen flexibel auf eingetretene oder erwartete Umweltänderungen reagiert werden. Zur Sicherung einer hochwertigen und auch für die stoffliche Nutzung geeigneten Rohstoffversorgung zukünftiger Generationen benötigen wir schon heute vitale, leistungsstarke und in hohem Maße anpassungsfähige Bestände. Für die Begründung dieser Bestände mittelfristig Vermehrungsgut von nachhaltiger Qualität und Vitalität bereitzustellen ist das Ziel des Verbundprojekts FitForClim.
Vorträge Session 2: Genetik der Gehölze im Klimawandel
19
Zur Variation von anpassungsrelevanten Merkmalen der abiotischen Resistenz zwischen Klonen und Nachkommenschaften der Pappel,
Lärche, Douglasie und Fichte
Heino Wolf1, Maria del Carmen Dacasa-Rüdinger1, Kai-Uwe Hartmann1, Marek Schildbach1, Andre Zeibig1
1 Staatsbetrieb Sachsenforst, Kompetenzzentrum für Wald und Forstwirtschaft, Referat Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung, Bonnewitzer Str. 34, D-01796 Pirna OT Graupa, [email protected]
Schlagworte: Abiotische Resistenz, Variation, Pappel, Nadelbaumarten
Für eine erfolgreiche Anpassung der Forstwirtschaft an sich ändernde Klimabedingungen kommt neben Aspekten der Leistungsfähigkeit und der Qualität der Betriebssicherheit der verwendeten Baumarten eine entscheidende Rolle zu. Aussagen zur Betriebssicherheit lassen sich u. a. durch eine systematische Prüfung von genetischen Einheiten wie Klone und Nachkommenschaften der jeweiligen Baumarten auf ihre Toleranz gegenüber abiotischen Schäden treffen. Bei der Betrachtung des abiotischen Risikos ist u. a. die Fähigkeit der Bäume entscheidend, auch längere niederschlagsarme Zeiten zu überstehen. Neben der Trockenheit ist auch das Risiko von Frostschäden zu beachten, besonders wenn Material aus anderen Klimaregionen in Deutschland verwendet werden soll. Im Rahmen drittmittel- und haushaltsfinanzierter Untersuchungen werden deshalb seit mehreren Jahren Untersuchungen zur Trockenheits- bzw. Frostresistenz an verschiedenen Klonen und Nachkommenschaften der Gattungen Pappel und Lärche sowie der Europäischen Fichte und Douglasie durchgeführt. Die Untersuchungen zur Resistenz gegenüber Trockenheit umfassen die Erhebung physiologischer Reaktionen auf Trockenheit und struktureller Parameter der Trockenstresstoleranz und des Wasserhaushaltes sowie die Erfassung von Trockenschäden auf den Versuchsflächen. Die Frostresistenz wird durch die Ermittlung der Frühfrost-, Winterfrost- und Spätfrostfestigkeit bestimmt. Hierzu dienen die Erfassung des Austriebes und des Triebabschlusses sowie Frosttests an abgeschnittenen Teilen ein- bzw. zweijähriger Pflanzen im Klimaschrank. Nach einem kurzen Überblick über die Ziele, verwendetes Material und Methoden der Untersuchungen werden an ausgewählten Beispielen die Ergebnisse von Pilotvorhaben und von mehrjährigen Versuchsreihen vorgestellt. Sowohl bei den Untersuchungen zur Trockenresistenz als auch zur Frostresistenz bestehen signifikante Unterschiede zwischen den untersuchten Klonen und Nachkommenschaften in den untersuchten Merkmalen. Die festgestellte Variation der anpassungsrelevanten Merkmale weist auf die Spannweite in der Reaktionsfähigkeit der untersuchten Baumarten hin und gibt wichtige Hinweise für die zukünftige Verwendung dieser Arten unter sich ändernden Klimabedingungen.
Vorträge Session 3: Forstl. isikomanagement unter sich ändernden Umweltbed. 20
Vermeidung von Trockenstress in jungen Fichtenbeständen– Wie lange hält sich der Durchforstungseffekt?
Timo Gebhardt1, Karl-Heinz Häberle2, Rainer Matyssek2, Christian Ammer1
1Abteilung Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen, Georg-August-Universität, D-37077 Göttingen, [email protected], [email protected] 2 Lehrstuhl der Ökophysiologie der Pflanzen, Technische Universität München/Weihenstephan, D-85354 Freising, Germany, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Klimawandel, Durchforstung, Wasserbilanz, Trockenstress
Angesichts des voranschreitenden Klimawandels wird seit einigen Jahren verstärkt das Potenzial von Durchforstungseingriffen in jungen Fichtenreinbeständen (Picea abies [L.] Karst) zur Verbesserung der Wasserversorgung in Trockenphasen diskutiert. Die Bilanzierung des Wasserhaushaltes in einer Versuchsanlage mit unterschiedlicher Auflichtung eines Fichten-Reinstandes zeigte nach der Durchforstung eine deutliche Erhöhung der Wasserverfügbarkeit. Während die unbehandelten Flächen auch in überdurchschnittlich feuchten Jahren in den Sommermonaten den kritischen relativen Bodenwassergehalt (REW) von 40% unterschritten, konnte dies durch die Durchforstungseingriffe vermieden werden. Auf besonders stark durchforsteten Flächen (Entnahme aller Individuen mit Ausnahme von 400 Auslesebäumen) führten der erhöhte Wasserverbrauch des verbliebenen Bestandes und jener der aufkommenden Bodenvegetation (v.a. Rubus spec.) zu einer raschen Angleichung des Wasserverbrauches an die konventionelle Durchforstung (Begünstigung von Z-Bäumen durch Entnahme von zwei Bedrängern). Auch gegenüber der nicht durchforsteten Kontrolle war nach fünf Jahren kein Unterschied im Wasserverbrauch mehr festzustellen. Der warme und trockene Sommer 2015 (7 Jahre nach der Durchforstung) führte auf allen Teilflächen zu einem signifikanten Zuwachseinbruch. Neben der Bodenwasserspeicherkapazität, dem Feinwurzelwachstum und der aufkommenden Bodenvegetation ist vor allem die Geschwindigkeit des erneuten Kronenschlusses ein wichtiger Entscheidungsfaktor für die Häufigkeit der Durchforstungseingriffe. Es hat sich gezeigt, dass eine etwas stärkere Auslesedurchforstung mit einem Durchforstungsintervall von ca. 5 Jahren am besten geeignet ist, negativen Auswirkungen trockener Sommer in jungen Fichtenreinbeständen entgegen zu wirken, zumal bekannt ist, dass Durchforstungen die Erholung der Bäume nach trockenheitsbedingten Zuwachseinbußen deutlich verbessern.
Vorträge Session 3: Forstl. Risikomanagement unter sich ändernden Umweltbed.
21
Eine neue Methode zur Berücksichtigung von ökonomischer Unsicherheit im Rahmen von Portfolio-Optimierungen in der
Waldbewirtschaftung
Thomas Knoke1, Katharina Messerer1
1Technische Universität München, Wissenschaftszentrum für Ernährung, Landnutzung und Umwelt Weihenstephan, Fachgebiet für Waldinventur und nachhaltige Nutzung, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Robuste Optimierung, Unsicherheitsmengen, nicht stochastische Optimierung
Mittlerweile sind zahlreiche Studien zur Portfolio-Optimierung im Bereich der Forst- und Umweltwissenschaft entstanden. Die Portfolio-Methode erfordert jedoch umfangreiche Informationen zur Unsicherheit der Eingangsparameter, welche in Form der Kovarianz zwischen allen betrachteten Diversifizierungskomponenten vorliegen müssen. Zudem ist die oft starke Variation der optimalen Lösungen bei nur geringfügiger Veränderung der Eingangsparameter problematisch. Der Vortrag stellt daher eine Alternative zur Berücksichtigung von Unsicherheit vor, welche auf Unsicherheitsmengen hinsichtlich der Eingangsparameter basiert. Es handelt sich um eine Form der robusten Optimierung, welche ein akzeptables Ergebnis für alle betrachteten Unsicherheiten fordert. Es wird also über den gesamten Unsicherheitsraum optimiert.
Vorträge Session 3: Forstl. isikomanagement unter sich ändernden Umweltbed. 22
Waldbauliche Strategien zur Erhöhung der Waldbrandresilienz von Waldstrukturen
Daniel Kraus1, Marc Castellnou2 und Teresa Jain3
1European Forest Institute, Wonnhaldestrasse 4, D-79100 Freiburg, [email protected] 2GRAF-DGPEIS, Universidad Autonoma Barcelona, Spain, [email protected] 3US Forest Service, Rocky Mountain Research Station, 1221 S. Main, Moscow, [email protected]
Schlagworte: Waldbrand, Resilienz, Strukturen, Störung
Die Nachahmung von natürlichen Störungen (Natural Disturbance Emulation, NDE) wird oft als Grundprinzip für eine ökologisch nachhaltige Waldwirtschaft betrachtet. Aktuelle Ansätze in der Waldbewirtschaftung betonen die Erhaltung von Ökosystemintegrität, -resilienz und Artenvielfalt durch die Einhaltung von ökologischen Prinzipien. NDE als waldbauliche Strategie zielt auf die Umsetzung waldbaulicher Praktiken, die Bestandesstrukturen reproduzieren und erhalten, welche in Wäldern mit natürlichen Störungsregimen zu finden sind. Im Wesentlichen ist es das Ziel, waldbauliche Verfahren zu entwickeln, die sich an die grundlegenden ökologischen Auswirkungen von Störungen anlehnen. Dem folgt die Hypothese, dass durch das Nachahmen von dynamischen Waldstrukturen, die durch Störungen entstehen, der Großteil der Prozesse und Entwicklung von ökologischer Funktionalität in einem Waldökosystem langfristig stabiler ablaufen als in konventionell bewirtschafteten Wäldern. Für Wälder, die regelmäßig von natürlichen Waldbränden gestört werden, können diese Beobachtungen bestätigt werden: Während geringe bis mittlere Feuerintensitäten eine weitgehend feuerresistente Waldstruktur schaffen können, werden durch hochintensive Waldbrände alle Strukturen zerstört und die Landschaft wird durch die Etablierung von Strauchformationen anfälliger für weitere Brände mit kürzeren Rückkehrintervallen. Als Reaktion auf immer verheerendere Waldbränden wurden in Europa vorrangig die Ressourcen in der Waldbrandbekämpfung erhöht, mit dem Ergebnis, dass kleine und mittlere Brände mit großem Erfolg unterdrückt wurden. Großbrände blieben aber weiterhin oft jenseits der Kontrollschwelle. Paradoxerweise führte gerade die Reduzierung von Waldbränden geringer bis mittlerer Störungsintensität zu den Großbrandlagen des letzten Jahrzehnts und gleicht in ihrer Auswirkung somit einer negativen Auslese der Waldbrandereignisse. Modellierungen zeigen, dass sich diese Situation in naher Zukunft nicht entscheidend verändern wird, wenn nicht Möglichkeiten der zielorientierten Landschaftsplanung und waldbaulicher Maßnahmen gesucht werden, die die Brandlast (d.h. die brennbare akkumulierte Biomasse) deutlich verringern können. Zwar ist eine flächendeckende Umsetzung entsprechender Maßnahmen nur schwer zu realisieren, doch werden entscheidende Neuerungen in dieser Richtung in verschiedenen europäischen Ländern bereits erprobt. Hierzu zählen: (1) Anwendung analytischer Verfahren zur Identifizierung strategisch wichtiger Punkte im Gelände, die mit gezielten Maßnahmen wie kontrollierter Feueranwendung und waldbaulichen Maßnahmen die Ausbreitung von Waldbränden verringern können; (2) die Entwicklung von Methoden und Techniken der Gegenfeueranwendung zur Entschleunigung und Eindämmung katastrophaler Brände mit extremem Feuerverhalten. Beide Maßnahmen können nur bei eintsprechenden Waldstrukturen erfolgreich sein.
Vorträge Session 3: Forstl. Risikomanagement unter sich ändernden Umweltbed.
23
Feldexperimente und Modelle als Entscheidungshilfen für die Waldbewirtschaftung in einer sich verändernden Umwelt
Andreas Rigling1, Arthur Gessler1, Marc Hanewinkel2, Marcus Schaub1, Thomas Wohlgemuth1, Roman Zweifel1, Harald Bugmanm3
1WSL Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, Walddynamik, 8903 Birmensdorf, Schweiz, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 2Universität Freiburg, Forstökonomie und Forstplanung, D-79106 Freiburg, Deutschland, [email protected] 3ETH Zürich, Waldökologie, 8092 Zürich, Schweiz, [email protected]
Schlagworte: Klimawandel, Trockenheit, Sensitivität, Ökosystemleistungen
Klimaszenarien sagen für das 21. Jahrhundert eine Zunahme von Extremereignissen wie Stürmen, Hitze- und Trockenperioden voraus und zudem dürften auch Waldbrände und Borkenkäferepidemien häufiger werden. Diese Szenarien erhöhen die Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Waldentwicklung und stellen die nachhaltige Waldbewirtschaftung vor grosse Herausforderungen. Die hier vorgestellte Untersuchung hatte zum Ziel den Einfluss von Klimawandel und unterschiedlichen Bewirtschaftungseingriffen auf verschiedene Waldtypen und ihre Leistungen abzuschätzen. Dabei fokussierten wir auf die Wälder im inneralpinen Trockental Wallis, vom Talboden (ca. 600 m ü.M.) bis hinauf zur oberen Waldgrenze (ca. 2200 m ü.M.). Es wurde die Klimasensitivität verschiedener Baumarten und Wälder analysiert und mehrere Waldbewirtschaftungsstrategien evaluiert und getestet. Grundlage waren Monitoringdaten aus dem Landesforstinventar und von Intensivuntersuchungs-flächen (ICP-Forests, Level II), kombiniert mit Resultaten aus Feldexperimenten und Testpflanzungen. Mittels dieser Daten wurden dynamische Waldentwicklungsmodelle angepasst, die Informationen aus Monitoring und Experimenten auf die Landschaftsebene hochskaliert und mit entsprechenden Szenarien in die Zukunft projiziert. Die Resultate zeigen auf, dass die zunehmende Trockenheit vielen einheimischen Baumarten in Tieflage derart zusetzen wird, sodass ein Wechsel zu mehr trockenheitstoleranten Baumarten gefördert werden muss. In den mittleren Höhenlagen dürften, zusätzlich zur Trockenheit, vermehrt Insektenkalamitäten die Waldentwicklung verändern. In den Hochlagen hingegen werden sich die Wälder ausdehnen und besser wachsen. Der Klimawandel wird zwar sämtliche Waldleistungen verändern, doch sind Richtung und Ausmass dieser Veränderungen spezifisch, je nach Leistung und Höhenlage. So werden beispielsweise die Holzproduktion, die Kohlenstoffspeicherung und auch die Steinschlagschutzwirkung in Tieflagenstandorten zusammenbrechen, während sich in den Hochlagen nicht nur die Biomasseproduktion, sondern auch die Lawinenschutzwirkung eher verbessern wird. Waldbewirtschaftungsmassnahmen sollten darauf abzielen, einerseits die Widerstandskraft der Bäume gegenüber Trockenheit und Schädlingen zu erhöhen und andererseits trockenheitstolerante Baumarten zu fördern. Die Resultate zeigen aber auf, dass nur verhältnismässig starke Eingriffe mittelfristig Wirkung zeigen und zur Sicherung der Waldleistungen beitragen können.
Vorträge Session 4: Auswirkungen von Extremwetterlagen auf älder 24
Niederschlagsradar- und Blitzortungsdaten zur forstlichen Bewertung des regionalen Sommerunwetterpotentials in Thüringen
Nico Frischbier1, Frank Heyner2
1ThüringenForst-AöR, Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum (FFK Gotha), Jägerstraße 1, D-99867 Gotha, [email protected] 2Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG), Thüringer Klimaagentur, Göschwitzer Straße 41, D-07745 Jena, [email protected]
Schlagworte: Extremereignisse, Konvektion, Starkregen, Sturm
Für eine umfassende Berücksichtigung von Klimaextremen beim Waldmanagement mangelt es häufig noch an ausreichend langen Beobachtungszeitreihen mit guter räumlicher Abdeckung, sowie an der akzeptablen Modellierung möglicher Extreme in Klimaprojektionen. Für sommerliche Unwetter (sog. atmosphärische Feuchtkonvektion) liefern Radar- und Blitzklimatologien flächendeckende Ansätze zur retrospektiven Auswertung und Synthese im Forst. Systematische Daten hierzu für die Bundesrepublik Deutschland stammen aus Blitzortungen (seit 1992) und Niederschlagsradar (seit 2001). Es entstehen neue Klimazeitreihen, die ohne Regionalisierungsnotwendigkeiten unmittelbar flächige Informationen bereithalten. Mit Hilfe eines Zellverfolgungsalgorithmus sind für den Freistaat Thüringen Niederschlags- und Blitzsequenzen für das Sommerhalbjahr (April-September) aus dem Zeitraum 2004-2014 zusammengefasst wurden, um GIS-Produkte mit räumlicher Auflösung von 1 km x 1 km abzuleiten, die retrospektiv eine klimatologische Aussage über sommerliche Unwetterpotentiale erlauben: (1) Anzahl an Starkniederschlagsgebieten, (2) mittlere Niederschlagsintensität je Starkniederschlagsgebiet, (3) Sturzflutpotential, (4) Blitzdichte und (5) Hagelpotential. Die Zeitreihen dazu sind noch kurz, sie werden aber täglich länger. Regional differenziert ließen sich für das Sommerhalbjahr für Thüringen im mehrjährigen Überblick 1,6 bis 5,1 Starkniederschlagsgebiete pro Jahr und Quadratkilometer nachweisen. Diese haben im Mittel eine Niederschlagsintensität von etwa 40 mm h-1. Zudem sind pro Jahr und Quadratkilometer bis zu 1,4 Hagelereignisse zu erwarten. Die mittlere Blitzdichte in Thüringen liegt bei 2 Wolke-Erde-Blitzen pro Jahr und Quadratkilometer. Schwerpunkte sommerlicher Feuchtkonvektion zeigten sich in Süd-Ost-Thüringen im Vogtland und Frankenwald im Lee der Thüringer Gebirge. Einige Anwendungen für den Forstbetrieb sind denkbar und werden erörtert. Für sommerliche Starkregenereignisse und potentielle Waldwegeschäden wird eine Anwendung bei ThüringenForst-AöR vorgestellt. Ziel ist, das Waldwegenetz u.a. hinsichtlich geeigneter Entwässerung, Art und Turnus der Wegeinstandsetzung und -unterhaltung etc. an die beobachteten Gefährdungspotentiale anzupassen. Auch zwischen regionalen Schwerpunkten des Schadholzaufkommens aus Wurf- und Bruchereignissen im Sommer im Thüringer Gesamtwald und dem ermittelten Unwetterpotential werden Zusammenhänge geprüft.
Vorträge Session 4: Auswirkungen von Extremwetterlagen auf älder 25
Modellierung der Sturmschadenswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von Maximalwindgeschwindigkeit, Windrichtung,
Einzelbaumparametern und Topographie
Matthias Schmidt1
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Grätzelstraße 2, 37079 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Logistisches Sturmschadensmodell, Orkan Lothar, Böen-Windgeschwindig-keit, Bundeswaldinventur
Der Beitrag präsentiert die Weiterentwicklung eines auf Basis von Sondererhebungen der BWI 2 in Baden-Württemberg parametrisierten logistischen Sturmschadensmodells. Der bisherige Ansatz bildet Baumarteneffekte, dendrometrische Effekte und Effekte der Topographie plausibel und sensitiv ab. Valide Informationen zum Windfeld des ursächlichen Orkans Lothar (26.12.1999) d.h. zum räumlichen Muster der Windgeschwindigkeit und -richtung lagen bisher jedoch nicht vor. Der Effekt räumlich korrelierter Störvariablen einschließlich der Windgeschwindigkeit wurde daher über eine 2-dimensionale Oberfläche zur Erfassung der großräumigen Autokorrelation modelliert. Bei der Anwendung des Modells für Prognosen bzw. bei der Ableitung von Entscheidungshilfen für die Forstwirtschaft muss somit unterstellt werden, dass der modellierte räumliche Effekt ausschließlich als Proxy für den Effekt der Windgeschwindigkeit dient. Im Rahmen der Weiterentwicklung des Sturmschadensmodells wurde das Windfeld des Orkans Lothar vom DWD über ein dynamisches Strömungsmodell in hoher räumlicher Auflösung rekonstruiert. Somit stehen die Maximalwindgeschwindigkeit und die zugehörige Windrichtung flächendeckend an den Stichprobenpunkten der BWI 2 in Baden-Württemberg zur Verfügung. Auf der Grundlage dieser Daten wird das existierende logistische Sturmschadensmodell neu parametrisiert, in dem die Maximalgeschwindigkeit als zusätzliche Kovariable verwendet wird. Weiterhin wird die zugehörige Windrichtung dafür genutzt, die Ausrichtung topographischer Parameter plotweise anzupassen. Damit werden neben den kausalen Kovariablen, die die Vulnerabilität eines Baumes und Standortes beschreiben, zusätzlich kausale Kovariablen, die das eigentliche Schadereignis charakterisieren, zur Schätzung der Schadwahrscheinlichkeit verwendet. Das erweiterte Sturmschadensmodell ermöglicht die Prognose von Sturmschäden auf Einzelbaumebene in Abhängigkeit der Baumart, des BHD, der Baumhöhe und der Topographie für unterschiedliche Windstärken und -richtungen. Durch die Verwendung kausaler meteorologischer Kovariablen, werden die Möglichkeiten zur Generalisierung des Modells deutlich erhöht und es können Schwellenwerte kritischer Windgeschwindigkeiten abgeleitet werden. Im Rahmen des Vortrages werden die verwendeten Datenquellen, der verwendete Modellansatz einschließlich einer Validierung sowie eine Sensitivitätsanalyse dargestellt.
Vorträge Session 4: Auswirkungen von Extremwetterlagen auf älder 26
Wie verschiedene Formulierungen der Baummortalität quantitative Analysen der zukünftigen Walddynamik beeinflussen
Harald Bugmann1 & PROFOUND Task Group 4.12
1 Waldökologie, ETH Zürich, CH-8092 Zürich, [email protected] 2 COST Action PROFOUND (Towards robust projections of European forests under climate change)
Schlagworte: Dynamische Waldmodelle, Mortalität, Unsicherheit, Klimawandel
Dynamische Modelle sind ein zentrales Werkzeug für die Analyse der zukünftigen Walddynamik unter dem Einfluss von Bewirtschaftung und abiotischen treibenden Kräften wie CO2-Konzentration, N-Deposition und Klimawandel. Diese Modelle enthalten notwendigerweise Formulierungen für den Zuwachs, die Mortalität und meist auch für die Verjüngung. Während die empirische Grundlage für die Modellierung des Zuwachses sehr solide ist, gilt dies weit weniger für die Mortalität. Im Rahmen der COST-Action PROFOUND wurde anhand von 15 verschiedenen dynamischen Modellen getestet, wie groß deren Sensitivität auf verschiedene, gleich plausible Formulierungen für die Baum-Mortalität ist. Dabei wurde sowohl „chronische“ („Hintergrund“-) Mortalität berücksichtigt als auch Mortalität, welche durch Extremereignisse ausgelöst wird (z.B. extreme Trockenheit). Von den 15 Modellen sind 8 auf der Bestandes-, 4 auf der Landschafts- und 3 auf der globalen Ebene angesiedelt. Sie weisen teils empirisch gefittete (z.B. mit Inventurdaten), teils theoretisch basierte (z.B. pflanzenphysiologische Betrachtungen zur C-Bilanz des Baumes) Mortalitäts-Formulierungen auf. Jedes Modell wurde mit mindestens zwei alternativen Mortalitäts-Algorithmen implementiert. In einem ersten Schritt wurde, so weit möglich, das Modellverhalten im Vergleich zu empirischen (Langzeit-)Daten getestet. In einem zweiten Schritt wurden mit allen Modellen Szenarien des Klimawandels untersucht. Aufgrund der Simulations-Ergebnisse wurde die Sensitivität der Modelle klassifiziert und eine Begründung für unterschiedliche Sensitivitäten gegeben. Insgesamt fanden wir, dass es sehr schwierig ist, anhand einer Validierung „geeignete“ resp. „ungeeignete“ Mortalitäts-Formulierungen zu unterscheiden. Ähnlich plausible und empirisch bestens abgestützte Mortalitäts-Algorithmen führen aber je nach Standort und Klimaszenario zu stark divergierenden Aussagen für die Zukunft. Es ist deshalb wichtig, bei Abschätzungen der zukünftigen Walddynamik mit Modellen nicht eine einzige Mortalitäts-Formulierung zu verwenden, sondern den Bereich zukünftiger Entwicklungen anhand multipler Formulierungen zu eruieren. Damit erhöht sich zwar die Unsicherheit der Aussagen, da keine a priori-Selektion der „besten“ Formulierung möglich ist. Gleichzeitig werden aber Fehlschlüsse verhindert, welche sich auf nur eine Formulierung abstützen, und dies ist positiv für die Entscheidungsunterstützung in der adaptiven Waldbewirtschaftung.
Vorträge Session 4: Auswirkungen von Extremwetterlagen auf älder 27
Zuwachsverluste in extremen Trockenjahren – ein Baumarten- und Standortsvergleich an bayerischen Waldklimastationen
Hans-Peter Dietrich1, Thomas Seifert2,5, Stefan Seifert5,Wolfgang Beck3 und Petia Nikolova4
1 Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected] 2 Stellenbosch University, Department of Forest and Wood Science, Faculty of AgriScience, Private Bag X1, Matieland, 7602, Stellenbosch, South Africa; [email protected] 3Thünen Institut für Waldökosysteme (TI), Alfred-Möller-Straße 1, Haus 41/4, 16225 Eberswalde: [email protected] 4 Eidg. Forschungsanstalt (WSL) - Swiss Federal Research Institute WSL, Zuercherstr. 11,CH-8903 Birmensdorf; [email protected] 5 Scientes Mondium UG (haftungsbeschränkt) Ruppertskirchen 5, 85250 Altomünster; [email protected]
Schlagworte: Trockenheit, Zuwachsverluste; Baumarten, forstliches Umweltmonitoring
In diesem Beitrag wird der Fragestellung nachgegangen, inwiefern sich extreme Trockenjahre in der Vergangenheit (1947, 1976 und 2003) auf das Zuwachsverhalten verschiedener Hauptbaumarten in Bayern ausgewirkt haben. Gestützt auf Bohrkernanalysen von Vergleichsbaumarten an elf bayerischen Waldklimastationen (WKS) der Baumarten Fichte, Tanne, Douglasie, Kiefer, Buche und Eiche werden artspezifische Zuwachsreaktion retrospektiv analysiert und mit Blick auf die Toleranz der Baumarten (Resistenz, Resilienz, Recovery und Persistenz) gegenüber Trockenheit und Wassermangel vergleichend interpretiert. Anhand von 33 Jahrringchronologien von 660 Bäumen erfolgt eine vereinfachte und orientierente Abschätzung artspezifischer Zuwachsverluste infolge extremer Trockenjahre. Der Untersuchungsansatz verwendet die jeweils herrschenden Bäume zur Bewertung des Verhaltens der Baumarten entlang eines Klimagradienten von Nordbayern bis zu den Alpen. Es wird dabei auf die exklusive Datenbasis langjähriger Mess- und Modellreihen zu Witterung und Wasserhaushalt an den Standorten des forstlichen Umweltmonitoring zurückgegriffen. Es zeigen sich substantielle baumartenspezifische Unterschiede in der Zuwachsreaktion vor allem an den klimatischen Rändern des betrachteten Klimagradienten, welche durchaus ökonomisch relevante Zuwachseinbußen erwarten lassen. Die stärksten Zuwachsverluste verzeichnet die Fichte, die geringsten die Eiche. Unerwartet stark waren die Interaktionswirkungen zwischen Zuwachs und zeitgleicher Blüte und Fruktifikation.
Vorträge Session 4: Auswirkungen von Extremwetterlagen auf älder 28
Über die Wirkung von Mischung auf den Zuwachs von Douglasien und Buchen unter Trockenstress
Eric Andreas Thurm1, Enno Uhl1 und Hans Pretzsch1
1Lehrstuhl für Waldwachstumskunde, Technische Universität München, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Douglasie, Rotbuche, Trockenstress, Jahrringe
In Mitteleuropa wird von vielen Forstverwaltungen ein erhöhter Anteil an Mischbeständen angestrebt. Man nimmt an, dass sie im Hinblick auf klimatische Veränderungen resilienter sind und gewünschte Ökosystemleistungen besser gewährleisten können als Reinbestände. Die Interaktion von Baummischungen unter Trockenstress und die Auswirkungen auf die Zuwachsleistung ist jedoch wenig untersucht. Die vorliegende Studie hat daher Jahrringdaten von Buchen und Douglasien in Rein- und Mischbeständen unter Trockenstressereignissen zwischen 1950 und 2010 analysiert. Der Versuchsaufbau umfasst sogenannte Triplets. Sie bestehen aus einem Reinbestand Buche, einem Reinbestand Douglasie und einem Mischbestand aus beiden Baumarten. Die drei Bestände eines Triplets befinden sich im gleichen Alter und weisen vergleichbare Standortsverhältnisse auf. Insgesamt wurden 18 Triplets entlang eines Feuchtegradienten mit jeweils 3 Altersklassen angelegt. Anhand von Trockenheitsindizes wurde das Reaktionsmuster beider Arten im Rein- und Mischbestand auf Baum- und Bestandesebene miteinander verglichen. Auf Baumebene zeigte sich, dass die Buche im Vergleich zur Douglasie insgesamt über eine bessere Resistenz verfügte und sich schneller von einem Trockenereignis erholte. Die Mischung führte jedoch dazu, dass sich das Erholungspotential der Buche verschlechterte, während es sich für die Douglasie verbesserte. Das wurde besonders deutlich bei Trockenereignissen, bei denen auf ein Trockenjahr ein weiteres Jahr mit überdurchschnittlich trockenen Bedingungen folgte. Dies könnte an der unterschiedlichen Phänologie der Baumarten liegen. Auf Bestandesebene wurde speziell das Jahr 2003 untersucht. Dabei gliederten sich die Mischbestände in Resistenz und Erholungszeit zwischen den Douglasien- und Buchenbeständen ein. Die Buchen-Reinbestände zeigten die höchste Resistenz, die Douglasien-Reinbestände die geringste. Auffällig war, dass die Buchen-Reinbestände die längste Erholungszeit benötigten. Negativ wirkte hier vermutlich das Buchen-Mastjahr 2004. Erstmalig wurden auch trockenheitsbedingte Zuwachsverluste pro Hektar untersucht. Dabei zeigten Rein- als auch Mischbestände, dass durch das Trockenjahr 2003 im Mittel 50% des durchschnittlichen Jahreszuwachses verloren gingen. Die veränderten Reaktionen der Arten in Mischung auf Baumebene, kompensierten sich auf Bestandesebene. Dies deckt sich mit einer vorangegangenen Studie, die positive Mischungseffekte auf niederschlagsreicheren Standorten ausmachte.
Vorträge Session 4: Auswirkungen von Extremwetterlagen auf älder 29
Risikoanalyse bei Waldbäumen gegenüber Witterungsextremen auf der Grundlage von Biomarkern
Ralf Kätzel1 und Sonja Löffler1
1Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde, LFB Brandenburg, Alfred-Möller-Straße 1, 16225 Eberswalde, [email protected]
Schlagworte: Schadensbewertung, Klimaplastizität, Monitoring, Stress
Anpassungsreaktionen an Witterungsextreme sind auch für Gehölze kostenintensiv, die u. a. zur temporären Reduktion des Zuwachses, der Blattmassenhaltung und der Fruktifikation führen können, letztendlich aber das Überleben sichern. Dies wirft grundsätzliche Fragen der Bewertung von tatsächlichen Schäden und Risiken auf, die an unterschiedliche Zielsetzungen und Sichtweisen geknüpft sind. Die Stressphysiologie unterscheidet seit langem zwischen Eustress und Disstress, wobei die konkrete, praktische Zuordnung von Stressereignissen im Grenzbereich beider Phasen äußerst schwierig ist und von zahlreichen Begleitfaktoren beeinflusst wird. Vorgestellt werden langjährige Zeitreihen von Biomarkermustern zur Vitalitätsdiagnostik auf Dauerbeobachtungsflächen der Forstlichen Umweltkontrolle der Baumarten Kiefer, Buche und Eiche im Norddeutschen Tiefland, vordringlich vor dem Hintergrund von sommerlicher Hitze und Trockenheit. Parallel zu den biochemischen Indikatoren werden jährliche Kronenverlichtungsgrade, Mortalitätsraten und der Dickenzuwachs für die Risikoanalyse auf Einzelbaumebene bewertet. Neben dem Vergleich von Indikatoren werden gleichfalls baumartenspezifische Anpassungsstrategien und Risiken verglichen, ohne die eine objektive und quantifizierbare Bewertung von Risiken nicht möglich ist. Die Ergebnisse leisten einen Beitrag zur Differenzierung von Baumreaktionen zwischen Eustress und Disstress und damit zur Bewertung von Anpassungspotenzialen, Schäden und Risiken.
Vorträge Session 4: Auswirkungen von Extremwetterlagen auf älder 30
Deutschlandweite Schadwirkungen von Trockenheit auf Waldverjüngungen – ökologische und ökonomische Projektionen
Marco Natkhin1, Tomasz Czajkowski1, Jürgen Müller1, Hermann Englert2, Björn Seintsch2, Andreas Bolte1
1Thünen-Institut für Waldökosysteme, A.-Möller-Straße 1, 16225 Eberswalde, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 2Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie, Leuschnerstraße 91, 21031 Hamburg-Bergedorf, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Klimawandel, LD50SWA, RCP-Szenarien, Schadenssummen
Im Rahmen des BMEL-Verbundprojektes „Agrarrelevante Extremwetterlagen und Möglichkeiten von isikomanagementsystemen“ wurde das Absterberisiko für die Verjüngung verschiedener Baumarten betrachtet. Dazu wurden junge Bäume kontrolliert Trockenstress ausgesetzt, um einen kritischen Schwellenwert des Bodenwassergehalts (LD50SWA) abzuleiten. Dieser Wert gibt an, bei welchem verfügbaren Bodenwassergehalt 50 % der Verjüngung absterben. Der abgeleitete LD50SWA-Wert von 20 % Bodenwasserverfügbarkeit wurde in einer räumlichen Wasserhaushaltsmodellierung verwendet, um deutschlandweit auf Landkreisebene das Vertrocknungsrisiko der Waldverjüngung zu modellieren und mit Hilfe des STARS-Modell (PIK) und des IPCC RCP 8.5-Szenarios zu projizieren. Im Ergebnis werden deutschlandweite Karten des Trockenstressrisikos für Baumartenverjüngungen unter dem Schirm der Hauptbaumarten Buche, Fichte und Kiefer dargestellt. Die betrachteten Zeiträume umfassen die Referenzperiode 1961-1990, nahe Zukunft (2021-2050) und ferne Zukunft (2081-2100). In weiten Gebieten Ost- und einigen Regionen Südwestdeutschlands deutet sich ein stark steigendes Risiko ab 2050 an, insbesondere für Baumartenverjüngungen unter einem Fichten- und Kiefernschirm. Unter Buche steigt das Risiko wegen geringer Interzeptionsverluste und hohem Stammablauf dagegen deutlich geringer an. Sich daraus ergebende Empfehlungen zum weiteren Waldumbau von Nadelbaumbeständen in Laub- und Mischwaldbeständen müssen aus ökonomischer Sicht aber mit dem deutlich geringeren Erwartungswert zukünftiger Laubwaldbestände abgewogen werden. Zukünftige Alternativen können ggf. ein Anbau von trockentoleranten (Nadel-) Baumarten auf der Freifläche und eine Bewässerung in der Anwuchsphase sein.
Vorträge Session 4: Auswirkungen von Extremwetterlagen auf älder 31
Untersuchung der zeitlichen Dynamik der Rundholzlagerung im Kontext von Kalamitätsereignissen
Klaus Zimmermann1, Wolfgang Hercher2 , Holger Hastreiter3 , Niels Ermisch1
und Holger Weimar1
1Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie, Leuschnerstrasse 91, 21031 Hamburg, [email protected], [email protected], [email protected] 2Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abteilung Forstökonomie, Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg, [email protected] 3Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Abteilung Waldbesitz, Beratung, Forstpolitik, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Rundholzlagerung, Kalamitäten, Quantifizierung, Rohstoffmonitoring
Im Rahmen des Verbundprojekts Rohstoffmonitoring Holz werden Aufkommen und Verwendung von Holz in Deutschland fortlaufend untersucht und in einer umfassenden Holzrohstoffbilanz zusammengeführt. Als Grundlage hierzu dienen Analysen zu den einzelnen Aufkommens- und Verwendungssektoren des Rohstoffs Holz. Das Rohstoffmonitoring hat seinen Schwerpunkt in Märkten, die statistisch nicht oder nur unzureichend erfasst sind (zum Beispiel Energieholzmarkt, Privathaushalte). Es besteht allerdings auch Bedarf an ergänzenden Informationen in Bereichen, die durch die amtliche Statistik bereits erfasst werden. Längerfristige Rundholzlagerung, wie sie etwa nach Großsturmereignissen in Erscheinung tritt, wurde bezüglich ihrer zeitlichen Dynamik bislang nur unzureichend wissenschaftlich untersucht. Um die Ergebnisqualität des Rohstoffmonitorings weiter zu optimieren, soll daher die Holzlagerdynamik im Wald, möglichst detailliert quantitativ untersucht werden. Es zeigte sich bei der Identifikation möglicher Datenquellen, dass die Testbetriebsnetze für Forstwirtschaft die Möglichkeit bieten, Auswirkungen von Rundholzlagern auf die Rohstoffbilanzen zu untersuchen. Für Betriebe über 200 ha Flächengröße wird das Testbetriebsnetz des Bundes als Datengrundlage herangezogen. Für Betriebe unter 200 ha Flächengröße wird mit den forstlichen Versuchsanstalten Bayerns und Baden-Württembergs kooperiert, die hierfür eigene Testbetriebsnetze unterhalten. Für die Testbetriebsnetze des Bundes sowie Baden-Württembergs steht eine Zeitreihe von 1991 bis 2013 als Untersuchungsgrundlage zur Verfügung. In Bayern werden auf Grundlage der aktuellen Zusammenarbeit erstmals für 2015 die Waldlager erfasst. Durch die bestehenden Zeitreihen können mehrere Großsturmereignisse, aber auch kleinere Kalamitäten und die einhergehenden Holzlagerveränderungen im Wald untersucht werden. Weiterhin wird die Holzeinschlagsstatistik des Statistischen Bundesamts zur Ermittlung der Schadholzmengen und Schadholzarten herangezogen. Ziel der Arbeit ist es, zu klären ob signifikante Erklärungsparameter für die Holzlagerdynamik existieren sowie deren Einfluss zu quantifizieren. Letztlich soll auf dieser Basis ein Modell für die Holzlagerdynamik im Wald erstellt werden.
Vorträge Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 32
Waldschutz als Kernkompetenz der Forstverwaltungen?!
Ralf Petercord1
1Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Klimawandel, Ausbildungsstand, Forstreformen, Forschungsförderung
Können die Forstverwaltungen den zunehmenden Anforderungen an den Waldschutz, die sich aus den veränderten Risiken durch den Klimawandel und die Einschleppung invasiver Arten durch den globalisierten Handel, den verschärften rechtlichen Bedingungen und den hohen gesellschaftlichen Anforderungen, aktuell noch gerecht werden? Kann der Waldschutz noch als eine Kernkompetenz der Forstverwaltungen betrachtet werden? Angesichts der hohen Bedeutung des Waldschutzes für die Anpassung der Wälder im Klimawandel und den Veränderungen in der forstlichen Ausbildung und der Forstwirtschaft insgesamt, bedarf es einer selbstkritischen Beantwortung dieser Fragen! In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Qualität der Ausbildung im Fachgebiet Waldschutz bedingt durch die Priorisierung anderer Schlüsselqualifikationen im Rahmen der Studienreformen, die wissenschaftliche Ausrichtung der Institute oder gar Wegfall der entsprechenden Lehrstühle und die Anzahl forstlich qualifizierter Mitarbeiter in den Instituten der verschiedenen forstlichen Ausbildungsstätten teilweise deutlich verschlechtert. Das daraus resultierende fehlende Fachwissen kann und wird in den verwaltungsinternen Ausbildungszeiten nicht ausgeglichen (werden). Die Qualifikation junger Forstbeamter im Fachgebiet ist daher i. d. R. nicht ausreichend. Gleichzeitig stehen auch nur wenige externe Waldschutzexperten zur Verfügung. Die Zusammenarbeit der Forstlichen Versuchs-und Forschungsanstalten mit den forstlichen Ausbildungsstätten im Bereich Waldschutz hat in der Folge abgenommen. Mit den Forstreformen der Länder, die Teils zur Trennung von Hoheit und Betrieb führten und mit einer Vergrößerung der Betriebs- resp. Verwaltungseinheiten auf allen Ebenen einhergingen, hat sich die Qualität der Waldschutzmeldungen verschlechtert. Die Förderfähigkeit der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalten für wissenschaftliche Forschungsprojekte zum Waldschutz durch Drittmittelgeber ist insgesamt schlecht. Damit nehmen deren Forschungsaktivitäten außerhalb der jeweils eigenen Forstverwaltungen eher ab und autökologische Forschungsansätzen überwiegen gegenüber den eigentlichen notwendigen syn- und demökologischen. Der angewandte Waldschutz verkommt damit von einer analytischen zu einer beobachtenden Wissenschaft, verliert damit zunehmend an Relevanz und Stellenwert und wird letztlich den wachsenden Anforderungen nicht gerecht werden können.
Vorträge Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
33
Befallsrisiko und Phänologie des Buchdruckes (Ips typographus) – aktuelle Prognosen und der Einfluss des Klimawandels
Oliver Jakoby1 und Beat Wermelinger1
1Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Zürcherstr. 111, 8903 Birmensdorf, Schweiz, [email protected]
Schlagworte: Klimawandel, Online-Informationsplattform (www.borkenkaefer.ch), Bestandesprädisposition, dynamisches Simulationsmodell
Der Buchdrucker (Ips typographus) ist der bedeutendste Waldschädling in fichtendominierten Wäldern Zentraleuropas. Die Prädisposition eines Bestandes gegenüber Buchdruckerbefall hängt von einer Vielzahl verschiedener biotischer und abiotischer Faktoren wie Bestandescharakteristik, Klima, Topographie und Störungen ab. Zusätzlich beeinflussen Management und Klimawandel die ökologischen Interaktionen zwischen dem Buchdrucker und seinem Wirtsbaum Fichte (Picea abies). Für ein optimales Schädlingsmanagements ist entscheidend, welche Veränderungen in der Phänologie des Buchdruckers und der Bestandesprädisposition auf unterschiedlichen Zeitskalen zu erwarten sind. Wir haben Simulationsmodelle entwickelt, die es ermöglichen, die prognostizierte Populationsentwicklung in täglicher Auflösung zu berechnen und das zukünftige Risiko eines Borkenkäferbefalls unter verschiedenen Klimaszenarien abzuschätzen. Dazu werden Flugperioden, Anzahl Generationen und relative Populationsdichte der verschiedenen Entwicklungsstadien des Käfers sowie der Trockenstress der Fichte auf einem 2x2 km Raster berechnet. Aufgrund dieser Informationen sowie Bestandes- und Umweltparametern wird die allgemeine Prädisposition von Waldbeständen gegenüber Käferbefall abgeschätzt. Am Beispiel der Schweiz mit ihrer komplexen Topographie untersuchen wir den Einfluss von verschiedenen Faktoren auf die Phänologie und das potentielle Befallsrisiko des Buchdruckers unter aktuellen Umweltbedingungen sowie verschiedenen Klimawandelszenarien. Dies ermöglicht es, Regionen mit einem erhöhten zukünftigen Befallsrisiko zu identifizieren. Außerdem zeigen wir, wie Modellergebnisse der Praxis verfügbar gemacht werden können, um Praktikern und Stakeholdern bei der Anpassung kurz- und langfristiger Managementstrategien zu unterstützen. Hierzu bietet unsere Onlineplattform (www.borkenkaefer.ch) detaillierte Berechnungen zur Verteilung der Entwicklungsstadien regionaler Populationen und deren Flugphasen für verschiedene Höhenstufen und Expositionen. Zusätzlich liefert sie Informationen zu Biologie und Management des Buchdruckers und ermöglicht die Abschätzung der aktuellen Befallssituation anhand regionaler Käferholzmengen der letzten 25 Jahre. Insgesamt zeigt unsere Studie, wie Modelle genutzt werden können, um Umweltrisiken unter Berücksichtigung des Klimawandels abzuschätzen, und wie diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis fließen können, um die ökologische Risikobewertung im Wald zu unterstützen.
Vorträge Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 34
Befallsrisiko durch Buchdrucker im Umfeld des Nationalparks Bayerischer Wald
Gabriela Lobinger1
1Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Buchdrucker, Befallsrisiko, Nationalparkumfeld
Der im Jahr 1970 gegründete Nationalpark Bayerischer Wald wurde 1997 um rund 11.000 ha auf eine Gesamtfläche von 24.240 ha erweitert. Durch sukzessive Ausweisung von Naturzonen wird in diesem Bereich bis zum Jahr 2027 auf mindestens 75% der Fläche die Bewirtschaftung eingestellt. In dieser fichtendominierten Region werden demnach auf zunehmender Fläche vom Buchdrucker befallene Fichten und durch Schadereignisse anfallendes bruttaugliches Material in den Beständen belassen. Angrenzende Waldbesitzer befürchten einen wachsenden Borkenkäferdruck aus dem Schutzgebiet. Um den Einfluss des Nationalparks auf die Gefährdung angrenzender Wirtschaftswälder durch Borkenkäfer objektiv beurteilen zu können, wurden zwischen 2010 und 2014 Untersuchungen zur Populationsdynamik des Buchdruckers und der räumlich-zeitlichen Befallsentwicklung im Umfeld des Nationalpark-Erweiterungsgebietes auf der Basis terrestrischer Aufnahmen und semi-automatisierter Auswertungen von Luftbildern durchgeführt. Aufgrund der moderaten Buchdruckerdichte im Untersuchungszeitraum war der auftretende Befall meist kleinräumig und verstreut. Er beruhte auf punktuellem Befallserfolg und war maßgeblich geprägt durch die bestandesbedingte Disposition der Wälder und die Qualität des lokalen Borkenkäfermanagements. Für das Gesamtgebiet bestand kein erhöhter Käferdruck aus dem Nationalpark heraus - grenzübergreifender Befall trat wechselseitig auf. Naturzonen in den entfernten Hochlagen und in Distanzen über 1.000 m zur Grenze wirkten sich nicht auf den Außenbereich aus. Dagegen führten Naturzonenausweisungen bis zu einer Distanz von 500 m zur Randzone zu leicht erhöhtem Befallsdruck auf angrenzende Wälder. Die Ergebnisse mündeten in Empfehlungen, die den Schutz der Wirtschaftswälder im Umfeld des Nationalparks noch weiter verbessern sollen. Bereiche hoher Befallsgefährdung beiderseits der Nationalparkgrenze werden identifiziert und die Erfordernis einer lokal und zeitlich begrenzten Erweiterung der Waldschutzzone geprüft. Die Befallsdisposition grenznaher Wälder in ausgewiesenen Risikobereichen kann durch Waldumbau zunehmend gemindert werden. Ein gezieltes Borkenkäfermonitoring im Randbereich des Nationalparks dient dazu, die Waldbesitzer regelmäßig über die aktuelle Befallsgefährdung zu informieren und durch Handlungsempfehlungen zu unterstützen. Die Überwachung des Gebietes aus der Luft ermöglicht einen Überblick über die Befallsentwicklung und Risikobereiche.
Vorträge Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
35
Phänologische Asynchronität zwischen Wirtspflanze und Insekt als Ursache für einen Dominanzwechsel bei Fichtenblattwespen
Christa Schafellner1, Martina Marschnig1, Martin Schebeck1, Rudolf Wegensteiner1, Agnes Andrae2, Cornelia Reichert2 und Ralf Petercord2, Axel Schopf1
1Institut für Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz, Department für Wald- und Bodenforschung, Universität für Bodenkultur, Hasenauerstraße 38, 1190 Wien, Österreich; [email protected] 2Abteilung Waldschutz, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, Deutschland
Schlagworte: Pristiphora abietina, Pachynematus montanus, Gradation, Klimaänderung
Sekundäre Fichtenwälder auf warmen, trockenen Standorten der österreichischen und bayerischen Voralpen in Höhenlagen von 400-600 m galten bis zur Jahrtausendwende als chronische Massenvermehrungsgebiete der Kleinen Fichtenblattwespe, Pristiphora abietina. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jhdts. wurde kein flächiger Befall mehr registriert. Seit 2011 treten wiederum massive Fraßschäden an Fichte in den Tieflagen des nördlichen Alpenvorlandes auf, die aber ausschließlich auf die Fichtengebirgsblattwespe, Pachynematus montanus, zurückzuführen sind. Von dieser Blattwespenart war bisher ein gelegentliches, räumlich begrenztes Massenauftreten nur in Höhenlagen von 800-1200 m bekannt; in Tieflagen blieb sie eine unscheinbare Begleitart der Kleinen Fichtenblattwespe. Da der aktuelle Befall durch P. montanus auf früheren Befallsflächen von P. abietina mehr oder weniger gleichzeitig beobachtet wurde, dürften klimatische Faktoren für die Gradationen der Wespen eine bedeutende Rolle spielen. Während sich die Larven der Kleinen Fichtenblattwespe ausschließlich von Mainadeln ernähren, fressen Larven der Fichtengebirgsblattwespe auch Altnadeln; massive Nadelverluste können die betroffenen Bäume derart schwächen, dass sie für Borkenkäfer und andere Sekundärschädlinge bruttauglich werden. Im Rahmen eines EU Projekts zum Thema Forstschädlinge und Klimawandel wurde die ungewöhnliche Verschiebung in der Populationsdynamik der Blattwespenarten von 2013-2015 an mehreren Standorten in Österreich und Bayern untersucht. Als wahrscheinlichste Ursache für das fast vollständige Verschwinden der Kleinen Fichtenblattwespe kann eine asynchrone Verschiebung der Frühjahrsphänologie von Fichte und Blattwespe angesehen werden. Warme Witterungsperioden im Frühling lassen die Fichtenknospen wesentlich früher aufbrechen als die adulten Wespen aus dem Boden schlüpfen. Die zeitliche Asynchronität von Fichtenaustrieb und Wespenflug beeinflusst die beiden Blattwespenarten unterschiedlich. Während die Weibchen von P. abietina für die Eiablage nur Fichtenknospen mit frisch abgesprengter Knospenschuppe, aber noch nicht gespreizten Nadeln nützen können, heften P. montanus Weibchen ihre Eier auch auf Mainadeln deutlich gestreckter Triebe. Durch die nunmehr fehlende Konkurrenz der Kleine Fichtenblattwespe – bedingt durch höhere Frühjahrstemperaturen – und das vergleichsweise weitere Zeitfenster bei der Eiablage dürfte die Fichtengebirgsblattwespe in den letzten Jahren zur dominanten Blattwespenart in den tiefer gelegenen Fichtenwäldern im Alpenvorland geworden sein.
Vorträge Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 36
Vielfalt kontra Kahlfraß? Zum Einfluss der Bestandesstruktur auf die Fraßintensität der Nonne (Lymantria monacha L.) in Brandenburg
Rainer Hentschel1, Aline Wenning1, Jens Schröder1 und Katrin Möller1
1Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE), Alfred-Möller-Straße 1, 16225 Eberswalde, [email protected]
Schlagworte: Lymantria monacha, biotische Risiken, Einflussfaktoren, Bestandesstruktur
Die periodisch auftretenden Massenvermehrungen von Lymantria monacha L. (LM) können mit einem bestandsgefährdenden Nadelfraß (Restbenadelung < 5%) in der Kiefer (Pinus sylvestris L.) einhergehen. Beispielsweise betrug der Nadelverlust während der Massenvermehrung von 2002-2004 in Brandenburg auf einer Fläche von ca. 93.000 Hektar über 30% und auf einer Fläche von 2.000 Hektar über 95%. Zudem mussten auf 63.000 Hektar Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden, um einen Bestandesverlust zu vermeiden. Hinsichtlich des prognostizierten Klimawandels ist eine weitere Begünstigung wärmeliebender Schadinsekten wie LM zu erwarten. Das erhöhte Schadpotential während der letzten beiden Massenvermehrungen sowie eine Verschiebung der Hauptfraßgebiete der Nonne weisen auf ein steigendes Risiko durch LM in Brandenburg hin. Neben einem intensiven Monitoring und etwaigen Pflanzenschutzmaßnahmen ergibt sich die Notwendigkeit, waldbauliche Strategien zu überdenken und risikomindernde Behandlungsalternativen zu etablieren. Ziel der vorgestellten Untersuchung ist es, die Prädisposition kieferndominierter Waldbestände in Brandenburg zu ermitteln und „ isiko-Zentren“ bestandesbedrohenden Fraßes durch LM zu identifizieren. Als Datengrundlage dienen Aufzeichnungen von 3037 Forstabteilungen, in denen im Zeitraum von 2002 bis 2013 Nadelfraß durch LM dokumentiert wurde. Zur Untersuchung der Einflussfaktoren wurden die Bestandeskennwerte auf Abteilungsebene und für umgebende Einflusszonen von 100, 200 und 1000 Hektar hergeleitet. Des Weiteren wurden Bodenkennwerte und Klimavariablen in der Analyse mitberücksichtigt. Erste Ergebnisse geben Hinweise auf eine fraßhemmende Wirkung heterogener und strukturreicher Bestände. Ebenso lässt sich – wie auch in der Literatur bekannt – nachweisen, dass dicht bestockte Kiefernbestände im Alter von 60 bis 80 Jahren eine besondere Risikogruppe darstellen. Mit Hilfe der geographischen Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren wird eine erste Risikokarte vorgestellt, die helfen soll, das Monitoring von LM zu optimieren, künftige „ isiko-Zentren“ zu identifizieren und einen waldbaulichen Handlungsspielraum aufzuzeigen.
Vorträge Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
37
Retrospektive Arealanalyse der wichtigsten Schaderreger an Kiefer und Eiche in ausgewählten Regionen Deutschlands
Ines Graw1, Pavel Plašil1, Michael Habermann1
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Grätzelstraße 2, 37079 Göttingen, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Klimawandel, Eichenfraßgesellschaft, Kieferngroßschädlinge, retrospektive Arealanalyse
Im Zuge des Klimawandels ist mit erhöhten Temperaturen und saisonal veränderten Niederschlagsmengen in ganz Europa zu rechnen. Die möglichen Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Wirtsbäumen und Schaderregern sind noch nicht hinreichend analysiert. Um potentielle Waldschutzrisiken prognostizieren zu können, ist eine Analyse des zurückliegenden Schaderregergeschehens von Bedeutung. Im Rahmen des Verbundprojekts WAHYKLAS1 wird eine retrospektive Arealanalyse für Schaderreger anhand des Waldschutzmeldewesens der letzten zwanzig Jahre für vulnerable Gebiete entlang eines Transekts durch die Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg durchgeführt. Für die Baumart Eiche stehen dabei Schaderreger der Eichenfraßgesellschaft (Großer und Kleiner Frostspanner, Eichenwickler sowie Schwammspinner und Eichenprozessionsspinner) im Fokus. Bei der Kiefer wird das Auftreten der Kieferngroßschädlinge (Forleule, Kiefernspanner, Kiefernspinner und Kiefernbuschhornblattwespen) sowie der Nonne analysiert. Dabei wurden potentielle Einflussfaktoren wie Klima-, Standorts- und Bestockungsparameter mit dem Auftreten der Schaderreger verschnitten, um die jeweiligen Auswirkungen auf die Populationsdynamik der Schaderreger bewerten zu können. Bisherige Analysen deuten an, dass besonders im Frühjahr die Temperatur- und die Niederschlagsverteilung die Entwicklung der Fraßgesellschaften in der Eiche und in der Kiefer beeinflussen. 1(Waldhygienische-Klimaanpassungsstrategien, gefördert durch Waldklimafonds)
Vorträge Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 38
Aktuelle Untersuchungen zum Diplodia-Triebsterben und Endophyten der Waldkiefer
Johanna Bußkamp
Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Abteilung Waldschutz, Sachgebiet Mykologie/ Komplex-erkrankungen, Grätzelstraße 2, 37079 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Diplodia-Triebsterben, Endophyten
Das Diplodia-Triebsterben ist eine weltweit verbreitete Erkrankung an Koniferen, die durch den Schlauchpilz Sphaeropsis sapinea hervorgerufen wird. Da S. sapinea ein termophiler Pilz ist, wird davon ausgegangen, dass der Pilz unter den sich ändernden Bedigungen im Klimawandel vermehrt Schäden verursachen kann. Begünstigt wird die Erkrankung durch Vitalitätsverluste oder Vorschädigungen (z. B. Mistelbefall, Hagelschlag, Insektenfraß). Das Besondere an S. sapinea ist, dass der Pilz endophytisch, saprophytisch und parasitisch vorkommen kann. Tritt S. sapinea als Krankheitserreger auf, kommt es zum Verbraunen und Absterben der Triebspitzen, Rindenschäden und bei starker Schädigung schließlich zum Absterben des Baumes. Im Rahmen des WAHYKLAS-Projekts (gefördert vom Waldklimafonds), Teilprojekt 9, werden Faktoren untersucht, die dazu führen, dass S. sapinea Schäden an Pinus sylvestris hervorruft. Dazu wurden in klimasensiblen Regionen Waldkiefern mit Diplodia-Schadsymptomen hinsichtlich krankheitsauslösenden Faktoren untersucht (z.B. Mistel, Wurzelschwamm, Hagel, standörtliche Gegebenheiten). Weiterhin wurden entlang eines Transekts, das von Südwest bis Nordost quer durch Deutschland verläuft, an 90 Punkten der Wald-/Bodenzustandserhebung Kiefern untersucht. Für die 90 Punkte wurde das endophytische Vorkommen von S. sapinea ermittelt. Damit ergab sich ein umfassendes Bild über das endophytische Vorkommen von S. sapinea in Waldkiefern. Darüber hinaus wurden weitere Endophyten der Kiefer aus dem Kronenbereich aus Triebspitzen isoliert. Das Ziel dieser Untersuchungen war es potentielle, infolge des Kilmawandels profitierende, pilzliche Schaderreger und potentielle Antagonisten oder Beiarten in der Krone von Kiefern zu identifizieren.
Vorträge Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
39
Modellgestützte Gefährdungsabschätzung des Eichenprozessionsspinners
Paula Halbig1,2, Horst Delb1, Jörg Schumacher1, Axel Schopf2
1Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA), Abteilung Waldschutz, Wonnhaldestr. 4, 79100 Freiburg, [email protected], [email protected], [email protected] 2Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Institut für Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz (IFFF), Hasenauerstr. 38, 1190 Wien, Österreich, [email protected]
Schlagworte: Thaumetopoea processionea, Gefährdungsabschätzung, Setae, Klimawandel
Angesichts des in Mitteleuropa zunehmenden Auftretens des Eichenprozessionsspinners (EPS), Thaumetopoea processionea L., seit den 1990er Jahren, welches möglicherweise mit den aktuellen Klimaveränderungen zusammenhängt, wird der bereits bestehende hohe Bedarf an Handlungsempfehlungen und Lösungsansätzen zur Prognose und Reduktion der mit dem EPS verbundenen Gefahren zukünftig noch weiter ansteigen. Neben der Gefährdung der Wirtsbäume durch den Fraß der Raupen stellen insbesondere die von den Raupen gebildeten Gifthaare (Setae) ein Risiko für die menschliche Gesundheit dar. Aus diesem Grund soll ein Online-Frühwarnsystem zur regional differenzierten Einschätzung der aktuellen Entwicklungsbedingungen (Phänologie) und Populationsdichten des EPS sowie der daraus resultierenden Gefahren für Wald und menschliche Gesundheit entwickelt werden. Durch die Verknüpfung phänologischer und populationsdynamischer Grundlagen der EPS-Entwicklung mit der Ausbreitung der Gifthaare in der Luft in Abhängigkeit von räumlicher Entfernung, Witterung und Wetterprognose wird das gegenwärtige und zukünftige Risiko von Gifthaarbelastungen und Fraßschäden der Raupen abschätzbar. Die Nutzung des Modells, welches prinzipiell eine Anwendbarkeit im gesamten Verbreitungsgebiet des EPS vorsieht, ermöglicht und erleichtert somit eine zeitgerechte und effektive Durchführung präventiver und regulierender Maßnahmen im Hinblick auf einen zielgerichteten Pflanzenschutz und Gesundheitsschutz des Menschen.
Vorträge Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 40
Das Eschentriebsterben an Stichpunkten der Bundeswaldinventur in Baden-Württemberg
Rasmus Enderle1, Berthold Metzler1, Gerald Kändler1
1Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Wonnhaldestr. 4, 79100 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Eschentriebsterben, Bundeswaldinventur, Hymenoscyphus fraxineus
Das Eschentriebsterben, das durch den invasiven Pilz Hymenoscyphus fraxineus verursacht wird, gefährdet die gesamte zukünftige forstliche Nutzung der Europäischen Esche (Fraxinus excelsior). In Baden-Württemberg kommt die Esche bundesweit am häufigsten vor und ist daher von besonderer Bedeutung. Bisher lagen nur wenige für einen überregionalen Bereich repräsentative Daten zum Eschentriebsterben vor. Im Sommer 2015 wurde daher eine Bonitur zum Eschentriebsterben an über 500 zufällig ausgewählten Tracktecken der Bundeswaldinventur in Baden-Württemberg durchgeführt. Dabei erfolgte eine Kronenansprache, wobei die Kronenverlichtung als Indikator für die allgemeine Vitalität und der Ersatztriebanteil an der grünen Krone als Indikator für die Anfälligkeit gegenüber dem Eschentriebsterben in Prozentklassen erhoben wurden. Zudem wurden die Eschen auf das Vorhandensein einer Stammfußnekrose geprüft. Insgesamt setzten sich 39,2% des Eschenvorrats (Vorratsfestmeter mit Rinde) aus Bäumen mit über 60% Kronenverlichtung zusammen. Diese Eschen werden voraussichtlich in wenigen Jahren absterben oder müssen genutzt werden. Eschen, die eine Stammfußnekrose aufwiesen und somit ebenfalls akut gefährdet sind, machten 17,5% des Vorrats aus. Dieser hohe Anteil an abgängigen Eschen wird die Forstbetriebe vor gewaltige Herausforderungen stellen. Nur 6,7% des Vorrats bestand aus Eschen, die eine Kronenverlichtung und einen Ersatztriebanteil von unter 25% aufwiesen und auch nicht von einer Stammfußnekrose betroffen waren. Dieser Anteil kann als langfristig zukunftsfähig angesehen werden, weil bei diesen Eschen ein hoher Grad an Resistenz wahrscheinlich ist. Allerdings ist auch hier das Auftreten zusätzlicher Stammfußnekrosen nicht ausgeschlossen. Eine differenzierte Betrachtung nach Wuchsgebiet ergab für das Neckarland die geringsten Schäden durch das Eschentriebsterben. In der Oberrheinebene lag der Anteil des Vorrats von Eschen mit Stammfußnekrosen bei 42,7% und somit besonders hoch. Seit der BWI 3 im Jahre 2012 ging die Anzahl an Eschen mit einem BHD < 7 cm um 56,4% zurück. Allerdings war jetzt mit 31,9% ein relativ großer Anteil dieser Eschen gesund, was möglicherweise durch eine bereits einsetzende natürliche Selektion zu erhöhter Resistenz zu erklären ist. Literatur: Enderle R.; Kändler G.; Metzler B. (2015): Eschentriebsterben. In: Waldzustandsbericht 2015 für Baden-Württemberg. Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. ISSN: 1862-863X. S.46-54.
Vorträge Session 6: Lichte Wälder
41
Zeidlerei: Waldbienenhaltung und Biodiversität in lichten Wäldern
Frank Krumm1, Daniel Kraus1, Andreas Schuck1, Ulrich Mergner2 und Przemek Nawrocki3
1European Forest Institute, Wonnhaldestrasse 4, D-79100 Freiburg, [email protected], [email protected] 2Forstbetrieb Ebrach, Bayerische Staatsforsten, Ebrach, [email protected] 3WWF Polen, [email protected]
Schlagworte: Zeidlerei, Artenvielfalt, Wilde Honigbiene
Die Waldbienenhaltung in lebenden Bäumen oder Zeidlerei ist Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend aus Europa verschwunden. Ihren Schwerpunkt hatte sie in lichten Eichen- oder Kieferndominierten Wäldern Mittel- und Osteuropas bis in den Ural, wo das alte Handwerk in lindenreichen Eichenwäldern Bashkortastans (besonders im Naturreservat Shulgan Tash) überlebt hat. Von dort wurde sie kürzlich wieder nach Mitteleuropa zurückgebracht. Die wilde Honigbiene (Apis mellifera mellifera) ist ursprünglich ein Waldtier, das seine Nester z.B. in hohlen Bäumen anlegt. Frühe Formen der Zeidelei haben wohl nur den Honig wildlebender Bienenvölker geernet. Bald ging man aber dazu über, die natürliche Wohnung der Bienen in der Form von künstlich angelegten Stammhöhlen nachzuahmen, um höhere Bienendichten zu halten und den Honig auch gewerblich zu nutzen. Die Zeidler wurden mit hohen Privilegien ausgestattet, nicht nur weil Honig die einzige Zuckerquelle bis ins Industriezeitalter geblieben ist, sondern auch wegen des hohen Nutzens, den die Bienen auf die allgemeine Ökosystemproduktivität hatten. So konnten Zeidler auch bestraft werden, wenn sie nicht Bienenhöhlen in ausreichender Menge angelegt hatten. Mit dem Erstarken der modernen Forstwirtschaft wurde die Zeidelei immer mehr zum Problem, da die Pflege des Bienenhabitats nicht nur das Anlegen von grossen Stammhöhlen beinhaltete, sondern auch das Einkürzen der Kronen, um frühzeitig das Dickenwachstum der Zeidelbäume zu fördern. In vielen Fällen wurde auch regelmässig Feuer benutzt, um eine blütenreiche Bodenvegetation zu fördern, vor allem das Heidekraut (Calluna vulgaris). Aus Sicht der Förster waren Wälder mit intensiver Zeidelwirtschaft degradierte Flächen, die es in produktive Forste umzubauen galt. Durch diese Entwicklungen wurde die Zeidlerei wie viele andere Waldnebennutzungen aus den Wäldern verbannt, und auch die wilde Honigbiene ist in ihrem mitteleuropäischen Verbreitungsgebiet wohl ausgestorben. Die überdurchschnittliche gute Bienengesundheit sowie die naturschutzfachlich hochwertigen lichten Wälder des südlichen Ural haben auch das Interesse des Naturschutzes in Mitteleuropa an der Zeidlerei geweckt. In Polen gibt es mittlerweile schon eine mehrjährige Erfahrung mit der wiedereingeführten Technik, und im Jahr 2014 wurden auch im Steigerwald wieder erste Zeidelhöhlen angelegt. In diesem Beitrag möchten wir die gesammelten Erfahrungen und erste Erkenntnisse aus diesen Projekten vorstellen, und auch das Potenzial dieser alten und naturnahen Form der Bienenhaltung besonders im Zusammenhang mit der Pflege von historisch genutzten lichten Wäldern diskutieren.
Vorträge Session 6: Lichte Wälder 42
Die Entstehung schutzwürdiger Eichenwälder unter dem Einfluss waldbaulicher und sozioökonomischer Faktoren des 18. und 19.
Jahrhunderts
Andreas Mölder1, Marcus Schmidt, Peter Meyer1 und Hendrik Rumpf1
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Grätzelstraße 2, 37079 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Eichenwälder, Forstgeschichte, Habitatkontinuität, Sozioökonomie
Sowohl der Erhalt als auch die Pflege lichter und offener Wälder sind wichtige Ziele im Waldnaturschutz. Dabei ist die heutige Schutzwürdigkeit dieser Lebensräume regelmäßig das Resultat einstiger, nun als historisch geltender Bewirtschaftungsformen. Deshalb kann das Wissen um die Entstehung und Bewirtschaftungsgeschichte von lichten Wäldern wertvolle Hinweise für deren zukünftige Behandlung liefern. Von großer Bedeutung sind insbesondere solche Maßnahmen in der Vergangenheit, die zum Erhalt der Habitatkontinuität beigetragen haben. Insbesondere anspruchsvolle Arten, die eine Bindung an lichte und altholzreiche Eichenwälder aufweisen, sind nur sehr eingeschränkt zur Fernausbreitung befähigt und daher auf die Kontinuität ihres Lebensraumes angewiesen. Die übermäßige Nutzung von Alt-Eichen kann daher die örtliche Habitatkontinuität unterbrechen, wenn keine geeigneten Eichen als Ersatzquartiere in unmittelbarer Nähe verfügbar sind. Für verschiedene naturschutzfachlich wertvolle Eichenwälder in Nordwestdeutschland wird herausgearbeitet, welche waldbaulichen und sozioökonomischen Faktoren im 18. und 19. Jahrhundert die heutigen Waldstrukturen und Habitate bedingt haben. Dabei werden sowohl die politischen Hintergründe der waldbaulichen Entscheidungen als auch deren gesellschaftliche Begleitumstände beleuchtet. So war bei der Anlage von Eichenpflanzwäldern im hessischen Reinhardswald die Erzeugung von Stammholz ebenso ein Ziel wie die Bereitstellung von Huteflächen, Mastbäumen und günstigen Bedingungen für die Jagd. Für das Waldgebiet Bulau bei Hanau kann gezeigt werden, das gute Absatzmöglichkeiten von Holz in die benachbarten Städte dafür sorgten, dass die Landgrafschaft Hessen-Kassel nachdrücklich für den Erhalt der dortigen Eichenwälder eintrat. Im Waldgebiet Friedeholz bei Delmenhorst führten sowohl standörtliche Bedingungen als auch bäuerliche Huteberechtigungen zu einem dauerhaften Erhalt naturschutzfachlich wertvoller Eichenwälder. Abschließend werden Möglichkeiten diskutiert, frühere Bewirtschaftungsformen in die heutige Bewirtschaftungsplanung zu integrieren. Diese können von verstärkten Heisterpflanzungen über mittelwaldähnliche Schläge bis hin zur Wiederbelebung von Hutewäldern reichen.
Vorträge Session 6: Lichte Wälder
43
Zur Natürlichkeit der Stieleiche (Quercus robur L.) in Flussauen Mitteleuropas - eine Fallstudie aus dem Naturschutzgebiet „Kühkopf-
Knoblochsaue“ am Oberrhein
Albert Reif1, Ralph Baumgärtel2, Emil Dister3, Erika Schneider3, Johannes Wagner1
1 Professur für Standorts- und Vegetationskunde, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Universität Freiburg, Tennenbacherstr. 4, 79085 Freiburg, [email protected] 2 Umweltbildungszentrum, Außerhalb 27, 64589 Stockstadt am Rhein, [email protected]
3 Professur für Fluss- und Auenökologie, KIT - Institut für Geographie und Geoökologie, Außenstelle WWF-Auen-Institut, Josefstraße 1, D-76437 Rastatt, [email protected], [email protected]
Hartholzauwälder gehören mit bis zu acht Baumarten in der Kronenschicht zu den Wäldern mit der höchsten Baumartenvielfalt in Europa und sie beherbergen eine Vielzahl gefährdeter Tierarten, für die insbesondere die Stieleiche eine wesentliche Schlüsselart ist. Das Fehlen von Eichen in der Etablierungsphase in ansonsten eichenreichen Waldgesellschaften ist daher naturschutzfachlich gravierend. Daher wird in den wenigen verbliebenen Hartholzwäldern der Flüsse und Ströme mit großem waldbaulichem und finanziellem Aufwand versucht, zumindest einen Anteil an Stieleiche in die nächste Bestandesgeneration hinüber zu retten. Das Ausbleiben der natürlichen Verjüngung der Stieleiche in mitteleuropäischen Hartholzauen muss wesentlich auf die heute weitgehend fehlende Substratdynamik nach starken Hochwässern und damit verbunden natürliche Auensukzession sowie auf überhöhe Wildbestände zurückgeführt werden. Das Beispiel am Kühkopf zeigt, dass sich die Stieleiche nach starken Hochwasserereignissen auf neu aufgelandetem Substrat unter den dann konkurrenzarmen Bedingungen und bei zugleich kontrolliertem Wildstand in Hartholzauen erfolgreich natürlich etabliert, auch in die Baumschicht einwächst und somit auch Bestandteil der potentiellen natürlichen Vegetation von Hartholzauen ist.
Vorträge Session 6: Lichte Wälder 44
Trägt Stockausschlagnutzung zur De-Eutrophierung von Waldlebensräumen bei?
Jörg Ewald1
1Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Fakultät Wald und Forstwirtschaft, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 3, 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Biodiversität, Biotoppflege, Historische Waldnutzung, Stickstoffüberschuss
Stickstoff-Eutrophierung in Folge von Landnutzungswandel und Eintrag aus Landwirtschaft, Industrie und Verkehr ist eine Hauptursache für den Verlust von Biodiversität in Mitteleuropa. In vielen Teilen Mitteleuropas erfolgte Eutrophierung zeitgleich zur Aufgabe des Stockausschlagbetriebs und anderer Nebennutzungen der Wälder. Die Substitution traditioneller Waldprodukte durch fossile Brennstoffe und Mineraldünger als eine unmittelbare Ursache der Eutrophierung markiert den sozio-ökonomischen Übergang von der Subsistenz zum Überfluss. Ist Stockausschlagnutzung im Umkehrschluss geeignet um unter modernen Bedingungen der Eutrophierung entgegenzuwirken? In Ermangelung von entsprechenden Langzeitversuchen sind De-Eutrophierungsstudien auf Messungen von Nährstoffen in Böden und Biomasse oder auf Nachweise von Reaktionen in der Artenzusammensetzung angewiesen. Die wissenschaftliche Literatur wurde nach entsprechenden Studien zur Nutzungsaufgabe, zu Umtriebs-Chronosequenzen und zu Effekten der Wiederaufnahme durchsucht. Direkte Nachweise zur Verarmung von Böden oder Ökosystemvorräten durch Stockausschlagnutzung sind extrem selten. Wiederholte Vegetationsaufnahmen von früher genutzten Plots nach Jahrzehnten der Nutzungsaufgabe liefern die meisten Hinweise, sind jedoch durch Überlagerung von Nährstoffangebot und Lichtverfügbarkeit schwer interpretierbar. Chronosequenzen von Stockausschlagsystemen belegen nicht-lineares Verhalten, mit kurzen Phasen der Überschussnitrifikation und anschließenden artenarmen Dickungsstadien, in welchen Nährstoffe in Oberboden und Biomasse angehäuft werden. Eine Phase mit Mangelzeigern (Arten magerer Feuchtwiesen und Säume) wurde dagegen nur ausnahmsweise unter besonderen geologischen Bedingungen nachgewiesen. In Renaturierungsexperimenten dominiert der initiale Nährstoffsschub gegenüber etwaigen Verarmungseffekten. Die Ergebnisse des Reviews zeigen die Notwendigkeit einer gleichzeitigen Untersuchung von Böden und Biodiversität in Stockausschlagwäldern über ganze Bewirtschaftungszyklen hinweg auf. Unter heutigen Eintragsregimes muss naturschutzfachlich motivierter Stockausschlagbetrieb durch zusätzliche Entzüge von Bodenvegetation, Streu oder Humus flankiert werden, was wiederum den nachhaltigen Energieholzertrag schmälert. Deshalb wird er selbst angesichts der Renaissance der Energieholznutzung eine atypische Nutzungsform bleiben, die spezifische finanzielle Anreize erfordert.
Vorträge Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität
45
Nutzung struktureller Funktionalität zur Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen in Wäldern
Franka Huth1 und Sven Wagner1
1Institut für Waldbau und Waldschutz, Fakultät Umweltwissenschaften, TU Dresden, Pienner Straße 8, 01737 Tharandt, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Strukturelemente, räumliche Optimierung, waldbauliche Maßnahmen
Waldbauliches Handeln beruht auf der Etablierung räumlicher Strukturen und deren Kombinationen, um definierte Effekte und Wirkungen zu erzielen. Die Festlegung der Wirkungszeiträume spezifischer Waldstrukturen (z. B. Zeitmischungen) liegt weitgehend in der Verantwortung der Waldeigentümer. Dieses Vorgehen unterstellt unter definierten Rahmenbedingungen einen kausalen Determinismus, d. h. die weitgehende Vorhersagbarkeit möglicher Ökosystemdienstleistungen anhand der Waldstrukturen. Die deterministische Verwendung von Waldstrukturen und Strukturelementen unterliegt jedoch zeitlichen und räumlichen Restriktionen. Bezüglich der zeitlichen Betrachtungsebene ergeben sich grundsätzlich Unsicherheiten, da nicht alle Rahmenbedingungen dauerhaft kontrollierbar und im Detail vorhersagbar sind (z. B. Klimawandel). In Wäldern ist die Kombination unterschiedlicher Strukturelemente außerdem durch den verfügbaren Raum begrenzt. Innerhalb einer definierten Waldfläche besteht somit eine ausgeprägte räumliche Konkurrenz zwischen Strukturelementen (z. B. Konkurrenz zwischen Baumarten) und die daran gebundenen Ökosystemdienstleistungen. Gegenwärtig existieren für die vier Hauptkategorien von Ökosystemdienstleistungen, die sich mit (i) der Regulierung und (ii) Unterstützung ökologischer Prozesse, (iii) der Versorgung mit Rohstoffen und Nahrungsmitteln und (iv) der Bereitstellung kultureller Werte befassen, unterschiedlich gute Kenntnisse zum Zusammenhang zwischen Waldstruktur und Leistungserbringung. Begründet durch die Geschichte des Waldbaus gibt es vergleichsweise viele Untersuchungen, die sich mit Fragen der Rohstoffversorgung (z. B. Quantität und Qualität von Holz) als Ergebnis einer konkreten Baumartenkonstellation oder Waldstruktur befassen. Auch die Funktionalität von Baumarten und Waldstrukturen zur Regulierung der Wassergabe und die daran gebundene Wasserqualität erlangten in der jüngsten Vergangenheit große Aufmerksamkeit. Im Vergleich dazu müssen weiterführende Informationen zur Förderung kulturell wichtiger Ökosystemdienstleistungen erhoben werden, die sich ebenfalls anhand konkreter Waldstrukturen und räumlicher Wirkungsbereiche beschreiben lassen.
Vorträge Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität 46
The functional significance of forest biodiversity in Europe
Michael Scherer-Lorenzen1, 2
1Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fakultät für Biologie, Abt. Geobotanik, Schänzlestr. 1, D-79104 Freiburg, [email protected] 2 and all members of the FunDivEUROPE project
Schlagworte: tree diversity, ecosystem functioning
A number of global change drivers, such as land use change and management, climate change, or air-borne eutrophication, have considerable impacts on the biological diversity of forest ecosystems. Understanding and forecasting the consequences of these changes in biodiversity on ecological processes, functions and the delivery of ecosystem services is certainly one of the major challenges for ecological research. I report on results from a large-scale, pan European project (FunDivEUROPE – Functional significance of forest biodiversity in Europe, www.fundiveurope.eu) that investigated the relationship between tree diversity and ecosystem functioning adopting three complementary approaches: (i) tree diversity experiments, with a gradient of diversity created by planting new stands differing in species richness and composition (“Experimental Platform”), (ii) comparative plots in mature stands of six major European forest types, with stands selected along existing gradients of tree diversity (“Exploratory Platform”), and (iii) data from National Forest Inventories from several European countries, analysed for functional diversity signals (“Inventory Platform”). A large variety of ecosystem characteristics and processes have been measured, including data on associated biodiversity, growth and C sequestration, nutrient cycling and water balance. The study suggests a positive relationship between tree diversity and functions related to productivity, associated biodiversity, and soil parameters. However, no and even negative effects were also documented for other ecosystem processes, and effects of species identity were usually larger than those of diversity. In addition, disentangling the diversity signal from confounding environmental heterogeneity remains difficult. Comparisons of tree species performance in pure and mixed plantations imply that changes in light acquisition and plant nutrition may be important underlying mechanisms for the observed diversity effects. The question then arises whether we can design mixed species forest stands that capitalize on the different diversity effects to enhance and stabilize the delivery of multiple ecosystem services. So, can we use the diversity of trees as a tool to manage future forests? This implies consideration of knowledge at very different levels, ranging from species functional traits, interspecific mixing effects, but also trade-offs between different ecosystem services or stand versus landscape perspectives.
Vorträge Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität
47
Rohstoffe für Arzneimittel, Lebensmittel und Kosmetik: Gesundheit und Wohlbefinden aus dem Wald
Barbara Michler 1, Anton Fischer 1, Hagen S. Fischer 1
1Fachgebiet Geobotanik, Technische Universität München, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, D-85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: MAPs, traditionelles Kulturgut, Waldpflanzen
Neben der offensichtlichen Funktion als Nutzholzlieferant erfüllen Wälder seit jeher viele weitere Ökosystemleistungen. Dazu zählt u.a. die Bereitstellung pflanzlicher Rohstoffe für Arzneimittel, Kosmetika, Lebensmittel und Industrierohstoffe, „Medicinal and Aromatic Plants“ (MAPs) genannt. Wir konnten in einer Studie das Potential an MAPs in naturnahen Wäldern erfassen, und zwar am Beispiel Bayerns. Vier zentrale Fragestellungen werden verfolgt: Welche MAPs finden sich in Wäldern? Wo in Bayern kommen MAPs bevorzugt vor? In welchen Waldgesellschaften kommen MAPs bevorzugt vor? Welche MAPs werden aktuell verwendet? Eine Datenbank mit einheimischen MAPs wurde auf der Basis pharmazeutischer Monographien und Standardliteratur erstellt. Informationen über MAPs in Nahrungsmitteln und Kosmetika wurden integriert. Die MAP-Datenbank wurde mit der Waldgefäßpflanzenliste Deutschlands, mit Verbreitungskarten nach FlorKart und mit den Angebotslisten von Firmen, die mit MAPs handeln, verschnitten um herauszufinden, welche MAPs in Deutschland vorkommen, welche MAPs in Wäldern wachsen und welche davon aktuell im Handel sind. Der Vergleich der MAPs-Liste mit Vegetationsaufnahmen der Naturwaldreservate Bayerns gibt Aufschluss darüber, in welchen Waldgesellschaften MAPs natürlicherweise auftreten. Weiterhin wurde ermittelt, welche Waldgesellschaften reich respektive arm an Arzneipflanzen sind. In Wäldern finden sich zahlreiche Arten, die früher genutzt wurden und die auch heute als Quelle von medizinischen Produkten ein wirtschaftliches Potential besitzen. Aktuell werden diese Rohstoffe bei uns aber wenig genutzt; stattdessen werden sie importiert. Dies hat zur Folge, dass in den Köpfen vieler Menschen die Verbindung zum Wald als Rohstofflieferant für Gesundheit und Wohlbefinden nicht mehr existiert. Die Nutzung einheimischer MAPs bietet Chancen; sie liegen in der kreativen Schaffung neuer Produkte und sind ökonomisch tragfähig. Sie bringen den ald „täglich auf den Tisch“. Lokale und regionale Wertschöpfung und Direktvermarktung können weit über die Bereitstellung des Rohstoffes hinaus zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Einkommensverhältnisse der Waldbauern beitragen und der Wald könnte zurück in die Köpfe der Menschen kehren.
Vorträge Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität 48
Von Rein- zu Mischbeständen: ist Artenreichtum der Schlüssel zu einem multifunktionalen Wald?
Laura Schuler1, Harald Bugmann1 und Rebecca S. Snell1
1Professur für Waldökologie, Institut für terrestrische Ökosysteme, ETH Zürich, 8092 Zürich, Schweiz, [email protected]
Schlagworte: Landschaftsmodellierung, Ökosystemdienstleistungen, Baumartenvielfalt, Höhengradient
Die Überführung von Reinbeständen in standortsgerechte Mischwälder wird als vielversprechender Ansatz gesehen, um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern und zugleich vielfältige Waldfunktionen aufrechtzuerhalten. Indessen ist noch wenig bekannt darüber, welche Baumartenmischungen und Bestandesstrukturen erfolgsversprechend sind, um die drohenden Folgen zu verringern. Wir befassten uns mit verschiedenen Mischbeständen und ihrer Fähigkeit, ausgewählte Ökosystemleistungen sowohl innerhalb eines Bestandes als auch auf Landschaftsebene bereitzustellen. Hierzu benutzten wir das Landschaftsmodell LandClim und simulierten alle relevanten Mischungen der dominanten Baumarten in zwei Untersuchungsgebieten: im Dischma, einem hochalpinen Tal in der Schweiz, sowie am Feldberg im Schwarzwald. Analysiert wurden vier Leistungen: Schutz gegen Steinschlag, Schutz vor Lawinen, Habitatqualität sowie Holzproduktion. Wir verwendeten die multikriterielle Entscheidungs-unterstützungsmethode PROMETHEE, um alle simulierten Rein- und Mischbestände zu vergleichen und mögliche Synergien und Trade-offs zwischen den Ökosystemleistungen zu untersuchen. Unsere Analyse zeigte, dass Mischbestände generell besser abschneiden, falls mehrere Waldfunktionen gleichzeitig erfüllt werden sollen. Im Falle von einzelnen Leistungen wie Holzproduktion oder Steinschlagschutz waren jedoch Reinbestände teilweise besser geeignet. Unsere Resultate weisen zudem darauf hin, dass sich klimatische Bedingungen und Höhenunterschiede stark auf die Bestandesstruktur auswirken können und deshalb auch auf die Ökosystemleistungen. Beispielsweise kann ein reiner Fichtenbestand in der hochmontanen Stufe durchaus effektiver gegen Steinschlag sein als ein Mischbestand. In der subalpinen Stufe hat jedoch ein Mischwald bestehend aus Lärche und Fichte die grössere Schutzwirkung. Die Fähigkeit eines Waldbestandes, verschiedenste Leistungen bereitzustellen, hängt stark ab von der Position innerhalb der Landschaft, den spezifischen Eigenschaften der Baumarten und der Artenzusammensetzung selbst. Unser Ansatz ermöglicht es, diese Zusammenhänge zu quantifizieren, und liefert eine gute Grundlage, um Klimaszenarien sowie Störungsregimes mit einzubeziehen, um unser Wissen über klima- und störungsgerechte Mischwälder zu konsolidieren und zu erweitern.
Vorträge Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität
49
Bundesforst – Funktionaler Waldbau für die Streitkräfte
Peter Mann1 und Georg Reitz2
1 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Zentrale Bundesforst, Außenstelle Berlin; Grellstr. 18; 10409 Berlin, [email protected] 2 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Zentrale Bundesforst, Ellerstr. 54 – 56; 53119 Bonn, [email protected]
Schlagworte: Waldfunktionen, Waldbau als Dienstleistung, Lärmschutz, Erträge
Bundesforst betreut ca. 180.000 ha Wald auf Liegenschaften der Bundeswehr. Besonders auf Übungsplätzen dient Wald zunächst als Kulisse für ein realitätsnahes Übungsgeschehen. Der militärische Schieß- und Übungsbetrieb beansprucht dabei in erheblichen Maße die jeweilige Liegenschaft selbst, zum anderen wird auch das zivile Umfeld in unterschiedlichem Maße beeinflusst, z.B. durch Schießlärm großkalibriger Waffen oder Staubentwicklung durch Fahrbetrieb. Vor diesem Hintergrund hat die Bundeswehr sich im Rahmen der Eigenbindung hohe Standards im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes gesetzt, um mit den natürlichen Ressourcen möglichst schonend umzugehen und das Störpotential für das Umfeld zu minimieren. Der Auftrag an den Dienstleister Bundesforst bezieht sich folgerichtig primär darauf, Waldlandschaften mit Blick auf die militärischen Anforderungen zu gestalten. Der gedankliche Schritt zu der in der Forstwissenschaft üblichen Betrachtung von Waldfunktionen liegt nahe. Auf Grundlage dieser grundsätzlichen Überlegungen wurden die militärischen Waldfunktionen gemeinsam mit der Bundeswehr systematisch definiert und beschrieben. Sie werden zu Beginn einer jeden Forsteinrichtung gemeinsam mit dem militärischen Nutzer flächenscharf festgelegt. Die waldbauliche Einzelplanung zielt auf eine Optimierung der jeweiligen Waldfunktion ab. Da insbesondere der Lärmschutz auf Schießplätzen besonders bedeutsam ist, wurden in einer Studie Wälder hinsichtlich ihrer Bestandesstruktur geclustert und im Feldversuch auf ihre Dämpfung für niederfrequenten Schießlärm großkalibriger Militärwaffen lärmphysikalisch untersucht. Ziel des Vortrages ist es, die systematische Definition militärischer Waldfunktionen als Ziel waldbaulicher Planung bei Bundesforst darzustellen. Weiterhin werden die Ergebnisse der lärmphysikalischen Feldversuche vorgestellt und Folgerungen für den funktionalen Waldbau gezogen. Schließlich wird erläutert, dass die Bundeswehr als Leistungsempfänger für die Sicherung der Waldfunktionen die Kosten erstattet.
Vorträge Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität 50
Where and when are mixed forests more productive than monocultures?
David Forrester1 und Jürgen Bauhus1
1Professur für Waldbau, Institut für Forstwissenschaften, Universität Freiburg, [email protected], [email protected]
Schlagworte: mixed-species stand, tree-species diversity, forest growth model
Mixed-species forests and plantations sometimes have greater levels of ecosystem functions and services, including productivity, than monocultures. Whether or not mixtures are more productive depends on the net effects of different types of interactions, and these are dynamic, changing through space and time with resource availability or climatic conditions. These spatial and temporal dynamics have now been examined in many studies and the general patterns are summarised in this presentation using a simple conceptual model; a positive mixing effect is predicted to increase as the availability of resource “X” declines (or climatic condition “X” becomes harsher) if the species interactions improve the availability, uptake or use efficiency of resource “X” (or interactions improve climatic condition “X”). Within a given mixed-species forest there are often several different types of species interactions that occur simultaneously and affect the net mixing effect (e.g. light-related, water-related or nutrient-related interactions). The spatial and temporal dynamics of multiple simultaneously occurring interactions cannot easily be predicted using empirical analyses. Therefore a relatively simple process-based forest growth model is presented here to examine the spatial and temporal dynamics of a mixed-species forest. Such models might be used to develop silvicultural regimes for mixed-species forests.
Vorträge Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität
51
Eine heterogene Kronenstruktur erhöht die Produktivität von Buchenwäldern: Ergebnisse aus drei Urwäldern in der Ostslowakei
Jonas Glatthorn1, Eike Feldmann1, Markus Hauck2, Stefan Kaufmann1 und Christoph Leuschner1
1Unitversität Göttingen – Pflanzenökologie und Ökosystemforschung, Göttingen, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 2Universität Oldenburg – Funktionelle Ökologie der Pflanzen, Oldenburg, [email protected]
Schlagworte: Strukturdiversität, Produktivität, Rotbuche, Lichttransmission
Wird die Produktivität von Wäldern durch erhöhte Arten- oder funktionale Diversität gesteigert? Dieser Fragestellung wurde in jüngster Zeit durch viele experimentelle oder vergleichende Studien nachgegangen und es liegen Hinweise vor, dass Mischungen von sich funktionell gegenseitig ergänzenden Baumarten produktiver als Reinbestände sind. Auch Reinbestände der Rotbuche sind jedoch an vielen Standorten sehr produktiv, obwohl die Artenzahl minimal ist. Wir stellen die Hypothese auf, dass der vermutete positive Zusammenhang zwischen Diversität und Produktivität auch für Buchenreinbestände gilt, in diesem Fall allerdings im Hinblick auf die strukturelle Diversität der Krone. Die hohe innerartliche morphologische und physiologische Plastizität der Buche erzeugt nach dieser Hypothese eine Vielfalt an Strategien der Ressourcennutzung, ähnlich wie dies in artenreichen Mischwäldern angenommen wird. Optimale Bedingungen zur Prüfung dieser Hypothese bieten Urwälder mit ihrem hohen Strukturreichtum. In drei Buchenurwäldern in der Ostslowakei haben wir sowohl den jährlichen Zuwachs an Holzbiomasse als Maß für die Produktivität als auch die Heterogenität der Kronenstruktur als Maß für Diversität in der Lichtnutzung untersucht. Zur Berechnung der Heterogenität der Kronenstruktur haben wir dabei Lichttransmissionsmessungen mit hohem Stichprobenumfang pro Untersuchungsfläche durchgeführt. Von einer hohen Streuung an auftretenden Transmissionswerten wurde auf ein heterogen aufgebautes Kronendach geschlossen. Die Produktivität wurde mit multiplen linearen Modellen in Abhängigkeit von Struktur- und Umweltparametern für verschieden strukturreiche Plots beschrieben. Das beste Model weist einen signifikanten Effekt der Strukturdiversität auf die Produktivität der Holzbiomasse für die untersuchten Wälder nach. Es wird eine Steigerung der Produktivität um ca. 1 Mg ha-1 a-1 für eine heterogene im Vergleich zu einer homogenen Kronenstruktur vorhergesagt. Im Vergleich zum Mittel ist das eine Erhöhung um ca. 20 % in strukturreichen Beständen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Strukturvielfalt auch im Reinbestand zu einer Erhöhung der Produktivität gegenüber einem strukturarmen Hallenwald führen kann, offenbar weil die Ressource Licht stärker ausgenutzt wird, ähnlich wie das für artenreiche Mischbestände vermutet wird. Diese Befunde erlauben Schlussfolgerungen für die Bewirtschaftung von Reinbeständen der Buche im Hinblick auf die Eignung von Waldbaukonzepte, die Strukturreichtum fördern.
Vorträge Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität 52
Strukturdiversität und Zuwachs in Bergmischwäldern Südwestdeutschlands
Adrian Dănescu1, Axel Albrecht1 und Jürgen Bauhus2
1Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Wonnhaldestr. 4, 79100 Freiburg, [email protected], [email protected] 2 Professur für Waldbau, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tennenbacherstr. 4, 79108 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Baumartendiversität, Holzproduktion, Kreisflächenzuwachs, Konkurrenz
Mögliche Beziehungen zwischen Baumartendiversität und Waldökosystemfunktionen wurden in den letzten Jahrzehnten intensiv untersucht. Im Gegensatz dazu gab es deutlich weniger Studien, die den komplexen, zusammenhängenden Einfluss der Baumartendiversität, der Strukturdiversität und von abiotischen Faktoren auf verschiedene Waldfunktionen analysierten. Wir untersuchten den Einfluss solcher Faktoren auf die Holzproduktion. Dafür verwendeten wir die Daten aus 52 langfristigen Versuchsflächen in Baden-Württemberg, mit breiten Diversitätsgradienten und mehr als 53.000 wiederholten Baumbeobachtungen. Der Grundflächenzuwachs wurde als Näherungsvariable für die Produktivität eingesetzt und es wurde angenommen, dass (1) die Diversität der Baumdimensionen einen signifikanten, positiven Einfluss auf die Baum- und Bestandesproduktivität hätte, und (2) die Diversitäts-Produktivitäts-Beziehung stärker für die strukturelle Diversität als für die Baumartendiversität wäre. Lineare gemischte Modelle wurden eingesetzt um die Diversitäts-Produktivitäts-Beziehungen zu testen, unter gleichzeitiger Berücksichtigung konventioneller Zuwachsfaktoren. Auf der Baumebene wurden unterschiedliche Modelle für die drei häufigsten Baumarten in unserem Datensatz (Tanne, Fichte und Buche) gebaut, wohingegen die aggregierten Zuwachsreaktionen aller vorhandenen Baumarten auf der Bestandesebene verwendet wurden. Zusätzlich, um die direkte und indirekte Abhängigkeit der Bestandesproduktivität von Struktur- und Baumartendiversität testen zu können, wurden Strukturgleichungsmodelle gebaut. Die linearen, gemischten Modelle deuteten auf positive signifikante Beziehungen zwischen den Diversitätsvariablen und relativem Bestandesgrundflächenzuwachs. Jedoch hatte die Strukturdiversität einen leicht stärkeren Einfluss auf diese Antwortvariable. Die Strukturgleichungsmodelle bestätigten, dass in unserem Datensatz direkte und indirekte Einflüsse der Baumartendiversität auf die Bestandesproduktivität nur eine marginale Rolle spielten. Die Strukturdiversität (aber nicht die Baumartendiversität) hatte einen starken, positiven Einfluss auch auf den Baumgrundflächenzuwachs (insbesondere auf große Bäume, mit niedrigen Konkurrenzdruck). Anhand eines einzigartigen Datensatzes aus Südwestdeutschland, bringen unsere Ergebnisse neue Erkenntnisse in die Diversität-Produktivität-Debatte ein.
Vorträge Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität
53
Does belowground interaction with Fagus sylvatica increase drought susceptibility of photosynthesis and stem growth in Picea abies?
Michael Goisser1, Uwe Geppert2, Thomas Rötzer3, Karl-Heinz Häberle1, Taryn Bauerle4, Hans Pretzsch3, Karin Pritsch2, Rainer Matyssek1, Thorsten Grams1
1 Chair for Ecophysiology of Plants, Technische Universität München, Hans Carl von Carlowitz-Platz 2, Freising-Weihenstephan, [email protected] 2 Institute of Soil Ecology, Helmholtz Zentrum München, Ingolstädter Landstraße 1, Neuherberg 3 Chair for Forest Growth and Yield Science, Technische Universität München, Hans Carl von Carlowitz-Platz 2, Freising-Weihenstephan 4School of Integrative Plant Science, Cornell University, Ithaca, NY, USA
Keywords: beech-spruce mixture, climate change, species interaction, drought susceptibility
Mixed stands of European beech (Fagus sylvatica L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) frequently reflect over-yielding, when compared to respective monospecific stands. Over-yielding is attributed to enhanced resource uptake efficiency through niche complementarity alleviating species competition, for example enhanced root stratification in mixture, with deep rooting in beech, but shallow rooting in spruce. Under severe and frequent summer drought, however, water limitation may become crucial in modifying the prevailing competitive interaction in mixed beech-spruce forests. We hypothesize, therefore, that under drought (HI) neighborhood with beech reduces water accessibility for spruce more than does intra-specific competition, so that (HII) mixture with beech exacerbates drought susceptibility of photosynthesis and stem growth in spruce. Analyzed were leaf, tree and stand scales in a maturing forest with beech-spruce group mixture. In interaction with beech, fine-root production and depth of water uptake in spruce was shifted to shallow, drought-prone soil horizons, in agreement with (HI). Overall, both lowered production and ramification of fine roots and reduction of long-distance ectomycorrhizal exploration types indicated decreased dynamics and intensity of soil exploitation in spruce when growing together with beech. High drought sensitivity of spruce was mirrored by distinct decrease in stomatal conductance, net CO2 uptake rate and stem growth during periods of water limitation. Notwithstanding, species interaction effects were absent in leaf gas exchange and stem growth, during six-week summer drought in 2013 as well as in the extremely dry year of 2003, hence rejecting (HII). Evidently the group-wise mixture pattern exposes spruce to beech competition only along group edges, i.e. laterally only, so that the putatively adverse beech effect stays limited. Our results suggest, compared to single tree mixture, beech-spruce group neighborhoods to be the favorable silvicultural option in the face of climate change.
Vorträge Session 8: Funktionelle Bedeutung von Totholz 54
Energieholzlager im Wald: Henkersmahlzeit für xylobionte Käfer?
Thibault Lachat1, Elena Haeler1,2, Beat Wermelinger1
1 Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf, [email protected], [email protected], [email protected] 2 Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL, Länggasse, 85, CH-3052 Zollikofen,
Schlagworte: Totholz, Waldenergieholz, xylobionte Käfer, ökologische Falle
Die Nachfrage nach erneuerbaren Energieressourcen steigt weltweit. In der Schweiz ist vorgesehen, dass die Energieholz-Ernte innerhalb der nächsten Jahrzehnte von 1,5 Millionen m3 pro Jahr auf 2,7 bis 3,2 Millionen m3 erhöht wird. Die Nutzung von Energieholz birgt jedoch Herausforderungen für den Erhalt der Biodiversität im Wald. Besonders xylobionte, also von Totholz abhängige Arten könnten gefährdet sein. Einerseits wird mehr Totholz dem Bestand entnommen, da nun auch minderwertiges Holz genutzt werden kann. Andererseits können Energieholzlager, auf denen das Energieholz für einen Sommer gelagert und getrocknet wird, sogenannte ökologische Fallen darstellen. Denn die meisten Insekten können ihre Entwicklung im Holz nicht abschliessen bevor es gehäckselt wird. In dieser Studie haben wir die Auswirkungen der Holzlager und deren Platzierung entlang eines Licht-Gradienten auf xylobionte Käfer untersucht. Dazu wurden in bewirtschafteten Buchenwäldern an 20 Standorten jeweils bei Energieholzlagern und im umgebenden Wald eine Flugfalle installiert. Des Weiteren wurden Äste (5-10 cm) und Stammholz (20 cm) von Holzlagern gesammelt, in Schlupffallen gelagert und die daraus schlüpfenden Käfer gefangen. Bei den Energieholzlagern wurden 2-3 mal mehr Arten und Individuen gefunden als in den Fallen im angrenzenden Wald, was zeigt, wie stark solche Lager xylobionte Käfer anlocken. Die Sonneneinstrahlung hatte wenig Einfluss auf die Artenzahl und Abundanz. Die relative Attraktivität nahm jedoch mit zunehmender Strahlung ab: an hellen Standorten war der Unterschied der Artenzahl zwischen Lager und Wald kleiner als an dunklen Standorten. Durch die beiden Faktoren Wald/Lager und Sonneneinstrahlung wurde ausserdem die Artenzusammensetzung signifikant beeinflusst. Auch bei den Holzstücken in den Schlupffallen zeigte sich eine Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung. Während es beim Stammholz keinen Effekt gab, wurden bei den Ästen mehr Arten gefunden, je heller der Herkunftsort der Holzstücke war. Diese Studie bestätigt, dass Energieholzlager eine sehr hohe Attraktivität für xylobionte Käfer haben. Die Ergebnisse lassen jedoch auch Schlüsse zu, wie die Anlockungswirkung reduziert werden könnte: (1) Lager in grösseren Gebieten mit hellem Wald anlegen, weil die relative Attraktivität dort geringer ist und (2) an dunklen Standorten Lager mit einer Schicht aus dünnen Ästen abdecken, da diese von xylobionten Käfern weniger besiedelt werden als Stammholz.
Vorträge Session 8: Funktionelle Bedeutung von Totholz
55
Die Bedeutung von Windwurf und Holzräumung für die Insektenvielfalt in verschiedenen Waldtypen
Beat Wermelinger1, Marco Moretti2 , Peter Duelli2, Thibault Lachat1, Gianni Boris Pezzatti3 und Martin K. Obrist2
1Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Abt. Walddynamik, Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf, [email protected]; [email protected] 2Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Abt. Biodiversität und Naturschutzbiologie, Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf, [email protected]; [email protected]; [email protected] 3Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Abt. Ökologie der Lebensgemeinschaften, A Ramél 18, CH-6594 Cadenazzo, [email protected]
Schlagworte: Windwurf, Insekten, Biodiversität, Schlagräumung
Windwurf ist in der natürlichen Walddynamik ein wichtiger ökologischer Treiber. Üblicherweise werden Sturmflächen aber aus ökonomischen oder phytosanitären Gründen so schnell wie möglich geräumt. Dies bedeutet allerdings einen erheblichen Eingriff in die natürliche Sukzession der Pflanzen- und Tiergemeinschaften. Da die Häufigkeit und Intensität von Stürmen im Zuge des fortschreitenden Klimawandels eher zunehmen werden, sind möglichst detaillierte Kenntnisse über die ökologischen Auswirkungen der Sturmholzräumung nötig. Zwei und fünf Jahre nach dem Sturm Lothar (1999) wurde in drei Windwurfgebieten der Schweiz die Zusammensetzung der Arthropoden- (Gliederfüsser) Fauna erhoben. In jedem Gebiet untersuchten wir mit verschiedenen Fallentypen jeweils während der ganzen Vegetationsperiode die Insekten- und Spinnenfauna auf ungeräumten (belassenen) und vom Sturmholz geräumten Windwurfflächen sowie im angrenzenden intakten Wald. Bei fast allen taxonomischen Einheiten und funktionellen Gruppen (Bestäuber, Totholzbewohner, Räuber) waren die Artenvielfalt und Abundanz auf den Windwurfflächen deutlich höher als im intakten Wald. Zwischen den beiden Räumungsbehandlungen (belassen/geräumt) zeigten sich jedoch kaum Unterschiede in der Artenvielfalt, trotz unterschiedlichem Totholzangebot auch nicht für die xylobionten Käfer. Hingegen unterschied sich die Zusammensetzung der Artengemeinschaften nicht nur zwischen intaktem Wald und Windwurf, sondern auch zwischen geräumten und ungeräumten Windwurfflächen. Auch die gefährdeten Käfer (Rote-Liste-Arten) wiesen im Windwurf höhere Artenzahlen auf als im intakten Wald. Dies liess sich sowohl im Nadelwald als auch im Laub- und Mischwald feststellen. Nur im intakten Wald anzutreffende Spezialisten gab es nur wenige, hingegen wiesen die Analysen zahlreiche Indikatorarten – meist Wanzen und Stechimmen – für die offenen Windwurfflächen aus. Unsere Untersuchungen zeigten, wie wichtig Windwürfe für die Erhaltung der Biodiversität sind. Da geräumte und belassene Sturmflächen zwar ähnliche Artenzahlen von Arthropoden zeigen, jedoch ein unterschiedliches Artenspektrum, führt ein regionales, kleinräumiges Mosaik von belassenen und geräumten Windwurfflächen zusammen mit intakten Beständen zu einem Optimum der Artenvielfalt.
Vorträge Session 8: Funktionelle Bedeutung von Totholz 56
Funktionale Diversität in stürmischen Zeiten – Strategien für Biodiversitätsschutz in der Aufarbeitung von Windwürfen
Simon Thorn1
1Nationalpark Bayerischer Wald, Sachgebiet Naturschutz und Forschung, Freyunger Straße 2, 94481 Grafenau, [email protected]
Schlagworte: Totholz, Phylogenie, Sturm, Sanitärhieb
In den Wäldern der Nördlichen Hemisphäre haben natürliche Störungen wie Waldbrände, Borkenkäferausbrüche oder Stürme in den vergangenen Dekaden stark zugenommen. Um Wertverluste durch Folgeschäden zu minimieren werden betroffene Flächen meist mit Nachdruck aufgearbeitet. Diese sogenannten Sanitärhiebe haben jedoch vielfältige Effekte auf Habitatstrukturen und Biodiversität. Der Vortrag gibt einen Überblick über die Auswirkungen von Sanitärhieben nach Windwürfen auf die funktionale Zusammensetzung unterschiedlicher Artengruppen. Beispielsweise wurden Gemeinschaften von xylobionten Käfer durch Sanitärhiebe nach Windwürfen deutlich in Richtung größerer und schattenadaptierter Käferarten verschoben. Dies deutet auch auf den Verlust von kleinen, sonnenliebenden Arten hin und kann daher mit dem Verlust von trockenen, exponierten Ästen in Verbindung gebracht werden. Eine Kombination aus funktionalen Arteigenschaften und Verwandtschaft zeigte zudem, dass Sanitärhiebe die Prozesse verändern, die Artgemeinschaften unter natürlichen Bedingungen strukturieren. So gingen beispielweise Käferarten indirekt verloren, da der Konkurrenzdruck um verbliebenes Totholz nach Sanitärhieben stark angestiegen ist. Solche funktionalen Analyseansätze können die Entwicklung von detaillierten Managementempfehlungen für einen nachhaltigeren Umgang mit natürlichen Störungen vereinfachen, vor allem, wenn sehr artenreiche Gruppen geschützt werden sollen.
Vorträge Session 8: Funktionelle Bedeutung von Totholz
57
Einfluss von Totholz auf die Stabilität der organischen Bodensubstanz
Janna Wambsganß1, Kenton Stutz1 und Friederike Lang1
1Professur für Bodenökologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Bertoldsstraße, [email protected]
Schlagworte: Buchentotholz, Bodenkohlenstoffspeicherung
Die Menge an Totholz ist in zentraleuropäischen Wäldern durch deren intensive Nutzung vergleichsweise gering. Der langfristige Entzug von verholzter Biomasses aus dem Wald könnte negative Auswirkungen auf Bodeneigenschaften mit sich bringen und unter anderem auch die Stabilität der organischen Bodensubstanz negativ beeinflussen. Das Ziel dieser Studie war es, den Einfluss von liegendem Buchentotholz (Fagus sylvatica L.) auf die Stabilität der organischen Bodensubstanz und damit auch auf die nachhaltige Speicherung von Kohlenstoff im Boden zu untersuchen. Die Hypothese war, dass Totholz - als zentrale Quelle von Lignin - zu einem erhöhten Eintrag von Lignin und dessen Abbauprodukten in den Boden führt, wodurch die Stabilität der organischen Bodensubstanz im Boden positiv beeinflusst würde. Dies würde anhand von erhöhten Konzentrationen und Anteilen stabilerer Kohlenstoff-Fraktionen im Oberboden ersichtlich werden. Um diese Hypothese zu prüfen, wurden auf acht ausgewählten Standorten in Südwestdeutschland Bodenproben unter Totholz verschiedener Zersetzungsstufen sowie naheligender Kontrollpunkte entnommen. Mittels Dichtefraktionierung wurde die organische Bodensubstanz in drei Fraktionen getrennt, die mit unterschiedlichen Stabilisierungsmechnismen in Verbindung gebracht werden können und dadurch verschiedene Stabilitätspools repräsentieren. Die Ergebnisse zeigen, dass es unter bestimmten Bedingungen signifikante Unterschiede in den Konzentrationen und Anteilen der verschiedenen Pools zwischen Proben unter Totholz und Kontrollproben gibt. Besonders unter stark zersetztem Totholz wurden signifikant erhöhte Konzentrationen von in Aggregaten okkludiertem organischem Kohlenstoff festgestellt, was als eine absolute Vergrößerung des intermediären Pools interpretiert werden kann. Dies deutet also darauf hin, dass stark zersetztes Totholz die Stabilität der organischen Bodensubstanz durch die Stabilisierung der Bodenaggregate erhöht. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass liegendes Buchentotholz, zusätzlich zu seinen anderen Funktionen für Waldökosysteme, einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Speicherung von Kohlenstoff im Boden leisten kann. Ein verstärkter Austrag von verholzter Biomasse könnte daher auch über diesen Wirkungszusammenhang negative Auswirkungen auf die Kohlenstoffspeicherung in Wäldern haben.
Vorträge Session 8: Funktionelle Bedeutung von Totholz 58
Wenn sich Totholz in Luft auflöst: Welche Faktoren bestimmen die CO2 Emissionen aus Totholz?
Tiemo Kahl1, Kristin Baber2, Peter Otto2, Christian Wirth2, Jürgen Bauhus1
1Professur für Waldbau, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Universität Freiburg, Tennenbacherstraße 4, 79106 Freiburg im Breisgau, [email protected] 2AG Spezielle Botanik und Funktionelle Biodiversität, Insitut für Biologie, Universität Leipzig, Johannisallee 21, 04103 Leipzig
Schlagworte: holzabbauende Pilze, CO2 Messung, Biodiversitäts Exploratorien, Waldbewirtschaftungsintensität
Totholz ist ein wichtiger Teil der Waldstruktur und eine bedeutende Komponente im Kohlenstoffkreislauf von Waldökosystemen. CO2 Emissionen aus Totholz können näherungsweise als die momentane Abbaurate verstanden werden. Die wichtigsten Einflussfaktoren auf die CO2 Emission aus Totholz in temperaten Wäldern Europas sind weitgehend unbekannt. Mittels einer neu entwickelten Methode wurden CO2 Emissionen an je 28 Totholzstämmen von 13 Baumarten in drei Regionen Deutschlands gemessen. Unsere Ergebnisse zeigten, dass die Baumartenidentität mit 71% den größten unabhängigen Beitrag zum Gesamtmodell lieferte (R2=0,62). Die Baumart ist damit der stärkste Einflussfaktor auf die volumenbasierte CO2 Emission von Totholz wobei Laubbäume im Mittel höhere CO2 Emissionen aufwiesen als Nadelbäume. Sowohl die Holztemperatur während der Messung als auch die Pilzartenzahl (basierend auf Fruchtkörpern) hatten einen positiven Einfluss auf die CO2 Emissionen, wohingegen die Totholzdichte einen negativen Einfluss hatte. Hervorzuheben ist hierbei der positive Einfluss der Pilzartenzahl welcher erstmals im Freiland nachgewiesen werden konnte. Außerdem konnten wir zeigen, dass hohe bzw. niedrige CO2 Emissionen mit bestimmten Pilzarten assoziiert sind. Die vorgestellten Ergebnisse wurden im Rahmen der Biodiversitäts Exploratorien in einem Totholz Langzeit Experiment (BELongDead) erarbeitet. Kahl T, Baber K, Otto P, Wirth C, J Bauhus (2015) Drivers of CO2 Emission Rates from Dead Wood Logs of 13 Tree Species in the Initial Decomposition Phase. Forests 6, 2484-2504
Vorträge Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern
59
Heterogene Waldstrukturen führen zu einem Anstieg der Artenvielfalt – Vergleich der Phytodiversität slowakischer Buchenurwälder mit
Wirtschaftswäldern
Stefan Kaufmann1, Eike Feldmann1, Jonas Glatthorn1, Markus Hauck2 und Christoph Leuschner1
1Abteilung für Pflanzenökologie, Universität Göttingen, Untere Karspüle 2, 37073 Göttingen, [email protected] 2Institut für Biologie und Umweltwissenschaften, Universität Oldenburg
Schlagworte: Heterogenität, Phytodiversität, Buchenurwälder, Wirtschaftswälder
Unlängst wurde von verschiedener Seite die Hypothese aufgestellt, dass Naturwälder nicht zwingend pflanzenartenreicher als Wirtschaftswälder sind, weil die Bewirtschaftung Strukturreichtum schaffen kann und zu einer Erhöhung der Baumartenzahl führt. Diese Hypothese wurde jedoch bisher nicht an wirklichen Urwäldern getestet, sondern nur an wenige Jahre aus der Nutzung genommenen Wirtschaftswäldern.
Urwälder gelten auf klein- wie auch großskaliger Ebene nach bisherigen Ergebnissen generell als artenreicher. Wenn aber die Diversität spezifischer Organismengruppen in Ur- und Wirtschaftswäldern verglichen wird, so findet man in der Literatur widersprüchliche Befunde. Der Vergleich der Moos- und Flechtendiversität fällt einheitlich zugunsten der Urwälder aus. Als Gründe hierfür werden insbesondere die Verfügbarkeit geeigneter Substrate und Mikrohabitate, sowie Habitatkontinuität genannt. Betrachtet man jedoch die Vielfalt der Gefäßpflanzen, so lassen sich keine eindeutigen Schlüsse ziehen. Bewirtschaftung erhöht in vielen Fällen die Krautschichtdiversität gegenüber Naturwäldern, indem Störungszeiger in den Wald eindringen. Dies sind jedoch keine typischen Waldarten. Vergleiche zwischen wirklichen Ur- und standortsgleichen Wirtschaftswäldern fehlen bisher.
Deshalb wurden in drei ostslowakischen Buchenurwäldern Untersuchungen bezüglich der Diversität von Flechten, Moosen und Gefäßpflanzen im Vergleich zu Wirtschaftswäldern durchgeführt. Die Urwälder unterlagen keinen forstlichen Eingriffen, zumindest nicht während der letzten 500 Jahre.
Die Ergebnisse zeigen eine deutlich höhere Flechten- und Moosdiversität der Urwälder auf Plotebene und das Vorkommen zahlreicher seltener Taxa. Die Zahl der Gefäßpflanzen auf Plotebene ist dagegen nur in einem Gebiet höher als in den Wirtschaftswäldern, was auf Störungszeiger zurückzuführen ist. Arten-Arealkurven zeigen, dass alle drei Urwälder auf größerer Fläche (>2 ha) dagegen auch reicher an Gefäßpflanzen sind als Wirtschaftswälder, weil die Habitatheterogenität in großen Urwaldregionen hoch ist. Die Störungszeiger kommen vermutlich im Urwald ebenfalls vor, wenn große Räume natürlicher Störstellen betrachtet werden. Zusammenfassend lässt sich folgern, dass die Diversität in Urwäldern in größeren Maßstäben betrachtet werden muss, und dann die Diversität in allen Pflanzengruppen höher als im Wirtschaftswald ist. Kurzfristig aus der Nutzung genommene ,Naturwälder’ sind für die Beantwortung dieser Frage dagegen weniger geeignet.
Vorträge Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern 60
Effektivität von Waldrefugien für den Biodiversitätsschutz im Wirtschaftswald
Jörn Buse1, Hans-Peter Ehrhart2 und Patricia Balcar2
1Universität Koblenz-Landau, Institut für Umweltwissenschaften, Fortstraße 7, 76829 Landau, [email protected] 2Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz, Hauptstraße 16, 67705 Trippstadt, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Biotop-, Alt- und Totholz-Strategie; Totholzmenge; Laufkäfer; Holzkäfer
Waldrefugien sind im Vergleich zu Naturwaldgebieten kleinere Flächen, die in der Regel dauerhaft, selten nur temporär, aus der Nutzung genommen werden und dem Arten- und Biotopschutz gewidmet sind. Wir haben in 40 repräsentativ ausgewählten Waldrefugien im südlichen Rheinland-Pfalz untersucht, wie sich die standörtlichen Bedingungen auf verschiedene Organismengruppen auswirken. Die Ergebnisse zeigten unterschiedliche Zusammenhänge für Laufkäfer, Spinnen und Totholzkäfer mit den über alle Flächen auftretenden Gradienten der Bodenfeuchte, des Kronenschlusses und der Totholzmenge sowie –qualität. Beispielsweise waren saisonal stark vernässte Flächen besonders geeignet für eine hohe Zahl an Waldlaufkäferarten, während Spinnen eher negativ auf eine hohe Bodenfeuchte reagierten. Auch beim Kronenschluss gab es je nach Organismengruppe unterschiedliche Einflüsse. Typische Waldlaufkäfer waren keineswegs an vollbeschattete Lebensräume gebunden, sondern präferierten Bestände mit 15-20 % offenem Anteil in der Krone. Für einen wirksamen Schutz der Totholzkäfer scheint es besonders wichtig Waldrefugien mit jeweils verschiedenen Hauptbaumarten auszuweisen. Dabei ist auf das Vorhandensein von Sonderstrukturen (lose Rinde, Pilzbesiedlung, Baumhöhlen etc.) an einzelnen Bäumen zu achten. Die Totholzmenge allein ist kein guter Indikator für einen hohen Artenreichtum. Insbesondere das Auftreten von Urwaldreliktarten unter den Totholzkäfern ließ sich nicht durch die gängigen Flächenmerkmale und Einzelbaumeigenschaften erklären. Für diese Arten scheint eine ununterbrochene Verfügbarkeit von artspezifischen Sonderstrukturen wichtig. Historisch alte Waldstandorte bevorzugt mit einer bereits existierenden hohen Totholzdiversität eignen sich daher besonders für die Ausweisung als Waldrefugium. Unter Beachtung dieser Grundsätze stellen Waldrefugien bereits mit der Ausweisung auch aufgrund einer höheren Konnektivität eine sinnvolle Ergänzung zu den Naturwaldflächen dar.
Vorträge Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern
61
Evaluierung des Alt- und Totholzkonzeptes in Baden-Württemberg
Juliane Schultze1, Vanessa Tschöpe1
1FVA Baden-Württemberg, Abteilung Waldnaturschutz, Wonnhaldenstr. 4, 79100 Freiburg, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Mikrohabitate, Kriterien und Indikatoren, Biodiversität, vorsorgender Naturschutz im Wirtschaftswald
Alt- und Totholz ist eine der wichtigen Schlüsselrequisiten zum Schutz der biologischen Vielfalt. Seit 2010 wird im Staatswald in Baden Württemberg das Alt- und Totholzkonzept (AuT-Konzept) umgesetzt. Bis 2020 sollen rund 10.000 ha Waldrefugien (dauerhaft aus der Nutzung entlassene Flächen mit einer Größe von ca. 1-3 ha) ausgewiesen werden. Zusätzlich sollen in allen Hauptnutzungs- und Dauerwaldbeständen sog. Habitatbaumgruppen ausgewählt werden (eine Gruppe von rund 10-15 Bäumen je 3 ha, die dem Alterungs- und Zerfallsprozess überlassen werden). Ziel des AuT-Konzeptes ist es, trotz der Intensivierung der Forstwirtschaft wertvolle Strukturen zu entwickeln, bzw. zu erhalten. Insbesondere sollen so die Mikrohabitate, die vorwiegende an alten und absterbenden Bäumen entstehen, auch im Wirtschaftswald zur Verfügung stehen. Totholzschwellen von 30-60m2/ha, unterhalb denen ein Biodiversitätsverlust rapide zunimmt, sollen annähernd erreicht werden. Mit dem AuT werden langfristige Habitate für Arten mit geringem Ausbreitungspotential bereitgestellt und zusätzlich soll eine Vernetzung zwischen Schutzgebieten und Waldrefugien gewährleistet werden. Die Halbzeit der Umsetzung ist erreicht. Die Fortschritte der Umsetzung werden in jährlichen Berichten dokumentiert. Neben dieser quantitativen Evaluierung soll zukünftig auch die naturschutzfachliche Zielerreichung analysiert werden. Hierzu werden die Schutzelemente (Habitatbaumgruppen und Waldrefugien) anhand von Kriterien beleuchtet, mit denen die räumlichen (Konnektivität, Flächengröße), zeitlichen (Habitattradition) und funktionalen (Repräsentanz, Strukturdiversität, Seltenheit) Dimensionen der naturschutzfachlichen Qualität evaluiert werden können. Dazu wurden -abhängig von den zuvor definierten Zielen- die Auswahl der Indikatoren zu den entsprechenden Kriterien vorgestellt. Insgesamt wird präsentiert, welchen Beitrag die Umsetzung des AuT-Konzept schon jetzt zum Schutz der Biodiversität im Wald leistet. Verschiedene Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen dem Vorkommen von Mikrohabitaten und der Baumart, des Durchmessers, des Alters, aber auch des Standortes auf. Dieser Zusammenhang kann zum Teil auch in den Habitatbaumgruppen in Baden-Württemberg beobachtet werden und wird in unserer Studie mit aktuellen Studien verglichen.
Vorträge Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern 62
Ergebnisse verschiedener Bewertungsansätze zur Naturnähe der Baumartenzusammensetzung von Wäldern in Deutschland
Hendrik Stark1, Stefanie Gärtner1,2, Reiner Suck3, Nicolas Schoof1, Jürgen Kayser4, Gerald Kändler5 und Albert Reif 1
1Professur für Standorts- und Vegetationskunde, Universität Freiburg, Tennenbacher Str. 4, 79085 Freiburg, E-Mail: [email protected], [email protected] 2Ökologisches Monitoring, Forschung & Artenschutz, Nationalpark Schwarzwald, Kniebisstraße 67, 77740 Bad Peterstal-Griesbach, E-Mail: [email protected] 3Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie, W. v. Brackel und Partner, Landschaftsökologen, Georg-Eger-Straße 1b, 91334 Hemhofen, E-Mail: [email protected] 4Individuelles Daten Management GmbH, Zasisusstr 77, 79102 Freiburg, E-Mail: [email protected] 5Abteilung Biometrie und Informatik, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg, E-Mail: [email protected]
Schlagworte: pnV, Methodenvergleich, BWI
Natürlichen und naturnahen Waldgesellschaften wird in der Waldstrategie 2020 (BMELV) und in der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt (BMU) eine wichtige Rolle zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel und zur Förderung der biologischen Vielfalt zugeschrieben. Dabei beschreibt die „Naturnähe“ der älder die Abweichung ihres aktuellen Zustandes von einem konstruierten Naturzustand. Das Konzept der potentiellen natürlichen Vegetation (pnV) wird häufig für eine Ableitung dieser Naturnähe herangezogen. Die Forstverwaltungen vieler Bundesländer orientieren sich im Rahmen der naturnahen Waldwirtschaft an einer solchen natürlichen Referenz, und auch für landschaftsplanerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird oftmals eine „natürliche Baumarten-zusammensetzung im Sinne der pnV“ gefordert. Das Kriterium „Naturnähe der Baumartenzusammensetzung“ von äldern besitzt damit eine zentrale umwelt- und naturschutzpolitische Bedeutung. Die Herleitung der Naturnähe der Baumartenzusammensetzung von Wäldern ist jedoch oft uneinheitlich, und unterscheidet sich z.B. in der Detailliertheit der genutzten Bestandesinformationen, der Anzahl der Naturnähestufen, der pnV Referenz oder der Berücksichtigung von Pionieren, neuheimischen Baumarten und natürlichem Baumartenwechsel. Diese Unterschiede in der Methodik und in den zugrunde liegenden Annahmen können die Vergleichbarkeit und Aussagekraft der jeweils erzielten Ergebnisse stark beeinflussen. Wie stark sich eine Methode x im Vergleich zu anderen möglichen Methoden auf die letztendlich attestierte Naturnähe auswirkt, ist jedoch unbekannt. Deshalb präsentieren wir in diesem Beitrag die Ergebnisse verschiedener bekannter und neuer Methoden und Annahmen zur Herleitung der Naturnähe der Baumartenzusammensetzung von Wäldern. Für unsere Modellierungen nutzen wir Daten der dritten Bundeswaldinventur. Die Ergebnisse sollen mehr Transparenz und Vergleichbarkeit bei der Planung, Durchführung und Interpretation solcher Naturnähebewertungen, z.B. zwischen Vertretern verschiedener Interessengruppen, ermöglichen. Darüber hinaus sollen konzeptionelle Vorschläge zur „umfassenderen“ Bewertung der Naturnähe der Baumartenzusammensetzung unterbreitet werden. Die Ergebnisse sind damit von erheblicher umweltpolitischer Bedeutung und landschaftsprägender Praxisrelevanz.
Vorträge Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern
63
Naturschutzziele und Bewirtschaftungsempfehlungen für reife Buchenwälder Nordostdeutschlands – ein Praxishandbuch
Susanne Winter1, Heike Begehold, Mathias Herrmann, Matthias Lüderitz, Georg Möller, Michael Rzanny, Martin Flade
1 Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Alfred-Möller-Str. 1 16225 Eberswalde, [email protected]
Schlagworte: Waldbiodiversität, Nutzungswälder, Integration von Naturschutzzielen, Waldnaturschutz
Eine Integration von Naturschutzzielen in die Bewirtschaftung unserer Wälder ist notwendig, um die Biodiversität im Wald zu bewahren und zu fördern. In zwei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Zeitraum 2000 bis 2014 im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und fünf benachbarten Großschutzgebieten haben Wissenschaftler und Praktiker 22 konkrete Empfehlungen für die Integration von Naturschutzzielen in die Buchenwaldbewirtschaftung und über 30 Steckbriefe zu wichtigen Schlüsselstrukturen für die Biodiversität erarbeitet. In dem Vortrag werden die von Naturschutz und Forstwirtschaft gemeinsam erarbeiteten Waldmanagementstrategien für Buchenwälder zur Integration von Naturnäheelementen in den Wirtschaftswald aufgezeigt – damit auch der bewirtschaftete Wald zunehmend Lebensraum für anspruchsvolle Waldarten der Pilze, Käfer, Vögel, Fledermäuse und anderer Säugetiere, Moose, Farn- und Blütenpflanzen werden kann. Zudem werden wichtige Ergebnisse der dem Praxishandbuch zugrunde liegenden wissenschaftlichen Untersuchungen der letzten 15 Jahre vorgestellt. Es wird aufgezeigt, wie das gemeinsame Ziel von Naturschutz und Forstverwaltung, die Biodiversität im Wald besser zu schützen und verlorene Elemente dauerhaft wieder zurück zu gewinnen, in der Praxis erreicht werden kann.
Vorträge Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern 64
Marteloskope: Biodiversitätswirksame Mikrohabitatstrukturen erkennen und bei der Waldbewirtschaftung erhalten
Daniel Kraus1, Patrick Pyttel2, Frank Krumm1, Andreas Schuck1, Susanne Winter3und Ulrich Mergner4
1European Forest Institute, Wonnhaldestrasse 4, D-79100 Freiburg, [email protected] 2Waldbau-Institut, Uni Freiburg, [email protected] 3HNE Eberswalde, Alfred-Möller-Str. 1, D-16225 Eberswalde, Winter, [email protected] 4Forstbetrieb Ebrach, Bayerische Staatsforsten, Ebrach, [email protected]
Schlagworte: Mikrohabitate, Marteloskope, Biodiversität, forstliche Ausbildung
Große Totholzanteile und eine hohe Dichte an alten Bäumen mit Mikrohabitatstrukturen sind charakteristisch für Naturwälder in der Alters- und Zerfallsphase. Diese spätsukzessionalen Phasen sind selbst in naturnah bewirtschafteten Wäldern oftmals eher selten. Der konsequente Hieb auf den schlechten, starken Stamm angefangen bei der Jungwuchs- bis hin zur Vorratspflege unterdrückt die Entwicklung von Habitatbäumen. Dabei hängt ein nicht unerheblicher Teil der Waldbiodiversität und insbesondere selten gewordene xylobionte Arten gerade von diesen oftmals Mikrohabitatreichen Einzelbäumen und deren Fortbestand ab. Mit dem Ziel das Bewusstsein seitens der forstlichen Praxis hinsichtlich der Bedeutung und Bewertung der waldökologischen Wertigkeit von Einzelbäumen nachzuschärfen und auszubauen wurden im Zuge des BMEL geförderten F+E Projekts „Integrate+“ bislang 29 Schulungsbestände, sogenannte Marteloskope, in 10 Europäischen Ländern eingerichtet. Diese Schulungsbestände helfen künftig waldbauliche Entscheidungen, die letztlich die Integration von Biodiversitätsaspekten in der Waldbewirtschaftung berücksichtigen sollen, einzuüben. Für die Übungen in den Schulungsbeständen wurde ein Katalog mit Baummikrohabitaten entwickelt, der eine standardisierte punktebasierte Bewertung von Habitatstrukturen erlaubt. Er umfasst 23 saproxylische und epixylische Strukturen wie Hohlräume, große Totäste, Risse oder abgelöste Rinde, Epiphyten, Harzfluss oder Stammfäule. Die an einem Baum identifizierten Habitate werden nach Seltenheit und Entstehungsdauer gewichtet. Anhand dieser gewichteten Bepunktung kann der Habitatwert für den Einzelbaum berechnet und den Gesamtbestand summiert werden. Mit diesen Informationen können potenzielle Auswirkungen von „virtuellen“ Nutzungsmaßnahmen auf Biodiversitätsaspekte dargestellt werden und betriebswirtschaftlichen Berechnungsgrößen gegenübergestellt werden. In unserem Beitrag wird das Projekt „Integrate+“ ausführlich vorgestellt. Darüber hinaus berichten wir aus ersten Erfahrungen aus der Verwendung der Marteloskope im Rahmen der forstbetrieblichen Weiterbildung und universitären Lehre.
Vorträge Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern
65
Fit für den Klimawandel
Dirk Bieker1, Michael Elmer1, Britta Linnemann1
1NABU Naturschutzstation Münsterland e.V., Westfalenstraße 490, 48165 Münster, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Klimawandel, Monitoring, Referenzflächen, Naturschutz
Im Rahmen des durch den aldklimafonds geförderten Projekts „Fit für den Klimawandel“ werden seit Anfang 2014 Maßnahmen zur Anpassung feuchter Wälder an Klimaveränderungen durchgeführt. Das Projektgebiet liegt südlich von Münster und hat eine Gesamtgröße von etwa 3.200 Hektar. Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts besteht in der Wiederherstellung des landschaftstypischen Wasserhaushalts durch einen stufenweisen Rückbau von Entwässerungsgräben in den Waldflächen. Durch den Rückbau der Gräben soll der Trockenstress für die Bäume gemindert werden und die Erhaltung der durch die FFH-Richtlinie geschützten Stieleichen-Hainbuchen Wälder gefördert werden. Um die Auswirkungen der Maßnahmen auf verschiedene Parameter wie Biodiversität, Bodenwasserhaushalt, Waldwachstum und Kohlenstoffspeicherung erfassen zu können, wurde vor der Umsetzung der Maßnahmen zur hydrologischen Optimierung ein Referenzflächenkonzept entwickelt. Die Referenzflächen basieren auf dem Probekreissystem der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt und umfassen insgesamt 56 Probekreise auf 14 Teilflächen. Zur Beobachtung des Bodenwasserhaushalts wurden die Probekreise dabei um einen systematischen Messpunkt zur Erfassung der Bodenfeuchtigkeit erweitert. Die Referenzflächen wurden insgesamt so angeordnet, dass sich sowohl Flächen mit/ohne wiederhergestelltem landschaftstypischen Wasserhaushalt als auch bewirtschaftete /unbewirtschaftete Waldflächen miteinander vergleichen lassen. Durch die frühzeitige Aufnahme der Referenzflächen vor Beginn der Maßnahmenumsetzung und einen mehrjährigen Vorlauf an Bodenwassersmessungen (ab 2013) kann eine gezielte Effizienzkontrolle in Bezug auf die Auswirkungen der Grabenverschlüsse durchgeführt werden. Im Rahmen des Vortrags wird das Projekt und seine Zielsetzung vorgestellt, das Referenzflächenkonzept erläutert und die bisher erzielten Ergebnisse diskutiert. Die Auswirkungen der Grabenverschlüsse werden durch die Ergebnisse der Bodenfeuchtigks- und Stauwassermessungen dargestellt. Die Auswirkungen eines geänderten Bodenwasserhaushalts auf Flora und Fauna der Stieleichen-Hainbuchenwälder werden diskutiert und an Beispielen erläutert. Abschließend erfolgt eine Bewertung in Bezug auf das Projektziel die älder “Fit für den Klimawandel” zu machen.
Vorträge Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern 66
Erhaltung forstlicher Genressourcen im Spannungsfeld verschiedener Naturschutzstrategien – Das Beispiel Schwarz-Pappel in Sachsen
Ute Tröber1 und Heino Wolf 1
1Staatsbetrieb Sachsenforst, Kompetenzzentrum für Wald und Forstwirtschaft, Referat Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung, Bonnewitzer Str. 34, D-01796 Pirna OT Graupa, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Genetische Struktur, Generhaltung, Wiedereinbringung, Naturschutz
In Sachsen ist die Schwarz-Pappel als wichtiger natürlicher Bestandteil der Auenwälder vom Aussterben bedroht. Nachdem dieser Tatsache lange Zeit nicht die nötige Aufmerksamkeit gewidmet wurde, sind in den letzten Jahren umfangreiche Anstrengungen von Seiten der Forstwirtschaft und des Naturschutzes auf ehrenamtlicher, institutioneller und ministerieller Ebene unternommen worden, um die Schwarz-Pappel als Art und deren genetisches Potential zu erhalten und zu fördern. Aus verschiedenen Untersuchungen liegen detaillierte Ergebnisse zu den noch vorhandenen Vorkommen, zu deren Größe, Vitalität und Altersstruktur vor. Genetische Analysen ermöglichen Aussagen zur genetischen Struktur der Vorkommen, zum Einfluss von Introgression und klonaler Vermehrung sowie zum Vergleich der genetischen Variation verschiedener regionaler Vorkommen. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse erfolgten die Etablierung von Mutterquartieren zur späteren Erzeugung von vegetativem Vermehrungsgut und die Saatgutgewinnung in zugelassenen Erntebeständen mit genetischen Begleituntersuchungen. Damit liegen die Voraussetzungen vor, mit geeignetem und qualitativ hochwertigem Vermehrungsgut bestehende Vorkommen zu fördern oder Auwälder durch Wiedereinbringung von Schwarz-Pappeln zu initialisieren. Das Ziel sollte dabei in der Begründung von Populationen bestehen, die groß und stabil genug sind, um sich perspektivisch selbst natürlich zu verjüngen und weiter zu entwickeln. Ausgehend von der Darstellung der sächsischen Schwarz-Pappel-Vorkommen und ihres aktuellen Zustandes werden erste Erfahrungen bei der Wiedereinbringung sowie die besonderen Herausforderungen bei der Planung und Realisierung solcher Maßnahmen präsentiert.
Vorträge Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern
67
Flechtenkiefernwälder – Eine Waldgesellschaft verschwindet, und was man noch dagegen machen kann
Anton Fischer1, Barbara Michler 1, Hagen S. Fischer1
1Fachgebiet Geobotanik, Technische Universität München, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, D-85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Flechtenkiefernwälder, Rückgang, Wiederherstellung
Flechtenkiefernwälder waren in Teilen Deutschlands über Jahrhunderte hinweg durchaus häufig: besonders auf Sandböden. Bis über die Mitte des letzten Jahrhunderts wurden sie oft als Teil der natürlichen Waldvegetation Mitteleuropas angesehen. Tatsächlich befinden sie sich seit einigen Jahrzehnten auf einem raschen Rückzug. Für Bayern haben wir diese Entwicklung quantitativ (besiedelte Fläche) wie qualitativ (Artenzusammensetzung) detailliert an Hand der Auswertung historischer pflanzensoziologischer Aufnahmen und damaliger Kartierungen im Vergleich zu rezent erhobenen Situation untersucht. Das Ergebnis ist noch erschreckender als befürchtet. Lediglich noch 159 Hektar dieses Waldtyps lassen sich nachweisen, und auch diese Bestände sind nach Artenzahl und Menge der Flechten meist nur noch auf quadratmetergroßen Flächen mit den Flechtenkiefernwäldern aus der Mitte des letzten Jahrhunderts vergleichbar. Der Flechtenanteil (Deckungsgrad, Median) ging von 39 % auf fast 0 % zurück; dafür stieg der Moosanteil von 20 auf 65 % an; dabei sind raschwüchsige pleurocarpe Moose vorherrschend, allen voran Pleurozium schreberi. Wegen der speziellen Lebensform der Flechten (relativ wenig Alge ernährt relativ viel Pilz) sind sie besonders konkurrenzschwach. Mit dem Wegfall des Streurechens nach dem Zweiten Weltkrieg und den gleichzeitig hohen N-Eintrag werden gerade die Konkurrenten der Flechten, besonders P. schreberi, gefördert. Wir konnten aus dem vorhandenen historischen Aufnahmematerial einen Vergleichsdatensatz der Flechtenkiefernwälder extrahieren, der in Zukunft als Qualitätsmaßstab bei der Beurteilung verbliebender Reste der Flechtenkiefernwälder und zudem als Zielmarke bei Pflege und Wiederherstellungs-maßnahmen dieses Waldtyps dienen kann. Für Bayern wurde ein sehr detailliertes Maßnahmenkonzept („Handbuch“) erarbeitet und steht zur Umsetzung allen relevanten Akteuren, besonders aus dem Bereich Forst, zur Verfügung.
Vorträge Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern 68
Systematische Schutzgebietsplanung im Wald
Falko Engel1 1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Grätzelstrasse 2, 37079 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: systematische Schutzgebietsplanung, Kosten, Biodiversität, Vorrangflächen
In dem DBU-Projekt „Identifizierung und Schutz von aldbeständen mit vorrangiger Bedeutung für den Erhalt der Biodiversität“ wurde in enger Zusammenarbeit mit den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten ein mögliches Vorgehen zur systematischen Ergänzung der Naturwälder in Schleswig-Holstein erarbeitet. Schutzgebiete dienen grundsätzlich der Trennung von Elementen der Biodiversität (Schutzgüter) und Prozessen, die eine Gefährdung für diese Schutzgüter darstellen. Um dies zu gewährleisten ist die repräsentative Abdeckung des vollen Umfangs der Biodiversität in einer spezifischen Region durch Schutzgebiete notwendig. Für Teile des Planungsprozesses einer systematischen Schutzgebietsplanung stehen unterschiedliche Methoden und Softwareimplementationen zur Verfügung. Es handelt sich dabei um Optimierungsprozesse, die gewährleisten sollen, dass naturschutzfachliche Zielsetzungen kosteneffizient umgesetzt werden. Planer machen von diesen Methoden jedoch bisher relativ wenig Gebrauch. Auch für den europäischen und deutschen Raum sowie für den forstlichen Bereich wurde bereits ein Defizit an systematischen Planungsansätzen im Naturschutz erkannt. Neben der objektivierten Ableitung von Naturschutzzielen scheint insbesondere die direkte Integration von ökonomischen Kosten in den räumlich expliziten Planungsprozess vielversprechend. Das Instrument der systematischen Schutzgebietsplanung könnte geeignet sein, um konstruktive Lösungsvorschläge für den anhaltenden Konflikt zwischen konkurrierenden Waldfunktionen zu machen. Die Datengrundlage für eine systematische Schutzgebietskulisse ist insbesondere im Landeswald meist detailliert. Daten der Forsteinrichtung können in Kombination mit weiteren Daten wie Standortsinformationen oder Karten der potenziellen natürlichen Vegetation genutzt werden, um besonders wertvolle Bereiche zu identifizieren (Hotspots, Habitatmodelle) oder ökonomische Kosten auf der Ebene der Beschreibungseinheit zu ermitteln. Die Ergebnisse einer systematischen Schutzgebietsplanung, insbesondere die konkreten Flächenvorschläge, sollten jedoch niemals als gesetzte Kulissen betrachtete werden. Vielmehr dienen die zu Grunde liegenden Konzepte sowie die konkreten Flächenvorschläge als Diskussionsgrundlage für Entscheidungsträger.
Vorträge Session 10: Nährstoffkreisläufe in naturnahen und Wirtschaftswäldern
69
Neuerschließung oder Recycling – P Vorräte entscheiden über die P-Nutzungsstrategien von Buchenwaldökosystemen
F. Lang1, J. Krüger1, W. Amelung2, J. Bauhus3, E. Bünemann4, E. Frossard4, E. Kandeler5, K. Kaiser6, R. Mikutta7, A. Polle8, J. Prietzel9, M. Schloter9
1Universität Freiburg, Bodenökologie, Freiburg, [email protected] 2Universität Bonn, INRES, Bonn 3Universität Freiburg, Waldbau, Freiburg 4ETH Zürich, Plant Nutrition Group, Zürich 5Universität Hohenheim, Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Hohenheim 6Universität Halle, Bodenkunde, Halle 7Universität Hannover, Hannover 8 Georg-August Universität Göttingen, Abteilung für Forstbotanik und Baumphysiologie, Göttingen 9TU München, München
Schlagworte: Waldernährung; Humusauflage; Phosphor-Effizienz
Die Hypothese des DFG-Schwerpunktprogramms „Ecosystem Nutrition“ (SPP 1685) ist, dass die Art der P- Nutzung in Waldökosystemen primär von der Höhe der Vorräte an mineralisch gebundenem P im Boden abhängt: Waldökosysteme auf Standorten, die reich an mineralisch gebundenem P sind, erschließen vor allem mineralische P-Quellen, während Waldökosysteme, die auf P-armem Substrat vorkommen, P-Mangel vermeiden, indem sie P aus abgestorbener Biomasse effizient recyceln. Im Rahmen des Schwerpunktprogramms untersuchen wir fünf Buchenwälder mit unterschiedlicher P-Ausstattung der Böden um diese Hypothese zu prüfen. Bis dato analysierten wir die Konzentrationen gesamt- und pflanzenverfügbaren Phosphors und führten eine Hedley-Fraktionierung von Bodenproben der verschiedenen Standorte durch. An ausgewählten Bodenproben wurde außerdem die Isotopenaustauschkinetik von P bestimmt, die durch NMR Analysen ergänzt wurde. Grundlegende bodenchemische- und mineralogische Analysen helfen bei der Interpretation der P-bezogenen Bodendaten. Ermittelte bodenbiologische „ esponse“-Variablen sind die Durchwurzelungsintensität, Mykorrhizierung, P-, C-, und N-Gehalte in der mikrobiellen Biomasse sowie die Phosphataseaktivität. Die P-Vorräte unserer Standorte decken einen weiten Bereich ab (1–9 t P ha-1; bis in 1 m Bodentiefe). Besonders auf P-reichen Standorten finden wir eine deutliche Anreicherung von P im Oberboden, was auf Erschließung von P-Reserven aus dem Unterboden hindeutet. Der Anteil organisch gebundenen Phosphors am gesamten P-Vorrat im Oberboden steigt von 50% auf P-reichen auf 80% auf P-armen Standorten an. Hinweise für P-Auswaschung und Verlagerung in den Unterboden finden sich hingegen nicht. Die P-Isotopenaustauschkinetik deutet darauf hin, dass auf P-armen Standorten tatsächlich vor allem P-Recycling für die Nachlieferung pflanzenverfügbaren Phosphors verantwortlich ist. Die Phosphataseaktivität im Boden scheint auf den P-ärmeren Standorten stark durch Wurzeln bzw. Pilzhyphen dominiert, während Bakterien auf den P-reichen Standorten eine große Rolle spielen. Die Qualität der organischen P-Verbindungen ist erstaunlich eng mit der P-Verfügbarkeit der Böden verbunden, was ebenfalls mit veränderter Diversität der Bodenmikroflora erklärt werden könnte. Die Dichte der Feinwurzeln in der Humusauflage und im Oberboden und der langsamere Umsatz der organischen Bodensubstanz scheinen einen wichtigen Beitrag zur hohen P-Effizienz von Wäldern auf P-armen Standorten zu leisten.
Vorträge Session 10: Nährstoffkreisläufe in naturnahen und Wirtschaftswäldern 70
Einfluss der Humusform auf die Vorräte an organischem und mikrobiellem P im Mineralboden und die potentielle Bedeutung dieser
Fraktionen für die P-Ernährung der Rotbuche
Dan Paul Zederer1 und Ulrike Talkner1
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Grätzelstr. 2, 37079 Göttingen, [email protected], [email protected]
Schlagworte: P-Ernährung, Humusformen, organischer P, mikrobieller P
Der Umsatz organischer Substanz (OS) sowie mikrobieller Biomasse steht im Zentrum des P-Kreislaufs von Waldökosystemen. Humusformen bringen eine unterschiedliche vertikale Kompartimentierung dieser Umsatzprozesse zum Ausdruck. Dieser Studie lagen zwei Hypothesen zugrunde: (i) aufgrund eines durch Bioturbation erhöhten OS-Eintrags liegen in Mineralböden unter Mull höhere Vorräte an organischem P [Porg] und mikrobiellem P [Pmik] als unter Moder vor; (ii) Die Vorräte an Porg und Pmik sind bedeutsam für die P-Ernährung der Rotbuche, was sich in Korrelationen dieser Fraktionen mit dem Blatt-P-Gehalt widerspiegelt. In den Mineralböden von je 10 Mull- und Moderflächen wurden Porg und Pmik in mehreren Tiefenstufen bis 50 cm Bodentiefe bestimmt. In 0-10 cm Tiefe wiesen Mullflächen gegenüber Moderflächen signifikant höhere Pmik-Vorräte auf (t-Test, p < 0,05), jedoch keine signifikant erhöhten Porg-Vorräte. In 10-50 cm Tiefe unterschieden sich die Pmik- und Porg-Vorräte nicht signifikant zwischen Mull- und Moderflächen. Auf den Moderflächen fand sich ein signifikanter linearer Zusammenhang zwischen dem Blatt-P-Gehalt und dem in 0-50 cm Tiefe vorliegenden Vorrat an Porg (R2 = 0,40, p < 0,05) wohingegen auf den Mullflächen keine signifikanten Korrelationen auftraten. Eine multiple Regressionsanalyse unter Einbeziehung aller Standorte ergab, dass eine Zunahme des Blatt-P-Gehalts am besten durch eine Zunahme des Porg-Vorrats bei gleichzeitiger Abnahme des Tongehalts erklärt werden konnte. Hypothese (i) konnte nur im Hinblick auf die Pmik-Vorräte bestätigt werden. Vergleichsweise hohe Porg-Vorräte auf Moderflächen könnten durch den Eintrag gelöster organischer P-Verbindungen aus der Humusauflage oder durch geringere Porg-Mineralisierungsraten im Vergleich zu Mullflächen bedingt sein. Hypothese (ii) konnte teilweise bestätigt werden. Der Zusammenhang zwischen Blatt-P-Gehalt und Porg-Vorrat untermauert die Relevanz organischer P-Fraktionen für die P-Ernährung der Rotbuche. Die gegensätzlichen Einflüsse von Porg-Vorrat und Tongehalt auf den Blatt-P-Gehalt könnten darauf hindeuten, dass Porg-Mineralisierungsraten mit zunehmendem Tongehalt abnehmen. Zur Quantifizierung der P-Mineralisierungsraten der Oberböden der 20 Versuchsstandorte werden derzeit 33P-Isotopenverdünnungsversuche durchgeführt.
Vorträge Session 10: Nährstoffkreisläufe in naturnahen und Wirtschaftswäldern
71
Zusammenhänge zwischen bodenökologischen Standortseigenschaften, Aggregateigenschaften und der Verteilung von C und P im Aggregat
Simon Stahr1 ,Ferdinand Briegel1, Markus Graf-Rosenfellner1 und Friederike Lang1
1Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Professur für Bodenökologie, Bertoldstr. 17, 79098 Freiburg im Breisgau [email protected]
Schlagworte: Phosphor, Bodenaggregate, Aggregatstabilität
Bodenstrukturbildung und Aggregatumsatz beeinflussen die Verfügbarkeit von Phosphor, einem der wenig mobilen Nährelementen im Boden. Weithin wird angenommen, dass es enge Zusammenhänge zwischen den bodenökologischen Eigenschaften in Wäldern und den Aggregateigenschaften im Boden gibt. Arbeiten, die Aggregateigenschaften und P-Verfügbarkeit verbinden, fehlen bisher. Ebenso ist zum Umsatz, bzw. dem turnover von kleinen Bodenaggregaten bisher erst wenig bekannt. In dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf Aggregate < 2 mm mit folgenden Hypothesen: Auf Standorten mit günstiger P-Versorgung erwarten wir aufgrund höherer biologischer
Aktivität verstärkte Aggregatbildung Disaggregierung führt zur Mobilisierung von eingeschlossenem P Aggregate bilden sich und zerfallen in relativ kurzen Zeiträumen (innerhalb von
Jahreszeiten). Die Untersuchungen wurden an Bodenaggregaten von fünf silikatischen Buchenstandorten mit abnehmendem Vorrat an mineralisch-gebundenem Phosphor durchgeführt:
Mikroskopie (Auflicht, 8-fach, Leica EZ4 HD). P–Extraktion mit Citrat von aggregierten und disaggregierten Bodenproben (400 J
cm-3 Ultraschall). Anschließende Pcit–Analyse mit ICP-MS. Dichtefraktionierung mit Na-Polywolframat (Dichte, ρ=1,6 g cm-3) und
sequenzieller Disaggregierung durch Ultraschall (25 und 400 J cm-3). Anschließende C-Analyse mit CNS-Elementaranalysator (vario EL cube) der drei Dichtefraktionen: freie leichte, okkludierte leichte und schwere mineral-assoziierte Fraktion.
Dies wurde an zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten genommenen Proben durchgeführt (Frühjahr, Sommer und Herbst). Entgegen unserer Annahme (H1), steigt der Anteil an organischer Substanz, der im inneren von Aggregaten eingeschlossen ist, mit abnehmendem P-Vorrat der Böden tendenziell an. Nach Disaggregierung konnte bis zu 21 % mehr PO4 extrahiert werden, der offenbar im Aggregat eingeschlossen war. Aggregateigenschaften und Aggregatstabilität zeigen eine starke jahreszeitliche Dynamik an allen untersuchten Standorten. Daraus folgern wir, dass auch im Aggregat okkludiertes P im Jahresgang für Pflanzen und Mikroorganismen verfügbar wird.
Vorträge Session 10: Nährstoffkreisläufe in naturnahen und Wirtschaftswäldern 72
Abschätzung des pflanzenverfügbaren Phosphors in Waldböden mit Hilfe von einfachen Extraktionsmethoden
Michael Kohlpaintner1, Hadi Manghabati1, und Axel Göttlein1
1Fachgebiet für Waldernährung, Technische Universität München, Hans-Carl-von Carlowitz-Plat 2, 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Phosphorverfügbarkeit, Extraktionsmethoden
Durch die emissionsbedingte Aufhebung der Stickstofflimitierung ist Phosphor (P) heute vermutlich eines der am stärksten wachstumslimitierenden Nährelemente in vielen mitteleuropäischen Wäldern. Die Abschätzung des pflanzenverfügbaren Bodenphosphors für das Pflanzenwachstum wäre daher eine wichtige Kenngröße für eine nachhaltige Waldwirtschaft. Aufgrund der starken Neigung von Phosphat zur selektiven Bindung an die mineralischen und organischen Bestandteile des Bodens sowie der starken Abhängigkeit der Verfügbarkeit vom pH-Wert ist die Bestimmung des pflanzenverfügbaren P schwierig. Leider gibt es bisher keine einheitliche Methode für Waldböden, die einfach durchzuführen ist und hohe Durchsatzzahlen erlaubt, um den pflanzenverfügbaren P abzuschätzen. Vorstudien am Fachgebiet für Waldernährung und Wasserhauhalt der TUM an jeweils 24 Buchen- und Fichtenstandorten aus dem Untersuchungskollektiv der BZE II haben gezeigt, dass sich mit verschiedenen Extraktionsverfahren unterschiedlich gute Korrelationen zwischen extrahierbarem P und der Baumernährung ergeben. Bei der Fichte konnten ca. 60% der standörtlichen Schwankung der P-Ernährung (P-Konzentrationen im aktuellen Nadeljahrgang) mit den Vorräten an hydrogencarbonat-löslichem P in den obersten 40 cm des Mineralbodens erklärt werden. Bei Buche dagegen war der zitronensäurelösliche P-Vorrat, ebenfalls in den obersten 40 cm, mit einem ähnlich hohen Erklärungsanteil ausschlaggebend. Dies deutet darauf hin, dass die beiden Baumarten entweder unterschiedliche P-Fraktionen im Boden erschließen können und/oder unterschiedliche Mobilisierungsmechanismen für P besitzen. Auf jeden Fall sollte eine entsprechende Datenauswertung stets Baumartenspezifisch erfolgen. Eine Stratifizierung der Standorte nach ihrem pH-Wert (nach <6,2 und >6,2) brachte eine weitere Verbesserung der Zusammenhänge. Aufbauend auf diesen vielversprechenden Ergebnissen werden zurzeit alle BZE II Standorte in Bayern horizontweise auf ihren zitronensäurelöslichen und hydrogencarbonatlöslichen P-Anteil untersucht. Mit diesem deutlich umfangreicheren Standortskollektiv soll untersucht werden, ob sich die Ergebnisse aus den Vorstudien bestätigt lassen und, ob diese Extraktionsverfahren auch die P-Verfügbarkeit für andere Baumarten (Kiefer, Eiche) abbilden können. Erste Ergebnisse dieser Studie werden vorgestellt.
Vorträge Session 10: Nährstoffkreisläufe in naturnahen und Wirtschaftswäldern
73
Phosphorus acquisition, storage, and mobilization of beech trees from two contrasting field sites during annual growth
Florian Netzer1, Ursula Scheerer1, Heinz Rennenberg1, Cornelia Herschbach1
1Chair of Tree Physiology, Institute of Forest Sciences, Albert-Ludwigs-University of Freiburg, Georges-Koehler-Allee 53/54, 79110 Freiburg, Germany, [email protected] Phosphorus is one of five macronutrients essential for plant growth and development. Because of its low availability in many forest soils, efficient uptake, use and cycling in plants and ecosystems are required. Furthermore, these processes have to be adapted to changing phosphorus demands throughout the annual growth cycle. It is commonly accepted that P-acquisition occurs by the uptake of inorganic phosphorus sources (Pi) from soil water or from organic bound phosphate after cleavage by phosphatases. Whether also organic P sources (Porg) are taken up by the roots is currently unknown. Phosphorus acquisition from inorganic Pi (Km, vmax, pH and concentration dependency) and organic P (Porg) (i.e. ATP, glucose-6-phosphate, NADPH) by poplar and beech roots was characterized under controlled conditions and also analysed in the field. P-acquisition of beech trees differs not only for Pi and Porg, but also with the availability of Pi in the soil (low and high P soils) and during the annual growth cycle. The latter differed between young and adult beech trees in order to avoid competition. Phosphorus cycling within beech trees during the annual growth cycle is needed to allow spring growth of the new developing leaves. Seasonal P cycling includes P storage in bark and wood tissues during autumn and winter as well as mobilization from these tissues during spring. In order to obtain insight into tree internal P cycling, total P and phosphate levels were determined in leaves (buds), bark and wood as well as in xylem saps and phloem exudates. Adult beech trees and their offspring from two field sides either with extremely low plant available P (Tuttlingen, calcareous soil) or with high plant available P (Conventwald, acidic soil) in the soil were investigated. The results revealed differences in P-nutrition between both field sites, Tuttlingen and Conventwald, but also between adult beech trees and their offspring that are to be expected from a P-recycling and a P acquiring system.
Vorträge Session 10: Nährstoffkreisläufe in naturnahen und Wirtschaftswäldern 74
Reisigmatten auf Rückegassen: Gefahr für die Nährstoffnachhaltigkeit der Waldnutzung?
Helmer Schack-Kirchner¹, Kenton Stutz¹, Hannes Warlo¹, Lea Landes¹, Martin Linz¹,
Gerald Kändler², Friederike Lang¹
1Albert-Ludwigs Universität, Professur für Bodenökologie, 79085 Freiburg, helmer. [email protected] 2Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abt. Biomtrie und Informatik Nährstoffentzug, Phosphor, mechanisierte Holzernte Nährstoffnachhaltigkeit bei der Biomassenutzung bzw. Waldnutzung ist derzeit ein Fokusthema. Dabei wird nicht nur der Nährstoffentzug durch Abfuhr z.B. für die energetische Nutzung diskutiert, sondern auch die Umverteilung im Bestand durch Biomasseakkumulation auf Rückegassen, wo auf ca. 10% der Bestandesfläche der größte Teil der Nadeln, Kronen und des Feinreisigs konzentriert wird. In einem Fichten- und einem Tannenbestand mit bekannter Geschichte der Reisigakkumulation auf den Rückegassen wurde ein dreistufiges Untersuchungsverfahren angewandt. Die Vorräte von Phosphor in der organischen Auflage und im Mineralboden der Rückegasse und des Zwischenbestandes wurden durch flächen- und volumenbezogene Transektbeprobung bestimmt. Die insgesamt auf der Rückegasse akkumulierten P-Mengen wurden anhand der Biomassekompartimente des aussgeschiedenen Bestandes rekonstruiert sowie durch Analyse der P-Konzentrationen dieser Biomassekompartimente an Einzelbäumen ermittelt. Die Gegenüberstellung dieser Mengen ergab eine erhebliche Diskrepanz zwischen den bei der Holzernte zugeführten und den im Boden noch gefundenen Mengen. Hohe Feinwurzeldichten in der mächtigen organischen Auflage der Rückegassen lassen den Schluss zu, dass Phosphor von dort lateral in den Bestand zurückgeführt wird.
Vorträge Session 10: Nährstoffkreisläufe in naturnahen und Wirtschaftswäldern
75
Holzernte und Nährstoffnachhaltigkeit - eine standorts- und nutzungsspezifische Beurteilung
Stephan Zimmermann1 und Oliver Thees 1
1Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, [email protected]
Schlagworte: Holzernte, Nährstoffentzug, Bilanzierungsmodell, Nachhaltigkeit
Die Rationalisierung der Holzernte sowie die intensivierte Energieholznutzung im Rahmen der angestrebten Substituierung fossiler Energieträger bedingen eine zunehmende Nutzung von allen Baumkompartimenten und insbesondere auch von Vollbäumen. Durch die Entnahme von Ästen/Reisig und Nadeln/Blättern erhöht sich der Nährstoffentzug gegenüber einer reinen Derbholznutzung. Dadurch kann auf nährstoffarmen Standorten eine Beeinträchtigung der Nährstoffversorgung des Folgebestandes resultieren. Für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ist es daher erforderlich, die Risiken des holzerntebedingten Nährstoffentzugs und die Möglichkeiten ihrer Vermeidung zu kennen. In unserem Beitrag stellen wir ein Instrument zur Bilanzierung des Nährstoffhaushalts vor. Dabei wird der erntebedingte Nährstoffentzug quantifiziert, in Beziehung zum Nährstoffpotenzial des Bodens gesetzt und bewertet. An einem Fallbeispiel zeigen wir, dass damit eine standorts- und nutzungsspezifische Beurteilung möglich ist und die Nährstoffnachhaltigkeit bei der Planung für die einzelnen Waldbestände berücksichtigt werden kann. Diese Möglichkeit trägt dazu bei, die Nutzung des Waldes im Sinne einer umfassenden Nachhaltigkeit zu optimieren.
Vorträge Session 10: Nährstoffkreisläufe in naturnahen und Wirtschaftswäldern 76
Steuerung der standortsverträglichen Nutzungsintensität über Nährstoffbilanzierung und Abschätzung der Nährstoffvorräte im
Boden
Joachim Block1, Jürgen Gauer1, Martin Greve1, Julius Schuck1, Volker Schwappacher1 und Uwe Wunn1
1Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft, Rheinland-Pfalz, Hauptstraße 16, D67705 Trippstadt, [email protected]
Schlagworte: Nährstoffnachhaltigkeit, Nährstoffbilanzen, Nährstoffvorräte, Entscheidungsunterstützungssystem
Die Ausschöpfung des Nutzungspotentials liegt nicht nur im Interesse der Waldbesitzenden, sondern unter den Aspekten Rohstoffversorgung und Substitution klimaschädlicher Stoffe auch im Interesse der Gesellschaft. Allerdings sind für den Waldbewirtschafter die Grenzen zwischen einer nachhaltigen Ausnutzung des jeweiligen Standortpotentials und einer, die Nährstoffnachhaltigkeit verletzenden Übernutzung nur schwer zu erkennen. Zur Beratung der Forstpraxis wurde für Rheinland-Pfalz ein System entwickelt, das die Sensitivität der einzelnen Waldstandorte gegenüber einer Beeinträchtigung der Nährstoffnachhaltigkeit bewertet. Hierzu werden in einem Entscheidungsunterstützungssystem (DSS) aus eingesteuerten Standorts- und Bestockungsparametern Bilanzen der Nährstoffe N, P, K, Ca, Mg und S (Bilanzgrößen atmosphärische Deposition, Mineralverwitterung, Ernteentzug bei unterschiedlicher Nutzungsintensität, Sickerwasseraustrag) erstellt, die Bodenvorräte dieser Nährstoffe geschätzt und der Indikator „Nährstoffentzugsindex“ (Vorrat eines Nährstoffs im Boden in Relation zum über 100 Jahr aufsummierten Entzug dieses Nährstoffs) berechnet. Mit Hilfe dieser Informationen wird der jeweilige Standort einer „Vulnerabilitätsstufe“ zugeordnet. Für die jeweiligen Vulnerabilitätsstufen werden konkrete Vorschläge zur standortsverträglichen Nutzungsintensität und waldbaulichen Behandlung zur Gewährleistung der Nährstoffnachhaltigkeit dargelegt. Soweit die flächenbezogenen Grundlagendaten (insbesondere geeignete Standortdaten) vorliegen, werden aus den Befunden (Bilanzsalden, Bodenvorräte, Vulnerabilitätsstufe …) digitale Karten erzeugt, die dem Waldbewirtschafter einen einfachen Zugang zu den Entscheidungsgrundlagen für die einzelne Bewirtschaftungseinheit verschaffen.
Vorträge Session 10: Nährstoffkreisläufe in naturnahen und Wirtschaftswäldern
77
Überarbeitung des Kalkungskonzeptes von Rheinland-Pfalz: Bestimmung der Kalkungsnotwendigkeit anhand Säurebelastung,
Nährstoffbilanzen und Nährstoffvorräten
Martin Greve1, Joachim Block1 und Jürgen Gauer 1
1Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft, Rheinland-Pfalz, Hauptstraße 16, D67705 Trippstadt, [email protected]
Schlagworte: Bodenschutzkalkung, Säurebelastung, Nährstoffbilanzen, Nährstoffvorräte
In Rheinland-Pfalz dominieren unter Wald basenarme Ausgangssubstrate. Der Eintrag versauernd wirkender Verbindungen führte zusammen mit einer historischen Übernutzung zu einer großflächigen Versauerung der Böden. Um dem entgegenzuwirken wurden in Rheinland-Pfalz frühzeitig Bodenschutzkalkungen durchgeführt. Um die Wirkung der Kalkung hinsichtlich gewünschter Effekte aber auch unbeabsichtigter Nebenwirkungen zu überwachen, wurde bereits vor 25 Jahren der „Vergleichende Kompensationsversuch“ auf basenarmen, versauerten Waldstandorten auf in Rheinland-Pfalz häufig vorkommenden Bodensubstraten eingerichtet. Die Befunde dieser Versuchsflächen bilden zusammen mit den Ergebnissen eines Projekts zur „Gewährleistung der Nährstoffnachhaltigkeit bei der Waldbewirtschaftung in Rheinland-Pfalz“ die wissenschaftliche Grundlage für die neue, am Stoffhaushalt der aldökosysteme ausgerichtete Kalkungsempfehlung. Dabei werden zur Bestimmung der Kalkungsnotwendigkeit mit Hilfe eines Entscheidungsunterstützungssystems (DSS) die Calcium- und Magnesium-Bilanz (bestehend aus atmosphärischer Deposition, Mineralverwitterung, Sickerwasseraustrag und Ernteentzug bei unterschiedlicher Nutzungsintensität), die ebenfalls Bilanz-basierte Säurebelastung sowie die pflanzenverfügbaren Calcium- und Magnesium-Vorräte im Boden geschätzt. Treten auf Standorten mit höchstens mittleren Vorräten bei Derbholznutzung negative Calcium- oder Magnesium-Bilanzsalden oder eine Netto-Säurebelastung auf wird eine Kalkung empfohlen, deren Turnus von der Höhe des Bilanzdefizits abhängt. Zudem ermöglicht das DSS eine Bewertung des Haushaltes weiterer Nährstoffe der Standorte. Dabei zeigen sich insbesondere auf Sanden des Buntsandsteins negative Kalium- und Phosphor-Bilanzen bei gleichzeitig geringen Bodenvorräten. Auf Versuchsflächen wird aktuell überprüft, ob sich eine Holzasche- und Phosphat-Beimischung zur Kalkung eignet, um der Gefahr einer zunehmenden Unterversorgung an diesen Nährelementen entgegenzuwirken.
Vorträge Session 11: Wasserbezogene Dienstleistungen des Waldes 78
Sprachen der Modelle von Wald und Wasser: wie Begriffe der Ökonomie, der Hydrologie und der Ökologie kompatibel bleiben.
Beispiele aus der Lange Bramke (Harz)
Michael Hauhs1 und Britta Aufgebauer
1Ökologische Modellbildung, BayCEER, Dr.-Hans-Fisch-Str.1--3, Universität Bayreuth, [email protected]
Schlagworte: Modelle, Waldwachstum, Wassertransport, Theorie
In der Wortwahl von Mechanismus, Strategie, Funktion und Dienstleistung liegt eine implizite Entscheidung, wie die Beziehung der menschlichen Nutzung zum Wald und zum Wasser modelliert und organisiert werden kann. Wann ist es einerseits vernünftig, den Wald als ein überwiegend physikalisches System zu abstrahieren, als Ökosystem mit dem Ziel der Vorhersage zu modellieren? Wann ist es andererseits vernünftig, aktuelle Situationen zu bewerten und Entscheidungshilfen über Eingriffe zu geben (`Flugsimulator für Förster')? Antworten auf diese Fragen hängen bisher weniger von einer Theoriebildung ab, sondern werden durch pragmatische (Miss)Erfolge geleitet. In vielen Umweltwissenschaften haben Modelle die Rolle von Theorie abgelöst. Hier wird eine Möglichkeit vorgestellt, wie Modellbegriffe aus unterschiedlichen Disziplinen an formale Sprachen angeschlossen und auf Konsistenz getestet werden können. Ein Ökosystem, in dem Wassertransport und Biomasseakkumulation mit den Methoden und der Sprache dynamischer Systeme modelliert wird, soll gegenübergestellt werden einer Schnittstelle, an der Entscheidungen getroffen und in der Sprache der Spieltheorie modelliert werden. Es wird geprüft, ob vermeintlich technische Schwierigkeiten der Modellierung, wie die Äquifinalität hydrologische Modelle, dabei auf ungeeignete und untereinander inkompatible Abstraktionen zurückgeführt werden können. Im Einzugsgebiet der Langen Bramke, heute eine UN-ECE ICP Level II Fläche, ist die forstliche Nutzungsgeschichte gut dokumentiert. Die Aufnahmen einer 1889 angelegten ertragskundlichen Messfläche wurden bis 1915 fortgesetzt und sind erhalten. 1988 wurden drei neue Flächen angelegt und bis heute fortgeführt. Die Menge und Zusammensetzung des Abflusses wird seit 1977 erhoben. Mit dieser Grundlage wurden mehrere Modelle zur Langen Bramke entwickelt. Eine Klassifikation dieser Modelle im Hinblick auf Abstraktion, Begriffe und Ergebnisse zeigt, warum eine formale Trennung von Mechanismen des Wassertransportes, Funktionen des Waldes und Leistungen der Forstwirtschaft bei der Modellbildung sinnvoll ist. Sie erleichtert die Unterscheidung von technischen und grundlegenden Problemen.
Vorträge Session 11: Wasserbezogene Dienstleistungen des Waldes
79
The influence of forest management on nitrate concentration in temperate streams: a meta-analysis
Anne-Christine Mupepele1and Carsten F. Dormann1
1Biometry and Environmental System Analysis, University of Freiburg, Tennenbacherstr. 4, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Meta-analysis, Water quality, Forest management
The Water Framework Directive from the European Union aims at reducing pollution in water bodies and achieving a good ecological quality status by 2015. One aspect altering stream ecosystems and moving them away from their natural state is nitrate leaching from agricultural fields. Nitrate, together with phosphate, has caused severe eutrophication of rivers and lakes and led to one of the earliest EU directives, the Nitrates Directive from 1991. Primary studies have investigated the relationship between land use and nitrate content of streams. Most research effort was concentrated on agricultural catchments and it is still not fully clear how forest management influences nitrate concentrations in adjacent streams. Meta-analysis is an important tool, often used in systematic reviews, to quantify research results from primary studies and to permit generalization of these results. Here we show the results of a meta-analysis on the impact of forest management on nitrate concentrations in temperate streams.
Vorträge Session 11: Wasserbezogene Dienstleistungen des Waldes 80
Änderung der Sickerwassermengen und Nährstofffrachten durch verschiedene Pflanzenkohlesubstrate in einem Kulturversuch auf einem
sandigen Waldstandort
Martin Listing1, Paul Schmidt-Walter1, Johannes Eichhorn1
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Grätzelstraße 2, 37079 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Pflanzenkohle, Kulturversuch, Sickerwasser, Nitrat
Die Wälder auf den sandigen Standorten im Hessischen Ried sind besonders exponiert gegenüber klimatischen Extremsituationen, die zukünftig vermehrt auftreten werden. Bereits heute können Auflösungserscheinungen der Wälder beobachtet werden. Pflanzungen sind im Hinblick auf die Sicherung der Waldfunktionen daher unerlässlich. Um diese Forstkulturen gegenüber den klimatischen Extremereignissen zu stabilisieren und den Anwuchserfolg zu sichern, kann das Einbringen von Pflanzenkohle mit ihren Einflüssen auf Wasser- und Nährstoffhaltekapazität ein erfolgversprechender Weg sein. Die Wälder sind besonders in der dicht besiedelten Rhein-Main-Ebene wichtige Gebiete der Grundwasserneubildung. Daher wird in diesem Beitrag der Blick auf mögliche Änderungen in der Zusammensetzung des Sickerwassers zwischen den Versuchsvarianten gelenkt, die mit der Bodenbearbeitung und Kohleneinbringung zusammenhängen. In einem randomisierten Blockversuch wurden sechs verschiedene Kohlesubstrate im Hessischen Ried ausgebracht. Die Kohlen unterschieden sich im Ausgangssubstrat und in der Vorbehandlung (aufgesprühte Nährstofflösung, Kompostierung). Auf den mit Hainbuchen und Kiefern bepflanzen Parzellen wurden Saugkerzen installiert, um die Nährstoff-konzentrationen im Sickerwasser während der Nichtvegetationszeit zu untersuchen. Durch Modellierung der Sickerwasserraten werden die mit dem Sickerwasser verlagerten Nährstoffmengen abgebildet. Zusätzlich wurden mit den Kohlesubstraten versetzte Bodenproben mit den Kohlesubstraten im Labor inkubiert um die Ergebnisse des Feldversuches zu verifizieren. Die Beprobung des Sickerwassers zeigte deutliche Unterschiede in der Nährstoff-konzentration während der ersten Nichtvegetationszeit nach Kohleeinbringung. Besonders die Nitratkonzentrationen des Sickerwassers unter vorbehandelten Kohlevarianten waren im Vergleich zur Kontrolle erhöht. In der zweiten Nichtvegetationszeit sind die Unterschiede der Nitratkonzentrationen weniger ausgeprägt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich durch die Einbringung von Kohlesubstraten die Nährstoffkonzentration des Sickerwassers je nach Vorbehandlung der Pflanzenkohle deutlich verändern kann.
Vorträge Session 11: Wasserbezogene Dienstleistungen des Waldes
81
Saisonale Effekte auf Stoffausträge aus Waldflächen im Einzugsgebiet einer Trinkwassertalsperre im Mittelgebirge
Stefan Julich1, Raphael Benning2 und Karl-Heinz Feger1
1 Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Fakultät Umweltwissenschaften, Technische Universität Dresden Pienner Str. 19, 01737 Tharandt, [email protected], [email protected] 2 Staatsbetrieb Sachsenforst, Kompetenzzentrum für Wald und Forstwirtschaft, Referat Standortserkundung, Bodenmonitoring und Labor, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna OT Graupa, [email protected]
Schlagworte: Landnutzung, Stoffaustragsdynamik, Rohwasserqualität, Klimawandel
Waldflächen in Einzugsgebieten sind wegen ihrer im Vergleich zu landwirtschaftlich genutzten Standorten durch stärker geschlossene Stoffkreisläufe gekennzeichnet. Die deswegen geringeren Stoffausträge haben einen sehr günstigen Einfluss auf die Wasserqualität. Dadurch können Wälder und damit die Forstwirtschaft einen bedeutenden Beitrag zur Bereitstellung von einwandfreiem Rohwasser zur Trinkwasserversorgung aus Talsperren liefern. Die Dynamik der Stoffausträge aus Wäldern ist geprägt zum einen vom jahreszeitlichen Verlauf von Temperatur und Niederschlägen, sowie von kurzfristigen Starkniederschlags- und Schneeschmelzereignissen. Am Beispiel der Trinkwassertalsperre Lehnmühle (Osterzgebirge) demonstrieren wir für den Zeitraum 2010 bis 2012 die jahreszeitliche Stoffaustragsdynamik (DOC, Nitrat und Phosphor-Verbindungen) aus Kleinsteinzugsgebieten mit den Landnutzungen Wald, Grünland und Acker und deren Bedeutung für die Wasserqualität in dieser für die Trinkwasserversorgung des Großraums Dresden sehr wichtigen Talsperre. Darüber hinaus diskutieren wir den Effekt kurzfristiger Niederschlagsereignisse auf die Stoffausträge der unterschiedlichen Landnutzungen. Am Beispiel der Nitratausträge werden mit Hilfe des ökohydrologischen Modells SWAT anhand der Simulation möglicher Klimaszenarien gezeigt, wie sich die jahreszeitliche Dynamik der Austräge künftig verschieben könnte.
Vorträge Session 11: Wasserbezogene Dienstleistungen des Waldes 82
Biomasseakkumulation als Minderungsoption für den klimawandelbedingten Anstieg der Nitratkonzentrationen?
Stefan Fleck1, Bernd Ahrends1, Johannes Suthmöller1, Matthias Albert1 und Henning Meesenburg1
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Grätzelstr. 2, 37079 Göttingen, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Nitrat, Biodiversität, Klimawandel, Altbäume
Wasserhaushaltssimulationen für 4 Regionen im Norddeutschen Tiefland (Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt & Brandenburg) zeigen, dass auf Basis des IPCC-Klimaszenarios RCP8.5 mit einem tendenziellen Rückgang der Grundwasserspende bis zum Jahr 2070 zu rechnen ist. Gleichzeitig lassen die erwarteten Temperaturerhöhungen langfristig eine gesteigerte Mineralisierung der Humusvorräte erwarten. Durch das Zusammenwirken des Abbaus der organischen Substanz und der zurückgehenden Grundwasserneubildung ist mit einem langfristigen Anstieg der Nitratkonzentrationen im Sickerwasser unter Wald zu rechnen. Der Anstieg kann besonders in Regionen mit hoher Stickstoffdeposition zu einer Verletzung der Qualitätskriterien der Wasserrahmenrichtlinie führen. Das im ahmen des Projekts „Nachhaltiges Landmanagement im Norddeutschen Tiefland“ (NaLaMa-nT) angewendete Modellierungskonzept basiert auf dem wasserbilanzbezogenen Medianlauf zahlreicher Realisierungen des RCP 8.5-Szenarios mit 3 Globalmodellen, die mit Hilfe des statistischen Regionalmodells STARS (Orlowsky et al. 2008) für Deutschland regionalisiert worden sind. Die klimasensitive Waldentwicklung wurde mit dem Modell Waldplaner (Hansen und Nagel 2014) bis 2070 simuliert. Die so erhaltenen Bestandesdaten dienten als Grundlage für die Wasserhaushaltsmodellierung mit WaSiM-ETH (Schulla 2015) und die Stoffhaushaltsmodellierung mit VSD+ (Bonten et al. 2011). Die Simulationen wurden für 3 alternative Bewirtschaftungsoptionen durchgeführt: Der Referenzpfad zeichnet sich durch die fortgesetzte Anwendung bestehender Durchforstungsregeln aus, während der Klimaschutzpfad den Einsatz schnell wachsender Nadelhölzer mit kürzeren Umtriebszeiten simuliert und der Biodiversitätspfad durch längere Umtriebszeiten, Bevorzugung von Laubbäumen, die Erhaltung alter Bäume und einen erhöhten Totholzanteil gekennzeichnet ist. Während sich die Nitratproblematik durch die Maßnahmen des Klimaschutzpfads verschärfte, bewirkte die Akkumulation von Biomasse in den alternden Wäldern des Biodiversitätspfad eine Abmilderung des Anstiegs der Nitratkonzentrationen in allen 4 Modellregionen.
Vorträge Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft
83
Mobilisierung von Holzreserven durch verbesserte Information und Qualifizierung von Waldbesitzern
Hans-Ulrich Dietz1, Ute Seeling1, Nadine Karl1
1Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. Spremberger Straße 1, 64823 Groß-Umstadt, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Holzmobilisierung, Qualifizierung, Waldbesitzer
Mobilisierung von Holzreserven in Privatwäldern ist schon seit Jahren ein prioritäres Ziel zahlreicher Projekte. Mit dem Projekt SIMWOOD werden europaweit Maßnahmen konzipiert und durchgeführt, um Waldbesitzer durch verbesserte Information und Qualifikation zur verstärkten Nutzung ihrer Wälder zu motivieren. Das K F hat dazu ein „ egional Learning Lab“ organisiert, an dem annähernd 5000 Personen teilnahmen. Rund 120 von ihnen beteiligten sich an einer mündlichen Befragung, bei der es um die Vorkenntnisse im Bereich der Waldnutzung sowie die individuelle Qualifikation und die technische Ausstattung ging. Weitere Fragen betrafen die Bereitschaft der Waldbesitzer, sich gemeinschaftlich zu organisieren und die Ziele, die sie mit ihrem Waldeigentum verfolgen. In dem Beitrag soll die Auswertung der Befragung vorgestellt werden.
Vorträge Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft 84
Automatische Radlastregelung zur Verbesserung der Bodenschonung und technischen Befahrbarkeit von Rückegassen
Florian Schnaible1und Dirk Jaeger1
1Professur für Forstliche Verfahrenstechnik, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Werthmannstr. 6, 79085 Freiburg, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Forstliche Verfahrenstechnik, Bodenschonung, Holzernte
Für die ökologisch und ökonomisch nachhaltige Nutzung des nachwachsenden Rohstoffs „Holz“, sind der Einsatz von modernen sowie hoch spezialisierten 6-/8-Rad-Forstmaschinen und damit ein Befahren von Waldböden unerlässlich. Die dabei entstehenden Bodenschäden wie Verdichtung und Spureintiefung werden gezielt auf systematisch und dauerhaft angelegten Rückegassen konzentriert. Dabei gilt als oberste Prämisse der dauerhafte Erhalt der technischen Befahrbarkeit. Untersuchungen zeigen, dass die möglichst gleichmäßige Lastverteilung auf alle Räder einen maßgeblichen Einfluss auf einen bodenschonenden Einsatz von Forstmaschinen und der Erhalt der technischen Befahrbarkeit von Rückegassen bei der Holzernte hat. Der Ansatzpunkt bei 6-/8-Rad-Forstmaschinen liegt darin, dass bei diesen Forstfahrzeugen so genannte Bogieachsen verwendet werden. Bei diesen Achsen sind jeweils das rechte und linke Räderpaar pendelnd am Fahrzeugrahmen gelagert, wodurch sich eine gute Geländegängigkeit z.B. beim Überfahren von Hindernissen oder Gräben ergibt. Durch die geometrischen Verhältnisse der Bogieachsen verursacht das Antriebsmoment Schubkräfte, die wiederum zu einem Aufstelleffekt führen und einer ständigen Bodenhaftung aller Räder, speziell bei hohem Zugkraftbedarf entgegenwirken. So können dynamische Radlastunterschiede am Versuchsfahrzeug zwischen Vorderrad und Hinterrad einer Bogieachse von rund 2800 kg und mehr gegenüber statischen Messungen auftreten. Dies bedeutet, dass das die Radlast am vorderen Rad abnimmt, während gleichzeitig die Radlast am hinteren Rad zunimmt. Dieser ungünstigen Radlastverteilung kann mit einem geeigneten Mess- und Regelsystem entgegen gewirkt werden. Untersuchungen auf homogenisierten Ackerböden und natürlich gewachsenen Waldböden zeigen bei der Überfahrt einer Forstmaschine mit Radlastregelsystem im Vergleich zur Überfahrt ohne Radlastregelsystem eine deutlich geringere Bodenverdichtung. Ebenso kann der entstehende Schlupf am Fahrzeug minimiert werden. Somit kann ein solches Radlastregelsystem einen Beitrag zur Bodenschonung und dem Erhalt der technischen Befahrbarkeit leisten.
Vorträge Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft
85
Grenzen der Befahrbarkeit. Welchen Einfluss haben Schlupf und Radlast auf die Spurbildung?
Sven Pasemann1 , Jörn Erler2 und Jörg Hittenbeck3
1ThüringenForst AöR – Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha (FFK Gotha); Jägerstr. 1, D-99867 Gotha; [email protected] 2Technische Universität Dresden - Professur Forsttechnik; Dresdner Str. 24, D-01737 Tharandt ³Georg-August-Universität Göttingen - Abteilung Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnologie (ifa); Büsgenweg 4, D-37077 Göttingen
Schlagworte: Schlupf, Traktion, Spurbildung, Radlast
Die Nachfrage nach dem Rohstoff Holz spielt in der heutigen Gesellschaft eine immer bedeutendere Rolle, sowohl für die energetische als auch stoffliche Verwendung. Gleichzeitig rückt das Ökosystem Wald in unterschiedlichster Form in die öffentliche Wahrnehmung. Insbesondere Befahrungen im Zuge der Holzerntemaßnahmen werden von der Bevölkerung oftmals kritisch betrachtet. Restriktionen und Vorgaben binden den Maschinenverkehr im Wald auf permanente Erschließungssysteme, welche die Basis der mechanisierten Holzernte darstellen. Veränderungen des Bodenzustandes im Bereich der Fahrtrassen als Ergebnis der Befahrung sind bekannt und auch beschrieben. Der Hauptgrund für die Änderung der Bodeneigenschaften wird oft in den Radlasten gesehen, mit denen sich die Forstmaschinen auf den Gassen bewegen, wobei diese eine Bodenverdichtung mit einem Anstieg der Lagerungsdichte und eine Reduzierung des Grobporenvolumens verursachen. Ein zweiter, oft unterschätzter Effekt ist die Abtragung und Materialverlagerung des Oberbodens durch den zum Teil hohen Schlupf (Traktionsverlust) der Räder. Beide Effekte entstehen zeitgleich und es ist bis jetzt nicht eindeutig geklärt, welcher Effekt für die Spurbildung verantwortlich ist. In einem Kooperationsprojekt von ThüringenForst AöR und der Abteilung Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnologie (ifa) der Universität Göttingen wurden die Hauptursachen für die Spurbildung untersucht. Dazu wurde gemeinsam ein Projektkonzept entwickelt, bei dem unterschiedliche Flächen in Thüringen, mit für Thüringen typischen Bodeneigenschaften, ausgewählt wurden und auf diesen eine gebrauchsübliche Holzrückemaschine (Forwarder), mit unterschiedlichen Beladungszuständen und unterschiedlicher Bereifungen sowie unterschiedlichen Bogiebändern, zum Einsatz kam. Größen wie zum Beispiel Lagerungsdichte und Scherfestigkeit des Bodens, Ausformung der Rückgassen sowie Schlupf und Auflast der Maschine, sollten als erklärende Variablen erhoben werden. Durch den Vergleich der Spurbildung in den unterschiedlichen Versuchsvarianten sowie die resultierenden unterschiedlichen Schlupfniveaus in Abhängigkeit des Zugkraftbedarfs lassen sich die verschiedenen technischen Bodenschutzmaßnahmen untereinander vergleichen und bewerten. Ziel des Projektes ist zum einen, aus den Ergebnissen fundierte Empfehlungen für den Maschineneinsatz bei ungünstigen Witterungsbedingungen abzuleiten, und zum anderen, neben der Charakterisierung von Fahrspuren, die Beantwortung der Fragestellung ob sich Grenzen für die Befahrung über Eingangsparameter erkennen lassen. Die Projektergebnisse sollen im Rahmen der Forstwissenschaftlichen Tagung vorgestellt werden.
Vorträge Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft 86
Superbreitreifen schonen die Rückegasse – Mehr als nur Reduzierung des Kontaktflächendruckes?
Johannes Haas1, Helmer Schack-Kirchner1, Friederike Lang1
1 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Professur für Bodenökologie, Bertoldstrasse 17, 79098 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Rückegasse, technische Befahrbarkeit, Superbreitreifen, Photogrammetrie
Dem Erhalt der technischen Befahrbarkeit von Rückegassen kommt in der modernen Forstwirtschaft eine hohe Bedeutung zu. Durch den Einsatz von schweren Holzerntemaschinen unter ungünstigen Bodenbedingungen kann es zu starker Gleis- und Wulstbildung kommen, welche die Befahrbarkeit einschränken und die dauerhafte Nutzung von Rückegassen in Frage stellen können. In einem Befahrungsexperiment auf einem sehr befahrungsempfindlichen Standort wurde die Fahrspurbildung von 940 mm Superbreitreifen untersucht und mit gängigen technischen Anpassungen zur Spurreduzierung (710 mm Breitreifen und Eco-Track Bogiebändern) verglichen. Mit einem photogrammetrischen Verfahren wurden hochaufgelöste digitale Höhenmodell der Fahrspuren erzeugt und daraus Spurtiefe, Wulsthöhe, Materialverlagerungsbilanz und die erosionsrelevante Wasserspeicherkapazität der Oberflächen abgeleitet. Zusätzlich wurde die Lagerungsdichte in den Fahrspuren und Wülsten mit Hilfe von Stechzylinderproben erhoben. Superbreitreifen reduzierten die Spurtiefe um 50 % bzw. 40 % im Vergleich zu 710 mm Breitreifen und Bogiebändern. Die Verlagerung von Bodenmaterial führte bei 710 mm Breitreifen und Bogiebändern zu einer intensiven Ausbildung von Wülsten welche die Erosion entlang von Fahrspuren begünstigen können. Wulstbildung fand bei 940 mm Breitreifen in deutlich geringerem Umfang statt. Entgegen ursprünglicher Vermutungen wurden keine Unterschiede der Fahrspurverdichtung der untersuchten Bereifungsvarianten festgestellt. Die Lagerungsdichten der Wülste wiesen ebenfalls keine Unterschiede auf. Individuelle Spur- bzw Wulstausprägungen scheinen daher unter den gegebenen Feuchte- und Texturbedingungen das Produkt von verschiedenen Verlagerungsdynamiken der Reifen in Folge einer maximal möglichen Verdichtung zu sein. Die unterschiedlichen Oberflächenmorphologien von Reifen und Bändern beeinflussen die Retention von Wasser in Fahrspuren durch die Erzeugung von abflusslosen Mikrostrukturen. Die speicherbaren Wassermengen sind bei allen Bereifungsoptionen sehr gering. Dennoch kann durch die parallele Anordnung der Stege von Bändern signifikant mehr Wasser in den Gleisen zurückgehalten werden als in von Reifen verursachten Fahrspuren.
Superbreitreifen können einen positiven Beitrag zum Erhalt der technischen Befahrbarkeit von Rückegassen leisten und stellen möglicherweise eine Alternative zu Bogiebändern unter ungünstigen Bodenbedingungen dar.
Vorträge Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft
87
PrAllCon-Track: Zur Druckverteilung unter Bogiebändern
Jörg Hittenbeck1, Henrik Brokmeier1 und Heribert Jacke1
1Abteilung Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnologie, Büsgenweg 4, 37077 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Kontaktflächendruck, Bogie-Bänder, Reifen
Das Thema Bodenschäden infolge der Befahrung des Waldbodens mit forstlichen Arbeitsmaschinen rückt immer wieder in den Fokus des Interesses. Bei den befahrungsbedingten Bodenschäden lässt sich zwischen den klassischen und vielfach untersuchten Verpressungsschäden im Boden und der erodierenden Verformungen des Oberbodens differenzieren. Erstgenannte Schäden äußern sich in einer Verschlechterung der Bodenfunktionen und resultieren primär aus der vertikal auf den Boden wirkenden Gewichtskraft. Um den Einfluss unterschiedlicher Faktoren auf den Kontaktflächendruck an der Schnittstelle von Reifen und dem Untergrund zu quantifizieren, führte die Abteilung Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnologie der Georg-August-Universität Göttingen in den vergangenen Jahren im Zuge unterschiedlicher Projekte umfangreiche Prüfstandsmessungen durch. Dabei zeigte sich, dass vergleichsweise einfach zu erhebende Parameter zur Prognose der Druckverteilung unter Einzelreifen auf weichem Untergrund herangezogen werden können. Während sich die Versuchsreihen zunächst auf die Einzelreifenbetrachtung beschränkten, stand bei einem Folgeprojekt der Einfluss von Bogiebändern im Fokus. Um die Druckverteilung unter Bogieachsen zu analysieren, wurde ein neuer Prüfstand entwickelt, mithilfe dessen ganze (mit Bändern bewehrte) Bogieachsen bemessen werden konnten. Bei den Messreihen wurde der Einfluss unterschiedlicher Bauweisen von Bändern berücksichtigt. Dazu zählen primär auf eine Zugkrafterhöhung ausgelegte „Traktionsbänder“, „tragende Bänder“, die durch breite Platten mit geringen Zwischenräumen für die Befahrung nachgiebiger Böden vorgesehen sind sowie „Allround-Bänder“, welche die positiven Eigenschaften beider anderen Bandtypen kombinieren sollen. Weitere Faktoren, deren Einfluss daneben quantifiziert werden konnte, sind beispielsweise die Auflast, die Reifenbreite und der Felgendurchmesser.
Vorträge Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft 88
Regeneration von Bodenverdichtung auf Fahrpuren im Wald und Auswirkungen auf das Baumwachstum
Corinna Ebeling1, Friederike Lang2, Heinz-Christian Fründ3 und Thorsten Gaertig1
1HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Fakultät Ressourcenmanagement,Büsgenweg 1a, 37077 Göttingen, [email protected], [email protected]
2Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Professur für Bodenökologie, Bertoldstr. 17, 79098 Freiburg i.Br., [email protected] 3Hochschule Osnabrück, Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur, Oldenburger Landstr. 24, 49090 Osnabrueck, [email protected]
Schlagworte: Bodenverdichtung, Regeneration, Baumwachstum
Der Einsatz von Forstmaschinen ist für eine rationelle Waldbewirtschaftung unvermeidlich, obwohl das Befahren von Waldböden Bodenschäden bewirkt. Durch Bodenverdichtung kommt es zu Strukturstörungen, die sowohl die physikalischen als auch biologischen und chemischen Eigenschaften des Bodens beeinflussen. Es ist jedoch schwierig, die Regenerationszeiträume einzuschätzen. Die Angaben in verschiedenen Studien reichen von wenigen Jahren bis zu mehreren Dekaden oder es kann keine Regeneration festgestellt werden. Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass das Baumwachstum auf den verdichteten Böden alter Rückegassen reduziert ist. Ziel dieser Untersuchung war, das Regenerationspotential verdichteter Rückegassen verschiedener Standorte zu vergleichen. Desweiteren wurde untersucht, inwiefern das Baumwachstum auf alten Rückegassen eingeschränkt ist und ob sich eine Regeneration der Bodenstruktur auch im Baumwachstum widerspiegelt. Es wurden in drei Untersuchungsgebieten in Niedersachsen (Göttingen, Solling, Heide), die sich in pH-Wert (pH 3-7) und Tongehalt (5-60 %) unterschieden, Rückegassen untersucht, die seit 10-40 Jahren nicht mehr befahren wurden. Es wurden die Parameter CO2-Konzentration der Bodenluft, Gasdiffusionskoeffizient, Feinwurzeldiche, Enzymaktivität und Aktivitätsspuren von Regenwürmern erfasst. In der Region Göttingen wurde zusätzlich die Auswirkung der Bodenverdichtung auf das Wachstum von Buchen und Esche untersucht. Dafür wurde ein Bestand ausgewählt, in dem 1971 eine Endnutzung stattfand. Anschließend wurde die Fläche aufgeforstet, sodass sich die Möglichkeit ergab, das Baumwachstum auf den alten Fahrspuren und in den unbefahrenen Bereichen zu untersuchen. Die Bodenstruktur der biologisch sehr aktiven und tonhaltigen Standorte in der Region Göttingen regenerierte innerhalb von 20 Jahren. Das Höhen- und Dickenwachstum der Bäume lag in den ersten 20 Jahren nach der Befahrung deutlich unter dem Wachstum der Bäume im unbefahrenen Bestand. In den nachfolgenden Jahren hingegen übertrafen das Höhen- und Dickenwachstum der Bäume auf den Fahrpuren das Wachstum der Bäume im unbefahrenen Bereich. Im Gegensatz dazu waren in der Region Heide auch nach 40 Jahren Bodenstrukturstörungen nachweisbar. Dieser Standort mit einem geringen Tongehalt und geringer biologischer Aktivität gilt als wenig verdichtungsempfindlich, weist jedoch ein sehr geringes Regenerationspotential auf.
Vorträge Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft
89
Einsatz akkubetriebener Kettensägen in der professionellen Waldbewirtschaftung
Jörg Hittenbeck1, Lukas Hellwig, Sebastian Deike1 und Eike Tiemann1
1Abteilung Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnologie, Büsgenweg 4, 37077 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Läuterungsarbeiten, Life-Cycle-Analysen, manuelle Waldarbeit
Die öffentliche Wahrnehmung von Holzernte wird in weiten Teilen durch hochmechanisierte Verfahren und die darin eingesetzten Großmaschinen bestimmt. Dabei wird heute je nach Region und Waldeigentumsart immer noch ein erheblicher Anteil der Waldbewirtschaftung durch manuelle Verfahren und Kleinmaschinen, wie beispielsweise Motorsägen, bewerkstelligt. Im Gegensatz zur Baubranche kommen dabei weitüberwiegend kleinere (Zweitakt-) Motoren zum Einsatz, da Steckdosen für die Stromversorgung aus verständlichen Gründen im Wald nicht vorhanden sind. Die sich ständig verbessernden Akkutechnologien machen jedoch zunehmend auch den Einsatz von Elektromotoren abseits der „Zivilisation“ interessant. Mögliche Einsatzgebiete in der Forstwirtschaft ergeben sich dort, wo leichtere Sägen vorteilhaft sind und kein permanenter Betrieb der Maschinen dominiert. Um die derzeitigen Chancen der Technik im Wald zu untersuchen, wurden einzelne Arbeitsrotten für passende Arbeiten beispielsweise bei Läuterungen oder im Hochsitzbau mit vergleichbaren Akku- und Benzingeräten ausgestattet. Vor dem Einsatz stand eine Befragung der Forstwirte hinsichtlich der Erwartungen an die Technik, die im Anschluss an die Maschinenutzung mit dem Erfragen der gewonnen Erfahrungen abgeschlossen wurde. Eine zusätzliche Versuchsreihe auf einem Motorprüfstand widmete sich den technischen Leistungsparametern der eingesetzten Geräte sowie der realisierbaren Akkuleistungen. Bei den bisherigen Probeeinsätzen kommen die Nutzer zu der Einschätzung, dass die Leistung und die Einsatzzeiten noch nicht für den Einsatz in der professionellen Holzernte ausreichen. Bei Arbeiten mit intermittierendem Betrieb beispielsweise im Hochsitzbau oder bei Arbeiten mit einem Hochentaster notieren die Nutzer jedoch Vorteile durch die schnelle Verfügbarkeit ohne separaten Motorstart und das Drehmoment, welches aus dem Stand zur Verfügung steht.
Vorträge Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft 90
Seilkraneinsatz in China – Technologie mit Zukunft? Schlussfolgerungen nach 3 Jahren Lin2Value-Projekt
Stephan Hoffmann1 und Dirk Jaeger1
1Professur für Forstliche Verfahrenstechnik, Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Wertmannstr. 6, 79085 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Seilkran, Plantagen, China
Der durch die wirtschaftlichen Entwicklungen der Volksrepublik China stetig steigende nationale Bedarf an Rundholz führte zu massiven Versorgungsengpässen und einer starken Abhängigkeit von Importen. Trotz intensiver Reformprogramme zur Entwicklung des Forstsektors und der Förderung industrieller Forstplantagen in den südlichen Provinzen scheint dieser Engpass zumindest mittelfristig fortzubestehen. Die großen Erwartungen die in den Ausbau des Plantagenanbaus gesetzt wurden konnten aufgrund waldbaulicher aber auch infrastruktureller und technischer Probleme nicht erfüllt werden. Die vorherrschend manuellen Arbeitsverfahren von der Bestandesbegründung bis zur Holzernte ermöglichen keine Umsetzung der im Rahmen der proklamierten Multifunktionalität, dauerwaldartigen Bewirtschaftung mit Einzelbaumnutzung, sowie eine effiziente und zeitgemäße Bewirtschaftung der teils schwerzugänglichen Bestände hinsichtlich neuer chinesischer Markt-, Sozial- und Umweltansprüche. Der Einsatz von Mobilseilkränen ist ein innovativer Ansatz den besonders kritischen Bereich der Holzbringung von Plantagen in Hanglagen zu verbessern, ist aber ein bisher kaum bekanntes bzw. verwendetes Arbeitsverfahren. Innerhalb des dreijährigen Kooperationsprojekts Lin2Value wurde eine Kippmastanlage und ein lokal angepasstes Arbeitsverfahren in den operativen Bereich des Experimental Center of Tropical Forestry in Pingxiang/Autonome Region Guangxi eingeführt. Die Verfahrensanwendung und der Maschineneinsatz in typischen Kiefernplantagen von Guangxi der innerhalb des Projekts ausgebildeten Seilmannschaft wurden arbeitswissenschaftlich über annähernd 2 Jahre begleitet und in Form einer Fallstudie ausgewertet. Darüber hinaus konnte eine weitere Fallstudie eines projektunabhängig, privatwirtschaftlich eingeführten Seilkransystems in der Region durchgeführt werden. Beide Fallstudien, zusammen mit der allgemeinen Verfolgung der regionalen forsttechnischen und sozioökonomischen Entwicklungen während des Projektzeitraums, identifizieren Herausforderungen bei der Technikeinführung und erlauben einen mittelfristigen Ausblick für die Berücksichtigung von Seilkrantechnik aber auch anderer mechanisierter und teilmechanisierter Holzernteverfahren in der Region zu geben.
Vorträge Session 13: Nutzungsintensität als Stellschraube z. Lösung v. Zielkonflikten
91
Waldbauliche Zeitmischungen in deutschen Buchenbeständen als Option zur Verbesserung von Produktivität und Einkommen deutscher
Forstbetriebe
Martin Redmann1
1Martin Redmann, UNIQUE forestry and land use, Schnewlinstr. 10, 79098 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Buchenbestände, Zeitmischungen, Produktivität, Forstbetriebsökonomie
Die dritte Bundeswaldinventur zeigt den rapide fortschreitenden Trend der seit 1987 sinken-den Anteile von Nadelwaldflächen in deutschen Wäldern. Vor diesem Hintergrund untersuchen UNIQUE forestry and land use und die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg in dem vom BMEL geförderten Projekt „ProduktivitätsPLUS“ die Effekte waldbaulicher Zeitmischungen mit schnellwachsenden Baumarten in Buchenrein- und -mischbeständen hinsichtlich ihrer Produktivität und Wertschöpfung. Ziel des Projektes ist eine empirische fundierte Analyse über die Optionen durchzuführen, welche die Rohstoffversorgung mit Holz durch Zeitmischungen in heimischen Buchenbeständen sichern und gleichzeitig die Einkommenssituation der Forstbetriebe verbessern können. Die Untersuchung berücksichtigt dabei verschiedene Ziele und Rahmenbedingungen – insbesondere die Wahrung des nachhaltigen Standort-Potenzials, naturschutzfachliche Restriktionen, Klimaschutzleistungen der verschiedenen Bestände sowie Anpassungs-notwendigkeiten an den Klimawandel. Folgende konkrete Fragestellungen werden analysiert und bewertet: Wie können strukturreiche Mischwaldbestände aus Laub- und Nadelholz durch
erfolgreiche Etablierung von Zeitmischungen mit z. B. Douglasie oder Vorwaldbaumarten in Buchenbeständen etabliert werden?
Wie kann das Rohholzangebot durch erfolgreich etablierte Zeitmischungen in Buchenbeständen gesichert bzw. optimiert werden – unter der Annahme, dass sie bereits nach wenigen Jahrzehnten zu signifikanten Steigerungen des Holzangebotes gegenüber einem waldbaulichen Vorgehen ohne Zeitmischungen beitragen?
Wie kann eine Sicherung der Flächenproduktivität auch bei wachsender Laubwaldzunahme durch standortsdifferenzierte, waldbauliche Behandlungsvarianten für zeitliche Mischungen aus Laub- und Nadelholz gewährleistet werden?
Durch Zusammenarbeit mit sechs Forstbetrieben werden waldbauliche Daten und Erfahrungen zur Umsetzung von Zeitmischungen analysiert, Optionen zur erfolgreichen Weiterentwicklung abgeleitet und die Ergebnisse im Jahr 2018 deutschlandweit zur Verfügung gestellt. Die deutschlandweite Aussagefähigkeit zu den Effekten von Zeitmischungen in Buchenbeständen z. B. mit Douglasie, Küstentanne oder Vorwald-baumarten wird durch aktuelle Daten der Bundeswaldinventur III sichergestellt. Die deutschlandweit prominente Stellung des Projektes resultiert daraus, dass praxisverwendbare Erkenntnisse zu aktuellen wie künftigen Fragestellungen nach wissenschaftlichen Standards gewonnen werden.
Vorträge Session 13: Nutzungsintensität als Stellschraube z. Lösung v. Zielkonflikten 92
Waldbauliche Strategien für eine erhöhte Holznutzung im Gebirge
Christian Temperli1, Golo Stadelmann1, Esther Thürig1 und Peter Brang1
1Eidg. Forschungsanstalt WSL, Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Empirisches Waldwachstumsmodell MASSIMO, Graubünden, Holznutzung, Schutzwald
Die Nachfrage nach Holz als Baustoff, Energiequelle und Ausgangsmaterial für verschiedenste chemische Produkte dürfte langfristig zunehmen. Der Holzzuwachs wird jedoch in vielen Gebirgsregionen Zentraleuropas nur teilweise genutzt. Dies kann zu Versorgungsengpässen für die lokale Holzindustrie führen, die Resistenz des Waldes gegenüber Windwurf- und Borkenkäferstörungen verringern und die Funktion des Waldes als Schutz vor Lawinen und Steinschlag beeinträchtigen. Es stellt sich die Frage wie sich eine Intensivierung der Holznutzung mit den Bewirtschaftungsregulationen in Wäldern, die vor Lawinen und Steinschlag schützen (Schutzwald), vereinbaren lässt. In dieser Arbeit wurde ein empirisches, auf dem Schweizerischen Landesforstinventar basierendes Waldwachs-tumsmodell verwendet, um verschiedene waldbauliche Strategien einer erhöhten Holzmobilisierung zu evaluieren. Dazu wurde die Waldentwicklung für die Periode 2007–2106 einzelbaumweise auf den 698 Probeflächen (PF) des Kantons Graubünden simuliert, wobei Bewirtschaftungseinschränkungen und -Anreize im Schutzwald Typ A und B (44% der PF) berücksichtigt wurden. Die Szenarien wurden bezüglich Vorratsentwicklung, Waldstruktur und Holzerntekosten evaluiert. In Szenarien, welche von einer Erhöhung der Holznutzung um 50% und 100% gegenüber der Inventurperiode 1995–2006 ausgehen, wurde im Schutzwald eine deutliche Vorratsabnahme simuliert, während der Vorrat ausserhalb des Schutzwaldes weiter anstieg. Diese divergierende Waldentwicklung in- und ausserhalb des Schutzwaldes ist eine Folge der Bewirtschaftungsregulationen und der damit einhergehenden Priorisierung der Bewirtschaftung, insbesondere der Durchforstungen, im Schutzwald. Die Auswirkungen unterschiedlicher Bewirtschaftungsintensitäten (intensiv auf kleiner Fläche vs. weniger intensiv auf grosser Fläche) auf die Vorratsentwicklung und die Waldstruktur waren im Vergleich zu den Auswirkungen einer erhöhten Nutzung klein. Die Erntekosten pro Festmeter waren in Simulationen mit gesteigerter Nutzung höher, da auch Probeflächen in schlecht zugänglichem Gelände bewirtschaftet werden mussten, um die vorgegebenen Nutzungsziele zu erreichen. Ein Rückgang der Bewirtschaftung ausserhalb des Schutzwaldes bietet Chancen aus Sicht des Naturschutzes, aber auch Risiken bezüglich Störungsresistenz. Um die Resilienz des Waldes gegenüber Störungen und Klimawandelrisiken zu sichern, sollten Bewirtschaftungsanreize auch ausserhalb des Schutzwaldes geschaffen werden.
Vorträge Session 13: Nutzungsintensität als Stellschraube z. Lösung v. Zielkonflikten
93
Die ökonomisch optimale Nutzungsintensität unter Berücksichtigung der forstlichen Nachhaltigkeit
Johannes Gerst1und Bernhard Möhring1
1 Georg-August-Universität Göttingen, Abteilung Forstökonomie und Forsteinrichtung, Büsgenweg 3, D-37077 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: optimale Nutzungsintensität, forstliche Nachhaltigkeit, endogener Grenzzins, Bundeswaldinventur, Logit-Modell
Forstbetriebe nutzen knappe Ressourcen (Waldböden, Waldbestände etc.) zur Erreichung ihrer Wirtschaftsziele. Die Bemühungen, forstliches Handeln auf eine rational-ökonomische Basis zu stellen, sind beinahe so alt wie die geregelte Waldbewirtschaftung selbst. Als ''klassisches'' forstökonomisches Entscheidungsproblem gilt die Bestimmung des ökonomisch optimalen Erntezeitpunkts. Das von Faustmann 1849 beschriebene Verfahren korrespondiert mit den heute gebräuchlichen neoklassischen Verfahren der dynamischen Investitionsrechnung. Vergleichsmaßstab ist ein Kalkulationszins, dem die Funktion eines Lenkpreises für das knappe Kapital zukommt. Anders als i.d.R. unterstellt gibt es jedoch in der Wirklichkeit keinen vollkommenen Kapitalmarkt, auch unterliegt Forstwirtschaft speziellen Restriktionen wie der Nachhaltigkeit. Soll dies in Entscheidungsmodellen berücksichtigt werden, sind simultan optimierende Totalmodelle erforderlich, die alle Faktoren explizit enthalten. Berücksichtigt man in einem betrieblichen Totalmodell die forstliche Nachhaltigkeit im Sinne der Erhaltung des Holzvorrates, so verliert der exogene Kalkulationszins seine Lenkungswirkung. Aus den mit Hilfe des Modells getroffenen Entscheidungen ergibt sich jedoch ein „endogener Grenzzins“, der für alle Entscheidungen bei ökonomisch optimaler Nutzungsintensität identisch ist. Anhand der Daten der Bundeswaldinventuren I und II wird exemplarisch gezeigt, wie der endogene Grenzzins, der mit dem tatsächlichen Nutzungsverhalten korrespondiert, mit Hilfe diskreter Entscheidungsmodelle geschätzt werden kann. Der ermittelte Grenzzins ist moderat, jedoch nicht gleich Null. Ein Waldreinertragsmaximum, welches implizit unbegrenzte Kapitalverfügbarkeit unterstellt, wurde von forstlichen Entscheidungsträgern also offenbar nicht angestrebt. Auch wird gezeigt, dass aus empirischen Daten hergeleitete endogene Grenzverzinsungen in „klassischen“ Partialmodellen als Kalkulationszins eingesetzt werden können, um realitätsnahe ökonomisch optimale Nutzungsintensitäten herzuleiten, die u.a. für Bewertungen als wichtige Bezugsgrößen dienen können.
Vorträge Session 13: Nutzungsintensität als Stellschraube z. Lösung v. Zielkonflikten 94
Belastungen der deutschen Forstwirtschaft aus der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
Björn Seintsch1, Markus Dög2, Lydia Rosenkranz1 und Matthias Dieter1
1 Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie, Leuschnerstraße 91, 21031 Hamburg, bjoern.seintsch@ thuenen.de 2 Georg-August-Universität Göttingen, Büsgenweg 3, 37077 Göttingen, E-Mail: [email protected]
Schlagworte: Schutz- und Erholungsfunktion, Mindererträge und Mehraufwendungen, forstbetriebliches Simulationsmodell
Nach § 41 (3) des BWaldG besteht eine Berichtspflicht gegenüber dem Deutschen Bundestag zu den Belastungen der Forstwirtschaft aus der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erträge und Aufwendungen für die Schutz- und Erholungsfunktion durch aktive forstbetriebliche Leistungserstellung sind im Testbetriebsnetzes Forst (TBN-Forst) im Produktbereich 2 „Schutz und Sanierung“ und Produktbereich 3 „Erholung und Umweltbildung“ verbucht. Neben den teilweise negativen Reinerträgen in diesen Produktbereichen ergeben sich Belastungen aus der Schutz- und Erholungsfunktion aber auch aus kalkulatorischen Mindererträgen und Mehraufwendungen in der Rohholzerzeugung. Diese können als die entgangenen Erträge und zusätzlichen Aufwendungen gegenüber einer nicht realisierten betrieblichen Handlungsalternative definiert werden. In der vorliegenden Studie wurde eine neue Methode entwickelt bei der Belastungen als Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen zur Sicherstellung der Schutz- und Erholungsfunktion verstanden werden, welche sich gegenüber einer Referenz ergeben, in der die Gewährleistung dieser Funktionen freigestellt ist. Hierfür wurde eine Zusatzbefragung des TBN-Forst zu den forstbetrieblichen Steuerungsgrößen der Waldbewirtschaftung durchgeführt. Die Differenzen in den Angebotsmengen an Baumholz und in den Deckungsbeiträgen sowie die Annuität der Ertragswertdifferenzen wurden mit einem forstbetrieblichen Simulationsmodell für einen 200jährigen Bewertungszeitraum bestimmt. Wie die eigene Studie aufgezeigt, werden Schutz- und Erholungsfunktionen durch Forstbetriebe in einem nennenswerten Umfang durch gezielte Unterlassungen in der Rohholzerzeugung sichergestellt. Diese Mindererträge und Mehraufwendungen reduzieren das Betriebsergebnis gegenüber der nicht realisierten Handlungsalternative. Dög M, Seintsch B, Rosenkranz L, Dieter M (2016) Belastungen der deutschen Forstwirtschaft aus der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Landbauforsch Appl Agric Forestry Res (eingereicht)
Vorträge Session 13: Nutzungsintensität als Stellschraube z. Lösung v. Zielkonflikten
95
Kohlenstoffspeicherung und ökonomische Perspektiven in nachhaltig bewirtschafteten tropischen Regenwäldern in Fidschi
Michael Mussong1, Setareki Qaliduadua 2, Daniel Plugge3 und Jan-Hendrik Hofmann4
1Hochschule für nachhaltige Entwicklung, Alfred-Möller-Str., 16225 Eberswalde, [email protected] 2Department of Fisheries and Forest, Research Division, Colo I Suva, Fidschi, [email protected] 3Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Suva, Fidschi, [email protected] 4Green Owl Development UG, Berliner Str. 91, 13189 Berlin, [email protected]
Schlagworte: Tropenwaldbewirtschaftung, Kohlenstoffspeicherung, REDD+, Fidschi
Zur Entwicklung eines nachhaltigen Bewirtschaftungssystems (sustainable forest management: SFM) für tropische Regenwälder in Fidschi wurden von 1992 bis 1994 in 7 Abteilungen eines Versuchsgebiets zielstärkenbasierte Holzernteeingriffe in 3 unter-schiedlichen Entnahmeintensitäten durchgeführt. Für Vergleichszwecke wurden 2 weitere Abteilungen nach gängiger Praxis (konventionell) beerntet sowie 3 Abteilungen von der Holzernte ausgenommen. Zwanzig Jahre nach der Holzernte erfolgte eine Inventur des Versuchsgebiets, bei der neben Holzvolumen und Zuwachswerten auch Kohlenstoffdaten für die gesamte oberirdische Biomasse (Laubstreu, Totholz, Nichtholz- und Holzvegetation) erhoben wurden. Der Kohlenstoff in der Wurzelbiomasse wurde in gängiger Relation zur oberirdischen Biomasse geschätzt; Bodenkohlenstoff wurde nicht erfasst. Die Ergebnisse zeigen, dass der durchschnittliche Kohlenstoffvorrat ca. 20 Jahre nach der präferierten SFM-orientierten Behandlung nur ca. 3 % geringer ist, als in den nicht beernteten Abteilungen. Dagegen weisen die konventionell beernteten Abteilungen ca. 23 % weniger Kohlenstoff auf. Simulationsrechnungen lassen erwarten, dass nach SFM-Behandlung keine Netto-Emission an CO2 eintritt, wenn ≥33 % des entnommenen Holzes nach 20 Jahren noch existiert oder als Ersatz für fossile Energieträger genutzt wurde. Aus ökonomischer Perspektive wird deutlich: Aufgrund des gegenüber konventioneller Holzernte festgestellten höheren Zuwachses
nach SFM-Behandlung kann für die Waldbesitzer (Familienclans) langfristig ein um ca. 15 % höheres Einkommen durch nachhaltige Waldbewirtschaftung erwartet werden.
Unter Berücksichtigung etwaiger Kompensationszahlungen für Emissionsreduktion (z.B. REDD+) ist eine Kombination von Einkommen aus SFM mit entsprechenden Einkommen aus Kompensation für die Waldbesitzer dann vorteilhafter als eine ausschließliche Kompensation nach Flächenstilllegung, wenn die Kompensationszahlungen unter Abzug aller Implementierungskosten geringer als 2,8 US$/t CO2 sind.
Unter einer makroökonomischen Perspektive generiert die Kombination von SFM und REDD+ höhere monetäre Werte als die konventionelle Holzernte oder eine ausschließliche Kohlenstoffkompensation nach Stilllegung der Flächen.
Vorträge Session 15: Wald als Restholzspeicher für die Bioökonomie 96
Lignozelluläre Biomasse aus dem Offenland
Christina Eilers1 und Rainer Luick1
1Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Schadenweilerhof, 72108 Rottenburg, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Biomassemengen, Biomasseverwendung, zusätzliche Biomassebereitstellungs-möglichkeiten
Die Nachfrage nach lignocellulärer Biomasse hat sich drastisch erhöht. Dies ist auf eine zunehmende stoffliche Verwendung zurückzuführen - in einem deutschen und europäischen Kontext vor allem aber auf eine verstärkte energetische Nutzung holzartiger Biomasse. So basieren die deutsche Energiewende und der Umstieg auf erneuerbare Energieträger besonders im Wärmebereich auf einer verstärkten energetischen Holznutzung. Ein weiterer Nachfrageschub ist zu erwarten, wenn die global anlaufenden Bioökonomie-Strategien aus dem Laborversuch in die reale Praxis überführt werden. Unter bioökonomischen Technologien werden allgemein die grund- und werkstoffliche Substitution von fossilen Rohstoffen durch Biomasse verstanden. Aufgrund der vergleichsweise homogenen Eigenschaften ist dies in erster Linie lignocelluläre Biomasse. Experten gehen (noch) davon aus, dass in Deutschland auf lange Sicht erhebliche und bislang ungenutzte Holzpotentiale für alle Nutzungsformen (konventionelle, neuartige stoffliche und energetische Nutzungen) vorhanden sind. Diese Einschätzungen werden jedoch zunehmend bezweifelt. Zu Recht stellt sich die Frage, ob eine Deckung der steigenden Nachfrage nach holzartiger Biomasse durch eine nachhaltige Nutzung deutscher Wälder überhaupt möglich ist. In diesem Sinne sollen bislang nicht genutzte Biomassereststoffe identifiziert und erschlossen werden. Im Forschungsvorhaben „Lignozelluläre Biomasse aus dem Offenland“ werden etablierte Nutzungen und vorhandene Potentiale dargestellt und analysiert. Biomasse aus dem Offenland fasst Aufkommensarten zusammen, die außerhalb der geregelten land- und forstwirtschaftlichen Nutzung durch vielfältige pflegende Maßnahme anfallen und wird oft auch als Landschaftspflegematerial bezeichnet. Ein Fokus des Projekts liegt auf den Entwicklungsmöglichkeiten zur zusätzlichen Bereitstellung von holzartiger Biomasse aus dem Offenland. Hierbei soll die Relevanz von Biomasse und Biomasse-produzierenden Gehölzbestände hinsichtlich typischer ökologischer Funktionen untersucht werden. Des Weiteren sollen die Rahmenbedingungen, wie eine Anreicherung der Landschaften mit nachhaltig Biomasse-generierenden Strukturen möglich ist, geprüft werden sowie der Nutzen weiterer Biomassestrukturen im Kontext verschiedener Naturschutz-Instrumente (z.B. Biotopvernetzung oder das EU-Konzept zu Grüner Infrastruktur u. a.) dargestellt werden.
Vorträge Session 15: Wald als Restholzspeicher für die Bioökonomie
97
Über das nachhaltig umsetzbare Potential an Lignocellulose aus Bäumen
Marcus Lingenfelder1, Joachim Maack2, Dirk Jaeger1, Barbara Koch2
1 Professur für Forstliche Verfahrenstechnik, [email protected] 2 Professur für Fernerkundung und Landschaftsinformationssysteme, [email protected]
Schlagworte: Bioökonomie, Lignocellulose, Potentialanalyse
Ein wichtiger Rohstoff für biobasierte Materialien in der Bioökonomie ist Lignocellulose aus holziger Biomasse. Die Verfügbarkeit von Holz aus dem Wald und aus der Landschaft, aus Sägerestholz und Kurzumtriebsplantagen, kann anhand einer Potentialanalyse beschrieben werden. Das theoretische Potential wird dabei stufenweise durch natürliche, technische und sozio-ökonomische Faktoren begrenzt. Diese sind allerdings nicht fest definiert, sondern von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig und unterliegen marktlichen Schwankungen. Je nachdem, was eine potentielle Bioökonomie bereit ist, für den Rohstoff aufzuwenden, können Konkurrenzsituationen zu herkömmlicher stofflicher und energetischer Nutzung von Holz entstehen und sich möglicherweise ökologisch nachteilige Konstellationen ergeben. Aus der Analyse resultierende, nachhaltig umsetzbare Potentiale müssen - bei derzeitigem Informationsstand - daher in Szenarien gerechnet, betrachtet und abgewogen werden. Dieser Vortrag stellt vorläufige Ergebnisse des Projekts „BioPotential“ aus dem Forschungsprogramm Bioökonomie Baden-Württemberg zur technischen Durchführung der Potentialanalyse vor und versucht die zu erwartenden Konfliktsituationen zu beleuchten.
Vorträge Session 15: Wald als Restholzspeicher für die Bioökonomie 98
Neue Indizes zur Beurteilung der Kontamination von Hackschnitzeln mit Bodenmaterial
Elke Dietz1, Daniel Kuptz2, Uwe Blum1, Fabian Schulmeyer1, Herbert Borchert1 und Hans Hartmann2
1Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft; Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising; [email protected], 2Technologie- und Förderzentrum (TFZ) im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Schulgasse 18, 94315 Straubing, [email protected]
Schlagworte: Bodenkontaminationsindex, Hackschnitzelverunreinigung, Hackschnitzel-qualität
Einleitung. Holzhackschnitzel können je nach Produktionsverfahren und Herkunft unterschiedlich stark mit Mineralboden verunreinigt sein. Dies kann zu einer Anreicherung an für die Verbrennung kritischen Elementen wie Chlor, Kalium, Silizium oder auch Schwermetallen führen. Ob diese kritischen Elemente aus der Biomasse, hier insbesondere dem Grünanteil oder aus dem Mineralboden stammen, wurde diskutiert, konnte aber bislang nicht eindeutig nachgewiesen werden. Um die Hackschnitzelqualität während der Produktion zu sichern und die Quelle für die hohen Gehalte an kritischen Elementen zu identifizieren, war ein Indikator notwendig. Material und Methoden. Insgesamt wurden 97 Proben, davon 80 Hackschnitzelproben, 11 ungehackte Proben und 6 Zweige incl. Nadeln, auf ihre Elementzusammensetzung hin (Al, As, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mn; N, Na, Ni, P, Pb, S, Si, Zn) gemäß den EU Qualitätsnormen untersucht. Die Proben deckten das Spektrum Waldrestholz, Energierundholz, Kurzumtriebsplantagen, Straßenbegleitgrün und Siedlungsholz ab. Basierend auf Literaturdaten und eigenen Untersuchungen wurden Biomasseindizes zur Kontamination mit Mineralboden entwickelt. Hierzu wurden die Quotienten der Elementkonzentrationen an Fe/Mn sowie das Al-Verhältnis (Al/200) in Pflanzen und Böden gebildet. Die Indizes wurden auf den oben genannten Forschungsdatensatz angewandt. Ergebnisse. Jeder Index teilt die Proben in zwei Klassen, Proben die vorwiegend aus Biomasse bestehen und jene mit einer Kontamination durch Mineralboden. Bei 74 % aller Proben gab es bezüglich der Zuordnung der Indizes eine Übereinstimmung, das heißt sie konnten entweder der Gruppe Biomasse oder mit Mineralboden kontaminiert zugeordnet werden. Nur 26 % waren diesbezüglich indifferent. Proben, die in die Klasse „Biomasse“ fielen, erreichten einen maximalen Aschegehalt von 3,1 % und lagen unter einem Si-Gehalt von 8.300mg/kg. Proben der Gruppe „Mineralbodenkontamination“ dagegen wiesen Aschegehalte bis 19,6 % und Si-Gehalte bis 59.700 mg/kg auf. Schlussfolgerung. Der Fe/Mn- und auch der Al/200-Index sind geeignet einzuschätzen, ob Hackschnitzel mit Bodenmaterial kontaminiert sind oder nicht.
Vorträge Session 15: Wald als Restholzspeicher für die Bioökonomie
99
Soil ecological challenges for forestry in the Bioeconomy
Kenton Stutz1, Janna Wambsganß1 und Friederike Lang1
1Professur für Bodenökologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, D-79085 Freiburg, [email protected]
Keywords: Soil, Lignocellulose, Beech forests, Forest management
Forests are expected to be a major source of raw biomaterial – namely lignocellulose – for the bioeconomy. More intensive removal of woody material can, however, disrupt litter and other succession cycles. Especially at risk is the retention of both deadwood and fine woody debris, crucial factors in forest biodiversity and nutrient cycling. Evidence from 64 paired Deadwood-Control points in eight Fagus sylvatica (L.) stands throughout southwestern Germany suggests deadwood influences soil quality too. Significant differences in soil pH, cation exchange capacity, nutrient availability, aeration, pore size distribution, and carbon fractions between paired samples demonstrate deadwood can ameliorate soil. Correlations between some of those properties and concentrations of both lignin and phenolic markers demonstrate that specific decay compounds and structural products from deadwood can influence soil in addition to macronutrient loads and changes to biological communities. These findings must be taken into consideration when adapting current forest management to fulfill resource demands for the Bioeconomy. Though deadwood’s influence on soil is limited spatially, it ought to be viewed as a ‘hot-spot’ in soil, which often have outsized contributions to soil functioning. As such, current thresholds for preserving biodiversity could be co-opted to protect soil quality. Likewise rotation ages could be set for deadwood based on decomposition rates. And given this ‘hot-spot’ nature of deadwood, spatial distributions should be considered. Each of the above would not only improve soil quality, but also increase overall forest resilience.
Vorträge Session 16: KUP und AFS als zusätzliche Quelle von Holzressourcen... 100
Ertragsleistung von Kurzumtriebsplantagen (KUP) im Vergleich zu Hochwäldern bei zuwachsoptimierter Bewirtschaftung
Heinz Röhle1, Hendrik Horn1 und Michael Körner1
1Institut für Waldwachstum und Forstliche Informatik, Fachrichtung Forstwissenschaften, Technische Universität Dresden, [email protected]
Schlagworte: Kurzumtrieb, Fremdländerbaumarten, Dendromasse, Ertragsleistung
Die Holznachfrage hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Nach MANTAU (2010) wird Deutschland ohne zusätzliche Maßnahmen zur Steigerung des Holzaufkommens „bereits im Jahr 2020 massive Probleme mit der Holz-Versorgung aus inländischen Quellen bekommen“. Mit KUP kann diese Lücke zumindest teilweise geschlossen werden. Von besonderem Interesse ist deshalb ein Vergleich der Produktivität von KUP mit Hochwäldern bei zuwachsoptimierter Bewirtschaftung. Um diese Frage zu beantworten, werden die Erträge ausgewählter Wirtschaftsbaumarten zum Kulminationszeitpunkt des durchschnittlichen Gesamtzuwachses (dGZmax) den Wuchsleistungen von KUP gegenübergestellt. Da das in KUP produzierte Holz vorrangig der energetischen Verwertung dient, erfolgt der Leistungsvergleich auf Basis des dGZ an oberirdischer Dendromasse in darrtrockenem Zustand (dGZB in tatro). Auf KUP in Ostdeutschland wurden auf Standorten mittlerer Güte in der 1. Rotation bei Pappel dGZB-Werte zwischen 6 und 14 tatro∙ha-1∙a-1 gemessen. Lediglich bei sehr hohen Stammzahlen (N > 15000∙ha-1) lag der Ertrag 9-jähriger KUP bei mehr als 20 tatro∙ha-1∙a-1. Weide erbrachte in der 1. Rotation Erträge zwischen 4 und 15 tatro∙ha-1∙a-1. Nach der ersten Ernte, d.h. ab der 2. Rotation, stellt sich meist eine deutliche Steigerung ein. Ursächlich dafür sind das überproportional entwickelte Wurzelsystem der Unterlage sowie die höhere Triebanzahl nach dem Rückschnitt. Die große Spannbreite der dGZB-Werte ist auf standörtliche Faktoren sowie Baumarten- und Klonwahl, Begründung, Rotationslänge und die Bestandsdichte (N∙ha-1) zurückzuführen. Auch im Hochwald variiert das Leistungsspektrum je nach Baumart und Standorteigen-schaften: Bei der Fichte beispielsweise reichen die dGZB-Werte im eher kontinental geprägten Ostdeutschland von 1,8 bis 6,8 tatro∙ha-1∙a-1, wobei das Kulminationsalter je nach Bonität zwischen 60 und 140 Jahren liegt (WENK et al. 1985). Im klimatisch begünstigten Süden Deutschlands dagegen erreicht die Fichte auf den besten Standorten dGZB-Werte von 8,1 tatro∙ha-1∙a-1 im Alter 80 (ASSMANN/FRANZ 1963). Ergebnisse von Dauerversuchsflächen zeigen, daß Fremdländerbaumarten wie Küstentanne, Douglasie oder Sitkafichte noch deutlich höhere Wuchsleistungen erbringen. Werden nun Fremdländer mit heimischen Baumarten vergesellschaftet und die am Bestandsaufbau beteiligten Baumarten zum Zeitpunkt des dGZmax geerntet, entstehen sehr leistungsfähige, ungleichaltrige und strukturierte Waldaufbauformen.
Vorträge Session 16: KUP und AFS als zusätzliche Quelle von Holzressourcen...
101
Modellierung zur Standortleistungsschätzung bewährter Sorten und Ertragspotenziale neuer Züchtungen in Kurzumtriebsplantagen –
Ergebnisse aus den Verbundprojekten ProLoc und FastWood
Christoph Stiehm1, Martin Hofmann1, Helmut Grotehusmann1, Jürgen Nagel1, Winfried Kurth2 und Alwin Janßen1
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt – Abteilung Waldgenressourcen, Prof.-Oelkers-Str. 6, 34346 Hann. Münden, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 2Georg-August-Universität Göttingen – Abteilung Ökoinformatik, Biometrie und Waldwachstum, Büsgenweg 4, 37077 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Kurzumtriebsplantage, Forstpflanzenzüchtung, Klon-Standort-Wechselwirkung, Ertragsdynamik
Das Ertragspotenzial von schnellwachsenden Baumarten im Agrarholzanbau wird durch mehrere Parameter maßgeblich beeinflusst, von großer Bedeutung sind die standörtlichen Eigenschaften. Zahlreiche Untersuchungen haben sich bereits mit der Wechselwirkung verschiedener Sorten mit bodenkundlichen und klimatischen Variablen befasst. Oft sind die Ergebnisse jedoch nur unter den jeweiligen standörtlichen Eigenschaften zu interpretieren. Um Entscheidungsträgern ein umfassendes Werkzeug für die Planung und Bewirtschaftung bereitzustellen, setzt das ProLoc Verbundvorhaben an, ein Standortleistungsmodell zu entwickeln, das durch ein umfassendes Versuchsflächennetz auf einer großen Amplitude unterschiedlicher Wuchsbedingungen basiert. Zur Modellierung werden dabei ein einzelbaumbasierter Ansatz und ein Ansatz auf Bestandesebene geprüft, die beide im Rahmen eines gemischten Modells implementiert werden. Zur Identifizierung von ertragsbeeinflussenden Parametern werden zahlreiche in Agrar- und Forstwirtschaft übliche Variablen und Kennzahlen getestet. Vielversprechende Ergebnisse liefern dabei die Gruppierung nach Bodentyp, die Bewertung nach Bodenzahl und klimatische Parameter wie z.B. die Vegetationsdauer. Neben der Identifizierung geeigneter Standorte spielt für den potentiellen Anbauer von Kurzumtriebsplantagen die Auswahl an zur Verfügung stehenden geprüften Sorten eine entscheidende Rolle für die gewinnbringende Bewirtschaftung. Aus diesem Grund liegt im FastWood Verbundvorhaben der Fokus auf der Selektion und Prüfung von Klonen aus vorhandenem Material sowie die Züchtung neuer Klone aus kontrollierten Kreuzungen. Die Auswahl dieser Kreuzungen erfolgt hinsichtlich des Ertragspotentials basierend auf Wuchs- und Resistenzeigenschaften. Für eine im Jahr 2010 angelegte Versuchsserie konnte aufbauend auf im ersten Umtrieb erhobenen Daten bereits die statistisch signifikante Überlegenheit einiger Kreuzungen gegenüber Standardsorten, welche auch in ProLoc getestet werden, nachgewiesen werden. Die Ertragsdynamik nach dem ersten Rückschnitt in einem dreijährigen Rotationsmodus liegt besonders im Fokus beider Forschungsprojekte. Für ProLoc wird das durch Stockausschlag beeinflusste Wuchsverhalten im Bezug zum Standort gesetzt, in FastWood liegt der Schwerpunkt auf dem Vergleich der Kreuzungen untereinander. Aufgrund der ähnlichen Versuchsbedingungen beider Projekte wird abschließend kurz ein möglicher Verschnitt der Ergebnisse betrachtet.
Vorträge Session 16: KUP und AFS als zusätzliche Quelle von Holzressourcen... 102
Möglichkeiten der Anlage von Kurzumtriebsplantagen auf Grünland
Frank Burger1und Johann Neuner1
1Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Kurzumtrieb, Grünland-Umbruch, Weideflächen
Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft legte auf zwei Grünland-Standorten in Oberbayern Kurzumtriebsplantagen an. Ziel des Vorhabens war, Möglichkeiten für eine weitgehend umbruchfreie Begründung von KUP auf den ehemaligen Weideflächen zu prüfen. Neben der klassischen Methode mit Pflügen, Eggen und einem maßvollen Einsatz von Herbiziden wurden der Einsatz von Mulchfolie und das streifenweise Fräsen der Grasnarbe als Begründungsvarianten mit vier Pappelklonen in drei Wiederholungen getestet. Weitere Alternativen waren das Einbringen von einjährigen Pappel-Setzruten, zweijährigen Pappel-Setzstangen und die Pflanzung der Baumarten Grau- und Schwarzerle direkt in die Grasnarbe. Die Aufnahmen und Messungen der letzten drei Jahre zeigen die klare Überlegenheit der klassischen Begründung. Sie ist den Varianten Fräsen und Mulchfolie hinsichtlich Anwuchs und Höhenentwicklung der eingebrachten Pappelstecklinge klar überlegen. Diese beiden Methoden verursachten außerdem z. T. sehr hohe Kosten, vor allem bei einem flachgründigen Standort. Eine gute Alternative stellen die Setzruten und Setzstangen dar. Als Pflanzsortiment etwas teurer, können sie doch von den Kosten her konkurrieren, da Bodenbearbeitungsmaßnahmen nicht notwendig sind. Auch die Pflanzung von Grau- und Schwarzerle ist bei Inkaufnahme von niedrigeren Biomasseleistungen, vor allem in ökologisch sensiblen Gebieten als vorteilhafte und praktikable Anbaualternative zu sehen.
Vorträge Session 16: KUP und AFS als zusätzliche Quelle von Holzressourcen...
103
Steigerung der wirtschaftlichen und ökologischen Flächenleistung durch silvopastorale Produktionssysteme
Andrea Braun1, Markus Grulke1, Suzanne Van Dijk1
1UNIQUE forestry and land use, Schnewlinstr. 10, 79098 Freiburg, [email protected]; [email protected], [email protected]
Schlagworte: Silvopastorale Produktion, Systemvergleich, wirtschaftliche und ökologische Leistungen
Der globale Holzverbrauch korreliert eng mit der demographischen Entwicklung. Die Weltbevölkerung wird bis 2050 auf ca. 10 Milliarden Menschen anwachsen. Mithin wird in den nächsten Dekaden der Holzverbrauch weiter ansteigen. Schon heute gibt es Versorgungslücken bei der Bereitstellung von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Um diese Lücken zu schließen, müssen jährlich mehrere Millionen Hektar aufgeforstet werden. Dies wiederum kann zu Konflikten mit der Welternährungssicherung führen, da geeignete Aufforstungsflächen oftmals auch landwirtschaftlich nutzbar sind. Durch kombinierte Flächennutzungen kann die Konkurrenz um fruchtbares Land entschärft werden. Südamerika weist wie kein anderer Kontinent ausgedehnte Weideflächen auf. Diese befinden sich meist auf ehemaligen Waldstandorten und werden extensiv bewirtschaftet. Können durch die Integration von Forst- und Viehwirtschaft die Leistungen dieser Flächen erhöht werden? Die Interamerikanische Entwicklungsbank (Banco Interamericano de Desarrollo – BID) hat UNIQUE forestry and land use damit beauftragt, diese Frage zu analysieren. Ziel des Forschungsprojektes ist es, die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Leistungen silvopastoraler Systeme zu beleuchten und die Best Practices einer optimalen Kombination von Forst- und Viehwirtschaft abzuleiten. Die Studie basiert in erster Linie auf empirisch erhobenen Daten und Expertengespräche. In Argentinien, Brasilien und Paraguay wurden Betriebe untersucht, die seit vielen Jahren auf großer Fläche (>500 ha) silvopastorale Systeme implementiert haben. Auf diesen Echtdaten aufbauend werden verschiedenen Szenarien modelliert. Hierbei werden neben Produktionsparametern auch Fragen zur Sicherung des Standortpotenzials, naturschutzfachliche Restriktionen, Klimaschutzleistungen sowie die sozioökonomischen Auswirkungen berücksichtigt. Das einjährige Forschungsprojekt wird im Mai 2016 abgeschlossen sein. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass silvopastorale Systeme hinsichtlich wirtschaftlicher Ertragskraft, ökologischer Leistung (hier v.a. Kohlenstoffbindung) und Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum der reinen Viehwirtschaft deutlich überlegen sind. Die hohe Anfangsinvestition, späte Erlöse aus der Forstwirtschaft sowie ein innovationszögerlicher Viehwirtschaftssektor sind allerdings Hürden für eine Systemimplementierung. Durch wissens- und erfahrungsbasierte Kennwerte und Praxisempfehlungen kann die Studie dazu verhelfen, diese Hürden abzubauen.
Vorträge Session 16: KUP und AFS als zusätzliche Quelle von Holzressourcen... 104
Umweltwirkungen der Erzeugung und Bereitstellung von Energieholz aus Pappel-Kurzumtriebsplantagen unter Einbeziehung von pflanzen-
und bodenbiologischen sowie technischen Prozessen, dargestellt am Beispiel eines landwirtschaftlichen Marginalstandorts in
Südwestdeutschland Janine Schweier1, Saúl Molina-Herrera2, Ruediger Grote2, Eugenio Díaz-Pinés2, Edwin
Haas2, Jürgen Kreuzwieser3, Klaus Butterbach-Bahl2, Heinz Rennenberg3, Jörg-Peter Schnitzler4 und Gero Becker1
1 Universität Freiburg, Professur für Forstliche Verfahrenstechnik, Werthmannstraße 6, 79085 Freiburg, [email protected], [email protected] 2 Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Meteorology and Climate Research, Kreuzeckbahnstraße 19, 82467 Garmisch-Partenkirchen, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 3 Universität Freiburg, Professur für Baumphysiologie, Georges-Köhler-Allee 53/54, 79110 Freiburg, [email protected], [email protected]
4 Helmholtz Zentrum München, Research Unit Environmental Simulation, Ingolstädter Landstraße 1, 85764 Neuherberg, [email protected]
Schlagworte: KUP, LCA, Energieholz, Treibhausgasbilanz, Stickstoffdüngung, Emissionen, Energieeffizienz, Pappel Die Inwertsetzung von landwirtschaftlichen Marginalstandorten durch die Anlage von Kurzumtriebsplantagen und die Biomassenutzung vornehmlich zur Energierzeugung gilt als nachhaltige und ökologische, wie auch wirtschaftlich und energiepolitisch günstige Form der Landnutzung. Die Quantifizierung der Kohlenstoffbindung im Anbausystem, die vergleichende Bewertung von potentiellen Umweltwirkungen, insbesondere des Treibhauspotentials, sowie die Ermittlung der Energieeffizienz kann mithilfe von auf LCA (Life Cycle Analysis) basierten Studien erfolgen. Bisher vorliegende Arbeiten fokussierten sich überwiegend entweder auf die Bewertung der Umweltwirkungen der technischen Prozesse der Energieholzerzeugung und –bereitstellung oder der Umweltwirkungen boden- und pflanzenbiologischer Prozesse. In der hier durchgeführten LCA wurden erstmals beide Aspekte berücksichtigt. Für eine Pappel-Kurzumtriebsplantage wurde eine Gesamt-Standzeit von insgesamt 21 Jahren mit alternativ (7x) drei- bzw. (3x) siebenjährigen Rotationen, jeweils mit verschiedenen Düngungsszenarien, angenommen. Mittels einer LCA nach DIN EN ISO 1404 wurden zunächst die Umweltwirkungen der in diesem Zeitraum anfallenden technischen Prozesse, von der Stecklingsanzucht, der Erstanlage der Plantage, über die mehrmalige Pflege und Ernte bis zur Flächenrodung zum Ende der Standzeit sowie die Erzeugung und Lieferung von Hackschnitzeln zu einem Heizwerk modelliert. Weiterhin wurden zentrale boden- und pflanzenbiologische Prozesse (Photosyntheseleistung, Ökosystematmung, N2O- und CH4-Flüsse, Nitratauswaschung, C- und N-Haushalt im Boden, etc.) und ihre Umweltwirkungen berücksichtigt. Für diese Modellierung wurden Messwerte herangezogen, die bei der Anlage und realen Bewirtschaftung einer 4,5 ha großen Kurzumtriebsplantage in Südwestdeutschland über 5 Jahre hinweg gewonnen wurden. Die Freilanddaten wurden ergänzt durch begleitende Labormessungen sowie durch Daten aus einschlägigen Umweltdatenbanken (etwa Ecoinvent). Die zusammenfassende Betrachtung zeigt das Ausmaß der jeweiligen Umweltwirkungen sowie die Relevanz der betrachteten Prozesse und ermöglicht damit Hinweise zur Gestaltung von Anbau, Bewirtschaftung und Nutzung von KUP in Hinblick auf Energieeffizienz und minimale (negative) Umweltwirkungen.
Vorträge Session 17: Holzbasierte Produkte und Werkstoffe
105
Möglichkeiten des verstärkten Einsatzes alternativer naturbelassener Holzarten sowie umweltverträglich modifizierter Hölzer
Peter Rademacher1,2,5, Radim Rousek2, Stanislav Hornicek2, Fanni Pozsgayné Fodor1, Gerald Koch3, Dietrich Meier3, Yongshun Feng3, Petr Pařil2, Jan Baar2, Zuzana
Paschová2, Róbert Németh1, Andreja Kutnar4, Dieter Murach5
1University of West Hungary, Faculty of Wood Sciences, Institute of Wood Sciences, Bajcsy-Zs. u. 4, H-9400 Sopron, Hungary, [email protected] 2Mendel University in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Dep. of Wood Science, Zemědělská 1, CZ-613 00 Brno, Czech Republic, [email protected] 3Thünen Institute of Wood Research, Leuschnerstr. 21, D-21031 Hamburg, Germany, [email protected] 4University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technology, Andrej Marušič Institute, Muzejski trg 2, Glagoljaška 8, SI-6000-Koper, Slovenia, [email protected] 5Eberswalde University for Sustainable Development, Faculty of Forest and Environment, Section Agro-Wood, Alfred-Möller-Strasse 1, D-16225 Eberswalde, Germany, [email protected]
Schlagworte: Holzverknappung, zusätzlich genutzte Holzsortimente, natürliche Holzeigenschaften, Eigenschaftsverbesserung durch umweltschonende Holzmodifizierung
Der Einsatz von Holz als nachwachsender Rohstoff hat in den letzten Jahren angesichts der Problematik erhöhter CO2-Freisetzung (Waldrodung, Verbrennung fossiler Energieträger, Klimaerwärmung) in starkem Maße zugenommen. Allerdings hat die erhöhte Nachfrage in einzelnen Bereichen zu einer zunehmenden Holzverknappung geführt. Angesichts dieser Entwicklung ist der effiziente und höchstwertige Einsatz der verfügbaren nachwachsenden Rohstoffe zu einer vordringlichen Aufgabe geworden. Unter diesem Aspekt ist beispielsweise die Verbrennung höherwertiger Sortimente oder der Einsatz unverhältnismäßig hoch- oder minderwertiger Holzsortimente für bestimmete Verwendungsgebiete nicht zu tolerieren. Vielmehr sollte nach einer zielorientierten Nutzung auch alternativer Sortimente gesucht werden, die die umweltverträgliche Verbesserung bestimmter Eigenschaften auch solcher Sortimente durch Holzmodifizierungsmaßnahmen einschließt, die im unbehandelten Zustand für die entsprechende Verwendung ungeeignet wären. Beispiele für solche erweiterten Nutzungen und die zugrundeliegenden Eigenschaften sind: - zusätzliche Nutzung von bislang nicht oder nur unzureichend genutzten Holzarten:
dekorativer Einsatzbereich: dunkles Holz z.B. der Vogelbeere; Edelkastanie aus Niederwäldern
konstruktiver Einsatzbereich: stoffliche Nutzung stärkerer Schnellwuchs-Plantagenhölzer von Pappael oder Weide für Leichtbauanwendungen, dichtes Hainbuchenstammholz oder stärkeres Kronen- und Astholz hoher Dichte von Hainbuche oder Robinie für hohe mechanische Belastungen
-zusätzliche Nutzung von natürlich nicht ausreichend festen, dimensionsstabilen oder dauerhaften Holzarten nach umweltschonender Holzmodifizierung:
Einsatz für höhere mechanische Beanspruchungen: Viskoelastisch-Hydrothermal verdichtetes Plantagenpappelholz (Ausnutzung höherer Festigkeiten mit zusätzlich verbesserter Dimensionsstabilität)
Einsatz für dauerhaftere, dimensionsstabilere Verwendungen: Holzmodifizierungs-beispiele aus der Thermobehandlung, Ammoniak-Begasung, Nanopartikel, Natur-stoffimprägnierung (Extraktstoffe, HTC).
Vorträge Session 17: Holzbasierte Produkte und Werkstoffe 106
Turning Forest Waste into High-Value Materials: Nanocellulose
Hatem Abushammala 1,2 und Marie-Pierre Laborie 1,2
1Chair of Forest Biomaterials, Institute of Earth and Environmental Sciences, Werthmannstr, 6, 79085 Freiburg, [email protected], [email protected] 2Freiburg Materials Research Center (FMF), Stefan-Maier-Str, 21, 79104 Freiburg
Schlagworte: Wood, Harvesting Residues, Nanocellulose, Ionic Liquids
The amounts of wood residues generated at harvesting and sawing sites are massive. For instance, ca. 28 Million tons of residues were generated in Brazil in 2011 [1]. There have been increasing efforts to better utilize these residues in the form of pellets for bioenergy or to process into functional biomaterials such as nanocellulose, high-value cellulose nanoparticles. Nanocellulose has very interesting properties with a stiffness similar to that for steel (~ 200 GPa). It is light, biodegradable, and lends itself to functionalization and self-assembles into high-tech nanostructures. These properties made nanocellulose very interesting for many areas such as automotive, pharmaceutical, medical, and electronic industries. Nanocellulose is traditionally produced using strong acid-catalyzed hydrolysis of cellulosic sources. Such severe route generally requires pure forms of cellulose as a starting material, such as pulp and microcrystalline cellulose, while no reports exist about the extraction of nanocellulose directly from lignocelluloses such as wood. Therefore, mild and direct production routes from wood are needed. In this presentation, I will present a novel method to extract nanocellulose in high yield and quality directly from low-value harvesting residues from the Amazonian forests and using one single chemical [2]. References: [1] Coelho, Suani Teixeira, and Patricia Guardabassi. "Brazil: ethanol."Sustainable development of biofuels in Latin America and the Caribbean. Springer New York, 2014. 71-101. [2] Abushammala, Hatem, Ingo Krossing, and Marie-Pierre Laborie. "Ionic liquid-mediated technology to produce cellulose nanocrystals directly from wood."Carbohydrate polymers 134 (2015): 609-616. Acknowledgments: This research is funded by German Academic Exchange Service (DAAD), German Society of International Collaboration (GIZ) and Brazilian Department of higher Education (CAPES program) through the Novas Parcerias program for Brazilian-German academic exchanges.
Vorträge Session 17: Holzbasierte Produkte und Werkstoffe
107
Funktionale Materialien aus nachhaltigen Holzkomponenten
Kai Zhang1
1Juniorprofessur Holztechnologie und Holzchemie, Georg-August-Universität Göttingen, Büsgenweg 4, 37077 Göttingen, Email: [email protected]
Schlagworte: Holz, Cellulosederivate, Nanocellulose, Funktionale Materialien
Biopolymere aus Holz, z.B. Lignocellulose, gehören zu den am häufigsten vorkommenden nachhaltigen Rohmaterialien auf der Erde. Zurzeit finden sie breite Anwendungen in Commodity-Produkten, z.B. Holzwerkstoffen, Papier und Textilienprodukten. Dennoch ist ein größeres Potential in vielen anderen Bereichen zu erwarten, insbesondere in High-Technology-Bereichen inklusiv gesundheits- und energierelevanter Bereichen. Die Realisierung benötigt jedoch weitere intensive Forschungen. In diesem Vortrag werden die neuen funktionellen Materialien vorgestellt, die auf Lignocellulose aus nachhaltigen Quellen wie Holz basieren. Sowohl polymerische Cellulosederivate als auch die kristalline Nanocellulose werden als Ausgangsmaterialien für die Funktionalisierung verwendet und danach für die Materialienbildung eingesetzt. Unter diesen neuen funktionellen Materialien sind beispielsweise Oberflächen mit besonderen Benetzungsverhalten, superhydrophobe Oberflächen, Stimuli-sensible Nanopartikel und selbststehende transparente Dünnfilme.
Vorträge Session 17: Holzbasierte Produkte und Werkstoffe 108
Kaskadennutzung von Buchenrinde
Heiko Winter1, Anna Fichtner1, Bernd Kammerer2, Joachim Hug3 und Marie-Pierre Laborie1
1Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Professur für Forstliche Biomaterialien, Werthmannstr. 6, 79085 Freiburg, [email protected] 2Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Zentrum für Biosystemanalyse (ZBSA), Kernkompetenz Metabolomics, Habsburgerstr. 49, 79104 Freiburg, [email protected] 3EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart, [email protected]
Schlagworte: Buchenrinde, Suberin, Heizwert, Kaskadennutzung
Das Projekt GANUBU (Ganzheitliche Nutzung von Buche) untersuchte die potentielle Kaskadennutzung der Buche. Ein Teilziel des Projektes war, Suberin und phenolische Substanzen aus der Buchenrinde zu gewinnen und zu charakterisieren. Depolymerisiertes Suberin konnte reproduzierbar mit einer mittleren Ausbeute von 3,9 % aus der Buchenrinde gewonnen werden. Die Analysen bestätigten, dass depolymerisiertes Suberin aus Buchenrinde Potential für eine Verwendung in Polymersynthesen hat, da viele der aliphatischen Ketten mehrere funktionelle Gruppen wie z. B. OH-Gruppen aufweisen. Phenolische Substanzen wurden nur in geringen Mengen aus der Buchenrinde extrahiert, so dass die Nutzung der phenolischen Inhaltsstoffe der Buchenrinde nicht weiterverfolgt wurde. Ein anderes Teilziel von GANUBU war die Untersuchung der brennstofftechnischen Eigenschaften des Buchenrindenrückstandes, welcher nach der Gewinnung der Rindensubstanzen übrigbleibt. Bei den meisten Parametern wurden Werte in gleicher Größenordnung wie bei Buchenrinde festgestellt. Auffällig waren allerdings hohe Asche- und Natriumgehalte, die wahrscheinlich aus der Gewinnung der Rindensubstanzen stammen und deren Entfernung erforderlich ist, um einen geeigneten Brennstoff für die Gewinnung von Bioenergie zu erhalten. GANUBU hat die Machbarkeit aufgezeigt, Substanzen für die stoffliche Nutzung aus der Buchenrinde zu gewinnen und im Sinne einer Kaskadennutzung die nicht löslichen Rindensubstanzen energetisch zu verwerten. Allerdings müssen zukünftige Arbeiten noch weitere Entwicklungsarbeit leisten, um die ganzheitliche, hochwertige Nutzung von Buche voranzutreiben. Danksagung Das Projekt wurde durch die Europäische Union - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - sowie das Land Baden-Württemberg (Clusterinitiative Forst und Holz Baden-Württemberg) gefördert.
Vorträge Session 17: Holzbasierte Produkte und Werkstoffe
109
Synthese von neuen Bio-basierten Polymeren aus Rinde: Erfahrungen, Strategie und Vision der Professur für Forstliche Biomaterialien
Marie-Pierre Laborie1,2
1Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Professur für Forstliche Biomaterialien, Werthmannstr. 6, 79085 Freiburg, [email protected] 2Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburger Materialforschungszentrum (FMF), Stefan Meier Str. 21, 79104 Freiburg
Schlagworte: Rinde, Klebstoffe, Schäume, Polyphenole, Polyurethane
Die Nutzung von Rinde für die Synthese von bio-basierten Polymeren ist nicht neu1. Allerdings hat sich seit kurzem die Forschung im Bereich der Rindennutzung intensiviert und zeigt insbesondere im Bereich Klebstoffe und Schäume aus Tanninen Fortschritte. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern wurden an der Professur für Forstliche Biomaterialen verschiedene Projekte konzipiert und koordiniert, in welchen neue Strategien zur Rindennutzung und zur Synthese von bio-basierten Polymeren und Copolymeren erfolgreich demonstriert wurden2. Diese Erfolge dienen der weiteren Erforschung und Entwicklung von Biopolymeren und insbesondere von bio-basierten Copolymeren. Dabei werden mehrere Bausteine, die aus Rinden extrahiert werden können, auf verschiedene Art und eise kombiniert, um ein „einstellbares“ bio-basiertes Copolymer zu erhalten. Diese Präsentation wird die von der Professur gewählten Synthesestrategien vorstellen, welche eine hohe Bandbreite von Eigenschaften und „Einstellbarkeit“ ermöglichen. 1 A. Pizzi (1982), Condensed Tannins in Adhesives, Industrial & Engineering Chemistry Product Research and Development 21(3), 359-369 2 https://www.biofoambark.uni-freiburg.de ; https://www.ganubu.uni-freiburg.de
Vorträge Session 18: Nachhaltiges Bauen mit Laubholz 110
Ursachen für die geringe Verwendung von (sekundären) Laubbaumarten in der stofflichen Nutzung generell und speziell im
Bausektor
Willy Hesselbach1 und Holger Militz1
1Georg-August-Universität, Büsgenweg 5, 37073 Göttingen, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Laubholz, stoffliche Nutzung, Interview, Bau
Gemäß 3. Bundeswaldinventur sind 44% der deutschen Waldfläche mit Laubholz bestockt; aufgrund des Waldumbaus mit steigender Tendenz. Trotzdem beträgt der Laubholzanteil nur ¼ des Gesamteinschlags. Weiter werden knapp 50% des geschlagenen Laubholzes thermisch genutzt, u.a. aufgrund der Nadelholzausrichtung der meisten Sägewerke. Bei sinkendem Nadelholz- und gleichzeitig steigendem Laubholzanteil führt dies zu einer Verknappung des Rohstoffs (Nadel-) Holz. Eine Möglichkeit dem entgegenzuwirken sind höherwertigere Laubholzanwendungen. Zuerst sind dafür Ursachen der geringen stofflichen Laubholznutzung zu identifizieren. Hierzu wurde ein methodenpluralistischer Ansatz gewählt. Mit an der Prozesskette Forst/Logistik/Verarbeitung Beteiligten wurden Experteninterviews durchgeführt, die gesammelten Daten zusammengefasst, verdichtet und durch eine anschließende Literaturrecherche ergänzt. Es konnten 9 Kategorien etwaiger Ursachen identifiziert werden:
1) Verfügbarkeit: Sekundärlaubhölzer sind meist nur einzeln bzw. in kleinen Beständen vorhanden, sodass eine durchgängige Belieferung der Verarbeiter nicht gegeben ist.
2) Holzqualität: Laubholz besitzt mit durchschnittlich ¼ einen vergleichsweise geringen Stammholzanteil. Dieser hat vorrangig C-Qualität.
3) Kosten: Hohe Investitionskosten für die Verarbeitung von Laubholz hoher Rohdichte, Lagerkosten bei Nasslagerung und ein reduzierter Durchsatz sind trotz höherer Margen Ursachen der Nadelholzbevorzugung.
4) Morphologie: Krümmung, Starkäste und ausladende Kronen erschweren das Handling über die gesamte Prozesskette und reduzieren die Ausbeute in der Verarbeitung.
5) Dimension: Laubholz geringer und sehr großer Durchmesser ist aufgrund technologischer Gegebenheiten der Verarbeiter schwer absetzbar.
6) Holzeigenschaften: Geringe natürliche Dauerhaftigkeit vieler einheimischer Laubhölzer reduziert die Einsatzmöglichkeiten. Rohdichtebedingt steigen bei der Verarbeitung außerdem die laufenden Kosten durch höhere Materialbeanspruchung sowie Energieverbrauch.
7) Holzmerkmale: Wertmindernde Merkmale wie Farbkernbildung, Innenspannungen und Verfärbungen sind bei Laubholz ausgeprägter als bei Nadelholz.
8) Holzpreis: Laubholzsortimente werden vorrangig im Sichtbereich eingesetzt und sind markt-, mode- und saisonabhängiger als Nadelholzsortimente.
9) Verarbeitungstechnologie: Laubholzverarbeitung ist gekennzeichnet durch geringeren Durchsatz bei Einschnitt und Trocknung sowie morphologie- und holzmerkmalsbedingte Ausbeuterisiken.
Vorträge Session 18: Nachhaltiges Bauen mit Laubholz
111
Der Einsatz des Götterbaums im Baubereich
Ulrich Müller1, Gerhard Schickhofer2, Reinhard Brandner2
1Institut für Holztechnologie und Nachwachsende Rohstoffe, Universität für Bodenkultur, Wien, Konrad Lorenz Strasse 24, A-3430 Tulln/Donau, [email protected] 2Institut für Holzbau und Holztechnologie, Technische Universität Graz, Inffeldgasse 24/I, A-8010 Graz, [email protected]
Schlagworte: Götterbaum, Neophyt, Holzbau
Im Rahmen von zwei Projekten (TU-Graz, BOKU-Wien) wurden die technologischen Potentiale der Baumart Götterbaum untersucht. Aufgrund der hohen Zuwachsraten dieser Baumart (auch in einheimischen Wäldern) wurden neben den Massivholzeigenschaften auch die Eignung des Materials für die Herstellung von Zellstoff und Holzwerkstoffen untersucht. Die Massivholzeigenschaften sind mit jenen der heimischen Esche vergleichbar. Auch die optischen Eigenschaften sind der Esche sehr ähnlich, wodurch der Götterbaum ggf. als Ersatz für die Esche eingesetzt werden könnte. Die Trocknungsversuche zeigten, dass die Baumart Götterbaum aufgrund der Schnellwüchsigkeit hohe Eigenspannungen aufweist, wodurch sich Probleme bei der Trocknung ergeben. Für die Optimierung der technischen Holztrocknung besteht über diese Projekte hinaus noch Forschungsbedarf. Die vergleichenden Untersuchungen von Götterbaum und Esche zeigen, dass bei entsprechender Holzqualität ein hohes technisches und wirtschaftliches Potential für den Einsatz für tragende Holzkonstruktionen vorhanden ist. Bei sachgemässer forstlicher Behandlung könnte Götterbaum auch für langlebige Holzkonstruktionen im Innenbereich eine wertvolle Ressource darstellen und nachhaltige Baukonstruktionen aus Laubholz ermöglichen.
Vorträge Session 18: Nachhaltiges Bauen mit Laubholz 112
Entwicklung eines Bausystems für Parkhäuser in Buchenfurnierschichtholz
Anne Niemann1, Peter Glaser2, Wiebke Wehrmann3 und Norman Werther4
1Professur für Entwerfen und Holzbau, Arcisstr. 21, 80333 München, [email protected] 2,4Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion, Arcisstr. 21, 80333 München, [email protected], [email protected] 3Lehrstuhl für Holzwissenschaft, Winzererstr. 45, 80797 München, [email protected]
Schlagworte: Buchen-Furnierschichtholz, vorgefertigtes modulares Bausystem, Parkhaus, Stoffpass Gebäude
Die Festigkeitswerte der Buche übertreffen die von Nadelhölzern deutlich und durch die Aufbereitung zu hochwertigem Furnierschichtholz kann Buchenholz auch in anspruchsvollen Dimensionen verwendet werden. Während Buchenfurnierschichtholz (Buchen-FSH) bereits häufig im Hallen- und Gewerbebau zum Einsatz kommt, wurden Konstruktionssysteme für Parkgaragen untersucht. Durch den Einsatz von Holz im Parkhausbau ergeben sich ökologisch, wirtschaftlich und ästhetisch neue Möglichkeiten: Zum einen kommt ein umweltfreundliches Material zum Einsatz, das aktiver Kohlenstoffspeicher eine sehr gute Bilanz aufweisen kann. Zum anderen kann das Buchen-FSH aufgrund der Festigkeitswerte in deutlich geringeren Dimensionen eingesetzt werden und ist somit im Vergleich zu Nadelholz oder Stahlbeton kostenneutral. Und durch die hochwertige Oberfläche ist Buchen-FSH bestens zum Einsatz im Sichtbereich und zur ästhetischen Aufwertung einer Parkgarage geeignet. In dem entwickelten System besteht die Grundkonstruktion des Parkhauses aus Stützen und Trägern aus Brettschichtholz aus Buchen-FSH und einer Decke aus Stahlbeton-Fertigteilen. Aufgrund der hohen Tragfähigkeit des Holzwerkstoffes können Stellplätze und Fahrbahn stützenfrei überspannt werden, so dass die Stellplätze unabhängig von der Konstruktion ausgewiesen werden können. Die Erschließung für den PKW-Verkehr erfolgt über Rampen aus Buchen-FSH Trägern und Fertigteilen aus Beton. Auf der höchsten Parkebene wird ein Dach als konstruktiver Schutz vor Bewitterung angebracht. Insgesamt wird – bei fachgerechtem und witterungsgeschütztem Einbau – eine Nutzungsdauer von über 50 Jahren für die Buchen-FSH-Tragelemente angenommen. Aufgrund der modularen Bauweise können die Parkebenen in beliebiger Länge aneinandergereiht werden, die maximale Höhe des Gebäudes ist bis zur Hochhausgrenze denkbar. Die Ressourceneffizienz der Baukonstruktion steigt mit dem hohen Vorfertigungsgrad. Durch eine Produktion im Fertigungswerk kann nicht nur eine höhere Qualität der Tragelemente gewährleistet, sondern auch der Materialabfall reduziert und die Bauzeit verkürzt werden. Die Betondecke, die die einzelnen Parkebenen trennt, dient während der Montagephase als Feuchtigkeitsschutz und später als vertikale Brandbarriere. Am Ende der technischen Lebensdauer der Parkgarage können die einzelnen Werkstoffe (Holz, Beton, Stahl) problemlos demontiert und als Recyclingmaterial weiterverwerte oder einer thermischen Verwendung zugeführt werden.
Vorträge Session 18: Nachhaltiges Bauen mit Laubholz
113
BauBuche mal drei: Der Neubau der Euregon AG, Augsburg
Frank Lattke 1
1lattkearchitekten, Beim Schnarrbrunnen 4, 86150 Augsburg, [email protected]
Schlagworte: Laubholz, BauBuche, Oberflächenbehandlung, Erfahrungsbericht
Architektur und Raumkonzept Ein Bürogebäude für Softwareentwickler in Holzskelettbauweise aus BauBuche mit einem Wohlfühlklima für angenehmes Arbeiten. Mitten im Grün des Parks bietet die Bürolandschaft über drei Geschoße eine lebenswerte Atmosphäre. Transparente und opake Wandflächen wechseln sich ab und ermöglichen Durchblicke. Die Gebäudestruktur als Skelettbau ermöglicht eine weitgehend freie und flexible Raumaufteilung. Die Skelettstruktur der Hauptkonstruktion bildet im Süden und Norden je eine 5,10 m tiefe Raumzone und einen 2, 4 m breiten Mittelflur. Hier liegt in der abgehängten Decke der Hauptversorgungsstrang der Gebäudetechnik für Lüftung, Heizung und Kühlung. Helle Holzoberflächen der Skelettkonstruktion mit sichtbaren Stützen und Balkendecken in Baubuche bestimmen den Raumeindruck. Die Trennwände und Wandfüllungen in Glas und weißen geschlossenen Flächen folgen dem konstruktiven Raster, treten optisch zurück und erlauben Blickverbindungen der Räume untereinander. Der 2 Meter breite Balkon auf der Südseite ist Raumerweiterung und bietet eine geschützte Austrittsmöglichkeit. Der Schattenwurf des Überstandes macht sich deutlich bemerkbar, da eine direkte solare Einstrahlung im Sommer vermieden wird und auf technischen Sonnenschutz verzichtet werden kann. Konstruktion und Material Die tragende Struktur des Gebäudes ist ein Skelettbau in Baubuche, einem Furnierschichtholz errichtet. Hauptträger mit einem Querschnitt von 20/40 cm spannen über die Stützen 20/20 cm im Raster von 5,10 m. Über der sichtbaren Balkendecke mit Baubucheträgern 12/32 cm im Raster von 85 cm liegt eine Baubuche-Platte mit 40 mm Stärke. Der Fußbodenaufbau bringt mit einer Latexgebundenen 12 cm hohen Splittschüttung Gewicht auf die Decke, um das Schwingungs- und Schallschutzverhalten der Konstruktion positiv zu beeinflussen. Nord- und Südseite des Gebäudes sind geöffnet. Eine Pfosten-Riegelfassade mit Dreifachverglasung, ebenfalls aus BauBuche steht vor der Stützenebene. Erfahrungen Der Vortrag dokumentiert neben der Architektur des Gebäudes die Erfahrungen des Bauprozesses mit BauBuche und geht insbesondere ein auf: - Schutz gegen Feuchtigkeit während der Bauphase - technische Herausforderungen der Montage eines Hartholzes - Anwendung von BauBuche für Konstruktion, Fassade und Bodenbelag - Oberflächenbehandlung von Wasserflecken Weitere Projektinformation: http://www.lattkearchitekten.de/projekt-details/euregon-ag.html
Vorträge Session 19: Holz in der Bioökonomie – Old School oder Trendsetter? 114
Quantifizierung der holzbasierten Bioökonomie: ein Methodenvergleich
Georg Becher1, Dominik Jochem1 und Holger Weimar1
1Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie, Leuschnerstraße 91, 21031 Hamburg, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Bioökonomie, Clusterstatistik Forst und Holz, Methodenvergleich
Im Sinne der Definition des Bioökonomierates von 2009 ist die Produktion und Nutzung von Holz ein wichtiger Bestandteil der Bioökonomie. Sie umfasst neben der primären Holzproduktion alle den Rohstoff Holz nutzenden Industrien und Wirtschaftszweige sowie diverse Dienstleistungen und den Holzhandel. Ein wichtiger Aspekt in diesem Kontext ist, Bioökonomie hinsichtlich unterschiedlicher wirtschaftlicher Kennzahlen wie beispielsweise Wertschöpfung oder Beschäftigung beobachten und quantifizieren zu können. Überlegungen des Bioökonomierates der Bundesregierung, ein kontinuierliches Monitoring aufzubauen, verdeutlichen dies. In diesem Zusammenhang stellt sich jedoch die Frage, welche Möglichkeiten der kontinuierlichen Quantifizierung von Bioökonomie es gibt. Der eingereichte Beitrag widmet sich dieser Fragestellung. Es werden verschiedene Methoden zur quantitativen Erfassung der holzbasierten Bioökonomie vorgestellt, analysiert und diskutiert sowie die Ergebnisse miteinander verglichen. Referenz dabei ist eine Methode, die am Thünen-Institut zur Analyse des bundesweiten Clusters Forst und Holz bereits seit vielen Jahren etabliert ist (Becher 2015). Darüber hinaus wurden wirtschaftliche Kenndaten der Bioökonomie auch mit anderen methodischen Ansätzen quantifiziert (z. B. BMBF 2014, Efken et al. 2015). Diese Verfahren nutzen unterschiedliche Statistiken des Statistischen Bundesamtes, ziehen aber auch andere Datenquellen heran, je nach methodischem Ansatz. Wo die Datenbasis es zulässt, erfolgt der Methodenvergleich in diesem Beitrag getrennt für verschiedene Jahre, um zu prüfen, ob die zum Vergleich herangezogenen Methoden zeitunabhängig zu systematisch abweichenden Ergebnissen führen können. Abschließend werden die Vor- und Nachteile der verwendeten Methoden bezüglich der Fortschreibungsfähigkeit, Belastbarkeit und Verfügbarkeit der Daten, Praktikabilität und der Aussagekraft diskutiert.
Vorträge Session 19: Holz in der Bioökonomie – Old School oder Trendsetter?
115
Die Treibhausgasvermeidung durch Wärme aus Holz
Christian Wolf1, Daniel Klein2, Gabriele Weber-Blaschke1, Klaus Richter1
1 Holzforschung München / Technische Universität München / Wissenschaftszentrum Weihenstephan. Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, 85354 Freising, Germany. [email protected] 2 Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, 85354 Freising, Germany. [email protected]
Schlagworte: Ökobilanz (LCA), Klimawandel, Treibhausgase, Vermeidung
Die Erfassung der Treibhausgas-Emissionen, die bei Herstellung, Transport, Nutzung und Entsorgung entstehen, ist wichtig, um Umweltwirkungen von Produkten zu bewerten. Durch nachwachsende Rohstoffe wie Holz können fossile Energieträger ersetzt werden. Dies wirkt sich meist positiv auf den Klimawandel aus. Um zu bestimmen, welche Menge an Treibhausgasen durch die Nutzung von Holz vermieden wird, müssen sowohl das Holzprodukt als auch dessen Referenzprodukte entlang ihres gesamten Lebensweges auf Material- und Energieverbrauch untersucht werden. Die allgemeine Methodik der Ökobilanzierung wird in zwei Normen (DIN EN ISO 14040/14044) geregelt. Diese lassen dem Anwender jedoch viel Spielraum, was zu vielen intransparenten und nicht vergleichbaren Ergebnissen führen kann. Im bayerischen Projekt ExpRessBio haben Experten aus allen Bereichen des Biomasseanbaus und der Biomassenutzung Handlungsempfehlungen erarbeitet und umgesetzt, um die Vorgaben aus den Ökobilanznormen zu präzisieren. Diese bilden die Basis für die Berechnung der THG-Emissionen von Wärme aus Holz, wobei für Bayern repräsentative Energiesysteme modelliert worden sind. Dabei wurden verschiedene Prozessgruppen berücksichtigt: Erzeugung und Bereitstellung von Rohholz [A]; Transformation zum Energieholzprodukt [B]; Konversion zu Wärme [C] sowie der Transport von Rohholz und Energieträger [T1] und [T2]. Die Treibhausgasvermeidung stellt die Differenz des verdrängten Energieträgers (Referenzsystem) im Vergleich zum Holzenergiesystem dar. Dafür müssen die THG-Emissionen des Referenzsystems bekannt sein. Im Mittel ergeben sich für den bayerischen Holzwärmemix (je MJ Heizwärme) THG-Vermeidungseffekte von 95,2 g CO2-Äquivalente bei der Substitution von Heizöl sowie von 71,5 g CO2-Äquiv. bei der Substitution von Erdgas und über 161 g CO2-Äquiv. bei der Substitution von Stromheizungen. Je technisch aufwendiger die Bereitstellung und Konversion von Holzenergieträgern ist, desto geringer ist der potentielle THG-Vermeidungseffekt. Dies zeigt sich beispielsweise bei der Betrachtung der relativ einfachen Scheitholzsysteme im Vergleich zur technisierten Pelletnutzung. Von größter Bedeutung für die Höhe der THG-Vermeidungseffekte ist jedoch die Wahl des ersetzten Referenzsystems. So können durch moderne Scheitholzkessel bei der Substitution von Heizöl annähernd 100 g CO2-Äquiv. je MJ und bei der Substitution von Wärme aus Strom (Heizlüfter oder Nachtspeicheröfen) 165 g CO2-Äquiv. je MJ eingespart werden.
Vorträge Session 19: Holz in der Bioökonomie – Old School oder Trendsetter? 116
Ist die Nutzung von Holz in Deutschland im Hinblick auf seine Klimawirksamkeit nachhaltig?
Jörg Schweinle1, Margret Köthke1, Matthias Dieter1 und Hermann Englert1
1Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie, [email protected]
Schlagworte: Nachhaltigkeit, Klimawirksamkeit, Holznutzung
Ist die nachhaltige Nutzung von Holz grundsätzlich möglich? Diese Frage erscheint angesichts anerkannter Zertifizierungssysteme für nachhaltige Waldwirtschaft, von ISO-Normen und gesetzlichen Regelungen (z. B. Renewable Energy Directive) beantwortet. Dennoch wird derzeit angesichts zunehmender Holzimporte in die EU für die energetische Nutzung diese grundsätzliche Frage vor allem im Hinblick auf die Klimawirksamkeit der Holznutzung überaus kontrovers diskutiert. Untersuchungen der letzten Jahre hierzu kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Weitgehende Einigkeit besteht darin, dass die gesamte Holzverwendung und nicht einzelne Wertschöpfungsketten betrachtet werden sollten, um die Frage nach der Klimawirksamkeit der Holznutzung zu beantworten. Die gesellschaftliche Akzeptanz einer zukünftigen Bioökonomie wir nicht zuletzt auch von der Antwort auf diese Frage abhängen. Ziel dieser Untersuchung ist es, die zukünftigen Netto-Kohlenstoffemissionen der Holznutzung in Deutschland abzuschätzen. Dies geschieht durch Kombination eines auf Daten der Bundeswaldinventur basierenden Waldwachstumsmodells (Strugholtz-Englert-Modell) mit Abschätzungen zur zukünftigen Entwicklung des deutschen Marktes für Holz und Holzprodukte und der Berücksichtigung von Substitutionseffekten. Im Rahmen einer Szenarien-Analyse wird untersucht, welche Wirkungen veränderte Waldbewirtschaftung, veränderte Marktanteile von Holzprodukten und ein höherer Anteil erneuerbarer Energien auf die Netto-Kohlenstoffemissionen der Holznutzung in Deutschland haben. Des Weiteren wird aufgezeigt, welche Modellannahmen den größten Einfluss auf die Modellierungsergebnisse haben. Es zeigt sich, dass nur eine radikale Umstellung der Waldwirtschaft zu dauerhaft positiven Kohlenstoffemissionen und damit negativer Klimawirksamkeit führen würde. Die Fortführung der derzeitigen Waldbewirtschaftung, aber auch ein höherer Anteil ertragreicherer Baumarten und die Veränderung von Marktanteilen von Holz- und Holzprodukten würden weiterhin zu negativen Netto-Kohlstoffemissionen führen. Berücksichtigt man Substitutionseffekte, so würden selbst die dauerhaft positiven Netto-Kohlenstoffemissionen einer radikal veränderten Waldbewirtschaftung mehr als kompensiert und die negativen Emissionen aller anderen Szenarien deutlich erhöht. Auch ein höherer Anteil erneuerbarer Energien würde nicht zu einer negativen Klimawirkung der Holznutzung in Deutschland führen.
Vorträge Session 19: Holz in der Bioökonomie – Old School oder Trendsetter?
117
Estimating forest products demand models in the presence of structural changes in European Countries
Paul Rougieux1, Olivier Damette2
1Laboratoire d’Economie Forestière, IN A/AgroParisTech, Nancy, France, [email protected]
2BETA-CNRS, Université de Lorraine, Nancy, France
Schlagworte: Structural Changes, Macroeconomic demand
Changes in forest products demand can be analysed at the scale of a country or of a group of countries. Our analysis focuses on the consumption of 4 major intermediate forest products: newsprint, printing and writing paper, coniferous sawnwood and particle board in a panel of 15 European countries, over the period 1980-2014. The most straightforward macroeconomic demand models considers that a given forest product's consumption in one country depends on national income (measured by the GDP) and on that forest product's prices. Based on this model, econometric analysis attempts to estimate a revenue elasticity and a price elasticity of demand for each given forest product. In line with the literature on macroeconomic forest products demand, demand elasticities common to all countries in the panel can be estimated over the long term (several decades). We are not interested in the business cycle variation. The influence of the 2008 financial crisis on forest products demand is taken into account through the use of a dummy variable. Our objective is rather to analyse changes in the long term demand structure. Non stationarity issues can lead to spurious regressions. Non stationarity issues are particularly difficult to deal with in the presence of structural breaks, because the spurious model will tend to be favored. Compared to single time series analyses, panel data analysis are more powerfull to identify non stationarity and structural break issues. In a panel context, we test for non stationarity and cointegration in the presence of structural breaks. We attempt to estimate break dates for each country in the panel. Where possible, we then estimate demand models before and after the change. In a final stage we try to add addtional explanatory variables for the change. The introduction of shifts into demand models should help refine forest sector models. Other disciplines at the interface between forest owners, the forest products industry and forest policy may find interest in a better description of long term demand changes.
Vorträge Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung 118
Verständnis und Vorhersage der Baummortalität – woran krankt die Forschung?
Lisa Hülsmann1,2, Harald Bugmann2, Peter Meyer3 und Peter Brang1
1 Waldressourcen und Waldmanagement, Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, [email protected], [email protected] 2 Departement Umweltsystemwissenschaften, ETH Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, [email protected] 3 Abteilung Waldwachstum, NW-FVA Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, [email protected] [email protected]
Schlagworte: Baummortalitätsmodelle, Robustheit, Generalisierbarkeit, Naturwaldreservate
Als einer der Schlüsselprozesse in der Walddynamik prägt Baummortalität sowohl die Bestandesstruktur als auch die Artzusammensetzung von Wäldern. Um die zukünftige Waldentwicklung vorhersagen zu können, sind robuste Mortalitätsalgorithmen daher unverzichtbar. Die Faktoren, die das Absterben von Bäumen beeinflussen, sind komplex und begünstigen sich gegenseitig. Da das heutige Verständnis der Mortalität nicht ausreicht, um diese mithilfe mechanistischer Modelle vorherzusagen, haben empirische Mortalitätsmodelle eine große Bedeutung. In etwa dreißig Publikationen wurden seit 1994 inventurbasierte Mortalitätsmodelle für europäische Baumarten veröffentlicht. Dennoch ist bis heute wenig über deren Anwendbarkeit außerhalb der ursprünglichen Studien bekannt, da Mortalität eine große räumliche und zeitliche Variabilität aufweist und die meisten Modelle mit eher kleinen Datensätzen kalibriert wurden. Zudem zeichnen sich die Modelle durch eine große Heterogenität z.B. in Bezug auf den Modellzweck, die erklärenden Variablen, die Waldtypen und die Modellselektion aus. Das erste Ziel der vorliegenden Studie war die Bereitstellung von robusten Mortalitätsmodellen, um die empirische Grundlage von Waldentwicklungszenarien zu verbessern. Mit generalisierten logistischen Modellen, die Daten mit unterschiedlich langen Inventurperioden erlauben, analysierten wir die Mortalitätswahrscheinlichkeit von Einzelbäumen basierend auf Durchmesser und Zuwachs. Zur Kalibration der Modelle wurde ein Inventurdatensatz mit >80000 Bäumen aus Naturwaldreservaten in Deutschland und der Schweiz verwendet. Sowohl bei der Modellselektion als auch bei der Evaluierung der Modelle wurde die Anwendbarkeit in forstlichen Simulationsmodellen berücksichtigt. Umwelt- und Bestandsvariablen machten Buchen-Mortalitätsmodelle nicht allgemeingültiger. Das zweite Ziel war die Bewertung von Mortalitätsmodellen aus der Literatur. Dazu wurde deren Übertragbarkeit in einem systematischen Assessment analysiert und die Ähnlichkeit der Modellvorhersagen mit einer hierarchischen Clusteranalyse bewertet. Basierend auf diesen Resultaten wurden erfolgversprechende Strategien für die zukünftige Mortalitätsmodellierung identifiziert. So erzielten wachstumsbasierte Modelle bessere Ergebnisse als solche, die Konkurrenzvariablen berücksichtigen. Unsere Ergebnisse betonen den Wert langfristiger Monitoringprogramme und liefern wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung forstlicher Vorhersagemodelle.
Vorträge Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung
119
Digital Forest Site Mapping – Beispiele und Erfahrungen mit Data Mining basierten Prognosen
Thorsten Behrens1, Ulrich Steinrücken1, Karsten Schmidt1, Jürgen Gauer2, Rainer Petzold3
1 Soilution GbR, Heiligegeiststr. 13, 06484 Quedlinburg, [email protected] 2 Landesforsten Rheinland-Pfalz Außenstelle Forsteinrichtung, Südallee 15 – 19, 56068 Koblenz, [email protected] 3 Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft, Staatsbetrieb Sachsenforst, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna, [email protected]
Schlagworte: Data Mining, Hyperskalige Digitale Reliefanalyse, Digital Soli Mapping
Detaillierte Standortskenntnisse sind die Voraussetzung für die für die Waldbewirtschaftung und die Entwicklung zielgerichteter Anpassungsstrategien für Waldökosysteme an den Klimawandel. Um fehlende Standortsdaten zu erheben oder unzureichende zu ergänzen, werden effiziente Verfahren aus dem Bereich der Pedometrie und des Digital Soil Mapping benötigt. Diese erlauben es, die oftmals nicht-linearen Zusammenhänge zwischen den zur Verfügung stehenden Umweltvariablen und den Standortseigenschaften abzubilden. Die für diese Verfahren notwendigen kartierten Standortsinformationen, die als regionale Lerngebiete benötigt werden, liegen meist in Form von Altdaten vor oder können spezifisch für die prognostische Fragestellung in kleinen Lerngebieten kartiert werden. Je nach Standortseigenschaft werden dann überwachte Klassifikationsverfahren bzw. Regressions-verfahren eingesetzt um Modelle zu erzeugen, die dann in die Fläche extrapoliert werden können. Dieser Vortrag bespricht unterschiedliche Beispiele und Erfahrungen aus verschiedenen Projekten in denen Data Mining-Verfahren aus dem Bereich des Digital Soil Mappings erfolgreich in der Standortsprognose in Rheinland-Pfalz, Sachsen und Montenegro eingesetzt wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass die reproduzierbare Genauigkeit in der gleichen Größenordnung liegt wie die Fehlerquote einer konventionellen Kartierung. Des Weiteren kann gezeigt werden, dass durch Generalisierungseffekte über die Data Mining Verfahren bestehende Kartierungen verfeinert werden können, ohne dass weitere Kartierungen not-wendig sind. Darüber hinaus geht der Vortrag auf neue Verfahren der hyperskaligen Reliefanalysever-fahren ein, die wesentlich bessere Prognosegüten liefern als herkömmliche Ansätze und die die Grundlage für die gezeigten Ergebnisse darstellen. Des Weiteren wird ein integriertes Client-Server basiertes System vorgestellt, dass es ermöglicht die gezeigten prognostischen Verfahren im Rahmen der Feldkartierung bereits während der Geländearbeit zu nutzen und so den Prozessablauf noch effizienter zu gestalten.
Vorträge Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung 120
Optimierungsansätze zur Ableitung optimaler Behandlungsstrategien auf der Basis von Wachstumsmodellen
Annett Degenhardt1
1Landesbetrieb Forst Brandenburg, Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde, A.-Möller-Str. 1, 16225 Eberswalde, [email protected]
Schlagworte: Heuristische Optimierung, Wachstumsmodelle, Bestandesbehandlung
Der traditionelle forstliche Ansatz zur Bewertung von Behandlungsstrategien basiert auf der Anlage und Auswertung von Durchforstungsversuchen. Ergebnisse sind dabei erst nach jahrzehntelanger Beobachtung zu erwarten. Überdies lassen langfristige Versuche nur eine sehr begrenzte Zahl von Behandlungsvarianten zu. Abstandsabhängige Einzelbaumwachstumsmodelle bieten die Möglichkeit, Bestandesent-wicklungen bei unterschiedlichsten Behandlungsvarianten näherungsweise zu prognostizieren und mit Hilfe ökologischer, ertragskundlicher und betriebswirtschaftlicher Parameter zu bewerten. In den Einzelbaummodellen werden dazu die in der Praxis üblichen Behand-lungsweisen (z. B. Hochdurchforstung, Niederdurchforstung, Z-Baum-Freistellung) durch parameterabhängige Algorithmen simuliert. Durch die Kombination der Wachstumsmodelle mit geeigneten Optimierungsverfahren („Direct Search“, VALSTA 1992) lassen sich so optimale Werte für die behandlungsrelevanten Parameter wie beispielsweise die Art der Durchforstung, Entnahmemengen oder der Freistellungsgrad von Z-Stämmen herleiten. Die aus diesem Ansatz abgeleiteten optimalen Behandlungsstrategien beschränken sich auf eine Variation der in der Praxis bewährten Behandlungsweisen. Aktuelle waldbauliche Zielstellungen, die auf eine Risikominimierung hinsichtlich abiotischer und biotischer Einflüsse, möglicher Klimaänderungen und der Unsicherheit des Holzmarktes ausgerichtet sind, können aber auch neue, unkonventionelle Behandlungsmethoden erfordern. Mit Hilfe von geeignet formulierten heuristischen Optimierungsansätzen wird daher versucht, die Optimierung der Bestandesbehandlung auf der Basis der Einzelbäume zu betrachten. Unabhängig von vorgegebenen Behandlungsalgorithmen werden optimale Ent-nahmezeitpunkte für jeden einzelnen Baum bestimmt. Im Ergebnis erhält man interessante Hinweise zur Wirkung der Entnahmezeitpunkte auf das Erreichen der waldbaulichen Zielstellung. Gegebenenfalls lassen sich dadurch neue, den aktuellen waldbaulichen Erfordernissen angepasste Strategien für die Bestandesbehandlung ableiten.
Vorträge Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung
121
Lückenfüllung und Modellierung von meteorologischen Daten für ICP Forests Level II Plots
Max Daenner1, Stephan Raspe1 und Peter Waldner2
1 Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Freising/Deutschland, [email protected], [email protected] 2 Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, Birmensdorf/Schweiz, [email protected]
Schlagworte: Lückenfüllung, ICP Forests, ECMWF, Meteorologie
Lückenlose, harmonisierte Zeitreihen meteorologischer Standardgrößen sind eine grundlegende Voraussetzung für viele standortsbezogene ökologische Modellierungen wie beispielsweise die Simulation der Wasserflüsse im Boden. Datenreihen von vor Ort Messungen weisen jedoch häufig Inkonsistenzen und Lücken auf, die mit geeigneten Methoden korrigiert bzw. geschlossen werden müssen. Der aufgrund der Anzahl der Messstandorte (355 Standorte) wohl umfangreichste forstmeteorologische Datensatz ist der des ICP Forests mit Zeitreihen, die z. T. bis 1990 zurückreichen. Die Messstandorte liegen in ganz Europa und darüber hinaus auf Freiflächen innerhalb geschlossener Waldbestände. Unter dem Dach des internationalen Programms ICP Forests wurden die Methoden harmonisiert, so dass bereits die Rohdatendaten weitgehend vergleichbar sind. Alle Messdaten werden in der zentralen Datenbank des ICP Forests zusammengeführt. In einem mehrstufigen Verfahren haben wir nun die meteorologischen Rohdaten in der ICP Forests Datenbank überprüft und die darin enthaltenen Lücken einheitlich aufgefüllt. Dazu wurde zunächst der gesamte Datensatz zusammen mit den Datenlieferanten aus den einzelnen Ländern überprüft und ggf. korrigiert b.zw. ergänzt. Für die weitere Bearbeitung wurde der frei zugängliche ERA-Interim-Datensatz des European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) in einer räumlichen Auflösung von 0,7° x 0,7° herangezogen. Mittels bilinearer Interpolation zwischen jeweils 4 Pixel wurden die meteorologischen Größen Lufttemperatur (Mittelwert, Minimum und Maximum), Niederschlag, relative Luftfeuchtigkeit, Globalstrahlung sowie Windgeschwindigkeit und Windrichtung in täglicher Auflösung für jeden ICP Forests Standort aufbereitet. Durch einen Vergleich zwischen den Messwerten des ICP Forests und dem ERA-Interim-Datensatz wurden Ausreiser mit der Mahalanobis-Distanz-Methode detektiert und ausgeschlossen. Anschließend erfolgte ein statistisches Downscaling der ERA-Interim Daten auf die ICP Forests Standorte mittels Kernel Density Distribution Mapping (KDDM). Der so gewonnene Datensatz konnte dann zur Lückenfüllung sowie zur retrospektiven Verlängerung der meteorologischen Zeitreihen der ICP Forests Standorte verwendet werden.
Vorträge Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung 122
Technische Spielerei oder neue, ernstzunehmende Alternative? Die fotooptische Vermessung von Kiefernstamm- und -industrieholz mittels
Smartphone-App
Tobias Cremer1, Lubomir Blasko2, Philipp Herold1 und Christoph Lehmann1
1Hochschule für nachhaltige Entwicklung, Fachgebiet für Forstnutzung und Holzmarkt, Alfred-Möller-Str. 1, 16225 Eberswalde, [email protected] 2 Landesbetrieb Forst Brandenburg, Landeswald-Oberförsterei Chorin, Kloster Amt Nr. 11, 16230 Chorin
Schlagworte: Fotooptische Vermessung, RVR, Holzbereitstellung
Die Maßermittlung von Holz ist in Kombination mit der nachgeschalteten Organisation der Logistik eine der Tätigkeiten mit den stärksten Auswirkungen auf das betriebswirtschaftliche Ergebnis von Forstbetrieben. Durch die rasante Weiterentwicklung fotooptischer Verfahren sind deutliche Veränderungen in der Ernte- und Transportlogistik zu erwarten. Zwar sind diese Verfahren aufgrund der noch fehlenden eichrechtlichen Zulassung bislang laut RVR nicht zur Ermittlung des Abrechnungsmaßes zugelassen; schon heute werden sie jedoch in Forstbetrieben und Landesforstverwaltungen als Kontrollmaß im regulären Betrieb eingesetzt. Unsicherheiten bestehen noch in der Validität der Daten und ihrer Reproduzierbarkeit sowie im Hinblick auf Einflussfaktoren auf das Ergebnis. Deshalb wird im Rahmen eines breit angelegten Forschungsprojektes die manuelle Maß-ermittlung gemäß RVR mit der fotooptischen Maßermittlung mittels Fovea App von Kiefernholz, als Brandenburgs häufigster Baumart, unter praktischen Bedingungen ver-glichen. Dazu werden zurzeit ca. 200 Stamm- und -industrieholzpolter mit einem Gesamt-volumen von 15-20.000 Rm manuell und fotooptisch vermessen, die Ergebnisse statistisch analysiert und relevante Einflussfaktoren auf die Ergebnisse herausgearbeitet. Es wird erwartet, dass insbesondere Bestelllänge, Poltergesamtgröße und Polterqualität die Genauigkeit der Maßermittlung beeinflussen, aber auch externe Parameter wie die Wetter-bedingungen eine Rolle spielen. Um erste Angaben zur Veränderung der Produktivität bei der Maßermittlung machen zu können, werden zudem orientierende Zeitstudien durchgeführt. Wie erste Auswertungen zeigen, weichen die fotooptisch ermittelten Volumina im Schnitt um ca. 2 % vom händisch ermittelten Volumen ab. Haupteinflussfaktoren scheinen insbesondere die äußeren Bedingungen sowie vor allem die Polterqualität zu sein. Damit liefert die Studie zum einen wichtige Hinweise darauf, welche Anforderungen künftig an die Bereitstellung von Holz gestellt werden müssen, um eine reibungslose Vermessung und nachfolgende Datenverarbeitung zu gewährleisten. Gleichzeitig zeigt sie, mit welchen Abweichungen vom bisher akzeptierten, händisch ermittelten Volumenmaß gerechnet werden muss und liefert damit eine Grundlage für den eichrechtlichen Anerkennungsprozess. Um die Akzeptanz der fotooptischen Vermessung weiter zu erhöhen, müssen künftig vergleichbare Daten für weitere relevante Baumarten und Sortimente erhoben werden.
Vorträge Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung
123
LiDAR-gestützte Erfassung von einzelbaum- und bestandsbasierte Waldentwicklung nach natürlichen Störungsprozessen
Steven Hill1, Hooman Latifi1, Marco Heurich2 und Jörg Müller2
1 Lehrstuhl für Fernerkundung, Institut für Geographie und Geologie, Universität Würzburg, E-Mail: [steven.hill, hooman.latifi]@uni-wuerzburg.de 2 Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Freyunger Straße 2, D-94481 Grafenau, E-Mail: [marco.heurich, joerg.mueller]@npv-bw.bayern.de
Schlagworte: LiDAR, natürliche Störereignisse, Waldwachstumsmodellierung, Punktmusteranalysen
Natürliche Störereignisse gehören zu den Hauptantriebskräften von Veränderungen in Waldökosystemen. Die Erfassung der Waldstruktur ermöglicht ein besseres Verständnis der unterliegenden Prozesse sowie eine Früherkennung von Veränderungsprozessen in Wäldern. Diese haben großen Einfluss auf die räumlichen und temporalen Muster in Wäldern, da sie zu Veränderungen in der Struktur, der Zusammensetzung und der Funktionalität führen. Einer der Hauptgründe für Störereignisse in Fichtenwäldern in Europa ist der europäische Borkenkäfer Ips typographus L. Im Nationalpark Bayerischer Wald führte das Zusammenspiel zwischen Windwürfen und Borkenkäferbefall zur Zerstörung großer Waldflächen. Gleichzeitig führten diese Ereignisse auch zur Entstehung natürlicher Verjüngungsflächen. Bisher ging man davon aus, dass die aufwachsenden Bäume auf Störungsflächen zunächst homogene Waldstrukturen ausbilden und strukturelle Komplexität erst in den späten Wachstumsphasen auftritt. Jedoch bestärken gegenwärtige Studien die Annahme, dass strukturelle Komplexität bereits viel früher in der Bestandesentwicklung auftreten kann und während des gesamten Wachstumsprozesses bestehen bleibt. Während traditionelle Feldmessungen zur Erfassung zukünftiger Waldentwicklungen zeitaufwendig und teuer sind, bietet die Fernerkundung vielversprechende Alternativen für die Datenerfassung. Der Einsatz von Laserscanning ermöglicht es sowohl horizontale als auch vertikale Informationen der Erdoberfläche zu erfassen. Ziel dieser Studie war die Analyse der aktuellen Waldstrukturen sowie die Modellierung zukünftiger Entwicklungen auf gestörten Flächen in den Hochlagen des Nationalparks Bayerischer Wald. Bei dem vorgestellten Ansatz wurde die aktuelle Waldstruktur aus LiDAR-Daten abgeleitet und die zukünftige Entwicklung mit einem einzelbaum-basierten Modellansatz simuliert. Die Einzelbäume wurden mit Hilfe der CIR-Luftbilder validiert. Die Ergebnisse dienten als Eingangsdaten, um die Bestandesentwicklung über einen Zeitraum von 80 Jahren zu simulieren. Um sowohl die aktuelle als auch die zukünftige Waldstruktur auf den Untersuchungsflächen zu analysieren, wurden eine Reihe Punktmusteranalysen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass natürlich nachwachsende Wälder nach einem Störereignis, bereits in den frühen Phasen, komplexe Strukturen aufweisen und dass sich ein Teil der komplexen Strukturen von Altbeständen bereits in diesen frühen Phasen entwickeln können.
Vorträge Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung 124
Forest Warehouse auf Basis von Laserdaten
Martin Opferkuch1, Gero Becker2, Thomas Smaltschinski1 und Dirk Jaeger1
1Professur für Forstliche Verfahrenstechnik, Uni Freiburg, Werthmannstr. 6, 79098 Freiburg, [email protected] 2Professur für Forstbenutzung, Uni Freiburg
Schlagworte: Holzqualität, bedarfsorientierte Holzbereitstellung, LiDAR, Nutzungsmodellierung
Die Möglichkeit einer präzisen Allokation der Produkte forstlicher Nutzungen zu Kunden der Holzindustrie bereits vor dem Zeitpunkt der Holzernte stellt ein Schlüsselelement für große Effizienzsteigerungen in der Holzbereitstellung dar. Kernvoraussetzungen dafür sind die Kenntnis der produktspezifischen Kundenanforderungen sowie insbesondere genaue Informationen über Dimension, Qualität und Quantität der potentiellen Erntebäume. Ein Großteil dieser Informationen ist aus Inventurdaten nicht ableitbar, eine Allokation somit nicht möglich. Durch die Kombination von Daten aus terrestrischem (TLS) und luftgestütztem (ALS) Laserscanning können konsistente Informationen über den Vorrat erzeugt werden und Berechnungen von Nutzungsvolumen sowie potentieller Sortimente auf Ebene von Einzelbeständen eines Forstbetriebs erfolgen. Über die Baumhöhe (h) und verschiedene Kronenparameter aus ALS sowie den Brusthöhendurchmesser (d1,3) aus TLS-Stichproben lassen sich einfache lineare Regressionsgleichungen berechnen die zur Schätzung des d1,3 mit h und den Kronenparametern als unabhängigen Variablen verwendet werden können. Darüber hinaus kann eine Regressionsgleichung berechnet werden für die enge Beziehung zwischen d1,3 und d7, der ebenfalls aus TLS leicht ableitbar ist. Damit sind für alle Bäume alle benötigten Variablen (d1,3, d7 und h) für eine möglichst genaue einzelstammweise Volumenberechnung durch das Volumen- und Sortenprogramm BDATpro vorhanden und es können bestandesspezifische Volumenverteilungen errechnet werden, die sich über die Weibullfunktion ausgleichen lassen. Über die Modifikation der Parameter der Weibullfunktion lassen sich verschiedene Nutzungsansätze modellieren und die resultierenden Sortimente simulieren. Die dazu benötigte Qualitätsinformation (Abholzigkeit, Krümmung) stammt aus den TLS-Daten. Derartige Informationen vor dem Nutzungszeitpunkt ermöglichen die Realisierung der Idee eines Forest Warehouse mit der benötigten Flexibilität hinsichtlich der zu produzierenden Stammholzprodukte.
Vorträge Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung
125
Automatisiertes Forstinventurverfahren mittels sensorbasierter Nahbereichsfernerkundung
Tom Thiele1, Adrian Schischmanow2, Jan-Peter Mund1
1 HNE Eberswalde, Alfred-Möller-Str. 1, 16225 Eberswalde, [email protected], [email protected] 2 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Institut für Optische Sensorsysteme, Informations-verarbeitung optischer Systeme, Rutherfordstraße 2, 12489 Berlin-Adlershof Holz wird als nachwachsender Rohstoff immer bedeutsamer. Detaillierte Kenntnisse über vorhandene Baumarten, Sortenqualitäten und die regional verfügbaren Holzvorräte sind heute die Grundbausteine einer kompletten Prozess- und Logistikkette in der modernen Holzindustrie. Um einen ökologisch nachhaltigen und wirtschaftlich dennoch effizienten Umgang mit der Ressource Holz zu erreichen, geht der Trend immer stärker in Richtung einer „Precision Forestry“ und zum „ arenlager ald“. Die übliche stichprobenartige Bestandserhebung in der Forsteinrichtung ist für zukünftige Bewirtschaftungsmethoden zu aufwendig und kostenintensiv, um flächenhaft durchgeführt zu werden. Aus diesem Grund sind in Zukunft effizientere und teilweise automatisierte Waldinventurverfahren zur flächenhaften Datenerfassung der Bestände und des Holzvorrates notwendig. Daher gibt es seit Jahren großes Interesse und großen Bedarf für neue, digitale, standardisierte und technisch automatisierte sowie auch wirtschaftlich effiziente Waldinventurverfahren mit der zusätzlichen Möglichkeit der Erfassung von Einzelbaumpositionen in Weltkoordinaten auf Basis terrestrischer Fernerkundungsmethoden. Das vorgestellte System basiert auf einem Multisensoransatz und besteht aus einer Stereokamera, einer Inertialsensorik und einem GNS-System. Die Neuheit des Ansatzes besteht in der Kopplung von GNSS und VINS Sensorik zur Verortung im Wald und in Zukunft auch mit weiterer Nahbereichssensorik, z.B. auf der Basis von UAVs. Bei dem VINS handelt es sich um die optisch gestützte Inertial-Navigation. Hier wird der menschliche Orientierungssinn sensorisch nachgebildet. Das Verfahren arbeitet komplett unabhängig von externer Infrastruktur (z.B. GPS, Funk oder künstliche Marken). In Zukunft soll die Verknüpfung weitere Nahbereichssensorik mittels Drohnen (UAV-Systemen) zur kompletten 3D Erfassung der Bestände zu Einsatz kommen. Die anfallenden Daten werden automatisch in einer zentralen Geodatenbank weiterverarbeitet und konsistent geocodiert verwaltet (Back-End). Die gesammelten Informationen können einem Nutzer jederzeit auf einem geeigneten mobilen Gerät (Front-End) zur Verfügung zu gestellt werden. Damit wird ein wesentlicher Baustein für eine effiziente Forstplanung, Entwicklung und Bewirtschaftung maschinell genutzter Wälder verfügbar. Das System ist in der Lage größere Waldgebiete, z. B. erschlossene Bestände zwischen den Rückegassen, terrestrisch, dreidimensional und geocodiert zu kartographieren und aussagekräftige forst- und betriebswirtschaftlich relevanten Kenngrößen der klassischen Waldinventur auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen auch für Einzelbäume abzuleiten (z.B. Baumposition, BHD und weitere Stammdurchmesser, Abholzigkeit und Stammlänge, Kronenansatz, etc.).
Vorträge Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung 126
Terrestrisches Laserscanning in der Waldvermessung – von der Wissenschaft in die Forstpraxis
Hans-Joachim Klemmt1, Bernhard Förster1,2, Elke Dietz1, Alfred Wörle1 und Thomas Seifert3,4
1Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85356 Freising, [email protected], [email protected], [email protected] 2Lehrstuhl für Strategie und Management der Landschaftsentwicklung, Technische Universität München, Emil-Ramann-Str.6, 85354 Freising, [email protected] 3Department of Forest and Wood Science, Faculty of AgriSciences, Stellenbosch University, Private Bag X1, 7602 Matieland (South Africa), [email protected] 4Scientes Mondium UG, Ruppertskirchen 5, 85250 Altomünster, [email protected]
Schlagworte: terrestrisches Laserscanning, Waldvermessung, Forstinventur, Baumartenunterscheidung
Terrestrisches Laserscanning (TLS) ist ein stationäres, aktives, bildgebendes 3D-Verfahren, das laserbasierte Streckenmessungen in einer automatisierten Abfolge von quasi gleichabständigen Abstastschritten in vertikaler und horizontaler Richtung erfasst und daraus geometrische Informationen über das Objekt gewinnt. In den letzten 10 Jahren haben alle forstlichen Fakultäten in Deutschland sowie eine Vielzahl internationaler Forschungseinrichtungen die Einsatzmöglichkeiten dieser Technologien im Bereich der quantitativen Walderfassung evaluiert. Alle Einrichtungen kommen einvernehmlich zu dem Schluss, dass diese Technologie ein hohes Zukunftspotenzial besitzt und wegen der vielfältigen Vorteile Eingang in die Forstpraxis finden sollte. Zahlreiche existierende wissenschaftliche Arbeiten zum Einsatz terrestrischer Laserscantechnologie im Wald haben sich mit der Erfassung von Dimensions- und Volumengrößen von Bäumen beschäftigt. Für die forstpraktische Anwendung ist allerdings die Bestimmung bzw. die Unterscheidung von Baumarten auf Beobachtungsflächen primär von großer Bedeutung. Im Rahmen des Vortrages wird – aufbauend auf einer umfassenden Darstellung des Stands des Wissens – eine für die forstpraktische Anwendung in der Forstinventur entwickelte Methodik zur Unterscheidung von Baumarten in terrestrischen 3D-Laserscandaten vorgestellt. Zur Anwendung kommt dabei ein neuartiger Ansatz zur Quantifizierung von Rauhigkeiten von Rinden und Borken. Zudem wird ein Vergleich eines 2D-Klassifikationsverfahrens mit dem neuartigen 3D-Ansatz angestellt. Die Ergebnisse der Anwendung der 3D-Baumartenunterscheidung werden mit Aufnahmedaten bayerischer Waldklimastationen verglichen und evaluiert. Weiterhin erfolgt eine Evaluation anhand von TLS-Aufnahmen auf bayerischen BWI-Schulungspunkten in Kelheim. Aufbauend auf der Ergebnisevaluation sowie des skizzierten Standes des Wissens werden abschließend Wünsche an die forstliche Forschung formuliert, die dazu beitragen sollen, der neuartigen Technologie schneller als bisher den Weg in die Forstpraxis zu ebnen.
Vorträge Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung
127
Flächendeckende Schätzung dendrometrischer Kenngrößen und Regionalisierung von Forstbetriebsinventuren mit Hilfe der Forstlichen
Fernerkundung
Christoph Straub1, Rudolf Seitz1
1Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft LWF, Abteilung Informationstechnologie, [email protected]
Schlagworte: Fernerkundung, Regionalisierung, Oberflächenmodelle, Forstbetriebs-inventuren
Aktuelle Forstbetriebsinventuren im öffentlichen Wald Bayerns erlauben statistisch abgesicherte Angaben zu dendrometrischen Kenngrößen für größere Planungseinheiten bzw. Straten oder für den gesamten Forstbetrieb. Problematisch ist jedoch, dass aufgrund des relativ groben Stichprobengitters von üblicherweise 200 × 200 Meter häufig keine abgesicherten Aussagen für einzelne Waldbestände möglich sind (Knoke 2012). Detaillierte Angaben zur kleinflächigen, räumlichen Verteilung von Holzressourcen sind dadurch nicht möglich, wären aber in der forstlichen Praxis z.B. für einzelbestandsweise Planungen äußerst nützlich. Ferner sind im Privatwald häufig überhaupt keine Informationen zu dendrometrischen Kennwerten verfügbar. Gerade für diese Waldflächen, für die es in der Regel keine terrestrischen Inventuren gibt, ist zu prüfen, ob amtliche Fernerkundungsdaten verwendbare, raumbezogene Hinweise zu dendrometrischen und naturschutzrelevanten Kenngrößen liefern können und wenn ja, zu welchen Kosten. Die Präsentation beleuchtet das Potential von amtlichen Fernerkundungsdaten (insbesondere von Stereo-Luftbildern) zur Schätzung dendrometrischer Kenngrößen, und stellt die Ergebnisse des LWF-Projektes SAPEX-DLB dar. Zusammenfassend zeigen die Untersuchungen, dass wichtige forstliche Kenngrößen wie Oberhöhe, Lorey’sche Höhe, Holzvorrat pro Hektar, mittlerer Stammdurchmesser und Grundfläche pro Hektar unter Verwendung von amtlichen Fernerkundungsdaten flächendeckend geschätzt und regionalisiert werden können. Für die Modellierung von Stammzahlen pro Hektar wurden bisher noch keine zufriedenstellenden Genauigkeiten erzielt. Zur flächendeckenden Modellierung von dendrometrischen Kenngrößen konnte ein praxisreifer Arbeitsablauf mit entsprechenden Softwarelösungen entwickelt werden. Die entwickelten Methoden konnten für Waldflächen mit einer Größe von 3.590,00 ha bis 39.553,00 ha erfolgreich angewendet werden. Durch eine Verknüpfung von amtlichen Fernerkundungsdaten mit terrestrischen Stichprobenkreisen sind somit kleinflächige und räumlich detaillierte Abschätzungen möglich, welche derzeit in der forstlichen Praxis fehlen. Diese Daten könnten in Zukunft sowohl für die einzelbestandsweise Planung als auch für forstliche Beratungsaufgaben ein nützliches Hilfsmittel sein.
Vorträge Session 22: Ableitungen aus Großrauminventuren f. d. Waldbewirtschaftung 128
Der Waldernährungszustand an den Punkten der bundesweiten Bodenzustandserhebung
Ulrike Talkner1, Winfried Riek2, Inge Dammann1, Martin Kohler3, Karl Josef Meiwes1 und Axel Göttlein4
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Grätzelstr. 2, 37079 Göttingen, [email protected], [email protected], [email protected] 2Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde, Alfred-Möller-Straße 1, 16225 Eberswalde, [email protected] 3Universität Freiburg, Professur für Waldbau, 79085 Freiburg, [email protected] 4Technische Universität München, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: BZE II, Waldernährung, zeitliche Veränderung, Kalkung
Die Durchführung chemischer Nadel- und Blattanalysen an den Punkten der Bodenzustandserhebung (BZE) soll der flächenrepräsentativen Einschätzung der Ernährungssituation der Waldbäume dienen und Hinweise auf deren zeitliche Veränderungen geben. Von allen untersuchten Baumarten ist die anspruchslose Kiefer am besten ernährt. Wie bei der Eiche besteht allerdings eine Überversorgung mit Stickstoff (N). Die anspruchsvolle Buche ist am schlechtesten mit den Hauptnährelementen versorgt. Über alle Baumarten hinweg zeigt sich eine normale Calcium- (Ca) und Magnesium- (Mg) Ernährung und auch Kalium (K) ist – abgesehen von der Buche – selten im Mangel. Die Phosphor- (P) Ernährung ist bei der Buche an mehr als der Hälfte der BZE-Punkte sowie bei Eiche und Fichte an einigen Standorten (latent) mangelhaft. Die N-Ernährung aller vier Baumarten ist im Zeitraum zwischen BZE I und BZE II luxuriöser geworden. Die in der BZE beobachteten Zunahmen der N-Nadel- und Blattgehalte deuten auf eine nach wie vor hohe Stickstoffverfügbarkeit in den Waldökosystemen hin. Die Ca-Ernährung aller vier Baumarten und die Mg-Ernährung von Fichte und Buche haben sich verbessert. Dies ist wahrscheinlich auf einen Rückgang der Bodenversauerung durch verringerte Säureeinträge und Bodenschutzkalkungen zurück zu führen. Sehr deutlich ist der Rückgang der S-(Über)ernährung aller vier Baumarten zu beobachten. Diese Abnahme der S-Nadel- und Blattgehalte geht auf die erfolgreiche Umsetzung der Luftreinhaltepolitik zurück. Alle vier Baumarten reagieren auf Kalkung mit verbesserten Mg-Gehalten in den Nadeln und Blättern, so dass Defizite ausgeglichen werden. Kalkungen verbessern außerdem die Ca-Ernährung von Buche und Eiche und führen zum Ausgleich von Ca-Defiziten. Nach Kalkung zeigen Kiefer, Buche und Eiche keine Reaktion der P-Gehalte. Bei Fichte sind hingegen geringere P-Gehalte auf den gekalkten BZE-Punkten zu beobachten. Bei Fichte und Buche ist mit (Wiederholungs-) Kalkungen das Risiko verminderter K-Gehalte verbunden. Der Zusammenhang zwischen Standort und Ernährungszustand zeigt für die vier Baumarten teilweise unterschiedliche (Reaktions-)Muster. Die Bäume sind physiologisch in der Lage, die Aufnahme von Nährstoffen zu steuern und somit bestehende Unterschiede in der Nährstoffausstattung der Böden in einem gewissen Maß auszugleichen.
Vorträge Session 22: Ableitungen aus Großrauminventuren f. d. Waldbewirtschaftung
129
Einfluss der Kalkung auf Veränderungen von Nährstoffversorgung, Säurestatus und organischem Kohlenstoff in Waldböden
Erik Grüneberg1, Amalie Lauer1, Nadine Eickenscheidt1 und Nicole Wellbrock1
1Thünen-Institut für Waldökosysteme, Alfred-Möller-Str. 1, 16225 Eberswalde, [email protected]
Schlagworte: Bodenschutzkalkung, Bodenzustandserhebung, Säurestatus, Bodenkohlenstoff
Die Versauerung von Böden im Laufe ihrer Entwicklung ist ein natürlicher Prozess, sie kann jedoch durch organischen Säureeintrag, durch Nährstoffentzug nach Biomassenutzung oder durch Deposition von Säurebildnern hervorgerufen werden. Mit der Bodenversauerung kommt es zur Entkopplung der Nährstoffkreisläufe unter Einbeziehung des tieferen Mineralbodens, wodurch sich der Nährstoffentzug weitgehend auf die laufende Streuzersetzung in der Humusauflage beschränkt. Zum Schutz der Bodenqualität wird mancherorts eine Kalkungen durchgeführt, um dem irreversiblen Verlust der Bodenqualität entgegenzuwirken. Mit der Auswertung der BZE-Wald lassen sich Auswirkungen der Kalkung auf die Nährstoffausstattung sowie auf den Kohlenstoff- und Stickstoffpool des Waldbodens auf nationaler Ebene untersuchen. Hierfür wurden ausschließlich gekalkte und nicht gekalkte Standorte innerhalb einer definierten Kulisse ausgewählt. Vorläufige Ergebnisse deuten auf eine flächendeckende, weitgehend substratunabhängige Basenverarmung und einem damit verbundenen Verlust von Nährstoffen auf nicht gekalkten Standorten. Mit der Kalkung konnte dieser Trend in den Oberböden gestoppt werden. Weiterhin ergaben sich kalkungsbedingte Änderungen in den Kohlenstoffvorräten. Während die Humusauflage durch die Kalkung Kohlenstoff verlor, nahmen im Mineralboden die Kohlenstoffvorräte zu. Somit wurden im gekalkten Kollektiv die Kohlenstoffverluste in der Humusauflage durch die Zunahmen im Mineralboden kompensiert. Wir vermuten einen durch die Kalkung bedingten Anstieg des Abbaus der Humusauflage. Die Zunahmen im Mineralboden lassen sich möglicherwiese durch eine Reduzierung der Mobilität und Löslichkeit von DOC durch die Bildung von Kationenbrücken erklären, da diese für eine Stabilisierung der organischen Substanz sorgen. Als weitere Ursachen einer Kohlenstoffzunahme sind Veränderungen mikrobieller Lebensgemeinschaften oder eine veränderte Rekalzitranz der produzierten organischen Substanz denkbar. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass sich die Kalkung großräumig auf essenzielle Bodenfunktionen auswirkt. Daher bedarf es einem Konzept zur Kalkung, dass je nach Bundesland und den dort vorherrschenden Standortsbedingungen unterschiedlichen Kriterien zur Ausweisung des Bedarfs einer Kalkung gerecht werden muss.
Vorträge Session 22: Ableitungen aus Großrauminventuren f. d. Waldbewirtschaftung 130
Nährstoffmängel in den Forstlichen Wuchsregionen Deutschlands - Problemgebiete und Ursachen
Karl H. Mellert1, Eckart Kolb1 Axel Göttlein1
1Professur für Waldernährung & Wasserhaushalt, Hans Carl von Carlowitz-Platz 2, D-85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Ernährungskarte, Ernährungskennwerte, Nährstoffmangel, Waldernährung
Üblicherweise werden Ernährungsdaten getrennt nach Baumart und Nährelement ausgewertet und dargestellt. Ein solches Kartenbündel liefert zwar detaillierte Informationen über einzelne Baumarten und Elemente, eine Übersicht über die generelle Ernährungssituation in Deutschland in einer Karte liefert dies nicht. Auch die Beschränkung auf häufige „Indikatorbaumarten“ hilft für eine deutschlandweite Übersicht kaum weiter, da selbst die bedeutendsten forstlichen Baumarten, wie die Fichte oder die Kiefer, nicht gleich verteilt in Deutschland vorkommen, sondern sich in Schwerpunktregionen konzentrieren. Das Ziel der Untersuchung ist es, (a) eine baumartenunabhängige Übersicht über die Situation in den Wuchsregionen Deutschlands zu geben, (b) Problemgebiete zu identifizieren und (c) die Hauptfaktoren für eine Mangelernährung offen zu legen. Eine derartige synthetische Darstellung der Waldernährungssituation in Deutschland ist jedoch an zwei Voraussetzungen gebunden. (i) An eine länderübergreifenden Karte zu den physiografischen Grundlagen, insbesondere mit Bezug zur Nährstoffverfügbarkeit, die nun in Form der überarbeiteten Wuchsregionengliederung Deutschlands vorliegt. (ii) An eine physiologische Interpretation (z.B. strenger Mangel, Mangel- und Normalernährung) von Nährelementkonzentrationen in den Blattorganen, die nun als Sammlung von bewährten Ernährungskennwerten für Deutschland vorliegt. Der synoptische Ansatz fußt auf folgenden Arbeitshypothesen: (1) Nährelementmängel sind an bestimmte wuchsregionsspezifische Substrate bzw. Leitbodentypen gebunden. (2) Mangelerscheinungen treten bei allen dort vorkommenden Baumarten auf. In unserer Analyse wurden die Blatt- und Nadelspiegelwerte von BZE-Beständen über die wichtigsten forstlichen Baumarten aggregiert und über alle Nährelemente integriert ausgewertet. Auf diese Weise konnten problematische Wuchsregionen identifiziert und klare Hinweise auf dominante Faktoren für eine Mangelernährung gefunden werden. Die Möglichkeiten und Grenzen einer solchen synoptischen Analyse, die mehrere Skalenebenen (vom Punkt zur Wuchsregion) umfasst, werden aufgezeigt.
Vorträge Session 22: Ableitungen aus Großrauminventuren f. d. Waldbewirtschaftung
131
Versauerung in Wäldern: Erholen oder verschlechtern sich die Waldböden?
Jan Evers1, Henning Meesenburg1, Uwe Paar1, Johannes Eichhorn1
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Grätzelstr. 2, 37079 Göttingen, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Bodenversauerung, Basensättigung, Substratgruppen, Waldkalkung
Bodenversauerung und Nährstoffverluste: Die jahrzehntelangen Säure- und Stickstoffeinträge haben die Waldböden in Deutschland nachhaltig verändert. Die Ergebnisse der ersten Bodenzustandserhebung im Wald (BZE I) von 1987-1993 weisen über ganz Deutschland hinweg auf vielen Standorten pufferschwacher Substrate eine Bodenversauerung und Basenverarmung der Oberböden aus. Mittlerweile hat die Belastung der Waldböden vor allem mit Schwefelsäure, aber auch von basischen Stäuben auf Grund der Luftreinhaltemaßnahmen deutlich nachgelassen. Viele Waldstandorte sind gekalkt worden, um die sauren Einträge zu kompensieren. Der luftbürtige Eintrag von säurewirksamem Stickstoff ist jedoch immer noch hoch. Die zweite Bodenzustandserhebung im Wald (BZE II), die zwischen 2006 und 2008 durchgeführt wurde, ermöglicht es erstmals, repräsentativ und fundiert Aussagen zur zeitlichen Veränderung von bodenchemischen Parametern in Waldböden zu treffen. Der Kalkungsstatus der BZE-Punkte wurde eingehend recherchiert. Der Vergleich von Säure-/Basezustand und Nährstoffvorräten für BZE I und BZE II in Niedersachsen, Hessen und Sachsen-Anhalt stratifiziert nach Substratgruppen zeigt, welche Standortsgruppen in besonderen Maße gefährdet sind und wo Handlungsbedarf besteht. Dabei stellt sich die Waldkalkung als wichtige Einflussgröße und Maßnahme heraus, die bis in 60 cm Bodentiefe die Basensättigung sowie die Calcium- und Magnesiumvorräte signifikant erhöhen kann. Auf ungekalkten Standorten dagegen kommt es zu einer weiteren Versauerung der Waldböden, was auf gegenüber den Pufferraten der Waldböden immer noch zu hohe Säureeinträge schließen lässt. Gut mit Nährstoffen ausgestattete Standorte zeigen eine geringe Sensitivität gegenüber Versauerung, wogegen bei mittleren Standorten starke Nährstoffverluste festzustellen sind. Die vorgestellten Ergebnisse sind in die forstliche Standortskartierung und damit in die forstliche Praxis übertragbar und wichtig für die Beurteilung der der Nährstoffkreisläufe als Grundlage einer nachhaltigen forstlichen Bewirtschaftung von Waldökosystemen.
Vorträge Session 22: Ableitungen aus Großrauminventuren f. d. Waldbewirtschaftung 132
Waldernährung in Rheinland-Pfalz
Martin Greve1, Hans-Werner Schröck1 und Willy Werner2
1Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft, Hauptstraße 16, 67705 Trippstadt, [email protected], [email protected] 2Universität Trier, Geobotanik, Behringstraße 21, 54296 Trier, [email protected]
Schlagworte: Waldernährung, Nadel-/Blattspiegelwerte, Bodenzustandserhebung, ernährungskundliche Bewertungssysteme
Im den Jahren 2006/07 wurden im Zuge der zweiten Bodenzustandserhebung (BZE II) die Hauptbaumarten Buche, Eiche, Fichte und Kiefer beprobt. Durch den Einsatz ernährungskundlicher Bewertungssysteme können flächenrepräsentative Aussagen über die Ernährungssituation in Rheinland-Pfalz getroffen werden. Dabei wurden verschiedene etablierte ernährungskundliche Grenzwerte (critical value approach, CVA) und als alternative Methode die auf Basis von Mehr-Element-Verhältnissen arbeitende Compositional Nutirent Diagnosis (CND) angewendet. Der Vergleich mit der ersten Bodenzustandserhebung (BZE I) des Winters 1988/89 für Fichte und Kiefer, der 1983 an Fichte durchgeführten Immissions-ökologischen Waldzustandserfassung (IWE) sowie umfangreiche Zeitreihen der Dauerbeobachtungsflächen (DBF) ermöglichen es Aussagen über die Entwicklung der Waldernährung zu treffen. Dabei fällt insbesondere die für die vier Hauptbaumarten als ungünstig eingestufte Phosphor-Ernährung auf, welche für Fichte auch eine signifikante Abnahme auf einem Teil der DBF und zwischen den Übersichtserhebungen zeigt. Stickstoff wird für die Baumarten zumeist als ausreichend oder im Überschuss bewertet, wobei die Stickstoff-Ernährung der Fichte je nach Bewertungssystem unterschiedlich eingestuft wird. Die mittels CND berechneten Ergebnisse weisen für die DBF und für die BZE II auf ein ausgeglichenes oder zu enges Verhältnis von N zu anderen Nährstoffen hin, wohingegen nach dem CVA ein größerer Anteil der Bestände dem Mangelbereich zugeordnet wird. Die Magnesium-Konzentrationen steigen bei Fichte und Kiefer zwischen BZE I und BZE II signifikant an, auch wenn nur die nicht gekalkten Rasterpunkte betrachtet werden. Die Calcium-Konzentrationen zeigen ebenfalls einen positiven Trend, wobei dieser lediglich auf den gekalkten Rasterpunkten signifikant ist. Die Kalium-Ernährung wird für den Großteil des BZE II-Kollektivs bei den Hauptbaumarten als normal oder als im Überschuss bewertet. Allerdings zeigt die Fichte eine Abnahme der Kalium-Konzentrationen. Die CND liefert Hinweise, dass dies mit der großflächigen Verbesserung der Magnesium- und Calcium-Ernährung zusammenhängt. Die Auswertung zeigt zudem, dass die Element-Konzentrationen sowohl von Bestandesalter, Fruktifikation und Standort als auch von der Witterung wenige Wochen bis mehrere Jahre vor der Probenahme beeinflusst werden können. Forschungsbedarf besteht, wie diese Einflüsse bei der Bewertung berücksichtigt werden können.
Vorträge Session 22: Ableitungen aus Großrauminventuren f. d. Waldbewirtschaftung
133
Nutzung der Bodenzustandserhebung Wald für die Validierung von Bodendaten an den Traktecken der Bundeswaldinventur am Beispiel
Sachsens
Raphael Benning1, Rainer Petzold1, Frank Jacob1 und Henning Andreae1
Staatsbetrieb Sachsenforst, Referat Standortserkundung, Bodenmonitoring und Labor, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna OT Graupa, [email protected]
Schlagworte: Bodendaten, Leitprofil, Standortskartierung, Bodenzustandserhebung
Im Rahmen des durch den Waldklimafonds geförderten Verbundprojektes „ aldproduktivität – Kohlenstoffspeicherung – Klimawandel“ ( P-KS-KW) wurden deutschlandweit für die Traktecken des Basisnetzes der Bundeswaldinventur (BWI) boden- und standortskundliche Informationen bereitgestellt. Diese umfassen für mehr als 80 % der Traktecken vollständig mit bodenphysikalischen Parametern (Textur, Skelettgehalt, Trockenrohdichte) charakterisierte Bodenprofile, die aus den bestmöglichen, verfügbaren Datengrundlagen der Bundesländer recherchiert wurden. In Sachsen wurden dafür die Daten der forstlichen Standortserkundung genutzt. Sie umfassen die forstliche Standortskarte sowie die nach dem ostdeutschen Kartierverfahren in Lokalbodenformen klassifizierten Weiser-profile, aus denen aggregierte Leitprofile generiert wurden. Die bodenphysikalische Untersetzung dieser Leitprofile ermöglicht die Berechnung von Kennwerten des Boden-wasser- und Lufthaushalts als ökologisch interpretierbare Vergleichsgrößen. Im Beitrag wird am Beispiel Sachsens die Validierung dieser für die Traktecken generierten Leitprofile präsentiert. Hierzu werden die Bodenprofile an den BZE-Punkten genutzt, denen zusätzlich entsprechende Lokalbodenformen zugeordnet wurden. Die Einordnung der BZE-Profile in Lokalbodenformen ermöglicht die Zuweisung aggregierter Leitprofile. Damit existieren für die BZE-Punkte Profilaufnahmen am Punkt sowie aggregierte Leitprofile, deren Übereinstimmung geprüft wird. Als Grundlage des Vergleichs dienen die boden-physikalischen Parameter sowie die berechneten Kennwerte der zusammengehörigen Bodenprofile. Die Ergebnisse der Validierung liefern wertvolle Hinweise auf Unsicherheiten, die mit der Zuweisung aggregierter Leitprofile einhergehen. Diese ermöglichen eine Bewertung der im Rahmen des Projektes WP-KS-KW für die Traktecken der BWI erstellten Bodendatensatzes, der zukünftig für Wasserhaushalts- und Waldwachstumssimulationen genutzt wird.
Vorträge Session 22: Ableitungen aus Großrauminventuren f. d. Waldbewirtschaftung 134
BZE-II: Bodenpflanzen als Standortzeiger
Hagen S. Fischer1, Barbara Michler1, Daniel Ziche2
1Geobotanik, TUM, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, 85354 Freising-Weihenstephan. [email protected], [email protected] 2Thünen Institute of Forest Ecosystems, Alfred-Möller-Str. 1, 16225 Eberswalde. [email protected]
Schlagworte: Bodeneigenschaften, Vegetation, Indikatorsystem
Im Rahmen der Bodenzustandserhebung im Wald II (BZE-II) wurden in Deutschland an ca. 2000 Probepunkten umfangreiche Daten zum Boden sowie zur Vegetation erhoben. Darüber hinaus liegen Daten zum aktuellen Klima und zum zu erwarteten Klima im Jahr 2100 vor. Da die Probepunkte in einem streng regelmäßigen Gitter verteilt sind, stellen die Daten auch im Sinn der Statistik eine repräsentative Stichprobe dar. Die Bodendaten bestehen primär aus horizontbezogenen bodenchemischen und -physikalischen Variablen. Daraus wurden vegetationsrelevante probepunktbezogene Variablen abgeleitet. Die Bodenvegetation (pflanzensoziologische Aufnahmen) wurde auf Flächen von 400m2 erhoben. Diese Daten sind Grundlage um Modelle der Verteilung der am Waldboden wachsenden Pflanzen entlang der im Rahmen der BZE gemessenen Standortsgradienten zu modellieren. Mit Hilfe der Bayes-Formel lassen sich diese Pflanzenarten-Modelle zu einem Indikatorsystem synthetisieren, mit dem aufgrund der in einem konkreten Bestand wachsenden Pflanzenarten – ohne aufwendige Laboranalysen – direkt messbare Bodeneigenschaften wie Säuregrad oder Nährstoffgehalte abgeschätzt werden können. Dieses Indikatorsystem ist eine Weiterentwicklung des Weihenstephaner Waldinformations-systems WeiWIS (Fischer & Fischer 2015) mit deutschlandweiter Gültigkeit. Fischer, H.S. & Fischer, A. 2015. Bodenpflanzen als Standortzeiger. In: Schubert, A., Falk, W. & Stetter, U. (eds.) Waldböden in Bayern - Ergebnisse der BZE II, pp. 107–112.
Vorträge Session 22: Ableitungen aus Großrauminventuren f. d. Waldbewirtschaftung
135
Phosphor-Fraktionen unterschiedlicher Verfügbarkeit in Mineralböden von Waldökosystemen
Jörg Niederberger1 Martin Kohler1 und Jürgen Bauhus1
1Professur für Waldbau, Institut für Forstwissenschaften, Universität Freiburg , Tennenbacher Str. 4, 79106 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Hedley P-Fraktionierung, P-Versorgung.
Viele Faktoren können zu einer Verarmung oder Fixierung von Phosphor im Mineralboden von Waldökosystemen und daher zu P-Mangelversorgung von Bäumen auf forstlichen Standorten führen. In vergangenen Untersuchungen wurde gezeigt, dass die Gesamt P-Vorräte ungeeignet sind, um die P-Verfügbarkeit und P-Ernährung von Bäumen einzuschätzen. Zur Bestimmung der unterschiedlich verfügbaren P-Fraktionen im Mineralboden wurden in unserer Studie stattdessen die sequentielle Extraktionsmethode nach Hedley verwendet. Mit dieser Methode konnten insgesamt elf organische und anorganische P-Fraktionen bestimmt werden. Wir untersuchten mit unserem Probenkollektiv die Zusammenhänge zwischen den P-Gehalten einzelner P-Pools und -Fraktionen und verschiedenen Bodeneigenschaften sowie mit der Ernährungssituation von Waldbäumen. Insgesamt wurden 285 Bodenproben (0-5 und 10-30 cm Tiefe) von 146 BZE Standorten un-tersucht. Die Gesamt P-Gehalte reichten dabei von knapp 60 mg kg-1 bis über 2700 mg kg-1. Mit zunehmender Bodentiefe konnten wir eine Abnahme der P-Gesamtvorräte, insbesondere der labilen sowie der organischen P-Fraktionen beobachten. Während der moderat-labile P- Pool mit zunehmender Tiefe mit rund 50% nahezu konstant blieb, ging der labile P-Pool von 27 auf 15% zurück. Der Anteil des stabilen P-Pools stieg von 21 auf 30 %. Wir fanden bei hohen pH-Werten im Boden die höchsten P-Gehalte, bei niedrigem pH-Wert die niedrigsten P-Gehalte. Während der labile P-Pool mit zunehmender Acidität des Bodens ebenfalls zunahm, ging der Anteil des stabilen P-Pools sowohl absolut als auch relativ zurück. Zudem haben auch der Kohlestoff- und Stickstoffgehalt sowie die Textur Einfluss auf die P-Fraktionen im Boden. Die mobilste P-Fraktion im Mineralboden wies interessanterweise den schwächsten Zusammenhang mit der P-Versorgung der Bäume auf. Die stärksten Zusammenhänge zwischen P-Ernährung und P-Mineralbodenvorräte fanden sich für den anorganischen P-Pool und hier insbesondere für moderat-labile P-Fraktionen. Bei Standorten mit geringen P- Gesamtgehalten im Mineralboden beobachteten wir deutlich stärkere Zusammenhänge zwischen den P-Fraktionen unterschiedlicher Pflanzenverfügbarkeit im Boden und der P-Ernährung des Bestandes. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine differenziertere Betrachtung der P-Vorräte im Mineralboden für die P-Versorgung von Waldbäumen notwendig ist, da diese stark von den anorganischen und hier insbesondere auch von den moderat-labilen P-Fraktionen beeinflusst wird.
Vorträge Session 23: Forstliche Großrauminventuren als Impulsgeber für die Waldb... 136
WEHAM im Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Holzverwendung
Katja Oehmichen1, Kristin Gerber1, Susann Klatt1
1Thünen-Institut für Waldökosysteme, Alfred-Möller-Str. 1, 16225 Eberswalde, [email protected]
Schlagworte: WEHAM, Modellierung, BWI, Szenarien
Die Anpassung der Wälder und deren Nutzung an die Folgen des Klimawandels, die Ausrichtung der Waldbehandlung an Biodiversitäts- und Naturschutzziele aber auch die CO2-Minderungspotenziale von Wald und Holzverwendung zum Klimaschutz sind Kernpunkte der Waldpolitik. Eine bedeutende Informationsquelle und Entscheidungshilfe für die zukünftige Waldentwicklung und die Wirkungen von Waldbehandlung und Holzverwendung sind die Bundeswaldinventur (BWI) und die darauf aufbauende Waldentwicklungs- und Holzaufkommensmodellierung (WEHAM). WEHAM ist ein Waldwachstums- und Waldbehandlungssimulator, basierend auf einem empirischen abstandsunabhängigen Einzelbaumwuchsmodell mit integriertem Rohholz-Sortierungsmodell. Im Rahmen des vom Waldklimafonds geförderten Projektes „ EHAM-Szenarien“ werden unter Beteiligung von Interessenvertreter aus Politik, Verwaltungen, Verbänden und Wirtschaft mit WEHAM verschiedene Szenarien entwickelt, die unterschiedliche Waldbehandlungsmöglichkeiten und deren Auswirkung auf die Waldstruktur und das Rohholzaufkommen für die nächsten 40 Jahre simulieren. Im Vordergrund stehen drei alternative Szenarien: das Fortschreibungsszenario, das Holzpräferenzszenario und das Waldnaturschutzszenario. Die Szenarienentwicklung umfasst den Weg von den Eingangsdaten über die jeweilige Zielstellung bis hin zum Ergebnis für den Zeitraum von 2012 bis 2052. Dabei werden über verschiedene Steuerparameter der Waldbewirtschaftung, wie beispielsweise Eingriffsart, Eingriffsintervall, Zielstärke, die entsprechenden Handlungsempfehlungen umgesetzt. Über einen iterativen Prozess werden die Steuergrößen angepasst, um eine optimale waldbauliche Behandlung in Hinblick auf die Zielgrößen, wie Entwicklung von Laub- und Nadelholzanteil, Holzvorrat, Habitatbäume, Totholzvorrat, für die Zukunft zu projizieren. Dabei steht beim Fortschreibungsszenario die Fortschreibung sämtlicher Waldbehandlungstrends zwischen der BWI 2002 und der BWI 2012 im Fokus der Untersuchungen. Beim Holzpräferenzszenario wird auf eine verstärkte Nutzung des Rohstoffes Holz abgezielt und beim Waldnaturschutzszenario stehen der Erhalt und die Förderung der Biodiversität im Wald im Mittelpunkt. Um diese komplexen Anforderungen zu erfüllen, sind neue Ansätze und Lösungen der Modellierung mit WEHAM gefragt.
Vorträge Session 23: Forstliche Großrauminventuren als Impulsgeber für die Waldb... 137
Wie wirken sich Naturschutzvorgaben auf das Nutzungspotenzial an Waldenergieholz aus? Ergebnisse für Deutschland sowie drei
Modellgebiete in BY, BB und NRW
Andreas Rothe1, Stefan Wittkopft1 und Matthias Wilnhammer1
1Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Fakultät Wald und Forstwirtschaft, Hans-Carl-von Carlowitz-Platz 3, D-85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Waldenergieholz, Nutzungspotenzial, Biodiversität, BWI
Im Rahmen des vom Bundesamt für Naturschutz geförderten Projektes "Energiewende und Waldbiodiversität" (Laufzeit 2012-2015) wurden Nutzungspotenziale für Waldenergieholz hergeleitet. Die Abschätzungen erfolgten für das gesamte Bundesgebiet sowie für drei Bioenergieregionen mit unterschiedlichen Waldtypen (Bayerisches Oberland: Fichte, Kultur Landkreis Höxter, NRW: Buche, Märkisches Oderland, BB: Kiefer). Datengrundlage waren auf Bundesebene im Wesentlichen BWI-Daten, in den Modellregionen wurden im Privatwald zusätzlich umfangreiche Befragungen (insgesamt 520 Waldbesitzer) durchgeführt. Die Herleitung der Potenziale erfolgte nach Wilnhammer et al. (Biomass Bioenergy 2012; 47:177-87) in einem dreistufigen Verfahren. Im ersten Schritt wurde der Gesamtzuwachs an oberirdischer Biomasse berechnet, anschließend durch Abzug von Nutzungseinschränkungen (Naturschutzflächen, Erschließung, Totholznachlieferung, Nährstoffnachhaltigkeit) das technisch-ökologisches Potenzial ("nutzbarer Zuwachs") hergeleitet. Unter Berücksichtigung der Sortenaufteilung erfolgte dann die Abschätzung des Nutzungspotenzials an Wald-energieholz Die Herleitung der Waldenergieholzpotenziale erfolgte für die aktuell praktizierte Wald-bewirtschaftung. Anschließend wurden zwei Szenarien berechnet, wie sich erhöhte Naturschutzvorgaben (insbesondere Totholzziele, Verzicht auf Kronennutzung, Flächen-stilllegung) auf das Nutzungspotenzial auswirken.
Vorträge Session 23: Forstliche Großrauminventuren als Impulsgeber für die Waldb... 138
Spatial valuation of timber provisioning in Finnish forests
Valentin Stefan, A. Talkari, C. Ammer, C. Cremer, Jan-Peter Mund1 1 HNE Eberswalde, Alfred-Möller-Str. 1, 16225 Eberswalde, [email protected] Key words: timber spatial valuation, net present value, equal annual equivalent, forest profitability map, ecosystem services, forest growth modelling, yield functions The EU 2020 Biodiversity Strategy, in addition to mapping and assessing the state of ecosystems and their services by 2014, also required the Member States to assess the economic value of such services by 2020 in a countrywide approach. Forest ecosystems provide several tangible and intangible benefits to humankind. Unfortunately, such vital benefits are usually ignored by policy makers since they lack monetary value and are not perceived as commodities. However, wood is usually a tangible good that can be bought in markets for a certain price. A case study was conducted across Finnish forests in order to address the need of spatially valuating timber provisioning. A geostatistical approach making use of published, very detailed national forest inventory data was explored for estimating and mapping the net present values of Finnish forests. The equal annual equivalent was calculated and mapped with 100×100 m spatial resolution. Forest growth was approximated in three ways using typical yield functions, with the EFISCEN inventory database and applying MOTTI forest stands simulator. Given the default MOTTI management guidelines, four main groups of species within sixteen different site conditions were considered for this appraisal. In addition a regional valuation of carbon sequestration by the accumulation of biomass was considered and estimated. At a discount rate of one per cent, the net present value of finish pine forest stands reached a maximum of 8,920 € ha-1 with an annual equivalent of 243 € ha-1year-1. For the spruce stands, the maximum net present value was 12,355 € ha-1 with an annual equivalent of 293 € h-1 year-
1. Birch and other broad-leaved species were less profitable. At a discount rate of five per cent, most of the forests were unprofitable except for certain pine and spruce stands on fertile southern mineral soils. The presented results indicate that the choice of both the yield estimation method and the management scenario can significantly impact profitability predictions, particularly at low discount rates and on fertile sites. However, this study does not suggest that less profitable or unprofitable forest stands are not valuable.
Vorträge Session 23: Forstliche Großrauminventuren als Impulsgeber für die Waldb... 139
Ein Umweltvektor für die BWI – Das Projekt „Waldproduktivität – Kohlenstoffspeicherung – Klimawandel“ (WPKSKW)
Tobias Mette1, Raphael Benning2, Rainer Petzold2, Dietmar Zirlewagen3, Heike
Puhlmann4, Klaus von Wilpert4, Arno Röder4, Thilo Wolf4, Gerald Kändler4, Jürgen Böhner5, Paul Schmidt-Walter6, Henning Meesenburg6, Christian Kölling7
1LWF, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected] 2Staatsbetrieb Sachsenforst, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna OT Graupa, [email protected], [email protected] 3Interra, St.-Peter-Str. 30, D-79341 Kenzingen, [email protected] 4FVA-BW, Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 5Uni Hamburg, Physische Geographie, Bundesstr. 55, 20146 Hamburg, [email protected] 6NW-FVA, Grätzelstr. 2, 37079 Göttingen, [email protected], [email protected] 7AELF Roth, Johann-Strauß-Str. 1, 91154 Roth, [email protected]
Schlagworte: Bundeswaldinventur, Bodendaten, Klimadaten, Standortleistung
Seit Anfang 2014 arbeiten insgesamt zwölf Projektpartner aus ganz Deutschland in dem vom aldklimafonds geförderten Verbundprojekt „ aldproduktivität – Kohlenstoffspeicherung – Klimawandel“ zusammen. Ziel ist es, eine umfassende Datenbasis und methodische Grundlagen zur Beantwortung der Frage zu schaffen: „ ie wirkt sich der Klimawandel auf die Produktivität und Kohlenstoffspeicherung unserer älder aus?“ Ein wesentliches Teilziel ist die Erstellung eines Umweltvektors zur BWI, d.h. einer Datenbank mit hochqualitativen Standortsdaten zu Klima und Boden. An insgesamt 26450 Traktecken (4 km x 4 km Raster) werden der BWI Bodendaten zugeordnet: einerseits in Form von Standorts- bzw. Bodeneinheiten zugehörigen Leitprofilen, andererseits in Form von Bodeneigenschaften, die über digital soil mapping mittels topographischer, geologischer u.a. Kovariablen berechnet werden. Klimadaten liegen für jeden Punkt in retrospektiver Regionalisierung von 1961-2013 vor und werden für drei RCP-Szenarien statistisch bzw. dynamisch von 2011-2050 bzw. 2011-2100 aufbereitet (8 Parameter in täglicher Auflösung). Zusätzlich wird das Modell LWF-BROOK90 verwendet, um aus Klima- und Bodendaten den Wasserhaushalt für repräsentative Standard-Bestände zu rechnen. In Kombination mit realen Vorkommens- und Produktivitätsdaten europäischer Waldinventuren lassen sich daraus potentielle Art- und Wachstumsspektren unter zukünftigen Klimabedingungen aufzeigen.
Vorträge Session 23: Forstliche Großrauminventuren als Impulsgeber für die Waldb... 140
Trade-offs between climate change adaptation and mitigation objectives for forests in Germany
Somidh Saha1 and Jürgen Bauhus1
1Chair of Silviculture, Institute of Forest Sciences, Albert Ludwigs University of Freiburg, Tennebacherstr. 4, D-79106 Freiburg, Germany, [email protected]
Schlagworte: German Forest Inventory, biomass, species diversity, structural diversity
The carbon stocks in German forests are at a historically high level. Yet, there are demands to store more carbon in forests as a climate change mitigation strategy. It is also generally agreed that species and structural diversity of forests should be increased to improve their resistance, resilience and adaptability in the face of climate change. However, these different goals of climate change mitigation and adaptation may not always be compatible. Important trade-offs may exist, if the conditions that maximize biomass do not support high levels of species and structural diversity. Here, we aimed to quantify achievements and trade-offs between the mitigation (i.e. standing biomass, biomass increment) and adaptation objectives (i.e. structural and species diversity) for a wide range of forest types. For example, the achievement for an objective at a given inventory plot was quantified as the relative deviation from the mean for a given forest type. The trade-off for one objective was defined as the standardized difference from the overall achievements of all objectives for that forest type. We synthesized long-term data from the national German forest inventories to capture the changes in trade-offs between the management objectives over space and time by performing Bayesian generalized linear mixed models. Achievements and trade-offs between objectives were influenced by harvesting intensity, forest composition, tree size, and species identity. Mixed forests had higher achievements in species diversity but also high trade-offs between diversity and stand biomass. In contrast, forests dominated by a single species showed the opposite trend. Achievements in structural diversity increased with average tree size, however, the influence of tree size on achievements in biomass and species diversity varied between tree species and harvesting intensity. We show for the first time, that significant trade-offs exist between climate change adaptation and mitigation through ecosystem-based C storage objectives for German forests.
Vorträge Session 23: Forstliche Großrauminventuren als Impulsgeber für die Waldb... 141
Treibhausgasberichterstattung – Nutznießer der Großrauminventuren
Wolfgang Stümer1, Johannes Brötz1 und Karsten Dunger1
1Thünen-Institut für Waldökosysteme, Alfred-Möller-Str. 1, 16225 Eberswalde, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Treibhausgas, Klimaberichterstattung, Kohlenstoff, Inventuren
Der Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) beinhaltet sowohl wichtige Speicher für Kohlenstoff, beispielsweise in Wäldern, als auch bedeutende andere Treibhausgasemissionen (Methan und Stickstoff), die bei der Bewirtschaftung des Sektors entstehen, z.B. aus organischen Böden. Veränderungen der Landnutzung, also natürliche Vorgänge und menschliche Einflüsse, können die Speicherleistungen und Emissionsmengen beeinflussen. Um diese Beeinflussungen zu quantifizieren und damit auch internationalen Übereinkommen gerecht zu werden, hat sich Deutschland verpflichtet seine Treibhausgasemissionen zu berichten und im Rahmen des Kyoto-Protokolls (KP) zu reduzieren. Dabei spielen gerade Aufforstung und Entwaldung (Artikel 3.3 KP) sowie Waldbewirtschaftung (Artikel 3.4 KP) eine große Rolle und werden auf die deutschen Reduktionsverpflichtung angerechnet. Die Grundlage für die Anrechnung sind detaillierte und vollständige jährliche Treibhausgasinventare. Die Treibhausgasberichterstattung folgt dabei international verbindlichen Vorschriften und Regelwerken (vgl. IPCC), die fortlaufend überarbeitet und weiterentwickelt werden. Um den politischen Anforderungen und Vorgaben gerecht zu werden, sind entsprechende Daten für Deutschland notwendig. Für den Waldbereich kommen diese für Biomasse und Totholz aus den Bundeswaldinventuren und für den Boden aus den Bodenzustandserhebungen. Um für wichtige Zeitpunkte, beispielsweise zum Beginn der ersten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls, detaillierte Kohlenstoffwerte zu haben, wurde dafür 2008 die Inventurstudie durchgeführt und für 2017/2018 eine Kohlenstoffinventur geplant. Detaillierte und vollständige Angaben über diesen Prozess werden in jährlichen Treibhausgasinventaren bereitgestellt. Der Vortrag soll das Verfahren, die Ergebnisse und aktuelle Probleme in der deutschen Treibhausgasberichterstattung im LULUCF Sektor widerspiegeln. Ein Schwerpunkt werden die verwendeten Inventurdaten und die dazu entwickelten Auswertemethoden sein.
Vorträge Session 23: Forstliche Großrauminventuren als Impulsgeber für die Waldb... 142
Titel: Wiederholungsaufnahmen im Schweizerischen Landesforstinventar - ein Instrument zur Qualitätssicherung
Berthold Traub1, Fabrizio Cioldi1 und Christoph Düggelin1
1Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Birmensdorferstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Nationale Forstinventur, Qualitätssicherung, Beobachterübereinstimmung, Reproduzierbarkeit
Der Vortrag zeigt die Methode und Ergebnisse der systematisch durchgeführten Wiederholungsaufnahmen des Schweizerischen Landesforstinventars (LFI). Im Rahmen dieser sogenannten ‚Zweitaufnahmen‘ werden ca. 10% der terrestrischen Probeflächen des LFI durch unabhängige Feldteams ein zweites Mal vollständig erhoben. Diese Wiederholungsmessungen leisten neben themenspezifisch ausgerichteten Kontrollaufnahmen, einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung der Felderhebungen und können insbesondere zeigen, wie gut sich die Erfassung der Probeflächenmerkmale reproduzieren lassen. Aktuelle Ergebnisse der Wiederholungsmessung verschiedener Baum- und Bestandesmerkmale aus dem LFI 2009/2017 zeigen eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Erst- und Wiederholungsaufnahmen. Ebenfalls positiv hat sich die, in 2009 vollzogene Umstellung von periodischen zu kontinuierlichen Felderhebungen auf die Reproduzierbarkeit der Merkmale ausgewirkt. Vergleiche aktueller Ergebnisse mit denen des vorangegangenen LFI 2004/2006 zeigen bis auf wenige Ausnahmen eine tendenzielle Verbesserung für die untersuchten Merkmale. Analysiert wurden die Ergebnisse messbarer Merkmale wie Brusthöhendurchmesser, Brusthöhenumfang, Durchmesser in sieben Meter Höhe sowie die Baumhöhe. Ebenfalls geprüft wurden Bestandesmerkmale wie Mischungsgrad, Bestandesstabilität, Entwicklungsstufe, Bestandesalter, Schlussgrad und Schichtzugehörigkeit, die auf Einschätzungen der Feldteams beruhen. Untersucht wurde auch inwiefern sich die Erfassung der Präsenz von Gehölzarten reproduzieren lässt. Für die statistische Analyse der Übereinstimmung aus den regulären und den Wiederholungsaufnahmen wurde die Korrelation beziehungsweise Konkordanz der beiden Ergebnisse anhand von Korrelationskoeffizienten und dem Cohen’s Kappa beurteilt. Für die Erkennung systematischer Unterschiede wurden verschiedene Signifikanztests verwendet. Eine wesentliche Rolle spielt auch die visuelle Beurteilung der Verteilung der Differenzen aus beiden Messungen. Neben der Präsentation der wichtigsten Ergebnisse aus den Widerholungsaufnahmen wird in diesem Vortrag diskutiert, welche Vor- und Nachteile mit der aktuellen Form der Organisation dieser Messungen verbunden sind und welche möglichen Veränderungen diesbezüglich im LFI diskutiert werden. In diesem Zusammenhang wird auch die zukünftige Verwendung von Daten aus Kontrollaufnahmen besprochen, die zur Erkennung von systematischen Abweichungen wichtig sind.
Vorträge Session 23: Forstliche Großrauminventuren als Impulsgeber für die Waldb... 143
Die Bundeswaldinventur als Datengrundlage für ein Monitoring von Waldbiodiversität
Judith Reise1, Florian Kukulka1 und Susanne Winter1
1 Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Alfred-Möller-Str. 1 16225 Eberswalde, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: andom Forest, Simpson’s Index, Naturschutz-Offensive 2020
Im Jahr 2007 beschloss das Bundeskabinett die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt (NBS). Darin werden Ziele für den Erhalt, die Verbesserung und nachhaltige Nutzung der Biodiversität in Deutschland formuliert. Ein Indikatorenbericht des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) gibt regelmäßig Auskunft über den Grad der Zielerreichung der NBS für die Komponenten der biologischen Vielfalt. Der im Februar 2015 erschienene „Indikatorenbericht 2014“ zeigt, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Erreichung der NBS-Ziele bis 2020 nicht ausreichend sind. Beispielsweise stagniert der Zielerreichungswert für die Wälder in Deutschland bereits seit vielen Jahren und liegt laut aktuellem Bericht bei rund 76 Prozent. Als Reaktion darauf legte das BMUB im Oktober 2015 einen Handlungsplan, die „Naturschutz-Offensive 2020“, vor, um die Ziele der NBS bis zum Jahr 2020 verwirklichen zu können. Zu den Maßnahmen zählt auch die Einführung eines bundesweiten Biodiversitätsmonitorings. Die Bundeswaldinventur ist bereits ein im Gesetz festgeschriebenes und regelmäßig stattfindendes Monitoring bei dem biodiversitätsrelevante Merkmale, wie Bestockungsalter, Bestockungsaufbau, Totholz und einige Sonderstrukturen, wie Spechthöhlen und Käferbohrlöcher erfasst werden. Darüber hinaus werden über das gesamte Bundesgebiet Daten zur Verbreitung der für den Wald typischen Brutvögel durch den Dachverband Deutscher Avifaunisten aufgenommen. Im Rahmen der Natura 2000-Richtlinie stehen ebenfalls deutschlandweite Verbreitungsdaten zu weiteren bedeutenden Waldtierartengruppen, wie den Fledermäusen, zur Verfügung. Auf Grundlage dieser Daten wird gezeigt, inwieweit die Daten der Bundeswaldinventur die Verbreitung verschiedener Artengruppen erklären können. Dadurch werden Möglichkeiten für die Verwendung der Daten der Bundeswaldinventur für ein nationales Waldbiodiversitätsmonitoring aufgezeigt werden.
Vorträge Session 24: Die Evidenzbasis der naturgemäßen Waldwirtschaft 144
Naturnahe und naturferne Elemente der naturgemäßen Waldwirtschaft: Erkenntnisse aus Urwalduntersuchungen
Peter Meyer1 und Peter Brang2
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Grätzelstr. 2, 37079 Göttingen, [email protected] 2Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf, Schweiz, [email protected]
Schlagworte: Naturnähe, Naturgemäße Waldwirtschaft, Urwald, Störungsregime
Unter naturgemäßer Waldwirtschaft werden Waldbehandlungskonzepte zusammengefasst, die als Gegenentwurf zu einer vorwiegend auf altersgleichen Reinbeständen und dem Nadelholzanbau beruhenden Forstwirtschaft entwickelt worden sind. Während die letztgenannte „geregelte“ Forstwirtschaft explizit auf Naturwissenschaft und Technik aufbaute, gründet sich die naturgemäße Waldwirtschaft auf individuelle Anschauung, Erfahrungswissen und Intuition. Urwälder spielten zwar als Bezug von Beginn an eine zentrale Rolle, naturgemäße Waldbewirtschaftungskonzepte wurden jedoch nur ausnahmsweise auf einer naturwissenschaftlich-ökologischen Grundlage entwickelt. Der historisch gewachsene Begriff naturgemäße Waldwirtschaft wird häufig mit naturnaher Waldwirtschaft gleichgesetzt. Hierdurch ergibt sich eine Verbindung zu den Begriffen Naturnähe und Hemerobie. Diese umfassen heute ein weites naturschutzfachliches Bedeutungsfeld, das das Selbstverständnis naturnaher Waldwirtschaft zunehmend beeinflusst. Die folgenden Prinzipien und Leitbilder sind für die naturgemäßer Waldwirtschaft charakteristisch: standortgemäße Baumartenwahl, Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel, angepasste Schalenwildbestände, natürliche Verjüngung des Waldes, kleinräumige, vorwiegend einzelstammweise Nutzungen bei optimaler Wertentwicklung des Einzelbaumes, Bevorzugung von Mischbeständen, großer vertikaler und horizontaler Strukturreichtum, mehr oder weniger dauerhafte Bestockung mit erntereifen Bäumen, Gleichmaß der Nutzungen (Stetigkeit). Viele dieser Merkmale weisen Analogien zu Old-Growth-Wäldern auf, wie sie in Naturräumen mit einem Regime kleinräumiger Störungen natürlicherweise entstehen. Anhand von Untersuchungen in Urwäldern und Naturwaldreservaten zeigen wir jedoch, dass die naturgemäße Waldwirtschaft ebenfalls naturferne Prinzipien verfolgt bzw. Merkmale besitzt: Aushieb von Bäumen geringer Holzqualität Anreicherung der Waldbestände mit nicht standortheimischen Mischbaumarten Einengung des Störungsregimes auf regelmäßige, kleinräumige Eingriffe Unterdrückung/Ausschluss anderer Störungsarten als der Baumentnahme weitgehender Ausschluss der Baumalterung über den Erntezeitpunkt hinaus geringe Menge an Totholz Abschließend diskutieren wir die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung naturnaher Waldwirtschaft auf einer naturwissenschaftlich-ökologischen Grundlage vor dem Hintergrund sich rapide ändernder Umweltbedingungen durch Klimawandel und Nährstoffeinträge.
Vorträge Session 24: Die Evidenzbasis der naturgemäßen Waldwirtschaft
145
Biodiversität schlagweiser und schlagfreier Buchenwälder im Vergleich
Peter Schall1, Christian Ammer2
1Abteilung Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen, Georg-August-Universität Göttingen, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Betriebsformen, Alpha-, Beta, Gamma-Diversität, Komplementarität, Exklusive Arten
Im Rahmen der Biodiversitätsexploratorien der DFG wurden schlagweise bewirtschaftete Wälder im Hainich (aus Schirmschlag hervorgegangene Buchenaltersklassenwälder in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, insgesamt 17 Fläche mit jeweils 1 ha Größe) und Buchenplenterwälder (insgesamt 13 Flächen mit ebenfalls jeweils 1 ha Größe) hinsichtlich ihrer Artenausstattung vergleichend untersucht. Erfasst wurden Arten von 15 Taxa. Diese reichten von Bakterien, über Pilze (Totholzpilze, Mykorrhiza), Moose, Flechten, Gefäßpflanzen, Käfer, Spinnen, Hautflügler, Netzflügler, Weberknechten, Wanzen, Fledermäusen, bis zu Vögeln. ir untersuchten für die beiden Betriebsformen α-, β- und γ -Diversität, Komplementarität und das Vorhandensein exklusiver Arten für die Taxa und die Untergruppe der aldspezialisten. ie sich zeigte, waren sowohl die β- und γ-Diversität als auch der Anteil exklusiver Arten im schlagweisen Hochwald über nahezu alle Artengruppen hinweg tendenziell oder signifikant höher als im Plenterwald, während die α-Diversität keine Unterschiede aufwies. Dieser Befund bestätigte sich auch für die Waldspezialisten. Eine Komplementarität des Arteninventars zwischen schlagweisem Hochwald und Plenterwald konnte nicht festgestellt werden. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Heterogenität von Waldstrukturen auf der Landschaftsebene für die Artenvielfalt bedeutsamer ist, als die Heterogenität der Bestandesstruktur auf kleiner Fläche. Vermutlich bieten auf kleiner Fläche heterogene, auf Landschaftsebene aber vergleichsweise homogene Bewirtschaftungssysteme nicht den für eine hohe Artenvielfalt erforderlichen Nischenreichtum. Für die Praxis naturgemäß arbeitender Betriebe ergibt sich aus den Befunden die Notwendigkeit zu größeren Bestandesöffnungen, sofern die Erhöhung der Biodiversität ein Bewirtschaftungsziel darstellt.
Vorträge Session 24: Die Evidenzbasis der naturgemäßen Waldwirtschaft 146
Analyse waldbaulicher Alternativen zur Kahlschlagswirtschaft: Forschungslücken mit Blick auf die bio-ökonomische Modellierung
Thomas Knoke1, Katharina Messerer1
1Technische Universität München, Wissenschaftszentrum für Ernährung, Landnutzung und Umwelt Weihenstephan, Fachgebiet für Waldinventur und nachhaltige Nutzung, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, 85354 Freising [email protected]
Schlagworte: Ökonomische Optimierung, Klimawandel, Unsicherheit
Altersklassenwirtschaft und Kahlschlag bilden weltweit vielerorts den Standard für das wald-bauliche Vorgehen. Allerdings zeigen moderne bio-ökonomische Ansätze, beispielsweise aus Skandinavien, dass Alternativen ohne Kahlschlag eine bessere ökonomische Option darstellen können. Auch diese Modelle haben jedoch ihre Probleme, da sie bisher noch nicht an komplexe Waldaufbauformen angepasst wurden und zudem vollständige Informationen über die Zukunft voraussetzen. Der Vortrag deckt daher Forschungsbedarf zu existierenden bio-ökonomischen Modellen auf, z.B. im Hinblick auf ein sich änderndes Klima und sich verändernde Wachstumsverhältnisse sowie die Robustheit von Optimierungsverfahren. Der Vortrag adressiert zwei übergeordnete Fragestellungen: 1. Wie beeinflussen neue Informationen zur Überlebenswahrscheinlichkeit in einem sich wandelnden Klima und zum Wachstum der Bäume die ökonomische Bewertung von waldbaulichen Alternativen? 2. Wie kann die Robustheit der gefundenen Lösungen bei unvollkommenen Eingangsinformationen verbessert werden?
Vorträge Session 24: Die Evidenzbasis der naturgemäßen Waldwirtschaft
147
ReSynatWald – Ein Referenzflächen-System naturnaher Waldbewirtschaftung in Österreich
Georg Frank1, Janine Oettel1, Sebastian Lipp1, Herfried Steiner1, Eckart Senitza²
1 Bundesforschungszentrum für Wald, Seckendorff-Gudent-Weg 8, A-1131 Wien, [email protected] 2 Forstbetrieb Gut Poitschach, Ingenieurbüro Waldplan, Poitschach 2, A-9560 Feldkirchen, [email protected]
Schlagworte: Referenzflächen, Dauerwald, best practice
In Österreich gibt es im Dauerwald bis auf wenige Ausnahmen keine systematisch angelegten und auf langfristige waldbauliche Untersuchungen ausgerichteten Versuchsflächen. Durch das Projekt ReSynatWald sollen in erster Linie die Voraussetzungen geschaffen werden, geeignete Referenzbestände zu identifizieren, einzurichten und zu dokumentieren. In weiterer Folge sollen diese als Langzeit-Monitoringflächen genutzt werden. Bisher angelegte Dauerversuchsflächen zeigen, dass derartige Referenz- und Forschungsflächen mit zunehmendem Fortbestand an wissenschaftlichem Wert gewinnen. Es werden Bestände ausgewählt, die bereits nach den Grundsätzen naturnaher Waldwirtschaft behandelt werden, es soll bewusst nicht mit der „Stunde Null“ begonnen werden. Im Zuge der Ersterfassung werden Kennzahlen der Bestandesstruktur, der Verjüngung, der Sortiments- und Qualitätsverteilung aber auch ökologische Merkmale wie Totholzvorräte und Habitatstrukturen erhoben. Wichtig ist, dass die Bewirtschaftung der Flächen von den Waldbesitzern ohne Beeinflussung durch das Projekt erfolgt. In den Referenz-Beständen werden nicht nur Waldwachstums-Parameter erhoben, die Waldbesitzer verpflichten sich auch zu regelmäßigen standardisierten Aufzeichnungen über durchgeführte Nutzungen, Aufwände und Erträge, um langfristige ökonomische Kenndaten über die Art der Bewirtschaftung generieren zu können. Mittelfristig können so die wirtschaftlichen Vorteile des kahlschlagfreien Dauerwaldes erfasst werden. Die Auswahl der „best practice“ – Betriebe erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Pro Silva Austria. Dabei kann aus einer Vielzahl von Mitgliedsbetrieben geschöpft werden. Ein großer Vorteil liegt darin, dass die Betriebe Ihrerseits großes Interesse an den Versuchseinrichtungen haben. Sie können diese für Ihre interne Erfolgskontrolle, aber auch als handfeste Beispiele für Exkursionen nutzen. In einigen Fällen ist auch vorgesehen, diese Flächen für Schulungen und Auszeigeübungen zu verwenden. Um mittel- und langfristige Vergleiche sicherzustellen, muss die Kompatibilität mit Pro Silva Europa Vergleichsflächen und den Monitoring-Einrichtungen des Österreichischen Naturwaldreservate-Programmes sichergestellt werden.
Vorträge Session 24: Die Evidenzbasis der naturgemäßen Waldwirtschaft 148
Welche Evidenz die naturgemäße Waldwirtschaft zeigt und ggf. nötig hätte – das Beispiel der Buchenplenterwälder im Hainich
Dirk Fritzlar1
1ThüringenForst, Forstamt Hainich-Werratal, Bahnhofstr. 76, 99831 Creuzburg, [email protected]
Schlagworte: Buchenplenterwald, Ökonomie, Ökologie, Forschungsbedarf
Im Hainich, einem Muschelkalkhöhenzug am Rande des Thüringer Beckens stocken auf großer Fläche ungleichaltrige Buchen- und Buchenmischbestände. Sie gelten als Beispiel einer echten Plenterung. Entstanden vor 150 – 200 Jahren aus mittelwaldartigen Bestockungen sind sie fast ausnahmslos in Besitz altrechtlicher Waldgenossenschaften mit ideellen Anteilen. Am Beispiel von drei Waldgenossenschaften im Forstrevier Langula mit insgesamt 1.199 ha (dav. 1.077 ha Plenterwald) werden die Entstehung und die Bewirtschaftung dieser Wälder vorgestellt. Eine 1994 angelegte Stichprobeninventur mit zwei Wiederholungen liefert dabei hervorragende Einblicke in die jüngere Bestandesentwicklung und in Schlüsselfragen des Plentergleichgewichts. Eine Betrachtung der Betriebsergebnisse von Waldgenossenschaften aus der Hainichregion, welche in einer Größenordnung von 150 – 400 €/a/ha liegen, zeigt die wirtschaftliche Stärke dieser Wirtschaftsweise. Die Betriebsergebnisse steigen dabei mit dem Anteil von sonstigen (Laub-)Mischbaumarten insbesondere von Edellaubhölzern. Basis dieser guten Betriebsergebnisse sind die permanente Starkholzernte bei vergleichsweise auskömmlichen Holzerntekosten auf der einen Seite und die biologische Automation bei Walderneuerung und Waldpflege auf der anderen Seite. Auch das Betriebsrisiko dieser Forstbetriebe kann als sehr überschaubar eingeschätzt werden. Nennenswerte biotische oder abiotische Schadereignisse sind selbst bei langfristiger Betrachtung nicht eingetreten. Eine wesentliche Voraussetzung für diese Wirtschaftsweise ist qualifiziertes Personal sowohl im Bereich des forsttechnischen Betriebs als auch im Bereich der Holzernte/Waldpflege. Einblicke in die ökologische Wertigkeit dieser Wälder zeigen Untersuchungen zur Biodiversität im ahmen des Forschungsprojektes „Biodiversitätsexloratorien“. Hierbei sind vergleichende Betrachtungen mit langjährig unbewirtschafteten Wäldern im Nationalpark Hainich und mit Altersklassenwäldern der Region besonders interessant. So zeigten Untersuchungen von BOCH im Bereich der Pflanzen, Moose und Farne, dass der Buchenplenterwald in diesem Vergleich insgesamt über die größte Artenvielfalt verfügt (WEISSER/KLEINN 2015). Forschungsbedarf besteht u.a. in folgenden Bereichen: Modellierung von Waldwachstumsprozessen im Buchenplenterwald; Grenzen der biologischen Automation; Mechanisierungsmöglichkeiten bei der Starkholzernte im Laubholz sowie betriebswirtschaftliche Vergleiche mit anderen Bewirtschaftungsformen.
Vorträge Session 24: Die Evidenzbasis der naturgemäßen Waldwirtschaft
149
Geht doch, mit links!
Eckart Senitza1, Georg Frank2
1Vors. Pro Silva Austria, vicepres. Pro Silva Europe, Forstbetrieb Gut Poitschach, Ingenieurbüro Waldplan, Poitschach 2, 9560 – Feldkirchen i.K., Österreich, [email protected] 2BFW - Bundesforschungszentrum für Wald, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1130 – Wien, Österreich, [email protected]
Schlagworte: Forschungsbedarf, Dauerwald, Kommunikation, Interdisziplinarität
„Linking practice, science and educational outreach“ - Tagungsthema von Pro Silva Europe 2009 - hat seither nichts von seiner brennenden Aktualität eingebüßt. Pro Silva sieht sich als Katalysator um diesen Prozess in Gang zu halten. Wissenschaft hat eine Eigendynamik entwickelt, die oft viel zu wenig Zeit lässt, die Erkenntnisse auch in die Praxis zu bringen oder auch den Fragen der Praxis zu antworten. Interdisziplinäre Ansätze sind gefordert. Die Eckpunkte und offenen Fragen für erfolgreiche naturnahe Waldbewirtschaftung lassen sich zusammenfassen: Verjüngung inkl. der genetischen Aspekte – auch unter dem Blickwinkel des
Klimawandels – braucht Verbesserungen der Wald-Wildsituation und Werkzeuge einer objektiven Erfassung des Wildeinflusses auch für kleine Flächeneinheiten.
Wie viele und welche Pflegeeingriffe werden gebraucht zur Unterstützung der natürlichen Differenzierung, lokal und an die Waldgesellschaft angepasst und ökonomisch optimiert?
Optimierung von Erziehungseffekten zur Qualitätsentwicklung und Dimensionierung ? Zuwachs in der Reifephase bei unterschiedlicher Konkurrenz – Gibt es geeignete
Überführungsmodelle ? – Kann das Ziel ohne „Strukturopfer“ erreicht werden? Erntetechnik in Naturverjüngung erfordert Spezialkenntnisse und gute Ausbildung. –
Analysen von Erntekosten und optimiertem Arbeitsfluss sind nötig. Vermarktung von Spezialsortimenten setzt eine gepflegte Abnehmerstruktur voraus,
Ausformung und Abfuhr brauchen geschultes Fachpersonal. Nachhaltigkeitsregulation erfordert Konzepte mit Standortsbetriebsklassen und
Wachstumssimulatoren. Doch bieten diese geeignete Eingangsparameter, um differen-zierte Behandlungsvarianten abzubilden?
Ein Referenzflächen-System zur Quantifizierung naturnaher Waldbaumethoden, also Beispiele von „best practice“ wird in Österreich gerade eingerichtet. Biometrische, ökonomische und ökologische Aspekte werden in einer Zusammenschau evaluiert und gemeinsam mit den Waldeigentümern für die Ausbildung zugänglich gemacht.
Ein Netz von Beispielsbetrieben für Weiterbildungsveranstaltungen wird systematisch entwickelt werden als „Infrastruktur“ für issensmultiplikation.
Eine Integration und Optimierung der Zielerfüllung von Holzlieferung, Schutzfunktion, Lebensraum und Biodiversität, Wasser- und Luft, sowie Erholung braucht neben den Behandlungsmodellen und auch eine volkswirtschaftliche Betrachtung.
„ oodlife management is management of people“ – in Abwandlung eines Kernsatzes der Wildbiologie – könnte auch eine Leitlinie bilden, Wissenschaftsergebnisse besser in der Praxis zu verankern. In erfolgreicher naturnaher Waldbewirtschaftung, auch von Autodidakten, schlummern viele Erfahrungen und Kenntnisse, die wert sind, entdeckt zu werden.
Vorträge Session 24: Die Evidenzbasis der naturgemäßen Waldwirtschaft 150
Naturgemäße Waldwirtschaft funktioniert - braucht sie da noch eine Evidenzbasis?
Manfred Schölch1, Hans von der Goltz2
1Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 3, 85354 Freising, [email protected] 2Bundesvorsitzender Arbeitsgemeinschaft Naturgemässe Waldwirtschaft (ANW) , Poststr. 7, 57392, Schmallenberg; [email protected]
Schlagworte: Waldfunktionen, Dauerwald, Bioökonomie, Naturschutz
Wenige Daten (Baumarten und Baumzahlen, Dimensionen und Qualitätsmerkmale für Nutzung und Schutz) genügen der naturgemäßen Waldwirtschaft bereits, um waldbauliche Entscheidungen zu treffen, wenn ein fundiertes gesamtheitliches Waldverständnis besteht. Zahlreiche Beispiele vornehmlich im privaten und kommunalen Waldbesitz zeigen überzeugend, dass naturgemäße Waldwirtschaft zu leistungsstarken, ökonomisch und ökologisch stabilen sowie ästhetisch ansprechenden Dauerwäldern führt, die vielfältigen Anforderungen gerecht werden können. Steigende Ansprüche hinsichtlich 1. Biodiversität (Naturschutz), 2. Baumartenwahl (Klimawandel), 3. Betriebssteuerung erfordern detailliertere, fundierte Daten und Empfehlungen, um integrativ wirtschaften zu können. Für Biodiversität und Naturschutz hat die Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW) 2013 neue ökologische Grundsätze mit statischen und dynamischen Elementen (Prozesse) eingeführt. Sie sieht gleichwohl erhebliche Wissenslücken über die tatsächlichen Wirkungen integrativer und segregativer Naturschutzansätze. Diese zu schließen, ist notwendig, um Akzeptanz zu erreichen. Große Flächen nutzungstechnisch einfach stillzulegen, ist aus naturgemässer Sicht keine annehmbare Lösung. Der Klimawandel beeinflusst die Baumartenwahl enorm. Weißtanne als flächendeckender Ersatz für Fichte oder Exoten? Standorteignung, Mischbarkeit und Invasivität sind vielfach ungeklärt, für Waldbesitzer jedoch zentrale Fragen zur Betriebsgestaltung. Für die Betriebssteuerung sind Verfahren zu entwickeln, die sowohl Verallgemeinerungen (z.B. Stammzahlen, Grundflächen- und Vorratshöhen) als auch betriebs- und standortsindividuelle Entscheidungen ermöglichen. Die meisten Dauerwälder in Deutschland befinden sich noch in der Überführungsphase. Je mehr Dauerwald entsteht, desto dringender sind numerisch verlässliche Kriterien sowie operationale Verfahren gefragt. Die ANW arbeitet derzeit an neuen Verfahren. Voraussetzung für nachhaltige naturgemäße Wirtschaft ist die Anpassung der vielerorts gesetzeswidrig hohen Schalenwildbestände. Hierfür muss ein objektives vegetationsbasiertes Bewertungsverfahren für die Balance von Wald und Wild entwickelt und bundeseinheitlich eingeführt werden. Ein entsprechendes Projekt dazu hat gerade begonnen.
Vorträge Session 25: Large-area forest monitoring in intern. forest related processes
151
Measuring, reporting and verification systems in the scope of REDD+
Michael Köhl1
1Universität Hamburg, Weltforstwirtschaft, Leuschnerstrasse 91, 21031 Hamburg, [email protected]
Keywords: REDD, degradation, integrated inventory, cost efficiency
Deforestation and forest degradation are major sources of greenhouse gas emissions (GHG). Reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) implies operational and cost efficient monitoring methodologies for providing reliable estimates of the respective forest biomass and carbon pools. Presently, methodologies to observe biomass and carbon stock change in the world’s forest area are studied. Integrated methods, utilizing terrestrial surveys and remote sensing data, are widely presented. Minor attention has been drawn to the implication of uncertainties and costs associated with the estimation of carbon stock changes. To raise awareness of these issues, we conducted a simulation study for a set of countries that show high to low deforestation rates, which demonstrates that the potential to generate benefits from REDD depends highly on the magnitude of the total error. For countries with low deforestation rates REDD is obviously not an option for generating benefits as they would need to implement monitoring systems that are able to estimate carbon stock changes with a total error well below 1 %.
Vorträge Session 25: Large-area forest monitoring in intern. forest related processes 152
Development of a cost-efficient sampling design for tropical remote forests – a study for Suriname
Ambros Berger1 and Klemens Schadauer1
1Federal Austrian Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards, and Landscape. Seckendorff-Gudent-Weg 8, A-1131 Vienna, Austria, [email protected], [email protected]
Keywords: cost-efficient sampling, tropical forests
The sampling design for Multi Purpose National Forest Inventories in remote tropical forests differs fundamentally from central European NFIs. Travelling costs for the field inventory are a big portion of the overall costs of NFIs in central Europe, yet they are small compared to the effort necessary in tropical countries due to enormous remote and untouched areas which lack any kind of infrastructure. Further challenges are shortages of available manpower and also funding. These circumstances call for specially adapted inventory procedures and methodologies. We present a concept for a NFI developed during a pilot project in Suriname. The core of this system is a regular inventory grid with two-phase sampling with regression, consisting of field plots and airborne remote sensing containing aerial photos and laser scanning mounted on a standard Cessna airplane. The main advantage of the laser scanning data is a precise measurement of the volume covered by tree crowns. This volume correlates strongly with biomass stocks and thus is a valuable independent variable for the regression. Reducing the number of field plots is a trade-off between lowering costs and still gathering sufficient information of parameters for which remote sensing provides no assistance; for example species composition, biodiversity, interviews with local communities, etc. By making use of the large aerial sample, we managed to develop a concept that costs only about 50% compared to a conventional NFI consisting only of field plots while maintaining the same level of accuracy for nationwide AGB and timber volume estimates.
Vorträge Session 25: Large-area forest monitoring in intern. forest related processes
153
Inferential framework for utilizing satellite LiDAR measurements in large-area forest monitoring
Sebastian Schnell1, Johan Holmgren1 und Göran Ståhl1
1Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management, Skogsmarksgränd, 90183 Umeå, Sweden, [email protected], [email protected], Gö[email protected]
Keywords: model-based inference, Monte-Carlo simulation, growing stock biomass, ICESat
The Ice, Cloud and land Elevation satellite (ICESat) was launched in January 2007 with the primary goal of measuring ice sheet elevation over its seven years lasting mission. The main instrument on board of the satellite was the Geoscience Laser Altimeter System (GLAS), a waveform sampling light detection and ranging (LiDAR) sensor that recorded the echoes of short duration laser pulses sent to the land surface (Lefsky 2010). Among the secondary goals of the ICESat mission was the measurement of vegetation cover. As the short pulses of light sent by the GLAS instrument penetrate forest canopies vertically, the recorded waveforms can be used to derive information about vertical forest structure (Lefsky 2010). Since data is collected in form of transects, the horizontal cover of space borne LiDAR instruments can be considered as poor. However, such data was nonetheless successfully used in the context of forest sciences to provide estimates of timber volume (Maselli et al. 2014; Nelson et al. 2009b), vegetation carbon density (Nelson et al. 2009a), above-ground biomass density (Boudreau et al. 2008), and vegetation height (Lefsky 2010) at regional and global scales. As a successor to ICESat, ICESat-2 will not be lunched before 2017. It will use a fundamentally different LiDAR instrument then ICESat (Herzfeld et al. 2014) and a modified layout of laser transects to yield an improved horizontal coverage of the land surface. The main objective of this contribution, is to assess the potential of data from ICESat-2 to assist large area forest monitoring. As ICESat-2 data is not yet available we will simulate such data using wall-to-wall airborne laser scanning (ALS) data and field data from the national forest inventory (NFI) of Sweden. One example of simulating such data was given by Montesano et al. (2015). We develop cost-efficient sampling strategies combining data from the space-borne LiDAR sensor and other sources, such as ALS and field data, and test those using Monte-Carlo simulations (e.g. Ene et al. 2012). As a basis for the sampling simulations, an artificial forest was created that resembles the characteristics of a forested region in northern Sweden by using ALS and NFI data. The inferential framework is model based with a special focus on small-area estimation and the handling of problems related to post-stratification.
Vorträge Session 25: Large-area forest monitoring in intern. forest related processes 154
Use of National Forest Inventory data to estimate biomass in the European Forests
Lea Henning1, Adrian Lanz2 und Thomas Riedel1
1Thünen-Institute of Forest Ecosystems, Alfred-Möller-Str. 1, 16225 Eberswalde, [email protected], [email protected] 2Swiss Federal Research Institute WSL, Zürcherstrasse 111, 8903 Birmersdorf, [email protected]
Keywords: EFDAC, Above-ground Biomass, Harmonization, Moving Window Approach
In context with the Preparatory Action (PA) „Future legal base on harmonized EU forest information“, the European Commission established a Framework Contract with a consortium of National Forest Inventory services, named eForest. eForest is a platform for projects between the Joint Research Centre (JRC) of the European Commission and the consortium “European National Forest Inventory Network” (ENFIN). It broadens and develops the knowledge base of the European Forest Data Centre (EFDAC), hosted by the JRC. EFDAC is built on the basis of the information systems currently existing or under development and in compliance with the guidelines of the Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE). In 2014 and 2015 two special contracts have been conducted by the ENFIN consortium to develop and apply a methodology for the harmonized assessment of forest biomass at European level and to provide spatial information on biomass and other forest parameters according to the INSPIRE grid and to NUTS level units. Altogether 26 countries participated in both special contracts. A harmonized definition of above ground biomass (AGB) was developed in SC13 (2014) and adopted in SC17 (2015). For comparability AGB in both projects includes the above ground part of stump, the stem from stump to tree top, dead and living branches as well as foliage. Participating countries used their national forest inventories to derive biomass according to the harmonized biomass definition. In doing so countries had to add e.g. foliage of deciduous trees or remove root biomass. Biomass of trees was estimated using either national estimator or eForest estimator and also using either national definition or harmonized definition of AGB. Comparing the results, the sources of differences in biomass estimations were analyzed: They occur due to e.g. different biomass definitions and/or different estimation procedures. Additionally, the spatial distribution of AGB was estimated across Europe using a moving window average. To reduce the occurring errors in a further development step the relation between the frame of sampling analysis (at the moment 50 x 50 km) and the mapping unit (currently used 10 x 10 km) was changed. Special thanks to all involved project partners and to JRC. .
Vorträge Session 26: Potential for the German contribution to intern. forest science
155
Internationality at German Forest Faculties
Benno Pokorny1
1Albert-Ludwig University Freiburg, Faculty of Environment and Natural Resources, Tennenbacherstraße 4, 79106 Freiburg, [email protected]
Keywords: Internationality, German forest faculties, students, theses
Since several decades German Universities propose Internationality as one of their priority goals. In view of the fact that the most of the remaining primary forests as well as the major part of forest plantations are located in the tropics and subtropics, an international perspective is particularly relevant also for the German Forest Faculties. However, little information is available about to what degree this goal has been achieved. This is one of the reasons why German Forest Faculties are continuously seen as organizations that mainly work on classic questions regarding forestry in Germany and Central Europe. This study intends to contribute to a better understanding about the level of Internationality at German Forest Faculties by assessing the actual importance of international students and international research topics at the Faculties.
Vorträge Session 26: Potential for the German contribution to intern. forest science 156
Higher education in international forestry in German speaking countries
Ralph Mitlöhner1, Eckhard Auch2
1Georg-August-University Göttingen, Faculty of Forest Sciences and Forest Ecology, Büsgenweg 5, 37077 Göttingen, [email protected] 2Technische Universität Dresden, Faculty of Environmental Sciences, Pienner Str. 7, 01737 Tharandt, [email protected]
Keywords: Higher education, international, tropical, forestry, courses, curricula, teaching
The presentation focuses on a comparative analysis on international forestry teaching offers on BSc, MSc and PhD levels in German speaking countries. Specific orientations of the different curricula will be discussed, dealing with subjects, study organization and teaching practices. Networking with alumni, their numbers and positions are reflected and outlined as an important potential for future development. Future demands for international forestry teaching will be discussed.
Vorträge Session 26: Potential for the German contribution to intern. forest science
157
International forest-related research and research funding sources in German speaking countries
Jürgen Pretzsch1
1Technische Universität Dresden, Faculty of Environmental Sciences, Pienner Str. 7, 01737 Tharandt, [email protected]
Keywords: Forest related research, research & development, forest research institutions, funding sources
International forest-related research with a special focus on tropics and subtropics is resumed in this contribution. A first analysis is based on the feedback of university and research institutions in Germany and German speaking countries. Research subjects will be clustered in research fields. Additionally information will be provided on the donor structure, involving trends in funding. Discussion on the research & development focus and on future international forestry research fields complements the overview.
Vorträge Session 26: Potential for the German contribution to intern. forest science 158
Employment Opportunities for German Forest Faculty Graduates with International Profiles
Gerald Kapp1
1Technische Universität Dresden, Faculty of Environmental Sciences, Pienner Str. 7, 01737 Tharandt, [email protected]
Keywords: International forestry labor market, job qualification, international profile of MSc students
The absorption of graduates with an international forestry profile in the labor market is outlined. Job positions in the private sector and in the public or NGO-sector are discussed and complemented by specific information on consulting enterprises, GIZ and KFW and further specific international institutions. Possible trends of job opportunities are discussed and the qualification profile is revised.
Vorträge Session 27: Internationale und EU waldrelevante Politiken...
159
Europäische Forstpolitik und Forstwirtschaft: Vom Adressaten zum Mitgestalter von Politik?
Kathrin Böhling1
1TU München, Lehrstuhl für Wald- und Umweltpolitik, Hans-Carl-von-Carlowitz Platz 2, 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Europäische Forstpolitik, Forstverbände, Politiklernen, Organisation
Die Organisation forstwirtschaftlicher Interessen auf europäischer Ebene hat im letzten Jahrzehnt deutlich an Fahrt aufgenommen. Nationale und regionale Zusammenschlüsse von Privat- und Staatswaldbesitzern haben ihre Interessen gebündelt, Strukturen und Kapazitäten in ihren Dachorganisationen gestärkt – dies mit dem Ziel verstärkt für ihre Interessen in europäischen Politikprozessen einzutreten. Waldbesitzer scheinen aus den Versäumnissen bei der Natura 2000 Gesetzgebung und Ausweisung von FFH Gebieten gelernt zu haben. In Brüssel und Straßburg erscheinen sie heute stärker aufgestellt als in den frühen 2000er Jahren. Im vorliegenden Beitrag soll dieser Vermutung auf den Grund gegangen werden indem die Kompetenzentwicklung forstwirtschaftlicher Interessen in Europa und dessen Wirkung aus vergleichender Perspektive untersucht wird. Inhaltlicher Bezugspunkt ist die Bioökonomie-Initiative der Europäischen Kommission (2012) und den damit angestoßenen Politikprozessen. Um die Kompetenzentwicklung forstwirtschaftlicher Interessen in Europa genauer in den Blick zu nehmen, bietet sich eine Verknüpfung von Theorien des Politiklernens mit Erkenntnissen aus der skandinavischen Organisationsforschung an. Hiernach werden europäische Dachverbände der Forstwirtschaft als Meta-Organisationen (Ahrne/Brunsson 2005) – also Organisationen bestehend aus Organisationen – verstanden, die als „ issensvermittler“ (teachers) ggü. den europäischen Institutionen auftreten (Bomberg 2007). Damit wird die Aufmerksamkeit auf jene Prozesse gelenkt, die für Verbände von zentraler Bedeutung sind, nämlich policy-maker von ihren Positionen und Argumenten zu überzeugen. Empirisch geht der Beitrag wie folgt vor: Was sind die Positionen und Argumente europäischer Forstwirtschaftsverbände zur Bioökonomie? Wie stellen sich diese im Vergleich zu den von ausgewählten Umwelt- und Naturschutzverbänden vorgebrachten Positionen und Argumente dar? Welche Lerntypen und -dynamiken kristallisieren sich im Handeln der Forstverbände heraus (political, instrumental and social learning)? Wie kommen gemeinsame Stellungsnahmen zur Bioökonomie in den europäischen Forstverbänden zustande, was sind typische Konflikte zwischen Dachverband und Verbandsmitgliedern und wie wurden diese gelöst (Überzeugen, Abstimmen, Verhandeln)? Zitierte Literatur: Ahrne, G. und N. Brunsson (2005) Organizations and meta-organizations. Scandinavian Journal of Management 21: 429-449. Bomberg, E. (2007) Policy learning in an enlarged European Union: envirnmental NGOs and new policy instruments. Journal of European Public Policy 14: 248-268.
Vorträge Session 27: Internationale und EU waldrelevante Politiken... 160
Nomination and Inscription of German Beech Forests as World Heritage – a Multi-Level-Governance Process between Science and
Politics
Janina Heim1 and Michael Böcher1
1Georg‐August‐University Göttingen, Chairgroup Forest Nature Conservation Policy, Büsgenweg 3, 37077 Göttingen, e‐mail: jheim@uni‐goettingen.de, [email protected]
Key words: World Heritage, beech forests, science-policy transfer, departmental research
International nature conservation regimes increasingly have an impact on national forest conservation policy. The World Heritage Convention came to life in 1972 and remains until today the only convention dedicated to both natural and cultural sites of international importance. Currently, there are 1031 properties inscribed in the World Heritage list, 197 of which are natural properties. Since 2011, the “Ancient Beech Forests of Germany” share the same status with other natural sites such as the Great Barrier eef (Australia) or East Africa’s Serengeti. This paper aims to analyze the political processes behind the nomination and inscription of German beech forests in this international convention. Especially, it focuses on the contribution of science to this process. Our paper presents the results of our research on these questions, concentrating on the role of the German Federal Agency for Nature Conservation (Bundesamt für Naturschutz, BfN), a departmental research organization and subordinate authority to the Federal Ministry for the Environment (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, BMUB). The BfN has promoted the inscription of more German Natural World Heritage properties since the early 2000s. However, the actual nomination and inscription of German beech forests to the World Heritage Convention also depended on other institutional levels, including those federal states (Bundesländer) in which the ancient beech forests are located and the international World Heritage Committee, which has to approve the inscription.
Based on our analytical research-integration-utilization (RIU) model of science‐based policy advice, we identify and analyze different aspects of this national and international process. The BfN and other actors involved undertake activities in “research”, “integration”, and “utilization” under the multi-level-governance setting of the convention. Our main thesis is that scientific evidence (“research”) is not the most important condition for listing natural properties under the World Heritage Convention. Instead, we find that certain political conditions and appropriate allies to support a cause can increase the chances of pushing an inscription (“integration”).
Vorträge Session 27: Internationale und EU waldrelevante Politiken...
161
Bedeutung der Entwicklung von integrierten Umwelt-Monitoring-Systemen für die Naturschutzpolitik im Kontext der Verbesserung von
Biodiversität in der Forstwirtschaft in mitteleuropäischen Grenzregionen
Aneta Lotycz1
1Marschallamt der Woiwodschaft Niederschlesien, [email protected]
Schlagworte: Naturschutzpolitik, Biodiversität, Umwelt-Monitoring-Systeme, mitteleuropäische Grenzregionen
Die Integration von Naturschutzmaßnahmen in den mitteleuropäischen Grenzregionen trägt bedeutend zur Verbesserung der biologischen Vielfalt in der europäischen Forstwirtschaft bei. Die Kompetenzen und Ziele der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden von EU-Richtlinien und Verordnungen festgelegt. Eine wesentliche Rolle für den grenzüberschreitenden Naturschutz spielt das europäische Programm Natura 2000, aber nicht nur die Schutzgebiete unterstützt werden sollen. Zu den relevanten Problemen gehören: die Verbesserung der Landschaftsstruktur, der Schutz vor Naturgefahren sowie die Erhaltung und Verbesserung des Artenreichtums. Zu den wichtigen Aspekten der Forstwirtschaft gehören auch das Wildtiermanagement und der Schutz von wandernden Wildtieren in Grenzgebieten. Die Natur in bewirtschafteten Wäldern in Grenzgebieten soll mit Hilfe gemeinsamer Instrumente und Maßnahmen wirksam geschützt werden. Die Forstbehörden in den Grenzregionen müssen die Unterschiede in der Gesetzgebung kennen lernen und eine effektive gemeinsame Naturschutzpolitik führen. Eine wesentliche Bedeutung für die Förderung von Naturschutz und Landschaftspflege in Grenzgebieten hat die Entwicklung von integrierten Umwelt-Monitoring-Systemen. Im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit müssen gemeinsame Maßnahmen zum Pflanzen- und Wildtierschutz berücksichtigt werden. Die grenzüberschreitenden Waldgebiete müssen vor langfristigen Schäden durch Stürme, Brände, Trockenheit und Schädlingsbefall wirksam geschützt werden. Die integrierten Umwelt-Monitoring-Systeme ermöglichen gemeinsame Überwachung der durch die Katastrophen und Schädlinge verursachten Gefahren und eine Analyse der potentiellen Gefahren. Eine große Bedeutung für die Entwicklung des Umwelt-Monitoring-Systems hat eine hohe Qualität des Projektmanagements. Die Projekte von Umwelt-Monitoring-Systemen müssen richtig dokumentiert werden. In den Anforderungsanalysen müssen alle gesetzlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen beinhaltet werden, weil sie in den Prozessanalysen berücksichtigt werden. Die richtigen Prozessanalysen beeinflussen die Qualität von Umwelt-Monitoring-Systemen, was eine wesentliche Bedeutung für den Naturschutz und die Verbesserung von Biodiversität in der Forstwirtschaft in Grenzgebieten hat.
Vorträge Session 27: Internationale und EU waldrelevante Politiken... 162
Insights from the ground level? A content analysis review of multi-national REDD+ studies since 2010
Richard Fischer1, Yvonne Hargita1, Sven Günter1
1 Thünen Institute for International Forestry and Forest Economics, Leuschnerstrasse 91, 21033, Hamburg, [email protected], [email protected], [email protected]
Keywords: REDD+, Results based finance, Co-benefits, Tenure rights
The EDD program (“ educing Emissions from Deforestation and Degradation”) was launched in 2007 under the United Nations Framework Convention on Climate Change. The program was designed as an innovative approach to reduce deforestation. The core idea is that developed countries would financially compensate losses due to avoided deforestation and degradation. In order to further develop methodologies and tools for an approach that will be based on national programs, hundreds of sub-national initiatives have in the meantime implemented REDD+ or REDD+-like mechanisms worldwide. These projects have been called the “the laboratory in which the EDD+ experiment is being conducted”. In the context of the COP (United Nations Framework Convention on Climate Change, Conference of the Parties) in Paris 2015 it was timely and necessary to analyze insights and to draw upon lessons learned. This study reviews 17 multi-national REDD+ studies by applying qualitative content analysis using the UNFCCC Warsaw Framework for categorization. The results show, that even though the official framework is adopted and accepted it obviously still needs time to be developed and implemented under differing local conditions. Specifically, experiences with the implementation of core REDD+ topics like institutional responsibility and results-based financing are mostly not yet encouraging. Monitoring systems require further development, and guidance for jurisdictional approaches is lacking that link projects with national programs. Experiences with reference levels, permanence and leakage have hardly been reported. More general topics like stakeholder participation, tenure clarification and biodiversity co-benefits are in turn more advanced. But these are not necessarily effects of REDD+ components in the projects. The projects obviously offer a platform to advance classical development issues. REDD+ is presented as a show case for complex and challenging implementation of an originally simple and convincing general approach. We conclude that continued financial commitments from the international community are essential to encourage further development and implementation. Authors claim that REDD+ should stimulate and support transformational change. Reference: Fischer et al. (2015). Insights from the ground level? A content analysis review of multi-national REDD+ studies since 2010. Forest Policy and Economics (2015)
Vorträge Session 27: Internationale und EU waldrelevante Politiken...
163
Marktabdeckung der EU-Holzhandelsverordnung und Auswirkungen ihrer Evaluierung
Niels Janzen1, Holger Weimar1
1Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie, Leuschnerstraße 91, 21031 Hamburg, [email protected], [email protected]
Schlagworte: EUTR-Evaluierung, Marktabdeckung, Holzprodukte, Illegaler Holzeinschlag
Illegaler Holzeinschlag ist eine der wichtigsten globalen Ursachen von Entwaldung und Degradation von Wäldern. Als eine wichtige Maßnahme zur Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags hat die Europäische Union (EU) im Jahr 2010 die EU-Holzhandelsverordnung (EU Timber Regulation, EUTR) verabschiedet. Sie verbietet das Inverkehrbringen von Holz und Holzprodukten aus illegalem Einschlag auf den EU-Binnenmarkt. Seit März 2013 ist die Verordnung in Kraft. Der derzeitige Evaluierungsprozess der EUTR wird vermutlich 2016 abgeschlossen sein und möglicherweise eine Veränderung des Umfangs der zu berücksichtigenden Produkte zur Folge haben. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zu quantifizieren, zu welchem Anteil die aktualisierte EUTR die Importe von Holz und holzbasierten Produkten in die EU abdeckt und aufzuzeigen, welche Veränderungen sich diesbezüglich aus dem Evaluierungsprozess ergeben haben. Diese und detailliertere Analysen können eine wichtige Grundlage für politische Entscheidungsträger in derzeitigen oder zukünftigen Evaluierungsprozessen der EUTR sein. Wir haben zunächst den Rahmen aller holzbasierten Produkte festgelegt und nutzen dabei die Definition der EU zum Cluster Forst und Holz. Als Datengrundlage dienen die jährlichen, bilateralen Handelsdaten von EUROSTAT. Für die Analysen müssen die Daten dieselbe Einheit aufweisen und sind daher ggf. umzurechnen. Separate Berechnungen erfolgen anhand der eferenzeinheiten Importwert [€], ohholzäquivalent [m³(r)] und Holzfaseräquivalent [m³(f)]. Zur Darstellung der Ergebnisse werden die Warennummern in zwölf Produktgruppen eingeteilt und die Herkunftsländer in neun Regionen zusammengefasst. Unsere Analyse der derzeitigen EUTR zeigt, dass etwa 90% der importierten Holzmengen und drei Viertel der eingeführten Warenwerte durch die EUTR abgedeckt werden. Damit findet für ein Holzvolumen von 17 Mio. m³ Rohholzäquivalenten (6 Mio. m³ Holzfaseräquivalenten) die Verordnung keine Anwendung. Diese Menge verteilt sich in etwa gleich auf Holz- und Papierprodukte. Die Holzmengen, die derzeit nicht von der EUTR abgedeckt werden, konzentrieren sich auf wenige Warennummern (z.B. Holzkohle) und bei diesen Holzmengen haben bestimmte egionen (z.B. „Ost und Süd-Ost Asien“) besondere Bedeutung. Es stellt sich daher derzeit die Frage, welche dieser Warennummern bei der Evaluierung der EUTR zusätzlich aufgenommen werden? Welche Änderungen ergeben sich für die Abdeckungsraten insgesamt, nach Produktgruppen oder nach Regionen?
Vorträge Session 27: Internationale und EU waldrelevante Politiken... 164
Russian regional responses to transnational forest policy: A political-cultural approach
Olga Malets1
1Professur für Environmental Governance, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tennenbacher Str. 4, 79106 Freiburg, [email protected]
Keywords: illegal logging, governance, certification
The paper adopts a political-cultural approach to markets, or markets as politics (Fligstein 1996, 2001), to explore how regional cross-border timber markets are structured differently across the regions of Russia. It focuses specifically on how regional markets respond to the EU illegal logging regulations (EU Timber Regulation) and more broadly how regional markets are changed by transnational illegal logging and good forest governance initiatives. The political-cultural approach views markets as social worlds, in which actors pursue their socially-constructed individual and collective goals in interaction with each other. The interactions are structured by several types of formal and informal institutions, including property rights, governance structures, conceptions of control, and rules of exchange. Firms as primary market actors seek to stabilize their position in the market and increase profits by containing competition and circumventing political, legal and moral constraints. Other actors, including state regulators and NGOs, seek to control and constrain firms’ strategies. External pressures challenge and change the interactions and institutions structuring these interactions. The papers explores how transnational illegal logging and good forest governance initiatives, including EU Timber Regulation and forest certification, challenge the structure of markets and market interactions in the Russian Northwest and the Russian Far East. It explores how various actors – forest industry, NGOs and federal and regional policy-makers – perceive and make use of new opportunities, mobilize constituencies and deal with new challenges in order to reinforce and stabilize their position and power in the market.
Vorträge Session 27: Internationale und EU waldrelevante Politiken...
165
The EU policy against illegal logging in Germany – Implementation “gap” or success?
Sina Leipold1
1Universität Freiburg, Tennenbacher Str. 4, 79106 Freiburg, [email protected]
Keywords: forest degradation, European Union, policy
Deforestation and forest degradation is a major environmental policy issue on the international level. Illegal logging has been seen as one of its key drivers. To tackle this problem, international political initiatives for a long time targeted “developing” countries that were seen as major producers of illegal timber. Yet, this approach changed remarkably during the recent decade. A new generation of policies emerged that target major wood consuming markets in “developed countries” by prohibiting the import of timber harvested in contravention to the laws of the country of origin. One of these policies is the European Timber Regulation (EUTR), adopted in 2010. In order to take effect, this policy needs to be implemented in all European member states. Its implementation in Germany recently attracted a lot of media attention. It has been portrayed as too “weak” and, hence, not being implemented in a way that meets the EUT ’s objectives. This problem has been described as implementation gap. Yet, it has not been analyzed so far whether this perception extends to the different stakeholder groups involved in implementation in Germany. And if so, what effects does this perception have on domestic and European implementation development? Based on 22 semi-structured interviews with key stakeholders, more than 100 documents, and participant observation data from Germany, this article asks two major questions: (1) How is the implementation perceived by the major involved stakeholder groups? (2) Which implementation practices and possibly new policy making processes result from these perceptions? Analytically, the paper applies discursive policy analysis. The results show that involved stakeholders hardly perceive the implementation in Germany as implementation gap. Instead, the enforcement described as “weak” in the media is viewed as following a certain “educational” approach partly prescribed by the EUT . Yet, stakeholders still identify certain weaknesses and possibilities for specific stakeholder groups to steer enactment in a direction favorable to them. These provide important insights into the effects of the “German” implementation pathway. They are not only of interest to scholars of policy implementation but also to stakeholders within Germany and in other EU member states that are still just commencing implementation. The article concludes with embedding the results in scholarly and stakeholder discussions.
Vorträge Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle... 166
Wild in Schutzgebieten: Effekte während einer dreijährigen Bejagungspause auf Reh- und Rotwild auf ca. 2.400 ha im
Biosphärenreservat Pfälzerwald
Ulf Hohmann1, Ulf Hettich1 & Ditmar Huckschlag1
1 Forschungsgruppe Wildökologie, Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft, Hauptstrasse D - 67705 Trippstadt, [email protected]
Schlagworte: Schalenwild, Biosphärenreservat, Jagdruhe, Wildmanagement
Kernzonen von Biosphärenreservaten sollen einen vom Menschen weitestgehend unbeeinflussten Ablauf der natürlichen Prozesse gewährleisten. Im Biosphärenreservat „Pfälzerwald-Nordvogesen“ beinhaltet dies auch einen Verzicht auf jegliches Management des dort vorkommenden Schalenwildes einschließlich der Jagd. Da jedoch andererseits Wildschäden auf angrenzenden bewirtschafteten Waldflächen vermieden werden sollen (§ 7 Abs. 3 Pkt. 4 der LVO) untersuchte die FAWF zwischen 2007 und 2015 die Effekte einer Jagdruhe auf Reh- und Rotwild in einer ca. 2.400 ha großen Kernzone im zentralen Pfälzerwald. Hierzu wurde zwischen 2007 und 2013 zunächst die herkömmliche Bejagung fortgeführt und parallel ein Monitoringprogramm etabliert, in dem die Schalenwildpopulationen, wildökologisch relevante Umweltfaktoren, die Jagdpraxis und Wildschäden in der Kernzone und auf 7.500 ha umgebendem Wald erfasst wurden. Ab April 2013, mit Beginn der Jagdruhe (Ausnahme Schwarzwild), wurde die Datenaufnahme unverändert fortgeführt. Mit Ende des Jagdjahres 2015/16, also nach drei Jahren, wurden erste Effekte bilanziert: Sowohl die Verbiss- als auch die Schälschadenssituation zeigte keine Verschlechterung. Die bei Frühjahrszählungen und Losungskartierungen ermittelte Verteilung und Dichte der Rotwildpopulation blieb weitgehend konstant. Allerdings zeigte sich, dass viele der ermittelten Messgrößen über die Zeitreihe unabhängig von der Jagdruhe beträchtlich schwankten. Die jagdlichen Aktivitäten, insbesondere die Ansitzhäufigkeiten und die Kirrungsbeschickungen, waren beispielsweise bereits während der Bejagungsphase rückläufig. Die Erlegungszahlen, insbesondere des Rotwildes, zeigten hingegen auf die jeweils bejagte Fläche bezogen keine wesentlichen Änderungen. Aufgrund planmäßiger waldbaulicher Maßnahmen zur Umsetzung der Waldentwicklungsplanung wie auch durch witterungsbedingte Störereignisse hat sich allerdings das Äsungspotential im Laufe des Untersuchungszeitraums verbessert. Die offensichtlich hohe Dynamik zahlreicher Einflussgrößen erschwert das Erkennen möglicher waldbaulicher Kausaleffekte durch die Jagdruhe. Doch deutet sich an, dass für eine nachhaltige Lenkung von Wildschäden neben der Steuerung von Erlegungszahlen offenbar zahlreiche weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen. Außerdem sind aufgrund der systembedingten Trägheit der hier untersuchten Wechselwirkungen vermutlich Untersuchungen über noch längere Zeitreihen notwendig, um Effekte einer Jagdruhe erkennen zu können.
Vorträge Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle...
167
Erholungsinfrastruktur als wichtiger Faktor im Raum-Zeit Verhalten des Rothirschs (Cervus elaphus): Konsequenzen für das
Rotwildmanagement
Joy Coppes1, Friedrich Burghardt1, Robert Hagen1, Rudi Suchant1, Veronika Braunisch1,2
1 Forest Research Institute of Baden-Württemberg (FVA), Wonnhaldestr. 4, D - 79100 Freiburg, Germany, [email protected] 2Conservation Biology, Institute of Ecology and Evolution, University of Bern, CH 3012-Bern, Switzerland
Schlagworte: Zonierungskonzept, Anthropogene Störung, Rothirsch, Mensch-Wildtier Interaktionen
Um Konflikte zwischen menschlichen Landnutzungsinteressen und den Bedürfnissen von Wildtieren zu entschärfen werden zunehmend Zonierungskonzepte angewendet, die Zonen mit unterschiedlichen Beschränkungen für Erholungssuchende oder deren Infrastruktur (z.B. Wanderwege) beinhalten. Es ist allerdings in den meisten Fällen nicht untersucht, ob solche Zonierungskonzepte „funktionieren“, d.h. die beabsichtigten Auswirkungen auf das Raumnutzungsverhalten der Wildtiere haben. Im Rotwildgebiet Südschwarzwald (Südwestdeutschland) wurde 2008 ein Zonierungskonzept implementiert, das neben Wildtierruhezonen, Kernzonen mit beschränkter touristischer Nutzung sowie Randzonen ohne Einschränkung für Erholungssuchende beinhaltet. Anhand von GPS-Telemetriedaten von 15 Rothirschen untersuchten wir, ob (1) Erholungs-Infrastruktur (z.B. Wanderwege, Loipen) und (2) das Zonierungskonzept das Raumnutzungsverhalten der Rothirsche beeinflusst, ob diese Effekte (3) tageszeitlich oder saisonal unterschiedlich sind, um Konsequenzen für das Rotwildmanagement abzuleiten. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Tiere sich bevorzugt in den Ruhezonen und Kernzonen des Gebiets aufhalten. Die Habitatwahl unterscheidet sich signifikant zwischen Tag und Nacht in beiden Jahreszeiten. Sowohl im Sommer als im Winter werden touristische Infrastrukturen (Wanderwege und Loipen) und nahegelegene Nahrungshabitate tagsüber gemieden und nachts bevorzugt aufgesucht. Das bedeutet, dass Rothirsche durch touristische Infrastruktur beeinflusst werden, Zonierungskonzepte jedoch effektive Instrumente sein können, um Wildtiere zu lenken und Störungen zu minimieren. Hierbei müssen aber sowohl tageszeitliche als auch saisonale Unterschieden in Mensch-Wildtier Interaktionen beachtet werden. Da tagsüber bestimmte Habitate nicht zu Verfügung stehen, weil sie zu nah an Wanderwegen liegen, muss sichergestellt werden, dass auch tagsüber ausreichend Nahrungshabitat in ungestörten Bereichen zur Verfügung steht. Zudem sollte die nächtliche Nutzung von Infrastruktur sowie Nachtveranstaltungen (z.B. Fackelläufe) vermieden werden. Räumliche Zonierungskonzepte sollten mit zeitlichen Beschränkungen kombiniert werden, um negative Auswirkungen von Erholungsnutzung auf die Bedürfnisse von Wildtiere zu minimieren.
Vorträge Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle... 168
Untersuchung saisonaler Wanderbewegungen von Rotwild mittels Genotypisierung – eine Pilotstudie aus dem Salzburger Land
Cornelia Ebert1,3, Franz Grill2, Ulf Hohmann3, Bernhard Thiele1
1Seq-IT GmbH & Co. KG, Pfaffplatz 10, 67655 Kaiserslautern, [email protected] 2Österreichische Bundesforste AG - Forstbetrieb Flachgau-Tennengau, 5441 Abtenau, Markt 14 3Research Institute for Forest Ecology and Forestry Rhineland-Palatinate, Haupstrasse 16, 67705 Trippstadt, Germany
Schlagworte: Rothirsch, Genotypisierung, Winterfütterung, Migration
Informationen über Raumnutzung und räumliche Verteilung von Wildtieren sind für deren Management von großer Wichtigkeit. Neben Telemetrie, Beobachtungen, Fotofallenstudien etc. können genetische Ansätze hier wertvolle Daten liefern. Wir haben eine Pilotstudie in einem montanen Waldgebiet nahe Salzburg durchgeführt, in dem Rotwild (Cervus elaphus) an Winterfütterungen mit Nahrung versorgt wird. Eine besonders große Ansammlung von etwa 200 Stück Rotwild an einer einzelnen Fütterung verursachte Schäden an den umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die geforderte Anpassung des dortigen Rotwildmanagements wurde dadurch erschwert, dass die Einstandsgebiete der Tiere während der Jagdsaison unbekannt waren. Um festzustellen, aus welchem Umkreis die Tiere zu der Winterfütterung hin migrieren, wurde ein genetischer Ansatz angewandt: Im Winter wurden an der Fütterung Losungsproben gesammelt. In den folgenden zwei Jagdsaisons wurden Gewebeproben erlegten Rotwilds aus insgesamt sechs umliegenden Jagdbezirken (Gesamtfläche: 649 km2) genommen. Alle Proben wurden an sieben Mikrosatelliten genotypisiert (Kotproben zusätzlich an einem Geschlechtsmarker), um ggf. Übereinstimmungen zwischen Losungsproben von der Winterfütterung und Gewebeproben erlegter Individuen festzustellen. Insgesamt wurden an der Fütterung über Losungsproben 126 verschiedene Individuen nachgewiesen. Im Anschluss wurden insgesamt 106 Gewebeproben erlegten Rotwilds analysiert, von denen 28 aus dem Bezirk der Winterfütterung und 78 aus den umliegenden Bezirken stammten. Insgesamt fanden wir dabei 13 Übereinstimmungen mit an der Winterfütterung bereits erfassten Tieren, von denen alle im selben Jagdbezirk, in dem sich die Fütterung befand, erlegt worden waren. Es konnte kein einziger Fall einer Abwanderung nachgewiesen werden, wohingegen 46% der im Bezirk der Fütterung erlegten Individuen zuvor im Winter dort genetisch nachgewiesen worden waren. Dieser Befund hatte direkte Konsequenzen für das Rotwildmanagement vor Ort, da gezeigt werden konnte, dass die ungewöhnlich große Ansammlung von Rotwild mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich das Jahr über im Gebiet ansässig ist, was eine Anpassung der Bejagung zur Folge hatte. Die Ergebnisse dieser Pilotstudie zeigen, dass genetische Ansätze ein nützliches Werkzeug zur Untersuchung von Migrationen und Raumnutzungsmustern wildlebender Tierarten sein können.
Vorträge Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle...
169
Rotwildbewirtschaftung in Österreich: Die wildökologische Raumplanung als Managementgrundlage
Rudolf Reiner1
1Univeristät für Bodenkultur Wien, Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft, Gregor-Mendel-Strasse 33, 1180 Wien, [email protected]
Schlagworte: Wildökologische Raumplanung, Wildschäden, Rotwild
Einen Ansatz, wie intensive landschaftliche Nutzung und Rotwild nebeneinander bestehen können, bietet die wildökologische Raumplanung (WÖRP), die mittlerweile in drei Österreichischen Bundesländern (Kärnten, Salzburg, Vorarlberg) im Jagdgesetz verankert ist. Grundprinzip der wildökologischen Raumplanung ist eine wildökologisch sinnvolle Zonierung bzw. eine auf Populationsebene basierende, räumliche Einteilung des Landesgebietes. Es wird also die gesamte Landesfläche einerseits in Wildräume (Populationsebene) und in nächster Ebene in Wildregionen (Teilpopulationen) und andererseits je nach Lebensraumkapazität und Wildschadensanfälligkeit in Rotwildbehandlungszonen (Kern-, Rand- und Freizone) eingeteilt. Die Kernzonen sollen dabei der langfristigen Lebensraumsicherung der Rotwildpopulationen dienen. Rotwild ist hier explizit erwünscht. Im Gegensatz dazu stellt die Freizone eine Behandlungszone dar, in der Rotwild nicht geduldet werden kann, weil die Integration des Rotwildes in der Kulturlandschaft bei tragbaren Belastungen nicht möglich ist. Freizonen sind immer als Inseln festzulegen, wohingegen Kernzonen miteinander vernetzt sein müssen. Als dritte Behandlungszone fungiert die Randzone. Sie ist Teil des Rotwildlebensraumes und stellen eine Pufferzone zwischen Kern- und Freizone dar. In ihr kann Rotwild nur in geringeren Dichten geduldet werden. Im Rahmen einer Masterarbeit an der Universität für Bodenkultur (unter der Betreuung von Univ. Prof. Dr. Klaus Hackländer und Univ. Prof. Dr. Friedrich Reimoser) wurden – ausgehend von den grundsätzlichen Zielsetzungen der WÖRP – die Entwicklung der Rotwildverbreitung, der Abschussdichte und der Schälschadenssituation auf deren Umsetzung und Erfolg untersucht. Ziel dieser Arbeit war es nicht, die unterschiedlichen Gründe für das Auftreten von Wildschäden zu untersuchen bzw. Patentrezepte für eine Verbesserung dieser Situation zu finden, sondern eine umfangreiche Analyse der Abschusszahlen und der Schälschadenssituation während des Untersuchungszeitraumes zu machen, und in diesem Zusammenhang den unterschiedlichen Einfluss der wildökologischen Raumplanung für Kärnten, Salzburg und Vorarlberg bzw. deren gesetzliche Verankerung zu vergleichen. Die Ergebnisse unterschieden sich doch sehr stark zwischen den drei Bundesländern, wobei sich diese Abweichungen größtenteils durch die unterschiedlichen Regelungen der Landesjagdgesetze erklären lassen.
Vorträge Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle... 170
Der Weg zu einer entspannten Nachbarschaft- Wildtiermanagement im Siedlungsraum Baden-Württembergs
Geva Peerenboom1, Andy Selter2 , Ilse Storch1, Ulrich Schraml3
1Professur für Wildtierökologie und Wildtiermanagement, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br., Tennenbacher Str. 4, 79106 Freiburg i. Br., [email protected] , [email protected] 2Professur für Forst- und Umweltpolitik, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br., Tennenbacher Str. 4, 79106 Freiburg i. Br., [email protected] 3 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abteilung Wald und Gesellschaft, Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg i. Br., [email protected]
Schlagworte: Urbanes Wildtiermanagement, Mensch-Wildtier Konflikte, Einstellungen, Governance
Wildtiere entwickeln zunehmend Strategien um die vielfältigen Ressourcen zu nutzen, die der menschliche Siedlungsraum bereithält. In immer häufigeren Fällen entstehen dadurch Konflikte mit Menschen in Form von Schäden an Grünflächen und Gebäuden, Gesundheitsrisiken und Ängsten. Kommunen sind in zunehmendem Maße gefordert, diese Konflikte zu entschärfen. Im Rahmen des Forschungsprojektes "Wildtiere im Siedlungsraum Baden-Württembergs" wurden wissenschaftliche Grundlagen für den Aufbau von urbanen Wildtiermanagement-Strukturen im Bundesland erarbeitet. Mit Hilfe von sozialwissenschaftlichen Methoden wurden die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die existierenden Governance-Strukturen erfasst. Deutliche Unterschiede in den Einstellungen der Bevölkerung gegenüber Wildtieren im Siedlungsraum konnten abhängig von Gemeindegrößen festgestellt werden. Es zeigt sich, dass in einem Großteil der Kommunen die nötigen Governance-Strukturen für ein nachhaltiges Wildtiermanagement im Siedlungsraum kaum vorhanden sind und hier ein teils hoher Handlungsbedarf besteht. Ziele des Wildtiermanagements im Siedlungsraum sollten neben der Entschärfung von Konflikten die Förderung des Naturerlebnisses der Bevölkerung sein. Basierend auf den Ergebnissen des Projektes wird empfohlen, gute Informationsangebote für Bürger zu schaffen, Ansprechpartner auf Landkreis- und Gemeindeebene zu benennen und deren Kompetenzen zu stärken, sowie die Etablierung stabiler Netzwerke zu fördern. Weiter lassen sich Habitatstrukturen im Siedlungsraum so manipulieren, dass darüber Populationen gesteuert und Mensch-Wildtier-Konflikte abgemildert werden können. Hierzu besteht weiterer Forschungsbedarf.
Vorträge Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle...
171
Nationalparke, Wildtiere und Akteure: Partizipative Konfliktanalyse und Konfliktmanagement
Stefan Ehrhart1 und Ulrich Schraml1
1Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abteilung Wald und Gesellschaft, Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg; [email protected], [email protected]
Schlagworte: Nationalparke, Wildtiere, Akteure, Konflikte
Nationalparke werden von ihren Befürwortern mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Potentialen assoziiert und sind eine Hauptstrategie zur Umsetzung von Naturschutzzielen. Aufgrund der unterschiedlichen Ziele für Nationalparke und von Akteuren aus deren Umfeld entstehen jedoch häufig Konflikte. Auch in Deutschland sind dabei Wildtiere ein bedeutendes Spannungsfeld. Interessen, Werte und Beziehungen zwischen Akteuren spielen eine zentrale Rolle. Dies verursacht oder verstärkt regelmäßig Kommunikationsprobleme und Konflikte. Eine nachhaltige Entwicklung von Nationalparken und deren Umfeld ist dann vor allem über Beteiligung und andere Formen des Konfliktmanagements möglich. Ziel der Studie war es, ein besseres Verständnis von Konflikten im Spannungsfeld Wildtiermanagement im Nationalpark und dessen Umfeld zu erlangen und Ansätze für das Konfliktmanagement zu entwickeln. Drei deutsche Nationalparke und deren Umfeld wurden als Fallstudiengebiete ausgewählt. Im Rahmen eintägiger Workshops wurden jeweils mehrere Gruppendiskussionen durchgeführt und aufgezeichnet. Leitfragengestützt wurde über die Akteursarena, Konflikte und Konfliktmanagement diskutiert. Die insgesamt neun Gruppendiskussionen wurden über eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet. Ergebnis der Studie sind die Konfliktthemen Wildtierwirkungen und -populationen, Wildtiermanagement, Monitoring, Prozessschutz, Akteursinteraktionen und Beteiligungsverfahren. Zudem wurden Konflikttypen identifiziert, welche Beziehungen, Interessen, Werte, Strukturen und Verteilung, Regeln sowie Daten umfassen. Konfliktthemen und Konflikttypen sind zwischen den Fallstudiengebieten vergleichbar. Jedes Konfliktthema wird unterschiedlich stark von den Konflikttypen bestimmt. Die Untersuchungsergebnisse spiegeln die für Deutschland spezifische Situation wider, zeigen aber auch Parallelen zu weltweit beobachteten Konflikten um Nationalparke, Wildtiere und Akteure. Diskutiert werden die grundlegende Konfliktdynamik und die Bedeutung der Konflikttypen, verschiedener Konfliktarenen und Flächenbezüge sowie von örtlichen Netzwerken komplexer Beziehungen. Aus den Erkenntnissen werden Empfehlungen für das Konfliktmanagement in und um die Nationalparke abgeleitet.
Vorträge Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle... 172
Einfluss von Jagdruhezonen auf die Raumnutzung des Wildschweins (Sus scrofa) in Baden-Württemberg
Markus Handschuh1,2, Simone Ciuti3, Peter Linderoth1, Toralf Bauch1, Guido Dalüge1,
Andreas Elliger1, Stefanie Thoma1 und Janosch Arnold1
1Wildforschungsstelle Baden-Württemberg, LAZBW, Lehmgrubenweg 5, 88326 Aulendorf. E-Mail: [email protected] 2Professur für Wildtierökologie und Wildtiermanagement, Universität Freiburg, Tennenbacher Straße 4, 79106 Freiburg 3Abteilung für Biometrie und Umweltsystemanalyse, Universität Freiburg, Tennenbacher Straße 4, 79106 Freiburg
Schlagworte: Wildschwein, Jagdruhe, Raumnutzung
In Kernzonen von Schutzgebieten ist die Jagd aufgrund naturschutzfachlicher Aspekte oft eingeschränkt oder untersagt. Angesichts steigender Schwarzwildbestände und damit einhergehender Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen können jagdliche Einschränkungen zwischen den Interessengruppen zu Konflikten führen. Die wildschadens-ersatzpflichtigen Jäger befürchten, dass sich die Wildschweine durch Rückzug in jagdfreie Zonen einer effektiven Bestandsregulierung entziehen. Landwirte befürchten eine Zunahme von Schwarzwildschäden im Umfeld von Gebieten mit jagdlichen Einschränkungen. Erschwerte Bejagbarkeit und zunehmende Wildschäden sind auch die Hauptargumente in der Diskussion um die Befriedung von Privatgrundstücken aus ethischen Gründen (§14 JWMG). Im Zuge eines Forschungsprojekts der Wildforschungsstelle zur Wildschweinproblematik im Umfeld von Schutzgebieten besenderten wir zwischen 2012 und 2015 in drei Untersuchungsgebieten mit unterschiedlichen Intensitäten jagdlichen Managements (Altdorfer Wald, Biosphärengebiet Schwäbische Alb, NSG Wurzacher Ried) 66 Wildschweine mit GPS-Satelliten-Halsbandsendern. Wir stellen Ergebnisse zum Raum-Zeit-Verhalten der Tiere vor und gehen der Frage nach, welche Rolle Jagdruhezonen dabei spielen.
Vorträge Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle...
173
„Gefühlte Effekte“ von Wolf und Luchs auf das Verhalten und die Bejagbarkeit des Schalenwildes in niedersächsischen Revieren
Egbert Strauß1,2, Reinhild Gräber2
1 Landesjägerschaft Niedersachsen, Schopenhauerstr 21, 30625 Hannover, [email protected] 2 Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, 30173 Hannover, [email protected]
Schlagworte: Befragung, Schalenwild, Wolf, Luchs
Die Rückkehr der Großprädatoren Wolf und Luchs wird von den niedersächsischen Jägern vermutlich vor allem deshalb akzeptiert, da sie in den Prozessen bei der natürlichen Wiederbesiedlungen des Wolfes bzw. der Wiederansiedlung des Luchses im Harz mit eingebunden sind. Über den Einfluss der Prädatoren auf die Schalenwildbestände und -bejagung sowie daraus resultierenden potentiellen Nachteile für die Jäger wird allerdings kontrovers diskutiert, da über die Effekte der Beutegreifer in „unserem“ Ökosystem wenig bekannt ist. Die Ausbreitung von Wolf und Luchs in Niedersachsen wird durch die Monitoringprogramme der Landesjägerschaft Niedersachsen bzw. des Nationalparks Harz detailliert dokumentiert. Beide Tierarten breiten sich in Niedersachsen regional (noch) getrennt kontinuierlich aus. Im Rahmen der Wildtiererfassung Niedersachsen (WTE) werden seit 1991 jährlich die Besätze und die Jagdstrecken verschiedener Wildarten in über 80% der Reviere (2014: n = 7702) erfasst. In den Jahren 2014-2016 wurden und werden zudem Angaben zum Vorkommen von Wolf und Luchs als auch das Meinungsbild der Jäger zu deren Effekte auf das Rot- und Rehwild auf Revierebene abgefragt. Im Frühjahr 2014 wurde in 163 Revieren das Vorkommen von Wölfen vornehmlich in der Norddeutschen Tiefebene bestätigt oder vermutet und in 108 Revieren das Vorkommen von Luchsen, vornehmlich im Harz und Weser-Leinebergland. (Die Daten aus 2015 werden zurzeit ausgewertet). In Gebieten, in denen der Wolf dauerhaft oder häufig vorkommt, nehmen die Revierinhaber in den letzten Jahren eine deutlich geringere Sichtbarkeit des Reh- und Rotwildes wahr. Zudem werden beim Rotwild zunehmend größere Rudel sowie kälberlose Alttiere im Herbst beobachtet. Inwieweit diese Beobachtungen tatsächlich auf das Vorhandensein von Wölfen zurückzuführen ist oder durch andere Faktoren (Krankheiten, Fehleinschätzungen etc.) verursacht wird, ist Inhalt zukünftiger Fragestellungen. Die Streckenentwicklung sowohl von Reh- als auch von Rotwild lassen derzeit keine deutlichen Rückgänge erkennen. Da Wolf und Luchs zunehmend in den Revieren vorkommen wird, sind solche Meinungsabfragen in der zeitlichen Entwicklung in Zusammenhang mit Jagdstrecken- und Besatzdaten besonders wertvoll, um zu entscheiden, welche Effekte großflächig auftreten und realistisch auf das Vorkommen der Beutegreifer zurückzuführen sind und welche Einflüsse „gefühlte“ Effekte darstellen. Beide sind jedoch entscheidend für die Akzeptanz dieser Beutegreifer.
Vorträge Session 29: Marktverhalten von Holzanbietern: Befragungen, Experimente... 174
Möglichkeiten der verstärkten Nutzung von Laubholz zur stofflichen Verwendung in Zukunftsmärkten (Laubholzstudie Nordrhein-
Westfalen)
Carsten Merforth1
1UNIQUE forestry and land use GmbH, Schnewlinstr. 10, 79098 Freiburg im Breisgau, [email protected]
Schlagworte: Laubholznutzung, Wertschöpfung, stoffliche Verwendung, Zukunftsmärkte
Die Bundeswaldinventur 3 zeigt, dass die Laubholzbestände bundesweit an Fläche und Volumen zunehmen. In Nordrhein-Westfalen (NRW) stieg die Laubholzfläche überdurchschnittlich seit der letzten Aufnahme um 38.000 ha. Die im gleichen Zeitraum um rd. 50 % angestiegenen Laubholznutzungen wurden weit überwiegend energetisch genutzt (rd. 80 %). Trotz des Nutzungsanstiegs sind die Vorräte im Laubholz um 14 Mio. fm weiter angestiegen. Vor dem Hintergrund des weiter fortschreitenden Waldumbaus Richtung Laubholz müssen zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit in Forstbetrieben und der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe des Holz-Clusters Märkte für Laubholz entwickelt bzw. weiterentwickelt werden. Vor diesem Hintergrund hat UNIQUE im Auftrag des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) des Landes Nordrhein-Westfalen die „Laubholzstudie Nordrhein- estfalen“ erstellt. Die Laubholzstudie NRW zeigt, wie die stoffliche Verwendung gesteigert und die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Laubholzindustrie in Nordrhein-Westfalen gestärkt werden kann. Im Einzelnen werden in der Studie die Auswirkungen von Flächenstilllegungen quantifiziert. die Entwicklung genutzter Laubholzmengen und –qualitäten analysiert. Konkrete Handlungsmaßnahmen für Betriebe und Politik in NRW formuliert. verschiedene Laubholz-basierte, zukunftsfähige Produkte für NRW genannt. erstmalig im Bundesgebiet der Laubholzeinsatz im Baubereich getrennt nach Neubau
und Modernisierung berechnet. die Entwicklung von Laubholzfassadensystemen für die energetische Gebäudesanierung
empfohlen. die Nutzungspotenziale aufgezeigt, die insbesondere bei Eiche erheblich sind.
Vorträge Session 29: Marktverhalten von Holzanbietern: Befragungen, Experimente...
175
Nachverkaufsmarketing - eine mögliche Maßnahme beim Holzverkauf als Beitrag zur Holzmobilisierung
Andrea Werner1, Tobias Stern2, Peter Schwarzbauer3
1 Kompetenzzentrum Holz — Wood K plus, Team Markt Analyse und Innovationsforschung, Feistmantelstr. 4, A-1180 Wien, Österreich, [email protected] 2 Universität Graz, Institut für Systemwissenschaften, Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung, Merang. 18/1 A-8010 Graz, Österreich, [email protected] 3 Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Marketing und Innovation, Feistmantelstr. 4, A-1180 Wien, Österreich, [email protected]
Schlagworte: Nachverkaufsmarketing, Holzmobilisierung, Kleinprivatwald
Aus der Marketingliteratur ist das sogenannte Nachkaufsmarketing bekannt: Dieses geht davon aus, dass ein Konsument nach einem getätigten Kauf für beeinflussende Kommunikation ( erbung, z.B.: „Sie haben sich für ein gutes Produkt entschieden“ oder „Sie werden sehr zufrieden damit sein“) besonders empfänglich ist, da er nachträglich nach Bestätigungen für die zuvor getroffene Entscheidung sucht. Dieses Verhalten, bestätigende Information zu suchen und widersprechende Information zu meiden baut auf grundlegende Konzepte und Theorien der Psychologie (Cognitive Response Analysis, Dissonanztheorie) auf. Für den An- und Verkauf von Holz sind solche Überlegung insofern interessant, als gerade im Kleinprivatwald, welcher auch die größten Holzreserven beinhaltet, der Holzverkauf nicht Teil der regelmäßigen beruflichen Tätigkeit ist und damit auch selten Erfahrungswerte, wie gerade eben bei Erstverkäufern vorliegen. Gleichzeitig ist der Holzmarkt für Außenstehende besonders komplex und intransparent, was vor allem in Vergleich zu anderen Märkten des täglichen Lebens zutrifft. Aus diesen Gründen erscheint die Gefahr, dass ein Holzverkäufer, insbesondere wenn es sich um Erstverkäufer oder seltene Verkäufer handelt, im Nachhinein keine Bestätigung für die von ihm getroffene Entscheidung vorfindet. Dadurch kann der Holzverkauf zu einem enttäuschenden und frustrierenden Erlebnis werden, welches in der Regel verdrängt wird und mit unangenehmen Erinnerungen verbunden wird. In einem solchen Fall wäre der Kleinwaldbesitzer für den Holzmarkt mit hoher Wahrscheinlichkeit weitgehend verloren. Das Nachverkaufsmarketing ist sozusagen die Umkehrung des Nachkaufsmarketing. Der Holzkäufer versucht den Holzverkäufer (Kleinwaldbesitzer) in seiner Entscheidung zum Holzverkauf zu bestätigen. Durch eine gezielte Verbesserung der Lieferanten-Abnehmerbeziehung beim Holzverkauf sollen insbesondere Erstverkäufer zu einer langfristigen und kontinuierlichen Marktteilnahme bewegt und damit auch Holz mobilisiert werden. Die positive Erfahrung dieser Verkäufer sollte auch ausstrahlen auf jene Kleinwaldbesitzer, die bisher nicht am Holzmarkt aktiv waren.
Die gegenständliche Studie versucht folgende Fragen zu klären: Wie gestaltet sich die Lieferanten-Abnehmerbeziehung bei Erstverkäufern? Welche Relevanz können diese Erstverkäufe für die Holzmobilisierung haben? Könnten hier mittels Nachverkaufsmarketing Verbesserungen erzielt werden? Was wären potenzielle Maßnahmen hierfür?
Vorträge Session 29: Marktverhalten von Holzanbietern: Befragungen, Experimente... 176
Präferenzen der Holzvermarktung – Ein Vergleich zwischen Holzanbietern in Bayern und zwei Schweizer Kantonen
Polia Tzanova1, Philipp Polosek1 und Roland Olschewski2
1Technische Universität München, Lehrstuhl für Forstliche Wirtschaftslehre, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, D-85354 Freising, [email protected], [email protected] 2Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Zürcherstr. 111, CH-8903 Birmensdorf, [email protected]
Schlagworte: Choice Experiment, Institutionenökonomie
Neben der Anzahl und Größe der Marktteilnehmer hat deren Marktverhalten entscheidenden Einfluss auf die gehandelte Holzmenge und den Holzpreis. Um Informationen über das Entscheidungsverhalten verschiedener Marktakteure zu gewinnen, wurde eine Umfrage bei Forstbetrieben in Oberbayern und Unterfranken sowie in zwei Schweizer Kantonen durchgeführt. Hauptbestandteil der Befragung war ein sogenanntes Choice Experiment (CE). Dabei wurden den Holzanbietern verschiedene Optionen für einen Geschäftsabschluss vorgelegt. Die Optionen waren durch bestimmte Attribute und ihre jeweiligen Ausprägungen (Levels) gekennzeichnet. Dazu gehören die Vertragslaufzeit, ein Preis-Auf- oder -Abschlag im Vergleich zum Direktverkauf, die Art des Vertragspartners (Forstbetriebsgemeinschaft/ Bündler, Holzhändler oder Forstunternehmer) sowie die Dauer der bisherigen Geschäfts-beziehung. Jedem Forstbetriebsleiter wurden nacheinander 12 solcher Entscheidungs-situationen mit der Maßgabe vorgelegt, jeweils die beste und schlechteste Option anzukreuzen. Es konnte immer auch der jeweilige Status quo gewählt werden, d.h., die zurzeit beim Hauptsortiment des Forstbetriebs vorherrschende Situation. Mittels statistischer Auswertung (Multinomialer Logit Ansatz) konnte bestimmt werden, wie wichtig die Attribute sind und ob sie einen positiven oder negativen Effekt auf die Entscheidung haben. Die Resultate und insbesondere der Vergleich zwischen den verschiedenen Regionen geben wichtige Einsichten in das Entscheidungsverhalten von Holzanbietern. Es zeigte sich unter anderem, dass das Holzangebot nicht allein durch den Preis bestimmt wird. Auch die Art des Absatzkanals und die Dauer der bisherigen Geschäftsbeziehung haben einen wichtigen Einfluss auf den Geschäftsabschuss. Ferner wird in einigen Regionen der Status quo signifikant bevorzugt. Auf Basis dieser Erkenntnisse können praxisrelevante Empfehlungen, etwa zur Steigerung des Holzangebotes, gegeben werden. Um erfolgreich zu sein, sollten etwaige Fördermaßnahmen die regionalen und institutionellen Besonderheiten berücksichtigen und nicht allein auf den Einfluss von Preissignalen setzen.
Vorträge Session 29: Marktverhalten von Holzanbietern: Befragungen, Experimente...
177
Geduld, Erwartungen und Vertrauen als verhaltensökonomische Determinanten der Lieferkettenstruktur für Rundholz in der Schweiz
Christian Kimmich1 und Urs Fischbacher2 1Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL, Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf (ZH), [email protected] 2Universität Konstanz und Thurgauer Wirtschaftsinstitut
Schlagworte: Verhaltensökonomik, Wertschöpfungsketten, Schweiz, Rundholzmarkt
Why do markets and hierarchies frequently coexist within an industry for the same transaction (Ménard, 2013)? One mode could be expected to be more efficient for a given transaction, and therefore dominate. To explain vertical integration when also markets could govern the same transaction has been a key objective in economics (Coase, 1937). The transaction properties and property rights related to a good or service have been found to be crucial determinants of vertical and lateral integration (Grossman & Hart, 1986; Williamson, 1979). Similar types of goods, services and production processes should therefore lead to similar structures of vertical integration or separation via markets. Yet, we often find coexistence of different forms of vertical integration as well as markets within one sector with similar transaction properties. We suggest that behavioral heterogeneity may play an important role that has been neglected in theoretical and empirical analyses so far. Two key behavioral variables in economic theory are time preferences and expectations. Both are crucial in household consumption and savings decisions, but may also influence institutional choices of firms. For example, patience may positively influence investment decisions into potentially more profitable institutions, while overly optimistic price expectations could prevent searching for such alternatives. Conversely, impatient managers may strongly discount the future returns of investments in institutions, while pessimistic price expectations may lead them to invest in alternatives. A second set of behavioral variables comprises social preferences. Trust has been found to be a key determinant in investment decisions (Berg, Dickhaut, & McCabe, 1995), including supplier relations (Sako & Helper, 1998). Thus, we can hypothesize that trust in a specific trading partner and trading partner types will be crucial in their selection. We find that all three behavioral dimensions are related to the choice of the sales channel. Optimistic price expectations are significantly correlated with selling directly, while pessimistic expectations suggest adaptation to the economically more efficient contracting of harvesting operations. Most importantly, trust is a key determinant in transfering rights to harvest to a contractor. Thus, the integration of behavioral biases and heterogeneity can add explanatory power to understand the alignment of property rights in a given industry.
Vorträge Session 29: Marktverhalten von Holzanbietern: Befragungen, Experimente... 178
Agentenbasierte Modellierung des Schweizer Holzmarktes
Stefan Holm1 und Oliver Thees1
1Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, [email protected] Schlagworte: Agentenbasierte Simulation, Choice Experimente, Holzmarkt, Holzversorgung
In diesem Projekt analysieren Forschende der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL die Funktionsweise von Schweizer Holzmärkten anhand von Fallbeispielen und erklären sie auf der Basis ökonomischer Theorie. Die Ergebnisse fliessen in die Entwicklung eines agenten-basierten Modells ein. Dieses soll ermöglichen, Szenarien für die zukünftige Holzverfügbarkeit und -versorgung darzustellen und Möglichkeiten für die Einflussnahme durch ökonomische Instrumente aufzuzeigen. Durch die Produktion von Holz sichert der Forstsektor eine wichtige Grundlage für die nachhaltige Ressourcennutzung in der Schweiz. Angesichts der verschiedenen Nutzungsarten von Holz herrscht jedoch eine Nachfragekonkurrenz. Daher reicht es nicht aus zu wissen, wie viel Holz nachwächst, sondern es stellt sich auch die Frage, unter welchen Umständen und für wen es tatsächlich verfügbar ist. Dabei spielt das bisher wenig erforschte Verhalten der Akteure im Forstsektor eine wesentliche Rolle. Das Projekt zielt auf einen wirtschaftswissenschaftlichen und forstpolitischen Erkenntnisgewinn in diesem Bereich. Durch die Verknüpfung mit einer agenten-basierten Modellierung bietet es die Chance, individuelle Angebots- und Nachfrageänderungen sowie externe Einflüsse zu simulieren und Szenarien für eine effiziente und nachhaltige Ressourcennutzung zu entwickeln. Auf Basis neuerer Ansätze der Verhaltens- und Institutionenökonomik werden spezifische Erklärungsansätze für das Akteursverhalten auf der Angebots- und Nachfrageseite von Holzmärkten entwickelt. Mithilfe dieser Ergebnisse sowie von Erkenntnissen aus partizipativen Prozessen in den Fallstudienregionen wird das Marktgeschehen abgebildet und die Funktionsweise des Marktes beispielhaft dargestellt. Dazu werden die Marktstruktur und das Akteursverhalten in einem agenten-basierten Modell erfasst, in dem zum Beispiel verschiedene Eigentümerkonstellationen sowie Transaktionskosten und Vertragsgestaltungen analysiert werden können. Der Erkenntnisgewinn basiert dabei auf der Analyse von Szenarien für bestimmte Marktsituationen, die Aufschluss über die zu erwartende Verfügbarkeit des Holzes und dessen Verwendung geben können. Im Vortrag werden die Vorteilhaftigkeit der agentenbasierten Modellierung für die Holzmarktanalyse, das Vorgehen bei der Analyse des Marktverhaltens und der Konzeption des Computermodells sowie Ergebnisse der Simulationen aufgezeigt.
Poster Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel
179
Site Suitability and Tree Species Selection in Forestry of Temperate Regions - a Literature Review
Sofche Spasikova1, Stefanie Gärtner1,2 and Albert Reif1
1Chair of Site Classification and Vegetation Science, Faculty of Environment and Natural Resources, Albert-Ludwigs-University, Tennenbacher Str. 4, D-79085 Freiburg, [email protected]; [email protected] 2Ecosystem Monitoring, Research and Conservation, Black Forest National Park, Kniebisstraße 67, D-77740 Bad Peterstal-Griesbach, [email protected]
Keywords: criteria classification, decision transparency
Information on site and production potential is central in natural resource management. Site classification, an essential part of forest management is given much attention which resulted in multiple sophisticated methods developed in the past decades. However, literature indicates that forest owners do not optimally apply this site information during selection of tree species, thus, the choice of species often results from the subjective decision of forestry practitioners. Literature further suggests that this occurs because site suitability, the most important requirement for the choice of tree species, continues to be rarely defined or identified based on pre-defined sets of rules and criteria, since they are usually not clearly documented and structured. The outcome is a non-transparent decision-making process for tree species selection in forestry. The objective of this study is to provide classification of decision-making criteria for site suitability and tree species selection. Clarifying the hierarchy, relationships and complementarity between criteria provides support for transparent decision-making in the ranking of forest owner´s criteria when applied in forestry practice. Generally, criteria used for tree species selection can be divided into economic and ecological ones. Economic criteria, such as productivity and growth performance, have been applied since sustainable timber production has been a goal in forestry. In the past two decades, selecting species more suitable to the site, more resilient towards disturbances and adaptive to changing climate is gaining more importance. The set of criteria compiled in this review has potential use in forestry, as it can be used as a framework of decision-making criteria and indicators for the targeted ecosystem functions and services of forests owned by different groups of owners. Additionally, this framework can be used by public forest owners to present a transparent decision-making process for tree species selection suitable to the site.
Poster Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel 180
Erste Ergebnisse zur Mortalität, Vitalität und Wuchsstrategie fremdländischer Baumarten im Anbauversuch in Thüringen
Nico Frischbier1, Johannes Brodowski2
1ThüringenForst-AöR, Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum (FFK), Jägerstraße 1, D-99867 Gotha, [email protected] 2 - ohne -
Schlagworte: Mortalität, Vitalität, Fremdländer, Klimawandel
In Klimaanpassungsstrategien des Sektors Wald- und Forstwirtschaft wird der vorausschauenden, klimawandelangepassten Baumartenwahl eine besondere Bedeutung beigemessen. Dabei sind u.a. auch Ablösungen bzw. Ergänzungen heimischer Waldbilder und Baumarten durch allochthone Baumarten zur Aufrechterhaltung oder sogar zur Maximierung ausgewählter Waldfunktionen im Gespräch. Voraussetzung dafür ist, dass ausreichend Erkenntnisse über die Anbaumöglichkeiten fremdländischer Baumarten und deren ökologische Folgen im potentiellen Anbaugebiet vorliegen. Nur für wenige, ausgewählte Arten ist der Wissensstand dazu inzwischen befriedigend. Andere Baumarten aus trocken-warmen Arealen der Erde sind dagegen noch weitestgehend unerforscht, gleichwohl mit Hilfe von Selektionsroutinen und Literaturrecherchen ihr Klima- und Nutzwertpotential speziell für mildere Klimabereiche Mittel- und Süddeutschlands nachgewiesen wurde (Schmiedinger et al. 2009). Für Orientbuche (Fagus orientalis LIPSKY), Silberlinde (Tilia tomentosa MOENCH.), Türkische Tanne (Abies bornmülleriana MATTF.), Libanonzeder (Cedrus libani RICH.) und Westamerikanische Hemlocktanne (Tsuga heterophylla (RAF.) SARG.) wurde daher durch die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft Saat- und Pflanzgut aus den natürlichen Arealen akquiriert, in Forstbaumschulen aufgezogen und anschließend im Rahmen eines koordinierten Anbauversuches auf Flächen in Bayern, Thüringen, Österreich und der Schweiz verteilt (Metzger et al. 2012). Pflanzungen erfolgten im Landeswald von ThüringenForst-AöR im Herbst 2012. Als Referenz wurde zusätzlich die Trauben-Eiche (Quercus petraea (MATT.) LIEBL.) angepflanzt. Seitdem wird jedes Jahr die Winter- und Sommermortalität erhoben. Da dies auch für die Nachbesserungen aus dem Frühjahr 2014 gilt, ist inzwischen zusätzlich eine zweite Beurteilung der Überlebensraten möglich. Auf der Thüringer Fläche sind außerdem 2013 intensive Aufnahmen erfolgt (Brodowski 2015), die u.a. Auswertungen zur räumlichen Variabilität der Vitalität der Pflanzen innerhalb einzelner Parzellen nach dem ersten Standjahr mit Hilfe von GIS-Analysen erlauben. Ergänzend können inzwischen auch diverse Beobachtungen zu den Eigenarten und Wuchsstrategien der Baumarten im Versuch vorgestellt werden.
Poster Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel
181
Verändert der Klimawandel die Jahrringstruktur der Traubeneichen?
Malte Gille1, František Hapla1 und Stefan Seegmüller2
1Holzbiologie und Holzprodukte, Universität Göttingen, Büsgenweg 4, 37077 Göttingen, [email protected] 2Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz, Hauptstraße 16, 67705 Trippstadt, [email protected]
Schlagworte: Eiche, Klimawandel, Holzeigenschaften
Früh- und Spätholzanteile beeinflussen den Wert von Eichenholz. Bisher unbekannt ist, ob der Klimawandel und die CO2-Anreicherung der Atmosphäre die Jahrringstruktur verändern. Deshalb wurden Traubeneichen aus dem kühlhumiden inneren Pfälzerwald und von der warm-ariden Weinstraße in einer orientierenden Untersuchung hinsichtlich ihrer Wachstumsreaktionen auf die Klimaänderungen hin geprüft. Die Frühholzbreite der Eichen reagierte nicht auf veränderte Stickstoffdepositionen, sondern hing im kühlhumiden Klima vom atmosphärischen CO2-Gehalt während der Vegetationszeit des Vorjahres ab. Trockenheit und Wärme behindern den Effekt der CO2-Düngung. Bei ausreichender Wärme steigt die Spätholzbreite mit der Wasserversorgung an. Allerdings sind die Lagen des inneren Pfälzerwaldes in vielen Jahren zu kühl für ein nennenswertes Spätholzwachstum, während trockene Sommer entlang der Weinstraße die Jahrringbreite hemmen. Vorläufiges Fazit ist, dass das Eichenholz milder werden dürfte. Dies wird im inneren Pfälzerwald durch mehr Frühholz bei konstanter Spätholzbreite erreicht, so dass wohl das Ertragsniveau steigen wird. Im Weinbauklima sinkt bei lediglich schwach zunehmender Frühholzbreite der Spätholzanteil mit dem Effekt eines geringeren Ertragsniveaus.
Poster Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel 182
Die Lichtkegelverjüngung - Neue Wege bei der Naturverjüngung der Taubeneiche im Pfälzerwald
Bernd Rose1, Hans-Peter Ehrhart1
1 Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft, Hauptstraße 16, 67705 Trippstadt, [email protected]
Schlagworte: Traubeneiche, Naturverjüngung, Lichtkegelverjüngung, Lichtbedarf der Eiche
Bei der Umsetzung naturnaher Waldbaukonzepte wird in den letzten Jahrzehnten verstärkt auf die natürliche Verjüngung gesetzt, mit dem Ziel ungleichaltrige, möglichst standortsheimische Wälder aufzubauen. Großflächige, systematische Eingriffe in die Waldökosysteme zur Einleitung der Verjüngung werden dabei abgelehnt. Dies kommt den Schattbaumarten wie Buche und Tanne entgegen. Dagegen fällt es zunehmend schwerer die Verjüngungsziele bei Lichtbaumarten, wie den Eichen, zu erreichen. Einzelne Untersuchungen kommen sogar zu dem Schluss, dass sich die Eiche, speziell die Traubeneiche im Pfälzerwald, nicht für eine kleinflächige Verjüngung eignet. Eine besondere Brisanz bekommt die Diskussion durch die Forderungen des FSC die Flächengröße von Verjüngungsfemeln auf 0,3 ha zu beschränken. Es stellt sich unter dieser Prämisse die Frage, ob sich der Eichenanteil im Pfälzerwald dauerhaft halten lässt. Die Eiche ist mit rund 10% Flächenanteil im Pfälzerwald vertreten (WILHELM, 2014). Aufgrund ihrer weit überdurchschnittlichen Holzqualität ist die Pfälzerwaldeiche in den erlösmäßig attraktiven Marktsegmenten Furnierindustrie und Fassholz konstant gut nachgefragt und kann zu Spitzenerlösen vermarktet werden. Andererseits gelten Stiel- und Traubeneiche wegen der hohen Anzahl der auf sie spezialisierten Arten als „Schlüsselbaumarten zum Erhalt der Biodiversität in äldern“ (JEDICKE und HAKES, 2005). Da der Traubeneiche aufgrund ihrer Trockenstresstoleranz auch in der für unsere Breiten projizierten Ausprägung des Klimawandels eine positive Entwicklung zugetraut wird (SCHNEIDER et al., 2014), kommt der erfolgreichen Verjüngung der Eichenwälder auch im Pfälzerwald für die Zukunft eine besondere Bedeutung zu. Landesforsten Rheinland-Pfalz hat deshalb im Herbst 2009 nach einer Teilmast der Traubeneiche 2 Versuchsflächen angelegt, um die natürliche Verjüngung der Eiche auf kleiner Fläche unter für die Eiche optimierten Lichtbedingungen zu untersuchen, die sogenannte Lichtkegelverjüngung. Es werden das Verfahren und erste Ergebnisse vorgestellt.
Poster Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel
183
Anpassungsfähigkeit von Eichen an den Klimawandel
Leila Arab1 und Stefan Seegmüller
1Professur für Baumphysiologie, Institut für Forstbotanik und Baumphysiologie, Universität Freiburg, Georges-Köhler-Allee 53/54, 79110 Freiburg, [email protected] 2Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz, Hauptstraße 16, 67705 Trippstadt, [email protected]
Schlagworte: Eiche, Trockenstress, Klimawandel
Einige Forstverwaltungen forcieren vor dem Hintergrund des Klimawandels den Anbau sogenannter Trockeneichen. Unbekannt ist aber bisher, ob solche Eichen besondere Eigenschaften für den Umgang mit dem Klimawandel besitzen. Deshalb zielt der Beitrag darauf, den Umgang verschieden arider Eichenherkünfte mit Trockenheit zu charakterisieren. Er soll die Frage beantworten, ob die Verbreitung sogenannter Trockeneichen eine sinnvolle und notwendige Strategie im Klimawandel darstellt. „Trockeneichen“ haben in einer günstigen Umwelt einen besseren asserstatus und ein reduziertes antioxidatives System. Offensichtlich gibt es Eichen, die besonders günstige Voraussetzungen für die Abwehr von Trockenstress bereithalten. Andererseits können alle bisher untersuchten Herkünfte unabhängig von ihren Leistungen in einer günstigen Umwelt unter arider Belastung ihren Wasserstatus aufrechterhalten und ihr antioxidatives System vollumfänglich aktivieren. Anscheinend können auch die kühlhumiden Herkünfte mit dem Klimawandel schadlos umgehen. Deshalb kommt die Untersuchung zum Fazit, dass die älder der Zukunft eher keine „Trockeneichen“ brauchen.
Poster Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel 184
Baumarteneignung unter Klimawandel in Baden-Württemberg: Überblick und Konzept
Konstantin v. Teuffel 1*, Axel Albrecht 1
1FVA Baden-Württemberg, Wonnhaldestr. 4, 79100 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Anschlussfähigkeit, Aktualisierung Klimaprognosen, Klimaschutz, Anpassungsstrategie
Dies ist der erste von zwei Teilbeiträgen zum Thema Baumarteneignung unter Klimawandel in Baden-Württemberg und bezieht sich überwiegend auf Projekte an der FVA Baden-Württemberg. Als Überblicksvortrag werden die diversen Anknüpfungspunkte thematisiert, die bei der Dynamisierung der Baumarteneignungsbeurteilung beachtet wurden. Diese gliedern sich in wissenschaftlich-methodische und umweltpolitische Aspekte. Die Anschlussfähigkeit zu bisherigen Verfahren der Baumarteneignungsbeurteilung stellt den Ausgangspunkt der wissenschaftlich-methodischen Aspekte dar. Wichtig ist die Anschlussfähigkeit, damit die Veränderung der Baumarteneignung kontinuierlich darstellbar wird, ohne einen Methodenbruch zur Vergangenheit aufzuweisen. Darauf aufbauend werden die zu dynamisierenden einzelnen Ökosystemkomponenten identifiziert, die dann später zur gesamten Baumarteneignung aggregiert werden. Außerdem wird erläutert, wie konzeptionell berücksichtigt wurde, dass in Zukunft mit Aktualisierungen der Klimaprognosedaten zu rechnen ist. Sehr umfangreich sind die Berührungspunkte zwischen dynamisierter Baumarteneignung und umweltpolitischen Aspekten. Beispielhaft werden die Anpassungsstrategie des Landes Baden-Württemberg mit konkreten Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld Wald und Forstwirtschaft, oder auch die deutsche Anpassungsstrategie genannt. Auch Aspekte des Anpassungsmonitorings sowie des Klimaschutzgesetzes werden geschildert. Zum Abschluss wird auf umweltpolitische Baustellen hingewiesen, die Relevanz für die Baumartenwahl und Baumarteneignung besitzen. Beispielhaft wird hier auf Zielkonflikte zwischen Klimaschutz und Naturschutz eingegangen, wie sie in Widersprüchlichkeiten zwischen der Förderung erneuerbarer Energien, Energiewende, Nachhaltigkeit und Emissionsreduktion auf der einen Seite und Naturschutzzielen auf der anderen Seite zum Ausdruck kommen. Die Darstellung der umweltpolitischen Aspekte soll den Tagungsteilnehmern die Gesamtzusammenhänge der Klimafolgenforschung und die Verbindlichkeit und Motivation für die einzelnen Forschungsprojekte in Baden-Württemberg vergegenwärtigen.
Poster Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel
185
Ergebnisse der bayerischen Douglasien-Herkunftsversuche der Versuchsreihen 1973 bis 1984
Gerhard Huber1, Claudia Storz1, Bernd Stimm2, Monika Konnert3, Reinhard Mosandl2
1 Bayer. Amt für forstliche Saat und Pflanzenzucht, Forstamtplatz 1, 85317 Teisendorf, [email protected], [email protected] 2 Technissche Universität München, Lehrstuhl für Waldbau, Hans-Carl-von- Carlowitz-Platz 2, 85354 Freising, [email protected], [email protected] 3 Bayer. Amt für forstliche Saat und Pflanzenzucht, Forstamtplatz 1, 85317 Teisendorf, [email protected]
Schlagworte: Douglasie, Provenienz, Herkunftsversuch, Anbaueignung
Die Douglasie verfügt über ein großes Verbreitungsgebiet im Nordwesten Nordamerikas mit einer breiten ökologischen Amplitude. Schon sehr früh wurde bei der Douglasie die Bedeutung der Herkunft für den erfolgreichen Anbau in Europa erkannt. Nach herben Rückschlägen durch das Auftreten der Douglasien-Schütten in Baden-Württemberg und Bayern nahm der Anbau der Douglasie aufgrund ihrer bekannten Leistungsfähigkeit ab Ende der 60iger Jahre wieder zu. Im Zuge des Klimawandels ist eine weitere deutliche Zunahme der Anbaufläche zu beobachten (BWI 3), der die Frage nach geeigneten Provenienzen aus den Ursprungsgebieten erneut befeuert. Zur Klärung der Herkunftsfrage wurden ab 1973 in Bayern mehrere Versuchsreihen mit verschiedenen Provenienzen aus dem nordamerikanischen Verbreitungsgebiet angelegt. Die Versuche enthalten überwiegend Herkünfte aus verschiedenen Samenzonen der US-Bundesstaaten Washington und Oregon sowie aus Britisch Columbia (Kanada). Die ältesten dieser Versuchsflächen werden seit über 40 Jahre beobachtet und regelmäßig aufgenommen. Die vorliegende Untersuchung beschreibt die Wachstumsunterschiede der Herkünfte für vier Anbauregionen Bayerns. Hierzu wurden zahlreiche Aufnahmen über die Höhen- und Durchmesserentwicklung sowie zu phänologischen Parametern der Provenienzen ausgewertet. Wie die Ergebnisse zeigen, sind die Provenienzen der grünen Douglasie in Bayern überdurchschnittlich wüchsig und den Inland-Herkünften meistens überlegen.
Poster Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel 186
Der Waldklimafonds – ein Beitrag zur Erreichung der Ziele der Klimapolitik der Bundestregierung
Astrid Uhlmann1 , Marianne Wagner1
1Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, 53168 Bonn, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Wald, Klima, Projektförderung
Der im Juli 2013 gestartete Waldklimafonds wird gemeinsam vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) getragen, aus Mitteln des Energie- und Klimafonds finanziert und vom Projektträger der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) umgesetzt. Der Waldklimafonds hat sich mittlerweile als anerkanntes Fördermittel im Querschnittsbereich Wald/Klima/Biodiversität etabliert. Bisher konnten bereits 33 Projekte mit 90 Teilvorhaben und einem Fördervolumen von 33,6 Millionen Euro für die Jahre 2013 bis 2019 bewilligt werden. Die Vorhaben zielen auf die mit der Förderrichtlinie des Waldklimafonds festgelegten fünf Schwerpunkte ab: - Anpassung der Wälder an den Klimawandel, - Sicherung der Kohlenstoffspeicherung und Erhöhung der CO2-Bindung von Wäldern, - Erhöhung des Holzproduktspeichers sowie der CO2-Minderung und Substitution durch
Holzprodukte sowie - Forschung und Monitoring (zu den 3 oben genannten Förderschwerpunkten) und - Information und Kommunikation (zu den 3 oben genannten Förderschwerpunkten). Das Themenspektrum umfasst beispielsweise neue Konzepte, um Wälder besser an den Klimawandel anzupassen, die Erprobung von Möglichkeiten der Risikoabschätzung und des -managements klimawandelgefährdeter Wälder, modellhafte Maßnahmen zur Wiedervernässung und Renaturierung wertvoller Waldmoore und Feuchtwälder, praxisorientierte Konzepte für den effizienten, klimaoptimierten Holzeinsatz sowie Informations- und Aufklärungsprojekte für unterschiedliche Zielgruppen. Bemerkenswert ist der nach wie vor hohe Anteil länder- und institutionenübergreifender Verbundvorhaben. Antragsteller und Interessierte finden nähere Informationen zum Waldklimafonds unter www.waldklimafonds.de . Neben den oben genannten Bewilligungen liegen derzeit 16 neu eingereichte Skizzen mit einem Fördervolumen von rd. 14,8 Mio € vor, ferner befinden sich 19 Anträge mit 50 Teilprojekten und einem Fördervolumen von rd. 12,8 Mio € in Bearbeitung. Hier erfolgt dann eine kurze Analyse der Projekte: Handlungsfelder, regionale Verteilung der Zuwendungsempfänger, Zielgrupen usw. Ausblick: Die dargestellte Entwicklung bestätigt, dass der Waldklimafonds in seiner Außenwirkung als wichtiges Steuerungsinstrument der Bundesregierung bei der Bewältigung des Klimawandels wahrgenommen wird und auch ein wichtiges Instrument zur Umsetzung der Waldstrategie 2020 der Bundesregierung darstellt. Um den WKF weiterhin in den Fachkreisen und der interessierten Öffentlichkeit präsent zu halten, ist geplant, im Frühjahr 2017 einen Waldklimafonds-Kongress zu veranstalten, der sich nicht nur an Projektbeteiligte wendet, sondern auch die breite wald- und forstinteressierte Öffentlichkeit im Fokus hat.
Poster Session 1: Baumartenwahl im Klimawandel
187
Epiphytische Flechten und Moose an Schwarznuss (Juglans nigra L.) in der Pfälzer Rheinaue – ein Beitrag zur Untersuchung der ökologischen
Einnischung in die natürliche Auewaldgesellschaft
Ernst Segatz1, Volker John2 und Norbert J. Stapper3
1 Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft, Hauptstraße 16, 67705 Trippstadt, [email protected] 2Dr. Volker John, Kaiserslautererstraße 86, 67098 Bad Dürkheim, [email protected] 3Büro für Ökologische Studien, Verresbergerstraße 55, 40789 Monheim a.R., [email protected]
Schlagworte: Schwarznuss, Moose, Flechten, Epiphyten
Im Bereich des Forstamts Pfälzer Rheinauen wurden in den Jahren 2014 und 2015 auf drei Auewaldstandorten der Rheinebene insgesamt 15 Schwarznussbäume auf ihren Flechten- und Moosbewuchs hin untersucht. Zur besseren Interpretation der Artvorkommen wurden auf denselben Standorten auch die Flechten und Moose auf den natürlich vorkommenden Baumarten Pappel, Esche, Bergahorn und Rotbuche bestimmt. Über die Erstellung von Artenlisten hinaus wurden Erkenntnisse über die unterschiedlichen Vorkommen auf den Segmenten Stammfuß, Stamm und Krone der einzelnen Bäume sowie über die unterschiedliche Besiedlung der Baumarten gewonnen. Die Moose wurden nach Lebermoosen sowie Akrokarpen und Pleurokarpen Laubmoosen unterschieden, die Flechten nach ihren Wuchsformen in Krustenflechten, Laub- oder Blattflechten und Strauchflechten. Die Epiphyten-Arten wurden darüber hinaus hinsichtlich ihrer Zeigerwerte für Immissionen, Eutrophierung, Klimawandel und ihrer potenziellen Eigenschaft als “Altwaldarten“ analysiert. Von besonderem Interesse war der Vergleich zwischen Schwarznuss und Esche, da diese zurzeit durch das Eschentriebsterben beeinträchtigt wird.
Poster Session 2: Genetik der Gehölze im Klimawandel 188
Physiologische Untersuchungen von Klonen und Nachkommenschaften von Picea abies zur Resistenz gegenüber Trockenstress
André Zeibig1, Heino Wolf1
1 Staatsbetrieb Sachsenforst, Kompetenzzentrum für Wald und Forstwirtschaft, Referat Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung, Bonnewitzer Str. 34, D-01796 Pirna OT Graupa, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Picea abies, Trockenstress, Resistenz, hydraulische Leitfähigkeit
Picea abies ist und bleibt auf absehbare Zeit die bedeutendste Wirtschaftsbaumart in Deutschland. Wegen ihres relativ großen Wasserbedarfs und des für die nächsten Jahrzehnte prognostizierten erhöhten Trockenstressrisikos wird sie voraussichtlich mit am stärksten vom Klimawandel beeinflusst werden. Eine weitere züchterische Bearbeitung dieser Baumart unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der SO2-Resistenzzüchtung soll zur Bereitstellung von höherwertigem klimaangepassten forstlichem Vermehrungsgut im Rahmen des bundesweiten Züchtungsvorhabens FitForClim beitragen. Physiologische Untersuchungen zur Trockenstressresistenz sollen die Auslese von Plusbäumen zur Bildung von Zuchtpopulationen unterstützen. Im Rahmen einer Voruntersuchung wurden sechs Klone von Picea abies mit unterschiedlicher SO2-Resistenz auf die Resistenz gegenüber Trockenheit getestet. Dazu wurden Zweige mit jeweils ein- bis vierjährigen Trieben aus dem 6. Wirtel der Lichtkrone im Winterzustand von ca. 30jährigen Individuen des Klonarchivs Graupa entnommen. Einjährige Zweigabschnitte wurden einem Welketest in einer Klimakammer unter konstanten Bedingungen unterzogen. Von zwei bis vierjährigen Zweigabschnitten wurde die maximale hydraulische Leitfähigkeit des Xylems vor und nach einer Trockenstressbelastung, die mit einer Scholander-Druckkammer in ausgewählten Druckstufen simuliert wurde, gemessen. Die einjährigen Triebe welkten in Abhängigkeit vom Zweigdurchmesser innerhalb von 21-27 Tagen bis nahe zum Trockengewicht. Zwischen den Gruppen der Klone wurden zunächst keine signifikanten Unterschiede im zeitlichen Verlauf des Gewichtsverlustes der Zweigabschnitte ermittelt. Die zwei- bis vierjährigen Zweigabschnitte zeigten überwiegend eine straffe Abhängigkeit der Eingangs-Leitfähigkeit vom Zweigabschnittsdurchmesser. Sie wiesen eine markante Zunahme des Leitfähigkeitsverlustes mit Erhöhung des Druckes nach simuliertem Trockenstress auf. Dabei zeichnete sich kein deutlicher Trend im Leitfähigkeitsverlust zwischen den Gruppen der Klone ab, jedoch trat eine relativ große Streuung der Werte innerhalb einer Gruppe auf. Ein Zusammenhang zwischen SO2- Resistenz und Trockenstress-Resistenz konnte vorerst nicht bestätigt werden. Die Ergebnisse beider Tests basieren auf einer sehr geringen Klonanzahl und lassen daher noch keine endgültigen Schlussfolgerungen auf die Trockenresistenz der Klone zu. Eine Wiederholung der Untersuchung mit einer deutlich höheren Stichprobengröße ist in Durchführung.
Poster Session 2: Genetik der Gehölze im Klimawandel
189
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut der Hybrid-Lärche und Aspe in Vorwaldsystemen – eine Option für die Anpassung an den
Klimawandel?
María del Carmen Dacasa-Rüdinger1, Wolfgang Hüller1, Heino Wolf1
1Staatsbetrieb Sachsenforst. Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft, Referat Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung. Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Vorwald, Klimawandel, hochwertiges Vermehrungsgut
Die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald sind längst spürbar; langsame Prozesse wie die Verschiebung der Artenverteilung sind im Gange, aber auch drastische Effekte wie der Ausfall großer zusammenhängender Waldareale sind immer häufiger anzutreffen. Die Wahl von standortgerechten Baumarten unter Berücksichtigung der zukünftigen klimatischen Verhältnisse sowie eine richtige waldbauliche Behandlung der Bestände sind entscheidende Aspekte einer klimaangepassten Forstwirtschaft, um die Vitalität und Stabilität der Wälder zu bewahren und deren Ertragsvermögen dabei zu erhalten. Vorwaldsysteme mit Pionierbaumarten können eine interessante Option für die Anpassung an den Klimawandel darstellen. Diese Baumarten sind gegenüber Klimaextremen besonders resistent. Als Vorwald bieten sie der Zielbaumart Schutz gegenüber Frost, Trockenheit und Wind und verbessern zudem die Bodeneigenschaften. Dank ihres raschen Wachstums sind kurze Umtriebszeiten möglich, was Vorerträge bringt und den Risikozeitraum verkürzt. Die Mischung mit der Zielbaumart streut das Produktionsrisiko und macht unterschiedliche Zielsortimente möglich. Für den Erfolg dieses Bewirtschaftungskonzepts ist der Auswahl des richtigen Forstvermehrungsgutes und dessen genetischen Hintergrunds besondere Beachtung zu schenken. An den Standort angepasste Herkünfte und gezüchteten Sorten erhöhen die Bestandesvitalität und -qualität sowie die Volumenproduktion erheblich. Die Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut als Vorwald wird im Rahmen des Projekts DendroMax zurzeit auf verschiedenen Flächen in Sachsen demonstriert. Im Forstbezirk Leipzig wurden Aspen aus in vitro-Kultur truppweise in Verband 3 x 2 m in einer 1,5 ha großen Fläche zusammen mit Eichentrupps im Mai 2014 eingebracht. Betriebszieltyp war hier die Umwandlung von einem Fichtenreinbestand zu einem Stieleichenbestand. Eine weitere 1,2 ha große Fläche im selben Forstbezirk wurde im April 2015 mit Hybridlärche aus somatischer Embryogenese bepflanzt. Als Hauptverband wurde ein Abstand von 3 x 3 m gewählt. Ziel der Maßnahme war der Umbau von Fichte zum Lärchen-Buchenbestandeszieltyp. Die ersten Schlussfolgerungen bezüglich Anwuchs und Qualität der Pflanzen nach Anlage der Flächen sowie über das verwendete Pflanzen- und Schutzsystem und über die Pflegemaßnahmen werden in diesem Beitrag präsentiert.
Poster Session 2: Genetik der Gehölze im Klimawandel 190
Potenzial von amerikanischen und europäischen Herkünften der Rot-Eiche in Deutschland
Mirko Liesebach1, Volker Schneck2 und Christoph Rieckmann1
1Thünen-Institut für Forstgenetik, Sieker Landstraße 2, 22927 Großhansdorf, [email protected], [email protected] 2Thünen-Institut für Forstgenetik, Eberswalder Chaussee 3 a, 15377 Waldsieversdorf, [email protected]
Schlagworte: Quercus rubra, Wachstum, Klimawandel, Stammform
Die Rot-Eiche (Quercus rubra L.) ist die häufigste nichtheimische Laubbaumart in Deutschland. Da über die genetische Variation der Baumart wenig bekannt ist, wurden in den Jahren 1991 und 1993 zwei Serien mit jeweils vier Herkunftsversuchen angelegt. In jeder Serie befindet sich eine Fläche in Brandenburg, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Das Pflanzgut, von 25 amerikanischen und 15 europäischen, überwiegend deutschen Herkünften der Rot-Eiche wurde in der Institutsbaumschule in Großhansdorf angezogen. Auf den Flächen wurden die Überlebensraten, biotische und abiotische Schäden aufgenommen sowie Höhen- und Dickenwachstum gemessen. Die beiden Flächen in Niedersachsen mussten bereits im Jahr der Anlage aufgegeben werden. Auf den anderen Flächen verlief die Entwicklung positiv mit ähnlichen Überlebensraten. Beim Wachstum sind Unterschiede im Jugendalter zwischen den Flächen aufgetreten. Zwischen den Herkünften zeigen sich Unterschiede sowohl im Wachstum als auch in der Qualität der Stammform. Zwischen dem Auftreten von Rindenbrand und der Ausformung der Stämme besteht ein Zusammenhang. Auf den kontinentaler geprägten Standorten erweist sich die Rot-Eiche als Baumart mit Potenzial für den Klimawandel. Saatgut für den Anbau der Rot-Eiche sollte in wüchsigen, möglichst qualitativ hochwertigen Beständen in Deutschland gewonnen werden. Saatgutimporte aus dem natürlichen Verbreitungsgebiet lassen keine weitere Ertragssteigerung erwarten.
Poster Session 2: Genetik der Gehölze im Klimawandel
191
Saatgutgewinnung bei Eiche durch Einzelbaumbeerntung – eine Ergänzung zu den Samenplantagen
André Hardtke1
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Abt. Waldgenressorucen, Prof.-Oelkers-Str. 6, 34346 Hann. Münden, [email protected]
Schlagworte: Eiche, Saatgut, genetische Qualität
Im Rahmen des Waldumbaus von Nadelholzreinbeständen und dem sich abzeichnenden Klimawandel haben die Eichenarten schon heute einen hohen Stellenwert. Zukünftig wird den Eichenarten eine noch größere Rolle aufgetragen. Gleichzeitig steigt der Bedarf des Rohstoffs Holz, bei abnehmender bewirtschafteter Waldfläche. Der Bedarf an hochwertigem Forstvermehrungsgut, welches Produktivität und Qualität zukünftiger Waldbestände erhöhen kann, ist deshalb groß. Aktuell wird der Saatgutbedarf hauptsächlich über amtlich zugelassene Saatguterntebestände gedeckt. Bei einer bestandesweisen Beerntung werden auch phänotypisch unerwünschte Individuen beerntet. Die genetische Qualität des gewonnenen Vermehrungsgutes kann durch diese Erntemethode beeinträchtigt sein, so dass eine Leistungssteigerung nicht zu erwarten ist. Dem gegenüber stehen die ausschließlich aus Plusbäumen aufgebauten Samenplantagen. Sie liefern hochwertiges Saatgut, welches den Ansprüchen gerecht wird. Die Anlage von Samenplantagen ist jedoch mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Zurzeit stellen die Samenplantagen nur einen geringen Anteil von wenigen Prozent am Saatgutaufkommen. Erst mittel- bis langfristig kann über neue Samenplantagen ein höherer Anteil des Saatgutbedarfs gedeckt werden. Als Ergänzung zu den Samenplantagen kann die Einzelbaumbeerntung von phänotypisch hervorragenden Individuen kurzfristig die Versorgung mit hochwertigem Eichen-Vermehrungsgut sichern. Diese verspricht eine Leistungssteigerung durch Erhöhung der genetischen Qualität. Der gezielte Umbau von Saatgutbeständen zur Optimierung der genetischen Saatgutqualität ist im Verhältnis kostengünstiger und kurzfristig realisierbar. Im Frühjahr 2015 wurden im Rahmen des Projektes FitForClim, 4 Saatgutbestände ausgewählt und Testflächen angelegt. Auf den Flächen wurden die Positionen der Eichen exakt ermittelt und über eine Vielzahl von Formparametern die phänotypische Variation bestimmt. Von einem Bestand wurden zusätzlich Kambiumproben für eine genetische Charakterisierung des Altbestandes genommen. An den Beständen sollen Möglichkeiten einer Einzelbaumbeerntung erprobt werden. Ebenfalls sollen waldbauliche Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Bestandesgenetik und Saatgutqualität simuliert werden. Ziel ist ein Konzept zur kurzfristigen Bereitstellung von hochwertigem und dabei kostengünstigem Eichen-Saatgut.
Poster Session 2: Genetik der Gehölze im Klimawandel 192
Die Erzeugung von Hybridlärchen-Klonen aus somatischer Embryogenese als Voraussetzung für die Entwicklung von Sorten mit hervorragenden Wachstums-, Qualitäts- und Resistenzeigenschaften
Marianne Kadolsky1, Maria del Carmen Dacasa-Rüdinger1, Heino Wolf1
1 Staatsbetrieb Sachsenforst, Kompetenzzentrum für Wald und Forstwirtschaft, Referat Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung, Bonnewitzer Str. 34, D-01796 Pirna OT Graupa, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Somatische Embryogenese, Akklimatisierung, Hybridlärche, Sortenzüchtung
Für eine erfolgreiche Anpassung der Forstwirtschaft an sich ändernde Klimabedingungen können in Zukunft neben der Risikostreuung durch Artenvielfalt, dem Waldumbau und der Berücksichtigung von trockenheitstoleranteren Baumarten auch unkonventionelle Ansätze eine zunehmende Bedeutung erlangen. Hierzu gehört unter anderem die Verwendung von schnellwachsenden Baumarten wie der Hybridlärche als Übergangs-, Zwischen- oder Ergänzungsbaumart mit Umtriebszeiten zwischen 20 und 40 Jahren, um Handlungsspielräume zu erhalten und flexibel auf Veränderungen des Klimas reagieren zu können. Die Baumart Hybridlärche eignet sich vor allem durch ihre außerordentliche Raschwüchsigkeit bei im Vergleich zur Europäischen Lärche guten Schaftformen für die angesprochene Rolle. Erste Untersuchungen zur Trockenstressresistenz von Hybridlärchen weisen auf eine erhebliche Variation innerhalb und zwischen den untersuchten Nachkommenschaften hin. In der ersten Phase des von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. mit Haushaltsmitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft auf Grund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages geförderten Verbundvorhabens DendroMax konnte die Arbeitsgruppe Botanik und Arboretum des Institutes für Biologie der Humboldt-Universität zu Berlin erfolgreich ca. 100 Hybridlärchen-Klone aus Saatgut von Familieneltern durch somatische Embryogenese erzeugen. Die für die Produktion des Saatgutes verwendeten Familieneltern der Europäischen und der Japanischen Lärche sind bereits als Ausgangsmaterial für die Erzeugung von Forstvermehrungsgut der Kategorie „Geprüft“ zugelassen. Nach einem kurzen Überblick über das Potential der Hybridlärche in Hinsicht auf Wachstum, Qualität und Trockenstressresistenz, werden die Ziele, verwendetes Material und Methoden der Entwicklungsarbeiten zur erfolgreichen Akklimatisierung und Jungpflanzenanzucht von Hybridlärchen aus somatischer Embryogenese vorgestellt. Es konnte ein mehrstufiges Verfahren entwickelt werden, das Akklimatisierungsraten von über 90 % ermöglicht. Dies ist die Voraussetzung für die Erzeugung von ausreichend großen Pflanzenzahlen je Klon, um kurzfristig eine Prüfung der Klone in Hinsicht auf ihr Wachstum, ihre Stammqualität und ihre Trockenresistenzeigenschaften durchführen zu können. Die Ziele und die Verfahren der Klonprüfung werden ebenso vorgestellt wie die Vorstellungen zur zukünftigen Verwendung der Hybridlärche.
Poster Session 2: Genetik der Gehölze im Klimawandel
193
Genetische Variation bei Bergahorn in Deutschland: Erkenntnisse aus molekulargenetischen Daten und Anbauversuchen
Charalambos Neophytou1, und Barbara Fussi2
1Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Waldbau, Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien, [email protected] 2ASP Teisendorf, Forstamtsplatz 1, 83317 Teisendorf, [email protected]
Schlagworte: Bergahorn, genetische Variation, molekulare Marker, Herkunft
Der Bergahorn (Acer pseudoplatanus L.) zählt zu den einheimischen Baumarten Mitteleuropas mit dem Schwerpunkt seiner Verbreitung in kollinen und montanen Lagen. Nacheiszeitliche Rückwanderung, Anpassung und Genfluss haben die genetische Variation dieser Art geprägt. Im Rahmen des Projektes FitForClim wurde mit Hilfe von molekularen Markern der genetische Fingerabdruck von zahlreichen Bergahorn-Plusbäumen, die über einen großen Teil seiner Verbreitung in Deutschland verteilt sind, erstellt. Mittels dieser umfangreichen Stichprobe werden die genetische Variabilität und ihre räumliche Verteilung über die verschiedenen Züchtungspopulationen des Projekts untersucht. Des Weiteren findet eine gemeinsame Auswertung von Anbauversuchen statt. Ziel ist es zu prüfen, inwieweit sich die Wuchseigenschaften der Herkünfte unterscheiden. Bei einer relativ großen Anzahl von Herkünften und Flächen interessiert besonders, ob sich eine Anpassung an die lokalen Standortsbedingungen in unterschiedlichen Wuchsmerkmalen manifestiert. Beide Ansätze liefern wichtige Erkenntnisse, die einen Beitrag bei der Festlegung von Verwendungsgebieten leisten können.
Poster Session 3: Forstl. Risikomanagement u. sich ändernden Umweltbedingungen 194
Wasserhaushalt, Wachstum und Risiko von Fichtenbeständen der Münchner Schotterebene
Steffen Taeger1, Tobias Mette1, Wendelin Weis1, Wolfgang Falk1, Alfred Schubert1, Allan
Buras2, Christian Kölling3 1LWF, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 2TU München, Ökoklimatologie, Hans-Carl-von-Carlowitz Platz 2, 85354 Freising, [email protected] 3AELF Roth, Johann-Strauß-Str. 1, 91154 Roth, [email protected]
Schlagworte: Fichte, Schotterstandorte, Trockenstress, LWF-Brook90
Die Münchner Schotterebene umfasst ein Gebiet von ca. 1500 km2 um München zwischen Isar und Amper. Es handelt sich hierbei um fluviatile Schotter der Nacheiszeit mit unterschiedlicher Mächtigkeit und Flutlehm-Überdeckung. Zwar wird die Schotterebene an verschiedenen Stellen von Terrassen durchschnitten, ist aber im Wesentlichen eben bis an die angrenzende Moränenlandschaft. Die Waldfläche setzt sich zu über 70% aus Fichte zusammen, allerdings bereitet eine erhöhte Borkenkäfer-Anfälligkeit in den letzten Jahren den Forstämtern zunehmend Sorgen. Als Grund dafür wird vermutet, dass die Fichte auf flachgründigeren Schottern in warm-trockenen Sommern unter erhöhtem Trockenstress leidet. Im Rahmen dieses Beitrags gehen wir der Hypothese nach, dass Trockenstress und Kalamitäts-Risiko signifikant mit der unterschiedlichen Bodenwasser-Speicherfähigkeit zusammenhängen, die sich primär in der Tiefgründigkeit manifestiert. Auf der Grundlage von Bundeswald- und Staatsforstinventur wird die Dynamik des Fichtenvorkommens und -wachstums in den letzten 30 Jahren nachgezeichnet. Parallel dazu werden für denselben Zeitraum mit dem Modell LWF-Brook90 Wasserhaushaltskenngrößen von Vegetation und Boden an verschieden tiefgründigen Standorten berechnet. Der Vergleich von Wasserhaushalt, Wachstum und Vorkommen der Fichte auf diesen Böden steht beispielhaft für den Zusammenhang von Wachstum und Risiko und der Rolle der Böden beim Fichten-Anbau im Klimawandel.
Poster Session 3: Forstl. Risikomanagement u. sich ändernden Umweltbedingungen
195
Standortleistungsmodelle auf der Grundlage europäischer Forst- und Boden-Inventurdatensätze
Susanne Brandl1, Wolfgang Falk1, Levent Burggraef2, Matthias Schmidt2, Paul Schmidt-Walter2 und Tobias Mette1
1LWF, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected], [email protected], [email protected] 2NW-FVA, Grätzelstr. 2, 37079 Göttingen, [email protected], [email protected],
Schlagworte: Standortleistungsmodelle, Höhenwachstum, Bonitierung, Klimawandel
Spätestens seit der Eichhornschen Regel von 1902 hat sich die Altershöhen-Beziehung weit über die deutschsprachige Forstwirtschaft hinaus als ein Standardmaß für die Beurteilung der Produktivität (Bonitierung) von gleichaltrigen Reinbeständen etabliert. Die direkte Schätzung der Leistung eines Standortes anhand von Bestandesmaßen ist wesentlich verlässlicher als die indirekte Schätzung über Umweltvariablen mit Hilfe von Standortleistungsmodellen. Trotzdem sind Standortleistungsmodelle für die Klimafolgenforschung unerlässlich, um den Effekt sich ändernder Umweltbedingungen auf das Waldwachstum abzubilden. Dazu reichen deutschlandweite Datensätze nicht aus, da in vielen Wuchsgebieten bis 2070 mit Klimabedingungen zu rechnen ist, wie sie heute z.B. im Burgund (Frankreich) vorherrschen. In diesem Beitrag vereinen wir vier Inventurdatensätze, um möglichst große Gradienten von Klimaparametern zu erfassen: die nationalen Forstinventuren von Deutschland (BWI) und Frankreich (NFIfr), sowie die Bestandesinventur der deutschen Bodenzustandserhebung (BZE) und der europäischen BioSoil-Inventur (BioSoil). Auf der Grundlage dieser Gesamtdatenbasis werden Standortleistungsmodelle für die sechs wichtigsten mitteleuropäischen Baumarten Fichte, Kiefer, Douglasie, Buche, Trauben- und Stieleiche entwickelt. Voraussetzung für die Entwicklung der Bonitätsmodelle ist die Ableitung eines einheitlichen Bonitätsmaßes unabhängig von den unterschiedlichen Designs der verwendeten Inventuren. Die eigentliche Modellentwicklung umfasst die Auswahl einer geeigneten biometrischen Funktion und die Selektion signifikanter Klima- und Bodenparameter. Als Teil des Waldklimafonds-Projekts „ aldproduktivität-Kohlenstoffspeicherung-Klimawandel“ treiben die hier erzeugten Standortleistungsmodelle Waldentwicklungsprognosen verschiedener Waldwachstumsmodelle für das 21. Jahrhundert an.
Poster Session 3: Forstl. Risikomanagement u. sich ändernden Umweltbedingungen 196
Automatisierte Erfassung der Vitalität von Waldbäumen aus neuesten optischen Fernerkundungsdaten
Rudolf Seitz1, Markus Immitzer2 und Anne Reichmuth3
1Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft LWF, Abteilung Informationstechnologie, [email protected] 2Universität für Bodenkultur Wien; Institut für Vermessung, Fernerkundung und Landinformation IVFL ³Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR, Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum Landoberfläche Oberpfaffenhofen
Schlagworte: Vitalität; HySpex; Spektroskopie; Ringelung
Die Entwicklung von fernerkundungsgestützten Methoden zur objektivierten, großflächigen, wirtschaftlich sinnvollen und frühzeitigen Vitalitätsansprache der aktuellen Bestockung ist Gegenstand des Projektes VitTree. Die zu erarbeitenden Methoden sollen auf großer Fläche eine Aussage über die Vitalität und akuter Gefährdungen der Waldbestände liefern und etablierte Methoden der Waldzustandserhebung und der Bekämpfung biotischer Kalamitäten unterstützen. Auf Grund der seit Längerem bekannten Gefährdung der Fichte durch Temperaturanstieg und Trockenstress (z.B. Wauer 2009), konzentriert sich die Studie auf diese in Bayern forstlich relevante Baumart. Mit der neuesten Generation von Satellitendaten stehen erstmals großräumige Informationen mit sehr hoher räumlicher und spektraler Auflösung bei gleichzeitig hoher Wiederholungsfrequenz für ein solches Vorhaben zur Verfügung. Gleichzeitig liefern Satellitendaten Informationen aus Spektralkanälen, die für die Fragestellung der Vitalität von Waldbäumen von hoher Bedeutung sind. Diese Erkenntnisse werden in der vorliegenden Studie auf ihre Umsetzbarkeit in die forstliche Praxis getestet werden. Zusätzlich wurde durch die Analyse von sehr hochauflösenden flugzeuggetragenen Hyperspektraldaten deren Potential für die Vitalitätserfassung von Waldbäumen selbst, aber auch in Hinblick auf die Verwendbarkeit zukünftiger Satellitenmissionen (z.B. Simulation von Sentinel-2-Daten) untersucht. Im Fall der Fichte manifestiert sich eine Vitalitätsminderung am augenscheinlichsten durch die Vergilbung, Verformung und/oder dem Verlust ihrer Assimilationsorgane. Eine Detektion von Bäumen oder Baumkollektiven mit eingeschränkter Vitalität (und somit erhöhter Disposition gegenüber z.B. Borkenbefall) noch bevor diese Symptome terrestrisch oder aus der Luft mit dem menschlichen Auge erfassbar sind (prä-visuell), weist ein sehr großes Potenzial für eine rasche und großflächige Anwendung in der forstlichen Praxis auf.
Poster Session 3: Forstl. Risikomanagement u. sich ändernden Umweltbedingungen
197
Emission der Rhizosphäre von Buche (Fagus sylvatica) und deren Wahrnehmung durch Engerlinge von Melolontha hippocastani
Christine Rachow1, Katharina Gellrich1, Martin Gabriel1, Stefan Schütz1
1Georg-August-Universität Göttingen, Abt. Forstzoologie und Waldschutz, Büsgenweg 3, 37077 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Rhizosphäre, Volatile, Melolontha hippocastani, Fagus sylvatica
Die Rhizosphäre ist eine wenige Millimeter breite Zone um die Pflanzenwurzel herum und wird direkt durch die Pflanzenwurzel und die Umgebung, mit der die Wurzel interagiert, beeinflusst. Sie ist ein wichtiges Habitat für viele Mikroorganismen und ein Ort der Interaktion der Mikroorganismen untereinander und mit der Pflanzenwurzel. Trotz der großen Bedeutung der Rhizosphäre ist der Wissenstand über flüchtige organische Verbindungen (VOC), die bei der Interaktion zwischen den verschiedenen Akteuren eine wichtige Rolle spielen, gering. Insbesondere von Waldstandorten existieren nur wenige Untersuchungen über VOCs in der Rhizosphäre. Ein bedeutender Akteur im Erdreich für die Forstwirtschaft ist der Engerling des Waldmaikäfers, Melolontha hippocastani. Dieser lebt im Boden und ernährt sich unter anderem von den Wurzeln der Buche (Fagus sylvatica) und der Eiche (Quercus spec.) und kann diese durch den Wurzelfraß stark schädigen. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass Engerlinge sich im Boden olfaktorisch orientieren. Das Wissen über die unterirdische Emission von VOCs kann deshalb beim integrierten Pflanzenschutz hilfreich sein, um zum Beispiel Engerlinge mittels VOCs von Pflanzenwurzeln fernzuhalten oder Antagonisten des Engerlings anzulocken. Um den Einfluss des Standortfaktors Jahresniederschlag auf die Zusammensetzung der Rhizosphären VOCs in alten Buchenbeständen auf sandigen Böden zu erfassen, wurden im Mai und im Oktober Proben in den oberen A-und B-Horizonten auf fünf verschiedenen Sandböden in der Lüneburger Heide (Calvörde, Klötze, Göhrde, Unterlüß und Sellhorn) genommen. Die Beprobung wurde in einem Closed-Loop-Verfahren durchgeführt. Als Adsorbens für die Volatile wurde Tenax®TA verwendet. Die Proben wurden anschließend mit einem Gaschromatographen und einem gekoppelten Massenspektrometer analysiert und die Volatile mittels Massenspektren und authentischen Standards identifiziert. Die VOCs werden sowohl im Mai als auch im Oktober von der Rhizosphäre abgegeben. Es konnten signifikante Unterschiede in den Emissionsraten in Abhängigkeit von Jahreszeit und Standort nachgewiesen werden. Mittels elektroantennographischen Messungen konnte gezeigt werden, dass diese VOCs aus der Rhizosphäre der Buche vom Engerling wahrgenommen werden.
Poster Session 3: Forstl. Risikomanagement u. sich ändernden Umweltbedingungen 198
Standortseigenschaften und Waldbrände in Bayern
Jürgen Kolb1,2, Lothar Zimmermann1 und Thomas Knoke2
1LWF, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected], [email protected] 2TU München, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 3, 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Waldbrandgefahrenprognose, Waldbrandindices, Standortseinfluss, Bestandeseinfluss
In den bisher verwendeten Prognoseverfahren zur Beschreibung der Waldbrandgefährdung wird hauptsächlich auf meteorologische Indikatoren (Waldbrandgefahrenindex des Dt. Wetterdienstes, Baumgartner-Index, SMHI, M-68-Verfahren n. KÄSE, Canadian Forest Fire Weather Index, Nesterov etc.) zurückgegriffen. Grundsätzlich beschreiben diese Ansätze eine Veränderung des Feuchtegradienten im System Brennstoff und Atmosphäre. Unterschiede in den Standortsparametern wie Relief, Exposition, Hangneigung sowie Humusform, Bodenart, Bestockung und Bestandesstruktur werden dabei nicht berücksichtigt bzw. nur in standardisierter Form (bspw. Annahme von Kiefernstreu beim DWD-Waldbrandgefahrenindex). Die Brandgefährdung eines Bestandes ist zwar wesentlich von den energetischen Aspekten bestimmt, d.h. wieviel Energie ist mindestens notwendig um dauerhaft Brennmaterial zu entzünden, so dass die meteorologischen Faktoren (Niederschlag, Turbulenz und Globalstrahlung) sehr hohen Einfluss auf die Brandgefährdung oder Brandhemmung haben. Gleichzeitig hängt aber der Wirkungsgrad dieser Faktoren von den standorts- und bestandesspezifischen Eigenschaften ab. In diesem Beitrag wird der Fragestellung nachgegangen, inwiefern bestandesspezifische Eigenschaften zu einem erhöhten Waldbrandrisiko führen können. In Bayern liegen nur wenig räumlich verortete Daten zu Waldbränden vor, die erlauben eine Analyse zwischen Standorts- und Bestandeseigenschaften vorzunehmen. Für eine Risikoanalyse konnte ein verorteter Waldbranddatensatz der Bayerischen Staatsforsten, erweitert mit einzelnen Ortsdaten der Bayerischen Forstverwaltung, gewonnen werden. Die eigentliche Modellentwicklung umfasst die Selektion signifikanter statischer und variabler Bestandesparameter sowie der Geodaten des Standorts, um Waldflächen mit einem erhöhten Waldbrandrisiko zu identifizieren. Dieses Modell wird mit verfügbaren Waldbrandindizes verknüpft, um die Aussage der meteorologischen Waldbrandprognosemethoden zu verfeinern.
Poster Session 3: Forstl. Risikomanagement u. sich ändernden Umweltbedingungen
199
Der Einfluss zunehmender Bodenaustrocknung auf Trockenstress und das Wachstum von Bäumen
Jürgen Müller1
1Thünen-Institut für Waldökosysteme, A.-Möller-Straße 1, 16225 Eberswalde, [email protected]
Schlagworte: Trockenheitsrisiko, Bodenwasserverfügbarkeit, Wasserverbrauch, Lysimeter
Durch Trockenheit und Hitze treten im Wald Ertragsausfälle und damit einhergehende wirtschaftliche Schäden auf. Viele Szenarien zur Klimaentwicklung lassen eine weitere Zunahme von Trockenheit erwarten, die für die forstliche Produktion nachteilige, teils existenzbedrohende Auswirkungen haben könnten. Die Adaption von Baumarten an den prognostizierten Klimawandel ist noch weitgehend ungeklärt. Wassermangel entsteht, wenn der Wasserbedarf der Pflanzen größer als die Wasserverfügbarkeit ist. Damit ergibt sich das Risiko aus den Wechselwirkungen zwischen der Pflanze, dem Boden und den meteorologischen Bedingungen. Schwerpunkt der Untersuchungen ist das Ursachen-Wirkungsgefüges von unterschiedlicher Trockenheit auf Wasserverbrauch, Radialzuwachs und den physiologischen Prozessen im Zuge der Austrocknung. Im Fokus der Untersuchungen stehen junge Bäume, die besonders empfindlich gegen Trockenheit sind, weil sie mit ihren Wurzeln noch nicht die tieferen Bodenwasservorräte erreichen können. Vor diesem Hintergrund wurden für die Untersuchung des Einflusses zunehmender Bodenaustrocknung auf den Wasserverbrauch und das Wachstum kleiner Buchen und Eichen spezielle wägbare Lysimeter genutzt. Die Anwendung der Lysimeter in Trockenversuchen unterschiedlicher Intensität steht im Fokus. Als Indikatoren für die Bewertung der Stresswirkung werden genutzt: - Die meteorologische Trockenheit (Klimatische Wasserbilanz) - Relative Bodenwasserverfügbarkeit der abnehmenden Bodenwassermengen - Die Evapotranspiration (Transpirationsdifferenz) - Physiologische Reaktion der Bäume (Blattturgordruck, Blattwasserpotential) Kritische Grenzen der Bodenwassermengen auf das Wachstumsverhalten der Bäume werden abgeleitet.
Poster Session 3: Forstl. Risikomanagement u. sich ändernden Umweltbedingungen 200
Forstliche Wasserstress-Dienste für den Freistaat Thüringen
Martyna Stelmaszczuk-Górska1, Herbert Sagischewski1 und Sergej Chmara1
1ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts, Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha, Jägerstr. 1, 99867 Gotha, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Klimawandel, Wasserversorgung, Copernicus, Sentinels
Als Folgen des globalen Klimawandels treten hydrologische Extremereignisse sehr wahrscheinlich häufiger, intensiver und langanhaltend auf. Durch höhere Temperaturen und andauernde Trockenperioden werden die Wälder unter Hitze- und Trockenstress gesetzt. Prädisponierte Wälder sind anfälliger für biotische Folgeschädigungen. Das Forstliche Umweltmonitoring im Freistaat Thüringen dient mit dem Intensiv-Monitoring an Wald- und Hauptmessstationen der Erfassung von Veränderungen im Ökosystem Wald. Diese Daten stehen aber nur punktuell zur Verfügung. Um notwendige Anpassungsstrategien an den Klimawandel zu entwickeln, ist es wichtig, kontinuierliche und möglichst aktuelle Informationen auf der gesamten Waldfläche zu erhalten. Eine Möglichkeit, diese Informationen zu generieren, könnten Erdbeobachtungsdaten bieten. So können Satellitendaten in Kombination mit verfügbaren Referenzdaten, vor allem Wetterdaten, die flächendeckende, prophylaktische Überwachung von Waldgebieten unterstützen. Gemeinsam mit der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) führt das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha von ThüringenForst-AöR gegenwärtig das Forschungsprojekt „Sentinels für Thüringer Informationssysteme“ (SenThIS) durch, das vom Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur (Förderkennzeichen 50EW1513) gefördert wird. Im forstlichen Teil des Projektes sollen einerseits die wasserbedingten Stressfaktoren direkt an konkreten Waldbeständen erfasst werden. Hierfür wird die Wasserversorgung aus optischen und Radar-Satellitendaten (Sentinel-1 und -2 und RapidEye), welche Informationen über Vegetations- und Bodenfeuchte liefern können, beispielsweise mit Hilfe von Vegetationsindizes bestimmt. Andererseits sollen aus den Satellitendaten auch Informationen über die Bestockung (Baumart, Kronenschlussgrad) erfasst werden, die zur Ableitung des Wasserhaushaltes des bestockten Bodens genutzt werden können. Analyseroutinen, die im Rahmen des Projektes entwickelt werden, stehen anschließend dem forstlichen Umweltmonitoring, insbesondere dem Waldschutz, zur Verfügung, um zeitnah und kleinräumig den Wasserstress der Wälder zu bewerten.
Poster Session 4: Auswirkungen von Extremwetterlagen auf Wälder
201
Semi-automatic fast forest change and storm damage detection using satellite imagery
Jan-Peter Mund1, J. May, P. Zeniuk
1 HNE Eberswalde, Alfred-Möller-Str. 1, 16225 Eberswalde, [email protected]
Detecting changes in forest health and disturbances and particular storm damages with earth observation imagery gained rather low scientific attention during the last years. Recent earth observation technology focuses on providing standardized semi-automatic, repeatable, reliable and near real time earth observation services covering different land cover and land use parameters. Therefore appropriate and full automatic data standardization and pre-processing of any earth observation imagery (Landsat 7 ETM+, Landsat 8 or hyperspectral data) is critical for detecting local to regional small scale forest changes over short periods of time. This paper provides an overview about most recent research results and operative semi- automated forest change detection methods using state of the art earth observation imagery. The paper discusses the implementation of statistical vegetation indices for a change detection using multi and - supraspectral earth observation data from various sources and presents some results from case studies in Norway, Poland and Brandenburg. In a semi-automatic change detection approach pixel information from controlled forest change areas are automatically extracted and compared with focus on data scattering, homogeneity of data, the trend behavior and their variance for classifying different forest damage categories. Since many years the NDVI and the red-edge channel is used to categorize and localize significant changes in photosynthetic activity over time. According several numerical tests and a statistical comparison of many vegetation indices the ‘ ide Dynamic ange Vegetation Index’ ( D VI), a modification of the NDVI, produced the most homogenous results with least outliers. The calculated data trend of WDRVI results and the increasing damage percentages in all controlled forest areas are correlating. Thus, WDRVI results and thresholds from a linear regression and a PAM classifier have been integrated in order to program the semi-automatic forest change detection model and a damage categorization workflow. The semi-automatic detection model was applied to several controlled study areas of managed spruce and pine forest stands producing overall detection accuracies of more than 95 (Cohen s KAPPA of 0.94). Such high quality detection results from a near-real-time and semi-automatic forest change detection earth observation service may contribute to a faster response to forest damages and threats and improved forest management of damaged forest areas.
Poster Session 4: Auswirkungen von Extremwetterlagen auf Wälder 202
Auswirkungen des Rekordsommers 2015 auf die Wälder in Bayern
Stephan Raspe1, Lothar Zimmermann1, Alexandra Wauer1 und Hans-Peter Dietrich1
1LWF, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Hitze, Trockenheit, Bodenwasserhaushalt, forstliches Umweltmonitoring
Schon im Frühjahr 2015 fiel im Norden Bayern nur ein Drittel der üblichen Niederschlagsmenge, während es im Süden noch überdurchschnittlich regnete. Dementsprechend wies die klimatische Wasserbilanz nördlich der Donau im Gegensatz zum Süden meist ein negatives Vorzeichen auf. Diese Entwicklung setzte sich im Sommer bei gleichzeitiger Rekordwärme und nur geringfügigen Niederschlägen bis Ende August hinein verstärkt fort. Der Sommer 2015 war mit durchschnittlich 19,0°C nach 2003 der zweitwärmste seit Beginn flächenhafter meteorologischer Messungen im Jahre 1881. Obwohl der Jahrhundertsommer 2003 mit durchschnittlichen 20,1°C nicht nur etwas wärmer, sondern auch niederschlagsärmer war, war bereits ab Juli 2015 eine deutlich negativere Wasserbilanz als 2003 festzustellen. Ursache hierfür waren die vielen sogenannten „heißen Tage“ mit über 30 °C. Die ausbleibenden Niederschläge hatten im Zusammenspiel mit den extremen Temperaturen und die dadurch deutlich höhere Verdunstung in vielen Regionen Bayerns ein frühzeitiges Austrocknen der Böden zur Folge. Auf der Fränkischen Platte war die Bodenfeuchte bereits Ende Juni soweit gesunken, dass die Bäume nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgt werden konnten. In Abhängigkeit von der Wasserspeicherkapazität der Böden und der Häufigkeit kleinräumiger Gewitterregen, wurde die Trockenstressgrenze in den verschiedenen Regionen Bayerns zu unterschiedlichen Zeitpunkten erreicht. An sieben der 19 über das Land verteilten Waldklimastationen wird die Feuchte im Waldboden gemessen, an den übrigen mit dem Wasserhaushaltsmodell LWF-BROOK90 modelliert. An elf Waldklimastationen standen die Bäume unter extremem Trockenstress wie zuletzt im Jahrhundertsommer 2003, da kaum noch Wasser für die Bäume im Boden vorhanden war. Vermehrt konnte daher beobachtet werden, dass sich Blätter an den Bäumen einrollten oder abgeworfen wurden. Besonders im trockenen Unterfranken warfen die Eichen ihre jüngsten Triebe ab, um Verdunstungsverluste zu reduzieren. Eine Wiederholungsaufnahme der Kronenzustandserhebung Ende September zeigte sich in diesem Bereich an den Waldklimastationen eine Zunahme des Blattverlustes von 10-15 Prozent. Parallel wurde ein deutlich erhöhter Streufall gemessen. Besonders an Kiefer zeigte sich ein Aussetzen der innerjährlichen Durchmesserzunahme mit Unterschreiten eines kritischen Bodenwassergehalts.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
203
Populationsdynamik von Schadorganismen der Eiche und die Vitalitätsentwicklung der Eiche in Abhängigkeit von biotischen und
abiotischen Einflussfaktoren
Gabriela Lobinger1, Bernhard Loock 1
1Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, 4, [email protected]
Schlagworte: Eiche, Schadorganismen, Eichenvitalität, Einflussfakoren
Die Eiche ist aufgrund ihrer hohen Standortstoleranz gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels eine wichtige Baumart. Sie ist aber auch Wirtsbaumart forstlicher Großschädlinge, die regelmäßig Massenvermehrungen aufbauen und auf großer Fläche massive Schäden verursachen können. Durch Folgeschädlinge und Einwirkung extremer Witterungsbedingungen kommen weitere akute Ausfälle oder chronische Vitalitätsminderung hinzu. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung im Zuge des Klimawandels noch verstärkt. Durch detaillierte Untersuchungen unter Einbeziehung möglichst vieler Parameter müssen Grundlagen geschaffen werden, um Befallsdiagnose und Risikoeinschätzung in Eichenwäldern zu optimieren und an die neuen Anforderungen anzupassen. Bedingung hierfür sind genaue Kenntnisse über die Zusammensetzung der Eichenfraßgesellschaft und der sekundären Schadorgenismen, die Steuerung des Massenwechsels der einzelnen Arten und die Auswirkungen verschiedener biotischer und abiotischer Konstellationen auf die Vitalität der Eiche. In den bayerischen Eichengebieten Unter- und Mittelfrankens wird seit einigen Jahren das komplexe Zusammenwirken biotischer und abiotischer Faktoren auf die Entwicklung von Eichenschäden untersucht. In klimatisch repräsentativen Regionen wurden Untersuchungsbestände ausgewählt, wo in definierten Probekreisen regelmäßig detaillierte Aufnahmen von Eichenvitalität, Artenzusammensetzung der Eichenfraßgesellschaft und auftretender sekundärer Schadorganismen sowie der Witterungsbedingungen erfolgen. So sollen die maßgeblichen Steuerungsparameter für die Dichtedynamik der Schadorganismen sowie die Vitalität der Eiche in Abhängigkeit von verschiedenen Konstellationen biotischer und abiotischer Bedingungen ermittelt werden. Gezielte und situationsgerechte prophylaktische und kurative Maßnahmen zum Schutz der Bestände sind vor dem Hintergrund zunehmender Restriktionen im Pflanzenschutz nur durch eine frühzeitige, zuverlässige Schadensprognosen möglich. Die in Abhängigkeit von der Belastung durch Schadorganismen, Standortbedingungen und aktuellen Witterungseinflüssen zu erwartende akute und chronische Schadentwicklung bei der Eiche soll mit hoher Zuverlässigkeit prognostizierbar werden. Auf dieser Grundlage werden die bisher praxisüblichen Verfahren von Monitoring und Prognose methodisch weiter entwickelt und an die künftigen Erfordernisse des Waldschutzes angepasst.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 204
Untersuchungen zur Populationsdynamik der Fichtengespinstblattwespe, Cephalcia abietis, in einem aktuellen
Befallsgebiet im Waldviertel/Niederösterreich
Christa Schafellner1, Edna Gober, Peter Zelinka, Anna Antonitsch
Institut für Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz, Department für Wald- und Bodenforschung, Universität für Bodenkultur, Hasenauerstraße 38, 1190 Wien, [email protected]
Schlagworte: Pronymphe, Eonymphe, Überlieger, Generationszyklus
Larven der Fichtengespinstblattwespe, Cephalcia abietis, fressen ausschließlich an Fichte, bevorzugt an älteren Nadeljahrgängen. Ausgewachsene Larven lassen sich zu Boden fallen, wo die Ruhelarven in einer Erdhöhle überwintern; die Verpuppung findet im Frühjahr statt. Die Generationendauer ist variabel, die Tiere können mehrere Jahre überliegen, ehe die Imagines schlüpfen. Bei Massenvermehrungen kommt es durch intensiven Nadelfraß befallener Bäume zu Zuwachsverlusten und in Folge zu erhöhter Anfälligkeit gegenüber Sekundärschädlingen. Zwischen 1950 und Mitte 1980 traten in mehreren Regionen Niederösterreichs wiederholt Gradationen der Fichtengespinstblattwespe auf; für die Zeit danach ist kein Befall mehr dokumentiert. Im Herbst 2013 wurden erstmals wieder beachtliche Fraßschäden durch Cephalcia-Larven gemeldet. Bei dem etwa 10 ha großen Befallsgebiet handelt es sich um einen 85jährigen Fichtenreinbestand im nördlichen Waldviertel (Raum Zwettl). Das Zentrum des Befalls wies extrem hohe Belagsdichten an Erdlarven (bis 1300/m2) auf. Seit dem Frühjahr 2014 werden regelmäßig Grabungen entlang zweier Transekte in West-Ost bzw. Nord-Süd-Richtung quer durch die Befallsfläche zur Dichteerhebung der Bodenlarven durchgeführt. Parallel dazu werden die Schlüpfdynamik der adulten Wespen, die Abbaumdichte der ausgewachsenen Larven und die Entwicklungsdynamik der Nymphen im Boden dokumentiert und ganzjährig Luft- und Bodentemperaturen aufgezeichnet. Die Bestimmungen physiologischer Parameter (Unterkühlungspunkt, Respirationsraten, Fettanteil) an Eo- und Pronymphen aus dem Freiland und unter kontrollierten Bedingungen ergänzen die Untersuchungen. In den Jahren 2014 und 2015 schlüpften nur wenige adulte Wespen; etwa 90 % der Tiere überlagen im Boden als Eonymphen. Die Entwicklung von Eo- zu Pronymphen erfolgte bei der überwiegenden Mehrheit der Tiere im Spätsommer 2015. Damit kann 2016 als das Hauptschwärmjahr angesehen werden. Die Cephalcia-Population in der Befallsregion weist damit einen überwiegend 3jährigen Generationszyklus auf. Abhängig von diversen abiotischen und biotischen Mortalitätsfaktoren muss im Sommer 2016 wieder mit erheblichen Fraßschäden bis zum Kahlfraß der betroffenen Fichten durch die Larven der Fichtengespinstblattwespe gerechnet werden. Die Vitalität der Bäume ist durch einen im vergangenen Winter auftretenden massiven Eisbruch zusätzlich stark beeinträchtigt und einzelne Stämme mussten bereits aufgrund von Buchdrucker-Befall entnommen werden.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
205
Rückkehr eines Provokateurs: Was steuert die Ausbreitungsdynamik des Eichenprozessionsspinners in Brandenburg?
Aline Wenning1, Jens Schröder1, Rainer Hentschel1, Katrin Möller1
1Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde, Alfred-Möller-Straße 1, 16225 Eberswalde, [email protected]
Schlagworte: Biotische Risiken; Populationsökologie; Witterung; Waldschutz
Der Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea L.; EPS) ist nicht nur eine der bedeutsamsten Schmetterlingsarten, die im nordostdeutschen Tiefland Fraßschäden an Eichen verursachen. Die pathogene Wirkung seiner Larven auf den Menschen hat über den forstsanitären Bereich hinaus zu einem hohen Maß an Öffentlichkeitswirksamkeit geführt. Seit Beginn des Jahrtausends belegen die Flugbeobachtungen, Fraßkartierungen und Nachweise von Gesundheitsproblemen in Siedlungsnähe eine deutliche Zunahme der Verbreitungsfläche des EPS im Bundesland Brandenburg. Im Poster werden zum einen der Prozess und die aktuelle Situation hinsichtlich Ausbreitung und Auswirkungen des Eichenprozessionsspinners in Brandenburg seit dem Jahr 2000 vorgestellt. Die von der Hauptstelle Waldschutz im LFE erfassten Überwachungsdaten wurden im Verbundprojekt "Waldhygienische Anpassungsstrategien (WAHYKLAS)", das vom BMEL über den Waldklimafonds finanziert wird, systematisiert und ausgewertet. Zu den Zielen des Verbunds gehört die Abschätzung der zukünftigen Populations- und Schadensentwicklung zentraler Insektenarten in trockenheitsgeprägten Wäldern. Die zunehmende Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners wird in verschiedenen Studien damit begründet, dass die Art an den Rändern ihres Verbreitungsgebietes von zunehmend günstigeren Witterungsbedingungen profitiert. Erhöhte Temperaturen und trockenere Frühjahre, wie sie sich in jüngerer Vergangenheit gezeigt haben, können im Zuge des Klimawandels noch häufiger werden und damit diesen Trend fortsetzen. Deshalb wurden im vorgestellten Projekt die Befallsgebiete des EPS mit detaillierten Witterungsdaten verschnitten, um mögliche klimatische Einflüsse auf seine Ausbreitung zu analysieren. Analog dazu werden auch Standorts- und Bestandesinformationen von Eichenbeständen mit und ohne Auftreten des EPS auf ihre möglichen Effekte hinsichtlich der Populationsdynamik geprüft. Anhand geografischer Daten zu Bekämpfungsmaßnahmen wird der Frage nachgegangen, ob Alleen und siedlungsnahe Wälder die Ausbreitung der Art fördern. Die Ergebnisse sollen im Weiteren genutzt werden, um das Monitoring des EPS zu optimieren und somit das Schadmaß begrenzen zu können.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 206
Wie beeinflussen Witterung und Standort die Massenentwicklung von Tannenläusen der Gattung Dreyfusia?
Reinhold John1 und Karin Weggler2
1Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Wonnhalde 4, 79100 Freiburg, [email protected] 2Schwedenstr. 10, 78234 Engen, [email protected]
Schlagworte: Tannenstammlaus, Dreyfusia piceae, Tannentrieblaus, Dreyfusia nordmannianae
Massenvermehrungen von Tannenstamm- und Triebläusen traten schon in der Vergangenheit immer wieder periodisch auf, in Baden-Württemberg war in den Jahren 2008 bis 2012 erneut eine solche Periode der Massenvermehrung. Tannentriebläuse schädigen vor allem jüngere Tannen (bis 20 Jahre), während Tannenstammläuse an Tannen mittleren Alters (ca. 40-60 Jahre) zu finden sind. Ein Stammlausbefall ist an typischen, weißen Wachsausscheidungen zu erkennen, während die unscheinbare Tannenstammlaus selber nur etwa 0,8 mm groß ist. Die Wachsausscheidungen können punktuell auftreten und bei schwerem Befall bis zu einem weißen Überzug des Stammes anwachsen. Die Schadsymptome der Tannentrieblaus äußern sich durch gelbe, gekrümmte Nadeln, die zuerst am Terminaltrieb und dann an den oberen Ästen erscheinen. Bei anhaltendem Befall sterben der Terminaltrieb und die oberen Äste ab und der Schaden kann bis zum Ausfall der Tanne führen. Stammscheibenanalysen belegen das zeitgleiche Auftreten von Wachstumseinbrüchen nach Stammlausbefall an verschiedenen Beständen in ganz Baden-Württemberg. Demnach müssen übergeordnete Faktoren die Massenvermehrung der untersuchten Tannenläuse maßgeblich bestimmen. Die Anwendung eines populationsdynamischen Models (Leslie Matrix) auf der Basis von lokalen Temperaturdaten prognostizierte jährliche Lauspopulationen, die hinreichend gut mit den beobachteten Befallsdaten korrelieren. Die Leslie-Matrix ist ein mathematisches Modell zur Analyse des Bevölkerungswachstums, welches in der theoretischen Ökologie zur Beschreibung von Populationen genutzt wird. Damit lassen sich die Änderungen in einer Organismenpopulation über einen bestimmten Zeitraum beschreiben. Den Berechnungen nach führt eine hohe modellierte Lauspopulation mit einem nachfolgenden, milden Winter zu einer massiven Lauspopulation im Wald, dabei unterscheiden sich für Stamm- und Triebläuse die Ergebnisse unwesentlich. Mithilfe des populationsdynamischen Modells konnten „lausfördernde“ Jahre bestimmt werden, die meist ein langes mildes Frühjahr aufweisen. Diese Klimakonstellation aus langem, mildem Frühjahr des Vorjahres und nachfolgend mildem Winter traten so auch bei einer Reihe von dokumentierten Lausbefällen in vergangenen Jahrzehnten auf und bestätigten die Ergebnisse. Es ist zu vermuten dass diese Klimakonstellationen in der Zukunft öfter auftreten als in den letzten 100 Jahren, was auch schon in einer modellierten Datenreihe von 1940-2014 tendenziell abzulesen ist.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
207
Ergebnisse zum Buchdruckermonitoring der vergangenen 25 Jahren in Baden-Württemberg - eine Verschneidung von Standort und
Schadholzaufkommen unter besonderer Berücksichtigung klimatischer Daten
Reinhold John1 und Horst Delb1
1Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Wonnhalde 4, 79100 Freiburg, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Ips typographus, Phänologie, Klimaveränderung
Seit 1990 wird in Baden-Württemberg ein systematisches Monitoring der drei forstwirtschaftlich bedeutsamsten Borkenkäferarten durchgeführt. Unter ihnen ist der rundenbrütende „Große achtzähnige Fichtenborkenkäfer“ (Ips typographus); diese Art verursacht in Baden-Württemberg im Vergleich mit anderen Waldinsekten regelmäßig die größte Menge Schadholz. Insgesamt beläuft sich beispielsweise diese im Jahr 2015 im Staatswald erfasste Käferholzmenge auf ca. 111.000 m³. In den Jahren nach dem Sturm „Lothar“ bzw. nach dem Trockenjahr 2003 wurden jährliche Schadholzmengen von 400.000 bis 500.000 m³ bzw. fast 900.000 m³ registriert (nur Baumart Fichte). Extremereignisse wie Sturm oder Schneebruch und längere Trockenperioden in der Vegetationszeit können Auslöser sein für eine Gradation des Buchdruckers. Das Risiko für die Schädigung eines Waldbestands durch Borkenkäfer steigt mit der Populationsgröße der Käfer an. Somit ist die Information über die Populationsdichte ein entscheidender Faktor, das Risiko für einen Borkenkäferbefall in einem Gebiet einschätzen zu können. Daher wurde überprüft, inwieweit aufgrund der absoluten Fangzahlen der Pheromonfallen Schlüsse auf die Populationsgröße und den Befallsdruck gezogen werden kann, um die Gefahreneinschätzung im entsprechenden Waldgebiet beurteilen zu können. Als wesentlich prägender, quasi übergeordneter Faktor werden die Witterungsdaten berücksichtigt. Dabei werden die durchschnittlichen Temperaturen im Untersuchungs-zeitraum anhand modellierter Klimadaten (prospektive Tageswerte der maximalen und durchschnittlichen Lufttemperatur auf Basis des globalen Klimamodells ECHAM5 und des REMO-UBA Regionalisierungsansatzes in einer räumlichen Auflösung von 250 m als Rasterformat in SAGA-GIS produziert) berücksichtigt. Für einzelne Untersuchungsgebiete und kürzere Zeiträume werden diese Daten mit real gemessenen Werten aus lokalen Klimastationen verglichen. So kann belegt werden, dass Buchdrucker vom zunehmenden sommerlichen Trockenstressrisiko profitieren, indem sie früher ausfliegen und mehr Generationen pro Jahr entwickelt haben.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 208
Zur Ausbreitungsdynamik des Buchdruckers – ein catch and release-Experiment im Nationalpark Schwarzwald
Jonas Hinze1 und Reinhold John1
1Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Wonnhalde 4, 79100 Freiburg, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Ips typographus, Dispersion, Nationalpark Schwarzwald
In den fichtendominierten Wäldern Mitteleuropas können Massenvermehrungen des großen Buchdruckers Ips topographus (Coleoptera: Scolytidae) immense, forstwirtschaftliche Schäden nach sich ziehen. Beispielsweise vernichtete der Folgebefall nach dem Sturm Vivian 1990 in der Schweiz innerhalb von fünf Jahren zusätzlich 50% des durch den Sturm geworfenen Fichtenholzes. Der Rindenbrüter wird zwar zu den sekundären Forstschädlingen gezählt, kann bei hohen Populationsdichten jedoch auch gesunde Bäume erfolgreich besiedeln und somit zu Absterben bringen. Um diese hohen Populationsdichten zu erreichen bedarf es jedoch ausreichend Brutmaterial aus frisch abgestorbenen oder stak gestressten Fichten, wie es häufig nach größeren Störereignissen, wie Sturmwurf, Schneebruch oder großer Trockenheit anfällt. In der Kernzone eines Nationalparks besteht ein besonders hohes Risiko für eine Massenvermehrung des Buchdruckers, da hier erwähntes Brutmaterial im Wald belassen wird. Um möglichst gute Kenntnisse über die Ausbreitung der Borkenkäfer aus befallenen Fichten im Wald zu erhalten, ist es unerlässlich, den Ausflug aus besiedelten Stämmen unter Realbedingungen zu untersuchen. Hierzu wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Freilassungs-Wiederfang-Experiment mit der zweiten Generation der Buchdrucker und deren Geschwisterbruten durchgeführt. Zehn Fichtenstammteile wurden ausgelegt und eine Besiedlung mittels Pheromon induziert. Die Stämme wurden mit Farbpulver ummantelt sodass sich die Buchdrucker beim Ausbohren markieren und leicht wiedererkannt werden können. Mit Hilfe von 57 Pheromon-Fallen, in verschiedenen Distanzen um den Holzpolter, wurden nun die markierten Käfer eingefangen. Anhand der Distanz der Fallen zum Auslassort und anderer Parameter (Höhenlage der Falle, Waldstruktur im Fallenumfeld, Windrichtung und weitere) lassen sich Rückschlüsse auf die Ausbreitungsdynamik, Flugdistanzen und die räumlichen Präferenzen der Käfer ziehen. In einer nachfolgenden Einzelkäferanalyse im Labor wurden die Geschlechter der Käfer und eine grobe Alterseinteilung vorgenommen. Anhand dieser Daten lässt sich erkennen ob das Geschlecht oder das Alter einen Einfluss auf das Ausbreitungsverhalten der Borkenkäfer hat. 4272 der ausgebrachten Käfer wurden wieder eingefangen, das entspricht 6,11% der geschätzten Gesamtmenge der aus den Fichtenstämmen stammenden Käfer. Jedem dieser Wiederfänge können die Strukturparameter der Fallen zugeordnet werden. Mittels einer multiplen egression wurden die „attraktivsten“ Struktureigenschaften der Fallenstandorte ermittelt.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
209
Genetic characterization in scots pine provenances regarding resistance / tolerance against mistletoe and diplodia tip blight
Franziska S. Peters1, Barbara Vornam2, Aikaterini Dounavi1, Jörg Schumacher1
1Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Wonnhaldestr. 4, 79100 Freiburg, Germany, [email protected] 2Abteilung Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung, Büsgen-Institut, Georg-August-Universität Göttingen, Büsgenweg 2, 37077 Göttingen, Germany
Keywords: mistletoe, diplodia tip blight, pine provenance
In recent years, the forest area affected by European pine mistletoe (Viscum album ssp. austriacum) has increased steadily in southwestern Germany, reaching threatening proportions for the standing crop in some cases, whereas the importance of this hemiparasite is relatively slight in the northern and eastern pine forests. To date, the cause of this increase cannot be scientifically ascertained, but there is evidence indicating that the effects of climate change (dry summers, warmer temperatures) are factors promoting infection with mistletoe. Diplodia tip blight of pine, caused by the thermophilic microfungus Sphaeropsis sapinea, has developed into an increasing problem impairing growth and health of native scots pine in Germany. For this pathogen, the beneficial effects of climatic change have been scientifically ascertained. It has also been shown that different provenances of scots pine occurring in Germany differ significantly in susceptibility to S. sapinea (Schumacher, 2012). Although a valid question, since both pathogens share the same host on similar environmental habitats, it has so far not been studied if primary infection with either mistletoe or S. sapinea will make scots pines more vulnerable towards the other pathogen. In this study, which is carried out in the framework of the government-funded joint research project WAHYKLAS (www.fva-bw.de/indexjs.html?http://www.fva-bw.de/forschung/ws/ wahyklas/), we are analyzing the difference in susceptibility to S. sapinea of different pine provenances on a molecular level. We are also examining if susceptibility to mistletoe, which is not an important parasite on pine in large areas of Germany, can also be ascribed to a difference in provenance. Information on specific host-parasite interaction with regard to tolerance and resistance characteristics of different German pine provenances gained during this project is to assist us in stemming a further spread and an increase in severity of these forest disturbances in future by a selection of tolerant provenances. Schumacher, J. 2012. Auftreten und Ausbreitung neuartiger Baumkrankheiten in Mitteleuropa unter Berücksichtigung klimatischer Aspekte. Contributions to Forest Science. Habilitationsschrift, Ulmer Verlag, Stuttgart. 153 S.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 210
Analysis of molecular traits enhancing tolerance of oak roots to feeding of forest cockchafer grubs
Julia Teply-Szymanski1, Carolin Creyaufmüller2, Jürgen Kreuzwieser2, Barbara Vornam3, Jörg Schumacher1, Aikaterini Dounavi1, Horst Delb1
1Forest Research Institute Baden-Württemberg, Freiburg, [email protected] 2Chair of Tree Physiology, Albert Ludwig University of Freiburg, [email protected] 3Büsgen Institute, Forest Genetics and Forest Tree Breeding, Georg August University of Göttingen, [email protected]
Keywords: population genetics, volatiles, oak, forest cockchafer
Aims - Our work aims to elucidate the below-ground interaction of forest cockchafer grubs (Melolontha hippocastani) and pedunculate oak (Quercus robur) by identifying specific molecular traits that might promote tolerance to grub feeding on roots. Background - Forest cockchafer larvae are among the most destructive insect pests in many European forest eco-systems by causing severe damages to host roots. White oak species are among their favoured food sources, so that in areas of high grub density the survival of oak progeny is endangered. Even more so, as the infestation area continuously expands due to increasingly favourable climatic conditions for forest cockchafer development. The soil-dwelling cockchafer grubs are found to be attracted by certain volatile organic compounds (VOCs) emitted by host roots. However, it is still unknown in which way different oak provenances differ in VOC composition and quantities and how this influences grub behaviour and fitness. Approach - Therefore, we characterized several German provenances at a chemical and at a genetic level. To this end, we challenged 4-year-old seedlings of pedunculate oak with cockchafer grubs and measured the changes of marker gene expression and of volatile emission in roots and leaves. In order to define the genetic background of the oak seedlings, we used polymorphic microsatellites for detailed population genetic analyses. Relevance - The selection of tolerant provenances should allow us to give recommendations to the forestry management in areas of high cockchafer grub density in a changing climate. These investigations are carried out in the framework of the government-funded joint research project WAHYKLAS (http://wahyklas.fva-bw.de/).
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
211
Effizienz des Monitorings des Asiatischen Laubholzbockkäfers im Wald
Hannes Lemme1
1Abteilung Waldschutz, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: invasive Arten, Anoplophora glabripennis, Waldbefall, Bayern
In Feldkirchen bei München wurde im Oktober 2012 Befall durch den Asiatischen Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabripennis) festgestellt. Der Asiatische Laubholzbock-käfer (ALB) befällt, im Gegensatz zu fast allen heimischen Bockkäfern, vitale Laubbäume. Eine Schadwirkung entsteht, da befallene Bäume oft über mehrere Generationen immer wieder besiedelt werden, bis die Bäume soweit beschädigt sind, dass diese absterben oder bei Sturm abbrechen. Bei einer erfolgreichen Etablierung dieser Art muss mit erheblichen Schäden im urbanen Grün und in der Forstwirtschaft gerechnet werden. Der ALB ist daher ein meldepflichtiger Quarantäneschadorganismus. In einem Feldgehölz nahe Feldkirchen wurden im Januar 2013 die Bäume mit dem Fernglas vom Boden auf Befall untersucht und in „befallen“ und “nicht befallen“ klassifiziert und nachfolgend gefällt (n=174 Stämme von Spitz- und Bergahorn). Diese Stämme wurden sofort im Wald auf Befall kontrolliert. Stämme und Äste mit Befall wurden bis Ende April 2012 in der Quarantänezone detailliert untersucht. Insgesamt wurden an 66 Stämmen von Spitz- und Bergahorn ALB Befall (Eiablage, Larven, Ausbohrlöcher) festgestellt. Die Befallsrate der Ahornstämme im Feldgehölz lag zwischen 16 und 33%. In der Regel wurden je Stamm nur wenige Eiablagen, 1 Larve oder 1 Ausbohrloch gezählt. Nur bei wenigen Bäumen am Südrand lag ein massiver Befall vor. Die Effizienz des Monitoring lag bei maximal 43 % (richtig positiv: 29 Stämme, falsch negativ: 37 Stämme; nach Herausnahme BHD starker Bäume: richtig positiv: 17 Stämme; falsch negativ: 34 Stämme). Der überwiegende Anteil befallener Stämme wurde somit nicht erkannt. Das Ziel aller Maßnahmen gegen den ALB ist die Ausrottung des Käfers. Bei einer ausschließlichen Fällung von als befallen erkannten Bäumen nach einem Monitoring mit dem Fernglas vom Boden, muss bei einer Effizienz von maximal 43 % erwartet werden, dass das Ziel Ausrottung nicht erreicht werden kann. Diese Studie wurde von der Bayerischen Forstverwaltung und dem Julius-Kühnen Institut finanziert.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 212
Anpassungsvermögen und Wirt-Parasit-Beziehungen der Eichen im Klimawandel - Interaktion von L. dispar und Quercus ssp. unter
erhöhten CO2-Konzentrationen und unter Trockenstress
Kirsten Evertz1, Stefan Seegmüller2, Heinz Rennenberg3, Horst Delb1
1 Forstliche Versuchs-und Forschungsanstalt Baden Württemberg, Abteilung Waldschutz, 79100 Freiburg, Deutschland, [email protected], [email protected] 2 Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinlandpfalz, Abteilung Nachhaltige Waldbewirtschaftung, 67 705 Trippstadt, Deutschland, [email protected] 3 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fakultät für Forstbotanik und Baumphysiologie, 79110 Freiburg, Deutschland, [email protected]
Schlagworte: Lymantria dispar, Eichengerbstoffe, CO2-Anstieg, Trockenstress
Der Klimawandel wird unsere Wälder verändern. Dazu gehört, dass Eichen vermutlich Standorte von anderen Baumarten übernehmen werden, die dort nicht mehr zufriedenstellend wachsen können. Ob die bewährten Eichenherkünfte den Anforderungen längerer Trockenperioden unter erhöhtem CO2 im Klimawandel überall genügen können, ist fraglich. Vielleicht erweisen sich sogenannte „Trockeneichen“, die heute schon auf Standorten mit schlechter Wasserversorgung stehen, diesbezüglich als vorteilhaft. Interaktionen zwischen Bäumen und Schädlingen stellen einem treibenden Faktor für evolutionäre Prozesse im Waldökosystem dar. In diesem Zusammenhang heißt es, dass Gerbstoffe (Tannine) eventuell eine negative Wirkung auf die Fraßleistung von Waldschädlingen, die zur Massenvermehrung neigen, haben. Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae) ist ein wichtiger Waldschädling bevorzugt an Eichenarten, vor allem in Nordamerika und Europa. Bisher ist wenig bekannt, wie Lymantria dispar während seiner gesamten Lebenszeit auf Eichen unterschiedlich arider Herkünfte bei Trockenstress unter einem CO2-Anstieg aufgrund von Veränderungen in den Tanningehalten der Blätter reagiert. Durch regelmäßige Gewichtsmessungen der Larven nach der Fütterung auf ihren Wirtspflanzen, die unterschiedlichen Ariditäten und CO2-Konzentrationen ausgesetzt waren, konnten Einblicke in die physiologischen Anpassungsmechanismen, die an solchen Prozessen beteiligt sind, gewonnen werden. Das Gewicht der Larven, die an Eichen in verschiedenen CO2-Konzentrationen wuchsen, zeigte signifikante Unterschiede auf. Weiterhin gab es signifikante Unterschiede zwischen den beiden getesteten Ariditäten im Fressverhalten der Larven. Ein Trend zu einer bevorzugten Herkunft durch die Larven konnte noch nicht statistisch wiederlegt werden, kann aber zusammen mit einer physiologischen Analyse des Pflanzenmaterials, der Larven und des Kotes zu weiteren Aussagen führen. Das Projekt soll Hinweise geben, inwieweit man bei den geprüften autochthonen Eichen bleiben kann oder ob ein Wechsel zu den so genannten „Trockeneichen“ sinnvoll wäre.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
213
Beobachtungen des Benadlungszustandes der Kiefer (Pinus sylvestris L.) und ausgewählter Parameter der Populationsdynamik der Nonne
(Lymantria monacha L.) bei einer Massenvermehrung
Lutz-Florian Otto1, Franz Matschulla1
1Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft, Referat Waldbau/Waldschutz/Verwaltungsjagd, Staatsbetrieb Sachsenforst, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna /OT Graupa, [email protected]
Schlagworte: Nonne, Lymantria monacha L., Massenvermehrung, Waldschutz
Mittelalte Kiefernbestände im Nordosten des Freistaates Sachsen sind unter den dort gegebenen standörtlichen Verhältnissen für das Auftreten einer Massenvermehrung der Nonne (Lymantria monacha L.) die in Sachsen am höchsten prädisponierten Gebiete. Sowohl die Struktur der Waldeigentumsverhältnisse als auch die Landschaftsstruktur mit einem hohen Anteil von Gebieten mit einem Schutzstatus stellen besondere Anforderungen an die Umsetzung des integrierten (Forst-) Pflanzenschutzes in diesem Landesteil. Mit dem Ziel einer Charakterisierung der Folgen unterschiedlicher Handlungsstrategien (PSM- Einsatz bzw. - Verzicht) wurde 2012 bis 2015 im Rahmen einer lokalen Massenvermehrung der Nonne in 30-80 jährigen Kiefernbeständen ein Set von insgesamt 21 Beobachtungsflächen angelegt. Diese Beobachtungsflächen mit einer Größe von je 30x30 m wurden zu verschiedenen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Phasen der Massenvermehrung angelegt. Einzelbaumweise wurde der Einfluss des Raupenfraßes sowie der anschließenden Regeneration auf den Benadlungs- und damit Vitalitätszustand der Kiefern bonitiert. Stichprobenartig erfolgte eine Ermittlung ausgewählter Parameter zur Charakterisierung der Populationsdynamik der Nonne (Eidichten, Kotfallproben und Pheromonfallenfänge). Satellitenaufnahmen und entsprechende Interpretationen hinsichtlich des von Waldbäumen absorbierten/reflektierten Sonnenlichtes und damit der relativen Vitalität der Waldbäume wurden mit den terrestrisch erfassten Benadlungsdaten verglichen. Die Ergebnisse werden sowohl hinsichtlich der angestrebten Zielstellung als auch im Hinblick auf zukünftige Gefährdungsprognosen diskutiert. Sie ermöglichen auch Schlussfolgerungen für die Interpretierbarkeit der Ergebnisse spezieller Monitoringmethoden in Sachsen bzw. werfen Fragen zu den Handlungsstrategien auf.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 214
Standort- und witterungssensitive Modellierung des Buchdruckerbefallsrisikos für Fichte in Mittelgebirgsregionen
Nordwestdeutschlands
Samuel Schleich1, Ronald Bialozyt1 und Matthias Schmidt1
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Grätzelstr. 2, 37079 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Fichte, Borkenkäfer, GAMM, Befallsrisiko
Schäden aufgrund von Borkenkäferbefall stellen ein erhebliches Risiko für die Forstwirtschaft dar. Eine besondere Bedeutung kommt dem Buchdrucker (Ips typographus) zu, dessen Massenvermehrungen, insbesondere nach Wintersturmereignissen, regelmäßig zu großen Schäden an Fichte (Picea abies) führen. Es ist abzusehen, dass die Einflüsse wesentlicher Faktoren, die eine Massenvermehrung des Buchdruckers begünstigen (z.B. Temperatur-summen) oder den Zustand potenzieller Wirtsbäume beeinflussen (z.B. anhaltende Trockenheit), durch den projizierten Klimawandel verstärkt werden. Die individuelle Prädisposition eines Fichtenbestandes wird auch von vorhergehenden Schadereignissen, benachbarten Bestandesstrukturen, kleinstandörtlichen Bedingungen und in besonderem Maße durch die Art und Intensität der Bewirtschaftung bestimmt. Um die Wirkung dieser Faktoren auf das spezifische Risiko eines Fichtenbestandes für einen Befall durch den Buchdrucker zu quantifizieren, wird an der NW-FVA ein verallgemeinertes additives gemischtes Regressionsmodell (GAMM) entwickelt. Als Basis dient ein GAMM von Overbeck und Schmidt (2011), welches am Beispiel des Westharzes, das Risiko für einen Borkenkäferbefall innerhalb einer 10-jährigen Periode schätzt. Das bestehende Modell wurde präzisiert und weiterentwickelt. Die regional umfassend erweiterte Datengrundlage beinhaltet Erhebungen aus den Berglandregionen in Nieder-sachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen. Die Schätzung des Befallsrisikos erfolgt für Einzeljahre, um die kausalen Zusammenhänge zu dynamischen Kovariablen (z.B. Witterung) besser erfassen zu können. Als Kovariablen werden der Grundflächenmittelstamm, Mischungsanteil, Temperatursumme in der Vegetationsperiode, nutzbare Feldkapazität und ein Topex-Index verwendet. Der Fichtenanteil in der Nachbarschaft des betrachteten Bestandes, die Vorjahrestemperatursumme und vorausgegangene Sturmereignisse bzw. die resultierenden Schadholzmengen wurden ebenfalls berücksichtigt. Unbekannte Einfluss-größen, wie die Bewirtschaftung, werden über Zufallseffekte auf Revierebene quantifiziert. Der jeweilige Grundflächenmittelstamm wurde standortsensitiv modelliert, um die Prädisposition eines Bestandes in Abhängigkeit von der Entwicklungsstufe zu beschreiben. Das Modell ermöglicht sowohl die Einschätzung eines allgemeinen standort- und bestandesspezifischen Risikos, als auch einer konkreten Gefährdung in Abhängigkeit von aktuellen Vorschädigungen und Witterungsverläufen.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
215
Untersuchungen zur Interaktion von Wurzelterpenemission mit Maikäferlarven (Melolontha hippocastani) bei Eichen
Carolin Creyaufmüller1, Jürgen Kreuzwieser1
1Institut für Forstbotanik und Baumphysiologie, Georges-Köhler-Allee 053, D-79110 Freiburg i. B., Germany, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Terpene, Metabolite, Waldmaikäfer (Melolontha hippocastani), Klimawandel
Klimamodelle prognostizieren für Zentraleuropa ansteigende Temperaturen sowie veränderte Niederschlagsmuster, die häufiger zu extremen Trockenperioden während der Sommermonate führen werden. Dies führt dazu, dass heimische Baumarten durch Hitze und Trockenheit geschwächt sein können, wodurch vermutlich eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Herbivoren, Parasiten und Pathogenen auftritt. Auf der anderen Seite gibt es Hinweise, dass sich die Entwicklungszyklen von Schädlingen unter wärmeren Bedingungen verkürzen. Dies gilt beispielsweise für den Waldmaikäfer (Melolontha hippocastani), der etwa im Main-Rhein-Gebiet in den letzten 30 Jahren verstärkt auftritt. Dies erschwert dort die Naturverjüngung besonders von Eichen (Quercus spp.), da die Larven (Engerlinge) durch Fraß das Wurzelsystem schädigen. Es wird beobachtet, dass Engerlinge Eichen bevorzugt attackieren und andere Baumarten in Mischbeständen meiden. Bislang ist unklar, inwieweit sich Engerlinge im Boden orientieren und bevorzugte Wirtspflanzen auffinden. Erste Untersuchungen deuten auf eine große Bedeutung von Terpenen hin, die als „Infochemikalien“ von den urzeln in den Boden abgegeben werden und Engerlingen als Erkennungssignal für bestimmte Baumarten/Herkünfte dienen. In der vorliegenden Studie sollte überprüft werden, ob es art- und herkunftsspezifische Muster der Terpenkomposition und –freisetzung in Wurzeln verschiedener Eichenarten und –herkünfte gibt. Da es klare Hinweise gibt, dass befressene Wurzeln Engerlinge verstärkt anlocken, sollte auch getestet werden, inwieweit sich Fraßschäden auf die Terpenfreisetzung auswirken. Zur Klärung dieser Fragen wurden Experimente unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt, in denen vergleichend Sämlinge von Stieleiche (Q. robur), Traubeneiche (Q. petraea) und Flaumeiche (Q. pubescens) untersucht wurden. Zudem wurde der Effekt von Fraßschäden auf die Terpenfreisetzung von Stieleichen bestimmt. Es konnte gezeigt werden, dass tatsächlich Art- und teilweise auch Herkunfts-spezifische Muster der Terpenfreisetzung bei Eichen existieren. Sehr deutlich zeigte sich zudem, dass Fraß zu signifikant höherer Freisetzung von flüchtigen Terpenen über die Wurzeln führt. Neben Terpengehalten wurden auch die Gehalte an Primärmetaboliten in Wurzeln verschiedener Eichenarten sowie der Einfluss von Fraß auf die Metabolitkomposition bestimmt. Auch hier deuteten sich Verschiebungen im Metabolitprofil durch Engerlingfraß an.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 216
Medikamenten-Notstand im Wald!
Peter Eichel1 und Ralf Petercord1
1Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Servicestelle, Pflanzenschutzmittel, Zulassungssituation, Indikationslücken
Die aktuell und auch in Zukunft als kritisch zu bewertende Waldschutzsituation wird durch die mangelhafte Verfügbarkeit von integrierten Pflanzenschutzverfahren, einschließlich zuge-lassener Pflanzenschutzmittel verschärft. Obwohl die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Wäldern immer eine Ultima Ratio ist, sich auf bewährte artspezifische Monitoringverfahren stützt und zudem einer fachkundigen Begutachtung der zuständigen Behörden der Länder unterliegt, findet sie im Abwägungsprozess der Risiko-Nutzen-Bewertung im Zulassungsverfahren wenig Berücksichtigung. Damit wird dem Waldschutz ein notwendiges Fundament zur Erfüllung seiner Aufgaben entzogen, im Notfall erforderliche Bekämpfungsmaßnahmen durchführen zu können. Die Tatsache, dass Pflanzenschutzmittel im Wald nur selten angewandt werden, führt dazu, dass die Pflanzenschutzmittel herstellende Industrie sich zunehmend aus diesem Sektor zurückzieht. Gleichzeitig wird dem integrierten Pflanzenschutz eine Handlungsaufforderung gegeben Waldschutzlösungen für die Forstpraxis bereitzustellen. Ende 2014 ist mit der Zulassung von Dimilin 80 WG die letzte reguläre Zulassung eines Insektizids, mit der Anwendungstechnik Luftfahrzeuge im Einsatzgebiet Forst ausgelaufen. Im Waldschutz stehen somit für Forstschädlinge keine langfristig zugelassenen Mittel mehr für eine Luftfahrzeugapplikation zur Verfügung. Die Anzahl der Anwendungsgebiete für die keine oder keine ausreichenden bzw. praktikablen Bekämpfungsverfahren existieren oder für die die noch zugelassenen Pflanzenschutzmittel keine oder keine ausreichende Problemlösung gewährleisten, nehmen im Einsatzgebiet Forst zu. Somit ist ein nachhaltiger Pflanzenschutz, der ausreichende und vielfältige nichtchemische sowie chemische Pflanzenschutzverfahren beinhaltet, nicht mehr gewährleistet. Im ahmen des Verbundprojektes „Zukunftsorientiertes isikomanagement für biotische Schadereignisse in Wäldern zur Gewährleistung einer nachhaltigen Waldwirtschaft (RiMa- ald)“ wurde an der Bayerischen Landesanstalt für ald und Forstwirtschaft eine Servicestelle zur Verbesserung der Pflanzenschutzmittelverfügbarkeit im Forst eingerichtet. Aufgaben dieser Servicestelle sind die Evaluierung von Indikationslücken und alternativer Pflanzenschutzmittel bzw. -wirkstoffe im Forst sowie die Unterstützung im nationalen Zulassungs- und Genehmigungsverfahren und darüber hinaus die Mitwirkung an der Erarbeitung einer Pflanzenschutzstrategie für den Anwendungsbereich Forst.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
217
Genetische Untersuchung der Maikäfer in der Oberrheinebene: Verkürzt sich der Lebenszyklus des Waldmaikäfers aufgrund
klimatischer Änderungen?
Aikaterini Dounavi1, Jörg Schumacher1, Reinhold John1, Horst Delb1
1Abteilung Waldschutz, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Wonnhaldesttr. 4, 79100 Freiburg, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Melolontha hippocastani, Flugstamm, genetische Differenzierung, Klimawandel
Im südwestdeutschen Raum kommt der Waldmaikäfer (Melolontha hippocastani) vor allem in der nordbadischen und pfälzischen Oberrheinebene vor und richtet dort seit einigen Jahrzehnten große Schäden an. Dadurch sind die Möglichkeiten einer Waldverjüngung teils erheblich eingeschränkt. Der Wurzelfraß seiner im Boden lebenden Engerlinge vernichtet die jungen Pflanzen vielerorts komplett. Seit den neunziger Jahren werden die Populationen im Verbreitungsgebiet des Waldmaikäfers von der FVA überwacht. Dabei wird zwischen fünf sogenannten Flugstämmen unterschieden, wo die Entwicklung des Waldmaikäfers in den letzten Jahrzehnten regional weitgehend synchron verlief. Die Ergebnisse des langjährigen Waldmaikäfer-Monitorings weisen dort, wo Flugstämme aneinander grenzen, mittlerweile auf eine Durchmischung der Populationen hin, die während des Fluges der adulten Käfers erfolgt. Jedoch werden auch andernorts in Waldbeständen in zunehmendem Ausmaß mehrere Entwicklungsstadien des Waldmaikäfers gleichzeitig nebeneinander gefunden, so dass eine Abspaltung von sogenannten Nebenflugstämmen erfolgt. Als Ursache hierfür kommt eine Verkürzung des Lebenszyklus eines Teils der Populationen aufgrund von klimatischen Änderungen in Betracht. So ist bekannt, dass die Entwicklung des Waldmaikäfers in verschiedenen Regionen Eurasiens bei voneinander abweichenden klimatischen Verhältnissen unterschiedlich lange dauert. Zur Stützung der Annahme einer Verkürzung des Lebenszyklus soll geklärt werden, ob die am gleichen Ort zeitgleich anzutreffenden unterschiedlichen Entwicklungsstadien tatsächlich der gleichen Population angehören. Hierzu werden Maikäfer mittels molekulargenetischer Methoden untersucht. Dabei wurden 456 Individuen aus dem nordbadischen Verbreitungsgebiet des Waldmaikäfers mittels neun nuklearen Mikrosatelliten untersucht. Die ersten Ergebnisse der genetischen Untersuchungen zeigen eine deutliche genetische Differenzierung zwischen den verschiedenen Flugstämmen (Nord- und Südstamm). Weiterhin wird festgestellt, dass in bestimmten Teilgebieten vor allem des Südstammes Genotypen aus dem Nordstamm vorhanden sind. Als Ursachen kommen in Betracht: a) Durchmischung während des Fluges, b) eigener Flugstamm, oder c) Abspaltung von Nebenflügen bei verkürzter Entwicklung. Bei der Bewertung der Ergebnisse und Einschätzung der Ursachen werden räumliche Komponenten mitberücksichtigt werden.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 218
Genetische Diagnostizierung invasiver Laubholzbockkäfer aus Asien
Aikaterini Dounavi1, Reinhold John1, Horst Delb1, Jörg Schumacher1
1Abteilung Waldschutz, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Wonnhaldesttr. 4, 79100 Freiburg, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] Schlagworte: Anoplophora glabripennis, genetische Diagnostizierung, Quarantäne Schadorganismen, Klimawandel Der Asiatische Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabripennis) (ALB) ist einer der gefährlichsten Laubholzschädlinge weltweit und seit einigen Jahren hat er auch Deutschland erreicht. Die Art wurde mit Verpackungsholz von China zuerst in die USA und danach auch nach Österreich, Frankreich und Italien verschleppt. Inzwischen wurde er vielmals in Deutschland an heimischen Baumarten im Freiland nachgewiesen. Der ALB ist als Schaderreger in der Pflanzenbeschauverordnung aufgeführt und wird aufgrund des Larvenfraßes in der Rinde und im Holz über die Grenzen Europas hinaus als ein gefährlicher Schädling an Laubbäumen angesehen. Vor allem in den frühen Larvenstadien sind viele Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Bockkäferarten gegeben. Sie lassen sich jedoch mit einer genetischen Analyse sicher unterscheiden. Hierzu wurden in den letzten Jahren verschiedene genetische Methoden entwickelt. Mit der Diagnostizierung früher Entwicklungsstadien kann die Verbreitung des ALBs ggf. rechtzeitig eingegrenzt werden. Drei unterschiedliche genetische Methoden wurden im molekulargenetischen Labor der FVA Freiburg angewendet und optimiert, um die sicherste und auch kosteneffektivste als Standarddiagnosemethode zu etablieren. Dabei werden ALB-Adulte genotypisiert und deren DNA-Sequenzen als Vergleichssequenzen zu den DNA-Sequenzen von Larven unbekannter Art verwendet.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
219
Modellierung des Massenwechselgeschehens von Kleinem und Großem Frostspanner an Eiche in Norddeutschland
Anika Hittenbeck1, Ronald Bialozyt1, Pavel Plašil1, Matthias Schmidt1
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Grätzelstraße 2, 37079 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Quercus, Eichenfraßgesellschaft, Modellierung, GAMM
Die Vitalität der Eiche wird vielerorts durch Massenvermehrungen von blattfressenden Insekten beeinträchtigt. Starke Schäden entstehen dabei durch die Arten der Eichenfraßgesellschaft, die an frisch austreibenden Blättern der Eiche fressen und diese in Gradationsjahren komplett entlauben können. Im Rahmen der Überwachungsmaßnahmen werden daher der Kleine Frostspanner (Operophtera brumata) und der Große Frostspanner (Erannis defoliaria) mit Hilfe von Leimringen erfasst, um auf Grundlage dieser Daten das Fraßgeschehen im folgenden Frühjahr abschätzen zu können.
Im Teilprojekt „Biotische isiken der Eiche“ des durch den aldklimafonds geförderten Verbundprojekts DSS RiskMan wurden alle verfügbaren Überwachungsdaten der Frostspannerarten in den Bundesländern Niedersachsen, Hessen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg ab dem Jahr 1993 zusammengestellt. Diese wurden anschließend mit Forst-einrichtungs-, Standort- und Witterungsdaten sowie mit geomorphologischen Daten verschnitten.
Die Ergebnisse zeigen zeitliche Abfolgen von Massenwechseln sowie räumliche Trends auf. Es ist jedoch zu beachten, dass ein großer Teil der Daten schwerpunktmäßig in Gebieten und Jahren mit aktuellem Fraßgeschehen erhoben wurde, was zu einer Verzerrung führt. Diese gerichteten Niveauunterschiede sind daher bei der Modellierung zu berücksichtigen, um kausale Zusammenhänge der Frostspannerdichten zu Witterung und Standort identifizieren zu können. Auch müssen die populationsimmanenten Massenwechsel quantifiziert werden, da diese die potenziellen Effekte von Witterungs- und Standortsparametern überlagern.
Diese Anforderungen lassen sich in verallgemeinerten additiven gemischten Regressions-modellen (GAMM) umsetzen. Dabei werden die gerichteten Niveauunterschiede infolge der subjektiven Auswahl von Probeständen über Zufallseffekte dieser Bestände erfasst. Massenwechsel sind über nicht-lineare Effekte der Zeit und kausale Kovariablen über weitere potenziell nicht-lineare Effekte zu modellieren. Die zeitliche Abhängigkeit der Modellresiduen innerhalb von Probebeständen wird über ein einfaches simultan geschätztes Zeitreihenmodell erfasst.
Das entwickelte Modell soll sowohl Einschätzungen über die generelle Gefährdung bestimmter Standorte vor dem Hintergrund des Klimawandels ermöglichen als auch kurzfristige Prognosen unter Berücksichtigung des bisherigen Auftretens der Frostspannerarten und des zurückliegenden Witterungsverlaufes erlauben.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 220
Beobachtungen zum Auftreten des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoea processionea L.) in Sachsen
Franz Matschulla1, Markus Bachmann², Lutz-Florian Otto1
1Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft, Referat Waldbau/Waldschutz/Verwaltungsjagd, Staatsbetrieb Sachsenforst, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna /OT Graupa, [email protected] ²Landkreis Nordsachsen – SG Untere Forstbehörde, Dr.-Belian-Straße 4, 04838 Eilenburg, [email protected]
Schlagworte: Eichenprozessionsspinner, Thaumetopoea processionea L., Sachsen, Monitoring
In den vergangenen beiden Jahrzehnten hat die Bedeutung des Eichenprozessionsspinners durch den Fraß der Raupen als Eichenschädling und insbesondere auf Grund von Gesundheitsproblem für Mensch und Tier ausgehend von den Raupenhaaren in Teilen Deutschlands stark zugenommen. Das letzte stärkere Auftreten in Deutschland um 1950 war fast in Vergessenheit geraten. In Reaktion auf die immer weiter fortschreitende Ausdehnung der Befallsareale in den benachbarten Bundesländer Bayern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt wurden in Sachsen an entsprechenden Grenzen erstmals 2009 Pheromonfallen zum Fang von Eichenprozessions-spinnerfaltern ausgebracht. Dieses Monitoring, mit dem Hintergrund der Beobachtung von Ausbreitung und Etablierung der Schmetterlingsart, wird seitdem durchgeführt und wurde zwischenzeitlich regional intensiviert. 2012 wurde erstmals ein Befall durch den Eichenprozessionsspinner in Form von Raupen und Gespinsten im Gebiet der Stadt Dresden und damit außerhalb des ursprünglichen Monitoringgebietes festgestellt. Ab 2013 kamen dann auch Raupenfunde im Monitoringareal des Landkreises Nordsachsen hinzu. Die Vorgehensweise und bisher vorliegende Beobachtungsergebnisse, einschließlich einer Befallschronik anhand mehrerer Karten, werden präsentiert.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
221
Untersuchungen zur genetischen Variation von Rhabdocline pseudotsugae (SYDOW)
Kristin Morgenstern1, Jens-Ulrich Polster2 und Doris Krabel1
1Technische Universität Dresden/ Fakultät Umweltwissenschaften/ Institut für Forstbotanik und Forstzoologie/ Arbeitsgruppe Molekulare Gehölzphysiologie, Pienner Straße 7, 01737 Tharandt, [email protected] 2Technische Universität Dresden/ Fakultät Umweltwissenschaften/ Dozentur für Wildökologie und Jagdwirtschaft, Pienner Straße 8, 01737 Tharandt, [email protected]
Schlagworte: Rostige Douglasienschütte, Start Codon Targeted Polymorphism, Branch Point Signal Sequences
Der Ascomycet Rhabdocline pseudotsugae (SYDOW) ist, aufgrund seines enormen Schadpotenzials, eines der bedeutendsten Pathogene der Douglasie (Pseudotsuga menziesii [MIRB.] FRANCO). Dennoch basiert der aktuelle Kenntnisstand zur Morphologie und Biologie von R. pseudotsugae im Wesentlichen auf makroskopischen und mikroskopischen Untersuchungen von Pilzfruchtkörpern, Ascosporen und infizierten Douglasiennadeln. Die Anwendung molekulargenetischer Methoden beschränkte sich bislang auf die Entwicklung Pilz-spezifischer Primer zum frühzeitigen Nachweis der Infektion. In der vorgestellten Untersuchung steht erstmals die genetische Struktur von zwei R. pseudotsugae-Vorkommen im Fokus. Fruchtkörper von R. pseudotsugae wurden auf zwei Versuchsflächen in Sachsen und Nordrhein-Westfalen gesammelt und mittels einem Branch Point Signal Sequences (BPS)-Marker und vier Start Codon Targeted Polymorphism (SCoT)-Markern untersucht. Zur Beschreibung der genetischen Unterschiede innerhalb und zwischen den beprobten Versuchsflächen wurde eine hierarchische Clusteranalyse durchgeführt. Die untersuchten R. pseudotsugae-Kollektive waren insgesamt durch eine hohe genetische Vielfalt sowie eine hohe genetische Diversität gekennzeichnet. Ausgeprägte Unterschiede in der genetischen Struktur wurden zwischen den Versuchsflächen trotz großer geographischer Distanz jedoch nicht nachgewiesen. Innerhalb der einzelnen Versuchsflächen konnten dagegen Cluster mit einer auffälligen räumlichen Verteilung gebildet werden. Basierend auf diesen Ergebnissen ist anzunehmen, dass die Verbreitung von R. pseudotsugae über Ascosporen eher lokal begrenzt ist und infiziertes Pflanzenmaterial bei der Überwindung größerer Distanzen eine wesentliche Rolle spielt.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 222
WaldKlima-App – Waldpädagogik per Smartphone
Markus Dotterweich1, Larissa Hauer1
1UDATA GmbH – Umwelt und Bildung, Hindenburgstr. 1, 67433 Neustadt a.d. Weinstraße, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Waldpädagogik, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Edutainment
Klassische Waldpädagogik erreicht vor allem jüngere Kinder, während bei Jugendlichen das Interesse an Naturerfahrungen nachlässt (Brämer 2010). Der Einsatz von neuen Medien wie dem Smartphone in der Umweltbildung ist daher eine Chance, Jugendliche dort abzuholen, wo sie sich ohnehin bewegen. Des Weiteren spielen die Zusammenhänge zwischen Wald und Klimawandel in der Waldpädagogik bisher eine untergeordnete Rolle. Im durch den aldklimafonds der Bundesregierung geförderten Projekt „ aldKlima-App“ machen wir den Themenbereich Wald und Klimawandel für Jugendliche per Smartphone spielerisch erlebbar. Vermittelt werden die Bedeutung der Kohlenstoffspeicherung von Wäldern für den Klimaschutz, Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald, Anpassungsstrategien der Wälder an den Klimawandel, nachhaltige Holznutzung und die Bedeutung der biologischen Vielfalt im Wald. Die Entwicklung der App erfolgt zusammen mit Schüler/innen in Form einer AG, so wird eine passgenaue Zuschneidung auf die Zielgruppe erreicht. Mit Rätseln, Spielen und Animationen werden die Informationen spielerisch aufbereitet und können ortsunabhängig, z.B. im Unterricht genutzt werden. Zusätzlich wird es WaldKlima-Pfade (Missionen) geben, die nur absolviert werden können, wenn man sich an die jeweiligen Koordinaten begibt. Dies ist auch bekannt als Augmented Reality, d.h. die Verschneidung der realen Welt mit virtuellen Informationen, wobei die reale Welt als Spielplan dient. Die Missionen werden entlang bestehender Waldlehrpfade in der Nähe von Bildungseinrichtungen (Beispiel: Biosphärenhaus Pfälzerwald) angelegt. So wird der Anreiz geschaffen, sich mit den vor Ort vorhandenen Bildungsinhalten auseinanderzusetzen. Unser Vortrag liefert den Teilnehmern Anregungen, wie Smartphone-Apps und GPS-basierte Spiele in der Waldpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden können. Die Entwicklung der App wird zum Zeitpunkt der Tagung abgeschlossen sein, sodass das fertige Produkt und erste Ergebnisse von Testläufen mit Jugendlichen vorgestellt werden kann. Bei Interesse könnten wir einen kleinen WaldKlima-Pfad (Mission mit Aufgaben) rund um den Tagungsort erstellen, den die Teilnehmer/innen in Pausen absolvieren können. Die Projektseite ist erreichbar unter: www.waldklima-app.de Brämer, Rainer (2010) Natur: Vergessen? Erste Befunde des Jugendreports Natur 2010. Abgerufen am 07.01.2016 von www.natursoziologie.de
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
223
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoea
processionea L.) mit Nematoden mittels hubschraubergestützter Applikation
Katharina Lindner1
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Abteilung Waldschutz, Sachgebiet Käfer und Mittelprüfung, Grätzelstr. 2, 37079 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Eichenprozessionsspinner, Nematoden, Bekämpfung
In dem vom BLE geförderten Projekt soll eine Methodik entwickelt werden, mit der insektenpathogene Nematoden der Art Steinernema feltiae per Luftfahrzeug im Kronenraum von Eichen appliziert werden, um Bestandesschäden durch die blattfressenden (und gesundheitsschädlichen) Raupen des Eichenprozessionsspinners wirksam zu reduzieren. Nematoden unterliegen als Makroorganismen und sofern sie heimisch sind, wie die hier verwendete Art, keinen Zulassungs- und Anwendungsbeschränkungen nach Pflanzenschutz- und nach Naturschutzrecht. Eine Anwendung im biologischen Pflanzenschutz kann möglicherweise auch auf bedrohte Alteichenbestände ausgeweitet werden, für die der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel wegen möglicher Nebenwirkungen grundsätzlich ausgeschlossen ist (z. B. Natura 2000 Habitate). Die Wirksamkeit von S. feltiae auf die Raupen des Eichenprozessionsspinners wurde in Labor- und Freiland-Versuchen nachgewiesen. Außerdem wurden feuchtigkeitsspendende Zusatzstoffe für den Einsatz der eigentlich im Boden lebenden Fadenwürmer geprüft und das konventionelle Spritzgerät des Hubschraubers wurde für die Ausbringung lebender Nematoden angepasst. In der Saison 2015 und 2016 wurden Bekämpfungen unter realen Freilandbedingungen durchgeführt. Die Ergebnisse werden hier vorgestellt. Diskutiert werden dabei die besonderen Rahmenbedingungen, unter denen Nematoden erfolgreich die Raupen des Eichenprozessionsspinners infizieren können.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 224
Entwicklung der Waldmaikäfergradation im bayerischen Alzenau 2008 bis 2015
Sebastian Gößwein1
1Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Melolontha hippocastani, Unterfranken, Massenwechsel
Seit 2004 werden in den Wäldern nördlich von Alzenau an der Landesgrenze zu Hessen erhöhte Dichten des Waldmaikäfers registriert. Die Hauptbaumart in diesen Wäldern ist Kiefer, wobei diese auf größeren Bereichen mit Buche unterbaut ist. In den Jahren 2011 und 2015 wurden jeweils im August auf 1289 ha systematische Probegrabungen in einem 250 x 250 m Raster durchgeführt. An jedem Punkt wurden 4 Satelliten mit einer Kantenlänge von 50 x 50 cm in den Haupthimmelsrichtungen 10 m vom Mittelpunkt entfernt gegraben. Die Grabungstiefe betrug mindestens 50 cm, wobei 20 cm über den letzten Engerlingfund hinausgegraben wurde. Die Fläche ohne Vorkommen von Engerlingen des Waldmaikäfers hat sich von 355 ha 2011 um 44 ha auf 399 ha erweitert. Gleichzeitig hat sich die Fläche, auf der die Kritische Dichte (x ≥ 3 Larvalstadium3/Puppe/Imago pro m²) überschritten ist, von 616 ha im Jahr 2011 um 95 ha auf 521 ha verringert. Im Gegensatz dazu ergibt sich auf der Grabungsfläche eine Erhöhung der Dichte von 3,5 L3/P/I pro m² im Jahr 2011 auf 3,6 L3/P/I pro m². Oberflächlich betrachtet hat sich die Situation für die Waldbesitzer im Grabungsgebiet verbessert, denn die Fläche ohne Vorkommen der Engerlinge hat sich vergrößert und gleichzeitig die Fläche mit Kritischer Dichte verringert. Allerdings lässt sich eine Konzentration der Engerlinge auf zwei Schwerpunkte feststellen. Im größeren Schwerpunkt hat sich die Dichte der Engerlinge entgegen dem allgemeinen Trend im Gebiet von 6,3 L3/P/I pro m² auf 8,8 L3/P/I pro m² erhöht. Auffällig ist, dass gerade auf den verlichteten Waldflächen die Dichte der Engerling abgenommen hat, obwohl gerade verlichtete Bestände als besonders günstig für die Entwicklung der Waldmaikäfer gelten. Die waldbauliche Situation bleibt für die Waldbesitzer angespannt, da bei weiteren Verschiebungen der Engerlingsvorkommen Ausfälle in der Verjüngung drohen.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
225
Effekte von Insektizidmaßnahmen und natürlichen Störungen auf die Antagonistenfauna in Kiefernwäldern
Bianca Kühne1, Antje Förster1 und Nadine Bräsicke1
1Julius Kühn-Institut (GF), Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Antagonisten, Biodiversität, Kiefernwälder, Pflanzenschutz
Seit mehreren Jahren wird der aviochemische Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Wäldern kontrovers diskutiert. Während der Umweltschutz die möglichen Risiken von Insektizidmaßnahmen auf den Naturhaushalt (Nichtzielorganismen) in den Vordergrund stellt, sieht die Forstwirtschaft den Erhalt der Waldbestände - aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln und den aktuell festgesetzten Anwendungsbestimmungen bei deren Ausbringung - gefährdet. Im Hinblick auf die erwarteten Folgen des Klimawandels, werden chemische Pflanzenschutzmaßnahmen aber weiterhin erforderlich sein, auch wenn sie bezogen auf die Waldfläche Deutschlands die Ausnahme bleiben. Hierfür ist es wichtig ökologische Daten zur Anwendung von Insektiziden in Wäldern zu erheben, um die ökosystemaren Belastungen zu identifizieren.
Im ostdeutschen Raum steht hierbei vor allem die Kiefer als Hauptbaumart im Fokus. Vorwiegend angebaut auf extrem schwachen Standorten, wird sie bei warm-trockener Witterung häufig durch regelmäßig auftretende Insektenkalamitäten bedroht. Trotz einer guten Regenerationsfähigkeit der Kiefer können ungünstige Wetterlagen und Sekundärschädlinge zu einem flächigen Absterben von Beständen führen, das wiederum die Biozönose beeinflusst.
Im Rahmen eines BMEL-FNR-Verbundvorhabens zum zukunftsorientierten Risikomanagement in Wäldern startete im Oktober 2015 eines von insgesamt fünf Teilvorhaben, welches gezielt Kiefernwälder in Schadgebieten Brandenburgs untersucht, und hier mit seinen Arbeitspaketen und Forschungszielen vorgestellt werden soll. Ziel ist es die direkten und langfristigen Auswirkungen von luftgestützten Insektizidmaßnahmen (z. B. mit einem Pyrethroid oder Häutungsbeschleuniger) sowie von Licht- und Kahlfraßereignissen in Wäldern auf die Antagonistenfauna (u. a. Räuber, Parasitoide) zu erfassen. Mit Rückstandsanalysen wird zusätzlich die Wirkstoffkonzentration in Schadinsekten bzw. Nichtzielorganismen sowie in Pflanzenmaterial bestimmt. Auch werden Abdrift- und Expositionsmessungen Aufschluss über die Belastung von angrenzenden Arealen bzw. über die verbleibende Menge des Spritzschleiers am Waldboden geben.
Die Ergebnisse sollen einen Beitrag zur Risiko-Nutzen-Analyse bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Wäldern leisten sowie bei der Formulierung von anwendbaren Risikominderungsmaßnahmen helfen unter der Erhaltung und Förderung der Biodiversität.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 226
Praxistest von Trinet® P zur Verringerung von Buchdrucker-Stehendbefall
Lutz-Florian Otto1, Jörg Thiel2
1Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft, Referat Waldbau/Waldschutz/Verwaltungsjagd, Staatsbetrieb Sachsenforst, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna /OT Graupa, [email protected] 2Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha, Jägerstraße 1, 99867 Gotha, [email protected]
Schlagworte: Buchdrucker, Ips typographus L., Befallsreduzierung, Trinet® P
Mit dem Produkt Trinet® P wurde im Oktober 2014 ein neues Pflanzenschutzmittel zugelassen, das die Möglichkeiten der Borkenkäferabwehr im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes erweitert.
Bei Trinet® P handelt es sich um ein 2,2 m² großes Kunststoffnetz, das pyramidenartig über ein Dreibeingestell gespannt wird. Das Netz besteht aus Polyesterfasern, die mit einer Formulierung des insektiziden Wirkstoffes alpha-Cypermethrin und einem polymeren Bindersystem beschichtet sind. Nach dem „attract-and-kill“-Prinzip werden durch die im Inneren der Pyramide eingehangene Pheroprax®-Ampulle gezielt Buchdrucker (Ips typographus L.) angelockt. Das Pyrethroid wirkt als Kontaktinsektizid und soll die Käfer bei Berührung mit dem Netz abtöten bzw. letal schädigen. Das Wirkprinzip entspricht somit dem pheromonbeköderter, insektizidbehandelter Fangholzhaufen.
Gemäß dem amtlichen Zulassungsbescheid reduziert der Einsatz von Trinet® P die Populationsdichte des Buchdruckers. Dieser Parameter allein ist aus Sicht der Versuchsansteller für einen Einsatz unter den Rahmenbedingungen der Bewirtschaftung großer fichtendominierter Landeswaldbetriebe jedoch nicht ausreichend. Nur wenn die lokale Dichtereduktion auch zu einer nachweisbaren Verringerung von Buchdrucker-Stehendbefall führt, ist das Anwendungsziel erreicht. Für dieses Ziel wird das Produkt auch vom Hersteller beworben. Damit liegt der Einsatzzweck wie beim Fangholzhaufen im Schutz von potenziellen Wirtsbäumen des Buchdruckers in Bereichen, in denen speziell im Frühjahr mit lokal sehr hohen Käferdichten zu rechnen ist. Das ist z. B. in unmittelbarer Nähe innerhalb der Befallsaison sehr spät entstandener, unsanierter bzw. zu spät oder nicht vollständig sanierter vorjähriger Befallsstellen der Fall.
In den Jahren 2014 und 2015 führten die Versuchsansteller methodisch abgestimmte Praxistests mit Trinet® P durch. Dabei wurde nicht die Abschöpfungsrate in Form der Anzahl der an das Netz angeflogenen Buchdrucker im Vergleich zu anderen Verfahren (z. B. Borkenkäfer-Schlitzfalle, Fangholzhaufen, Fangbaum) untersucht. Als Kriterium zur Beurteilung der Wirksamkeit dient vorrangig der Vergleich der Menge an neuen Stehendbefall an unbehandelten bzw. mit Trinet® P geschützten vorjährigen Befallsstellen. Das methodische Vorgehen und die bisher vorliegenden Ergebnisse werden präsentiert.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
227
Monitoring der Populationsdynamik forstschädlicher Kurzschwanzmäuse (Arvicolinae) im Kontext waldbaulicher Ziele
Lutz-Florian Otto1, Kerstin Rödiger1
1Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft, Referat Waldbau/Waldschutz/Verwaltungsjagd, Staatsbetrieb Sachsenforst, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna /OT Graupa, [email protected]
Schlagworte: Wühlmäuse, Arvicolinae. Monitoring, Waldbauplanung
Forstschädliche Kurzschwanzmäuse der Unterfamilie der Wühlmäuse (Arvicolinae) können zu erheblichen Schäden bis zum vollständigen oder partiellen Totalausfall von künstlichen Waldverjüngungen führen. Im Zusammenhang mit den flächenmäßig umfangreichen Waldumbaumaßnahmen durch den Staatsbetrieb Sachsenforst, jährlich werden etwa 1.200 ha vorrangig mit Laubbaumarten umgebaut, ist die Thematik forstwirtschaftlich relevant. Die Sicherung dieser Investitionen in einen an die zukünftigen Anforderungen angepassten Wald ist in den ersten Jahren der Etablierung der Verjüngung eine wesentliche Waldschutzaufgabe. Neben dem pflanzenschutzrechtlichen Erfordernis, vor dem Einsatz bestimmter Rodentizide eine Prognose der Schadentwicklung vorzunehmen, die für eine Einzelfläche gilt, führt eine Reihe von Bundesländern auch ein großräumiges Monitoring zur Überwachung der Populationsdynamik von Erd-, Feld- und Rötelmaus durch. In Sachsen wurden dafür bisher vorrangig Flächen genutzt, die z.B. als waldbauliche oder züchterische Versuchsflächen angelegt waren, auf denen in den Vorjahren auffällige Schäden registriert wurden oder die aufgrund ihrer Lage die regionale Verteilung des Monitoringnetzes vervollständigten. Mit dem Vorliegen einer Zielbaumartenkarte und einem Konzept für Waldentwicklungstypen (WET), das ausgehend von einen Ausgangszustand der aktuellen Bestockung den Weg zur Erreichung des Zielzustandes beschreibt, ergeben sich neue Möglichkeiten für eine gezielte Ausrichtung des Mäusemonitorings. Besonders die WET EI-RBU beim Ausgangszustand Kiefer bzw. die WET EI-LB, RBU-EI und GFI-RBU beim Ausgangszustand Fichte können bei ihrer Etablierung Sukzessionsphasen durchlaufen, in denen durch die Bodenvegetation dominierte Biotope entstehen, die ideale Maushabitate darstellen. Unter diesen Bedingungen können kurative Pflanzenschutzmaßnahmen, wie die Anwendung von Rodentiziden, notwendig und allein zielführend sein. Vorgestellt wird das GIS-basierte methodische Vorgehen zur Auswahl geeigneter Monitoringstandorte, die neben den vorgenannten Aspekten weitere populationsdynamisch relevante Parameter berücksichtigen und damit einen Beitrag zur Qualifizierung des Monitoring der Populationsdynamik forstschädlicher Kurzschwanzmäuse leisten.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel 228
Forest clearing as cause of invasions by woody species: the case of Prosopis in Eastern Africa
Miguel Alvarez1, Simon K. Choge2, Gereon Heller1, Itambo Malombe3, Kennedy W. Matheka3 und Mathias Becker1
1Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES), Universität Bonn, Karlrobert-Kreiten-Str. 13, 53155 Bonn, [email protected], [email protected], [email protected] 2Kenya Forestry Research Institute (KEFRI), Marigat, Kenya, [email protected] 3East African Herbarium, National Museums of Kenya (NMK), Museum Hill, Nairobi, Kenya, [email protected], [email protected]
Keywords: coppice, forest clearing, soil erosion, wood invasion
Prosopis juliflora and P. pallida have been reported as highly noxious invasive species in dry areas among the Tropics worldwide. In Eastern Africa, as in many other places, Prosopis species have been deliberately introduced for afforestation purposes. Due to its rapid spread by endozoochorous dispersal, fast growth and coppice ability, Prosopis became invasive, affecting pastoral land and causing big economical and ecological problems in East Africa. In order to assess the causes of successful spread of Prosopis in this region, we made a survey in the areas surrounding the Lake Baringo at the Great Rift Valley in Kenya. Through measurements of structure variables and estimations of the predominance of Prosopis in invaded stands we attempt to generate an objective classification of the infestation degree. We further try to produce a map of the Prosopis infestation, using spectral analysis of Spot5 imagery and ground truth. Additionally, spatial models are calibrated using environmental variables (soil, climate and landscape) as predictors. Finally, floristic surveys aim to determine relationships between the occurrence of Prosopis and other woody species, as well as its preference for specific vegetation units. Absolute cover of Prosopis canopy was determined as the best variable representing the degree of infestation in woody stands. Floristic studies suggest a close relation of the cover of Prosopis to the occurrence of high trees such as Acacia tortilis, Balanites aegiptica and Cordia sinensis, suggesting an original occurrence of dense riparian forests in invaded areas. On the other hand, Prosopis is less invasive in vegetation units typical of shallow, stony soils and characterized by Acacia reficiens, A. mellifera and A. senegal. Clear-cut of riparian forests as well as the subsequent soil erosion is already documented in the literature. Strategies to ameliorate effects of invasion may include reforestation, but a detailed study of reference forests is required for restoration purposes. In this work we also discuss deforestation as cause of Prosopis invasion in other localities in East Africa and abroad.
Poster Session 5: Waldschutz unter Globalisierung und Klimawandel
229
Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP) im Bereich Wald/Forst
Christoph Göckel1, Thomas Bublitz2 und Horst Delb3
1Regierungspräsidium Freiburg, Abt. Forstdirektion; Landesbetrieb Forst Baden-Württemberg 2Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg; Landesforsten Rheinland-Pfalz 3Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, [email protected]
Schlagworte: Waldschutz, Nationaler Aktionsplan, Integrierter Pflanzenschutz
Die Bundesregierung hat am 10. April 2013 den Nationalen Aktionsplan (NAP) zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verabschiedet. Er ist Teil der Umsetzung der EU-Pflanzenschutz-Rahmenrichtlinie 2009/128/EG über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden. Im Mittelpunkt des NAP steht die Reduktion von Risiken für Mensch, Tier und Naturhaushalt, die durch die Anwendung von zugelassenen Pflanzenschutzmitteln entstehen können. Dabei werden die gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen auch für den Wald berücksichtigt. Mehr als ein Drittel der Landesfläche von Baden-Württemberg sind Wald. Mit rund 14.000 km² Wald zählt es zu den waldreichsten Bundesländern. Zuständig für den Waldschutz bei ForstBW ist die Abt. 8 Forstdirektion im Regierungspräsidium Freiburg und hier der Geschäftsbereich Waldschutz im Fachbereich/Referat 83. Die Tätigkeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Abt. Waldschutz der FVA-Baden-Württemberg. Diese befasst sich mit der Gesunderhaltung des Waldes und seiner Produkte. Dabei sind das Wissen über Waldkrankheiten und deren zuverlässige Erkennung für das Verständnis über die Entstehung von Schäden an Bäumen und an Nutzholz, aber auch für die Erklärung vielfältiger weiterer Prozesse im Wald wesentlich. Es werden biotische Schadensverursacher, insbesondere Insekten und Pilze sowie die Folgen abiotischer Schadensursachen wie Sturm, Trockenheit und weitere Faktoren betrachtet. Ziel der Arbeit ist es, Schädlingsaufkommen und Krankheitsverläufe möglichst genau vorherzusagen sowie zur Verhütung von Schäden fundierte Empfehlungen für deren Vorbeugung und umweltschonende Regulierung zu geben. Diese Aufgabe wird im Rahmen eines sich verändernden Klimas immer bedeutender. Der Integrierte Pflanzenschutz stellt ein wesentliches Grundprinzip dar. Dabei steht die Vermeidung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln im Vordergrund. Diese müssen jedoch als „ultima ratio“- Option dennoch einsetzbar bleiben. Die Aktivitäten bei ForstBW im Rahmen des NAP beziehen sich bisher v.a. auf die Bereiche Zertifizierung (PEFC, FSC), Optimierung der Pflanzenschutzmittel-Dokumentation, Initiierung von „Waldschutz-beauftragten“ an den Unteren Forstbehörden, Fortbildungs-Kampagne „Sachkunde-Pflanzenschutz“, forstzoologische und forstpathologische Forschung, Optimierung der Schädlingsüberwachung und Prognose (Monitoring) sowie die waldgesundheitliche Beratung.
Poster Session 6: Lichte Wälder 230
Lichte Wälder im Kanton Aargau
Steffi Burger1
1Kanton Aargau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Wald, [email protected]
Schlagworte: Lichter Wald, Mahd, Beweidung
Das Naturschutzprogramm Wald des Kantons Aargau ist seit 20 Jahren auf Kurs. Lichte Wälder bilden darin eine wichtige Kategorie von Lebensräumen, welche seltene Tier- und Pflanzenarten schützen und fördern. Bei einem Ersteingriff werden die meist mit zahlreichen Föhren bestockten Waldungen aufgelichtet. Zu Beginn des Naturschutzprogramms wurden lichte Wälder ausschliesslich gemäht. 2001 wurden auch erste Pilotprojekte mit einer Beweidung als Pflegemaßnahme gestartet. Seither werden im Kanton Aargau rund ein Fünftel aller lichten Wälder beweidet. Der Vortrag umreisst das Naturschutzprogramm Wald des Kantons Aargau und geht auf die Erfahrungen im Umgang mit lichten Waldflächen in der Praxis ein.
Poster Session 6: Lichte Wälder
231
Biodiversität und Naturschutz: Lichte Wälder bei Bundesforst
Matthias Pollmeier1, Sabine Stein1
1Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Bundesforstbetrieb Schwarzenborn + Zentrale Bundesforst, [email protected]
Schlagworte: Militär, Naturschutz, Lichte Wälder
Militärisch genutzte Flächen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zeichnen sich häufig durch einen besonders hohen naturschutzfachlichen Wert aus. Gleiches gilt für sogenannte Konversionsliegenschaften – also für Flächen, die nicht mehr privilegiert durch den Bund genutzt werden. Die übende Truppe selbst, aber auch die Flächenbetreuer von militärischen Übungsplätzen tragen dazu bei, in der dort (halb-)offenen Landschaft selten gewordene Biotopstrukturen für störungsempfindliche Arten zu schaffen und zu erhalten. Nachhaltige militärische Nutzung ist somit ein Garant für die Sicherung von besonderen Lebensräumen und geschützten Arten. Eine Vielzahl von militärischen Übungsplätzen ist deshalb in die NATURA 2000 Schutzgebietskulisse integriert. Mit Aufgabe der militärischen Nutzung stellt sich wiederkehrend die Frage der Anschlussnutzung dieser Flächen. Naturschutzfachlich besonders wertvolle Flächen werden häufig im Nationalen Naturerbe gesichert. Eine weitere Möglichkeit der Sicherung stellt die Einrichtung von Flächenpools zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft dar, beispielsweise als Kompensation für den Bundesfernstraßenbau oder den Ausbau des Schienennetzes. Besonders wertvolle Strukturen lichter Wälder, die durch häufiges Betreten und Befahren, Beschuss und Feuer im Rahmen des Übungsbetriebs entstanden sind, sind unter forstlichen Gesichtspunkten häufig nur bedingt wirtschaftlich nutzbar - Munitionsbelastung, Beschussholz und geringwertige Sortimentsgliederungen des Nutzholzes lassen die forstliche Nutzung in den Hintergrund treten. Auch deshalb eignen sich diese, sowie ehemalige Hutewald-Bereiche auf ehemaligen Übungsplätzen sehr gut für Naturschutzprojekte.. Im Regelfall entstehen individuell auf die jeweilige Fläche und naturschutzfachliche Zielvorstellung entwickelte Projekte in den Bundesforstbetrieben, darunter u.a. Artenschutzprojekte für xylobionte Käfer oder auch (Wald-)weideprojekte zum Erhalt und der Entwicklung von Halboffenland. Zielstellung der Sparte Bundesforst für die ihr anvertrauten Liegenschaften ist die Sicherung und Entwicklung der auf ihnen vorkommenden sehr seltenen Arten und Lebensräume. Dies kann sowohl über eine gelenkte und nachhaltig organisierte militärische Nutzung als auch über Naturschutzprojekte im Nachgang der Nutzung durch das Militär erfolgen. Bundesförster fühlen sich ihrem Leitbild verpflichtet: Bundesforst – Natur in guten Händen.
Poster Session 6: Lichte Wälder 232
Invasive Pflanzenarten in lichten Waldstrukturen: Übersicht, Quellen und Schadwirkungen
Götz Heinrich Loos1
1Naturschutzbund Deutschland (NABU) NRW, Landesfachausschuss Botanik, Wittenberger Str. 3, 59174 Kamen, [email protected]
Schlagworte: Invasive Pflanzen, Neophyten, Schadarten, Schadwirkungen
Waldweideprojekte wie generell die Herstellung von lichten Waldstrukturen sehen sich vor der Problematik der starken Ausbreitung bestimmter Pflanzenarten, wobei es sich vielfach um invasive Neophyten handelt. Die möglichen Schadwirkungen, die von diesen Pflanzen ausgehen, sind allerdings verschieden – sowohl artspezifisch als auch örtlich, so dass erst nach Einzelfallprüfungen sichere Aussagen über die Problematik jeweils vor Ort getroffen werden können. In der präsentierten Übersicht zeigt sich folglich ein heterogenes Spektrum: Gebietsfremde Arten, heimische Arten, Arten mit grundsätzlicher Invasivität, Invasivität mit Schadwirkungen, Invasivität ohne Schadwirkungen, diese generell oder örtlich. Hinzu kommt die Herkunft bzw. die Ausbreitungsursachen entsprechender Arten, die teilweise nur schwer beeinflussbar sind (u.a. Landschaftshypertrophierung, Klimawandel, autonome Ausbreitungen/Einwanderungen, Gartennähe von entsprechenden Projekten), zum Teil jedoch durch einschlägige Maßnahmen verhindert werden könnten (u.a. Unterbinden der Ausbringung von Gartenabfällen, Verhinderung der Anpflanzung bestimmter Arten in freier Landschaft bzw. in Wäldern und Forsten). Eine Reihe von Arten wird hinsichtlich des Schadpotenzials zudem überschätzt, einige andere unterschätzt. Studien des Verfassers in mehreren Regionen Deutschlands und die Auswertung von Literatur werden hier zusammengetragen, um eine Gesamtübersicht geben zu können und Angaben zu den Herkünften und bislang beobachteten sowie potenziellen Schadwirkungen.
Poster Session 6: Lichte Wälder
233
Waldweide wieder im Kommen? Erprobung neuer Synergien zwischen Naturschutz, Forstwirtschaft und stadtnaher Erholung
Uta Steinhardt1, Peter Spathelf1, Dörte Beyer1, Ninett Hirsch1, Vera Luthardt1, Georg Ruck1 und Anja Stache1
1Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, [email protected]; [email protected]
Keywords: Rieselfeldlandschaft, extensive Ganzjahresbeweidung, Biodiversität, Naturpark Barnim
Wie können Landnutzungssysteme aussehen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes ebenso erhalten oder wiederherstellen wie die Produktionsfunktion? Wie können devastierte Flächen wieder in Nutzungsräume überführt werden, die gleichzeitig die biologische Vielfalt auf der Ebene der Arten, Biozönosen und Ökosysteme stärken? Bezogen auf die ehemalige Rieselfeldlandschaft um Hobrechtsfelde am nördlichen Berliner Stadtrand galt es in diesem Sinne, Synergien zwischen Naturschutz, Forstwirtschaft und stadtnaher Erholung zu identifizieren und mittels extensiver Beweidung einen für Deutschland neuen Landschaftstyp zu entwickeln: die halboffene Waldlandschaft. Im Fokus der wissenschaftlichen Begleitung dieses vom BfN geförderten Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens standen deshalb sowohl Ziele des Naturschutzes (Habitatvielfalt, landschaftliche Diversität und Dynamik, ausgedehnte Übergangsstadien zwischen Gehölzstrukturen und Offenlandschaft, Schaffung von Pionierstandorten) als auch forstwirtschaftliche Ansprüche wie die Förderung von Zielbaumarten (Eiche, Hainbuche, Ahorn, Esche, Feldahorn) und das Zurückdrängen von Neophyten (Eschenahorn, Spätblühende Traubenkirsche). Eines der wesentlichen Erprobungsziele war zudem die enge Verzahnung der extensiven Ganzjahresbeweidung mit der Nutzung des Gebietes durch Erholungssuchende. Angestrebt wird ein abwechslungsreiches Mosaik aus offenen, halboffenen und geschlossenen Pflanzenformationen. Prägend für den untersuchten Landschaftsraum sind zum einen die enorme Heterogenität der Standortverhältnisse und zum anderen die sich in den zurückliegenden 150 Jahren drastisch wandelnden (Nutzungs-)Ansprüche an diesen Raum. In Kombination mit den aktuellen klimatischen Veränderungen hat dies zu einer unvergleichlich hohen Landschaftsdynamik beigetragen, aus der eine sehr spezifische Biotopausstattung resultiert. 2011 wurden auf ca. 830 ha neun Beweidungskomplexe mit Flächengrößen zwischen 50 und 150 ha abgegrenzt, die ganzjährig v.a. mit Koniks und Schottischen Hochlandrindern sowie Uckermärker Rindern bei einer mittleren Besatzstärke von 0,2 GVE/ha ganzjährig beweidet wurden. Sowohl disziplinäre als auch integrative Ergebnisse des räumlich und zeitlich hierarchisch gestaffelten Untersuchungsansatzes werden in Verbindung mit Erfahrungen zur Partizipation aus diesem transdisziplinären Vorhaben exemplarisch vor- und übertragbare Schlussfolgerungen und weiterführende Überlegungen zur Diskussion gestellt.
Poster Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität 234
Baumartendiversität auf Buchenstandorten unter Dauerwaldbewirtschaftung
Martin Brüllhardt1, Harald Bugmann2 und Peter Rotach3
1ETH Zürich, Institut für Terrestrische Ökosysteme, Universitätstrasse 16, 8092 Zürich, [email protected] 2ETH Zürich, Professur für Waldökologie, Universitätstrasse 16, 8092 Zürich, [email protected] 3ETH Zürich, Gruppe Waldbau/Waldmanagement, Universitätstrasse 16, 8092 Zürich, [email protected]
Schlagworte: Dauerwaldbewirtschaftung, Baumartendiversität, Licht, Buche
Viele traditionell schlagweise bewirtschaftete Wälder werden heute vermehrt einzelbaumweise bewirtschaftet (Dauerwälder) oder in solche umgewandelt. Insbesondere auf gut wüchsigen Buchenwaldstandorten stellt sich dabei die Frage nach dem Erhalt einer breiten Baumartenpalette. Die Baumartendiversität dürfte eine zentrale Rolle spielen für die Stabilität, Produktivität und Resilienz von Waldökosystemen, was vor dem Hintergrund des Klimawandels und zunehmender sowie teils neuartiger Störungen an Bedeutung gewinnt. Aus Erfahrungen ist bekannt, dass vertikal strukturierte Mischbestände weniger störungsanfällig sind als gleichförmige, gleichaltrige Bestände. Für den Aufbau und Betrieb von nachhaltig ungleichaltrigen Mischbeständen ist es aber von großer Bedeutung, die Anforderungen der Baumarten an die Lichtverfügbarkeit zu quantifizieren, um die langfristigen Folgen der Eingriffsgröße und Eingriffsstärke auf die Waldentwicklung abschätzen zu können. Wir gehen von der Hypothese aus, dass durch die Schaffung ungleichförmiger und ungleichaltriger Bestandesstrukturen flächig schattentolerante Arten begünstigt werden und die Abundanz lichtbedürftiger Mischbaumarten geringer wird. Um diese Hypothese zu überprüfen, greifen wir auf eine breite Palette von Inventurdaten zurück und analysieren die Artenzusammensetzung der über die Kluppschwelle eingewachsenen Bäumen in Abhängigkeit von Bestandesstruktur und Nachbarschaft. Des Weiteren untersuchen wir, wie die Lichtverfügbarkeit in stufigen Strukturen das Wachstum der Buche (Fagus sylvatica) und des Bergahorns (Acer pseudoplatanus) beeinflusst. In Bestandeslücken unterschiedlicher Ausdehnung rekonstruieren wir Höhen- und Durchmesserwachstum mittels Stammscheibenanalyse von Bäumen der Dickung und des Stangenholzes. Mit den Resultaten wollen wir konkrete Handlungsempfehlungen für den langfristigen Erhalt der Baumartendiversität in einzel- bis truppweise bewirtschafteten Dauerwaldsystemen auf Buchenstandorten herleiten.
Poster Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität
235
Auswirkung der strukturellen Ausprägung von Waldbeständen auf die Biozönose am Beispiel verschieden bewirtschafteter Wälder der Eifel
Klara Krämer1, Vanessa Bursche1, Jae-Gyun Byun1, Alexander Bach1, Timm Knautz1, Lisa Siebenaler1, Joana Stärk1, Richard Ottermanns1, Martina Roß-Nickoll1
1Institut für Umweltforschung (Biologie 5), RWTH Aachen University, Worringer Weg 1, 52074 Aachen, [email protected]
Schlagworte: Waldbewirtschaftung, Lebensgemeinschaft, Struktur, Funktion
Wälder stellen einen wichtigen Lebensraum für eine Vielzahl von Lebewesen dar. Das natürliche Arteninventar ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Waldökosystemen und stellt gleichzeitig einen bedeutenden Anteil der biologischen Vielfalt Deutschlands dar. Daher steht der Erhalt der natürlichen Struktur und Artenvielfalt der heimischen Wälder im Fokus des Naturschutzes. Da in Deutschland nur ein geringer Anteil der Wälder unbewirtschaftet ist, ist es notwendig, angewandte Forstpraktiken mit Naturschutzzielen in Einklang zu bringen. Die ökologischen Auswirkungen verschiedener Waldbewirtschaftungsverfahren sind jedoch bisher vielfach unbekannt. Ziel dieser Arbeit ist es, die ökologischen Konsequenzen verschiedener Waldmanagement-verfahren zu evaluieren, die in der Eifel Anwendung finden. Es werden unbewirtschaftete Buchenaltwälder, bewirtschaftete Buchendauerwälder sowie bewirtschaftete Buchen-, Fichten- und Douglasienaltersklassenwälder im Hinblick auf die strukturelle Bestandsausprägung und die strukturelle und funktionelle Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft verschiedener trophischer Ebenen untersucht. Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae), Spinnen (Araneae), Rüsselkäfer (Coleoptera: Curculionoidea) und höhere Pflanzen dienen dabei als Indikatoren. Der Einfluss des Waldmanagements auf die horizontale und vertikale Bestandsstruktur, auf die Ausbildung der Bodenvegetation sowie die Ausprägung habitatrelevanter Einzelbaumstrukturen und Alterungsmerkmale konnte gezeigt werden. Es fanden sich managementbedingte Unterschiede in der strukturellen und funktionellen Zusammensetzung der verschiedenen Lebensgemeinschaften, die auf einen Einfluss der strukturellen Ausprägung der Bestände zurückgeführt werden konnten.
Poster Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität 236
Stammqualität in Mischwäldern – Diversität ist nicht das Problem
Adam Benneter1, Jürgen Bauhus1
1Professur für Waldbau, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tennenbacher Str. 4, D-79106 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Biodiversität, Stammqualität, FunDivEurope
Neben der potenziellen positiven Wirkung auf die Volumenproduktivität von Waldbeständen zeigen viele Studien, dass Baumartendiversität für Ökosystemfunktionen und Ökosystemdienstleistungen wie Kohlenstoffspeicherung, Bestandesstabilität und Anpassungsfähigkeit bezüglich des Klimawandels bedeutend sein können. Bisher kaum untersucht ist die Wirkung von erhöhter Baumartenvielfalt auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Wäldern. Insbesondere fehlen Erkenntnisse zu den Auswirkungen erhöhter Baumartenvielfalt auf die Stammqualität – und damit das wirtschaftliche Potenzial – von Wäldern in Europa. Die vorgestellte Studie untersucht den Zusammenhang zwischen der Artenvielfalt des Hauptbestandes und der Stammqualität der Bestände in sechs europäischen Regionen mit 18 Baumarten und 5 Diversitätsstufen. Die Ergebnisse anhand der Auswertung von Qualitätsdaten in 208 Versuchsflächen zeigen, dass die Baumartendiversität eine untergeordnete Rolle für die Bestandesqualität spielt und Einzelbaum- und Bestandesvariablen sich deutlich stärker auswirken. Es konnte gezeigt werden, dass steigende Baumartenvielfalt zu keiner signifikanten Abnahme der Bestandes-Stammqualität führte. Stattdessen zeigte sich, dass in Beständen mit mittlerer relativer Kronenlänge, symmetrischer Kronenform und höherem Durchschnittsdurchmesser höhere durchschnittliche Stammqualitäten auftraten. Auch bei der Betrachtung der Auswirkung von Diversität auf einzelne Baumarten konnte keine signifikante Abnahme der Bestandesstammqualität bei höherer Artenvielfalt festgestellt werden. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass qualitätsbeeinflussende Prozesse sich vermutlich stärker auf Ebene der Einzelbaumbeziehungen (der Baumnachbarschaft) auswirken und auf Bestandesebene pauschal kein negativer Zusammenhang zwischen Baumartenvielfalt und Stammqualität vorausgesetzt werden kann.
Poster Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität
237
Zum Zusammenhang zwischen der Art und Intensität der Waldbewirtschaftung und der Struktur von Waldbeständen
Martin Ehbrecht1
1Burckhardt Institut, Abteilung Waldbau & Waldökologie der gemäßigten Zonen, Georg-August-Universität Göttingen, Büsgenweg 1, 37077 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Bestandesstruktur, Bewirtschaftungsintensität, Laserscanning
Eine Erhöhung der strukturellen Diversität von Waldbeständen in Mitteleuropa wird seit vielen Jahren als eine Möglichkeit angesehen, die Naturnähe von mitteleuropäischen Wirtschaftswäldern zu fördern und biologische Vielfalt zu erhalten. Da die Waldstruktur durch waldbauliche Maßnahmen unmittelbar beeinflusst bzw. gesteuert wird, stellt sich die Frage, inwieweit die Art und Intensität der Bewirtschaftung die Waldstruktur und damit möglicherweise auch die biologische Vielfalt bestimmt. Es ist bislang wenig untersucht, welche Auswirkungen verschiedene waldbauliche Systeme (Altersklassenwald, Plenterwald, unbewirtschaftete Wälder) und Mischungsformen (Rein- vs. Mischbestände) auf die strukturelle Diversität von Wäldern auf Bestandes- und Landschaftsebene haben. Mithilfe terrestrischen Laserscannings haben wir auf der Schwäbischen Alb, dem Hainich und dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin jeweils 50 Bestände (n = 150) mit jeweils einer Fläche von 1 ha dreidimensional erfasst. Als aus den Laserscan-Daten abgeleitete Maße der strukturellen Diversität der Bestände verwendeten wir die Blattflächendichte (Leaf Area Density) und ihre vertikale Verteilung (foliage height diversity). Erste Ergebnisse zeigen auf Bestandesebene eine höhere strukturelle Diversität von Buchen-Plenterwäldern und von unbewirtschafteten Wäldern im Vergleich zu Altersklassenwäldern, wobei die Bestandesstruktur maßgeblich durch die Hauptbaumart beeinflusst wird. Im Gegensatz zur bestandesbezogenen Betrachtung weisen Alterskassenwälder auf Landschaftsebene eine höhere Strukturvielfalt auf. Das räumliche Nebeneinander verschiedener Altersklassen erzeugt ein Mosaik von Beständen unterschiedlicher Strukturen, die zu erhöhter Vielfalt von Waldstrukturen auf Landschaftsebene führt. Zudem deutet sich an, dass die strukturelle Diversität mit zunehmender Bewirtschaftungsintensität (Silvicultural Management Intensity nach Schall und Ammer 2013) auf Bestandesebene abnimmt. Gegenstand weiterer Untersuchungen ist der Effekt der Baumartenzahl und -vielfalt auf die strukturelle Diversität. Durch diese Arbeit soll ein Beitrag zur funktionellen Biodiversitätsforschung geleistet werden, um den Zusammenhang zwischen forstlicher Bewirtschaftungsintensität und der Waldstruktur und der damit vermutlich in Verbindung stehenden Habitatfunktion von Wäldern zu verstehen.
Poster Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität 238
Modelling natural forest dynamics in individual tree based forest growth simulators
Tobias Mette1, Wolfgang Falk1, Markus Blaschke1, Bernhard Förster1, Helge Walentowski2
1LWF, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 2HAWK-HHG, Ressourcenmanagement, Büsgenweg 1a, D-37077 Göttingen, [email protected]
Keywords: European beech, sessile oak, natural forest reserve, old growth
Individual tree-based forest growth models (ITBMs) are the most popular type of forest growth model in forestry practice. Spatially explicit competition algorithms and a direct empirical parameterization of the most relevant tree parameters dbh, height and volume make ITBMs precise and robust. Especially in mixed stands where the species arrangement creates individual competition situations for each tree, spatial explicitness is inevitable. Still, the validity and functionality of individual tree-based models is often restricted to the main growth phase. This is because the models are traditionally heirs of yield table experiments where surveys begin when trees exceed 5-7 cm diameter, and end before the harvest. Old growth and regeneration dynamics remain challenging, all the more, as old habitat trees, dead wood and natural regeneration become increasingly important aspects of forestry. The ITB-model <xcomp> provides two simple effective modelling solutions for old growth and regeneration phase. These solutions are presented exemplary for beech and oak dominated natural forest reserves in the warm-dry region of the upper Main river. Today, stands are between 130-150 years old and still very vital. Over the last 30 years beech has outgrown the previously dominant oak and linden trees. As the climate gets warmer, oak could theoretically reconquer dominance. Yet, unless serious beech dieback is assumed or larger disturbance facilitates oak regeneration, beech can maintain its dominance for more than 100 years. Simulations with the xcomp-model visualize how this interplay between the climate sensitivity, longevity and disturbance dynamics determines the potential future species composition of the natural forest reserves.
Poster Session 7: Funktionen von Mischbeständen und struktureller Diversität
239
Konkurrenz um Stickstoff, Phosphor und Kalium zwischen Bäumen und mikrobieller Biomasse im Nationalpark Hainich
Marcus Schmidt1, Edzo Veldkamp1und Marife D. Corre1
1Büsgen-Institut – Ökopedologie der Tropen und Subtropen, Georg-August-Universität Göttingen, Büsgenweg 2, 37077 Göttingen, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Streuzersetzung, Nährstoffumsätze, Nährstoffresorptionseffizienz, Baumartendiversität
Viele deutsche Wälder sind seit Jahrzehnten einer erhöhten Stickstoffdeposition ausgesetzt und es mehren sich die Anzeichen dafür, dass Phosphor (P) und/oder basische Kationen an Stelle von Stickstoff (N) das Waldwachstum limitieren. Bisher gibt es jedoch keine Studie, die sich der Frage widmet, ob eine Konkurrenz zwischen mirkobieller Biomasse und Bäumen um diese Nährstoffe existiert und wie sie sich zwischen Rein- und Mischbeständen unterscheidet. Unsere gegenwärtige Studie beschäftigt sich mit der Frage, ob es im Hainich, dessen Baumartenzusammensetzung typisch für Mitteleuropa ist, Nährstoffkonkurrenz (N, P und K) zwischen Bäumen und der mikrobiellen Biomasse gibt. Ausgewählt wurden dafür Reinbestände von Buche, Eiche, Hainbuche und Linde (jeweils 4-8 Bäume), sowie Mischbestände aus drei dieser Arten. Jede der acht Bestandstypen kam in sechs Wiederholungen vor. Die Nährstoffresorptionseffizienz (NRE) wurde als Differenz der Konzentrationen von N, P und K in sonnenexponierten Blättern im Juli 2013 und in der Blattstreu im Herbst 2012 gemessen – im Verhältnis zu den Konzentrationen in den sonnenexponierten Blättern. Die jährliche Netto-Nährstoffveränderung während der Streuzersetzung (NNV) wurde als Differenz des initialen Nährstoffgehalts im Blattlaub und seines verbleibenden Nährstoffgehalts nach einem Jahr ermittelt. Dazu diente eine in-situ Messung der Streuzersetzung über 1.75 Jahre zwischen November 2011 und Juli 2013. Der Nährstoffeintrag über die Blattstreu sowie die Zersetzung und Nährstoffumsätze der Blattstreu waren abhängig von der Baumart aber nicht von der Artdiversität. Auf Grund der quantitativen Beziehungen zwischen NRE, NNV und pflanzenverfügbaren Nährstoffen konnten wir zwischen Bäumen und der mikrobiellen Biomasse eine starke Konkurrenz um P, eine geringere Konkurrenz um K und nur eine minimale Konkurrenz um N ableiten. Am stärksten war eine solche Konkurrenz in Reinbeständen von Buche und Eiche, wo geringe Nährstoffumsätze stattfanden; und weniger ausgeprägt in Reinbeständen von Hainbuche und Linde, die größere Nährstoffumsätze aufwiesen. Die wahrscheinlich durch hohe N-Depositionswerte im untersuchten Waldökosystem bedingte P- und K-Limitierung der Buche wurde durch eine Beimischung von Hainbuche und Linde abgeschwächt. In der forstlichen Praxis kann dies die Nährstoffversorgung des Bestandes verbessern, die Konkurrenz zwischen Bäumen und mikrobieller Biomasse verringern und möglicherweise die Holzproduktion steigern.
Poster Session 8: Funktionelle Bedeutung von Totholz 240
Förderung von Alt- und Totholz in Eichen-Hainbuchenwäldern als Lebensraum für xylobionte Organismen
Michael Elmer1, Frank Köhler2, Dirk Bieker1 und Britta Linnemann1
1NABU-Naturschutzstation Münsterland, Westfalenstraße 490, 48165 Münster, [email protected] 2Koleopterologisches Forschungsbüro, Strombergstraße 22a, 53332 Bornheim, [email protected]
Schlagworte: Totholz, Eichen-Hainbuchenwälder, xylobionte Käfer, Waldbewirtschaftung
Alt- und Totholz leisten einen essentiellen Beitrag zur Entwicklung struktur- und artenreicher Wälder. Sie wirken sich positiv auf ihre Stabilität und Resilienz aus. Der Erhalt von Alt- und Totholz bis zum natürlichen Zerfall hat eine jahrzehntelange Form der Kohlenstoff-Speicherung im Wald zur Folge und fördert gleichzeitig die biologische Vielfalt der Wälder. Nutzungsfreie Wälder mit größeren Totholzmengen weisen eine signifikant erhöhte Artenvielfalt auf. Davon profitieren vor allem Vertreter von Artengruppen, die an eine Kontinuität der Waldbedeckung, hohe Totholzanteile und große alte Bäume gebunden sind, wie Flechten, Moose, Pilze und xylobionte Insekten.
Ziel des Projektes „Fit für den Klimawandel“ ist es, den großen zusammenhängenden Waldbereich südlich von Münster im sonst waldarmen Münsterland durch Maßnahmen auf den zu erwartenden Klimawandel vorzubereiten. Für die langfristige Beobachtung der Waldentwicklung wurden hier Referenzflächen zur Erforschung der Anpassungsfähigkeit von Waldökosystemen und deren CO2-Bilanz eingerichtet. Die untersuchten Eichen-Hainbuchenwälder befinden sich in der Westfälischen Bucht in den Naturschutz- und FFH-Gebieten Wolbecker Tiergarten und Davert.
Hier wurden in mehreren Waldbeständen die Gemeinschaften xylobionter Käfer erfasst, um ihren Wert als Lebensraum für xylobionte Organismen einschätzen zu können. Die Erfassung der Totholzkäfer erfolgte entlang eines Nutzungsgradienten in Wirtschaftswäldern, Wildnisentwicklungsgebieten und Naturwaldzellen mit Hilfe manueller Aufsammlungen und Fallenfängen. Zusätzlich wurden zahlreiche Habitatparameter aufgenommen, unter anderem der Wasserhaushalt, die Böden, die Gefäßpflanzen und Moose, die Waldstruktur sowie das Totholzangebot.
Das Arteninventar xylobionter Käfer wird bewertet, die Flächen werden untereinander sowie mit weiteren genutzten und ungenutzten Wäldern verglichen, Beziehungen zu den erfassten Habitatparametern werden analysiert. Empfehlungen für die forstliche Bewirtschaftung der Bestände werden abgeleitet, um das Totholzangebot quantitativ und qualitativ zu verbessern und xylobionte Organismen zu fördern. Abschließend wird ein Alt- und Totholz-Konzept für Wirtschaftswälder vorgestellt, das deren Artenvielfalt fördern und sich positiv auf ihre Stabilität und Resilienz auswirken soll.
Poster Session 8: Funktionelle Bedeutung von Totholz
241
Wie viel ist machbar? Totholzanreicherung in österreichischen Naturwaldreservaten
Sebastian Lipp1, Janine Oettel1, Herfried Steiner1, Georg Frank1
1Bundesforschungszentrum für Wald, Landschaft und Naturgefahren, Seckendorff-Gudent-Weg 8, A-1131 Wien, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Totholz, Naturwaldreservate, Waldgesellschaftsgruppe, Biodiversität
Totholz ist ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems Wald. Es ist Lebensgrundlage einer Vielzahl von Artengruppen und steigert die Biodiversität. Auch Naturverjüngung profitiert vom Vorhandensein von Totholz. Doch wie hoch ist die Anreicherung in einem bestimmten Zeitraum? ie viel Totholz ist ausreichend? Als Themenschwerpunkt bietet „Totholz“ auf diversen einschlägigen Veranstaltungen von Forstwissenschaftlern, Waldbesitzern, Politikern und Naturschützern reichlich Diskussionsstoff. In Österreich gibt es 195 Naturwaldreservate mit insgesamt 8403 Hektar Fläche, in denen seit 20 Jahren eine Waldentwicklung ohne forstliche Beeinflussung stattfindet - Waldentwicklung heißt auch Totholzanreicherung. Ab dem Jahr 2014 wurden die ersten Wiederholungsaufnahmen seit der Einrichtung der Reservate durchgeführt. Dabei wird nicht nur die Bestandesentwicklung erfasst, sondern unter anderem auch eine Totholzaufnahme durchgeführt, wobei liegendes und stehendes Totholz, sowie der Zersetzungsgrad und Absterbeursache dokumentiert wird. Die Aufnahmen erfolgen auf Stichprobenpunkten eines permanent eingerichteten Rasternetzes. Mithilfe der Ergebnisse können Aussagen über Totholzmengen, -qualität und –anreicherung getroffen werden. Auf das Bundesgebiet bezogen können Totholzmengen für Waldgesellschaftsgruppen ermittelt werden. Eine Untersuchung der Mortalitätsraten eines bestimmten Zeitraums erlaubt Rückschlüsse auf die Anreicherungsgeschwindigkeit. Die Fokussierung auf Waldgesellschaftsgruppenebene gewährleistet eine fundierte Datengrundlage und eine ausreichende Stichprobenanzahl. Die Ergebnisse aus den Naturwaldreservaten lassen einen Vergleich mit bewirtschafteten Wäldern, aber auch Urwäldern zu. Die wissenschaftliche Untersuchung von Totholz kann als Grundlage für forstpolitische Fragestellungen dienen. Die Ergebnisse sollen einen Beitrag leisten zur Erörterung der Fragestellung „ ieviel Totholz wird benötigt?“, denn nicht nur die Menge zählt, sondern auch Qualität. Insbesondere Schwellen- und Sättigungswerte können als Diskussionsgrundlage für Waldbewirtschafter und Naturschutz dienen.
Poster Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern 242
Was wo schützen? Nischenbasierte Selektion von Zielarten für den Artenschutz im Wald
Nora Magg1, Veronika Braunisch1,2
1 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA), Abteilung Waldnaturschutz, Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg, [email protected], [email protected] 2 Conservation Biology, University of Bern, Baltzerstrasse 6, 3012 Bern, [email protected]
Schlagworte: Waldnaturschutz, Artenschutz, Indikatorartenselektion
Aufgrund limitierter Ressourcen steht Artenschutz vor dem Dilemma, nicht alle Arten einer Region gleichermaßen berücksichtigen zu können. Daher bedarf es einer Auswahl an Arten, die aufgrund ihrer ökologischen Ansprüche stellvertretend für weitere Arten stehen und auf welche Schutzbemühungen sowie Monitoring fokussiert werden können. In der Literatur sind viele Ansätze und Kriterien zur Auswahl solcher Surrogatarten zu finden, wie z.B. Gefährdung, Indikator- oder Schirmfunktion, wobei Letztere häufig nur schwer zu beweisen ist. Hinzu kommt, dass die Auswahl von Arten oft ausschließlich basierend auf Experteneinschätzungen erfolgt und daher von den Interessen und Schwerpunkten der beteiligten Experten beeinflusst ist. Eine repräsentative Abdeckung aller Anspruchstypen, Naturräume und Maßstabsebenen wird dabei nicht zwingend erfüllt. Um eine objektive Auswahl an Zielarten für den Artenschutz in den Wäldern Baden-Württembergs zu treffen, wurde ein systematischer, nischenbasierter Ansatz verwendet. Er erlaubt die Auswahl eines Artensets, das mit möglichst wenig Arten alle vordefinierten Ansprüche (Nischen) abdeckt und dabei möglichst sensitiv auf Veränderungen im Lebensraum reagiert. Der Fokus lag dabei auf dem Anspruch der Arten an Waldstrukturen, da diese direkt forstlich beeinflusst werden können. Anhand einer kriterienbasierten Vorauswahl wurde ein Pool naturschutzrelevanter Arten der Gruppen Säugetiere (N=24), Vögel (N=29), Amphibien & Reptilien (N=18), sowie Tagfalter & Widderchen (N=40) definiert. Innerhalb der jeweiligen Artengruppen wurde für jede Art eine Nischenkategorisierung vorgenommen und mittels eines Selektionsalgorithmus (SpecSel) das Artenset errechnet, das (1) alle waldstrukturellen Nischen abdeckt und (2) möglichst eng an diese Waldstrukturen gebunden ist. Ergebnis der Selektion war die Reduktion der Artenpools auf Artensets von 6 (Amphibien & Reptilien) bis 15 (Tagfalter & Widderchen) Arten, die mittels Indikatorarten die Anspruchstypen der faunistischen Artengemeinschaft im Wald auf unterschiedlichen Maßstabsebenen repräsentieren. Für die praktische Umsetzung des Artenschutzes ist eine weitere Priorisierung der Arten jedoch unerlässlich; während manche Arten flächendeckend über die Förderung leicht realisierbarer Habitat-Requisiten wie beispielsweise stehendes Totholz oder Kleingewässer geschützt werden können, bedarf es bei Reliktpopulationen hochgradig gefährdeter Arten lokal angepasster und detaillierter Maßnahmendefinitionen.
Poster Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern
243
Vertragsnaturschutz im Wald – Analyse der waldökologischen, ökonomischen und rechtlichen Optionen
(WaVerNa-Verbundprojekt)
Dierk Kownatzki1, Moritz von Blomberg3, Laura Demant2, Carina Lutter4, Peter Meyer2, Bernhard Möhring3, Marian Paschke4, Anne M. Selzer1 und Björn Seintsch1
1Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie, Leuschnerstraße 91, 21031 Hamburg, [email protected], [email protected] 2Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Grätzelstraße 2, 37079 Göttingen, [email protected], [email protected] 3Universität Göttingen, Abteilung Forstökonomie und Forsteinrichtung, Büsgenweg 3, 37077 Göttingen, [email protected], [email protected] 4Universität Hamburg, Fakultät für Rechtswissenschaft, Rothenbaumchaussee 33, 20146 Hamburg, [email protected]
Schlagworte: Vertragsnaturschutz, Forstwirtschaft, Wirksamkeits- und Effizienzanalysen
Nach § 3 (3) des BNatSchG ist bei Naturschutzmaßnahmen vorrangig zu prüfen, ob der Zweck mit angemessenem Aufwand auch durch vertragliche Vereinbarungen erreicht werden kann. Während Vertragsnaturschutz in der Landwirtschaft vielfach als Erfolgsmodell angesehen wird, werden Naturschutzmaßnahmen im Wald mit diesem Instrument kaum umgesetzt. Es dominieren ordnungsrechtliche Instrumente und freiwillige, unentgeltliche Selbstverpflichtungen der Waldeigentümer. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und nur lückenhaft dokumentiert. Eine vermehrte Anwendung von Waldvertragsnaturschutz wird jedoch von Politik und Verbänden seit Jahren gefordert. Vor diesem Hintergrund will das WaVerNa-Verbundprojekt die Potenziale und Hemmnisse von Waldvertragsnaturschutz waldökologisch, ökonomisch und rechtlich analysieren. In einem ersten Arbeitspaket soll der Status quo zum Vertragsnaturschutz im Wald auf Basis von Befragungen und Literaturrecherche im Bundesgebiet erhoben werden. Hierauf aufbauend sollen vertiefende Fallbeispielsanalysen durchgeführt werden. Mit diesen Eingangsdaten soll in einem zweiten Arbeitspaket eine synoptische Bewertungsmatrix entwickelt werden, um die Implementierbarkeit einzelner Naturschutzmaßnahmen mit dem Instrument Vertragsnaturschutz aus waldökologischer, ökonomischer und rechtlicher Sicht analysieren zu können. Die ökonomischen Analysen berücksichtigen hierbei die Anbieter- und Nachfragerseite. Unsere Forschungsfragen sind hierbei bspw. die Langfristigkeit der Verträge, die naturschutzfachlich-waldökologische Wirksamkeit von Maßnahmen, die forstbetrieblichen Opportunitäts- und Transaktionskosten von Waldvertragsnaturschutz oder deren Kosteneffizienz aus Sicht der Nachfrager. Aufbauend auf diesen Analysen sollen Handlungsempfehlungen und Praxishilfen für eine vermehrte Anwendung von Vertragsnaturschutz im Wald erarbeitet werden. Als erste Zwischenergebnisse des WaVerNa-Verbundprojektes wird ein vorläufiger Überblick zum bundesweiten Status quo der Anwendung von Vertragsnaturschutz im Wald sowie zu einem naturschutzfachlich-waldökologischen Ziel- und Maßnahmenkatalog geboten.
Poster Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern 244
Artenschutz für Pflanzen und Pilze – Das Waldzielartenkonzept im Staatswald von Baden-Württemberg
Maria-Barbara Winter1, Hans-Gerhard Michiels1
1 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA), Abteilung Waldnaturschutz, Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Waldnaturschutz, Indikatorartenanalyse, Strukturvielfalt
Wissenschaftliche Studien belegen die Gefährdung und den weiteren Rückgang auf Waldlebensräume angewiesener Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in Mitteleuropa. Die Landesforstverwaltung von Baden-Württemberg (ForstBW) hat sich aus diesem Grund für den Staatswald mit ihrer Gesamtkonzeption Waldnaturschutz bis zum Jahr 2020 ambitionierte Ziele im Waldnaturschutz gesetzt. Durch den Erhalt naturnaher Waldgesellschaften, die Förderung natürlich und kulturell bedingt lichter Waldbestände, die Sicherung von Wäldern nasser Standorte und die Ausweisung von Prozessschutzflächen sollen die Naturressourcen des Staatswaldes von Baden-Württemberg geschützt werden. Zusätzlich wurde über das Waldzielartenkonzept ein Instrument geschaffen, um Maßnahmen des Artenschutzes effektiv und transparent in die Waldbewirtschaftung zu integrieren. So genannte Waldzielarten sollen über ihre ökologischen Ansprüche als Indikatorarten für bedeutende Bestandes- und Sonderstrukturen (z.B. Rohboden, Totholz, Gewässer) und Lichtverhältnisse dienen und über verschiedene Formen des Monitorings den Erhalt und die Funktionalität dieser Strukturen auf Bestandes- bzw. Landesebene sicherstellen. Für Gefäßpflanzen, Moose, Flechten und Pilze erfolgt die Auswahl dieser Waldzielarten für die im Land vorkommenden Waldgesellschaften und Wuchsgebiete unter Abdeckung möglichst vieler relevanter Bestandesstrukturen mittels Indikatorartenanalyse. Die statistische Artauswahl wird durch Experten der vier Artengruppen begleitet und durch Nennung hochgradig gefährdeter Arten, bei denen Handlungsbedarf sowie eine große Verantwortung des Landes Baden-Württemberg besteht, gestützt und ergänzt. Die für die Forstpraxis aufbereiteten Informationen beinhalten neben den ökologischen Ansprüchen der Waldzielarten auch deren derzeitig bekannte und potentielle Verbreitung, sowie Vorschläge für Handlungsmaßnahmen, um die Arten und relevante Strukturen zu erhalten und zu fördern. Als Instrument zur Bündelung aller für die Umsetzung des Waldzielartenkonzeptes auf der Fläche relevanten Informationen erfolgt derzeit der Aufbau eines Arteninformationssystems. Mit dem Gesamtkonzept im Sinne eines zielartenorientierten Artenmanagements wird die Grundlage für einen in sich abgestimmten und effektiven Artenschutz im Wald geschaffen.
Poster Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern
245
Förderung seltener Baumarten durch Nutzung überalteter Niederwälder
Patrick Pyttel1, Jörg Kunz1 und Jürgen Bauhus1
1Professur für Waldbau, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tennenbacher Straße 4, 79106 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Niederwald, Sorbus torminalis, Verjüngung, Biodiversität
Niederwälder sind aufgrund ihrer naturschutzfachlichen Wertigkeit Gegenstand verschiedener föderaler Waldnaturschutzkonzepte. Länderübergreifend fordert die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt konkret den Erhalt von Niederwäldern. Durch ein i.d.R. kleinflächiges Nutzungsmosaik in Kombination mit verhältnismäßig kurzen Umtriebszeiten sind Niederwälder Lebensraum für Biozönosen frühsukzessionaler Waldentwicklungsphasen. Zu den in Niederwäldern vorkommenden Baumarten gehört insbesondere die Elsbeere (Sorbus torminalis [L.] Crantz). Sie zählt in Deutschland zu den seltenen Baumarten. Umwandlung und Überführung von insbesondere Eichenniederwäldern gelten u.a. als Hauptgrund für die voranschreitende Verkleinerung ihres inselartigen Vorkommens. Die hier vorgestellte Untersuchung beschreibt die Wirkung von Verjüngungshieben in durchgewachsenen Niederwäldern, sogenannte Stockausschlagwälder, auf die Verjüngung der Elsbeere. Hierfür wurden im Winter 2008/2009 auf einer Gesamtfläche von rund einem Hektar niederwaldähnliche Erntemaßnahmen im Bundesforstamt Baumholder angelegt. Über einen Zeitraum von sieben Jahren wurde die Verjüngung der Elsbeere auf Basis einer jährlichen Vollerhebung nachvollzogen. Neben Entstehen und Vergehen erfasste die Inventur insbesondere Höhen- und Dickenzuwachs der Verjüngung. Die Inventur wurde durch lichtökologische und mykologische Untersuchungen ergänzt, um den Verjüngungsprozess der Baumart zu erklären. Unsere Ergebnisse zeigen, dass in den ersten Jahren nach niederwalartiger Nutzung die vegetative Verjüngung der Elsbeere insbesondere durch Wurzelbrut erheblich aktiviert werden kann. Die höchste Verjüngungsdichte (rund 1100 N/ha) konnte drei Jahre nach der Holzernte beobachtet werden. Das Höhenwachstum der Elsbeerwurzelsprossen ist sehr variabel. Es wird z.T. durch Konkurrenz und Pathogene negativ beeinflusst, kann aber mutmaßlich wegen der Verbindung zum Mutterbaum nur bedingt durch Strahlungsgenuss erklärt werden. Diese Untersuchung belegt einen starken positiven Zusammenhang zwischen der niederwaldartigen Nutzung von eichendominierten Stockausschlagwäldern und der Etablierung der Elsbeere. Mittels planvoller Wiederaufnahme der Niederwaldwirtschaft kann die Elsbeere zur waldbaulichen Option werden und sich vom Image der dendrologischen Kuriosität befreien.
Poster Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern 246
Mikrohabitatstrukturen in unterschiedlich stark durchforsteten Eichen-Stockausschlagwäldern in Luxemburg
Christian Suchomel1 und Alex Carneiro2
1Universität Freiburg, Professur für Landespflege, Tennenbacher Str. 4, 79104 Freiburg, [email protected] 2Lycée Technique Agricole, 72 av. Lucien Salentiny, L-9080 Ettelbruck, [email protected]
Schlagworte: Mikrohabitate, Stockausschlagwald, Niederwald
Niederwald als historische Nutzungsform spielt in Mitteleuropa vielfach nur noch eine untergeordnete Rolle. Dennoch sind noch zahlreiche Flächen bestockt mit Niederwäldern, die die typische Umtriebszeit weit überschritten haben, vorhanden. Das Interesse des Naturschutzes und der Forstwirtschaft an einem geeigneten Umgang mit diesen Flächen ist groß. Naturschutzfachliche Potenziale sind vielerorts vorhanden. In Luxemburg befinden sich heute noch rund 10.250 ha Niederwälder. Größtenteils werden auch diese nicht mehr als Niederwald bewirtschaftet. Die noch vorhanden Relikte einer historischen Nutzung sind in Luxemburg seit dem letzten Umtrieb entweder gar nicht bewirtschaftet oder zum Zweck der Überführung durchforstet worden. Ziel der vorliegenden Studie war es, das Vorkommen von Mikrohabitatstrukturen quantitativ zu erfassen und zu untersuchen, ob es Unterschiede hinsichtlich der Durchforstungsstärke gibt. Dazu wurden in fünf Eichen-Stockausschlagbeständen (Alter ca. 80 Jahre) mittels Stichproben für die Varianten (i) undurchforster Stockausschlagwald, (ii) leicht durchforstet und (iii) stark durchforstet an insgesamt 1175 Bäumen Mikrohabitatstrukturen erfasst. Die Mikrohabitatstrukturen waren zum einen Struktruren am Holz, die potenziell Lebensraum bieten können, wie z.B. Spechthölen, Risse, Rindentaschen, Hohlräume, uvm. Darüber hinaus wurden Moos-, Flechten-, Efeubedeckungen und das Vorkommen von Vogel- und Insektennestern und Pilze erfasst und jeweils einem Baum zugeordnet. Zusätzlich wurden Einzelbaumparameter, wie Baumart, BHD, Vitalität erfasst sowie notiert, ob es sich um einen Solitärbaum handelt oder der Stamm aktuell im Stockausschlag steht. Anschließend erfolgte eine Auswertung nach Mikrohabitattypen und Anzahl. Insgesamt wurden 1617 Strukturen am Holz aufgenommen. Ob die Bäume Solitäre sind oder im Stock mit anderen Bäumen stehen, wirkte sich nicht auf die Anzahl der Mikrohabitate am Stamm und in der Krone aus. Einige Mikrohabitatstrukturen kamen nicht an einzelnen „Austrieben/Stämmen“ vor, sondern mussten dem Fuß von Stöcken zugeordnet werden. Diese Stockstrukturen als potenzielle Habitate bilden eine Besonderheit von Niederwäldern. Hier handelte es sich vor allem um Hohlräume, die u.a. Kleinsäugern Lebensraum bieten können. Mikrohabitatstrukturen am Holz (Höhlen, Risse, Taschen, Abbrüche) kommen in undurchforsteten Stockausschlagwäldern häufiger vor als an schwach durchforsteten und diese wiederum häufiger als an stark durchforsteten.
Poster Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern
247
Arten- und Strukturvielfalt in Douglasienwäldern – Untersuchungen in zwei Douglasien-Naturwaldreservaten und ihren bewirtschafteten
Vergleichsflächen in Rheinland-Pfalz
Patricia Balcar1, Torsten Vor2, Frank Köhler3, Peter Keth4 und Steffen Caspari5
1Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz, Hauptstraße 16, 67705 Trippstadt, [email protected] 2Institut für Waldbau, Georg-August-Universität Göttingen, Büsgenweg 1, 37077 Göttingen, [email protected] 3Koleopterologische Forschungsbüro, Strombergstr. 22a, 53332 Bornheim, [email protected] 4Pilzsachverständiger und Fachberater für Mykologie, Berliner Str. 24, 67551 Worms, [email protected] 5Moossachverständiger, Dillinger Str. 35, 66606 St. Wendel, [email protected]
Schlagworte: Waldstrukturen, Vegetation, Käfer, Pilze
Zur Einschätzung der ökologischen Integration der Douglasie in heimische Waldökosysteme und ihrer Invasivität wurden in zwei rheinland-pfälzischen Schwerpunktvorkommen der Douglasie, im Pfälzerwald (PW) und in der Eifel (EI), je ein Naturwaldreservat (NWR) mit einer bewirtschafteten Vergleichsfläche (VFL) eingerichtet. Die Flächen wurden bezüglich Waldstrukturen, Vegetation, Käfer-, Pilz- und Moosvorkommen untersucht. Die (vormals) unterschiedliche regionale waldbauliche Behandlung bedingte, dass der Derbholzbestand im NWR Grünberg (PW) stärker geschichtet ist, einen höheren Bestockungsgrad aufweist, aber aus nur 4 Baumarten, in allen Schichten, besteht. Demgegenüber steht im NWR Eselskopf (EI) v.a. nur eine Hauptschicht aus Douglasien. Die Unterschicht ist zwar von Douglasien dominiert, besteht aber aus 14 Holzarten. In allen Flächen (NWR und VFL) verjüngt sich die Douglasie mit deutlich geringeren Anteilen gegenüber dem Hauptbestand unabhängig von Zäunung. Vegetationsaufnahmen ergaben, dass beide NWR mit 64 (PW) und 91 Waldarten (EI) reich an Bodenvegetation sind. In den Douglasienbeständen steigt die Artendiversität mit zunehmendem Bestandesalter stark an und sinkt mit zunehmendem Buchenanteil. Bei Moosen fällt das massierte Auftreten von atlantisch verbreiteten Epiphyten in der EI auf, die im PW weitgehend fehlen. Im PW wurden 109 Moosarten im NWR und 107 in der VFL gefunden. Die Funde in der EI liegen um ca. 10 % niedriger. Die Artenvielfalt der Käferfauna an Douglasien-Standorten basiert vor allem auf der Beimischung mit anderen Baumarten und beschränkt sich überwiegend auf ubiquitäre Arten. Die Flächen (NWR und VFL) im PW sind aus Klimagründen mit 770 Arten artenreicher als in der EI mit 690, was sich auch bei Xylobionten und Rote Liste-Arten widerspiegelt. Ähnliche Befunde wurden auch bei Pilzen erzielt: In den NWR wurden 273 Arten (PW) gegenüber 118 (EI), in den VFL 292 (PW) gegenüber 101 (EI) identifiziert. Die meisten waren holz-, streu- und bodenbesiedelnde Pilze, wobei im PW von Kiefern auf Douglasien überspringende Arten beobachtet wurden. Die Vorkommen von Mykorrhizzapilzen gehen im Wesentlichen auf Mischbaumarten zurück. Die ökologische Integration bzw. Invasivität der Douglasie wird z.T. unterschiedlich beurteilt. Auf den Sandorten mit bodensauren Buchenwäldern kommt es nach derzeitigen Ergebnissen nicht zu einer Verdrängung oder zum Verschwinden von Arten der natürlichen Vegetation, teilweise sogar zu einer Erweiterung des Artenspektrums.
Poster Session 9: Effektivität von Naturschutzmaßnahmen in bewirtsch. Wäldern 248
Opportunitätskostenanalyse zur Implementierung des naturschutzorientierten Waldbehandlungskonzepts
„Neue Multifunktionalität“
Lydia Rosenkranz1 und Björn Seintsch1
1 Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie, Leuschnerstraße 91, 21031 Hamburg, [email protected], [email protected]
Schlagworte: naturschutzfachliche Standards, Opportunitätskostenanalyse, Deckungsbeitrag, Forstwirtschaft
In den letzten Jahren sind die teilweise konkurrierenden Ansprüche an die Wald- und Holznutzung in Deutschland gestiegen. Zur Anhebung des Waldnaturschutzniveaus wurde von Höltermann (2013) eine Segregation von Waldfunktionen gefordert. Im Rahmen dieser „neuen Multifunktionalität“ (Höltermann, 2013) soll die aldbewirtschaftung auf drei verschiedenen Waldflächenkategorien stattfinden: (1) Wirtschaftswald mit naturschutzfachlichen Mindeststandards, (2) Wald mit Naturschutzvorrangfunktion und (3) Wald ohne forstliche Bewirtschaftung. Mit zahlreichen naturschutzfachlichen Maßnahmen im Wald sind Mindererträge und Mehraufwendungen in der Rohholzerzeugung für Waldbesitzer zu erwarten. In der vorliegenden Studie werden die Opportunitätskosten der forstlichen Nutzung ( ohholzerzeugung) bei einer Umsetzung der „Neuen Multifunktionalität“ für den deutschen Wald mit einem forstlichen Simulationsmodell über 200 Jahre berechnet und mit einer Waldbehandlungsvariante zur Fortführung der derzeitigen Waldbewirtschaftung verglichen. Die Operationalisierung der Waldbewirtschaftungsvarianten erfolgte auf Basis einer Literaturrecherche und eigenen Annahmen. Bei einer Umsetzung der „Neuen Multifunktionalität“ ergeben sich aus den Modellierungsergebnissen Einschlagseinbußen von rund 11,2 Mio. Erntefestmeter/Jahr und Verzichtskosten in der forstlichen Nutzung von rund 1,0 Mrd. €/Jahr. Die Umsetzung der „Neuen Multifunktionalität“ wäre nur dann eine rationale Entscheidung, wenn der zusätzliche Nutzen an Naturschutzleistungen bei einer Implementierung der Neuen Multifunktionalität zumindest in Höhe der Opportunitätskosten der eingeschränkten forstlichen Nutzung (Rohholzproduktion), wenn nicht sogar in Höhe der verminderten Wertschöpfung der nachgelagerten Holzindustrie liegen würde. Rosenkranz L, Seintsch B (2016) Opportunitätskostenanalyse zur Implementierung des naturschutzorientierten Waldbehandlungskonzepts „Neue Multifunktionalität“. Landbau-forsch Appl Agric Forestry Res (im Druck)
Poster Session 10: Nährstoffkreisläufe in naturnahen und Wirtschaftswäldern
249
Welchen Beitrag können neue Verfahren zur Nährstoffschonung bei der Holzernte leisten?
Elke Dietz1, Fabian Schulmeyer1, Marianne Schütt, Karl Hüttl1, Brigit Reger1,
Herbert Borchert1
1Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft; Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising; [email protected]
Schlagworte: Nährstoffschonung, Ernteverfahren
Einleitung. Die Produktion von Waldhackschnitzeln hat sich gerade im Rahmen der Energiewende als fester Bestandteil der Forstwirtschaft etabliert. Um eine umfassende Nachhaltigkeit bei steigender Nachfrage zu sichern, müssen die damit verbundenen Nährstoffentzüge berücksichtigt werden. Die Intensität der Nutzung kann u. a. durch die Wahl von geeigneten Ernteverfahren an das Potential des Standorts angepasst werden. Bei der Bereitstellung von Hackholz aus Baumkronen können alternativ zur Bringung der ganzen Kronen diese im Bestand grob entastet werden. Das Verfahren kann insbesondere in nadelholzdominierten Durchforstungs- bis Endnutzungsbeständen motormanuell oder vollmechanisiert angewendet werden. Methoden. Bisher wurden an drei fichtendominierten Standorten Arbeitsstudien zum Ernteverfahren durchgeführt und an je 5 – 6 Bäumen Biomasse, Nährstoffgehalte (Basen, Haupt- und Spurenelemente) bestimmt sowie deren Verteilung im Baum, insbesondere der Krone u.a. in Abhängigkeit von der sozialen Stellung, Exposition der Äste sowie deren Höhe in der Krone untersucht. Nach Mellert & Göttlein (2013) führen P und K bei Unterversorgung zu Wachstumseinbußen. Gerade bei diesen Nährstoffen ist eine sehr differenzierte Verteilung innerhalb der Krone zu erwarten. P beispielsweise kommt bevorzugt in jüngeren Kronenbereichen vor. Ziel des Projekts ist es unter anderem, die Verteilung der Nährstoffe in den unterschiedlichen Kronenbereichen im Baum abzubilden und ggf. Gesetzmäßigkeiten ableiten um die Nährstoffentzüge bei der Holzernte je nach Ernteverfahren und Zopfdurchmesser genauer zu quantifizieren. Auf diese Weise kann eine standortsbezogen Beratung gezielt unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten erfolgen. Ergebnisse. Die bisher durchgeführten Fallstudien und erste Berechnungen zeigten, dass der Biomasseexport durch die Methode des groben Entastens je nach sozialer Stellung des Baumes und Aufarbeitungsgrenze (Ø 14 bzw.18 cm) um etwa 5 % - 25%, der Export an Kalium und Phosphor um etwa 5 – 50 % reduziert werden konnte. Je stärker der Zopfdurchmesser der stofflichen Sortimente ausfällt und je niedriger die soziale Stellung des Baumes ist, desto positiver wirkt sich das grobe Entasten auf Biomasse- und Nährstoffschonung aus.
Poster Session 10: Nährstoffkreisläufe in naturnahen und Wirtschaftswäldern 250
Kann die Variabilität von Phosphorgehalten in Jahrringen des Kernholzes von Bäumen als Indikator für die P-Verfügbarkeit in
Waldökosystemen dienen?
Jörg Niederberger1, Adrian Wichser2, Peggy Bierbass1, Martin Kohler1, Davide Bleiner2 und Jürgen Bauhus1
1Professur für Waldbau, Institut für Forstwissenschaften, Universität Freiburg, Tennenbacher Str. 4, 79106 Freiburg, E-Mail: [email protected] 2Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA), Überlandstraße 129, 8600 Dübendorf, Schweiz
Schlagworte: Dendrochemie, P-Versorgung, Jahrringe
Eine Vielzahl von Waldökosystemen zeigte in den vergangenen Jahrzehnten eine angespannte bis kritische P-Versorgung. Mögliche Ursachen hierfür könnten die Versauerung der Oberböden auf Grund von Säureeinträgen oder auch eine Verschiebung der Nährelementverhältnisse durch erhöhte N-Einträge und damit erhöhte Biomassezuwächse sein. Dendrochemische Analysen könnten hierbei eventuell eine retrospektive Analyse der P- Versorgung von Bäumen ermöglichen und dabei wertvolle Informationen über kurzfristige und langfristige Trends in der P-Verfügbarkeit liefern. Dieser Ansatz setzt aber voraus, dass es ein klares P-Signal in den Jahrringen gibt, das nicht durch Translokationsprozesse (z. B. Rückverlagerung von älteren zu jüngeren Jahrringen) zwischen den einzelnen Jahrringen verwaschen wird. Um dies zu prüfen, haben wir Kernholz-Jahrringe von 5-6 dominanten Fichten (Picea abies) und Kiefern (Pinus sylvestris) zweier Düngeversuche aus den 60er Jahren untersucht. Dabei wurden Jahrringproben von Bäumen der Dünge- und den Kontrollflächen verwendet, die fünf Jahre vor und 15 Jahre nach der Düngung gebildet wurden. Die einzelnen Jahrringe wurden von Hand abgetrennt, gemahlen und mit Hilfe eines HNO3 Druckaufschlusses aufgeschlossen. Für die so gewonnenen Proben wurden mit einem ICP-MS die Elementgehalte bestimmt. Die Düngung mit 70 kg ha-1 P führte zu einer prompten und anhaltenden Zunahme der P- Gehalte im Kernholz bei den gedüngten Bäumen beider Versuchsflächen. Auf beiden Versuchsflächen führte die Düngung zu einer Verdopplung der P-Gehalte im Kernholz im Vergleich mit der Vordüngeperiode und auch im Vergleich zu den Kontrollflächen. Die Reaktion der einzelnen Bäume war dabei in Abhängigkeit der initialen P-Gehalte im Kernholz sehr unterschiedlich. Bäume mit sehr niedrigen P-Gehalten zeigten eine viel stärkere Reaktion auf die Düngung (Zunahme um bis zu Faktor 10) als Bäume mit vergleichsweise hohen initialen P-Gehalten (Zunahme Faktor 0.25-0.5). Eine Verlagerung von P in Jahrringe, die vor dem Düngezeitpunkt gebildet wurden, konnte nicht beobachtet werden. Unsere Ergebnisse lassen daher darauf schließen, dass die P-Gehalte in Kernholzjahrringen von Fichten und Kiefern als Indikator für eine Änderung der P-Verfügbarkeit in Waldökosystemen geeignet sind.
Poster Session 10: Nährstoffkreisläufe in naturnahen und Wirtschaftswäldern
251
Tiefendurchwurzelung von Waldbäumen auf quartären Standorten im Norddeutschen Tiefland
Victor Steinmann1, Robin Köbel1 und Martin Jansen1
1Abt. Ökopedologie, Universität Göttingen, Büsgenweg 2, 37077 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Tiefendurchwurzelung, Wasserversorgung, Nährstoffressourcen, C-Speicherung
Zur Unterstützung der forstliche Standortskartierung bei der Einschätzung von Waldstandorten in Bezug auf eine standortsgerechte Baumartenwahl, wird mit dieser Arbeit das Ziel verfolgt, die Tiefendurchwurzelung auf quartären Lockersedimenten zu quantifizieren. Mit einer Abwandlung der Profilwandmethode ist die Wurzelverteilung von sieben Baumarten in 60 Profilen bis zu einer Tiefe von 3,9 m erfasst worden. Zusätzlich ist für 10 Profile die Wurzelbiomasse und der organische Kohlenstoff des Mineralbodens bestimmt worden. Für die Baumarten Buche, Fichte, Lärche und Douglasie wird der Einfluss des Standortes (i.e.S. Bodenart, geologische Schichtenfolge, Carbonat, Standortskennziffer für die Bodenart und die Nährstoff- und Wasserversorgung) sowie der Baumdimensionen (i.e.S. Höhe und Durchmesser) auf die vorgefundene Wurzelverteilung getestet. Die erfassten Durchwurzelungstiefen variieren zwischen 60 cm und 3,9 m. In über 30 % der Profile können Durchwurzelungstiefen von mehr als 3 m beobachtet werden. Die Durchwurzelungstiefe der Fichte (173 cm ± 80 cm) ist signifikant geringer als die der Buche (281 ± 74 cm) und Douglasie (275 ± 68 cm), jedoch nicht gegenüber der Lärche (209 ± 55 cm). Unabhängig von der Baumart befinden sich etwa 70 % der Feinwurzeln und fast 90 % der Wurzelbiomasse innerhalb des ersten Meters. Die Ergebnisse geben einen deutlichen Hinweis darauf, dass die Durchwurzelung im Wesentlichen durch die Nährstoffverfügbarkeit beeinflusst wird. So weisen Standorten mit carbonathaltigen geologischen Schichten im Untergrund eine signifikant größere Durchwurzelungstiefe und -intensität auf. Entgegen verschiedener anderer Studien erscheint der Einfluss bodenmorphologischer Eigenschaften auf die Durchwurzelung deutlich geringer im Vergleich zur Nährstoffverfügbarkeit zu sein. Hinsichtlich des organischen Kohlenstoffs befinden sich etwa 30 % in der Tiefe von 1 bis 3,6 m. Die durchschnittliche Menge des im Boden enthaltenen Kohlenstoffs bei einer Tiefe von 3,6 m beträgt 117 t pro ha. Insgesamt macht die Wurzelbiomasse in tieferen Bodenschichten nur einen geringen Anteil aus. Da der über die Wurzel eingetragene Kohlenstoff mit zunehmender Tiefe deutlich länger im Boden gespeichert wird, kann die Tiefendurchwurzelung quartärer Lockersedimente trotzdem von großer Bedeutung für die Speicherung von Kohlenstoff sein.
Poster Session 10: Nährstoffkreisläufe in naturnahen und Wirtschaftswäldern 252
Mykorrhizahyphen in ihrer natürlichen Umgebung: Neue Einblicke in den unterirdischen Wald
Helmer Schack-Kirchner¹, Veronika Sturm¹, Jörg Grüner², Siegfried Fink², Friederike Lang¹
1Albert-Ludwigs Universität, Professur für Bodenökologie, [email protected] 2Albert-Ludwigs Universität, Professur für Forstbotanik, [email protected]
Schlagworte: Mikromorphologie, externe Hyphen, Hartig'sches Netz, Auflichtmikroskopie
Die Mykorrhiza der Waldbäume spielt eine wichtige Rolle bei der Nährstoffaufnahme, z.B bei der Erschließung der Phosphorvorräte. Gerade im Fall von Phosphor können wegen der starken Adsorption an der mineralischen Bodensubstanz nur äußert kurze Transportdistanzen überwunden werden. Eine wichtige Strategie der Pflanzen ist „foraging“, d.h. die urzeln wachsen den Phosporvorräten hinterher. Bei der Ektomykorrhiza unterscheidet man das direkt mit der Wurzelrinde verbundene Hartig'sche Netz und die in den umgebenden Boden einwachsenden externen Hyphen. Letztere könnten wegen ihrer Feinheit und möglicherweise auch wegen des schnellen Wachstums besonders geeignet sein, das Boden-P für die Wurzeln verfügbar zu machen. Bisher sind jedoch insgesamt die Kenntnisse über die Ausdehnung, die Masse und die begrenzenden Faktoren des externen Myzels sehr lückenhaft. In diesem Zusammenhang stellen wir eine verbesserte boden-mikromorphologische Methode einschließlich einer neuen Färbetechnik und erste damit gewonnene Ergebnisse vor. Zur Präparation werden gezielt von Feinstwurzeln durchwachsene Bodenaggregate (ca. 5-10mm Durchmesser) ausgewählt und in aufsteigender Acetonreihe getrocknet und mit einem Epoxidharz mit besonders niedriger Viskosität getränkt. Nach Aufsägen, Schleifen und Polieren werde die Proben im Auflichtmikroskop untersucht. Spektakuläre Aufnahmen von Hyphen mit 1-2µm Durchmesser, die aus dem Hartig'schen Netz in den umgebenden Boden einwachsen zeigen das Potential der neuen Methode.
Poster Session 10: Nährstoffkreisläufe in naturnahen und Wirtschaftswäldern
253
Notwendige Stellungnahme der Deutschen Forstwissenschaften zur (inter-)nationalen forstwirtschaftlich (in-)direkt nährstoffrelevanten Gesetzgebung und deren nachhaltige Harmonisierung betreffend die
Nährstoffhaushalte von Corg, N, (P) und S - auch unter den Auswirkungen des Klimawandels
Klaus Isermann1 und Renate Isermann2,
1, 2 Büro für Nachhaltige Ernährung, Landnutzung und Kultur (BNELK ), Heinrich-von-Kleist-Strasse 4, D 67374 Hanhofen, [email protected]
Schlagworte: Forstwissenschaften, nährstoffrelevante Gesetzgebung ( Corg, N, (P) und S)
Trotz Reduktion der atmosphärischen Emissionen an reaktivem N in Deutschland im Zeitraum 1990 bis 2013 um -39 (NOx-N: -56; NH3-N: -15) % vorwiegend durch die Verursacherbereiche Energie (einschl. Verkehr) bzw. Landwirtschaft (UBA 2015) haben sich die N-Depositionen vergleichsweise nur unwesentlich verringert, auch in Waldökosystemen gemessen an den kritischen N-Eintragsraten aktuell immer noch auf 2-3fach zu hohem Niveau mit entsprechender N-Eutrophierung und –Versauerung der Böden und Gewässer. Zusätzliche Destabilisierung der Waldböden bewirkt der Klimawandel durch verminderte C-, N-, (P-), S-Immobilisierung („Sequestrierung“) bzw. zunehmende –Mobilisierung und somit eine Umkehrung ihrer Senken- zur Quellenfunktion (u.a. Waldzustandsberichte der Länder 2014/15). Aktuell (2015) beschleunigt wird diese bedauerliche Entwicklung durch Tolerierung 4fach zu hoher Emissionen der Tierproduktion der Landwirtschaft von maximal 90 kg NH3-N/ha LF.a durch die (Entwürfe) von Düngegesetz und Düngeverordnung. Ebenso durch Erkenntniszugewinn hinsichtlich der NH3-Emissionen der Landwirtschaft (+100 kt NH3-N/a) und der NOx- (und CO2-)Emissionen des Kfz-Verkehrs (Realwerte >manipulierte Standardwerte). Vorsätzliche „Sicherheitszuschläge“ dieser beiden VO von 10 kg P2O5 / ha LF . a zusätzlich zur P-Düngung nach P-Entzug sichern den Bestand von weiteren 5,5 Mio. GV vor dem Hintergrund der bereits vorhandenen 13 Mio.GV. Verschärfte Anforderungen hinsichtlich des Gewässerschutzes mit der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und entsprechender Zielsetzungen der Oberflächengewässerverordnung (OGewV 2015/16) hinsichtlich maximal tolerierbarer N-Einträge mit den Flüssen und ihren Grundwasserkörpern in die Nord- und Ostsee von 2,8 bzw. 2,6 TN/l (vgl. LAWA II) ersetzen somit den Zielwert von 50 mg NO3 = 11,3 mg NO-N/ l der Trinkwasser-VO, EU-Nitrat-, Wasser-, Grundwasser-Rahmenrichtlinien. Somit sind auch die wasserbezogenen Dienstleistungen der Wälder noch mehr als bisher gefährdet. Kontraproduktiv wirken auch die Initiativen des UBA (2014/15) einerseits durch Erhöhung der kritischen N-Eintragsraten für Waldökosysteme unter Ausnutzung ihrer N-Belastbarkeit von ca. 10 auf 20 (BImSchG: 50) kg N/ha FN. a und andererseits um durch -28 % geringer berechnete N-Deposition mit dem Modell PINETI. Dies nehmen u.a. die EU-Umweltminister (16.12.2015) zum Anlaß, um z.B. für Deutschland, bezogen auf 2005, für 2030 nur noch eine Minderung der NH3-Emissionen von -29 anstelle von -67% bis 2020 zu fordern. Die nun durch Zugrundelegung o.a. Sachverhalte dringend notwendige Stellungnahme der Forstwissenschaften zu diesen nährstoffrelevanten Gesetzesinitiativen betreffen z.B. innerhalb der DVFFA insbesondere die Sektionen „Waldernährung“ und „Wald und Wasser“, aber auch „Waldbau, Standorts- und Ertragskunde, Forstnutzung sowie Forstökonomie“
Poster Session 11: Wasserbezogene Dienstleistungen des Waldes 254
Der Einfluss von Baumart, -alter und Bestandesbehandlung auf die wasserwirtschaftliche Leistung des Waldes
Jürgen Müller1
1Thünen-Institut für Waldökosysteme, A.-Möller-Straße 1, 16225 Eberswalde, [email protected]
Schlagworte: Waldstrukturen, Baumartenwahl, Interzeptionsverdunstung, Lysimeter
Vor dem Hintergrund eines geringer werdenden Wasserdargebotes einerseits und der guten Qualität des Sickerwassers unter Wald andererseits stellt sich zunehmend die Frage nach der wasserwirtschaftlichen Leistung des Waldes im Landschaftswasserhaushalt. Die Bedeutung gerade der Waldareale als Wasserlieferanten hat deshalb wesentlich zugenommen. Die Produktion von Wasser in Qualität und Menge ist nach der Holzproduktion die wichtigste materielle Leistung des Waldes, dessen monetäre Bewertung derzeit in der gesellschaftlichen und politischen Diskussion steht. In den Waldökosystemen führen die strukturellen Bedingungen des Kronendaches zur unterschiedlichen Verteilung des Bestandesniederschlages und zu sich stark differenzierenden Interzeptionsverlusten. Die Interzeptionsunterschiede bestimmen bei gegebenen Niederschlags- und Bodenbedingungen maßgeblich die Höhe und den zeitlichen Verlauf der Grundwasserneubildung und führen zu unterschiedlichen hydrologischen Vorteilswirkungen. Die Forstwirtschaft hat über Baumartenwahl und Bestandesbehandlung die Möglichkeit, den Landschaftswasserhaushalt gezielt zu beeinflussen. Unsere Ergebnisse belegen, dass unter vergleichbaren Witterungs- und Bodenbedingungen die baumartenspezifischen Unterschiede und vegetationsstrukturellen Differenzierungen sowohl in den aufwachsenden als auch in den gleichaltrigen Beständen einen signifikanten Einfluss auf die Wasserhaushaltskennwerte haben. Verdunstung und Grundwasserneubildung sind Funktionen bestandesbezogener Strukturparameter und des Wachstums der Bestände. Die intensive Erfassung von Struktur- und Prozessparametern in den Ökosystemen und die Quantifizierung ihrer Wechselwirkungen ist eine wichtige Voraussetzung für die Bewertung der wasserwirtschaftlichen Leistung der Wälder. Baumart und Alter, die vertikale Schichtung und Mischung der Wälder sowie ihre Bewirtschaftung beeinflussen maßgeblich die Komponenten des Wasserkreislaufes. Erst durch die Berücksichtigung der strukturellen Besonderheiten der Wälder wird eine treffende Beurteilung ihrer Wasserhaushaltsbedingungen möglich.
Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft
255
Holzernte und –bringung in den Wäldern von Morgen: Ein Überblick über naturschonende Verfahren in Süddeutschland
Janine Schweier1, Férreol Berendt1, Dirk Jaeger1
1 Universität Freiburg, Professur für Forstliche Verfahrenstechnik, Werthmannstraße 6 D-79085 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Klimawandel, emissionsarme Bewirtschaftung
Wissenschaft und Praxis sind einhellig der Überzeugung, dass die Wälder und ihre Bewirtschaftung schnellstmöglich an die zu erwartenden Klimaänderungen angepasst werden müssen. Dies kann u.a. durch Steuerung von Baumartenwahl und –mischungen, Schaffung von Waldstruktur, Anpassung der Eingriffsintensität, Eingriffshäufigkeit oder Verkürzung der Gesamtproduktionszeiträume erfolgen. Die damit einhergehenden waldbaulichen Anpassungen führen unweigerlich auch zu neuen technischen Herausforderungen bei der Holzernte und –bringung; so kommen etwa die vollmechanisierte Laubholzernte oder die Seilkranbringung in der Ebene immer häufiger zum Einsatz. Gleichzeitig soll die zukünftige Waldbewirtschaftung möglichst emissionsarm erfolgen, so dass beispielsweise eine weitere Reduzierung der Bodenbefahrung notwendig wird. Es wurden alternative Bereitstellungsverfahren der Wald-Holz-Kette identifiziert, die auf zukünftige Umwelt- und Bestandesbedingungen ausgerichtet und als naturschonend und/ oder emissionsarm einzustufen sind. Dazu wurden die potentielle Zusammensetzung und die Struktur zukünftiger Waldgesellschaften in Baden-Württemberg untersucht. Dies erfolgte auf der Grundlage der wichtigsten prognostizierten Waldentwicklungstypen und unter Einbeziehung zusätzlicher, für die Waldbewirtschaftung wichtiger Parameter wie Bodenbefahrbarkeit oder Hangneigung. Die umweltbezogenen Bewertungen hinsichtlich CO2-Bilanzen wurden mittels der Methode der Ökobilanz durchgeführt. In dem Vortrag werden ausgewählte Ergebnisse für verschiedene Bereitstellungsverfahren vorgestellt.
Poster Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft 256
Verbesserte Information und Abwicklung von Forstlichen Dienstleistungen (ForstInvoice)
Hans-Ulrich Dietz1, Ute Seeling
1Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. Spremberger Straße 1, 64823 Groß-Umstadt, E-Mail: [email protected]
Schlagworte: Standard, Holzerntekette, Forstliche Dienstleistungen, Abrechnung
Mit dem Projekt Forstinvoice, das kurz vor dem Abschluss steht, wurde das Ziel verfolgt, die Geschäftsprozesse zwischen Forstverwaltungen und den mit der Holzernte beauftragten Forstunternehmern zu vereinfachen mittels einer standardisierten IT-Lösung zur Erfassung des Auftrags durch den Unternehmer sowie die zeitnahe Rechnungsstellung und – dokumentation. Diese IT-Lösung soll anstelle der bisherigen gedruckten Version einen digitalen Datenaustausch ermöglichen. ForstInVoice setzt hierbei neben der Entwicklung der IT-Werkzeuge auf die Nutzbarkeit der potentiellen Anwender. Die hierzu erstellten Softwareanwendungen wurden unter Berücksichtigung der Praxisvorgaben geschaffen und evaluiert. Es handelt sich um Softwarelösungen, die unabhängig vom Maschinentyp genutzt werden können. Ein besonderer Schwerpunkt des Projektes ist die gemeinsame Sprache für Leistungsbeschreibungen von Forstlichen Dienstleistungen und wiedererkennbare Arbeitsaufträge.
Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft
257
Sicherung der Nährstoffnachhaltigkeit von Waldbeständen durch Belassen der Rinde bei Holzerntemaßnahmen
Bernd Heinrich1, Ute Seeling1, Jochen Grünberger1
1Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. Spremberger Straße 1, 64823 Groß-Umstadt, E-Mail:[email protected]
Schlagworte: Standortsnachhaltigkeit, Rinde
Bei nachhaltiger Bewirtschaftung der Wälder wird dem Erhalt der Leistungsfähigkeit von Waldstandorten immer größere Bedeutung beigemessen. Ein Großteil der Nährstoffe, die bei den Holzerntemaßnahmen den Wäldern entzogen werden, sind in der Rinde konzentriert. Deshalb wurde im Projekt „Debarking Heads“ geprüft, ob es bei vollmechanisierter Holzernte möglich ist, die Stämme im Zuge der Aufarbeitung gleichzeitig zu entrinden. Dazu wurden Versuchsreihen an verschiedenen Baumarten (Nadel- und Laubholz) sowie zu verschiedenen Jahreszeiten (Sommer und Winter) durchgeführt. Der Grad der Entrindung der Stämme war sehr unterschiedlich, bei Sommerfällung wurden mehr als 80 % der Rinde entfernt. Die Holzerntemaßnahmen dauerten etwa 30 % länger. Im Beitrag werden die Einflussfaktoren und weitere Verbesserungspotenziale erläutert.
Poster Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft 258
Holzbereitstellung und Optimierung
Thomas Smaltschinski1
1Professur für Forstliche Verfahrenstechnik, Uni Freiburg, Werthmannstr. 6, 79098 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Lineare Optimierung, Kombinatorik, Informationsfluss, Effizienzsteigerung
Der Focus bei der Holzbereitstellung kann auf technische Lösungswege oder auf die Planung, Steuerung und Organisation gelegt werden. Forsttechnische Lösungswege betreffen gewisse Ernteverfahren und die dazugehörenden Ressourcen. Hier stehen Lösungsansätze im Vordergrund, die Forderungen nach Bodenschonung, Klimaschutz, Effizienz und ganzjähriger Holzbereitstellung gerecht werden sollen. Eine Optimierung bezieht sich nicht auf das Beste, sondern auf die Minimierung oder Maximierung einer Zielgröße bei der Holzbereitstellung mit Rücksicht auf die vorhandenen Mittel, die hier in einer boden- und klimaschonenden Forsttechnik bestehen. In einem größeren Forstbetrieb werden im Laufe eines Jahres große Mengen an Holz zunehmend vollmechanisiert genutzt und dabei Treibstoffe in größeren Mengen verbraucht. Eine Optimierung bei der Holzernte kann dabei in einer Minimierung der Umsetzstrecken der Erntemaschinen zwischen den Nutzungsbeständen bestehen. Implizit wird das forstliche Wegenetz weniger beansprucht und die unvermeidlichen Schäden am Wegenetz minimiert. Hierbei sollten nicht irgendwelche Nutzungsbestände geerntet werden, sondern es sollten Kombinationen von geplanten Nutzungsbeständen zusammengestellt werden, die den Bedarf der Kunden zeitgerecht decken und minimale Umsetzstrecken ergeben. Die Optimierung richtet sich daher auf zwei Zielgrößen (Minimierung der Umsetzstrecken und Bedarfsdeckung der Kunden). Nachdem die Bestände geerntet und Polter gebildet sind, werden für die Holzbereitstellung weitere Ressourcen beim Transport verbraucht. Eine optimierte Allokation der Polter zu Kunden führt zu einer Minimierung dieses Verbrauchs, der durch Rückfrachten oder Dreiecksrouten weiter verringert werden kann. Eine weitere Möglichkeit zur Senkung des Ressourcenverbrauchs ergibt sich durch den modalen Transport mit der Bahn. Klimaschutz, Effizienz und ganzjährige Holzbereitstellung sind nicht isoliert durch forsttechnische Lösungswege zu gewährleisten. Erst eine systemische Betrachtung der gesamten Kette und ihre Planung und Steuerung führt zu gewünschten Effekten.
Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft
259
Bodenverdichtung in der forstwirtschaftlichen Erschließung und ihr Einfluss auf die lokale Hydrologie und Erosionsgefährdung
Julian J. Zemke1
1Universität Koblenz-Landau, Institut für Integrierte Naturwissenschaften, Abteilung Geographie. Universitätsstr.1, 56070 Koblenz. [email protected]
Schlagworte: Bodenverdichtung, Bodenhydrologie, Bodenerosion, Beregnungssimulation
Im Zuge der forstwirtschaftlichen Erschließung kommt es in den meisten Fällen zu einer Befahrung mit schwerem Gerät. Insbesondere aus einer direkten Befahrung ungeschützten Oberbodens resultiert eine Kompaktierung der Bodenmatrix aufgrund der hohen Gewichtsauflast. Hierdurch ändern sich die bodenhydrologischen Eigenschaften dieser Standorte signifikant: Die verringerte Infiltrationskapazität bedingen die Ausbildung von Oberflächenabfluss, so dass der Wasserrückhalt vermindert wird. Zusätzlich kann es zu einem Anstieg der Bodenerosionsraten kommen, da mit dem Abfluss ein Partikeltransport möglich ist. Insgesamt sinkt durch diese Effekte auch die ökologische Standortqualität. Die vorliegende Studie untersucht diese Zusammenhänge mit einer Kombination verschiedener Methoden. Neben der Erstellung von interpolierten Profilen der Lagerungsdichte in Rückegassen wurden Beregnungsversuche durchgeführt, die eine zeitlich hoch aufgelöste Betrachtung der Abfluss- und Bodenerosionsprozesse ermöglichen. Die Ergebnisse zeigen einen eindeutigen Einfluss der Befahrung auf die bodenphysikalischen und hydrologischen Parameter der untersuchten Wege. So konnten in Bereichen der direkten Befahrung klare Indizien für eine schadhafte Bodenverdichtung gewonnen werden, maximal wurden Trockenrohdichten > 2 g/cm³ kartiert. Diese Teilflächen grenzten sich dabei scharf von den unbefahrenen Waldböden ab. Die Beregnungsversuche zeigten eine deutliche Tendenz zur Ausbildung von Oberflächenabflüssen. Infiltrierten auf unbeeinflussten Waldböden im Mittel 96% des Niederschlags, sank der Anteil in Rückegassen auf durchschnittlich 54% ab. Auf naturfesten und geschotterten Wegen lag der Anteil bei lediglich 16%. Parallel hierzu stieg der Bodenabtrag deutlich an, so wurden auf Waldböden durchschnittlich 1,3 g, in Rückegassen 10,8 g und auf Wegen 181,3 g Sediment erodiert. Deutlich wird, dass die Befahrung im Zuge der forstwirtschaftlichen Erschließung einen negativen Effekt auf ökologisch relevante Prozesse und Standortfaktoren ausübt. Zu diskutieren ist daher, in wie weit es in der Praxis möglich ist, diese Schäden zu minimieren. Die vorgestellten Methoden und Ergebnisse können dabei eine in-situ erhobene Komponente zur Beurteilung und Evaluierung von Befahrungsschäden darstellen.
Poster Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft 260
Waldbau meets Technik: Holznutzung in pionierbaumreichen Jungbeständen. Ergebnisse aus dem Projekt „Piowood“
Rüdiger Unseld1
1 Professur für Waldbau, Universität Freiburg, Tennenbacherstraße 4, 79106 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: maschinelle Bestandspflege, Sukzession, Deckungsbeitrag, Birke
Die Holzvorräte und Flächenanteile pionierbaumreicher Jungbestände haben in den Wäldern Deutschlands eine beträchtliche Bedeutung. Die häufigsten Pionierbaumarten in den Beständen sind Birken, deren Holz energetisch oder stofflich sehr gute Eigenschaften aufweist. Birken sind zumeist vorwüchsig und bilden in Mischbeständen lange Zeit den Oberstand. Zur Förderung der gewünschten Hauptbaumarten sind Bestandspflegen unumgänglich. Eine Behandlung der Bestände kann durch Überdichten und Entnahme herrschender Bäume erschwert werden. Eine Möglichkeit ist eine voll maschinelle Pflege. Je nach Bestandesaufbau ist der Maschineneinsatz kostenintensiv oder es können bereits positive Deckungsbeiträge erzielt werden. In der Präsentation werden dazu stichprobenbasierte Studien mit verschiedenen Erntemaschinen vorgestellt, deren Leistung mit Bestandsgrößen gekoppelt wurde. Daraus wurden Deckungsbeiträge für verschiedene Bestandsdurchmesser berechnet. Pfleglichkeitsaspekte ergänzen die reinen Kostenüberlegungen und es werden erste Rückschlüsse darauf gezogen, wie eine optimierte Bestandesgestaltung aussehen könnte, die den Hauptbestand fördert und zugleich einen Vorertrag durch die Pioniere gewährleistet.
Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft
261
Verbundprojekt: Bodenschonender Maschineneinsatz im Wald (BoMaWa)
Bastian Hinte1
1Abteilung Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnologie, Büsgenweg 4; 37077 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Bodendruck, Bodentragfähigkeit, Befahrungsmodell
Die allgemeine Nachfrage nach Holz ist seit einiger Zeit ungebrochen hoch und wird tendenziell in Zukunft eher zunehmen, sei es zur stofflichen oder energetischen Nutzung. Diese Nachfrage hat viele Waldeigentümer und Waldbewirtschafter dazu veranlasst die Bewirtschaftung auf den Waldflächen zu intensivieren und auf Grund der gängigen Zertifizierungssysteme (PEFC, FSC) Feinerschließungsnetze anzulegen, auf denen nahezu der gesamte Holzernteprozess stattfindet. Die bodenphysiologischen Auswirkungen der Befahrung und die technische Befahrbarkeit dieser Erschließungssysteme gewinnen daher für die Forstbetrieb zunehmend an Bedeutung. Die Befahrung von Wäldern mit Forstmaschinen zur Holzernte stellt den Schwerpunkt im kürzlich angelaufenen Verbundprojekt „Bodenschonender Maschineneinsatz im ald“ - kurz BoMaWa - dar. Als Projektinitiator ist die Abteilung für Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnologie an den Auswirkungen der Befahrung von Waldflächen mit Forsttechnik interessiert und untersucht diese in Feldversuchen und auf abteilungseigenen Prüfständen. Erstmals wird die dynamische Bodenbelastung in einem neuentstandenen Außenprüfstand ermittelt. Dies ist eine Fortführung der bisher statisch durchgeführten PrAllCon - Messreihen (Pressure Allocation on Contact Areas under Forest tires - Druckverteilung auf Kontaktflächen unter Forstreifen). In Zusammenarbeit mit der Universität Kassel - Fachgebiet Bodenkunde - werden die bodenspezifischen Parameter in realistischen Feldversuchen erhoben und ausgewertet. Zusätzlich ist die Firma Felasto Pur an dem Projekt beteiligt und daran interessiert die bestehenden Bogie-Bänder aus dem leichteren Kunststoff mit Blick auf die üblichen Anforderungen der mechanisierten Holzernte unter deutschen Bedingungen zu optimieren. Ziel des gesamten Vorhabens ist die Entwicklung einer Entscheidungshilfe für den Waldbesitzer bzw. Waldbewirtschafter. Sie soll Entscheidungen zur Befahrung der Waldflächen erleichtern, indem Vorschläge zu Maschinenkonfigurationen (technische Möglichkeiten) in Abhängigkeit von Bodenfeuchte und Bodentyp gemacht werden. Dazu werden die Erfahrungen zum Kontaktflächendruck sowie zur Spurbildung beim Einsatz von Großmaschinen mit Erhebungen zur aktuellen Bodentragfähigkeit verknüpft.
Poster Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft 262
Holzernte- und Holzbringungskonzepte für die Baden-Württembergischen Buchen-Mischwälder von Morgen
Ferréol Berendt1, Janine Schweier1, Dirk Jaeger1
1Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Professur für Forstliche Verfahrenstechnik, Werthmannstr.6, 79085 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Klimawandel, Befahrungsempfindlichkeit, Kohlenstoffspeicherung
Der Klimawandel kann zu deutlichen Auswirkungen auf die Forstwirtschaft führen. Experten gehen davon aus, dass die Temperatur vor allem in den Wintermonaten am stärksten ansteigen wird, im Süden Deutschlands über 4 °C. Zudem ist es wahrscheinlich, dass die Winterniederschläge um bis zu 35 % zunehmen, die Frost- und Eistage deutlich zurückgehen und es durch die Isolationswirkung des Kronendachs kaum noch langanhaltenden Bodenfrost geben wird. Dadurch werden insbesondere die Waldböden bei der Holzernte und –bringung einem erhöhten Schädigungsrisiko ausgesetzt. Die klimatischen Veränderungen erschweren damit die Anwendung naturschonender bodengestützter Holzernte- und Holzbringungsverfahren. Diese Studie zeigt naturschonende Holzernte- und Holzbringunsverfahren, die in Zukunft relevant sein werden. Weil grundsätzlich das Konzept eines naturnahen Waldbaus verfolgt und natürliche Waldtypen mit ihrer potentiellen natürlichen Vegetation (pnV) gefördert werden, liegt der Hauptfokus auf Verfahren die in Buchen-Mischwäldern zur Anwendung kommen können. In Baden-Württemberg gehören über 96 % der Waldfläche zu den Verbreitungsarealen der Rotbuche und jährlich steigende Flächenanteile verdeutlichen ihr Potenzial als zukünftige Hauptbaumart. Für die Holzernte- und Holzbringungsverfahren erscheint eine Erschließung mittels Maschinenwegen möglich, so dass eine Befahrung weitgehend witterungsunabhängig erfolgen kann. Weder die Unterhaltung eines permanenten Rückegassensystems noch der Einsatz von Seilkränen scheinen in Zukunft zielführend zu sein, weil zum einen in multifunktionalen Dauerwäldern nur eine geringe Zahl an Bäumen je Hektar entnommen wird und zum anderen die Böden in den Flachlagen sehr befahrungsempfindlich sind. Denkbar wäre hingegen, Holz nach der motormanuellen Fällung mittels Pferd (Sortiment) oder Forstschlepper (Rohschaft) zum Maschinenweg vorzurücken. Bei zunehmender Hangneigung geht dieses Verfahren, geländebedingt, zu einer motormanuellen Ernte mit anschließender Seilkranbringung über. Dementsprechend muss das Hiebsvolumen erhöht und die Eingriffshäufigkeit gesenkt werden, um die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens zu sichern. Durch den Wegfall von Rückegassen im 40-Meter-Abstand und die Bestockung mit Waldbäumen könnten in Deutschland zusätzliche 39,2 Mio. t CO2–Äq. in der Biomasse gespeichert werden.
Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft
263
Reduktion von Nährstoffentzügen bei der Waldenergieholzernte durch grobes Entasten von Baumkronen
Fabian Schulmeyer1, Elke Dietz1, Karl Hüttl1, Marianne Schütt1, Herbert Borchert1
1Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising. [email protected]
Schlagworte: Waldhackschnitzel, Nährstoffentzug, Ernteverfahren, Produktivität
Einleitung. Die Produktion von Waldhackschnitzeln hat sich gerade im Rahmen der Energiewende als fester Bestandteil der Forstwirtschaft etabliert. Um eine umfassende Nachhaltigkeit bei steigender Nachfrage zu sichern, müssen die damit verbundenen Nährstoffentzüge berücksichtigt werden. Die Intensität der Nutzung kann u. a. durch die Wahl von geeigneten Ernteverfahren an das Potential des Standorts angepasst werden. Bei der Bereitstellung von Hackholz aus Baumkronen können alternativ zur Bringung der ganzen Kronen diese im Bestand grob entastet werden. Das Verfahren kann insbesondere in nadelholzdominierten Durchforstungs- bis Endnutzungsbeständen motormanuell oder vollmechanisiert angewendet werden. Methoden. Bisher wurden an drei fichtendominierten Standorten Arbeitsstudien zum Verfahren durchgeführt und an je 5 – 6 Bäumen die Biomasse der Baumkompartimente bestimmt. Die Flächen wurden in Blöcke mit vergleichbarer Bestandescharakteristik unterteilt. Diese wurden bei der motormanuellen Ernte abwechselnd ohne Aufarbeitung bzw. mit grober Entastung der Kronen bearbeitet. Bei der vollmechanisierten Ernte wurde als dritte Variante die Industrieholzaufarbeitung ergänzt. Erfasst wurden der Zeitbedarf für die Verfahrensschritte Ernte, Rücken und Hacken nach Arbeitsablaufabschnitten und die produzierten Holzmengen. Ergebnisse. Die Auswertung der Probebäume der ersten Versuchsfläche ergab, dass durch das grobe Entasten der Kronen der Biomasseexport bezogen auf das gesamte Baumvolumen potentiell um 12-26 % (Mittel: 17 %) reduziert werden kann. In der ersten motormanuellen Fallstudie wurden 82 Fichten im BHD-Bereich 23-65 cm (Mittel: 43,5 cm) gefällt. Die Aushaltungsgrenze der stofflichen Sortimente betrug 18 cm. Der zeitliche Mehraufwand lag je nach Dimension und Kraft’scher Klasse der Bäume bei 0,5-5,0 min/Krone (Mittel: 1,6 min/Krone). Dies entspricht einem Zuschlag von im Mittel 14 % der reinen Arbeitszeit der Waldarbeiter. Aus den grob entasteten Kronen wurden durchschnittlich jeweils 0,26 Srm Hackschnitzel produziert. Der volumenbezogene Mehraufwand belief sich damit auf 6,15 min/Srm. Die Ausbeute an Hackschnitzeln wurde um 63 % reduziert. Bei der Rückung konnte die Zuladung (bezogen auf das produzierte Hackschnitzelvolumen) um 41 % gesteigert werden. Die Arbeitsstudien werden Anfang 2016 um weitere Einsätze zur vollmechanisierten Holzernte ergänzt. Bisherige Auswertungen lassen einen deutlich geringeren Mehraufwand als bei der motormanuellen Ernte erwarten.
Poster Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft 264
Verbessertes Ressourcenmanagement in der Forstwirtschaft durch qualifizierte Planzeiten und Plankosten für standardisierte
Arbeitsverfahren (RePlan)
Christina Hock1, Ute Seeling,1Andrea Hauck1, Markus Dög2 und Felix Rinderle3
1Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. Spremberger Straße 1, 64823 Groß-Umstadt, [email protected], [email protected] 2Georg-August-Universität Göttingen, Büsgenweg 5, 37077 Göttingen, [email protected] 3Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Werthmannstraße 6, 79085 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Planzeiten, Plankosten, Ressourcenmanagement, Arbeitsverfahren
Das Wissen über Zeit und Ressourcenverbrauch forstlicher Arbeitsverfahren ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Im Zuge der Umstellung von Stück- auf Zeitlohn in fast allen Forstverwaltungen und Forstbetrieben wurden die bis dahin als Standard-kalkulationsgrundlage für die motormanuelle Holzernte geltenden Daten nicht mehr aktualisiert. Zudem werden aufgrund des technischen Fortschritts aktuell Arbeitsverfahren in den verschiedenen forstlichen Betriebsbereichen eingesetzt, die untereinander und im Vergleich zu den Verfahren der Vergangenheit in Kosten- und Leistungswerten sehr verschieden sein können. Die Einsatzzeit eigener Forstwirte in der reinen Holzernte hat deutlich abgenommen, wodurch Tätigkeiten an Bedeutung gewonnen haben, für die bisher noch kaum durchschnittliche Zeitverbrauchs- und Kostendaten dokumentiert wurden. Das Wissen um diese Daten ist jedoch für eine wirtschaftliche Betriebsführung und einen effizienten Ressourceneinsatz von zentraler Bedeutung. Belastbare Daten in Form von Durchschnittswerten werden von forstlichen Akteuren für die Planung, Steuerung und das Controlling forstbetrieblicher Maßnahmen bei der nachhaltigen Waldbewirtschaftung benötigt. Im ahmen des Verbundprojektes „ ePlan“ werden von den Projektpartnern (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V., Professur für Forstliche Verfahrenstechnik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und Abteilung für Forstökonomie und Forsteinrichtung der Georg-August-Universität Göttingen) Daten zu Planzeiten und Plankosten zu definierten forstlichen Arbeitsverfahren erfasst und ein Verfahren zur Erweiterung und zukünftigen Aktualisierung der so geschaffenen Datenbasis entwickelt und evaluiert. Mit dem von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. geförderten Projekt wird innerhalb der Projektlaufzeit (Juni 2015 bis Mai 2018) eine als EDV-gestütztes arbeitswissenschaftliches, technologisches und betriebswirtschaftliches Informationssystem konzipierte Datenbank zu Planzeiten und Plankosten entstehen, die von allen forstlichen Akteuren (z.B. Waldbesitzer, Forstbetriebe, forstliche Berater, Forstunternehmer) genutzt werden kann. Im vorliegenden Beitrag werden Hintergründe zum Datenbedarf in der forstlichen Praxis, die Auswahl der im Projekt zu bearbeitenden forstlichen Arbeitsverfahren und die Herangehensweise bei der Erstellung eines Grundkonzeptes für die betriebswirtschaftliche Kalkulation vorgestellt.
Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft
265
Bodendeformationsprozesse unter verschiedenen Holzerntetechniken auf Rückegassen – Ein Bewertungsschema
Roland Riggert1
1Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, [email protected] Anhand eines Posters wird ein Bewertungsschema zu Bodendeformationsprozessen unter verschiedenen Holzerntetechniken auf Rückegassen vorgestellt. Als Grundlage dieses Schemas werden die interne Bodenstabilität und die externe Auflast, gemessen als Spannungseinträge von Holzerntemaschinen, gegenüber gestellt und bewertet. Mittels einer dreijährigen Messreihe wurden detaillierte Daten für sieben verschiedene Maschinenvarianten untersucht und ausgewertet. Neben der Vorbelastung als Maß für die Stabilität des Bodens und die 1. Hauptspannung als Funktion der Spannungseinträge wurden außerdem Werte der gesättigten Wasserleitfähigkeit, der Lagerungsdichte und der Luftkapazität bestimmt. Alle Werte wurden für eine Referenz vor der Befahrung und nach mehrmaliger Befahrung in drei Bodenhorizonten untersucht. Mit Hilfe der gesammelten Ergebnisse konnten zunächst plastische und elastische Deformationsprozesse abgeleitet werden. Des Weiteren geben die Verläufe der Spannungseinträge bei zunehmender Überfahrten Anzahl Auskunft über die Bodenstabilität und eine mögliche Gleisausbildung während er Holzernte. Ein einfaches Überschreiten der Vorbelastung bei abnehmenden Spannungseinträgen mit zunehmender Überfahrten Anzahl führt im Gegensatz zur Nichtüberschreitung zu negativen Konsequenzen für die gemessenen bodenphysikalischen Parameter. Die technische Befahrbarkeit einer Rückegasse wird jedoch nur marginal gestört. Steigende Spannungseinträge mit zunehmender Überfahrt bedeuten stark scherende Prozessen und führen zu einem Grundbruch und somit zum Verlust der technischen Befahrbarkeit. Die negativen Auswirkungen auf die bodenphysikalischen Parameter sind auch in diesem Fall zu beobachten bzw. verschlimmern sich. Als Ursache für diesen Prozess konnten eindeutig zu hohe Gewichte bei niedrigen Kontaktflächen, wie z.B. bei normalen Rad-Maschinen identifiziert werden. Als Worst-Case-Szenario wurde zusätzlich ein erhöhter Wassergehalt im Boden bei dem Einsatz von schweren Holzerntemaschinen beobachtet. Dieser führt zum vollständigen Verlust der Bodenstruktur und zur Homogenisierung der ückegasse mit tiefen Fahrspuren voll mit „Matsche“.
Poster Session 12: Angepasste Forsttechnik für die nachhaltige Forstwirtschaft 266
Ökonomische Überlegungen zum physikalischen Bodenschutz im Wald
Oliver Thees1 und Roland Olschewski1
1Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Zürcherstr. 111, CH-8903 Birmensdorf, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Holzernte, Bodenschutz, Qualitätsstandards, Ökonomie
Der Beitrag analysiert den physikalischen Bodenschutz bei der Holzernte aus produktions-, industrie- und institutionenökonomischer Sicht in der Schweiz. Die Ergebnisse tragen zu einem besseren Verständnis dieses privatwirtschaftlich erzeugten öffentlichen Gutes bei.
Der physikalische Bodenschutz verursacht beträchtliche Kosten, stiftet aber auch großen Nutzen. Der Wettbewerbsschutz der öffentlichen Forstbetriebe gewährleistet derzeit einen Bodenschutz auf hohem Niveau. Die sensibilisierte Bevölkerung und das forstliche Berufsethos entschärfen Anreiz- und Kontrollprobleme. Die Zertifizierung kann derzeit nicht zu einer Verbesserung beitragen. Durch einen Standard bezüglich der zu vermeidenden Schadwirkung auf der Grundlage einer Fahrspurtypisierung lässt sich ein Konsens zwischen allen Beteiligten – Waldbesitz, Bevölkerung und Forstunternehmertum – schaffen.
Herausforderungen bilden Klimawandel und steigende Ressourcennachfrage. Sie können das Problem des Bodenschutzes verschärfen und die Mehrkosten in die Höhe treiben. Die ökonomische Analyse und Bewertung sollte fortgesetzt werden, um die wirtschaftlichen Konsequenzen des Bodenschutzes besser beurteilen und entsprechend bessere Entscheide fällen zu können.
Poster Session 13: Nutzungsintensität als Stellschraube z. Lösung v. Zielkonflikten
267
Analyse der ökonomischen Potentiale von Einzelbeständen im Kontext der optimierten Bereitstellung von Waldökosystemleistungen
Hilmar v. Bodelschwingh1
1Georg-August-Universität Göttingen, Abteilung Forstökonomie und Forsteinrichtung, Büsgenweg 3, D-37077 Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Versorgungsleistungen, Forsteinrichtung, betrieblicher Erfolg
Bei der Auseinandersetzung mit den Ökosystemleistungen von Wäldern überrascht, dass sich für die Beschreibung der Versorgungsleistungen bisher keine Kennziffern etabliert haben, die deren betriebliche aber auch gesamtwirtschaftliche Bedeutung hinreichend beschreiben. Die Aufrechterhaltung gerade der Holzproduktionsfunktion der Wälder ist eine existenzielle Grundlage wirtschaftender Forstbetriebe. Auch aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive erbringt die Holznutzung bspw. in Form von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in der Forst- und Holzwirtschaft oder die Substitution nicht-nachhaltiger Rohstoffe wichtige gesellschaftliche Leistungen. Andere Waldleistungen konkurrieren im Regelfall mehr oder weniger stark mit dieser Funktion. Auf begrenzter Fläche eine effiziente Bereitstellung verschiedener Ökosystem-leistungen zu erreichen und dieses Ziel in forstliche Produktionsentscheidungen zu integrieren, erfordert die Kenntnis flächenspezifischer (räumlich disaggregierter) Leistungs-potentiale. Auf der Grundlage von hessischen Forsteinrichtungsdaten wurde anhand von Kenngrößen eine Potentialanalyse einzelner Waldbeständen zur Erfüllung unterschiedlicher, wirtschaftlicher Ziele von Forstbetrieben erstellt. Diese Ziele umfassen die Sicherung der (kurzfristigen) Liquidität, den dauerhaften betrieblichen Erfolg sowie den langfristigen Vermögenserhalt bzw. -aufbau. In die Analyse wurden neben den Bestockungsinformationen auch standörtliche Parameter, mögliche Folgebestände und Bestandesrisiken einbezogen. Auch wenn kein Bestand zeitgleich ein hohes Potential für alle genannten Ziele aufweisen kann, zeigen die Ergebnisse eine große Spannweite zwischen Beständen mit geringer wirtschaftlicher Bedeutung bis hin zu solchen, die für den betrieblichen Erfolg kaum entbehrlich erscheinen. Die Analyse liefert zum einen Opportunitätskosten für Bewirtschaftungseinschränkungen. Zum anderen kann sie als betriebliches Steuerungsinstrument Grundlagen für eine effiziente Lokalisation konkurrierender Leistungen sowie eine darauf abgestimmte Nutzungsintensität sein (ähnlich dem im aldnaturschutz diskutierten „Hot-Spot Konzept“). Für die Vorteilhaftigkeit dieses Vorgehens spricht eine starke Differenzierung der Leistungspotentiale über der Fläche. Die räumliche explizite und kleinmaßstäbliche Darstellung der Ergebnisse ermöglicht eine lokale Priorisierung. Korrespondierende Zielkonflikte lassen sich auf dieser Ebene oft besser auflösen, als es in hoch aggregierter Form möglich erscheint.
Poster Session 13: Nutzungsintensität als Stellschraube z. Lösung v. Zielkonflikten 268
Paradigmenwechsel in der Forstgeschichte – Holzselektion, Walddegradation und Fichtenkultur auf dem Prüfstand
Thomas Ludemann1
1Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fakultät für Biologie, Abt. Geobotanik, Schänzlestraße 1, D-79104 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Anthrakologie, Energieholznutzung, Holzkohle, Köhlerei
Es wird allgemein davon ausgegangen, dass bei den historischen Waldnutzungen vielfach eine gezielte Auswahl bestimmten Holzes erfolgte und letztendlich eine großflächige Veränderung und Degradation der Waldbestände bewirkt wurde; dies gilt insbesondere für die intensiveren mittelalterlichen sowie vor allem für die umfangreichen vor- und früh-industriellen Energieholznutzungen im Rahmen der Holzkohle-Produktion. Diese allgemeine Annahme wurde in bedeutenden historischen Bergbaurevieren sowie in weiten Teilen des Südschwarzwaldes anhand anthrakologischer (holzkohleanalytischer) Untersuchungen an zahlreichen archäologischen Fundplätzen des mittelalterlichen Bergbaus und der (früh)neuzeitlichen Holzkohle-Herstellung/Waldköhlerei geprüft. Festgestellt wird anhand der Großrestanalyse von Holzkohle-Rückständen insbesondere, welche Holzarten und -stärken wann, wo und bei welcher Nutzung verwendet wurden. Die holzkohle-analytischen Ergebnisse werden vegetationskundlichen und waldökologischen Erwartungswerten zur natürlichen Baumartenzusammensetzung gegenübergestellt. Bemerkenswerterweise lassen sich hinsichtlich des genutzten Holzes nur selten Hinweise auf Holzselektion oder Walddegradation finden; dies gilt vor allem auch für die Zeit der intensivsten Waldköhlerei im 17. und 18. Jahrhundert. Häufig kommen dagegen in den verschiedenen Mengenverhältnissen der genutzten Baumarten räumliche Unterschiede der natürlichen Wuchsbedingungen zum Ausdruck, indem sich deutliche Zusammenhänge zu den Baumartenzusammensetzungen der natürlichen Standortswälder (pnV, potenzielle natürliche Vegetation; Klimaxwälder) nachweisen lassen. Lediglich eng begrenzt auf die nahe Umgebung von Siedlungen und Bergbaustätten lassen sich anthropogene Einflüsse erkennen, während viele Waldgebiete offensichtlich noch bis weit in die Neuzeit hinein eine naturnahe Baumartenzusammensetzung hatten und in ihnen selbst im 17./18. Jh. noch große Holzvorräte der Klimaxbaumarten vorhanden waren. Neben dem als Energieträger begehrten Laubhartholz von Buche und Eiche war auch das weniger gut geeignete Nadelholz von großer Bedeutung, in vielen Gebieten Tanne, in bestimmten Gebieten aber auch Fichte oder Kiefer. Unter orographisch (Höhenlage, Subalpin) oder lokalstandörtlich (Sonderstandorte an Mooren und Felsen) besonders nadelholzgünstigen Wuchsbedingungen wurde dementsprechend umfangreich Nadelholz genutzt, Fichte insbesondere in den höchsten Lagen des Südschwarzwaldes, über 1200-1300 m üNN.
Poster Session 13: Nutzungsintensität als Stellschraube z. Lösung v. Zielkonflikten
269
Naturverträgliche Energiewende – im Spannungsfeld energiepolitischer Ziele und naturschutzfachlicher Anforderungen am Beispiel des
Ausbaus der Windkraft an Land.
Dimitri Vedel1, Bernd Demuth2, Rainer Luick1, Stefan Heiland2
1 Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Schadenweilerhof, 72108 Rottenburg a.N., [email protected], [email protected] 2 Technische Universität Berlin, Straße des 17. Juni 1945, 10623 Berlin, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Energiewende, Naturschutz, Akzeptanz, Kommunikation
Der Klimawandel und die sich abzeichnende Knappheit fossiler Energieträger haben in den letzten Jahren zu einer gesellschaftspolitischen Debatte über die zukünftige Energieversorgung geführt. Mit der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, wurde der Einstieg in die Energiewende geschaffen. Die garantierten Einspeisevergütungen führten zu einem Ausbau, insbesondere von Windkraftanlagen an Land. Aus Sicht des Naturschutzes ist die Umstellung von fossilen und atomaren auf erneuerbare und CO2-neutrale Energieträger unabdingbar. Dadurch werden sich im Zuge der Energiewende Landschaftsbilder weiterhin verändern, was gesellschaftlich kontrovers bewertet, diskutiert und teilweise instrumentalisiert wird. Auswirkungen auf den Naturhaushalt sowie Flora und Fauna sind unvermeidbar. Die „Energiewende“ sollte so natur- und landschaftsverträglich wie möglich erfolgen. Hierfür ist die Reduktion des derzeitigen Energieverbrauchs von Bedeutung, denn Energie, die nicht erzeugt wird, beansprucht weder Flächen noch Infrastruktur und ist frei von negativen ökologischen Nebenwirkungen. Zudem ist die Reduktion des Energieverbrauchs ein Ziel der Langfristszenarien der Bundesregierung – ohne dies kann die Energiewende nicht gelingen. Obwohl die Reduktion des Energieverbrauchs ein elementarer Bestandteil der Energiepolitik ist, wird dies öffentlich bislang nur nachrangig diskutiert – die Notwendigkeit zur Veränderung individuellen „Energieverbrauchsverhaltens“ wird kaum thematisiert. Dies ist jedoch nötig, da die Energiewende neben dem Ausbau erneuerbarer Energien und technischen Effizienzsteigerungen vermutlich auch Änderungen des „Energieverhaltens“ von Wirtschaft und Bürger*innen erfordert. Der Ausstieg aus Kohle und Atomkraft, der Erhalt von Landschaften und der biologischen Vielfalt, sowie die Beibehaltung unseres bisherigen Energieverbrauchs sind nicht gleichzeitig zu verwirklichen, sondern stehen teilweise im Widerspruch zueinander und sind daher gegeneinander abzuwägen. Mit Stakeholder-Interviews und bei Workshops wurde erörtert, wie die Gesamtheit der Energiewende für eine bessere gesellschaftliche Akzeptanz kommuniziert werden kann, welche Kommunikationsprozesse geeignet sind. Erkenntnisse können Regionen unterstützen, die noch am Anfang des Ausbaus stehen. Für Regionen, in denen bereits eine dezentrale Energiegewinnung sichtbar ist, kann ein suffizientes Verhalten angestoßen werden.
Poster Session 14: Urbanisierung und Forstwirtschaft 270
Zahlungen für Naturschutz im Wald – Problem und Lösungsansatz
Kristin Bormann1
1Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie, Leuschnerstr. 91 21031 Hamburg, [email protected]
Schlagworte: Waldbesitzer, Naturschutz, Agency-Analyse, PES
Vor dem Hintergrund steigender gesellschaftlicher Ansprüche an den Wald rücken finanzielle Instrumente zur Honorierung der Erbringung ökologischer Leistungen, auch Payments for Ecosystem Services (PES) genannt, immer mehr in den Fokus. In Europa existieren solche Instrumente im Bereich des Naturschutzes bereits. Im Rahmen der ländlichen Entwicklungspolitik der EU gibt es dabei auch Maßnahmen, die speziell den Naturschutz im Wald adressieren. Aber diese Instrumente werden bisher nicht effizient umgesetzt. In der Praxis verursachen sie hohe Implementationskosten auf der Fördermittelgeberseite bei zugleich geringer Nachfrage durch den Waldbesitz. Die zentrale Hypothese der vorgestellten Arbeit ist, dass die institutionelle Umsetzung des Förderprogramms wichtige Eigenschaften der Waldbesitzer unzureichend berücksichtigen. Bei den Waldbesitzern ergeben sich deshalb hohe Transaktionskosten, die eine stärkere Inanspruchnahme der Programme behindern.
Die Analyse des Fördersystems erfolgt unter dem Blickwinkel der Agency-Analyse als Teil der Neuen Institutionenökonomie. Als Werkzeug innerhalb der Agency-Analyse wird die Theorie des geplanten Verhaltens (TPB) (Ajzen) zur Beschreibung der Hintergründe des Verhaltens der Waldbesitzer genutzt. Im Rahmen der Agency-Analyse werden die Eigenschaften der Akteure und der Transaktion beschrieben und verknüpft. Ziel ist es, besonders kritische Punkte im Zusammenspiel des Fördersystems als institutionellem Rahmen und dem individuellem Verhalten der Waldbesitzer zu identifizieren. Darauf aufbauend werden Empfehlungen zur Überwindung dieser Punkte entwickelt, die sowohl die Ansprüche des Fördermittelgebers als auch der Fördermittelnehmer besser berücksichtigen.
Die Umsetzung der Naturschutzförderung kann als eine Transaktion beschrieben werden, in der der Fördermittelgeber Prinzipal und der Waldbesitzer sein Agent ist. Aufgrund der Eigenschaften des Waldbesitzers ist zusätzlich der Betreuungsförster in die Betrachtung einzubeziehen. Dieser ist wiederum Agent des Waldbesitzers. Datengrundlage für die Beschreibung der Transaktion, des Fördermittelgebers und des Betreuungsförsters sind verschiedene Förderdokumente und Interviews, die im Rahmen der Evaluation des ländlichen Entwicklungsprogramms des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurden. Zusätzlich wurde eine an der TPB orientierte Waldbesitzerbefragung durchgeführt. Der Beitrag stellt die Hauptergebnisse und daraus abgeleitete Empfehlungen zur Instrumentenausgestaltung vor.
Poster Session 14: Urbanisierung und Forstwirtschaft
271
Erholungsnutzung stadtnaher Wälder an den Beispielen München und Freising
Gerd Lupp1, Valerie Kantelberg2, Marc Koch2, Günter Weber1, Roland Schreiber2,
Stephan Pauleit1
1 Lehrstuhl für Strategie und Management der Landschaftsentwicklung, TU München, Emil-Ramann-Str. 6, 85354 Freising, [email protected] 2 Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising In stadtnahen Wäldern ist die Erholungsnutzung von zentraler Bedeutung. Besucherlenkung, Schaffung geeigneter Infrastrukturen und zielgerichtete Informationen sind daher wichtig, um Schutzgüter und Leistungen des Waldes zu sichern und Konflikte zwischen den Nutzergruppen und der Waldbewirtschaftung zu minimieren. Als Grundlage für integrative Waldmanagementkonzepte dienen Aussagen zu Waldbildpräferenzen, Nutzung und Nachfrage nach Erholungseinrichtungen im Wald, Wahrnehmung forstlicher Maßnahmen, sowie Daten zur Ausübung von unterschiedlichen Aktivitäten, Verteilung und der Aufenthaltsdauer der Personen im Gebiet. Im Großraum München wurden knapp 1.500 Interviews mit Passanten im Wald (Next-to-pass sowie Quellmarktbefragung in München) durchgeführt. Daneben wurde in zwei Freisinger Wäldern ein kamerabasiertes Besucherzählverfahren mittels abgeklebter Wildkameras angewendet. Das Erholungsverhalten hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert und durch neue Trendsportarten differenziert. Je nach Freizeitaktivität gibt es spezifische räumliche und zeitliche Nutzungsmuster. Auffällig ist die Nutzung der Wälder in den frühen Morgenstunden und abends bis in die Dunkelheit durch Sporttreibende. Die durchschnittliche Verweildauer im Wald ist rückläufig und liegt in den untersuchten stadtnahen Wäldern Münchens derzeit bei knapp zwei Stunden. Die Mehrheit wünscht sich „Natur pur“ mit möglichst sparsamen Freizeiteinrichtungen. Ebenso sind sichtbare Zeichen der Forstwirtschaft störend. Allerdings gaben bei einer Passantenbefragung während eines Hiebs etwa ein Drittel der Befragten an, dass sie diesen gar nicht wahrgenommen hätten. Bei Beobachtungen von Erholungs-suchenden im Wald konnte festgestellt werden, dass sich diese den größten Teil der Zeit im Wald vor allem miteinander unterhielten, auf den Weg achteten oder die Aufmerksamkeit den begleitenden Kinder oder Hunden widmete. Es wurden auch Waldbildpräferenzen mittels Bildbefragung abgefragt. Besonders beliebt war der Bildeindruck von ungleichaltrigen, stufigen Mischbeständen aus Laub- und Nadelholz mit einem kleinen Totholzanteil. In den Aussagen der Befragten wurde deutlich, dass aber auch eine Mischung unterschiedlicher Bestände als besonders attraktiv empfunden wird. Daher wurden auch Waldbilder wie dichte, mittelalte gleichaltrige Fichtenreinbestände, die in einem erzwungenen Ranking am Schlechtesten abschnitten, von den befragten Personen in ückmeldungen als „nicht wirklich schlecht“ angesehen.
Poster Session 14: Urbanisierung und Forstwirtschaft 272
Eintrag von Schwermetallen aus Kremationsaschen in Bestattungswälder – ein „schweres“ Erbe für Wald und Mensch?
Markus Graf-Rosenfellner1, Lorenz Schramm1 und Friederike Lang1
1Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Professur für Bodenökologie, Bertoldstr. 17, 79098 Freiburg i.Br., [email protected]
Schlagworte: alternative Waldnutzung, Schwermetallverlagerung, Immission, Grundwasser.
Die Beisetzung Verstorbener in Bestattungswäldern wird seit einigen Jahren als Alternative zur klassischen Bestattung auf Friedhöfen vermehrt angeboten und auch nachgefragt. Diese Form der Bestattung wird häufig als besonders naturnah empfunden und insbesondere der Kreislaufgedanke spielt bei der Entscheidung für eine Beisetzung in einem Bestattungswald eine zentrale Rolle. In den vergangenen Jahren werden jedoch auch negative Auswirkungen dieser für Waldbesitzer meist rentablen und neuartigen Waldnutzungsform gesellschaftlich und innerhalb der Bestattungsbranche kontrovers diskutiert. Dabei werden insbesondere der zusätzliche Eintrag von in der Kremationsasche enthaltenen Schwermetallen sowie Schäden an Vegetation und Boden durch erhöhte Besucherfrequenz und –zahl als Argumente gegen Beisetzungen in Bestattungswäldern angeführt. Zur Bewertung des Risikos einer etwaig auftretenden Belastung von zur Bestattung genutzten Wäldern wurden sowohl Berechnungen der zu erwartenden Frachten als auch bodenkundliche Untersuchungen in drei verschiedenen Bestattungswäldern durchgeführt. Hierbei wurden Bodenproben an 33 Bestattungsplätzen mit unterschiedlicher Liegedauer direkt unterhalb der Urnen entnommen. In den entnommenen Bodenproben wurden Schwermetallgehalte (HNO3-Druckaufschluss) und Boden pH bestimmt. Die dabei erhaltenen Ergebnisse wurden mit den Schwermetallgehalten und dem Boden pH entsprechender Referenzproben außerhalb des möglichen Einflussbereiches der Urnen verglichen. Es zeigte sich deutlich, dass im Vergleich zu Referenzproben keine erhöhten Schwermetallgehalte in Böden aus dem Abstrombereich des Sickerwassers unterhalb der Urnen ermittelt werden konnten. Hingegen konnte eine leichte Erhöhung des Boden pH festgestellt werden, die auf die Auswaschung von basischen Inhaltsstoffen der Kremationsasche zurückgeführt werden kann. Berechnungen zur zusätzlichen Schwermetallfracht zeigen, dass diese über die Widmungsdauer von 99 Jahren in Abhängigkeit vom betrachteten Element unterhalb oder im Bereich der durch ubiquitäre atmosphärische Deposition eingetragenen Mengen liegen. Nichtsdestotrotz sollte die Umwidmung von Waldflächen in Bestattungswälder zur weiteren Risikominimierung bodenkundlich begleitet werden, um eine mögliche Grundwassergefährdung durch die vorliegenden punktuellen Einträge von Schwermetallen unter ungünstigen bodenkundlichen Bedingungen auszuschließen.
Poster Session 14: Urbanisierung und Forstwirtschaft
273
Von Wäldern und Menschen - Nutzungskonflikte in dicht besiedelten Räumen
Andy Selter1, Ulrich Schraml2 und Matthias Wurster2
1Professur für Forst- und Umweltpolitik, Universität Freiburg, Tennenbacherstraße 4, 79106 Freiburg, [email protected] 2Abteilung Wald und Gesellschaft, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Waldbesuch, Nutzungskonflikte, Kommunikation, Urbanisierung
Die direkte Begegnung mit waldrelevanten Themen erfolgt für den größten Teil der Bevölkerung während der Ausübung von Freizeitaktivitäten im Wald. Eine Vielzahl von Waldbesuchenden wird mit Maßnahmen der Waldbewirtschaftung und deren Auswirkungen konfrontiert und gleichzeitig entwickelt die Gesellschaft mit zunehmender Urbanisierung und knapper werdenden natürlichen Ressourcen immer diversere Ansprüche an den Wald. Sozialempirische Studien, die Art und Umfang der Erholungsnutzung von Wäldern sowie Wahrnehmungen, Einstellungen und Ansprüche der Waldbesuchergruppen erforschen, liefern Erkenntnisse über die gesellschaftliche Rezeption der Waldbewirtschaftung. Gleichzeitig erhält das Management von Wäldern Informationen über Waldbesuchergruppen, um mögliche Nutzungskonflikte angemessen steuern zu können. Zusammen mit der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt erfasst die Professur für Forst- und Umweltpolitik seit über sieben Jahren Art und Umfang der Erholungsnutzung in ausgewählten urbanen Wäldern und führt Befragungen zu Motiven des Waldbesuchs und zur Einstellung zu aktuellen forstpolitischen Themen durch. Der Beitrag zur Forstwissenschaftlichen Tagung liefert einen Überblick über die genannten Forschungsaktivitäten und möchte an Hand von Fallbeispielen diskutieren, welchen Beitrag die Kommunikation mit der Wald besuchenden Öffentlichkeit leisten kann, um Nutzungskonflikte in viel besuchten Wäldern zu steuern.
Poster Session 14: Urbanisierung und Forstwirtschaft 274
Ökosystemdienstleistungen der Wälder und ihr volkswirtschaftlicher Wert. Eine Fallstudie für die Wälder im Gebiet der Stadt Hagen.
Norbert Asche1,2
1LB Wald und Holz NRW, LVFA Arnsberger Wald, Brößweg 40, 45897 Gelsenkirchen, [email protected] 2Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Höxter, FB 9, An der Wilhelmshöhe 44, 37671 Höxter, [email protected]
Schlagworte: Waldökosystem, Dienstleistungen, Volkswirtschaft, monetäre Bewertung
Wälder sind die ursprüngliche Vegetationsbedeckung in Deutschland. Der Mensch nutzt und gestaltet diese Wälder seit Jahrtausenden entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse. Er hat so aus der Naturlandschaft eine Kulturlandschaft entwickelt. Heute bedecken Wälder lediglich noch ca. 1/3 der Landfläche in Deutschland und diese Wälder haben im Landschaftshaushalt und für die Menschen viele Funktionen. Zwar wird derzeit viel und gern von der multifunktionalen Waldwirtschaft gesprochen; welchen volkwirtschaftlichen Wert die zahlreichen Ökosystemdienstleistungen für die Menschen haben, ist bisher nur ansatzweise berechnet bzw. eingeschätzt worden. Die Wälder in Deutschland werden als Forstbetriebe bewirtschaftet. Während die von den Betrieben erzeugten Produkte (u.a. Holz, Wildbret, Waldgrün) am Markt monetär bewertet werden, werden von den Forstbetrieben bereitgestellten Dienstleistungen (u.a. Luftfilterung, Erholungsraum, Biotop) nur selten monetäre Werte zugewiesen. Das ist erstaunlich, da in der gesellschaftlichen Wertschätzung gerade die Ökosystemleistungen der Wälder einen hohen Stellenwert genießen und sich in zahlreichen Forderungen und Regelungen niederschlagen. Welche Leistungen und Produkte die Wälder im Gebiet der Stadt Hagen für die Menschen bereitstellen, wurde in einer Fallstudie untersucht. Das Ergebnis ist, das die zahlreichen Ökosystemdienstleistungen (u.a. Luftfilterung, Wasserschutz, Erosionsschutz, Arten- und Naturschutz, Erholung) der Wälder einen volkswirtschaftlichen ert von ca. 20.000.000 € oder ca. 2.800 € pro ha und Jahr repräsentieren. Dieser Betrag ist ca. 10 mal höher, als der Betrag, der durch den Verkauf geernteten Holzes derzeit erlöst werden kann.
Poster Session 14: Urbanisierung und Forstwirtschaft
275
Vorsicht Kamera! Möglichkeiten und Grenzen eines Besuchermonitorings im Wald mit Wildkameras
Gerd Lupp1, Valerie Kantelberg2, Bernhard Förster1, Carolin Honert2, Johannes Naumann1, Marc Koch2, Roland Schreiber2, Stephan Pauleit1
1 Lehrstuhl für Strategie und Management der Landschaftsentwicklung, TU München, Emil-Ramann-Str. 6, 85354 Freising, [email protected] 2 Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising In stadtnahen Wäldern und Tourismusregionen spielen Erholung und die Minimierung von damit verbundenen Konflikten eine große Rolle. Konzepte und Strategien sollten dabei auf objektiven transparenten Datengrundlagen beruhen. Zentrale Fragen sind: Welche Aktivitäten werden im Wald ausgeübt? Wie viele Erholungsuchende nutzen bestimmte Waldbereiche? Zu welcher Zeit nutzen Erholungsuchende den Wald? Es wurde der Frage nachgegangen, inwieweit vergleichsweise kostengünstige Wildkameras für die genannten Fragen eingesetzt werden können. Testgebiete waren zwei Freisinger Wälder und eine Aufstiegsroute zum Grünten (Allgäu). Um Belangen des Datenschutzes (§ 6b BDSG) Rechnung zu tragen, wurden durch Abkleben der Linse unscharfe Bilder angefertigt. Mit dem Verfahren konnten Aktivitäten wie z.B. Radfahren, Wandern, Joggen, Nordic Walking, Reiten, Hund ausführen, und Merkmale wie Besuch des Waldes allein, zu zweit oder in der Gruppe, Aufmerksamkeit, sowie Altersstufen von Kindern erhoben werden. Ereignisse wurden mittels des Programms XnViewMP auf einem Bild einer aufgenommenen Bilderserie attribuiert, die im Statistikprogramm „ “ analysiert wurden. Das Verfahren zeigte gute Ergebnisse mit einer Neigung zur Unterzählung z.B. bei sehr breiten Wegen oder schnellen Bewegungen. Als erstes Fazit lässt sich festhalten, dass eine Vollauswertung extrem zeitaufwändig ist. Über ausgewertete Tage konnten jedoch Faktoren ermittelt werden, die mit hoher Signifikanz über die Auslösezahl auf die Gesamtzahl von Besucherbewegungen über Tages-, Wochen- und Monatsverläufe schließen lassen. Aus den erhobenen Daten können gezielt interessante Tage für eine Vollauswertung ausgewählt werden. Dies bietet einen großen Vorteil im Vergleich zu Verfahren, die auf Personal vor Ort angewiesen sind. Auch können gezielt z.B. Tage mit Maximalnutzung zur Dimensionierung bei der Planung von Erholungseinrichtungen bzw. konfliktminierten Durchführung forstbetrieblicher Maßnahmen ausgewertet werden.
Poster Session 15: Wald als Restholzspeicher für die Bioökonomie 276
Der Beitrag des Kleinprivatwaldes zur regionalen Wertschöpfung durch die Energieholznutzung
Marie Sophie Schmidt1, Rainer Luick1
1Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Schadenweilerhof, 72108 Rottenburg, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Regionale Wertschöpfung, Waldenergieholz, Kleinprivatwald, Wertschöpfungskette
Feste Biomasse – insbesondere (Wald-)Holz – leistet mit 73,5 % bislang den größten Anteil der Erneuerbaren Energien an der Wärmeerzeugung in Deutschland (Jahr 2014 1 ). Mit steigendem Energieholzverbrauch wächst auch die Konkurrenz mit der stofflichen Holzverwertung. Ein Kriterium bei der Entscheidung zwischen verschiedenen Verwendungen kann die (regionale) Wertschöpfung sein. Gerade beim Ausbau der erneuerbaren Energien sieht die Politik Chancen für ländliche Räume. Gleichzeitig ist aber auch ein Globalisierungstrend erkennbar, der sich durch wachsende Energieholzimporte bemerkbar macht. Das laufende Forschungsvorhaben „Kleinprivatwald – Energieholzversorgung und regionale ertschöpfung (KLEN)“ untersucht in drei Modellregionen Baden-Württembergs, welchen Beitrag der kleine und mittlere Privatwald (<200ha) durch die Energieholznutzung zur regionalen Wertschöpfung leistet. Im Fokus des Projektes stehen insbesondere Indikatoren ökonomischer Effekte, die jedoch neben sozialen und ökologischen Aspekten nur einen Teil des Entscheidungskriteriums „regionale ertschöpfung“ abbilden können. Ein wichtiger Indikator sind mögliche Einsparungseffekte von Waldbesitzern durch Selbstversorgung mit Energieholz gegenüber dem Einsatz fossiler Referenzsysteme, die innerhalb einer Kostenvergleichsrechnung ermittelt werden. Multiplikatorwirkungen, die durch die erhöhte Kaufkraft hervorgerufen werden, steigern die regionale Wertschöpfung. Ferner können Einkommen, Unternehmergewinne, Steuern und Fremdkapitalzinsen durch Eigen-/ Fremdvermarktung, Dienstleistungen und Investitionen erzielt werden. Zum Nachweis dieser Effekte wird die Nettowertschöpfung innerhalb einer Entstehungsrechnung ermittelt. Anschließend wird untersucht, in welchem Umfang beteiligte Akteure, d. h. Waldbesitzer, ggf. Händler, ggf. Mitarbeiter, Fremdkapitalgeber und Staat, von der Wertschöpfung profitieren sowie welcher Anteil davon in der Region verbleibt (Verteilungsrechnung). Die Effekte sollen für typische Wertschöpfungsketten der Energieholznutzung im kleinen und mittleren Privatwald ausgewiesen werden. Datengrundlage sind schriftliche und mündliche Befragungen von Waldbesitzern zur Charakterisierung der Wertschöpfungsketten sowie zu Kosten und ggf. Erlösen der Energieholznutzung. Innerhalb einer Sensitivitätsanalyse sollen wichtige Einflussfaktoren auf die Wertschöpfung und ihre Verteilung identifiziert werden, auf deren Basis Handlungsempfehlungen entwickelt werden.
1 Quelle: BMWi, AGEE-Stat, 10/2015.
Poster Session 15: Wald als Restholzspeicher für die Bioökonomie
277
Ökonomische Betrachtung der durch sekundäre Aufbereitungsmaßnahmen zu erreichenden Qualitätsverbesserung von
Hackschnitzeln aus Waldrestholz
Kathrin Schreiber1, Daniel Kuptz2, Fabian Schulmeyer1, Hans Hartmann2, Herbert Borchert1
1Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising [email protected], [email protected], [email protected] 2Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe, Schulgasse 18, 94315 Straubing, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Holzhackschnitzel, technische Trocknung, Siebung, Rentabilität
Waldrestholz wird in Bayern zur thermischen Verwendung eingesetzt und bildet das Hauptsortiment bei Waldhackschnitzeln. Um den hohen Anforderungen vieler kleiner und mittlerer Heizanlagen (< 1 MW thermischer Leistung) zu genügen, ist nach dem Hacken oft eine weitere Aufbereitung notwendig. Um gängige Aufbereitungsverfahren zu identifizieren, wurde eine bundesweite Online-Umfrage bei Hackschnitzelproduzenten, -aufbereitern und -händlern durchgeführt. Dabei wurden verwendete Verfahren und eingesetzte Maschinen abgefragt. Anhand der Ergebnisse wurden Fallstudien mit den wichtigsten Techniken der Aufbereitung (Trocknen, Sieben) ausgewählt. Die Fallstudien umfassen u. a. die Verwendung von Wälzbetttrocknern mit nachgestellten Rüttelsieben, Sternsieben, Trommelsieben, Bandtrocknern und die Containertrocknung. Zudem wurde in einer Fallstudie das Homogenisieren von trockenen und frischen Hackschnitzeln bewertet. Die Fallstudien wurden jeweils in zwei Teile aufgeteilt. Zum einen wurden Proben für Brennstoffanalysen und Verbrennungsversuche gewonnen. Dabei wurden u. a. der Wassergehalt, der Aschegehalt und der Feinanteil ermittelt. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass mit den gängigen Verfahren die Qualität des Endproduktes soweit verbessert werden kann, dass es für die Verwendung in kleinen und mittleren Anlagen gut geeignet ist. Zum anderen wurden zur ökonomischen Betrachtung der sekundären Aufbereitungsmaßnahmen Zeitstudien durchgeführt. Neben dem Energieverbrauch wurden auch die Mengen der anfallenden Produkte während des Aufbereitungsprozesses ermittelt. Unter Berücksichtigung der Ausbeute und des zeitlichen und technischen Aufwands für den jeweiligen Aufbereitungsschritt wurden die Aufbereitungskosten bezogen auf das Zielsortiment errechnet. Die alternativen Aufbereitungspfade werden nach Kosten und Grad der Qualitätsverbesserung bewertet.
Poster Session 15: Wald als Restholzspeicher für die Bioökonomie 278
Qualitätssicherung bei der Hackschnitzelproduktion
Volker Zelinski1, Finn Ahrens1, Achim Loewen1
1HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Büsgenweg 1 a, 37077 Göttingen, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Holzhackschnitzel, DIN EN ISO 17225-4, Brennstoffqualität, Eigenüberwachung
Um bei dem Betrieb von Holzhackschnitzelkesseln die aktuellen Vorgaben der 1. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (1. BImSchV) einzuhalten, bedarf es eines Brennstoffes mit optimierten Eigenschaften, insbesondere bei Kleinanlagen ohne nachgeschaltete Filtereinrichtungen. Als Konsequenz machen viele Hersteller solcher Anlagen genaue Vorgaben bezüglich der Brennstoffqualität, z. B. dass Holzhackschnitzel (HHS) der Klasse A1 gemäß DIN EN ISO 17225-4 einzusetzen sind. Die Definition solcher HHS-Qualitäten, die zugehörige Qualitätssicherung in der Produktion, wie auch die Nachweisbarkeit im HHS-Handel sind bestimmende Faktoren, wenn der potentielle Beitrag des Brennstoffs zur Emissionsminderung nutzbar gemacht werden soll. Die Charakterisierung von HHS wird derzeit gemäß DIN EN 17225-4 vorgenommen, wobei die entsprechenden Analysen relativ zeit- und arbeitsintensiv sind. Als Ergänzung wurde an der HAWK eine vereinfachte Systematik zur Qualitätssicherung entwickelt, die sich an die Vorgaben der Norm anlehnt, wobei der Fokus dieser Prüfsystematik auf den Parametern Wassergehalt und Korngrößenverteilung liegt. Beide Faktoren beeinflussen nachweislich die Staub- bzw. CO-Emissionen einer Hackschnitzelheizung. Diese vereinfachte Analytik ist vorrangig für Eigenversorger oder auch zur internen Prozessüberwachung in der HHS-Bereitstellung konzipiert, um auch für diese Bereiche eine praxistaugliche Möglichkeit zu schaffen, mit angemessenem Aufwand eine gleichbleibende Qualität des Brennstoffes gewährleisten zu können. Das entwickelte System wurde in mehreren Fallstudien an verschiedenen Bereitstellungsketten bzw. Aufbereitungsverfahren angewandt und mit Hilfe parallel durchgeführter Analytik gemäß DIN EN ISO 17225-4 validiert. Damit wurde zum einen seine Leistungsfähigkeit nachgewiesen und zum anderen auch die Korrelation zu den Verfahren nach Norm dokumentiert. Anhand der Ergebnisse der beschriebenen Qualitätsanalyse können notwendige Maßnahmen zur Qualitätssteigerung in der Hackschnitzelerzeugung und -bereitstellung abgeleitet werden. Je nach Art der Bereitstellungskette kann das die Wahl des Ausgangsmaterials sowie die Anpassung der verschiedenen Schritte in der Bereitstellung beeinflussen.
Poster Session 15: Wald als Restholzspeicher für die Bioökonomie
279
Emissionsreduktion durch den Einsatz unterschiedlicher Hackschnitzelqualitäten in Kleinfeuerungsanlagen
Daniel Kuptz1, Robert Mack1, Elisabeth Rist1, Hans Hartmann1
1Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe, Schulgasse 18, 94315 Straubing, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Hackschnitzel, DIN EN ISO 17225-4, Brennstoffqualität, Feinstaubemission, Kohlenmonoxid
Der Erfolg von Qualitätsvorgaben im Rahmen eines Brennstoffzertifizierungsprogramms oder von qualitätssteigernden Maßnahmen bei der Brennstoffproduktion kann nur durch systematische Feuerungsversuche in geeigneten typischen Hackschnitzelkesseln festgestellt werden. Am Technologie- und Förderzentrum erfolgte daher eine Validierung der durch die Qualitätsvorgaben gängiger Brennstoffnormen (DIN EN ISO 17225-4) sowie zukünftiger Zertifikate (ENplus-Hackschnitzel) getroffenen Festlegungen in realen Hackschnitzel-feuerungen. Hierbei werden zusätzlich die Effekte einzelner Aufbereitungsschritte bei der Hackschnitzelproduktion am Betriebshof, z. B. die Siebung oder die Trocknung auf einen definierten Zielwassergehalt in die Versuchsreihen integriert. In insgesamt mehr als 30 Feuerungsversuchen an zwei Hackschnitzelkesseln < 100 kW thermischer Leistung wurden Hackschnitzel unterschiedlicher Aufbereitungsstufen und aus unterschiedlichen Rohmaterialien getestet. Neben der Analyse der physikalischen und inhaltstofflichen Brennstoffqualität (z. B. der Wassergehalt und der Gehalt an aerosolbildenen Elementen) erfolgte die systematische Erfassung kritischer Emissionen, z. B. der Werte an CO und Gesamtstaub. Die Ergebnisse werden mit den aktuellen Grenzwerten der 2. Stufe der 1. BImSchV verglichen und bewertet. Sie ermöglichen eine Einschätzung über die not-wendige Qualität der Holzhackschnitzel, die in Kleinfeuerungsanlagen auch zukünftig noch ohne sekundäre Staubminderungsmaßnahmen, z.B. ohne Elektrofilter, eingesetzt werden kann.
Poster Session 15: Wald als Restholzspeicher für die Bioökonomie 280
Feldversuche zur Lagerung von Holzhackschnitzeln unter Praxisbedingungen
Nicolas Hofmann1, Theresa Mendel2, Fabian Schulmeyer1, Daniel Kuptz2, Herbert Borchert1 und Hans Hartmann2
1Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected]; [email protected]; [email protected] 2Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe, Schulgasse 18, 94315 Straubing, [email protected]; [email protected]; [email protected]
Schlagworte: Holzhackschnitzel, Lagerung, Substanzverluste, Brennstoffqualität
In Freilandversuchen wurde die Lagerung von Fichtenhackschnitzeln (HS) aus Waldrestholz (Kronenmaterial) und aus Energierundholz (grob entastete Stammabschnitte) je mit und ohne Regenschutz (Vlies) untersucht. Die Versuche dauerten jeweils 5 Monate und wurden im Winter und im Sommer durchgeführt. Die Probenahme erfolgte mit Bilanzbeuteln, die beim Aufbau des Versuchs innerhalb der HS-Schüttungen rasterförmig angeordnet und im Verlauf der Lagerung herausgezogen wurden. Dadurch wurden sowohl eine zeitliche als auch eine räumliche Auflösung sowie Messwiederholungen ermöglicht. Insgesamt wurden über 1.000 Beutel analysiert. Über den Schüttungsquerschnitt verteilt wurden an jeweils 15 Positionen Temperaturmessungen vorgenommen, um den Einfluss der Temperatur auf Substanzverluste und Qualitätsänderungen zu prüfen. Zusätzlich zur HS-Lagerung wurden beide Sortimente ungehackt in Poltern ohne Regenschutz gelagert. Die bisherigen Auswertungen zeigen, dass eine natürliche Trocknung von HS über den Winter nur bedingt, über den Sommer hingegen gut möglich ist. Das Vlies kann die Trocknung zusätzlich fördern. Die Substanzverluste waren im Sommer höher als im Winter. Der insgesamt höchste Verlust wurde bei den Waldrestholz-HS mit ca. 11,1 m.-% im Sommer gemessen. Die Energierundholz-HS zeigten eine geringere Zersetzung, die jedoch im Sommer nahezu doppelt so hoch war wie im Winter. Grund hierfür könnte die nur schwache Eigenerwärmung sein, welche über den Winter in weiten Teilen dieser Schüttungen keinen optimalen Temperaturbereich für Mikroorganismen zuließ. Das Vlies hatte im Winter keinen deutlichen Einfluss auf den Substanzabbau. Im Sommer hingegen verursachte es bei den Waldrestholz-HS eine stärkere Zersetzung. Die ungehackte Lagerung bewirkte einen geringeren Substanzabbau bei beiden Sortimenten und führte nur im Sommer zu einer Wassergehaltsänderung. Das Rundholz trocknete dabei stärker als alle anderen untersuchten Varianten auf ca. 24 m.-% Wassergehalt. Beim Waldrestholz war die Masse der zusätzlich abrieselnden Biomasse im Winter jedoch so groß, dass der Gesamtsubstanzverlust an den der Lagerung in Form von HS heranreichte. Aschegehalt und Schüttdichte veränderten sich bei den HS im Winter nicht. Der Verlust an nutzbarer Energie war mit ca. 12 % bei offen gelagerten Waldrestholz-HS im Winter am größten. Für den Sommer werden die Daten hierzu noch ausgewertet. Eine gewisse Kompensation des Energieverlusts infolge des Substanzabbaus wird durch die Trocknung erwartet.
Poster Session 15: Wald als Restholzspeicher für die Bioökonomie
281
Behälterversuche zur Lagerung von Hackschnitzeln
Theresa Mendel1, Daniel Kuptz1 und Hans Hartmann1
1Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe (TFZ), Schulgasse 18, 94315 Straubing, [email protected]; [email protected]; [email protected]
Schlagworte: Holzhackschnitzel, Lagerung, Substanzverluste, Siebung
Bei der Lagerung von frischen Hackschnitzeln treten oft hohe Substanzverluste auf. Besonders ein hoher Anteil an feinem Material, v. a. Nadeln und Blätter, kann den Stoffabbau verstärken, weil er eine hohe Oberfläche und einen großen Anteil an leicht löslichen Nährstoffen bietet. Ziel der Versuche am Technologie- und Förderzentrum war es daher, den Einfluss der Siebung auf Trocknungseffekte und Substanzverluste festzustellen. Hierfür wurden in 0,6 m³ fassenden Behältern fünf unterschiedliche Hackschnitzelsortimente (Waldrestholz aus Laub- und Nadelholz, Energierundholz aus Buche und Fichte sowie Pappelholz aus Kurzumtrieb) eingelagert, jeweils mit den Varianten gesiebt (Partikel > 8 mm Durchmesser) und ungesiebt. Die Lagerung fand in einer regen- und windgeschützten Überdachung statt. Der Lagerort, Einlagerungszeitpunkt und die Lagerdauer (23 Wochen) waren für jedes Sortiment und jede Variante identisch. In den Behältern wurden Temperatursensoren eingebaut, welche die Temperaturentwicklung der Hackschnitzel während des Lagerzeitraums aufzeichneten. Zusätzlich wurden die Außentemperatur und die relative Luftfeuchte erfasst. Zur Überprüfung der Gewichtsänderung wurden die Behälter alle zwei Wochen gewogen. Die Substanzverluste bei den ungesiebten Sortimenten lagen nach der Lagerung zwischen 4,2 und 21,7 m.-%. Je höher der Wassergehalt bei der Einlagerung der Hackschnitzel war, desto höher waren auch die Substanzverluste, da sich die Hackschnitzel über einen längeren Zeitraum im optimalen Wassergehaltsbereich für das Wachstum von Mikroorganismen befanden. Die gesiebten Varianten wiesen durchschnittlich 4,1 m.-% geringere Substanzverluste im Vergleich zur ungesiebten Variante auf. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass bei sinkendem Feinanteil (d. h. Partikel < 3,15 mm Durchmesser) auch der Temperaturanstieg in den Behältern geringer ist und auch die Substanzverluste sinken. Auch in Bezug auf die Trocknung erzielten die gesiebten Varianten bessere Ergebnisse. Der insgesamt gute Trocknungserfolg ist jedoch auch auf die optimalen Klimabedingungen in den Sommermonaten zurückzuführen. Die Ergebnisse der ungesiebten Waldrestholz- und Energierundholzhackschnitzel bewegen sich bei den Behälterversuchen auf einem ähnlichen Niveau wie bei den Freilandversuchen. Deshalb wird eine gute Übertragbarkeit der Ergebnisse aus derartigen Behälterversuchen auf praxisnahe Lagerungsbedingungen erwartet.
Poster Session 15: Wald als Restholzspeicher für die Bioökonomie 282
Qualitätssicherung bei der Hackschnitzelproduktion – Schnellbestimmung des Wassergehaltes
Theresa Mendel1, Andreas Überreiter1, Daniel Kuptz1 und Hans Hartmann1
1Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe, Schulgasse 18, 94315 Straubing, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Hackschnitzel, DIN ISO 17225-4, Wassergehalt, Schnellbestimmungs-verfahren
Der Wassergehalt ist der wichtigste Brennstoffparameter von Holzhackschnitzeln. Er beeinflusst den Heizwert, das Verbrennungsverhalten und die Lagerfähigkeit des Brennstoffes. Eine genaue und sofortige Wassergehaltsbestimmung ist an vielen Schnittstellen während der Produktion notwendig, z. B. für die interne Qualitätssicherung sowie für Abrechnungszwecke. Das Standardmessverfahren zur Bestimmung des Wassergehalts durch die Ofentrocknung nach DIN EN 14774-2 ist jedoch sehr zeit- und arbeitsintensiv. Des Weiteren erfordert die Heterogenität von Hackschnitzeln für eine repräsentative Bewertung häufig eine große Anzahl an Einzelproben. Neu entwickelte gravimetrische und elektrische Messverfahren könnten hier eine schnelle und akkurate Alternative für die Wassergehaltsbestimmung darstellen. Für die Überprüfung der Messgenauigkeit dieser Verfahren wurden neun Messgeräte überprüft. Diese umfassten zwei Infrarot-Trockner, fünf dielektrische Verfahren, ein Leitfähigkeitsverfahren und ein TDR (time domain reflectometry)-Verfahren. Für die Versuche kamen fünf Hackschnitzel-sortimente (Waldrestholz aus Nadel- und Laubbäumen, Energierundholz aus Buche und Fichte sowie Hackschnitzel aus dem Kurzumtrieb) mit jeweils fünf Wassergehaltsstufen (frisch, 35 m-%, 25 m-%, 15 m-% und 10 m-%) zum Einsatz. Die mittlere Abweichung der Geräte vom Referenzwert lag zwischen 0,12 m-% (± 3,53 m-%) und 3,96 m-% (± 4,70 m-%). Beste Resultate lieferten dabei die beiden Infrarottrockner, wobei für die Bestimmungen jedoch nur kleine Probenmengen (5–35 g) verwendet werden kann. Da Hackschnitzel i. d. R. einen sehr heterogenen Brennstoff darstellen, könnten weniger akkurate Messverfahren, die jedoch eine größere Probenmenge einschließen, die Messgenauigkeit erhöhen. Die hohe Genauigkeit der Ofentrocknung konnte von keinem der Geräte erreicht werden. Nichts destotrotz können einige der Geräte für ausgewählte Zwecke, wie z. B. für eine interne Qualitätssicherung, empfohlen werden
Poster Session 16: KUP und AFS als zusätzliche Quelle von Holzressourcen...
283
Energieholzpotentiale besser nutzen mit KUP-Scout
Elke Dietz1, Ute Bachmann-Gigl, Nele Sutterer, Frank Burger1
1Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft; Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising; [email protected]
Schlagworte: Pappel-Ertragspotentialkarten, www.kupscout-bayern.de
Einleitung. In Bayern soll vor allem zur Unterstützung der Energiewende der Anbau von schnell wachsenden Baumarten (KUP) vorangebracht werden. Bisher zögern viele Landwirte noch. Ein Grund hierfür könnte unter anderem sein, dass die Flächenauswahl schwierig war, da der zu erwartende Ertrag bisher schlecht abschätzbar war. Als Beratungsinstrument schafft KUP-Scout u.a. in Form einer Ertragspotentialkarte für Pappel- KUP hier Abhilfe. Material und Methoden. Im Rahmen des Projekts KUP-Scout wurden 4 Pappel-KUP-Ertragsmodelle (Murach et al. 2008, Ali 2009, Aust 2012, Amthauer Gallardo 2014) sowie ein eigener Modellansatz bezüglich ihrer Anwendbarkeit auf Bayern getestet. Hierzu wurden die modellierten Erträge mit tatsächlichen Erträgen bayerischer KUP-Versuchsflächen verglichen. Durch umfangreiche Analysen konnten einerseits die Gültigkeitsbereiche der Modelle eingeschränkt und so ihre Übertragbarkeit auf Bayern eingeschätzt werden. Andererseits konnte der vielversprechendste Ansatz für ein an die bayerischen Verhältnisse angepasstes Modell identifiziert werden. Dieser diente als Basis für eine schrittweise Anpassung und Optimierung der Ertragsschätzung für bayerische Standortverhältnisse. Ergebnis. Die daraus entwickelte digitale Ertragskarte für Pappel-KUP in Bayern wird auf verschiedene Zielgruppen zugeschnitten in entsprechend angepasster Detailschärfe in unterschiedlichen Medien zur Verfügung gestellt. Aggregierte Informationen stehen online in Form von Übersichtskarten und Datentabellen (www.kupscout-bayern.de) für die bayerischen Landkreise und Gemeinden mit ergänzenden Informationen zu Schutzgebieten und zur regionalen Eignung für Kurzumtrieb zur Verfügung. Flurstückscharfe Informationen dagegen sind in die behördeninternen Informationssysteme der Land- und Forstwirtschaftsverwaltung (BayWIS und iBalis) in Form einer digitalen Potentialkarte eingebunden. Das dort abrufbare Themenpaket „KUP-Ertragspotential“ ist auf die Beratung zu KUP zugeschnitten. So können Zielkonflikte z.B. mit Naturschutzgebieten erkannt und vermieden oder Flächen mit geringem Potential zur Nahrungsmittelproduktion aber gutem KUP-Ertrag identifiziert werden
Poster Session 16: KUP und AFS als zusätzliche Quelle von Holzressourcen... 284
Untersuchungen zum Toleranzverhalten neu gezüchteter Leistungsträger von Schwarz- und Balsampappeln gegenüber
Melampsora larici-populina
Christina Fey-Wagner1, Christoph Stiehm1 und Alwin Janßen1
1Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt; Professor-Oelkers-Strasse 6, 34346 Hann. Münden; [email protected]
Schlagworte: KUP, Pappel, Züchtung, Pappelblattrost
Im Verbundvorhaben „Züchtung schnellwachsender Baumarten für die Produktion nachwachsender ohstoffe im Kurzumtrieb (Fast OOD)“ werden neue Schwarz- und Balsampappelklone, Aspen und Weidenklone über kontrollierte Kreuzungen gezüchtet. Die Neuzüchtungen werden in mehreren Schritten auf ihre Biomasseleistung und die Blattrosttoleranz sowie weitere für die Leistungsfähigkeit wichtige Parameter selektiert und ihre Eignung zum Anbau auf Kurzumtriebsplantagen (KUP) über mehrere Umtriebszeiten überprüft.
Das zurzeit auf Kurzumtriebsplantagen angebaute Pappelmaterial basiert auf nur wenigen Klonen mit einer geringen genetischen Diversität. Pflanzenpathogene können sich innerhalb weniger Jahre an die vorherrschenden Genotypen ihrer Wirte sehr gut anpassen. So zeigen sich genetisch bedingte Krankheitsanfälligkeiten und mangelnde Anpassungsfähigkeit der auf KUP verwendeten Pappelklone sehr deutlich und über die gesamten Plantagen hinweg. Demzufolge gewinnen Pflanzenpathogene wie der Pappelblattrost (Melampsora larici-populina) als Faktor für die Gefährdung der Betriebssicherheit von KUP in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung.
Das an der NW-FVA ansässige Teilprojekt 1 des FastWOOD-Verbundvorhabens prüft durch ein engmaschiges Netz verschiedenster Selektionsschritte die Eignung, Leistungsfähigkeit und Resistenzeigenschaften der Neuzüchtungen im Anbau auf Kurzumtriebsplantagen in Mini- und Midirotationszeiten. Dabei werden die zunächst ausgewählten Klone auf Prüffeldern verteilt über ganz Deutschland den unterschiedlichsten Standorteigenschaften und Klimabedingungen sowie den an den jeweiligen Standorten vorkommenden Pflanzenpathogen ausgesetzt.
Unsere Untersuchungen, die auf annuellen Bonituren aller in FastWOOD seit 2010 angelegten Schwarz- und Balsampappel-Versuchsflächen basieren, lassen erste Erkenntnisse über das Resistenzverhalten der getesteten Leistungsträger zu. Ein Vergleich des Blattrostbefalls mit der während der ersten Rotationsphase erbrachten Massenleistung zeigt eine deutliche Korrelation dieser beiden Indices. Zu der Komplexität und Intensität von Faktoren wie Klimabedingungen oder Standortgegebenheiten sowie sektions-, art- und sogar klonabhängigem Toleranzverhalten gibt es durch die bisher getesteten Klone nur initiale Informationen. Weitere Hinweise über die Tendenz der Korrelation zwischen Massenleistung und Blattrosttoleranz werden hier mit den Ergebnissen der Untersuchungen während der zweiten Rotationsphase dargestellt.
Poster Session 16: KUP und AFS als zusätzliche Quelle von Holzressourcen...
285
Pappel-Kurzumtriebsplantage auf leichten Böden im Oberrheingraben – Ergebnisse der ersten Umtriebsphase
Martin Armbruster1, Hubert Fischer2 und Franz Wiesler 1
1LUFA Speyer, Obere Langgasse 40, 67346 Speyer, [email protected] 2Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF), Hauptstraße 16, 67705 Trippstadt, [email protected]
Schlagworte: Pappel-Kurzumtriebsplantage, Erträge, Stoffhaushalt
Die LUFA Speyer und die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) Trippstadt führen seit 2009 ein langfristig angelegtes Kooperationsprojekt durch, in dem Ertragsleistung und ökologische Auswirkungen des Anbaus vom Pappeln im Kurzumtrieb auf landwirtschaftlichen Grenzstandorten untersucht werden. Die Kurzumtriebsplantage (KUP) wurde im April 2009 auf dem Versuchsfeld „ inkenbergerhof“ der LUFA Speyer mit zwei Pappelsorten („Androscoggin“, „Muhle-Larsen“) als Stecklingspflanzung (2 m Reihen-abstand und 0,8 m Abstand in der Reihe) in Handsteckung angelegt. Dabei wurden jeweils 4 Reihen pro Sorte im Wechsel auf einer Fläche von ca. 0,56 ha angepflanzt. Als Bodentyp hat sich auf der Versuchsfläche aus Terrassensanden des Rheins und des Speyerbaches eine Parabraunerde-Braunerde mit einer Ackerzahl zwischen 25 und 35 entwickelt. Im langjährigen Mittel fallen knapp 600 mm Jahresniederschlag, die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt etwa 10,0 C. Der Versuchsstandort wird aufgrund der niedrigen Ackerzahl, der vor allem im Unterboden geringen nutzbaren Feldkapazität, vergleichsweise niedrigen Jahresniederschlägen sowie häufigen Trockenperioden während der Vegetationszeit nach bisherigen Erkenntnissen nur als bedingt geeignet für die Anlage einer KUP angesehen. Der mittlere jährliche Gesamtzuwachs (dGZ) für die erste Rotation (6 Jahre nach Pflanzung) ist mit 8,2 t Trockenmasse pro Hektar und Jahr als überdurchschnittlich eizuordnen. Vor allem für die Sorte Androscoggin wurde mit einem dGZ von fast 10 t Trockenmasse pro Hektar und Jahr ein sehr hoher Wert ermittelt. Die mittlere Nährstofffestlegung im Holz wies für beide Pappelsorten nur geringe Unterschiede auf und war vor allem bei Stickstoff und Phosphor im Vergleich zu anderen Untersuchungen erhöht. Unmittelbar nach der Anlage der Kurzumtriebsplantage traten vergleichsweise hohe Nitratkonzentrationen im Sickerwasser in 1 m Bodentiefe auf. Ab Mitte 2011 wurden nur noch sehr niedrige Konzentrationen gemessen. Nach Ernte des ersten Umtriebs im Jahr 2015 konnte bislang noch kein Anstieg der Nitratkonzentrationen im Sickerwasser gemessen werden. Der Anbau der Papeln führte neben einer lockereren Lagerung des obersten Mineralbodenkompartimentes im Boden zu einem Anstieg der Kohlenstoff- und Stickstoffgehalte in 0-10 cm Tiefe gegenüber dem Ausgangszustand. Für die Kohlenstoffvorräte in 0 bis 30 cm Bodentiefe konnte bislang noch keine Veränderung gegenüber dem Ausgangszustand ermittelt werden.
Poster Session 16: KUP und AFS als zusätzliche Quelle von Holzressourcen... 286
Erhöhung der ökologischen und ökonomischen Wertigkeit aufgelassener Weinberge durch die Aufforstung mit seltenen
Laubbaumarten
Jörg Kunz1 und Jürgen Bauhus1
1Professur für Waldbau, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tennenbacher Straße 4, 79106 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: seltene Baumarten, Aufforstung, aufgelassene Weinberge, Flächennutzung
Aufgrund des allgemeinen Strukturwandels in der Landwirtschaft sowie politischer Regulierungsmaßnahmen sind in den vergangenen zwanzig Jahren bundesweit viele Weinberge aus der wirtschaftlichen Nutzung genommen worden. Insbesondere entlang der Mosel wurden vor allem sehr steile und wenig lukrative Lagen in den Seitentälern aufgegeben und der natürlichen Sukzession überlassen. Solche aufgelassenen Weinberge werden innerhalb weniger Jahre von naturschutzfachlich wenig wertvollen Sträuchern wie Ginster und Brombeere, oder Pionierbaumarten wie Pappel, Weide, Robinie oder Kiefer flächig bewachsen. Zusätzlich sind solche Flächen ideale Einstände für Schwarz- und Rehwild und bieten verschiedenen Phytopathogenen zusätzliche Wirtspflanzen, wodurch weitreichende negative Auswirkungen auf weiterhin bewirtschaftete Reben möglich sind. Derzeit werden die Sukzessionsflächen zumeist periodisch gemulcht oder mit Nutztieren beweidet, was jedoch sehr arbeits- und kostenintensiv ist und die weitere Verbuschung der ehemaligen Rebflächen oft nur aufschiebt. Dies verdeutlicht den Bedarf an einem extensiven und langfristigen Managementkonzept, das sowohl eine wirtschaftliche Nutzung als auch eine Steigerung der ökologischen Wertigkeit aufgelassener Weinberge ermöglicht. Ein solches Konzept ist die Aufforstung der ehemaligen Reben mit seltenen Laubbaumarten der Gattungen Sorbus, Acer, Pyrus oder Malus. Diese Arten zählen zu den wertvollsten Holzarten Europas, liefern Früchte zur Herstellung von Obstbränden und sind aufgrund ihrer Seltenheit und Stellung innerhalb der Biozönose naturschutzfachlich überaus bedeutsam. Darüber hinaus erlaubt die gezielte Bepflanzung der früheren Weinberge eine im Vergleich zu Reben und Sukzessionsflächen erhöhte Speicherung von Kohlenstoff in Holz und Boden. Allerdings ist bei der Anlage solcher Aufforstungen mit seltenen Laubbaumarten mit Kosten von 10.000 bis 15.000 € pro Hektar zu rechnen, wodurch das Konzept für private inzer und kleineren Parzellen nur schwer realisierbar ist. Jedoch bietet die Umsetzung der Aufforstungen im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vor allem für Kommunen interessante Möglichkeiten, zumal dieses Managementkonzept als Alternative zu Flächenstilllegungen im Wald und der Landwirtschaft die Konkurrenz um Flächennutzungen in der Kulturlandschaft reduzieren kann. Hier stellen wir das Projekt vor und präsentieren erste Ergebnisse zum Anwuchs der verschiedenen Baumarten auf Versuchsflächen.
Poster Session 16: KUP und AFS als zusätzliche Quelle von Holzressourcen...
287
Der Bodenstickstoffkreislauf entlang der Übergangszone eines Agroforstsystems (alley cropping) von Baum zu Grünland in
Südniedersachsen
Marcus Schmidt1, Lin Chen1, Edzo Veldkamp1und Marife D. Corre1
1Büsgen-Institut – Ökopedologie der Tropen und Subtropen, Georg-August-Universität Göttingen, Büsgenweg 2, 37077 Göttingen, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Stickstoffumsätze, Stickstoffnutzungseffizienz, Stickstoffretentionseffizienz, Nachhaltigkeit
Die konventionelle Landwirtschaft weist hohe Produktivität auf, geht jedoch zu Lasten der Nachhaltigkeit, da hohe Mengen an Stickoxiden in die Atmosphäre und Stickstoff (N)-Verbindungen ins Grundwasser gelangen. Die Funktionsweise von Agroforstsystemen lehnt sich näher an natürliche Ökosysteme an und bietet daher möglicherweise eine nachhaltige Alternative bei gleicher oder ähnlicher Produktivität. Unsere Studie gliedert sich in das BMBF-Projekt BONARES-SIGNAL ein, welches sich mit nachhaltiger Landwirtschafts-intensivierung durch Agroforstsysteme beschäftigt. Eine Einschätzung der Nährstoffkreis-läufe und Nährstoffeffizienzen für N, Phosphor, Kalium, Kalzium und Magnesium bezüglich der Nachhaltigkeit findet dabei für insgesamt fünf Agroforstsysteme mit Grünland- und/oder Ackerstreifen in Nord- und Ostdeutschland statt. Ziel der hier vorgestellten Teilstudie ist es, den Boden-N-Kreislauf im konventionell bewirtschafteten Grünland und angrenzenden Grünlandsteifen im Agroforst (alley cropping) vergleichend zu charakterisieren, N-Nutzungs- und N-Retentionseffizienzen zu ermitteln und damit die Nachhaltigkeit des Agroforstsystems bezüglich des N-Kreislaufs zu bewerten. Hierbei erwarten wir eine erhöhte Effizienz in N-Nutzung und N-Retention in den Grünlandstreifen des Agroforstsystems verglichen mit dem konventionellen Grünland. Es wurden in einem alley cropping-System in Reiffenhausen / Südniedersachen Bodenproben sowohl innerhalb der Weide-Baumsteifen, als auch in 1 m und 4 m Entfernung von der Weide im Grünlandstreifen analysiert (jeweils vier Wiederholungen). Gemessen wurden Netto- und Brutto-N-Mineralisation, Brutto-Nitrifikation, N-Immobilisation sowie dissimilatorische Nitratreduktion zu Ammonium (DNRA) in 2015 und 2016 sowie die N2-Fixierung, N-Auswaschung und Grasproduktion in 2016. Die N-Nutzungseffizienz ist die Biomasseproduktion pro verfügbarem Nährstoff. Die N-Retentionseffizienz ergibt sich aus 1 minus Nährstoffauswaschung pro verfügbarem Nährstoff. Wir stellen auf dem Poster die Ergebnisse zum Boden-N-Kreislauf vor, integrieren erste Ergebnisse zur N-Auswaschung und Biomasseproduktion und treffen damit Aussagen zur N-Nutzungseffizienz, N-Retentionseffizienz und Nachhaltigkeit im Agroforst verglichen mit konventioneller Grünlandwirtschaft.
Poster Session 16: KUP und AFS als zusätzliche Quelle von Holzressourcen... 288
Biomassezuwachs in Kurzumtriebsplantagen – das Wachstum von Pappeln und Robinien in Rein- und Mischbeständen
Jessica Rebola Lichtenberg1, Christian Ammer1
1 Universität Göttingen, Burckhardt Institut, Abt. Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen, [email protected]
Schlagworte: Kurzumtriebsplantagen, Mischkulturen, Energieholz, Biomasse
Das Bedürfnis die Biomasseproduktion für die Bereitstellung von Energieholz aus Kurzumtriebsplantagen zu steigern, führt zu der Frage, ob die dazu geeigneten Baumarten in Rein- oder Mischbeständen angebaut werden sollten. Während Populus-Hybride schon lange für die Biomasseproduktion genutzt werden, ist die stickstofffixierende Robinia pseudoacacia eine weniger bekannte Baumart zur Gewinnung von Energieholz. Neben der Fähigkeit Stickstoff zu binden und geringen Ansprüchen an die Nährstoffausstattung der Böden, weist die Robinie eine ausgeprägte Trockenheitstoleranz auf. Mischanbauten aus Pappeln und Robinien könnten daher das Potenzial haben, durch Ressourcenkomplementarität die Erträge im Vergleich zu Reinbeständen zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen eines Verbundprojekts die intra- und interspezifischen Wechselbeziehungen der Baumarten in Rein- und Mischbeständen analysiert und deren Einfluss auf die Biomasseproduktion und Ressourcennutzung untersucht. Dazu wurden je 8 Pappelklone und 3 Robinien-Sorten an zwei Standorten in der Nähe von Göttingen angebaut. Insgesamt ergeben sich 24 Misch- und 11 Reinkulturen in jeweils 4 Wiederholungen pro Standort. Dort werden jährliche Aufnahmen der Stammdurchmesser, Baumhöhen und Kronenstrukturen durchgeführt. Die Biomasse wird anhand von regelmäßigen Ernten auf der Basis allometrischer Funktionen geschätzt. Zusätzliche Messungen betreffen den Stickstoffgehalt der Böden. Erste Ergebnisse zu Anwuchserfolg und Wachstumserfolg werden mitgeteilt.
Poster Session 16: KUP und AFS als zusätzliche Quelle von Holzressourcen...
289
Wuchspotenzial schnellwachsender Baumarten in verschiedenen Klimaregionen Europas
Max Lennart Petersen1, Cemal Visnjic2 und Achim Dohrenbusch1 1Abt. Waldbau und Waldökologie der gemäßigten. Zonen, Universität Göttingen, Büsgenweg 1, D-37077 Göttingen, [email protected] 2Faculty of forestry University Sarajevo Zagrebačka 20 71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina
Schlagworte: Wuchspotenzial, Schnellwachsende Baumarten, KUP
Biomasseproduktion durch den Anbau schnellwachsender Baumarten wird insbesondere nach dem Atomausstieg als aussichtsreiche Option zur Sicherstellung des Energiebedarfs in Deutschland angesehen. Doch obwohl mit der Novellierung des Bundeswaldgesetzes 2010 die Rahmenbedingungen für die Anlage von Kurzumtriebsplantagen auf landwirtschaftlichen Flächen deutlich verbessert wurden, bleibt bisher der erwartete Anstieg der Produktionsfläche aus. Das Bundesumweltministerium ging in seiner Leitstudie zum Ausbau Erneuerbarer Energien im Jahr 2008 davon aus, das bis 2020 in Deutschland Kurzumtriebsplantagen in einer Größenordnung um 450.000 Hektar anzustreben sind. Bis heute liegt die Fläche unter 5000 ha! Die Gründe dafür sind sicher vielschichtig. Ein wesentlicher dürfte sein, dass sich Flächeneigentümer unzureichend informiert fühlen über die möglichen Produktionspotenziale. Die vorliegende Arbeit hat deshalb zum Ziel, auf der Basis von Literaturstudien die Wuchsleistung verschiedener Gehölzarten und –sorten auf Kurzumtriebsplantagen in Europa zusammenzustellen und dabei den Biomassezuwachs in Abhängigkeit der standörtlichen Rahmenbedingungen (v.a. der klimatischen Merkmale) zu betrachten. Der Focus liegt dabei auf aktuell populären Arten und Sorten der Gattungen Populus, Salix, Robinia und Paulownia. Zentrales Ergebnis ist ein Koordinatensystem, bei dem die Produktionserwartung über mittlerem Jahresniederschlag und Jahresmitteltemperatur abgetragen ist. Die Arbeit wurde durchgeführt im Rahmen der EU COST Action „Eurocoppice“.
Poster Session 16: KUP und AFS als zusätzliche Quelle von Holzressourcen... 290
Grundwasserspende unter Pappel-Kurzumtriebsplantagen
Martina Zacios1, Lothar Zimmermann1 und Karl-Heinz Feger2
1LWF, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected], [email protected] 2TU Dresden, Pienner Str. 19, 01737 Tharandt, [email protected]
Schlagworte: KUP, Wasserhaushalt, Bestandesdynamik, Witterung
Eine Kurzumtriebsplantage (KUP) entwickelt sich bedeutend schneller als ein Waldbestand, da vorzugsweise Baumarten mit rasantem Jugendwachstum angebaut werden. An dem Untersuchungsstandort im Alpenvorland in Kaufering hat sich innerhalb von sieben Jahren aus einem bracheähnlichen Zustand mit 1 – 2 Meter hohen Pappeltrieben ein Niederwald mit beträchtlichen Baumhöhen von im Mittel 12 Metern nach der siebten Vegetationsperiode entwickelt. Entsprechend dynamisch verhält sich auch der Wasserhaushalt einer KUP. Dieser wird neben dem Bewirtschaftungsstadium auch von den unterschiedlichen Witterungsverhältnissen während eines Jahres beeinflusst. Mit Messdaten zu Pflanzenparametern sowie gemessenen hydrologischen Größen wurden mit einem so angepassten bodenhydrologischen Modell (LWF-BROOK90) die Wasserbilanzen der KUP sowie einer Vergleichsackerfläche für 4-5 Jahre berechnet. Für zwei Jahre konnte ein Variantenvergleich eines frisch geernteten Bestand und eines sechs- bzw. siebenjährigem Bestand durchgeführt werden. Der größte Unterschied zwischen den Landnutzungsformen liegt erwartungsgemäß im Was-serbedarf der beiden Kulturen. Die Grundwasserneubildung unter Acker liegt zwischen 277 mm im trockenen Jahr 2012 und 571 mm im kühlen, niederschlagsreichen Jahr 2013. Die GWN unter KUP schwankt im gleichen Zeitraum zwischen 113 mm (2012) und 373 bzw. 281 mm unter dem geernteten bzw. dem sechsjährigen Bestand. Dies entspricht einer Reduktion der Grundwasserneubildung um 160 mm im fünfjährigen Bestand (2012) bis 290 mm im sechsjährigen Bestand 2013. Die KUP-Bewirtschaftung bewirkt je nach Bestandesalter und jeweiligen Witterungsverhältnissen eine Reduktion der Grundwasserneubildung von 35 bis 60 % gegenüber einjährigen Ackerkulturen. Im Mittel werden dem Grundwasserkörper unter KUP rund 19 % des Jahresniederschlags weniger zur Verfügung gestellt. Da die Evapotranspiration mit dem Alter der Bäume zunimmt, kann über kürzere Umtriebszeiten von maximal 4 bis 5 Jahren diesem Effekt etwas entgegen gewirkt werden. Zwar haben KUP erst bei größeren Flächenanteilen messbare Auswirkungen auf den Wasser-haushalt eines Gebiets, vor einem großflächigen Anbau, besonders in Bereichen mit geringer Grundwasserneubildung sollten daher wasserwirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden. Andersherum betrachtet kann die größere Ausschöpfung des Bodenwasserspeichers durch die KUP-Bäume auch durchaus gewünschte Effekte bspw. beim Hochwasserrückhalt in der Fläche fördern.
Poster Session 16: KUP und AFS als zusätzliche Quelle von Holzressourcen...
291
Variabilität des Brennstoffcharakters von Pappelsorten
Matthias Meyer1, Kathrin Gebauer2, Björn Günther3, Alwin Janßen4, Doris Krabel1
1TU Dresden, Institut für Forstbotanik und Forstzoologie, AG für molekulare Gehölzphysiologie, PF 1117, 01735 Tharandt, [email protected], [email protected] 2 TU Dresden, Institut für Verfahrenstechnik und Umwelttechnik, Professur für Energieverfahrenstechnik, 01062 Dresden, [email protected] 3TU Dresden, Institut für Forstnutzung und Forsttechnik, Professur für Forstnutzung, PF 1117, 01735 Tharandt, [email protected] 4 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Abteilung Waldgenressourcen, Prof.-Oelkers-Str. 6, D-34346 Hannoversch Münden, [email protected]
Schlagworte: Populus, Energiedichte, Asche, FastWOOD
Kurzumtriebsplantagen (KUP) mit Pappeln und Weiden werden als Brennstoffquelle für regionale Wärme-Wertschöpfungsketten mindestens in einem relativ kleinen Anteil am gesamten Markt für die regenerative Wärmeversorgung mit Holz von Interesse bleiben. Ein deutlicher Anstieg des Bedarfes an Dendromasse aus KUP ist künftig nicht auszuschließen. Angestrebte Entwicklungen einer Bio-Economy hin zu künftig ausgefeilteren Wertschöpfungsketten, welche möglichst auch stoffliche Nutzungs-Zwischenschritte vor einer energetischen Nutzung von KUP-Dendromasse einbinden, würden nichts daran ändern, dass eine grundlegende Brennstoffcharakterisierung vonnöten sein wird, um technische Anlagen der Energiegewinnung, etwa aus KUP-Hackschnitzeln, konzipieren zu können. Insbesondere bei der Einführung bzw. Züchtung und Zulassung neuer Pappel-Sorten, könnte es zu leichten Veränderungen der Brennstoffeigenschaften der angebotenen Dendromasse kommen, da hierbei auch genetische Hintergründe der Sorten eine Rolle spielen. Der Beitrag befasst sich mit, technologisch betrachtet meist weniger interessanten, jedoch ökophysiologisch nicht unbedeutenden Sortenunterschieden hinsichtlich des Brennwertes Ho. Die massebezogene Energiedichte (= Brennwert, Ho), die volumenbezogene Energiedichte sowie relevante chemische Parameter (Asche, N, S, Cl) sind an neu zuzulassenden Sorten aus dem Verbundvorhaben FastWOOD (www.fastwood.org) untersucht worden. Gemessen an der mittleren Höhe der Brennwerte ist deren Variabilität, wie zu erwarten war, recht gering und für die Praxis nicht so bedeutend wie beispielsweise die Wassergehalte von angeliefertem Hackgut an Biomasse-Kraft-/-Wärmeanlagen. Dennoch ergaben sich sowohl für Pappelsorten, für Holz und Rinde, aber auch für den Standorteffekt beachtenswerte Unterschiede. Diese Sortenunterschiede im Gehalt der relevanten Elemente oder der Asche könnten für bestimmte Dendromasse-Sortimente hinsichtlich der Einhaltung der brennstofftechnischen Anforderungen an hochwertige Brennstoffe (z.B. Pellets), gemäß DIN- / ISO-Normen bzw. gemäß Zertifizierungssystemen, eine Rolle spielen.
Poster Session 18: Nachhaltiges Bauen mit Laubholz 292
Nachhaltigkeitsprofil von Brettschichtholz aus Buche
Laura Lautenschläger1, Alina Kasten1, Pia Schmid1, Thomas Gugler1
1Technische Universität München, Studienfakultät Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement, Freising, [email protected]
Schlagworte: Buchen-Brettschichtholz, Nachhaltigkeitsbewertung, Prozesskette, SWOT-Analyse
Laubholz wird in Zukunft durch Klimawandel und Waldumbau vermehrt als Holzressource zur Verfügung stehen. Durch die guten elastomechanischen und attraktiven Struktureigenschaften vieler Laubholzer bietet sich auch ein Einsatz für tragende Anwendungen an, so dass ganze Holzbausysteme aus Laubholz denkbar sind. Weil die Bearbeitungsprozesse für Laubholz gegenüber der Nadelholzbearbeitung angepasst werden müssen, kann dies auch Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsbewertung von zukünftigen Holzbausystemen haben. Mit diesem Beitrag möchten wir die Unterschiede zwischen der Herstellung von Brettschichtholz aus Buchenholz und Fichtenholz entlang der Prozesskette betrachten und in Bezug auf ihre Nachhaltigkeitswirkungen bewerten. Dabei werden vor allem die Bearbeitungsschritte Rundholztransport, Einschnitt, Trocknung, Sortierung und Verklebung berücksichtigt. Zudem werden die Unterschiede in den Bereichen Festigkeit, Materialeinsparung und Dauerhaftigkeit beleuchtet. Die genannten Punkte werden anhand eines Beispielträgers in Bezug auf die ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit bewertet. Die Stärken, Schwächen, Potenziale und Gefahren der Herstellung und der Verwendung von Brettschichtholz aus Buche werden abschließend in einer SWOT-Analyse dargestellt.
Poster Session 18: Nachhaltiges Bauen mit Laubholz
293
Beziehungen zwischen Rundholzeigenschaften und den mechanischen Eigenschaften von Brettschichtholz-Lamellen bei Buche (Fagus
sylvatica L.) und Esche (Fraxinus excelsior L.)
Lorenz Breinig1, Peter Linsenmann2, Franka Brüchert1 und Udo Hans Sauter1
1FVA Baden-Württemberg, Wonnhaldestr. 4, 79100 Freiburg, [email protected], [email protected], [email protected] 2Holzforschung Austria, Franz-Grill-Str. 7, 1030 Wien, Österreich, [email protected]
Schlagworte: Laubholzverwendung, Brettschichtholz, Rundholzqualität, Festigkeit
Für eine breitere Anwendung von Holz im Bauwesen, die nicht zuletzt im Hinblick auf die Reduktion von Treibhausgasen wünschenswert ist, sind verklebte Holzwerkstoffe wie Brettschicht- und Brettsperrholz als leistungsfähige und standardisierte Bauteile von besonderer Bedeutung. Bei abnehmenden Nadelholzvorräten in Deutschland und der erwarteten Steigerung im Holzbau ist langfristig mit einer Lücke im Rohholzangebot für diese Produkte zu rechnen. Gleichzeitig sind die Vorräte der Laubhölzer, insbesondere der Buche (Fagus sylvatica L.), in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen. Gerade bei der Buche fehlt es aber nach wie vor an hochwertigen Verwendungen für die Massensortimente. Sowohl für die Buche als auch für die Esche (Fraxinus excelsior L.) wurden hohe Festigkeiten des Schnittholzes und damit prinzipiell hohe Tragfähigkeiten daraus gefertigter Bauteile nachgewiesen. Aufgrund der im Vergleich zu Nadelholz schwierigen Verarbeitbarkeit und der damit verbundenen hohen Herstellungskosten konnten sich Brettschicht- und Brettsperrholz aus diesen Holzarten aber bisher nicht durchsetzen. Hier stellt sich die Frage, ob durch eine bessere Vorsortierung des Rundholzes unter Nutzung zerstörungsfreier Prüfmethoden die Effizienz bei der Produktion von festigkeitssortierten Brettschichtholz-Lamellen aus Buche und Esche gesteigert werden könnte. Dazu wurden Rundholzabschnitte von Buchen und Eschen aus Südwestdeutschland untersucht. Bei 29 beziehungsweise 18 Stämmen wurden eine Rundholzsortierung nach RVR und EN 1316-1, eine Messung des dynamischen Elastizitätsmoduls (E-Moduls) sowie vollständige 3-D-Aufnahmen mit einem Röntgen-Computertomografen durchgeführt. Aus 16 Buchen- und 14 Eschen-Stammabschnitten wurden daraufhin Bretter als Ausgangsmaterial für Brettschichtholz-Lamellen erzeugt. An diesen wurde der E-Modul vor und nach technischer Trocknung und Hobelung gemessen sowie vor der abschließenden Prüfung der Zugfestigkeit eine visuelle Tragfähigkeitssortierung vorgenommen. Als ein erstes Ergebnis zeigte sich bei der Untersuchung, dass die Buchen-Stammabschnitte einerseits eine schlechtere Rundholzqualität aber andererseits deutlich höhere E-Modul-Werte als die Eschen-Stammabschnitte aufwiesen. Die E-Modul-Werte der einzelnen Bretter streuten in der ersten Messung bei den Buchen jedoch tendenziell stärker als bei den Eschen, insbesondere bei höherem E-Modul des Stammes.
Poster Session 19: Holz in der Bioökonomie – Old School oder Trendsetter? 294
Quantifizierung von Einflussfaktoren auf den Konsum von Produkten im Bauwesen
Dominik Jochem1, Niels Janzen1 und Holger Weimar1
1Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie, Leuschnerstraße 91, 21031 Hamburg, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Substitution, Preiselastizitäten, Holz im Bauwesen
Die ausreichende Verfügbarkeit von Holz für die unterschiedlichen Verwendungsbereiche ist eine wesentliche Voraussetzung für eine Ausrichtung hin zu einer biobasierten Wirtschaft. Auf der anderen Seite ist es jedoch ebenso erforderlich, Holzprodukte herzustellen und anzubieten, die konkurrenzfähig gegenüber Substituten aus anderen, nicht biobasierten Materialien sind. Das Bauwesen ist beispielsweise eine zentrale Branche, in der Holz eingesetzt wird. In Deutschland werden mehr als 50 % aller Holzhalbwaren in diesem Wirtschaftszweig verwendet. Die Kenntnis über die einflussnehmenden Faktoren auf den Konsum von Holzprodukten im Bauwesen ist daher von großer Bedeutung. Grundsätzlich wird die Substitution von Holz und anderen Materialien durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z. B. Umweltfaktoren, technologische Faktoren und ökonomische Faktoren. In diesem Beitrag nutzen wir auf Basis aktueller Literatur statistisch verfügbare ökonomische Faktoren zur Berechnung von Preis- und Kreuzpreiselastizitäten. Dabei wird differenziert nach den verschiedenen Baustoffen sowie nach Art der Nutzung der Gebäude. Ebenfalls wird untersucht, ob Preiseinflüsse bei Werkstoffen (z. B. Holz, Ziegel, Beton) und bei Bauprodukten (z. B. Fenster) feststellbar sind. Mit Hilfe standardisierter Schätzfunktionen (log-log) werden die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Konsum verschiedener Produkte des Bauwesens in Deutschland getestet. Erste Ergebnisse zeigen, dass sich die Einflussfaktoren im Wohn- und Nichtwohnbau unterscheiden. Dies deckt sich mit der aktuellen Literatur. Die weiteren Untersuchungen sollen die getesteten Faktoren hinsichtlich ihrer Auswirkungen quantifizieren. Die Ergebnisse sollen dazu dienen, Politik wie auch Marktteilnehmern weitergehende Informationen zu erwartbaren Marktreaktionen bezüglich der Verwendung von Holz im Bauwesen bereitzustellen.
Poster Session 19: Holz in der Bioökonomie – Old School oder Trendsetter?
295
Planning for unintended consequences in the pulp and paper sector: Good intentions aren’t enough
Genevieve Mortimer1, Timo Busch2 und Jörg Schweinle1
1Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics, [email protected] 2Universität Hamburg, Chair of Sustainability and Management, timo.busch@ wiso.uni-hamburg.de
Keywords: sustainability, environmental complexity, unintended consequences
In an emerging bioeconomy, sustainability issues will gain importance especially for companies in the forest and pulp and paper sector. One central challenge for businesses seeking to improve their corporate sustainability is the unpredictability of the external environment. On one hand, corporate sustainability encourages business to take bold, timely and ethical action to address society’s grand challenges. On the other, due to the complexity and unpredictability of our world, action brings with it a higher risk of unforeseen outcomes as a result of a company’s good intentions. Currently, in the sustainability management literature, there is no theory on how the likelihood of unintended consequences influences strategy development and business action. This research uses a multi-case study of multinational companies in the pulp and paper sector to investigate how the likelihood of unintended consequences caused by environmental complexity impacts business action on sustainability. Three data sources are being analyzed for this study: GRI reports (current and past reports), sustainability related information on company websites and interviews with sustainability leaders at each firm. Through the analysis we investigate the significance of unintended consequences for businesses implementing their sustainability strategy and the extent to which business leaders perceive and respond to unintended consequences in the pulp and paper sector. To do this we identify examples of sustainability initiatives, then dig deeper to understand in some detail the extent to which business decision-makers monitor the external world and tried to be sensitive to unintended impacts. We explore the awareness and perceptions of the decision-makers in dealing with surprises. We also seek to understand whether the likelihood of unforeseen impacts is perceived more as a driver for innovation and continual improvement or more as a risk leading to more caution when developing sustainability strategy. Early results indicate that there is general awareness and acknowledgement in the sector of unintended consequences. Generally concern about unintended consequences is more likely to impede corporate action on sustainability. Businesses are defensive about the possibility of unintended consequences resulting from their sustainability strategy and deploy risk management as the key response. Results also provide evidence that business leaders in the pulp and paper sector are pressured to ensure initiatives that are implemented according to plans. Many acknowledge that this is sometimes at the expense of implementing more far-reaching sustainability initiatives.
Poster Session 19: Holz in der Bioökonomie – Old School oder Trendsetter? 296
Überprüfung und Erweiterung des ökologischen Modells IPS („Infestation Pattern Simulation“) für die Beantwortung
waldschutzrelevanter Fragestellungen - eine Simulationsstudie
Bruno Pietzsch1, Uta Berger1, Lutz-Florian Otto2
1Technische Universität Dresden, Institut für Waldwachstum und Forstliche Informatik, Professur für forstliche Biometrie / Systemanalyse, Postfach 1117, 01737 Tharandt, [email protected], [email protected] 2Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft, Referat Waldbau/Waldschutz/Verwaltungsjagd, Staatsbetrieb Sachsenforst, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna /OT Graupa, [email protected]
Schlagworte: Ips typographus L., ökologische Modellierung, Waldschutz, Masterarbeit
Der Große Buchdrucker (Ips typographus L.) zählt aus ökologischer und ökonomischer Sicht zu den bedeutendsten Vertretern der rindenbrütenden Borkenkäferarten. Deshalb wurden zur Risikoabschätzung, zur Beobachtung des Schwarmverlaufs und zur Kalamitätsbekämpfung künstliche Vorrichtungen (nachfolgend Fallen genannt) wie die Pheromonfalle entwickelt. Den mittels Fallen erzielten Ergebnissen liegt stets die Problematik der Unkenntnis der Gesamtpopulation zugrunde, wodurch eine verlässliche Bewertung für die Erreichung der Ziele des Monitorings und der Bekämpfung fehlen. In der vorgestellten Abschlussarbeit wurde das 2013 veröffentlichte Modell IPS (Infestation Pattern Simulation; KAUTZ, 2013), welches sich mit der Ausbreitungsdynamik des Buchdruckers in Abhängigkeit der Baum- und Käfereigenschaften beschäftigt, erweitert. Dazu wurden Fallen, wie sie im Waldschutz verwendet werden, eingefügt. Ziel der Arbeit war neben der Modellüberprüfung die Implementation und die Untersuchung der sich im System abbildenden Zusammenhänge. Als potentielle Einflussfaktoren auf die Aussagefähigkeit des Monitorings sowie auf die Effekte der Bekämpfungsmaßnahmen wurden die Anordnung und Anzahl der Fallen sowie ihre Entfernung zu den Ausbreitungspunkten der Käfer untersucht. Darüber hinaus wurden die Eigenschaften der Käferpopulation und des Fichtenbestandes betrachtet. Für die Modellierung wurde die freie Software NetLogo verwendet, in der bereits das Ausgangsmodell entwickelt wurde. IPS basiert auf dem Konzept der individuenbasierten Modelle (IBM). Dieses besitzt den Vorteil, dass die Individuen im System spezifische Eigenschaften besitzen und situationsbedingte Entscheidungen treffen können. Dadurch können tatsächliche Systeme sehr gut abgebildet, untersucht und für die Ableitung von Zusammenhängen und Vorhersagen genutzt werden. Vor der Erweiterung des Modells fand eine statistische sowie fachliche / mechanistische Überprüfung statt, die der Qualitätssicherung beider Modellvarianten dient. Für die eigene Untersuchung wurden die implementierten Freiflächen und Fallen parametrisiert. Dabei wurde explizit auf die Einhaltung des IBM-Konzepts Wert gelegt, sodass jeder Käfer entscheidet, ob er unter den gegebenen Umständen eine Falle anfliegt. Im Ergebnis konnten Zusammenhänge zwischen den Fangzahlen und der Population sowie Einschätzungen der Änderung der Befallsintensität durch den Einsatz der Waldschutzsysteme abgeleitet und die Grundlage für weitere Untersuchungen geschaffen werden.
Poster Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung
297
Klimasensitive Optimierung der räumlichen Baumartenverteilung unter Berücksichtigung gesamtbetrieblicher Nebenbedingungen
Ronald Bialozyt1, Matthias Schmidt1, Jan-Hendrik Hansen1, Annekatrin Petereit1, Jürgen Nagel1, Hermann Spellmann1
1NW-FVA, Göttingen, [email protected]
Schlagworte: Baumartenwahl, Klimawandel, Standort-Leistung, Risiko-Modellierung
Wichtigster Aspekt der strategischen Waldbauplanung ist die Baumartenwahl. Für eine standortgemäße Baumartenwahl müssen die Leistung und wichtige abiotische und biotische Risiken berücksichtigt werden. Dabei werden sowohl die baumartenspezifische Leistung als auch verschiedene Risiken durch Boden- und Klimaparameter beeinflusst. Die Notwendigkeit die Baumartenwahl in Abhängigkeit von Standorteigenschaften zu optimieren wird dadurch verstärkt, dass sich klimatische Parameter unter den projizierten Klimaszenarien deutlich verändern werden. Zur klimasensitiven Abschätzung der Leistung und von Risiken werden in verschiedenen Teilprojekten des durch den Wald-Klima-Fond geförderten Projektes “DSS- iskMan“1 verallgemeinerte Regressionsmodelle entwickelt. Neben den Auswirkungen des Klimawandels müssen für eine optimale Baumartenwahl vor allem gesamtbetriebliche Vorgaben sowie naturschutzfachliche und ökonomische Leitplanken berücksichtigt werden. Für die konkrete Planung werden diese in Richtlinien aufgenommen und festgeschrieben. Allerdings weisen derartige statische Planungsgrundlagen den Nachteil auf, dass baumartenspezifische Wuchsleistung und Risiken nur indirekt über kategorische Standortstraten abgebildet werden. Dagegen ermöglicht der hier entwickelte Ansatz eine gesamtbetriebliche multikriterielle und klimasensitive Optimierung unter Verwendung der eigentlichen kausalen und stetigen Einflussgrößen. Als weiterer Vorteil fällt somit der durch die bisherige Kategorisierung in Standortstraten verursachte Informationsverlust weg. Die Optimierung ermöglicht neben der Identifikation einer optimalen Lösung weiterhin die Bewertung von Alternativszenarien. Die hierzu entwickelte Software verwendet metaheuristische Verfahren, in welchen die multikriterielle Zielfunktion die entsprechenden Randbedingungen abbildet. Die wichtigsten Parameter für die Auswahl stellen Wuchsleistung und Trockenstress sowie ausgewählte Risiken wie Sturmschadenswahrscheinlichkeiten dar. Diese werden über artspezifische Faktoren, welche als Parameter in den Optimierungsalgorithmus eingehen, so verändert, dass die Zielfunktion bzw. der multikriterielle Nutzen maximiert wird. Anschließend werden sukzessive Restriktionen in die Zielfunktion mit aufgenommen, um durch die Iteration des Verfahrens die Baumartenwahl immer genauer an die Randbedingungen anzupassen. Das Verfahren erlaubt es, Aussagen zur Wertigkeit der einzelnen Parameter abzuleiten und diese in späteren Szenarien entsprechend verändert einzusetzen. 1 FKZ: 28WB401501. .
Poster Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung 298
Die Erstellung einer aktuellen Vorkommenskarte für Fichte und Kiefer in Bayern auf der Basis von Fernerkundungsdaten
Rudolf Seitz1, Markus Immitzer² und Adelheid Wallner1
1Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft LWF, Abteilung Informationstechnologie, [email protected] 2Universität für Bodenkultur Wien; Institut für Vermessung, Fernerkundung und Landinformation IVFL
Schlagworte: Fichtenkarte, Fernerkundungsdaten, Upscaling, Klimarisikokarte
Die Fichte zählt in Bayern zu den am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffenen Baumarten. In mehreren Regionen (z.B. Mittelfranken) wird bereits ein deutlicher Rückgang ihrer Verbreitungsfläche beobachtet. Es fehlten jedoch verlässliche, flächendeckende Daten in mittlerer Auflösung (ha) über die Verbreitung dieser Baumart im staatlichen wie insbesondere auch im nicht-staatlichen Waldbesitz, die sowohl für die forstliche Beratung als auch als Grundlage für langfristige Monitoringverfahren dienen können. Ähnliches gilt für die Kiefer. Um der besonderen Gefährdung bzw. der Rolle von Fichte und Kiefer im Rahmen der Klimawandel-Diskussion gerecht zu werden, ist es notwendig, ihr tatsächliches Vorkommen im staatlichen und nicht-staatlichen Waldbesitz Bayerns mit ausreichender Genauigkeit festzustellen. Grundsätzlich lassen sich solche Informationen flächendeckend aus räumlich sehr hoch aufgelösten (VHR) Satellitendaten ableiten. Wegen der damit verbundenen Datenkosten und der benötigten Prozessierungskapazität scheiden solche Verfahren jedoch gewöhnlich aus. In einem Projekt wurde daher eine kostengünstige Alternative entwickelt, die sich ohne weiteres auch auf andere Baumarten anwenden lässt und ggf. regelmäßig wiederholen ließe. Die für die Kartierung verwendeten Satellitendaten zeichnen sich durch eine relativ hohe radiometrische Stabilität und teilweise hohe Wiederholungsfrequenz (bis zu täglich) aus. Die Kostenreduktion wird durch ein mehrstufiges Verfahren erreicht. In dem entwickelten Verfahren werden kommerzielle WorldView-2 (WV2) Daten lediglich zur ‚kleinflächigen‘ Eichung kostenfrei verfügbarer Satellitendaten in 30 m Auflösung verwendet. Damit wurde eine kostengünstige, bayernweite Kartierung der Verbreitung von Fichte und Kiefer durchgeführt. Die erstellten digitalen Karten haben eine räumliche Auflösung von 1 ha und geben die prozentualen Anteile von Fichte und Kiefer in jeder Zelle an. Die in der Vorstudie WV2-TreeIdent erarbeiteten Erfahrungen wurden dabei zielführend umgesetzt. Die Überprüfung der Ergebnisse mit verschiedensten Validierungsverfahren bescheinigt den erstellten Karten ausreichend gute Genauigkeit.
Poster Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung
299
Species-specific and generic biomass equations for seedlings and saplings of European tree species.
Peter Annighöfer1, Christian Ammer1, Martina Mund1
1Abteilung für Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen, Georg-August-Universität Göttingen, Büsgenweg 1, 37077 Göttingen, Deutschland, [email protected]
Schlagworte: Juvenile tree biomass, allometric equations, forest regeneration
Biomass equations are a helpful tool to estimate the tree and stand biomass production and standing stock. Such estimations are of great interest for science but also of great importance for global reports on the carbon cycle and the global climate system. Even though there are various collections and generic meta-analyses available with biomass equations for mature trees, reports on biomass equations for juvenile trees (seedlings and saplings) are mainly missing. Against the background of an increasing amount of reforestation and afforestation projects and forests in young successional stages, such equations are required. We have collected data from various studies on the aboveground woody biomass of 19 common tree species growing in Europe. The aim was to calculate species-specific biomass equations for the aboveground woody biomass of single trees in dependence of root-collar-diameter (RCD), height (H) and the combination of the two (RCD² H). Next to calculating species-specific biomass equations for the available species, we also calculated generic biomass equations for all broadleaved species and all conifer species. The biomass equations are a contribution to the pool of biomass equations, whereas the novelty is, that the equations were exclusively derived for young trees.
Poster Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung 300
Wie genau und objektiv sind alte Standortskarten?
Rainer Petzold1, Rainer Gemballa1 und Thorsten Behrens2
1Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft, Staatsbetrieb Sachsenforst, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna, [email protected] 2Soilution GbR, Heiligegeiststr. 13, 06484 Quedlinburg, [email protected]
Schlagworte: Standortserkundung, Altdaten, digital soil mapping
Forstliche Standortskarten stellen nach wie vor die Grundlage für die Waldbewirtschaftung dar. Solche Daten werden aber auch für die Beantwortung wissenschaftlicher Fragestellungen herangezogen. In der Regel wurde der Großteil von Standortsinformationen vor Jahrzehnten analog erfasst, später digitalisiert, teilweise entsprechend den forstwirtschaftlichen Rahmenbedingungen umgearbeitet und aktualisiert. Die Abgrenzungen von Kartiereinheiten basieren auf ökologisch relevanten, standortskundlichen Einzelmerkmalen, deren Erfassung jedoch ein umfangreiches Erfahrungswissen und intensive Feldarbeit erforderten. Wie genau sind solche Kartengrundlagen und können diese unter den heutigen Rahmenbedingungen objektiv nachvollzogen und gegebenenfalls aktualisiert werden? Am Beispiel von Daten des Wermsdorfer Waldes im mittelsächsischen Löss-Hügelland zeigen wir, wie mit Methoden des digital soil mapping alte Standortsinformationen überprüft, aktualisiert und für heutige Anforderungen (ökologischer Waldumbau) disaggregiert werden können. Zur Anwendung kamen hyperskalige Reliefanalysen hochauflösender Geländemodelle (2 m) und robuste Klassifikationsverfahren (Random Forest). Die Modellergebnisse zeigen zum Teil eine erstaunlich gute Übereinstimmung mit detailreichen Kartierungen der 1950er Jahre. Andererseits werden räumliche und inhaltliche Inkonsistenzen aufgedeckt. Die Ergebnisse stellen damit eine hervorragende Grundlage für die schnelle und vereinfachte Arbeit im Gelände und die Aktualisierung der Standortsinformationen dar.
Poster Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung
301
Unterwuchs: vernachlässigbar für die Vorhersage der Walddynamik?
Timothy Thrippleton1, Harald Bugmann1 und Rebecca S. Snell1
1Professur für Waldökologie, Institut für terrestrische Ökosysteme, ETH Zürich, 8092 Zürich, Schweiz, [email protected]
Schlagworte: Unterwuchsvegetation, Landschaftsmodellierung, Sukzession, Höhengradient
Der nicht verholzte Unterwuchs (Gräser, Farne, Hochstauden, etc.) wird in den meisten Modellen der Walddynamik nicht berücksichtigt, da sein Einfluss auf die Sukzession als vernachlässigbar betrachtet wird. Eine wachsende Zahl an Studien zeigt jedoch, dass dichter Unterwuchs einen erheblichen Effekt auf die Verjüngung der Baumarten haben kann. Dies kann zu einer Verzögerung der Sukzession führen, welche im Extremfall sogar zum Erliegen kommen könnte („arrested succession“). Die meisten Studien basieren jedoch auf empirischen Untersuchungen, die einen kurzen Zeitraum von wenigen Jahren umfassen und nur kleinräumig repräsentativ sind. Unser Wissen über die langfristigen und grossräumigen Auswirkungen ist hingegen noch sehr begrenzt. Im Rahmen der Studie wurde das dynamische Vegetationsmodell LandClim um funktionelle Gruppen der krautigen Unterwuchsvegetation erweitert und für Simulationen der Waldsukzession auf Landschaftsebene angewandt. Im Zentrum der Untersuchungen standen die oberirdische Konkurrenz um Licht sowie die unterirdische Konkurrenz um Wasser. Die Simulationen mit dem Fokus auf Lichtkonkurrenz zeigten, dass der krautige Unterwuchs die Sukzession stark verlangsamte (um bis zu 100 Jahre), jedoch über längere Zeiträume stets eine Wiederbewaldung stattfand, d.h. wir konnten keinen Fall von „arrested succession“ nachweisen. Auf der Landschaftsebene traten deutliche Unterschiede entlang eines Höhengradienten auf. Während der krautige Unterwuchs in tiefen Lagen eine hohe Biomasse erreichte und damit einen großen Einfluss auf die Baumverjüngung hatte, nahm dieser Einfluss in höheren Lagen aufgrund der Wachstumslimitierung durch niedrigere Temperaturen deutlich ab. Erste Simulationsergebnisse zur Wasserkonkurrenz zeigen, dass ein erheblicher Teil des verfügbaren Wassers in lichten Wäldern von der Unterwuchsvegetation beansprucht wird. Unter zunehmend trockenen Bedingungen verursacht diese Konkurrenz um Wasser nicht nur eine Veränderung der Baumverjüngung, sondern sie beeinflusst zudem das Wachstum etablierter Bäume und somit auch die Konkurrenzverhältnisse im Bestand insgesamt. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Unterwuchsvegetation für die langfristige Dynamik und Baumartenzusammensetzung von Wäldern. In der Anwendung von Waldsukzessionsmodellen sollte die nicht-verholzte Unterwuchsvegetation deshalb berücksichtigt werden.
Poster Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung 302
Additive Biomassefunktionen für die wichtigsten Baumarten Deutschlands
Christian Vonderach1 und Gerald Kändler1
1Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Additivität, nonlinear Seemingly Unrelated Regression, Multiple Imputation, Nährelemententzug
Allometrische Biomassefunktionen sind wertvolle Hilfsmittel, um bei gegebenem Baumbestand interessierende Größen wie Trockenmasse, gebundenen Kohlenstoff oder – wie hier im Fall des Projekts EnNa (Energieholzernte und Nachhaltigkeit) – Nährelementmengen abzuleiten. Für diesen Anwendungsfall ist es allerdings notwendig, für jedes Baumkompartiment eine eigene Biomassefunktion abzuleiten. Dabei ist die Additivität der einzelnen Kompartimentsfunktionen eine wünschenswerte Eigenschaft, d.h. die Summe der Kompartimentsschätzungen soll genau der Schätzung der Gesamtmasse entsprechen. Die für diese Arbeit zugrunde liegenden Daten entstammen verschiedenen Studien und waren unterschiedlich stark kompartimentiert. Zur Aufbereitung der Daten war damit nicht nur ein Homogenisierungsschritt zwischen den Studien notwendig, es wurde auch eine Datenergänzung mittels Multipler Imputation (MI) durchgeführt. Damit wurde einer möglichen Verzerrung der Ergebnisse vorgebeugt. Zur Parameterschätzung des Gleichungssystems kam die Methodik der „Seemingly Unrelated egression“ (SU ) zum Einsatz. Diese liefert einerseits additive Biomassefunktionen und reduziert andererseits durch die Berücksichtigung der Korrelationen zwischen den Kompartimenten die Unsicherheiten der einzelnen Schätzungen. Neben den Korrelationen wurde auch der vorhandenen Heteroskedastie durch eine geeignete Gewichtung der Datensätze begegnet. Als Ergebnis stehen additive Biomassefunktionen für acht verschiedene Baumarten (Fichte, Tanne, Douglasie, Kiefer, Eiche, Buche, Bergahorn, Esche) zur Verfügung, sowohl als Bhd-Höhen-Funktionen als auch in Form von Funktionen mit den Prädiktoren Bhd, Höhe, D03, Kronenlänge, Alter und Höhe über NN (sofern signifikant). Die gewählte Kompartimentierung trennt in Stock, Stockrinde, Derbholz, Derbholzrinde, Nichtderbholz mit Rinde und (bei Nadelbäumen) Nadeln. Die summarischen Kompartimente Stock mit Rinde, Derbholz mit Rinde und oberirdische Biomasse verhalten sich jeweils additiv zu ihren jeweiligen Kompartimenten. Ein Vergleich mit bisher vorhandenen Biomassefunktionen (z.B. Wirth et al. 2004, Wutzler et al. 2008) wird gezogen. Der Anwendungsfall zur Berechnung der Nährelementmengen aus einem WEHAM-Szenario unter Nutzung der ermittelten Biomassefunktionen wird dargestellt.
Poster Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung
303
Wildschadensmonitoring 2015 in Sachsen – Verfahrensoptimierung unter Einbeziehung verorteter Verjüngungsobjekte und definierter
Zielbaumartengebiete
Klaus Polaczek1, Tobias Eibenstein1
1Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft, Referat Waldbau/Waldschutz/Verwaltungsjagd, Staatsbetrieb Sachsenforst, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna /OT Graupa, [email protected]
Schlagworte: Wildschadensmonitoring, Zielbaumartengebiet, Verjüngungsverortung
Basierend auf den langfristig anzustrebenden, waldbaulichen Entwicklungszielen, den sogenannten Zielzuständen, ergeben sich potentiell für den sächsischen Landeswald größere Areale mit einer ähnlichen Baumartenausstattung (Zielbaumartengebiet). Aus einer Ergänzung der Zielbaumartengebiete mit regionalen waldbaulichen Besonderheiten resultieren die sogenannten Zielvereinbarungsgruppen. Für diese Regionen wird im Turnus von drei Jahren das weitere operative walbauliche und jagdliche Vorgehen abgesteckt. Die dafür notwendige Datengrundlage entstammt einem Wildschadensmonitoring, welches in allen Landeswaldgebieten mit einer zusammenhängenden Fläche von mehr als 500 ha durchgeführt wird. Vor dem Hintergrund einer jährlichen Verjüngungsfläche für den Landeswald von rund 1.200 ha in den letzten 10 Jahren, kommt nicht nur dem Verfahren als solchem, sondern auch einer Rationalisierung der Aufnahmemethodik eine große Bedeutung zu. Durch Weiterentwicklung früherer Verfahren hat sich in Sachsen ein Stichprobenraster von 1×1 km etabliert, wobei die dem Rastermittelpunkt am nahesten liegende Fläche stichprobenartig bonitiert wird. Im Rahmen des Wildschadensmonitorings (WSM) 2015 wurde die Rasterstichprobe durch lage- und größenbezogene Informationen von georeferenzierten Verjüngungsobjekten erweitert. Anhand dieser Information wird angestrebt, je Rasterpunkt einen Stangenholzbestand auf Schälschäden und ein Verjüngungsobjekt (Kultur) auf Verbisseinfluss zu untersuchen. Der Fokus ist dabei nur auf künstlich begründete Flächen gerichtet, da der Schadeinfluss ausschließlich bei investiven Maßnahmen abgeschätzt wird. Des Weiteren erfolgt eine Vorauswahl der potentiellen Boniturflächen über verschiedene Parameter zur Rationalisierung der Feldaufnahmen und zur Auswahl von Kulturen, die dem Baumartenspektrum der Zielvereinbarungsgruppe entsprechen. Mit den neuen Ergebnissen kann eine differenziertere Betrachtung der Wildschadenssituation in den einzelnen Regionen erfolgen. Ziel ist es, den Einfluss des Wildes nur an den Baumarten zu erfassen, die langfristig das waldbauliche Entwicklungsziel bestimmen. Da diese Ziele, bedingt durch bodenkundliche und klimatische Datenänderungen, nicht statisch sind, erlaubt die jetzige Methodik des WSM eine flexible Anpassung. Darüber hinaus kann perspektivisch durch eine Aktualisierung der Zielvereinbarungsgruppen und der Verjüngungsverortung das Potential des Verfahrens noch besser ausgenutzt werden.
Poster Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung 304
Zuwachs- und Nutzungsmodellierung im Rahmen der Betriebsinventur der Forsteinrichtung im sächsischen Landeswald mithilfe des
Simulators BWINPro-S
Kristian Münder1
1Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft, Referat Waldbau/Waldschutz/Verwaltungsjagd, Staatsbetrieb Sachsenforst, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna /OT Graupa, [email protected]
Schlagworte: Sachsen, Forsteinrichtung, Stichprobeninventur, Simulation
Seit dem Jahr 2015 erfolgt die Forsteinrichtung im Landeswald des Freistaates Sachsen nach einem neuen Verfahren. Die bisherige bestandesweise Taxation und Planung wird hierbei von einer permanenten Stichprobeninventur (Betriebsinventur WISA) mit nachfolgendem Planungsbegang abgelöst. Ziel der Verfahrensumstellung ist eine fundierte und statistisch gesicherte Zustandsanalyse, die eine Berechnung eines Modellhiebssatzes auf Basis festzulegender waldbaulicher Szenarien sowie die Festlegung von Betriebszielen im Vorfeld des Planungsbeganges ermöglicht. Im Anschluss an die Datenerhebung erfolgt im ersten Aufnahmezyklus die Fortschreibung der Stichprobenpunkte mit dem Waldwachstumssimulator BWINPro-S. Dabei werden das Wachstum der aufgenommenen Bäume sowie die Nutzung bei Durchforstungen und Erntemaßnahmen simuliert. Die Steuerung des Nutzungsmodells erfolgt mithilfe von Leitkurven und baumartenabhängigen Parametern wie z.B. dem Anteil zielstarker Bäume. Real existierende Nutzungseinschränkungen am Stichprobenpunkt werden ebenso berücksichtigt wie die standortsabhängigen Zielzustände der Waldentwicklung. Im Vortrag werden die Methodik der Modellierung und die Anwendung des Simulators im Rahmen des Forsteinrichtungsverfahrens beschrieben. Außerdem werden Zwischen-ergebnisse der ersten im neuen Verfahren einzurichtenden Forstbezirke vorgestellt.
Poster Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung
305
Evaluating the potential of Stereo Aerial Photographs (AP), Stereo Very High Resolution Satellite Images (VHRS) and TanDEM-X for the
Retrieval of Forest Canopy Height at plot level
Sami Ullah1, Matthias Dees1, Petra Adler2, Pawan Datta1 and Barbara Koch1
1Chair of Remote Sensing and Landscape Information System, Institute of Forest Sciences, University of Freiburg, Germany, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 2 Forest Research Institute, Baden-Wurttemberg (FVA), Germany, [email protected]
Schlagworte: Forest structure, Canopy height model, Stereo aerial photographs, Stereo high resolution satellite images, TanDEM-X
Air born laser scanning light detection and ranging (LiDAR) data is generally known as the most accurate and primary source for providing 3D structure of forest canopy information, as it has the capability to produce both the digital surface model (DSM) and digital terrain model (DTM). However, LiDAR data is the most costly option and therefore in many countries, it is not updated as needed for continuous forest management planning. In contrast to LiDAR, stereo aerial photographs (AP), stereo very high resolution satellite images (VHRS) and TanDEM-X data based on photogrammetric and interferometric techniques can also be used for the generation of 3D structure information of forest canopy in the presence of pre-existing LiDAR DTM. Over the last decade the demand for combined use of digital surface model (DSM) generated from air born and space born sensors in combination with pre-existing LiDAR DTM has tremendously increased for the retrieval of forest structure information. In this study, we compared the performance of three types of 3D data i.e. AP, stereo VHRS and TanDEM-X in combination with pre-existing LiDAR DTM for the retrieval of field Lorey’s mean height at plot level. Point clouds were generated from AP using Semi-Global Matching (SGM) and from stereo VHRS using enhance Automatic Terrain Extraction (eATE) and were normalized with LiDAR DTM. Similarly, DSM was generated from Tandem-X data using interferometry and was normalized (nDSM) with LiDAR DTM. Plot level heights metrics were extracted from the normalized point clouds and nDSM. The extracted height metrics were regressed with field Lorey’s mean height using linear regression model based on leave-out-one cross validation (LOOCV). We achieved highest R2 = 0.71 and lowest RMSE = 1.45 m for the height at 99% percentile extracted from normalized point clouds produced from AP and LiDAR DTM for all sample plots, R2 = 0.77 with RMSE = 1.51 m for coniferous, R2 = 0.62 with RMSE = 1.56 for broadleaves and R2 = 0.63 with RMSE = 1.53 for mixed sample plots with GLMH. Similarly, height at 99% percentile extracted from normalized point cloud produced from stereo WorldView-2 and LiDAR DTM show R2 =0.45 with RMSE = 2 m for all sample plots, R2 = 0.42 with RMSE = 2 m for coniferous, R2 = 0.52 with RMSE = 1.78 m for broadleaves and R2 = 0.4 with RMSE = 1.96 for mixed species with GLMH. For height at 99% percentile extracted from the nDSM generated from DSM of TanDEM-X data using interferometry and LiDAR DTM show R2 = 0.37 with RMSE = 2.26 m for all sample plots, R2 = 0.59 with RMSE = 1.87 m for coniferous, R2 = 0.31 with RMSE = 2.14 m for broadleaves and R2 = 0.38 with RMSE = 2 m for mixed species with GLMH. Our finding shows that AP gives the most accurate results followed by stereo VHRS and Tandem-X with GLMH. The study shares valuable information which will be useful for the generation and regular update of forest structure information in the presence of pre-existing LiDAR DTM.
Poster Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung 306
Einsatz satellitengestützter Fernerkundungsdaten zur Flächenvorklärung für die Waldbiotopkartierung im Freistaat
Thüringen
Herbert Sagischewski1, Martyna Stelmaszczuk-Górska1 und Sergej Chmara1
1ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts, Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha, Jägerstr. 1, 99867 Gotha, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Satellitengestützte Fernerkundungsdaten, Copernicus-Dienste, High Resolution Layer, Waldbiotopkartierung
Bisher werden von den Landesforstverwaltungen satellitengestützte Fernerkundungsdaten nur in geringem Umfang genutzt. Lediglich zur Erfassung großflächiger biotischer und abiotischer Schäden kommen diese gelegentlich zum Einsatz. Am Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha wurde ein Verfahren für die von ThüringenForst AöR turnusmäßig durchzuführende Waldbiotopkartierung entwickelt, in das satellitengestützte Fernerkundungsdaten integriert sind. Im Rahmen der Waldbiotopkartierung wird im Freistaat Thüringen flächendeckend und besitzübergreifend die Naturausstattung aller Waldflächen erfasst [1]. Im Vorfeld der Kartierung ist eine Vorklärung notwendig, die die Erfassung sämtlicher Waldflächen sicherstellen soll. Basis dieser Vorklärung sind die forstlichen „High esolution Layer“ der Copernicus-Dienste zur Überwachung der Landoberfläche, mit deren Hilfe Verdachtsflächen bezüglich bisher nicht bekannter Waldflächen ermittelt werden. Die Copernicus-Dienste zur Überwachung der Landoberfläche bieten kostenfrei verschiedene Datensätze an, die regelmäßig aus Satellitendaten europaweit aktualisiert werden [2]. Die forstlichen „High esolution Layer“ bilden dabei alle Flächen ab, die mit Bäumen oder holzartigen Gewächsen bestockt sind. Mit Hilfe von digitalen Zusatzinformationen werden aus dieser Vorauswahl alle Flächen ausgeschieden, die bereits als Wald erfasst sind bzw. die auf Grund der gesetzlichen Definitionen nicht als Wald gelten (Parkanlagen, Obstanbauflächen usw.). Das Ergebnis dieser Vorklärung wird den zuständigen Forstämtern zur Verfügung gestellt, die die endgültige Entscheidung zu treffen haben, welche dieser Flächen in die Waldbiotopkartierung einbezogen werden sollen. Referenzen [1] Sechste Durchführungsverordnung zum Thüringer Waldgesetz (6. DVO ThürWaldG) [2] http://land.copernicus.eu/
Poster Session 20: Entwicklungen b. Datenerfassung, Auswertung & Modellierung
307
Monitoring der natürlichen Waldentwicklung im Nationalpark Schwarzwald
Stefanie Gärtner1, Sönke Birk1, Jörn Buse1, Sandra Calabro1, Esther del Val Alfaro1, Christoph Dreiser1, Raffael Kratzer1, Flavius Popa1 und Marc Förschler1
1Nationalpark Schwarzwald, Ökologisches Monitoring, Forschung & Artenschutz, Kniebisstraße 67, D-77740 Bad Peterstal-Griesbach, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Monitoring, natürliche Waldentwicklung, Nationalpark Schwarzwald, Prozessschutz
Mit diesem Beitrag möchten wir das naturwissenschaftliche Monitoringkonzept des Nationalparks Schwarzwald vor- und zur Diskussion stellen. Die Forstwissenschaftliche Tagung bietet ein exzellentes Forum, da wir zusammen mit verschiedensten Forschungsinstituten die wichtigen wissenschaftlichen Fragen von heute, aber auch die von Morgen beantworten möchten. Das Monitoringkonzept ist hierfür eine der Grundlagen, die der Nationalpark Schwarzwald bietet. Mithilfe der Inventur und deren periodische Wiederholung wird dokumentiert, wie sich das Gebiet durch den Prozessschutz „eine Spur wilder“ entwickelt. Neben der reinen Dokumentation der Veränderung liegt der Schwerpunkt auf der Analyse von Habitat- und abiotischer Schutzfunktion der Waldlandschaft. Unser Ansatz ist sowohl skalen- als auch organismengruppen übergreifend. Die Waldstrukturentwicklung wird für das gesamte Gebiet mittels Fernerkundung erfasst, und abgestimmt mit anderen deutschen Nationalparken (z.B. NLP Berchtesgaden) analysiert. Kombiniert wird diese Landschaftsanalyse mit detaillierten feldökologischen Erfassungen. Die Stratifizierung für die terrestrische Erfassung orientiert sich zum einen an den naturräumlichen Gegebenheiten der Mittelgebirgslandschaft und wird nach Regionalklima und geologischem Ausgangssubstrat in Anlehnung an die Forstliche Standortskartierung der FVA untergliedert. Zum anderen an Stichprobendesigns länger bestehender Nationalparke, z.B. ein Vergleich der Entwicklungen entlang der Höhengradienten (NLP Bayrischer Wald). Zur Lokalisierung der einzelnen Stichprobenpunkte innerhalb der Straten wird das permanente Stichprobennetz der Betriebsinventur (ForstBW) weitergenutzt. Diese Nutzung bestehender Infrastruktur wie auch die Anlehnung der Waldstrukturerfassung an die der Bannwälder Baden Württembergs (FVA) ermöglicht den Vergleich mit aktuellen und historischen Daten. Sonderstandorte, wie beispielsweise Kare und Blockhalden, werden mit zusätzlichen Punkten berücksichtigt. An den Aufnahmeflächen der Waldstruktur werden genestet die verschiedensten Organismengruppen (Gefäßpflanzen, Bryophyten, Pilze u. Flechten, Vertebraten und Invertebraten) erfasst, was eine Analyse der Strukturentwicklung, und deren Einfluss auf und die Interaktion zwischen den funktionalen Gruppen des Ökosystems ermöglicht. Mit dieser Vorstellung unserer Arbeit erhoffen wir uns neue Impulse aus der Forst-wissenschaft und gleichzeitig möchten wir zu weiteren wissenschaftlichen Kooperationen einladen.
Poster Session 22: Ableitungen aus Großrauminventuren f. d. Waldbewirtschaftung 308
Erstellung einer Karte zur Bewertung der nährstoffnachhaltigen Nutzung für das Fürstentum Liechtenstein
Eckart Kolb1, Axel Göttlein1
1Fachgebiet Waldernährung und Wasserhaushalt der TU München, Hans Carl von Carlowitzplatz 2, 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Nährstoffnachhaltigkeit, Substratkarte, Liechtenstein
Der steigende Bedarf an Holz insbesondere an Energieholz erhöht das Interesse, die Waldnutzung zu intensivieren. Insbesondere der Bau von Hackschnitzelkraftwerken erhöht den Druck, auch Nicht-Derbholzkompartimente zu nutzen. Diese Kompartimente sind besonders nährstoffreich und entziehen daher den Waldstandorten überproportional viel Nährstoffe verglichen mit dem derzeitigen Standard einer Derbholznutzung mit Rinde. Zur Abschätzung der Nutzungspotentiale wurde eine Karte zur Bewertung der nährstoffnachhaltigen Nutzung für das Fürstentum Liechtenstein erstellt. Da keine ausreichenden Punktinformationen für eine Berechnung von Nährstoffbilanzen vorhanden sind wird auf vorhandene Flächeninformationen in Form einer geologischen und einer Waldgesellschaften-Karte zurückgegriffen. Die geologische Karte wurde zunächst in eine Substratkarte umgewandelt, mit einem Ansatz, welchen wir für die Alpen entwickelt und in großen Teilen der Nördlichen Kalkalpen angewendet haben. Anschließend wurde sie hinsichtlich ihrer Nährstoffnachhaltigkeit in einem vier-klassigem System bewertet. Das größte Problem lag hierbei – wie schon bei vergleichbaren Projekten in Bayern, Tirol, Salzburg und Oberösterreich – in der Bewertung der quartären Lockersedimente. Daher wurde parallel zur Einwertung der geologischen Substrate eine Waldgesellschaftenkarte eingewertet. Durch die darin enthaltenen differenzierten Informationen zum Boden konnte eine „Pseudobodenkarte“ erstellt und eingewertet werden. Ein Vergleich der beiden Karten zeigt, dass die Einwertungen beider Karten auf 82 % der Fläche um höchstens einer Bewertungseinheit auseinander liegen. Anschließend wurden beide Karten regelbasiert verschnitten, so dass möglichst die immanenten Nachteile beider Systeme vermieden oder verringert wurden. 53 % der Waldfläche Liechtensteins wurde als schwach empfindlich bis unempfindlich hinsichtlich einer klassischen Nutzung von Derbholz mit Rinde bewertet, 30 % als empfindlich und 17 % als sehr empfindlich. In einem weiteren Schritt wurden die Flächen berechnet, für die eine restriktive Bewirtschaftung erforderlich ist, selbst wenn ausreichend bodenbürtige Nährstoffe zur Verfügung stehen. Es handelt sich immer um Standorte, auf denen der Standortschutz und die Erhaltung zumindest einer teilweisen Bewaldung im Vordergrund stehen. Nach diesen Berechnungen können 14 % der in Liechtenstein vornehmlich für die Holzproduktion zur Verfügung stehenden Flächen nicht uneingeschränkt genutzt werden.
Poster Session 22: Ableitungen aus Großrauminventuren f. d. Waldbewirtschaftung
309
Ableitung von Nährelementrelationen für Fichte, Kiefer, Buche, Eiche aus dem Wertebereich normaler Ernährung
Axel Göttlein1, W. Riek2, U. Talkner3, I. Dammann3, M. Kohler4, K.J. Meiwes3
1Fachgebiet Waldernährung und Wasserhaushalt, H.C.v.Carlowitz-Platz 2, 85354 Freising-Weihenstephan, [email protected]
2Hochschule f. nachhaltige Entwicklung, Fachbereich Wald u. Umwelt, Alfred-Möller-Str. 1, 16225 Eberswalde, [email protected]
3Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Abteilung Umweltkontrolle, Grätzelstraße 2, 37079 Göttingen, [email protected], [email protected], [email protected]
4Unversität Freiburg, Professur für Waldbau, Tennenbacherstr. 4, 79085 Freiburg, [email protected]
Schlagworte: Nährelementverhältnisse, Ernährungs-Grenzwerte, Hauptbaumarten
Die Berechnung von Nährelementrelationen ist ergänzend zur Einwertung von Nährelement-gehalten eine zusätzliche diagnostische Größe zur Beurteilung des Ernährungszustandes von Waldbäumen. Da für die Einwertung von Nährelementrelationen, wie auch für die Nährelementgehalte, in der Literatur mehrere teilweise untereinander inkonsistente Bewertungssysteme existieren, wurde der Versuch unternommen, einen auf breiter Datenbasis aufbauenden Bewertungsrahmen aufzustellen. Zunächst wurden alle relevanten Literaturangaben erfaßt und ausgewertet. Da hier nur für Kiefer und Fichte eine einigermaßen auswertbare Anzahl an Werteangaben verfügbar war, wurden für alle vier Hauptbaumarten die Grenzwerte der Nährelementrelationen aus den Grenzwerten für den Konzentrationsbereich normaler Ernährung hergeleitet. Der Bereich harmonischer Nährelementrelationen wurde hierbei aus der kreuzweisen Verrechnung der Ober- und Untergrenze des Bereichs normaler Ernährung (nach Göttlein et al. 2011) berechnet. Ferner wurde ein Optimalbereich aus der Verrechnung sich entsprechender Grenzen berechnet. Die so abgeleiteten Werte wurden mit einer Herleitung kritischer Nährelementverhältnisse aus dem ernährungskundlichen Datenfundus der BZE2 verglichen. Die aus dem Bereich normaler Ernährung abgeleiteten Relationsbereiche harmonischer Ernährung fügen sich gut in den von der Literatur aufgespannten Wertebereich ein (aufgrund der Datenlage nur bewertbar für Fichte und Kiefer). Auch der Vergleich der berechneten Obergrenzen der Nährelementrelationen mit kritischen Relationen, die aus dem Datensatz der BZE2 abgeleitet wurden, ergibt eine gute Übereinstimmung. Die Berechnung des Bereichs harmonischer Ernährung aus den Grenzwerten normaler Ernährung erscheint daher als brauchbare Methode, um auch für Baumarten, für die bislang keine entsprechenden Werte existieren, diese herzuleiten. Literatur: Göttlein, A., Baier, R., Mellert, K.H. (2011): Neue Ernährungskennwerte für die forstlichen Hauptbaumarten in Mitteleuropa – Eine statistische Herleitung aus van den Burg`s Literaturzusammenstellung. Allg. Forst- u. J.-Ztg. 182, 173-186.
Poster Vorträge Session 23: Forstliche Großrauminventuren als Impulsgeber... 310
Ergebnisse von Wasserhaushaltssimulationen als Teil eines Umweltvektors für die BWI - Parametrisierung, Modellhintergründe,
Ergebnisse
Paul Schmidt-Walter1, Henning Meesenburg1, Bernd Ahrends1, Heike Puhlmann2, Klaus von Wilpert2, Arno Röder2, Thilo Wolf2, Dietmar Zirlewagen3, Raphael Benning4, Rainer
Petzold4, Jürgen Böhner5, Tobias Mette6, Christian Kölling7
1NW-FVA, Grätzelstr. 2, 37079 Göttingen, [email protected], [email protected], [email protected] 2FVA-BW, Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 3Interra, St.-Peter-Str. 30, D-79341 Kenzingen, [email protected] 4Staatsbetrieb Sachsenforst, Bonnewitzer Str. 34, 01796 Pirna OT Graupa, [email protected], [email protected] 5Uni Hamburg, Physische Geographie, Bundesstr. 55, 20146 Hamburg, [email protected] 6LWF, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, [email protected] 7AELF Roth, Johann-Strauß-Str. 1, 91154 Roth, [email protected]
Schlagworte: Wasserhaushalt, Standortleistung, Bundeswaldinventur, Klimawandel
Das vom Waldklimafonds geförderte Verbundprojekt „ aldproduktivität- Kohlenstoffspeicherung-Klimawandel“ befasst sich mit der Erstellung eines Umweltvektors für die BWI, d.h. einer umfassenden Grundlage von Standortsdaten zu Klima und Boden an den Punkten der Bundeswaldinventur, mithilfe derer die Auswirkungen des Klimawandels auf Vitalität und Leistungsfähigkeit unserer Wälder abgeschätzt werden können. Neben statischen mittleren Angaben zum Wasserhaushalt sind dabei zunehmend auch inner- und zwischenjährliche Schwankungen der Bodenwasserverfügbarkeit (z.B. Intensität und Dauer von Trockenperioden) gefordert, denen zusätzliches Erklärungspotential für das Verständnis von Standort-Leistungs-Beziehungen innewohnt. Zur Abschätzung der zeitlichen Dynamik und räumlichen Heterogenität des Bodenwasserhaushalts und der Wasserflüsse wird im Rahmen des Verbundprojekts an bis zu 26450 Traktecken der Bundeswaldinventur (4 km x 4 km Raster) das numerische Bodenwasserhaushaltsmodell LWF-Brook90 mit repräsentativen Standardbeständen parametrisiert und mit retrospektiven Klimadaten (1961-2013) betrieben. Die für die Simulationen benötigten physikalischen Bodeneigenschaften der einzelnen BWI-Punkte (Retentions- und Leitfähigkeitscharakteristika der Bodenhorizonte) stammen von Leitprofilen, die im Rahmen des Verbundprojekts dem jeweiligen BWI-Punkt zugeordnet wurden. Ergebnisse der Simulationen (Evapotranspiration, Grundwasserneubildung, Bodenwasserdynamik, Trockenstress) werden hinsichtlich ihrer zeitlichen Dynamik und räumlichen Heterogenität untersucht.
Poster Session 23: Forstliche Großrauminventuren als Impulsgeber...
311
Kronenzustand in Deutschland - Steuergrößen und Raum-Zeit-Entwicklung von 1989-2014
Nadine Eickenscheidt1, Nicole Augustin2, Nicole Wellbrock1, Petra Dühnelt1 und Lutz Hilbrig1
1Thünen-Institut für Waldökosysteme, Alfred-Möller-Str. 1, 16225 Eberswalde, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 2Department of Mathematical Sciences, University of Bath, Bath BA2 7AY, 4 West, [email protected]
Schlagworte: Kronenverlichtung, Waldzustandserhebung, Raum-Zeit-Modellierung, Generalisierte additive gemischte Modelle
Die Waldzustandserhebung (WZE) stellt neben der BZE einen wichtigen Bestandteil des Forstlichen Umweltmonitorings dar. Sie erfolgte erstmalig im Jahr 1984 und wird seit 1990 jährlich im gesamten Bundesgebiet durchgeführt. Die WZE basiert im Wesentlichen auf der Kronenverlichtung, welche den am häufigsten verwendeten Indikator für die Vitalität der Bäume repräsentiert. Zusätzlich erfolgt eine Ansprache von biotischen und abiotischen Schäden. Die Aufnahme wird verpflichtend auf den Level-I-Flächen (europaweites 16 × 16 km Raster) durchgeführt, zusätzlich liegen verschiedene Netzverdichtungen vor. Von 2006 bis 2008 erfolgte die WZE auf dem verdichteten 8 x 8 km Raster der BZE. Für diesen Zeitraum liegen somit potentielle Einflussgrößen für die Kronenverlichtung vor. Die Auswertung der Kronenverlichtungsdaten stellt eine statistische Herausforderung dar, weshalb im Allgemeinen auf deskriptive Statistik zurückgegriffen wird. Generalisierte additive gemischte Modelle (GAMM) eignen sich hervorragend für die Raum-Zeit-Modellierung. GAMMs benötigen keine regelmäßigen Raster, erlauben eine weite Spanne an Korrelationsstrukturen und können für jede Zielgröße angewendet werden, welche einer Verteilung aus der exponentiellen Familie folgt. Nicht-linearer Effekte von Einflussgrößen können mit Hilfe von Glättungsfunktionen modelliert werden. Die Betrachtung des Raum-Zeit-Trends und der -Interaktion kann durch eine Glättung der Raum-Zeit-Dimension mit Hilfe des skaleninvarianten Tensor Produkts erfolgen. Ziel der vorliegenden Studie ist daher, i) die Raum-Zeitmodellierung der bundesweiten Kronenverlichtungsdaten der vier Hauptbaumarten Gemeine Fichte (Picea abies), Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris), Rotbuche (Fagus sylvatica) und Eiche (Quercus robur und Q. petraea) von 1989 bis 2014 mit Hilfe von GAMMs und ii) die Bestimmung von Einflussgrößen für die Kronenverlichtung unter Hinzunahme der BZE-Daten.
Poster Session 25: Large-area forest monitoring in intern. forest related processes 312
Wurzeln als Kohlenstoffspeicher: Untersuchungen zur unterirdischen Biomasse von Birke, Eiche und Kiefer
Mirko Neubauer1, Burkhard Demant
1Thünen-Institut für Waldökosysteme, 16225 Eberswalde, Alfred-Möller-Str.1, [email protected]
Schlagworte: Wurzelbiomasse, Biomassefunktion, Kohlenstoffinventur
Im Rahmen des Kyoto-Protokolls (2005) hat sich Deutschland dazu verpflichtet, seinen Ausstoß an Treibhausgasen zu reduzieren. Als Nachweis dafür dient der jährlich zu erstellende Nationale Inventarbericht (NIR). Dieser berichtet u.a. über die vorhandenen Kohlenstoffvorräte in Wäldern, zu denen neben der oberirdischen Biomasse auch deren Wurzelmasse gehört. Bisher wurde die unterirdische Biomasse anhand von pauschalen Schätzern ausgehend von der oberirdischen Biomasse ermittelt. Dies erfolgte mit Hilfe des Wurzel/Spross-Verhältnisses je Hektar mit vorgegebenen Tabellenwerten des IPCC von 2003. Diese Werte berücksichtigen nur in sehr geringem Umfang die Baumart und die Dimension des Einzelbaumes. Quantitative Untersuchungen sind aufgrund des hohen Aufwands bisher sehr spärlich. Zudem haben diese häufig einen geringen Stichprobenumfang und betrachten meist nur junge Bäume mit geringen Durchmessern. Ziel des Projektes ist die Erarbeitung bundesweit anwendbarer Biomassefunktionen für Einzelbäume für die Wurzelmasse von Eiche, Birke und Kiefer. Mit Hilfe dieser Funktionen soll anhand von Baumart und Brusthöhendurchmesser (BHD) die unterirdische Biomasse berechnet werden. Als Datengrundlage hierfür können die Bundeswaldinventur und deren Zwischeninventuren dienen. Für das vorliegende Projekt sollen Wurzeln von jeweils 40 bis 50 Bäumen der Baumarten Eiche, Birke und Kiefer mit einer möglichst großen BHD-Spanne untersucht werden. Die Probebäume werden zur Ermittlung der ober- und unterirdischen Biomasse umgezogen und anschließend vermessen. Aus den erhobenen Daten werden Funktionen zur Berechnung der unterirdischen Biomasse abgeleitet. Bisher wurden 32 Eichen (BHD 7 – 42 cm), 40 Birken (BHD 8 – 53 cm) und 48 Kiefern (BHD 7 – 53 cm) beprobt. Die Zwischenergebnisse zeigen zum Teil deutliche Unterschiede zu den Werten des IPCC. Im Weiteren sollen Rückschlüsse über das Wurzelwachstum und den Bodenaufschluss unter verschiedenen klimatischen und standörtlichen Bedingungen gezogen werden.
Poster Session 25: Large-area forest monitoring in intern. forest related processes
313
Forest Biomass Mapping using TanDEM-X IDEM, Landsat based Spectral characteristics and BWI-3 forest inventory
Pawan Datta1, Heinz Gallaun2, Barbara Koch1, Mathias Schardt2, Matthias Dees1
1Chair of Remote Sensing and Landsacape Information System, University of Freiburg, Tennenbacherstr. 4, 79104 Freiburg, Germany, [email protected]; [email protected]; [email protected] 2Remote Sensing and Geoinformation Group, Joanneum Research, Graz, Austria, [email protected]; [email protected]
Keywords: forest biomass, TanDEM-X, BWI-3, multi-sensor
The use of remote sensing for the quantification of forest resources, viz. above ground biomass and growing stock volume has been a topic of research as well as has been in practice for monitoring to support decision making. There have been continuous efforts to apply improved methodologies and tools to ever improving remote sensing datasets in order to reduce the uncertainties and improve the quality of estimations. While single sensor approaches are also in practice, but multi-sensor approaches have been applied with increasing level of success for forestry applications, especially for biomass and volume estimation. The aim of this study is to apply a multi-sensor approach to calculate regional scale forest biomass in order to estimate the harvesting potential for energy use. The focus of this study will remain the comparative evaluation of: 1. Modelling approaches, where different parametric and non-parametric models will be tested for the given parameter, and 2. Combinations of in situ and remote sensing data types based on their qualitative performance under different modelling approaches. TanDEM-X intermediate DEM (IDEM) and Landsat 8 will be used to derive the forest height and spectral parameters respectively. TanDEM-X IDEM is an intermediate DEM product, a precursor to the WorldDEM product, which is a high resolution global DEM product by the DLR and is based on X-band interferometric SAR data obtained using the two satellite TanDEM-X mission. The in-situ reference data for modelling as well as for model validation will be obtained from the Third German National Inventory (BWI-3) plots from the Federal State of Baden-Württemberg. Furthermore, the performance of the Pan-European High Resolution Forest type layer will also be evaluated. The general hypothesis is that IDEM based nDSM can be used as a tool for improving the accuracy of regional and large area forest biomass and growing stock maps.
Poster Session 25: Large-area forest monitoring in intern. forest related processes 314
UAV Applications in Forestry: an Empirical Approach
Stuart Krause1 and Jan-Peter Mund1
1Eberswalde University for Sustainable Development, Alfred-Moeller-Str. 1, 6225 Eberswalde, Germany, [email protected], [email protected]
Keywords: UAV, Remote Sensing, Forestry
Due to a rapidly evolving UAV industry, “in-house” high resolution aerial imagery acquisition could become an integral part of resource management particularly in the forestry sector. The questions are however, how effective is this imagery in reference to management issues and what are some of the challenges facing forestry professionals when acquiring datasets? This study is an empirical analysis of UAV applications in forestry and aims to validate the acquisition and implementation of aerial imagery in forest management decision making. UAV mounted sensors can deliver high quality georeferenced RGB, IR, TIR imagery as well as point clouds similar to LiDAR (XYZ) for a considerably low production cost and can be carried out at regular time intervals. This imagery can enhance traditional inventory and surveying methods with a decrease of “boots on the ground” proving more time and cost effective as well as ergonomic. This technology is however not without its challenges and limitations. Workflow optimization and a multitude of skillsets are essential in acquiring and assessing high quality imagery. Furthermore the creation of orthomosaics and point clouds are dependent on effective flight planning, aircraft stability, sensor and gimbal quality as well as GPS accuracy. Through extensive field studies in corporation with research institutions and forest companies an effective workflow was designed and implemented showing the effectiveness of incorporating UAV technology in forest management. .
Poster Session 26: Potential for the German contribution to intern. forest science
315
Effect of silvicultural interventions on the recovery of commercial growing stock over 30 years in the Brazilian Amazon
Angela Luciana de Avila1, Gustavo Schwartz2, Ademir Roberto Ruschel2, José do Carmo Lopes2, José Natalino Silva3, Lucas Mazzei2, João Pereira de Carvalho3, Jürgen Bauhus1
1Chair of Silviculture, Faculty of Environment and Natural Resources, University of Freiburg, Tennenbacher Str. 4, 79085 Freiburg, Germany, [email protected], [email protected] 2Embrapa Amazônia Oriental, Caixa Postal 48, 66095-100, Belém, Pará, Brazil, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 3Universidade Federal Rural da Amazônia, Av. Presidente T. Neves, 2501, Montese, 66077-530, Belém, Pará, Brazil, [email protected], [email protected]
Keywords: felling cycle, polycyclic system, stand thinning, tropical silviculture
Sustainable forest management for timber requires that forest ecosystem properties and processes will recover during each cycle to permit sustainable yield of target species and ultimately the long-term functioning of forest ecosystems. Nonetheless, the sustainability of timber production through the regeneration of merchantable species and stems within given felling cycles is still a matter of concern in most tropical forests. In this study, we analyzed how silvicultural intervention intensity (measured as reduction in basal area relative to the pre-logging state) and type (harvesting and thinning) affected the growth of future crop trees (15 ≤ DBH < 50 cm) and the recovery of commercial growing stock (DBH ≥ 50 cm). The study was conducted in a long-term experiment established in 1981 to study the effects of different management intensities and interventions on forest dynamics. The experimental site is located in the Tapajós National Forest, Pará, Brazil. Intervention intensities comprised logging (1982), damage to trees not harvested (i.e., trees that died as an indirect result of logging) and thinning (1993 to 1994), together ranging from 19 to 53% of basal area reduction in relation to pre-logging stocks. An area of 36 ha of unlogged forest was installed in 1983 and served as a control. Trees (DBH ≥ 10 cm) were measured on eight occasions in 41 permanent sample plots of 0.25 ha each. The cohort of merchantable species analysed here comprised 22 harvested species and 30 non-harvested species. The results indicate that harvesting and thinning promoted growth of future crop trees. Nonetheless, for interventions with high damage and high follow-up thinning intensity the commercial growing stock of harvested species have a proportion of recovery significantly lower than in the other treatments (P < 0.01). When considering together the 30 non-harvested species, recovery increased considerably but was still very low for the strongest intervention (P < 0.05), although growth rates increased after high thinning intensity. These findings indicated that a new harvest within the current felling cycle has to deal with a different cohort of species and that intensive interventions may impair the recovery of timber stocks in these forests.
Poster Session 26: Potential for the German contribution to intern. forest science 316
ARBONETH – The Ethiopian Arboretum Network
Peter Borchardt1 und Habtamu Assaye2
1 CEN Center for Earth System Research and Sustainability - Institute of Geography, University of Hamburg – KlimaCampus Hamburg, [email protected] 2 University of Bahir Dar, Ethiopia
Keywords: capacity development, ex situ conservation, in situ reforestation, red list
Tree species are of particular importance at the Horn of Africa. In this region of low forest cover, but high diversity of shrub and tree species, the remnant forest stands are adversely affected by anthropogenic disturbance and climate change. According to the Red List of Endemic Trees and Shrubs in Ethiopia and Eritrea (FFI, IUCN et al. 2005) tree species play a central role in the livelihood strategies of the rural population in this region. About 90% of the energy used in Ethiopia is produced from biomass - whereby firewood is the main component. Under these circumstances, the development of sustainable use of natural resources as well as in situ (lat. for "in place“) and especially ex situ (lat. for “outside the [original] site") nature conservation are indispensable. The Conference ‘Building Capacity for Botanic Garden Management in Ethiopia’ hosted by Botanic Gardens Conservation International (BGCI) and the Ethiopian Biodiversity Institute (EBI) in November 2014 laid the foundation for a network of biodiversity research and conservation in Ethiopia. This network will start to work with the help of the DAAD/BMZ funded project: ARBONETH - The Ethiopian Arboretum Network. The mission of ARBONETH is to create - in particular with the (re-)construction of arboreta, tree nurseries and herbaria in Ethiopia and through knowledge transfer and capacity development - a network of sustainability, nature conservation, education and research. ARBONETH creates the necessary capacity to respond to the challenges of biodiversity loss and the loss of habitats in the context of the post 2015 development agenda at selected university locations in Addis Ababa, Hawassa / Wondo Genet and Haramaya. Further cooperation with international experts, the University of Bonn, the Oxford University, BGCI and various academic and NGO partners will help to establish a vibrant network. Our goal is to enable ARBONETH to act as a platform for environmental sustainability through ex situ- and in situ conservation as well as research on biodiversity in the challenging environment of East Africa.
Poster Session 26: Potential for the German contribution to intern. forest science
317
Analysis of the potential of forest woody biomass for energetic use at a regional scale in Mexico
Ulises Flores1 and Dirk Jaeger1
1Professur für Forstliche Verfahrenstechnik; Albert-Ludwigs Universität Freiburg; D-79098 Freiburg im Breisgau, Germany, [email protected], [email protected]
Keywords: Bioenergy, Forest woody biomass, Mexico, Energy supply chain
Most of the current activities carried out in the Mexican rural sector are related to the use of biomass as energy input, which is not utilized to its sustainable potential, yet. The design and implementation of bioenergy supply chains opens a range of opportunities for forest utilization and sustainable development of rural communities in Mexico. This study focuses on advancing research for sustainable energy generation based on forest woody biomass in Mexico. The main objective is to develop a methodology for holistically evaluating the sustainable potential of supplying energy from decentralized bioenergy plants using woody biomass, thus, creating regional value chains which support sustainable development of rural communities. The proposed methodology includes an analysis for residue utilization assessing the availability of woody biomass for energetic use. Considering its design, the study is based in three research modules: i) Availability and appropriateness of lignocellulose biomass, ii) Forest management for bioenergy supply and iii) Energy output. The research includes an analysis of forest biomass utilization coming from residues out of harvesting activities, non-extracted stands and sawmills. The methodology uses variable inputs to assess the status quo, which later are used for scenario analysis affecting the theoretical, technical and economic potentials. A regional case study focusing on tree species of commercial importance (pine, oak and fir) is analyzed involving 10 provinces with the highest timber production located in the north and central-south part of the country. A spatial approach is carried out delimiting the geographical area for analysis, involving land use and inventory data. At a theoretical and technical level, equations to account the availability of woody biomass as well as extraction limits equations are developed using statistical and geographical data. Furthermore, digital elevation models (DEM) are used to analyze terrain conditions in order to calculate sustainability constraints. For the economic potential, a sensitivity analysis is developed for calculating new economic flows and the net present value (NPV) of woody biomass for energetic utilization. A comparison of the status quo against proposed utilization scenarios will complement the developed holistic evaluation methodology for assessing the feasibility of energy supply chains based on forest woody biomass in Mexico.
Poster Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle... 318
Disturbance susceptibility of grouse: assessing the role of hunting
Farina Sooth1, Ilse Storch1
1University of Freiburg, Chair of Wildlife Ecology and Management, Tennenbacher Str. 4, 79106, Freiburg i. Br., Germany, [email protected], [email protected]
Keywords: disturbance susceptibility, flight initiation distance, human disturbance, hunting history
Human disturbance can affect the behavior and the physical condition of wildlife and may show in altered habitat use, shorter flight initiation distances, increased vigilance and stress hormone levels. Also grouse species have been shown to alter their behavior in response to disturbances such as recreational activities. Thus, human disturbance has become a much discussed threat to wildlife. According to risk-disturbance theory (Frid & Dill 2002, Beale & Monaghan 2004) perceived predation risk is a major explanation for variation in the responses of wildlife, including grouse (Storch 2013), to encounters with humans. Thus, hunting by humans can be expected to be a major factor influencing the disturbance susceptibility of wildlife. To address these ideas, I develop a cooperative research project aimed at exploring the effect of hunting on the responses of grouse to humans. Grouse are excellent study species because they are found in many different environments. Combining empirical and experimental approaches, the project will test the hypothesis that grouse populations with a long and intense history of human hunting will show higher disturbance susceptibility as compared to populations that have never experienced much human persecution. As indicators of disturbance susceptibility flight initiation distance and stress hormone levels can be used and confounding variables such as habitat, season and hunting method will be taken into account. In my poster I will outline how the project will be implemented and in how far its results can be of use for the understanding and management of human disturbance of grouse. Beale, C. M., and P. Monaghan. 2004. Human disturbance: people as predation-free predators? Journal of Applied Ecology 41:335-343. Frid, A., and L. M. Dill. 2002. Human-caused disturbance stimuli as a form of predation risk. Conservation Ecology 6:Unpaginated. Storch, I. 2013. Human disturbance of grouse - why and when? Wildlife Biology 19:390-403.
Poster Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle...
319
Risikomanagement als Naturschutzwerkzeug
in der Verkehrswegeplanung
Jens-Ulrich Polster1, Philipp Kob1, Sven Herzog1
1Technische Universität Dresden, Pienner Straße 8, 01737 Tharandt, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Risikomanagement, Biotopvernetzung, Monitoring, Querungshilfen
Bei Planung und Bau bzw. Ausbau von Verkehrswegen finden wir verschiedene Zielkonflikte in Bezug auf die Frage der Vermeidung nachteiliger Einflüsse auf Wildtiere. Einerseits führen Maßnahmen zur Kollisionsvermeidung, insbesondere Zäune, zu einem Zerschneidungseffekt in der Landschaft. Andererseits sind sie aus Tier- und Artenschutzgründen erforderlich. Ein weiteres Problem stellen langwierige Planungs- und Ausführungszeiträume der jeweiligen Baumaßnahmen dar. Während dieser Zeit auftretende Änderungen der Raumnutzung durch Wildtiere, insbesondere große mobile Säugetiere, werden bisher nicht berücksichtigt. In diesem oft mehrjährigen Zeitraum können sich wichtige Einflussfaktoren auf das Raumnutzungsverhalten der zu fördernden Arten grundlegend ändern. Insbesondere in der Planungsphase ist die Berücksichtigung kleinräumiger oder saisonaler Faktoren oft nicht möglich. Das vorgestellte Konzept des aktiven Risikomanagements basiert daher auf einer iterativen Risikobewertung durch ein wiederholtes Monitoring des Vorkommens und der Raumnutzung der Zielarten entlang des gesamten Verkehrsweges und dem daraus resultierenden Einsatz im Vorfeld konzipierter Querungshilfen an den jeweils festgestellten potentiellen Kollisionsschwerpunkten bzw. deren Anpassung an festgestellte Veränderungen. Das Verfahren basiert dabei auf bereits etablierten Monitoring-Verfahren, die seit vielen Jahren im Rahmen der ökologischen Begleitplanung eingesetzt werden. Es wird von uns erstmals im Rahmen eines Bauprojekts der Deutschen Bahn in der Lausitz zum Schutz der dort lebenden Wölfe und anderer Tierarten vor Kollisionen mit Schienenfahrzeugen eingesetzt. Der besondere Vorteil des Risikomanagements mit integriertem Monitoring besteht in der wiederholten Bewertung, Erfolgskontrolle und Anpassung von Querungshilfen bereits in der Planungs- und Bauphase unter Berücksichtigung des gesamten Umfeldes der Verkehrswege. Damit wird ein gezielter und ressourcenschonender Einsatz notwendiger Maßnahmen zur Kollisionsvermeidung möglich.
Poster Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle... 320
Entwicklung der Verbiss- und Schälschäden in Rheinland-Pfalz von 1995 bis 2015 – 20 Jahre Waldbauliches Gutachten bzw.
Forstbehördliche Stellungnahme
Hubert W. Fischer1 und Michael Jochum1
1 Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft, Hauptstraße 16, 67705 Trippstadt, [email protected], [email protected]
Schlagworte: Wildschäden, Waldbauliches Gutachten, Verbiss, Schäle
Seit 1994 werden in den rheinland-pfälzischen Wäldern systematisch Untersuchungen zum Einfluss des wiederkäuenden Schalenwildes auf das Wachstum der Waldbäume durchgeführt. Die Untersuchungen dienen dazu, die Beeinträchtigungen der berechtigten Ansprüche der Forstwirtschaft auf Schutz gegen Wildschäden darzustellen. Nach Landesjagdgesetz haben dazu die Forstämter als Untere Forstbehörden regelmäßig eine Stellungnahme anzufertigen und den Unteren Jagdbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Revierleiter erheben nach vorgegebenen Regeln stichprobenartig das Verbiss- und Schälprozent für die vorkommenden Baumarten. Die Ergebnisse münden in die Waldbaulichen Gutachten bzw. Forstbehördlichen Stellungnahmen. Abhängig von der Schadenshöhe erfolgt eine Gefährdungseinstufung jedes begutachteten Jagdbezirks in die drei Kategorien „nicht gefährdet“, „gefährdet“ und „erheblich gefährdet“. Die Ergebnisse der Forstbehördlichen Stellungnahmen werden zunächst für die Wildarten Rot-, Reh-, Dam- und Muffelwild dargestellt. In einem weiteren Schritt werden die Wildschäden nach Wildarten und den Jagdbezirkstypen „gemeinschaftliche Jagdbezirke“ und „kommunale Eigenjagdbezirke“, „nicht verpachtete staatliche Eigenjagdbezirke“ und „verpachtete staatliche Eigenjagdbezirke“ beleuchtet. Auch die Schäl- und Verbissprozente nach Baumartengruppen werden aufgezeigt. Im Ergebnis zeigt sich, dass landesweit betrachtet die Wildschäden sowohl durch Verbiss als auch durch Schäle nach wie vor (zu) hoch sind. Ein eindeutiger Trend sowohl nach Wildarten wie auch bei Jagdbezirkstypen lässt sich nicht nachweisen. Durch die Novellierung des Landesjagdgesetzes und insbesondere der Landesjagddurchführungsverordnung sind Instrumente (u.a. Verlängerung der Jagdzeiten bei Rot- und Rehwild) geschaffen worden, die Anlass zur Hoffnung geben, dass sich eine dadurch ermöglichte höhere Jagdeffizienz die Wald- Wild-Situation positiv entwickeln kann.
Poster Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle...
321
Wildtierportal Bayern
Katharina Mikschl1, Henning Zimmermann1 und Holger Friedrich1
1 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Lange Point 12, 85354 Freising, [email protected], [email protected], [email protected]
Schlagworte: Wildtierportal, Bürgerplattform, Meldesystem, Wildschaden
Schwarzwild, aber auch andere Arten wie Wildgänse richten regelmäßig Schäden in der Kulturlandschaft an. Häufig sind sie Auslöser für Konflikte zwischen Jägern und Landwirten bzw. Jagdgenossen. Beide Arten breiten sich rasant aus und stellen neue Anforderungen an das jagdliche Management. Um diese Probleme bewältigen zu können, müssen Landwirte und Jäger zusammenarbeiten, um gemeinsam regional angepasste Strategien zu entwickeln. Aufgrund der positiven Erfahrungen, die während eines Vorläuferprojekts gesammelt wurden, führt die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) gemeinsam mit der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft unter Federführung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten das Projekt „ ildtierportal Bayern“ durch. Das Wildtierportal umfasst zwei Komponenten: Einen Webauftritt mit Informationen über die in Bayern lebenden Wildtiere, die Jagd in Bayern, Wildlebensräume, Wildtiere in der Stadt sowie Ausflugsziele. Unter anderem werden Streckendaten und die Ergebnisse des forstlichen Gutachtens in interaktiven Karten zur Verfügung gestellt. Ein weiteres Element des Wildtierportals wurde an der LfL in Zusammenarbeit mit einer externen Softwarefirma entwickelt: Es entsteht eine Bürgerplattform, in der auf Basis eines geografischen Informationssystems Daten abgerufen, eingegeben und ausgewertet werden können. Regionale Arbeitsgruppen, bestehend aus Landwirten, Jägern und weiteren betroffenen Interessensgruppen, erhalten einen Onlinezugang zur Bürgerplattform. Je nach Thematik (z.B. Schwarzwild) können Sichtungen, Schäden, Abschüsse und weitere Elemente in die Karte eingetragen und von allen Arbeitsgruppenmitgliedern eingesehen werden. Die von der Gruppe erhobenen Daten sind geschützt, über ihre Verwendung entscheidet ausschließlich die Arbeitsgruppe. Die zur Verfügung gestellten Daten über Streckenlisten, die landwirtschaftliche Nutzung und andere Informationen lassen sich zusammen mit den erhobenen Daten der Arbeitsgruppen schnell auswerten und in Karten darstellen. So können die Beteiligten vor Ort gemeinsam und auf Augenhöhe regional angepasste Managementkonzepte erarbeiten. Mit der Bürgerplattform wurde ein regional und auf diverse Tierarten übertragbares Instrument geschaffen, das den Arbeitsgruppen hilft, eigenverantwortlich und revierübergreifend Lösungen für Probleme zu finden, mit deren Bearbeitung eine Interessensgruppe alleine schnell an ihre Grenzen stößt.
Poster Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle... 322
Untersuchung zur saisonalen Nahrungsverfügbarkeit und Panseninhaltsanalyse von Rehen in Bayern
Juliane Mitschke1, Martina Scheingraber1, Andreas König1
1Arbeitsgruppe Wildbiologie und Wildtiermanagement, Wissenschaftszentrum Weihenstephan, Technische Universität München, Hans-Carl-von-Carlowitz Pl. 2, 85354 Freising, [email protected]
Schlagworte: Capreolus capreolus, Nahrungsverfügarkeit, Panseninhaltsanalyse
Im Rahmen einer weitangelegten Studie zu Energiegehalt und Qualität der Nahrung von Rehen im Jahresverlauf in zwei unterschiedlich geprägten Habitaten erfolgte eine Betrachtung der vorhandenen Vegetation vor Ort sowie die Analyse der Panseninhalte von 220 Tieren. Während das erste stark anthropogen beeinflusste Untersuchungsgebiet in Niederbayern durch einen großen Anteil an landwirtschaftlich genutzter Fläche geprägt ist („Land“), kennzeichnen die zweite Versuchsfläche im Süden Münchens strukturreiche Fichten-Buchen-Mischwälder („ ald“). Mittels einer zufälligen Stichprobenziehung in ArcGIS wurden in den Untersuchungsgebieten für die pflanzensoziologischen Aufnahmen Kartierungspunkte erstellt und monatlich kartiert. Während dieser Aufnahme wurden an jedem Punkt im Radius von 0,5 m2 vorkommende Pflanzenarten sowie deren Vitalität/Qualität aufgenommen. Mithilfe der Panseninhaltsanalyse wurde Auskunft über die inhaltlichen Bestandteile des letzten Retentionszeitraumes sowie deren verschiedenen prozentualen Anteile gewonnen. Diese Untersuchung fand in Anlehnung an Onderscheka und Jordan (Die Bodenkultur – Journal für Landwirtschaftliche Forschung, Band 27, Heft 2, 1976. Österreichischer Agrarverlag Wien) mithilfe von Analysesieben und via makroskopischen Vorgehens statt. Für die Auswertung der Pflanzensoziologischen Aufnahmen sowie die Panseninhaltsanalysen wurde eine meteorologische Einteilung der Jahreszeiten verwendet. Mit Hilfe der durchgeführten Kartierung wurde eine deutliche Differenz hinsichtlich der Vegetation zwischen den Untersuchungsgebieten abgeleitet. Innerhalb beider Gebiete konnten verschiedenste Äsungspflanzen festgestellt und in ihrer Qualität als gut bis sehr gut für das Rehwild bewertet werden. Auf beiden Untersuchungsflächen stellt Weichäsung (v.a. Kräuter) ganzjährig einen entscheidenden Bestandteil der Nahrung dar, wobei im Land ebenfalls Feldfrüchte und Baumfrüchte sowie im Wald auch Kryptogamen (v.a. Pilze) geäst werden. Bezüglich des Vorhandenseins vor Ort und der Aufnahme durch die Rehe zeigt sich für Tanne eine große Präferenz.
Poster Session 28: Wer will Bambi? Wildtiere zwischen ökologischer Rolle...
323
Saisonelle Qualität und Energiegehalt der Nahrung von Rehen aus einem landwirtschaftlichen und einem forstlich geprägten Revier in
Bayern
Martina Scheingraber1, Wilhelm Windisch2, Andreas König1
1Arbeitsgruppe Wildbiologie und Wildtiermanagement, Wissenschaftszentrum Weihenstephan, Technische Universität München, Hans-Carl-von-Carlowitz Pl. 2, 85354 Freising, [email protected] 2Lehrstuhl für Tierernährung, Technische Universität München, Liesel-Beckmann-Straße 2, 85354 Freising
Keywords: Capreolus capreolus, Fasergehalt, Rohnährstoffe, Kulturlandschaft
Der Lebensraum des Rehwildes (Capreolus capreolus), die in unseren Breiten am häufigsten vorkommenden Wildwiederkäuerart, hat sich mit zunehmender Bewirtschaftung unserer Landschaft stark verändert. Die heute von Agrarflächen durchzogenen oder umgebenen Waldgebiete bieten dem Reh nicht nur mehr Lebensraum, sondern führen auch zu einem stark veränderten Nahrungsspektrum. Inwieweit sich diese veränderte Nahrungszusammensetzung auch auf die Energieversorgung und die Qualität der Nahrung für das Rehwild auswirkt ist noch unzureichend geklärt. Besonders in Zeiten der Nahrungsknappheit, dem späten Winter bis Frühling, welche außerhalb der Jagdzeiten liegen, besteht noch Forschungsbedarf. Entscheidend ist aber, dass die Nahrungsselektion des Rehwildes und mögliche Notzeiten für Land- und Forstwirtschaft von großem Interesse sind, da gerade hierdurch großer Schaden an land- und forstwirtschaftlichen Flächen entstehen kann. Um diese Fragen ausreichend zu erklären, wurde im folgenden Projekt der Energiegehalt und die Qualität der aufgenommenen Nahrung von Rehen analysiert. Dies wurde in zwei sich stark voneinander unterscheidenden Untersuchungsgebieten, einem landwirtschaftlich und einem forstlich geprägten Gebiet in Bayern vorgenommen, um einen detaillierten Vergleich ziehen zu können. Hierfür wurden die Tiere im Rahmen der Jagdausübung ganzjährig erlegt und beprobt. Der Panseninhalt der Tiere wurde mit den Standardverfahren der Futtermittelanalytik (Weender-Verfahren, VanSoest-Verfahren und Hohenheimer Futterwerttest) auf Zusammensetzung der Rohnährstoffgehalte, Fasergehalte und Energiegehalte untersucht. Ergänzend wurden folgende Parameter des Pansensafts: flüchtige Fettsäuren, Ammoniak-, Laktatgehalt sowie pH-Wert gemessen. Die Summe der Ergebnisse liefern konkrete Aussagen über die Nahrungssituation und Nahrungsverfügbarkeit der beiden Reviere im Jahresverlauf und offenbaren die große Plastizität und Anpassung des Rehwildes in unserer Kulturlandschaft.
Vorstellung des neuen Graduiertenkollegs ConFoBi der Universität Freiburg 324
Conservation of Forest Biodiversity in Multiple-Use Landscapes of Central Europe (ConFoBi): A new DFG Research Training Group
Ilse Storch1
1University of Freiburg, Chair of Wildlife Ecology and Management, Tennenbacher Str. 4, 79106, Freiburg i. Br., Germany, [email protected]
Keywords: ConFoBi, forest biodiversity, interdisciplinary research, multi-scale studies
The Research Training Group ConFoBi of the Albert-Ludwigs University of Freiburg presents an inter- and transdisciplinary biodiversity research and qualification programme which draws its novelty from the combination of multi-scale ecological studies on forest biodiversity with social and economic studies of biodiversity conservation. The added value of this integrative approach will additionally be underpinned by a translational set up, oriented at establishing a lively exchange of expertise between scientific research and the demands of forestry and conservation practice. ConFoBi will focus on the effectiveness of structural retention measures, namely habitat trees and dead wood, for biodiversity in multi-functional forests of Central Europe, using the Black Forest as a model system. ConFoBi will explicitly concentrate on the influences of the landscape context and the socio-economic context on the effectiveness of retention measures to maintain biodiversity in multi-functional forests. Moreover, it will identify how conservation can effectively be integrated with other forest uses in a translational approach in close cooperation with the forestry and conservation sectors. To maximise interdisciplinary synergies, ConFoBi researchers will work in a common pool of 135 study plots distributed along gradients of forest structure and connectivity. ConFoBi comprises 4 Research Modules: A will provide tools for Multi-Scale Assessment of Structures ranging from trees to landscapes; B will focus on linkages between Structures and Forest Biodiversity by studying components of biodiversity along gradients of forest structure and connectivity; C will use social science and economic approaches to assess Human Dimensions of Forest Biodiversity such as opportunity costs and stakeholder perceptions; D will focus on the interface between science and society in order to study and foster Integration and Translation between ConFoBi and forest management; Within this framework, ConFoBi formulates two lead questions, studied in Research Modules A-C: 1) What is the contribution of the landscape context to the effectiveness of retention for conserving biodiversity in multi-functional forests? 2) What is the role of the socio-economic context for the integration of such measures in forest management? Module D will integrate results across A-C and provide for a transdisciplinary setup with interaction between researchers and external partners from the forestry and conservation sectors.
Vorstellung des neuen Graduiertenkollegs ConFoBi der Universität Freiburg
325
ConFoBi: Evidence-based biodiversity management of forests
Carsten F. Dormann1
1University of Freiburg, Chair of Biometry and Environmental System Analysis, Tennenbacher Str. 4, 79106 Freiburg i. Br., Germany, [email protected]
Keywords: biodiversity management, ConFoBi, evidence-based guidelines, systematic review
The slow growth of forests makes accumulation of understanding of how forests respond to management a trans-generational task. Experience has accumulated locally, passed on from one forest manager to the next. Since the 19th century forest scientists have attempted to generalise this knowledge, e.g. through comparisons of national inventories, replicated experiments, or training networks for foresters, and also biodiversity has become an important issue in recent years. Within the DFG-funded Research Training Group ConFoBi, we will evaluate the documented global knowledge on temperate forest management for biodiversity to develop evidence-based guidelines, a gap identified by practitioners. Essentially, this project comprises a systematic review of field studies linking forest management to biodiversity, sounding of practitioner perspectives on the value of scientific evidence and an expert-driven development of guidelines for biodiversity management in forests. The second step, confronting scientific evidence with the perspectives represented by practitioners, will identify the key elements required for any translation of scientific evidence into practice. We shall contact practitioners individually, using a combination of open and multiple-choice questions to gauge (a) what they think are key processes and management activities for forest biodiversity (plants, birds, insects); (b) how they rate the scientific evidence from outside the region; and (c) what the main constraints are impeding the implementation of foreign or own knowledge in forest management. Next, we shall be able to tackle the development of regionally specified guidelines, which cannot be undertaken by academics but needs to be driven by practitioners. Literature evidence may transfer to some extent, but management needs to be locally specified, thus requiring the consideration of local context. Thus, guidelines have to fill in the gaps left by academic studies, outline recommended practice in situations where context demands nuanced practice, and respect working experience. Our project will be a milestone in the cooperation between forestry academics and managers and hence worth pursuing. It will provide the scientific knowledge on temperate forest management for biodiversity, condensed into a best evidence statement and a critique of its regional applicability by practitioners.
Vorstellung des neuen Graduiertenkollegs ConFoBi der Universität Freiburg 326
Local biodiversity knowledge and forest conservation practices
Ulrich Schraml1, Georg Winkel2
1Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abteilung Wald und Gesellschaft, Günterstalstraße 61, 79100 Freiburg, [email protected] 2European Forest Institute, Yliopistokatu 6, 80100 Joensuu, Finland, [email protected]
Keywords: forest owner, nature protection, survey, ConFoBi
Forest practitioners (private forest owners and their employees, forestry service staff, contractors) are the persons to implement biodiversity conservation objectives in forest management. Yet, a systematic and broad analysis of the local (traditional) ecological knowledge of forest practitioners and, more specifically, related practices has not been conducted in the German context. The presented project will address these gaps within the DFG funded post graduate programme on the conservation of forest biodiversity (ConFoBi) and will analyze (1) the perceptions and the local (traditional) ecological knowledge of forest practitioners related to forest biodiversity conservation and management practices, (2) the motivations of forest owners related to the management of their forests ranging from economic rationality to different types of ‘culturally entrenched’ beliefs, and (3) the biodiversity conservation practices forest practitioners do undertake. The project will progress in three distinct phases: (1) A systematic review of the available literature on local (traditional) knowledge of forest practitioners. (2) Qualitative interviews combined with joint visits of forest sites in order to understand local (traditional) ecological knowledge and related practices. (3) A quantitative, representative mail survey will be used in order to strive for a quantification of derived patterns, also with regard to social, economic and ecological gradients.
Vorstellung des neuen Graduiertenkollegs ConFoBi der Universität Freiburg
327
Professional epistemologies & the integration of biodiversity-related knowledge into socio-political decision-making
Michael Pregernig1
1University Freiburg, Tennenbacher Str. 4, 79085 Freiburg, [email protected]
Keywords: biodiversity; knowledge utilisation; transdisciplinarity
The disciplinary integration of scientific knowledge and its translation into application systems has frequently been pledged, but science-policy studies indicate that the interface between science, policy and praxis is often not effective.(1) As part of the DFG Research Training Group “Conservation of Forest Biodiversity in Multiple-Use Landscapes of Central Europe (ConFoBi)”, this newly started project strives to address the question under which conditions specific stocks of biodiversity-related knowledge are taken up – or maybe even created – in different societal decision contexts. In theoretical terms, the project proposes to develop a framework built on the concept of ‘professional epistemologies’, i.e. the institutionalized practices by which members of different professional communities test and deploy knowledge claims used as a basis for their decision-making(2). The project is built on the hypothesis that both within the field of biodiversity science and the different areas of biodiversity policy and management in a broader sense there are clearly distinguishable professional epistemologies that have an impact on problem definition, agenda setting as well as the formulation and implementation of problem-solving strategies. The project will use a qualitative-interpretative approach building on document analysis, expert interviews, and participatory observations in the broader ConFoBi research area. Research will proceed in three empirical steps: (i) reconstruction of disciplinary ‘thought styles’(3) of selected disciplines represented in ConFoBi and comparison of discipline-specific inner-scientific practices and interactions with non-scientists; (ii) reconstruction of specific ‘knowledge orders’(4) of selected decision-making contexts in which conservation-relevant organizations (incl. state or private forest enterprises, forest administrations, nature conservation associations) draw on insight from biodiversity research to guide or contextualize their decisions; (iii) systematic comparison of different disciplinary thought styles and organizational knowledge orders to gain insights on how specific professional epistemologies mediate the effectiveness of distinct approaches of interdisciplinary integration and knowledge translation. In the end, the project will help to clarify how biodiversity knowledge is represented, under what circumstances science can provide decision-relevant knowledge and where and how a translational approach has to take account of specific institutional contexts and related thought-styles and knowledge orders. (1)Pregernig 2014. Framings of science-policy interactions and their discursive and institutional effects: examples from conservation and environmental policy. Biodiversity and Conservation, 23/14, 3615-3639. (2)Jasanoff 2005. Designs on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States. Princeton University Press. (3)Reckwitz 2002: Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing. Europ J Social Theory 5:243-263. (4)Mayer 2006. Biodiversity: The appreciation of different thought styles and values helps to clarify the term. Restor. Ecol. 14:105-111.
Vorstellung des neuen Graduiertenkollegs ConFoBi der Universität Freiburg 328
ConFoBi: Economic valuation of biodiversity-oriented forest management strategies
Marc Hanewinkel1
1University of Freiburg, Chair of Forestry Economics and Forest Planning, Tennenbacher Str. 4, 79106 Freiburg i. Br., Germany, [email protected]
Keywords: biodiversity value, ConFoBi, forest management strategies, retention measures
The Millenium Ecosystem Assessment classifies biodiversity as an existence value under the non-use values. However, research shows the important values the world’s ecosystems deliver to societies. If forest owners or forest managers have to be convinced to modify forest management in order to enhance biodiversity, the economic effects of the modified management strategies have to be disclosed. Within the DFG-funded Research Training Group ConFoBi we will address the hypothesis that orienting forest management towards biodiversity has economic implications that can be quantified on different spatial scales. The value of biodiversity can be expressed as an opportunity cost within a simulation-optimization approach to account for multiple goods and services in the management of pure and mixed stands of Norway spruce. Research questions will focus on opportunity costs of retention measures, and in particular habitat trees and dead wood, to enhance biodiversity in forest ecosystems. Major forest ecosystems in the study area will be assessed and stratified in terms of forest types using information on the 135 ConFoBi study plots and inventory data in the surrounding landscapes. The forest types will then be modelled on different spatial scales using a distance-dependent single-tree growth simulator and applying an array of silvicultural strategies, including “business as usual”- approaches as well as different retention levels. Using results of other ConFoBi projects, the effects of the various strategies on biodiversity will be quantified to find optimal potential strategies to enhance biodiversity. Different components of biodiversity, expressed as specific biodiversity indices, will be assessed and modelled together with retention strategies. Further, we will assess whether forest management measures explicitly oriented towards threatened species, such as retention of nesting trees and dead wood for woodpeckers and other cavity nesters, and of old and open conifer-dominated stands for capercaillie, to enhance biodiversity. Based on this adaptive simulation-optimization approach, the opportunity costs of retention strategies compared to standard production-oriented management schemes will be assessed for several standard economic parameters (net present values, annuities, land expectation values). The marginal utility of different retention levels will be calculated to support an economically efficient choice of habitat trees and dead wood volumes.
Vorstellung des neuen Graduiertenkollegs ConFoBi der Universität Freiburg
329
Remote sensing based methods for the assessment of forest structures (ConFoBi - A1)
Barbara Koch1
Chair of Remote Sensing and Landscape Information Systems, University Freiburg, Tennenbacher Strasse 4, 79106 Freiburg; [email protected]
Keywords: structural elements, multi-scale, biodiversity, remote sensing
Background - Assessment and monitoring of biodiversity are part of effective forest management. Multi-scale structural diversity has been promoted as an indicator of bio-diversity. Accordingly, abundance, heterogeneity, and spatial distribution of structural elements such as habitat trees as well as the amount and decay stage of dead wood, will be assessed as predictors of biodiversity components in all ConFoBi Module B projects. Study Questions - Multi-sensorial remote sensing (RS) may allow adapted measurement and modelling of structural elements across scales and through times. Major study questions are: What is the most adequate, multi-scale RS constellation to provide parameters
representing abundance, quality and distribution of structural retention elements? What are the best procedures to link the terrestrial information with the multi-scale RS
information? Which algorithms and new processing approaches are needed to achieve high quality
information for modelling structural elements from the different RS constellations? How can RS based information support a set of rules that indicates the degree of
biodiversity? Approach and Methods - Sensitivity of the modelled structural parameters as biodiversity indicators will be validated for their use in B projects. The aim is to weight the structural input parameters according to their sensitivity within a biodiversity classification in order to find an optimal set of structural parameters. Virtual reality visualization will be applied to selected plots and trees. This allows a visual representation of typecast examples. Modelled parameters will be provided to all ConFoBi projects. Outputs and Linkages - A1 will provide multi-scale structural data for all 135 study plots Perspectives - For RTG phase II, A1 will consider an advanced monitoring concept of forest structures. Monitoring concepts require multi-temporal data sets and special alignment of different data sets and appropriate change detection algorithms to avoid artefacts.
Vorstellung des neuen Graduiertenkollegs ConFoBi der Universität Freiburg 330
Retention of structural elements in selectively harvested forests
Patrick Pyttel1 and Jürgen Bauhus1
1Professur für Waldbau, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tennenbacher Straße 4, 79106 Freiburg, [email protected]
Keywords: retention, microhabitats, biodiversity, conservation
Live or dead standing trees that provide particular ecological niches, also called microhabitats are defined as habitat trees. Owing to the rarity and discontinuity of these microhabitats in managed forests, many of the species that rely on these are also rare and threatened or have become locally extinct. Our project is focusing on the effects of different levels of structural retention on the number of habitat trees and volume of dead wood per ha, its spatial pattern, and the determinants of microhabitat structures in 135 one hectare plots. Our specific hypotheses are that i) the abundance of habitat trees and dead wood and related habitat features depends on management history and landscape context; ii) the frequency and quality of microhabitat structures and thus habitat trees depends on tree attributes (age, dimension, species, etc.) and the neighbourhood situation; iii) the spatial distribution of retained habitat trees affects their longevity. In our study we will conduct a spatially explicit terrestrial inventory of structural diversity comprising elements in semi-natural forest stands. Full stand inventories will specifically include microhabitat features. Recent management intensity of our 135 study stands will be quantified using an Index of Forest Management Intensity. By using information of species occurrences, abundances, and activities we will simulate the effects of different retention strategies on habitat provision for different harvesting scenarios. Our project is one part of the research training group ‘Conservation of Forest Biodiversity in Multiple-Use Landscapes of Central Europe – ConFoBi’ which is founded by the German Research Foundation (DFG). Jointly with other ConFoBi subprojects, we will examine the use of microhabitats in habitat trees by different species groups. Based on the spatial mapping of microhabitats and the presence and abundance of different species that use them, the effectiveness of habitat tree retention density and patterning will be assessed.
Vorstellung des neuen Graduiertenkollegs ConFoBi der Universität Freiburg
331
Underlying mechanisms of vegetation change and diversity in retention forestry
Michael Scherer-Lorenzen1
1Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fakultät für Biologie, Abt. Geobotanik, Schänzlestr. 1, D-79104 Freiburg, [email protected]
Keywords: forest structure, plant diversity, understorey vegetation, light heterogeneity
Applying retention measures to enhance structural elements in rather homogeneous, even-aged stands alters microclimate and resource availability to which plants respond sensitively. Introducing structural diversity by creating gaps, or by leaving habitat trees, will affect light quality and quantity, wind speed and air humidity, soil temperature and moisture, litter input, and hence nutrient availability at the forest floor. Particularly, the spatio-temporal variability of light intensity at the forest floor is usually increased in structurally more complex forest stands. Thus, the complex interplay of these changes results in altered resource availability for plants and hence competitive advantages of certain species over others. Therefore, understorey plant diversity sensitively reacts to retention measures. Less known are the influence of the landscape context, as well as the relative contributions of the different resources axes and their variability for understorey diversity. In this project, which is part of the DFG Research Training Group ConFoBi (Conservation of Forest Biodiversity in multiple-use landscapes of Central Europe), we aim to mechanistically understand the role of retention measures (with a focus on habitat trees) and their landscape context (forest connectivity) for plant diversity by disentangling various effects of abiotic changes on plant performance. We hypothesize that a) plant diversity is influenced by habitat trees, due to their complex canopy architecture, and by standing deadwood, due to reduced presence of leaves and twigs, which alter light conditions, soil water availability and organic matter input and mineralization compared to structurally more homogeneous stands, and b) that diversity of typical forest plants profits from light heterogeneity, but only at overall low light levels, whereas simply increasing light availability will favour ruderal generalists. In addition, we will determine the relative importance of light vs. soil resource heterogeneity for understorey vegetation diversity, hypothesizing a dominant effect of light. We will record the spatial distribution of understorey higher plants and ground-dwelling mosses within each of the 135 study plots. Light conditions and soil resource availability will be monitored at high spatial and temporal resolution. These measures will be correlated to plant performance, quantified on several biological hierarchies from leaf, to whole-plant and community.
Vorstellung des neuen Graduiertenkollegs ConFoBi der Universität Freiburg 332
ConFoBi: Epiphyte and microhabitat diversity and function on habitat trees
Albert Reif1 und Stefanie Gärtner2
1University of Freiburg, Chair of Site Classification and Vegetation Science, Tennenbacher Str. 4, 79106 Freiburg i. Br., Germany, [email protected] 2Black Forest National Park, Department Ecosystem Monitoring, Research and Conservation, Schwarzwaldhochstraße 2, 77889 Seebach, Germany, [email protected]
Keywords: ConFoBi, epiphyte microhabitats, habitat trees, light management
Habitat tree retention is currently being practiced in central Europe to provide microhabitats and conserve biodiversity. The long-term persistence of perennial plant structures, particularly tree stems is essential due to the slow growth of most epiphytes. Since the surface area of these structures normally exceeds that of the ground area in forests, they greatly extend the area available for colonization by plants. Epiphytes are part of the floristic diversity in forests, and threatened lichens in particular depend on forest habitats. Forest management plays a key role in retention of suitable habitat trees and in maintaining a suitable microclimate for epiphytic lichens and bryophytes. While the role of tree species, age, size and microstructures in shaping the epiphytic community is well understood, there is a lack of knowledge regarding the influence played by management history and the surrounding landscape. Within the DFG-funded Research Training Group ConFoBi, our aim is to assess the epiphyte diversity, composition and functional response to forest management and connectivity in landscapes. We will identify and assess epiphytes (lichens and bryophytes) collected from the targeted habitat trees within the 135 ConFoBi plots. We will also assess one habitat tree in each of the 135 plots (micro-structures, epiphytes). In the subsequent years a subset of epiphytes and habitat tree species will be selected. We aim to analyse specific indicator/umbrella species and their relationship to light and also to the surrounding landscape at different scales and explain their distribution pattern using functional traits. As predictors we will use spatially explicit stand structure data and the landscape information (fragmentation, heterogeneity and spatial connectivity between habitat trees) provided by other ConFoBi projects. We aim to develop a monitoring scheme to efficiently assess the diversity of available epiphyte microhabitats and to test its ability to provide conditions for a high diversity of epiphytes. Within this interdisciplinary setup it will be possible to provide experimental evidence for the effects of light management on retained habitat trees and to evaluate this effect on the diversity of epiphytes and specifically on the abundance of indicator species.
Vorstellung des neuen Graduiertenkollegs ConFoBi der Universität Freiburg
333
ConFoBi: Landscape-moderated use of forest structures by bats
Veronika Braunisch1 und Ilse Storch2
1Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg i. Br., Germany, [email protected] 2University of Freiburg, Chair of Wildlife Ecology and Management, Tennenbacher Str. 4, 79106, Freiburg i. Br., Germany, [email protected]
Keywords: bats, ConFoBi, forest structure, landscape patterns
Bats are considered as indicators of forest structural complexity and are frequently selected as target species for conservation programmes integrating key structural elements in forest management. Forest-dwelling bat species use old and dead trees as roosting sites, and forest gaps and linear elements for foraging and commuting. Retention of old-growth structures may be beneficial, yet, as recent studies indicate, their use and usability by bats may strongly depend on the landscape context. Species-specific association of bat occurrence with forest structures has been shown at plot scale (1 ha), yet minimum landscape-scale requirements for abundance and distribution of such structural elements are lacking. Within the DFG-funded Research Training Group ConFoBi, we will relate bat diversity, activity, and type of use to forest characteristics and landscape heterogeneity for the 135 ConFoBi plots. We expect that: The species-specific use of structural elements at the local scale – and thus the
effectiveness of retention measures – will be modulated by the surrounding landscape. Overall bat activity at the plot scale will increase with matrix heterogeneity, permeability
and linear connecting structures. Diversity of species and functional guilds will increase with heterogeneity at both the
forest stand and landscape scale. The use by foraging guilds will be related to the surrounding forest matrix, with a
decreasing amount of gaps and open structures shifting the community towards clutter-tolerant species.
The relative abundance and diversity of forest-specialists will increase with the abundance of old forest (habitat trees) and dead wood in the surroundings.
Forest structure and landscape patterns will be assessed by remote sensing complemented with plot-scale terrestrial mapping. LiDAR-information capturing the 3D-characteristics of sub-canopy space may predict bat occurrence at the stand scale. Using bat-loggers will allow species identification as well as distinguishing hunting from commuting bats. Capturing of bats with mist nets will complement and refine species identification. Assessment of food availability will allow elucidating functional patterns. By relating bat presence and diversity to structural characteristics quantitative threshold values for integrative forest management will be derived.
Vorstellung des neuen Graduiertenkollegs ConFoBi der Universität Freiburg 334
ConFoBi: Multi-scale assessment of bird-forest relationships
Ilse Storch1
1University of Freiburg, Chair of Wildlife Ecology and Management, Tennenbacher Str. 4, 79106, Freiburg i. Br., Germany, [email protected]
Keywords: biodiversity, birds, retention, landscape
Birds are commonly-used indicators of biodiversity: they are popular, well studied, and comparatively easy to survey. Old forest specialists are of particular conservation concern, and are believed to be negatively affected by forestry. Studies of local bird species richness in managed versus natural forests, however, have reported ambiguous results. Because of their mobility, bird communities are likely shaped not only by local forest structure, but also by the surrounding landscape. For old forest species such as three-toed woodpecker Picoides tridactylus and capercaillie Tetrao urogallus, abundance correlates with stand structure; yet, stand structure is an insufficient predictor of species occurrence and hence, of bird species richness. Within the DFG-funded Research Training Group ConFoBi, we will address the overall hypothesis that the effects of stand-scale retention measures for biodiversity on forest bird communities are moderated by the surrounding landscape. We will assess the structural correlates of avian biodiversity at multiple spatial scales by relating plot-scale presence (passerines, woodpeckers, and capercaillie) and species richness (overall, functional groups, red-listed species) of birds to the abundance, heterogeneity and spatial distribution of structural elements (old trees, dead wood, open canopy) at plot, stand mosaic, and landscape scales. We will annually collect data on bird species presence using repeated point-stop counts in spring (passerines) and surveys of indirect sign (woodpeckers, capercaillie) in summer in all 135 ConFoBi study plots and their surroundings. Data will be analysed using multivariate modelling approaches. Resulting models of multi-scale bird-forest relationships will also be validated using existing independent data sets from the Alps. Finally, quantitative threshold values for integrative forest management will be derived. We aim to provide forest managers with quantitative threshold values for the abundance and configuration of stand-scale and landscape-scale structural habitat elements (i.e., old trees, dead wood, open canopy, etc.) in favour of forest bird species and communities.
Vorstellung des neuen Graduiertenkollegs ConFoBi der Universität Freiburg
335
ConFoBi: Diversity and functions of plant-insect interactions
Alexandra-Maria Klein1 und Michael Staab1
1Professur für Naturschutz und Landschaftsökologie, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Universität Freiburg, Tennenbacherstr. 4, 79106 Freiburg, [email protected], [email protected]
Keywords: herbivory, Hymenoptera, trophic interactions
Insect communities and their interactions with plants are structured by an ecosystems habitat properties and the surrounding landscape. However, how landscape complexity such, as forest fragmentation, and local-scale habitat properties, such as habitat trees and amount of dead wood, interact and influence functional insect diversity and the related ecosystem functions is not yet well understood in forest landscapes. In the framework of ConFoBi, the subproject B3 will study insect diversity, particularly in the order Hymenoptera, and different forms of herbivory (chewing, mining, leaf-sucking, gall-building) to test the following hypotheses: (1) diversity of parasitic Hymenoptera increases with increasing number of habitat trees and increasing dead wood amount, while (2) herbivory is negatively influenced through higher top-down control provided by parasitic Hymenoptera. (3) We expect that the plot-scale effects of retention forestry on insect diversity and insect-related functions are influenced by the surrounding landscape. Additionally, we will study fruit removal by birds and hypothesize (4) that the number of habitat trees and the amount of forest in the landscape will increase fruit removal. To collect the necessary data, B3 will expose flight interception traps for sampling flying insects in all 135 ConFoBi study plots and access leaf damage caused by chewing, mining, galling, and sucking insect herbivores. Furthermore, plant galls will be collected to rear gall-makers and their associated parasitoids for studying plant-herbivore-parasitoid interactions. Lastly, to estimate fruit removal by birds, artificial fruits made from modelling clay will be used and fruits with peck marks will be recorded.
Vorstellung des neuen Graduiertenkollegs ConFoBi der Universität Freiburg 336
ConFoBi: Functional connectivity among saprophytic beetles in dead wood patches
Gernot Segelbacher1
1University of Freiburg, Chair of Wildlife Ecology and Management, Tennenbacher Str. 4, 79106, Freiburg i. Br., Germany, [email protected]
Keywords: dead wood, connectivity, eDNA, invertebrates
Within managed forests, locations with dead wood are distributed irregularly. It is unclear what maximum distance between such isolated patches still allows functional connectivity for dead wood inhabiting invertebrates, and whether distance effects are modulated by matrix quality. We here investigate species and genetic diversity for saprophytic beetles within dead wood patches across the landscape in the Southern Black Forest. Additionally we estimate genetic distance between-patches for three invertebrate dead wood specialists with different dispersal ability (short distance, medium distance and long distance disperser) in order to characterize gene flow among patches as a function of abundance, distribution and isolation of dead wood across the landscape and to infer thresholds for functional connectivity between dead wood patches. We hypothesise that (i) species and genetic diversity are positively correlated with patch size, and this effect decreases with increasing connectivity to neighbouring patches; (ii) gene flow, and thus functional connectivity, is a function of inter-patch distance, with the effect size depending on the species’ dispersal ability. Species will be sampled at dead-wood patches of different size and distance. Genetic diversity will be quantified using both eDNA approaches for total diversity as well as species specific markers (SNP) for genetic distance. Matrix characteristics (tree species composition, height, horizontal and vertical structuring) will be obtained by aerial photographs, the amount of coarse woody debris between patches will be quantified by a combination of terrestrial mapping and remote sensing. Based on the resulting functions, quantitative thresholds for patch-size, inter-patch distance and matrix quality will be derived, which will facilitate the implementation and increase the effectiveness of existing dead-wood concepts in forest management.
Autorenindex Abushammala, Hatem 106 Adler, Petra 305 Ahrends, Bernd 82, 310 Ahrens, Finn 278 Albert, Matthias 82 Albrecht, Axel 14, 52, 184 Alvarez, Miguel 228 Amelung, W. 69 Ammer, Christian 20, 138, 145, 288, 299 Andrae, Agnes 35 Andreae, Henning 133 Annighöfer, Peter 299 Antonitsch, Anna 204 Arab, Leila 183 Armbruster, Martin 285 Arnold, Janosch 172 Asche, Norbert 274 Assaye, Habtamu 316 Auch, Eckhard 156 Aufgebauer, Britta 78 Augustin, Nicole 311 Baar, Jan 105 Baber, Kristin 58 Bach, Alexander 235 Bachmann-Gigl, Ute 283 Bachmann, Markus 220 Balcar, Patricia 60, 247 Balkenhol, Niko Bauch, Toralf 172 Bauerle, Taryn 53 Bauhus, Jürgen 50, 52, 58, 69, 135, 140, 236, 245, 250, 286, 315, 330 Baumgärtel, Ralph 43 Becher, Georg 114 Beck, Wolfgang 27 Becker, Gero 104, 124 Becker, Mathias 228 Begehold, Heike 63 Behrens, Thorsten 119, 300 Benneter, Adam 236 Benning, Raphael 81, 133, 139, 310 Berendt, Férreol 255, 262
Berger, Ambros 152 Berger, Uta 296 Beyer, Dörte 233 Bialozyt, Ronald 214, 219, 297 Bieker, Dirk 65, 240
Bierbass, Peggy 250 Birk, Sönke 307 Blanck, Christian 10 Blaschke, Markus 238 Blasko, Lubomir 122 Bleiner, Davide 250 Block, Joachim 76, 77 Blum, Uwe 98 Böcher, Michael 160 Böhling, Kathrin 159 Böhner, Jürgen 139, 310 Bolte, Andreas 30 Borchardt, Peter 316 Borchert, Herbert 98, 249, 263, 277, 280 Bormann, Kristin 270 Brandl, Susanne 195 Brandner, Reinhard 111 Brang, Peter 92, 118, 144 Bräsicke , Nadine 225 Braun, Andrea 103
Braunisch, Veronika 167, 242, 333 Breinig, Lorenz 293 Briegel, Ferdinand 71 Brodowski, Johannes 180 Brokmeier, Henrik 87 Brötz, Johannes 141 Brüchert, Franka 293 Brüllhardt, Martin 234 Bublitz, Thomas 229 Bugmann, Harald 23, 26, 48, 118, 234, 301 Bünemann, E. 69 Buras, Allan 194 Burger, Frank 102, 283
Burger, Steffi 230 Burggraef, Levent 195 Burghardt, Friedrich 167
Autorenindex
Bursche, Vanessa 235 Busch, Timo 295 Buse, Jörn 60, 307
Bußkamp, Johanna 38
Butterbach-Bahl, Klaus 104 Byun, Jae-Gyun 235 Calabro, Sandra 307 Carl, Christin 7
Carneiro, Alex 246 Caspari, Steffen 247 Castellnou, Marc 22 Chen, Lin 287 Chmara, Sergej 200, 306 Choge, Simon K. 228 Cioldi, Fabrizio 142 Ciuti, Simone 172 Coppes, Joy 167 Corre, Marife D. 239, 287 Cremer, C. 138 Cremer, Eva 15 Cremer, Maike 8 Cremer, Tobias 122 Creyaufmüller, Carolin 210, 215 Czajkowski, Tomasz 30 Dacasa-Rüdinger, Maria del Carmen 19, 189, 192 Daenner, Max 121 Dalüge, Guido 172 Damette, Olivier 117 Dammann, Inge 128, 309 Dănescu, Adrian 52
Datta, Pawan 305, 313 de Avila, Angela Luciana 315 de Carvalho, João Pereira 315 Dees, Matthias 305, 313 Degenhardt, Annett 120 Deike, Sebastian 89 del Val Alfaro, Esther 307 Delb, Horst 39, 207, 210, 212, 217, 218, 229 Demant, Burkhard 312 Demant, Laura 243
Demuth, Bernd 269 Díaz-Pinés, Eugenio 104 Dieter, Matthias 94, 116 Dietrich, Hans-Peter 27, 202
Dietz, Elke 98, 126, 249, 263, 283
Dietz, Hans-Ulrich 83, 256
Dister, Emil 43 do Carmo Lopes, José 315 Dög, Markus 94, 264 Dohrenbusch, Achim 289 Dolos, Klara 11 Dormann, Carsten F. 79, 325 Dotterweich, Markus 222 Dounavi, Aikaterini 209, 210, 217, 218 Dreiser, Christian Dreiser, Christoph 307 Duelli, Peter 55 Düggelin, Christoph 142 Dühnelt, Petra 311 Dunger, Karsten 141 Ebeling, Corinna 88
Ebert, Cornelia 168 Ehbrecht, Martin 237 Ehrhart, Hans-Peter 60, 182 Ehrhart, Stefan 171 Eibenstein, Tobias 303 Eichel, Peter 216 Eichhorn, Johannes 80, 131 Eickenscheidt, Nadine 129, 311 Eilers, Christina 96
Elliger, Andreas 172 Elmer, Michael 65, 240 Enderle, Rasmus 40
Engel, Falko 68
Englert, Hermann 30, 116 Erler, Jörn 85 Ermisch, Niels 31 Evers, Jan 131 Evertz, Kirsten 212 Ewald, Jörg 44
Falk, Wolfgang 194, 195, 238 Faßnacht, Fabian 11
Autorenindex Feger, Karl-Heinz 81, 290 Feldmann, Eike 51, 59 Feng, Yongshun 105 Fey-Wagner, Christina 284 Fichtner, Anna 108 Fink, Siegfried 252 Fischbacher, Urs 177 Fischer, Anton 47, 67
Fischer, Hagen S. 47, 67, 134 Fischer, Hubert W. 285, 320 Fischer, Richard 162 Flade, Martin 63 Fleck, Stefan 82
Flores, Ulises 317 Forrester, David 50
Förschler, Marc 307 Förster, Antje 225 Förster, Bernhard 126, 238, 275 Frank, Georg 147, 149, 241 Friedrich, Holger 321 Frischbier, Nico 24, 180
Fritzlar, Dirk 148 Frossard, E. 69 Fründ Heinz-Christian 88 Fussi, Barbara 15, 193 Gabriel, Martin 197 Gaertig, Thorsten 88 Gallaun, Heinz 313 Gärtner, Stefanie 62, 179, 307, 332 Gauer, Jürgen 76, 77, 119 Gebauer, Kathrin 291 Gebhardt, Timo 20
Gellrich, Katharina 197 Gemballa, Rainer 300 George, Jan-Peter 16 Geppert, Uwe 53 Gerber, Kristin 136 Gerst, Johannes 93
Gessler, Arthur 23 Gille, Malte 181 Glaser, Peter 112 Glatthorn, Jonas 51, 59
Gober, Edna 204 Göckel, Christoph 229 Goisser, Michael 53
Gößwein, Sebastian 224 Göttlein, Axel 72, 128, 130, 308, 309 Gräber, Reinhild 173 Grabner, Michael 16 Graf-Rosenfellner, Markus 71, 272 Grams, Thorsten 53 Graw, Ines 37
Greve, Martin 76, 77, 132
Grill, Franz 168 Grote, Ruediger 104 Grotehusmann, Helmut 101 Grulke, Markus 103 Grüneberg, Erik 129 Grünberger, Jochen 257 Grüner, Jörg 252 Gugler, Thomas 292 Günter, Sven 162 Günther, Björn 291 Haas, Edwin 104 Haas, Johannes 86
Häberle, Karl-Heinz 10, 20, 53 Habermann, Michael 37 Haeler, Elena 54 Hagen, Robert 167 Halbig, Paula 39
Handschuh, Markus 172 Hanewinkel, Marc 23, 328 Hansen, Jan-Hendrik 297 Hapla, František 181 Hardtke, André 191 Hargita, Yvonne 162 Hartmann, Hans 98, 277, 279, 280, 281, 282 Hartmann, Kai-Uwe 19 Hastreiter, Holger 31 Hauck, Andrea 264 Hauck, Markus 51, 59 Hauer, Larissa 222 Hauhs, Michael 78
Autorenindex
Heiland, Stefan 269 Heim, Janina 160 Heinrich, Bernd 257 Heller, Gereon 228 Hellwig, Lukas 89 Henning, Lea 154 Hentschel, Rainer 36, 205
Hercher, Wolfgang 31 Herold, Philipp 122 Herrmann, Mathias 63 Herschbach, Cornelia 73 Herzog, Sven 319 Hesse, Benjamin 10 Hesselbach, Willy 110 Hetemäki, Lauri 4
Hettich, Ulf 166 Heurich, Marco 123 Heyner, Frank 24 Hickler, Thomas 2
Hilbrig, Lutz 311 Hill, Steven 123 Hinte, Bastian 261 Hinze, Jonas 208 Hirsch, Ninett 233 Hittenbeck, Anika 219 Hittenbeck, Jörg 85, 87, 89
Hock, Christina 264 Hoffmann, Stephan 90
Hofmann, Jan-Hendrik 95 Hofmann, Martin 101 Hofmann, Nicolas 280 Hohmann, Ulf 166, 168 Holm, Stefan 178 Holmgren, Johan 153 Honert, Carolin 275 Horn, Hendrik 100 Hornicek, Stanislav 105 Huber, Gerhard 185 Huckschlag, Ditmar 166 Hug, Joachim 108 Hüller, Wolfgang 189 Hülsmann, Lisa 118
Huth, Franka 45
Hüttl, Karl 249, 263 Immitzer, Markus 196, 298 Isermann, Klaus 253 Isermann, Renate 253 Jacke, Heribert 87 Jacob, Frank 133 Jaeger, Dirk 84, 90, 97, 124, 255, 262, 317 Jain, Teresa 22 Jakoby, Oliver 33
Jansen, Martin 251 Janßen, Alwin 101, 284, 291 Janzen, Niels 163, 294 Jetschke, Gottfried 7 Jochem, Dominik 114, 294 Jochum, Michael 320 John, Reinhold 206, 207, 208, 217, 218 John, Volker 187 Julich, Stefan 81
Kadolsky, Marianne 192 Kahl, Tiemo 58
Kaiser, K. 69 Kammerer, Bernd 108 Kandeler, E. 69 Kändler, Gerald 40, 62, 74, 139, 302 Kantelberg, Valerie 271, 275 Kapp, Gerald 158 Karanitsch-Ackerl, Sandra 16 Karl, Nadine 83 Kasten, Alina 292 Kätzel, Ralf 29
Kaufmann, Stefan 51, 59
Kayser, Jürgen 62 Keth, Peter 247 Kimmich, Christian 177 Klatt, Susann 136 Klein, Alexandra-Maria 335 Klein, Daniel 115 Klemmt, Hans-Joachim 126 Klumpp, Raphael T. 16 Knautz, Timm 235
Autorenindex Knoke, Thomas 21, 146, 198
Knutzen, Florian 9 Kob, Philipp, 319 Köbel, Robin 251 Koch, Barbara 97, 305, 313, 329 Koch, Gerald 105 Koch, Marc 271, 275 Köhl, Michael 151 Köhler, Frank 240, 247 Kohler, Martin 128, 135, 250, 309 Kohlpaintner, Michael 72
Kolb, Eckart 130, 308 Kolb, Jürgen 198 Kölling, Christian 139, 194, 310 König, Andreas 322, 323 Konnert, Monika 15, 185
Körner, Michael 100 Köthke, Margaret 116 Kownatzki, Dierk 243 Krabel, Doris 221, 291 Krämer, Klara 235 Kratzer, Raffael 307 Kraus, Daniel 22, 41, 64
Krause, Stuart 314 Kreft, Holger 5
Kreuzwieser, Jürgen 104, 210, 215 Krüger, J. 69 Krumm, Frank 41, 64 Küchenmeister, Hans 12
Kühne, Bianca 225 Kukulka, Florian 143 Kunz, Jörg 245, 286 Kuptz, Daniel 98, 277, 279, 280, 281, 282 Kurth, Winfried 101 Kutnar, Andreja 105 Laborie, Marie-Pierre 106, 108, 109 Lachat, Thibault 54, 55 Lang, Friederike 57, 69, 71, 74, 86, 88, 99, 252, 272 Landes, Lea 74 Lanz, Adrian 154 Latifi, Hooman 123
Lattke, Frank 113 Lauer, Amelie 129 Lautenschläger, Laura 292 Lehmann, Christoph 122 Leipold, Sina 165 Lemme, Hannes 211 Leuschner, Christoph 9, 51, 59 Liepe, Katharina 17
Liesebach, Mirko 17, 190 Linderoth, Peter 172 Lindner, Katharina 223 Lingenfelder, Marcus 97
Linnemann, Britta 65, 240 Linsenmann, Peter 293 Linz, Martin 74 Lipp, Sebastian 147, 241 Listing, Martin 80
Lobinger, Gabriela 34, 203
Loewen, Achim 278 Löffler, Sonja 29 Loock, Bernhard 203 Loos, Götz Heinrich 232 Lotycz, Aneta 161 Ludemann, Thomas 268 Lüderitz, Matthias 63 Luick, Rainer 96, 269, 276 Lupp, Gerd 271, 275 Luthardt, Vera 233 Lutter, Carina 243 Maack, Joachim 97 Mack, Robert 279 Magg, Nora 242 Malets, Olga 164 Malombe, Itambo 228 Manghabati, Hadi 72 Mann, Peter 49
Märkel, Ulrike 11
Marschnig, Martina 35 Martens, Sven 12 Matheka, Kennedy W. 228 Matschulla, Franz 213, 220 Matyssek, Rainer 10, 20, 53
Autorenindex
May, J. 201 Mayer, Konrad 16 Mazzei, Lucas 315 Meesenburg, Henning 82, 131, 139, 310 Meier, Dietrich 105 Meißner, Marcus Meiwes, Karl Josef 128, 309 Mellert, Karl H. 130 Mendel, Theresa 280, 281, 282 Merforth, Carsten 174 Mergner, Ulrich 41, 64 Messerer, Katharina 21, 146 Mette, Tobias 139, 194, 195, 238, 310 Metzler, Berthold 40 Meyer, Matthias 291 Meyer, Peter 42, 118, 144, 243 Michiels, Hans-Gerhard 244 Michler, Barbara 47, 67, 134 Mikschl, Katharina 321 Mikutta, R. 69 Militz, Holger 110 Mitlöhner, Ralph 156 Mitschke, Juliane 322 Möhring, Bernhard 93, 243 Mölder, Andreas 42
Molina-Herrera, Saúl 104 Möller, Georg 63 Möller, Katrin 36, 205 Moretti, Marco 55 Morgenstern, Kristin 221 Mortimer, Genevieve 295 Mosandl, Reinhard 185 Müller, Jörg 123 Müller, Jürgen 30, 199, 254 Müller, Ulrich 111 Mund, Jan-Peter 125, 138, 201, 314 Mund, Martina 299 Münder, Kristian 304 Mupepele, Anne-Christine 79
Murach, Dieter 105 Mussong, Michael 95
Nagel, Jürgen 101, 297
Nathkin, Marco 30
Naumann, Johannes 275 Nawrocki, Przemek 41 Németh, Róbert 105 Neophytou, Charalambos 193 Netzer, Florian 73
Neubauer, Mirko 312 Neuner, Johann 102 Nicke, Anka 7 Niederberger, Jörg 135, 250 Niemann, Anne 112 Nikolova, Petia 27 Obrist, Martin K. 55 Oehmichen, Katja 136 Oettel, Janine 147, 241 Olschewski, Roland 176, 266 Opferkuch, Martin 124 Ottermanns, Richard 235 Otto, Lutz-Florian 213, 220, 226, 227, 296 Otto, Peter 58 Paar, Uwe 131 Pařil, Petr 105 Paschke, Marian 243 Paschová, Zuzana 105 Pasemann, Sven 85
Pauleit, Stephan 271, 275 Peerenboom, Geva 170 Petercord, Ralf 32, 35, 216 Petereit, Annekatrin 297 Peters, Franziska 209 Petersen, Max Lennart 289 Petrokofsky, Gillian 1
Petzold, Rainer 119, 133, 139, 300, 310 Pezzatti, Gianni Boris 55 Pietzsch, Bruno 296 Plašil, Pavel 37, 219 Plugge, Daniel 95 Pokorny, Benno 155 Polaczek, Klaus 303 Polle, Andrea. 69 Pollmeier, Matthias 231
Autorenindex Polosek, Philipp 176 Polster, Jens-Ulrich 221, 319 Popa, Flavius 307 Pozsgayné Fodor, Fanni 105 Pregernig, Michael 327 Pretzsch, Hans 28, 53 Pretzsch, Jürgen 157 Prietzel, Jörg 8, 69 Pritsch, Karin 53 Puhlmann, Heike 139, 310 Pyttel, Patrick 64, 245, 330 Qaliduadua, Setareki 95 Rachow, Christine 197 Rademacher, Peter 105 Raspe, Stephan 121, 202 Rebola Lichtenberg, Jessica 288 Redmann, Martin 91
Reger, Birgit 249 Reichert, Cornelia 35 Reichmuth, Anne 196 Reif, Albert 43, 62, 179, 332 Reinecke, Horst Reiner, Rudolf 169 Reise, Judith 143 Reitz, Georg 49 Rennenberg, Heinz 73, 104, 212 Richter, Klaus 115 Rieckmann, Christoph 190 Riedel, Thomas 154 Riek, Winfried 128, 309 Riggert, Roland 265 Rigling, Andreas 23
Rinderle, Felix 264 Rist, Elisabeth 279 Röder, Arno 139, 310 Rödiger, Kerstin 227 Röhle, Heinz 100
Rose, Bernd 182 Rosenkranz, Lydia 94, 248 Roß-Nickoll, Martina 235 Rotach, Peter 234 Rothe, Andreas 137
Rötzer, Thomas 53 Rougieux, Paul 117 Rousek, Radim 105 Ruck, Georg 233 Rumpf, Hendrik 42 Ruschel, Ademir Roberto 315 Rzanny, Michael 63 Sagischewski, Herbert 200, 306 Saha, Somidh 140 Sauter, Udo Hans 293 Schack-Kirchner, Helmer 74, 86, 252 Schadauer, Klemens 152 Schafellner, Christa 35, 204
Schall, Peter 145 Schardt, Mathias 313 Schaub, Marcus 23 Schebeck, Martin 35 Scheerer, Ursula 73 Scheingraber, Martina 322, 323 Scherer-Lorenzen, Michael 46, 331
Schickhofer, Gerhard 111 Schildbach, Marek 19 Schischmanow, Adrian 125 Schleich, Samuel 214 Schloter, M. 69 Schmid, Pia 292 Schmidt-Walter, Paul 80, 139, 195, 310 Schmidt, Karsten 119 Schmidt, Marcus 42, 239, 287 Schmidt, Marie-Spohie 276 Schmidt, Matthias 13, 25, 195, 214, 219, 297
Schmiedtlein, Sebastian 11 Schnaible, Florian 84
Schneck, Volker 190 Schneider, Erika 43 Schnell, Sebastian 153 Schnitzler, Jörg-Peter 104 Schockenhoff, Eberhard 3
Schölch, Manfred 150 Schoneberg, Sebastian 13
Schoof, Nicolas 62
Autorenindex
Schopf, Axel 35, 39 Schraml, Ulrich 170, 171, 273, 326 Schramm, Lorenz 272 Schreiber, Kathrin 277 Schreiber, Roland 271, 275 Schröck, Hans-Werner 132 Schröder, Jens 36, 205 Schubert, Alfred 194 Schuck, Andreas 41, 63 Schuck, Julius 76 Schuler, Laura 48
Schüler, Silvio 16
Schulmeyer, Fabian 98, 249, 263, 277, 280 Schultze, Juliane 61
Schumacher, Jörg 39, 209, 210, 217, 218 Schütt, Marianne 249, 263 Schütz, Stefan 197 Schwappacher, Volker 76 Schwartz, Gustavo 315 Schwarzbauer, Peter 175 Schweier, Janine 104, 255, 262
Schweinle, Jörg 116, 295 Seegmüller, Stefan 181, 183, 212 Seeling, Ute 83, 256, 257, 264 Segatz, Ernst 187 Segelbacher, Gernot 336 Seifert, Stefan 27 Seifert, Thomas 27, 126 Seintsch, Björn 30, 94, 243, 248
Seitz, Rudolf 127, 196. 298 Selter, Andy 170, 273 Selzer, Anne M. 243 Senitza, Eckart 147, 149 Siebenaler, Lisa 235 Silva, José Natalino 315 Smaltschinski, Thomas 124, 258 Snell, Rebecca S. 48, 301 Sooth, Farina 318 Spasikova, Sofche 179 Spathelf, Peter 233 Spellmann, Herrmann 297
Staab, Michael 335 Stache, Anja 233 Stadelmann, Golo 92 Ståhl, Göran 153 Stahr, Simon 71
Stapper, Norbert J. 187 Stark, Hendrik 62
Stärk, Joana 235 Stefan, Valentin 138 Stein, Sabine 231 Steiner, Herfried 147, 241 Steinhardt, Uta 233 Steinmann, Victor 251 Steinrücken, Ulrich 119 Stelmaszczuk-Górska, Martyna 200, 306 Stern, Tobias 175 Stiehm, Christoph 101, 284
Stimm, Bernd 185 Storch, Ilse 170, 318, 324, 333, 334 Storz, Claudia 185 Straub, Christoph 127 Strauß, Egbert 173 Stümer, Wolfgang 141 Sturm, Veronika 252 Stutz, Kenton 57, 74, 99
Suchant, Rudi 167 Suchomel, Christian 246 Suck, Reiner 62 Suthmöller, Johannes 82 Sutterer, Nele 283 Taeger, Steffen 194 Talkari, A. 138 Talkner, Ulrike 70, 128, 309 Temperli, Christian 92
Teply-Szymanski, Julia 210 Thees, Oliver 75, 178, 266 Thiel, Jörg 226 Thiele, Bernhard 168 Thiele, Tom 125 Thoma, Stefanie 172 Thorn, Simon 56
Thrippleton, Timothy 301
Autorenindex Thürig, Esther 92 Thurm, Eric Andreas 28
Tiemann, Eike 89 Tomasella, Martina 10 Traub, Berthold 142 Tröber, Ute 66
Tschöpe, Vanessa 61 Tzanova, Polia 176 Überreiter, Andreas 282 Uhl, Enno 28 Uhlmann, Astrid 186 Ullah, Sami 305 Unseld, Rüdiger 260 Van Dijk, Susanne 103 Vedel, Dimitri 269 Veldkamp, Edzo 239, 287 Visnijc, Cemal 289 Volmer, Katharina 18
von Blomberg, Moritz 243 von Bodelschwingh, Hilmar 267 von der Goltz, Hans 150 von Teuffel, Konstantin 14, 184 von Wilpert, Klaus 139, 310 Vonderach, Christian 302 Vor, Torsten 247 Vornam, Barbara 209, 210 Wagner, Johannes 43 Wagner, Marianne 186 Wagner, Sven 45 Waldner, Peter 121 Walentowski, Helge 238 Wallner, Adelheid 298 Wambsganß, Janna 57, 99 Wauer, Alexandra 202 Warlo, Hannes 74 Weber-Blaschke, Gabriele 115 Weber, Günter 271 Wegensteiner, Rudolf 35 Weggler, Karin 206 Wehrmann, Wiebke 112 Weimar, Holger 31, 114, 163, 294 Weis, Wendelin 194
Wellbrock, Nicole 129, 311 Wenning, Aline 36, 205 Wermelinger, Beat 33, 54, 55
Werner, Andrea 175 Werner, Willy 132 Werther, Norman 112 Westekemper, Katharina Wichser, Adrian 250 Wiesler, Franz 285 Wilnhammer, Matthias 137 Windisch, Wilhelm 323 Winkel, Georg 326 Winter, Heiko 108 Winter, Maria-Barbara 244 Winter, Susanne 63, 64, 143 Wirth, Christian 58 Wittkopft, Stefan 137 Wohlgemuth, Thomas 23 Wolf, Christian 115 Wolf, Heino 19, 66, 188, 189, 192 Wolf, Thilo 139, 310 Wörle, Alfred 126 Wunn, Uwe 76 Wurster, Matthias 273 Zacios, Martina 290 Zederer, Dan Paul 70
Zeibig, André 19, 188 Zelinka, Peter 204 Zelinski, Volker 278 Zemke, Julian J. 259 Zeniuk, P. 201 Zhang, Kai 107 Ziche, Daniel 134 Zimmermann, Henning 321 Zimmermann, Jorma 9 Zimmermann, Klaus 31
Zimmermann, Lothar 198, 202, 290 Zimmermann, Stephan 75
Zirlewagen, Dietmar 139, 310 Zweifel, Roman 23