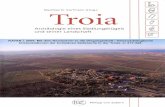63. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen ... - CORE
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 63. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen ... - CORE
A E F
63. Jahrestagung
der
Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft
in Verbindung mit der Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft Extraterrestrische Forschung(Fachverband Extraterrestrische Physik der DPG)
Jena
23. Februar bis 28. Februar 2003
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Recommended citation
Deutsche Geophysikalische Gesellschaft (Ed.) (2003): 63. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft: in Verbindung mit der Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft Extraterrestrische Forschung (Fachverband Extraterrestrische Physik der DPG); 23. Februar bis 28. Februar 2003 in Jena, Jena: Friedrich-Schiller-Universität, 481 p. DOI: http://doi.org/10.2312/dgg63ISSN: 0344-7251
IGMIngenieurgesellschaft für Geophysikalische Messtechnik mbH
Ingenieure und Geowissenschaftler beraten bei allen geotechnischen undgeowissenschaftlichen Aufgabenstellungen
Geophysikalische Messgeräte und Systemvorschläge für:
Seismik BohrlochmessungenEnergiequellen GeoradarSeismologie LeitungsortungErschütterungsmessungen GravimetrieEM- und TD-EM- Messtechnik GezeitenmessungGeoelektrik MagnetikSpektroskopie EKS (Elektrokinetik)
Messtechnik, Reparaturdienst, Gerätelieferung, Gerätevermietung,Lieferung von Ersatzteilen aller Art, Geophysikalische Dienstleistung undDateninterpretation, Beratung, Projektstudien und Geräteentwicklung inZusammenarbeit mit zahlreichen namhaften Herstellern bilden unserumfangreiches geowissenschaftliches Liefer- und Leistungsprogramm
Sie erreichen uns:Tel.: +49 7551 40 77 oder 40 78Fax.: +49 7551 1623Email: [email protected]: www.igm-geophysik.de
IGMIngenieurgesellschaft für Geophysikalische Messtechnik mbHUntere Sankt Leonhard Strasse 16 88662 Überlingen Germany
St. Annenufer 220457 HamburgGermanyPhone: +49.40.303 99 576FAX: +49.40.303 99 578email: [email protected]: www.geopro.com
World Wide Geophysical Exploration
- Wide Aperture Reflection/Refraction Profiling (WARRP) :r e s o l v e s
- sub-salt, sub-basalt and thrust belt structures
- Work Flows for WARRP - migration, - tomography
- SEDIS – SEismic DIgital Station
- Microseismicity and Microzonation Studies
SEDIS-IV – OBS-Deployment
WARRP offshore – Principle of measurement
SEDIS-IV - LandstationSEDIS-IV -Landstation
WARRP onshore - Principle of measurement
Inhaltsverzeichnis
Einladung zur Mitgliederversammlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
Allgemeine Hinweise für Tagungsteilnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
Schülerpräsentationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Sponsoren und Firmen der Tagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
Programmübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
Abstracts 1
Plenarvortrag (PL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Elektromagnetik und Geoelektrik (EE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie (EX) . . . . . . . . . . . 55
Geodynamik und Gravimetrie (GD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Geodynamische Modellierung (GD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Geodäsie und Gravimetrie (GG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Kontinentale Tiefbohrungen (KT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Geodynamo und Geomagnetismus (MA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Marine Geophysik (MG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Seismologie (SL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Seismik und seismische Methoden (SM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Umwelt- und Ingenieurgeophysik (UI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Verschiedenes (VE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Physikalische Vulkanologie und Georisiken (VU) . . . . . . . . . . . . . . . 450
Autorenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
ii
Einladung zur Mitgliederversammlung
W. Webers, Potsdam, Schriftführer
Im Namen des Vorstandes der DGG lade ich alle Mitglieder unserer Gesellschaft zur Mitgliederversammlungein, die am Donnerstag, dem 27. Februar 2003, in der Zeit von 17.30 - 20.00 Uhr im Hörsaal HS1 desHörsaalgebäudes der Friedrich-Schiller-Universität am Ernst-Abbe-Platz stattfinden wird.
Tagesordnung:
1. Begrüßung, Feststellung der fristgerechten Einberufung und der Beschlußfähigkeit2. Genehmigung der Tagesordnung3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 7. März 2002 in Hannover4. Bericht des Vorsitzenden5. Bericht des Schriftführers6. Bericht des Kassenwarts7. Bericht des Kassenprüfers und Entlastung des Kassenwarts8. Bericht der deutschen Herausgeber des GJI9. Bericht der Redaktion der DGG-Mitteilungen
10. Kurzberichte der Vorsitzenden/Sprecher der DGG-Kommitees und Arbeitskreise
Komitee Publikationen AK Angewandte GeophysikÖffentlichkeitsarbeit Elektromagnetische TiefensondierungInternet Geodynamik des ErdinnernJahrestagungen Digitale SeismologieEhrungen HydrogeophysikMitglieder Umwelt- und IngenieurgeophysikFirmen GeothermieStudenten Geschichte der GeophysikFrauenStudienfragenKooperationen
11. Aussprache12. Anträge und Beschlüsse
· Erhöhung der DGG-Mitgliedsbeiträge· Einführung des Ernst-v.-Rebeur-Paschwitz-Preises· Beteiligung der DGG am Dachverband der Gesellschaften der Festen Erde
13. Entlastung des Vorstandes14. Wahlen/Bestätigungen zum Vorstand (Vorsitzender, stellv. Vorsitzender, designierter Vorsitzender,
Kassenwart, 3 Beisitzer)15. Bestätigung des neuen Vorstandes16. Wahl der Kassenprüfer17. Verschiedenes
iii
63. Jahrestagungder
Deutschen Geophysikalischen GesellschaftJena
in Verbindung mit der Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft Extraterrestrische Forschung(Fachverband Extraterrestrische Physik der DPG)
23. Februar bis 28. Februar 2003
Veranstalter
Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e. V.Geschäftsstelle: c/o W. Webers, GeoForschungsZentrum PotsdamTelegrafenbergD-14473 PotsdamTelefon +49-331-288-1232Fax +49-331-288-1235E-Mail [email protected] http://www.dgg-online.de
AusrichterLokales Organisationskomitee DGG-Tagung 2003 (Universität Jena)Burgweg 1107749 JenaTelefon +49-3641-948-661Telefax +49-3641-948-662E-Mail [email protected] http://dgg2003.geo.uni-jena.de
AnsprechpartnerTagungsleiter G. Jentzsch +49-3641-948660 [email protected] P. Malischewsky +49-3641-948663 [email protected] U. Walzer +49-3641-948680 [email protected] H. Fichtner +49-234-3223786 [email protected] H. Koetitz +49-3641-948661 [email protected]
C. Dietl +49-3641-948601 [email protected] C. Kroner +49-3641-948609 [email protected] T. Jahr +49-3641-948665 [email protected] K. Gottschaldt +49-3641-948683 [email protected]ülerpräsentation P. Malischewsky +49-3641-948663 [email protected] R. Heinrich +49-3641-948611 [email protected] H. Steffen +49-3641-948673 [email protected]
A. Hoffmann +49-3641-948684 [email protected]. Fischer [email protected]
Unterkunft E. Weder +49-3641-664076 [email protected]
Tagungsort: Hörsaalgebäude der Friedrich-Schiller-Universität am Ernst-Abbe-Platz , 07743 Jena
Tagungsbüro: Büro ab 24.02.2003:Hörsaalgebäude der FSU JenaErnst-Abbe-Platz07743 JenaTel. 03641-941876
iv
Anmeldung zur TagungAnmeldungen zur Tagung sind während der Tagung im Tagungsbüro möglich.
Lokale Registrierung, Ausgabe der Tagungsunterlagen usw. erfolgen ab Montag, dem 24. Februar 2003, ab08:30 Uhr im Tagungsbüro am Tagungsort (Hörsaalgebäude der Universität am Ernst-Abbe-Platz).
Tagungsgebühren
DGG-Mitglieder 60,00 €Nicht-Mitglieder* 85,00 €Studierende Mitglieder ---Studierende Nicht-Mitglieder 10,00 €Begleitpersonen 15,00 €Tageskarte 25,00 €Tageskarte für Studierende 7,00 €
*Der Differenzbetrag zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern wird bei einem Beitritt zur DGG auf einenJahresbeitrag angerechnet.
Die Tagungsgebühren schließen die Kosten des geselligen Abends am Montag, dem 24. Februar, 19:00 Uhr, ein. Sie sind auf das Konto der Tagungsleitung zu überweisen.
Kontonummer der Tagungsleitung
Sonderkonto Prof. JentzschKennwort DGG 2003Merkur BankKto.-Nr.: 40 66 30 286BLZ 701 308 00
Bitte geben Sie bei der Einzahlung unbedingt Ihren vollständigen Namen und den Wohnort an.
TagungsbeginnDie Tagung beginnt am 24. Februar 2003 um 9:30 Uhr im Hörsaalgebäude der Friedrich-Schiller-Universität am Ernst-Abbe-Platz.
EröffnungsveranstaltungDie Eröffnungsveranstaltung beginnt am Montag, dem 24. Februar 2003, um 14:00 Uhr in der Aula desHauptgebäudes der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fürstengraben 1.
EröffnungsvortragProf. Dr. Harald Schuh (Technische Universität Wien): „Moderne geodätische Weltraumverfahren - ihrBeitrag für die Geowissenschaften“
AbendveranstaltungenDer Begrüßungsabend findet am Sonntag, 23. Februar 2003, ab 18:00 Uhr in der Ratszeise im historischenRathaus am Markt statt.
Der gesellige Abend ist am Montag, 24. Februar 2003, von 19:00 Uhr bis etwa 21:30 Uhr, in der Mensa amErnst-Abbe-Platz.
Der öffentliche Abendvortrag von Prof. Dr. Tilman Spohn: „Geophysiker auf dem Mars“ wird amMittwoch, dem 26. Februar 2003, um 20:00 Uhr im Hörsaal HS1 des Hörsaalgebäudes der Friedrich-Schiller-Universität am Ernst-Abbe-Platz gehalten.
Eine LaserAllDome Ganzkuppelprojektion der Firma Carl Zeiss Jena findet am Donnerstag, dem 27. Februar 2003, um 20:30 Uhr im Zeisswerk-Laserzentrum, Carl-Zeiss-Promenade 10, statt. Tagungsteilnehmer habennach vorheriger Anmeldung bei der Tagungsleitung die Möglichkeit, an dieser kostenlosen Veranstaltungteilzunehmen. Die ersten 100 Anmeldungen werden berücksichtigt.
v
ExkursionenEs werden folgende Exkursionen angeboten:
Geodynamisches Observatorium Moxa und Pumpspeicherwerk Hohenwarte,Donnerstag ganztägig Kosten: 15 €Uranerzbergbaufolgelandschaft Ostthüringen, Donnerstag nachmittag Kosten: 15 €
Am Dienstag, dem 25. Februar 2003, findet eine Stadtführung statt:
Geschichte von Wissenschaft und Technik in Jena Kosten (ohne Eintrittsgelder): 5 €
Die Teilnehmerzahlen der Exkursionen sind beschränkt. Die Tagungsleitung behält sich vor, Exkursionen beimangelnder Beteiligung zu streichen. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs derÜberweisungen der Exkursionsgebühren berücksichtigt. Nicht Berücksichtigte erhalten ihre Teilnahmegebührzurück. Näheres zu den Exkursionen finden Sie unter http://dgg2003.geo.uni-jena.de.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, während der Tagung verschiedene Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten inund um Jena wahrzunehmen. Weitere Informationen erhalten sie im Tourist-Informationsbüro der Stadt Jenaoder auf den Internetseiten der Stadt Jena http://www.jena.de.
FirmenausstellungFirmen und Institute stellen von Dienstag, dem 25. Februar, bis Donnerstag, dem 27. Februar, imZugangsbereich der Tagung geophysikalische Geräte und Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Mess- undProcessing-Verfahren vor. Fachverlage und der örtliche Buchhandel sind mit einer Präsentation vonFachbüchern und Fachzeitschriften vertreten. Am Dienstag haben die ausstellenden Firmen die Möglichkeit, sich und ihre Produkte ab 17:45 Uhr im Hörsaal HS1 vorzustellen.
SchülerpräsentationAm Dienstag, dem 25. Februar, nehmen Schülerinnen und Schüler thüringischer Schulen an der Tagung teil.Von 10:30 bis 12:30 Uhr stellen sie eigene Arbeiten vor, die von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr in zwangloser Formzur Diskussion gestellt werden. Da die Schülerinnen und Schüler sich auch über das Studium informierenmöchten, bitten wir alle Institute, entsprechendes Material für einen Info-Stand zur Verfügung zu stellen. Sollten Sie darüber hinaus für ein etwa 20-minütiges Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern zur Verfügungstehen, so wenden Sie sich bitte an Herrn Prof. Dr. P. Malischewsky ([email protected]).
Schwerpunktthemen
- Seismologie
- Geodynamische Modellierung
- Physikalische Vulkanologie und Georisiken
- Vogtland und Nordwestböhmen
- Geodynamo und Geomagnetismus
PosterausstellungDie Posterausstellung nimmt eine zentrale Stellung ein. Die Autoren haben die Möglichkeit, am Montag, dem24. Februar 17:00 Uhr sowie am Dienstag, dem 25. Februar 11:00 Uhr in drei Minuten mit höchstens zweiFolien ihr Poster vorzustellen. Die Autoren von Postern verpflichten sich, während der Posterausstellung amMontag, dem 24. Februar, ab 17.45 Uhr bzw. am Dienstag, dem 25. Februar, ab 15.00 Uhr am Poster anwesend zu sein. Es wird außerdem angeregt, zusätzliches Material wie A3/A4-Versionen des Posters oder andereZusammenfassungen zur Verfügung zu stellen. Für die Poster stehen Stellwände von 1,5 m Höhe und 1,2 mBreite bereit. Für die Befestigung der Poster an den Tafeln stellt das Tagungsbüro Material zur Verfügung. Diebesten Posterpräsentationen werden auf der nächsten Tagung ausgezeichnet.
vi
Thematische Einordnung der Vorträge (V) und Poster (P)
EEV/EEP Elektromagnetik und Geoelektrik MAV/MAP Geodynamo und Geomagnetismus
MGV/MGP Marine GeophysikEXV/EXP Extraterrestrische Physik, Aeronomie
und Planetologie SLV/SLP Seismologie
GDV Geodynamik und Gravimetrie SMV/SMP Seismik und seismische Methoden
GDP Geodynamische Modellierung UIV/UIP Umwelt- und Ingenieurgeophysik
GGP Geodäsie und Gravimetrie VEV Verschiedenes
KOV Kolloquium der DGG VOV/VOP Vogtland und Nordwestböhmen
KTV/KTP Kontinentale Tiefbohrungen VUV/VUP Physikalische Vulkanologie und Georisiken
DGG-Kolloquium
Das Thema des DGG-Kolloquiums am Mittwoch, dem 26. Februar, lautet
Interdisziplinärer Einsatz geophysikalischer Methoden
Es stehen vier Beiträge aus den Bereichen
- Ingenieurgeologie- Wasserwirtschaft- Bodenkunde- Archäologie
fest. Bitte melden Sie sich auch zum Kolloquium an. Zum Kolloquium erscheint ein Sonderband derMitteilungen der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft, in dem die Vorträge in gekürzter Form gedrucktwerden. Er ist zum Preis von 3 € im Tagungsbüro zu erhalten.
PodiumsdiskussionAm Mittwoch, dem 26. Februar, findet zwischen 17:45 Uhr und 19:00 Uhr im Hörsaal HS1 des Hörsaalgebäudes der Friedrich-Schiller-Universität am Ernst-Abbe-Platz eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wo liegt dieZukunft der Geophysik in Deutschland?“ statt.
ArbeitskreiseDie Arbeitskreise werden sich am Dienstag, dem 25. Februar, und am Donnerstag, dem 27. Februar, treffen.Vorgesehen sind zwei Anfangszeiten (19:00 Uhr und 20:00 Uhr), um die Teilnahme an mehreren Arbeitskreisen zu ermöglichen.
Hinweise für Vortragende und SitzungsleiterEin Vortrag dauert 15 Minuten. Anschließend sind 5 Minuten für die Diskussion vorgesehen. Diese Zeitensollten unbedingt eingehalten werden, um die Synchronisation der Parallelsitzungen zu gewährleisten undnachfolgende Redner nicht zu benachteiligen.Benötigen Sie für Ihren Vortrag mehr Geräte als zwei Overhead-Projektoren, einen Diaprojektor und einenBeamer (Videoprojektor), so bitten wir um Rücksprache. Falls eine Präsentation mit Beamer vorgesehen ist, sosollte sie auf einer CD oder auf einem mitgebrachten Notebook vorliegen (bitte angeben). AlsPräsentationsformate kommen folgende Programme bzw. Formate in Frage: MS PowerPoint, PDF, HTML. ImZweifelsfall oder falls andere Formate gewünscht werden, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an dasTagungsbüro. Bitte prüfen Sie rechtzeitig vor der Sitzung die Beamerprojektion mit dem Projektionsassistenten.Diapositive können Sie ebenfalls bei den Projektionsassistenten abgeben.
Weitere MitteilungenWeitere Informationen sind den Infowänden am Tagungsbüro und den Hörsälen zu entnehmen.
vii
Schülerpräsentationen auf der DGG 2003:
Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt:
1. Caroline Meißner, Dagmar Roth, Tobias Hahn: Verbesserung der Landbedeckungsanalyse am geografischenRaumbeispiel des Flusses Jahna (Betreuer: R. Kirschner)
2. Johannes Nicolai und Patric Schenke: Security Suite für Linux (Freizeitprojekt, ohne Betreuer)
3. Christoph Thäle und Marcus Wohler: Gleichseitige n-Ecke und gleichwinklige n-Ecke (Betreuer: em. Prof.W. Mögling; H.-J. Brenner)
4. Anja Vogler und Christoph Burmeister: Herschels Visionen werden wahr – Neue Wege in derInfrarotastronomie (Betreuer: Dr. Fischer; H. Staff)
5. Anne Böhnisch, Maren Weisser, Peter Helbing: Biochemische Untersuchung historischer Wundheilverfahren(Betreuer: Dr. Stuerzebecher, Dr. Prasa; K.-H. Niessler)
Staatliches Gymnasium Greiz:
1. Markus Wirth, Thomas Basler, Benjamin Giegling, Doreen Haase: Automatisierung und Modernisierung inder ENKA GmbH & Co KG Elsterberg (Seminarfacharbeit, Betreuer: Herr Herzog)
2. Klasse 10d: Vom Hanf zur Umweltmatte (Projekt "Jugend recherchiert Umwelt - 100 Schulen im Dialog",Greiz-Itzehoe, Betreuer: Ch. Dietel)
Staatliches Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau:
Anne Kessler, Martin Schmidt, Martin Kuchorz, Björn Baumgart: Modellhaus zur Erzeugung von Wasserstoffmittels Sonnenenergie und dessen Nutzung in einer Brennstoffzelle (Betreuer: G. Winter)
Gymnasium Fridericianum Rudolstadt:
Kerstin Damerau: Der Sommer war kurz - Synoptische Wetteranalyse des Jahres 2001/02 im LandkreisSaalfeld-Rudolstadt (Betreuer: S. Gerber)
Adolf-Reichwein-Gymnasium Jena:
Anja Reuter: Power-Point-Präsentation zum Planetensystem (Betreuer: W. Meier)
Carl-Zeiss-Gymnasium Jena:
1. Stefan Bartzsch: Ultraschalluntersuchungen zum Anisotropieverhalten natürlicher Gesteine im OstthüringerSeismischen Netz (OTSN) (Betreuer: Prof. P. Malischewsky, Dipl.-Ing. A. Ziegert)
2. Franz Carlsen: Untersuchungen am OTSN zur Bebenfolge nahe Plauen im April 2002 (Betreuer: Dr. A.Hemmann)
3. Rolf Gehre: Azimutbestimmung mit Geophonen (Betreuer: Dipl.-Ing. M. Brunner)
Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar:
Christian Holz: Einrichtung eines Routers für das Schulnetzwerk auf der Basis des Betriebssystems LINUX(Betreuer: R. Heerdegen)
viii
Folgende Firmen/Einrichtungen stellen finanzielle Mittel zur DGG 2003 zur Verfügung:
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Gesellschaft der Freunde und Förderer der Friedrich-Schiller-Universität Jena e.V.
EEG Erdöl und Erdgas GmbHZimmerstr. 5610117 Berlin
Merkur Bank JenaMarkt 1007743 Jenahttp://www.merkurbank.de
Restaurant Ratszeise JenaAm Markt 107743 Jenahttp://www.ratszeise.net
Scala – Das Turmrestaurant JenaLeutragraben 107743 Jenahttp://www.scala-jena.de
ALLIED ASSOCIATES GEOPHYSICAL LTD.Halterner Str. 12546284 Dorstenhttp://www.allied-associates.co.uk
DBM Bohrlochmessungen-Dr. K. BuckupHohenwarther Str. 239126 Magdeburghttp://www.bohrlochmesser.de
E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung Science PublisherJohannesstr. 3AD-70176 Stuttgart
Geophysik GGD mbHEhrensteinstr. 3304105 Leipzighhtp://www.geophysik-ggd.com
GeoPro Gesellschaft für geophysikalische Untersuchungen mbHSt. Annenufer 220457 Hamburghttp://www.geopro.com
Springer Verlag GmbH & Co. KGTiergartenstr. 1769121 Heidelberghttp://www.springer.de
ix
Folgende Firmen stellen auf der DGG 2003 aus:
ALLIED ASSOCIATES GEOPHYSICAL LTD.Halterner Str. 12546284 Dorstenhttp://www.allied-associates.co.uk
DBM Bohrlochmessungen-Dr. K. BuckupHohenwarther Str. 239126 Magdeburghttp://www.bohrlochmesser.de
DMT-DEUTSCHE MONTAN TECHNOLOGIE GmbHMines & More DivisionAm Technologiepark 145307 Essenhttp://www.minesandmore.de
FEMLAB GmbHBerliner Str. 437073 Göttingenhttp://www.femlab.de
FOERSTER – Institut Dr. Förster GmbH & Co. KGIn Laisen 7072766 Reutlingenhttp://www.foerstergroup.de
GeoPro Gesellschaft für geophysikalische Untersuchungen mbHSt. Annenufer 220457 Hamburghttp://www.geopro.com
Geo Sys GmbH LeipzigBraunstr. 23-2504347 Leipzighttp://www.geosys-germany.com
GeotomographieAm Tonnenberg 1856567 Neuwiedhttp://www.geotomographie.de
HarbourDom GmbHRiehler Platz 150668 Kölnhttp://www.harbourdom.de
HGN Hydrogeologie GmbH, Niederlassung TorgauSüptitzer Weg04860 Torgauhttp://www.hgn-online.de
Hommel Vermessungssysteme GmbHFelsbachstr. 507745 JenaEmail: [email protected]
IGM Ingenieurgesellschaft für Geophysikalische Messtechnik mbHUntere St. Leonhard Str. 1688662 Überlingenhttp://www.igm-geophysik.de
x
JUB – Jenaer UniversitätsbibliothekPostfach 10 07 2107707 Jenahttp://www.jub.de
Lennartz electronic GmbHBismarckstr. 13672072 Tübingenhttp://www.lennartz-electronic.de
OmniQuest InternationalLeipzig OfficeArndtstr. 504275 Leipzighttp://www.omniquest.nl
OptoSys Mikroskope und ZubehörRobert-Bosch-Str. 764293 Darmstadthttp://www.opto-sys.de
RF Reedereigemeinschaft Forschungsschiffahrt GmbHPF 330 66028336 Bremenhttp://www.rf-bremen.de
SIOS Meßtechnik GmbH Am Vogelherd 4698693 Ilmenauhttp://www.sios.de
Yokogawa - nbn GmbHTest- und Messtechnik VertriebsgesellschaftGewerbestr. 1782211 Herrschinghttp://www.yokogawa-nbn.de
xi
Programmübersicht
Montag, 24. Februar 2003
09:30 – 10:25 Plenarvortrag PL01 (Hörsaal HS1)Harro Schmeling (U Frankfurt am Main)„Konvektion und Schmelzprozesse im Erdmantel“
HS1 HS2 HS3 HS6 HS710:30-11:00 Kaffeepause11:00-11:20 SL01 UI01 GD01 VU01 MG0111:20-11:40 SL02 UI02 GD02 VU02 MG0211:40-12:00 SL03 UI03 GD03 VU03 MG0312:00-12:20 SL04 UI04 GD04 VU04 MG0412:20-12:40 SL05 UI05 GD05 MG0512:40-13:00 SL06 UI06 GD06 MG06
13:00 – 14:00 Mittagspause
14:00 – 17:00 Eröffnungsveranstaltung (Aula)EröffnungsvortragHarald Schuh (TU Wien) „Moderne geodätische Weltraumverfahren - ihr Beitrag für die Geowissenschaften“
17:00 – 17:45 Vorstellung von Postern (I)
HS1 HS2 HS317:00-17:45 SL,VO,KT VU,GG,GR,EE,UI GD,MA,MG,SM
17:45 – 19:00 Posterausstellung (I) (HS4, HS5)
19:00 – 21:30 Geselliger Abend (Mensa, Ernst-Abbe-Platz)
xii
Dienstag, 25. Februar 2003
08:30 – 09:25 Plenarvortrag PL02 (HS1)Jürgen Neuberg (U Leeds, GB)„Mehrere Finger am Puls eines Vulkans – ein Multiparameter-Ansatz in der physikalischen Vulkanologie“
09:30 DGG-Vorstandssitzung (SR 1.13)
09:45 – 12:45 Exkursion: Stadtführung zur Geschichte von Wissenschaft und Technik in JenaTreffpunkt: Vor dem Tagungsgebäude auf dem Ernst-Abbe-Platz
HS1 HS2 HS3 HS6 HS709:30-09:50 SL07 UI07 GD07 VU05 MG0709:50-10:10 SL08 UI08 GD08 VU06 MG0810:10-10:30 SL09 UI09 GD09 VU07 MG0910:30-11:00 Kaffeepause
10:30 – 12:30 Schülerveranstaltung (HS7)Vorstellung der Schülerarbeiten
11:00 – 12:30 Vorstellung von Postern (II)
HS1 HS2 HS311:00-12:30 SL,VO,KT VU,GG,GR,EE,UI GD,MA,MG,SM
12:30 – 14:00 Mittagspause
13:00 – 17:00 BDG-Ausschuß Geophysikalische Meß- und Beratungsunternehmen (HS6)
14:00 – 14:55 Plenarvortrag PL03 (HS1)Shun-ichiro Karato (Yale University, New Haven, CT, USA)„Mapping water in the Earth’s mantle“
15:00 – 17:30 Posterausstellung (II) (HS4, HS5)
15:00 – 16:30 Schülerveranstaltung (HS7)15:00 – 15:30 Preisverteilung an die Schüler15:30 – 16:30 Diskussionsrunde
17:45 Eröffnung der Firmenausstellung mit Vorstellung der Industriepartner (HS1)
19:00 StudentenabendTreffpunkt: Vor dem Tagungsgebäude auf dem Ernst-Abbe-Platz
19:00 Arbeitskreis Geschichte der Geophysik (HS6)
19:00 Arbeitskreis ASFA (HS1)
19:00 Arbeitskreis Geodynamik (HS7)
19:00 Arbeitskreis Angewandte Geophysik (SR 1.13)
20:00 Arbeitskreis Studienfragen (HS2)
20:00 Arbeitskreis Seismologie (HS1)
19:00/20:00 weitere Arbeitskreise siehe Infowand (HS1, HS2, HS3, HS6, HS7, SR 1.13)
xiii
Mittwoch, 26. Februar 2003
08:30 – 09:25 Plenarvortrag PL 04 (HS1)David Crossley, (U Saint Louis, USA)„What high precision gravity measurements can tell us about geodynamics“
Hinweis: EX-Vorträge gliedern sich in Vorträge von 30 (Hauptvorträge) und 15 Minuten Länge!
HS1 HS3 HS7 HS2 Zeiten für HS6 HS609:30-09:50 SL10 GD10 UI10 09:30-10:00 EX0109:50-10:10 SL11 GD11 UI11 10:00-10:15 EX0210:10-10:30 SL12 GD12 UI12
KO01
10:15-10:30 EX0310:30-11:00 Kaffeepause11:00-11:20 SL13 GD13 UI13 11:00-11:15 EX0411:20-11:40 SL14 GD14 UI14 11:15-11:30 EX0511:40-12:00 SL15 GD15 UI15
KO02
11:30-12:00 EX0612:00-12:20 SL16 GD16 UI16 12:00-12:15 EX0712:20-12:40 SL17 GD17 UI17 12:15-12:30 EX0812:40-13:00 SL18 GD18 UI18
KO03
12:30-13:00 EX09
13:00 – 14:00 Mittagspause
14:00 – 14:55 Plenarvortrag PL05 (HS1)Guust Nolet (U Princeton, USA)„Seeing plumes in a new (diffracted) light“
HS1 HS3 HS7 HS2 Zeiten für HS6 HS615:00-15:20 SL19 GD19 UI19 15:00-15:30 EX1015:20-15:40 SL20 GD20 UI20 15:30-15:45 EX1115:40-16:00 SL21 GD21 UI21
KO04
15:45-16:00 EX1216:00-16:30 Kaffeepause
16:30 – 17:25 Plenarvortrag PL06 (HS1)Sami Solanki (MPI Katlenburg-Lindau)„Solar-terrestrische Beziehungen: Das Weltraumwetter und das Erdklima“
17:45 – 19:00 Podiumsdiskussion (HS1) AEF-Sitzung Wo liegt die Zukunft der Geophysik in Deutschland? HS6
17:45-18:00 EX1318:00-18:15 EX1418:15-18:30 EX1518:30-18:45 EX1618:45-19:00 EX17
20:00 Öffentlicher Abendvortrag (HS1)Tilman Spohn (Münster)„Geophysiker auf dem Mars“
xiv
Donnerstag, 27. Februar 2003
08:30 – 17:15 Exkursion: Geodynamisches Observatorium Moxa und Pumpspeicherwerk HohenwarteTreffpunkt: Vor dem Tagungsgebäude auf dem Ernst-Abbe-Platz
11:45 – 17:15 Exkursion: Uranerzbergbaufolgelandschaft OstthüringenTreffpunkt: Vor dem Tagungsgebäude auf dem Ernst-Abbe-Platz
08:30 – 09:25 Plenarvortrag PL07 (HS1)Aleš Špicák (Geophys. Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, Prag, CZ)„Magmatic origin of earthquake swarms in the Vogtland/West Bohemia seismically active region“
HS1 HS2 HS709:30-09:50 SL22 (VO01) SM01 EE01 Zeiten für HS3 HS309:50-10:10 SL23 (VO02) SM02 EE02 09:30-10:00 EX1810:10-10:30 SL24 (VO03) SM03 EE03 10:00-10:30 EX1910:30-11:00 Kaffeepause
HS1 HS2 HS7 HS3 Zeiten für HS6 HS611:00-11:20 SL25 (VO04) SM04 EE04 11:00-11:30 11:30-11:45 EX2511:20-11:40 SL26 SM05 EE05 EX20 11:45-12:00 EX2611:40-12:00 SL27 SM06 EE06 EX21 12:00-12:15 EX2712:00-12:20 SL28 SM07 EE07 EX22 12:15-12:30 EX2812:20-12:40 SL29 SM08 EE08 EX23 12:30-12:45 EX2912:40-13:00 SL30 EX24 12:45-13:00 EX30
13:00 – 14:00 Mittagspause
14:00 – 14:55 Plenarvotrag PL08 (HS1)Ulrich Christensen (U Göttingen)„Numerische Modelle des Geodynamos“
HS1 HS2 HS7 HS3 Zeiten für HS6 HS615:00-15:20 SL31 SM09 EE09 MA01 15:00-15:30 EX3115:20-15:40 SL32 SM10 EE10 MA02 15:30-15:45 EX3215:40-16:00 SL33 SM11 EE11 MA03 15:45-16:00 EX3316:00-16:30 Kaffeepause16:30-16:50 SL34 SM12 EE12 MA04 16:30-17:00 EX3416:50-17:10 SL35 SM13 EE13 MA05 17:00-17:15 EX3517:10-17:30 SM14 EE14 17:15-17:30 EX36
17:30-17:45 EX3717:45-18:00 EX38
17:30 – 20:00 DGG-Mitgliederversammlung (HS1)
18:00 – 19:00 AEF-Poster-Session (HS4, HS5)
19:00 – 20:00 AEF-Mitgliederversammlung (HS2)
20:00 Arbeitskreis Dynamo-Modellierer (SR 1.13)
20:30 LaserAllDome (Carl Zeiss Jena GmbH); auf aktuelle Aushänge achten!
xv
Freitag, 28. Februar 2003
08:30 – 9:25 Plenarvortrag PL09 (HS1)Hans-Joachim Kümpel (GGA Hannover)„Energie- und Fluidtransport in kontinentalen Bruchsystemen – eine neue Serie großskaliger Experimente an der KTB-Lokation“
HS1 HS2 Zeiten für HS3 HS309:30-09:50 KT01 SM15 09:30-10:00 EX3909:50-10:10 KT02 SM16 10:00-10:15 EX4010:10-10:30 KT03 SM17 10:15-10:30 EX4110:30-11:00 Kaffeepause11:00-11:20 VE02 SM18 11:00-11:15 EX4211:20-11:40 VE03 SM19 11:15-11:30 EX4311:40-12:00 VE04 VE01 11:30-11:45 EX4412:00-12:20 VE05 11:45-12:00 EX45
12:00-12:15 EX4612:15-12:45 EX4712:45-13:00 EX4813:00-13:15 EX4913:15-13:30 EX50
13:00 Tagungsabschluß (Foyer)
13:30 DGG-Vorstandssitzung (SR 1.13)
Plenarvortrag 3
PL06 – Mi., 26.2., 16:30-17:25 Uhr · HS1Solanki, S. K. (MPAe Lindau)
Solar-terrestrische Beziehungen: Das Weltraumwetter und das Erdklima
Die Sonne beeinflusst die Erde und ihre un-mittelbare Umgebung auf vielfältige Art undWeise. Das variable offene Magnetfeld derSonne und der Sonnenwind modulieren dieMagnetosphäre, Ionosphäre und obere Atmo-sphäre der Erde. Zudem beeinflussen siedie Intensität der kosmischen Strahlung, diedie Erde erreicht und somit die Konzentra-tion kosmogener Isotope, z.B. von 10Be ingrönländischem oder antarktischem Eis. Dassich ändernde Magnetfeld der Sonne verändertauch deren Helligkeit. Diese wiederum be-einflusst das Klima der Erde, wobei der Gradder Beeinflussung noch Gegenstand intensiverForschung ist. Im Vortrag wird die Variabili-tät der Sonne und ihre Ursprünge beschrieben.Zudem werden die solar-terrestrischen Bezie-hungen aus der Sicht eines Sonnenphysikersdiskutiert.
4 Abstracts
PL08 – Do., 27.2., 14:00-14:55 Uhr · HS1Christensen, U. (Göttingen)
Numerische Modelle des GeodynamosE-Mail: [email protected]
Dynamomodelle, die nur auf den funda-mentalen Grundgleichungen der Magnetohy-drodynamik ohne Parametrisierungen und ad-hoc-Annahmen beruhen, spielen eine immerwichtigere Rolle zum Verständnis des erd-magnetischen Hauptfeldes. Hierbei werdengleichzeitig die konvektive Strömung und dieMagnetfelderzeugung in einer mit einer elek-trisch leitenden Flüssigkeit gefüllten und raschrotierenden Kugelschale numerisch simuliert.Mehrere Kontrollparameter haben allerdingsWerte, die sich um viele Größenordnungenvon denen des Erdkerns unterscheiden. DieViskosität ist in den Modellen stark überhöht.Andere wichtige Parameter haben dem ge-genüber realistische Werte. Vereinfacht ge-sagt wird der magnetische Teil des Problemskorrekt beschrieben, die turbulente Natur derStrömung dagegen nicht erfasst.
Einfache Modelle bei sehr moderaten Para-metern sind benutzt worden, um den grund-legenden Mechanismus der Magnetfelderzeu-gung besser zu verstehen. Hierbei spieltdie gegenseitige Umwandlung der poloidalenund toroidalen Magnetfeldkomponenten eineSchlüsselrolle. In den meisten Modellen zeigtsich, dass dabei der sogenannte α-Effekt durchhelikale Konvektionsströmungen die zentraleRolle spielt, während der ω-Effekt durch dif-ferentielle Rotation kaum konstruktiv beiträgt.
Ein Vergleich der Magnetfelder von Mo-dellen mit realistischeren Parametern mit demErdmagnetfeld an der Kern-Mantel-Grenzezeigt eine gute Korrelation auch für Details inder Morphologie. Magnetische Flußbündel inhohen Breiten lassen sich mit Hilfe der Mo-
delle durch Abströme im Zentrum zyklonalerWirbel erklären, während geringer oder inver-ser magnetischer Fluß direkt an den Rotations-polen mit aufsteigenden Plumes an der Polenund einem antizyklonalen polaren Wirbel inVerbindung zu bringen sind. Dynamomodel-le sind auch zum Test von Methoden benutztworden, mit denen die beobachtete Säkular-variation benutzt wurde, um nach der Flüssig-keitsströmung an der Oberfläche des Kerns zuinvertieren.
Die Konvektion im Kern wird durch die he-terogene Verteilung des Wärmeflusses an derKern-Mantel-Grenze strukturiert, welche demKern durch den viel langsamer konvektieren-den Mantel vorgegeben wird. Modelle mit in-homogenem Wärmefluss zeigen, dass dies zuAbweichung im zeitgemittelten Magnetfeldvon dem eines geozentrischen axialen Dipolsführt. Solche Abweichungen sind in paläoma-gnetischen Daten dokumentiert. Auch regio-nale Unterschiede im Verhalten der Säkularva-riation, z.B. in deren Amplitude oder im Auf-treten einer Westwärtsdrift, zeigen sich in denModellen, sind aber in den Daten schwierig zubelegen.
Viele veröffentliche Dynamomodelle zei-gen dipoldominierte Magnetfelder stabiler Po-larität. Polumkehrungen treten z.B. bei ge-nügend hoher Rayleighzahl (heftiger Konvek-tion) auf. Während des Übergangs ist dasRestfeld schwächer und von höheren Multi-polkomponenten dominiert. In manchen Mo-dellen laufen die Umpolungen sehr ähnlich ab,wie es für die Erde aus der Paläomagnetik ge-schlossen wird, jedoch ist der Mechanismus
Plenarvortrag 5
der Feldumkehr noch nicht gut verstanden.Bei Modellen mit lateral variablem Wärme-fluss an der Kern-Mantel-Grenze nimmt dervirtuelle geomagnetische Pol (VGP), so wieer sich aus Feldrichtungen an der Erdoberflä-che berechnen würde, während des Umklap-pens einen bevorzugten Pfad entlang den Re-gionen hohen Wärmeflusses. Das gleiche Ver-halten ist aus paläomagnetischen Daten postu-liert worden, bleibt jedoch umstritten.
6 Abstracts
PL09 – Fr., 28.2., 08:30-09:25 Uhr · HS1Kümpel, H.-J. (Hannover), Erzinger, J. (Potsdam), Rabbel, W. (Kiel), Shapiro, S. (Berlin), KTBScience Team
Energie- und Fluidtransport in kontinentalen Bruchsystemen - Eine neue Serie großska-liger Experimente an der KTB-LokationE-Mail: [email protected]
Das Kontinentale Tiefbohrprogramm derBundesrepublik Deutschland (KTB) beinhal-tete bisher die Phase der Vorerkundungen(1984–86), die aktive Bohrphase (1987–94)und einige Jahre der Nutzung als Tiefenla-bor (1995–2001). Während der Bohrphasewurden die 4000 m tiefe Vorbohrung (VB)niedergebracht sowie im Abstand von 200 mvon ihr die 9101 m tiefe Hauptbohrung (HB).Die VB ist nur im Tiefenbereich 3850 bis4000 m unverrohrt und damit zum Gebirgehin offen, die HB im Bereich 9031 bis 9101m. Die jeweiligen Temperaturen im Bohrloch-tiefsten betragen 119 °C bei der VB und 265°C bei der HB. Seit kurzem ist das Tiefbohr-programm um das neue Vorhaben „Energie–und Fluidtransport in kontinentalen Bruchsys-temen“erweitert worden.
Zu den Besonderheiten von KTB gehörenneben der Existenz der beiden Bohrungen inunmittelbarer Nachbarschaft zueinander die inQuantität und Qualität einzigartige Datenbasissowie die Tatsache, dass bei 4,0 und 7,2 kmTiefe zwei größere Störsysteme erbohrt wur-den. Letztere sind auch seismisch von derOberfläche aus sichtbar und als SE1– bzw.SE2–Reflektoren bekannt. Zwei der spektaku-lären wissenschaftlichen Ergebnisse des bis-herigen KTB–Programms sind zum einen dieunerwartet hohe Präsenz mobiler Tiefenflui-de in der Kruste und damit auch ihre Fähig-keit, erhebliche Fluidvolumina zu speichernund zu transportieren. Zum anderen über-raschte die niedrige mechanische Stabilität der
hier weitgehend aseismischen Kruste, konn-te doch gezeigt werden, dass eine mäßige Er-höhung des Fluiddrucks ausreicht, um Mikro-seismizität zu erzeugen. Mit dem Gewinn die-ser Erkenntnisse bei Abschluss des Bohrpro-gramms und deren Bestätigung innerhalb dernachfolgenden Phase des Tiefenlabors war dasPotenzial von KTB jedoch bei weitem nichtausgeschöpft. Im Gegenteil: Es waren geradediese Erkenntnisse, die nach weiteren Unter-suchungen verlangten, hatte man doch an derKTB–Lokation unvergleichliche Möglichkei-ten, die von petrohydraulischen Eigenschaftenbestimmte Rheologie der kristallinen Krustesowie die Inhaltsstoffe und Migration von Tie-fenfluiden eingehend und beispielhaft zu stu-dieren.
Diese Situation gab Anlass, ein neu-es, mehrjähriges Forschungsprogrammmit dem o.g. Titel zu konzipieren undseine Förderung im Rahmen des DFG–Schwerpunktprogramms ICDP zu beantragen.Vorrangiges Ziel des neuen Vorhabens solltedie experimentelle Untersuchung der beidenStörsysteme auf der Kilometer-Skala sein.Dabei stehen die Gewinnung unkontaminier-ter Tiefenfluide – was zuvor nicht gelungenwar – und ihre Analyse im Vordergrund,ebenso die kontrollierte Erzeugung vonMikroseismizität in Bruchsystemen undschließlich Versuche zum Abbilden vonStörsystemen anomalen Fluiddrucks mithilfegeophysikalischer Verfahren. Auf der Basiseiner Machbarkeitsstudie wurden die techni-
Plenarvortrag 7
sche Durchführbarkeit langanhaltender Pump-und Injektionsversuche zum Erreichen dieserZiele bestätigt und die Kosten abgeschätzt.
Das vorgeschlagene Programm sieht fol-gende Serie von Großversuchen vor: (1) Ein-jähriger Pumptest in der VB mit Fluidförde-rung aus der 4 km tiefen Störzone; nach sei-nem Abschluss mindestens 6–monatige Erho-lungsphase. (2) Einjähriger Injektionstest inder VB mit Fluidverpressung in der 4 km tie-fen Störzone; nach seinem Abschluss min-destens 6–monatige Erholungsphase. (3) Vor-bereiten der HB für entsprechende Versuchein der 7,2 km tiefen Störzone; hierzu Über-brücken von undichten Abschnitten der Ver-rohrung der HB, Perforieren der Verrohrungin ca. 7,2 km Tiefe und Setzen eines Packersunterhalb der Perforationsstrecke. (4) Einjäh-riger Pumptest in der HB mit Fluidförderungaus der 7,2 km tiefen Störzone; nach seinemAbschluss mindestens 6–monatige Erholungs-phase. (5) Einjähriger Injektionstest in derHB mit Fluidverpressung in der 7,2 km tie-fen Störzone; nach seinem Abschluss mindes-tens 6–monatige Erholungsphase. (6) Versucheiner vertikalen Zirkulation zwischen der 7,2und der 4 km tiefen Störzone zur Gewinnunggeothermischer Energie.
Die Pump– und Injektionstests gilt es durchein Monitoring verschiedener geophysikali-scher und geochemischer Parameter zu be-gleiten. Aufbauend auf der umfangreichenDatenbasis früherer KTB–Vorhaben erlaubendie gesammelten Messreihen darüber hinaus,maßgebliche Prozesse der Gesteins–Fluid–Wechselwirkung in kristalliner, kontinentalerKruste detailliert zu modellieren.
Mit der Bewilligung mehrerer DFG–Anträge Anfang 2002 trat das neue Vorhabenin seine erste aktive Phase. Meilensteinewaren bisher Vorversuche zur Ermittlung derWegsamkeit von Klüften im offenen Abschnitt
der VB, die Installation und Inbetriebnahmeeiner Pumpe in knapp 1300 m Tiefe in derVB, eines Feldlabors zur online–Analyseder geförderten Fluide und Gase sowie einesBohrlochgeophons in der HB zur Erfassungvon Mikroseismizität.
Nach einer mehrmonatigen Förderrate von28 l/min werden seit Oktober 2002 bei einerAbsenkung von ca. 460 m Wassersäule konti-nuierlich 55 l/min Tiefenfluid aus der VB pro-duziert (Stand: 2.12.2002). Die elektrischeLeitfähigkeit des geförderten Fluids beträgt 84mS/cm, der auf das Volumen bezogene Gasan-teil bei Atmosphärendruck knapp 90% (zu 2/3N2 , zu 1/3 CH4), die über den offenen Bohr-lochabschnitt gemittelte Permeabilität des Ge-birges beträgt ca. 2 · 10−15m2. Eine Abnah-me der Fluidergiebigkeit des Gebirges mit derZeit ist nicht festzustellen.
Entsprechend dem vorgeschlagenen Pro-gramm der neuen Serie von Großversuchensoll der Pumptest in der VB bis Mitte 2003fortgesetzt und durch eine halbjährige Erho-lungsphase abgeschlossen werden. Die Finan-zierung des dann folgenden einjährigen Injek-tionstests in der VB wird für 2004 bei derDFG beantragt. Interessenten, die sich mitbegleitenden Untersuchungen daran beteiligenmöchten, sind willkommen und werden gebe-ten, zur Vorbereitung eines DFG–Antrags baldmit einem der Initiatoren des neuen KTB–Programms (s. Autorenliste) Kontakt aufzu-nehmen.
Webseite: http://www.icdp-online.de/html/sites/ktbhydraulic/news/news.html
Elektromagnetik und Geoelektrik 9
EE01 – Do., 27.2., 09:30-09:50 Uhr · HS7Schmucker, U. (Göttingen)
Der innere Anteil tagesperiodischer Variationen und der Dst-Nachphase erdmagneti-scher Stuerme unter dem Einfluss elektromagnetisch induzierter Stroeme in den Welt-meerenE-Mail: [email protected]
Kuestenanomalien und Inseleffekte sindausgepraegte und wohlbekannte Erscheinun-gen, soweit es die Vertikalkompente (Z)von Baystoerungen und von aehnlichen kurz-periodischen Variationen des erdmagnetischenFeldes in mittleren Breiten betrifft. Auch imEinflussbereich von ionosphaerischen Jets tre-ten sie als erkennbar induktionsbedingte An-omalien hervor. Weniger bekannt sind diezugehoerigen Anomalien der Horizontalkom-ponenten (H,D), welche auf der Landseite ineiner raeumlich ausgedehnten Verminderungund auf der Seeseite in einer raeumlich kon-zentrierten Verstaerkung von H und D beste-hen.
Tagesgaenge und die Dst-Nachphase vonStuermen besitzen infolge ihrer laengeren Pe-rioden abgeschwaechte innere Anteile. Glei-ches gilt auch fuer ihre Kuesten- und Inse-lanomalien, die zudem nur in Z unmittelbarerkennbar sind, Zu ihrer Darstellung in derForm bivariater magnetischer Uebertragungs-funktionen (zH,zD) und Induktionsvektorenist es ausserdem notwendig, die raeumlicheStruktur der Quellenfelder einzubeziehen undaus ihr einen Normalanteil (Zn) abzuleitenund von Z vor der Analyse abzuziehen. DieserNormalanteil kann entweder fuer eine vorge-gebene geschichtete Normalstruktur des Erd-mantels berechnet werden oder mittels einertrivariaten Analyse direkt aus den Daten ge-wonnen werden, wobei die dritte Uebertra-gungsfunktion die aus den raeumlichen Ablei-tungen von H und D bestimmte Eindringtie-
fe (C) ist. In beiden Faellen muessen dabeizunaechst Anomalien in H und D unberueck-sichtigt bleiben.
Dieser Beitrag verfolgt drei Ziele: (1) dieBestimmung von zH und zD an kuestenna-hen Oberservatorien und auf Inseln, und zwarmittels einer Analyse von Stundenmittelwer-ten und getrennt fuer die Perioden des Ta-gesganges (6 bis 24 Stunden) und der Dst-Nachphase (2 bis 25 Tage); (2) Korrekturenfuer Ozeaneffekte, wenn Tiefensondierungendes Erdmantels mit Tagesgaengen und Dst-Nachphasen auf dem Festland oder auf Inselnvorgenommen werden sollen, und zwar unterder Voraussetzung geschichteter Normalstruk-turen. (3) Modellstudien zu der Moeglichkeit,aus Kuesteneffekten auf der Landseite und aufInseln zu Aussagen ueber die ozeanische Nor-malstruktur zu kommen, insbesondere ob die-se sich moeglicherweise von der ozeanischenNormalstruktur unterscheidet.
Das Ergebnis zu (1) und (2) ist, dass allekuestennahen Observatorien schwache, abersignifikante und korrigierbare Anomalien inZ aufweisen, soweit es den Tagesgang be-trifft. Bei der Nach-Phase von Stuermen sindsie jedoch nur an exponiert gelegenen Ob-servatorien klar erkennbar. Das Ergebnis zu(3) ist, dass im Falle von Kuestenanomalienohne Beobachtungen auf der Seeseite kaumAussagem ueber die tiefere Leitfaehigkeitenim Erdmantel unter den Ozeanen moeglichsind. Im Falle von Inseln waere dies im Prin-zip moeglich, doch muessten die Meerestie-
10 Abstracts
fen in einer sehr detaillierten Modellrechnungberuecksichtigt werden, abgesehen davon dassdie Inseln selbst mit Leitfaehigkeitsanomalienin Erdmantel verbunden sein koennten.
Elektromagnetik und Geoelektrik 11
EE02 – Do., 27.2., 09:50-10:10 Uhr · HS7Golden, S., Junge, A. (Frankfurt am Main), Beblo, M. (München), Björnsson, A. (Akureyri)
Langperiodische Magnetotellurik auf Island – Vergleich von Prozessing MethodenE-Mail: [email protected]
Im Rahmen des Deutsch-Isländischen Ge-meinschaftsprojektes CMICMR (ContinuousMonitoring of the Icelandic Crust and MantleResistivity) werden seit 1999 langperiodischemagnetotellurische Messungen an drei Statio-nen auf Island durchgeführt: Akureyri (AKU),Húsafell (HUS) und Skrokkalda (SKR). DieMessungen an den Stationen Húsafell undAkureyri dauern noch an. Jede Stationzeichnet die beiden horizontalen elektrischenFeldkomponenten sowie alle drei magneti-schen Feldkomponenten kontinuierlich mit ei-ner Abtastperiode von 1 s auf. Der auswert-bare Periodenbereich erstreckt sich von etwa16 s bis in den Bereich der täglichen Varia-tionen, möglicherweise auch darüber hinaus.Bis jetzt haben sich die Auswertungen aufden Periodenbereich von einer Minute bis zu9 Stunden konzentriert.
Die aufgezeichneten Zeitreihen werdennach einer Instrumentenkorrektur und einerzeitlichen Synchronisation zum geomagne-tischen Observatorium Leirvogur (LRV) inZeitsegmente zerlegt, und nach ihrer Fou-riertransformation zur Berechnung von Über-tragungsfunktionen zwischen unterschiedli-chen Kanälen und Stationen verwendet. Diezeitliche Synchronisation ist notwendig, umtrotz Verzicht auf eine GPS-Zeitbasis an denFeldstationen eine genügend hohe Absolut-Zeitgenauigkeit für die Berechnung der Über-tragungsfunktionen zwischen den Stationenzu erreichen. Dies gelingt durch eine Bestim-mung der Zeitversätze zwischen den Stationenfür unterschiedliche Zeitfenster, wozu die La-ge der Maxima der Kreuzkorrelationen zwi-
schen gleichartigen Kanälen verwendet wird.Der verbleibende Zeitfehler beträgt – bei einerAbtastperiode der Observatoriumsdaten von60 s – weniger als 1 s.
Die berechneten Übertragungsfunktionenhängen von der Quellfeldgeometrie und vonder elektrischen Leitfähigkeitsverteilung imUntergrund ab. In der Magnetotellurik wirdin der Regel ein quasi-homogenes Quell-feld angenommen, um auf die Untergrund-Leitfähigkeit zu schließen. Starke Quellfeld-Inhomogenitäten führen dabei zu systemati-schen Verzerrungen der bestimmten Leitfähig-keiten, die als Quellfeldeffekte bekannt sind.Aufgrund der Lage von Island nahe dem po-laren Elektrojet muss mit starken Quellfeld-effekten gerechnet werden. Daher wurde wieim folgenden nach geeigneten Kriterien für ei-ne automatische Selektion von Zeitsegmentenmit schwachen Quellfeldeffekten gesucht.
Die MT-Übertragungsfunktionen zeigtensich verhältnismäßig stabil gegenüber Quell-feldeffekten, wohingegen die Übertragungs-funktionen zwischen den horizontalen Ma-gnetfeldkomponenten unterschiedlicher Sta-tionen einen besonders starken Einfluss desQuellfeldes zeigten. Dennoch wurde versucht,durch den Einbezug der Information aus denÜbertragungsfunktionen zwischen den hori-zontalen Magnetkomponenten eine Verbesse-rung der MT-Übertragungsfunktionen zu er-reichen. Zu diesem Zweck wurden un-terschiedliche Prozessing-Algorithmen ange-wandt und ihre Ergebnisse gegenüberge-stellt: Es handelt sich im einzelnen umMT-Einzelstationsanalyse mit Least-Squares
12 Abstracts
oder robustem Prozessing, Remote-Referencemit Least-Squares oder robustem Prozessing,die Verwendung der Übertragungsfunktionenzwischen horizontalen Magnetfeldkomponen-ten sowie der Übertragungsfunktionen zwi-schen horizontalen und vertikalen Magnet-feldkomponenten als Selektionskriterium. DieErgebnisse dieser Gegenüberstellung sollenvorgestellt und diskutiert werden.
Mit Hilfe gesicherter MT-Übertragungs-funktionen jenseits einer Periode von 1000 ssoll geklärt werden, ob und wie sich derIsland-Plume in der Magnetotellurik bemerk-bar macht, um so gegebenenfalls Leitfähigkei-ten für den Plume zu bestimmen, die z.B. alsRandbedingungen für mögliche Schmelzan-teile in geodynamische Modellierungen einge-hen könnten.Webseite: http://www.geophysik.uni-frankfurt.de/em/icelmt/
Elektromagnetik und Geoelektrik 13
EE03 – Do., 27.2., 10:10-10:30 Uhr · HS7Brost, E., Binot, F., Noell, U., Sauer, J., Suckow, A. (GGA-Institut), Siemon, B. (BGR)
Eine Süßwasserlinse im WattenmeerE-Mail: [email protected]
Am Anfang war die Erfahrung der Ein-wohner des Raums Sahlenburg, dass es imWatt strandnah Quellen gibt, deren Wasserim Sommer kühlt und im Winter die Eisde-cke des Watts in merkwürdigen Formen auf-tauen lässt. Geologen des NiedersächsischenLandesamtes für Bodenforschung (NLfB) stu-dierten das Phänomen qualitativ in den siebzi-ger Jahren (KUSTER, pers. Mitteilung) und in-terpretierten diese Quellen als ausströmendessüßes Grundwasser, das in der Geest, die beiSahlenburg direkt an das Watt grenzt, neu ge-bildet wird. Damit gehören sie als Sonderfallzu den typischen Geestrandquellen. Dass sichdieses Süßwasservorkommen nicht allein aufden unmittelbaren Geestrand mit seinen Quel-len beschränkt, wurde deutlich, als im Jah-re 2000 die Hubschrauberelektromagnetische(HEM) Vermessung des Gebietes Cuxha-ven/Bremerhaven vorgenommen und ausge-wertet wurde. Sie zeigt das Süßwasservor-kommen als ca. 5 km langes ca. N- Sstreichendes, linsenförmiges Gebilde erhöhtenelektrischen Widerstands (40-100 Ωm), wel-ches sich ca. 2 km weit ins Watt erstreckt.An der Stelle, wo nach der HEM Messungdie Widerstände oberflächennah am höchstensind, etwa 1000 m von der MTHW-Linie imWatt, wurde eine ca. 1 m tiefe Flügelbohrungabgeteuft. Das dort geförderte Wasser warsüß. Tritium-Untersuchungen haben ergeben,dass das Süßwasser der strandnahen Quellenein Grundwasser ist, welches sehr schnell vomInfiltrationsgebiet zur Quelle fließt, denn dieNiederschläge, aus denen dieses Grundwas-ser entstand, fielen nach den atmosphärischen
Wasserstoffbombentests von 1963. Das Was-ser aus der Flügelbohrung hingegen lieferteHinweise, dass es bis zum Fundpunkt län-ger als 50 Jahre unterwegs war. Dennoch istes nach den Ergebnissen für δ18O nicht ausMeerwasser entstanden sondern echtes, ausNiederschlägen an Land neugebildetes Grund-wasser.
In 2002 wurden im Watt zwei Profi-le mit Schlumberger-Tiefensondierungen ver-messen. In dem etwa SE-NW verlaufen-den ersten Profil im Nordbereich des Süßwas-servorkommens wurden unter einer dünnenKleischicht für den süßwassergefüllten Sandspez. Widerstände von 70-230 Ωm bestimmt.Die Mächtigkeit der auf Süßwasservorkom-men hinweisenden Schicht mit erhöhten spez.Widerständen beträgt am Messpunkt 110 ca.50 m. Zu den Rändern hin nimmt die Mäch-tigkeit ab (Abb. 1). Damit war die Exis-tenz und die Größe des Süßwasservorkom-mens, so wie es die HEM-Ergebnisse zeig-ten, bestätigt, aber der Ursprung des Wasserswarf neue Fragen auf. Eine Süßwasserlinseunter der Geest, die sich bei Sahlenburg bisins Watt hinein erstreckt, müsste sich in Rich-tung Geest vertiefen. Das Profil zeigt aber ab-nehmende Mächtigkeit der Linse mit erhöh-ten spez. Widerständen in Richtung Geest.Zur Klärung der landwärtigen Abnahme derspez. Widerstände wurde in Sahlenburg, 150m von der MTHW-Linie entfernt, eine 110 mtiefe Schneckenbohrung, CAT_CSW 01, nie-dergebracht. Die gewonnenen Proben wur-den mittels eines einfachen Eluationsverfah-rens auf ihren Salzgehalt hin untersucht. Bis
14 Abstracts
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
Tie
fe in
m
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
Tie
fe in
m
Priel
NW SE
Sahlenburg Neuwerk
Insel
200
180150
230
210
140
34
9075 80
150
18
26
25
3535
35 3330
23
30
104040 45 301,43 1,5 1,6
7
1,4
9 9
1512
7,5
1,5 1,3 1,6 1,8 1,5
WattenmeerFestland
Geoelektrik - Cuxhaven 2002
Spezifische Widerstände in m
Süßwasserbereich
Übergangszone
Salzwasserbereich
500 m75-230
18-35
1,3-15
111 Meßpunkt Nr.
�10
Abbildung 1: Geoelektrisches Profil im Wattenmeer
zur Endteufe konnte kein relevanter Salzge-halt festgestellt werden. Bis zur Tiefe vonca. 20 m u. NN wurden Geestsande ange-troffen. Darunter folgt ca. 3 m Ton, an densich eine zunächst mittelsandige, später fein-sandige Schichtenfolge mit häufigen bindigen(Schluff und Ton) Zwischenlagen anschließt.Die Widerstandsabnahme des geoelektrischenProfils kann durch diese bindigen Einschal-tungen verursacht sein. Demnach ist die hiergeoelektrisch interpretierte Schichtgrenze kei-ne Süßwasser-Salzwassergrenze, sondern dieGrenze zwischen reinem Geestsand und dendarunter liegenden Sanden mit häufigen tonig-schluffigen Einlagerungen. Darauf deutenauch die spez. Widerstände von 30 - 35 Ωmhin, die bei tonigen und schluffigen Sedimen-ten üblich sind. Niedrige spez. Widerständevon 7 - 15 Ωm, die auf Grundwasserversal-zung hindeuten, wurden nur im NW-Teil desProfils angetroffen. In diesem Bereich sinkenauch die Widerstände innerhalb der „Linse “;vermutlich dringt hier das Salzwasser in die„sauberen “Geestsande ein. Ein zweites Profil
längs der Küste zeigte den erwarteten Verlauf;unter einer dünnen (2-5m) leitfähigen Schichtvon Wattsedimenten zeigt sich das Süßwasser-kommen mit einer Mächtigkeit von 100 - 120m und Widerständen zwischen 100 - 250 Ωm.Dieses Ergebnis lässt sich zwanglos interpre-tieren als Abbild der unter der Geest tiefrei-chenden Süßwasserlinse, die unter dem Wattausstreicht und als Quellen strandnah im Wattzu Tage tritt. Mit Annäherung an die Bohr-lokation verringert sich auch in diesem Profildie Mächtigkeit der Linse mit erhöhten spez.Widerständen. Dies deutet darauf hin, dassmit der Bohrung eine lokal begrenzte Hochla-ge der Schichtfolge mit bindigen Anteilen er-bohrt wurde.
Elektromagnetik und Geoelektrik 15
EE04 – Do., 27.2., 11:00-11:20 Uhr · HS7Koch, O., Helwig, S., Scholl, C. (Köln, IGM)
TEM-Messungen in Jordanien zur Erkundung der Leitfähigkeitsstruktur der Arava-StörungE-Mail: [email protected]
Im September 2002 wurden in JordanienTransient-elektromagnetische Messungenvom Institut für Geophysik und Meteorologieder Universität zu Köln im Rahmen desDESERT-Projekts (Dead-Sea-Rift-Transec-Projekts) durchgeführt. Untersuchungsobjektder Messkampagne war die Arava-Störung,die Teil der Dead-Sea-Störungszone ist. Eshandelt sich dabei um eine Tranformverschie-bung, bei der sich die Arabische Erdplatterelativ zur Sinai Erdplatte nördlich verschiebt.Das DESERT-Projekt beschäftigt sich mit derErforschung des Dead-Sea-Rift-Systems unterder Anwendung verschiedenster Methoden.Transient-elektromagnetische Untersuchun-gen tragen dazu Erkenntnisse über dieLeitfähigkeitsstruktur im Untergrund bei. Ins-besondere kann die LeitfähigkeitsverteilungHinweise über die Existenz von Fluiden imUntergrund geben.Die Ergebnisse der bisherigen MT-Messungenim diesem Gebiet lassen aufgrund der Leit-fähigkeitsverteilung auf die Position derStörungszone schließen. Die Region lässtsich in ein westliches und östliches Gebieteinteilen, deren Widerstandskontrast signifi-kant ist. Die TEM-Messungen sollten nun dieMT-Ergebnisse bestätigen und mehr Informa-tion über die Leitfähigkeitsverteilung an derStörung und deren Umgebung liefern. Hierzuwurde auf einem etwa zehn Kilometer langenProfil senkrecht zur Verwerfungslinie eineLOTEM-Messung durchgeführt (siehe Ab-bildung 1). Dabei wurden auf jeder Seite derVerwerfung jeweils zwei Sender aufgebaut.
Die Empfängerpositionen zu den insgesamtvier Sendern wurden so gewählt, dass sowohlMessungen, bei denen Sender und Empfängerauf der gleichen Seite der Verwerfung lagen,als auch Messungen, bei denen Sender undEmpfänger auf unterschiedlichen Seiten derVerwerfung lagen, zustande kamen. Insge-samt wurden dabei 65 Empfängerstationenaufgebaut, an denen jeweils die horizonta-le Komponente des Magnetfeldes und dieparallel zum Sender stehende Komponentedes elektrischen Feldes gemessen wurde. Anjeder zweiten Station wurde außerdem diesenkrecht zum Sender stehende Komponentedes Magnetfeldes und die senkrecht zum Sen-der stehende Komponente des elektrischenFeldes aufgezeichnet.Darüber hinaus wurde eine oberflächennaheErkundung auf einem etwa 1km langenProfil über den inneren Bereich der Ver-werfung durchgeführt. Hierbei wurde einTransient-elektromagnetisches Messgerät ineiner Central-Loop-Anordnung verwendet.
Abbildung 1: Positionen der Empfänger undSender der LOTEM-Messkampagne. X- undY-Achse geben die zugehörigen Längengrad-und Breitengradwerte an.
16 Abstracts
Es sollte festgestellt werden, ob es möglichist, die Störungszone oberflächennah zubestätigen [Koch et al. 2002].Bei den Ergebnissen der LOTEM-Messungzeigt sich, dass Daten aus Konfigurationen,bei denen sich Empfänger und Sender aufder gleichen Seite der Störung befanden,eindimensional interpretiert werden können.Erste resultierende Modelle der Leitfähig-keitsverteilung können die MT-Resultatebestätigen. Das bestehende Modell der Leitfä-higkeitsverteilung kann mit Informationen ausTiefenbereichen ergänzt werden, die bishernicht gut aufgelöst werden konnten. Daten,die aus denjenigen Konfigurationen gewonnenwurden, bei denen Empfänger und Senderauf unterschiedlichen Seiten der Verwerfungstanden, scheinen wie erwartet nur durchein mindestens zweidimensionales Modellerklärbar zu sein.Das LOTEM-Profil wurde speziell danachausgerichtet, um eine zweidimensionaleAuswertung der Daten zu ermöglichen.Daher besteht ein zukünftiger Schwerpunktder Auswertung in der Entwicklung eineszweidimensionalen Modells der Störung,welches die gemessenen Daten ausreichenderklären kann. Hierzu soll ein zweidimen-sionaler Inversionscode verwendet werden,welcher bisher nur mit synthetischen Datengetestet wurde [Scholl et al. 2002]. Für dieAnwendung auf reale Daten ist eine Weiter-entwicklung des Programmcodes notwendig.
Literatur:
Koch, O., Helwig, S., Scholl, C., Ers-te Ergebnisse einer TEM-Messung zurBestimmung der oberflächennahen Wider-standsverteilung an der Arava-Störung inJordanien, DGG-Tagungsband, 2003
Scholl, C., Commer, M., Helwig, S., Mar-tin, R., Lotem-3D-Inversion auf kleinen LinuxClustern, DGG-Tagungsband, 2002
Elektromagnetik und Geoelektrik 17
EE05 – Do., 27.2., 11:20-11:40 Uhr · HS7Lange, J., Helwig, St. L., Scholl, C., Tezkan, B. (Universität Köln), Goldman, M. (G.I.I.)
Joint Inversion von Central-Loop-TEM und LOTEM Transienten am Beispiel von Mess-daten aus IsraelE-Mail: [email protected]
Der See Genezareth ist das größte Süßwas-serreservoir Israels. Sein Salzgehalt ist jedochüberdurchschnittlich hoch. Um die Mecha-nismen der Versalzung zu erklären, existierenverschieden hydrogeologische Modelle. Ent-scheidend dabei ist die Verteilung und Tiefemit Salzwasser gefüllter Aquifere (siehe Bei-trag von Scholl et al.).Zur genauen Bestimmung vor allem der Tiefeder Salzwasser enthaltenden und daher nied-rigohmigen Schicht wurden im März LOTEMMessungen mit 9 verschiedenen Sender und28 Empfänger Positionen zwischen dem Mit-telmeer und dem See Genezareth durchge-führt. Pro Empfänger wurden mindestensdrei Komponenten (Hz, Ex, Hy) aufgezeich-net. Wegen der guten Ankopplung konntemeist mit ungefähr 30 A bei einer Senderlän-ge von ca. 1 Km gesendet werden. Der Zeit-bereich der aufgezeichneten Transienten liegtzwischen 10 ms und 900 ms. Die sich dar-aus ergebene Explorationstiefe beträgt bei an-genommenen Widerständen um die 10 Ohmmetwa 400 m - 4 km.Eine genauere Auflösung der oberen 400 mist demnach nicht möglich. Zur Bestimmungdes gesamten Tiefenbereichs und zur bessernAuflösung der Aquifertiefe wurden die LO-TEM Messungen mit SHOTEM Messungen(Central-Loop-TEM), die zu früheren Zeitenaufzeichnen kombiniert. Die SHOTEM Mes-sungen wurden von M. Goldman vom Geo-physical Institute of Israel an 15 Standortendurchgeführt. Der Zeitbereich dieser Messun-gen liegt zwischen 0.1 bis ca. 40 ms, die Ex-
plorationstiefe also etwa zwischen 40 und 800m.Durch eine gemeinsame (joint) Inversion ver-schiedener geophysikalischer Messungen aneinem Punkt reduziert man Äquivalenzen diebei der individuellen Inversion auftreten (Juppand Vozoff, 1974).Dazu wurde ein bestehendes LOTEM 1D In-versionsprogramm um die Central-Loop TEMVorwärtsrechnung erweitert und verschiede-ne Inversionsarten implementiert (Marquardt-Levenberg, Occam und Monte-Carlo). DieJoint-Inversion mit diesem Programm kannmit bis fünf Komponenten durchgeführt wer-den. Durch die unterschiedliche Sensitivitätder einzelnen Komponenten gegenüber Ab-weichungen vom 1D Fall ist meist jedochnur die gemeinsame Inversion von wenigerKomponenten erfolgreich (z. B. LOTEM-Hz, LOTEM-Ex und SHOTEM). Die Central-Loop-TEM Messungen wurden mit einenGeonics Gerät gemessen, das die Daten in dreisich stark überlappenden Zeitfenstern mist.Jedes Zeitfenster beinhaltet einen Transientender aufgrund unterschiedlicher Sendeperiodenund Sendeabschaltfunktionen unterschiedlichstark verzehrt ist.Mittels einer Dekonvolution (siehe auch Pos-ter von Helwig, Lange und Hanstein) wurdendie Verzerrungen beseitigt und die Transien-ten der einzelnen Zeitfenster zu einem Tran-sienten vereinigt. Der so erhaltene Datensatzwurde zunächst mit der Hz-Komponente derLOTEM Messung gemeinsam invertiert. Dafür die SHOTEM Daten keine Fehler vorlie-
18 Abstracts
Abbildung 1: Resultate der SHOTEM (links) und LOTEM (mitte) Einzelinversionen, sowieder gemeinsamen Inversion (rechts).
gen wurde für beide Datensätze ein Fehler voneinem Prozent angenommen.Das Beispiel zeigt die Occam Inversionser-gebnisse für einzelne SHOTEM und LOTEMInversion, sowie die gemeinsame Inversionbeider Komponenten. Die Darstellung ist dop-peltlogarithmisch gewählt, so dass auf den ers-ten Blick die Schichtdicken verzerrt erschei-nen.Die Inversion der SHOTEM Daten zeigt einedifferenzierte Schichtung der oberen 500 m.Der darauf folgende gute Leiter ist allerdingsnicht gut bestimmt, besonderst der sehr nied-rige Widerstand ist fragwürdig und durch dieDaten nicht abgedeckt.Das LOTEM Inversionsergebnis zeigt eineschlechte Auflösung der oberen 200 m, jedochauch einen guten Leiter in größerer Tiefe.Eine Vorraussetzung für eine erfolgreicheJoint Inversion ist nun das der integrierte Wi-derstand beider einzelnen Inversionsergebnis-se ungefähr übereinstimmt. Die hier gezeigtenModelle erfüllen diese Voraussetzung.Dass durch die Joint Inversion beider Metho-den erhaltene Modell zeigt nun bei geringerVerschlechterung der Anpassung, Charakte-
ristika beider Modelle. Die oberen 200 m ent-sprechen weitgehend dem SHOTEM Model,während die darunter liegenden dem LOTEMModel ähneln. Vor allem die für die Untersu-chung wichtige gutleitende Schicht zwischen700 und 900 m ist deutlicher erkennbar.Aufgrund der erhaltenen Occam Modelle kön-nen dann Startmodelle für die Marquardt In-version gefunden werden und so die Anzahlder Schichten reduziert und die Glättung ver-mieden werden.Literatur : K. Vozoff and D. L. B. Jupp, 1975.Joint Inversion of Geophysical Data, Geophy-sical Journal of the Royal Astronomical Socie-ty, 42, 977-991.
Elektromagnetik und Geoelektrik 19
EE06 – Do., 27.2., 11:40-12:00 Uhr · HS7Scholl, C. (IGM), Goldman, M. (GII), Helwig, S. L. (IGM), Kafri, U. (GSI), Tezkan, B. (IGM)
Grundwasserexploration mit Long-Offset-TEM in NordisraelE-Mail: [email protected]
Für Israel ist die Frischwasserversorgungein äußerst wichtiger Faktor. Eine der wich-tigsten Quellen für Frischwasser stellt der SeeGenezareth im Norden des Landes dar. Etwa25% des jährlich in Israel verbrauchten Was-sers wird diesem See entnommen und über ei-ne Pipeline bis in den Küstenbereich und denariden Süden gepumpt.
Problematisch ist dabei der für einen Süß-wassersee hohe Salzgehalt von etwa 220 mgCl− pro l. Zum Vergleich: Die den See spei-senden Flüsse weisen einen Salzgehalt von 20-30 mg/l auf, das Mittelmeer liegt bei rund22000 mg/l. Die hohe Salinität wird verur-sacht durch den See speisende, saline Quel-len mit Salzgehalten von bis zu 22000 mg/l.Wichtig für die weitere Versorgung Israels mitFrischwasser ist, den Ausstoß von Salz ausden Quellen möglichst niedrig zu halten. Dazuist es notwendig, den Mechanismus der Ver-salzung zu kennen.
In den letzten Jahrzehnten wurden verschie-dene hydrogeologische Modelle diskutiert, dieversuchen, den Salzgehalt, die Grundwas-serdynamik und die sonstigen chemischen Be-funde zu erklären. Einige Modelle geben alsQuelle der Versalzung entweder eine vor Ur-zeiten gebildete Sole, die in tiefen Aquife-ren liegt und durch unterschiedlichste Prozes-se wieder an die Oberfläche tritt. Ein anderesModell nimmt an, das Mittelmeerwasser imKüstenbereich in die oberen Aquifere ein- undgravitativgetrieben an den etwa 200 m tiefer-liegenden Quellen am See austritt. Um einesder Modelle verifizieren zu können, sind bes-sere Kenntnis über die Verteilung des salinen
Grundwassers in Nordisrael notwendig.Die salzwasserführenden Aquifere weisen
eine hohe elektrische Leitfähigkeit auf. Jenach Porosität und Salzgehalt werden spezi-fische Widerstände zwischen 1 und 10 Ωmerwartet. Für derartig niedrige Widerständekommt in Nordisrael keine andere geologischeUrsache als Salzwasser in Betracht. Unter-suchungen der elektrischen Leitfähigkeit imUntergrund mit elektromagnetischen Metho-den bieten sich daher an, um die Verteilungsalinen Wassers festzustellen. EntsprechendeMessungen wurden bereits in anderen TeilenIsraels mit Erfolg durchgeführt.
In Zusammenarbeit mit dem GeophysicalInstitut of Israel (GII) und dem GeologicalSurvey of Israel (GSI) hat das Institut fürGeophysik und Meteorologie der Universi-tät Köln (IGM) im Frühjahr 2002 eine ers-te Messung in Nordisrael durchgeführt. Da-bei soll die Leitfähigkeitstruktur des Unter-grundes zwischen der Bucht von Haifa unddem See Genezareth sowie dem Küstenstrei-fen südwestlich des Karmelgebirges unter-sucht werden. Für die Tiefe bis zu 500 m wur-de dazu vom GII die „SHort-Offset TransientElectroMagnetics“-Methode (SHOTEM) ein-gesetzt. Um die Tiefenbereiche zwischen 300und 3000 m auflösen zu können, führte dasIGM Messungen mit der „Long-Offset Tran-sient ElectroMagnetics“-Methode (LOTEM)durch.
Mit neun Sendern wurden an insgesamt 28Empfängerstationen Daten aufgezeichnet (sie-he Abbildung 1. Für diese erste Phase des Pro-jektes wurden die Messlokationen in der Nähe
20 Abstracts
NTiberias
Sea ofGalileeAfeq
Bet-Alfa
Devora
Gan-Shemuel
Sarid
Taninim
Yagur
Yokneam
3590
3600
3610
3620
3630
3640
UTM
N/k
m
680 690 700 710 720 730 740
UTM E/km
LOTEM Rx
LOTEM Tx
SHOTEM site
Borehole
City
Haifa
NazarethKarmel
Kerem-Maharal
Med
iterra
nean
Abbildung 1: Topographische Karte des Messgebiets. Eingezeichnet sind Bohrlöcher, die Lo-kationen der bisher durchgeführten SHOTEM-Messungen sowie LOTEM Sender und Empfän-ger. Die unterlegten helleren Ellipsen zeigen, welche Empfänger mit den jeweiligen Sendernverwendet wurden.
von vorhandenen Bohrungen gewählt, um dieErgebnisse anhand der Bohrlochdaten zu ka-librieren. An allen Stationen wurden Senso-ren für die Ableitung der magnetischen Ver-tikalkomponente Hz, die Ableitung des hori-zontalen magnetischen Feldes senkrecht zurSenderrichtung Hy, sowie das elektrische Feldparallel zum Sender Ex aufgebaut, an einigenStationen wurde sogar der komplette Tensor(zusätzlich also Hx und Ey) gemessen.
Die Ergebnisse der 1D-Inversionen der ein-zelnen LOTEM-Komponenten ergeben an denmeisten Stationen ein uneinheitliches Bild,was auf eine komplexere Erdstruktur hinweist.Weiterhin wurden erstmals Joint-Inversionenmit mehr als zwei gemessenen LOTEM-Datensätzen durchgeführt. Durch einen Ver-gleich mit den Bohrlochdaten kann nun ge-
prüft werden, welche Kombination von Kom-ponenten die besten Ergebnisse liefert.
Im Herbst 2003 sollen weitere Messungendurchgeführt werden, um die Traverse von derKüste bis zum See zu vervollständigen.
Elektromagnetik und Geoelektrik 21
EE07 – Do., 27.2., 12:00-12:20 Uhr · HS7Binot, F., Grinat, M., Noell, U. (GGA-Institut), Ringelhan, A. (Universität Bremen), Suckow,A., Wonik, T. (GGA-Institut)
Kartierung von Eem-Tonen mit geophysikalischen Methoden: Ein Beitrag zur regionalenHydrogeologie?E-Mail: [email protected]
Seit 1999 bearbeitet das In-stitut für GeowissenschaftlicheGemeinschaftsaufgaben (GGA-Institut) inZusammenarbeit mit dem NiedersächsischenLandesamt für Bodenforschung (NLfB) dasProjekt Coastal Aquifer Testfield (CAT).In diesem Projekt werden geophysikalische,hydrogeologische und geochemische Unter-suchungen im Gebiet Bremerhaven/Cuxhavenzur Erforschung der hydrogeologischenProzesse durchgeführt. Die eingesetztenMethoden umfassen neben traditionellen Ver-fahren wie Geoelektrik, Bohrlochgeophysikund Seismik auch Isotopenhydrologie undhubschraubergestützte elektromagnetischeMessungen (HEM). Das CAT umfasst eineFläche von ca. 800 km2 im nordwestlichenNiedersachsen. Hier befinden sich mindestenszwei glaziale Rinnen, die durch subglazialeStrömungen am Ende der Elster-Eiszeit ent-standen sind. Die Bremerhaven-CuxhavenerRinne ist an der Rinnenbasis (z. T. tiefer als300 m unter NN) teilweise mit Grobsandenund Kiesen gefüllt. Sie wird zur Wasserver-sorgung genutzt. Im überwiegenden Teil derRinne ist in Tiefen zwischen 50 m und 120m Ton abgelagert, der als Lauenburger Tonangesprochen wird. In den HEM-Messungenzeigen sich diese Tone mit spezifischenWiderständen von 8-30 Ωm. Nahe Cuxhavenwurden in der Forschungsbohrung CAT_LUD 1/1a in Tiefen zwischen 13 m und25 m unter NN grüne und schwarze, z.T.schillführende Tone und Mergel erbohrt.
Diese wurden in ähnlicher Ausprägung inüber 20 Bohrungen im Umfeld angetroffen.Durch pollenanalytische Untersuchungenkonnten sie als eemzeitliche Sedimenteidentifiziert werden. Ihre Ablagerung erfolgteunter marinen und limnischen Bedingun-gen. Bohrlochgeoelektrische Messungensowohl in der Forschungsbohrung wie inPVC-verrohrten Grundwassermessstellen derUmgebung weisen in diesem Schichtpaketauffällig niedrige spez. Widerstände auf(Abb. 1). Die geoelektrischen Oberflächen-messungen (Schlumberger-Sondierungen,Dipol-Dipol-Messungen) entlang eines Profilsin diesem Bereich zeigen für diese Tone spez.Widerstände unter 3 Ωm. Die Auswertung derHEM-Messungen zeigt eine Zone niedrigerspez. Widerstände (< 8 Ωm) im Tiefenbereich0 m bis 30 m, die sich 16 km2 sichelförmigvon Lüdingworth bis Cuxhaven erstreckt. An65 Bohrkernhälften der ForschungsbohrungCAT LUD 1 wurden im Rahmen eines Prakti-kums mit dem Messgerät 4-Punkt light C derFirma LGM Messungen des spezifischen Wi-derstandes in Wenner-Elektrodenanordnungmit einem Elektrodenabstand von 2 cmdurchgeführt. Der Messpunktabstand betrug5 cm. An den Kernen aus dem Tiefenbereich13 m bis 25 m unter NN treten i.a. niedrigescheinbare spez. Widerstände von 2 Ωmbis 8 Ωm auf. Lediglich die Sandschichtzwischen 15 m und 16 m Tiefe tritt mitdeutlich erhöhten scheinbaren spez. Wider-ständen bis 40 Ωm in Erscheinung. Eine
22 Abstracts
1 10 100�a in��m
-80
-60
-40
-20
0
Tie
fe in
m
Abbildung 1: Scheinbare spez. Widerstände ρa aus Kernmessungen [*] und Dual Laterolog[deep, shallow)zusammen mit dem Untergrundmodell aus geoelektrischen Messungen
Kalibrierung der Messapparatur an Wässernmit unterschiedlichen NaCl-Gehalten zeigt,dass die wahren spez. Widerstände nochetwa ein Drittel niedriger sein dürften. Auchin der Oberflächengeoelektrik und im DualLaterolog, das aufgrund der Stahlverrohrungin der Bohrung erst unterhalb von 18 m Tiefemessen konnte, treten spez. Widerständeunter 10 Ωm auf. Spezifische Widerständevon weniger als 8 Ωm sind für Tone außeror-dentlich niedrig. Die Auswertung der Daten(Lithologie, spez. Widerstand, elektrischeLeitfähigkeit des Wassers) im Bereich Bre-merhaven/Cuxhaven zeigt, dass in fast allenFällen spez. Widerstände unter 8 Ωm nur inGebieten festgestellt werden, in denen salz-bzw. brackwasserführende Sande oder Tonevorkommen. Selbst der stratigraphisch ältereLauenburger Ton hat für Quartärtone bereitseinen ungewöhnlich niedrigen spez. Wider-stand, meist aber Werte größer als 8 Ωm.Wasserproben in zwei Bohrungen zeigten in
Tiefen direkt oberhalb der Eem-Tone erhöhteSalzgehalte. Die Genese dieser Salzwässerwird momentan durch weitere Untersu-chungen erforscht. IsotopenhydrologischeUntersuchungen ergeben für diese Wässerholozäne Alter größer als 50 Jahre. Oberflä-chennahe Brackwasservorkommen sind fürdie regionale Hydrogeologie von Bedeutung.Ihr Auftreten ist im norddeutschen Raumnicht ungewöhnlich. Bisher war im Bereichder Eem-Tone mit Süßwasser gerechnetworden, denn das hydrogeologische Konzept-modell geht von Grundwasserneubildung inder Geest und Aufstieg dieses neugebildetenSüßwassers im Marschbereich aus. DieAuswertung der HEM-Messungen erlaubtdie Kartierung der Bereiche mit oberflächen-nahen Brackwasservorkommen mit hoherGenauigkeit und liefert dadurch Beiträge zurhydrogeologischen Konzeptbildung.
Elektromagnetik und Geoelektrik 23
EE08 – Do., 27.2., 12:20-12:40 Uhr · HS7Danckwardt, E., Petzold, G., Jacobs, F., Voigt, R. (Leipzig)
Field experiments with a Vertical Electrical System (VES) in the KTB-VBE-Mail: [email protected]
A Vertical Electrode System (VES) was de-veloped in a one-year project funded by theDFG (Ja 590/19-1) and tested in the KTB pilotborehole. The VES consists of a 100 m Bridle-cable (10 streaks outside, inside the carryingrope). In a distance of 25 m are 5 electrodesin contact with an outside streak. The VESis connected with a normal drillhole measure-ment cable by a so-called torpedo. The poten-tial differences between the electrodes (for ex-ample 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 1-3, 3-5 and 1-5) canbe measured by transient recorders (for exam-ple TEXAN 125). The current electrodes arefixed on the surface using dipole widths 0.5 to1 km.
The VES test in april 2002 was carried outin two experiments:
- Surface to hole experiment. Current injection of 2-4 A at 9 concentric
arranged around the pilot hole dipoles with theScintrex TSQ - 4.
. Length of the current dipoles 250 m andthe middle distance to the hole 1000 m.
. Potential registered in the pilot holeat 4 dipoles (l=25 m) in depths of 3863.5,3887.5, 3912.5 and 3937.5 m with data loggerTEXAN 125 (REFTEK).
This experiment is used as basic measure-ment for the detection of fluid motion whichare initialized by the pumping test. By way ofcomparison of measurements in later phasesof the pumping test it is possible to find out thedependence on the azimut of the fluid motion.Different potential in different depths refer tovertical fluid motion.
- In hole experiment
During the in hole experiment was carriedout resistivity measurements with the VES andthe resistivity meter GEOTOM in the pilothole part below the casing. The horizontalinvestigation depth around the hole is nearly25 m with the electrode arrangements dipole -dipole (electrode distances AB=BM=MN=25m).
Measurements was carried out immedi-ately after a fresh water injection withinthe project ”Hydraulischer Test KTB-VB”(Gräsle, Kessels, GGA Hannover). The appar-ent resistivity was distinct increased aroundthe open part of pilot hole by exchange of themuch mineralized water with the low conduc-tive fresh water. A comparison to accordingmeasurements in June 2001 shows a four timeincreasing of the apparent resistivity. The quo-tient’s maximum has in 3900 m a lower depthas hydraulic relevant fault (3944 m). A firstestimation results a "angle of incidence"to thehorizon of 70 degree. This caused a much ver-tical fresh water motion.
24 Abstracts
EE09 – Do., 27.2., 15:00-15:20 Uhr · HS7Schwarzbach, C. (TU Bergakademie Freiberg)
Inversion gleichstromgeoelektrischer Daten mittels eines genetischen AlgorithmusE-Mail: [email protected]
Die inverse Aufgabe in der Geoelektrikbesteht darin, Verteilungen des spezifischenelektrischen Widerstands im Untergrund zubestimmen, die Messwerte – scheinbare spe-zifische elektrische Widerstände, Spannungenoder Potentiale – im Rahmen der Messfeh-ler erklären. Aus der Menge aller möglichenLösungen der Anpassung der Daten werdenaber nur Modelle gesucht, die weiteren An-forderungen genügen. Dies können minima-le Struktur, Glattheit, minimale Variation übereinem Hintergrundwiderstand u. a. sein. Wirformulieren das inverse Problem als nichtli-neare, multikriterielle Optimierungsaufgabe.Nichtlinear, da die Abbildung des Modell-raums auf den Datenraum, der Vorwärtsope-rator, nichtlinear ist. Multikriteriell, da meh-rere Zielfunktionen, der Fehler der Datenan-passung sowie weitere Modellnormen, mini-miert werden sollen. Der klassische Lösungs-weg ist die Linearkombination der verschie-denen Zielfunktionen und die Bestimmung ei-nes optimalen Modells mit Hilfe der L-Kurve.Dazu wird ein benachbartes linearisiertes Pro-blem minimiert, das die rechen- und speicher-intensive Erstellung der Sensitivitätsmatrix er-fordert. Das Inversionsergebnis ist dabei i. A.von der Wahl des Startmodells abhängig.Stochastische Optimierungsmethoden, wieMonte-Carlo-Suche, simulated annealing undgenetische Algorithmen, erfordern keine ge-eigneten Startmodelle und benötigen keineSensitivitätsmatrix, sind jedoch sehr rechenin-tensiv. Es ist möglich, die Optimierungsauf-gabe ohne Linearkombination der Zielfunk-tionen mit Hilfe eines genetischen Algorith-
mus zu lösen. Dazu wird die Technik dernicht-dominierten Sortierung eingesetzt, wiesie von Srinivas und Deb (1994)1 vorgestelltwurde. Dabei wird ausgenutzt, dass gene-tische Algorithmen nicht mit einem einzel-nen Modell, sondern mit einer Population, ei-ner großen Anzahl von Modellen gleichzei-tig arbeiten. Man erhält nach einem Durch-lauf des genetischen Algorithmus eine Anzahlsogenannter quasi-optimaler Lösungen. Einequasi-optimale Lösung ist ein Modell, zu demkein anderes Modell existiert, dessen Ziel-funktionswerte alle besser sind als diejenigendes ersten Modells. Somit unterscheiden sichdie Lösungen im Grad ihrer Anpassung derDaten und im Grad der Glattheit, Strukturiert-heit, etc.Neben den gebäuchlichen Ansätzen für dieEinschränkung des Modellraums, wie z. B. dieNorm des Modellvektors oder die Norm derAbleitung des Modellvektors, ist es mit einemgenetischen Algorithmus einfach möglich, an-dere Maße zu verwenden. Wir setzen einenOperator ein, der die Anzahl von Blöcken un-terschiedlicher Widerstandswerte zählt. Da-mit wird eine blockige Struktur erzielt undder Anpassung des Rauschanteils der Datenmit oszillierenden Modellen entgegengewirkt.Blöcke in geringer sensitiven Bereichen kön-nen dabei leicht zu größeren Einheiten zusam-mengefasst werden, so dass sich der Informa-tionsgehalt des Datensatzes im Modell wider-spiegelt.
1Srinivas, N., Deb, K. (1994). Multiobjective opti-mization using nondominated sorting in genetic algo-rithms. Evolutionary Computation, 2(3), 221-248.
Elektromagnetik und Geoelektrik 25
Um mit dem genetischen Algorithmus einestatistisch zuverlässige Konvergenz zu errei-chen, sind bei einer großen Anzahl von ge-suchten Parametern große Populationen unddamit viele Evolutionsschritte erforderlich.Essentiell für den praktischen Einsatz ist we-gen der enormen Anzahl benötigter Modell-rechnungen ein schneller Vorwärtsoperator.Weiterhin lässt sich die Rechenzeit durchParallelisierung des genetischen Algorithmusdeutlich verkürzen. Auf einem kleinen Clusterherkömmlicher PCs ist damit derzeit die Inver-sion kleiner 2D-Datensätze möglich.
26 Abstracts
EE10 – Do., 27.2., 15:20-15:40 Uhr · HS7Becken, M., Schenk, A., Burkhardt, H. (TU Berlin)
Zur Parametrisierung des ImpedanztensorsE-Mail: [email protected]
Die Dimensionalität des magnetotelluri-schen Impedanztensors wird durch die An-zahl der Freiheitsgrade bestimmt. Fünf Frei-heitsgrade entsprechen dem ’strengen’ 2D-Fall, acht Freiheitsgrade - die maximale An-zahl von Freiheitsgraden - spiegelt ’starke’3D-Effekte wider. Es treten aber auch Fällemit sechs oder sieben Freiheitsgraden auf, dievom strengen 2D-Fall abweichen, unter Um-ständen aber noch mit einem regionalen 2D-Modell und lokaler 2D/3D Verzerrung erklärtwerden können (z. B. Bahr 1988, Groom-Bailey 1989, Smith, 1995). Bei der Ver-zerrungsanalyse wird implizit vorausgesetzt,dass sich der Polarisationszustand des elek-trischen Feldes nicht ändert, d.h. ein line-ar polarisiertes elektrisches Feld in Richtungder Hauptachsen der regionalen 2D-Strukturbleibt bei galvanischer Verzerrung linear pola-risiert, während die Polarisationsrichtung ge-dreht und die Amplitude skaliert wird.
Ein anderer Ansatz in der MT-Datenanalyseist eine modifizierte Singulärwertzerlegungnach LaTorraca et al. (1986) bzw. die kano-nische Zerlegung des Impedanztensors nachYee und Paulson (1987). Im Gegensatz zurVerzerrungsanalyse sind die elektrischen undmagnetischen Singulärvektoren generell ellip-tisch polarisiert, aber bi-orthogonal, d.h. dieelektrischen wie die magnetischen Singulär-vektoren bilden jeweils ein Orthogonalsystem.Daraus wird gefolgert, dass sich die Verzer-rung des regional zweidimensionalen elektri-schen Feldes durch eine zweidimensionale In-homogenität in linearen elektrischen Polarisa-tionszuständen in einem gedrehten Orthogo-
nalsystem äußert, wohingegen im Fall einerdreidimensionalen verzerrenden Inhomogeni-tät mit unterschiedlichen Drehwinkeln für diebeiden Feldkomponenten elliptische Polarisa-tionszustände in jedem orthogonalen Koordi-natensystem auftreten.
Deshalb wird in Analogie zur SVD eine al-ternative Parametrisierung des Impedanzten-sors mit acht Freiheitsgraden eingeführt, dieeine nicht-orthogonale Basis für das elektri-sche Feld zulässt. Wenn ein Verzerrungsmo-dell die Daten erklären kann, dann werdenein oder zwei Parameter Null, während dienicht verschwindenden Parameter die regio-nalen Impedanzen, das regionale Koordina-tensystem sowie die Verzerrungswinkel erge-ben. Im Fall von sechs Freiheitsgraden ent-spricht diese Parametrisierung der SVD, wo-mit gleichzeitig deutlich wird, dass hier dieSVD und die Verzerrungsanalyse das gleicheErgebnis liefern.
Die Anwendung auf MT-Daten, die übereiner mittelskaligen Grabenstruktur gemes-sen wurden, führen zu der Hypothese, dassdie hochleitfähigen Grabensedimente mit ei-ner Mächtigkeit von bis zu 500 m zur Verzer-rung der Daten mit Perioden größer 10 s füh-ren, indem die Ströme in Richtung der Gra-benachse kanalisiert werden. Die großskaligeregionale Struktur scheint dabei in einem Win-kel von 45 Grad zur Grabenachse zu streichen.Diese Ergebnisse werden momentan mit 3D-Modellrechnungen überprüft.
Die Daten, die hier verwendet wurden, wur-den während einer Messkampagne im Jahr2001 im Rahmen des DFG-Projektes ’Geo-
Elektromagnetik und Geoelektrik 27
physikalische Untersuchungen von Becken-strukturen und Sedimentinventar in der nörd-lichen Badain Jaran Shamo, NW-China’ ge-wonnen.
28 Abstracts
EE11 – Do., 27.2., 15:40-16:00 Uhr · HS7Braun, M., Hertrich, M., Yaramanci, U. (TU Berlin)
Modellierung komplexwertiger SNMR Signale im leitfähigen UntergrundE-Mail: [email protected]
Die SNMR (Surface Nuclear Magnetic Re-sonance) wird zur Erkundung und Charakte-risierung von Aquiferen verwendet. Bei derSNMR können der Wassergehalt und die ef-fektive Porengröße direkt aus Messungen ander Erdoberfläche bestimmt werden.
Zur Durchführung des NMR-Experimenteswird eine an der Erdoberfläche liegendestromdurchflossene Spule verwendet, die einmit der lokalen Larmorfrequenz oszillieren-des Wechselfeld erzeugt. Das Erdmagnetfelddient als statisches Hauptfeld. Die Eindring-tiefe wird durch das Pulsmoment bestimmt.Eine Vergrößerung des Pulsmomentes bewirkteine Tiefenfokussierung [1]. In einem leit-fähigen Halbraum ist das anregende Magnet-feld elliptisch polarisiert. So erhält man ei-ne komplexe SNMR Sondierungskurve, derenAmplitude proportional zum Wassergehalt istund deren Phase sensitiv bezüglich leitfähigerStrukturen ist [2].
Unter eindimensionalen Bedingungen setztsich das SNMR Signal aus einer komplexenSensitivitätsmatrix (Kernfunktion), welche dielokalen Randbedingungen (Spulengeometrie,Erdmagnetfeld, Leitfähigkeit des Untergrun-des) berücksichtigt, und einer eindimensiona-len Wasserverteilung zusammen [3].
Zur Untersuchung der Auswirkungen vonleitfähigen Schichten auf das SNMR Signalwird ein für Norddeutschland typisches geo-logisches Beispiel verwendet, bei dem in ca.150 m Tiefe eine hochleitfähige Schicht (Ton)ansteht. Die Untergrundmodelle A und Bunterscheiden sich durch eine hochleitfähi-ge Schicht in ca. 150 m Tiefe bei gleicher
Wassergehaltsverteilung (Abb. 1a). Abb. 1czeigt die Kernfunktionen in Real- und Imagi-närteil für vier unterschiedliche Pulsmomenteder Modelle A und B. Insbesondere bei höhe-ren Pulsmomenten kann man eindeutig erken-nen, dass die hochleitfähige Schicht einen be-deutenden Einfluss auf die Kernfunktion hat.Oberhalb von 150 m werden die Amplitudenvergrößert, in der leitfähigen Schicht wird dasSignal stark gedämpft. Dabei sind die Effekteim Imaginärteil größer als im Realteil. Dementsprechend unterscheiden sich die SNMRSondierungskurven für die Modelle A und B(Abb. 1b). Das Modell A weist sowohl höhereAmplituden als auch größere Phasen auf.
Nachdem es nun möglich ist, das SNMR Si-gnal in Betrag und Phase zu modellieren, wirddie Relevanz der Leitfähigkeit bis in großeTiefen deutlich. So kann eine erweiterte Aus-wertung von bisher unerklärten Phänomenenin SNMR Daten erfolgen.
[1] Yaramanci, U., 2000. Surface Nuclear Ma-gnetic Resonance (SNMR) - A new method for ex-ploration of ground water and aquifer properties.Ann. Geofis., 43 (6), 1159-1175.
[2] Weichman, P., Lavely, E., Ritzwoller, M.,2000. Theory of surface nuclear magnetic reso-nance with applications to geophysical imagingproblems. Phys. Rev. E, 62 (1), 1290-1312.
[3] Braun, M., 2002. Untersuchungen komplex-wertiger Oberflächen-NMR Signale im leitfähigenUntergrund. Diplomarbeit. TU Berlin.
Webseite: http://www.geophysik.tu-berlin.de
Elektromagnetik und Geoelektrik 29
Abbildung 1: a) Untergrundmodell mit Wassergehaltsverteilung (graue Fläche, linear ska-liert) und Widerstandsverteilung A und B (Linien, halblogarithmisch skaliert); b) modelliertesSNMR Signal; c) Kernfunktionen in Real- und Imaginärteil für vier Pulsmomente für ModelleA und B; Kreisspule mit 100 m Durchmesser, B0 = 48985.92nT, I = 60◦ .
30 Abstracts
EE12 – Do., 27.2., 16:30-16:50 Uhr · HS7Tillmann, A. (FZ Jülich, ICG-IV), Verweerd, A. (FZ Jülich, ZEL), Kemna, A. (FZ Jülich, ICG-IV)
MERIT: Eine nichtinvasive Methode zur Bestimmung der dreidimensionalenelektrischen LeitfähigkeitsverteilungE-Mail: [email protected]
Die nichtinvasive Messung physikalischerParameter in porösen Medien ist ein notwen-diges Hilfsmittel, um Fließ- und Transport-prozesse in ungestörten Bodenproben zeitlichund räumlich kontinuierlich zu beobachten,um das Verständnis der Transportprozesse zuvertiefen. Allerdings ist es notwendig einenmeßbaren physikalischen Ersatzparameter zufinden, der die eigentlichen interessierendenParameter wie Porosität, Wassersättigung, Sa-linität etc. repräsentiert. In diesem Falle die-nen die Variationen der elektrischen Leitfä-higkeit als physikalisch messbare Größe, dieaus der zeitlichen und räumlichen Änderungder Fluidsalinität bzw. der Fluidsättigung desPorenraumes herrührt. Mit Hilfe von ME-RIT (Magneto-Electrical Resistivity ImagingTechnique) untersuchen wir daher die drei-dimensionale elektrische Leitfähigkeitsvertei-lung in Bodensäulen und Lysimetern.
Die Methode basiert auf der kombinier-ten Messung und Auswertung des elektri-schen Potentials an der Probenoberfläche undder aus der Stromeinspeisung resultieren-den Magnetfeldstärken außerhalb der Probe.Damit stellt MERIT eine Kombination derElektrischen Widerstandstomographie (ERT)und Magnetometrischen Widerstandsmetho-de (MMR) dar. Um eine räumliche Auflö-sung der elektrischen Leitfähigkeitsverteilungzu erreichen, werden niederfrequente Strömemit Frequenzen kleiner als 100 Hz in zahl-reichen Konfigurationen in eine zylindrischesynthetische oder natürliche Bodenprobe ein-
gespeist. Die Berechnung des dreidimensio-nalen elektrischen Potentials erfolgt mit Hilfeder Finite-Elemente-Methode, wobei die Geo-metrie der zylindrischen Probe in einzelne He-xaeder und Prismen zerlegt wird. Die darausermittelte Stromdichteveteilung in den einzel-nen Elementen dient als Grundlage für die Be-rechnung der magnetischen Feldstärken an be-liebigen Messpunkten durch das Gesetz vonBiot-Savart.
Anhand von Modellrechnungen werden dieSensitivitäten und das Auflösungsvermögenbezüglich der Leitfähigkeitsänderungen in deneinzelnen Elementen sowohl der elektrischenund magnetischen Messungen als auch derenKombination durch MERIT für unterschied-liche Messkonfigurationen bestimmt und ge-genübergestellt. Die Vorteile von MERIT ge-genüber der alleinigen Verwendung von ERToder MMR werden aufgezeigt.
Untermauert werden die theoretischenErgebnisse durch Messungen an einerTestsäule durchgeführt wurden. Der Mess-aufbau umfasst einen robotergesteuerten3-Komponenten-Fluxgatesensor unter abge-schirmten Bedingungen. Der Messaufbau unddie damit gewonnenen Erkenntnisse aus dentheoretischen Überlegungen und den bishe-rigen Messungen bezüglich der Anwendungauf der Lysimeterskala werden dargelegt.
Webseite: http://www.fz-juelich.de/icg
Elektromagnetik und Geoelektrik 31
EE13 – Do., 27.2., 16:50-17:10 Uhr · HS7Rücker, C. (Leipzig)
3D Finite-Elemente Methode zur DC WiderstandsmodellierungE-Mail: [email protected]
Mit immer leistungsfähigeren Rechnersys-temen und genauer werdenden Inversions-algorithmen steigen auch die Anforderun-gen und Wünsche an die Vorwärtsmodellie-rungsmethoden für die Gleichstromgeoelek-trik. Eine Leitfähigkeitsverteilung in 3 Di-mensionen oder die freie Wahl von Elek-trodenpositionen, wie sie z.B. für Modellie-rungen von Bohrlochmessungen oder nichtäquidistanten Meßkonfigurationen notwendigsind, bereiten den meisten Algorithmen wenigSchwierigkeiten. Modellprobleme mit kom-plizierter Topographie, hohen Leitfähigkeits-kontrasten oder die Modellierung mit großenGeometrieverhältnissen sind mit Hilfe derklassischen Methoden, wie z.B. die Finite Dif-ferenzen Modellierung, nur durch enorm ho-hen Aufwand oder gar nicht zu lösen.
Bei der gerade in der Geophysik weit ver-breiteten Methode der Finiten Differenzen er-folgt die Diskretisierung des Modellraumsin Quader, was nur eine bedingte Anpas-sungsfähigkeit an die gewünschte Modellgeo-metrie zur Folge hat. Die Finite Elemen-te Modellierung unterliegt dieser Einschrän-kung nicht und bietet durch die freie Wahlder Diskretisierungformen die Flexibilität diefür moderne Modellierungsprobleme notwen-dig ist. Mit der vielseitigsten GeometrischeForm in 3 Dimensionen, dem Tetraeder, istdie Möglichkeit gegeben nahezu jede Geome-trie nachzubilden und somit für eine Model-lierung vorzubereiten. Mit einem aus Tetra-edern aufgebauten nicht regulären Diskretisie-rungsgitter sind leicht Geometrieverhältnissevon 1:100000 zu verwirklichen. Ein Beispiel
für die Notwendigkeit einer solchen Geome-triedynamik wäre die Einbettung eines Bohr-lochs von 40 cm Durchmesser in einen Mo-dellraum von 40 km. Komplizierte Topogra-phische Reliefs wie sie bei der Modellierungvon Messungen an Vulkanen auftreten sindebenso realisierbar wie lokale Verfeinerungendes Meßgitters. Numerische Probleme welchedurch Singularitäten an den Einspeisepunktenoder sehr hohe Leitfähigkeitskontraste auftre-ten können so entgegengewirkt werden. Mo-delle mit Kontrasten in der Leitfähigkeit von1:107 konnten somit bisher erfolgreich berech-net werden.
Der numerische Aufwand einer auf Dis-kretisierung beruhender Modellierungsmetho-de ist im wesentlichen von der Anzahl anStützstellen im Modellraum, den sogenanntenKnoten, abhängig. Eine Erhöhung der Kno-tenanzahl bringt in der Regel eine Verbesse-rung des Modellierungsergebnisses, läßt aberauch die Rechenzeit überproportional anstei-gen. Eine an das Problem angepaßte Ver-teilung der Diskretisierungsdichte bietet dabeieinen guten Kompromiß zwischen Rechenzeitund erzielter Genauigkeit. Durch nichtregulä-re Tetraedergitter ist es nun möglich eine lo-kale Verdichtung von Knotenpunkten an kriti-schen Stellen im Modell zu erreichen und so-mit die Anzahl an Knotenpunkten gering zuhalten.
In diesem Vortrag wird eine auf Te-traederdiskretisierung basierende 3D FE-Modellierung vorgestellt und die Vor- undNachteile dieses Verfahrens diskutiert.
32 Abstracts
EE14 – Do., 27.2., 17:10-17:30 Uhr · HS7Radic, T. (TU Berlin)
Erkennung und Minderung von systematischen Fehlern bei spektralen IP-MessungenE-Mail: [email protected]
EINLEITUNGSpektrale IP-Messungen werden mittler-weile zur Klärung der unterschiedlichstengeowissenschaftlichen Fragestellungen ein-gesetzt. Waren die Untersuchungsobjektevor kaum mehr als einem Jahrzehnt pri-mär Erzvorkommen, so sind es jetzt, dankverbesserter Messtechnik, auch sämtlichenichtmineralisierten Gesteine. Die klassischeTiefenerkundung von der Oberfläche her wirddabei ergänzt durch Rammloch, Bohrloch,Crosshole und untertägige Messungen, sowie
Abbildung 1: Am Teststandort Nauen (beiBerlin) gemessene Phase in Abhängigkeit vonder Frequenz und einem Zusatzwiderstand Ran einer der Stromelektroden (B). Zur Berech-nung des spezifischen Widerstandes wurde deran dieser Elektrode gemessene Strom verwen-det. Der Betrag des scheinbaren spezifischenWiderstandes beträgt bei 10 Hz 2610 Ohmm.Konfiguration: AB=10 m, MN=1 m (Schlum-berger).
Mischformen zwischen diesen. SämtlicheFeldkonfigurationen findet man im Labor-maßstab wieder. Weitere Anwendungsfeldersind die Charakterisierung von technischenStoffen, Gebäuden und lebende Objekten wieBäumen.
PROBLEMSTELLUNGDiese vielfältigen Einsatzbereiche bedin-
gen extrem unterschiedliche Anforderungenan die Messtechnik. Zum Teil werden dieMessungen durch hohe Störsignalpegel er-schwert oder aufgrund extrem hoher oderniedriger Leitfähigkeiten von systematischenFehlern verfälscht. Während Störsignaleleicht erkannt und, z.B. mit der geoelektri-
Abbildung 2: Im Labor an einem nicht polari-sierbarem Medium gemessene parasitäre Pha-se des spezifischen Widerstandes in Abhän-gigkeit von der Frequenz und dem Ankopp-lungswiderstand R. Linien: Beste Anpassungmit RC-Tiefpässen (C = 3 pF, R s. Legende).
Elektromagnetik und Geoelektrik 33
schen Referenztechnik (Radic, 2002), vielfachwirksam gemindert werden können, sind dieMethoden zur Erkennung von systemati-schen Fehlern sowie deren Behebung nochunvollständig und, wenn vorhanden, wenigbekannt. Typisch für systematische Fehlerist, dass sie sich stark auf die Messdatenauswirken können, ohne dass dies bemerktwird. Fehlinterpretationen sind dann unver-meidlich. Wenn die Frequenzcharakteristikenaber keine Auffälligkeiten zeigen, dannsind Techniken zu Ihrer Aufdeckung vonessentieller Bedeutung für den erfolgreichenEinsatz von Wechselstrommessungen. Gutuntersucht und verstanden sind Induktionser-scheinungen (Kretzschmar, 2001). Wenigerbekannt, obwohl immer vorhanden, sind die,in Fällen unzureichender galvanischer An-kopplung der Potential- und Stromelektroden,hervortretenden ungewollten Signalpfade.Diese konkurrieren stets, mehr oder wenigererfolgreich, mit den gewollten Pfaden. Darestriktive Randbedingungen (getrocknetesProbenmaterial, kleine Probenvolumina, ver-baute Proben etc.) eine optimale Ankopplungnicht selten behindern, müssen die parasi-tären Leitungspfade identifiziert und durchtechnische Maßnahmen versperrt oder durcheine Modellierung der Störeffekte ihr Einflussgemindert werden.
FALLBEISPIELEIm Rahmen des Vortrages werden 3 para-
sitäre Signalpfade hinsichtlich ihres Erschei-nungsbildes in den Messdaten vorgestellt:– Kapazitive Kopplung der stromführenden
Kabel mit dem Erdboden (Abb. 1)– Tiefpasseffekt bei der Spannungsmessung
(Abb. 2)– Galvanische Einspeisung von Störsignalen
in die SignalquelleAusgehend von Schlüsselexperimenten wur-
den Störmodelle aufgestellt und Methodenzur Minderung dieser Fehler entwickeltund erprobt. Sämtliche Methoden wurdenso gewählt, dass sie möglichst breit ein-gesetzt werden können, ohne dass es zuihrer Anwendung besonderer Fertigkeitenund Kenntnisse bedarf. Auch sogenannteGleichstromapparaturen verwenden zeitlichvariierende Anregungssignale. Daher mussauch bei diesen mit dem Auftreten vonsystematischen Fehlern gerechnet werden,sofern die unerwünschten Leitungsvorgängebei Frequenzen um ein Hertz bedeutsamsind. Allerdings können die neu entwickeltenMethoden mit Gleichstromapparaturen nichtgenutzt werden, da zu ihrer Anwendung dieKenntnis der Phase des frequenzabhängigenspezifischen Widerstandes erforderlich ist.
LITERATURKretzschmar, D. (2001): Untersuchungenzur Inversion von spektralen IP-Daten un-ter Berücksichtigung elektromagnetischerKabelkopplungseffekte. Dissertation D83,Technische Universität Berlin.Radic, T. (2002): Wirksame Unterdrückungvon Störspannungen bei SIP-Messungenmittels geoelektrischer Referenztechnik.Zusammenfassungsband zur DGG-Tagung2002, Hannover.
Webseite: http://www.radic-research.de
34 Abstracts
EEP01Börner, R.-U. (Freiberg)
3D Finite Difference Time Domain Modelling of Electromagnetic FieldsE-Mail: [email protected]
The Finite Difference Time Domain mod-eling technique provides much needed insightabout the response of transient electromag-netic fields in complicated conductivity struc-tures. The FDTD method, introduced by Yeein 1966, has remained the subject of contin-uous development. There are several reasonsfor the expansion of interest in FDTD solutionapproaches for Maxwell’s curl equations.
Being a fully explicit computation, FDTDavoids difficulties with linear algebra thatlimit the size of conductivity models to gen-erally fewer than 106 electromagnetic fieldunknowns. Moreover, the sources of errorin FDTD calculations are well understood.While the trend of rapidly increasing com-puter capacities positively influences all nu-merical techniques, it is of particular advan-tage to FDTD methods which are founded ondiscretizing space over a volume, and there-fore inherently require large memory.
We have developed a solution for 3D prob-lems, which is based on a time-stepping ofthe system of Maxwell equations using astaggered-grid approach. By introducing atransformation of the spatial and temporalvariables, a regular grid is obtained which re-duces the need for many enlarged conductiv-ity blocks near the boundaries of the model-ing domain. This is of particular interest, sincethe inhomogeneous boundary condition at theair-earth interface requires an upward con-tinuation of the magnetic field which is per-formed by a two-dimensional Fourier trans-form. The regular grid avoids numerical inac-curacies which would occur by interpolating
the fields at the non-transformed model sur-face. In contrast, interpolation is computed inthe wavenumber domain by zero-padding andproper windowing the spectra, thus preservingthe spatial frequency content of electromag-netic fields.
Elektromagnetik und Geoelektrik – Poster 35
EEP02Wu, X. (TU Freiberg)
3-D DC resistivity / IP inversions using conjugate gradient methodE-Mail: [email protected]
A rapid DC resistivity / IP inversion algo-rithm has been developed using conjugate gra-dient (CG) relaxation techniques and Jacobianmatrices G obtained by the Rodi method. Theobjective function of the 3-D resistivity inver-sion for minimum structure is given by
Ψ = ΔmT (RTx Rx +RT
y Ry +RTz Rz)Δm (1)
+λ−1(Δd −GΔm)T (Δd −GΔm),
where the vector Δd is the difference be-tween the measured potential data dobs and thetheoretical potential d0 of the synthetic model.The vector Δm is the model update, G is thederivative or Jacobian matrix. For 3-D mod-els, we use a 3-D prismatic grid of nx×ny×nzgrid nodes. The model parameter is the con-ductivity σ of each block, which will be recon-structed in the 3-D resistivitiy inversion. Themeasured data are E-SCAN pole-pole poten-tials φobs. Rx, Ry, and Rz are the roughnessmatrices in the x-,y-,and z- directions, respec-tively. λ is a Lagrange multiplier. Both themodel parameters and the potential data val-ues are logarithmically scaled in order to im-prove the stability of the 3-D inversion, i.e.d = lnφobs and m = lnσ. A smoothest solutionis obtained by minimizing the objective func-tion. The CG method is used to solve the largeoptimization problem. It bypasses the com-putation of the derivative matrix G and onlyrequires the results of the derivative matrixG and its transpose GT multiplying vectors,which gives Gx and GT y, respectively. Theinversion is computed rapidly without hugestorage requirements for G and GT G. On
the other hand, to solve the smoothest solu-tion effectively erases unnecessary structures,suppresses non-uniqueness and obtains stable,trustworthy results close to the true model.
There is an intimate connection betweenDC resistivity and IP data. The developedresistivity inversion can be easily transferredinto 3-D IP inversion. Let η denote the charge-ability of each block. The IP data ηa, whichwe refer to as apparent chargeabilities, have alinear relation to η, written as
ηa = Gη, (2)
where G is the same Jacobian matrix as in 3-Dresistivity inversion. In the same way, the in-verse IP problem is solved by minimizing anobjective function similar to eq. (1). This ob-tains a system of linear equations
[GT G+λ(RT
x Rx +RTy Ry +RT
z Rz)]
η =
GT ηa. (3)
First, the conductivity distribution is recov-ered in the 3-D DC resistivity inversion andthen it is used to compute the Jacobian ma-trix G in the previous equation. Finally, thisequation is solved using the conjugate gradientmethod to obtain the chargeability η. The al-gorithm is tested using simple synthetic mod-els and it shows promising results.
ACKNOWLEDGMENTSThis work was supported by funds fromthe Natural Sciences Foundation of China(No.40004005)
36 Abstracts
EEP03Günther, Th., Spitzer, K. (TU Freiberg)
Improvements on 3d dc resistivity inversionE-Mail: [email protected]
In multi-dimensional inversion problemsthe number of free model parameters is usu-ally higher than the number of data points.Furthermore, when data errors are consid-ered, a lot of possible models exist, whichagree with the data within a given error limit.Thus, such problems are generally ill-posedand have to be regularized in an appropriateway to obtain a confident and plausible result.The difficulties can be significantly reduced bythe following ways:
Effective data sets Especially in 3d prob-lems it is useful to think about effec-tively combining various measurementsgiving a maximum of information at agiven cost. Assuming a certain data er-ror one can define an "‘data efficieny"’which helps to find a trade-off betweendata quality and resolution.
Model parameterization The arrangementof model cells has to consider theresolving capabilities of the data set.This can be obtained regarding "‘modelresolution"’ by means of SVD analysisof the Jacobian matrix. The result is areduction of cells without loss of infor-mation. Hence one has to distinct modeldiscretization for inverse procedure andforward calculation.
Optimized Regularization With an optimalchoice of regularization method andstrength one can avoid loosing informa-tion by the regularization procedure. Theoptimum can be determined by regard-
ing the L-curve of the varying regulariza-tion parameter λ. Solutions for many λican be obtained simultaneously using fastCG-based algorithms.
Sensitivity calculation In nonlinear inver-sion the Jacobian (or sensitivity) matrixhas to be computed in every iterationstep. This can be accomplished by updat-ing schemes like Broyden’s method or byFinite Difference (FD) approximations ofthe sensitivity theorem. The decomposi-tion into normal and anomalous potentialin the forward operator can be exploitedto derive an update formula, which ismore accurate than FD approximations,since the anomalous potential is generallysmaller and smoother than the normal po-tential.
The new approaches are applied to three-dimensional inversion of synthetic and fielddata sets. It can be seen, how the solution ofthe inverse problem is improved in a very fastway.
Web page: http://www.geophysik.tu-freiberg.de/spitzer/
Elektromagnetik und Geoelektrik – Poster 37
EEP04Krause, Y., Just, A., Tuch, A. (Leipzig)
3D-Modellierung zur Auswertung linienhaft gemessener Untertage-GeoelektrikdatenE-Mail: [email protected]
Bei der untertägigen geophysikalischen Er-kundung ist die Profilanlagengeometrie aufdie Streckenauffahrung durch den Bergbaube-trieb angewiesen. Insbesondere wenn sich kei-ne Möglichkeit zur Tomographie oder Kreuz-sondierung des Untersuchungsobjekts bietet,erfordern Untertagemessungen die Berück-sichtigung einer Systemantwort aus dem Voll-raum, der von den Hohlräumen des Grubenge-bäudes durchdrungen wird.
Im Rahmen des Forschungsvorhabens„Geophysikalische Erkundung als Beitragzur Bewertung der Langzeitsicherheit vonEndlagern und Untertagedeponien“ (Fkz.BMBF 02C0861), das in einem gesondertenBeitrag (JACOBS ET AL.) vorgestellt wird,wurden im Kalisalz-Bergwerk Sigmundshallauf der 480m Sohle Geoelektrikmessungendurchgeführt. Gegenstand der Untersuchun-gen war ein Salzlösungsvorkommen in etwa60m Entfernung vom Stoss, dessen Lage undAusmass nicht genau bekannt ist.
Ein Profil von 318m Gesamtlänge wur-de am Stoss der Strecke mit einem Elektro-denabstand von 2m angelegt und in Dipol-Dipol-Anordnung gemessen. Bei einer Brei-te der Strecke von 11m und einer Höhe von6m erreicht das Verhältnis von Dipolauslagezur Streckenbreite bei Weitaufstellungen derMessanordnung Werte von 20:1, was die In-terpretation der Daten im dreidimensionalenRaum erforderlich macht.
Für die Auswertung der linienhaft gemes-senen Untertage-Geoelektrikdaten sollen da-her anhand von dreidimensionalen Modell-rechnungen die folgenden Fragen geklärt wer-
Abbildung 1: 3D-Modellierung einer Dipolein-speisung an der Firste eines quaderförmigen Hohl-raums
den: Unter welchen Voraussetzungen darfangenommen werden, dass die auf einemMessprofil gewonnenen Messdaten tatsäch-lich aus einer zweidimensionalen Profilschnit-tebene kommen? Von zentraler Bedeutung isthier, bis zu welcher Entfernung zum Messpro-fil ein Target als dreidimensionaler Störkör-per noch richtungsabhängig lokalisiert wer-den kann. Darüber hinaus kann davon aus-gegangen werden, dass die Hohlraumgeome-trie des Grubengebäudes, speziell Streckenab-zweigungen oder existente Nachbarsohlen, dieGeoelektrikmessung im Vollraum beeinflusst.
38 Abstracts
Ziel der Modellierung ist die Erstellung eines3D-Referenzmodells der untertägigen Streckeim Bereich des Messprofils, um die Geoelek-trikdaten anhand des zweidimensionalen In-versionsergebnisses besser interpretieren zukönnen.
Der Beitrag widmet sich in numerischenModelluntersuchungen den Schwierigkeitender Mehrdeutigkeit und den Störeinflüssen,die bei geoelektrischen Untertagemessungenauftreten können, sowie der Inversion derMessdaten aus Sigmundshall.
Abbildung 1 zeigt ein Gitter mit 930000Finiten Elementen für einen quaderförmigenHohlraum der Abmessungen 10x10m ineinem homogenen, 1km grossen Modell. DieModellierung einer Einspeisung an der Firstemit einem achsenparallelen Dipol von 2mergibt in Einspeisungsnähe Abweichungenvon 100% zum Dipolpotential im Vollraum,die auf die an der Firste geltenden Halbraum-bedingungen zurückgeführt werden können.Dargestellt auf vier achsenparallelen Profilenentlang der Flächen von Firste, Sohle undStössen, ist das elektrische Potential in etwa100m Dipolentfernung auf eine Abweichungvon unter 1% abgefallen, und es könnenVollraumbedingungen angenommen werden.
REFERENZ:JACOBS, F., JUST, A., KRAUSE, Y., TUCH,A., SCHUCK, A. (Leipzig), SCHULZ, R.,KURZ, G., IGEL, J. (Hannover), LIND-NER, U., SCHICHT, T. (Sondershausen),SCHWANDT, A. (Erfurt), KÜHNICKE, H.,SCHULZE, E. (Dresden): Geophysikali-sche Erkundung als Beitrag zur Bewertungder Langzeitsicherheit von Endlagern undUntertagedeponien.- 63. Jahrestagung derDeutschen Geophysikalischen Gesellschaft,24.-28.2.2003 in Jena.
Elektromagnetik und Geoelektrik – Poster 39
EEP05Mohnke, O., Yaramanci, U. (TU-Berlin)
Spektrale Inversion und Interpretation von Oberflächen NMR FelddatenE-Mail: [email protected]
Mit dem geophysikalischen Verfahren derOberflächen NMR (Surface Nuclear Magne-tic Resonance, SNMR oder Magnetic Reso-nance Sounding, MRS) ist es möglich, durchOberflächenmessungen direkt auf die Vertei-lung des freien Porenwassers im Untergrundzu schließen und Informationen über die Ver-teilung der Porengrößen zu gewinnen. Beieiner SNMR Sondierung werden die Wasser-stoffprotonen des Porenwassers durch ein ma-gnetisches Wechselfeld angeregt, welches mitder lokalen Larmorfrequenz oszilliert (ca. 2kHz). In der Praxis wird dies durch einean der Oberfläche ausgelegte stromdurchflos-sene Spule realisiert (Durchmesser 50 - 100m). Die Intensität der Anregung wird durchdas Pulsmoment q charakterisiert, welches dieEindringtiefe des Verfahrens steuert. Durchdie Verwendung höherer Pulsmomente wirddie NMR Anregung auf größere Tiefenberei-che fokussiert. Nach dem Abschalten desPulses wird das durch die Relaxation der an-geregten Wasserstoffprotonen hervorgerufeneMagnetfeld mit derselben Spule registriert.Die Signalamplitude ist dabei proportional zurMenge des freien Porenwassers. Das Relaxa-tionsverhalten (Abklingkonstante) des SNMRSignals ist abhängig von der Verteilung derPorengrößen im Untergrund. Die Signalphasesteht in Beziehung zur elektrischen Leitfähig-keit des Untergrundes [1, 2].
Bislang konzentriert man sich bei der Aus-wertung von SNMR Sondierungen auf die In-terpretation der Verteilung des freien Poren-wassers. Für die Analyse des Abklingverhal-tens der gemessenen SNMR Signale wird je-
weils nur eine Abklingzeit für jedes Schicht-paket angepasst, d.h. es wird näherungswei-se von einer mittleren Porengröße ausgegan-gen [3, 4]. Dies hat jedoch oft eine nicht op-timale Anpassung der einzelnen Abklingkur-ven zur Folge und kann zu Fehlinterpretatio-nen der Ergebnisse von SNMR Sondierungenin Bezug auf Wassergehalt und Porenvertei-lung im Untergrund führen.
Mit der erstmaligen Anwendung einer spek-tralen Inversion, d.h. einer multi-exponentialeAnpassung, von SNMR Abklingkurven lassensich analog zur Labor- bzw. Bohrloch- NMRdifferenziertere Aussagen über die Porenver-teilung im Untergrund allein aus Oberflächen-messungen machen. Bei der spektralen An-passung werden für ein festgelegtes Spektrum(z.B. 32 Abklingzeiten zwischen 10 und 1000ms) SNMR Amplituden optimiert. Für jedeAbklingzeit des Spektrums wird eine eigeneindividuelle Sondierungskurve angepasst. DieInversion ergibt dann jeweils die Verteilungdes freien Porenwassers innerhalb eines zu ei-ner charakteristischen Abklingzeit zugeordne-ten Porenradienbereiches.
Aufbauend auf die an synthetischen Mo-dellen gewonnenen Erkenntnisse werden dieSNMR Datensätze zweier Messgebiete spek-tral analysiert. Die Geologie des Messge-bietes Nauen ist geprägt durch Wechsellage-rungen quartärer Sande und ist aufgrund vonBohrlochmessungen sowie begleitenden geo-physikalische Untersuchungen petrophysika-lisch gut erfasst [5]. Das Messgebiet Waalwi-jk befindet sich innerhalb einer Marschland-schaft im Küstenbereich der Niederlande.
40 Abstracts
Neben einer erheblichen Verbesserung derDatenanpassung kann im Vergleich zur kon-ventionellen Interpretation von SNMR Da-ten auf diese Weise für beide Datensätze ei-ne tiefenhängige Porenradienverteilung ermit-telt werden, die in guter Übereinstimmung mitvorhandenen Bohrlochdaten ist.
Literatur[1] Shirov, M., Legchenko, A.V. and Creer,
G. 1991. A new direct non-invasive ground-water detection technology for Australia. Ex-ploration Geophysics 22, 333-338.
[2] Weichmann, P.B., Lavely, E.M. andRitzwoller, M., 2000. Surface nuclear magne-tic resonance with application to geophysicalimaging problems. Physical Review E 62(1),Part B, 1290-1312.
[3] Legchenko, A.V. and Shushakov, O.A.1998. Inversion of surface NMR data. Geo-physics 63,75-84.
[4] Mohnke, O. and Yaramanci, U. 2002.Smooth and block inversion of surface NMRamplitudes and decay times using simulatedannealing. Journal of Applied Geophysics, 50,163-177.
[5] Yaramanci, U., Lange, G. and Hertrich,M. 2002. Aquifer characterisation using Sur-face NMR jointly with other geophysical tech-niques at the Nauen/Berlin test site. Journal ofApplied Geophysics, 50, 47-65.
Webseite: http://www.geophysik.tu-berlin.de/Forschung/Projekte/SNMR/snmr.html
Elektromagnetik und Geoelektrik – Poster 41
EEP06Thiemer, M., Tezkan, B. (Köln)
Mehrdimensionale Auswertung von Geoelektrik-Messungen am Vulkan am Rodderbergbei BonnE-Mail: [email protected]
Der Rodderberg-Vulkan bei Bonn gehörttrotz seiner geographischen Nähe zum Sieben-gebirge zu den Maar-Vulkanen der Osteifelund ist damit ihr nordöstlichster Vertreter. Ob-wohl schon nachweislich im Jahre 1835 Geo-logen bei Brunnenbohrungen anwesend wa-ren, fehlt es weiterhin an einer genauen Al-tersdatierung. Gesichert ist nur eine Span-ne von 130 bis 778 tausend Jahren vor heute.Das Geographische Institut der RheinischenFriedrich-Wilhelms-Universität Bonn hat da-her ein Forschungsprojekt gestartet, an demüber eine Verbindung zum Geologischen In-stitut der Universität zu Köln auch das Institutfür Geophysik und Meteorologie der Univer-sität zu Köln eingebunden ist.
Ziel der geophysikalischen Untersuchungenist, die Schichtdicke der Sedimentfüllung imKrater zu bestimmen. Da der Vulkan seitseinem letzten Ausbruch eine geschlosseneHohlform darstellt, sollte eine lückenlose Se-dimentabfolge bis heute erwartet werden kön-nen. Neben einer genauen Altersbestimmungwäre damit auch Material für eine Klimastra-tegraphie gegeben.
Abbildung 1: Elektroden-Anordnung fürkombinierte Schlumberger- und Halb-Schlumberger-Messungen
Abbildung 2: Inversionsergebnisse des Nord-Süd-Profil. Die Darstellung ist etwa 3,7-fachüberhöht.
Die bisherigen Modelle über den Aufbaudes Rodderberg-Vulkans gingen von einer Se-dimentschichtdicke mit etwa 20 m Mächtig-keit aus. Eine bis auf über 50 m Tiefe abge-teufte Testbohrung enthielt aber im Bohrkernnur Sedimente, hatte also noch nicht die Un-terkante der Sedimentschicht erreicht. Um denRodderberg-Vulkan mit weiteren Bohrungenuntersuchen zu können, wird ein neues Modelldes Untergrundes benötigt. Die neuen Boh-rungen sind für das Frühjahr 2003 geplant.
Nach umfangreichen Tests wurde im Juli2001 eine Geoelektrik-Messkampagne durch-geführt. Gemessen wurden Schlumberger-und Halb-Schlumberger-Auslagen mit L/2 biszu 340 m. Da das Messgebiet von Siedlun-gen, Privatbesitz und dem Rheintal begrenztist, ließen sich die Auslagen nicht weiter ver-größern. Zusätzlich galt es, den Betrieb des
42 Abstracts
in der Mitte des Kraters liegenden Broichhofsmit seiner Reitschule möglichst nicht zu stö-ren. Für die Kombination aus Schlumberger-und Halb-Schlumberger-Auslagen sprach dieerwartete Kesselform des Kraters, die nebeneiner Schichtung in der Mitte mit dem Krater-rand auch eine laterale, schräg einfallende Stö-rung aufweist. Während die Schlumberger-Auslage gut geeignet ist, einen geschichte-ten Halbraum aufzulösen, reagieren die Halb-Schlumberger-Auslagen gut auf laterale Stö-rungen.
Zur Realisierung wurde die Messanordnungnach SCHULZ und TEZKAN verwendet, beider eine dritte Stromelektrode senkrecht zurursprünglichen Auslage in großer Entfernungpositioniert wird (siehe Abbildung 1). Ins-gesamt wurden an zehn Punkten auf zweiProfilen innerhalb des Kraters vollständigeSondierungen durchgeführt, Referenzmessun-gen gab es an zwei weiteren Punkten außer-halb des Kraters mit einfachen Schlumberger-Auslagen.
Bei einem Teil der Messpunkte ist diefür laterale Störungen bekannte Schere fürHalb-Schlumberger-Untersuchungen in denρa-Kurven zu erkennen. Es liegt damit eindeutliches Zeichen für ein mehrdimensiona-les Problem vor. Auch die eindimensionaleAuswertung der Schlumberger-Auslagen deu-tet auf ein unsymmetrischeres Aussehen desKraters hin, als bisher angenommen. Soscheinen die Flanken der Kraterwand nichtgleichmäßig geneigt zu sein, sondern eher ei-ne Trichterform mit sehr großen Tiefen in derKratermitte zu bilden. Auch sind die Wider-standskontraste zwischen der Sedimentfüllungund deren Unterbau nicht so groß wie erwar-tet. Die Abbildung 2 zeigt den Schnitt durchden Krater von Süden nach Norden, die Ab-bildung 3 den Schnitt von Osten nach Wes-ten. Die eindimensionale Inversion und die
Abbildung 3: Inversionsergebnisse des Ost-West-Profil. Die Darstellung ist etwa 2,1-fachüberhöht.
Profildarstellung erfolgte mit dem ProgrammIPI2Win. Auf der x-Achse sind die Profilme-ter aufgetragen, auf der y-Achse die Höhe überNormalnull. Mit MPx ist der jeweilige Mess-punkt bezeichnet.
Um auch die Halb-Schlumberger-Auslagenauszuwerten, wird das Modellierungspro-gramm 3DDC von K. SPITZER verwendet.Es bietet eine freie Elektrodenpositionierungauch für Werte von z > 0 m. Diese Funktionwird zur groben Nachbildung der Topographieim Messgebiet benutzt, indem der Bereichzwischen einem Referenzniveau (z = 0 m) undder Geländeoberkante mit Luft (ρ = 105 Ωm)gefüllt wird. Das entstandene Gitter nutzt diemaximal mögliche Gitterpunktzahl von 106
Gitterpunkten fast vollständig aus. Das Mo-dell wird systematisch vom homogenen Halb-raum zum Modell mit der geringsten Blockan-zahl entwickelt. So kann eine Überinterpre-tation der Daten vermieden werden. Die ein-dimensionalen Inversionsergebnisse geben da-bei den Rahmen vor.
Elektromagnetik und Geoelektrik – Poster 43
EEP07Hördt, A. (Universität Bonn), Scholl, C. (Universität zu Köln)
Verzerrungen in LOTEM- Daten durch Störkörper in Empfänger- und in SendernäheE-Mail: [email protected]
Kleine, oberflächennahe Körper werdenvon elektromagnetischen Messungen in derRegel zwar nicht aufgelöst, können die Datenaber empfindlich stören. In der Magnetotellu-rik (MT) kann die Wirkung von Störkörpernzu hinreichend niedrigen Frequenzen durcheinen frequenzunabhängigen Verzerrungsten-sor beschrieben werden, der mit dem elektri-schen Feld multipliziert wird. Für bestimm-te Symmetrien ergibt sich dann ein static shiftder scheinbaren Widerstandskurven. Die Ver-zerrung elektrischer Felder im Zeitbereich istbesonders für die long-offset transient electro-magnetics (LOTEM) Methode interessant. Sieist zu späten Zeiten ebenfalls durch einen kon-stanten Tensor beschreibbar, der mit dem Vek-tor des elektrischen Feldes multipliziert wird.
Durch die Tensor-Multiplikation werdenverschiedene Komponenten des elektrischenFeldes miteinander vermischt, so dass einzel-ne Komponenten im allgemeinen Fall zeit-abhängig verzerrt werden. Wünschenswertist aber eine statische Verzerrung, da sichdann der Störkörper mit nur einem einzi-gen, skalaren Parameter beschreiben lässt.Sie kann durch Wahl spezieller Sender-Empfänger Geometrien erreicht werden, oderdurch die Verwendung zweier aufeinandersenkrecht stehender Sender und tensorielleMessung des elektrischen Feldes. Die Deter-minante des so bestimmten scheinbaren Wi-derstandstensors erfährt dann ebenfalls einestatische Verzerrung.
Die Verzerrung kann korrigiert werden, in-dem man die Elemente des Tensors als freieParameter während einer Inversion bestimmt.
Da es in der Praxis nicht immer möglich ist,tensorielle Messungen durchzuführen, sind fürjede Empfängerlokation vier zusätzliche Pa-rameter zu bestimmen. Hierdurch wird aller-dings die Mehrdeutigkeit der Interpretation er-höht, so dass eine geeignete Regularisierungerforderlich ist. Für ein synthetisches Beispielwird gezeigt, dass sich ein Modell mit ver-zerrten Daten auch dann rekonstruieren lässt,wenn Daten für nur einen Sender verwendetwerden.
Zusätzlich wird auch der Fall eines Störkör-pers in der Nähe des Senders untersucht. MitHilfe des Reziprozitätsgesetzes wird gezeigt,dass sich die Verzerrung ebenfalls durch einenkonstanten Tensor darstellen lässt, der aller-dings von rechts an den Vektor des elektri-schen Feldes multipliziert wird. Physikalischentsteht ein zusätzliches Dipolmoment senk-recht zum realen Sendedipol. Da dies auchfür Magnetfeldempfänger gilt, lässt sich ele-gant der Transmitter overprint erklären, d.h.eine statische Verzerrung von zeitlichen Ab-leitungen des vertikalen Magnetfeldes, welchebisher durch 3-D Modellrechnungen diagno-stiziert wurde. Sowohl Empfänger- als auchSenderverzerrungen lassen sich in gemesse-nen LOTEM - Daten nachweisen, so dass diehier angestellten theoretischen Überlegungenauch eine praktische Bedeutung haben.
44 Abstracts
EEP08Helwig, S., Lange, J., Hanstein, T. (Universität zu Köln)
Kombination dekonvolvierter Messkurven zu einem langen TransientenE-Mail: [email protected]
Bei transient-elektromagnetischen (TEM)Messungen zu frühen Zeiten kann wegen derhohen Dynamik des Messsignals der Transientmit gängigen Apparaturen, wie z.B. GeonicsPROTEM oder Zonge NanoTEM-ZeroTEM,nicht als eine durchgängige Zeitreihe gemes-sen werden. Stattdessen werden üblicherweisemehrere Messungen für unterschiedliche Zeit-und Spannungsbereiche am gleichen Ort undmit der gleichen Auslage durchgeführt. Nebender Kombination mehrerer Messungen mitidentischem Sendesignal, identischem Zeit-bereich und unterschiedlichen Empfängerver-stärkungen (Gaidetzka et al. 2001) zu einemTransienten ist für die Interpretation auch dieKombination von Messungen mit unterschied-lichen Sendesignalen wünschenswert.
Dabei müssen zumindest zwei durch dasSendesignal verursachte Verzerrungen desTransienten berücksichtigt werden. Zumersten die unterschiedliche Länge des Ab-schaltvorgangs (Rampe) des Sendesignals undzum zweiten der unterschiedliche Einflußder Überlagerung mit vorherigen Transientendurch unterschiedliche Grundfrequenzen desSendesignals.
Eine Möglichkeit, beide Verzerrungen aufein Mal anzugehen bietet die parametrisier-te Dekonvolution (Hanstein 1992) bei der derunverzerrte Transient hz(t) durch eine endli-che Summe von Exponentialfunktionen darge-stellt wird:
hz(t) =m
∑k=1
ake−bkt
Die gemessenen Daten y(ti) lassen sich da-
mit als Faltung der Abschaltfunktion (Rampe)R(τ) mit dem unverzerrten Transienten hz(t)darstellen.
y(ti) =m
∑k=1
ak
ti∫0
R(t)e−bk(ti−τ)dτ
Entscheidend für die Güte der Dekonvoluti-on ist die möglichst optimale Wahl der Para-meter ak und bk und damit eine möglichst per-fekte Wiedergabe des Transienten durch dieParametrisierung. Sie wird, da das Problemnicht linear ist, durch ein zweistufiges Inversi-onsschema erreicht.
Die Abbildung zeigt ein Beispiel der De-konvolution für Daten die mit der Kombinati-on NanoTEM-ZeroTEM von Zonge gemessenwurden. Der lang gestrichelte obere Graph istdie NanoTEM-Messkurve, die nicht verändertwird. Der gepunktete Graph im unteren Be-reich ist die ZeroTEM-Messkurve die durchden Einfluß einer 52µs langen Rampe verzerrtist. Sie weicht deutlich von der NanoTEM-Kurve ab. Nach Durchführung der Dekonvo-lution schmiegt sich die ZeroTEM-Kurve andie NanoTEM-Kurve an und beide können zueinem Transienten vereinigt werden.
Wir diskutieren im Beitrag die Einsatzmög-lichkeiten dieser Technik sowie ihre Auswir-kung auf 1D-Inversionsergebnisse.
Literatur:Gaidetzka, A., Goldman M.,Helwig, S.
L., Tezkan, B., 2001, Erste Erfahrungenmit der NanoTEM-Apparatur, 19 Kolloquium„Elektromagnetische Tiefenforschung“Burg-Ludwigstein, Seite 68-77
Elektromagnetik und Geoelektrik – Poster 45
1e-11
1e-10
1e-09
1e-08
1e-07
1e-06
1e-05
0.0001
0.001
0.01
1e-06 1e-05 0.0001 0.001 0.01
ampl
itute
in V
time in s
deconvolvedNanoTEMZeroTEM
Abbildung 1: Beispiel für einen dekonvolvierten ZeroTEM Datensatz (durchgezogene Linie)und Kombination mit einen NanoTEM Datensatz der unverändert bleibt.
Hanstein, T., 1992, Iterative und parame-trisierte Dekonvolution für (LO)TEM Daten,14 Kolloquium „Elektromagnetische Tiefen-forschung“Borkheide, Seite 163-172
46 Abstracts
EEP09Hölz, S., Burkhardt, H. (TU Berlin)
Praktische Aspekte bei der Datenbearbeitung und Bewertung von äquivalenten 1D-Modellen von TEM-DatenE-Mail: [email protected]
In den Jahren 2000-01 wurden in einem Be-ckengebiet in NW-China 160 Meßpunkte mitder TEM-Methode aufgenommen. Nachdemim letzten Jahr die erste Auswertung einesTeildatensatzes vorgestellt wurde, sollen hierProbleme der Datenbearbeitung / -auswertungmit Lösungsansätzen präsentiert werden. We-sentliche Punkte bei der Untersuchung der Da-ten waren die Abschätzung realistischer Meß-fehlers für die einzelnen Meßpunkte, die Ab-schätzung von Äquivalenzen für das invertier-te Modell sowie die Bestimmung einer mini-malen und maximalen Aussagetiefe. Die ausder Inversion von TEM-Daten resultierendenModelle hängen teilweise stark von der An-zahl der in der Inversion verwendeten Daten-punkte ab [Munkholm & Anken, 1996]. Esist deswegen wichtig, zu einer realistischenAbschätzung des Noise zu gelangen, um denzu invertierenden Transienten auf den richti-gen Zeitbereich zu beschränken. Eine ersteAuswertung der Daten wies hierbei systema-tisch größere Fehler auf, als aus dem glattenVerlauf der Transienten zu späten Zeiten zuerwarten war. Eine genauere Untersuchungder Rohdaten zeigte, daß die fehlerhafte Be-rechnung des Noises durch eine geräteinter-ne Drift der verwendeten Laptem-Apparaturverursacht wurde, die in der Datenauswer-tung korrigiert werden muß, um zu einer bes-seren Abschätzungen für den Noise zu ge-langen. Äquivalenzmodelle wurden zunächstdurch systematisches Verändern der einzelnenModellparameter des invertierten Modells, an-schließende Vorwärtsrechnung und Auswer-
tung des RMS-Fehlers abgeschätzt, was sichallerdings häufig nicht als sehr aussagekräf-tig erwies. Als bessere Methode hat sich dassystematisches Verändern eines Modellpara-meters mit anschließender Inversion bei fest-gehaltenem veränderten Parameter herausge-stellt [vgl. Goldman, 1994]. Die so gefun-den Äquivalenzmodelle zeigen bei quasi iden-tischem RMS-Fehlers eine sehr viel größe-re Variabilität in den einzelnen Modellpara-metern. Somit ist eine bessere Abschätzungder Signifikanz der einzelnen Parameter mög-lich. Weiterhin lassen sich durch diese Metho-de der Äquivalenzbestimmung teilweise signi-fikant bessere Inversionsmodelle finden, dievon der ursprünglichen Inversion nicht erfaßtworden sind. Die so gefundenen Äquivalenz-modelle wurden als Ausgangspunkt für dieAbschätzung der minimalen und maximalenAussagetiefe verwendet. Hierzu wurden dieModelle durch das Einfügen einer zusätzli-chen Schicht erweitert, deren jeweilige Tie-fe in Vorwärtsrechnungen mit Bezug auf denRMS-Fehler variiert wurden. - Munkholm,M., Auken, E.: EM Noise Contamination onTEM Soundings in Culturally Disturbed En-vironments. JEEG (1,2), ’96, pp.119-127. -Goldman, M., du Plooy, A., Eckard, M.: OnReducing Ambiguity in the Interpretation ofTEM Sounding Data. Geo. Pros., 42, ’94,pp.3-25.
Webseite: http://www.geophysik.tu-berlin.de/Forschung/Projekte/China
Elektromagnetik und Geoelektrik – Poster 47
EEP10Becken, M., Hölz, S., Burkhardt, H. (TU Berlin)
1D Dünne-Schicht Modelle in der TEM: quasianalytische Transformation in den Zeitbe-reich und Vergleich mit optimierten HankelfilterlängenE-Mail: [email protected]
Für die Berechnung von transient-elektromagnetischen Sondierungskurvenwerden für die Transformation vom Frequenz-in den Zeitbereich Hankelfilter, die ein Fre-quenzspektrum in der Größenordnung von 8-11 Dekaden abdecken, verwendet. Dies stelltfür 2D/3D Modellierungen einen Rechenauf-wand hinsichtlich der Anzahl der Frequenzenund der räumlichen Diskretisierung des Mo-dells dar, der ohne Genauigkeitsverluste nurschwer zu erfüllen ist. Die Transformations-filter müssen hinreichend lang sein, um füralle realistischen Modelltypen und denkbarenZeitbereiche ausreichend genau zu sein. Siewerden dabei für verschiedene Modelltypengeschichteter Halbräume und unterschiedli-che Spulengrößen untersucht, um für jedenZeitpunkt des zugehörigen Transienten dieminimal benötigten Filterlängen festzustellen.Aus den so gewonnenen minimalen Filternkönnen Aussagen über das zum betrachtetenZeitpunkt wesentliche Frequenzspektrumbzw. Wellenzahlspektrum gemacht werden.
Im Vergleich zur schnellen Hankeltransfor-mation werden hier in Analogie zur Magneto-tellurik sogenannte D+ - Modelle betrachtet,die aus einer Serie dünner Schichten mit inte-grierten Leitfähigkeiten bestehen, und für diedie Polstellen der Übertragungsfunktion in derkomplexen Frequenzebene bis auf numerischeRundungsfehler im Prinzip exakt bestimmtwerden können. Aus der Kenntnis der Vertei-lung der Pole, die alle auf der positiven imagi-nären Achse liegen, kann analytisch die Ori-ginalfunktion im Zeit-Wellenzahlbereich als
Superpostion endlich vieler abfallender Expo-nentialfunktionen angegeben werden. Im Ex-ponenten treten dabei die Zerfallskonstantenals Funktion der Wellenzahl auf. Die anschlie-ßende Transformation in den Ortsbereich er-folgt abhängig von der Spulengeometrie eben-falls mit einer schnellen Hankeltransformati-on.
Folgende Schritte sind also mit dem neu-en Ansatz durchzuführen: (a) Ausgehendvon der Darstellung des Transienten imFrequenz-Ortsbereich wird zunächst mit einerInversionsrechnung ein äquivalentes Dünne-Schicht Modell bestimmt. Über eine Re-kursionsformel für den Reflexionskoeffizien-ten an der Erdoberfläche kann das Frequenz-Wellenzahlspektrum rekonstruiert werden. (b)Die Bestimmung der Polstellen in der kom-plexen Frequenzebene erfolgt über eine Ent-wicklung der Rekursionsformel in einen Ket-tenbruch und seiner anschließenden Zerlegungin Partialbrüche. (c) Die gefundenen Partial-brüche werden analytisch in den Zeitbereichtransformiert und ergeben dort die Impulsant-wort.
Die Anwendung auf 1D-Modelle und diesystematische Einschränkung des Frequenzin-haltes bei der Inversion des 1D Dünne-SchichtModells (Schritt (a)) sowie die Verteilung derPole (Schritt (b)) soll Erkenntnisse darüberbringen, ob das Verfahren ein schmaleres Fre-quenzband benötigt als die digitale Filterungim Sinne der schnellen Hankeltransformation.
48 Abstracts
EEP11Koch, O., Helwig, S., Scholl, C. (Köln, IGM)
Erste Ergebnisse einer TEM-Messung zur Bestimmung der oberflächennahen Wider-standsverteilung an der Arava-Störung in JordanienE-Mail: [email protected]
Im Rahmen des DESERT-Projekts (Dead-Sea-Rift-Transec-Projekt) wurden im Septem-ber 2002 in Jordanien an der Arava-StörungTransient-elektromagnetische Messungenvom Institut für Geophysik und Meteorologieder Universität zu Köln durchgeführt. DieArava-Störung ist von zentraler Bedeutungim Störungssystem des Toten-Meer-Raumes.Sie ist eine Transformverschiebung zwischender Sinai und der Arabischen Erdplatte, durchdie sich Arabische Platte gegenüber der SinaiPlatte bis heute um etwa 110km nordwärtsverschoben hat.Das DESERT-Projekts (Dead-Sea-Rift-Transec-Projekt) soll die grundlegendenMechanismen und das Verhalten des Dead-Sea-Rifts mit verschiedenen Methodenuntersuchen. Elektromagnetische Mes-sungen können dabei einen wesentlichenBeitrag durch die Bestimmung der Leitfähig-
10
100
1000
1e-06 1e-05 1e-04 1e-03
app.
res.
in Ω
m
time in s
west of faulteast of fault
Abbildung 1: Übersicht über die gemessenenscheinbaren Widerstandskurven der drei öst-lichsten und drei westlichsten Stationen.
keitsstruktur im Untergrund liefern. Diesewiederum steht im engen Zusammenhang zuder Existenz von Fluiden.In bisherigen MT-Ergebnissen zeigt sich dieStörung insbesondere durch einen drastischenWiderstandskontrast in einer Tiefe von et-wa zwei bis drei Kilometern. Im Gebiet,in dem eine Störungszone vermutet wird,ist allerdings optisch an der Erdoberflächekeinerlei Anzeichen für eine Grenze zwischenzwei unterschiedlich beschaffenen Gebietenauszumachen. Es stellt sich die Frage, wiedie genaue Ausdehnung der Störung in deroberflächennahen Leitfähigkeitsverteilung inder untersuchten Region ist. Zur Klärungwurde ein 1050m langes TEM-Profil mit22 Messpunkten senkrecht zur vermutetenStörung positioniert. Verwendet wurde eineCentral-Loop-Konfiguration mit einer 50mx 50m großen Sendespule mit einem Mess-
10
100
1000
1e-06 1e-05 1e-04 1e-03
app.
res.
in Ω
m
time in s
MT fault
Abbildung 2: Übersicht über die gemessenenscheinbaren Widerstandskurven der Stationenim inneren Bereich des Messprofils.
Elektromagnetik und Geoelektrik – Poster 49
punktabstand von jeweils 50m.Bereits die Rohdaten der TEM-Messungzeigen eine deutliche Gruppierung, aufgrundderer die Messregion in drei Bereiche ge-gliedert werden kann. Die Transienten derdrei östlichsten Messpunkte zeigen einennahezu identischen Verlauf und lassen sichgut durch ein eindimensionales Modell er-klären. Es existiert daher in diesem Gebietkein Anzeichen für eine Störungszone. DieTransienten der drei westlichen Stationenverlaufen ebenfalls sehr ähnlich, womit auchin diesem Gebiet keine Störung zu existierenscheint. Die Form der gemessenen Transien-ten unterscheidet sich jedoch stark von derForm der Transienten der östlichen Stationen(siehe Abbildungen 1). Die Leitfähigkeits-verteilung im Osten ist demnach auch naheder Oberfläche signifikant anders als die imWesten. Im inneren Bereich des Messprofilsauf einer Länge von ca. 700m zeigt sich eineArt Übergangsbereich, der die eigentlicheStörung darstellen könnte. In dieser Regionwechselt die Form der Transienten von Mess-punkt zu Messpunkt (siehe Abbildung 2).Ergebnisse der Inversionsrechnungen undModellstudien zur Widerstandsverteilungsollen mehr Erkenntnisse über die untersuchteRegion bringen. Durch weitere Messun-gen an anderen Stellen der Störung solluntersucht werden, inwieweit die Ausdeh-nung des gestörten Bereichs entlang derTransformverschiebung variiert. Außerdemsoll in einem weiteren Experiment geklärtwerden, ob der zweidimensionale Charakterder Störungszone durch die Messung derHorizontalkomponenten des Magnetfeldesin einer Central-Loop-Anordnung bestätigtwerden kann.
50 Abstracts
EEP13Just, A., Danckwardt, E., Jacobs, F. (Leipzig)
Elektrische Widerstandstomographie zur Zustandsbewertung von Bauwerken - Ergeb-nisse von Messungen im PergamonmuseumE-Mail: [email protected]
Der zerstörungsfreien Prüfung von Bau-denkmälern kommt große Bedeutung zu, damöglichst detaillierte Informationen über denZustand des Kulturgutes bei möglichst wenigVerlust an wertvoller Bausubstanz und voll-ständiger Erhaltung der Oberfläche gewünschtsind.
Zur Lösung dieser Aufgabe werden auchaus der Geophysik bekannte physikalischeVerfahren herangezogen (z. B. NIEDERLEIT-HINGER et al. 2002).
Abbildung 1: Messaufbau zur ElektrischenWiderstandstomographie mit der ApparaturSIP Fuchs Kompakt an einer Säule am Tor vonMilet.
Prinzipiell geeignet zur Untersuchung ins-besondere zylindrischer Säulen ist die spezi-elle Form der Elektrischen Widerstandstomo-graphie (2D), die an der Universität Leipzigzur Untersuchung zylinderförmiger Objektewie Bohrkernen und zylindrischer Gefäße mitLockersedimenten entwickelt wurde und aucherfolgreich zur Untersuchung von Baumstäm-men angewendet wird (JUST 2002).
Beispielhaft wurden Messungen am Tor vonMilet im Pergamonmuseum Berlin durchge-führt. Die Säulen des Tores bestanden ur-sprünglich aus Marmor. Im Zuge der Auf-stellung der zu Beginn des 20. Jahrhundertsin Milet (Türkei) ausgegrabenen Teile des To-res im Pergamonmueseum wurden die erhal-tenen Säulensegmente ausgebohrt, innen mitBeton aufgefüllt und mit Stahlträgern verse-hen. Fehlende Säulensegmente wurden durchBetonsegmente, teils mit Ziegelelementen ab-wechselnd, ersetzt.
Zur Messung des komplexen elektrischenWiderstandes (Betrag und Phase) im Fre-quenzbereich 366 mHz bis 12 kHz wurdedie Apparatur SIP Fuchs Kompakt von Ra-dic Research Berlin genutzt. Als Elektro-den kamen medizinische Elektroden, wie siezur Reizstrombehandlung verwendet werden,zum Einsatz. Diese mit einem Leitgel verse-henen Elektroden werden auf die Oberflächedes zu untersuchenden Objektes geklebt (Abb.1).
Die Widerstandsmessungen wurden anzwei Segmenten einer Säule durchgeführt,deren unteres Segment außen aus Original-
Elektromagnetik und Geoelektrik – Poster 51
Marmor besteht, während das obere Segmentkomplett aus Ersatzmaterial ist. Die ermittel-ten Widerstandsverteilungen der beiden Seg-mente (Abb. 2, Widerstandstomogramme beieiner Frequenz von 1.46 Hz) unterscheidensich signifikant: Während in der unteren Ebe-ne sehr hohe spezifische elektrische Wider-
Abbildung 2: Widerstandstomogramme (Fre-quenz 1.46 Hz) einer Säule am Tor von Milet.
stände (10exp8 bis zu 10exp10 Ohm*m, Mar-mor, Hohlräume im darunterliegenden Beton?) auftreten, liegen die Werte oben bei ma-ximal 10exp6 bis 10exp7 Ohm*m (trockenerBeton). Im unteren Tomogramm erkennt manein deutliches Widerstandsminimum im Zen-trum, das dem Stahlträger im Inneren zu-geordnet werden kann. Das obere Tomo-gramm weist ein kreisförmiges Widerstands-minimum auf, das auf eine zusätzliche ring-förmige Bewehrung des Betonsegmentes hin-deutet. Durch die quasi abschirmende Wir-kung dieser Bewehrung wird der zweifelsfreiauch hier vorhandene Stahlträger im Zentrumnicht mehr aufgelöst. Der Stahlträger wurdedurch Ultraschallmessungen (Universität Göt-tingen) und durch Radarmessungen (TU Ber-lin) nachgewiesen. Das Radar erbrachte auchIndikationen auf Bewehrungsringe im oberenSegment.
Referenzen:NIEDERLEITHINGER, E., MAIER-
HOFER, CH., KRAUSE, M., WERITZ,F., GARDEI, A. (2002): ZerstörungsfreieBauwerksdiagnose.- 62. Jahrestagung derDeutschen Geophysikalischen Gesellschaft,3.-8.3.2002, Hannover.
JUST, A. (2002): Bestimmung der räumli-chen Verteilung des spezifischen elektrischenWiderstandes an zylinderförmigen Körpernmit Hilfe der Elektrischen Widerstandstomo-graphie - Anwendung in der Petrophysik aufBohrkerne und Lockersedimente.- Dissertati-on, Universität Leipzig 2001 und Shaker Ver-lag Aachen 2002, ISBN 3-8265-9894-6.
52 Abstracts
EEP14Münch, H.-M., Mojid, M. (ICG-IV), Zimmermann, E. (ZEL, FZ Jülich), Kemna, A. (Institut fürChemie und Dynamik der Geosphäre: Agrosphäre (ICG-IV), Forschungszentrum Jülich)
Optimierung eines Labormessplatzes zur elektrischen Impedanzspektroskopie an Boden-und SedimentprobenE-Mail: [email protected]
Von elementarer Bedeutung für eine er-folgreiche Anwendung elektrischer bildge-bender Verfahren zur Erfassung und Charak-terisierung von Fließ- und Transportprozes-sen in Böden und Sedimenten ist die quanti-tative Verknüpfung der erfassten elektrischenLeitungs- und Polarisationseigenschaften mitfließ- und transportrelevanten Strukturmerk-malen und Zustandsvariablen. Insbesonde-re die induzierten Polarisationseigenschaftenenthalten Strukturinformationen, die wesent-lich zur erforderlichen Parameterverknüpfungbeitragen können, da sich elektrische Polari-sationsphänomene vor allem in der Nähe derGrenzflächen Bodenmatrix-Porenfluid mani-festieren.
Um den Zusammenhang elektrischerLeitungs- und Polarisationseigenschaftenmit stofftransportrelevanten Strukturmerk-malen und Variablen zu untersuchen, wirdgegenwärtig am ICG-IV ein optimierter La-bormessplatz zur Vermessung der SpektralenInduzierten Polarisation (SIP) im Frequenzbe-reich 1 mHz bis 45 kHz entwickelt. RelevanteStrukturmerkmale sind z. B. Porosität,Korn-/Porengrößenverteilung, spezifischeOberfläche; relevante Zustandsvariablen sindz. B. Wassergehalt der Bodenprobe und che-mische Zusammensetzung des Porenfluids.Es soll die komplexe elektrische Leitfähigkeitim genannten Frequenzbereich von verschie-denen künstlichen und natürlichen Probengemessen werden. Künstliche Proben sindz.B. Glaskugeln, Teco-Sil und gesiebter Sand;
bei den natürlichen Proben handelt es sichum ungesiebte Sande und ungestörte Boden-proben. Die jeweiligen Strukturmerkmalesind zu bestimmen und die Zustandsvariablensystematisch zu verändern.
Zur Variation des Wassergehaltes soll eineMulti-Step-Outflow-Anlage verwendet wer-den, die ebenfalls am ICG-IV entwickelt wird.Die SIP-Messungen sollen unmittelbar wäh-rend des Betriebs der Multi-Step-Outflow-Anlage erfolgen, so dass der Messzylinderdem vorgesehenen Druck von 1 bar angepasstsowie um eine den Lufteintrittswert festset-zende Keramikplatte erweitert werden muss.Nachdem in Vormessungen das geeigneteElektrodenmaterial ermittelt wurde (Bronzefür die Strom- und Platin für die Spannungs-elektroden), soll der Aufbau dahingehend ge-ändert werden, dass statt stiftförmiger Span-nungssonden ringförmige verwendet werden,um so über den Probenquerschnitt (Durchmes-ser: 60 mm) zu mitteln und dadurch den Ein-fluss lokaler Inhomogenitäten zu minimieren.
Aufgrund der ersten Untersuchungsresulta-te an dem neuen Meßaufbau wurden konstruk-tive Verbesserungen zur genaueren Bestim-mung der Phase geplant. Diese Modifikatio-nen werden zur Zeit durchgeführt.
Webseite: http://www.fz-juelich.de/icg/icg-iv/de/docs/ziel01.htm
Elektromagnetik und Geoelektrik – Poster 53
EEP15Roßberg, R., Golden, S. (Frankfurt am Main), Beblo, M. (München), Fischer, V., Junge, A.(Frankfurt am Main)
Geolore – Ein neuer Langzeit-DatenloggerE-Mail: [email protected]
Im Verlaufe des Jahres 2002 wurde ander Johann Wolfgang Goethe-Universität,Frankfurt am Main und an der Ludwig-Maximilians-Universität, München der Proto-typ eines neuen Datenloggers mit dem NamenGeolore (Geophysical longtime recorder) ent-wickelt. Zielsetzung dieser Entwicklung istein Datenlogger, der für unterschiedliche geo-physikalische Feldmessungen einsetzbar undfür lange Messreihen optimiert ist. Unter„lang“ versteht sich dabei ein Zeitraum von biszu einem Jahr (mit zusätzlichem Speicher undBatterien auch länger), während dessen keineexterne Stromversorgung und keinerlei War-tungseingriffe erforderlich sind.
Bei mobilen Feldstationen ohne externeStromversorgung begrenzt im wesentlichender Stromverbrauch die Einsatzzeiten. DerSchwerpunkt bei der Entwicklung der Geolorelag daher bei der Minimierung des Stromver-brauchs. Desweiteren sollte das Gerät natür-lich eine möglichst hohe Messgenauigkeit auf-weisen, als Feldgerät robust, zuverlässig undleicht zu transportieren, und letztendlich kos-tengünstig sein. Das Ergebnis dieser Entwick-lung ist ein Prototyp, der bereits eine Reihevon Labortests bestanden hat und derzeit sei-ne erste Felderprobung durchläuft.
Im momentanen Grundaufbau verfügt dieGeolore über drei Messkanäle. Weitere Kanä-le können bei Bedarf bei zukünftigen Gerä-ten durch zusätzliche Wandlerkarten hinzuge-fügt werden. Jeder Kanal verfügt über einenunabhängigen 24-bit Analog-Digital-Wandler.Es können Abtastraten bis zu 1 Hz eingesetzt
werden. Die Daten werden in einem stromspa-renden Speicher zwischengepuffert und in re-gelmäßigen Intervallen (z.B. einmal pro Tag)auf eine CompactFlash®-Karte geschrieben,die nach der Messung entnommen und von ei-nem PC ausgelesen werden kann.
Im Rahmen der ersten Felderprobungwird ein Gerätevergleich mit einem RAP-Datenlogger durchgeführt: Während mitdem RAP-Datenlogger eine Standard-MT-Sondierung mit drei magnetischen und zweielektrischen Feldkomponenten vorgenommenwird, werden mit der Geolore simultan in derNähe nur die horizontalen elektrischen Feld-komponenten aufgezeichnet. Auf diese Wei-se können die elektrischen Feldkomponentenbeider Datenlogger verglichen werden.
Da der Geolore-Datenlogger klein ist (ca.60 cm langer Zylinder) und über langeZeiträume ohne Wartungseingriffe auskommt,kann er auch unter Wasser eingesetzt werden,um so das elektrische Feld unter wesentlichstabileren Umweltbedingungen zu messen, alsdies an Land möglich ist. Diese Technik könn-te insbesondere in Permafrostgebieten vorteil-haft sein, wo die Elektroden an Land, imWinter durch Einfrieren die Ankopplung andas Erdreich verlieren. Die Erprobung dieserTechnik ist für den Sommer 2003 auf Islandgeplant.
Obwohl der momentane Einsatzschwer-punkt bei der Magnetotellurik liegt, sind auchandere Anwendungen denkbar, bei denen dieAufzeichnung langer Zeitreihen mit niedrigen
54 Abstracts
Abtastraten gefordert sind.
Webseite: http://www.geophysik.uni-frankfurt.de/em/geolore/
56 Abstracts
EX01 – Mi., 26.2., 09:30-10:00 Uhr · HS6Strassmeier, K. G. (AIP)
Stellare AktivitätE-Mail: [email protected]
Fast alles, was ein Mensch in einer klarenNacht am Himmel sehen kann, sind Sterne.5000 an der Zahl, in Wirklichkeit aber rund400 Milliarden in unserer Galaxis, davon etwa1 Milliarde sonnenähnlicher G2V-Sterne.
Unsere Sonne ist ein recht durchschnitt-licher Stern, der sich vor allem durch seinegeringe Entfernung zu uns auszeichnet. Beinäherer Betrachtung entpuppt sich die Son-nenoberfläche aber als wahrer “Hexenkessel”mit Magnetfeldern aller Art, den Sonnen-flecken, Plasma-Eruptionen und plötzlichenExplosionen, die alle einen fundamentalenEinfluß auf unseren Planeten haben, einenEinfluß den wir erst mit der heutigen, mo-dernen Astronomie zu messen und langsamzu verstehen beginnen. Diese ganze Palettemagnetischer Aktivitäten, die wir auf derSonne beobachten, treten auch bei anderenSternen auf, manchmal aber tausend- jasogar millionenfach verstärkt – dies sinddie Aktiven Sterne. Was erzählen uns nundiese Sterne? Können sie uns helfen unsereeigene Sonne besser zu verstehen, etwaden berühmten Sonnenfleckenzyklus? Oderist die Sonne tatsächlich ein einzigartigerStern? Wie immer, vom Schicksal des unsam nächsten stehenden Sternes, der Sonne,hängt die Zukunft der Menschheit ab. IhreLeben spendendeEnergie bestimmt, ob undwie lange wir in der gegenwärtigen Formexistieren können.
In diesem Vortrag möchte ich einige aktuel-le Forschungsergebnisse auf dem Gebiet akti-ver Sterne, deren ungelöste Fragen und über-raschende Erkenntnisse vorstellen. Es sollenmodernste Beobachtungstechniken - wie z.B.die Doppler Tomographie (siehe Abbildung)- und neuestes Datenmaterial aus erster Handvorgestellt werden. Doppler Tomographie isteine Inversionstechnik, die aus einer beobach-teten Zeitserie hochaufgelöster Spektren rotie-render astronomischer Objekte eine Karte vonderen Oberfläche erstellen kann. Wir wendendiese Technik bei Sternen mit magnetischenAktivitäten an um die Temperaturverteilungbzw. Magnetfeldverteilung zu kartografieren,und so auf etwaige Aktivitätszyklen in solarerAnalogie schliessen zu können.
Webseite: http://www.aip.de
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 57
Abbildung 1: Example of two active stars in a binary system. Pseudo three-dimensional viewof the σ2 CrB binary containing two solar-type stars. The surface maps were obtained from afull-spectrum tomographic line-profile inversion.
58 Abstracts
EX02 – Mi., 26.2., 10:00-10:15 Uhr · HS6Mann, G. (Potsdam, Astrophysikalisches Institut Potsdam)
First RHESSI ResultsE-Mail: [email protected]
The NASA small explorer mission RHESSI(Ramaty High Energy Solar SpectroscopicImager) is able to provide images of the Sun inthe light of hard X-rays at the first time. It waslaunched on February 5, 2002. The detectorsof RHESSI observe the electromagnetic radi-ation from the Sun in the energy range 3 keV -20 MeV with a highly energetic, temporal andspatial resolution. The aim of the mission isthe study of processes of impulsive energy re-lease and particle acceleration as well as theparticle and energy transport in the solar at-mosphere. The Astrophysical Institute Pots-dam (AIP) is involved to the RHESSI missionby providing solar radio data to the RHESSIdata center and the joint RHESSI and radiodata analysis. The temporal data down-link bythe GSOC of the DLR in Weilheim is an addi-tonal contribution of Germany to the RHESSImission. The solar radio data are recorded bythe radiospectralpolarimeter of the AIP work-ing in the range 40-70 MHz. First results ofthe joint RHESSI and solar radio data analyisare presented. The solar events on February26 and June 2, 2002 are of particular interestwith respect to particle acceleration by mag-netic reconnection and shock waves in the so-lar corona and the transport of energetic elec-trons into the interplanetary space..
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 59
EX03 – Mi., 26.2., 10:15-10:30 Uhr · HS6Kliem, B. (AIP, Potsdam)
Dreidimensionale Expansion des ausbrechenden Magnetflußsystems im solaren X Flareund CME am 21. April 2002E-Mail: [email protected]
Detaillierte Beobachtungen des solaren X-Flares am 21. April 2002, der einen derschnellsten bisher beobachteten koronalenMassenauswürfe (CME) auslöste, werden prä-sentiert. Die Eruption ereignete sich naheam Sonnenrand, so daß sowohl die schwacheEmission des aufbrechenden Magnetflußsys-tems vor dem Himmelshintergrund als auchdie hellen Fußpunktstrukturen auf der Son-nenscheibe in EUV-Aufnahmen des TRACE-Satelliten bei 195 Å abgebildet werden konn-ten. Gleichzeitige Beobachtungen des UV-Spektrometers SUMER auf dem SOHO-Satelliten an einer festen Position in der ak-tiven Region über dem Sonnenrand ermög-lichen quantitative Untersuchungen des Plas-mas in der aufbrechenden Struktur. Die Da-ten stützen einige der essentiellen Elementesowohl des “Tether Cutting Modells” für dieÖffnung der magnetischen Konfiguration alsauch des “Standardmodells” für die Haupt-phase von Flares, insbesondere das Auslösender Eruption durch magnetische Rekonnexionin einem niedrig liegenden stark verscherten“Kernflußsystem” und die Bildung einer groß-skaligen Stromschicht im Gefolge des sichöffnenden Flusses, in der schnelle magneti-sche Rekonnexion einsetzt und die langdau-ernde Energiefreisetzung bewirkt. Anderer-seits zeigen die Daten jedoch auch wesent-liche Differenzen zu diesen Modellen. ImUnterschied zu einer Hypothese des TetherCutting Modells konnten keine Anzeichen füreine Verlängerung der Feldlinien im Kern-fluß vor dem Einsetzen der Instabilität gefun-
den werden, und das Plasma im aufbrechen-de Kernfluß wurde bereits lange vor der im-pulsiven Flarephase auf typische Flaretempe-raturen von > 107 K geheizt. Dies legt na-he, daß Rekonnexion des Kernflusses mit ei-nem kompakten System magnetischer Loopsan einem Ende des Kernflusses die Ursachefür die Destabilisierung bildete. Im Unter-schied zum Standardmodell, aber in Überein-stimmung mit der Beobachtung einer gros-sen Raumwinkelausdehnung des CMEs in derbetrachteten und in vielen anderen Eruptio-nen, behielt der aufbrechende Kernfluß seineanfänglich quasi-lineare Geometrie nicht bei,sondern entfaltete sich während des Aufstiegsin ein komplexes, voll dreidimensional expan-dierendes Loopsystem. Für das zum TetherCutting Modell alternative “Magnetic Break-out Modell” konnten keine Anzeichen in denDaten gefunden werden.
Webseite: http://www.aip.de/ kli
60 Abstracts
EX04 – Mi., 26.2., 11:00-11:15 Uhr · HS6Vocks, C., Mann, G. (Astrophysikalisches Institut Potsdam)
Generation of suprathermal electrons by resonant wave-particle interaction in the solarcorona and windE-Mail: [email protected]
Observations of solar wind electron velocitydistribution functions (VDFs) show enhancednumbers of suprathermal electrons comparedto a Maxwellian VDF. These distributions of-ten are described as core and halo population,or fitted by kappa distributions. The questionarises whether these suprathermal tails of theelectron VDFs are generated in the solar wind,or if they originate from the solar corona. Astudy of the relaxation process of suprather-mal electrons in the corona shows that a coro-nal origin of the tails is possible. We present amodel based on resonant interaction betweenelectrons and whistler waves to investigate theacceleration of suprathermal electrons. Thewave-electron interaction is described withinthe framework of quasilinear theory and leadsto pitch-angle diffusion of the electrons in thereference frame of the waves. In a plasmaregime with high Alfvén speed, as found in thelower corona, electrons with low v‖ can be ac-celerated to high v⊥. A kinetic model for theelectrons is developed in order to study thisacceleration process in detail against the back-ground of the inhomogenious plasma condi-tions in a coronal funnel, and its competionwith Coulomb collisions. Simulation resultsfor electron VDFs from the corona up into theinterplanetary space and in the energy rangeof several keV are presented. The VDFs showdeformations from a Maxwellian distributionthat are expected from theory. The effect ofthe waves is clearly visible in the corona, andtowards interplanetary space the mirror forcein the opening magnetic field geometry leads
to the formation of a “strahl”. The resonantabsorption of the whistler waves in the coronaresults in a considerable enhancement of solarwind suprathermal electron fluxes, in coinci-dence with the observations. Higher electronenergies up to 100 keV are also discussed.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 61
EX05 – Mi., 26.2., 11:15-11:30 Uhr · HS6Marsch, E. (Katlenburg-Lindau), Tu, C.Y. (Beijing)
Pitch-Winkel Diffusion, Welle-Teilchen-Wechselwirkungen und Ionen-Strömungen inder Korona und im SonnenwindE-Mail: [email protected]
Es werden kinetische Prozesse und Welle-Teilchen-Wechselwirkungen im Sonnenwindund in der Sonnenkorona untersucht. Diegemessene Temperaturanisotropie der Proto-nen lässt sich durch resonante Diffusion derProtonen im Wellenfeld von Zyklotronwellenerklären, wobei sich Plateaus ausbilden unddie Verteilungsfunktion die Form von zweizusammengefügten Kugelschalen-Segmenten(bi-shells) annimt. Der Protonenbeam wirdin seiner Driftgeschwindigkeit ebenfalls durchresonante Diffusion reguliert. In der unte-ren Sonnenkorona wurden mit SUMER aufSOHO hohe Temperaturen von vielen MKgemessen. Bei niedrigen Höhen von eini-gen 10000 km über der Photosphäre beob-achtete SUMER in der Emissionslinie vonNe VIII Dopplerverschiebungen von bis zu10 km/s, die als Ausströmen des Sonnen-windes von seinen Quellen in den korona-len Trichtern (expandierende Magnetfelder)interpretiert werden. Zur theoretischen Be-schreibung dieser Phänomene wurden Zwei-Flüssigkeitsmodelle und eine reduzierte kine-tische Theorie entwickelt. Numerische Er-gebnisse aus diesen Modellrechnungen wer-den vorgestellt. Es stellt sich heraus, dass re-sonante Diffusion der Ionen auch die Opazi-tät und Absorption von Zyklotronwellen be-stimmt, die vermutlich im Netzwerk erzeugtwerden und die untere Korona heizen.
62 Abstracts
EX06 – Mi., 26.2., 11:30-12:00 Uhr · HS6Brueggen, M. (IUB)
Theoretical Challenges in HelioseismologyE-Mail: [email protected]
Here I will give a general overview of thelatest advances in the field of helioseismology.Recent results will be presented as well as re-maining challenges. Particular emphasis willbe put on the field of local helioseismology. Inrecent years it has become possible to measurethe travel times of acoustic waves travellingthrough the outer layers of the Sun through‘time-distance helioseismology’. These traveltimes are used to infer information about thesub-surface structure of the Sun and have re-vealed inhomogeneities in the wave propaga-tion conditions. Here we calculate the effectof temperature inhomogeneities on the traveltimes of sound waves. A temperature increase,e.g. in active regions, not only increases thesound speed but also lengthens the path alongwhich the wave travels because the expansionof the heated layers shifts the upper turning ofthe waves upward. Using a ray tracing ap-proximation we find that in many cases thenet effect of a temperature enhancement is anincrease of the travel times. We argue thatthe reduced travel times that are observed arecaused by a combination of magnetic fields inthe active region and reduced subsurface tem-peratures. Such a reduction may be related tothe increased radiative energy loss from smallmagnetic flux tubes. Temperature variationsnear the surface might also drive geostrophicflows which - according to a model - drive thetorsional oscillation pattern of the Sun’s rota-tion.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 63
EX07 – Mi., 26.2., 12:00-12:15 Uhr · HS6Hilchenbach, M. (Max-Planck-Institut für Aeronomie)
Remote Sensing of the Inner and Outer HeliosphereE-Mail: [email protected]
The heliosphere can be observed remotelyfrom 1 AU via energetic neutral atoms and,possibly, via photons. We will present ourconclusions from the observations of ener-getic hydrogen and helium atoms with the in-strument CELIAS/STOF onboard the SOHOsatellite. The data shows evidence that the ter-mination shock of the heliosphere might be aweak shock, i.e. the compression ratio couldbe about 2.5 . We will then discuss futuremethods of observing remotely the outer he-liosphere.
64 Abstracts
EX08 – Mi., 26.2., 12:15-12:30 Uhr · HS6v. Kienlin, A. (MPI Garching)
Das Gammastrahlungsobservatorium INTEGRALE-Mail: [email protected]
INTEGRAL ist das International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory der ESA zurBeobachtung von astronomischen Objektenim Licht der Gammastrahlung von 15 keVbis 10 MeV. Der vier Tonnen schwereINTEGRAL-Satellit wurde am 17. Oktober2002 erfolgreich mit einer russischen Proton-rakete vom Kosmodrom in Baikonur in einestark exzentrische Umlaufbahn mit einer Um-laufzeit von drei Tagen eingeschossen. Diegeplante Missionsdauer ist 3 Jahre mit einermöglichen Verlängerung um 2 Jahre.
Die wissenschaftliche Nutzlast des Satel-liten besteht aus zwei Hauptinstrumenten, diefür verschiedene sich ergänzende Aufgabenvorgesehen sind. Mit dem Imager IBIS sollder Gammahimmel mit hoher Ortsauflösungbeobachtet werden. Das Spektrometer SPIsoll dagegen die Quellen mit hoher Energieau-flösung beobachten. Die beiden Hauptin-strumente werden von den beiden Monitorin-strumenten JEM-X und OMC unterstützt, dieMessungen im Röntgenbereich und im sicht-baren Licht vornehmen sollen. Unser Institut,das Max-Planck-Institut für extraterrestrischePhysik in Garching, ist mit dem Antikoinzi-denzschild ACS des Spektrometers SPI an derMission beteiligt.
Die ersten drei Monate der Mission wurdenfür Inbetriebnahme und Eichung der Instru-mente verwendet. Während dieser Zeit war esmöglich, schon erste wissenschaftliche Ergeb-nisse zu erzielen. Nach dieser Phase wird IN-TERGRAL der wissenschaftlichen Gemeindeals Observatorium übergeben. Im Vortragwird die Mission, ihre wissenschaftlichen
Zielsetzungen und die Ergebnisse der erstenBeobachtungen vorgestellt.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 65
EX09 – Mi., 26.2., 12:30-13:00 Uhr · HS6Falcke, H. (MPI f. Radioastronomie, Bonn)
LOFAR - the next generation radio telescopeE-Mail: [email protected]
The rapid evolution in information tech-nology makes it now possible to build fullydigitally phased radio arrays at low radiofrequencies using ultra-high speed internetlinks. One major effort in this direction is theDutch/American Low-Frequency Array (LO-FAR) planned for 2006 which may be sup-plemented by a deep space radar (LOIS).While being initially designed as a radio tele-scope LOFAR will be a very interdisciplinaryproject with many applications also in ex-traterrestrial research,atmospheric, solar andplasma physics. The project promises an in-crease by three orders of magnitude in sensi-tivity and resolution compared to earlier tele-scopes. Due to its fully digital nature it willalso feature multiple, electronically steeredbeams that allow simultaneous and indepen-dent imaging of widely separated patches onthe sky and rapid switching.The ionosphereis continuously monitored. A data buffer al-lows beams to be formed retrospectively in re-sponse to transient events and thus effectivelyallows one to look back in time. This featurewill for the first time enable a detailed studyof the transient radio sky. Scientific driversfor LOFAR are: the epoch of reionization andthe formation of the first stars in the universe,search for the first generation of black holes,clusters, radio relics and star forming galaxiesat large redshifts, Galactic transients, cosmicrays, search for nearby planets, study of thesun and coronal mass ejections, and the struc-ture of the earth ionosphere and atmosphere.First prototypes of LOFAR are currently beingbuilt and locations of LOFAR stations within
Germany are being considered.
Web page: http://www.mpifr-bonn.mpg.de/staff/hfalcke
66 Abstracts
EX11 – Mi., 26.2., 15:30-15:45 Uhr · HS6Krueger, H. (MPIK Heidelberg)
In-Situ-Staubmessungen in Jupiters Gossamer-RingE-Mail: [email protected]
Das Ring-System Jupiters besteht aus demdünnen, hellen Hauptring und dem schwäche-ren, ausgedehnteren Gossamer-Ring. Opti-sche Beobachtungen des Gossamer-Rings er-geben mindestens 3 Komponenten verschie-dener Dichte, die überwiegend aus mehre-re Mikrometer großen Staubteilchen bestehen.Quellen für den Staub sind die in der Ringre-gion um Jupiter umlaufenden kleineren Mon-de Amalthea, Thebe, Adrastea und Metis. Diebeobachteten Strukturen im Ring deuten dar-auf hin, daß für die Dynamik der Ringteil-chen die Poynting-Robertson-Kraft über Plas-makräfte dominiert. Am 5. November 2002hat die Galileo-Raumsonde zum ersten Malden Gossamer-Ring durchflogen und dabei In-situ-Daten mit dem Staubinstrument an Bordgewonnen. Diese Daten liefern u.a. Informa-tionen über die Dichte- und die Größenvertei-lung der Staubteilchen im Ring und lassen soauch Rückschlüsse auf ihre Dynamik zu. ZumZeitpunkt des Einreichens dieser Zusammen-fassung waren die Meßdaten des Staubinstru-ments erst teilweise von der Galileo-Sonde zurErde übertragen. Es werden die ersten Ergeb-nisse der Messungen vorgestellt.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 67
EX12 – Mi., 26.2., 15:45-16:00 Uhr · HS6Srama, R., Grün, E., Kempf, S., Krüger, H., Moragas-Klostermeyer, G. (Max-Planck-InstitutKernphysik)
Staubastronomie - Ein neues ForschungsfeldE-Mail: [email protected]
Staubteilchen werden an weit entferntenOrten geboren: in den Atmosphären roterRiesensterne, in den Aschewolken von Vul-kanen, in der Kälte dichter Molekülwolkenund in den Wirbeln protoplanetarer Scheiben.Aus der Untersuchung von Staubteilchenkönnen wir über diese entfernten Welten, indenen die Teilchen entstanden sind, Infor-mationen gewinnen. Diese Methode nennenwir Staubastronomie. Staubastronomie wirdmit einem Staubteleskop an Bord eines Stau-bobservatoriums im Weltraum durchgeführt.Staubastronomie liefert uns wertvolle Infor-mationen über den Ursprungsort der Teilchenund die dort herrschenden Bedingungen,die mit anderen Mitteln nicht erreichbarsind. Beobachtungsobjekte eines solchenStaubteleskops sind der interstellare Staubund der interplanetare Staub kometarer undasteroidaler Herkunft.
Seit etwa 10 Jahren wissen wir, dass inter-stellarer Staub in unserem Planetensystem zufinden ist. Staubmessungen auf der UlyssesSonde konnten einen Strom von interstellarenStaubteilchen nachweisen, der durch dasSonnensystem fliegt. Die Richtung diesesStroms von submikrometergroßen Teilchenstimmt mit derjenigen des interstellaren Gasesüberein und auch die Geschwindigkeit derStaubteilchen ist von vergleichbarer Größe.Dieser Strom interstellarer Staubteilchenwurde auch über den Polen der Sonne inunverminderter Stärke nachgewiesen. Neuein-situ Messungen mit den Staubdetektoren
auf den Hiten und Cassini Raumsonden habeinterstellarer Staub auch in Erdentfernungnachgewiesen. Modellierungen der Ulyssesund Galileo Daten sagen voraus, dass ca. 30%des Flusses von kosmischen Staubteilchender Masse 10−13 g tatsächlich interstellarenUrsprungs sind. Radar Messungen vonMeteoren mit Geschwindigkeiten oberhalbder heliozentrischen Fluchtgeschwindigkeitzeigen dass sogar interstellare Teilchen mitder Masse 10−7 g vorhanden sind.
Ziel eines Staubobservatoriums ist es, ver-schiedene Sorten von interstellaren und inter-planetaren Staub zu unterscheiden und ihrephysikalischen
Eigenschaften und chemische und isotopi-sche Zusammensetzung zu bestimmen. Umden Beitrag von menschengemachten festenTeilchen in Erdnähe zu minimieren, solltedas Observatorium außerhalb der Staubgürtelder Erde d.h. außerhalb des geosynchronenBahn liegen. Mögliche Bahnen sind hoch ex-zentrische Bahnen in großer Erdeentfernungoder Bahnen um den Librationspunkt des ErdeSonne System.
Webseite: http://www.mpi-hd.mpg.de/dustgroup/dune/index.html
68 Abstracts
EX13 – Mi., 26.2., 17:45-18:00 Uhr · HS6Rietveld, M. T., Hagfors, T., Röttger, J. (Max-Planck Institut für Aeronomie)
Future Directions in Solar-Terrestrial physics using the EISCAT Facilities in NorthernScandinaviaE-Mail: [email protected]
The core of the EISCAT facilities innorthern Scandinavia comprises start-of-the-art tristatic, (931 MHz) and (224 MHz) mono-static incoherent scatter radars in the auroralzone, together with a 550 MHz radar withtwo antennas on Svalbard in the polar cap. Apowerful HF-facility in Tromsø allows artifi-cial perturbation techniques to be applied toionospheric, atmospheric and magnetosphericstudies. Together with an excellent collectionof other diagnostic instruments in the regionand dedicated satellite missions like Cluster-II, TIMED, CHAMP and GRACE, the EIS-CAT facilities allow comprehensive studies ofenergy and mass flow from the Sun to thelower atmosphere.
An outline will be presented of the researchpossibilities to German users of EISCAT.Universities are encouraged to use the facili-ties, the German share (23%) of which will bepaid for by the Max-Planck-Gesellschaft until2006. Research opportunities include studiesof the solar wind by using interplanetaryradio scintillations, studies of magnetosphericand ionospheric processes, auroral physics,atmospheric physics, and plasma physicsincluding the use of artificial perturbationsinduced by HF radio waves. A list of newscience opportunities is given in the followingtable:
New EISCAT-related science in thepolar/auroral region
Polar troposphere, stratosphere and
mesosphere:Synoptic-scale disturbances: frontal passagesand tropopause foldings,Stratosphere-troposphere exchange,Radar reflectivity layers and sheets: theirrelation to aerosol layers,Mountain lee waves propagating into themiddle atmosphere,Wave-wave interaction in the lower andmiddle atmosphere,Lower-middle-upper atmosphere coupling inpolar regions,Momentum and energy deposition by gravitywaves into the polar atmosphere,Studies of dusty complex plasma causing thePolar Mesosphere Summer Echoes (combineseveral instruments),High spatial resolution of dusty plasmastructures in the polar mesopause by usingradar interferometry,Dependence of dusty plasma on backgroundionization, temperature, electric fields, parti-cle precipitation, waves and turbulence,Impact of meteors into the mesosphere andlower thermosphere.
Polar thermosphere:Coupling from above (magnetosphere) andbelow (lower and middle atmosphere),Coupling between ionized and neutral atmo-sphere in the magnetospheric cusp region andunder severe space weather conditions.Neutral gas outflow in the CUSP region,Coordinated experiments with satellites e.g.,CHAMP, GRACE, Cluster-II
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 69
Polar/auroral ionosphere:Measure fine horizontal structure of auroralarcs and associated anomalous echoes,Measure relativistic electron precipitationbursts into the D region,Ion outflows in the cusp region,Excitation of energetic electrons and artificialaurora by plasma instabilities,Heating and cooling processes in the cuspregion,Polar patches and other large-scale densitystructures,Coordinated experiments with satellites.
Plasma physics:The acceleration of auroral particles fromthe thermal plasma in the magnetosphere isnot understood. Time is now ripe for deeperinvestigation with Cluster-II on EISCAT fieldlines and vastly improved optical observa-tions.Observing along the magnetic field lines withEISCAT, strongly asymmetric spectra not ofthermal origin are often seen. Field alignedcurrents may flow in constricted ducts andbe related to these spectra. EISCAT now isequipped to directly observe such structure.Use the HF facility to get magnetosphericechoes off plasma turbulence.EISCAT is in position to study turbulentplasma flow near 100 km. The resultinganomalous conductivity has a controllinginfluence on the current flow in the magneto-sphere. With Cluster-II on EISCAT field linesunique opportunities exist for understandingthe relation.EISCAT is unique in being capable of in-ducing ionospheric plasma turbulence byHF waves and observe the effects with anISR. The role of the geomagnetic field in theprocess is unclear. The reason for turbulence
after wave penetration of the ionosphere is notunderstood.Ionospheric modification will be conductedat Svalbard by a UK group (SPEAR)for plasma investigations and for iono-spheric/magnetospheric studies. The EISCATHF facility in Tromsø is crucial for prop-erly understanding the results of this initiative.
Extraterrestrial science:Measure extra high energy cosmic rays,Quantify interstellar dust fluxes,Solar wind velocity and turbulence measure-ments
70 Abstracts
EX14 – Mi., 26.2., 18:00-18:15 Uhr · HS6Heibey, W., Neubauer, F. M. (Köln)
Das Weltraumwetter zwischen Erde und JupiterE-Mail: [email protected]
In dieser Arbeit wird ein Konzept zur Vor-hersage des Weltraumwetters bis in fünf astro-nomische Einheiten (AE) vorgestellt, wobeiMessdaten des Satelliten WIND (1 AE) undder Raumsonde Ulysses verwendet werden.Um das solare Aktivitätsminimum ist diegroßskalige Struktur des Sonnenwindes beider Erde noch stark geprägt von den koronalenQuellregionen. Die heliosphärische Strom-schicht im interplanetaren Raum ist dann einguter Indikator für die Sonnenwindstruktur, daihr in einem statistischem Sinne Eigenschaf-ten der relevanten physikalischen Parameterzugeordnet werden können. Wir bestimmendeshalb aus den Beobachtungen der Raum-sonde Ulysses zur Zeit des Periheldurchgan-ges im Frühjahr 1995 ein Modell der Strom-schicht in 1 AE, unter der Annahme der Sta-tionarität in einem mit der Sonne korotieren-den Koordinatensystem. Aus Beobachtun-gen in situ durch WIND, dem Modell derStromschicht und den ihr zugeordneten Eigen-schaften sowie den durch Ulysses bestimm-ten Mittelwerten der Observablen über denKoronalöchern ermitteln wir zweidimensiona-le Karten der Parameter des Sonnenwindesin idealer magnetohydrodynamischer (MHD)Beschreibung. Diese Karten werden verwen-det als innere Randbedingungen einer MHD-Computersimulation in sphärischen Polarko-ordinaten, durchgeführt im rotierenden Ko-ordinatensystem. Der stationäre Endzustanddieser Simulationen kann als Vorhersage desWeltraumwetters in 5 AE dienen. In der ra-dialen Evolution zeigt sich ein morphologi-scher Wandel des Sonnenwindes im Rück-
gang der koronalen Prägung zugunsten star-ker dynamischer Effekte. In 5 AE dominie-ren Kompression und Verdünnung das Bild,es entstehen korotierende Wechselwirkungs-zonen (engl. CIR), die teilweise von Stoß-wellenpaaren umrahmt sind. Die räumlicheOrientierung der Kompressionszonen in derSimulation entspricht den Erwartungen undwird bestimmt von der Lage der sie treibendenHochgeschwindigkeitsströme.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 71
EX15 – Mi., 26.2.,18:15-18:30 Uhr · HS6Vogt, J., Zieger, B. (International University Bremen), Glassmeier, K., Stadelmann, A. (Techni-sche Universität Braunschweig), Gombosi, T., Hansen, K., Ridley, A. (University of Michigan)
MHD-Simulationen der PaläomagnetosphäreE-Mail: [email protected]
Da die Erdmagnetosphäre durch die Wech-selwirkung des geomagnetischen Innenfeldesmit dem magnetisierten Plasma des Sonnen-windes kontrolliert wird, haben Variationendes Erdinnenfeldes auf geologischen Zeits-kalen auch Änderungen der magnetosphäri-schen Struktur zur Folge. Während Phasender Polaritätsumkehr dürften Multipole hö-herer Ordnung wichtig werden. Wir kon-zentrieren uns auf den Quadrupolanteil undstudieren die resultierende magnetosphärischeStruktur mit Hilfe des BATS-R-US MHD-Simulationscodes, der an der University ofMichigan entwickelt wurde.
Im Vergleich zu Dipolmagnetosphären wei-sen Quadrupolmagnetosphären neue topologi-sche Merkmale auf. Es zeigt sich weiterhin,dass die globale magnetosphärische Konfigu-ration nicht nur quantitativ, sondern auch qua-litativ von der Orientierung der Quadrupolfel-der abhängt. Die damit verbundenen Ände-rungen des geomagnetischen Feldes im Au-ßenraum haben Auswirkungen auf die Flüs-se hochenergetischer geladener Teilchen in dieErdatmosphäre.
Zwei topologisch verschiedene Klassenvon Quadrupolkonfigurationen werden genau-er untersucht: (1) axialsymmetrische Quadru-pole, und (2) Quadrupolfelder, die magneti-sche Neutrallinien aufweisen.
Im axialsymmetrischen Fall hängt die To-pologie der Magnetosphäre stark von der Stel-lung der Symmetrieachse zur Richtung deseinfallenden Sonnenwindes und der Richtungdes interplanetaren Magnetfeldes ab. Rekon-
nexion kann sowohl auf der Tagseite und anden Flanken der Magnetopause als auch anmehreren Orten im Schweif gleichzeitig statt-finden. Anders als im Dipolfall lassen sichpraktisch keine Konfigurationen finden, in de-nen Rekonnexion überhaupt nicht auftritt, sodass der Sonnenwind in eine Quadrupolma-gnetosphäre kontinuierlicher einkoppeln kann.
In der Kategorie der Quadrupolfelder mitNeutrallinien kommt es insbesondere dann zustarker Wechselwirkung der Magnetosphäremit dem Sonnenwind, wenn die Neutrallinieparallel zum einfallenden Sonnenwind gerich-tet ist. An der Tagseite haben dann hochener-getische Teilchen direkten Zugang zur oberenErdatmosphäre.
72 Abstracts
EX16 – Mi., 26.2., 18:30-18:45 Uhr · HS6Borrmann, T., Fichtner, H. (Bochum, Ruhr-Universität Bochum), Scherer, K. (Katlenburg-Lindau, dat-hex), Stawicki, O. (Bochum, Ruhr-Universität Bochum)
Die großskalige Struktur der Heliosphäre und des lokalen interstellaren Mediums :Ein neuer ModellierungsversuchE-Mail: [email protected]
Die Modellierung der Struktur der Helio-sphäre auf großen Skalen, hat in den letztenJahren deutliche Fortschritte gemacht. Vonpuren Flüssigkeitsmodellen für die Protonenund den neutralen Wasserstoff, in welchennoch Pick-Up Ionen und Kosmische Strah-len eingebunden werden, bis hin zu magne-tohydrodynamischen Modellen. Nichts de-sto weniger sind die gegenwärtigen Modellenoch nicht in der Lage eine realistische drei-dimensionale Heliosphäre zu beschreiben, inder mehrere Teilchenpopulation sowie das so-lare und interstellare magnetische Feld mitein-ander wechselwirken.
Die Entwicklung der letzten Jahre auf demGebiet der paralleln Programmierung, gibt unsaber nunmehr die Möglichkeit realistischeredreidimensionale Heliosphären zu modellie-ren. Es wird und darüber hinaus die Möglich-keit gegeben die Auswirkungen und Effektebei Änderungen im interstellaren Medium unddessen Auswirkung auf die Heliosphäre undnichtzuletzt der Erde zu studieren.
Wir informieren über eine neue Modellie-rungsmöglichkeit basierend auf dem ZEUS-MP Code, der eine parallele Version des be-kannten ZEUS-3D Code ist. Es werden ersteTestresultate präsentiert.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 73
EX17 – Mi., 26.2., 18:45-19:00 Uhr · HS6Fahr, H.-J., Scherer, K. (Bonn)
Die Heliosphäre der ruhenden SonneE-Mail: [email protected]
Das gegenwärtige Bild der Heliosphäre istganz wesentlich bestimmt durch die nachge-wiesene Tatsache, daß das Sonnensystem sichmit einer Relativgeschwindigkeit von 25 km/srelativ zum umgebenden interstellaren Medi-um bewegt. Unter diesem Umstand ergibt sicheine Leedimension der Heliopause von 150AU und ein mindestens 800 AU langer luv-seitiger Helioschweif. Interessant ist nun abereine Betrachtung alternativer Heliosphären-konfigurationen unter geänderten interstella-ren Randbedingungen. In diesem Beitrag wer-den wir speziell den interessanten Fall einerHeliosphäre für eine Sonne betrachten, die ge-genüber dem umgebenden interstellaren Me-dium fast in Ruhe ist. Mit unseren Multifluid-Simulationen zeigen wir die dabei resultieren-de, zeitabhängige Entwicklung einer Helio-sphärenstrukturen in der Zeit nach Aufkom-men des Sonnenwindes. Es zeigt sich, daß un-ter letzteren Umständen eine Heliosphäre vonständig wachsender Dimension und einer ge-störten zirkumsolaren Plasmaregion bis hin-aus zu Entfernungen von 5000 AU resultierenwürde.
74 Abstracts
EX18 – Do., 27.2., 09:30-10:00 Uhr · HS3Klinkmann, W. (DLR Bonn)
Zukunft des Extraterrestrik - Programms der DLR - RaumfahrtagenturE-Mail: [email protected]
Im Zuge der aktuellen Haushaltsentwick-lung und verstärkt durch Mehrkosten beiaktuellen und geplanten Projekten gestal-tet sich die Extraterrestrik - Förderungderzeit sehr schwierig. Die extraterrestrischeWissenschaft in Deutschland hat auf denverschiedensten Forschungsgebieten eineinternationale Spitzenstellung erreicht. Diesgilt in der Astrophysik für die IR-, Röntgen-und Gamma- Bereiche wie auch für diePlanetenforschung inklusive Staubexperi-menten und für die Magnetosphärenphysik.Wenn man sich die Entwicklung des Ex-traterrestrikhaushalts beginnend mit denNeunziger Jahren betrachtet, musste dieFörderung allein nominal um mehr als 50%bis Ende 2002 zurückgefahren werden. Unterdiesen Randbedingungen ist nachvollziehbar,dass die Exzellenz der deutschen extrater-restrischen Forschung in Zukunft nur noch inreduziertem Umfang erhalten werden kann.
Ansonsten läuft man Gefahr, dass auch dieZahl der Wissenschaftler, die in der extrater-restrischen Forschung arbeiten, abnimmt unddamit auch das Interesse der Jugend an derWeltraumforschung zurückgeht. Hier gilt esaus Erfahrungen in den USA zu lernen, wodie Förderung der Extraterrestrik um 20% proJahr bis 2007 gesteigert werden soll.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 75
EX19 – Do., 27.2., 10:00-10:30 Uhr · HS3Wimmer-Schweingruber, R.F. (Universität Kiel)
Interplanetare StörungenE-Mail: [email protected]
Gewaltige Eruptionen auf der Sonne, soge-nannte koronale Massenauswürfe, rufen aufihrer Reise durch das interplanetare Mediumentsprechende Störungen hervor. DieserVortrag fasst die wichtigsten Eigenschaftendieser “interplanetary coronal mass ejections”zusammen und konzentriert sich auf die in-situErkennungsmerkmale, sowie auf ausgewählteEffekte der ICMEs, wie z.B. Teilchenbeschle-unigung und Forbush decreases.
76 Abstracts
EX20 – Do., 27.2., 11:00-11:30 Uhr · HS3Hatzes, A. (Thüringer Landessternwarte Tautenburg)
Extrasolar PlanetsE-Mail: [email protected]
To date precise stellar radial velocity mea-surements have discovered over 100 giantgaseous planets in orbit around other solartype stars. None of these extrasolar plan-ets have characteristics that are similar to theplanets in our own solar system. Is this a se-lection effect, or are the properties of our plan-etary system unique? These discoveries mayprovide important clues as to how our own so-lar system formed. The current status of ex-trasolar planet research will be presented andthe ensemble properties of these systems ex-amined. Future prospects for the study of ex-trasolar planets will also discussed including-future space-based missions which may oneday detect terrestrial extrasolar planets in thehabitable zone of other stars.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 77
EX21 – Do., 27.2., 11:40-12:00 Uhr · HS3Buske, M., Christensen, U. (Göttingen)
Dreidimensionale Evolutionsmodelle der Konvektion im MarsmantelE-Mail: [email protected]
Auf dem Mars legt die starke Konzentrati-on des Vulkanismus, der tektonischen Aktivi-täten und der Anomalien im Schwerefeld aufnur eine Region, die Tharsis Region, besonde-re, sich von der Erde unterscheidende Konvek-tionsformen im tiefen Mantel nahe.Es ist möglich, dass das heutige Konvektions-muster im Marsmantel von nur einem star-ken Aufstrom unter der Tharsis Region ge-prägt ist. Eine mögliche Ursache für diesestarke Reduktion der Aufströme kann die kon-vektionshemmende, endotherme Phasengren-ze vom γ-Spinell zum Magnesiowüstit undPerowskit sein, die im Mars knapp über derKern-Mantelgrenze liegen könnte.In 3-D Modellen wird die zeitliche Evoluti-on des Marsmantels bzw. seiner Konvekti-onsströmung unter Einbeziehung der säkula-ren Abkühlung und der endothermen Phasen-grenze zum Perowskit numerisch simuliert.Die Viskosität variiert radial und hängt überein Arrheniusgesetz von der mittleren Tem-peratur beim Radius r ab. Entsprechend derTemperaturänderung kann sie zeitlich variie-ren und erlaubt so, das Anwachsen der Litho-sphärendicke zu simulieren.Neben Modellen mit einem festen Tempera-turkontrast zwischen der Kern-Mantelgrenzeund der Oberfläche sind Modelle berechnetworden, in denen das Abkühlen des Kerns mit-berücksichtigt wird und die Temperatur an derKern-Mantelgrenze in jedem Zeitschritt ausder Wärmeabgabe an den Mantel bestimmtwird.Die Ergebnisse zeigen, dass die Anwesenheitder Phasengrenze zu einer starken Reduktion
der Anzahl der Aufströme führt. In den Mo-dellen, in denen das Abkühlen des Kerns mit-simuliert wird, beobachtet man eine Redukti-on auf nur zwei Aufströme über einen Zeit-raum von etwa 4.5 Ga.Die Variation der Dicke der Perowskitschichtund des Phasenparameters zeigen, dass der re-duzierende Effekt der Phasengrenze von ih-rer Lage innerhalb der kernnahen thermischenGrenzschicht abhängt. Liegen große Teile derGrenzschicht oberhalb der Phasengrenze, soist der Einfluss geringer.Die Phasengrenze beeinflusst zudem die Wär-meabgabe aus dem Kern. Ohne Phasengrenzekühlt der Kern nach 4.5 Ga um ca. 500 K ab,wohin gegen die Abkühlung im Fall mit Pha-sengrenze je nach Wahl der Parameter zwi-schen 400 K und 450 K liegt.In den Modellen mit abkühlendem Kern hatdie Phasengrenze nur geringen Einfluss aufdie Dicke der Lithosphäre am Ende der Evo-lution, die bei etwa 150 km liegt.
78 Abstracts
EX22 – Do., 27.2., 12:00-12:20 Uhr · HS3Knapmeyer, M., Spohn, T. (Münster), Oberst, J. (Berlin, DLR)
Seismologische Leistungsfähigkeit verschiedener für NetLander vorgeschlagenerNetzwerk-KonfigurationenE-Mail: [email protected]
Im Europäischen NetLander-Projekt sollerstmalig ein Netzwerk aus vier Seismometernauf dem Mars installiert werden. Die geplan-te Lebensdauer beträgt ein Marsjahr. Wissen-schaftliche Zielsetzung des seismischen Ex-periments sind sowohl die Untersuchung derKrustenstruktur als auch die Ermittlung dergenauen Grösse des Kerns und seines Auf-baus.
Bei der Auswahl der Standorte sind, ne-ben den technischen Randbedingungen, diesich u.a. aus der Landung mit Fallschirmenund Airbags sowie der geplanten Überwin-terung ergeben, auch die Anforderungen derverschiedenen Experimente zu berücksichti-gen. Den derzeit diskutierten Konfigurationenist gemein, dass jeweils drei Stationen in ei-nem mehr oder weniger kompakten Dreieckum die vermutlich seismisch aktivsten Gebiete(Tharsis und Elysium) plaziert werden, wäh-rend die vierte antipodal zu den erwarteten Be-benherden aufgestellt wird, um dort seismi-sche Kernphasen zu registrieren.
Wir haben neun verschiedene Konfiguratio-nen auf ihre Eignung speziell für eine glo-bale Seismologie hin untersucht, d.h. unterdem Gesichtspunkt der Detektion, Lokalisie-rung und Auswertung von Beben auf dem ge-samten Mars mit dem Ziel der Erstellung ei-nes Geschwindigkeitsmodells für den gesam-ten Mantel und Kern. Dazu wurden diese Kon-figurationen mit der theoretisch idealen Auf-stellung auf den Eckpunkten eines gleichseiti-gen Tetraeders verglichen.
Als Mass für die globale Detektionsfähig-
keit wurde für jeden Punkt eines den Mars um-spannenden 2x2-Grad Gitters berechnet, wieweit er von der nächstgelegenen Station ent-fernt ist. Bei der Tetraederkonfiguration kannman sich nicht weiter als 70.5 Grad von dernächsten Station entfernen. Andere Konfigu-rationen weisen dem gegenüber Gebiete mitgrösserer Minimalentfernung und damit rela-tiv schlechterer Detektionsfähigkeit auf. Sol-che Gebiete gilt es zu minimieren und in Teileder Marsoberfläche zu legen, an denen geringeSeismizität erwartet wird.
Als Mass für die Lokalisierungsfähigkeitwurde für jeden Punkt desselben Gitters er-mittelt, wie genau er sich durch eine Kreuz-peilung von allen vier Stationen mit Azimu-ten einer angenommenen Genauigkeit von +/-10 Grad lokalisieren lässt. Auch hier gibtdie Tetraederkonfiguration einen Maximalfeh-ler vor, mit dem die anderen Konfigurationenverglichen werden. Die beschriebenen Be-rechnungsverfahren wurden ausgewählt, weilsie keinerlei Annahmen über die erst noch zuermittelnde seismologische Struktur des Marserfordern.
Die seismologische Untersuchung des tie-fen Mantels und des Kerns erfordert die Re-gistrierung von Wellen, welche bis in dieseTiefen vorgedrungen sind. Diese Wellen ge-langen, in Abhängigkeit von der Geschwin-digkeitsstruktur, in bestimmten Entfernungenvom Herd wieder an die Oberfläche. Um her-auszufinden, ob überhaupt Beben in den rele-vanten Entfernungen der geplanten Stations-standorte zu erwarten sind, müssen daher so-
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 79
wohl die Geschwindigkeitsstruktur als auchdie Verteilung der Epizentren modelliert wer-den. Als Geschwindigkeitsmodelle wurdendas Modell B von Sohl & Spohn (1997) unddas 40%-Fe-Modell von Mocquet et al. (1996)verwendet, die sehr unterschiedlich aufgebautsind und sich z.B. hinsichtlich der Laufzeitender P-Welle um bis zu 60s unterscheiden. Eswird angenommen, dass der wahre Mars sichirgendwo in dem von diesen Modellen abge-steckten Wertebereich befindet. Für die Mo-dellierung der globalen Seismizität wurde an-genommen, dass diese in einem ca. 3000kmdurchmessenden Kreis um das Zentrum vonTharsis sowie in einem 600km durchmessen-den Kreis um Elysium Mons konzentriert ist.Zusätzlich wurden 20% der gesamten Seis-mizität gleichmässig über den Mars verteilt.Da für eine Untersuchung des tiefen Man-tels praktisch nur global registrierbare Bebenin Frage kommen, wurden die aus der mo-dellierten Verteilung der Epizentren ermittel-ten wahrscheinlich beobachteten Epizentraldi-stanzen auf eine erwartete Zahl von 40-80 glo-bal detektierbaren Beben pro Marsjahr (Go-lombek et al., 2002) bezogen und die resultie-renden Verteilungsdichten mit den benötigtenEpizentraldistanzen verglichen.
Es stellt sich heraus, dass eine Netzwerk-konfiguration mit drei um den Nordrand vonTharsis herum platzierten Stationen und ei-ner antipodischen Station am Nordrand desHellas-Beckens (namentlich die unter Be-zeichnung T1 diskutierte Konfiguration) hin-sichtlich aller drei Kriterien die besten Ergeb-nisse erbringt. Die antipodale Station ist zurDetektion von Phasen aus dem tiefen Mantelunabdingbar. Mit allen lokal stärker konzen-trierten Konfigurationen (etwa einem Netz un-mittelbar am Rand des Elysium-Massivs) las-sen sich Beben nur auf einem sehr kleinen Teildes Mars zuverlässig lokalisieren.
Golombek, M.P. (2002): A Revision ofMars Seismicity From Surface Faulting; Lu-nar and Planetary Science, vol. XXXIII
Mocquet, A.; Vacher, P.; Grasset, O.; So-tin, C. (1996): Theoretical Seismic Models ofMars: the Importance of the Iron Content ofthe Mantle ; Planet. Space Sci., vol. 44, No.11, pp.1251-1268
Sohl, Frank; Spohn, Tilman (1997): The In-terior Structure of Mars: Implications fromSNC Meteorites ; JGR, vol. 102, No. E1,pp.1613-1635
80 Abstracts
EX23 – Do., 27.2., 12:20-12:40 Uhr · HS3Hezel, D.C., Palme, H., Brenker, F. E. (Köln), Nasdala, L. (Mainz)
Silica rich components in meteorites as indicators of early solar system processesE-Mail: [email protected]
Introduction: Solid matter of the solar sys-tem evolved from aprotostellar disk surround-ing the young sun. Unmelted or undifferen-tiated meteorites – i.e. chondrites – containprimitive components, which formed in theprotostellar disk. Thus meteorites provide aunique insight into the physical and chemi-cal properties, as well as in the dynamics ofthe protostellar disk. The main components ofchondrites are micrometer to millimeter sized,round droplets, termed “chondrules”. Furtherabundant components are FeNi–metals, finegrained matrix and Ca, Al–rich inclusions, of-ten designated as “CAIs”.
It is generally assumed that components ofmeteorites formed during cooling of an ini-tially hot, more or less chemically and isotopi-cally homogenized, nebula. The first phasesto condense are oxides, followed by Mg–rich silicates – which are gradually convertedto more Si–rich phases. Meteoritic compo-nents formed at various temperatures, includ-ing fine grained material as the basic ingredi-ents of chondrules, which formed during tran-sient and intense heating events with temper-atures of up to over 2000 K and subsequentrapid cooling at cooling rates between 1 and10.000 K/hr. Possible heat sources are nebularlightning, density waves or the X–wind.
In the CH-carbonaceous chondrites Acfer182 and 207 we have discovered a subgroupof chondrules rich in SiO2. The existence ofSiO2–rich objects in primitive meteorites ispuzzling, because they are not predicted byequilibrium condensation. We have studiedseveral of these SiO2–rich chondrules and
Figure 1: BSE-picture of a SRC-fragment. Herea cryptocrystalline pyroxene (hy) normative matrixcontains blebs of SiO2.
fragments by optical microscopy, electronmicroprobe and micro Raman spectrometry.
Petrology: The silica rich componentsSRCs) are rare with <0.1 vol.% abundance.They are usually mixtures of two phases:(1) nearly pure SiO2 and (2) a pyroxenenormative composition, which is sometimesslightly SiO2-oversaturated. The bulk chem-ical composition has SiO2–concentrations,between 65 and 85 wt.%. The SRCs have adistinctive texture: either the silica occurs asblebs within the pyroxene normative matrixor – vice versa – the pyroxene occurs as blebswithin a silica matrix (Fig. 1). Both, silicaand pyroxene appear either cryptocrystallineor glassy. When crystalline, micro Ramananalyzes revealed that the silica occurs in themodifications quartz and cristobalite.
Discussion: Most chondrules in meteoritesare Mg-rich. Their abundances of SiO2 is far
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 81
Figure 2: A “what happened when” plot for theSRCs in the CH–chondrites. (1) A completelyevaporated nebular compartment begins to cool.(2) Solids begin to condense, at first Ca, Al–rich components, later Mg–rich phases, the morevolatile Si remains in the gas. (3) Condensationof SiO2–rich phases and formation of SRC pre-cursors. (4) These precursors are reheated to atleast 1968 K (5). (6) After reheating the SRCsquickly cool down and are finally (7) incorporatedinto planetesimals, which later become asteroids,parent bodies of meteorites.
below 65 wt.%. Components with high SiO2–concentrations can be produced by fractionalcondensation where Mg-rich components donot react with the SiO of the gas because cool-ing is faster than solid state diffusion. Underthese conditions SiO2–rich phases form as cal-culated by [1]. The SiO2–rich phases are thebasic constituents of the SRCs.
We thus propose a two stage model for theformation of the SRCs (Fig. 2):
1. In the first stage an evaporated neb-ula compartment cooled, leading to frac-tional condensation according to [1]. Sil-ica condensed at low temperatures andthen agglomerated with other condensedsilicates to dusty SRC–precursors.
2. The texture of the SRCs, with blebs ofone phase within the other and the hightemperature modification cristobalite re-quire that the SRCs formed within a liq-uid immiscibility gap that opens above1968 K in the system MgO–FeO–SiO2
[2]. This means that the SRC precur-sors in the second stage were reheated tomore than 1968 K, thereby receiving theirpresent texture.
Conclusion: This result demonstratesthat the history of solid matter in the solarnebula may be more complicated than usuallyassumed. The SRC components of CH–chondrite require fractional condensation andlater reheating to high temperatures.
References: [1] Petaev MI and Wood JA(1998) MAPS 33:1123–1137; [2] Bowen N.L. and Schairer J. F. (1935) Am. J. Sci. 29,151–217.
Web page: http://www.kosmochemie.de
82 Abstracts
EX24 – Do., 27.2., 12:40-13:00 Uhr · HS3Oberst, J., Heinlein, D., Köhler, U. (DLR), Neukum, G. (Freie Universität, Berlin)
Der Meteoritenfall vom 6. April 2002 und die erfolgreiche Suche nach “Neuschwanstein”E-Mail: [email protected]
Am Abend des 6. April dieses Jahres(2002), 20h 20m 17.7s UT, ereignete sich überSüddeutschland ein Meteoritenfall. In denOrtschaften Mittenwald und Garmisch Parten-kirchen, die sich direkt unter der Flugbahndes Boliden befanden, war dessen Druckwelleso heftig, dass der Boden vibrierte und Fens-ter klirrten. Da ausgezeichnete Sichtbedin-gungen herrschten, konnten insgesamt 10 Ka-meras des “Europäischen Feuerkugelnetzes”(Oberst et al., 1998), vom Schwarzwald bis indie tschechische Republik, den Meteor erfas-sen.
Auf der Grundlage von 7 dieser Aufnah-men wurde das Ereignis rekonstruiert und dieFlugbahn des Projektils vermessen. Die Aus-wertung, die am Ondrejov Observatorium inPrag erfolgte (Spurny et al., 2002), zeigt, dassder Meteoroid (mit einer Masse von geschätztca. 600 kg) unter einem Winkel von etwa40° mit einer Geschwindigkeit von 20 km/sin die Erdatmosphäre eintrat. Die sichtbareLeuchtspur begann in einer Höhe von 84,9km und endete nur etwa 16 km über demBoden, ein Hinweis darauf, dass Fragmen-te (geschätzt 20 kg) im Dunkelflug den Bo-den erreicht hatten. Die Einschlagstelle derHauptmasse konnte auf ein Gebiet von etwa700 mal 1.000 Meter östlich der Stadt Füsseneingegrenzt werden, leider in gebirgigem undschwer zugänglichem Gelände.
Nach mehreren vom DLR geleiteten syste-matischen Suchkampagnen, mit Mannschaf-ten von bis zu 30 Teilnehmern, wurde am 14.Juli das erste etwa 1,7 kg schwere Teilstückdes Meteoriten, mit charakteristischer matt-
schwarzer Schmelzkruste und rostigen Fle-cken, gefunden. Der Meteorit wurde aufden Namen “Neuschwanstein” getauft, da derFundort nur sechs Kilometer entfernt von dembekannten Schloss in der Nähe von Hohen-schwangau lag.
Erste Labor-Untersuchungen, die an denMax-Planck Instituten von Mainz und Heidel-berg, sowie an der Universität Münster durch-geführt wurden, konnten kurzlebige radioakti-ve Isotope im Fundstück nachweisen, was be-stätigt, dass Neuschwanstein tatsächlich vomMeteoritenfall des 6. April stammt. DieUntersuchungen zeigten weiter, dass es sichbei dem Exemplar um einen relativ seltenenEnstatit-Chondriten handelt.
Die fotografischen Aufzeichnungen einesMeteoritenfalls sind ein wichtiges Hilfsmittelfür die gezielte Meteoritensuche. Sie erhal-ten jedoch eine ebenso große Bedeutung da-durch, dass man den Orbit des astronomischenFlugkörpers vor seiner Kollision mit der Er-de genau bestimmen kann. Ein erstaunlichesErgebnis in diesem Fall war, dass die Bahnvon Neuschwanstein (q=0,79 AE, Q=4.01 AE,i=11,4°) nahezu identisch ist mit der Bahndes Meteoriten Pribram (eines gewöhnlichenChondriten vom Typ H), der 43 Jahre zuvorauch von Feuerkugelkameras aufgezeichnetund danach — ebenso wie Neuschwanstein—geborgen werden konnte. Die Übereinstim-mung legt nahe, dass beide Meteorite mögli-cherweise Mitglieder eines “Schwarms” vonObjekten darstellen, obwohl die unterschiedli-che Klassifizierung der beiden Meteorite dieseher unwahrscheinlich erscheinen lässt.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 83
Meteoritenfälle sind äußerst seltene Natur-ereignisse. Mit Neuschwanstein konnte inDeutschland erstmals ein Meteorit aufgrundfotografischer Beobachtungen des seit fast 40Jahren bestehenden Europäischen Feuerkugel-netzes gezielt gesucht und geborgen werden.Im kommenden Frühjahr sind weitere gezielteSuchaktionen nach der Hauptmasse des Me-teoriten geplant, die auf etwa 15 Kilogrammgeschätzt wird.
Oberst, J., D. Heinlein, et al., The ‘Euro-pean Fireball Network‘: current status andfuture prospects, Meteoritics and PlanetaryScience 33, 49-56, 1998.
Spurny, P., D. Heinlein, und J. Oberst, Theatmospheric trajectory and heliocentric orbitof the Neuschwanstein meteorite fall on April6, 2002, Proceedings of the ‘Asteroids, Co-mets and Meteors Conference‘ 2002, Berlin,29. Juli - 2. August, 2002.
Webseite:
http://solarsystem.dlr.de/PG/EN/
84 Abstracts
EX25 – Do., 27.2., 11:30-11:45 Uhr · HS6Kleimann, J., Fichtner, H., Grauer, R., Kopp, A. (Bochum, Ruhr-Universität)
Numerische Modellierung des Sonnenwindes: Erste Ergebnisse mit einem neuen MHD-CodeE-Mail: [email protected]
Die Mehrzahl der existierenden magnetohy-drodynamischen Modelle des Sonnenwindesverwenden zur Reduktion des numerischenRechenaufwandes die vereinfachende Annah-me der axialen Symmetrie, sodass insbesonde-re die Achse des magnetischen Dipols mit derRotationsachse zusammenfällt. Während die-ser Ansatz im solaren Aktivitätsminimum gutmit den beobachteten Verhältnissen im Ein-klang steht, so sind axialsymmetrische Model-le dennoch ungeeignet, die komplexe, dreidi-mensionale Struktur des Magnet- und Massen-stromfeldes im solaren Maximum zu beschrei-ben. Zwar ist diese Problematik schon seit vie-len Jahrzenten bekannt, doch hat erst die enor-me Steigerung der Rechnerleistung der letz-ten Jahre — verbunden mit der Entwicklungleistungsfähiger Algorithmen — die Möglich-keit einer echten 3D-Modellierung praktikabelwerden lassen.Dies motiviert unser Vorhaben, ein zeitabhän-giges, voll dreidimensionales MHD-Modellder Sonnenwindexpansion zu entwickeln, dassich außerdem durch folgende Punkte vonexistierenden Arbeiten abheben soll:
• Berücksichtigung der verschiedenenTemperaturen von Elektronen undH-Ionen (gemessen werden typischer-weise Tp/Te ≈ 5) in einem (reduzierten)Zwei-Fluid-Modell mit je einer Energie-gleichung für Elektronen und Protonen,
• explizite Behandlung der elektrischenResistivität anstelle des Rückgriffs aufdie stets vorhandene, jedoch viel schlech-
ter zu kontrollierende „numerische“ Re-sistivität,
• selbstkonsistente Behandlung der Plas-maheizung durch magnetische Wellen,welche in der Photosphäre angeregt wer-den, ihre Energie in größerer Entfernungvon der Sonne durch Proton-Zyklotron-Resonanz an das koronale Plasma abge-ben und dadurch sowohl einen zusätzli-chen Druck als auch eine Heizung derProtonen bewirken.
Zum Einsatz kommt die C++ - Imple-mentierung eines CWENO - Algorithmusdritter Ordnung, dessen Details im Rahmendes Posters „On the dynamics of the solarcorona: first results obtained with a new3D MHD model“ von Kleimann et al. aufdieser Konferenz vorgestellt werden. DieEigenschaften dieses Codes („eingebau-te“ Flusserhaltung, präzise Auflösung vonSchocks (weitgehend) ohne oszillatorischeArtefakte, einfache cartesische Implementie-rung) ermöglichen komplexe Simulationenbei durchweg moderatem Rechenaufwand.Die Kombination mit einem leistungsfähigenVerfahren zur adaptiven Gitterverfeinerunggestattet zusätzlich nochmals eine erheblicheSteigerung der effektiven Gitterauflösung beifast unverändertem Bedarf an Rechenzeit undSpeicherplatz.
Das implementierte Gleichungssystembesteht aus den klassischen Gleichungen derresistiven (nichtidealen) MHD für Gesamt-
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 85
massendichte, mittl. Massengeschwindigkeit,Magnetfeld und (beiden) Temperaturen,jeweils als Funktion von Ort und Zeit. Zuergänzen ist die Evolutionsgleichung desmagnetischen Wellendrucks nach Tu, Pu &Wei (1984).Ein bisher ungelöstes Problem bestehtin der scheinbaren Unvereinbarkeit einesZwei-Fluid-Modells mit diskontinuierlichenLösungen (Schocks). Dies ergibt sich daraus,dass es in diesem Fall im Allg. keine ein-deutig bestimmte Lösung der entsprechendenEvolutionsgleichungen gibt, sondern nurmehrere, mathematisch gleichwertige sog.schwache Lösungen. Um zu vermeiden, dassder Algorithmus zu einer „falschen“ Lösungkonvergiert, muss das Problem mit Erhal-tungsgrößen formuliert werden. Da aber imFall des Zwei-Fluid-Modells (höchstens) dieGesamtenergie EProtonen + EElektronen erhaltenist, gibt es offenbar eine solche Größe zuwenig.
Die im Vortrag dargestellten Simulationenbeschreiben zunächst das Verhalten rein hy-drodynamischer Lösungen (etwa des isother-men Modells nach Parker (1958)) beim Indu-zieren einer zeitabhängigen „Störung“ und dieRückkehr der Konfiguration in den Gleichge-wichtszustand. Für nicht-isotherme Simula-tionen wird zunächst ein neues Gleichgewichthergestellt, das durch Vorgabe einer ad hoc-Heizfunktion stabilisiert wird. Die nachfol-gende Expansion und Propagation der Störungkann über lange Zeit verfolgt werden.
86 Abstracts
EX26 – Do., 27.2., 11:45-12:00 Uhr · HS6Posner, A. (Univ. Kiel)
Suprathermische und energiereiche Teilchen von Erde und Sonne: Wind/STICS und SO-HO/COSTEPE-Mail: [email protected]
Es existieren verschiedene Populationenvon beschleunigten Teilchen in der Heliosphä-re. Zwei dieser Populationen werden in die-sem Vortrag vorgestellt:
1: Energiereiche Teilchen, die in unmit-telbaber Nähe der Sonne beschleunigt werden.Der Beschleunigsprozess für Ionen laeuft sehrschnell ab. SOHO/COSTEP-Beobachtungenzeigen, dass Protonen und Heliumkerne imMeV-Bereich die Erde bereits innerhalb we-niger Stunden erreichen. NiederenergetischeTeilchen hingegen benoetigen wie der Son-nenwind einige Tage, bis sie 1 AU erreichen.Mit einer Kombination von Teilchenexperi-menten bei 1 AU laesst sich diese für schnel-le Beschleunigungsprozesse charakteristischeEnergiedispersion erkennen. Aus dem zeit-lichen Verlauf des Einsatzes solcher Teilche-nereignisse lassen sich Rueckschlüsse auf denOrt, den Einsatzzeitpunkt sowie auf den Be-schleunigungsprozess ziehen. Es zeigt sich,dass diese Energiedispersion kontinuierlich istvon relativistischen Energien bis in den niedri-gen keV-Bereich hinein, was auf eine gemein-same Beschleunigung hindeutet. EUV- undRadiobeobachtungen der solaren Korona wer-den vergleichend herangezogen.
2: Suprathermische Teilchen aus der Erd-magnetosphäre. Im Gegensatz zum Vorhan-densein im Schweif der Erdmagnetosphäreist erst seit wenigen Jahren bekannt, dassSauerstoff- und Stickstoffionen auch strom-aufwärts (bis zum Lagrange-Punkt 1) den erd-nahen Raum bevölkern. Die Charakterisie-rung zweier neuer Teilchenpopulationen aus
der Erdmagnetosphäre mit Messungen desSTICS-Instrumentes der Raumsonde Windwird vorgestellt. Die Beschleunigung die-ser Teilchen geschieht innerhalb der Erdma-gnetosphäre, während geomagnetische Stür-me verschiedener Intensität beobachtet wer-den . Eine Injektion in das Magnetfeld derHeliosphäre ist möglich, wenn Rekonnekti-on zwischen den Feldern von Erde und Son-ne erfolgt. Die Zusammenhänge zwischendem Auftreten von einfach geladenem Sau-erstoff/Stickstoff stromaufwärts von der Erdeund Parametern im Sonnenwind werden an-hand einer Korrelation aus den Jahren 1995 bis2001 deutlich. Neben dieser generellen Cha-rakterisierung wird auf das bemerkenswertesEreignis vom 12. Februar 2000 eingegangen,welches aus der Dynamik der Teilchen herausdie Abschätzung der Größe der Rekonnekti-onsregion erlaubt.
Webseite: http://www.heliosphere.de
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 87
EX27 – Do., 27.2., 12:00-12:15 Uhr · HS6Kissmann, R., Fichtner, H. (Institut für Theoretische Physik IV, Ruhr-Universität Bochum), Fer-reira, S. E. S. (Unit for Space Physics, School of Physics, Potchefstroom University for C.H.E.,South Africa), Heber, B. (Fachbereich Physik, Universität Osnabrück)
Die Wirkungen von Corotating Interaction Regions auf den Fluss Jovianischer Elektro-nen bei 1 AUE-Mail: [email protected]
Ein überarbeitetes Modell zur Beschreibungdes Transports energetischer Elektronen in derHeliosphäre wurde erfolgreich auf die Unter-suchung von deren Ausbreitung in der innerenHeliosphäre angewandt. Insbesondere kon-zentrierten sich die Untersuchungen auf dieBeschreibung des Einflusses von CorotatingInteraction Regions (CIRs) auf den Transportvon Jupiter-Elektronen zur Erdbahn. Durcheinen Vergleich der Modellierungsergebnissemit Daten, die von der IMP 8 und der SO-HO Raumsonde aufgenommen wurden, wares möglich, erste Aussagen über die Modu-lation von Elektronen innerhalb von CIRs zutreffen.
Dazu wurde die Auswirkung der Variationder Sonnenwindgeschwindigkeit und der Ein-fluß der erhöhten Turbulenz auf den Diffusi-onstensor innerhalb der CIRs durch das Mo-dell berücksichtigt. Für beide Aspekte wur-de jeweils ein einfaches Modell benutzt, dasdie durch verschiedene Raumsonden gemes-senen Variationen von Magnetfeldstärke undSonnenwindgeschwindigkeit in erster Nähe-rung wiedergeben konnte.
Dabei wurde ein einfacher Ansatz benutzt,der die Magnetfeldstärke innerhalb der CIRszur dortigen Stärke der Diffusion in Bezie-hung setzt. Im Verlauf der Untersuchungenzeigte sich, daß dieser einfache Ansatz fürdie Änderung des Diffusionstensors innerhalbder CIRs die 1 AU Daten nicht wiederzuge-ben vermochte. Dies legt eine komplexere
Beschreibung des Diffusionstensors in diesenStrukturen nahe, wie es angesichts der höhe-ren Turbulenzlevel in diesen Gebieten auchplausibel erscheint. Insbesondere zeigen Mes-sungen von CIRs das Auftreten von Wellenty-pen, die außerhalb dieser Regionen nicht ge-funden wurden.
Außerdem konnte gezeigt werden, daßdie Variation der Sonnenwindgeschwindigkeitüber einen CIR einen erheblichen Einfluß aufdie Modulation der Elektronen hat. Ein wich-tiger Schluß aus der Modellierung ist somit,daß Variationen der Sonnenwindgeschwindig-keit bei einer solchen Untersuchung nicht ver-nachlässigt werden dürfen.
88 Abstracts
EX28 – Do., 27.2., 12:15-12:30 Uhr · HS6Grießmeier, J.-M., Motschmann, U., Glassmeier, K.-H. (TU Braunschweig)
Exomagnetosphären und ihre Wechselwirkung mit dem SternenwindE-Mail: [email protected]
Die Mehrzahl der Planeten unseres Sonnen-systems ist magnetisiert und bildet ausgepräg-te Magnetosphären, die sich in Wechselwir-kung mit dem Sonnenwind formen. Für ex-trasolare Planeten sind z. T. sehr viel extreme-re magnetosphärische Bedingungen zu erwar-ten. Abb. 1 zeigt, daß mehrere der bereits be-kannten Exoplaneten den Riesenplaneten zu-zuordnen sind, zugleich jedoch Bahnhalbach-sen kleiner als die des Merkur besitzen. Die-se extrasolaren Riesen sind dem Sternenwindsehr stark ausgesetzt. Die Nähe zum Stern läßteinen hohen kinetischen Sternenwinddruck er-warten, der die Magnetosphäre stark zusam-menpreßt. Die substellare Magnetosphären-bzw. Magnetopausen-Ausdehnung hängt zumanderen aber auch wesentlich vom inneren
Abbildung 1: Massen und Bahnhalbachsenbekannter extrasolarer Planeten (nach Armita-ge).
planetaren Magnetfeld ab. Da die solaren Rie-sen durchweg starke innere Magnetfelder auf-weisen (vgl. Abb. 2), ist man geneigt, solcheauch für extrasolare Riesen zu erwarten. Hier-bei ist aber zu beachten, daß ein geringer Ab-stand zum Zentralkörper mit starken Gezei-tenkräften einhergeht. Man darf nicht davonausgehen, daß derartige Planeten schnell ro-tieren; die Rotation wird möglicherweise ge-bunden bzw. in einer Resonanz mit der Um-laufperiode erfolgen wie von Venus und Mer-kur bekannt. Dementsprechend ist die Aus-bildung des ω-Effektes für das Anlaufen einesαω-Dynamos keineswegs sicher. Wir ziehendeshalb einen α2-Dynamo für derartige Plane-ten ebenfalls in Erwägung.
Für die Abschätzung des planetaren magne-tischen Momentes M ist eine ganze Kollek-tion von Skalengesetzen vorgeschlagen wor-den. Folgen wir den neueren Arbeiten, so er-gibt sich:
Abbildung 2: Magnetische Momente und Dre-himpulse der solaren Planeten. Daten nachCain (1995). Durchgezogene Linie: Fit an dieDatenpunkte (ohne Mars und Venus, die kei-nen ausgeprägten Dynamo besitzen).
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 89
1. M ∝ ρ1/2ωr4c (Busse, 1976)
2. M ∝ ρ1/3ω1/2r7/2c E1/6
(Curtis und Ness, 1986)
3. M ∝ ρ1/2ω3/4r7/2c σ−1/4
(Mizutani et al., 1992)
4. M ∝ ρ1/2ω3/4r3cσ−1/2
(Mizutani et al., 1992)
5. M ∝ ρ1/2ωr7/2c (Sano, 1993)
Hierbei sind ρ die Dichte, ω die Rotations-frequenz und rc der Kernradius des Planeten.Für den Kernradius verwenden wir
rc ∝ Mγp, (1)
wobei Mp die Masse des Planeten ist. γ wirdvon Curtis und Ness (1986) aus einem best fitfür das Sonnensystem zu γ = 0.44 berechnet.Die oben angegebenen Skalengesetze wendenwir exemplarisch auf den Exoplaneten HD209458b an und finden das magnetische Mo-ment (relativ zum Jupiter) in den Grenzen M =0.031− 0.062. Zum Vergleich ergeben dieseSkalengesetze für Saturn M = 0.079 − 0.14;der tatsächliche Wert ist mit M = 0.1 im ab-geschätzten Bereich.
Das magnetische Moment wird nun benutzt,um die charakteristische Skala der Magneto-pause zu ermitteln. Wenn wir vereinfachendannehmen, daß am substellaren Punkt derStrömungsdruck des stellaren Windes durchden magnetischen Druck des Planeten balan-ciert wird, ergibt sich für den Magnetopausen-abstand:
RM ∝ M1/3α−1/6 (2)
Dabei ist α ∝ R−2 der dynamische Sonnen-winddruck.
Mit den oben angegebenen Abschätzungenfür das magnetische Moment ergibt sich für
den Planeten HD 209458b ein Abstand von et-wa zwei bis drei Planetenradien (oder 3-4%des Abstandes zum Stern). Die Jupiterma-gnetosphäre dehnt sich subsolar immerhin aufca. 50 Planetenradien aus.
Von besonderem Interesse sind Exomagne-tosphären für die Erzeugung elektromagneti-scher Strahlung, vor allem im Radiobereich.Das Eindringen des stellaren Windes in Teil-bereiche der Exomagnetosphären kann zurAnregung einer Zyklotron-Maser-Instabilitätführen. Diese bewirkt die Emission nicht-thermischer Radiostrahlung. Derartige Emis-sionen sind von den solaren Riesen sowie inder terrestrischen Magnetosphäre gut bekannt.Die Emissionen aus Exomagnetosphären kön-nen jedoch wesentlich stärker sein, da die Nä-he zum Stern den Pumpprozeß verstärkt. Innaher Zukunft könnte derartige nichthermi-sche Radiostrahlung unter günstigen Bedin-gungen auf der Erde beobachtbar sein (Ru-cker, 2002).
Referenzen:Armitage P. J., http://star-www.st-and.ac.uk/˜pja3/planets/extrasolar.htmlBusse F. H., Phys. Earth Planet. Inter., 12, 350(1976)Cain J. C. et al., JGR, 100, 9439 (1995)Curtis S. A. und Ness N. F., JGR, 91, 11003(1986)Mizutani et al., Adv. Space Res., 12, 265(1992)Rucker H. O., ESA-SP518 (2002)Sano Y., J. Geomag. Geoelectr., 45, 65 (1993)
90 Abstracts
EX29 – Do., 27.2., 12.30-12:45 Uhr · HS6Scholer, M., Sidorenko, I., Jaroschek, C., Treumann, R. A. (Garching, MPI f. extraterr. Physik)
Three-dimensional full particle simulations of magnetic reconnection in thin currentsheetsE-Mail: [email protected]
We have investigated the onset of re-connection in thin current sheets by three-dimensional full particle simulations with arelatively high ion to electron mass ratio of160. Instead of imposing reconnection ab ini-tio, reconnection is allowed to develop out ofhe numerical noise. No symmetry about themidplane is imposed, and the sausage instabil-ity, the drift kink instability, and the Kelvin-Helmholtz instability can in principle occur.Two cases are investigated: (1) a current sheetwith exactly antiparallel fields; (2) a currentsheet with a guide field in the main currentdirection of the same order as the antiparal-lel field. In case (1) the electric field due tothe lower hybrid drift instability in the centerof the current sheet accelerates the electronsand leads to a strong localized current, i.e. toa further thinning of the current sheet. This,in turn, results in rapid patchy onset of recon-nection. The reconnection patches merge intoone neutral line. In case (2) the growth rateof the lower hybrid drift instability is consid-erably smaller, but leads eventually also to athinning of the current sheet and to reconnec-tion along a single neutral line.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 91
EX30 – Do., 27.2., 12:45-13:00 Uhr · HS6Silin, I., Büchner, J. (MPAe)
Nonlinear instability of thin current sheets with magnetic shear.E-Mail: [email protected]
The influence of current-aligned magneticguide field on the nonlinear resonant insta-bility of thin current sheets is investigatedby means of 3D electromagnetic Vlasov codesimulations. First, due to the density gradi-ent at the current sheet edges lower-hybrid-drift (LHD) waves are excited, which propa-gate perpendicular to the local magnetic fieldand obliquely to the current direction. Withgrowing guide field the propagation directionsof the LHD waves are further declined fromthe current flow and the number of particleswhich get in resonance with the waves de-creases. This causes the decrease in growthrate of the LHD waves. Finally, the LHDwaves can no longer drive the global eigen-modes of the current sheet.
92 Abstracts
EX31 – Do., 27.2., 15:00-15:30 Uhr · HS6Lübken, F.-J., Rapp, M. (Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik, Kühlungsborn)
Starke Radarechos aus der Mesosphäre im Sommer: ein Phänomen steht vor der Aufklä-rungE-Mail: [email protected]
Seit etwa 20 Jahren beobachtet man imSommer in mittleren und polaren Breiten ge-legentlich sehr starke Radarechos aus einemHöhenbereich von etwa 82 bis 90 km. Die-se Echos werden nach ihrer englischen Bezei-chung „(polar) mesosphere summer echoes“als (P)MSE bezeichnet. In diesem Vortragkonzentrieren wir uns auf Echos von VHF-Radars bei einer Frequenz von 50 MHz, waseiner Bragg-Skala (λ/2) von 3 m entspricht.Dies bedeutet, daß es räumliche Strukturen imElektronengas bei sehr kleinen Skalen von biszu 3 m geben muß. Da die PMSE nur imSommer und nur in der Nähe der sehr kaltenMesopause mit Temperaturen unterhalb von150 K auftreten, bestand schon früh die Ver-mutung, daß sie im Zusammenhang mit Eis-teilchen („Aerosole“) stehen, die sich nur dortbilden können. Eisteilchen mit Radien größerals etwa 20 nm kann man mit bloßem Augeund mit Lidars vom Boden aus beobachten,ein Phänomen, das als sogenannte „leuchten-de Nachtwolken“ (engl.: noctilucent clouds,NLC) seit mehr als 100 Jahren bekannt ist. Inder Abbildung ist eine gleichzeitige Messungeiner NLC mit einem Lidar und einer PMSEmit einem VHF-Radar gezeigt. Man erkenntdeutlich die enge Korrelation zwischen beidenPhänomenen. Es fällt auf, daß die Unterkan-ten von NLC und PMSE sehr genau überein-stimmen, wohingegen die PMSE sich im Ver-gleich zur NLC bis in größere Höhen erstreckt.
Als primärer Erzeugungsmechanismus fürPMSE wurde schon Anfang der 90er JahreNeutralgasturbulenz vorgeschlagen, wobei die
kleinskaligen Strukturen im Plasma aufgrundder niedrigen Diffusivität der geladenen Aero-sole von der Neutralgasturbulenz entkoppeln.Neutralgasturbulenz allein müßte nämlich un-realistisch intensiv sein (mit entsprechendenAufheizraten von mehren zigtausend Kelvinpro Tag), um Strukturen bei 3 m zu erzeugen.Die Entkopplung der Spektren bei kleinenSkalen wird bestimmt durch das Verhältnisder kinematischen Viskosität der Atmosphäreν (bestimmt die Dissipation der turbulentenGeschwindigkeitsfluktuationen bei kleinenSkalen) zur Diffusivität der Aerosole (unddamit der Elektronen). Dieses Verhältnis,welches auch als Schmidt-Zahl Sc=ν/Dbezeichnet wird, sollte innerhalb einer PMSEalso deutlich größer als eins sein. In derTat haben insitu-Messungen mit raketenge-tragenen Instrumenten die Entkopplung derSpektren bei kleinen Skalen nachgewiesenund Schmidt-Zahlen von bis zu einigenHundert aufgezeigt. Es zeigte sich aber leiderauch, daß im unteren Teil der PMSE desöfteren keine Turbulenz auftritt, sodaß diesoeben erläuterte Erklärung in diesen Fällennicht funktionieren kann.
Mit Hilfe von Modellrechnungen wur-den in den vergangenen Monaten weitereEinzelheiten zur Lebensdauer von Plas-mairregularitäten in der Anwesenheit vongeladenen Aerosolen aufgedeckt. Es stelltesich heraus, daß diese Irregularitäten jenach Größe der Eisteilchen auch mehrereStunden nach Abschalten des Erzeugungs-
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 93
mechanismus (Turbulenz) noch vorhandensein können. Typische „Lebensdauern“ derIrregularitäten sind 10 Minuten für rA=10 nm(rA = Radius der Aerosole) und zwei Stundenfür rA ∼35 nm. Unter Berücksichtigung desklimatologischen Auftretens von Turbulenzläßt sich hiermit die beobachtete Diskrepanzzwischen Turbulenz und PMSE erklären: Inder Mesopausenregion (ca. 88 km) sind dieAerosole klein (d.h. kleine Lebensdauer derIrregularitäten), aber die Häufigkeit von Tur-bulenz ist groß. Man erwartet und beobachteteine gute Korrelation zwischen Turbulenz undPMSE. In NLC-Höhen (ca. 82-83 km) sinddie Teilchen groß (d. h. große Lebensdauerder Irregularitäten) und Turbulenz ist selten.Man erwartet und beobachtet eine schlechteKorrelation zwischen PMSE und Turbulenz.Da die Aerosole hier „groß“ sind, kann mansie mit bloßem Auge und auch mit Lidarsals NLC beobachten. Dies erklärt die gute
Abbildung 1: Zeitliche Entwicklung der alsPMSE bekannten starken Radarechos (grauschattiert), gemessen am 2. Juli 2002 mit demALWIN VHF Radar auf ALOMAR in Nord-norwegen. Zum Vergleich sind Konturlinieneiner sogenannten „leuchtenden Nachtwolke“gezeigt, die am gleichen Ort zur gleichen Zeitmit einem Lidar gemessen wurde.
Koinzidenz der NLC-Schicht mit dem unterenTeil der PMSE (siehe Abbildung).
Die damit verfügbare Erklärung von PM-SE ermöglicht es, die weltweit durchgeführ-ten Radar-Messungen von PMSE im Hinblickauf Eisteilchen (d.h. extrem niedrige Tempe-raturen) und Turbulenz neu zu interpretierenund daraus geophysikalisch relevante Schluß-folgerungen über den thermischen und dyna-mischen Zustand der Hintergrundatmosphäreabzuleiten. Dies betrifft u. a. die fehlendenPMSE in der Antarktis, sowie die praktischpermanent vorhandenen PMSE in Spitzber-gen.
94 Abstracts
EX32 – Do., 27.2., 15:30-15:45 Uhr · HS6Fricke-Begemann, C., Höffner, J., Lübken, F.-J., Müllemann, A. (Kühlungsborn, IAP)
Messung von leuchtenden Nachtwolken und Temperaturen auf SpitzbergenE-Mail: [email protected]
Leuchtende Nachtwolken (NLCs, noctilu-cent clouds) werden in mittleren und hohenBreiten (ca. 50–70◦N) seit über 100 Jahren je-des Jahr im Sommer beobachtet. Mit dem Au-ge erkennt man dabei auffällige „leuchtende“Strukturen am Nachthimmel. Nach heutigemVerständnis handelt es sich um dünne Eiswol-ken, die sich in einer Höhe von 80–85 km bil-den. Aufgrund ihrer Höhe können sie dortnoch von der Sonne angestrahlt werden, wenndiese tief unter dem nördlichen Horizont steht.
Um in dieser Höhe die Existenz von Was-sereis zu ermöglichen sind sehr niedrige Tem-peraturen von unter 150 K erforderlich. Dassind die tiefsten Werte, die in der gesamten At-mosphäre vorkommen, und diese werden nurim Sommer in polaren Breiten in Höhen um85 km erreicht. Verantwortlich dafür ist eineerstaunliche Temperaturanomalie: Die Tem-peraturen in der mittleren Atmosphäre sinddort im Winter, ohne Sonneneinstrahlung, bei-nahe einhundert Grad wärmer als im Sommerund damit weit entfernt vom intuitiv erwarte-ten Strahlungsgleichgewicht. Da die Entste-hung der NLCs so eng mit der Temperatur ver-knüpft ist, erwartet man auch einen Einflussvon Klimaveränderungen auf deren Auftreten.
In polaren Breiten können NLCs aufgrunddes ständigen Tageslichtes im Sommer nichtmit dem Auge beobachtet werden. Aufgrundder dort auftrenden extrem niedrigen Tempe-raturen wird dort jedoch ein besonders häufi-ges Vorkommen erwartet.
Mit bodengebundenen Lidar-Instrumenten(light detection and ranging) können vertikaleRückstreuprofile an festen Standorten aufge-
nommen werden. Daraus lassen sich die NLC-Stärken und ihre Höhen, sowie deren Häu-figkeit und zeitliche Veränderung bestimmen.Mit speziellen Filtern ausgerüstet, können die-se Geräte auch bei Tageslicht arbeiten, so dassNLCs auch im Polarsommer und zu beliebi-gen Tageszeiten untersucht werden können.
Das Leibniz-Institut für Atmosphärenphy-sik betreibt das einzige mobile Kalium-Lidar,dass speziell zur Messungen von Lufttempera-tur und Aerosolgehalt in diesem Höhenbereicham Tage entwickelt wurde. Dieses Instrumentwurde im Jahr 2001 auf der arktischen InselSpitzbergen (78◦N) aufgebaut und betrieben.NLCs wurden dort über einen Zeitraum von 2Monaten beobachtet. Sie treten in der Tat häu-figer auf als in niedrigeren Breiten, wobei ihreHöhe jedoch unverändert bei ca. 83 km liegtund die Wolken weniger als 2 km dick sind.Damit zeigen die NLCs ein erstaunliches Ver-halten: Ihre Höhe ist, unabhängig von der geo-graphischen Breite, innerhalb von 1 km kon-stant.
Die Messungen fanden im Rahmen ei-ner Kampagne gemeinsam mit anderen at-mosphärischen Untersuchungen statt. DieBestimmung der Temperatur mittels Höhen-forschungsraketen zeigt die enge Verknüp-fung zwischen dem NLC-Vorkommen und derÜbersättigung des Wasserdampfgehalts derLuft.
Webseite: http://www.iap-kborn.de
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 95
EX33 – Do., 27.2., 15:45-16:00 Uhr · HS6Füllekrug, M. (Universität Frankfurt am Main, Institut für Meteorologie und Geophysik)
Ozeanische und kontinentale Blitze im globalen atmosphärischen elektrischen Feld derErdeE-Mail: [email protected]
Ein globales Netzwerk von ULF/ELF Magne-tometern wird benutzt um außergewöhnlichstarke ozeanische und kontinentale Blitzeauf globalem Maßstab zu triangulieren. Miteiner Modenentwicklung des Magnetfeldesund meteorologischen Ranbedingungen kanndie Ladungsmenge abgeschätzt werden,die im Blitzkanal von der Wolke zur Erdetransportiert wird. Der mittlere Tagesgangdieses Ladungsflußes wird durch die lokalenmeteorologischen Bedingungen bestimmt,die zur Konvektion führen. Ordnet man dieBeobachtungen des Ladungsflußes negativerund positiver Blitze über den Ozeanen undden Kontinenten nach Weltzeit, so erhält maneinen chrakteristischen Tagesgang, der mitdem Tagesgang des globalen atmosphärischenelektrischen Feldes vergleichbar ist.
Das atmosphärische elektrische Feld derErde wird durch die globale Gewitterak-tivität aufrecht erhalten und liegt in einerGrößenordnung von 100 V/m. Diesem elek-trischen Feld kann eine Ladung von 500 kCauf der Erde zugeordnet werden, die in derAtmosphäre gerade kompensiert wird. DerLadungsfluß in den außergewöhnlich starkenozeanischen und kontinentalen Blitzen kannprinzipiell diesen Ladungszustand verstärkenoder abschwächen.
Der quantitative Vergleich der beiden Prozessezeigt, daß die außergewöhnlich starken nega-tiven Blitze über den Ozeanen und den Kon-tinenten einen vergleichbaren integrierten La-
dungsfluß haben und daß sich daher ihre Bei-träge zum atmosphärischen elektrischen Feldder Erde gerade aufheben. Dagegen summie-ren sich die Beiträge der positiven Blitze undtragen zu einer Abschwächung des globalenatmosphärischen elektrischen Feldes der Er-de von maximal ∼1 % bei. Berücksichtigtman die Leitfähigkeit der Atmosphäre, so er-hält man einen Mindestbeitrag von ∼0.03 %.In jedem Fall liesse sich der Beitrag außerge-wöhnlich starker Blitze zum globalen atmo-sphärischen elektrischen Feld der Erde vonelektrostatischen Meßgeräten mit einem Dy-namikbereich von ∼10−4 quantitativ nachwei-sen.Webseite: http://www.geophysik.uni-frankfurt.de/ fuellekr
96 Abstracts
EX34 – Do., 27.2., 16:30-17:00 Uhr · HS6Lühr, H., Liu, H., Köhler, W., Rother, M. (GFZ Potsdam)
Wirkung des Magnetfeldes auf Dichte und Wind in der Thermosphäre: CHAMP-EntdeckungenE-Mail: [email protected]
Mit der CHAMP-Mission ist zum erstenMal ein hochempfindliches Akzelerometer anBord eines Raumfahrzeugs zum Einsatz ge-kommen. Primäre Aufgabe dieses Instrumentsim Rahmen der Schwerefeldmission ist es, dienicht-gravitativen Kräfte, die auf den Satelli-ten wirken, zu messen. Seit dem Start am 15.Juli 2000 umrundet CHAMP etwa 16 mal proTag die Erde auf einer polnahen Bahn in ei-ner Höhe von ca. 400 km. In dieser Höheist die Luftreibung die größte nicht-gravitativeKraft, die auf den Satelliten wirkt. Bei Kennt-nis des balistischen Koeffizienten ist es mög-lich, die lokale Luftdichte aus der gemessenenAbbremsung zu bestimmen. In ganz ähnlicherWeise lässt sich aus der beobachteten Quer-beschleunigung auf die Windgeschwindigkeitaus den Richtungen quer zur Bahn schließen.Die Daten von CHAMP erlauben zum erstenMal ein detailliertes Bild der Dichteverteilungund der Windfelder der oberen Thermosphä-re zu erstellen. An ruhigen Tagen beobach-tet man die erwartete Verteilung, hohe Dichtenam tagseitigen Äquator und um den Faktor 3geringere auf der Nachtseite. Zu magnetischgestörten Zeiten ergibt sich ein ganz anderesBild. In den auroralen Gebieten findet man lo-kal begrenzte Dichteerhöhungen, die sich teil-weise um mehr als den Faktor 2 von der Um-gebung abheben. Im Laufe der Zeit breitetsich die Dichte äquatorwärts aus, um dann ei-nige Stunden nach dem Abklingen der Aktivi-tät wieder die gewohnte Tag-Nachtverteilunganzunehmen. Ein besonders ausgezeichnetesGebiet ist die untere Cusp-Region. Hier fin-
det man auch an ruhigen Tagen ein Aufstei-gen von Luftmassen mit der anschließendenAusbreitung in Richtung Äquator. CHAMPist weiterhin mit Instrumenten zur hochgenau-en Vermessung des Magnetfeldes ausgerüs-tet. Hiermit ist es uns möglich, ionosphäri-sche Ströme, die möglicherweise die Ursachefür das Aufsteigen des Neutralgases sind, zubestimmen. Erste Studien haben gezeigt, dassoffensichtlich weniger die Pedersen-Ströme,wie im Allgemeinen angenommen, für dieAufheizung des Gases verantwortlich sind,sondern mehr die feld-parallelen Ströme undhier im Speziellen die kleinskaligen. Dichteer-höhungen sind in der Regel begleitet von sehrintensiven feld-parallelen Stromfilamenten imKilometerbereich. In speziellen Messkampa-gnen, die auch EISCAT und Bodenmagneto-meternetze mit einbeziehen, versuchen wir dieDissipationsmechanismen zu ergründen.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 97
EX35 – Do., 27.2., 17:00-17:15 Uhr · HS6Schwarte, J. (GeoForschungsZentrum Potsdam), Chambodut, A. (IPGP Paris, LaboratoireGeomagnetisme), Luehr, H. (GeoForschungsZentrum Potsdam), Mandea, M. (IPGP Paris, La-boratoire Geomagnetisme)
Modelierung des externen Erdmagnetfeldes anhand von CHAMP DatenE-Mail: [email protected]
Eine erste Modelierung des externen ma-gnetischen Feldes mittels CHAMP Skalarda-ten zeigt, dass es immer noch Probleme in derParameterisierung des magnetischen Effektsvon externen Quellen gibt. Eine übliche Kor-rektur bei der Modellierung des magnetischenInnenfeldes ist die Beschreibung der großräu-migen magnetosphärischen Quellen durch dengeomagnetischen DST -Index. Schwierigkei-ten gibt es in der Nähe der Pole und bei derModelierung von Lokalzeitabhängigkeiten. Ineinem zweiten Schritt wurden daher CHAMPVektordaten verwendet, um den Effekt dermagnetosphärischen Ströme zu beschreiben.Immer wieder fliegt der Satellite in Resonanzmit der Erdrotation. Die Vorteile dieser soge-nannten ‘repeat tracks’ werden enutzt, indemdie Differenzen zweier aufeinanderfolgender‘repeat tracks’ betrachtet werden. Die Bei-träge der Lithosphäre und Fehler im Haupt-feldmodell werden dabei eliminiert. Vor derInversion wird außerdem noch eine Korrek-tur im Bereich von ±20◦ um den Nord- undSüdpol angewandt. Um die Beiträge der nichtskalaren Potentiale zu minimieren, wird dasAmpere’sche Ringintegral über einen ganzenOrbit berechnet und als Korrekturgröße in derPolregion herangezogen. Außerdem wird dieOst-Komponente nicht mit in die Berechnungeinbezogen, da sie stark durch feldparalleleStröme beeinflußt wird. Alle Berechnungenwerden dabei in geomagnetischen Koordina-
ten und im Lokalzeitsystem durchgeführt.
Webseite: http://www.gfz-potsdam.de/champ
98 Abstracts
EX36 – Do., 27.2., 17:15-17:30 Uhr · HS6Bouhram, M., Klecker, B. (Max-Planck-Institut fuer extraterrestrische Physik), Reme, H.(CESR, Toulouse, France), Paschmann, G., Puhl-Quinn, P. (Max-Planck-Institut fuer extra-terrestrische Physik), Kistler, L. (University of New Hampshire, USA)
Solar wind control of the dayside ionospheric oxygen ion source : Case studies with Clus-terE-Mail: [email protected]
The outflow of ionospheric ions from thehigh-latitude auroral and polar regions is oneof the main signatures of the coupling betweenthe solar wind, the magnetosphere, and theionosphere. This outflow acts as a significantsupply of oxygen ions for the Earth’s magne-tosphere. The dayside cusp/cleft region hasbeen identified as the major source of oxygenions. After being energized in the cusp/cleft,oxygen ions overcome gravity via the mir-ror force, and drift poleward under the ef-fect of the magnetospheric convection. There-fore, when outflowing ionospheric ions areobserved at high altitudes, a detailed knowl-edge of the convection field is needed so asto locate their source. The present study isfocussed on the characteristics (location, up-ward flux) of the oxygen ion source that leadsto the outflow observed in the dayside high-latitude regions by the Cluster multi-satellitesystem for a few passes at geocentric dis-tances from 4 up to 9 Earth radii. For do-ing so, we use upflowing oxygen distributionsrecorded by the CIS/CODIF experiment as in-put to numerical simulations, which model thebackward motion of ions from the observa-tion point down to the ionosphere. In thismodel, we compute the horizontal transportof ions using time-dependent, small-scale con-vection maps, as inferred from in-flight con-vection measurements from the oxygen dis-tributions and the Electron Drift Instrument(EDI), depending on the available data from
the four Cluster satellites. Here, the footpointsof magnetospheric field lines or the mappingof the convection field measurements in theionosphere are obtained using the Tsyganenko96 model, which takes into account tempo-ral variations of the interplanetary magneticfield (IMF) and the solar wind bulk parame-ters, as inferred from ACE satellite measure-ments. Because the cusp is a region of directentry for solar wind plasma, changes in theIMF and the solar wind bulk parameters areexpected to influence the characteristics of theionospheric ion source. Hence, the responseof the dayside ionospheric source, on the basisof our simulation results, to these solar windchanges is also discussed.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 99
EX37 – Do., 27.2., 17:30-17:45 Uhr · HS6Förster, M. (Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE), Garching, Germany),Baker, J., Greenwald, R. (Johns Hopkins University, Laurel, Maryland, USA), Paschmann, G.,Puhl-Quinn, P., Vaith, H. (MPE Garching, Germany), Quinn, J. M., Torbert, R. B. (Universityof New Hampshire, Durham, NH, USA)
Simultane Messungen der magnetosphaerischen Konvektion von EDI auf Cluster undvom SuperDARN RadarnetzE-Mail: [email protected]
In-situ Messungen der magnetosphärischenKonvektion, die mit dem Electron Drift In-strument (EDI) auf Cluster gewonnen wurden,werden mit gleichzeitigen Messungen die-ser grossräumigen Drift im erdnahen Bereichder ionosphärischen F-Schicht verglichen, diemittels des Beobachtungsnetzes SuperDARNvon neun kohärenten Radaren in der nördli-chen Hemisphäre erzielt wurden. Mittels ei-nes Mapping-Verfahrens werden die Driftvek-toren vom innermagnetosphärischen Meßortentlang der magnetischen Feldlinien in die Io-nosphäre (oder umgekehrt) projiziert. Die-ses Verfahren stützt sich auf ein zuverlässigesempirisches Modell des Erdmagnetfeldes fürvariierende Bedingungen des Sonnenwindes(Tsyganenko) und es beruht auf der Annah-me der Equipotentialität entlang der Feldlini-en. Der Vergleich zeigt über grössere Zeiträu-me eine gute Übereinstimmung der Messun-gen. Andererseits offenbart er aber auch si-gnifikante Abweichungen, deren Interpretati-on von großem Interesse für die Plasmaphysikdes erdnahen Raumes ist, da sie Rückschlüs-se auf elektrodynamische Kopplungsprozes-se zwischen Sonnenwind, Magnetosphäre undIonosphäre erlaubt.
100 Abstracts
EX38 – Do., 27.2., 17:45-18:00 Uhr · HS6Streb, C., Richter, P., Lebert, M., Häder, D.-P. (Lehrstuhl für Ökophysiologie der Pflanzen,Friedrich-Alexander-Universität Erlangen), Dachev, T. (Sofia, Bulgarian Academy of Science)
R3D-B, ein vollautomatisches Dosimeter für sichtbare, UV und ionisierende StrahlungE-Mail: [email protected]
Das R3D Radiometer–Dosimeter wurdeentwickelt, um das Strahlungsklima währendWeltraummissionen mit biologischer Lang-zeitexperimenten, wie z.B. dem Life ScienceExperiment SPORES auf der EXPOSE Platt-form der ISS zu protokollieren. Es stellt ei-ne miniaturisierte Kombination zweier bereitsbestehender Prototypen von Strahlungsmess-geräten dar: Das ELDONET (entwickelt fürdas European light dosimeter network) ist einGerät zur Erfassung von UV–A, UV–B undPAR (photosynthetic active radiation) Strah-lung, das Liulin Instrument wurde auf derMIR zur Bestimmung der Dosis der ionisie-renden Strahlung eingesetzt.
European Light DOsimeter NETwork(ELDONET)
Die ELDONET Instrumente wurden imRahmen eines EU Projektes entwickelt, sie er-fassen die Solarstrahlung in drei biologisch re-levanten Wellenlängenbereichen: UV–B (280nm – 315 nm), UV–A (315 nm – 400 nm)und PAR (400 nm – 700 nm). Die Aufga-benstellung der über 40 hauptsächlich in Eu-ropa, aber auch in aller Welt installierten Sys-teme liegt in der Beobachtung des Verlaufsder solaren Strahlendosis (über Tage, Monateund Jahre), die auf die Erdoberfläche auftrifftund in die Wassersäule eindringt [1–4]. DasHauptaugenmerk des 1986 gestarteten Pro-jekts lag auf der Entwicklung der UV–B Strah-lung infolge der möglicherweise durch an-thropogene Umweltverschmutzung verursach-ten [5, 6] Ausdünnung der stratosphärischenOzonschicht. Ein ELDONET Gerät besteht
Abbildung 1: Das ELDONET Messgerät fürsichtbare und UV-Strahlung.
aus einem Messkopf (Ulbrichtsche Kugel) mitdrei angeflanschten Dioden/Filterkombinatio–nen und ist über den RS232 Anschluß mit ei-nem Hostcomputer verbunden. Die erhobenenDaten werden automatisch im ASCII–Formataufgezeichnet und mit dem eigens entwickel-ten Programm WinDose 2000 bearbeitet.
Einsatz des Liulin auf der MIRDas in bulgarisch–russischer Zusammen-
arbeit entstandene hochsensitive Dosimeter–Radiometer Liulin wurde ab 1988 auf derWeltraumstation MIR eingesetzt, um dieabsorbierte Dosis und den Flux der ein-dringenden Partikel zu bestimmen. [7].Das System besteht aus einer read/writeMikrocomputer– und Telemetrieeinheit undeiner batteriebetriebenen Silikon Solid StateDetektoreinheit.
R3DMit dem Strahlungs–Dosimeter R3D erhält
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 101
Abbildung 2: Ansicht des R3D Strahlungs-messgeräts.
man die Möglichkeit, die UV– und ionisie-rende Strahlung auf der Außenseite von Welt-raumfahrzeugen mit einer Auflösung von ei-ner Minute aufzuzeichnen. Ein Vierkanal Fil-terdosimeter erfasst UV–A, UV–B, UV–C (<280 nm) und PAR. Die kosmische ionisie-rende Strahlung wird mit einem 256 KanalSpektrometer–Dosimeter gemessen und in denbeiden in der Raumfahrt gängigen EinheitenMikrogray / h und Partikel / cm2 ausgegeben.Das Gerät hat eine Größe von 76 x 76 x 36 mmund ein Gewicht von 250 g. Die aufgenom-menen Messwerte werden auf einem internenFlash Memory Chip gespeichert und in defi-nierten Zeitintervallen über ein RS–422 Inter-face zum Hostcomputer der ISS übermittelt.Die Daten, die mit R3D aufgenommen wer-den können, spielen eine wichtige Rolle beider Evaluierung von direkt in Weltraum ex-ponierten Life Science Experimenten, die eineDosisabhängigkeit aufzeigen sollen [8].
Literatur1. Häder D.–P. et al. ELDONET – Euro-
pean light dosimeter network: hardware andsoftware, J. Photochem. Photobiol. B. Biol.Vol. 52, 51 – 58, 1999.
2. Marangoni R. et al. ELDONET – Euro-pean light dosimeter network. Structure andfunction of the ELDONET server, J. Photo-chem. Photobiol. B. Biol. Vol. 58, 178 –184, 2000.
3. Häder D.–P. et al. European light dosi-meter network (ELDONET): 1998 data. Hel-gol. Mar. Res., Vol. 55, 35 – 44, 2001.
4. Lebert M. et al. The European LightDosimeter Network: Four years of measure-ments, J. Photochem. Photobiol. B: Biol., Vol.66, (1) 81 – 87, 2002.
5. Madronich S. et al. Changes in biologi-cally active ultraviolet radiation reaching theEarth´s surface, J. Photochem. Photobiol. B:Biol., Vol. 46, 5 – 19, 1998.
6. Ma J. et al. Effects of stratospheric ozonedepletion and tropospheric pollution on UVBradiation in the troposphere, Photochem. Pho-tobiol., Vol. 66, 346 – 355, 1997.
7. Dachev Ts. et al. New results for thespace radiation environment of MIR space sta-tion obtained by Liulin dosimeter–radiometer.Comparison with LET spectrometer NAUSI-CAA, Acta Astronaut., Vol. 36 (8–12), 505 –515, 1995.
8. Horneck G. et al. Biological experi-ments on the EXPOSE facility of the Interna-tional Space Station, Proceedings on the Ex-pose Facility of the International Space Stati-on, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands 16–18 November 1998, 459 – 468 (ESA SP–433),1999.
102 Abstracts
EX39 – Fr., 28.2., 09:30-10:00 Uhr · HS3Oberst, J. (DLR)
Die Mondforschung im Wandel: Von den Apollo-Landungen bis heuteE-Mail: [email protected]
Die Erforschung des Mondes war lange Zeitden Astronomen und ihren Teleskopen vorbe-halten. Die Kartierung der Mondoberfläche inhoher fotografischer Auflösung mit den unbe-mannten Missionen Surveyor und Lunar Or-biter, schließlich in ganz erheblichem Maßedie Apollo-Landungen haben unser Bild vomErdtrabanten grundlegend verändert und ent-scheidend dazu beigetragen, den inneren Auf-bau des Mondes und seine Geschichte zu ent-schleiern. Von größter Bedeutung war na-türlich die Analyse von 382 kg Probenmate-rial. Daneben jedoch gab es eine Vielzahlvon wissenschaftlichen Experimenten, die ausder Umlaufbahn der Apollo-Kapseln oder vonder Mondoberfläche Daten lieferten, denenman noch heute —mit modernen technischenHilfsmitteln— neue Geheimnisse entlockenkann.
Ein Beispiel dafür sind die Daten der Seis-mographenstationen an den Apollo Landeplät-zen, die in den siebziger Jahren ca. 13.000seismische Ereignisse aufzeichnen konnten.Auf der Grundlage dieser Daten wurden mitHilfe neuer numerischer Verfahren in den letz-ten Jahren verbesserte seismische Modelle desMondes erstellt (Khan und Mosegaard, 2002),die z.B. zeigen, dass die Mondkruste mächti-ger ist, als bislang angenommen wurde. Beieiner neuen Durchmusterung dieser Seismo-gramme konnte außerdem eine Vielzahl neuerMondbeben identifiziert werden (Oberst undMizutani, 2002).
Auch auf dem Gebiet des “Lunar La-ser Ranging” (Laser-Laufzeitmessungen zuden an den Mondlandestellen zurückgelasse-
nen Licht-Reflektoren), die z.B. auch hier inDeutschland vom Observatorium Wettzell imBayerischen Wald aus durchgeführt werden,sind seit der Apollo Ära deutliche Fortschrittegemacht worden. Mittlerweile erreichen die-se Entfernungsbestimmungen eine Genauig-keit im Bereich von Zentimetern. Damit kön-nen erstmals Verformungen des Mondes durchdie Gezeitenkräfte direkt gemessen werden.
In den letzten 12 Jahren eröffneten dieMissionen Galileo, vor allem aber Clementi-ne und Lunar Prospector der Mondforschungvöllig neue Perspektiven. Mit modernen In-strumenten der Fernerkundung beobachtetendie beiden amerikanischen Raumsonden denErdtrabanten aus polaren Mondumlaufbahnenmehrere Monate lang. Clementine gelang es,mit Hilfe digitaler Kameras den Mond fastvollständig multispektral zu kartieren. Ein La-ser Altimeter tastete über 90% der Mondober-fläche ab und lieferte Daten zur Morpholo-gie der großen Einschlagsbecken, wie z.B. das2200 km durchmessende Südpol-Aitken Be-cken. Auch verbesserte Werte für die Ver-schiebung von Figuren- und Massenmittel-punkt des Mondes wurden ermittelt. Das Neu-tronenspektrometer an Bord des Lunar Pro-spector lieferte Karten des Mondes mit derVerteilung chemischer Elemente, wie H, U,Th, K, O, Si, Mg, Fe, Ti, Al, und Ca. Die Mes-sungen ergaben deutliche Hinweise auf Was-sereis in den polaren Schatten- Gebieten desTrabanten.
Die beiden Missionen haben jedoch aucheine Reihe von neuen Fragen aufgeworfen,die zukünftige Raumsonden und Planeten-
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 103
forscher beantworten müssen. So geht imnächsten Jahr (2003) die europäische Raum-sonde Smart-1 an den Start, ausgestattetu.a. mit optischen Kamerasystemen undRöntgenstrahlen-Spektrometern. Im darauffolgenden Jahr erfolgt der Start der japani-schen Mission Lunar-A. Zwei jeweils antipo-dal abgesetzte Penetratoren sollen neue seis-mische Messungen, sowie Wärmeflussbestim-mungen durchführen. Lunar-A will damit dieFrage nach dem Vorhandensein und der Größedes Mondkerns klären.
Khan, A. and K. Moosegaard, An inquiryinto the lunar interior: A nonlinear inversionof the Apollo lunar seismic data, J. Geophys.Res. 107, No. E6, 10.1029/2001JE001658,2002.
Oberst, J. and H. Mizutani, A new inventoryof Deep Moonquake nests visible in the Apol-lo 12 area, Lunar and Planetary Science Con-ference, Houston, Tx, March 11-15, 2002.
104 Abstracts
EX40 – Fr., 28.2., 10:00-10:15 Uhr · HS3Giese, B. (DLR, Berlin)
Die Topographie von Ganymed im Übergangsbereich zwischen einem dunklen und einemhellen GebietE-Mail: [email protected]
1. Einführung Voyager-Bilder haben ge-zeigt, dass die Oberfläche von Ganymed auszwei Arten von Gebieten besteht: dunkle, mitvielen Kratern überdeckte Gebiete und helle-re, deutlich jüngere Gebiete, die mehr als dieHälfte der Oberfläche ausmachen. BesonderesInteresse galt den hellen Gebieten, da ihre Ent-stehung wichtige Informationen über die Evo-lution von Ganymed liefern kann. Als poten-tieller Entstehungsprozess wurde eine Kombi-nation von Vulkanismus und Tektonik vorge-schlagen, obwohl es bei der von Voyager er-zielten Bildauflösung (> 1km/pixel) keine An-zeichen für Vulkanismus gab.
Eines der wissenschaftlichen Ziele derGalileo-Mission war es darum, die existieren-den Entstehungsmodelle einzugrenzen. Dassollte durch eine bessere Bildauflösung («1km/pixel) und Stereobildaufnahmen erreichtwerden. Stereobilder ermöglichen, die Topo-graphie der Oberfläche zu rekonstrieren, sodass die geologische Interpretation der Bilderwesentlich unterstützt wird.
Während Galileos 28. Orbit um Jupi-ter wurden Stereobilder im Übergangsgebietvon Ganymedes Nicholson Regio zu Harpa-gia Sulcus gewonnen (Figure 1). Zwei Bil-der mit 130 m/pixel Bildauflösung bilden Ste-reopaare mit fünf 20 m/pixel Bildern. DerKonvergenzwinkel beträgt ca. 50°. Die-se Bildsequenz wurde speziell zusammenge-stellt, um die topographischen Eigenschaftensowohl von dunklem und hellem Gebiet, alsauch ihre topographische Beziehung zu erfas-sen.
2. Ergebnisse Das aus den Stereobildern ab-geleitete digitale Geländemodell hat eine ho-rizontale Auflösung von etwa 500 m und einevertikale Punktgenauigkeit von 15-30 m. Eszeigt, dass dunkles und helles Gebiet durcheinen mehrere km breiten und bis zu 400 mtiefen Trog getrennt sind. Die östliche Flan-ke des Trogs liegt gegen weiter entfernt lie-gendes, helles Gebiet um einige hundert Meterhöher. Die Flankenneigung beträgt bis zu 7°.Helles und dunkles Gebiet befinden sich etwaauf gleichem topographischen Niveau (Profilp3). Ein markanter Unterschied zwischen bei-den Gebieten besteht in der Oberflächenrau-higkeit. Wie das Höhenmodell zeigt, hat dasdunkle Gebiet mehr Relief als das helle Ge-biet, das wesentlich glatter erscheint.
3.Implikationen Das helle Gebiet ist, weiles vergleichsweise glatt ist, durch Ablage-rung von Material mit geringer Viskosität ent-standen. Da das topographische Niveau etwadem des dunklen Gebiets entspricht, ist einvulkanischer Prozess auf der Grundlage vonWasser (+Salze) eher unwahrscheinlich. Viel-mehr könnte es warmes Eis gewesen sein, daseine durch tektonische Prozesse entstandeneLücke infolge isostatischen Druckausgleichs(und Gletscher-artigem Fließen) gefüllt hat.Der dunkles und helles Gebiet trennende Trogist sehr wahrscheinlich durch spätere Dehnungder Oberfläche entstanden und die erhöhte ost-liche Flanke das Resultat der isostatischen Re-aktion einer duktilen Eisschicht in der Tiefe.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 105
Abbildung 1: Höhenmodell im Übergangsgebiet zwischen Ganymeds Nicholson Regio(dunkles Gebiet links) und Harpagia Sulcus (helleres Gebiet rechts)
106 Abstracts
EX41 – Fr., 28.2., 10:15-10:30 Uhr · HS3Werner, S., Titov, D. (Max-Planck-Institut für Aeronomie, Katlenburg-Lindau), Erard, S., Bi-bring, J.P. (Institut d’Astrophysique Spatiale, CNRS, Université Paris XI, Orsay)
Die Wechselwirkung des atmosphärischen Wasserdampfs mit dem Regolith der Marso-berfläche: Ergebnisse der Messungen des Infrarot-Spektrometers (ISM) der Phobos-2Sonde unter Verwendung von MOLA/MGS-TopographiedatenE-Mail: [email protected]
Der Wasserdampfgehalt der Mars-atmosphäre ist ein wesentlicher Aspektder Erforschung dieses Planeten. Wasser-dampf ist das Spurengas der Marsatmosphäre,das die höchste Variabilität aufweist. Er kannmit der Jahreszeit und mit der Breite um einenFaktor 10 variieren. Dazu kommen Ände-rungen mit der Tageszeit und Variationen,die mit den Eigenschaften der Oberflächekorreliert sind. Auch die Höhenverteilungdieses Gases ist variabel. Die Ursachen dieserVariationen sind Sublimation und Konden-sation des atmosphärischen Wasserdampfesan den Polkappen und Oberflächenfrost,Adsorption am und Desorption vom Regolithder Oberfläche und der advektive Transportdes Gases in der Marsatmosphäre durch dieglobale Konvektion. Sowohl der jahreszeit-liche Wechsel, als auch die tageszeitlichenund räumlichen Variationen legen nahe,dass der Austausch mit dem Regolith derMarsoberfläche eine bedeutende Rolle beidiesen Änderungen des atmosphärischenWasserdampfs spielt. Der Wasserdampfgehaltder Marsatmosphäre wurde sowohl von derErde aus, als auch von Sonden im Marsorbitgemessen. Neben den Viking-Sonden Endeder 70er Jahre führte die Phobos-2 Sonde, die1989 für einige Monate den Mars beobachtethat, entsprechende Messungen durch. DerenInfrarot-Spektrometer (ISM) lieferte räumlichaufgelöste Spektren im Wellenlängenbereichvon 0.8–3.5 µm. Ein sehr gutes Signal-zu-
Rausch-Verhältnis erlaubt die Untersuchungsehr schwacher spektraler Charakteristika desatmosphärischen Wasserdampfs. Da die Ab-sorptionsbanden des in der Marsatmosphäredominanten Kohlendioxids die H2O-Bandenüberlappen, muss bei deren Untersuchungder Beitrag des Kohlendioxids berücksichtigtwerden. Nun liegen räumlich hochaufgelösteDaten zur Topographie der Marsoberflächevor, die es erlauben die dazu benötigte CO2-Säulendichte genauer zu berechnen. DieseDaten stammen vom Mars Orbiter LaserAltimeter (MOLA) an Bord der Sonde MarsGlobal Surveyor (MGS). Mit Hilfe dieserAltimeter-Daten werden die vom ISM ge-messenen Spektren nochmals analysiert. Dieersten Ergebnisse dieser Untersuchung sollenvorgestellt werden. Im Besonderen soll dieräumliche Variabilität des atmosphärischenWasserdampfgehalts und seine Korrelationmit der Topographie und den Oberflächenei-genschaften untersucht werden. Diese könneneinen Einblick in die Mechanismen liefern,die den Austausch von H2O zwischen Atmo-sphäre und Regolith bestimmen. Beispielhaftwird dies anhand eines Vergleichs der überden Tharsis-Vulkanen gewonnen Daten mitden Daten, die über den umgebenden Ebenengewonnen wurden, untersucht.
Webseite: http://www.linmpi.mpg.de
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 107
EX42 – Fr., 28.2., 11:00-11:15 Uhr · HS3Imre, B. (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt)
Numerical Slope Stability Simulations of Chasma Walls in Valles Marineris/Mars usinga Distinct Element Method (DEM).E-Mail: [email protected]
Numerical Slope Stability Simulations ofChasma Walls in Valles Marineris/Mars usinga Distinct Element Method (DEM).
B. Imre, University of Graz - KFU, Austriaand German Aerospace Center - DLR, Berlin([email protected])
The Martian equatorial canyon system ofValles Marineris (VM) extends approximatelyeast-west for about 4000-km. Individual chas-mata are as much as 100-km wide. Their 8-to 10-km depths offer excellent views into theupper Martian crust (Kieffer et al., IN Mars,1992). This deep insight allows to bring lightinto the still poorly known history of volcan-ism, tectonic, erosion and sedimentation of theRed Planet. Mostly recent publications relatethe formation of this canyon system to ero-sional widening and tectonic processes whichare of alternate dominance (e.g. Lucchitta etal., J. Geophys. Res. 99, 1994; Peulvast et al.,Geomorphology 37, 2001; Schultz & Lin, J.Geophys. Res. 106, 2001). The stratigraphiccolumn of the upper Martian crust as seen atVM Chasma walls consists roughly of threegeological units:- A dominant uppermost cap rock of diage-netic material (Treiman et al., J. Geophys.Res. 100, 1995).- A horizontally layered rock unit buildsprominent parts of the wall. It consists mostlikely of volcanic material.- Fractured bedrock near the bottom of thecanyon (McEwen et al., Nature 397, 1999).VM Chasma walls show numerous signs ofmass wasting in form of dry rock avalanches
(McEwen, LPSC XXI, 1990) and (or) wetLandslides due to ice and or water (Geissler etal., LPI Techn. Rep. 90-06, 1990; Lucchitta,J. Geophys. Res. 84, 1979).
Layering, fracturing, lithology, stratigraphyand the content of volatiles are results of thegeologic and climatic history of Mars. Butthese parameters also reflect the developmentof VM and its wall slopes. The scope ofthis work is to gain understanding in theseparameters by back-simulating the develop-ment of wall slopes in VM. For doing so thetwo dimensional Particle Flow Code PFC2Dhas been chosen (ITASCA, version 2.0, up-date 04/04/2002). PFC2D is a distinct ele-ment code for numerical modelling of move-ments and interactions of assemblies of arbi-trarily sized circular particles. Particles maybe bonded together to represent a solid ma-terial. Movements of particles are unlimited.That is of importance because results of opensystems with numerous unknown variables arenon- unique and therefore highly path de-pended. This DEM allows the simulation ofwhole development paths of VM walls whatmakes confirmation of the model more com-plete (e.g. Oreskes et al., Science 263, 1994).To reduce the number of unknown variables aproper, that means as simple as possible field-site has to be selected. This site will first serveas base for creating a numerical model. Sec-ondly the field-site will be compared to themodel results to confirm them. As field-sitethe northern wall of eastern Candor Chasmahas been chosen. This wall is up to 8-km high
108 Abstracts
and represents a valuable outcrop of the up-per Martian crust. It is quite uncomplex, well-aligned and of simple morphology. Currentlythe work on the model is at the stage of per-forming the parameter study. Results will beavailable by the AEF-Meeting.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 109
EX43 – Fr., 28.2., 11:15-11:30 Uhr · HS3Pätzold, M. (Universität zu Köln), Häusler, M. (Universität der Bundeswehr, München), MaRSTeam
Mars Express Orbiter Radio Science (MaRS)E-Mail: [email protected]
Die Mars Express Raumsonde wird EndeMai 2003 von Baikonur gestartet und wird denMars Weihnachten 2003 erreichen. Nach zweiMonaten Tests im Mars Orbit wird etwa imMärz 2004 die operationelle Phase der Missi-on beginnen. Die Ziele des Mars ExpressOrbiter Radio Science Experimentes sind diesystematische Radiosondierung der Marsat-mosphäre (0 - 50 km Höhe) und Ionosphäre(80 km - 300 km Höhe) über zwei Marsjahre,das Ausmessen von Schwereanomalien überbestimmten Zielgebieten, die Bestimmung derMasse des Mondes Phobos und die Charak-terisierung der Oberfläche mit einem bistati-schen Radarexperiment. Vorbereitungen zuroperationellen Phase und die erwarteten Ge-nauigkeiten werden erläutert.
110 Abstracts
EX44 – Fr., 28.2., 11:30-11:45 Uhr · HS3Bagdonat, T., Motschmann, U. (TU Braunschweig), Kührt, E. (DLR Berlin)
Plasmagrenzschichten und magnetische Kavität bei schwachen KometenE-Mail: [email protected]
Die Daten der in-situ Messung an KometHalley weisen neben dem Bow shock nochzwei weitere Plasmagrenzschichten auf, diesogenannte Ion Composition Boundary (ICB)sowie die magnetische Kavität. Die ICB trenntdie Protonen des solaren Windes von den ko-metaren Ionen. Gleichzeitig steigt die magne-tische Feldstärke an (Magnetic Pile-up Boun-dary, MPB). In der Nähe des Kerns verschwin-det das Magnetfeld völlig (Kavität). ÄhnlicheStrukturen finden sich auch bei grossen, un-magnetisierten Körpern, wie z.B. dem Mars.
Bei schwachen Kometen liegt die charak-teristische Längenskala des Hindernisses inder Größenordnung der Ionengyrationsradien.Kinetische und nicht-lineare Effekte spielendann eine wesentliche Rolle. Es wird unter-sucht, inwieweit sich die genannten Struktu-ren in diesem Fall wiederfinden, insbesonde-re hinsichtlich der Bildung der magnetischen
Abbildung 1: Komet Wirtanen bei 2.8AU. Ge-zeigt ist die magnetische Feldstärke (links)und die Dichte der kometaren Ionen (rechts).Bei dieser heliozentrischen Distanz tritt erst-mals eine magnetische Kavität auf.
Kavität.Hierzu wurden dreidimensionale Hybrid-
Code Simulationen für einige Modellfälle undein quantitatives Modell von Komet Wirta-nen durchgeführt. Es zeigt sich, daß z.B.bei Komet Wirtanen die Kavität erst ab einerheliosphärischen Distanz um 2,5AE auftritt.Bei größeren Abständen ist das Magnetfeld inder Koma hingegen erhöht. Ebenso zeigendie übrigen Grenzschichten ein anderes Er-scheinungsbild. Diese Ergebnisse versprecheninteressante neue plasmaphysikalische Entde-ckungen durch die Rosetta-Mission.
Webseite: http://www.tu-braunschweig.de/theophys/research/plasma
Abbildung 2: Schnitt durch den Schweif ausAbb. 1. Man erkennt die scharfe Trennungvon SW und kometaren Ionen (ICB). Das Ma-gnetfeld steigt leicht an (MPB).
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 111
EX45 – Fr., 28.2., 11:45-12:00 Uhr · HS3Schmitt, J. E., Pätzold, M., Neubauer, F. M. (Institut für Geophysik und Meteorologie, Univer-sität zu Köln)
Sonnenwindwechselwirkung des Kometen WirtanenE-Mail: [email protected]
Zur Vorbereitung des Radiosondierungsex-perimentes RSI der ROSETTA-Mission wirddie Umgebung des Kometen Wirtanen simu-liert. Das Ziel ist die Abschätzung der Effekteder Kometenumgebung auf das Radioträger-signal. Basierend auf einer thermischen Mo-dellierung des Kometenkerns und damit sei-nes Sublimationsverhaltens, sowie einer drei-dimensionalen hydrodynamischen Simulationder inneren Koma, wird die Entstehung deskometaren Plasmas und seine Wechselwir-kung mit dem Sonnenwind in Abhängigkeitzum heliozentrischen Abstand untersucht. Diewichtigsten Prozesse in einer H2O dominier-ten Koma und die Lage der Plasmagrenzenaus der MHD-Theorie werden diskutiert. Dadie Dynamik des Sonnenwindes zu starkenVariationen der Plasmaumgebung des Kome-ten führen kann, werden die für die Radio-sondierung interessanten Zeiträume währendder Hauptphase der Mission vorgestellt, insbe-sondere die solare Opposition im Juli/August2012.
112 Abstracts
EX46 – Fr., 28.2., 12:00-12:15 Uhr · HS3Stawicki, O. (Institut für Theoretische Physik IV, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germa-ny), Lerche, I. (Department of Geological Sciences, University of South Carolina, Columbia,South Carolina, USA), Fichtner, H. (Institut für Theoretische Physik IV, Ruhr-Universität Bo-chum, Bochum, Germany)
On the transport of pick-up ions in the heliosphere: A new semi-analytical modelE-Mail: [email protected]
We present new solutions of the pitch-angleaveraged transport equation of pick-up ions inthe heliosphere. These solutions supplementthose so far available for the case of a vanish-ing momentum diffusion. A general solutionis derived for non-vanishing momentum diffu-sion. This solution, which is valid for a simplespatial power law behaviour of the solar windplasma and for arbitrary source functions, isapplied to the stochastic acceleration of pick-up ions and generalizes earlier solutions.
Based on this we present several asymp-totic phase space integralas for the outer helio-sphere and solve them analytically for a stan-dard pick-up ion source function. Numericalcalculations for interstellar neutral hydrogenyield phase space distributions depending sen-sitively on the underlying turbulence and itsdependence on heliocentric distance.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 113
EX47 – Fr., 28.2., 12:15-12:45 Uhr · HS3Flury, W. (ESA/ESOC Darmstadt)
SPACE DEBRIS - EINE GEFAHR FUER DIE RAUMFAHRT?E-Mail: [email protected]
Seit dem Start von Sputnik am 4. Okto-ber 1957 haben mehr als 4000 erfolgreicheRaketenstarts stattgefunden. Zurzeit befindensich ungefähr 10000 Objekte größer als 10-30cm - operationelle und ausgediente Satelliten,Raketenoberstufen, Fragmente von Satellitenund Raketenstufen - in Bahnen um die Erde.Tagtäglich werden sie mit Radars und optis-chen Teleskopen der amerikanischen sowieder russischen Weltraumüberwachung geortetund die aktuellen Bahndaten in einem Kat-alog festgehalten. Die zurzeit 600 - 700operationell genutzten Satelliten sind durchdiese sogenannten katalogisierten Objekte,aber auch durch die 100 - 200 Tausend Ob-jekte größer als 1 cm gefährdet. Der Grundist die hohe Bahngeschwindigkeit mit der dieErde umkreist wird. Bei einer Kollision kannselbst ein 1 cm großes Teilchen einen Satel-liten ernsthaft beschädigen.
Im Vortrag werden die heutige und diezukünftige Situation im Weltraum, dieRisiken durch Weltraummüll im Orbit sowieauf der Erde, Sicherungsmaßnahmen zumSchutz gegen Kollisionen, Maßnahmen zurEindämmung der Raumfahrtrückstände,sowie die Aktivitäten der Weltraumagenturenbeschrieben. Space Debris stellt ein Umwelt-problem dar, welches nur im internationalenRahmen gelöst werden kann. Die Diskus-sionen im Weltraumausschuß der VereintenNationen sind für eine effektive Lösung vongrundlegender Bedeutung.
114 Abstracts
EX48 – Fr., 28.2., 12:45-13:00 Uhr · HS3Oswald, M., Wegener, P., Wiedemann, C. (Braunschweig, ILR)
Space-Based Optical Observation of Space Debris with the ROGER DemonstratorE-Mail: [email protected]
This paper analyzes a concept for the in-situ detection of space debris by an opticaltelescope to be mounted on an orbiting plat-form as a secondary payload. For the purposeof this investigation, the main region of in-terest is the geostationary earth orbit (GEO).It will be shown that even smaller telescopesare suitable means of extending the knowl-edge of the space debris environment in GEO.The analysis was performed using the ESA-PROOF tool (Programm for Radar and Opti-cal Observation Forecasting). The main pur-pose of this tool has been the validation of cur-rent space debris models like ESA-MASTERby simulating the detection of space debris ob-jects by passive and active ground- and space-based sensors. Here, the ESA-PROOF toolwas used as a design tool which makes a de-tailed performance evaluation of different tele-scope configurations possible. The tool en-ables a mission planner to estimate the perfor-mance trade-offs without the need to build anyhardware.
Although GEO is frequently used by allkinds of military and civilian satellites onlyfew is known about the actual space debris en-vironment in GEO and its vicinity. With thesensors currently available, only objects largerthan 10 cm diameter can be detected in this re-gion. Thus the largest number of the popu-lation remains unobserved, and current spacedebris environment models are subject to highuncertainties as there is no means for validat-ing the smaller sized population yet.
A major contributor to the GEO space de-bris environment are explosion events. Cur-
rently there are only two events confirmed yet:the explosion of the Russian-built Ekran satel-lite and the explosion of the US-built Titan3C Transtage. Nevertheless, even with theabove mentioned ground-based sensors, likethe ESA Space Debris Telescope, a large de-bris population below the catalogue threshold(about 1 m) could be detected in recent obser-vation campaigns. The analysis of the resultsfrom the observations of the ESA Space De-bris Telescope indicated that even more frag-mentations might have occured. Current spacedebris models assume that up to 11 morefragmentation events have taken place there.With a space-based sensor designed to ob-serve space debris objects down to a diame-ter of 1 cm the information on these suspectedevents could be extended providing valuableinput for future space debris models.
Another major contributor to the GEOspace debris environment is solid rocket motorslag. Due to its size, no ground based obser-vation of SRM slag is possible. Thus, a space-based sensor flying near or directly throughthe area of interest, the geostationary ring andits vicinity, could provide first insight into theactual SRM slag environment and could thusprovide valuable information for the valida-tion of current space debris models like ESA-MASTER 2001.
For the purpose of the planned ROGER(RObotic GEostationary orbit Restorer) De-monstrator mission, Aerospace Systems hasinvestigated the possible addition of an opticaltelescope for the observation of orbital debris.
The ROGER Demonstrator shall be riding
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 115
as piggyback-payload on an Ariane 5 rocket.Its target orbit will be GTO. Due to the launchpolicy of Arianespace initially the apogee willbe facing towards the sun. The inclination ofthe vehicle will be around 5.2 degrees. In or-der to have both an optimum orientation of thespacecraft for power generation and the bestpossible target illumination, the line of sight ofthe optical sensor would have an inertial orien-tation, facing away from the sun.
This orbit will be significantly influencedby the perturbation forces resulting from thenon symmetric gravitational field of the Earth.As a major consequence, the line of apsideswill rotate with an inertial angular velocity ofabout 0.7° per day. RAAN would be chang-ing at about -0.35° per day (assuming a typicalAriane 5 GTO).
This effect causes a change of the orienta-tion of the LOS with respect to the orbit, lead-ing to an observation scenario that changeswith time. Consequently, different crossingand detection rates should be expected. Theimpact of the Earth shadow on the observa-tion result will also change steadily. In addi-tion, objects are invisible to the detector whenthe Earth is inside the FOV which is inevitablefor 0° declination staring directions. An obser-vation scenario that constantly provides opti-mum viewing conditions is thus not possible.
Nevertheless, the influence of these variableconditions does not significantly affect themission performance. A detailed 24-monthmission simulation for the telescope on theROGER-Demonstrator platform showed thatthe variation of the number of detectable de-bris objects remains rather low. About 300 ob-jects could be observed every month.
A variation of telescope parameters showedthat even a small telescope with a 15 cm aper-ture could yield promising observation resultswithin cost-effective constellations. This con-
figuration would be able to detect a large num-ber of objects below 10 cm diameter and couldthus provide valuable insight into a diameterregime that could previously not be observed.
Web page: http://www.aerospace-systems.de
116 Abstracts
EX49 – Fr., 28.2., 13:00-13:15 Uhr · HS3Wiedemann, C., Oswald, M., Wegener, P. (Braunschweig, ILR)
Neue Quellen von WeltraummüllE-Mail: [email protected]
Einen wesentlichen Forschungsschwer-punkt am Institut für Luft– und Raumfahrt-systeme der TU Braunschweig bildet dieBahndynamik der Gesamtheit aller Objek-te auf Erdumlaufbahnen (Weltraummüll).Auf diesem Gebiet wurde in der jüngerenVergangenheit intensiv im Rahmen desProjektes MASTER (ESA’s Meteoroid andSpace Debris Terrestrial Reference Model)gearbeitet. MASTER ist das europäischeModell zur Abschätzung des Risikos durchRaumfahrt–Rückstände für frei definierbareMissionen. MASTER liegt ein sehr komple-xes Modell der Weltraumumgebung zugrunde,um die räumliche Dichte und Geschwindig-keitsverteilung der Weltraummüllobjekteeinschließlich natürlicher Meteoriten in ei-nem dreidimensionalen Kontrollvolumen zubestimmen.
Weltraummüll besteht aus künstlichen Ob-jekten verschiedener Größe, Zusammenset-zung und Herkunft. Die bekanntesten Beiträgezum Weltraummüll umfassen ausgediente Sa-telliten, missionsbedingte Objekte und Trüm-mer von zahlreichen Explosionen und weni-gen Kollisionen. In den vergangenen Jahrenwurden weitere Beiträge entdeckt und in dasMASTER Modell eingefügt. Im folgendenwerden zwei davon näher dargestellt. Diessind Flüssigmetalltropfen aus Natrium undKalium sowie Cluster aus Kupfernadeln.
Flüssigmetalltropfen sind beim Einsatzvon Kernreaktoren in den achtziger Jah-ren freigesetzt worden. Diese Reaktorenmit der russischen Bezeichnung “Buk” (zudeutsch “Buche”) wurden zur Erzeugung
elektrischer Leistung an Bord von Radar–Ozeanüberwachungssatelliten des TypsRORSAT eingesetzt. Nach dem Ende ihresBetriebes wurden die Reaktoren meistensauf höhere Umlaufbahnen zwischen 900km bis 950 km Bahnhöhe gebracht, umdort zu verbleiben. Nach Erreichen diesesOrbits öffnete sich der Reaktorbehälter undstieß den Reaktorkern, bestehend aus einemkleinen Paket von 37 Uranbrennstäben, inden Weltraum hinaus. Insgesamt haben16 Kernabstoßungen stattgefunden. Diemit der Reaktorkernabstoßung verbundeneÖffnung des Reaktorbehälters hatte zur Folge,dass damit auch der primäre Kühlkreis-lauf geöffnet wurde. Der Reaktorbehälterund der Kühlkreislauf stehen unter Druck,der sich bei der Öffnung des Behältersvermutlich schlagartig abbaut. Die darinenthaltene Kühlflüssigkeit, eine eutektischeNatrium–Kalium–Flüssigmetalllegierung(NaK–78), konnte durch diesen Vorgang inden Weltraum entweichen. Dort entstandendann kugelförmige Tropfen, die sich nochheute im All befinden. Die Tropfen könnenunter Weltraumbedingungen existieren, dadie verwendete Flüssigmetalllegierung einesehr niedrige Verdampfungsrate aufweist.Natrium–Kalium–Tropfen sind nur zwischen1980 und 1988 freigesetzt worden. Siehaben eine Größe von 100 Mikrometer bis5 cm. Simulationsrechnungen zeigen, dasskleine Tropfen mit einem Durchmesser voneinigen Millimetern abgestiegen sind und sichheute nicht mehr im Weltraum befinden. DieTropfen treten in einem schmalen Höhenband
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie 117
gehäuft auf. Die Flüssigmetalltropfen imZentimeterbereich finden sich noch heutenur auf Umlaufbahnen nahe 900 km Höhe.Fragmente und Schlacke aus Feststoffmotorendagegen sind in allen Höhenbereichen, bis hinzur geostationären Bahn anzutreffen.
Cluster aus kurzen dünnen Kupferdrähtenwurden bei zwei Experimenten im Rahmendes West Ford Projektes in den frühen sechzi-ger Jahren auf Umlaufbahnen nahe 3.600 kmBahnhöhe freigesetzt. Die Drähte sollten alsDipolantennen dienen und werden auch als“West Ford Needles” bezeichnet. Die Entste-hung von Clustern, d. h. zusammenhängen-den Nadelklumpen, war eine unerwünschteBegleiterscheinung der Freisetzungsvorgänge.Für die Experimente wurden Umlaufbahnengewählt, bei denen der Solardruck das Peri-gäum der jeweiligen Umlaufbahn kontinuier-lich verringert (Resonanz), bis die Dipole dieoberen Schichten der Atmosphäre erreichenund wiedereintreten. Die Verklumpung derNadeln reduzierte allerdings das Flächen–zu–Massen–Verhältnis (A/m) der Objekte. Da-durch fiel die Wirkung des Solardruckes aufdas Abstiegsverhalten der Cluster deutlich ge-ringer aus als ursprünglich geplant. Infolgedessen erhöhte sich die orbitale Lebensdauerder Cluster, so dass viele Objekte der Frei-setzungsexperimente heute noch im All sindund einen Beitrag zum Weltraummüll leisten,der allerdings relativ gering ist. Es wird ge-zeigt, dass die Cluster des ersten Experimen-tes sehr hohe orbitale Lebensdauern aufwei-sen. Es sind zwei Modelle entwickelt wor-den, um das unbeabsichtigte Freisetzen vonClustern bei zwei Experimenten im Rahmendes West Ford Projektes zu beschreiben. Bei-de Modelle haben ähnliche Parameter und be-rücksichtigen Cluster mit A/m–Verhältnissen,die ungefähr zwischen 1 m2/kg und 5 m2/kgliegen. Die Cluster haben durchschnittliche
geometrische Durchmesser zwischen einigen100 Mikrometern und wenigen Millimetern.Die Gesamtmasse aller Cluster im Weltraumim Jahre 2002 wird auf ungefähr 60 g ge-schätzt. Die Gesamtzahl der Cluster um-fasst etwa 40.000 Objekte, die insgesamt ca.750.000 Nadeln enthalten. Als wesentlicheGründe für die Langlebigkeit einiger Clustersind zwei Ursachen identifiziert worden. Diessind die Verringerung des A/m–Verhältnissesdurch das Auftreten kompakter Komponen-ten infolge der Verklumpung einiger Nadelnund im Falle des ersten Experimentes der Ein-schuss des Satelliten in einen falschen Orbit,auf dem die Resonanzbedingung nicht erfülltist. Es kann erwartet werden, dass die meistenCluster des ersten Experimentes für lange Zeitim Orbit verbleiben werden.
Webseite: http://www.aerospace-systems.de
118 Abstracts
EXP01Scherer, K., Fahr, H.-J. (Bonn)
Überwachung der Zeitabhängigkeit der Heliosphäre durch energetische Neutralteilchen.E-Mail: [email protected]
Wie in den letzten Jahren klar erwiesen,kann die Plasmakonfiguration der Wechsel-wirkung zwischen Sonnenwind und interstel-larem Medium nur durch eine Multifluidsi-mulation angemessen repräsentiert werden.Bei unserer Modellierung berücksichtigen wirProtonen, H-Atome, Pick-up Ionen, anoma-le und galaktische kosmische Strahlung alswechselwirkende Fluide. Im Hinblick auf diesolarzyklischen Variationen der Sonnenwin-dimpulsströme läßt diese Simulation nunmehrauch zeitabhängige Berechnungen zu, die diesolarzykklische Variation der Heliosphären-konfiguration darzustellen erlauben. Wie wirzeigen werden, läßt sich diese zeitabhängi-ge Reaktion der äußeren Heliosphäre durchenergetische Neutralteilchen direkt erfassen,welche im Gebiet jenseits des Sonnenwind-schocks durch Ladungsaustausch entstehenund frei bis in Erdnähe vordringen, um dortvon entsprechenden Teilchendetektoren regis-triert werden zu können. Wir stellen ersteRechnungen zu vorhergesagten Teilchenflüs-sen vor.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie – Poster 119
EXP02Fichtner, H. (Institut für Theoretische Physik, Lehrstuhl IV: Weltraum- und Astrophysik, Ruhr-Universität Bochum), Laitinen, T. (Space Research Laboratory, Department of Physics, TurkuUniversity, Finland ), Vainio, R. (Department of Physical Sciences, University of Helsinki,Finland )
Eine selbstkonsistente Behandlung der Heizung und Beschleunigung des Sonnenwind-plasmas durch ZyklotronwellenE-Mail: [email protected]
Die für die Heiz- und Beschleunigungs-raten verwendeten Plasmawellenfelder sindnicht vereinbar mit den Folgerungen aus denBeobachtungen des Transports solarer ener-getischer Teilchen. Um letztere als zusätz-lichen Test für Modelle der Sonnenwindhei-zung und -beschleunigung nutzen zu können,haben wir eine 2-Fluid-Beschreibung der ra-dialen Sonnenwindexpansion nahe der koro-nalen Basis entwickelt, bei der die entspre-chenden Momentengleichungen des Plasmasergänzt sind durch eine Gleichung, die dieEntwicklung der spektralen Energiedichte derPlasmawellen beschreibt. Das Modell ist so-mit bezüglich der radialen Entwicklung derTurbulenz selbstkonsistent formuliert. Unterder Annahme, dass im Ionzyklotronfrequenz-bereich genügend Energie vorhanden ist, kön-nen die Heiz- und Beschleunigungsraten desthermischen Plasmas in der Korona und im in-terplanetaren Medium neu bestimmt werden.In Verbesserung früherer Modelle der nicht-lokalen Dynamik der solaren Korona wird da-bei die Dissipationsfrequenz selbstkonsistentaus der Dämpfungsrate von Ionzyklotronwel-len bestimmt. Im Vortrag wird zunächst ge-zeigt, dass die zeitunabhängige Modellierungdie gleichen Lösung wie die (im obigen Sinne)nicht-selbstkonsistenten Modelle liefert. An-schliessend wird die Signifikanz einer selbst-konsistenten Behandlung anhand der neuenLösungen demonstriert und deren Implikatio-
nen für den Transport solarer energetischerTeilchen diskutiert.
120 Abstracts
EXP03Kleimann, J., Fichtner, H., Germaschewski, K., Grauer, R., Kopp, A. (Bochum)
On the dynamics of the solar corona: the numerics behind a self-consistent 3D MHDmodelE-Mail: [email protected]
Space missions like SOHO have renewedthe interest in the physics of the solarcorona. This complex system is not yetfully understood due to lack of sufficientlydetailed observations, and also because re-alistic models should cover processes occur-ring on various spatial scales, while beingboth multidimensional and time-dependent.Significant progress with respect to theirnumerical realization was achieved recentlywith the "Central Weighted Essentially Non-Oscillatory"scheme. A 3rd order CWENOscheme efficiently capturing strong gradientsforms the basis of our new code. After de-scribing the algorithm and its implementation,we present test results as well as comparisonswith preexisting codes.
Web page:
http://www.tp4.rub.de/ jk/science/aef-poster.html
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie – Poster 121
EXP04Marsch, E. (Katlenburg-Lindau), Tu, C.Y. (Beijing), Wang, L.H. (Berkeley)
A way of understanding the differential motion of minor ions in the solar windE-Mail: [email protected]
Measurements with SOHO/CELIAS in highspeed solar wind show that some minor ionssuch as O6+ have a relatively high drift ve-locity, however other ions such as Fe9+ tendto lag behind oxygen by a few tens of km/s.This subtle observational feature has not yetbeen understood. A possible way, based on thequasi-linear theory of cyclotron resonance, ofunderstanding this phenomenon is presentedin this paper. The charge per mass of the ionO6+ and Fe9+ are different, a fact which re-sults in different features of the ion-cyclotronresonance with waves. In a plasma with pro-tons, drifting alpha particles and electrons, thedispersion relation of cyclotron waves has twobranches. The oxygen ions tend to resonatewith the inward propagating waves of the left-hand polarized (LHP) first branch and the out-ward propagating waves of the LHP secondbranch. These resonances may together leadto a velocity distribution with a central veloc-ity higher than the proton (solar wind) bulk ve-locity by about 50 km/s at 1 AU. The Fe9+
ions tend to resonate with both the inward andoutward propagating waves of the first branchand may thus form a velocity distribution witha central velocity very near the proton bulk ve-locity. These analytical results are shown tobe supported by numerical results from a two-dimensional simulation based on the quasi-linear diffusion equation. The limitations ofthe present analysis and further work, whichshould be done to corroborate the ideas pro-posed here, are also discussed.
122 Abstracts
EXP05Hagermann, A., Pätzold, M. (IGM Uni Köln), Häusler, B. (Universität der Bundeswehr Mün-chen), Aksnes, K. (Oslo University), Anderson, J.D., Asmar, S.W. (JPL Pasadena), Barriot, J.P.(Observatoire Midi-Pyrenees, Toulouse), Bird, M.K. (Universität Bonn), Grün, E. (MPI Heidel-berg), Ip, W.H. (Chung-Li National University, Taiwan), Marouf, E. (San Jose State University),Morley, T. (ESOC Darmstadt), Neubauer, F.M. (IGM, Uni Köln), Rickmann, H. (Uppsala Astro-nomical Observatory), Schmitt, J. (IGM, Uni Köln), Thomas, N. (MPAe, Katlenburg-Lindau),Tsurutani, B. (JPL Pasadena), Wennmacher, A. (IGM, Uni Köln)
Rosetta Radio Science Investigations (RSI)E-Mail: [email protected]
The Rosetta spacecraft, launched in January2003 will be equipped with the Rosetta RadioScience Investigations (RSI) experiment. Thisexperiment addresses fundamental aspects ofcometary physics such as the mass and bulkdensity of the nucleus, its gravity field aswell as nongravitational forces, nucleus sizeand shape, internal structure, composition androughness of the nucleus surface, the abun-dance of large dust grains, the plasma contentin the coma and the combined dust and gasmass flux.RSI does not have a dedicated instrument onthe Rosetta spacecraft but makes use of theonboard radio subsystem which is responsiblefor communication between the spacecraft andthe ground stations on Earth. The Rosetta ra-dio subsystem is specially equipped with anUltra-Stable Oscillator (USO) which signifi-cantly improves the sensitivity and accuracyof the measurements. The spacecraft is ca-pable of receiving two uplink signals at S-band via the Low Gain Antennas (LGAs), ornon-simultaneously receiving at either X-band(7100 MHz) or S-band via the HGA. Thedownlink transmission via the High Gain An-tenna (HGA) can occur simultaneously at S-band and X-band or at S-band only via theLGAs. RSI is interested in the nondisper-sive frequency shifts (classical Doppler) and
dispersive frequency shifts (due to the ion-ized propagation medium), the signal powerand the polarization of the radio carrier waves.Variations in these parameters will yield in-formation on the motion of the spacecraft, theperturbing forces acting on the spacecraft andthe propagation medium.
The primary and secondary science objec-tives of RSI at the comet, the asteroids flybysand during cruise. The science objectives aredivided into categories
• cometary gravity field investigations,
• comet nucleus investigations,
• cometary coma investigations
• asteroid mass and bulk density
as the prime science objectives, and
• solar corona sounding
as secondary science objective Provided firstcommissioning data are available, an overviewof the RSI science performance will be given.
Web page: http://www.radio-science.de
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie – Poster 123
EXP06Pätzold, M. (Universität zu Köln), Häusler, B. (Universität der Bundeswehr, München), VeRaTeam
Venus Express Radio Science (VeRa)E-Mail: [email protected]
Die Europäische Raumfahrtagentur ESAhat auf ihrer letzten SPC Sitzung die VenusExpress Mission bestätigt. Die Raumsondewird auf dem Satellitenbus von Mars Expressaufbauen, die ausgewählten Instrumente sindErsatzinstrumente von Rosetta und Mars Ex-press. Die Ziele der Mission werden sich aufdie Zusammensetzung und Dynamik der At-mosphäre und die Wechselwirkung der Atmo-sphäre mit dem Sonnenwind konzentrieren.Das Venus Express Radio Science Experiment(VeRa) ist Teil der Nutzlast. Ein UltrastabilerOszillator (USO) wird dem Radiosystem zurStabilisierung der Trägersignale im X-Bandund S-Band beigestellt. Wichtigstes Ziel desVeRa Experimentes ist die Sondierung der Ve-nusatmosphäre und -ionosphäre zwischen 600km und 40 km (Höhe der Wolkendecke), dieCharakterisierung der Oberfläche (Rauigkeitund Zusammensetzung) über ein bistatischesRadarexperimen und die Ausbreitung von Ra-diowellen im Sonnenwind und der Sonnenko-rona während unterer und oberer solarer Kon-junktion. Methoden und Besonderheiten desVeRa Experimentes werden vorgestellt.
124 Abstracts
EXP07Stanzel, C., Pätzold, M., Neubauer, F. (Institut für Geophysik und Meteorologie, Universität zuKöln)
Staubteufel auf dem MarsE-Mail: [email protected]
Staubteufel sind staubtragende atmosphäri-sche Wirbel, die typischerweise am Nachmit-tag auftreten, wenn der Boden die darüber lie-gende Luft erwärmt hat, und diese nun be-ginnt aufzusteigen. Durch die aufsteigendeLuft können kleine Teilchen wie Staub aufge-nommen werden und diese machen den Wir-bel sichtbar. Auf der Erde ist dies ein bekann-tes Phänomen.Auf dem Mars ergaben Bilder von Viking Or-biter 1985 ein vornehmliches Auftreten derStaubteufel ebenfalls am Nachmittag im Som-mer auf der Nordhemisphäre. Es wird vermu-tet, dass Staubteufel für den Eintrag von Staubin die Atmosphäre verantwortlich sind undsomit einen wichtigen Aspekt in der Grenz-schicht der Marsatmosphäre darstellen. Aufden Bildern der Marsorbiter sind Staubteufelals helle Wolken mit länglichen Schatten zuerkennen. Außerdem gilt als Merkmal, dasssich Staubteufel fortbewegen. Bei der Un-tersuchung der Viking Orbiter Bilder wurdeals positives Kriterium ein Nichtvorhanden-sein der Merkmale auf einem nachfolgendenBild gewertet. Insgesamt wurden (ohne po-sitive Bestätigung ermittelte Staubteufel mit-gezählt) über 250 Staubteufel entdeckt. Amhäufigsten treten diese Phänomene zwischen14.30 Uhr und 16 Uhr am Nachmittag auf.Die Größe liegt im Mittel bei 1000 m und derDurchmesser bei 200 bis 300 m.Zukünftig soll mit Hilfe von Pattern Recogni-tion die Analyse von Viking und Mars Glo-bal Surveyor Bildern fortgesetzt werden, umweitere Ergebnisse in bezug auf das zeitliche
und räumliche Vorkommen, die Größe, dieBewegung und Bewegungsrichtung, sowie dieGeschwindigkeit und den Staubeintrag in dieAtmosphäre zu erhalten. Dies wird ab 2004mit dem HRSC Experiment auf Mars Expressfortgeführt werden.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie – Poster 125
EXP08Török, T., Kliem, B. (AIP, Potsdam)
Quasi-statische und dynamische Entwicklung verdrillter koronaler FlußröhrenE-Mail: [email protected]
Numerische Simulationen der Verdril-lung einer anfänglich stromfreien koronalenMagnetfluß-Röhre durch Wirbelbewegungenan den photosphärischen Fußpunkten alsein Modell für solare Eruptionen werdenvorgestellt. Hierzu wurden die kompressiblenidealen MHD-Gleichungen für ein kaltes (d.h.druckfreies) Medium mittels eines Differen-zenverfahrens integriert. Die aufgeprägtenWirbelbewegungen führen zur Bildung einerverdrillten Flußröhre, die in geringer verdrill-ten bzw. verscherten Magnetfluß eingebettetist. Unter der Wirkung sehr langsamerWirbelbewegungen entwickelt sich die Fluß-röhre quasi-statisch entlang einer Folge vonstabilen kraftfreien Gleichgewichten, die mitzunehmender Verdrillung eine geringfügigeHöhenzunahme sowie eine helikale Form zei-gen. In der Simulation existiert ein kritischerWert der Verdrillung, oberhalb dessen keinGleichgewicht mehr gefunden wird und dieFlußröhre eine sehr schnelle Expansion zugrößerer Höhe beginnt. Entweder es existiertdann in der Realität ebenfalls kein Gleichge-wicht mehr, oder benachbarte Gleichgewichtesind durch extrem schnell anwachsende Höhebei nur geringfügig anwachsender Verdrillunggekennzeichnet. Die Simulation kann zwi-schen diesen Fällen aufgrund der endlichenBoxgröße nicht unterscheiden, aber beideFälle würden sich in der Beobachtung alseine Eruption darstellen. Die erreichte Höheder Flußröhre beim Abbruch der Simulationentspricht etwa drei Sonnenradien – derHöhe, in der der einsetzende Sonnenwindalle Strukturen weiter nach außen trägt. Der
kritische Wert der Verdrillung (der Gesamt-Twist der Flußröhre) liegt für die untersuchteKonfiguration im Bereich 2.5π < Φc < 3.0π.
Webseite: http://www.aip.de/ kli
126 Abstracts
EXP09Heber, B. (Universitaet Osnabrueck), Ferrando, P., Raviart, A. (DAPNIA/Service d Astrophy-sique, CEA/Saclay, Gif-sur-Yvette, France), Paizis, C., Sari, G. (Istituto Fisica Cosmica CNR,Universita di Milano, Milano, Italy ), Posner, A., Mueller-Mellin, R., Wibberenz, G., Kunow,H. (Experimentelle und Angewandte Physik, Universitaet Kiel, Kiel, Germany ), Potgieter,M. S. P., Ferreira, S. E. S. (Unit for Space Physics, Potchefstroom University, PotchefstroomUniversity, South Africa), Fichtner, H. (Institut fuer Theoretische Physik IV: Weltraum- undAstrophysik, Ruhr-UniversitaetBochum, Ruhr-Universitaet Bochum, Germany )
-20 MeV electrons in the inner three-dimensional heliosphere at solar maximum: CO-SPIN/KET observationsE-Mail: [email protected]
The Ulysses trajectory, as displayed inFig.1, provides a unique opportunity to studythe propagation of MeV electrons in a widerange of heliographic latitudes and duringvarying conditions in the inner heliosphere.
From the Ulysses launch up to the begin-
X [AU]
Z [A
U]
1991
2004
2003
2002
1993
P1
Y [AU]
P2
U2
U1
Figure 1: Parts of the Ulysses trajectory fromlaunch to 1993 (U1) and from 2002 to 2004(U2) in a system where the positions of Jupiterand Sun are fixed. A Parker magnetic fieldlines in Jupiter’s orbital plane and at 40◦ Nare shown for a solar wind speed of 400 km/s.Open circles are plotted at the beginning ofeach year.
ning of 1998, the 3-10 MeV electron countrate of the COSPIN/KET instrument has beenconsistently described by modulation modelstaking into account galactic cosmic rays aswell as Jovian electrons. In this paper we fo-cus on the MeV electron observations from2001 onwards, covering solar maximum con-ditions. In contrast to our expectations, theelectron intensity stayed at approximately thesame level as the one observed in 1991 whenUlysses was magnetically well connected toJupiter (Fig. 2).
In this paper we present KET observationsof 3-10 MeV electrons. We identified a se-ries of Quiet Time Increases (QTIs). TheseQTIs are characterised by 1) an increase inthe MeV electron intensities and no significantvariations in the corresponding protons, and 2)by a spectral index, which is the same as dur-ing quiet times. Such QTIs observed in theecliptic have been interpreted as Jovian elec-tron events. 3) In spring 2002 Ulysses ob-served a QTI,
At the time of the 2002 QTI Ulysses wasabove 40◦ N and in a Parker like heliosphericmagnetic field configuration there are no fieldlines going through Jupiter and Ulysses in thesame plane (see Fig. 1). Therefore an effi-cient latitude transport is needed in order to
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie – Poster 127
Ulysses Swoops
V [k
m/s
]
v [k
m/s
]
P1EP2
P1 E
P3
RR
Figure 2: Two quiet time increases observed in 1991, and 2002, when Ulysses was ∼1.5 AUand ∼4.1 AU away from Jupiter. From top to bottom the hourly averaged solar wind speed,measured by the SWOOPS instrument, Ulysses radial distance to the Sun, heliographic lati-tude, 6-hour averaged 3-10 MeV to 7-20 MeV electron ratio, and the count rates of 3-10 MeVelectrons (E), 5 to 25 MeV (P1) and 38 to 125 MeV (P2) protons are displayed. The verti-cal lines mark the onset and end of the QTIs. The latter are most probably related with theoccurrence of the reverse shock (R) of a Corotating Interaction Region.
preserve a longitudinal structure close to theecliptic towards polar latitudes. In the futurewe will investigate these events by analysingmagnetic field observations simultanously.
128 Abstracts
EXP10Stawicki, O., Fichtner, H., Schlickeiser, R. (Institut für Theoretische Physik IV, Ruhr-UniversitätBochum, Bochum )
On the influence of turbulence parameters on solar modulation of anomalous and galacticcosmic raysE-Mail: [email protected]
An analytical solution of the fundamentaltransport equation of cosmic rays, i.e. of theParker equation, is presented. The solution isvalid for an arbitrary power law dependence ofthe coefficient of spatial diffusion on both theconfiguration and the momentum space coor-dinate. Furthermore, it allows to include asimple spatial power law behavior of the so-lar wind speed. This solution, which is validfor arbitrary source functions, is applied to theproblem of heliospheric modulation of anoma-lous as well as galactic cosmic rays. Numer-ical calculations yield differential intensitiesdepending sensitively on the underlying turbu-lence and its dependence on heliocentric dis-tance.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie – Poster 129
EXP11Kissmann, R., Fichtner, H. (Institut für Theoretische Physik IV, Ruhr-Universität Bochum ),Ferreira, S. E. S. (Unit for Space Physics, School of Physics, Potchefstroom University forC.H.E., South Africa ), Heber, B. (Fachbereich Physik, Universität Osnabrück)
Ein neues Modell zur Beschreibung des zeitabhängigen Transports energetischer Elek-tronen in der HeliosphäreE-Mail: [email protected]
Alle bisherige numerische Modelle fürdie Beschreibung des Transports JovianischerElektronen in der Heliosphäre, sind auf ei-ne Berücksichtigung von vier Koordinatenbeschränkt. Besonders bei der Betrachtungder Jovianischen Elektronen-Quelle werdenfür die Beschreibung des Elektronentrans-ports in der inneren Heliosphäre jedoch be-reits drei räumliche Koordinaten benötigt. Diefür die Beschreibung dieser Transportprozes-se benutzte Modifikation der erstmals 1965von Eugene Parker vorgeschlagenen Parker-Gleichung umfasst jedoch neben den auftre-tenden räumlichen Abhängigkeiten auch eineAbhängigkeit von der Energie der untersuch-ten Elektronen und eine zeitliche Variationendes Elektronenflusses sowie der äußeren Be-dingungen. Damit liegt also eine Gleichungvor, deren Lösung ein fünfdimensionales nu-merisches Modell benötigt. Jedoch gibt es ver-schiedene Wege, um eine dieser Abhängigkei-ten zu nähern, so daß sie in der numerischenRechnung vernachlässigt werden kann.
In der äußeren Heliosphäre kann zum Bei-spiel die longitudinale Abhängigkeit des Elek-tronenflusses in guter Näherung vernachläs-sigt werden, so daß nur zwei Raumdimen-sionen zu berücksichtigen sind. Nahe derJupiter-Quelle bietet sich diese Möglichkeitjedoch nicht. Dort kann sich eine Modellie-rung somit entweder nur auf die Zeit- oder nurauf die Energieabhängigkeiten des Problemskonzentrieren. So ist bei Betrachtung von
Zeiträumen, für die die Meßdaten über min-destens eine Sonnenrotation gemittelt wurden,eine Vernachlässigung der zeitlichen Abhän-gigkeit des Elektronenflusses möglich (siehezum Beispiel Ferreira et al. (2001a)). Dabeidürfen nur Zeitskalen betrachtet werden, diegleichzeitig so kurz sind, daß sich der solareZyklus nicht auf den Elektronenfluss auswir-ken kann.
Bei einer Beschreibung der zeitliche Ab-hängigkeiten muß dagegen ein Weg gefundenwerden, die Energieabhängigkeiten zu berück-sichtigen, ohne daß diese durch das Modellselbst berechnet werden. Das einzige solcheModell, das bisher auf die Untersuchung desEinflusses von Corotating Interaction Regions(CIRs) auf die Modulation Jovianischer Elek-tronen angewandt wurde, ist das Modell vonFichtner et al. (2001). Hier wurde so vorge-gangen, daß anstatt des Elektronenflusses derElektronendruck berechnet wurde, so daß kei-ne Energieabhängigkeiten mehr auftraten. Da-mit war es bereits möglich erste qualitative Er-gebnisse über die Wirkung von CIRs zu ge-winnen. Als Nachteil dieses Modells mag je-doch angesehen werden, daß es damit nichtmehr möglich ist, Elektronenflüsse bei einerfesten Energie zu untersuchen.
Um dieses Problem schließlich umgehenzu können, wurde dieses Modell weiter ver-feinert. Dafür wurde angenommen, daßdas Spektrum des Elektronenflusses durchein Potenzgesetz-Spektrum mit einem nur
130 Abstracts
schwach energieabhängigen Spektralindex an-gesetzt werden kann. Durch Anwenden diesesAnsatzes in der Parker-Gleichung zeigt sichdie Möglichkeit, ein zeitabhängiges Modell zuerhalten, wenn es erreicht werden kann, fürden Exponenten eine zeitlich konstante Nähe-rung zu finden. Eine solche Näherung für dieUntersuchung der Auswirkung von CIRs aufdie Modulation von Elektronen läßt sich errei-chen, wenn der Spektralindex über die helio-graphische Länge gemittelt wird. Durch nähe-re Untersuchungen zeigte sich, daß die Genau-igkeit trotz der longitudinalen Mittelung ei-nerseits und die angenommene Zeitunabhän-gigkeit des Spextralindexes andererseits, alssehr gut anzusehen ist. So konnte auch ge-zeigt werden, daß die Lösung eines zeitunab-hängigen Problems mit Hilfe des zeitabhän-gigen Modells der Lösung eines steady-stateModells entsprach.
Der Vorteil dieses neuen Modells liegtin der weitergehenden Berücksichtigung derEnergieabhängigkeiten verglichen mit demModell von Fichtner et al. (2001). Außer-dem wird hier der Elektronenfluss selbst un-tersucht, so daß eine Untersuchung bei einerfesten Energie möglich wird.
Während das hier vorzustellende Poster dietechnischen Aspekte des Modells in den Vor-dergrund stellt, wird der zugehörige Vortragerste interessante und illustrative Ergebnisseüber den Einfluß von CIRs auf die Modulationenergetischer Elektronen vorstellen.
Extraterrestrische Physik, Aeronomie und Planetologie – Poster 131
EXP12Werner, S., Keller, H.-U., Korth, A., Lauche, H. (Max-Planck-Institut für Aeronomie,Katlenburg-Lindau)
Determining the hydrogen distribution in the geocorona using UVIS/HDAC Lyman-αobservations during Cassini’s Earth swingbyE-Mail: [email protected]
The Hydrogen Deuterium Absorption Cell(HDAC) is part of the Ultraviolet ImagingSpectrograph (UVIS) experiment aboard theCassini spacecraft. During Cassini’s Earthswingby on August 18, 1999, HDAC was usedas a photometer to measure solar Lyman-αradiation scattered by the neutral hydrogenatoms of the geocorona. These data provideinformation about the hydrogen column den-sity along HDAC’s line of sight during theEarth swingby.
The data cover a large part of the Earth’s ex-osphere and enable us to determine the distri-bution of hydrogen atoms in this region. Theresults are compared to predictions from mod-els of the Earth’s exosphere/geocorona.
Web page: http://www.linmpi.mpg.de
132 Abstracts
EXP13Weiler, M., Rauer, H., Knollenberg, J. (DLR, Berlin), Jorda, L. (LAM, Marseille), Helbert, J.(DLR, Berlin)
Die Staubaktivität des Kometen C/1995 O1 (Hale-Bopp) zwischen 3 AE und 13 AE helio-zentrischen AbstandsE-Mail: [email protected]
Der außergewöhnlich aktive KometC/1995 O1 (Hale-Bopp) war Gegenstand eineroptischen Langzeit-Beobachtungskampagne,bei der zwischen April und Oktober 1996sowie von September 1997 bis Januar 2001Daten erhalten wurden. Ein Bereich helio-zentrischer Abstände von etwa 4,6 AE bis2,9 AE vor dem Periheldurchgang am 1.April 1997 und von 2,8 AE bis 12,8 AE nachdem Periheldurchgang wurde abgedeckt. MitInstrumenten der Europäischen Südsternwarte(ESO) in Chile wurden Breitbandfilteraufnah-men und Langspaltspektren aufgenommen.Aus den Langspaltspektren wurde die Rö-tung auf den Wellenlängenintervallen von4100 Å bis 5400 Å und von 5400 Å bis6100 Å bestimmt. Es wurde keine signifikan-te Variation der Rötung der Staubkoma desKometen Hale-Bopp mit heliozentrischemAbstand gefunden.Aus den radialen Intensitätsprofilen derLangspaltspektren wurde unter der Annahmeeiner Rotationsymmetrie der Kometenkomader Parameter Afρ bestimmt.Unter Annahme einer stationären, isotropenStaubfreisetzung aus dem Kern des Kometenwurden die Staubproduktionsraten aus denAfρ-Parametern bestimmt. Die nukleozen-trische Geschwindigkeit der Staubpartikelin Abhängigkeit von der Größe der Staub-teilchen sowie die maximale Größe derStaubteilchen, die durch die Gasströmunggegen die Gravitation des Kometenkernsangehoben werden koennen wurden dazu mit
einem gasdynamischen Modell bestimmt.Die Staub-zu-Gas-Massenverhältnisse wur-den bestimmt. Ein linearer Fit an dieStaub-zu-Gas-Massenverhältnisse nach demPeriheldurchgang ergibt einen Zusammen-hang Qstaub/Qgas = 1,40 − 0,05 · rh. Damitwurde ein im Vergleich zu anderen Publi-kationen (z.B. Rauer et al. 1997, Gruen etal. 2001) deutlich niedrigerer Staubgehaltdes Kometen Hale-Bopp bestimmt und einenur geringe Abhängigkeit des Staub-zu-Gas-Massenverhältnisses vom heliozentrischenAbstand rh gefunden.
134 Abstracts
GD01 – Mo., 24.2., 11:00-11:20 Uhr · HS3Breuer, M., Weßling, S., Hansen, U. (Münster)
Die Bedeutung der mechanischen Trägheit in thermischen KonvektionsströmungenE-Mail: [email protected]
Die Dynamik der Erde wird wesentlichdurch thermische Konvektionsströmungen ge-prägt. Zum Beispiel bilden Konvektionss-trömungen im äußerem Erdkern den Motorfür den Geodynamo, der die Grundlage fürdie Entstehung des Erdmagnetfeldes darstellt.Weitere Beispiele sind Ozean- und Atmosphä-renzirkulationen und Strömungen im Erdman-tel, die verantwortlich für die Plattentektoniksind. Die Bedeutung der mechanischen Träg-heit in thermischen Konvektionsströmungenlässt sich durch einen Ähnlichkeitsparame-ter, der Prandtlzahl (Pr = ν/κ), ausdrücken.Die Prandtlzahl stellt dabei ein Maß für dieDiffusion des Impulses relativ zur Wärme-diffusion dar und ist somit ein Materialpa-rameter. Fluide in geodynamischen Syste-men weisen eine erhebliche Bandbreite in ih-rer Prandtlzahl auf. Für den im Wesentli-chen aus flüssigem Eisen bestehenden äuße-ren Erdkern wird eine Prandtlzahl zwischen0.01 − 1 als realistisch angesehen. Wasserist durch eine Prandtlzahl von 7 gekennzeich-net, wohingegen für Magmen eine Prandtzahlvon etwa 100 angenommen wird. Letztend-lich wird der zähe Erdmantel durch eine nahe-zu unendliche Prandtlzahl beschrieben (Pr =1023). In einer numerischen Studie haben wirden Einfluss der Prandtlzahl, für Pr = 10−2 −102, auf das Verhalten von Konvektionsströ-mungen in einer dreidimensionalen Rayleigh-Bénard-Anordnung untersucht. Die Rayleigh-zahl wurde dabei konstant auf Ra = 106 ge-setzt, hoch genug, um ein stark zeitabhängigesStrömungsverhalten zu gewährleisten. Da-bei haben wir insbesondere untersucht, wel-
chen Einfluss die Prandtlzahl auf die räum-liche Struktur der Strömung, auf die Effek-tivität des advektiven Wärmetransports, aus-gedrückt durch die Nusseltzahl (Nu), und aufdas Verhalten von thermischen und viskosenGrenzschichten hat. Zudem haben wir unse-re Resultate mit vorhandenen Theorien, insbe-sondere mit der aktuellen Theorie von Gross-mann & Lohse (Phys. Rev. Lett. 86, 2001),verglichen. Wir konnten, in Abhängigkeitvon der Prandtlzahl, zwei deutlich vonein-ander verschiedene Strömungsregime identifi-zieren. Bei niedrigen Prandtlzahlen, Pr <<1, wird Wärme hauptsächlich über den dortherrschenden großskaligen Wind transportiert.Die Effektivität des Wärmetransports steigt indiesem Regime mit zunehmender Prandtlzahleinem Potenzgesetz folgend stark an. Deswei-teren zeichnet sich dieses Regime durch einenhohen Anteil von toroidaler Energie an derGesamtenergie aus. In dem Regime bei ho-hen Prandtlzahlen, Pr >> 1, bilden sich dünneAufströme bzw. Abströme (engl. plumes) aus,über die der Wärmetransport im Wesentlichenstattfindet. Der effektive Wärmetransport istin diesem Regime nahezu unabhängig von derPrandtlzahl. Zudem lässt sich in diesem Be-reich, mit Zunahme der Prandtlzahl, ein deut-licher Abfall des Anteils von toroidaler Ener-gie an der Gesamtenergie feststellen.
Geodynamik und Gravimetrie 135
GD02 – Mo., 24.2., 11:20-11:40 Uhr · HS3Walzer, U., Hendel, R. (Jena), Baumgardner, J. (Los Alamos, USA)
Variation der Parameter eines kugelschaligen thermischen Evolutionsmodells des Erd-mantelsE-Mail: [email protected]
Die Differentialgleichungen der thermi-schen Konvektion mit unendlicher Prandtlzahlwurden gelöst, wobei eine 3D FE Kugelscha-lenmethode verwendet wurde. Das Gitter be-ruht auf einer Zentralprojektion eines regulä-ren Ikosaeders auf Kugelflächen und sukzessi-ver Teilung von je einem sphärischen Dreieckin vier Dreiecke in je einem Schritt. So ha-ben wir 1351746 oder 10649730 Gitterpunk-te je Lauf verwendet. Das radiale Viskosi-tätsprofil wurde aus der Festkörperphysik undaus dem seismischen Modell PREM hergelei-tet. Neu an diesem Profil ist eine hochvis-kose Übergangsschicht unter der herkömmli-chen Asthenosphäre, eine zweite niedrigvis-kose Schicht unter dem endothermen Phasen-übergang in 660 km Tiefe und ein beträcht-
Abbildung 1: Die Verteilung der Temperatu-ren (Schattierung) und der Geschwindigkei-ten des Festkörperkriechens (Pfeile) nach 4.49Ga in 134.8 km Tiefe für das Evolutionsmo-dell mit dem dimensionslosen Viskositätsni-veau rn=0. Das Modell enthält keine Konti-nente.
licher Viskositätsanstieg in den unteren 80 %des unteren Mantels.Abb. 1 u.a. zeigen, daß, obzwar das Stoff-gesetz newtonsch ist, sich bis in Tiefen vonetwas über 1350 km flächenhaft schmale Ab-ströme ergeben, die Subduktionsplatten äh-neln. An der Oberfläche treten wegen desStoffgesetzes erwartungsgemäß keine Plattenauf. Weil das Modell keinerlei chemische Dif-ferentiation enthält, gibt es auch keine Konti-nente an der Oberfläche. Die innere Heizungist zwar zeitlich abklingend, aber räumlich ho-mogen.Um von den speziellen Ergebnissen dieserHerleitung unabhängig zu werden, haben wirsowohl das Niveau des hergeleiteten radialenViskositätsprofils als auch seine Form syste-matisch variiert. Auch für einige andere phy-sikalische Größen wurde eine Variation derParameter durchgeführt, um die Folgen für
Abbildung 2: Die Beziehung zwischen derNusseltzahl Nu(2) und der Rayleighzahl Ra(2).Siehe Text.
136 Abstracts
Abbildung 3: Die Abhängigkeit des Logarith-mus der Rayleighzahl Ra vom dimensions-losen Viskositätsniveauparameter rn. HohleDreiecke stehen für ein Alter von 4000 Ma,schwarze Dreiecke für 2000 Ma, hohle Krei-se für 500 Ma und schwarze Kreise für 0 Ma,also für die Gegenwart.
Abbildung 4: Die Abhängigkeit der Nusselt-zahl Nu von rn. Zeichenerklärung siehe Abb.3.
die Strömungsmuster und den Konvektions-mechanismus zu untersuchen.Die Effekte der zwei Phasenübergänge in 410und 660 km Tiefe erweisen sich als kleiner alsdie Effekte einer starken Variation der Visko-sität als Funktion des Radius. Der Schwer-punkt der Arbeit liegt auf einer Variation di-mensionsloser Größen wie der RayleighzahlRa, der Nusseltzahl Nu, dem reziproken WertRor der Ureyzahl, des Viskositätsniveaus rn
usw. Wenn wir mit Nu(2) das zeitliche Mittelvon Nu eines Laufes über die letzten 2000 Mader Evolution bezeichnen und Ra(2) das ent-sprechende Mittel von Ra, so erhalten wir füreinen weiten ParameterbereichNu(2) = 0.120Ra0.295
(2) .Dieses Ergebnis (vgl. Abb. 2) ähnelt demvon parameterisierten Mantelmodellen, ob-wohl unser Modell näher an der Realität seindürfte. Für −0.5 ≤ rn ≤ +0.3, d.h. für einengroßen Rayleighzahlbereich (vgl. Abb. 3), er-weist sich folgende Erkenntnis als stabil: DieExistenz zweier Schichten niedriger Viskosi-tät innerhalb des Mantels verursacht Netzwer-ke von dünnen, flächenartigen Abströmungen,obgleich das Modell viskos ist.Für −0.3 ≤ rn ≤ +0.1 hängt die Nusseltzahlfür die letzten 3500 Ma der Mantelentwick-lung nur schwach von der Zeit ab (siehe z.B.Abb. 4). Das dürfte darauf zurückzufüh-ren sein, daß wir in diesem rein thermischenModell (zunächst) chemische Differentiationnicht zugelassen haben.
Webseite: http://www.uni-jena.de/chemie/geowiss/geodyn
Geodynamik und Gravimetrie 137
GD03 – Mo., 24.2., 11:40-12:00 Uhr · HS3Gottschaldt, K.-D., Walzer, U., Hendel, R. (FSU Jena), Baumgardner, J. (Los Alamos), Steg-man, D. (UC Berkeley)
Geochemische Heterogenitiät in 3D-kugelschaligen Modellen der Konvektion im Erd-mantelE-Mail: [email protected]
Durch Extraktion partieller Schmelze undEntgasung werden nahe der Erdoberflächegeochemische Heterogenitäten erzeugt undanschließend durch die Konvektion im Erd-mantel verrührt. Die Größen der beobach-teten Heterogenitäten reichen von zentime-tergroßen Strukturen in Hochtemperaturperi-dotiten (Allégre und Turcotte, 1986) bis zurerdumspannenden DUPAL-Anomalie (Hart,1984). Einblicke in das Mischungsverhaltensind wichtig für die Zusammenführung vongeochemischen und geophysikalischen Mo-dellen des Erdmantels.
In diesem Beitrag werden die Mischungsei-genschaften von Strömungsfeldern untersucht,die aus numerischen Berechnungen zur Erd-mantelkonvektion stammen. Wichtige Eigen-schaften der Felder sind Zeitabhängigkeit und3D-kugelschalige Geometrie. Allerdings sinddie Modelle auf newtonsche Rheologie be-schränkt. Die Viskosität ist radial und la-teral ortsabhängig, aus numerischen Grün-den aber nicht in voller Höhe. Die to-roidalen Strömungsanteile nahe der Oberflä-che bleiben –insbesondere aufgrund fehlenderLithosphärenplatten– geringer als beobachtet.
Die Erhaltungsgleichungen für Masse,Energie und Impuls in einem kompressiblenMedium wurden mit dem Programm TERRA(Baumgardner, 1983) auf Parallelrechnerngelöst. Die typische Gitterweite liegt bei100 km. Durch das Geschwindigkeitsfeldwerden passive Marker bewegt. Diese sindunterscheidbar und erlauben deshalb im Post-
processing mehrere Differenziationsmodellefür einen Konvektionslauf.
Anstelle der Modellierung einer Zweipha-senströmung wurde für die Differenzierungein anderer, stark vereinfachter Ansatz ge-wählt: Der Anteil des entgasten Mantels amgesamten Mantel ist ein Eingabeparameter desModells. Außerdem wurde davon ausgegan-gen, dass die stärksten Materialveränderungendurch Extraktion partieller Schmelze und Ent-gasung nahe der Erdoberfläche stattfinden. ImDifferenziationsmodell wird nun alles Mantel-material als verändert bzw. entgast gekenn-zeichnet, das durch die Konvektionsströmungjemals in die Nähe der Erdoberfläche transpor-tiert wurde. Die Entgasungstiefe wird dabei sogewählt, dass der Anteil des entgasten Man-tels am Ende der Rechnung den Beobachtun-gen entspricht.
Trotz aller Vereinfachungen und der Be-schränkung auf zwei Komponenten geben dieDifferenziationsmodelle Hinweise auf mög-liche räumliche Verteilungen geochemischerReservoire im Erdmantel. Abbildung 1 zeigtz.B., dass nach 4.49 Milliarden Jahren Kon-vektion noch größere zusammenhängende Be-reiche undifferenzierten Materials bestehenkönnen. Das entspricht den geochemischenBeobachtungen, wurde aber unseres Wissensbisher in noch keinem 3D-sphärischen Kon-vektionsmodell nachgewiesen.
Es werden Größen eingeführt, die denVermischungszustand des (berechneten)Erdmantels in Abhängigkeit vom Betrach-
138 Abstracts
Abbildung 1: Verteilung undifferenzierter Bereiche (hell) in einem Modell von Walzer, Hendel& Baumgardner (2002), wenn der Mantel zu 50 % aus differenziertem Material besteht
tungsmaßstab quantitativ beschreiben. Sieerlauben einen objektiven Vergleich verschie-dener Modelle.
Allégre,C.J.; Turcotte,D.L. (1986): Im-plications of a two–component marble–cakemantle. Nature, 323, 123–127.Baumgardner,J.R. (1983): A Three–Dimensional Finite Element Model forMantle Convection. Diss., Univ. Calif., LosAngeles, 271 pp.Hart, S.R. (1984): A large–scale isotopeanomaly in the Southern Hemisphere mantle.Nature, 309, 753–757.Walzer,U.; Hendel,R.; Baumgardner,J.R.(2002): The effects of a variation of the
radial viscosity profile on mantle evolution.Tectonophysics, submitted.
Webseite: http://www.uni-jena.de/chemie/geowiss/geodyn
Geodynamik und Gravimetrie 139
GD04 – Mo., 24.2., 12:00-12:20 Uhr · HS3Stein, C., Hansen, U. (Münster)
Plattenähnliche Strukturen in einem selbstkonsistenten MantelkonvektionsmodellE-Mail: [email protected]
Mit einem dreidimensionalen Mantelkon-vektionsmodell werden plattenähnliche Struk-turen untersucht, die in selbstkonsistenterWeise entstehen. Für die selbstkonsisten-te Entwicklung von Platten in thermisch ge-triebener Konvektion spielt die Rheologie ei-ne Schlüsselrolle. Während für die Tempe-raturabhängigkeit der Viskosität üblicherwei-se das Arrhenius-Gesetz Anwendung findet,ist die Spannungsabhängigkeit der Viskositätnicht eindeutig bekannt, denn in verschiede-nen Tiefen sind unterschiedliche Deformati-onsmechanismen von Bedeutung. Im vor-liegenden Modell werden daher verschiede-ne Spannungsabhängigkeiten untersucht. Dar-überhinaus werden im vorliegenden Modellverschiedene Tiefenabhängigkeiten und derEinfluss von interner Heizung berücksichtigt.Im Gegensatz zu anderen Modellen wird beider Betrachtung von Konvektion mit internerHeizung keine adiabatische Randbedingungfür den unteren Rand angenommen, sondernvielmehr eine Kombination aus interner undbasaler Heizung.
Bei der Verwendung einer komplexenRheologie zeigt sich, dass drei verschiede-ne Bereiche auftreten. Diese drei Endberei-che weisen jeweils ein Verhalten auf, das ver-gleichbar ist mit dem Verhalten von der Erde,von Venus bzw. von Mars. Das plattenähnli-che Verhalten der Erde tritt bei kleinen Grenz-spannungen auf, das episodische Verhalten derVenus bei mittleren Grenzspannungen und diefeste, immobile Oberfläche von Mars bei ho-hen Grenzspannungen. Der genaue Wert derGrenzspannung, bei der es zu einem Wechsel
des Endbereichs kommt, ist stark von der ge-wählten Rheologie abhängig.
Einige Phänomene, die vergleichbar mit derPlattentekonik der Erde sind, sind z.B. eineplattenähnliche Oberfläche (d.h. mit einheitli-cher Geschwindigkeit bewegte und kaum de-formierte Oberflächenbereiche) und die Mi-gration von Plattenrändern. Weiter bildetsich im Modell selbstkonsistent eine Zone mitniedriger Viskosität aus. Diese Zone trittim Zusammenspiel mit einer plattenähnlichenOberfläche auf. Ähnlich wie für Mars ange-nommen, zeigt sich das anfängliches platten-artiges Verhalten mit der Zeit abklingt, unddas System in dem Bereich mit fester Ober-fläche endet.
140 Abstracts
GD05 – Mo., 24.2., 12:20-12:40 Uhr · HS3Stemmer, K., Harder, H., Hansen, U. (Münster, Institut für Geophysik)
Mischprozesse in 3D sphärischen Konvektionsströmungen - Einfluß der Toroidalkompo-nenteE-Mail: [email protected]
Geochemische Isotopenanalysen von Man-telgestein, entnommen an mittelozeanischenRücken (MORB) und Vulkanen der Ozeanin-seln (OIB), deuten auf einen heterogenen Erd-mantel hin. Die Längenskalen diser Hetero-genitäten reichen von einigen tausend Kilo-metern, wie die Dupal Anomalie, bis hin zuwenigen Metern, beschränkt durch die Diffu-sion in geologischen Zeitspannen. Diese In-homogenitäten scheinen bis heute über einensehr langen Zeitraum im stark konvektieren-den Ermantel stabil zu sein. Die Stärke dergeochronologischen Datierung liegt in der ho-hen zeitlichen Auflösung, wo hingegen dieSchwäche die räumliche Zuordnung der be-probten Gesteine ist. SeismotomographischeUntersuchungen liefern dagegen Momentauf-nahmen der Struktur des Erdmantels, jedochdiese nur zu einem Zeitpunkt. Die Verbindungzwischen den Informationen aus Geochemieund seismischer Tomographie bildet das Ver-ständnis der Dynamik thermischer Konvekti-on. Welche Beschränkungen und Annahmenmuss nun ein Modell der thermischen Kon-vektion erfüllen, damit Heterogenitäten überlange Zeiträume in einer stark konvektieren-den Strömung überleben?In dieser Arbeit werden elementare Mi-schungseigenschaften thermischer Konvekti-on in einer Kugelschale mittels numerischerMethoden untersucht. Schon einfache sta-tionäre Konvektionsströmungen können kom-plexe Mischprozesse aufzeigen. Diese Mi-schungseigenschaften werden aus den Bewe-gungen von passiven Spurenstoffen abgelei-
tet. Die Trajektorien der sogenannten Tra-cer werden durch räumliche Interpolation derGeschwindigkeiten mittels kubischen Splinesund anschließender zeitlichen Integration miteinem Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung miteiner hohen räumlichen und zeitlichen Genau-igkeit bestimmt.Untersucht werden Mischungseigenschaftenstationärer Strömungen mit verschiedenenSymmetrieeigenschaften. Darüber hinauswird der Einfluß der toroidalen Geschwindig-keitskomponente auf die Vermischung ermit-telt. Jedes divergenzfreie Vektorfeld kann ineinen poloidalen und toroidalen Anteil zer-legt werden. Eine Kopplung zwischen dempoloidalen und toroidalen Skalarfeld kanndurch ganz verschiedene Gegebenheiten er-reicht werden. Dazu zählen mechanischeTrägheit (d.h. endliche Prandtlzahl), die Kip-pung der Gravitationsachse, eine tempera-turabhängige Viskosität oder durch speziel-le Randbedingungen wie Transformstörungen.Im Erdmantel entsteht eine toroidale Kompo-nente wegen der Platten an der Oberfläche unddurch die Temperaturabhängigkeit der Visko-sität. In diesen Experimenten wird ein toro-idaler Anteil durch eine endliche Prandtlzahlrealisiert. Sie beschreibt das Verhältnis vonkinematischer Viskosität zu thermischer Dif-fusivität und ist ein Maß für die Trägheit desSystems.Qualitative und quantitative Auswertungsver-fahren von Tracertrajektorien, wie Poincaré-Schnitte, finite Zeit Lyapunov Exponentenund die Boxcounting Methode, liefern Infor-
Geodynamik und Gravimetrie 141
mationen über die Struktur- und Musterbil-dung der Trajektorien, die Existenz und Häu-figkeit von Cross-Cell und Inner-Cell Mixing,die Unterscheidung von regulären und irregu-lären Bereichen der Strömung und das zeit-liche Dispersionsverhalten von Tracerwolken.Als wesentliches Ergebnis bleibt festzuhalten,dass die Existenz einer toroidalen Geschwin-digkeitskomponente die Effizienz der Vermi-schung auf kleinen Skalen steigert.
Webseite: http://earth.uni-muenster.de
142 Abstracts
GD06 – Mo., 24.2., 12:40-13:00 Uhr · HS3Loddoch, A., Hansen, U. (Münster)
Parallelisierung eines numerischen MantelkonvektionsmodellsE-Mail: [email protected]
In vielen Systemen, die in der Geophy-sik untersucht werden, stellt Konvektion einencharakteristischen Prozess dar. So weiß manheute beispielsweise, daß das Erdmagnetfelddurch thermisch getriebene Konvektionsströ-me im äußeren Erdkern erzeugt wird und daßauch die Dynamik der Erdoberfläche in en-gem Zusammenhang mit der des Erdmantelssteht. Die Untersuchung von Konvektionsvor-gängen ist somit für das geophysikalische Ver-ständnis dieser Systeme von grundlegen derWichtigkeit. Da die für das Erdinnere rele-vanten Materialparameter und Umgebungsbe-dingungen eine direkte Untersuchung mittelsLaborexperimenten nicht oder nur sehr einge-schränkt zulassen, stellt die numerische Unter-suchung, also das Computerexperiment, daswichtigste Werkzeug des Geodynamikers dar.
Extreme Parameterwerte und Abhängigkei-ten wie etwa die der Viskosität von der Tempe-ratur erschweren allerdings nicht nur den Zu-gang durch das Laborexperiment, auch an nu-merische Modelle und Verfahren werden da-durch hohe Anforderungen gestellt. Eine Ver-einfachung der betrachteten Modelle ist da-bei in der Regel jedoch nicht möglich – dieAnnahme der o.g. starken Temperaturabhän-gigkeit der Viskosität beispielsweise, ist fürdie Untersuchung von Mantelkonvektion undPlattentektonik unumgänglich. NumerischeKonvektionsexperimente haben daher einenRechenzeitbedarf, der im Bereich von mehre-ren Monaten liegt. Die einzige Möglichkeit,diesen Zeitraum entscheidend zu verkürzen,stellt die Nutzung von Parallelrechnern dar.
Die grundlegende Idee des parallelen Rech-
nens besteht in einer Aufteilung des numeri-schen Problems um eine gleichzeitige Bear-beitung durch mehrere Prozessoren zu ermög-lichen. Üblicherweise wird dabei eine räum-liche Aufteilung vorgenommen: Jeder Prozes-sor berechnet die gesuchten Größen wie Tem-peratur und Geschwindigkeit auf einem Teil-bereich des Grundgebietes. Um diese Paral-lelität zu ermöglichen, muß der zugrundelie-gende Algorithmus modifiziert werden. Da-bei ist zu beachten, daß einige Verfahren nichtoder nur bedingt parallelisierbar sind, so z.B.das Gauss-Seidel Iteration sverfahren. Die-se sind durch parallele Varianten zu erset-zen, im genannten Fall beispielsweise durchdas sog. Schachbrett-Gauss-Seidel Verfah-ren, das vollständig parallelisierbar ist. Dar-überhinaus entsteht durch die Parallelisierungdie Notwendigkeit des Datenaustausches zwi-schen den einzelnen beteiligten Prozessoren.Diese Kommunikation wird durch Bibliothe-ken wie dem Message Passing Interface (MPI)
Abbildung 1: Speedup des parallelisiertenProgramms. Dargestellt für Gittergrößen von128x128x32, 64x64x16 und 32x32x8 Punkten
Geodynamik und Gravimetrie 143
realisiert. MPI stellt dem Programmierer ei-ne Reihe von Routinen zur Verfügung, mit de-nen Daten explizit zwischen Prozessoren aus-getauscht werden können.
In der hier vorgestellten Arbeit wurdeein dreidimensionales Finite-Volumen Man-telkonvektionsmodell [1,2] mittels MPI par-allelisiert. Die dadurch erreichte Erhö-hung der Berechnungsgeschwindigkeit, Spee-dup genannt, ist in Abbildung 1 in Abhängig-keit von der Zahl der benutzten Prozessorenfür drei Modellgrößen dargestellt. Deutlichzu erkennen ist, daß die Effizienz der Paralle-lisierung mit zunehmender Problemgröße an-steigt. Die maximal erreichte Effizienz liegtbei über 50%, d.h. bei Benutzung von ledig-lich vier Prozessoren läßt sich die Rechenzeitum mehr als die Hälfte verkürzen. Angesichtsder Tatsache, daß Parallelrechner in Form vonCluster-Systemen auch im universitären Um-feld erschwinglich sind, stellt das paralle-le Rechnen ein entscheidendes Werkzeug zurgrundlegenden Erweiterung der Möglichkei-ten von numerischen Modellen dar.
(1) Trompert R., Hansen, U.: Mantle convec-tion simulations with rheologies that generateplate-like behaviour. Nature 1998; 195:686-689(2) Trompert R., Hansen, U.: The applicationof a finite volume multigrid method to three-dimensional flow problems in a highly viscousfluid with variable viscosity. Geophys. Astro-phys. Fluid. Dyn. 1996; 83:261-291
144 Abstracts
GD07 – Di., 25.2., 09:30-09:50 Uhr · HS3Müller, K., Schmeling, H. (Frankfurt)
Der Einfluß eines Spannungsfeldes auf die Kanalisierungsinstabilität in partiell ge-schmolzenen MantelbereichenE-Mail: [email protected]
EinleitungWir modellieren eine poröse deformierbareMatrix mit Schmelzeinschlüssen, auf welchewir ein gegebenes Spannungsfeld (EinfacheScherung bzw. Reine Scherung) einwirkenlassen.
Folgende Fragestellungen sollen durch die-se Experimente geklärt werden:
• Kann in einer Matrix mit einer zufäl-ligen Schmelzverteilung eine Kanalisie-rung auftreten?
• Wenn ja, wie werden diese Kanäle ausge-richtet sein?
• Unterstützt diese Ausrichtung einen ver-stärkten Schmelztransport zu einem mit-telozeanischen Rücken (MOR) hin?
• Gibt es Unterschiede in der Orientierungder Kanäle bei Einfacher Scherung oderReiner Scherung?
Der 2D-FD Code FDCON [1] löst die rele-vanten fluid-dynamischen Gleichungen. Der-zeit wird nur isotherm gerechnet, somit wer-den nur die Massenerhaltungs- und die Implu-serhaltungsgleichung, welche von McKenzie[2] aufgestellt wurden, gelöst. Weiterhin wirdin dem Code die Compaction Boussinesq Ap-proximation und ein spezielles Upwindverfah-ren verwendet. Die Lösung der relevantenGleichungen erfolgt durch einen Stromfunk-tionsansatz.
ErgebnisseDie Modellierungen mit Einfacher Scherungbzw. Reiner Scherung zeigen, daß sich bei ei-ner zufälligen Schmelzverteilung Kanäle aus-bilden, welche eine Orientierung parallel zurmaximalen kompressiven Hauptspannung auf-weisen.
Eine systematische Variation der drei be-schreibenden Parameter (Schmelz Retenti-on Zahl, Schmelz Rayleigh Zahl und derDehnungsrate) zeigt, daß der Prozeß derSchmelzakkumulation umgekehrt proportio-nal zur Schmelz Retention Zahl, weitestge-hend unabhängig von der Schmelz RayleighZahl und proportional zur Dehnungsrate ist.
Neuste Ergebnisse zeigen, daß die Wachs-tumsrate der Kanalisierungsinstabilität pro-portional der Wellenzahl einer Störung ist.
Weitere Studien sollen klären, welchen Ein-fluß ein kombiniertes Spannungsfeld aus Ein-facher Scherung und Reiner Scherung hat.
Referenzen1. H. Schmeling. Partial melting and melt se-gregation in a Convecting mantle. Physics andchemistry of partially molten rocks; N. Bag-dassarov and D. Laporte and A. B. Thompson,Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,141-178, 2000
2. D. McKenzie. The generation and com-paction of partially molten rock. Journal ofPetrology, 25:713-765, 1984
Geodynamik und Gravimetrie 145
GD08 – Di., 25.2., 09:50-10:10 Uhr · HS3Kühn, D., Dahm, T. (Universität Hamburg)
Simulation des Magmaaufstiegs im Mantel unter mittelozeanischen RückenE-Mail: [email protected]
MotivationBei der Bildung ozeanischer Kruste an mittel-ozeanischen Rücken steigt Material aus demtieferen Mantel auf, wobei durch adiaba-tische Dekompression partielle Schmelzenentstehen. Da die Schmelzzone mehre-re hundert Kilometer breit ist, während dieSchmelzaustrittszone an der Rückenachse nureine Ausdehnung von wenigen Kilometernaufweist, wird ein Mechanismus zur Fokus-sierung der Schmelzen von der Schmelzzonezur Rückenachse gefordert. Weiterhin ist dieArt der Schmelzfortbewegung ungeklärt undder genaue Ort der Schmelzentstehung um-stritten. Es existieren verschiedene Modelle:[1] schlagen einen Schmelzfluß in den Poreneiner viskosen Matrix vor, die ihrerseits demcorner flow unterliegt. Die Schmelze soll da-bei Darcys Fließgesetz gehorchen und demDruckgradienten folgen, der der Deformati-on der viskosen Matrix entspringt. [2] spre-chen sich nach einer Untersuchung des Oman-Ophioliths gegen einen porösen Fluß aus,da durch die lange Kontaktzeit der Schmel-zen mit dem umgebenden Mantelgestein dieMORB-Zusammensetzung nicht erreicht wer-den könne. Zur Isolierung der Schmelzevon ihrer Umgebung wird ein Schmelzfluß inDunitröhren angeregt. Die Schmelzextrakti-on aus dem Mantel durch den Transport vonMagma in fluidgefüllten Rissen wurde mehr-fach vorgeschlagen (siehe z. B. [3]), ist bisheraber nicht numerisch modelliert worden.Das verwendete ModellDas Modell beruht auf dem Wachstum und derquasistatischen Propagation von fluidgefüll-
ten Rissen in elastischem Gestein, das eineminhomogenen und deviatorischen Spannungs-feld unterliegt. Pro Iteration ist eine Rißöff-nung, eine -schließung oder ein Konstantblei-ben der Rißlänge möglich. Je nach vorgege-benem Spannungsfeld ist so eine Fortbewe-gung des gesamten Risses durch den konti-nuierlichen Prozeß des Öffnens von Segmen-ten der Rißspitze und Schließens von Segmen-ten am Rißende realisierbar. Das im Riß vor-handene endliche Fluidvolumen, das auf einsich änderndes Rißvolumen mit Kompressi-on und Extension reagiert, wird berücksich-tigt. Das verwendete Programm geht auf [4]zurück und beruht auf der Randelementme-thode. Spannungs- und Druckgradienten ent-stehen durch die Annahme eines corner flowals fluiddynamisches Modell für die Konvek-tion unterhalb mittelozeanischer Rücken. DieFlußstärke beruht auf dem Produkt aus Ge-schwindigkeit der divergierenden Platten undViskosität des strömenden Materials.Ergebnisse und DiskussionDie Aufstiegspfade der fluidgefüllten Rissewerden im wesentlichen durch drei Fakto-ren bestimmt. Durch die Fluidbewegung ent-steht zum einen ein sog. dynamischer Druck,zum anderen ein deviatorisches Spannungs-feld. Der dynamische Druck für sich genom-men weist ein Minimum an der Oberfläche desmittelozeanischen Rückens auf und besitzt soeine Sogwirkung in Richtung des mittelozea-nischen Rückens, da sich die Risse stets inRichtung abnehmenden Drucks fortbewegen.Die Aufstiegspfade der fluidgefüllten Rissegleichen so den Flußlinien porösen Flusses.
146 Abstracts
Das deviatorische Spannungsfeld bewirkt hin-gegen eine Rißpropagation entlang der Trajek-torien maximaler Kompression, die nicht aufden Rücken fokussiert sind, sondern in größe-ren Tiefen sogar eine Ablenkung nach außenhervorrufen. Zusätzlich liegt eine scheinba-re Auftriebskraft durch den Dichteunterschiedzwischen Magma und umgebendem Gesteinsowie aufgrund des lithostatischen Gradientenvor. Je höher diese Auftriebskraft ist, destoeher folgt der Aufstiegspfad einer Senkrech-ten. Die Addition dieser drei Effekte leistetjedoch keine Fokussierung der Aufstiegspfadefluidgefüllter Risse auf den mittelozeanischenRücken. Möglichkeiten zur Verbesserung desModells werden diskutiert.DanksagungDas Projekt ist Teil des DFG-Bündel-Projekts„Hotspot-Ridge Interaction: Crust Formationand Plate Divergence in and around Iceland“und wird von der DFG gefördert.Literatur
[1] M. Spiegelman und D. P. McKenzie,Simple 2-D models for melt extraction at mid-ocean ridges and island arcs, Earth Plan. Sci.Let. 83, 137-152, 1987
[2] P. B. Kelemen, N. Shimizu und V. J. M.Salters, Extraction of mid-ocean-ridge basaltfrom the upwelling mantle by focused flow ofmelt in dunite channels, Nature 395, 747-753,1995
[3] N. H. Sleep, Tapping of melt by veinsand dikes, J. Geophys. Res. 93, 10255-10272,1988
[4] T. Dahm, Numerical simulations of thepropagation path and the arrest of fluid-filledfractures in the earth, Geophys. J. Int. 141,623-638, 2000
Geodynamik und Gravimetrie 147
GD09 – Di., 25.2., 10:10-10:30 Uhr · HS3Jacoby, W. (Mainz)
Lava Cooling Features, Observed in Iceland and Modeled in the KitchenE-Mail: [email protected]
A poorly known feature of lava cooling are’steam chimneys’ in flows over wet ground.They are visible as round holes in the sur-face, e.g., when a river has cleared it of anyloose material. Many cases are beautifullydocumented near Selfoss, Iceland. An ex-ceptionally good example is a vertical sec-tion in a lava cliff near Dettifoss. The chim-neys are trumpet-shaped, opening up towardthe free lava surface. Their walls are striated’upward’ indicating material extruded throughthem. Frequently the striae are traversed bysets of sub-horizontal cracks. Their edges atthe surface are dragged up.Very similar sur-face features can be generated in a ’kitchen ex-periment’ by shearing the surface of a powder(e.g. flour) or plastic material (e.g. dough).The most important property is low cohesionor small tensional strength. Stress analysispredicts that the cracks dip into the material inthe direction of surface shear (flow) and thatthe crack edges are dragged by it. The pre-dictions are borne out by the field observa-tions and experimental results. Scaling lawsare considered, and material properties are dis-cussed. An essential point of the observationsis the state of the cooling lava during steamventing and the constraints this places on theprocesses of cooling and subjacent-water heat-ing. There may be only a short time windowfor the lava to behave as a plastic material. Thephenomenon is compared to related features,some as well known as pseudocraters, hornitosand tunnels. Rarer occurrences are lava foun-tains, chimney towers and multi-storey struc-tures when lava is drained episodically. In-
deed, most of these phenomena are related,e.g. steam vents will generally create pseu-docraters.
148 Abstracts
GD10 – Mi., 26.2., 09:30-09:50 Uhr · HS3Jacoby, W. (Mainz), Fedorova, T. (Oberwesel), Wallner, H. (Mainz)
Iceland crust: what do seismic, gravity and topography data tell?E-Mail: [email protected]
In view of the ”thin-thick crust” debate,the increasing data set relevant to this ques-tion is analysed for interrelationships. Icelandis compared with the adjacent North Atlanticfeatures, and internal tectonic ”provinces”are also distinguished. The statistical anal-ysis includes published age, elevation andbathymetry, Bouguer and Free Air anoma-lies, seismic refraction models, receiver func-tion results and tomography, particularly ve-locities vp, vs and depths of interfaces as the”Moho”; sediment thickness, heat flow andelectical conductivity are taken into account.How deep are the sources of the ”Icelandanomalies”, in the mantle and/or the crust?The Iceland plume hypothesis is most plau-sible, but the depth extent and source regionare controversial, and some prefer alternatives.At least three components contribute to theprominence of Iceland: (1) spreading of theMAR, (2) uplift by deep, anomalously hot,light mantle of the Iceland plume and (3) pro-duction of a thick basaltic crust by enhancedmelting, also a plume effect, generating theIceland Plateau and thickening the ocean crusttowards Iceland. Spreading and plume flowgenerate ”dynamic topography” usually takenas deviation from isostasy. One principal re-sult is that the density contrast between what istermed ”lower crust” and ”uppermost mantle”is only about 100 kg/m3, and the nature of the”reflector Moho” is distinct from continentalor oceanic Moho. Under central Iceland ( 100km radius) a transient evolutionary state pre-vails. In the whole region of Iceland youngerthan 7 Ma the lower crust and upper man-
tle relations, though evolving, maintain theirdensity relationships. Other regions have dif-ferent characteristics with no correlation be-tween thickness and topography and/or grav-ity indicating seismically unrecognized inter-nal structures and very different histories (con-tinental fragments?). The spreading history inIceland must be revised.
Geodynamik und Gravimetrie 149
GD11 – Mi., 26.2., 09:50-10:10 Uhr · HS3IsmailZadeh, A. (Geophysikalisches Institut, Universität Karlsruhe), Korotkii, A., Tsepelev, I.(Institute of Mathemaitcs and Mechanics, Ural Branch, Russian Academy of Sciences)
On an Inverse Problem of Thermal ConvectionE-Mail: [email protected]
Modern seismic tomography images of theEarth’s interior allow the complex trajecto-ries of present-day convective flow to be seenat least in the upper mantle. To reconstructquantitatively both the observed mantle struc-ture and temperature field backwards in time,we need a numerical tool for solving an in-verse problem of thermal convection at in-finite Prandtl number. We develop a varia-tional approach to three-dimensional numer-ical restoration of thermoconvective mantleflow. The approach is based on a search forthe mantle temperature and flow in the geolog-ical past by minimizing differences betweenmantle temperature derived from seismic ve-locities (or their anomalies) and temperaturepredicted by forward models of mantle flow.The mantle temperatures and flow fields in thepast so obtained could be employed as con-straints on forward models of mantle dynam-ics. To demonstrate an applicability of thistechnique, we restore numerically a model ofthermal plume generated at the boundary be-tween the lower and upper mantle and showthat unknown initial shape of the plume canbe reconstruct accurately.
150 Abstracts
GD12 – Mi., 26.2., 10:10-10:30 Uhr · HS3Mihalffy, P., Schmeling, H. (Frankfurt am Main), Steinberger, B. (Yokosuka, Japan)
The influence of the large-scale mantle flow field on the interaction of mid-Atlantic ridgeand the Iceland plumeE-Mail: [email protected]
The dynamics and structure of the Icelandplume was studied by using a fluid dynam-ical model. In order to consider the influ-ence of the large-scale mantle flow field onthe plume, a two-fold modelling approach wasused. First, a global and robust model of thelarge-scale mantle flow field was calculated. Itwas followed by a regional model study con-taining the plume. The coupling of the twomodels was achieved by applying mechanicalboundary conditions in the regional model, de-rived from the global model. This resulted ina "more realistic"model configuration contain-ing the effect of the global mantle flow, as wellas detailed ridge geometry, as boundary condi-tions. The global mantle flow field in the up-per mantle has a strong northward componentat the Iceland region. In the regional modelwe observe a northward tilt of the plume as itis observed from recent seismic tomographyresults. Plume material is drifted partly west-ward in spreading direction and partly north-ward along the ridge.
Web page: http://www.geophysik.uni-frankfurt.de
Geodynamik und Gravimetrie 151
GD13 – Mi., 26.2., 11:00-11:20 Uhr · HS3Weber, M. (GeoForschungsZentrum Potsdam)
Structure and dynamics of the Dead Sea Transform in the Middle EastE-Mail: [email protected]
Despite numerous efforts to study largetransform systems, especially at the San An-dreas Fault (SAF) system, the processes re-sponsible for large continental-scale shearzones, one of the key elements of plate tec-tonics, and their relation and interaction withthe crust and upper mantle are still not fullyunderstood. The Dead Sea Transform (DST),at the border between Israel and Jordan, hasfor a long time been considered a prime site toexamine large shear zones, but due to the polit-ical situation in this area no geoscientific pro-file has crossed the DST. Moreover, studies ofhistorical earthquakes of the past few thousandyears, paleoseismic studies and instrumentalearthquake studies demonstrate that a numberof damaging earthquakes have occurred alongthe DST. The DST therefore poses a consider-able seismic hazard to Israel, Jordan, and thePalestine Authority.
A geophysical profile crossing the DST,the boundary between the African and Ara-bian plates in the Middle East, and the bor-der between Israel and Jordan, has been com-pleted for the first time. High-resolution seis-mic tomography and magnetotelluric sound-ing of the shallow crust show drastic lateralchanges in material properties within a nar-row zone around the DST. The seismic base-ment is offset by 3-5 km under the DST,and strong lower-crustal reflectors are imagedeast of the DST. The seismic velocity sectionsshow a steady increase in the depth of thecrust-mantle transition (Moho) from 26 km atthe Mediterranean to 38-39 km under the Jor-dan highlands, but only small topography of
the Moho under the DST. These observationscan be linked to the left-lateral movement ofthe two plates of 105 km in the last 17 Maaccompanied by strong deformation within a20-30 km wide zone cutting through the en-tire crust. Sub-horizontal lower-crustal reflec-tors and deep reaching deformation zones oc-cur in the DST (originating in a relatively ho-mogeneous cold and stable lithosphere; slowrelative plate motion of ca 0.5 cm) and also inthe San Andreas Fault system (originating ina strongly heterogeneous, hot lithosphere; fastrelative plate motion of ca. 3.5 cm). The factthat lower-crustal reflectors and deep defor-mation zones are observed in transform sys-tems of such different origin could suggestthat these structures are fundamental featuresof large transform plate boundaries.
Web page: http://www.gfz-potsdam.de/pb2/pb22/
152 Abstracts
GD14 – Mi., 26.2., 11:20-11:40 Uhr · HS3Ott, N. (FU Berlin)
Synoptische Modellierung geowissenschaftlicher Daten am Beispiel der Red Sea Hills-SudanE-Mail: [email protected]
Synoptische Modellierung geowissen-schaftlicher Daten am Beispiel der Red SeaHills - Sudan
Norbert OttDer Einsatz von Geoinformationssystemen
und digitalen Bildverarbeitungstechniken inden Geowissenschaften ermöglicht die Inte-gration verschiedener thematischer Daten undInformationen. Die Verknüpfung von Fer-nerkundungsdaten des Erdbeobachtungssatel-liten Landsat mit geophysikalischen Potenti-alfelddaten der Gravimetrie und Aeromagne-tik sowie die Einbindung der Geologie undStrukturgeologie sind die Grundlage für diesynoptische Datenmodellierung, besonders inschwer zugänglichen Gebieten. Ein ganz ent-scheidender Aspekt ist die mögliche Korrela-tion von spektralen Oberflächendaten der Sa-tellitensensoren mit Tiefeninformationen dergeophysikalischen Potentialfelddaten am Bei-spiel der Red Sea Hills im Sudan an der Gren-ze zu Eritrea.
Die Red Sea Hills erstrecken sich vonÄgypten über den Sudan bis nach Eritrea undverlaufen entlang des Roten Meeres. Sie sindTeil des Präkambrischen Arabisch-NubischenSchildes. Die Gesteinsassoziationen beinhal-ten zum großen Teil Vulkanite mit einge-schalteten Sedimenten. In diese metavulkano-sedimentären Serien sind eine große Anzahlvon Plutoniten unterschiedlichen Alters intru-diert. Ophiolitische Sequenzen liegen mehroder weniger vollständig vor und sind bedeu-tende Indikatoren für Suturen und Reste ozea-nischer Kruste. Radiometrische Altersange-
ben liegen bei 900-550 Ma.Durch die Kombination digitaler Klassi-
fizierungsmethoden nach den Prinzipien derMustererkennung mit Ergebnissen visuellergeologischer und strukturgeologischer Inter-pretationen können die jeweiligen Vorteilebeider Ansätze in die weiteren Untersuchungen einfließen. Die weitere Verarbeitung ineiner GIS- und Bildverarbeitungsumgebungermöglicht umfangreiche Abfragen. Dabeikommt eine Vielzahl an Operationen zum Ein-satz, um die verschiedenen Daten optimal fürdie rechnerische und logische Verknüpfungaufzubereiten. Hier sollen zwei Anwendun-gen exemplarisch vorgestellt wer den.
1. Evaluierung der Klassifizierungser-gebnisse lithologischer Einheiten Durch dieKorrelation geologischer Gesteinseinheitenmit gravimetrischen Residuen konnte derHamaret-Intrusivkomplex, der bislang als reingranitische Intrusion galt, als Ringkomlex mitbimodalem Gesteinscharakter aus Gabbro imzentralen Bereich und randlichem Granit be-schrieben werden. Dies bestätigt die Ergebnis-se einer digitalen überwachten Klassifizierungvon Fernerkundungsdaten für diese Intrusion.
2. Lokalisierung potentieller Minerali-sationen Neben Untersuchungen großräumi-ger geologischer Strukturen ist die Bearbei-tung lokaler Phänomene ebenso wichtig wieschwierig. Die Korrelation von berechnetenZiel gebieten aus Satellitenbilddaten mit wei-teren Indikatoren wie Störungen, Mutterge-stein und Potentialfeldanomalien führt zu ei-ner Anzahl unbekannter Mineralisationen, von
Geodynamik und Gravimetrie 153
Abbildung 1: Perspektivisches Geländemodell des Tehilla-Ringkomplexes in den südlichenRed Sea Hills mit überlagerten Landsat-TM Daten und gravimetrischen Residuen zur verbes-serten Darstellung geologischer Strukturen und geophysikalischer Anomalien.
denen einige jetzt als polymetallische Sulfi-derzelagerstätten abgebaut werden, wie diezwei Lagerstätten des Jebal Mugrar zum Bei-spiel.
Da komplexe Fragen heute nicht mehr voneinem Wissenschaftler alleine bearbeitet wer-den, kann eine verbesserte Visualisierung geo-wissenschaftlicher Daten zu Synergieeffek-ten bei der interdisziplinären Teamarbeit füh-ren. Dies soll am Beispiel des Tehilla-Ringkomplexes in den südlichen Red SeaHills gezeigt werden. Ein perspektivischesModell mit überlagerten Satellitenbilddatendes Landsat-TM gibt sowohl das topographi-sche Relief als auch die lithologischen Einhei-ten aufgrund der spektralen Reflexionswertewieder. Die zusätzliche Einbindung gravime-trischer Residuen als farbkodierte Isanomalenverbindet Oberflächeninformationen mit Tie-feninformationen und weist für die gabbroideIntrusion eine positive Residualanomalie vonbis zu 30 mGal auf.
154 Abstracts
GD15 – Mi., 26.2., 11:40-12:00 Uhr · HS3Meier, T., Harjes, H.-P. (Bochum)
Unterschiede zwischen dem westlichen und östlichen Forearc der Hellenischen Subduk-tionszoneE-Mail: [email protected]
Die Hellenische Subduktionszone wirddurch die Ägäisch-Anatolische Platte und dieAfrikanische Platte gebildet. Vor ca. 20 Masetzte die Subduktion der afrikanischen ozea-nischen Lithosphäre ein. Aufgrund der Annä-herung von Afrika und Eurasien, der Rotationund Extension der Ägäisch-Anatolischen Plat-te läßt sich abschätzen, daß maximal ca. 650km ozeanische Lithosphäre südlich von Kre-ta subduziert worden sind. Seismische undseismologische Untersuchungen erlauben es,ein Strukturmodell des Forearcs der Helleni-schen Subduktionszone für die oberen ca. 100km entlang von NE-SW gerichteten Profilenaufzustellen. Dabei zeigen sich Unterschie-de zwischen dem östlichen und dem westli-chen Teil der Hellenischen Subduktionszone.Diese betreffen den Abtauchwinkel der Afri-kanischen Lithosphäre, die Tiefe des Slabs un-terhalb des Hellenische Bogens und die süd-liche Erstreckung der Ägäisch-AnatolischenPlatte. Die Seismizität in globalen Katalogenzeigt ebenfalls deutliche laterale Unterschie-de bzgl. der Tiefenverteilung mitteltiefer Be-ben. Zusätzlich werden seismisch aktive NE-SW verlaufende Störungen innerhalb des Fo-rearcs abgebildet. Entlang einer NE-SW Stö-rung durch Zentralkreta ändert sich die mit lo-kalen temporären Netzen beobachtete flacheSeismizität der Hellenischen Subduktionszo-ne. Unterschiede in der Struktur und Seismi-zität parallel zum Hellenischen Bogen werdenin Beziehung gesetzt zu lateralen Änderun-gen der horizontalen Deformationsgeschwin-digkeiten innerhalb der Ägäisch-Anatolischen
Platte. Untersuchungen mittels Oberflächen-wellen ergeben, daß die afrikanische ozeani-sche Lithosphäre fast vollständig subduziertist. Eine tektonische Reorganisation inner-halb des Forearcs der Hellenischen Subduk-tionszone vor ca. 3 Ma markiert möglicher-weise den Beginn der Kollision der Ägäisch-Anatolischen Platte mit dem passiven Konti-nentalrand Nordafrikas. Die beginnende Kol-lision ist u.a. mit tektonischen Hebungen aufKreta und Extension parallel zu dem Helleni-schen Bogen verbunden. Unterschiede in EW-Richtung weisen auf stärkere NE-SW Extensi-on der Ägäisch-Anatolischen Platte und weiterfortgeschrittene Kollision im westlichen Teilder Hellenischen Subduktionszone hin.
Geodynamik und Gravimetrie 155
GD16 – Mi., 26.2., 12:00-12:20 Uhr · HS3Fischer, K. D. (Bochum)
Numerische Modelle zur Untersuchung einer konvergenten PlattengrenzeE-Mail: [email protected]
Das regionale Spannungs- und Deformati-onsfeld im Umfeld eines konvergenten Plat-tenrandes wird durch eine Vielzahl an Pa-rametern kontrolliert. Neben der geologi-schen Struktur der Platten spielt dabei u. a.die Temperatur, die Rheologie, die geometri-schen Randbedingungen und das überregio-nale Spannungsfeld eine entscheidende Rolle.Der Einfluss einzelner Parameter kann durchnumerische Modellierungen quantifiziert wer-den.
Am Beispiel der Hellenischen Subduktions-zone soll durch numerische Experimente mitder Methode der finiten Elemente der Einflussder zugrunde liegenden Rheologie und der Ge-schwindigkeiten der Platten bzw. des abtau-chenden Slabs auf das regionale Spannungs-und Deformationsfeld untersucht werden. Da-zu wird das berechnete Spannungsfeld mit derSeismizität und die berechnete Deformationmit beobachteten Hebungsraten sowie geodä-tischen Plattengeschwindigkeiten verglichen.
Der Einfluss der genannten Parameter wirdzunächst anhand eines zweidimensionalen(2D) Modells entlang eines Südwest-Nordost-Profils untersucht. Die Struktur entlang desProfils wurde seismologischen und gravime-trischen Unterlagen entnommen. Variatio-nen einzelner Randbedingungen und der Ma-terialeigenschaften bei gegebener Geometriebeeinflussen die zeitliche Entwicklung desSpannungs- und Deformationsfeldes. Ein Ver-gleich der unterschiedlichen Ergebnisse hilft,die bestimmenden Parameter zu identifizierenund deren Einfluss zu quantifizieren.
Erste Ergebnisse zeigen, dass es sowohl
in der Unterplatte als auch der Oberplatteunter geeigneten Bedingungen zur Extensionkommt. Diese Bedingungen liegen vor, wenndie Konvergenzgeschwindigkeit der Plattenim Vergleich zur Abtauchgeschwindigkeit desSlabs klein ist. Des weiteren können einzelneBereiche, in dennen sich Spannungen aufbau-en, mit seismisch aktiven Bereichen korreliertwerden.Webseite: http://www.geophysik.ruhr-uni-bochum.de
156 Abstracts
GD17 – Mi., 26.2., 12:20-12:40 Uhr · HS3Heinbockel, R., Dehghani, G. A. (Universität Hamburg)
Gravimetrische und Magnetische Modellierung des Peruanischen KontinentalrandesE-Mail: [email protected]
Zwischen 7.25°S und 16.75°S zeigen erst-mals drei-dimensionale gravimetrische undmagnetische Modelle die Krustenstruktur deskonvergenten Plattenrandes. Die kombinier-ten gravimetrischen und magnetischen Mo-delle basieren auf den Geschwindigkeitsmo-dellen der Weitwinkelseismik (Hampel et al.,2002; Broser et al., 2002). In dem Yaqui-na Gebiet (7.25°S - 11°S) werden der Tru-jillo Graben und die Mendaña Störungszo-ne mit starken Undulationen in der Mächtig-keit der ozeanischen Kruste modelliert. DerKontinentalrand zeigt besondere Merkmale inder Lima Gegend (10.50°S - 14.40°S). Diegebogenen Schichten der kontinentale Krus-te beeinflussen die oberen Sedimentschich-ten und unterstützen die Entwicklung von Be-cken entlang des peruanischen Kontinental-randes. Die verdickte und leicht asymmetri-sche Kruste des Nazca Rückens wird in demdrei-dimensionalen Modell deutlich. In demNazca Rücken Gebiet (14.25°S - 16.75°S) istes sehr wahrscheinlich, dass erodierte Sedi-menten subduziert werden. Es ist anzuneh-men, dass die Schicht 2A erodierte Sedimentebeinhaltet, die in lokalen Depressionen einge-schlossen sind. Die Theorie, dass der perua-nische Kontinentalrande durch die Subduktiondes Nazca Rückens angehoben wird (Kulm etal., 1988; Hagen & Moberly, 1994), bestätigtsich in der gravimetrischen und magnetischenModellierung. Der subduzierende, Auftriebverursachende Nazca Rücken ist verantwort-lich für eine ausgedehnte Zone flacher Sub-duktion. Die zunehmenden Dichten, die fürdie Schichten der bereits subduzierten ozeani-
schen Kruste modelliert wurden, sind ein Zei-chen für eine ursprünglich hohe Porosität. Indem Nazca Rücken Gebiet wird kein Akkreti-onskomplex modelliert. Dies ist ein Zeichendafür, dass der Rücken den Kontinentalranderodiert. Weiter nördlich im Lima Gebiet istein relativ einheitlicher Akkretionskomplex zubeobachten. In dem Yaquina Gebiet wird zwarin der ganzen Region ein Akkretionskomplexmodelliert, dieser weist aber deutliche lokaleVariationen in seiner Lage und Struktur auf.Da hier der Nazca Rücken nicht subduzierte(Hampel, 2002) müssen andere Strukturen aufder abtauchenden, ozeanischen Nazca Platteden Kontinentalrand beeinflusst haben.
Entlang des peruanischen Kontinentalran-des können mehrere magnetische Lineationenkorreliert werden. Die in etwa parallelen Li-neationen 13 bis 18 können von dem südli-chen Teil des Untersuchungsgebietes bis zuder Mendaža Störungszone verfolgt werdenund zeigen, dass die Konvergenzrate der Naz-ca Platte zwischen 12°S und 17.5°S sich inden letzten 33 Ma nicht wesentlich geänderthat. Die variabelsten magnetischen Anoma-lien werden in dem Yaquina Gebiet beobach-tet. Südlich der Störungszone reicht die ma-gnetische Lineation 18 bis in das Yaquina Ge-biet hinein. In der drei-dimensionalen Mo-dellierung ist die Mendaža Störungszone alsdas Gebiet erkennbar, in dem die geringsteÜbereinstimmung zwischen den modelliertenund den beobachteten magnetischen Anomali-en erreicht wird. In dem Nazca Rücken Gebietkönnen die erwarteten magnetischen Lineatio-nen 19 und 20 in der drei-dimensionalen Mo-
Geodynamik und Gravimetrie 157
dellierung nicht reproduziert werden. Die An-omalien verlaufen mit einem Winkel von et-wa 30° zu der Orientierung der zu erwartendenLineationen. Dieses Muster ist wahrscheinlichbei der Bildung des Nazca Rückens am Oster-insel Hotspot entstanden. Der Nazca Rückenformte sich auf der bereits bestehenden NazcaPlatte und überprägte die ursprünlichen ma-gnetischen Anomalien. In allen Modellen istdie basaltische Schicht Sheeted Dykes bedeu-tend schwächer magnetisiert als die oberenPillow Lavas und die unteren Gabbros. DieMagnetisierung der oberen Sedimentschicht,die sowohl die ozeanische Kruste, als auch denKontinentalrand bedeckt, ist nicht zu vernach-lässigen. Das Verhältnis von remanenter zu in-duzierter Magnetisierung, d.h. die KönigsbergRatio, ist klein für alle Schichten der ozeani-schen Kruste.
Broser, A., Bialas, J., Hampel, A., Kukow-ski, N.; 2002: Subduction Processes Along thePeruvian Margin From Wide Angle SeismicData, EGS, XXVII General Assembly, Nice,France
Hampel, A.; 2002: The migration historyof the Nazca Ridge along the Peruvian activemargin: a re-evaluation, Earth and PlanetaryScience Letters 203, pp. 665-679
Hampel, A., Kukowski, N., Bialas, J.; 2002:Effects of the Oblique Subduction of the Naz-ca Ridge on the Peruvian Convergent Margin:Insights from Bathymetric and Wide-AngleSeismic Data, in: Bialas, J., Kukowski, N.,GEOPECO-Arbeitsgruppe, GEOPECO, Zwi-schenbericht 2001
Hagen, R. A., Moberly, R.; 1994: Tecto-nic Effects of a Subducting Aseismic Ridge:The Subduction of the Nazca Ridge at the PeruTrench, Marine Geophysical Researches 16,pp. 145-161
Kulm, L. D., Thornburg, T. M., Suess, E.,Resig, J., Fryer, P.; 1988: Clastic, diagenetic,
and metamorphic lithologies of a subsidingcontinental block: central Peru forearc, in: E.Suess, R. von Huene (eds.): Proc. Ocean Dril-ling Program (ODP), Init. Reports 112, Colle-ge Station, TX, pp. 91-10
Webseite: http://www.geophysics.dkrz.de
158 Abstracts
GD18 – Mi., 26.2., 12:40-13:00 Uhr · HS3Weinrebe, W., Ranero, C. (GEOMAR, Kiel), Masson, D. (SOC, Southampton, UK), Huguen,C., Klaucke, I., Sahling, H. (GEOMAR, Kiel), Hühnerbach, V. (SOC, Southampton, UK), Flüh,E. R., Bohrmann, G. (GEOMAR, Kiel)
Mehrskalige Kartierung des konvergenten Kontinentalrandes vor Costa Rica - erste Er-gebnisse der Fahrt SO163 mit FS SONNEE-Mail: [email protected]
Die Fahrt SO163 war die erste Expediti-on im Rahmen des Sonderforschungsberei-ches 574 VOLATILE UND FLUIDE IN SUB-DUKTIONSZONEN in das Gebiet der Sub-duktionszone vor der Pazifik-Küste Costa Ri-cas. Schwerpunkt dieser Fahrt waren umfas-sende Kartierungen des Untersuchungsgebie-tes, um eine grundlegende Datenbasis für dieweiteren Arbeiten zu schaffen.
Hauptziel der oberflächennahen Kartie-
Abbildung 1: Bathymetrische Karte eines Ge-bietes westlich der Nicoya-Halbinsel mit auf-fälligen Mounds, aufgenommen mit dem Sim-rad EM-120 Fächerecholot (12 kHz) von FSSONNE.
rungsarbeiten war die Erfassung von Prozes-sen, die direkt den Meeresboden beeinflus-sen und verändern, wie Sediment-Ablagerung,Erosion, Hangrutschungen sowie Manifesta-tionen von Fluid- und Gas-Austritten. Umdiese Auswirkungen zu erfassen, wurde einmehrskaliger Ansatz mit Kartierungssystemenmit unterschiedlicher Auflösung gewählt. Fürdie Übersichtsvermessung wurde neben derBathymetrie mit dem schiffseigenen Fäche-recholot Simrad EM 120 (Abb. 1) das TOBI-System der beteiligten britischen Kollegen ausSouthampton (Abb. 2) eingesetzt. Zusam-men mit den Vermessungen, die auf der FahrtSO-144 im Jahre 1999 mit dem TOBI-Systemdurchgeführt wurden, sind damit wesentli-che Bereiche des gesamten Kontinentalrandesvom Nordwesten Costa Ricas vor der San-ta Elena Halbinsel bis zum Cocos-Rücken imSüdosten mit einer Auflösung im Bereich voneinigen Metern erfaßt worden. Zur Erreichungnoch höherer Auflösung wurde in vier Schlüs-selgebieten das neue Sidescan-Sonar DTS-1 (Abb. 3) vom GEOMAR eingesetzt, mitdem eine Auflösung im Dezimeter-Bereich er-reicht werden kann. Zur Verifizierung die-ser Aufzeichnungen wurden mit dem tief-geschleppten Video-Schlitten OFOS an 25Stellen detaillierte optische/visuelle Beobach-tungen durchgeführt sowie an 9 PositionenProben mit dem TV-Greifer genommen.
Die systematischen Kartierungen zeigen ei-ne Vielzahl kleiner, runder Strukturen von ei-
Geodynamik und Gravimetrie 159
Abbildung 2: Sidescan-Sonar Vermessungvom selben Gebiet wie in Abb. 1, aufgenom-men mit dem TOBI System (30 kHz) vomSouthampton Oceanography Centre.
nigen hundert Metern Durchmesser, die in derBathymetrie als Hügel und in den Sidescan-Sonar-Aufnahmen als Gebiete mit höhererRückstreuung (Abb. 2) erkennbar sind. TV-Schlitten-Einsätze sowie gezielte Beprobun-gen mit dem TV-Greifer an diesen Moundserbrachten Karbonate in großer Anzahl undVielfalt. An mehreren Stellen konnten auchFaunen gefunden werden, die aktives Austre-ten von Fluiden dokumentieren.
Webseite:
http://www.geomar.de/projekte/
Abbildung 3: Kartierung zweier auffälligerMounds mit dem GEOMAR DTS-1 SidescanSonar (75 kHz).
160 Abstracts
GD19 – Mi., 26.2., 15:00-15:20 Uhr · HS3Ismail-Zadeh, A. (Geophysikalisches Institut, Universität Karlsruhe), Martin, M., Demetrescu,C., Müller, B., Wenzel, F. (Geophysikalisches Institut, Universität Karlsruhe)
Three-Dimensional Modelling of Temperature and Tectonic Stress Beneath the SE-CarpathiansE-Mail: [email protected]
Repeated large intermediate-depth earth-quakes in the SE-Carpathians (Vrancea) at-tract the attention of geoscientists to the regi-on. Recent seismic tomographic studies revea-led a high-velocity body in a nearly verticalposition. The body is interpreted as a lithos-pheric slab descending into the mantle, andVrancea seismicity is associated with the slab.To understand processes of tectonic stress ge-neration and its release in earthquakes, weanalyse 3D numerical models of crust-mantleflow and thermal viscous stress induced by thesinking slab. Temperature is one of the phy-sical key parameters controlling mantle dyna-mics, because density and viscosity are tem-perature dependent. Using recent experimen-tal data on elastic parameters and anelasticity,we obtain a model of temperature at 50 to 350km depth beneath the SE-Carpathians fromthe seismic tomography model of P-wave ve-locity anomalies. Temperature in the crust anduppermost mantle is estimated on the basis ofheat flow data. The model temperature pre-dicts (i) a hot region at depth of about 50 kmto the northwest of the Vrancea region, (ii) acold mantle volume associated with the de-scending Vrancea slab and (iii) relatively hotmantle regions surrounding the slab at greaterdepths. Derived from the temperature modeldensity and viscosity models are used in nu-merical models. Vertical crustal movementspredicted by the models are consistent withGPS observations. A downward mantle flowis associated with the lithospheric slab. Mo-
delled tectonic stress shows that the maximumhorizontal compression beneath the Vrancearegion coincides with the stress regime definedfrom fault-plane solutions for intermediate-depth earthquakes. The stress reaches its ma-ximum at depths of 70 to 110 km and 130 to180 km and decays below being in good agree-ment with the observed seismicity.
Geodynamik und Gravimetrie 161
GD21 – Mi., 26.2., 15:40-16:00 Uhr · HS3Flury, J. (TU München)
Die ESA-Schwerefeldmission GOCE: Status der Entwicklung und Vorbereitung der wis-senschaftlichen NutzungE-Mail: [email protected]
Die ESA-Satellitenmission GOCE (Gravi-ty field and steady-state Ocean CirculationExplorer) soll im Jahr 2006 gestartet werdenund in einer Missionsdauer von 20 Monatenein globales, hochgenaues und hochauflösen-des Schwerefeld der Erde bestimmen. GO-CE ist die erste Schwerefeldsatellitenmission,bei welcher ein 3-Achs-Schweregradiometereingesetzt wird. Die Schwerefeldbestimmungaus Schweregradienten wird durch kontinuier-liche genaue Bahndaten aus GPS-Satellite-to-Satellite-Tracking unterstützt. Eine wesentli-che Komponente der Mission ist die aufwendi-ge Drag-Free-Steuerung durch mehrere konti-nuierlich arbeitende Thruster-Systeme, durchwelche in der gewählten Messbandbreite einperfekter freier Fall des Satelliten simuliertwird.
Die Bauphase für GOCE hat bereits begon-nen, sowohl für die Thruster-Systeme als auchfür die Akzelerometer, welche das Gradio-meter bilden. Diese sind Weiterentwicklun-gen der bei den bereits fliegenden MissionenCHAMP und GRACE eingesetzten STAR-Akzelerometer, mit gesteigerten Anforderun-
Abbildung 1: Der GOCE-Satellit: die wich-tigsten Systemkomponenten
gen an Empfindlichkeit und Robustheit. Deraktuelle Status der Entwicklung soll im Vor-trag geschildert werden.
Das GOCE-Gradiometer wird die dreiDiagonal- und eine Nichtdiagonalkomponen-te des Gradienten-Tensors mit sehr hoherGenauigkeit messen (4 mE/
√Hz). Daraus
wird ein Schwerefeldmodell als sphärisch-harmonischer Koeffizientensatz bis zum Ent-wicklungsgrad 250 oder 300 berechnet, auswelchem dann Geoidhöhen und Schwerean-omalien abgeleitet werden. Die räumlicheAuflösung des Modells wird bei ca. 70 km lie-gen.
Die Nutzung des GOCE-Schwerefeldes imBereich der festen Erde gehört zu den Haupt-zielen der Mission, neben der Bestimmung derabsoluten Ozeanzirkulation, der Ableitung kli-marelevanter Kenndaten für den Massen- undWärmehaushalt der Meere sowie der geodä-
Abbildung 2: 2. radiale Ableitung desSchwere-Störpotentials T in der Flughöhe vonGOCE (250 km)
162 Abstracts
tischen Nutzung. Für den Bereich der festenErde werden sich Anwendungsmöglichkeitenauf den folgenden Gebieten ergeben:
• Bestimmung von Viskositätsprofilen fürden Erdmantel aus dem langwelligenGeoid über die inverse Modellierung derMantelkonvektion,
• Identifikation von Signalen von Mantel-plumes im Schwerefeld,
• Dichtebestimmung für Slab-Modelledurch gemeinsame Inversion von seismi-schen Daten und Schwerefeldgrößen,
• Bestimmung der Lithosphären- undKrustenstruktur, soweit erforderlichin Kombination mit terrestrischenSchwerefelddaten.
Für diese Ansätze sollen Studien zur Fort-pflanzung der zu erwartenden GOCE-Fehlermodelle angeregt werden.
Mit dem Geoid aus GOCE und der dar-auf aufbauenden geodätischen Geoidmodel-lierung wird eine wesentlich genauere Refe-renz für nationale und kontinentale Höhensys-teme zur Verfügung stehen. Dies wird Fort-schritte bei der Modellierung aller mit demMeeresspiegel und dessen Variation verknüpf-ten Prozesse ermöglichen, z.B. für den glazia-len isostatischen Ausgleich, für den Eismas-senhaushalt der Polargebiete sowie für tekto-nische Vertikalbewegungen.
Das GOCE-Projektbüro Deutschland ander Technischen Universität München bemühtsich um die Koordination der Aktivitäten zurGOCE-Schwerefeldanalyse und um die För-derung des Interesses an der wissenschaftli-chen Nutzung in Deutschland.
Webseite: http://www.goce-projektbuero.de
164 Abstracts
GDP01Hagedoorn, J.M., Martinec, Z., Wolf, D. (GeoForschungsZentrum Potsdam)
A NEW TIME-DOMAIN METHOD OF IMPLEMENTING THE SEA-LEVEL EQUA-TION IN GLACIAL-ISOSTATIC ADJUSTMENTE-Mail: [email protected]
The sea-level equation (SLE) describes theredistribution of glacial melt water in theoceans. Its implementation is complicatedin conjunction with the Laplace-transformmethod conventionally used to model glacial-isostatic adjustment (GIA). The recently de-veloped spectral-finite element method (Mar-tinec, 2000) solves the field equations gov-erning GIA in the time domain and, thus,eliminates the need of applying the Laplace-transform method. Moreover, the spectralfinite-element approach allows us to solve theSLE when modelling GIA for a 3-D viscositymodel. The present test is restricted to a radi-ally symmetric, self-gravitating, incompress-ible earth model consisting of a fluid core, aMaxwell-viscoelastic lower and upper mantle,and an elastic lithosphere.
The Pleistocene deglaciation is simulatedusing the global ice model ICE-3G (Tushing-ham and Peltier, 1990). To study the sensitiv-ity of the GIA predictions, we consider threeocean models, i.e. approximations to the com-plete solution of the SLE. Our test confirmsthe importance of allowing for geoid undula-tions and for moving coastlines when calcu-lating the redistribution of glacial melt waterin GIA. Finally, we compare our predictionswith different types of observational constraintfrom Canada and Fennoscandia.
• Martinec, Z., 2000. Spectral-finite ele-ment approach to three-dimensional vis-coelastic relaxation in a spherical earth.Geophys. J. Int., 142, 117-141.
• Tushingham, A.M., Peltier, W.R., 1990.ICE-3G: a new global model of late Pleis-tocene deglaciation based upon geophys-ical predictions of post-glacial relativesea level change. J. Geophys. Res., 96,4497-4523.
Geodynamische Modellierung – Poster 165
GDP02Martinec, Z., Wolf, D. (GeoForschungsZentrum Potsdam)
INVERTING THE FENNOSCANDIAN RELAXATION-TIME SPECTRUM INTERMS OF A 2-D VISCOSITY DISTRIBUTION WITH CRATONIC LITHOSPHEREE-Mail: [email protected]
The Fennoscandian relaxation-time spec-trum (RTS), recently revised by Wiecz-erkowski et al. (1999), is a standard dataset used in studies of glacial-isostatic adjust-ment (GIA). We interpret this observationaldata set in terms of a 2-D viscosity distri-bution with a thick cratonic lithosphere be-low the former Fennoscandian ice sheet anda much thinner lithosphere underlain by an as-thenosphere in the peripheral regions. The for-ward modelling of GIA is implemented in thetime domain using the spectral-finite elementapproach developed by Martinec (2000). Thecomputed vertical displacement for individualspherical harmonics is fitted by a single expo-nential function and the relaxation time is de-termined. The synthetic RTS for degrees 10to 40 is then compared with the observationalRTS and the acceptability of the underlyingearth model is evaluated. The free parame-ters for the inverse modelling of GIA are ei-ther the the cratonic-lithosphere thickness andthe upper-mantle viscosity or the peripheral-lithosphere thickness and the asthenosphereviscosity. We show that a 2-D viscosity dis-tribution with a cratonic lithosphere of 200-km thickness satisfies the observational RTSas well as a conventional 1-D viscosity distri-bution with a 95-km thick lithosphere.
• Martinec, Z., 2000. Spectral-finite ele-ment approach to three-dimensional vis-coelastic relaxation in a spherical earth.Geophys. J. Int., 142, 117-141.
• Wieczerkowski, K., Mitrovica, J.X.,
Wolf, D., 1999. A revised relaxation-time spectrum for Fennoscandia. Geo-phys. J. Int., 139, 69-86.
166 Abstracts
GDP03Kesten, D., Stiller, M., Ryberg, T., Schulze, A. (GeoForschungsZentrum Potsdam), Bartov, Y.(National Ministry of Infrastructure, Jerusalem), Garfunkel, Z. (Hebrew University, Jerusa-lem), DESERT Group
From Above and Below - Complementary Information on Crustal Structures Relatedto the Dead Sea Transform from Remote Sensing and Seismic Reflection Observationswithin the Project DESERT 2000E-Mail: [email protected]
Within the project DESERT 2000, a multi-national project by German, Israeli, Jordanianand Palestinian geoscientists, various geo-physical experiments have been carried outto study the geological structures, geophys-ical properties and mechanisms of the DeadSea Transform Fault System (DST). This con-tinental transform fault is the plate boundarybetween the Sinai microplate to the W andthe Arabian plate to the E and links the zoneof oceanic spreading in the Red Sea with theTaurus-Zagros collision zone. The cumulativeleft-lateral displacement along the N-S strik-ing DST during the last 18 Ma is more than100 km with some minor transverse ( W-E) ex-tension having occurred along normal faults.
Results from the near-vertical incidenceseismic reflection (NVR) transect of 100 kmlength across the Dead Sea Transform will bepresented in combination with structural ob-servations based on ASTER satellite imagesof the area. Stress will be put on the shal-low (near-surface) crustal structures as recog-nised both on satellite images and in the depth-migrated seismic CDP section. The NVR ex-periment, that was carried out between SedeBoqer/Israel in the NW and Ma’an/Jordan inthe SE, crossed the DST in the Arava Val-ley. Here, between Red Sea and Dead Sea, theDST is also called Arava Fault. The NVR lineaimed to image the crust down to the Mohoand was closely related to a wide-angle as well
as a small-scale seismic array study.A steady increase of the crust/mantle
boundary from around 30 km depth in theNW to 40 km in the SE can be observed aswell as strong lower crustal reflections beneaththe Jordanian highlands, that might either becaused by underplated material or deformationdue to lower crustal flow. The deep continua-tion of the main transform fault (Arava Fault),that is clearly recognised on satellite images asrather straight line between Red Sea and DeadSea, cannot unambiguously be delineated inthe CDP section. This is mainly due to ratherdiffuse seismic reflections in the vicinity ofthe fault and missing contrasts in crustal re-flections west and east to the fault. However,offsets of sedimentary reflections, which areseen in the seismic section especially fartherwest of the Arava Fault, show several otherfaults with varying displacements. Regard-ing surface geological data the displacementsalong most of the faults in the Arava Valleyshow both a dip-slip and a left-lateral strike-slip component. There are some faults whichcan clearly be identified in the seismic sectionbut which have no surface expression. It is in-ferred that these faults have not been active re-cently and the question is put whether exten-sion orthogonal to the DST was greater in thepast than it is today.
Geodynamische Modellierung – Poster 167
GDP04Maercklin, N., Haberland, C., Rümpker, G., Ryberg, T., Schulze, A., Weber, M. (GeoFor-schungsZentrum, Potsdam, Germany), Agnon, A. (Hebrew University, Jerusalem, Israel), El-Kelani, R. (An-Najah University, Nablus, Palestine Territories), Qabbani, I. (Natural ResourcesAuthority, Amman, Jordan), Scherbaum, F. (University of Potsdam, Germany), DESERT Group
Shallow structure of the Arava Fault, Dead Sea Transform, from seismic investigationsE-Mail: [email protected]
Within the DESERT project, the structureof crust and upper mantle in the southern partof the Dead Sea Transform (DST) was stud-ied by a series of geophysical experiments.This transform, stretching from the Red Sea tothe Tauros-Zagros collision zone, is one of theworld’s major active continental shear zones,exhibiting a total slip of about 100 km withinthe last 20 Myr. In the southern part, the Ar-ava fault (AF) is considered to be the mainfault strand. Latest seismic investigation wasa small-scale high-resolution experiment (re-ceiver distance: 5 m, source distance: 20 m)which provided detailed P wave velocity mod-els (first-break tomography) and reflection im-ages of the shallow subsurface structure (<1000 m) along eight 1 km long profiles cross-ing the AF at a 10 km long segment. Theseimages directly complement previous studiesat larger scale and the analysis of explosiongenerated guided waves in the same area.
We observe a strong cross-fault velocitycontrast at depths greater than 1 km, withhigher velocities east and lower velocitieswest of the fault (which we relate to the sed-imentary basin fill). In the uppermost lay-ers (< 100 m) the velocity images appear inpart patchy, on some profiles the AF seems todistinguish domains with different velocities.Even in the high-resolution tomographic pic-tures we see no indication for a fault-zone re-lated low-velocity zone, but CMP stacks showcross-fault changes in the reflectivity pattern.
The observations of guided waves suggest thatat some segments the fault shows a very nar-row sub-vertical low-velocity layer (< 20 mwide).
Our results suggest that the AF is charac-terized by the juxtaposition of different blocksseparated by a very narrow damage zone. Thiscan be explained by the fact that the total slipwithin the DST system is/was distributed inspace and time over several fault strands, re-sulting in a reduced slip on the currently ac-tive strand of the AF. Furthermore, the shal-low velocity structure probably reflects the in-teraction of movement along the fault and thedeposition of sediments.
Web page: http://www.gfz-potsdam.de/pb2/pb22/projects/deadsea/ds-home.html
168 Abstracts
GDP05Kopp, H., Flueh, E. R., Klaeschen, D. (Kiel, Geomar), Comte, D. (Santiago, Universidad deChile), Gaedicke, C. (Hannover, BGR)
Krustenstruktur des zentralen chilenischen KontinentrandesE-Mail: [email protected]
Der zentrale chilenische Kontinentrand istdurch die Subduktion der ozeanischen Nazca-Platte, deren Entstehungsalter im Eozän liegt,unter den südamerikanischen Kontinent ge-prägt. Die Subduktionszone weist einen ho-hen Grad an Segmentierung auf. Mehrere Be-reiche entlang der südamerikanischen Platten-grenze sind durch eine flache Subduktion ge-kennzeichnet, so z.B. unter Nord- und Zentral-Peru als auch unter Zentralchile. Nördlichund südlich dieser sogenannten ’Flat Slab’Segmente taucht die ozeanische Platte in ei-nem steileren Winkel ab und führt hier zuaktivem Vulkanismus auf der Oberplatte, derentlang der ’Flat Slab’ Segmente vermindertist. Die Ursache für das flachere Abtauchender Unterplatte ist weiterhin ungeklärt. Da
Abbildung 1: Lokationskarte des Untersu-chungsgebietes.
die Segmentübergänge häufig mit der akti-ven Subduktion bathymetrischer Erhebungenwie z.B. aseismischer Rücken oder Seamountsauf der ozeanischen Platte korrelieren, wirdhier ein Zusammenhang zwischen dem er-höhten Auftrieb einer verdickten ozeanischenKruste und der flacheren Subduktion vermu-tet. Der Küstenbereich vor Valparaiso warZiel der SONNE-Fahrt SO161 im Dezember2001. Dieses Gebiet ist durch einen Wech-sel in der Materialzufuhr geprägt. Der late-rale Materialtransport im Tiefseegraben wirdnach Norden durch die aktive Subduktion desaseismischen Juan Fernandez Rückens blo-ckiert, so dass der südliche Bereich des Un-tersuchungsgebietes einen insgesamt breiterenund durch die Sedimentfüllung flacheren Tief-seegraben aufweist als das Gebiet im Nor-den. Die geophysikalischen Untersuchungender Subduktionszone und der angrenzendenozeanischen Platte wurden durch seismischeRegistrierungen an Land komplimentiert undbeinhalteten neben der aktiven refraktionsseis-mischen Datenakquisition auch die Kartierungder Meeresbodenbathymetrie. Die aktiven re-fraktionsseismischen Profile wurden entlang
Abbildung 2: ’Checkerboard’-Test des Profilsüber den O’Higgins Seamount.
Geodynamische Modellierung – Poster 169
Abbildung 3: Geschwindigkeits-Tiefenmodellder O’Higgins Seamount Gruppe.
Abbildung 4: Krustenstruktur der Subduk-tionszone entlang P05. Profillokation vgl.Abb.1.
zweier Linien quer zur Subduktionszone bei31°S und 32° S ausgelegt, um eine Anbin-dung an frühere Untersuchungen im Rahmender SONNE Fahrt SO103 (CONDOR) wei-ter südlich und die Erweiterung des Untersu-chungsgebietes nach Norden zu gewährleis-ten. Zusätzlich wurden zwei weitere Pro-file über die O’Higgins Seamount Gruppe,die den östlichsten Teil des Juan FernandezRückens bildet, senkrecht zueinander ausge-bracht (Abb. 1). Diese Profile wurden füreine tomographische Untersuchung der Krus-
tenstruktur unter der Seamount Gruppe undder benachbarten ozeanischen Kruste heran-gezogen. Die Auflösung der tomographischenModelle wurde anhand eines ’Checkerboard’-Tests untersucht (Abb. 2), für den synthetischeDaten mit einer dem realen Experiment ent-sprechenden Geometrie und gepickten Phasengeneriert wurden. Unterhalb der Instrument-lokationen ist die Auflösung bis in die Berei-che der Unterkruste von hoher Qualität. Dasresultierende Geschwindigkeits-Tiefenmodellwird in einer quasi 3D-Darstellung präsentiert(Abb. 3). Eine verdickte Unterkruste ist lo-kal auf den Bereich unterhalb der Vulkangrup-pe konzentriert. Des weiteren wurden vermin-derte Geschwindigkeiten nahe des Tiefseegra-bens festgestellt, die hier evtl. mit den starkausgeprägten Verwerfungen verbunden sind.Dieses Phänomen wird mithilfe einer Man-teltomographie weiter untersucht. Die Krus-tenstruktur der Subduktionszone entlang vonP05 ist in Abb. 4 dargestellt. Im oberenTeil der Abbildung ist das Geschwindigkeits-Tiefenmodell dargestellt, das im unteren Teilin eine Zeitsektion transformiert ist und mitder Linienzeichnung der Reflexionslinie ver-glichen wird. Die 7 km mächtige ozeanischeKruste wird mit einem Abtauchwinkel von 11°unter die Oberplatte subduziert, die ein etwa15 km frontales Akkretionsprisma hoher Re-flektivität aufweist. Der landwärtig gelegeneBackstop weist höhere seismische Geschwin-digkeiten auf, die eine erhöhte Scherfestigkeitcharakterisieren.
Webseite:
http://www.geomar.de/projekte/spoc
170 Abstracts
GDP06Enns, A., Schmeling, H. (Frankfurt am Main)
Trench rollback effectE-Mail: [email protected]
Bei manchen Subduktionszonen wie z.B.die Subduktionszone im Mittelmeerraum oderbei Tonga wird der sogenannte „trench roll-back effect“ beobachtet. Mit Hilfe der nu-merischen Modellierung der Subduktion wer-den der Mechanismus und die Faktoren unter-sucht, die einen Einfluß auf die Entwicklungvon „trench rollback“ haben können. Zu sol-chen Faktoren gehört z.B. die Viskosität derabtauchenden Platte. In einfachen isotherma-len Modellen, die eine subduzierende und kei-ne überschiebende Platte enthalten, wird dieEntwicklung der charakteristischen Grössenwie Abtauchwinkel, Abtauchgeschwindigkeitund die Geschwindigkeit von „trench retre-at“ in Abhängigkeit von der Viskosität, Dichteund der Dicke der subduzierenden Platte un-tersucht. Die Modelle sind rein viskos, Plattenwerden als viskoplastische Körper mit tiefen-abhängiger Plastizitätsgrenze modelliert. DieModelle werden in 2D mit FDCON gerech-net. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass für diePlatte, die an einem Rand der Modellbox fi-xiert ist, der Abtauchwinkel beinahe linear mitder Zeit zunimmt. Für eine nicht fixierte Plattewird kein „trench reatreat“ beobachtet.
Geodynamische Modellierung – Poster 171
GDP07Ruedas, T., Kreutzmann, A., Schmeling, H., Junge, A. (Frankfurt/M.), Marquart, G. (Utrecht)
Melting and Dynamics of a Ridge-Centered Plume and the Effect on Geophysical Obser-vables with Application to IcelandE-Mail: [email protected]
A series of combined numerical mantle con-vection and melt segregation experiments wasconducted together with the application of the-oretical relations between vS, T and porosityand magnetotelluric modelling to investigatethe influence of different excess temperaturesand amounts of retained melt on observableslike crustal thickness, seismic velocities andelectrical conductivities for the case of a ridge-centered plume in the upper mantle. The re-sults are compared to the present situation ofIceland, where a considerable amount of datahas been collected over the years by severalgroups.
The point of reference is a model with aplume with a radius of 125 km and a tempera-ture anomaly of 250 K at the model bottom; amaximum of 1 % melt is retained in the man-tle, i.e., all melt in excess of this is extractedinstantaneously from the model and broughtto the surface, where it forms the crust andmoves along with the drifting plate. Startingfrom this reference plume, we explore the pa-rameter space in two directions: one seriesconsiders the effect of anomalies weaker resp.stronger by 100 K, the other probes the effectof a change of the melt extraction thresholdfrom 1 to 0.1, 3, and 100 %, respectively.
The models result in a wide range of maxi-mum crustal thicknesses for the plume, from33 km (ΔT = 250 K, ϕex = 0.03) to 146 km(ΔT = 350 K, ϕex = 0.01). Judging from thecrustal thickness, the most reasonable mod-els are those closely resembling the referenceplume (hmax = 58 km); additional models in-
dicate that the Iceland plume might as well bea bit cooler than our reference, allowing for alower extraction threshold.
A conversion of T and melt content toseismic velocities was performed to com-pare these models with field data, e.g. fromseismic tomography (ICEMELT, HOTSPOT);the depth range considered was limited toca. 350 km, and anomalies were taken withrespect to a lithosphere and mantle of 20 Maage. While the temperature effect alone as ex-pressed in the deeper parts of the plume stemcauses only a vS reduction by 1–3 %, the com-bined effect of temperature and melt in themelting region is quite strong, e.g. reaching−10 % in the shallowest part of the referenceplume; the contribution of the plume is abouta quarter. Another remarkable feature of thevS anomalies of the models with hotter plumesand low extraction thresholds is the presenceof a second velocity minimum just above thesolidus depth.
The temperature and melt distributions werealso converted into electrical conductivitieswhich are the input for the 3-D magnetotel-luric (MT) modelling. The conductivities de-pend on both excess temperature and meltthreshold, whereby the influence of the meltis stronger. Based on the computed magneticand electric fields the MT transfer functions(apparent resistivities and phases) were cal-culated. Depending on the input parameters,melt and temperature, these transfer functionsare affected by the plume. The larger theamount of melt and the larger the melt region,
172 Abstracts
the more distinctive are these influences.
Web page: http://www.geophysik.uni-frankfurt.de/geodyn/island/publications/ru-etal02a.html
174 Abstracts
GGP01Götze, H.-J., Schmidt, S. (FU Berlin)
Krümmungsattribute für die Interpretation von PotenzialfeldernE-Mail: [email protected]
Bei der Prä-Interpretation von Potenzialfel-dern werden Verfahren der Glättung, Eckener-kennung (edge detection) und/oder Schattie-rungen (Gradientenverfahren) verwendet unddanach visualisiert. Sie ergeben wichtige Hin-weise für eine spätere numerische Interpreta-tion mit Hilfe der Vorwärtsmodellierung oderInversion. Wir stellen hier zusätzliche Mög-lichkeiten für das Datenprozessing vor, dieauf der Auswertung von Krümmungseigen-schaften von Feldern beruhen und auf einemorthogonalen Gitter vorliegen (X,Y, Funkti-onswert). Es kann gezeigt werden, dassdie Krümmung umgekehrt proportional zumKrümmungsradius (R) einer Kugel ist, diein einem bestimmten Punkt der Fläche sichan diese anschmiegt. Eine weitere Definiti-on der Krümmung von Kurven und Flächenim 3-dimensionalen Raum kann mit Hilfe der2. Ableitungen gegeben werden. Die Krüm-mung ist ”positiv” im Maximum einer Flä-che (Antikline) und ”negativ” im Minimum(Synkline). Mit Hilfe der ”Normalkrümmun-gen” einer Fläche wird gezeigt, wie minimaleund maximale Krümmung, der ”shape-index”,die Krümmung im Streichen (strike curvature)und ”Dip-curvature” zur Berechnung von At-tributen der Felder verwendet werden könnenund wie sie zu einer qualitativen Interpreta-tion verwendet werden. Die interaktive Be-rechnung mit anschließender Visualisierungwird mit einem Java-Programm durchgeführt.Wir zeigen Bearbeitungen von Bouguer- undRestfeldern aus den Anden, dem nahen Os-ten (Arava Fault System) und dem norddeut-schen Becken. Sehr befriedigende Ergebnisse
werden mit der ”dip-curvature” erzielt, derenMaximalwerte sehr gut mit den Rändern vonKörpern mit unterschiedlicher Dichte- oderSuszeptibilität korrelieren. Der ”shape-index”gibt Hinweise auf die ”Gestalt” der Anomalie:kompakte wie langgestrecke Formen werdenunterschieden, ebenso wie konkave und kon-vexe Strukturen.
Geodäsie und Gravimetrie – Poster 175
GGP02Stadtler, C., Casten, U. (Bochum), Thomsen, S. (Tondern)
Anwendung der „maximum curvature“ Methode auf Schweredaten zur Lokalisierungund Kartierung quartärer Rinnen in Südjütland (Dänemark)E-Mail: [email protected]
Quartäre Rinnen sind durch subglazialeProzesse entstanden und können bis zu 500m tief in die unterlagernden Schichten einge-schnitten sein. Die Rinnen sind mit glazia-len Sanden und Mergeln verfüllt und spielenbei der Grundwasserversorgung eine wichti-ge Rolle. Je nach Art der Verfüllung kön-nen sie ergiebige Grundwasserspeicher sein,eine Verbindung zu tiefer liegenden Wasserlei-tern herstellen und somit einen hydraulischenDurchlass von Schadstoffen ermöglichen oderals Grundwassernichtleiter eine hydrogeologi-sche Barriere in wasserführenden Schichtendarstellen.
Die Rinnen verursachen Anomalien imSchwerefeld, wenn zwischen dem eingelager-ten Material und der Umgebung ein Dich-tekontrast besteht. Je nach Vorzeichen desDichtekontrasts kann die Anomalie positivoder negativ sein. Erfahrungen haben gezeigt,dass in Südjütland die Verfüllung häufig ei-ne größere Dichte als die Umgebung hat undsomit eine positive Anomalie hervorgerufenwird. Die Schwereanomalien haben Amplitu-den von nur wenigen hundert µGal und Wel-lenlängen von mehreren hundert Metern. Siekönnen durch gravimetrische Untersuchun-gen lokalisiert werden, indem Dichtemodel-le des Untergrundes, unterstützt durch geo-metrische Informationen aus Reflexionsseis-mik und Bohrungen, erstellt werden. Die Vor-wärtsmodellierung wird an einem Schwere-profil bei Tinglev verdeutlicht, das im Rahmendes dänisch-deutschen INTERREG II Projek-tes vermessen wurde. Durch die Untersuchun-
gen konnte eine Rinne gefunden werden, dieetwa 1 km breit und in einer Tiefe zwischen40 und 100 m liegt.
Das regionale Schwerefeld von Südjütlandwird von großräumige Anomalien mit starkenAmplituden zwischen -18 und +36 mGal do-miniert; hochfrequente Anomalien von geolo-gischen Strukturen wie quartäre Rinnen wer-den überlagert. Bevor das gemessene Schwe-refeld für eine Modellierung verwendet wer-den kann, muss eine Feldertrennung durch-geführt werden. So werden hochfrequenteSignale im Schwerefeld hervorgehoben undsichtbar. Für die Durchführung der Feldertren-nung gibt es verschiedene Möglichkeiten, u.a.die Berechnung der vertikalen und horizonta-len Ableitungen des Schwerefeldes.
Das Poster befasst sich mit einer weiterenMöglichkeit. Das Schwerefeld kann als eineFläche mit Krümmungseigenschaften betrach-tet werden, die sich berechnen lassen. Erst-malig wurde die „maximum curvature“, alsodie größte absolute Krümmung, des Schwe-refeldes berechnet, um Signale von quartärenRinnen hervorzuheben. Die „maximum curva-ture“ des Schwerefeldes einer Rinne, die mitMaterial größerer Dichte als die Umgebungverfüllt ist, ist gekennzeichnet durch negati-ve Krümmungen an den Flanken und positi-ven Krümmungen oberhalb der Rinne. Dienegativen Krümmungen in der Karte der „ma-ximum curvature“ des Bouguer Schwerefel-des bei Bredebro (Abb. b) folgen genau demVerlauf der Flanken der skizzierten quartärenRinne (schwarze Linien), oberhalb der Rinne
176 Abstracts
sind die Krümmungen positiv. Darüber hin-aus lassen sich in der Karte der „maximumcurvature“ des regionalen Schwerefeldes fürden gesamten Bereich von Südjütland zahlrei-
4.86 4.87 4.88 4.89 4.9 4.91 4.92
x 105
6.098
6.099
6.1
6.101
6.102
6.103
6.104x 106
x−UTM [m]
y−U
TM [m
]
a)
1111.5
12
12
12.5
12.5
12.5
13
13
13
13.5
13.5
13.5
13.5
14
14
14
14.5
14.5
15
15.5 16
Bouguer Anomaly [mGal]8 10 12 14 16 18
4.86 4.87 4.88 4.89 4.9 4.91 4.92
x 105
6.098
6.099
6.1
6.101
6.102
6.103
6.104x 106 b)
x−UTM [m]
y−U
TM [m
]
MC [1/mGal]−18 −15 −12 −9 −6 −3 0 3 6
x 10−7
Abbildung 1: a) Bouguer Schwerefeld beiBredebro mit Verteilung der Schwerestatio-nen. b) Maximum curvature des BouguerSchwerefeldes mit Verlauf und Ausdehnung(schwarze Linien) einer bekannten quartärenRinne.
che Korrelationen mit weiteren geologischenStrukturen, wie z.B. Störungen und Graben-systemen, finden.
Die Anwendung der „maximum curvature“Methode auf das Schwerefeld bietet somit ei-ne vielversprechende Möglichkeit, den Ver-lauf und die Ausdehnung quartärer Rinnenund weiterer geologischer Strukturen mit Hil-fe des charakteristischen Krümmungsfeldeszu lokalisieren und zu kartieren.
Webseite: http://www.angewandte-geophysik.ruhr-uni-bochum.de
Geodäsie und Gravimetrie – Poster 177
GGP03Wienecke, S., Götze, H.-J. (Freie Universität Berlin)
Untersuchungen zur flexurellen Rigidität - Beispiele aus den AndenE-Mail: [email protected]
Der Posterbeitrag ist im Rahmen der Ar-beiten des SFB 267 „Deformationsprozessein den Anden “entstanden. Das Poster be-schäftigt sich mit Unter-suchungen zur Isosta-sie und flexurellen Rigidität im Bereich derzentralen Anden. Die Ergebnisse aus drei-dimensionalen Dichte-Modellierungen lieferndie Basis für eine umfassende Analyse des De-formationsverhaltens der Lithosphäre in densüdlichen patagonischen Anden und im Be-reich der Zentralanden. Die Kenntnis derelastischen Parameter, wie das Elastizitätsmo-dul E, das Poissonverhältnis v und die Biege-steifigkeit D, bildet einen wichtigen Anhalts-punkt, um Aussagen über die Prozesse der Ge-birgsbildung treffen zu können, und um weite-re strukturelle Informationen (z.B. tektonischeProvinzen) zu gewinnen, die sich nicht alleinaus der Dichteverteilung ableiten lassen. Einerder wichtigsten Parameter, welcher die me-chanische Festigkeit der Lithosphäre kontrol-liert, ist die Biegesteifigkeit D, die in der Geo-logie oftmals durch die elastische Dicke Teausgedrückt wird. Die genaue physikalischeBedeutung und Aussagekraft bleibt oftmalsunklar und muss durch die methodischen Un-tersuchungen kalibriert werden. Die Model-le basieren zunächst darauf, eine analytischeelastische Lösung für das Deformationspro-blem zu finden. Anhand der analytischen Lö-sungen des dreidimensionalen Flexur-Modellsmittels einer Approximation von Hertz wirddie Signifikanz der verschiedenen Inputpara-meter wie z.B. die Krusten- und Manteldich-te untersucht. Des Weiteren wurden einfacheGrundmodelle entwickelt, um das mechani-
sche Verhalten der Lithosphäre in den Südli-chen und Zentralen Anden physikalisch kon-sistent und einheitlich interpretieren zu kön-nen. Zur Überprüfung der Ergebnisse wur-den aus den Flexur-Modellen Regionalfelderberechnet und mit den gemessenen Schwere-werten verglichen.
178 Abstracts
GGP04Heyde, I., Schreckenberger, B. (BGR Hannover), Schmidt, S., Götze, H.-J. (FU Berlin)
Schweremessungen an der Subduktionszone vor ZentralchileE-Mail: [email protected]
Während der SONNE Fahrt SO-161(SPOC) im Herbst 2001 wurden auf Leg 2bis 4 marine Schweremessungen mit demSeegravimetersystem KSS31M der BGRdurchgeführt. Die mittlere Messgenauigkeitbeträgt etwa 1 mGal. Verfügbare seegravi-metrische Fremddaten wurden wegen ihrererheblich geringeren Genauigkeit bei derErstellung der Schwerekarte (Fig. 1) nichtverwendet.
Die Anomalien der Freiluftschwere zeich-nen die Bathymetrie des Messgebietes nach.Im Westen verursacht die ozeanische Krus-te der abtauchenden Nazca Platte positiveSchwereanomalien von im Mittel etwa 10 bis20 mGal bei Wassertiefen von etwa 4000 m.Im Bereich des Chilegrabens sinken die Wertebei Wassertiefen von 6500 m auf bis zu -150mGal ab. Landwärts im Bereich des Akkre-tionskeils und des Überganges zur kontinen-talen Kruste steigen die Anomalien mit ab-nehmender Wassertiefe stark an. Diese brei-te Zone ist charakterisiert durch sich abwech-selnde positive and negative Anomalien vari-ierender Amplitude. Diese können zum einendurch die Morphologie des Kontinentalhangesund zum anderen durch eine nicht einheitlicheDichteverteilung in der oberen Kruste begrün-det sein. Inwieweit Dichtestrukturen verant-wortlich sind, die zu bereits erodierten Teileneiner alten Forearc Region gehören, soll ge-klärt werden.
Die Profile im Norden und Süden des SPOCGebietes liegen recht weit auseinander. ImGebiet A jedoch bilden die vermessenen Pro-file ein recht regelmässiges und engmaschi-
ges Netz meist E-W streichender Profillini-en. Für dieses Gebiet wird ein dreidimensio-nales Dichtemodell mit Hilfe des Programm-paketes IGMAS erstellt (Schmidt and Götze,1998). IGMAS ermöglicht die interaktive In-terpretation von Potentialfelddaten (Gravime-trie und Magnetik) mittels Vorwärtsmodellie-rung. Bereiche in denen keine Schweredatenvorliegen wurden mit aus der Satellitenalti-metrie gewonnenen Schweredaten nach Wang(2001) aufgefüllt.
In das Modell gehen die Ergebnisse derReflexionsseismik und insbesondere der Re-fraktionsseismik ein. Die Dichten werden ausden Geschwindigkeiten entsprechend üblicherGeschwindigkeits-Dichterelationen bestimmt.Von besonderem Interesse in diesem Gebietsind die Mocha- und die Valdivia- Bruchzo-nen. Die Spur dieser Zonen soll landwärtsverfolgt werden. Etwaige Unterschiede inder ozeanischen Kruste beiderseits der Zonenwerden dargestellt. Desweiteren werden dieDichtestrukturen des schmalen Akkretions-keils und des Kontinentalhanges sowie derküstennahen Becken untersucht.
Schmidt, S. and Götze, H.-J., 1998: In-teractive visualization and modification of3D-models using GIS-functions. Physics andChemistry of the Earth, 23 (3), 289-295.Wang, Y. M., 2001: GSFC00 mean seasurface, gravity anomaly, and vertical gravitygradient from satellite altimeter data. J.Geophys. Res., 106 (C12), 31167.
180 Abstracts
-160
-160
-140
-140
-120
-120
-120
-100
-100
-100
-80
-80
-80
-60
-60
-60
-60
-60
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-20
-20
-20
-20
-20
00
0
0
0
20
20
20
20
20
20
40
40
40
40
60
60
60
80
100
120
140
160
180
76 W 74 W 72 W 70 W 68 W
44 S
42 S
40 S
38 S
36 S
34 S
32 S
30 S
28 S
Abbildung 1: Karte der Freiluftschwereanomalien auf Basis der Messungen während der Fahr-ten SO-161, Leg 2 bis 4 (s. kleine Karte). Isolinienabstand 20 mGal.
Geodäsie und Gravimetrie – Poster 181
GGP05Reitmayr, G. (Hannover)
Gravimetrie in Polargebieten: Methoden, Probleme, ErgebnisseE-Mail: [email protected]
Die geologische Forschung ist in Polarge-bieten naturgemäß sehr behindert, da die Eis–und Schneebedeckung in weiten Teilen kei-nen direkten Zugang zu den Gesteinen er-laubt. Der Einsatz geophysikalischer Metho-den, mit denen man tiefer ins Erdinnere “se-hen” kann, ist deshalb sehr wichtig. Insbe-sondere die Gravimetrie liefert uns Informa-tionen über verborgene Intrusiv–Körper, li-thologische Grenzen, Sediment–Becken, Än-derungen der Krusten–Dicke oder andere In-homogenitäten innerhalb der Erdkruste oderdes oberen Mantels. Mit ihrer Hilfe lassensich auch isostatische Störungen erkennen, diedurch Änderungen der Eisbedeckung verur-sacht sind. Damit erhalten wir wichtige Bei-träge zum Verständnis der Klimageschichte.
MethodenDie Schwerebeschleunigung wird mit kon-
ventionellen Gravimetern gemessen. Unerläß-lich für die Gravimetrie ist die genaue Kennt-nis der Ortskoordinaten jedes Meßpunktes, dieheute problemlos mit differenziellem GPS er-mittelt werden können. Für eine sinnvolle In-terpretation von Schweremessungen in eisbe-deckten Gebieten benötigen wir außerdem In-formationen über die Eisdicke. Diese mes-sen wir mit dem RES– (Radio Echo Soun-ding) Verfahren. Gravimetrische Vermessun-gen werden heute auch zunehmend von derLuft aus durchgeführt. Besonders in denschwer zugänglichen Polargebieten wird sodie Geländearbeit sehr erleichtert.
ProblemeDie Genauigkeiten der konventionellen
Gravimetrie können unter polaren Bedingun-
Abbildung 1: Karte der Bouguer-Schwere desantarktischen Victoria-Landes und der angrenzen-den Meere
gen i.a. kaum erreicht werden, denn:
• widrige Meßbedingungen, wie star-ke Temperaturschwankungen, Sturm,Schneedrift, Bewegung schwimmenderGletscher etc. reduzieren die Meßgenau-igkeit,
• für Geländekorrekturen benötigte topo-graphische Detail–Karten sind, wennüberhaupt vorhanden, oft ungenau undfehlerhaft,
• die Fehler auf Grund mangelhafter oderunsicherer Eisdickeninformation sindvermutlich die weitaus größten, trotz der
182 Abstracts
zunehmenden Möglichkeiten, Eisdickenflächenhaft von der Luft aus zu erfassen,
• die ermittelten Ortskoordinaten könnenmit größeren Fehlern als gewöhnlich be-haftet sein, da aus logistischen Grün-den die Meßpunkte und die GPS–Basisstationen oft sehr weit auseinanderliegen können,
• in Gebirgen, wie dem Transantarkti-schen, gibt es sehr große Höhendiffe-renzen zwischen einzelnen Meßpunkten.Die Beiträge der obligaten Frei–Luft–und der Bouguer–Platten–Korrekturensind dann sehr unterschiedlich und mög-licherweise fehlerhaft, da man nur miteinem theoretischen Vertikal–Schwere–Gradienten und geschätzten mittlerenDichten rechnen kann.
Ergebnisse (Beispiele aus zwei antarkti-schen Meßgebieten)
Die BGR führt seit über 15 Jahren gravime-trische Vermessungen in der Antarktis durch.Während fünf GANOVEX (German Antarc-tic North Victoria Land) Expeditionen wurdedas Schwerefeld des Victoria–Landes (gegen-über von Neuseeland) vermessen. Diese Da-ten wurden offshore ergänzt mit Schiffs– undSatellitendaten und so detailreiche regionaleSchwerekarten erzeugt.
Im Königin–Maud–Land (südlich von Afri-ka) konnten wurde eine starke isostatischeAnomalie gefunden. Ihre Ursache muß einMassendefizit im Untergrund sein. Mankönnte dieses einmal erklären mit verminder-ten Gesteinsdichten, z.B. eines Sedimentbe-ckens, oder mit einer noch nicht kompensier-ten Eindellung der Krusten/ Mantel–Grenzeauf Grund verschwundener Eisauflasten.
Webseite:
http://www.bgr.de/b313/antarktis.htm
Geodäsie und Gravimetrie – Poster 183
GGP06Snopek, K., Casten, U., Staackmann, M. (Ruhr-Universität Bochum)
Gravimetrisches Modellieren der Lithosphäre im Bereich des Hellenischen BogensE-Mail: [email protected]
Im Rahmen des Bochumer SFB 526 - TPC2, „Structural and rheological informationof the Hellenic subduction zone from gravi-ty data“, wurde ein Dichtemodell der Litho-sphärenstruktur für die Hellenische Subdukti-onszone erstellt. Diese erstreckt sich bogen-förmig vom Peloponnes über die Inseln Kre-ta und Karpathos hinweg bis in die Türkeihinein. Der Subduktionsbereich ist durch einnordwestwärts gerichtetes Abtauchen der afri-kanischen unter die eurasische Platte gekenn-zeichnet. Die gravimetrische Modellierungdient der Interpretation der regionalen Schwe-refeldanomalien.
Da bisher lediglich Dichtemodelle für dieKruste im Vordergrund standen, sollte diemalder Versuch unternommen werden, die Mo-dellierung auf die Lithosphäre auszuweiten.Zu diesem Zweck wurde ein 400 × 400 kmgroßes 3D-Strukturmodell erstellt mit Kretaim Zentrum und mit einer Tiefenerstreckung
Abbildung 1: Bouguer-Anomalien des Helle-nischen Bogens.
bis 100 km. Für diesen Modellaufbau wur-den die zu berücksichtigenden geometrischenRandbedingungen den bislang vorliegendenErgebnissen seismischer Strukuruntersuchun-gen entnommen. Das Strukturmodell bestehtaus 4 Körpern variabler Mächtigkeit: Was-serbedeckung, Sedimente, Kruste und obererMantel. Die subduzierte Platte wurde nichtals separater Körper berücksichtigt, sondernist im Modell lediglich durch eine Ausdellungder Moho nach unten angedeutet, da Körperin dieser Tiefe nur noch einen geringen Ein-fluss auf die Schwere an der Erdoberfläche ha-ben. Das Modellierungsgebiet wurde sowohlin x- als auch in y-Richtung zunächst in 40Blöcke eingeteilt. Daraus ergibt sich ein Ab-stand der Modellierungsschnitte von 10 km.Für die Modellrechnungen wurden Bouguer-Anomalien verwendet. Die Wasserbedeckung
Abbildung 2: NS-Profil durch Mittel-Kreta(x = −50).
184 Abstracts
hat daher eine Dichte von 2.67 g/cm 3. DieDichtewerte der anderen Strukturkörper wur-den mit Hilfe von Geschwindigkeits-Dichte-Relationen aus seismischen Daten ermittelt.Für die Sedimente wurde eine Kompaktierungmit zunehmender Tiefe berücksichtigt.
Die Berechnung der Modellanomalien wur-de computergestützt mit einer neu entwickel-ten Software durchgeführt. Das Verfahren be-nutzt rechteckige Elementarkörper, mit denender Aufbau eines Dichtemodells sowie seineÄnderungen, vor allem bei Verwendung ei-ner großen Anzahl von Modellierungsschnit-ten, schneller und komfortabler durchgeführtwerden können als mit Verfahren, die eineModellstruktur aus triangulierten Polyedero-berflächen verwenden.
Als Ergebnis der Modellrechnung wurdenzunächst die Schwereanteile der einzelnenDichtekörper ermittelt. Diese lassen sich ein-zeln diskutieren. Die Summation aller Antei-le liefert dann die Modellschwere. Die resi-duale Schwere wurde durch Differenzbildungaus der gemessenen ermittelt. Sie gibt zumeinen Aufschluss über die laterale Dichtever-teilung im Mantel, die bei der Modellbildungnicht berücksichtigt worden ist, und ermög-licht zum anderen eine Abschätzung der Mo-dellgüte. Beides unterscheidet sich in der Wel-lenlänge der Anomalien. Als weitere Ergeb-nisse wurden die Mächtigkeit der Sediment-bedeckung und der Tiefenverlauf der Moho-fläche ermittelt.
Webseite: http://www.angewandte-geophysik.ruhr-uni-bochum.de
Geodäsie und Gravimetrie – Poster 185
GGP07Ebbing, J. (FU Berlin)
Spannungsverteilung in den Ostalpen - Erste ErgebnisseE-Mail: [email protected]
Die Alpen sind durch die Kollision der eu-ropäischen und adriatischen Platte entstanden.Durch eine Reihe von interdisziplinären Pro-jekten sind in jüngster Vergangenheit neue Er-kenntnisse über die Struktur der Lithosphä-re in den West- und Ostalpen gewonnen wur-den. Hieraus lassen sich auch neue Schlüs-se über die dynamischen Prozesse der alpinenGebirgsbildung ableiten.
Für die Ostalpen geben das seismische Pro-fil TRANSALP und seine Begleitprojekte eindetailliertes Bild der Krustenstruktur der Ost-alpen. Die Berücksichtigung der verfügba-ren Informationen in einem 3D-Dichtemodellliefert darüber hinaus neue Einblicke in dieStruktur der Lithosphäre, die jedoch nicht ein-deutig hinsichtlich einer Zuordnung zur euro-päischen oder adriatischen Platte sind. Ins-besondere im Bereich südlich der maximalenKrustenwurzel treten in der Seismik Struk-turen im Bereich der Krusten-Mantel-Grenzeauf, die aus gravimetrischer Sicht sowohl deradriatischen als auch der europäischen Kruste,oder aber sogar dem Mantel zuzuordnen sind.
Isostatische Untersuchungen liefern Hin-weise, die auf eine Subduktion der europäi-schen Kruste und auf ein Krustenverdopp-lung unterhalb der Dolomiten schließen las-sen. Genauere Erkenntnisse lassen sich jedochnur mittels dynamischer Betrachtungen wiez. B. Finite-Elemente-Modellierungen gewin-nen. Hierbei ist insbesondere die rezent in derLithosphäre herrschende Spannung ein wich-tiger Anhaltspunkt, um von den statischen Be-trachtungen zu Isostasie und Dichtestrukturden Übergang zu einer dynamischeren, struk-
turellen Betrachtungsweise zu gewinnen.Anhand von 2D-Finite-Elementen-Modelle
werden erste Aussagen über die vorherrschen-den Spannungen getroffen, die mit den Span-nungen entlang wohldefinierter Grenzflächenverglichen werden sollen. Hierbei wird diedurch unterschiedliche Geometrien und Dich-ten induzierte Spannung betrachtet.
186 Abstracts
GGP08Walther, A., Kroner, C., Jahr, T. (FSU Jena)
Beobachtungen mit einem Laserstrainmeter im Geodynamischen Observatorium MoxaE-Mail: [email protected]
Im Geodynamischen Observatorium Moxaregistriert seit März 1999 ein Laserstrainme-ter. Dieses ist in Kooperation mit der FirmaSIOS Meßtechnik GmbH Ilmenau entwickeltworden.
Mit Strainmetern werden Deformationender Erdkruste gemessen, wie sie z.B. durchErdgezeiten und Erdeigenschwingungen ver-ursacht werden.
Das Laserstrainmeter ist in einer 38 m lan-gen horizontalen Bohrung im Stollenbereichdes Observatoriums installiert, welche NW–SE verläuft (Abb.1). Die Horizontalbohrungbildet die Diagonalkomponente zu den N–S und E–W verlaufenden Quarzrohrstrainme-tern, so daß Untersuchungen mit den dreiStrainkomponenten zum Flächenstrain mög-lich sind. Die Daten des Laserstrains werdenim Abstand von 10 s registriert.
Die Messung des Laserstrainmeters basiertauf dem Prinzip des Michelson Interferome-ters. Die Lichtquelle ist ein frequenzstabi-lisierter He–Ne–Laser mit einer Wellenlängevon 632.8 nm, und die Spiegel sind zu Pris-men modifiziert. Die Auflösung beträgt 1.24nm.
Temperatur- und insbesondere Luftdruck-variationen haben einen großen Einfluß auf dieStrainmessungen. Das Laserstrainmeter wirktwie ein Barometer, da der Meßwert abhängigvon der Brechzahl der Luft ist. Eine Änderungder Brechzahl tritt durch Variationen der Luft-dichte auf, die von Schwankungen im Luft-druckes und der Stollentemperatur verursachtwerden. Im Stollenbereich werden daher dieUmgebungsparameter Luftdruck und Tempe-
ratur kontinuierlich gemessen. Die Auflösungdes Luftdrucksenors beträgt ±11.5 Pa und diedes Temperaturfühlers ±0.15 K. Der Stollenhat eine Temperaturstabilität von 8.6±0.05°Cim Jahr.
Die Daten wurden bisher auf Gezeiten undErdeigenschwingungen analysiert, und Un-tersuchungen zum Rauschgehalt und Umge-bungseinflüssen vorgenommen. Die Ergeb-nisse der Gezeitenanalyse korrelieren mit den
Abbildung 1: Installation des Laserstrainme-ters im Stollen des Geodynamischen Observa-toriums Moxa
Geodäsie und Gravimetrie – Poster 187
Resultaten für die Quarzrohrstrainmeter. DerRauschgehalt der Registrierungen der beidenStrainmetertypen an ruhigen Tagen ist ver-gleichbar.
188 Abstracts
GGP09Kroner, C., Jahr, Th., Jentzsch, G. (Institut für Geowissenschaften, FSU Jena)
Beobachtung von Schwerevariationen mit einem supraleitenden Gravimeter im Geody-namischen Observatorium MoxaE-Mail: [email protected]
Seit Ostern 1999 registriert im Geodynami-schen Observatorium Moxa (Thüringen) dassupraleitende Gravimeter CD034 von GWRInstruments. Eine Besonderheit dieses Instru-ments ist sein doppeltes Sensorsystem. Diebeiden Sensoren sind im Abstand von etwa20 cm übereinander angeordnet. Das Ob-servatorium mit seinem Gravimeter ist eineder jüngeren Stationen des ’Global Geodyna-mics Project’ (GGP, Crossley et al., 1999),in dem alle supraleitenden Gravimeter welt-weit zusammengeschlossen sind. Neben ei-ner hohen Langzeitstabilität zeichnet sich die-ser Instrumententyp durch ein breites Beob-achtungsspektrum aus, das von den Erdeigen-schwingungen bis zu Langzeitvariationen wieder Polbewegung reicht. Durch den großenSpektralbereich, den diese Instrumente erfas-sen, ist auf der einen Seite des Spektralbe-reichs eine Verknüfung zur Seismologie gege-ben und auf der anderen zu raumgeodätischenBeobachtungen.
Im internationalen Vergleich von Statio-nen mit supraleitenden Gravimetern ist Moxaim gesamten Beobachtungsspektrum eine derrauschärmsten (Ducarme et al., 2002; Kro-ner, 2002; Rosat et al., 2002). In den Da-ten lassen sich im Zeitbereich Signale mit ei-ner Amplitude von wenigen nm/s2 auflösenund im Frequenzbereich Signale von einigenZehntel nm/s2. Abb. 1 zeigt das mittlere, mi-nimale Rauschniveau zwischen 0.05 und 50mHz, das in Moxa beobachtet wird. Zum Ver-gleich ist das Niveau des ’New Low NoiseModel‘ (NLNM; Peterson, 1993) eingezeich-
net. Dieses Modell beschreibt das mittlere,weltweit zu beobachtende minimale Rausch-niveau. Je dichter das Rauschspektrum ei-ner Station an dieser Modellkurve liegen, de-sto ruhiger ist diese. Das Unterschreitendes Rauschmodells bei Frequenzen unter 0.9mHz liegt darin begründet, daß in den Beob-achtungsdaten die Erdgezeiten und der Luft-druckeinfluß eliminiert wurden, während dasRauschmodell diese noch enthält. Aufgrunddes niedrigen Rauschgehalts eignen sich dieDaten aus Moxa gemeinsam mit Registrierun-gen anderer ruhiger Stationen gut für Unter-suchungen zu Kern- und Slichtermoden. Dielangperiodischen Variationen der Schwerere-siduen zeigen eine gute Übereinstimmung mitdem Polbewegungssignal. Zwischen den Re-gistrierungen der beiden Sensoren des Gravi-meters läßt sich bis auf eine leicht unterschied-liche Drift kein signifikanter Unterschied fest-stellen. Das Spektrum des Differenzsignalsist durch instrumentelles Rauschen im Fre-quenzbereich zwischen 0.5 und 15 mHz cha-rakterisiert. Meteorologisch–induzierte Ein-flüsse in den Registrierungen entstehen durchLuftmassenumlagerungen lokaler bis globa-ler Ausdehnung. Ebenso lassen sich Effek-te durch Grundwasserspiegel– und Boden-feuchteschwankungen in der Observatorium-sumgebung nachweisen. Abschätzungen fürMoxa zu globalen Variationen in Bodenfeuch-te, Schneehöhe und Meeresspiegelanomalienbelegen, daß hierdurch saisonale Effekte inder Größenordnung von 20 bis 30 nm/s2 mög-lich sind (Kroner, 2002).
Geodäsie und Gravimetrie – Poster 189
Abbildung 1: Mittlere Energiedichtespektren berechnet aus Daten fünf ruhiger Registriertage.
Literatur
Crossley, D., Hinderer, J., Casula, G., Francis, O.,Hsu, H.–T., Imanishi, Y., Jentzsch, G., Kää-riäinen, J., Merriam, J, Meurers, B., Rich-ter, B., Shibuya, K., Sato, T. und van Dam,T., 1999. Network of superconducting gravi-meters benefits a number of disciplines, EOSTransact. AGU, vol. 80, no. 11
Ducarme, B., Sun, H.–P. und Xu, J.–Q., 2002. Acomparison of tidal gravity results from theGGP network, Bull. d’In.f Mar. Terr., 136,10761–10776
Kroner, C., 2002. Zeitliche Variationen des Erd-schwerefeldes und ihre Beobachtung mit ei-nem supraleitenden Gravimeter im Geodyna-mischen Observatorium Moxa, Jenaer Geo-wiss. Hefte, Heft 2, 149 S.
Peterson, J., 1993. Observations and modelingof seismic background noise, Open file report93–332, U.S. Department of Interior, Geolo-gical Survey, Albuquerque, New Mexico
Rosat, S., Hinderer, J. und Crossley, D., 2002. Acomparison of seismic noise levels at variousGGP stations, Bull. d’Inf. Mar. Terr., 135,10653–10668
Kontinentale Tiefbohrungen 191
KT01 – Fr., 28.2., 09:30-09:50 Uhr · HS1Jahr, T., Jentzsch, G. (Jena), Sauter, M. (Göttingen)
Beobachtung und Modellierung hydraulisch induzierter geomechanischer Deformatio-nen in der Umgebung der KTBE-Mail: [email protected]
Im Rahmen des neuen Projektes werdenhochauflösende Neigungsbeobachtungen, diePorendruck-Änderungen und Variationen inder vorherrschenden Fluid-Situation wider-spiegeln, mit dreidimensionalen (3D) nu-merischen Modellierungen, die hydrogeolo-gisch und mit der Finiten-Elemente-Methode(FEM) realisiert werden, verknüpft. Dieaus den laufenden Pump- und den geplan-ten Injektionstests in der KTB-Vorbohrungresultierenden, sich ändernden Fluidsituatio-nen und damit einhergehenden Porendruck-Variationen sollen mit den hochauflösendenASKANIA Bohrlochneigungsmessern (AB-NM) an fünf Lokationen beobachtet werden.Im ersten Projektjahr soll zusätzlich an einerBohrung erprobt werden, wie sich der gleich-zeitige Einsatz eines ABNM und eines Bohr-
Abbildung 1: Finite-Element-Blockmodellzur Abschätzung der fluidinduzierten Defor-mation. Eine Störungszone, entsprechend derSE02 an der KTB-Lokation ist modelliert unddie Porendruck-Quelle befindet sich in 3670mTiefe.
lochseismometers im selben Bohrloch rea-lisieren lässt. Falls sich diese Kombinati-on erfolgversprechend einsetzen lässt, sollenim weiteren Projektverlauf auch die anderenABNM-Bohrungen mit Bohrlochseismome-tern bestückt und die seismologischen Datenin den Datenstrom des seismologischen Ober-flächennetzes eingebunden werden. Mit denABNM ist, instrumentell bedingt, die weltweithöchste Beobachtungsgenauigkeit von Nei-gungen der obersten Erdkruste garantiert. Infrüheren Arbeiten konnte wiederholt gezeigtwerden, dass diese Bohrloch-Instrumente ex-trem empfindlich auf Porendruck-Änderungenund Variationen der Fluid-Situation reagieren.Dies konnte sowohl für Sedimente als auch fürdas Kristallin nachgewiesen werden. Damit
Abbildung 2: Blick auf das halbe Modell: Diehorizontale Deformation zeigt Maximalbeträ-ge an der Störungszone und an der Erdober-fläche. Unter realistischen Randbedingungenwerden induzierte Neigungen von 3.4 msecberechnet. Die Auflösung der Neigungsmes-ser beträgt 0.2 msec.
192 Abstracts
sind die Pendel, die von uns zur Verfügung ge-stellt werden können, prädestiniert dafür, diegeplanten Pumpversuche durch ein entspre-chendes Monitoring zu begleiten.
Die von Beginn an gewonnenen, signi-fikanten Neigungen werden sowohl mit-tels hydrogeologischen- als auch über FE-Modellierungen interpretiert. Die beobach-teten, fluidinduzierten Neigungen sollen überdie Modellrechnungen verifiziert und letztend-lich bezüglich der hydrologischen Prozesse in-terpretiert werden. Zusätzlich sollen alle bis-lang vorliegenden geowissenschaftlichen In-formationen zur KTB genutzt werden und diezu erwartenden neuen Ergebnisse der paral-lel laufenden Projekte in die Modellierungeneinfliessen. Im Einzelnen wird folgender Er-kenntnisgewinn erwartet: 1) Entwicklung desVerständnisses von Prozessen, die von kluft-dominierten, lang- und aperiodischen Ände-rungen im hydraulischen Parameterfeld ge-steuert werden. 2) Quantifizierung der geome-chanischen Parameter der oberen Kruste durchdie definierten Versuchs- und Anregungsbe-dingungen durch die Pump- und Injektions-tests. 3) Aufschluss über die Heterogenitätund die Sensitivität des Parameterfeldes. Da-bei sollen auch geothermische und seismolo-gische Größen, insbesondere vor dem Hinter-grund der Schwarmbeben-Entstehung, mitbe-rücksichtigt werden.
Die bereits vorgenommenen Abschätzun-gen mittels FE-Modellierungen zeigen, dassdie durch Pump- und Injektionstests induzier-ten Deformationen mittels ABNM gemessenwerden können (Abb.1 und Abb.2). Die Kom-bination von hochauflösenden Neigungsmes-sungen an fünf Punkten in Verbindung mithydrogeologischen- und FE-Modellierungenermöglicht einen signifikanten Beitrag zurKlärung der durch Pump- und Injektions-tests verursachten Geo-Prozesse im Bereich
der KTB. Dies könnte insbesondere auch zurErforschung von fluidinduzierter Seismizität,wie sie für Schwarmbeben diskutiert wird, vongroßer Bedeutung sein.
Für die oberste Erdkruste im Bereich derKTB liegen extrem viele geowissenschaftlicheInformationen vor. Dies gilt für die gesam-te geologisch/geophysikalische Situation, ins-besondere auch für die Klüfte. Diese Tatsa-che ist sowohl für die Interpretation der be-obachteten Neigungen, als auch für die hy-drogeologischen und die FE-Modellierungenvon wesentlicher Bedeutung. Die geplan-ten Experimente in der KTB-VB stellen ei-ne definierte Anregung dar. In Verbindungmit den Neigungsbeobachtungen können dieÜbertragungseigenschaften der obersten Erd-kruste direkt modelliert werden. Die paral-lel stattfindenden Projekte, insbesondere dieseismologisch- und fluid-Ausgerichteten kön-nen einerseits weitere Randinformationen fürdie numerischen Modellierungen liefern, an-dererseits können natürlich auch andere Pro-jekte die hier gewonnenen Beobachtungenund Modellierungen berücksichtigen. Ver-knüpfungspunkte ergeben sich zu den Projek-ten und Untersuchungen: Hydrochemie undGeo-Hydraulik, Wasserwegsamkeiten, Geo-elektrik und den Fluid-untersuchenden Pro-jekten.
Kontinentale Tiefbohrungen 193
KT02 – Fr., 28.2., 09:50-10:10 Uhr · HS1Kulenkampff, J., Spangenberg, E. (Geoforschungszentrum Potsdam)
Gesteinsphysikalische Charakterisierung gashydrathaltiger SedimenteE-Mail: [email protected]
Methan kommt in sehr großen Mengen alsHydrat in Ozeanböden und in den Sedimentender Permafrostgebiete vor. Vorsichtige Schät-zungen dieser Methanvorräte übersteigen diebekannten Erdgasvorkommen um ein Vielfa-ches. Man könnte meinen, daß es sich loh-nen würde diese riesige und bisher kaum be-kannte Rohstoffquelle zu nutzen. Aus ei-ner Vielzahl von Gründen (Technik, Kosten,Havarie- und Umweltrisiken) steht die Erkun-dung von Gashydraten als Rohstoffquelle beiuns derzeit aber nicht im Vordergrund. Viel-mehr können latente und akute Gefahren vondiesem thermodynamisch fragilen Stoff aus-gehen. Insbesondere kann durch Erwärmungoder Druckentlastung Methan freigesetzt wer-den, das ein starkes Treibhausgas ist. Es istwenig Konkretes bekannt über die geologi-schen und physikalischen Voraussetzungen fürdie Bildung von Hydratlagerstätten und derenStabilität über geologische Zeiträume. Übli-cherweise werden bei Bohrungen Permafrost-und Hydratbereiche möglichst schnell durcht-euft und ausgebaut, weil diese Zonen instabilsind. Dadurch gibt es gewöhnlich kaum Infor-mation durch Bohrlochmessungen und keineBohrkerne.
Eine internationale Bohrkampagne im Nor-den Kanadas, die speziell auf die Erkundungdes Gashydratvorkommens ausgerichtet war,wurde vor einem Jahr unter Beteiligung desGeoforschungszentrums Potsdam unternom-men.
Im Rahmen dieses Projektes wurde einLaborinstrumentarium für die Untersuchungvon gashydrathaltigen Sedimenten unter in-
situ Bedingungen entwickelt. Diese Appara-tur (FLECAS: Field Laboratory Experimen-tal Core Analysis System) ermöglicht es, Ge-steinsproben im weitgehend stabilen tiefgefro-renen Zustand einzubauen und anschließendin den Bereich der die in-situ Bedingungen zubringen, wobei sich die Probe ständig im ther-mischen Stabilitätsbereich des Hydrats befin-det. Dabei kann ständig die elektrische Leit-fähigkeit sowie die Ultraschall-Kompressions-und Scherwellengeschwindigkeit erfasst wer-den. Außerdem ist die Messung des Porenvo-lumens und der Permeabilität möglich. Prinzi-piell ist die Apparatur einsetzbar für den Tem-peraturbereich von -20 bis 40° C, einen Po-rendruck bis 200 bar und einen lithostatischenDruck von 700 bar. Der Einbau einer Hei-zung erlaubt selbstverständlich auch die An-wendung bei höheren Temperaturen. Grund-sätzlich können durch die Möglichkeit des ge-frorenen Einbaus von Kernen unkonsolidier-te Sedimente untersucht werden, die im auf-getauten Zustand durch die Druckbedingun-gen konsolidiert werden, so dass das petrophy-sikalische Instrumentarium für den Bereichunkonsolidierter Sedimente deutlich erweitertwurde.
Die Apparatur hat sich als sehr zuverlässigerwiesen und es konnten hydrathaltige Kerneweit über das erwartete Maß hinaus untersuchtwerden. Es konnte der Beweis erbracht wer-den, dass Messungen an tiefgefrorenen Bohr-kernen, was bisher mangels geeigneter Gerätedas übliche Verfahren war, in keiner Weise be-friedigende Aussagen über die in-situ Bedin-gungen liefern. Dagegen sind die Resultate
194 Abstracts
von FLECAS mit Bohrlochmessungen direktvergleichbar und erlauben somit ihre Kalibrie-rung und die Verifizierung petrophysikalischerModelle.
Wichtige Ergebnisse konnten bereits an-hand synthetisch erzeugter gashydrathaltigerSande gewonnen werden, die nach Errei-chen eines möglichen in-situ Zustandes durchDruckentlastung zum zersetzen gebracht wur-den. Es zeigt sich, dass die damit einhergehen-de Widerstandsänderungen und die Änderun-gen der Ultraschallgeschwindigkeiten überra-schend gering ausfallen, dagegen eine außer-ordentlich deutliche Amplitudenzunahme desUltraschallsignals erfolgt. Umgekehrt trittsehr starke Absorption auf wenn das zu Eisgefrorene Porenwasser schmilzt, während dasHydrat sich noch im Stabilitätsbereich befin-det. Das Hydrat wirkt im Porenraum - trotzmechanischer Sprödheit und elastischer Steif-heit - als starker akustischer Absorber. Mögli-cherweise handelt es sich um einen Wechsel-wirkungsprozeß zwischen Wasser und Hydrat,der mit geringen Mengen von Gasentwicklungeinhergehen könnte.
Webseite: http://www.gfz-potsdam.de/pb5/pb52/projects/gashydrat/welcome.html
Kontinentale Tiefbohrungen 195
KT03 – Fr., 28.2., 10:10-10:30 Uhr · HS1Gräsle, W., Kessls, W., Rifai, H. (Hannover, Leibniz Institute for Applied Geosciences (GGA))
A new flow-log technique suitable for small flow rates tested in the 4000 m pilot boreholeof the KTBE-Mail: [email protected]
Method:Due to low transmissivities in the open hole
section of deep drillings conventional flow-log techniques, which are only applicable forrather high flow velocities in the well, requireintense pressure changes in the borehole. Inmany cases this is undesirable either with re-spect of the corresponding technical require-ments or because further studies would be dis-turbed by the strong pressure signal.
Therefore, a flow-log technique suitable forvery low flow rates (flow velocities downto 5 · 10−5 m/s in the drilling) has been devel-oped and tested in the pilot borehole of theKTB (depth 4000 m, open hole 3850-4000 m).It requires the existence of a pronounced salin-ity gradient in the well. Applying a low in-jection pressure (approx. 0.1 MPa) by simplyfilling up the borehole, the freshwater to salt-water transition was pushed downward. Thiswas monitored with a mud-resistivity-pressurelogging tool (MRP-tool). The MRP-tool was
Figure 1: Comparison of drawdown test andflow-log results
moved down in steps of several meters, sep-arated by standstill phases of several hours ina way that it was always located close to thesteepest part of the salinity gradient.
Within a sequence of step-down and stand-still phases, the same salinity is measured re-peatedly at different times and depths. Theflow rate Q can be calculated from the verticaland temporal distances (Δz and Δt) betweensubsequent recordings of the same salinityvalue: Q = A ·Δz/Δt. The accuracy of flowrate determination can be improved by calcu-lating ΔV = A ·Δz and Δt for any salinity valueavailable within a standstill phase. Thus, theflow rate is given as the slope of the ΔV (Δt)-relationship.
Since flow rate calculation is based on depthdifferences Δz a high differential accuracy ofdepth data is required. A twisted shape of theborehole causes intense cable friction result-ing in a delay of MRP-tool movement rela-tive to cable movement (measured at surface)when cable movement starts or stops. This re-sults in relevant differential errors in the depthraw data. Thus, depth correction has to beperformed using the high resolution pressure
Table 1: The permeability model
196 Abstracts
measurements of the MRP-tool. During cablemovement the pressure records show strongoscillations probably induced by cable fric-tion. These have to be eliminated first by fit-ting smooth functions to enable depth correc-tion.
To derive a permeability profile from flow-log data requires knowledge of the total in-jection rate Qtot(t) (measured at surface) anda permeability model including some simpli-fications. Neglecting vertical permeabilitiesand assuming the same characteristic b(t) oftransient behaviour of the injection process forany depth, the vertical flow rate in the well atdepth z is given by
Q(z, t) = b(t)∫ z
zbotK (zz)
[p(zz, t)− peq (zz)
]dzz
With: zbot = bottom of drillingK (z) = permeability at depth z (a fracture with
transmissivity Tf at depth z f would berepresented by δ(z− z f )Tf )
p(z, t) = actual fluid pressure in the wellpeq (z) = initial equilibrium pressure in the for-
mation, known from a pressure-logpreceding the injection test
Thus, the characteristic of transient behaviourgets eliminated from the ratio R(z, t) =Q(z, t)/Qtot(t):
R(z, t) =
∫ zzbot
K (zz)[p(zz, t)− peq (zz)
]dzz∫ ztop
zbotK (zz)
[p(zz, t)− peq (zz)
]dzz
With: ztop = position of the casing shoe
The parameters of a permeability model K(z)can be determined by fitting the observedR(z, t)-data, except for a constant factor. Areasonable choice for this factor is the totaltransmissivity Ttot of the open hole section.This should be determined more reliably by anindependent hydraulic test involving larger in-jection or extraction volumes.
Results from the KTB pilot borehole:
To verify the flow-log results, a small vol-ume drawdown test has been carried out sub-sequent to the injection test to detect hydrauli-cally relevant fractures. Highly saline forma-tion fluid drawn from fractures would causesalinity plumes in the borehole, which is filledwith a low salinity fluid at that time. Lowerboundaries of salinity plumes mark fracturepositions. A relevant fracture was foundat 3946.5 m (see figure). The rise of salinefluid from the bottom indicates another rele-vant hydraulic pathway below 3980 m.
A pronounced jump in the R(z, t)-data be-tween 3940 m and 3947 m offers an indepen-dent affirmation of the detected fracture. Fur-thermore, the extrapolation of the R(z, t)-dataresults in values clearly greater than 0 at thebottom of the borehole, thus validating the as-sumption of another fracture below 3980 m.
Based on these observations, a permeabil-ity model assuming two fractures (3946.5 mand 4000 m) and sections of constant perme-ability between these fractures was fitted to theR(z)-data. The results prove the dominance offracture transmissivity (approx. 75 %) com-pared to diffuse transmissivity in the fault zoneof the crystalline crust penetrated by the KTBpilot borehole.
198 Abstracts
MA01 – Do., 27.2., 15:00-15:20 Uhr · HS3Harder, H., Hansen, U. (Münster)
Eine Finite Volumen Methode zur numerischen Lösung des DynamoproblemsE-Mail: [email protected]
Bisherige numerische Modelle des Geody-namos sind überwiegend im Parameterbereicheiner Ekman Zahl von E = 10−3 bis 10−6
berechnet worden, während für den flüssigenErdkern eine weit geringere Ekman Zahl vonE = 10−15 anzunehmen ist. (Ekman Zahl= Viskosität / Rotationsrate der Erde). Eskann mit Sicherheit erwartet werden, dass ei-ne derartige Diskrepanz weitgehende Auswir-kungen auf die modellierten Dynamoprozes-se hat. Um dieses Problem zu überwinden,entwickeln wir zur Zeit eine neue Finite Vo-lumen Methode zur Lösung von Dynamopro-blemen. Da sich ein derartiger Ansatz wesent-lich besser für massiv paralleles Rechnen eig-net als etablierte Spektralverfahren, erwartenwir in Zukunft Modelle mit wesentlich höhe-rer Aufl% ösung und damit auch in erdähnli-cheren Parameterbereichen berechnen zu kön-nen.
Die Entwicklung der thermischen und strö-mungsmechanischen Lösungsalgorithmen istweitgehend abgeschlossen. In diesem Beitragkonzentrieren wir uns daher auf Testlösungender magnetischen Induktionsgleichung, aberauch auf Lösungen des vollständig gekoppel-ten Dynamoproblems.
Geodynamo und Geomagnetismus 199
MA02 – Do., 27.2., 15:20-15:40 Uhr · HS3Kutzner, C., Christensen, U. (Göttingen)
Der Einfluß des Mantels auf den umpolenden GeodynamoE-Mail: [email protected]
Der Erdmantel ist für den Geodynamowichtig, weil er bestimmt, wieviel Wärmeaus dem Kern abtransportiert werden kann.Seismologische Untersuchungen des unterenMantels (der D”-Schicht) zeigen laterale Un-terschiede in der Wellengeschwindigkeit. Die-se Unterschiede können als Temperaturan-omalien gedeutet werden. In den kalten Ge-bieten am Boden des Mantels ist der Wär-mefluß aus dem Kern größer, in den war-men Gebieten kleiner als der durchschnittlicheWärmefluß. Anhand eines dreidimensionalennumerischen Dynamo-Modells wird der Ein-fluß von Wärmeflußvariationen an der Kern-Mantel-Grenze (KMG) untersucht. Wir be-finden uns mit den Modellparametern in ei-nem Bereich, wo chaotische Umkehrungendes Magnetfeldes auftreten. In dem Refe-renzmodell (ohne Variationen des Wärmeflus-ses an der KMG) wechselt das Magnetfeldeinige Male pro Million Jahre seine Polari-tät. Es werden nun verschiedene einfache, zu-nächst nur breitenabhängige Wärmeflußvaria-tionen an der KMG vorgegeben, während derGesamtwärmefluß aus dem Kern konstant ge-halten wird. Hoher Wärmefluß an den Po-len stabilisiert den Dynamo, d. h. das Di-polfeld ist in diesen Modellen stärker und dieUmpolhäufigkeit geringer als im Referenzmo-dell. Die Modelle mit niedrigem Wärmeflußan den Polen haben ein deutlich schwäche-res Dipolfeld und kehren häufiger um. Alsnächster Schritt wird ein longitudinal variie-render Wärmefluß vorgegeben (Kugelfunkti-onsgrad zwei, Ordnung zwei), und untersucht,ob Polumkehrungen entlang bevorzugter Län-
gen stattfinden. Dazu werden an zufällig aufder Oberfläche verteilten Stationen virtuellegeomagnetische Pole (VGP’s) berechnet. Ob-wohl das Feld während der Umkehrungen vonnicht-Dipol-Komponenten dominiert wird, er-gibt sich eine Häufung von VGP’s an Stellenmit hohem Wärmefluß. Das ist konsistent mitdem, was Paläomagnetiker für die Umkehrun-gen unserer Erde finden: eine Häufung vonVGP’s in Regionen mit hoher seismischer Ge-schwindigkeit am Boden des Mantels.
200 Abstracts
MA03 – Do., 27.2., 15:40-16:00 Uhr · HS3Wicht, J. (Göttingen), Olson, P. (Baltimore), Kutzner, C. (Göttingen)
Simulierte geomagnetische Feldumkehrungen im Detail betrachtetE-Mail: [email protected]
Feldumkehrungen sind wohl die spekta-kulärsten und interessantesten Ereignisse imGeomagnetismus. Paläomagnetische Beob-achtungen können nur ein grobes Bild die-ser Vorgänge zeichnen. Ihnen fehlt die zeitli-che und räumliche Auflösung für eine genaue-re Analyse. Zudem können sie nur Auskunftüber das Feld an der Kern-Mantel-Grenze ge-ben. Dynamosimulationen hingegen liefernein komplettes Bild der dynamischen Prozes-se einer Feldumkehr, mit der Einschränkung,daß die Numerik nicht erlaubt alle geophysi-kalischen Parameter korrekt nachzubilden.
Wir konzentrieren uns auf wenig überkri-tische Dynamos bei relativ großen Ekman-Zahlen. Diese einfachen Modelle erlaubenes noch die räumlichen Strukturen und zeit-lichen Abläufe anschaulich zu visualisieren.Gleichzeitig sind sie Magnetfelden dem geo-magnetischen Feld recht ähnlich. Animatio-nen der Vorgänge in Verschiedenen Schnit-ten durch die dreidimensionalen Lösungen de-monstrieren die internen Abläufe. Ein beson-dere Rolle spielt der imaginäre Tangentialzy-linder, der den inneren Kern mit der Kern-Mantel-Grenze verbindet und parallel zur Ro-tationsachse verläuft. Feld entgegengesetzterPolarität wird bevorzugt im Tangentialzylin-dern erzeugt, muss jedoch nicht zwangsläu-fig eine kompletten Feldumkehrung nach sichziehen. Erst wenn die Zellen entgegengesetz-ter Polarität außerhalb des Tangentialzylindersgeraten, können sie durch die meridionale Stö-mung nahe der Kern-Mantel-Grenze über dengesamten Kern verteilt werden. Feldumkeh-rungen hängen damit wesentlich sowohl von
der Stärke der Konvektion im Tangentialzy-linder als auch von der Zirkulation außerhalbdieser Barriere ab. Letztere könnte die Dauereiner Feldumkehrung bestimmen.
Webseite: http://www.uni-geophys.gwdg.de/ wicht/movies.html
Geodynamo und Geomagnetismus 201
MA04 – Do., 27.2., 16:30-16:50 Uhr · HS3Webers, W. (Potsdam)
Probleme und Vorteile für die Nutzung simultaner Magnetfelddaten von der Erdoberflä-che bzw. von SatellitenE-Mail: [email protected]
Jedes globale Magnetfeldmodell z.B. inForm der Kugelfunktionsentwicklung (SHA)für das geomagnetische Innenfeld wird auf ei-ne Referenzkugel bzw. ein Referenzellipso-id bezogen. Hierfür wird i.a. die Erdober-fläche gewählt. Damit ergibt sich für die-se eine quasi zweidimensionale Felddarstel-lung mit gewisser Approximationsqualität inAbhängigkeit vom Abbruchindex N der SHA.Aus diesem Feldmodell kann - jedoch nur ba-sierend auf dessen Qualität - das Feld für jedenPunkt des Außenraumes bestimmt werden. Dadas SHA-Modell mathematisch nur eine end-liche Partialsumme einer unendlichen Reihen-entwicklung ist, ergibt der Bezug des Mo-dells auf konzentrische Referenzkugeln bzw.-ellipsoide andere Konvergenz- und Appro-ximationsgüte. Dies beinhaltet gleichzeitigentsprechend der Potentialtheiorie den unter-schiedlichen physikalischen Gehalt der jewei-ligen Feldmodelle konzentrischer Referenz-flächen. Wie bekannt gibt es nur dann ei-ne eindeutige Zuordnung zwischen Feld undFeldquelle, wenn das Feld in allen Punktendes dreidimensionalen Raumes, d.h. auch imQuellbereich, bekannt ist (vgl.u.a. Diessel-horst, 1939). Dies liegt demzufolge praktischniemals vor. Notwendigerweise sind Feldfort-setzungen auf konzentrische Referenzflächennach oben wie nach unten Inversionsaufgabenmit Nichteindeutigkeit der Lösung. Insofernbieten simultane Feldmodelle, unabhängig aufkonzentrischen Referenzflächen bestimmt, so-wie diese im Vergleich zu mathematischenFeldfortsetzungen wichtige physikalische In-
formationen. Diese sind im Falle des Magnet-feldes z.B. nutzbar für die Feldtrennung In-nenfeld/Außenfeld. Die Rechnungen für Da-ten der Erdoberfläche und zu denen der Satel-liten Oersted und Champ zeigen Details, wieder theoretisch/mathematische Sachverhalt fürphysikalische Interpretationen genutzt werdenkann. Die hohe Datenqualität der Oberser-vatoriumsdaten und der Satellitendaten mög-lichst ausschöpfend zu nutzen, verlangt not-wendigerweise, diese mathematischen Fragenbesser zu approximieren als allein über dieeinfache Approximation der Feldtransformati-on durch das Radienverhältnis der konzentri-schen Referenzflächen.
202 Abstracts
MA05 – Do., 27.2., 16:50-17:10 Uhr · HS3Reinders, J., Hambach, U., Zöller, L. (Bayreuth), Frechen, M. (Hannover, GGA)
Hochauflösende Paläomagnetik in warmzeitlichen terrestrischen Sedimenten − Untersu-chungen in Lössen, Travertinen und Seesedimenten der Klimastufen 5 und 7E-Mail: [email protected]
Vorrangiges Ziel dieses Forschungsvorha-bens im Rahmen des SPP 1097 “Erdmagne-tische Variationen“ist es, die säkularen Va-riationen des Paläomagnetfeldes (PMF) hoch-auflösend zu dokumentieren. Wir hoffen eincharakteristisches paläomagnetisches Signalim Zeitraum zwischen ungefähr 110.000 −95.000 Jahren vor heute in unterschiedlichenSedimenten bestätigen zu können, und die bis-her erzielte zeitliche Auflösung zu erhöhen.Dieses “Führungs−“Signal ist in der Abbil-dung schematisch dargestellt. Die Amplitudenvon Deklination und Inklination sind kurzzei-tig so groß, dass sie nicht mehr in den Bereichder “normalen“Säkularvariation des PMF fal-len. Die Signalform und das Phasenverhält-nis der bisher untersuchten Komponenten De-klination und Inklination legen nahe, dass esvon einer stationären Nichtdipolquelle hervor-gerufen wurde, die im Nordatlantik wirksamwar. Dort polte sie wahrscheinlich das PMFregional um. Weiterhin können wir mit denvorliegenden Daten vermuten, dass die Quellesich nur sekundär, als Folge eines geringerenDipolmomentes mit der beobachteten, großenAmplitude bemerkbar gemacht hat.
Bisher glauben wir paläomagnetische Auf-zeichnungen dieses Signals in drei verschie-denen sedimentären Archiven nachweisen zukönnen. Durch die Dokumentation in Archi-ven aus sehr verschiedenen Ablagerungsräu-men hoffen wir bewiesen zu haben, dass essich bei der beobachteten, kurzzeitigen Exkur-sion des PMF − Größenordnung der Dauersicher kleiner 3000 Jahre − nicht um zufälli-
ge, ungefähr zeitgleiche sekundär oder diage-netisch veränderte Remanenzen handelt. Wirhoffen, insbesondere die zeitliche Auflösungbei weiteren angestrebten Beobachtungen desSignals in einem begrenzten Gebiet Mitteleu-ropas erhöhen zu können. Insbesondere wol-len wir auch das Verhalten des Dipolmomentsdes PMF als Kurve der so genannten relativenPaläointensität untersuchen.
Durch die Ausweitung des Untersuchungs-zeitraums auf die gesamte Klimastufe 5 undweitergehend auf die vorletzte Warmzeit (Kli-mastufe 7) soll geklärt werden, ob es sichbei der vermuteten Quelle um einen kurzfris-tig wirksame − “zufällige“− Region inversenmagnetischen Flusses handelt, oder ob sie alsessentieller Teil des Geodynamos zu deutenist. Bei weiteren Analysen wollen wir danndie Phasenbeziehungen zwischen den paläo-magnetischen Daten, − so der Nachweis ge-lingt, dass es sich um echte Feldaufzeichnun-gen handelt, − und Klimaänderungen untersu-chen. Für diesen Aspekt der geplanten Arbei-ten ist es natürlich unerlässlich, dass beide, pa-läomagnetische und paläoklimatische Daten-sätze an einem Objekt erhoben werden. Nurso können wir hoffen die erforderliche Klar-heit über die zeitlichen Abläufe zu erhalten.Gesteinsmagnetische Untersuchungen werdenauch an dieser Stelle eingesetzt werden, umdie Gleichzeitigkeit von Matrix und Rema-nenz zu testen.
Neben dem Beitrag zur Grundlagenfor-schung − d.h. der Erstellung hochauflösen-der, hochgenauer paläomagnetischer Daten-
Geodynamo und Geomagnetismus 203
Abbildung 1: Schematische Darstellung, des paläomagnetischen Muster während der Klima-stufe 5.3. Links ist der Verlauf der Inklination als Abweichung von der Inklination eines geo-zentrisch axialen Dipolfeldes (GAD) dargestellt. Rechts ist die idealisierte Kurve des Deklina-tionsverlaufs gezeigt.
sätze, die geeignet sind, auch als Testdaten-sätze für die Modellierung des Geodynamoszu fungieren − erwarten wir auch für andereFragestellungen wertvolle Daten. Insbesonde-re die Paläoklimaforschung wird von dem Er-kenntnisgewinn durch die notwendigen hoch-genauen Datierungen der verschiedenen Se-dimentarchive profitieren. Die zu erstellen-de paläomagnetische Musterkurve wird natür-lich als Eichkurve für genaue paläomagneti-sche Datierungen und Korrelationen nutzbarsein.
DFG-Fördernummer Ha2193/7−1
Marine Geophysik 205
MG01 – Mo., 24.2., 11:00-11:20 Uhr · HS7Reston, T., Perez-Gussinye, M., Phipps Morgan, J., Ranero, C.R. (GEOMAR Research CentreKiel)
The formation of non-volcanic rifted margins by the progressive extension of the lithos-phereE-Mail: [email protected]
Rifted margins include two main end–members: those termed “Volcanic Rifted Mar-gins – VRMs” where magmatism is muchmore voluminous than predicted by passiveasthenospheric upwelling (e.g. White et al.,1989), and those where magmatism is consis-tent or even less than the same predictions.The latter are termed “Non–Volcanic RiftedMargins – NVRMs” to emphasise the contrastwith the VRMs: the name does not exclude thepresence of minor amounts of magmatic activ-ity. The NVRMs are typified by the North Bis-cay, south Australian, SW Greenland, and theWest Iberian margins, which share a numberof common characteristics:
• extreme crustal thinning, increasing to-wards the ocean;
• presence of well–defined rotated faultblocks. However at the feather edge ofthe continent the amount of extensionthat can be inferred from the geometry ofthese faults is far less than that indicatedby the crustal thinning observed. Thisis the so–called extension discrepancy re-ferred to by some authors;
• presence in places of a detachment faultat the base of the fault blocks;
• little evidence for synrift magmatism;
• the presence of a broad zone of partiallyserpentinised mantle (Boillot et al., 1988;Whitmarsh et al., 1996; Krawczyk et al.,
1996; Pickup et al., 1996), both occurringbeneath the highly thinned and faultedcontinental crust of the continental riseregion, and as a zone of exhumed con-tinental mantle, now largely buried bypostrift sediments.
In this presentation, I consider how suchmargins are the logical result of progressiveextension of continental lithosphere abovecool sub–lithospheric mantle. The key fac-tors controlling the development of the mar-gin may be the rheological evolution of thecrust and the way this controls the serpentini-sation of the uppermost mantle, the occurrenceof multiple phases of faulting, so that the lat-est phase does not reveal the entire rift his-tory, and the temperature structure of the sub–continental mantle.
206 Abstracts
MG02 – Mo., 24.2., 11:20-11:40 Uhr · HS7Ehrhardt, A., Hübscher, C., Gajewski, D. (Institut für Geophysik, Universität Hamburg)
The Northern Gulf of Aqaba(Elat): surficial sediment tectonics above crustal pull–apartbasinsE-Mail: [email protected]
Along the sinistral strike–slip fault of theDead Sea Transform (DST) that separates theArabian Plate from the Sinai–Sub Plate andconnects the Red Sea Rift in the south withthe Taurus–Zagros orogenic belt in the north,several pull–apart basins have been developed.The Gulf of Aqaba (Elat), located at the south-ern part of the DST, contains three large pull–apart basins, with the Elat–Deep as the north-ernmost and largest basin. The northern endof the Gulf of Aqaba, the Gulf’s Head, is atransition zone between the Elat–Deep and theArava–Valley, onshore. In this transition zonethe main strike–slip motion steps over fromthe eastern rift shoulder of the Elat-Deep tothe western boundary at the Arava–Valley onland.Because of its marine environment, this area isa unique location to study pull–apart basin de-velopment and the transition of the strike–slipfaulting with marine geophysical methods. Byperforming a dense multichannel seismic andHydrosweep-bathymetrical survey, sedimen-tary units were determined as pre– and syn-tectonic (concerning the development of theElat–Deep), and a fault system was mapped.This information was used to derive a modelfor the development of the Gulf’s Head.The model shows that the strike–slip motionon the eastern boundary of the Elat–Deep,well indicated by the eastward tilted sedi-ments, has no sharp left–lateral step–over tothe western side, but has a transition zone,where the main strike-slip motion is compen-sated at both boundaries, well expressed by
symmetric sedimentary layers. The model in-dicates that the sediments in the northern Gulfof Aqaba are decoupled from the basement,and that the formation of the Gulf’s Head isthe response of the detached sediments to theleft–lateral crustal strike–slip motion betweenthe Arabian– and the Sinai Sub–plate. Thus,the left–lateral step–over and the left–lateralmotion are responsible for the development ofthe Elat–Deep, but the shape is controlled byinduced sediment tectonics above the crustalpull–apart basin.
34˚ 48'E 34˚ 54'E 35˚ 00'E
29˚ 24'N
29˚ 30'N
29˚ 36'N
-800
-800
-600
-600
TransitionZone
ArabianPlate
Sinai−SubPlate
Elat
Deep
Arav
a Vall
ey
Figure 1: Northern part of the Gulf ofAqaba(Elat). Transition from the Elat–Deepto the Arava–Valley
Marine Geophysik 207
MG03 – Mo., 24.2., 11:40-12:00 Uhr · HS7Dehghani, G. A., Aboulel, H. (Universität Hamburg)
MARINE GRAVIMETRIC AND MAGNETIC INVESTIGATIONS WITHIN THEAREA OF THE SOUTHEASTERN MEDITERRANEAN SEA AND THE NORTHERNSECTION OF EGYPTE-Mail: [email protected]
The southeastern Mediterranean Sea andthe northern section of Egypt constitutes oneof the most important and complex tectonic ar-eas. A wide range of field work obtained fromthe marine potential field geophysical data onthe southeastern Mediterranean Sea and thenorthern section of Egypt has been acquiredfrom Meteor 25/4 expedition during July-August, 1993, Meteor 40/1 expedition dur-ing November, 1997, GEODAS (GEOphysi-cal DAta System) Data bank, B. G. I. (Bu-reau Gravimétrique International) and Etopodata to throw some light on the marine bathy-metric and topographic features pattern of theinvestigated area, to deduce the major tec-tonic trends prevailing in the region throughusing the potential field data, and to per-form two and three-dimensional density grav-ity models within the regional tectonic con-cepts constrained by the seismic data. Newfree-air, Bouguer, and total intensity magneticanomaly maps were constructed for the studyarea. A qualitative interpretation of the ob-served potential anomalies show a good cor-relation between the main tectonic featuresand the distribution of the potential anoma-lies. The regional gravity anomaly field val-ues in the study area generally decreases to-wards the E-W and SE directions. The causeof the regional gravity trend is the transitionfrom oceanic crust of the Eastern Mediter-ranean to the continental crust of the Arabianplate. The regional magnetic anomaly fieldin the study area on the other hand are dom-
inant in NW- SE trends and increases towardsthe north, which may reflect the shallow depthof the basement rocks in this direction. Theresidual gravity and magnetic anomalies re-flect the effect of the difference in density be-tween the crystalline or igneous crust and thesediments, the variation of the basement ge-ometry and also the effect of the bathymetricand topographic features. Trend analysis tech-nique of the structural pattern has been appliedfor the potential anomaly maps and revealedthat the structural pattern of the area is amongfour major trends affected and arranged ac-cording to their predominance and percentageas follows: the NW-SE trend (Suez-trend), theNE-SW trend (Qattara-Eratosthenes trend),ENE-WSW trend and NE- SW (Aqaba trend).Based on the available seismic velocity, twoand three-dimensional density gravity mod-els were constructed along four seismic pro-files crossing the main tectonic elements inthe study area. The results of the two andthree-dimensional density gravity modellingare presented and their ensures that the pre-sented models satisfy and agree with the ob-served gravity field, regarding geometry andstructural features in a regional setting. Thetransition of the oceanic-continental crust oc-curs near the coast of Israel, the Mohorovicic(Moho) lies at a depth of approx. 32 km be-neath Cyprus, and at a depthof approx. 27km at the coast of Israel.The deep parts of theLevantine Basin is covered by approx. 13 kmof thick sediments. The Moho depth varies
208 Abstracts
Figure 1: Research Area
from approx. 26 km beneath the EratosthenesSeamount to approx. 23 km under the LevantBasin. The depth to the basement lies at ap-prox. 6 km beneath the Egyptian coast. How-ever, the thickness of the sedimentary layer in-creases towards the East Mediterranean Ridge.The basement depth varies from approx. 9 kmat the Egyptian coast to approx. 13 km in theHerodotus Abyssal Plain and beneath the EastMediterranean Ridge.
Web page: http://www.geophysics.dkrz.de
Marine Geophysik 209
MG04 – Mo., 24.2., 12:00-12:20 Uhr · HS7Hübscher, C. (Hamburg), Ben-Avraham, Z. (Tel-Aviv), Dehghani, A., Gajewski, D. (Hamburg),Gohl, K. (Bremerhaven), Pätzold, J. (Bremen), GEMME Working Group
New data from the easternmost Nile system - the GEMME projectE-Mail: [email protected]
In order to investigate the tectonic and sedi-mentary setting of the southern Levantine con-tinental margin as well as the Late Quater-nary paleoceanography of the outer Nile Conea geophysical and geological survey was car-ried out in the eastern Mediterranean betweenFebruary 4th and March 7th 2002. For the socalled GEMME project the German researchvessel METEOR (cruise M52/2) operated for5 weeks in the territorial waters of Israel (LegA; February 4th to 25th) and Egypt (Leg B;February 26th to March 6th). The data setincludes 2 refraction lines (15 OBS, 5 OBHon each line) and about 2500 km multichan-nel seismic data (44 profiles). A magnetome-ter (gradiometer) was deployed along the re-flection seismic measurements. Gravity andhydroacoustic data have been collected con-tinuously on a 24/7 schedule. About 3500km of relevant potential field data have beengained. 30 piston cores including multicor-ers have been collected along 4 selected pro-files, the sample sites have been carefully se-lected from the hydroacoustic systems, whichinclude swathsounder data (Hydrosweep) and4 kHz narrow beam echo sounder data (Para-sound). The multicorer samples and gravitycorer samples permit the investigation of thecomplete Holocene sequence. The first ob-jective of the geophysical part of the programis to reconstruct the Plio-Quaternary evolutionof the continental margin of southern Israelby means of sequence stratigraphy. The Post-Messinian sediment prism is considered torepresent the easternmost deposition center for
Nile derived sediments. This analysis shouldassist in understanding local as well as re-gional stratigraphic and tectonic features likestrike-slip movement and constrain quantita-tive parameters such as subsidence, sedimen-tation rates and sea-level changes. Correlationof local sequence boundaries with global andMediterranean events may provide age con-straints to the processes mentioned above. Thesecond objective is to create a 3D-model ofthe entire crust consisting of crystalline base-ment, pre-, syn-, and post-Messinian layers.This model, which will be based on potentialfield, refraction seismic and industry reflectionseismic data, represents the tectonic frame andis crucial for any subsidence analysis. Theparticular scientific questions were: How didchannel levee complexes evolve on the outerNile Cone? How reflects the Post-Messiniansediment prism the interplay between sedi-ment input, transport mechanisms, uplift andsubsidence, halokinetics, and sea level and cli-mate? What is the source of gassy clasticsediments above the basal Pliocene unconfor-mity? What is the relation between salt tec-tonics and gas/fluid migration? What causedthe dominant disturbances (Gaza, Palmahim,Dor) along the continental slope off Israel? Ofwhat kind is the transition from south of theCarmel fault to north of it in terms of basementand sediment structures? How important isthe Pelusium lineament regarding the dynamicof the ocean-continent boundary? Where isthe transition between oceanic and continen-tal basement in the eastern Mediterranean, and
210 Abstracts
what is the relation to the Dead Sea TransformFault?
A striking observation in the reflection seis-mic data was that the landward terminationof Messinian evaporites coincides with faultsin the Plio-Quaternary sediments above. Atthe northern margin, where the termination islocated beneath the slope, faults have beenproduced within the prism. Frequently pin-nacle like structures can be observed on theseafloor in the vicinity of the faults. To sum-marise the occurrence of pinnacles it can bestated that they occur above faults or slumps.We assume that slumping or faulting inter-rupts stratigraphic seals, which prevent up-ward gas migration. Mass transport processesand faulting are strongly correlated to salt tec-tonics. At the seafloor carbonates may be pro-duced when calcium is taken from the wa-ter column and carbon from methane. OffHaifa we investigated the tectonic activity ofthe Carmel (Yagur) fault with 18 MCS lines.A newly discovered active fault proofs the tec-tonic activity of that region. The landwardprolongation of this fault aims at the regionsouth of Mount Carmel and was not knownbefore. The final seismic profile grid coversthe transition from the southern EratosthenesSeamount to the Nile Cone. Messinian evap-orites and the Nile derived Plio-Quaternarycover sequences stop abruptly at the south-ern flank of the seamount at the so-called NileScarp. A magnetic and gravity anomaly, indi-cating basement structures and the presence oflow-density salt respectively mark the north-ern Nile Cone. All together 5 MCS lines crossthe Nile Scarp to investigate tectonic activityof this region. The paleoclimate history ofthe Nile deposits will be studied from the ex-tensive sediment core collection. Four differ-ent sediment profiles were covered, i.e. threecore transects representing the three differ-
ent provinces (western, central, eastern) of theNile fan and one core transect across the con-tinental margin of southern Israel. High reso-lution dating by AMS 14C will reveal detailedchronologies in proximal and distal provincesof the marine Nile fan. A set of high resolutionlogger methods (color, MSCL-Data, XRF-Scanner) will be used to establish sedimento-logical and geochemical chronologies of theNile fan sedimentation. High resolution geo-chemical (Corg, CaCO3) and stable isotopechronologies (d18O, d13CCaCO3, d13CCorg,d15N) will reveal climatic and oceanographicchanges in the southeastern Mediterreaneanunder the impact of the Nile. Special empha-sis will be given to reconstruct the late glacialand Holocene climatic record and to compareit with the terrestrial archives of African andMiddle East climate change. It will be alsopossible to reconstruct changes in sedimenta-tion in post-Aswan times.
Marine Geophysik 211
MG05 – Mo., 24.2., 12:20-12:40 Uhr · HS7Hübscher, C., Gajewski, D., Grobys, J. (Hamburg), Kukowski, N. (Potsdam), Netzeband, G.,Wagner, M. (Hamburg), Bialas, J. (Kiel)
Complex BSR Pattern in the Yaquina Basin off Peru: Implications for Impact of Aniso-tropic Permeability and TectonicE-Mail: [email protected]
The Yaquina Basin is a forearc basin lo-cated on the Peruvian upper continental slopebetween 8S and 9S. In the northern part ofthe basin a terrace like feature rests below theshelf break in water depth between 400 m and1200 m. The slope gradient increases sea-wards and towards the Peru Trench. Here,the Nazca Ridge is subsided beneath the An-des. High-resolution MCS data from theYaquina Basin reveal a complex pattern ofBSRs. The observed BSRs show a wide vari-ation in strength and continuity in dependenceto stratigraphy, structure and gas- or fluid flow.In the central deposition center of most pro-files a strong, concordant BSR is observed atthe estimated depth of the base of the gas hy-drate stability zone (BGHS). The reflection isbent at faults but conform with the stratigra-phy, which runs almost parallel to the seafloor.The reflection amplitudes above are reducedand beneath reflections are first obscured andthan blanked. Obviously gas migrates ups-lope and parallel to the stratigraphy. Furtherdownslope where the stratigraphy dips againstthe slope, the BSR changes into a weak, butcontinuous and now discordant BSR. The re-flections above and beneath these BSR arenot obscured. Again fluid migration happensalong the stratigraphy towards the sea floor.At the lower basin we observe a strong butdiscontinuous BSR, which is hummocky tostratigraphy and disrupted by faults. Beneaththis patches blanking is observed. Accord-ing to the Blake Ridge we assume gas hy-
drate patches within the GHSZ, which meansthat gas migrates into the GHSZ. At someMCS lines we observe interrupted chaotic re-flection patches presumably marking the up-per and lower boundary of the GHSZ. In oneline a clear and crisp double BSR is presentat the assumed BGHS, they a separated by20-30 ms. Gas and gas hydrate saturation,tilting, and anisotropic permeability may ex-plain the observed lateral variation of the seis-mic characteristic of the BGHS and gas/gashydrate bearing Plio-Quarternary sediments inthe Yaquina Basin. The sediment infill ofthe Yaquina Basin consists of alternating highand low permeable strata. Upwards migratinggas splits at a hinge zone. At both sides ofthe hinge zone, layers dip in an opposite di-rection. Upslope the hinge zone the BGHSruns conformable to the strata. Both low-permeable strata and gas hydrate bearing high-permeable strata form a seal which preventsupward flow across the strata. Beneath theseal, the gas migrates along permeable lay-ers. A vertical faults displaces the permeablelayers and forms a lateral gas trap and gasaccumulates here. Further upslope little gasis present and the reflection from the BGHSis shifted to the seafloor where it terminates.Where the BGHS is disrupted by a fault gasescapes from beneath and migrates upwards.The section on the other side of the hinge zonehas been tilted which shifted the GHSZ up-wards with respect to the sediment. As a con-sequence gas hydrate dissociated. The seal
212 Abstracts
has been broken and gas formerly trapped be-neath the previous BGHS can escape. Thegas migrates upwards along permeable layersand, if present, along faults. When it reachesthe undisturbed turbiditic cover sequence, thegas migrates across the strata upwards and es-capes at the seafloor, where chemoherms de-velop. Further downslope a swarm of nearlyvertical faults allow the upward migration ofgas inside the GHSZ. Short gas hydrate lay-ers produce bright spot patches and pretendsometimes phase reversals due to thin layer re-flections. The upper level marks the TGHSor gas hydrate layers within the GHSZ. Thelower level characterizes reflections from thebottom of free gas or, more likely, reflectionof gas which is trapped by non-permeable lay-ers, partly disrupted by faults. Methane es-capes where this faults reach the seafloor andcarbonate forms. In order to foster our in-terpretation of gas and gas-hydrate distribu-tion, we analyzed recordings of ocean-bottom-seismometers. We derived 2D-velocity depthfunction by ray-tracing. Additionally wecalculated 1D-velocity depth functions fromRMS-velocities. Previously the data have un-dergone a Kirchhoff wave-equation datumingand adjacent coherence filtering to eliminatethe one sided travel path through the water col-umn. This processing step was motivated bythe fact, that the RMS-velocity of thin layersbeneath the seafloor is very close to the watervelocity, if the water depth is much bigger thanthe layer thickness. Assuming that the receivergather approximates a CDP-gather, identifiedreflections have been examined with a sem-blance supported interactive velocity analysis.Data have also been analyzed with high andlow resolution in depth in order to find an opti-mum trade-off between vertical resolution andminimization of errors caused by sensitivity ofthe DIX’ formula regarding velocity variations
at thin layers. The velocity data help to under-stand the reflection pattern in terms of gas andgas-hydrate occurrence.
Marine Geophysik 213
MG06 – Mo., 24.2., 12:40-13:00 Uhr · HS7Zöllner, H., Schikowsky, P. (Universität Leipzig)
Zum Einfluss seebodennaher Langsamschichteinlagerung auf flachmarine reflexionsseis-mische MessungenE-Mail: [email protected]
Auf CDP-seismischen Seemessungen, diein den achtziger Jahren zur Erdöl-Erdgas Ex-ploration im Bereich des Greifswalder Bod-dens durchgeführt wurden, zeigten sich außer-ordentlich starke Störeinflüsse, die bei einerkomplexen Interpretationen in den 90er Jah-ren zu erheblichen Unsicherheiten führten. Zuden Störeinflüssen gehören extreme Absorpti-on der Nutzsignale (bis nahezu 100 Prozent),bislang unerklärlich starke Laufzeitanomali-en, hochfrequentes Singing, und Erscheinentieffrequenter Störwellen. Ein Seismogrammmit den typischen Erscheinungsbildern zeigtAbbildung 1, wobei zur besseren Sichtbarkeitder Störeinflüsse nur der schusspunktnächste
Abbildung 1: Amplitudengetreue Einkanal-abspielung eines typischen Seismogrammesbeim Einfahren in einen gestörten Bereich;auffällig ist der nahezu totale Ausfall derNutzsignale ab Koordinate 5700; gut zu sehenist auch das monofrequente Singing im mittle-ren Teil des Seismogrammes im Bereich vonKoordinate 7500
Kanal dargestellt ist.Es sollte die Frage geklärt werden, welche
physikalischen Ursachen den Erscheinungenzugrunde liegen und inwiefern eine rechen-technische bzw. messtechnische Eliminierungdieser Störeinflüsse möglich ist.
Der untersuchte Datensatz umfasst 75 CDP-seismische Profile mit einer Gesamtlänge vonmehr als 500 km. Hinzu kommen etwa25 boomerseismische Profile (Sedimentecho-gramme) und Ergebnisse von Flachbohrun-gen um Informationen über den seebodenna-hen Untergrund zu erhalten.
Durch eine umfangreiche Kartierung wur-de die flächenhafte Verteilung von Laufzeit-erhöhungen, Singing und erhöhter Absorptionsowie der Gasindikationen aus Sedimentecho-grammen bestimmt.
Die Kartierungen zeigen, dass erhöhte Ab-sorption nur dort auftritt, wo die Sedimen-techogramme Hinweise auf Durchgasungen
Abbildung 2: Stapelergebnis im Bereich einerLaufzeitanomalie (Koordinate 8300)
214 Abstracts
liefern. Damit konnte -wie erwartet- durch-gaster Schlick als wesentliche Ursache derstarken Absorption nachgewiesen werden.Weiterhin ist zu erkennen, dass auch Singingnur in Gebieten durchgasten Schlicks auf-tritt, die eine bestimmte Seetiefe überschrei-ten, was mit den theoretischen Vorhersagenfür die Entstehung von stehenden Wellen imWasser in Einklang steht. Die rechentech-nische Eliminierung von Singing und tieffre-quenten Störwellen kann mit einer prediktivenDekonvolution bzw. einfachem Bandpassfil-tern erreicht werden.
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeitlag in der Untersuchung von Laufzeitanoma-lien (Abbildung 2). Von besonderem Inter-esse war die Entwicklung einer Methodik diees erlaubt, Strukturinformationen von seebo-denbedingten Laufzeitanomalien zu trennenund wenn möglich, zu korrigieren. Um dieBedeutung dieser Zielstellung zu untersetzen,sei darauf verwiesen, dass bei Interpretationenaus den frühen 90er Jahren teilweise oberflä-chenbedingte Laufzeitanomalien als tektoni-sche Gräben angesprochen wurden.
Zur Erkennung oberflächennaher Einflüs-se wird vorgeschlagen, jeweils eine Einka-nalabspielung eines schusspunktnahen und -fernen Kanals anzufertigen. Engbegrenzteoberflächennahe Laufzeitinhomogenitäten bil-den sich in schusspunktfernen Spuren dop-pelt ab. Die Einkanalabspielungen ermögli-chen außerdem eine exakte Lokalisierung vonStörungsgrenzen. Damit ergibt sich die Mög-lichkeit den Einfluss der Störung durch Un-terschiessen zu eliminieren, sofern die lateraleAusdehnung der Störung klein gegenüber derMessauslage ist.
Nach Analysen der refraktierten See-bodenwelle und der mathematischen Mo-dellierung ihrer Ausbreitung zeigte sich,dass die Laufzeitanomalien nicht -wie zu-
nächst angenommen- durch die geringeP-Wellengeschwindigkeit des durchgastenSchlick verursacht werden, sondern vielmehrdurch bis zu 150 m mächtige Langsam-schichteinlagerungen im seebodennahenUntergrund entstehen. Es wird angenommen,dass es sich hierbei um quartäre Rinnenhandelt, die mit Sedimenten geringer P-Wellengeschwindigkeit verfüllt sind. Einedurchgeführte Kartierung der Ersteinsätzerepräsentiert damit im Wesentlichen dieLage und den Verlauf von bislang im Greifs-walder Bodden noch nicht nachgewiesenenRinnensystemen.
Eine statische Korrektur zur Beseitigungder Laufzeitanomalien durch klassischeRefraction-Statics ist auf Grund der Messgeo-metrie (min. Offset 160 m) nicht möglich.Ein Versuch der Berechnung von statischenKorrekturen aus den Informationen der Sedi-mentechogrammen scheiterten daran, dass dieLangsamschichtunterkante im Allgemeinennicht erfasst wird. Dagegen ist es möglich,relative Laufzeitanomalien der refraktier-ten Welle direkt zur statischen Korrekturheranzuziehen.
Die Anwendung der beschriebenen Schritteverbessert die Datenqualität in gestörten Be-reichen deutlich, ermöglicht detailliertere In-terpretationen und erhöht die Sicherheit derInterpretation erheblich.
Marine Geophysik 215
MG07 – Di., 25.2., 09:30-09:50 Uhr · HS7Müller, C., Bönnemann, C., Neben, S. (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe,Hannover)
Der Bodensimulierende Reflektor - mehr als nur ein Hinweis auf GashydrateE-Mail: [email protected]
Gashydrate werden seit drei Jahrzehntenmit zunehmender Bedeutung im Rahmen glo-baler Klimaveränderungen, als potenziellerAuslöser katastrophaler Tsunamis und Gefahrfür Offshoreeinrichtungen, sowie als potenti-elle Energieressource für die Zukunft disku-tiert. Als Beitrag zur Abschätzung des regio-nalen Potenzials als Georisiko bzw. Energie-ressource wird die flächenhafte Ausdehnungder Gashydrate durch Kartierung des Boden-simulierenden Reflektors (BSR), der die Un-terkante der Gashydratstabilitätszone anzeigt,erfasst. Der BSR trägt darüber hinaus abernoch weitere Informationen. Als Phasengren-ze zwischen festem Gashydrat und freiem Gasist die Temperatur am BSR gut definiert undermöglicht dadurch die Abschätzung des Geo-thermischen Gradienten bzw. des Wärme-flusses. Als markante seismische Reflexionbeinhaltet der BSR außerdem Informationenüber die elastischen Eigenschaften der Sedi-mente. Aus steilwinkelseismischen Daten las-sen sich Hinweise auf Impedanzkontraste undaus weitwinkelseismischen Daten zusätzlichHinweise auf Kontraste im Poissonverhältnisermitteln.
Auf Basis eines Netzes reflexionsseismi-scher Profile von 1999 wurde der Wärmeflussauf dem aktiven Kontinentrand vor derPazifikküste Costa Ricas erfasst. Der Geo-thermische Gradient wurde aus der Tiefenlagedes BSRs, der Gashydratstabilitätskurve undder Temperatur am Meeresboden abgeschätztund mit einer konstanten Wärmeleitfähig-keit von 0.85 W/mK (ODP-Leg 170) in
Wärmefluss konvertiert. Im Gegensatz zuden besonders niedrigen Wärmeflüssen amODP-Leg 170, verursacht durch effektivehydrothermale Kühlung, erhalten wir imBereich südöstlich der Nicoya-Halbinsel Wär-meflüsse im Normalbereich zwischen 20 und80 mW/m2. Vor der Osa-Halbinsel steigendie Wärmeflüsse aufgrund des abtauchen-den Cocos-Rückens auf bis zu 120 mW/m2 an.
Die Kartierung der BSRs vor Costa Ricazeigt südöstlich der Nicoya-Halbinsel eine fle-ckenhafte Verteilung der Gashydrate. In die-sem Bereich wurden hochauflösende reflexi-onsseismische Daten mit Streamerlängen von5250 m aufgenommen. Durch diese Konfi-guration wurden am BSR Einfallswinkel vonüber 70° erreicht. Nach einer Amplitudenkor-rektur wurde die Variation der Reflexionsam-plitude mit dem Einfallswinkel (AVA) unter-sucht und die elastischen Eigenschaften derSedimente im Bereich des BSRs bestimmt.In Verbindung mit Modellrechnungen (Zo-eppritz) lassen sich bei hohen EinfallswinkelnBereiche mit und Bereiche ohne freies Gasunterhalb der Gashydratstabilitätszone unter-scheiden. Die Bereiche mit freiem Gas sinddabei neben einem starken negativen Steil-winkelreflexionskoeffizienten durch eine star-ke Variation des Poisson-Verhälnisses gekenn-zeichnet und werden als Bereiche mit erhöh-ter vertikaler Fluidmigration entlang von tie-fen Störungen erklärt.
216 Abstracts
MG08 – Di., 25.2., 09:50-10:10 Uhr · HS7Behain, D., Fertig, J. (Institut für Geophysik, TU Clausthal), Meyer, H., Franke, D., Barckhau-sen, U. (BGR)
Properties of gas hydrates off NW Sabah (Borneo)E-Mail: [email protected]
Natural gas hydrates occur globally widelyin marine sediments of the continental slopesand rises or in permafrost regions. Gas hy-drates have recently gained increasing scien-tific and industrial attention considering theirroll as a potential energy resource, in cli-mate changes and in seafloor stability. Inthe seismic lines gas hydrates are indicatedby a so-called Bottom Simulating Reflector(BSR). The BSR marks the base of the sta-bility zone of gas hydrates and runs nearlyparallel to the seafloor. In 2001, during thescientific survey BGR01 off Sabah more than2900 km of seismic, magnetic, gravimetricdata were acquired. One of the targets of thesurvey BGR01 was the gathering of supple-mentary data for a detailed study of the occur-rence and properties of gas hydrates off NWSabah. For the subsequent AVA-analysis (Am-plitude Versus Angle) at the BSRs more than1400 km of high resolution MCS-lines witha 6 km long streamer (480 channels, samplerate 1 ms, record length 7 s, shot distance 25m) have been acquired. Due to the differ-ent structural settings and sedimentation his-tories the continental margin off NW Sabahhave been subdivided into different tectonos-tratigraphic provinces (NW Sabah Platform,NW Sabah Trough, Baram Delta Thrust Beltzone, Lower Tertiary Thrust Sheet, OutboardBelt and Inboard Belt. The BSR occurrencesoff Sabah appear to be linked with structuraland tectonic units and are focused mainly inthe folded, thrusted, and uplifted structures.They occur in the post-Miocene sediments be-
tween 250 and 300 m beneath the seafloor,and have been observed in the Baram DeltaThrust Belt zone, the Compressed Thrust Toeand Lower Tertiary Thrust Sheets and in theNW Sabah Trough. The BSRs occur mainlyin the hanging walls of the individual thrustsheets which form anticline-like structures.Due to the tectonically controlled morphologyof the seafloor the distribution of BSRs con-sists mainly of elongated bodies with a max-imal length of 190 km and an average lateralextent of 5 km, which run mainly parallel toeach other. We have assumed 3 models forthe origin of BSRs off Sabah (BSRs are ei-ther caused by existence of only free gas be-low the BSR, either only hydrate above BSRor a combination of free gas beneath and gashydrates above the BSR in the sediments).To restore amplitudes at the BSR, source andreceiver directivity are explicitly considered.The source-receiver offset that is in most cases5 times the target depth provides incidence an-gles up to 70 degrees. AVA-analysis at theBSRs along the high resolution MCS linesshow the class III AVA anomalies with strongnegative zero-offset reflection coefficient thatincrease with offset. Using the forward mod-eling (full Zoeppritz) the AVA trend shows thebest correlation with the result of low com-pressional wave velocity and low Possion´s ra-tio of the sediments beneath the BSR, clearlyindicating the existence of free gas beneath theBSRs.
Marine Geophysik 217
MG09 – Di., 25.2., 10:10-10:30 Uhr · HS7König, M. (Bremerhaven, AWI), Kopsch, C. (Potsdam, AWI), Jokat, W., Miller, H. (Bremerha-ven, AWI)
Das schiffsfeste Magnetometersystem auf Polarstern:Ergebnisse, Probleme, PerspektivenE-Mail: [email protected]
Die geotektonische Entwicklungsgeschich-te des Meeresbodens lässt sich anhand sei-ner magnetischen Signatur in weiten Berei-chen des Ozeans zeitlich eindeutig bestim-men. Um die räumliche Abfolge von posi-tiven und negativen magnetischen Anomalienvon einem Schiff aus zu erfassen, werden übli-cherweise geschleppte Magnetometersystemeverwendet. Dabei wird ein aus einem, odermehreren Geräten bestehendes Sensorsysteman einem 600 - 800 m langen Kabel hinter demSchiff gezogen. In Gebieten mit teilweiser,oder vollständiger Eisbedeckung ist diese Me-thode nur bedingt einsetzbar. Die Gefahr derBeschädigung, oder des Verlustes des Systemsist sehr groß. Eine Möglichkeit diese Schwie-rigkeiten zu umgehen bietet die schiffsfesteInstallation eines Magnetometersystems, wiesie auf dem deutschen PolarforschungsschiffPolarstern während des Fahrtabschnitts ANTXVII/4 im Frühjahr 2000 durchgeführt wurde.
Es wurden 2 3-Komponenten Fluxgatesen-soren auf Ringkernbasis der Firma Magson,auf der Backbord- und Steuerbordseite desKrähennestes in etwa 7 m Entfernung vonein-ander aufgebaut.
Ziel ist es, ein System bereitzustellen, wel-ches im Dauereinsatz auch bei Fahrten in eis-bedeckten Gebieten mit möglichst wenig War-tungsaufwand betrieben werden kann. Ne-ben der direkten Messung von Meeresboden-anomalien soll Polarstern somit auch als Ba-sisstation für hubschrauber- und flugzeugge-stützte Messungen dienen.
Durch die unmittelbare Nähe zum Schiffsind die Störeinflüsse des Schiffs am Ort desSensors um ein vielfaches größer als bei ge-schleppten Systemen. Aus diesem Grundist die Berechnung stabiler Korrekturkoeffi-zienten hier von entscheidender Bedeutung.Eine weitere Erschwerung der Messbedin-gungen kommt durch das Mitbewegen derSensoren mit dem Schiff hinzu. Ein ge-schlepptes System behält, je nach Tiefe in derder Sensor geschleppt wird, auch bei mitt-lerem Seegang seine Position bei, wohinge-gen das Schiff und somit auch das schiffsfes-te System deutlich mehr Bewegungen durch-führt. Um diese Bewegungen in einem „Post-Processing“rechnerisch korrigieren zu könnenist die präzise und synchrone Erfassung derLagedaten (roll, pitch, head) von entscheide-ner Bedeutung. Auf Polarstern werden hierzudie Navigationsdaten des Schiffsystems ver-wendet.
Seit der Südpolarexpedition ANT XIX/2 imWinter 2001/2002 ist dieses System voll funk-tionsfähig und im Dauereinsatz. Die Datender digitalen Fluxgatesensoren werden mit 1Hz registriert und in das wissenschaftlicheBordrechnersystem PODAS eingespeist. Vondiesem zentralen Rechnersystem aus kann„online“auf die Daten zugegriffen und zurweitern Verarbeitung lokal gespeichert wer-den.
Die Daten dieser Expedition, sowie ein wei-terer Datensatz der Nordpolarexpedition ARKXVIII/2 vom Sommer 2002, bieten die Grund-
218 Abstracts
lage für eine umfangreiche Analyse der ver-wendeten Korrekturalgorithmen und des „ma-gnetischen Verhaltens“des Schiffes. Letzte-res ist v.a. im Hinblick auf die Überquerungdes magnetischen Äquators und die damit ver-bundene Ummagnetisierung des Schiffes vonbesonderem Interesse. HubschraubergestützteMessungen parallel zum Schiffstrack mit ei-nem Caesiummagnetomer der Firma Scintrexsowie ein zusätzlich für diese Expedition amKrähennest angebrachtes Caesummagnetome-ter der Firma Geometrics bieten weitere Mög-lichkeiten der Messwertvalidierung.
In diesem Vortrag sollen erste Ergebnissedieser Untersuchungen, sowie Probleme beider Messwertkorrektur und ein Ausblick aufweitere mögliche Auswertungen dargestelltwerden.
Marine Geophysik – Poster 219
MGP01Bialas, J., Breitzke, M. (Kiel, Geomar)
Ein hochauflösender tiefgeschleppter Mehrkanalstreamer: Technische GestaltungE-Mail: [email protected]
Marine seismische Vermessungen sind inihrer Auflösung sehr stark durch die Mee-restiefe beeinflußt. Der Öffnungskegel vonOberflächenempfängern (Mehrkanalstreamer)bedingt bei großer Tiefe einen entsprechendgroßen Fresnelradius. Durch Prozessing-schritte (Migration) läßt sich dieser Einflußin Profilrichtung zwar verringern, Seitenef-fekte bleiben dabei jedoch unverändert. Ei-ne Verkleinerung der Fresnelzone kann durchgrößere Annäherung der Meßkonfiguration andas Untersuchungsziel erreicht werden. ImOzean bedeutet dies, Empfänger und Quellezum Meeresboden abzusenken.
Zu diesem Zweck wurde im Projekt ING-GAS ein tiefgeschlepptes Streamersystem inVerbindung mit einem tiefgeschleppten Si-deScan Sonar entwickelt. Der Streamerwird zusammen mit konventionellen Airgunsals sogenanntes hybrides System betrieben,der Empfangsteil ist abgesenkt, während dieQuelle an der Oberfläche bleibt. Abhängigvon der Einsatztiefe und Signalfrequenz wirddabei eine unterschiedlich große Reduktionder Fresnelzone erreicht. Für ein 200 Hz Si-gnal reduziert sich der Fresnelradius in 3000m Tiefe von 106 m auf 27 m. Die einzelnenHydrophone des Streamers werden mit Kabel-segmenten verbunden, so daß die Konfigurati-on dem jeweiligen Meßziel angepaßt werdenkann. Zur Zeit stehen 1 m und 6.5 m langeKabel zur Verfügung.
Von den 26 Hydrophonen wurden drei alssogenannte Engineering-knoten ausgeführt,d.h. neben einem Hydrophon sind ein Kom-paß, Drucksensor und Neigungsmesser instal-
liert, deren Werte ebenfalls digital übertragenwerden. Hierdurch ist eine laufende Kontrol-le über Tauchtiefe und Verhalten des Streamermöglich. Von besonderer Wichtigkeit ist dieseInformation jedoch in dem späteren Navigati-onsprozessing, das zu jedem Schuß eine exak-te Positionierung der Hydrophone bereitstel-len muß. Eine Besonderheit stellt hier auchdie USBL (Ultra Short Baseline) Navigationdar. Dieses System erlaubt eine permanentePositionsbestimmung des Schleppfisches oh-ne das Referenzbaken zum Meeresboden ab-gesenkt werden müssen.
Die seismischen Signale werden mit 24 Bitund 0.25 ms Samplingrate abgetastet und voneinem Bottom-PC in einem Unterwasserge-häuse gespeichert. Hier werden die Daten zu-sammen mit den SideScan Sonar-Werten übereine Telemetrie an Bord übermittelt. Die Te-lemetrie ist sowohl für Koaxial- als auch fürGlasfaserkabel ausgelegt. An Bord werden dieDaten per Ethernet an weitere Rechner ver-teilt, die eine Online-Darstellung der Messungermöglichen. Neben der Qualitätskontrolleund der vollen Parametrisierung der Meßanla-ge findet hier eine zweite Datensicherung statt.Bei unzureichender Bandbreite des Schlepp-kabels werden nur Teile der Daten zu Kon-trollzwecken übertragen, die komplette Spei-cherung findet dann im Unterwassergehäusestatt.
Die ungewöhnliche Geometrie von Quelleund Empfänger erlaubt es nicht länger die üb-lichen CMP orientierten Verfahren der Mehr-kanalseismik anzuwenden. Wellenfeldfortset-zung und Migration muß angewendet werden,
220 Abstracts
um der hyperbelhaften Anordnung der Refle-xionspunkte im Untergrund gerecht zu wer-den. Das notwendige Navigations- und Daten-prozessing wird in dem Beitrag von Breitzkeund Bialas vorgestellt.
Marine Geophysik – Poster 221
MGP02Breitzke, M., Bialas, J. (Kiel, Geomar)
Ein hochauflösender tief geschleppter Mehrkanalstreamer: Erste Ergebnisse und Daten-prozessingE-Mail: [email protected]
Einführung Im Rahmen des durch die Gas-hydratinitiative des GEOTECHNOLOGIENProgramms geförderten Projektes INGGASwurde ein tief geschleppter digitaler mehrka-nalseismischer Streamer entwickelt mit demZiel, die laterale Auflösung von kleinskaligenUntergrundstrukturen, die bsp. Hinweise aufeinen Fluidfluß in der Sedimentsäule und da-mit auf die Bildung und Existenz von Gas-hydraten liefern können, zu optimieren. Einetechnische Beschreibung der einzelnen Gerä-tekomponenten ist in dem Beitrag von Bialasund Breitzke (dieser Abstract Band) zu finden.Es handelt es sich um ein hybrides System,bei dem der Streamer tief geschleppt wird,während als Quelle konventionelle Air-, GI-oder Waterguns verwendet werden. Bei einerWassertiefe von beispielsweise 3000 m, einerHauptfreqeunz von 200 Hz und einer Schlepp-tiefe von 100 m über dem Meeresboden kannso der Radius der Fresnelzone als Maß für dielaterale Auflösung von 106 m für ein konven-tionelles, oberflächennah geschlepptes Quell-und Streamersystem auf 27 m für ein hybridesSystem reduziert werden.
Die SO162 Testfahrt (INGGAS Test)Während der FS Sonne Fahrt SO162 wur-de dieses hybride Streamersystem im Yaqui-na Becken vor Peru in Wassertiefen von 900 -1000 m erfolgreich getestet. Als Quellen ka-men ein 0.7 l GI- und eine 1.6 l Prakla Air Gunzum Einsatz, deren Quellspektren einen Fre-quenzbereich von etwa 20 - 300 Hz umfassen.Die Daten wurden mit einem Abtastintervallvon 0.25 ms digitalisiert und über 3 s Dau-
er aufgezeichnet. Das Schußintervall betrug5 s. Bei einer mittleren Schleppgeschwindig-keit von 3 kn führte dies zu einer durchschnitt-lichen 3fach Überdeckung des Untergrundes.Ein erstes Testprofil verlief in Streichrich-tung des peruanischen Kontinentalrandes. Esdiente dazu, alle Gerätekomponenten zu testenund Erfahrungen mit der Schiffsgeschwindig-keit, Manövrierfähigkeit und der Tiefen- undPositionskontrolle des insg. 75 m langen Stre-amer sowie des den Streamer schleppendenSide Scan Sonar Fisches und Depressors zusammeln. Die Schlepptiefe betrug 80 - 120m über dem Meeresboden. Eine Beobachtungder Heading, Roll und Pitch Werte der En-gineering Knoten des Streamer auf den Kon-trollmonitoren zeigte eine sehr gute Überein-stimmung in der Tiefenbestimmung des Strea-mer und des Side Scan Sonar Fisches durchdas POSIDONIA USBL System, so daß ei-ne sehr gute Lagekontrolle des tief geschlepp-ten Systems möglich ist. Variationen in derSchiffsgeschwindigkeit zwischen 1 und 4 knergaben, daß der geringste Rauschpegel bei ei-ner Schiffsgeschwindigkeit von 3 kn liegt. Einzweites Testgebiet lag im Gebiet der währendder FS Sonne Fahrt SO 146 (GEOPECO) ge-fundenen Max und Moritz Chemoherme. EinNetz von 11 parallel verlaufenden Profilen miteinem Profilabstand von ca. 100 m abgefah-ren, um die Einsetzbarkeit und Manövrierfä-higkeit des tief geschleppten Systems für 3DUntersuchungen zu testen, und um die Auflö-sung von kleinskaligen Strukturen wie die derChemoherme (200 - 300 m Durchmesser) in
222 Abstracts
den mit dem tief geschleppten Streamer auf-gezeichneten seismischen Daten zu untersu-chen. Es zeigte sich, daß bei einer Wasser-tiefe von etwa 1000 m Kurven zwischen Pro-fillinien mit 500 - 600 m Abstand auch mitdem tief geschleppten System ohne Proble-me gefahren werden können, so daß zukünftigdurch eine entsprechende Profilplanung und -schachtelung auch sehr engabständige Linienvon wenigen 10er Metern Abstand für sehrhochauflösende 3D seismische Vermessungenabgefahren werden können.
Geometrie Prozessing Zur hochauflösen-den Abbildung der Chemoherme in den seis-mischen Sektionen ist eine detaillierte Berech-nung der Geometrie von marin-seismischerQuelle, Side Scan Sonar Fisch und Streamer-knoten notwendig. Als Eingangsdaten ste-hen dazu die GPS Daten der Schiffsantenne,die USBL Daten des POSIDONIA Positionie-rungssystems und die Daten der drei Enginee-ring Knoten des Streamers zur Verfügung. DieGPS Daten liefern, nach Berücksichtigung derPosition der Antenne auf dem Schiff und derAuslage der marin-seismischen Quelle direktdie Koordinaten der Quellposition. Die USBLDaten des POSIDONIA Positionierungssys-tems geben nach Interpolation auf die Trigger-zeiten die zugehörige Position des Side ScanSonar Fisches an. Aus den Tiefen- und Hea-ding Werten der drei Engineering Knoten las-sen sich durch räumliche Interpolation Tiefenund Heading Werte für jeden Streamerkno-ten und, unter Berücksichtigung des Knoten-abstandes, geographische Koordinaten sowieTiefenwerte für jeden Streamerknoten berech-nen.
Geometrische Korrektur der Daten Aufder Grundlage dieses Geometrie Prozessingkann anschließend eine einfache geometrischeKorrektur durchgeführt werden mit dem Ziel,die Variationen in der Eintauchtiefe des Stre-
amer rückgängig zu machen und so den ba-thymetrischen Verlauf des Meeresbodens zurekonstruieren. Dazu definiert man eine Re-ferenztiefe und berechnet, basierend auf demOffset, der Wassertiefe und der Eintauchtiefejeden Streamerknotens eine Laufzeitkorrektur,die die variable Tiefenlage des Streamer aufdie Referenztiefe nivelliert. Die Lage von Re-flektoren unterhalb des Meeresbodens wird soallerdings nicht korrekt korrigiert. Dazu sindWellenfeldfortsetzungs- und Prestack Migrati-onsverfahren notwendig.
Das Max und Moritz Chemoherm Ge-biet Erste Auswertungen der im Max und Mo-ritz Chemoherm Gebiet aufgezeichneten Da-ten zeigen, daß entlang einer Profillinie unab-hängig von der Länge des Schleppkabels Va-riationen in der Eintauchtiefe des Streamer biszu 30 m auftreten können. Dadurch verur-sachte Variationen im Offset zwischen Quel-le und Streamerknoten können bis zu 200m betragen. Eine vorläufige Darstellung derseismischen Daten als Common Offset Ga-ther mit einem Spur (=Schußpunkt-) Abstandvon 7.7 m zeigt sowohl vor als auch nachder geometrischen Korrektur bereits eine sehrhohe Auflösung der Sedimentstrukturen imBereich der Chemoherme sowie andeutungs-weise interne Strukturen innerhalb der Che-moherme. Starke Amplitudenanomalien un-terhalb einer feingeschichteten Sedimentbede-ckung und zwischen den Chemohermen lassenvermuten, daß hier möglicherweise Karbonat-krusten auch in größerer Sedimenttiefe zu fin-den sind oder sich lokal Gas angesammelt hat.Eine zukünftige laterale Vedichtung der Da-ten in den Seismogrammsektionen auf einenReflexionspunktabstand von etwa 0.5 m durchWellenfeldfortsetzungs- und Prestack Migra-tionsverfahren läßt bereits jetzt vermuten, daßso eine sehr hohe laterale Auflösung der in-ternen Sedimentstrukturen in diesem Chemo-
224 Abstracts
MGP03Kugler, S., Bohlen, T., Klein, G. (Kiel), Forbriger, T. (Frankfurt a. M.)
Entwicklung einer Scholtewellen-Tomographie für den flachmarinen BereichE-Mail: [email protected]
Für geotechnische Fragestellungen sind In-formationen über die dreidimensionale Ver-teilung der Schereigenschaften flachmarinerSedimente von großer Bedeutung. Der vonuns verfolgte Ansatz zur Bestimmung ei-nes 3D-Modells der Scherwellengeschwin-digkeiten in diesem Bereich basiert aufder tomographischen Analyse und Inversi-on der frequenzabhängigen Ausbreitungsge-schwindigkeiten von Grenzflächenwellen zwi-schen Wasser und Meeresboden, den soge-nannten Scholtewellen. Dabei wird aus-
Abbildung 1: a) Common-Receiver-Gatheraus der Tromper Wiek (tiefpassgefiltert< 20 Hz und spurnormiert) b) LokalesPhasenlangsamkeits-Frequenz-Spektrum füreinen Offset von -100m.
genutzt, daß die Ausbreitungsgeschwindig-keit der Scholtewelle in starkem Maße vonder Scherwellengeschwindigkeit und ihre Ein-dringtiefe von der Frequenz abhängt.Scholtewellen hoher Amplitude wurden imRahmen einer Seemessung in der TromperWiek, einer nach Nordosten zur Ostsee hingeöffneten Bucht nördlich von Rügen, aufge-zeichnet. Der Meeresboden ist dort durch fei-
Abbildung 2: Aus lokalen Spektren bestimm-te Langsamkeiten der Scholtewelle für 3 Hz(oben) und 7 Hz (unten).
Marine Geophysik – Poster 225
ne, schlickige Sande aufgebaut, denen mit zu-nehmender Tiefe Geschiebemergel folgt. DieAufzeichnung der Daten erfolgte in Koopera-tion mit der Bundesmarine. Die verwende-ten Geophone wurden durch Taucher am Bo-den angebracht, was eine sehr gute Ankopp-lung gewährleistete. Angeregt wurde durcheine Airgun mit einem Kammervolumen von0.6 l, die profilhaft nah der Wasseroberflächegeschleppt wurde. In Abbildung 1 a) ist ein ty-pisches Common-Receiver-Gather dargestellt.Die Scholtewelle zeigt die größte Amplitudeim Wellenfeld.Die Analyse erfolgt in zwei Schritten. In ei-nem ersten Schritt wird die 2D-Verteilung derScherwellengeschwindigkeiten entlang vonProfilen bestimmt. Als Grundlage hier-für dienen Common-Receiver-Gather. Die-se werden durch eine Wellenfeldtransfor-mation in ein Frequenz-Phasenlangsamkeits-Spektrum überführt, aus dem die frequenz-abhängigen Phasenlangsamkeiten aller durchdie Quelle angeregter Moden bestimmt wer-den können. Um laterale Variationen desUntergrundes entlang des Profils erfassen zukönnen, wird das Common-Receiver-Gathervor der Wellenfeldtransformation mit einerFensterfunktion multipliziert, die entlang derOffset-Achse verschoben wird. Für jedesdieser Fenster werden die Phasenlangsamkei-ten bestimmt und zu jeweils einem eindimen-sionalen Modell der Scherwellengeschwin-digkeit invertiert, das den Untergrund unterdem Fensterbereich charakterisiert. Abbil-dung 1 b) zeigt das Langsamkeits-Frequenz-Spektrum für eine gaußförmige Fensterfunk-tion der Halbwertsbreite 100 m mit Mittel-punkt bei -100 m Offset. Trotz des rela-tiv kurzen Fensters kann daraus die Dispersi-on der Scholtewelle mit hoher Auflösung be-stimmt werden. Der Vergleich der auf dieseArt ermittelten, lokalen Phasenlangsamkeiten
der Scholtewelle, wie er in Abbildung 2) ex-emplarisch für zwei Frequenzen dargestellt ist,zeigt deutliche laterale Variationen innerhalbdes Meßgebietes.
Das entlang der Profile entstandeneModell wird im zweiten Schritt einer aufflachmarine Ansprüche angepaßten klassi-schen Oberflächenwellen-Tomographie alsHintergrundmodell dienen. Dabei sollenlaufwegsabhängige Abweichungen der Aus-breitungseigenschaften der Scholtewelle vomHintergrundmodell für eine Vielzahl sichkreuzender Laufwege untersucht und für jedeFrequenz zu einer Phasenlangsamkeitskarteinvertiert werden. Aus diesen Karten solldann letztendlich ein dreidimensionalesUntergrundmodell der Scherwellengeschwin-digkeiten ermittelt werden.
Wir danken der Bundesmarine (WTD 71,Kiel) für die Datenerfassung. Das Projektwird gefördert von der Deutschen Forschungs-gemeinschaft DFG (Bo 1727/1-2).
226 Abstracts
MGP04De Nil, D., Rabbel, W. (Kiel, CAU)
Shear characteristics of gas hydrate bearing sediments at Nicoya SlideE-Mail: [email protected]
One aim of project B1 of the Sonder-forschungsbereich 574 ”Volatiles and Fluidsin Subduction Zones: Climate Feedback andTrigger Mechanisms for Natural Disasters”is to develop and to apply a new techniquefor determining shear wave velocity of ma-rine gas hydrate bearing sediments. Gas hy-drates may be incorporated into sediments aspart of the pore fluid, as part of the matrix oract as cement of sediment grains in differentways. The different possible fine structuresmay be discriminated by different changes incompressional and shear wave velocity causedby the presence of gas hydrates. Especiallyif gas hydrates act as cement, shear wave ve-locity is increased significantly even in thepresence of only small amounts of hydrates,because of the significantly increased shearstrength. Determining the fine structure of hy-drate bearing sediments is important for esti-mating the amount of bounded methane fromelasto-dynamic properties reliably and for un-derstanding the role of gas hydrates in slopestability and slope failures, respectively. Dis-sociation of gas hydrates due to reduced over-burden load or due to an increase in temper-ature and release of free gas from below thegas hydrate stability zone through faults mayresult in emitting large volumes of climate rel-evant methane. Large slope failures may causetsunamis.
Since the inversion of offset dependent re-flection amplitudes may be especially compli-cated by the interaction of effects caused bythe presence of gas hydrates and effects dueto the presence of free gas trapped beneath
gas hydrate bearing sediments with low per-meability, we have focussed our studies onevaluating absolute and relative travel timesof converted waves. During RV Sonne cruiseSO163-2 and RV Meteor cruise M54-1B,ocean-bottom seismic surveys with differentmain frequencies have been performed at sev-eral locations at the Cocos subduction zone offCosta Rica. Among these sites Nicoya Slide, alarge slumping mass on the continental slopeoff Nicoya Peninsula, and its vicinity havebeen our major targets. We have observedapproximately horizontally polarized phaseswith relative high amplitude, which can be ex-plained by shear waves excited by p to s con-version at the seafloor and at the base of thegas hydrate stability zone, if there is a signifi-cant contrast in shear wave velocity.
Furthermore, we have observed indicationsof anisotropy. For example, there is ratherhigh energy on crossline components, al-though the structure of the sub-seabottom ishorizontally layered as a first approximation.We have fitted some simple anisotropic mod-els which are capable of explaining main fea-tures of the data in order to demonstrate thatthey may be explained by anisotropy. Thisanisotropy may be caused by pre-stress or ori-ented small scaled heterogeneities like finelayering or small fractures and cracks, alongwhich volatiles and fluids may migrate pref-erentially. Even highly anisotropic effectivemedia may be explained by assuming gas hy-drates to be deposite preferentially in certainlayers of fine layered media or in orientedcracks and fractures.
Marine Geophysik – Poster 227
MGP05Bönnemann, C. (BGR, Hannover), Behain, C. (TU Clausthal), Meyer, H., Neben, S., Müller, C.(BGR, Hannover)
Recent seismic investigations on gas hydrates at continental margins by BGRE-Mail: [email protected]
In the last years all marine seismic cruisesof BGR on convergent margins revealed de-posits of gas hydrates. The standard analysisof these data begins with the mapping of theBSR (bottom simulating reflector) in the pro-cessed reflection seismic data to achieve an es-timate of the minimal extension of the gas hy-drates. The BSR is not in all cases clearlyvisible, it can be masked by diffractions (instacked data) or by reflections from complexstructures. Also high-reflective sedimentarysequences, parallel to the slope of the seafloor,can aggravate the identification of the BSR.Finally, in the case of gas hydrate without freegas trapped below the BSR can be very weekor absent. The second standard analysis tool isthe derivation of the heat flow from the depthparameters of the BSR at selected locations.This gives valuable data for further analysisand interpretation. The work of BGR withthese data has a variety of objectives: reser-voir investigations, structural studies, compar-ative studies to understand the origin of the gasand to assess the role of gas hydrates and thefree gas beneath it as a possibly future energysource. The following areas will be shortlydiscussed:
The convergent continental margin of CostaRica is an area with large known gas hydrateoccurrences. At this margin BGR undertookin 1992 a 3D seismic survey and acquired 2Dseismic data during several cruises. The map-ping of the BSR from these data reveals fivedifferent areas of gas hydrates and indicationsfor a strong variability of the heat flow. The
distribution is controlled by tectonism, slopesand the roughness of the subducting crust.The 3D seismic data and high-resolution 2Ddata from cruise BGR99 are subject of a de-tailed seismic study of a gas hydrate reservoirstudy (DEGAS project in the framework of theGeotechnologien program).
The Sunda subduction zone formed theMentawai and the Java forearc basins. Gas hy-drates are observed mostly in boundary partsof the basins and in the anticlinal structuresin depths between 1300 mbsl and 3800 mbsl.In the center of the basins the BSR is eitherweak, obscured or totally absent. The de-rived heat flow in the basis ranges between 35and 44 mW/m2. The values at the boundariesare much higher which could be explained byfluid circulation.
At the active margin of middle Chile gashydrate has been observed only south of Val-paraiso. They occur mainly on the middleslope and are formed in lenghty patches par-allel to the coast.
At the continental margin off Sabah gas hy-drates occurrences were found in depths be-tween 1300 mbsl and 2800 mbsl. They oc-cur mainly on the hanging walls and the top ofthe anticlines in the Baram Delta Thrust Toe,the compressed thrust toe and the lower ter-tiary thrust sheets. Isotope analyses and ther-mal maturity modeling suggest a mixture ofbacterial and thermal generation for the gasesinside the gas hydrates off NW Sabah.
228 Abstracts
MGP06Fekete, N., Reston, T. (GEOMAR Research Centre Kiel), Spiess, V. (Uni Bremen)
Seismic imaging of mud diapirs offshore Costa Rica/NicaraguaE-Mail: [email protected]
The convergent margin offshore Costa Rica/ Nicaragua is the focus of studies withinSFB 574: ”Volatiles and Fluids in Subductionzones: Climate Feedback and Trigger Mech-anisms for Natural Disasters”. Within thisSFB, Subproject B1 concentrates on the use ofgeophysical methods to study fluid transportand storage processes in the forearc region.Of particular interest is the study of moundstructures, probably associated with mud di-apirism, investigated during cruises with theSonne (SO–163) and the Meteor (M54) in2002. In this presentation we show first resultsfrom these cruises.
High resolution seismic data shows that be-neath the mounds, the BSR reflection appearsdisrupted. We suggest that the disruption ofthe BSR may be an indication for the intru-sion of a mud diapir, and thus that the moundsrepresent the top of mud diapirs. A similar dis-ruption of the BSR is also observed in a placewhere there is no mound at the seafloor – weinterpret this as evidence for a diapir that hasnot yet breached the seafloor. Further studyof these structures may help reveal the rate atwhich diapirs pierce the sediment column.
The disruption of the BSR beneath the mudvolcano may also be in part a function ofpoor signal penetration, although this providesno obvious explanation for BSR–disruptionwhere no mounds actually outcrop. To inves-tigate this possibility, we have studied the con-tinuity of the BSR on wide–angle data that un-dershoot the surface expression of the mound.
Future work will include the determina-tion of the deep velocity structure beneath the
mounds with the aim of identifying the sourceregion of the muds. This will constrain thecause of mud diapirism and help constrain thedewatering processes occurring in the forearcregion.
Marine Geophysik – Poster 229
MGP07Berhorst, A., Flueh, E.R. (Kiel, Geomar), McIntosh, K.D. (Austin, USA, UTIG), Ranero, C.R.(Kiel, Geomar), Ahmed, I. (Austin, USA, UTIG), Silver, E.A. (Santa Cruz, USA, UCSC), Barck-hausen, U. (Hannover, BGR)
The structure of the convergent Nicaraguan margin from a combined reflection and re-fraction studyE-Mail: [email protected]
We present seismic profiles from a largemulti-channel-seismic and wide-angle surveyoff Nicaragua acquired in June 2000 duringR/V Maurice Ewing cruise EW00-05. Theobjective of this study is to improve theknowledge about the structure of the conver-gent Nicaraguan margin, where pronouncedchanges in the volcanic arc occur betweenCosta Rica and Nicaragua. Off Nicaragua, the24 Myr old Cocos Plate subducts beneath theCaribbean Plate slightly oblique to the trench.The nearly 100 km wide continental shelf ofNicaragua includes the Sandino Basin whichis more than 10 km deep in places. A 200km long dipline from the outer rise to the vol-canic arc is presented, which was extended 60km onshore by 9 landstations. A perpendic-ular wide-angle profile along the upper shelfimages the along-strike variations. Multichan-nel MCS data were collected coincident withthe two wide-angle profiles. The wide-angledata were interpreted using forward modelingtechniques. The MCS data are processed up toa time migration and integrated into the refrac-tion model. The dipline reveals a thin oceaniccrust (< 5 km) with an approximately 500 mthick sedimentary layer on top. About 40 kmseaward of the trench the plate starts to bendand becomes strongly faulted in response tothe plate flexure. Below the Moho the MCSdata reveal some landward dipping reflectionswhich might be deeply penetrating normalfaults related to the plate bending. The oceanic
plate reveals an unusual velocity structure.This can be explained by fractures in the crustwhich can also serve as fluid conduits for aneffective hydrothermal cooling. Partially ser-pentinised upper mantel due to water penetra-tion through deep cutting faults would reducethe P-wave velocity to the observed values. Asmall sediment prism of less than 2 km widthoccures landward of the trench. The slope sed-iments are divided by a basement high into ashallower (< 3 km thick) seaward part and thedeep Sandino basin with 6 km of sedimentsclose to the coastline. Satellite gravity dataindicate that this basement high is connectedto the outcrops of the Santa Elena Peninsulain northern Costa Rica. The basement showsa high velocity and a high landward veloc-ity gradient from 3.3 km/s at the seaward tipof the margin wedge up to 5.4 km/s belowthe Sandino basin. These velocities suggestthat the margin wedge is composed of ophi-olitic rock comparable to the Nicoya complexin Cost Rica. The strike line along the upperslope reveals a low velocity zone within thebasement, close to the Nicoya Peninsula. Thelow velocity zone is accompanied to a strongmagnetic anomaly, which might indicate dif-ferences in upper plate generation.
Marine Geophysik – Poster 231
MGP08Franke, D. (Hannover, BGR), Barckhausen, U., Behain, D. (TU Clausthal), Hinz, K., Meyer, H.(Hannover, BGR)
Seismic reflection imaging of the NW Sabah (Borneo) continental marginE-Mail: [email protected]
The NW Sabah/Borneo continental marginis located at the southeastern boundary of theSouth China Sea basin and occupies a cen-tral position in the area of the junction be-tween the Eurasian, Indo-Australian, Pacific,and Philippines plates. In 2001 the Federal In-stitute for Geosciences and Natural Resources(BGR) has carried out a marine geophysicalsurvey off NW Sabah with the focus on thedeep water areas. A total of 2900 km of multi-channel reflection seismic lines were acquiredduring the cruise. The oldest event which isclearly visible in the reflection seismic dataof the Dangerous Grounds area is an exten-sion of the crust that is proved by a system ofhorsts, tilted blocks, and syn-rift half-grabens.We infer that the event lasted from the LateCretaceous to the Late Eocene. Near the endof Eocene time, the clastic sediment supplydissipated and a wide-spread Early Oligoceneto Early Miocene carbonate platform devel-oped. We interpret the Dangerous Groundsarea as a piece of extended and subsided con-tinental crust which to the south was limitedby a proto-South China Sea. The origin ofthe Borneo-Palawan Trough is still under de-bate. One possible interpretation is the devel-opment as a subduction related trench. Butaccording to our data the trough is flooredby subsided continental crust, similar to thetype known from the Dangerous Grounds. Ex-tensional features as normal faults and tiltedblocks are clearly visible in the seismic data.The magnetic anomalies which are dominatedby the magnetic signatures of relatively young
volcanic features also continue under the con-tinental slope. The thrusted sediments ofthe upper plate, in contrast, seem to gener-ate hardly any magnetic anomalies. The fold-thrust belt, which increases in thickness andthrusting intensity in landward direction, ismade up of sets of subsidiary faults cuttingthrough post-Early Miocene sediments. Be-neath the individual, fold-related ridges weobserve widely extended Bottom SimulatingReflectors (BSRs) that indicate the presence ofgas hydrates. Apparently the thrust belt’s sedi-ments are thrusted onto the progressively sub-siding continental crust of the gradually over-ridden Borneo-Palawan Trough. The top ofthe subsiding continental crust, the Oligoceneto Early Miocene carbonate platform, formsthe major detachment surface. Based on thenew data we propose the following scenariofor the development of the NW Sabah con-tinental margin: Seafloor spreading in thepresent South China Sea started at about 30Ma. The spreading process separated the Dan-gerous Grounds area from the SE Asian conti-nent and ceased in late Early Miocene whenthe oceanic crust of the proto South ChinaSea was fully subducted in eastward direc-tion along the Borneo-Palawan Trough. Dur-ing Lower and/or Middle Miocene, Borneo ro-tated counterclockwise and was thrusted ontothe edge of the rifted continental block of theDangerous Grounds.
232 Abstracts
MGP09Gaw, V., Reston, T., Klaeschen, D., Ranero, C.R. (GEOMAR Research Centre Kiel), Stuben-rauch, A., Walker, I. (Conoko UK Ltd. Aberdeen)
Prestack depth migration reveals the deep structure of the Porcupine Basin (W of Ire-land): detachment tectonics and possible mantle serpentinisation.E-Mail: [email protected]
The symmetry or asymmetry of the riftingprocess leading to breakup (e.g. the pure vs.simple shear debate) is strongly debated andhas led to the proposed study of conjugaterifted margins. However, exact conjugates arein many case difficult to determine, and theseuncertainties combined with the natural alongstrike variations in margin structure make thestudy of conjugate margins problematic. Fur-thermore, it is unclear how the crust is ex-tended by the extreme amounts that can beinferred from the thinness of the crust as thecontinent-ocean transition is approached: thegeometry of the observable normal faults canaccount for only a fraction of the total thinningobserved.
To address these problems and improve ourunderstanding of the rifting process leading tobreakup, we have applied pre-stack depth mi-gration to a series of high quality MCS pro-files collected by Fugro-Geoteam across theV-shaped Porcupine Basin. Axial stretchingfactors within this basin increase from c. 1.5in the north to values typical of rifted mar-gins (>6) in the south. Thus a series of tran-sects across the basin can be used to deducehow a rift develops into a fully–fledged riftedmargin. Furthermore, as both margins of thebasin can be studied along a single transect,the basin provides the opportunity to inves-tigate the symmetry/asymmetry of the riftingprocess.
First results indicate that extension wassymmetric until detachment faults developed
at stretching factors greater than about 4. Thiscorresponds to the expected onset of mantleserpentinisation: at such a stretching factor,the entire crust has become brittle allowingthe passage of fluids into the mantle and theconsequent development of serpentine. As themain detachment dips consistently to the west,beyond this point, the extension is asymmet-ric.
Marine Geophysik – Poster 233
MGP10Zöllner, H., Berger, D., Schikowsky, P. (Universität Leipzig)
Absorptionskarte des Greifswalder BoddensE-Mail: [email protected]
Die Bedeckung vieler Binnenseen undFlachmeere mit Schlick -der in vielen Fäl-len auch durchgast auftritt- stellt für seismi-sche Messungen im Allgemeinen große Pro-bleme dar. Neben Einflüssen auf die Laufzeitist vor allem die außerordentlich starke Ab-sorption eine Störgröße, die die Interpretati-on der Daten erheblich erschwert oder teilwei-se ganz unmöglich macht. Bei Interpretatio-nen von reflexionsseismischen Daten aus demGreifswalder Bodden zeigte sich, dass die Ab-sorption Werte bis nahezu 100 Prozent aufwei-sen kann. Erste qualitative Kartierungen er-gaben eine eindeutige Korrelation von Loka-tionen mit Durchgasungen (ermittelt aus Se-dimentechogrammen) und hohen Werten derAbsorption. Durch Anfertigung einer Absorp-tionskarte wird es möglich, Aussagen über
Abbildung 1: Seismogramm mit typischenNutzsignalausfällen durch starke Absorptiondes Seebodens; im oberen Teil ist die Maxima-lamplitude der jeweiligen Spur im Zeitfensterzwischen 500 und 700ms aufgetragen
die räumliche Verteilung von Schlickmächtig-keit und Stärke der Durchgasung zu treffen.Zudem repräsentiert die Karte die zu erwar-tende seismische Datenqualität in einem be-stimmten Bereich und kann bei Interpretati-onsunsicherheiten berücksichtigt werden. Eszeigte sich, dass die Schwankungen der Re-flexionskoeffizienten einzelner Reflexionsho-rizonte innerhalb des Arbeitsgebietes im Ver-hältnis zu den absorbierenden Oberflächenbe-dingungen vernachlässigbar sind. Methodischwird daher so vorgegangen, dass stellvertre-tend für die Absorption der Amplitudenwerteines im gesamten Arbeitsgebiet sicher auszu-haltenden Reflektors untersucht wird. Der Ab-sorptionskarte werden Ergebnisse von Kartie-rungen der Ersteinsätze, Lokationen mit Sin-ging, der Wassertiefe und Gasindikationen aufSedimentechogrammen gegenübergestellt.
Abbildung 2: Lage der seismischen Profi-le und qualitative Kartierung von Lokationendeutlich erhöhter Absorption.
234 Abstracts
MGP11Papenberg, C., Petersen, J., Klaeschen, D. (Kiel, GEOMAR)
Wide-angle reflection amplitude variations along a bottom simulating reflector (BSR) atHydrate RidgeE-Mail: [email protected]
Hydrate Ridge is part of the Cascadia ac-cretionary complex and is characterized by thepresence of extensive gas hydrates. The baseof the gas hydrate stability zone is markedby a well-pronounced bottom simulating re-flector (BSR) in all seismic sections. To in-vestigate amplitude variations along the BSRand how they relate to structural lithologies ofhydrate bearing sediments, seismic data havebeen recorded during the HYDGAS cruise insummer 2000, covering near- and wide-anglereflection data with a frequency range from10 to 500 Hz. One aspect of our project,which is presented here, is the analysis of lo-cal anomalies (’bumps’) in AVA (AmplitudeVariation with Angle) curves deviating from abackground AVA trend and how they coincidewith the reflection strength pattern of vertical-incidence streamer sections. Ocean BottomHydrophones and Seismometers (OBH andOBS) were placed densely with 200 meters
3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 47000
0.1
0.2
0.3
|Rpp|
bump
Model - Distance [m]
Figure 2: Vertical-incidence amplitudes, de-rived from wide-angle reflection OBH data
spacing along regional line OR89-2, makingthe BSR reflections overlap for 150 meters toeach station. Since seismic sections of OBHsare of common receiver geometry, the foot-print of the BSR is up to 300 meters longand therefore amplitude analysis with increas-ing angles (AVA analysis) is not directly com-parable with common AVO analysis in com-mon midpoint geometry. Raw amplitudes arecorrected for geometric spreading and for thefree surface ghost reflection. Since the sourcepulse interferes with the ghost reflection, anangle dependent correction factor has to be ap-plied in addition to the geometric spreadingcorrection. For the direct water wave this isequivalent to an additional amplitude multi-plication with t, leading to an overall correc-tion factor of t2. All other reflection ampli-tudes (e.g. BSR) have to be corrected traceby trace with calculated takeoff angles respec-tively. The main objective is to map localamplitude anomalies and compare these withthe reflection strength pattern of vertical in-cidence streamer reflection data. To obtainthe effective vertical incidence reflection pat-tern in OBH sections, the data passes a spe-cific processing scheme. All OBH sectionsare flattened to gain more coherency for easierpicking of the BSRs raw amplitudes. Theseamplitudes are then assigned to a reflectionpoint along the BSR. For this purpose a veloc-ity model was derived by traveltime inversion,not only to calculate the reflection points at theBSR but also to obtain the correspondent take-off angles from each shot. This is necessary to
Marine Geophysik – Poster 235
Figure 1: Prestack time migrated seismic section across the southern summit of Hydrate Ridge
correct the amplitude at this point. Geometriccorrections applied to the picked amplitudesyield AVA-curves in common receiver geom-etry. These AVA-curves are then reduced tovertical-incidence reflection-strength sectionsby subtracting a mean background AVA-trend.
Amplitudes of three OBS stations arepicked and geometric corrections applied toobtain common receiver AVA-curves withinthree different frequency ranges. Mean theo-retical AVA-curves (Zoeppritz equations), de-rived from Vp,Vs and Rho ratios, are sub-tracted from the picked AVA trend. The re-sulting reflection strength pattern is now re-duced to vertical incidence. The AVA anoma-lies investigated from our three OBS stationscorrelate with zones of local higher velocitiesand with patches of relative strong reflectiv-ity in the migrated streamer section OR-89-2.Some anomalies though are restricted to onlyone profile, recorded with a specific seismicsource. A possible explanation is the uncer-tainty of the velocity model, which is the keyelement of the main process flow. Amplitude
correction factors as well as subsurface reflec-tion points are calculated from the geometry ofthis model. With the results of the recent ODPleg 204 a more detailed velocity model willmake interpretations more accurate. Anotherexplanation of uncorrelating anomalies is pos-sibly due to thin hydrate bearing layers and/ortuning effects. In this case the AVA-trend mayshow a strong frequency dependency. There-fore the next step will include forward model-ing of synthetic sections and waveform anal-ysis, as well as expanding the investigation tomore OBS stations along the BSR.
236 Abstracts
MGP12Klaucke, I., Weinrebe, W., Bohrmann, G. (GEOMAR, Kiel)
Use of High-Resolution Sidescan Sonar in the Study of Near-Surface Marine Gas Hydra-tes and Associated FeaturesE-Mail: [email protected]
Near surface gas hydrates and associatedfeatures such as carbonate crusts, mud vol-canoes, clam fields and bacterial mats in theBlack Sea and on Hydrate Ridge have been thetarget of detailed studies using high-resolutionsidescan sonar. The main target of the stud-ies is to distinguish and quantify the extent ofthe individual features. Our recently acquireddual-frequency sidescan sonar system uses 75kHz (for up to 1500 m swath width) and 410kHz (up to 200 m swath width) Chirp sidescansignals together with a 2-16 kHz Chirp sub-bottom profiler in order to image up to 1500and 200 m wide swaths of the seafloor, and toprovide up to 30 m of subbottom penetration,respectively. Yet unsolved problems with thestability of the towfish resulted in relativelyhigh towing speeds around 3 kn, which givealong-track resolutions of 1.5 and 0.25 m forthe 75 and 410 kHz sidescan sonar, respec-tively. Vertical resolution of the subbottomprofiler is up to 6 cm, and underwater navi-gation of the towfish was carried out with aportable USBL system providing a resolutionof about 1% of the range. Initial processing ofthe data clearly indicate a strong improvementover previously available mid-range sidescansonar imagery (30-36 kHz) with better distinc-tion between individual features. However,only the most recently active features are im-aged with this system while older features areburied under a thin sediment cover and remain’invisible’ for high-resolution sidescan sonar.An exception to this rule are carbonate crustsand chemoherms that are widely associated
with near-surface gas hydrates and representthe remnants of former fluid venting struc-tures. Such carbonate crusts are widely dis-tributed on the summits and flanks of HydrateRidge (offshore Oregon) and on the top ofmud volcanoes in the Sorokin Trough (SE ofCrimea, Black Sea). Mudflows and clam fieldsare also clearly imaged, especially with 410kHz sidescan sonar. However, whether the ex-tent of near-surface gas-hydrates and bacterialmats can be quantified on the basis of high-resolution sidescan sonar is not yet clear andrequires further integration of sidescan sonardata, subbottom profiler records and ground-truthing from video observations and coring.
Web page: http://www.gashydrate.de
Marine Geophysik – Poster 237
MGP13König, M., Jokat, W. (Bremerhaven, AWI)
Eine Magnetikkompilation für den Südatlantik:Grundlage neuer Modelle zum frühen Gondwana-AufbruchE-Mail: [email protected]
Das Alfred-Wegener-Institut (AWI) hat seitin den Jahren 1996 - 2002 im Bereichdes östlichen Weddell-Meeres, der Lazarev-und Riiser-Larsen-See ein intensives Flug-programm mit mehr als 90000 km Flugli-nien durchgeführt. Ziel des EMAGE Pro-jektes (East Antarctic Margin Aeromagneticand Gravity Experiment) ist es, neue Informa-tionen zur mesozoischen ÖffnungsgeschichteGondwanas zu sammeln.
Zusammen mit den Daten des USAC Pro-jektes (US-Argentine-Chile) aus den Jahren1985 - 1989, einer Kompilation russischer Da-ten von Golynsky et. al 1998 und den Datendes US NGDC in Boulder wurde daraus eineumfangreiche Datenbasis erstellt.
Diese Gesammtkompilation ist die Grund-lage für ein Modell, das eine erste Öffnungzwischen Afrika und der Antarktis im Bereichder Riiser-Larsen-See vor ca. 155 Ma vor-sieht. Im heutigen Weddell-Meer schiebt sichdas Weddell Rift zwischen 144 Ma und 146Ma von südwesten nach nordosten und erzeugtso in diesem Bereich den ersten Ozeanboden.Vor 139 Ma kommt es schließlich zur Tren-nung von Westgondwana und Ostgondwana,was in den küstenparallelen magnetischen An-omalien nördlich von Dronning Maud Landsehr gut dokumentiert ist.
238 Abstracts
MGP14Dehghani, G. A., Hübscher, Ch. (Universität Hamburg), Ben-Avraham, Z. (Tel-Aviv Universi-ty), Gajewski, D. (Universität Hamburg)
Gravimetrische und magnetische Messungen am Kontinentalrand von Israel und auf demNil-FächerE-Mail: [email protected]
Wechselwirkungen zwischen sedimentolo-gischen, tektonischen und geodynamischenProzessen wie Subsidenz, Salztektonik undKrustendehnung waren Forschungsthema derMETEOR–Expedition M 52/2 in das süd–östliche Mittelmeer. Im Rahmen des GEM-ME Projektes (Geophysik und Geologie imsüd-östlichen Mittelmeer) wurden umfangrei-che gravimetrische und magnetische Messun-gen durchgeführt. Die gravimetrischen Mes-sungen wurden in Istanbul begonnen, wäh-rend der gesamten Zeit (33 Tage) kontinuier-lich weitergeführt und in Limassol beendet.Die magnetischen Daten wurden mit einemGradiometer und parallel zu den seismischenProfilen aufgenommen. Es wurden insgesamt6000 km gravimetrische und 1600 km magne-tische Profile vermessen. Die Profile wurdenso angelegt, daß die tektonisch interessantenEinheiten wie z. B. die Gaza– und Palmahim–Rutschung entlang des Kontinentalhanges er-faßt wurden.
Weiterhin wurde im Bereich der seismolo-gisch aktiven Carmel–Struktur ein dicht an-gelegtes Profilnetz gravimetrisch, magnetisch,und seismisch untersucht, um Aussagen überden Übergang zwischen Krusten– und Sedi-mentstrukturen in diesem Gebiet machen zukönnen. Die aufgenommenen Potentialdatensind von sehr guter Qualität und lassen ins-besonders im Bereich der Carmel-Struktur ei-ne 3–D Modellrechnung zu. Die Freiluftan-omalie in dem Untersuchungsgebiet ist gene-rell negativ und hat Werte zwischen 0 und
250 mGal. Eine Ausnahme wurde im Bereichvon 11°S verzeichnet, wo positive Freiluftan-omalien mit Amplituden von +60 mGal beob-achtet wurden. Die magnetischen Anomalien(Restfeld) sind tendenziell positiv und errei-chen Amplituden bis zu + 500 nT.
Es werden einige interessante Profile prä-sentiert. Weiterhin wird auf dem Poster eineSchwere– und Magnetikkarte dargestellt.
Webseite: http://www.geophysics.dkrz.de
Marine Geophysik – Poster 239
MGP15Dehghani, G. A., Heinbockel, R. (Universität Hamburg), Haase, K. (Universität Kiel)
Gravimetrische und magnetische Untersuchungen während der SONNE 160 Fahrt amGalapagos RiseE-Mail: [email protected]
Im Verlauf der Expedition SO 160 (GARI-MAG) im September und Oktober 2001 wur-den gravimetrische und magnetische Messun-gen sowohl am Galapagos Rise als auch aufder Transitfahrt zum und vom Galapagos Risedurchgeführt (siehe Abbildung). Das Haupt-untersuchungsgebiet befindet sich zwischen13° S und 95,5° W, 9,5° S und 94° W undist vermutlich eine abgestorbene Spreizungs-zone, die vor ca. 18,5 bis 6,5 Million Jahrenaktiv gewesen sein könnte.
Ziel der gravimetrischen und magnetischenUntersuchungen in diesem Gebiet war, die ge-naue Lage der alten Spreizungsachse zu be-stimmen. Weiterhin sollten mit Hilfe der gra-vimetrischen und magnetischen Modellrech-nungen Aussagen über den Aufbau und dieStruktur der Kruste in diesem Bereich ge-macht werden. Die gravimetrischen Datenwurden verwendet, um die Dichtekontraste,die Tiefe und die Orientierung der untenlie-genden Strukturen zu ermitteln. Als letztessollte anhand der magnetischen Daten und de-ren Interpretation das Alter der hier entstande-nen ozeanischen Lithosphäre sowie die Plat-tenbewegungsrichtung bestimmt werden.
Für die gravimetrischen Untersuchungenwurde das Seegravimetersystem des Institutsfür Geophysik der Universität Hamburg (IfG)eingesetzt. Das System wurde in Guayaquil(Ecuador) auf dem Forschungsschiff SON-NE installiert und war während des gesam-ten Fahrtabschnittes ununterbrochen in Be-trieb. In Antofagasta (Chile) wurde das Sys-tem wieder abgebaut. Die Aufzeichnung der
Schwere- und Navigationsdaten erfolgte so-wohl analog als auch im Abstand von 10 Se-kunden digital.
Die aufgezeichneten Schweredaten am Ga-lapagos Rise wurden in einer Schwerekarte(Freiluft und Bouguer) zusammengestellt. AmGalapagos Rise zeigt die Freiluftkarte ein Mi-nimum von bis zu ≈100 mGal, während inder ungestörten Umgebung ein Minimum von≈200 mGal herrscht. Die Bouguerkarte vari-iert zwischen ≈20 mGal bis ≈60 mGal, wasein Zeichen dafür ist, daß das Gesteinsmateri-al am Galapagos Rise eine niedrigere Dichteals normal aufweist.
Die Schweredaten, die auf den beiden lan-gen Transitprofilen gesammelt wurden, wur-den zur Kalibrierung der Satellitendaten ver-wendet.
Die magnetischen Daten wurden währenddieser Fahrt mit Hilfe eines Gradiometers desIfG aufgenommen. Auch sie wurden analogund digital aufgezeichnet und zeigen sehr in-teressante Anomalien sowohl im Bereich derSpreizungszone als auch auf Teilen der langenTransitprofile.
Das hier präsentierte Poster zeigt die Ergeb-nisse dieser Untersuchungen und deren Inter-pretation.
Webseite: http://www.geophysics.dkrz.de
Marine Geophysik – Poster 241
MGP16Neben, S., Damm, V., Tessensohn, F. (BGR Hannover)
Gibt es die Wegener Störung? Die seimische Struktur der Nares StraßeE-Mail: [email protected]
Die Frage „Gibt es eine große Störung inder Nares Straße zwischen Grönland und Ka-nada?“ wird seit über 80 Jahren kontroversdiskutiert. Geologische Korrelationen zwi-schen Grönland und Ellesmere Island ergabeneinen maximal möglichen Versatz von 25 km.Demgegenüber wird nach plattentektonischenRekonstruktionen ein sinistraler Versatz vonmindestens 225 km postuliert.
Zur Beantwortung dieser Frage wurdein deutsch-kanadischer Zusammenarbeit eineseismische Messfahrt (Nares Geocruise 2001)durchgeführt. In verschiedenen Abschnittender Nares Straße, im Hall Becken im Norden,im Kennedy Kanal in der Mitte und in der Nor-thwater Bucht im Süden wurden mit einemmkanadischen Eisbrecher mehrkanalige refle-xionsseismische Profile gemessen.
Das seismische Bild wird vorwiegenddurch hochenergetische Meeresbodenreflexio-nen bestimmt, die durch das proterozoischeBasement, proterozoische und paläozoischeKlastika sowie besonders ausgeprägt durchpaläozoische Karbonate hervorgerufen wer-den. Die flachen Wassertiefen verursachenstarke Multiple und erschweren das Abbildentieferer Strukturen. In der nördlichen Na-res Straße (Hall Becken) wird das seismischeBasement durch Blockverwerfungen versetzt.Weiter im Süden besteht das Basement aus un-deformierten paläozoischen Karbonaten. Ins-gesamt ist in dieser Region die Sedimentbede-ckung sehr gering.
In der Northwater Bucht nördlich der Baf-fin Bay wurden Sedimentbecken angetrofffen,die vermutlich känozoische Füllungen aufwei-
sen. Diese Becken zeigen, vor allem in denRandbereichen kompressive Deformationen,die durch Hochlagen des akustischen Base-ments begrenzt werden. Die Becken streichenSW-NE, während das westliche „NorthwaterBasin“ N-S streicht. Eine als Störung inter-pretierbare Struktur begrenzt die östlichen Be-cken an ihrem Westrand.
Außer dieser Störung gibt es in der NaresStraße in den seismischen Profilen keine An-zeichen für eine große, NE-SW streichendeTransform Störung.
Seismologie 243
SL01 – Mo., 24.2., 11:00-11:20 Uhr · HS1Bormann, P. (GFZ Potsdam)
Earthquake magnitude - what does this parameter really mean?E-Mail: [email protected]
Besides source location, the magnitude isthe most frequently used parameter to charac-terize a seismic source and is of utmost im-portance for proper earthquake hazard assess-ment. However, most users are neither awareof the original definitions underlying the vari-ous magnitude scales, their physical basis, in-herent limitations, variability, etc., nor of im-proper procedures of magnitude determinationand annotation which are not in accordancewith internationally recommended standards.This may result in incompatible data, baselinechanges in earthquake catalogs and wrong in-ferences.Magnitude was originally intended to be ameasure of earthquake size in terms of theseismic energy ES released by the source.ES is proportional to the squared velocity ofground motion. It can be obtained by integrat-ing spectral energy density over all frequen-cies contained in the P-, S- or surface-wavegroups. This procedure could not be carriedout efficiently with analog recordings. There-fore, Gutenberg (1945) assumed that the maxi-mum amplitude observed in a wave group wasa good measure of the total energy in that ar-rival. As classical seismographs were rela-tively broadband displacement sensors, he ob-tained a measure of ground motion velocity bydividing the measured maximum ground dis-placement by the associated period. However,Gutenberg´s magnitude calibration functionsdid not account for frequency-dependent at-tenuation. Classical calibration functions are,therefore, usually applicable only over ratherlimited frequency ranges, e.g., around 1 Hz
and 0.05 Hz, respectively. According to Fig-ure 1 magnitude can be a reasonable measureof ES only if it samples the maximum am-plitudes in the velocity spectrum, which oc-cur at the corner frequency fc of the displace-ment ”source spectrum”; fc decreases withincreasing seismic moment and, thus, withmagnitude. Most classical band-limited seis-mic recordings sampled the ground motionover a bandwidth of not more than 1 to 3octaves. Hence, sampling of spectral ampli-tudes at frequencies smaller or larger than fcunderestimates the maximum ground velocityand, thus, ES. This is the case for the body-wave magnitude mb, which is determined byNEIC and ISC from narrow-band short-periodrecordings centered around 1 Hz, already formagnitudes larger than about 5. Similarly, Ms,which is determined from surface waves withperiods around 20 s, underestimates maximumground velocity and ES for Ms < 6 and for Ms> 7.5 (Figure 1).
Accordingly, all band-limited magnitudessaturate, e.g., Ms for values > 8.5, Gutenberg´soriginal body-wave magnitude mB for > 7.5whereas mb saturates already for > 6.5. Toovercome the problem of saturation, magni-tude determinations should be based on broad-band digital recordings with a bandwidth ofideally 4 decades or even more. Only then itcan be assured that the peak of the ground-velocity spectrum as well as a fair part ofhigher and lower frequencies on both sides ofthe corner frequency are covered within thepass-band of the seismograph. This pass-bandis sufficient to allow determination of both thescalar seismic moment M0 (and the associ-
244 Abstracts
ated moment magnitude Mw) and the radiatedenergy ES (and the associated energy mag-nitude Me). Both Mw and Me do not satu-rate. However, direct determination of ES isnot trivial and requires a good distribution ofstations. Moreover, Mw and Me express dif-ferent aspects of the seismic source and maydiffer by more than one magnitude unit. Mwis derived from the (near) zero-frequency partof the source spectrum and thus related to thefinal static displacement and thus to the tec-tonic effect of an earthquake. In contrast, Meis more related to the high-frequency contentin the radiated spectrum and thus to seismichazard and damage potential of an earthquake.We propose to develop a non-saturating mBscale that is closely linked to Me and thus tothe original magnitude concept of Gutenberg.This mB could be determined at single stationsequipped with a velocity-proportional digitalbroadband sensor by sampling the maximumamplitudes of ground velocity with a prede-fined, e.g., 1 octave, bandwidth. However, ap-
Figure 1: ”Source spectra” of ground displace-ment and velocity, respectively for a seismicshear source scaled to the scalar seismic mo-ment, moment rate and corresponding surface-wave magnitude Ms, respectively. The brokenline (long dashes) shows the increase of cornerfrequency fc with decreasing seismic momentof the event.
propriate and tested frequency-dependent cal-ibration functions for such an mB magnitudeare not yet available.
Despite the advantage of more physicallybased broadband magnitudes, the overwhelm-ing majority of magnitude data is and will con-tinue to be based for quite some more timeon band-limited recordings using the classicalformulas. In many earthquake-prone regions,particularly those lacking historical macro-seismic data and strong-motion records, seis-mic hazard assessment rests on the availabilityof such data. Moreover, band-limited magni-tudes sometimes have value for purposes otherthan energy or moment estimates. E.g., themb/Ms ratio is a very powerful teleseismicdiscriminator between earthquakes and under-ground nuclear explosions, and Ml (=ML) is,at least up to medium-size earthquakes, wellscaled with macroseismic intensity and, thus,damage. Therefore, magnitudes of differentkinds will still be needed in the foreseeablefuture. Their proper use, however, requires anunderstanding of their potentials, limitations,original definitions and mutual relationshipsand their long-term availability, stable deter-mination and unambiguous reporting accord-ing to agreed standards of measurement andannotation have to be assured.These issues are discussed in great detail in theIASPEI New Manual of Seismological Obser-vatory Practice (Bormann, 2002). Currently,a IASPEI WG on Magnitude Determinationlooks into the standardization of filter param-eters for reproducing magnitudes from digi-tal broadband records that are compatible withthe classical magnitudes Ml, Ms, mB and mb.
Seismologie 245
SL02 – Mo., 24.2., 11:20-11:40 Uhr · HS1Gutdeutsch, R. (Wien), Kaiser, D. (Hannover)
Regressionsverfahren seismologischer Daten - eine GegenüberstellungE-Mail: [email protected]
Aus einem Datensatz I0i, MSi mit i = 1, ...,N(I0 Maximalintensität, MS Oberflächenwellen-magnitude, als Beispiel) werden mit 5 ver-schiedenen Ansätzen lineare Näherungsfunk-tionen abgeleitet und verglichen:
Standard-RegressionAnsatz einer linearen BeziehungMS = AI0 +B oder I0 = CMS +D
∑(MSi −AI0i −B)2 = min.fehlerbehaftetes MSi (1)
∑(I0i −CMSi −D)2 = min.fehlerbehaftetes I0i (2)
Abbildung 1: N = 405 Eintragungen I0, MS, Erd-bebenkatalog von Kárník 1996, Herdtiefe 1km <H ≤ 30km, nur verläßliche I0, Anzahl der Stationenmit MS Meldungen > 3; Legende: (1): MS feh-lerbehaftet, I0 fehlerfrei, (2): I0 fehlerbehaftet, MSfehlerfrei, (3): orthogonale Regression, (4): Maxi-mum likelihood, (5): Mittelwert aus 1 und 2.
Orthogonale Regression (Ambraseys et al.1996, Gutdeutsch et al. 2002)
∑h2i = ∑(P−nMSMSi −nI0I0i)2 = min. (3)
mit P = const. = Abstand der Gera-den vom Koordinatenursprung, (nMS ,nI0) =(cosφ,sinφ) = Normalenvektor der Länge 1.Die Nebenbedingung nMS
2 +nI02 = 1 bewirkt,
dass die Fehler ΔI0i und ΔMSi automatisch ge-wichtet in den Gesamtfehler eingehen:
hi = nI0ΔI0i +nMSΔMSiMaximum likelihood
Abbildung 2: N = 79 Eintragungen MS, ML, Erd-bebenkatalog von Kárník 1996, Herdtiefe 1 km <1 km ≤ 30km, Anzahl der Stationen mit MS Mel-dungen > 3, nur verläßliche I0; Legende: (1): MLfehlerbehaftet, MS fehlerfrei, (2): MS fehlerbehaf-tet, ML fehlerfrei, die übrigen Geraden (3): ortho-gonale Regression, (4): Maximum likelihood, (5):Mittelwert von (1) und (2) fallen praktisch zusam-men und werden nicht getrennt bezeichnet.
246 Abstracts
(Hantel et al. 2000, Grünthal et al. 2002)Mit allgemeineren Voraussetzungen ar-
beiten andere Methoden des Maximumlikelyhood-Prinzips. Wir haben die bei Hantelet al. verwendete zu mimimierende Funktionbenutzt:
∑i
⎛⎜⎝
(I0i − MSi
A + BA
)2
σI0,I20
+(MSi −AI0i −B)2
σMS,M2S
⎞⎟⎠
= min. (4)
mit σI0,I20= Autokovarianz von I0, σMS,M2
Svon
MS, beide in Bezug auf den Datenschwer-punkt.
Mittelwerte (Schenk et al. 1996)Vorschlag einer linearen Beziehung
Ms = A′ +B′I0 (5)
mit A′ = 1/2(A + 1/C), B′ = 1/2(B−D/C)(arithmetische Mittelwerte der Koeffizienten).
ErgebnisseDie Daten (I0i,MSi) stammen aus dem
Erdbebenkatalog von Kárník 1996. In Abb. 1werden die 5 Regressionsverfahren einandergegenübergestellt. Nur die Mittelwertsgerade(3) und die Gerade der maximum likelihoodliegen dicht beieinander. Weit besser als(I0i,MSi) korreliert der Datensatz (MSi,MLi)mit ML = Lokalmagnitude. Zum Vergleich ister in Abb. 2 aufgeführt. Hier unterscheidensich die Geraden (3), (4) und (5) fast gar nichtmehr. Für gut korrelierte Datensätze ist esbelanglos welche Form der Regression, unterAusschluß von (1) und (2), man wählt.
LiteraturGrünthal, G., Stromeyer, D. & Wahlström,
R. (2002): Chi-square maximum likelihoodregression for local magnitude, maximal in-tensity and focal depth with uncertainties.ESC-Generalversammlung, Genua
Gutdeutsch, R., Kaiser, D. & Jentzsch, G.(2002): Estimation of earthquake magnitu-des from epicentral intensities and other focalparameters in Central and Southern Europe.Geophys. J. Int., 151, 1-11
Hantel, M., Ehrendorfer, M. & Haslinger,A. (2000): Climate sensitivity of snow coverduration in Austria. Int. J. Climatology 20,615-640
Schenk, V., Schenková, Z., Kottnauer, P.,Guterch, B. & Labák, P. (2000): Earthqua-ke hazard for the Czech Republic, Poland andSlovakia - Contribution to the ILC/IASPEIGlobal Seismic Hazard Assessment Program,Natural Hazards 21, 331-345
Webseite: http://www.geo.uni-jena.de/geophysik/seismologie/esc02macmag.pdf
Seismologie 247
SL03 – Mo., 24.2., 11:40-12:00 Uhr · HS1Klinge, K., Stammler, K., Plenefisch, T. (SZGRF Erlangen)
LOKALISIERUNG UND HERDPARAMETER BESTIMMUNG SEISMISCHER ER-EIGNISSE AM SZGRF UNTER EINBEZIEHUNG VON WELLENFORMDATENVERSCHIEDENER STATIONSNETZEE-Mail: [email protected]
Das Seismologische ZentralobservatoriumSZGRF hat neben seiner Funktion als Daten-zentrum für das GRF-Array und das Deut-sche Regionalnetz (GRSN) die Aufgabe loka-le, regionale und globale seismische Registrie-rungen zu analysieren, zu interpretieren unddie Ergebnisse nationalen und internationalenEinrichtungen (NEIC, ISC, EMSC) zur Verfü-gung zu stellen. Die bisherigen Routineauf-gaben der einfachen Detektion und Phasena-blesung an ausgewählten Stationen wurdenin letzter Zeit wesentlich ergänzt durch im-mer genauere Lokalisierungen und Interpre-tationen (Erdbeben, Explosionen, bergbauin-duzierte Ereignisse), sowie durch Bestimmun-gen von Herdmechanismen bei stärkeren lo-kalen Ereignissen (M > 4). Diese Verbesse-rungen insbesondere in Grenzbereichen warennur möglich durch die Einbeziehung zusätz-licher in- und ausländischer Stationen bzw.Stationsnetze, wie dem GEOFON, dem Ös-terreichischen und dem Schweizer Stations-netz, Tschechischen Stationen und ausgewähl-ten Stationen deutscher lokaler Netze. BeiBeben im unmittelbaren Bereich von lokalenStationsnetzen kann jedoch die Genauigkeitder lokalen Netze nicht erreicht werden undnur durch deren Beitrag kann ein qualitativhochwertiges Bulletin seismischer Ereignissein Deutschland herausgegeben werden. Aufweitere mögliche Verbesserungen, wie die Er-richtung offener Datenzentren und gemeinsa-mer Datenportale wird im Vortrag eingegan-
gen.
Webseite: http://szgrf.bgr.de
248 Abstracts
SL04 – Mo., 24.2., 12:00-12:20 Uhr · HS1Tittel, B. (Leipzig / Collm)
Seismische Ereignisse als Objekte von HäufigkeitsverteilungenE-Mail: [email protected]
Erkenntnisse, die auf Arbeitserfahrungenim aktuellen seismologischen Stationsdienstbasieren, werden anhand von drei Beispielenvorgestellt:1) Seismische Registrierungen unterirdischerNukleartests seit dem internationalen Vertragüber das teilweise Verbot von Kernwaffen-versuchen (PTBT 1963) bis zum Ende derTestprogramme (1998).Solche an der Station Collm (CLL) registrier-ten Ereignisse mit Raumwellenmagnitudenzwischen etwa 4.3 und 6.9 im Entfernungsbe-reich zwischen 18° und 145° wurden anhandverschiedener Merkmale - häufig schonaktuell - sicher von natürlichen Erdbebenunterschieden und damit als “künstlich verur-sacht“ erkannt. Die seismologische Detektionder Tests war das überregional wichtigsteNachweiskriterium und hat der Seismologieeine bedeutende Aufwertung eingebracht.Die Abschätzung der unbekannten Stärkeder Tests (Ladungsmengen-Äquivalent inKilotonnen TNT) mit ihren Magnituden blieballerdings bis zuletzt ein nur teilweise gelöstesProblem.Kurzperiodische PKP-Wellen, die nach Testsim Südpazifik an mitteleuropäischen Statio-nen registriert wurden, hatten sich wegenentfernungsabhängigen, ungewöhnlich inten-siven Amplitudenänderungen als besonderseindrucksvolle Indikatoren füra) die Tests selbstund b) die Stationsentfernung der Erdkern-Kaustikzone bei Ereignissen in der oberstenErdkrusteerwiesen.
2) ErdbebenserienIn vielen seismisch aktiven Regionen der Er-de folgen auf bestimmte große Beben Nachbe-benserien, wobei sich mit meist nur geringfü-giger Migration der Hypozentren i.a. schwä-cher werdende Beben aneinanderreihen. Dasdeutet auf zeitlich und lokal gestaffelten Span-nungsabbau hin.Hier werden Bebenserien aufgezählt, bei de-nen je mindestens 50 im obigen Sinne zusam-mengehörige Beben ohne größere Zeitlückenin CLL registriert wurden. Das zeitliche Ab-klingen erfolgt nach quantitativ vergleichba-ren Gesetzmäßigkeiten. Darüber hinaus sindjedoch manche Bebenserien durch individuel-le Merkmale gekennzeichnet.
3) Erdbebenschwarm in der NW-lichenTschechischen Republik, Herbst 2000An der grenznahen sächsischen Station WER-Nitzgrün wurden in etwa 13 km Herdentfer-nung über 10500 Einzelbeben (mit Magnitu-den zwischen etwa -0.4 und +3.4) registriert.Dabei kam es während der besonders akti-ven Perioden zu Anhäufungen von über 20Einzelbeben pro Minute; dazwischen lagenaber auch ganz bebenfreie Tage. Gerade sol-che Nahfeld-Seismogramme zeigen deutlicheStrukturunterschiede, die auf variierende Hy-pozentren und Herdvorgänge hinweisen.Analoge Untersuchungen wie beim ähnlichen,stärkeren Bebenschwarm 1985/86 für CLLund andere Stationen mit vergleichbaren Her-dentfernungen haben zu Erkenntnissen ge-führt, die - siehe Erdbebenserien - nebenreproduzierbaren Eigenschaften auch spezifi-
250 Abstracts
SL05 – Mo., 24.2., 12:20-12:40 Uhr · HS1Kroner, C., Jahr, Th. (Institut für Geowissenschaften, FSU Jena), Fischer, K. D. (Ruhr-Universität Bochum)
Untersuchungen zu meteorologisch-induziertem Rauschen für das Geodynamische Ob-servatorium MoxaE-Mail: [email protected]
Luftdruck–induziertes Rauschen des Unter-grundes stellt einen wesentlichen limitieren-den Faktor in der Analyse seismologischerDaten dar, wobei insbesondere die Horizon-talkomponenten hiervon betroffen sind. Eingemeinsames Forschungsvorhaben des Geo-dynamischen Observatoriums Moxa und desGeowissenschaftlichen Observatoriums Schil-tach befaßt sich mit Untersuchungen, wiesich diese Luftdruckeinwirkung in den Regis-trierungen reduzieren läßt und wie die phy-sikalischen Zusammenhänge aussehen. DieLuftdruckeinwirkung beruht auf der Gravita-tionswirkung der Luftmassen und der von ih-nen verursachten Deformation der Erdkrus-te, die sich durch Beschleunigungen und Nei-gungen auswirken. Weitere Faktoren, dieden Luftdruckeffekt beeinflussen, sind dieTopographie sowie direkt der Installations-ort des jeweiligen Instrumentes. Zum Nach-weis der physikalischen Zusammenhängewerden Finite–Element (FE)–Modellierungen(ABAQUS) vorgenommen. Die Resultate derUntersuchungen für Moxa werden vorgestellt.Für die Modellierung wurde die lokale Topo-graphie in der Observatoriumsumgebung aufdie wesentlichen Elemente wie Taleinschnitteund Bergflanken im Umkreis von etwa 1 kmum das Observatorium reduziert. Der Stol-lenbereich (60 m in EW–Richtung, 34 m inNS-Richtung), in dem sich die Quarzrohr–Strainmeter und das STS–1– und STS–2–Seismometer befinden, wurde mit einer Auflö-sung von 5 m modelliert. Dieses Modell wur-
de mit drei verschiedenen Luftdruckszenarienbelastet.
• eine homogene Luftdruckauflast
• Staudruck durch Wind
• Passage einer Luftdruckwelle von Westnach Ost und von Süd nach Nord.
Es wird eine rein elastische Rheologie benutzt,so daß einzelne Lasten überlagert und skaliertwerden können.
Die FE–Modellierungen ergeben, daß so-wohl durch eine einheitliche Luftdruckauflast,Windeinwirkung in Form von Staudruck alsauch bei der Passage einer Luftdruckfront si-gnifikante Neigungen und Strains in der Grö-ßenordnung einiger nrad und nstrains verur-sacht werden können. Dies liegt in der Grö-ßenordnung der Effekte, die in den Daten be-obachtet werden. Zusätzlich ergibt sich ei-ne Richtungsabhängigkeit in den Effekten fürdie einzelnen Instrumentenkomponenten, aberauch abhängig von der Bewegung der Luft-massen.
Seismologie 251
SL06 – Mo., 24.2., 12:40-13:00 Uhr · HS1Wirth, W., Wenzel, F. (Karlsruhe)
Analyse urbaner StandorteffekteE-Mail: [email protected]
Starkbebenaufzeichnungen von analogenRekordern, Aufzeichnungen mit einem mo-dernen digitalen Stationsnetz von Beben mitMagnitude < 5.3 und Intensitätsbeobachtun-gen während früherer Starkbeben werden ge-meinsam zur Analyse räumlicher Variatio-nen seismischer Bodenbewegung in Rumäni-ens Hauptstadt Bukarest verwendet. Aus derAuswertung dieser verschiedenen Datensätzefolgt ein geographischer Trend zunehmenderVerstärkung der Bodenbewegung in RichtungNord-West. Dabei variiert die Bodenbewe-gung im Frequenzbereich unterhalb von zweiHz nur wenig, wogegen sie zwischen 2 Hz und5 Hz um einen Faktor 3 bis 4 schwankt. Dieseismische Gefährdung Bukarests wird durchBeben eines räumlich eng begrenzten Herdge-bietes unter der Vrancea-Region am südöst-lichen Rand der Karpaten ausgemacht. Da-mit liegen i. d. R. Hypozentralentfernun-gen von mehr als 150 km vor. Variationender Bodenbewegung innerhalb des im Ver-gleich dazu relativ kleinen Stadtgebietes sinddeshalb hauptsächlich auf Standorteffekte zu-rückzuführen. Deren Ursache ist ein mächti-ges alluviales Sedimentbecken unter der Stadt.Die Lagerung der obersten quartären Schich-ten ist kompliziert und weist linsenförmigeStrukturen und stark variierende Schichtmäch-tigkeiten auf. Durch die oben beschriebeneHerd-Standort-Geometrie scheint eine beson-ders einfache Möglichkeit zur Zerlegung derBodenbewegung in Herd- und Standorttermegegeben zu sein. Das Verhältnis zweier Re-gistrierungen eines Bebens innerhalb der Stadtsollte das Verhältnis der Standorteffekte an
den entsprechenden Aufzeichnungsorten wie-derspiegeln. Tatsächlich aber weist eine sol-che Bestimmung dieser Verhältnisse ein ho-hes Mass an aleatorischen Schwankungen auf.Theoretische Berechnungen zeigen, dass die-se Schwankungen ca. 3 mal so gross sindals man aufgrund der unterschiedlichen Hy-pozentren und Herdflächenlösungen der unter-suchten Beben erwarten würde. Dies ist alsHinweis darauf zu deuten, dass die standard-mä ssig verwendete Parameterisierung der Bo-denbewegung in Herd-, Laufweg- und Stand-ortterme, die obigen Überlegungen zugrundeliegt, keine ausreichende Beschreibung dar-stellt. Vielmehr scheinen Ursachen und Aus-mass von Standorteffekten noch nicht voll-ständig verstanden. Mehrere bislang unbe-rücksichtigte Phänomene könnten möglicher-weise als Ansatz zur Erklärung der unerwarte-ten Komplexität der Standorteffekte herange-zogen werden. Solange diese jedoch nicht mitausreichender Genauigkeit vorhergesagt wer-den können, empfehlen wir eine probabilisti-sche Beschreibung von Standorteffekten mitzugehöriger Fehlerangabe.
252 Abstracts
SL07 – Di., 25.2., 09:30-09:50 Uhr · HS1Weidle, C. (Karlsruhe), Widiyantoro, S. (Bandung (Indonesien))
Hochauflösende P–Wellen Tomographie in einem globalen Erdmantelmodell – Die Me-thode der integrierten seismischen Tomographie am Beispiel Südost–RumäniensE-Mail: [email protected]
In den letzten 20 Jahren wurden mitmobilen Stationen viele seismologischeTomographie–Experimente mit lokalem oderregionalem Fokus durchgeführt. Diese Ex-perimente liefern hochqualitative Datensätze,die eine lokal hochauflösende Inversionder Geschwindigkeitsverteilung im oberenErdmantel unterhalb des Messgebietes er-möglichen. Mit linearisierten, teleseismischenTomographiemethoden stößt man dabei je-doch in Bezug auf die Tiefenauflösung aufProbleme, da die maximal auflösbare Tiefe inetwa der Gesamtauslage des Stationsnetzesentspricht.
Durch die Integration eines solchen regio-nalen Datensatzes in einen globalen Daten-satz und Inversion des gesamten Erdmantels,lassen sich unter Verwendung eines nicht–linearen, iterativen Lösungsansatzes und ei-ner an die vorhandene Datendichte angepass-ten Parametrisierung die jeweiligen Vorteilevon teleseismischer und globaler Tomogra-phie nutzen:(a) durch die Inversion des gesamten Erd-mantels mit einem iterativen, nicht–linearenLösungsansatz (unter Verwendung von 3D–RayTracing) werden Heterogenitäten der Ge-schwindigkeitsstruktur im Erdmantel lokali-siert und nicht in das regionale Untersu-chungsgebiet hineinprojiziert. Zudem wirddurch die Überdeckung der gesamten Erd-oberfläche mit Stationen eine gute Tiefenauf-lösung erzielt, was besonders bei tiefen Struk-turen, wie z.B. Subduktionszonen oder Man-telplumes von Interesse ist.
(b) Andererseits ermöglicht die enge Stations-überdeckung im Untersuchungsgebiet eine lo-kal feinere Parametrisierung und dadurch ei-ne regional hohe Auflösung der Geschwindig-keitsstruktur in der Größenordnung der tele-seismischen Tomographie. Das Ergebnis istzudem nicht isoliert, sondern im Kontext mitder überregionalen Geschwindigkeitsstrukturund bietet somit zusätzlich die Möglichkeit ei-ner großräumigeren Interpretation.
Aus dem CALIXTO–Experiment (Carpa-thian Arc Lithosphere X–Tomography), dasim Rahmen des Sonderforschungsbereiches461 (Starkbeben: Von geowissenschaftlichenGrundlagen zu Ingenieurmaßnahmen) durch-geführt wurde, steht ein hochwertiger regio-naler Datensatz zur Verfügung. Aus dem Ge-samtdatensatz von etwa 1800 Erdbeben imZeitraum des Experimentes von Mai bis No-vember 1999, wurde ein Subdatensatz von 60Erdbeben als regionale Datenbasis für die In-version zusammengestellt. Als globale Daten-basis dient der von Engdahl et al. überarbei-tete Datensatz von ISC– und NEIC–Daten ausden Jahren 1964–1998, der in allen gängigenglobalen Tomographiestudien verwendet wird(z.B. Bijwaard et al., Widiyantoro et al.).
Die Ergebnisse, vor allem auch aus syn-thetischen Auflösungstests zeigen u.a. die zuerwartende Verbesserung in der Tiefenauflö-sung im Vergleich zu den Ergebnissen einerInversion nach der linearisierten ACH – Me-thode, ebenso wie eine Überhöhung der Am-plituden in den obersten Bereichen des Mo-dells (bis in eine Tiefe von rund 65 km), die
Seismologie 253
sich auf nicht vorhandene Korrekturterme fürStations- und Krusteneffekte (z.B. Mohotopo-graphie) zurückführen lassen.
254 Abstracts
SL08 – Di., 25.2., 09:50-10:10 Uhr · HS1Martin, M., Wenzel, F. (Karlsruhe), CALIXTO Group
Hochauflösende P-Wellentomographie Südost-RumäniensE-Mail: [email protected]
Die häufigen Starkbeben in Südost-Rumänien (Vrancea Region) bedeuten einepermanente Gefährdung für die dortige Be-völkerung, insbesondere für die Bewohner dernahegelegenen Millionenstadt Bukarest. Einwichtiger Aspekt für die Risikoabschätzungist die genaue Kenntnis der Struktur desoberen Erdmantels. Alle Starkbeben desletzten Jahrhunderts (1940, 1977, 1986 u.1990) ereigneten sich im mitteltiefen Bereichzwischen 70 und 180 km Tiefe. Der Ort derEpizentren ist dabei nahezu konstant.
Geodynamische Modelle (z.B. Sperner etal., 2001) beschreiben die Vrancea Regionals ein Subduktionsszenario im Endstadium.Die tertiäre Subduktion entlang des Karpa-tenbogens endete im Miozän. Seither kames zur progressiven Ablösung der subduzier-ten Lithosphäre, beginnend im Nordwestenund fortschreitend nach Südosten hin. Heu-te befindet sich danach das letzte Stück ehe-mals subduzierter Lithosphäre im Ablösungs-prozess unterhalb Vrancea und ist für die star-ke Seismizität verantwortlich.
Zwischen April und November 1999 fandim Rahmen des Sonderforschungsbereichs461 ein Tomographieexperiment (CALIXTO)in Südost Rumänien zur Erforschung diesernahezu einzigartigen Erdbebenregion in Eu-ropa statt. Bereits erste Ergebnisse der tele-seismischen Tomographie mit Hilfe der ACH-Methode (Martin et al., 2001) und einem se-lektierten Datensatz zeigten ein deutliches Ab-bild des Hochgeschwindigkeitkörpers unter-halb Vrancea. Aufgrund von Einschränkun-gen in der Auflösung durch die benutzte li-
neare Inversionsmethode, sowie durch Ver-schmierungen durch unkontrollierte Krusten-effekte, war eine Bewertung der Geschwin-digkeitsstruktur allerdings nur im Rahmen dergroben Auflösungsgenauigkeit möglich. Ins-besondere die genaue Lage des ’Slabs’ imVerhältnis zur Lage der Hypozentren, sowiedie Tiefenbereiche unterhalb der Kruste (30-70km) bzw., unterhalb 300 km Tiefe konn-ten bisher nicht mit ausreichender Genauigkeitaufgelöst werden.
Seither wurde der Datensatz von 106 auf196 Erdbeben erweitert und somit eine erheb-liche Verbesserung der Durchstrahlung unddamit der Auflösung erreicht. Mit Hilfe derErgebnisse der refraktionsseismischen Expe-rimente Vrancea’99 (Hauser et al. 2001)und Vrancea’01 (Hauser et al., 2002) war esmöglich, entlang der Nord-Südlinie, wowieder Ost-Westlinie des Stationsnetzes eine gu-te Kontrolle über die Krustenstruktur zu er-halten. Dies konnte mit bestehenden älte-ren Ergebnissen ergänzt und zu einem 3D-Bild der Kruste (Sedimentbecken, kristallinesBasement, Konrad, Moho) zusammengefügtwerden. Dabei kommt es nur auf die Erfas-sung der Strukturen an, die einen deutlichenEinfluss auf die Laufzeitresiduen der eintref-fenden teleseismischen Wellenfronten haben.In der neuen hochauflösenden Tomographiewurde dieser störende Einfluss der Krustedurch Berechnung des Wellenfeldes mit FDRaytracing durch die angenäherte Krusten-struktur eliminiert und eine 1D Kruste nachdem IASP’91 Erdmodell (Kennett et al., 1991)simuliert. Die Inversion selbst wurde mit dem
Seismologie 255
nichlinearen Laufzeitcode JI-3D (Jordan et al.,2001) und 3D Raytracing (Steck & Prothe-ro, 1991) durchgeführt. Die neuen Ergebnissewerden im Rahmen ihres Auflösungsvermö-gens geodynamisch interpretiert.
256 Abstracts
SL09 – Di., 25.2., 10:10-10:30 Uhr · HS1Hauser, F. (Karlsruhe), Raileanu, V. (Bukarest), Landes, M. (Karlsruhe), Bala, A. (Bukarest),Prodehl, C., Fielitz, W. (Karlsruhe)
Crustal properties of the Eastern Carpathians, derived from two seismic refraction pro-files in RomaniaE-Mail: [email protected]
Several major earthquakes struck Romaniain the last century, and all of them occurred atintermediate depths between 70 and 200 kmunderneath the Vrancea zone in the southeastCarpathian Mountains. To study the crustaland uppermost mantle structure beneath thisseismic high-risk area, two major active-source seismic experiments VRANCEA-99and VRANCEA-2001 and a passive teleseis-mic tomography project CALIXTO-99 werecarried out in 1999 and 2001, nearly 30 yearsafter the last seismic investigations across theeastern Carpathians in the 1970s. The ac-tive and passive source projects are a con-tribution to the joint German-Romanian re-search program Strong Earthquakes–A Chal-lenge for Geosciences and Civil Engineering.This program was initiated by the Collabora-tive Research Centre 461 (CRC 461) at theUniversity of Karlsruhe, Germany, and theRomanian Group for Vrancea Strong Earth-quakes (RGVE) at the Romanian Academy inBucharest.
The first seismic refraction lineVRANCEA99 investigates the structureand physical properties of the upper litho-sphere along a N-S profile between the townof Bacau and the Danube River, traversingthe Vrancea epicentral area and the city ofBucharest. It consists of: (1) a 300 km longmain N-S profile with 12 shot points (averageseparation about 25 km) and a station spacingof 2-3 km. (2) A shorter (about 70 km)E-W running profile with one additional shot
point at each end. All shots were recordedsimultaneously on both profiles. In a first stepof interpretation a P-wave velocity model forthe main N-S line was developed. It displays amulti-layered crust with velocities increasingwith depth. They vary in the sedimentarycover from N to S, but are relatively constantat the levels of the crystalline crust. Theautochthonous basement of the MoesianPlatform is structured. Within the uppermostpart of the mantle a low velocity zone mayexist. The subsequent interpretation of theobservable S-waves results in a velocitymodel showing the same multi-layered crust,with S-velocities increasing similarly asthe P-waves with depth. The subsequentlyderived Poisson’s ratio is variable across thecrust: 0.22-0.35 for the sedimentary cover,0.24-0.25 for the crystalline crust and 0.28for the upper mantle. Finally, using the 2-Dvelocity model, a density model was devel-oped. Different density values were assignedto each layer according to the velocity modeland in agreement with values accepted forthe geological units in the area. After severaliterations a good fit between the computedand observed Bouguer anomaly curves wasobtained. Because of the experimental con-figuration it is possible to interpret a 115x 235 km wide region with the help of a3-D refraction and reflection tomographyalgorithm (Hole 1992, 1995). In order toenhance the model resolution, first arrival datafrom local earthquakes of the CALIXTO-99
Seismologie 257
teleseismic project were also included. Theresults, here, indicate a high-velocity structurebeneath the northern part of the Vrancea zoneextending from shallow levels to depths ofabout 12 km. This structure may be related tothe Trotus and Capidava-Ovidiu faults, whichconverge to the north of it. The high-velocityregion is surrounded by the lower velocityFocsani and Brasov basins.
For the second seismic refraction lineVRANCEA2001, ten chemical sources, be-tween 300 kg and 1500 kg, were used alonga 400 km long E-W trending profile. This re-sulted in an average shot point spacing of 40km, while the receiver spacing was about 1km. In a first step P-wave first arrival timeswere picked and inverted using a non-linearhigh-resolution tomographic technique (Hole1992, 1995). The results show only mod-est variations in the crustal velocities. Themost notable feature is the very deep (ca. 15-20 km) Focsani Basin. Here, velocities in-crease from 2 km/s at the surface to 5.8 km/sat the sediment-basement interface. Sinceintra-crustal and Moho reflections are promi-nent on most seismic sections, they can beused to constrain deeper structures. Here,preliminary results indicate a down warp ofonly the mid-crustal discontinuity under theCarpathian Mountains and the Focsani Basin.Surprisingly, the Moho shows no crustal root,but shallows slightly from some 40 km in theeast to about 35 km in the west.Web page: http://www-sfb461.physik.uni-karlsruhe.de/
258 Abstracts
SL10 – Mi., 26.2., 09:30-09:50 Uhr · HS1Igel, H., Cochard, A. (München), Schreiber, U. (Wettzell), Flaws, A. (Christchurch,NZ)
Observations and simulations of rotational motions recorded by a ring laserE-Mail: [email protected]
The general motion of a body is uniquelyspecified by 3 components of displacement(those determined by classical seismometers)plus 3 components of rotation. While it isstandard to observe translational motions thestudy of rotations had little attention, partlybecause rotational effects generated by earth-quakes were thought to be small comparedto the corresponding translational effects, andpartly because no instruments existed whichdirectly measure absolute rotations. Recently,there has been a revival of interest for rotationsdue to a growing body of observational evi-dence that, at least in some cases, rotationalmotions are indeed strong. At present instru-ments are being developed directly measur-ing rotational motions with respect to inertialspace. Very large ring lasers are such a classof rotational seismometers, which take advan-tage of a frequency shift between too counter-rotating beams inside the (rotating) laser cav-ity. We present the basics of ring laser inter-ferometry and show data from regional anddistant earthquakes recorded by a very highsensitivity ring laser installed in Southern Ger-many, originally designed to monitor earth ro-tation. The rotational motion is compared withthe recordings of a collocated broadband seis-mometer. We also show some preliminarynumerical simulations and discuss various ef-fects of medium heterogeneity and anisotropyon rotational motions.Web page: http://www.geophysik.uni-muenchen.de
Seismologie 259
SL11 – Mi., 26.2., 09:50-10:10 Uhr · HS1Li, X., Kind, R. (GFZ Potsdam)
Die Sp Receiver Function MethodeE-Mail: [email protected]
Durchstößt eine teleseismische S Welle eineDiskontinuitäten unter einer seismischen Sta-tion, werden konvertierte P Wellen (Sp) er-zeugt, die als Vorläufer zur S Welle regis-triert werden. Die konvertierten Sp Wellensind senkrecht zur S Welle polarisiert und kön-nen deshalb durch eine Rotation in das strah-leneigene Koordinatensystem (P, SV und SH)aus der S Welle isoliert werden. Nach derDekonvolution der P-Komponente durch dieSV-Komponente wird das Ergebnis als Sp Re-ceiver Function bezeichnet. Wir benutzenDrei-Komponenten Registrierungen mit Epi-zentraldistanzen von 60-85◦ für S Wellen undvon 85-140◦ für SKS Wellen mit großem Si-gnal/Stör Verhältnis. Im Veigleich zur Ps Re-ceiver Functions liegt der Vorteil der Sp Re-ceiver Functions darin, dass sie frei von denmultiplen Phasen sind. Die Multiplen errei-chen die Station nach der S Welle. Deshalbkönnen Strukturen direkt unterhalb der Mohobesonders klar erkannt werden. Die Metho-de erscheint geeignet die Grenze Lithosphäre-Asthenosphäre zu erkennen. Erste Ergebnissevon Stationen des globale Netzes auf Hawaiiund an anderen Orten werden gezeigt.
260 Abstracts
SL12 – Mi., 26.2., 10:10-10:30 Uhr · HS1Wölbern, I. (GFZ Potsdam)
Spuren des Hawaii-Plumes im oberen Mantel untersucht mit Receiver FunctionsE-Mail: [email protected]
Mit der Methode der Receiver Functionswurde das Gebiet unter Hawaii auf nachweis-bare Einflüsse durch aufsteigendes heißesPlumematerial untersucht und somit aufdie Position und Lage des Hawaii-Plumesgeschlossen. In Kooperation des GeoFor-schungsZentrums (GFZ) mit dem DublinInstitute for Advanced Studies (DIAS) wur-den dazu Breitbandstationen über zwei Jahreauf den vier größten Hawaii-Inseln betrieben.Zusätzlich konnten Daten von permanentenStationen benutzt werden. Die Moho flachtvon Kauai (im Nordwesten) bis unter BigIsland (im Südosten) ab. Im Südosten von BigIsland ist die Existenz der Moho fraglich, dafür die ersten Konversionen hier Tiefen imBereich des Meeresbodens ermittelt wurden.Die Lithosphären-Asthenosphären-Grenze(Gutenberg-Diskontinuität) zeigt einen ge-genläufigen Effekt. Sie weist geringere Tiefenunter Kauai auf und verdickt sich nach Süd-osten. Unter dem Südwesten von Big Islandzeigt sich jedoch eine kleinräumige Anhebungder Gutenberg-Diskontinuität. Hier wurdeeine Niedriggeschwindigkeitszone unterhalbder Lithosphäre festgestellt und als Region mitauftretender partieller Schmelze interpretiert.Die Manteldiskontinuitäten in 410 km und660 km Tiefe weisen beide verzögerte An-kunftszeiten der konvertierten Phasen auf, wasauf reduzierte S-Wellen-Geschwindigkeitenim oberen Mantel zurückgeführt wird. Wäh-rend die P410s-Phase keine signifikantenEinflüsse des Plumes erkennen lässt, zeigtdie 660-km-Diskontinuität eine deutlicheAufwölbung südwestlich von Big Island bei
gleichzeitiger Ausdünnung der Transitionszo-ne. Die Ergebnisse deuten auf einen geneigtenPlumeschlauch hin, dessen Quellregionunterhalb der 660-km-Diskontinuität liegt.
Seismologie 261
SL13 – Mi., 26.2., 11:00-11:20 Uhr · HS1Endrun, B., Meier, T., Dietrich, K., Bischoff, M., Harjes, H.-P. (Bochum)
Struktur im Bereich Kretas aus Receiver Functions und der Dispersionsanalyse vonOberflächenwellenE-Mail: [email protected]
Für den Bereich Kretas werden Ergebnisseder Auswertung tele- und regionalseismischerDaten in Form von Receiver Functions undDispersionskurven der Rayleigh-Grundmodevorgestellt, die auf die Erkundung der Struk-tur von der Erdoberfläche bis in etwa 100 kmTiefe abzielen. Hierzu standen sowohl Da-ten aus Registrierungen mit temporären, kurz-periodischen Meßnetzen, die von der Ruhr-Universität Bochum zwischen 1996 und 2002auf Kreta betrieben wurden, als auch vonGEOFON-Breitbandstationen in der südlichenÄgäis zur Verfügung.
Die Dispersionskurven wurden mit Hilfeder Zwei-Stationen-Methode berechnet, wo-bei durch Verwendung regionaler Erdbebenan den kurzperiodischen Stationen Frequen-zen von bis zu 0.3 Hz ausgewertet werdenkonnten. Dies erlaubt eine bessere Auflösungim oberflächennahen Bereich, der mit teleseis-mischen Registrierungen an Breitbandstatio-nen nur sehr begrenzt zu betrachten ist. Fürdie Receiver Functions ergab sich durch diekurzperiodischen Meßnetze eine gute räumli-che Überdeckung, wie sie gerade für die Mi-gration benötigt wird, um den räumlichen Ver-lauf von Diskontinuitäten verfolgen zu kön-nen.
Besonderes Augenmerk in der Interpreta-tion wird auf die Unterschiede in der Struk-tur zwischen West- und Zentralkreta gelegt.Durch die temporären Netze ergibt sich dieMöglichkeit, Receiver Functions auf einemProfil von West- nach Zentralkreta zu bestim-men. Für West- und Zentralkreta werden Di-
sperionskurven der Rayleighgrundmode vor-gestellt. Durch Inversion der Dispersions-kurven werden eindimensionale Modelle derScherwellengeschwindigkeit erhalten. Wei-terhin lassen sich die Ergebnisse der Ober-flächenwellenanalyse in Phasengeschwindig-keitskarten räumlich darstellen. Vorteile ei-ner gemeinsamen Betrachtung von Dispersi-onskurven und Receiver Functions werden anBeispielen erläutert.
Die Existenz und die Tiefenlage der kon-tinentalen Moho unter Kreta wird diskutiert.Deutlich wird die Moho innerhalb der sub-duzierten afrikanischen Lithosphäre abgebil-det. Der Slab weist ein starkes Einfallen nachNE und ein geringfügiges Einfallen in östli-che Richtung auf. Die Moho der subduzier-ten ozeanischen Lithosphäre liegt unter Kretaim Mittel bei etwa 55 bis 60 km Tiefe. DieEurasische Lithosphäre weist deutliche Unter-schiede zwischen West- und Zentralkreta auf.
262 Abstracts
SL14 – Mi., 26.2., 11:20-11:40 Uhr · HS1Bohnhoff, M. (Bochum), Rische, M., Meier, T., Becker, D., Endrun, B. (Bochum), Stavrakakis,G. (Athen), Harjes, H.-P. (Bochum)
Monitoring seismicity at the volcanic arc of the Hellenic subduction zone using a combi-ned broadband/short period temporary seismic network on the Cyclades (CYC-NET)E-Mail: [email protected]
The south Aegean region with the con-vergent margin between the African and theAnatolian-Aegean plate offers an unique op-portunity for the study of rheology and geo-dynamic processes at retreating subductionzones. To thoroughly understand seismotec-tonics of the Hellenic subduction zone, somemain properties can be gained from the anal-ysis of larger seismic events recorded by thepermanent networks. However, to monitor lo-cal seismicity at low detection threshold and toperform structural investigations at crustal anduppermost mantle depth levels an adequatelylocated digital-recording network with suffi-cient azimutal coverage and densely spacedrecording units is needed. Here, we focuson the forearc-backarc transition zone repre-sented by the volcanic arc where distinct seis-mically active centers can be identified fromglobal seismicity catalogues. These centerscan be correlated with the volcanism at Mi-los, Santorini and Nisyros. However, a num-ber of questions still remain open with themost important ones being: How is the mi-croseismic activity distributed in the area ofconsideration? What is the relation betweenspatio-temporal evolution of hypocenters andupward migrating fluids and magma? Why isthe seismicity clustered in space and time overa broad range of magnitudes? Furthermore,open questions remain concerning structure atlower crustal and uppermost mantle depth. Wepresent a 22-station digital broadband/shortperiod seismic network that was installed on
the Cyclades (CYC-NET) to address thesequestions. The CYC-NET covers the centralvolcanic arc and is in operation since autumn2002. The network geometry forms a suffi-cient azimutal coverage allowing to preciselydetermine hypocenters not only for shallowearthquakes but along the entire depth rangedown to the Benioff zone as for the deeperevents recordings of permanent stations dis-tributed around the South Aegean will be im-plemented. The recording period of two yearswill allow to get a detailed resolution of thelocal seismicity as well as to estimate thequality of hypocenter determinations by re-gional permanent networks. In addition, struc-tural investigations will be performed apply-ing receiver-function and surface wave analy-sis techniques.
Seismologie 263
SL15 – Mi., 26.2., 11:40-12:00 Uhr · HS1Heit, B., Kind, R., Asch, G., Yuan, Y. (GFZ)
The ReFuCA 2002 ProjectE-Mail: [email protected]
A set of 60 seismological stations (45 shortperiod and 15 broadband) was installed along21°S on a profile about 500 km length andwill be running for the next two years inthe Central Andes region. The stations op-erate at 50 samples per second (sps) will al-low to record large teleseismic, local eventsand quarry blasts from the mines in the vicin-ity of the profile. The results will be usedto improve the two dimensional crust-mantleboundary image, solve questions concerningsimple shear plateau uplift models and thedistribution of deformation at various crustallevels. In addition, a shorter profile about200 km length consisting of 20 stations (10short period and 10 broadband) was installedin Argentina along 25.5°S with the aim to in-vestigate lithospheric delamination across theCerro Galan caldera, one of the most promi-nent intra-plate volcanoes in the world. Theinstruments will be also running for two yearsperiod and will contribute to solve the ques-tions proposed for the first profile and in ad-dition, provide some signs of mantle delami-nation which can help us to develop a modelthat explains the evolution of the Puna highplateau.
264 Abstracts
SL16 – Mi., 26.2., 12:00-12:20 Uhr · HS1Thierer, P. O., Tilmann, F., Flueh, E. R., Kopp, H., Gossler, J. (Kiel, Geomar)
Seismologische Untersuchungen des zentralen chilenischen KontinentrandesE-Mail: [email protected]
Der zentrale chilenische Kontinentalhangseewärts von Valparaiso war Ziel der 161. For-schungsreise von F/S SONNE, die aus ins-gesamt 5 Fahrtabschnitten bestand. Währenddes SPOC Experiments (Subduction Proces-ses Off Chile) wurde neben der aktiven refrak-tionseismischen Datenakquisition ein lokalesErdbebennetz installiert. Dieses wurde aufdem ersten Fahrtabschnitt im Oktober 2001ausgelegt und konnte 10 Wochen später, zuBeginn des 4. Fahrtabschnittes im Dezember,
Abbildung 1: Position der Epizentren sowieProjektion der Hypozentren auf N-S bzw. W-E streichende Profile. Bathymetrie: CON-DOR und SPOC Survey, Dreiecke: OBH Po-sitionen, Rauten: Epizentren.
wieder geborgen werden. Die marinen Unter-suchungen, zu denen auch die Kartierung derMeeresbodenbathymetrie sowie Schweremes-sungen zählten, wurden durch seismische Re-gistrierungen an Land
vervollständigt. Das Untersuchungsgebietist von der Subduktion der ozeanischen NazcaPlatte unter den südamerikanischen Kontinen-talrand geprägt und weist einen hohen Gradan Segmentierung auf. Einzelne dieser Seg-mente, etwa der Abschnitt nördlich von Valpa-raiso, sind durch einen flachen Subduktions-winkel gekennzeichnet. Hinzu kommt, dassin Bereichen flacher Subduktionswinkel kein
Abbildung 2: Minimum 1-D Modell: Vp-Tiefen Profil, Ergebnis der Inversion.
Seismologie 265
oder nur sehr geringer Vulkanismus beobach-tet wird, sehr im Gegensatz zu denjenigen Re-gionen, in denen die Nazca Platte in steilemWinkel subduziert. Im Allgemeinen gehendie übergangsbereiche von flacher zu steilerSubduktion mit der Subduktion von aseismi-schen Rücken oder Seamount Ketten konform.Im Küstenbereich von Valparaiso wird rezentder Juan Fernandez Rücken (JFR) subduziert.Darüber hinaus wird durch die Subduktion desJFR der laterale Materialtransport nach Nor-den unterbunden, so dass der nördliche Teildes Arbeitsgebietes im Gegensatz zum südli-chen Abschnitt einen schmaleren und tieferenTiefseegraben aufweist. Die explizite Ursa-che für das flache Abtauchen der ozeanischenPlatte konnte noch nicht geklärt werden. Dasaus 23 Ozean Boden Stationen (8 OBS und 15OBH) bestehende seismische Netz wurde inein nördliches sowie ein südliches Sub-Netzgegliedert. Es konnten etwa 180 lokale Erdbe-ben registriert werden. Das der Lokalisierungzu Grunde liegende 1-D Geschwindigkeits-Tiefenmodell wurde aus dem refraktionsseis-mischen Profil SO 161-02 abgeleitet, welchesbei 32 S gemessen wurde. Die in Abb. 1 dar-gestellte Detailkarte des Untersuchungsgebie-tes zeigt neben der Lage der Messgeräte (Drei-ecke) auch die Epizentren der lokalen Erdbe-ben (Rauten). In den Profilen wird die Pro-jektion der Hypozentren auf Nord-Süd bzw.Ost-West streichende Ebenen dargestellt. Eszeigt sich, dass das Maximum der seismischenAktivität auf einen Tiefenbereich zwischen 15km und 30 km konzentriert ist, jedoch Erd-beben bis in einer Tiefe von über 60 km re-gistriert wurden. Die Verteilung der Seismi-zität ist inhomogen, drei Bereiche erhöhterAktivität können unterschieden werden (I-III).Das Gebiet I befindet sich nahe des inaktivenOHiggins Seamount auf der ozeanischen Plat-te, die ermitteltelte Erdbebenherdtiefe liegt bei
ca. 25 km. Das Seismizitätsmaximum ist aufden oberen Kontinentalhang nördlich von 33S (II) konzentriert. In einem engen Bereichum 32,5 S treten Erdbeben mit Herdtiefen vonbis zu 60 km auf. Dies kann mit einer mögli-chen Krustenverdickung des hier subduzieren-den JFR in Zusammenhang stehen. Im süd-lichen Teil des Untersuchungsgebietes (III),wo der durch Magnetik und Schweremessun-gen nachgewiesene und bereits subduzierteTopocalma Knoll Seamount nachgewiesen ist,konnte ein grösserer Erdbebenschwarm regis-triert werden. Abbildung 2 zeigt die ersten Er-gebnisse der Minimum 1-D Modellierung ba-sierend auf der simultanen Inversion des ge-samten Erdbeben Datensatzes. Das Haupt-merkmal des Startmodells (graue Linie) istdessen durchschnittlich konstanter Vp Gradi-ent. Das Ergebnis der Inversion (schwarze Li-nie) zeigt zwei markante Geschwindigkeitss-prünge bei 8 km und 28 km Tiefe. Die Grenzein 28 km Tiefe wird als Krusten-Mantel Gren-ze interpretiert, was in guter übereinstimmungmit dem Ergebnis der Vp Modellierung vonProfil SO 161-2 steht.
266 Abstracts
SL17 – Mi., 26.2., 12:20-12:40 Uhr · HS1Malischewsky, P. G. (Jena, FSU)
Seismologische Implikationen impedanzartiger RandbedingungenE-Mail: [email protected]
Impedanzartige Randbedingungen werdenin verschiedenen Gebieten der Physik und Ma-terialwissenschaft erfolgreich eingesetzt, ha-ben aber bisher nur eine verhältnismäßig ge-ringe Verbreitung in der Seismologie gefun-den. Es erscheint daher durchaus angebracht,auf diese Randbedingungen in einem speziel-len Beitrag hinzuweisen und die Anwendun-gen in der Seismologie zu diskutieren. Allge-mein gesprochen sind solche Randbedingun-gen immer dann von Interesse, wenn der Ein-fluß eines Körpers auf ein Wellenfeld in sei-nem Inneren durch einen integralen Effekt aufseiner Oberfläche beschrieben werden soll.Dies führt zur Formulierung von sogenannten„äquivalenten Randbedingungen“. Im Inne-ren der Erde treffen wir bekanntlich auf dieverschiedensten Arten von Grenzflächen. DerKontakt zwischen zwei festen Körpern ist imGrunde genommen ein kompliziertes Phäno-men. Doch wenn es um die Wechselwirkungmit seismischen Wellen geht, wird häufig einidealer fester Kontakt angenommen, was aufStetigkeit der relevanten Verrückungs- undSpannungskomponenten hinausläuft. Dies istnur ein allererster Ansatz, der erweitert wer-den kann und muß. Es ist nicht unüblich,sich Kontaktflächen als sehr dünne Schich-ten vorzustellen, was im Grenzfall zur For-mulierung neuartiger Randbedingungen führt.Wir wollen im folgenden aus der großen Fa-milie impedanzartiger Randbedingungen nurzwei herausgreifen: (1) die Randbedingungennach Tiersten (1969) und (2) die Randbedin-gungen nach Pod”yapol’sky (1963), die fürdie Beschreibung unterschiedlicher Phänome-
ne wichtig sind.Die Tierstenschen RandbedingungenBekanntlich hat eine Schicht über einem
homogenen elastischen Halbraum einenbedeutenden Effekt auf die Ausbreitungseismischer Wellen. Insbesondere bei Ober-flächenwellen führt das Vorhandensein einereinzigen Schicht zu einer erheblichen ma-thematischen Komplizierung, die durch dieAnwendung der Tierstenschen (nichthomo-genen) Randbedingungen gemildert werdenkann. Wir benutzen ein kartesisches Ko-ordinatensystem, dessen Ursprung auf derOberfläche liegt und dessen x3-Achse in denHalbraum zeigt. Die Schichtdicke sei h, unddie elastischen Parameter der Schicht werdendurch Striche gekennzeichnet. Dann läßt sichnach Tiersten der Einfluß der Schicht durchAnwendung der niederfrequenten Näherungvon Plattenschwingungen als folgende inho-mogene Randbedingungen approximieren:
σ3 j = −δ jbhµ′{[(3λ′+2µ′
)/(λ′+2µ′
)×ua,a,b +ub,a,a]}+hρ′ ..u j für x3 = 0,
wobei die Einsteinsche Summenkonven-tion gilt und der Index j von 1 bis 3 läuft,aber die Indizes a und b von 1 bis 2.Durch diese Randbedingungen lassen sichgrundlegende Tatsachen der Oberflächenwel-lentheorie wesentlich einfacher formulierenund klären. Bövik (1996) verbesserte dieseRandbedingungen durch Anwendung derStörungsrechnung, wobei alle in h linearenTerme berücksichtigt werden [O(h)-Theorie].Die erweiterten Randbedingungen lauten:
Seismologie 267
σ3 j = −δ jb hµ′[(3λ′
+2µ′)/(λ′
+2µ′)×
ua,a,b +ub,a,a] −δ jb hη′σ33,b
−δ j3 hσ3a,a +hρ′ ..u j für x3 = 0,
wobei η′ durch
η′= λ′
λ′+2µ′
gegeben ist. In dieser Formulierung wirddie Dispersionsrelation der Lovewellen in be-zug auf Tiersten nicht verändert, wohl aberdie der Rayleighwellen deutlich verbessert. Esist darauf hinzuweisen, daß die durch solcheRandbedingungen generierten Lovewellen imhomogenen Halbraum überhaupt die einfachs-ten elastischen Oberflächenwellen sind. Sieeignen sich darum sehr gut dazu, grundlegen-de Fragen der Wellenausbreitung in gestörtenWellenleitern zu klären, insbesondere auch dieWechselwirkung von Rayleigh- mit Lovewel-len.
Die Randbedingungen nach Pod”yapol’skyBei diesen Randbedingungen wird die Nor-
malkomponente der Verrückung auf der Kon-taktfläche als stetig angenommen, nicht aberdie Tangentialkomponente. Der auftretendeSprung ist proportional zur anliegenden Tan-gentialspannung. Es läßt sich zeigen, daßdiese Randbedingungen den Fall einer einge-betteten unendlich dünnen Schicht mit ver-schwindender S-Wellengeschwindigkeit si-mulieren. Sie wurden mit Erfolg von Itsund Malischewsky (1987, 1988) bei der Aus-breitung von Oberflächenwellen über latera-le Störungen eingesetzt. Weiterhin ist inter-essant zu bemerken, daß, wie hier erstma-lig gezeigt wird, bei diesen Randbedingun-gen auch Stoneleyartige Grenzschichtwellenmit SH-Polarisation existieren.
LiteraturBövik, P.: A comparison between the Tiers-
ten model and O(h) boundary conditions forelastic surface waves guided by thin layers,Transactions of the ASME 63 (1996), 162-167.
Its, E. N.; Malischewsky, P.: Propagationof Rayleigh waves through a loosely-bondedinterface of elastic media (in Russian), Izv.Akad. Nauk SSSR, Fiz. Zemli (1987), 66-72.
Its, E. N.; Malischewsky, P.: Reflection andtransmission of Love waves across a verticalboundary of horizontally homogeneous mediain the case of loosely-bonded contact (in Rus-sian), Gerl. Beitr. Geophysik 97 (1988), 144-151.
Pod”yapol’sky, G. S.: Reflection and refrac-tion at a boundary of two elastic media in thecase of loosely-bonded contact (in Russian),Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Geofiz. (1963)4,525-531.
Tiersten, H. F.: Elastic surface waves gui-ded by thin films, J. Appl. Physics 40 (1969),770-789.
268 Abstracts
SL18 – Mi., 26.2., 12:40-13:00 Uhr · HS1Ceranna, L., Hartmann, G., Dohmann, M., Grasse, T., Henger, M. (Hannover)
Registrierung von Infraschallsignalen an der Station I26DEE-Mail: [email protected]
Das Infraschallnetzwerk I26DE im Bayri-schen Wald nahe Freyung ist Teil des interna-tionalen Überwachungssystem (IMS) zur Ve-rifikation der Einhaltung des Atomwaffentest-stoppabkommens (CTBT) und liefert seit dem05.10.1999 kontinuierliche Daten. Zum jetzi-gen Zeitpunkt liegt unser Hauptaugenmerk aufder Gewinnung von Erfahrungswerten bzgl.der Leistungsfähigkeit derartiger Netzwerkesowie der Ausbreitung von Schallwellen durchdie Atmosphäre anhand von Signalen bekann-ten Ursprungs.
Um die registrierten Infraschalldaten in-terpretieren zu können, werden verschiede-ne Detektions- und Analyseverfahren verwen-det. Diese umfassen die PMCC-Methode(Progressive Multi-Channel Correlation), denFisher-Detektor im Frequenzbereich sowiedas MUSIC-Verfahren (MUltiple SIgnal Clas-sification). Ferner wird eine Aufspaltung desrelevanten Frequenzbereichs von 0.1 bis 4.0Hz in mehrere sich überlappende Frequenz-bänder vorgenommen. Dies ermöglicht es uns,zum einen dem unterschiedlichen Charakterder verschiedenen Infraschallsignale gerechtzu werden, zum anderen können somit dieStärken der unterschiedlichen Detektionsalgo-rithmen besser genutzt werden.
Es wurden bisher sowohl transiente als auchkontinuierliche Signale beobachtet, wobei fürletztere atlantische Tiefdruckgebiete, die teil-weise über einige Tage verfolgt werden, derprominenteste Vertreter sind. Diese langperi-odischen Schallwellen breiten sich über meh-rere tausend Kilometer aus; gleiches gilt bei-spielsweise auch für eruptive Phasen vom Ät-
na. Hingegen werden transiente Signale, de-ren Ursprung primär Meteoriten und Explo-sionen bzw. Sprengungen sind, über der-art große Distanzen in der Regel nicht beob-achtet. Während für kontinuierliche Signa-le eine Lokalsierung der Quellen meist durchKreuzpeilung mit Hilfe anderer europäischerStationen möglich ist oder durch einen Ver-gleich mit der Wetterkarte, ist dies für transi-ente weitaus komplizierter. Da eine Vielzahlder Meteoriten und Explosionen nur an I26DEbeobachtet werden, kann hier eine Lokalsie-rung nur durch einen Vergleich mit Laufzeit-kurven bzw. durch strahlentheoretische Über-legungen erfolgen. Dafür bedarf es eineszuverlässigen, regional gültigen Temperatur-und Windmodells für den betreffenden Zeit-raum. Teilweise können diese Ergebnissejedoch auch mittels sekundärer Informatio-nen überprüft werden; im Fall von Meteori-ten Dank des internationalen Feuerkugelnetz-werks und für Sprengungen durch einen Ver-gleich mit Gebieten bekannter bergbaulicherAktivitäten.
An Beispielen werden wir einen Überblickder verschiedenen Infraschallsignale gebenund das Potential der IMS-Station I26DE so-wie der von uns verwendeten Verfahren de-monstrieren.
Seismologie 269
SL19 – Mi., 26.2., 15:00-15:20 Uhr · HS1Funke, S. (Stuttgart), Friederich, W. (Frankfurt), SVEKALAPKO Seismic Tomography WorkingGroup
Ein kontinentaler Kiel unter der archaisch-proterozoischen Kruste SüdfinnlandsE-Mail: [email protected]
Im Winterhalbjahr 1998/1999 wurdein Südfinnland ein temporäres, passivesseismisches Experiment durchgeführt mitdem Ziel durch Raumwellentomographie,Receiverfunction-Analyse und der Model-lierung seismischer Oberflächenwellen dieStruktur des Mantels zu kartieren. ZentraleFragestellung war, ob sich in der alten Litho-sphäre des fennoskandischen Schildes nochSpuren der damaligen plattentektonischenProzesse nachweisen lassen. Hinweise aufsolche Strukturen hatte das BABEL-Projektgeliefert, bei dem ein geneigter Mantelre-flektor im südlichen Bottnischen Meerbusengefunden wurde. Weitere Fragen waren:Gibt es eine Asthenosphäre unter dem fen-noskandischen Schild und wenn ja, wie dickist die Lithosphäre? Ist die Sutur zwischenProterozoikum und Archaikum, die querdurch Südfinnland verläuft, auch im Mantelzu sehen? Liegt unter der ungewöhnlichdicken proterozoischen Kruste im südlichenTeil auch ungewöhnlicher Mantel? Die Ant-worten auf diese Fragen liegen nun teilweisevor. Aus der Analyse seismischer Ober-flächenwellen ergeben sich keine Hinweiseauf die Existenz einer seismisch definiertenAsthenosphäre. Die Schergeschwindigkeitenim Mantel sind generell hoch und steigenmonoton mit der Tiefe an. Die Sutur zwischenProterozoikum und Archaikum ist nicht alsStruktur im Mantel zu erkennen. Erstaun-licherweise befindet sich aber unter derverdickten archaisch-proterozoischen Krusteauch schneller Mantel bis in ca. 150 km
Tiefe. Nach einer P-Wellentomographie derZüricher Gruppe reicht diese Zone sogar bisin 400 km Tiefe. Dies deutet auf die Existenzeines kontinentalen Kiels hin, der sich seitdem letzten plattentektonischen Ereignis vor1.5 Ga in der Lithosphäre erhalten hat. Unddies, obwohl Fennoskandien in dieser Zeitden halben Erdball umrundet hat.
270 Abstracts
SL20 – Mi., 26.2., 15:20-15:40 Uhr · HS1Krüger, F. (Uni Potsdam), Schweitzer, J. (NORSAR), Arbeitsgruppe MASI
Die Krustenstrukur der Finnmark und der südlichsten Barentssee - Resultate des MASI-1999 ExperimentesE-Mail: [email protected]
Im Jahre 1999 wurden die 13 LennartzMARSlite Stationen der Universität Potsdamals temporäres Netz in der Finnmark (Norwe-gen) aufgestellt. Mit den Mobilstationen wur-den zusammen mit den permanenten Statio-nen ARCES, KEV, KTK und TRO für etwafünf Monate lokale, regionale und teleseismi-sche Ereignisse registriert. Die so gewonne-nen Daten wurden in den letzten Jahren in ei-ner Reihe von Untersuchungen bei NORSARund and den Universitäten in Potsdam und Bo-chum ausgewertet und interpretiert. In die-sem Vortrag sollen alle bisherigen Resultatezusammenfasst werden:
Die Auswertung der Laufzeiten einiger gutlokalisierter lokaler Erdbeben und Sprengun-gen ergibt für Kruste und obersten Mantelmittlere P Geschwindigkeiten von 6.4 und et-wa 8 km/s. Das aus Wadati-Diagrammen be-stimmte vp/vs Verhältnis liegt etwas unter demüblichen Wert von 1.73.
Mittels der Methode von Zhu und Kanamorilässt sich die Moho-Tiefenlage kartieren. Siereicht von 38 km im küstennahen Bereich bisdeutlich über 45 km in den proterozoischenund archaischen Gebieten landeinwärts. DieModellierung von Receiver Funktionen zeigtfür die Stationen auf Proterozoikum und Ar-chaikum die Krusten-Mantelgrenze als brei-te Übergangszone sowie eine Gliederung derOber- und Unterkruste. Für die Stationenauf den kaledonischen Überschiebungsdeckenhingegen zeigt sich eine einfache Krusten-struktur mit einem relativ scharfen Geschwin-digkeitssprung an der Moho von mehr als 1
km/s über einen Tiefenbereich von wenigenKilometern. Dies lässt auf eine tiefgreifen-de Überprägung der gesamten Kruste im Be-reich der kaledonischen Decken durch die ka-ledonische Orogenese und/oder die Existenzeiner tiefreichenden, prä-kaledonischen Ost-West gerichteten Sutur schließen.
Aus der Modellierung von Rayleigh-Welleneines Ms = 4.2 Ereignisses im LovozeroMassiv auf der Kola-Halbinsel konnte einmittleres Geschwindigkeitsmodel für Nord-Fennoskandia abgeleitet werden. DiesesKrustenmodel bildete das Startmodell für ei-ne detaillierte Inversion von Rayleigh-WellenDispersionskurven, die mit der Zwei-Stations-Methode und mit direkter Messung von Pha-sengeschwindigkeiten durch FK-Analyse ge-wonnen wurden. Diese Arbeit bestätigte einemittlere Krustenmächtigkeit von etwa 40 kmund eine zweigeteilte Kruste.
Im Sommer 1999 wurde von der Erdölin-dustrie ein reflexionsseismisches Experimentin der südlichen Barentssee durchgeführt. DieAirgun-Signale wurden auch von den MASI-1999 und den permanenten Stationen regis-triert. Entlang eines Nord-Süd Profils konntendiese Beobachtungen als refraktionsseismi-sches Experiment interpretiert werden. Die-se Daten lassen sich nur erklären, wenn dieMoho als Gradientenzone angenommen wird,die Moho-Tiefe im Küstenbereich und unterder Barentssee deutlich geringer ist als unterder zentralen Finnmark und die kaledonischeKruste sich deutlich von der Schildstruktur desnördlichen Fennoskandia unterscheidet.
Seismologie 271
Zu diesen Ergebnissen im Rahmen desMASI-1999 Projektes haben beigetragen:
Universität Potsdam: Frank Krüger, JensHöhne, Gudrun Richter und Ronny Haber-mann Ruhr-Universität Bochum: Katja Diet-rich und Thomas Meyer Universität Oslo: Le-ne Helminsen und Jan Inge Faleide NORSAR:Johannes Schweitzer, Hilmar Bungum, Mi-chael Roth, Conrad Lindholm und Erik Hicks
272 Abstracts
SL21 – Mi., 26.2., 15:40-16:00 Uhr · HS1Schweitzer, J. (NORSAR), Kennett, B.L.N. (RSES, ANU, Canberra)
Comparison of Location Procedures - The Kara Sea Event of 16 August 1997E-Mail: [email protected]
We have compared various location proce-dures applied to the Kara Sea event of 16 Au-gust 1997. This event has been the subjectof considerable discussion, and in particularit has been difficult to obtain a reliable focal-depth estimate. We have therefore undertakena sequence of location experiments to comparethe results of
a) using different velocity models to de-scribe the travel times of the phases
andb) to make a comparison between the use
of a fully non-linear scheme (shakeNA, Sam-bridge and Kennett, 2001) and a linearizedlocation algorithm (HYPOSAT, Schweitzer,2001).
For direct comparisons between the twomethods we have used a standard least-squaresmisfit criterion, but we have also examinedthe influence of more robust choices for datamisfit. This study has shown both the impor-tance of S-wave information in assessing thedepth of regional events, and the need to ap-ply a reliable velocity model in order to placethe strongest constraints on the location of theevent.
The conclusions from our comparisons ofthe solutions from different data centres andour results are that using only a limited data setbut an adequate travel-time model one can lo-cate the event in the Kara Sea relatively closeto our most reliable locations. However, in thiscase, there is no depth resolution. The rela-tively small error ellipses reported by the datacentres are a problem which arises when us-ing only a limited number of data. The loca-
tion estimates for the whole data set from thedifferent techniques agree quite well. We con-clude that the event cannot be shallower than10 km and is most likely in the lower crustaround 20-30 km depth. Such deep crustalevents have previously been observed at No-vaya Zemlya (e.g. Marshall et al., 1989).
Seismologie 273
SL22 – Do., 27.2., 09:30-09:50 Uhr · HS1Neunhöfer, H. (Jena), Hemmann, A. (Jena, Universität)
Earthquake swarms in the Vogtland/Western Bohemia region: Spatial distribution andmagnitude-frequency distribution as indication of the genesis of swarmsE-Mail: [email protected]
The region is characterized by the occur-rence of earthquake cluster, most of them areearthquake swarms. Single events occur aswell. In 20th century there have been observed67 clusters among them 56 swarms. Since1962 the detection threshold for cluster is atleast ML=1.8. Fig. 1 depicts the cumulativerecurrence of all independent seismic eventssince 1962 and of swarms and nonswarms.The recurrence disintegrates into a low mag-nitude part (ML ≤ 3.1) and a high magnitudepart (ML > 4.3). In the low magnitude part,swarms and nonswarms don’t differ remark-ably neither in number nor in shape of the re-currence.
The majority of earthquake clusters are con-centrated in isolated epicentral patches. Thatone near Novy Kostel is most prominent,smaller ones are located in the vicinity ofMarkneukirchen, Marktredtwitz, Bad Elster,Lazy and Werdau. The patches are discussed.The spatial distribution of the cluster withinthe patches is along discontinuities of thestructure.
The earthquakes within a cluster are inter-dependent. Each cluster yields also an ownmagnitude-frequency distribution with an ownb-value. The accuracy of it is only limited bythe registration threshold. The shape of thedistribution and the b-value might give piecesof information of the process of clustering.Different types of the magnitude-frequencydistribution are discussed. Fig. 2 shows the re-lation between the b-value and the maximummagnitude of the cluster. There is a separate
branch of flat-b-value clusters (crosses).Additionally, swarms (dots) are predomi-
nantly concentrated along four other brancheswhich differ in the level of the b-value. Thetendency is observed that the maximum mag-nitude of the cluster gets greater proportionalto that level of the b-value. In the average,the regarded swarm patches prefer differentbranches.
The region is characterized by the existenceof fluids with water and CO2 as main compo-nents. The occurrence of swarms is supposedto be due to both, proper fault structures andproper state of fluids. Only than, a triggeringprocess, which is a dissipative dynamic pro-cess may get running. The state of the flu-ids gives influence to the b-value; vice versathe b-value might give hints of the nature oftriggering process in the focal zone. At sur-face there is well known the evidence of post-seismic effects with regard to an earthquakeswarm. The attempt is undertaken to matchthe idea of triggering with the observation offluids at surface.
274 Abstracts
Figure 1: Cumulative magnitude recurrence of all independent earthquakes and swarms andnonswarms, as well, for ML ≥ 1.8. Levels of magnitude scales used at different networks inthe region are inserted. Magnitude scale according to VOCATUS is applied here.
Figure 2: b-values of observed swarms (dots) and nonswarm-like cluster (crosses) over max-imum magnitude. Full dots refer to earthquake swarms localized confidently to Novy Kostelzone. An average line indicates nonswarms. Four average lines indicate concentrations ofswarms. Threshold of swarm detection by at least ten events is given.
Seismologie 275
SL23 – Do., 27.2., 09:50-10:10 Uhr · HS1Hemmann, A. (Jena, Universität), Geißler, W. (Potsdam, GFZ)
Erdbebenschwärme, Bebenfolgen und Einzelereignisse seit 1991 in der Region Františ-kovy Lázné / Skalná - einem Beben-Cluster südwestlich von Novy KostelE-Mail: [email protected]
Das Untersuchungsgebiet als Teil desFrantiškovy Lázné - Skalná - Markneu-kirchen Herdgebietes gehört zur RegionVogtland/NW-Böhmen, die durch das häufigeAuftreten von Erdbebenschwärmen bekanntist. Die internationalen Forschungen der letz-ten Jahren konzentrierten sich nur auf dasgrößte und aktivste Schwarmbeben-Clusterder Region, Novy Kostel. Außerdem fehlenfast vollständig äquivalente Untersuchungender Einzelereignisse und Erdbebenfolgen imVogtland/NW-Böhmen. Die Autoren sind derMeinung, dass nur durch eine übergreifendeBetrachtung aller Arten der auftretenden Seis-mizität und eine einheitliche Untersuchung al-ler Beben-Cluster die Ursachen und Mecha-nismen der Erdbebenschwärme geklärt wer-den können. Dies ist Voraussetzung für ei-ne interdisziplinäre Interpretation der gesam-ten Region unter Einbeziehung geochemischerund hydrogeologischer Befunde.
Im Untersuchungsgebiet wurden eineschwache Seismizität in Form von Erd-bebenschwärmen, Erdbebenfolgen undEinzelereignissen registriert. Der Schwer-punkt der seismischen Aktivität liegt in derNähe des CO2-Entgasungszentrums bei Fran-tiškovy Lázné innerhalb dessen bisher keineErdbeben aufgetreten sind. Die Epizentrender untersuchten Ereignisse sind in einemGebiet lokalisiert, für das mittels receiverfunction eine MOHO Aufwölbung sowieein mögliches Fluid-Reservoir im oberstenMantel und mittels Refraktions-Seismik(CELEBRATION 2000) eine ’laminierte’
MOHO postuliert wurden.Es konnten über 90 Ereignisse mit über 500
Wellenformen von 28 Stationen der seismi-schen Netze: OTSN, WEBNET und Krasliceaus dem Zeitraum 09.11.1991 bis 05.02.2002analysiert werden. Die Epizentraldistanz be-trug zwischen 2 km und über 100 km. Die be-rechnete Lokal-Magnitude erreicht Werte zwi-schen ML = -1.1 bis ML = 0.7 (WEBNETBulletin). Alle Ereignisse wurden neu loka-lisiert.
Der Lokalisierungsfehler lag unter 500m.Es konnten 2 Gebiete erhöhter Seismizität un-terschieden werden; eines im Norden das an-dere im Süden. Die mittlere Tiefe in beidenGebieten lag bei 12 km (±0.9 km). Erdbe-benschwärme ereigneten sich in einem Tie-fenbereich von 11 - 13 km, Einzelereignissevon 4.1 - 17 km. Der Bereich der Schwär-me ist kompakter und liegt nahe des vermute-ten spröd-duktil Übergangs. Durchschnittlichwurden Erdbebenschwärme tiefer als Einzel-beben lokalisiert. Die Herdgebiete im Nordenund Süden werden durch eine SW-NE strei-chende Störung getrennt. Die Beben nördlichder Störung sind Einzelereignisse, Schwär-me konnten hier nicht nachgewiesen wer-den. Südlich der Störung treten alle Artender Seismizität auf. Die Störung könnte alsEntgasungslinie/Fluidsperre für den Fluide-Stroms fungieren, dessen Hauptanteil sichvon Süden dem Untersuchungsgebiet nähert.Somit würde verhindert, dass die für denSchwarm-Mechanismus unverzichtbaren Flui-de den nördliche Bereich erreichen.
276 Abstracts
Die durchgeführte Kreuzkorrelation ermög-licht eine Unterscheidung von Einzelereignis-se und Erdbebenschwärmen. Die Korrelationeines 0.5 s langen Wellenform-Teils (30 - 80Hz Bandpass gefiltert) um die P-Phasen allerEreignisse lieferten durchschnittliche Korre-lationskoeffizienten von 0.71 (Station NKC).Alle Wellenformen mit einem Koeffizienten ≥0.95 wurden als zu einem Erdbebenschwarmoder zu einer Erdbebenfolge gehörend identi-fiziert.
Die Berechnung der Herdflächenlösung er-folgte unter Verwendung des ProgrammsFOCMEC. Die Ereignisse weisen unter-schiedliche Charaktere auf. Auf- und Ab-schiebungen mit sehr ähnlichem Einfallen undStreichen wurden eng benachbart nachgewie-sen. In der Literatur finden sich Hinweise,dass dies innerhalb komplexer, lokaler Horst-strukturen möglich ist.
Seismologie 277
SL24 – Do., 27.2., 10:10-10:30 Uhr · HS1Hainzl, S. (Universität Potsdam)
Die Rolle von Stress-Triggern während des Vogtland Erdbebenschwarms 2000E-Mail: [email protected]
In den letzten Jahren wurde die Bedeu-tung von Erdbeben-induzierten Spannungs-umlagerungen für die nachfolgende Sesmi-zität deutlich. Speziell für die Nachbeben-aktivität von tektonischen Hauptbeben konn-te gezeigt werden, dass die räumliche Ver-teilung der Nachbeben mit jenen durch dasHauptbeben verursachten Spannungsänderun-gen korreliert ist. Während die Bedeutungdes sogenannten Stress-Triggerns für die antektonischen Plattengrenzen häufig auftreten-den Seismizitätsmuster weitgehend anerkanntist, ist die Rolle der Spannungsumlagerun-gen bei Erdbebenschwärmen noch ungeklärt.Im Falle der Erdbebenschwärme scheinen mi-grierende Mantelfluide eine dominante Rollezu spielen, da Schwarmaktivität häufig in en-gem Zusammenhang mit vulkanischer Aktivi-tät beobachtet wird. Dies scheint sich auchin den Seismizitätsmustern widerzuspiegeln,welche sich deutlich von den der bekannterenNachbebensequenzen unterscheiden. Wäh-rend das Abklingen der Nachbebenaktivität imallgemeinen gut durch das Omori-Gesetz be-schreibbar ist, sind bisher keine vergleichba-ren Gesetzmäßigkeiten für Erdbebenschwär-me bekannt. Die Energiefreisetzung findet imFalle der Erdbebenschwärme in vielen kleinenErdbeben - ohne das Auftreten eines domi-nanten Erdbebens (Hauptbeben)- statt. Aller-dings scheint dieser Unterschied bei nähererBetrachtung zu verschwinden, da im Verlau-fe einer Schwarmaktivität häufig auch einzel-ne oder mehrere Nachbebensequenzen statt-finden.
Wir haben nun die Rolle des Spannungstrig-
gerns im Falle des zwischen August und De-zember 2000 im Vogtland/NW Böhmen auf-getretenden großen Erdbebenschwarms unter-sucht. Dazu haben wir in einem ersten Ver-such den Versatz und die Bruchfläche der Erd-beben aus unabhängigen Beobachtungen be-rechnet, bzw. aus Herdflächenlösungen be-stimmt. Anschließend haben wir die Span-nungsumlagerungen im elastischen Halbraumberechnet, um sie mit den jeweils zeitlichfolgenden Erdbebenverteilungen zu verglei-chen. Es zeigt sich, dass ein Teil der Akti-vität mit den Spannungsänderungen korreliertist. Stress-Triggern spielt also auch im Falleder Vogtland-Schwärme eine wichtige Rolle.
278 Abstracts
SL25 – Do., 27.2., 11:00-11:20 Uhr · HS1Hofmann, Y., Jahr, T. (Universität Jena)
Drei-dimensionale gravimetrische und geodynamische Modellierungen in der RegionVogtland/NW-BöhmenE-Mail: [email protected]
Die Region Vogtland/NW-Böhmen zeich-net sich seismologisch durch das periodischeAuftreten von Schwarmbeben aus. Als Ursa-che der Beben werden Interaktionen zwischendem Spannungsfeld, den ebenfalls im Un-tersuchungsgebiet auftretenden Fluiden undeiner speziellen Geometrie der geologischenEinheiten vermutet (Weise et al., 2001; Neun-höfer & Güth, 1989). Durch die Entwicklungeines hochauflösenden 3D Untergrundmodellssollen besonders die tiefliegenden Strukturender mittleren und unteren Kruste im Hinblickauf tektonische Störungen und eine Mantel-aufwölbung bzw. einen Magmakörper an derKruste/Mantel Grenze als mögliche Ursachender Schwarmbeben untersucht werden.
Die Arbeitsgrundlage für die gravimetri-sche 3D Modellierung bildet eine einheitlicheBouguer-Karte des Untersuchungsgebietes.Aus gravimetrischer Sicht liegt das epizentraleGebiete in einer Gradientenzone mit einer ma-ximalen Differenz von 80 mGal südöstlich desSchwerehochs von Hof und westlich das aus-gedehnten Erzgebirge-Nordböhmen Schwere-minimums. Die mit dem Erdbebenschwär-men in Verbindung gebrachte Mariánské Láz-ne Störungszone wird durch generelle Ände-rungen des Anomalienbildes gekennzeichnet.
Die 3D gravimetrische Vorwärtsmodellie-rung wurde mit dem Programm IGMAS(Schmidt & Götze, 1995) durchgeführt. DasModellierungsgebiet überdeckt eine Flächevon 143,2×165,2 km2. Die Modellierungstie-fe beträgt 35 km, um die Moho in das Modelleinzubeziehen. Aufgrund der komplexen Geo-
logie im Vogtland/NW-Böhmen wurde dasgravimetrische Modellierungsgebiet in 36 par-allele Ebenen unterteilt, mit einem durch-schnittlichen Ebenenabstand von 4 km im zen-tralen Bereich und 6 km im nördlichen undsüdlichen Teil des Untersuchungsgebietes.
Bei der gravimetrischen Modellierung istdie Einbeziehung umfangreicher Randbedin-gungen notwendig, um die aus dem Äquiva-lenzprinzip folgenden Mehrdeutigkeiten ein-zuschränken. Dazu werden geologische undtektonische Kenntnisse, Resultate reflexions-und refraktionsseismischer Untersuchungen,Informationen aus Bohrungen sowie aus be-reits abgeschlossenen gravimetrischen 2DModellierungen herangezogen. Die aus demEndmodell berechnete Schwere weist im Ver-gleich zur beobachteten Bouguer-Schwere ei-ne Differenz von 4 mGal auf. Die Existenz ei-ner Mantelaufwölbung bzw. eines Magmakör-pers an der Kruste/Mantel Grenze konnte mit-tels gravimetrischer Modellierung nicht ein-deutig nachgewiesen werden, da keine Infor-mationen über die Dimensionen solcher Struk-turen und über die vertikale Erstreckung derGranite und Metabasite in der oberen Krustevorliegen.
Zur Untersuchung der von Neunhöfer& Güth (1989) postulierten Verbindung zwi-schen Spannungsfeld und den geometrischenBesonderheiten der geologischen Strukturenim Untersuchungsgebiet wurden Modellie-rungen mittels der Finite-Elemente-Methode(FEM) vorgenommen. Die Umsetzung derelastischen Modellierungen erfolgte mit dem
Seismologie 279
Programm ABAQUS. Das geodynamischeModellierungsgebiet umfasst eine Fläche von30×40 km2 und ist auf das Schwarmbebenge-biet um Nový Kostel fokussiert. Die Geome-trie inklusive der Dichten des 3D gravimetri-schen Untergrundmodells bilden die Grundla-ge für das FEM-Modell. Elastische Parameter,wie Elastizitätsmodul und Poisson-Zahl basie-ren auf Resultaten des seismischen Profils DE-KORP3/MVE90 (Behr et al., 1994).
Die mittels der FEM berechneten Span-nungsakkumulationen zeigen einen signifi-kanten Einfluss der geologischen Strukturen,insbesondere des Granites, auf die Schwarm-bebengenerierung. Die resultierendenScherspannungen allein sind allerdings nichtausreichend, um Brüche zu erzeugen. Hiermüssen weitere geophysikalische Prozesse,wie z.B. Porendruckänderungen, stattfinden.Literatur:
Behr, H.-J., Dürbaum, H.-J. & Bankwitz,P., 1994: Crustal structure of the Saxothu-
Abbildung 1: Schnitt durch das gravimetri-sche Modell von NW nach SO. Die vertikaleÜberhöhung beträgt 2,5.
ringian Zone: Results of the deep seismicprofile MVE-90(East), Z. geol. Wiss. 22 (6):647–769.
Neunhöfer, H. & Güth, D., 1989: Detai-led investigation of the great earthquakeswarm in western Bohemia by the local Vogt-land network, in Monitoring and analysis ofthe earthquake swarm 1985/86 in the regionVogtland/western Bohemia (P. Bormann, Hg.),Nr. 110, S. 124–164, Zipe Veröff.
Schmidt, S. & Götze, H.-J., 1995: IG-MAS: 3-D Gravity and Magnetic Modeling,Progam Documentation, FU Berlin, unveröf-fentlicht.
Weise, S. M., Bräuer, K., Kämpf, H.,Strauch, G. & Koch, U., 2001: Transportof mantle volatiles through the crust tracedby seismically released fluids: a naturalexperiment in the earthquake swarm areaVogtland/NW-Bohemia, Central Europe,Tectonophysics 336: 137–150.
280 Abstracts
SL26 – Do., 27.2., 11:20-11:40 Uhr · HS1Hergarten, S. (Universität Bonn)
Erdbebenschwärme – besondere Physik oder Facette komplexen Systemverhaltens?E-Mail: [email protected]
Nach wie gibt es Diskussion über den phy-sikalischen bzw. geologischen Hintergrunddes Auftretens von Erdbebenschwärmen inbestimmten Regionen. In diesem Vortrag wirddiskutiert, ob es prinzipiell möglich wäre, dassErdbebenschwärme auch ohne spezielle phy-sikalische Bedingungen auftreten.
Das Werkzeug der Untersuchung ist dasOlami-Feder-Christensen (OFC) Modell, wel-ches eines der am weitesten verbreiteten Mo-delle für die Simulation von Erdbebenstatis-tiken ist. Es handelt sich hierbei um einenzellulären Automaten auf Basis eines Modells
Abbildung 1: Aufbau eines Erdbebenmodellsaus Blöcken und Federn
100
101
102
103
104
0 0.1 0.2
num
ber o
f dis
plac
ed b
lock
s
time
Abbildung 2: Sequenz von Ereignissen imOFC-Modell
aus Blöcken, die durch elastische Federn un-tereinander und mit einer antreibenden Platteverbunden sind (Abb. 1). Das OFC-Modellwird seit Anfang der 90er Jahre erfolgreicheingesetzt, um das Gutenberg-Richter Gesetzund das weitgehend unregelmäßige Auftretenvon Erdbeben zu erklären. Vor kurzem konn-te gezeigt werden, dass ein Teil der zeitlichenKomplexität der Erdbebendynamik, nämlichdas Auftreten von Vor- und Nachbeben, vondiesem einfachen Modell reproduziert wird(Hergarten & Neugebauer, Phys. Rev. Lett.88, 238501). Daher liegt es nahe, zu untersu-
Seismologie 281
100
101
102
103
0 0.001 0.002
num
ber o
f dis
plac
ed b
lock
s
time
Abbildung 3: Sequenz von Ereignissen imOFC-Modell während einer langen Phase oh-ne große Beben
chen, ob das OFC-Modell sogar noch weite-re Eigenschaften der zeitlichen Dynamik vonErdbeben reproduziert, z.B. das Auftreten vonErdbebenschwärmen.
Abb. 2 zeigt einen Ausschnitt aus einer Si-mulation des Modells. Die Zeit ist hier eineabstrakte, dimensionslose Skala, und die Stär-ke der Beben wird durch die Anzahl der ver-schobenen Blöcke charakterisiert. Große Be-ben (z.B. mit mehr als 1000 beteiligten Blö-cken) treten im Modell in weitgehend unre-gelmäßigen Zeitintervallen auf. Daher gibt esvereinzelt auch lange Phasen ohne große Be-ben, welche der Gegenstand dieser Untersu-chung sind. Abb. 3 zeigt einen Ausschnitt ausder längsten Phase ohne große Beben aus ei-ner Simulation von insgesamt 109 Ereignis-sen. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen
zu den Vor- und Nachbeben gibt es auch hiereine starke Variation der Aktivität des Modellsum ein bis zwei Zehnerpotenzen. In der Mittedes Diagramms ist eine Sequenz von über 100meist kleinen Beben zu erkennen, ohne dass esein eindeutig identifizierbares, starkes Haupt-beben gäbe.
Somit liefert das OFC-Modell nebenSequenzen aus Vorbeben, Hauptbeben undNachbeben auch Cluster von überwiegendschwachen Beben ohne ausgezeichnetesHauptbeben, welche zumindest auf dem ers-ten Blick wie Erdbebenschwärme aussehen.Um einen konkreteren Bezug zur Schwarm-bebendynamik zu untersuchen, ist allerdingseine genauere Analyse dieser Sequenzen bzgl.Zeitskalen, Größenverteilung und räumlicheStruktur erforderlich, welche Gegenstandeiner zukünftigen Studie sein soll.
Webseite: http://www.geo.uni-bonn.de
282 Abstracts
SL27 – Do., 27.2., 11:40-12:00 Uhr · HS1Heinrich, R., Kracke, D. (Jena, Institut für Geowissenschaften)
Die rezente Seismizität Ostthüringens - Registrierung und AnalyseE-Mail: [email protected]
Ostthüringen mit seinen angrenzenden Ge-bieten, m.a.W. das Territorium östlich Je-na, südlich Leipzig und westlich Chem-nitz ist tektonisch wesentlich geprägt durchdie herzynisch streichende Kyffhäuser-Gera-Jachymov-Störungszone, die im Nordostendurch die Crimmitzschau Störung und im Süd-westen von der Finnestörung bzw. Pohle-ner Störung begrenzt wird. Daneben exis-tieren SW-NO streichende Strukturen, z. B.die Vogtlandstörung, sowie die wesentlichdurch Fernerkundungs-Informationen stärkerins Blickfeld gelangte NS verlaufende tiefrei-chende Leipzig-Regensburg-Störungszone. Inder Region östlich von Gera kreuzen sich diegenannten Störungen und bilden im Ergeb-nis eine komplizierte tektonische Struktur. ImZentrum des Gebiets liegt zudem das sich imFlutungsprozeß befindliche ausgedehnte Ron-neburger Erzfeld.
Verglichen mit seinen Nachbargebieten,weist das betrachtete Territorium in seinemnördlichen und zentralen Teil eine erhöhtedoch moderate Seismizität auf. Die seismi-sche Energie entlädt sich hier in Form von Ein-zelbeben. Nach Süden hin nimmt die Seismi-zität stetig zu. Das Gebiet geht nahtlos in diewegen ihrer hohen Seismizität und Schwarm-bebentätigkeit weit bekanntere Region desSächsischen und Bayerischen Vogtlands sowieNW-Böhmens über. Dieses Schwarmbeben-gebiet erfreut sich seit Jahrzehnten zunehmen-dem seismologischen Interesses.
Das stärkste Erdbeben im östlichen TeilDeutschlands hat sich jedoch in Ostthüringennahe Posterstein ereignet. Dieses relativ klei-
ne Gebiet östlich von Gera ist seismisch ge-fährdet und zwar stärker als die südlich an-schließenden Gebiete hoher Seismizität, ver-gleichbar etwa dem Rheingraben. Aufgrunddieser Gefährdung und der bis dato geringenseismischen Überwachung des Gebietes mitlediglich einer Einkomponentenstation in Pos-terstein wurde 1997 mit dem Aufbau einesseismischen Überwachungsnetzes für Ostthü-ringen begonnen. Ziel war und ist, nebender natürlichen Mikroseismizität Kenntnisseüber eine mögliche flutungsinduzierte Seismi-zität im Ronneburger Raum zu gewinnen, dieerkannten seismischen Ereignisse zu lokali-sieren und Herdflächenlösungen anzustreben.Auf diesem Wege soll die Seismotektonik des
Abbildung 1: Seismizität Ostthüringens undangrenzender Gebiete grau: historische Seis-mizität in Intensitätswerten schwarz: rezenteSeismizität in Magnitudenwerten
Seismologie 283
Territoriums erkundet werden. Weiterhin sollmit dem Netz ein Beitrag zur Überwachungdes Schwarmbebengebietes von Norden hersowie der Gesamtenregion geleistet werden.Gegenwärtig besteht das weitgehend automa-tisch arbeitende Ostthüringer Seismische Netz(OTSN) aus 9 Stationen.
Nach nunmehr fünfjährigem Betrieb sindweit mehr Erdbeben registriert worden alsdie bekannte historische Seismizität erwartenließ. Im betrachteten Territorium existiert ei-ne Mikroseismizität bis in den negativen Ma-gnitudenbereich. Sie bestätigt und komplet-tiert die bekannte historische Seismizitätsver-teilung. Unbekannt war bisher eine erhöh-te Seismizität nördlich von Altenburg. Ge-nerell zeigt die registrierte Seismizität einenicht zu übersehende NS-Erstreckung. Dieserbisher nicht beobachtete Sachverhalt ist inso-fern interessant, als daß seismische Aktivitä-ten bisher hauptsächlich der Gera-Jachymov-Störungszone zugeordnet worden sind. Erlegt somit den Schluß nahe, daß die Leipzig-Regensburger Störungszone seismotekonischvon größerer Bedeutung ist als bisher ange-nommen wurde. Ein weiteres interessantes Er-gebnis, u.a. im Zusammenhang mit den Ur-sachen von Erdbebenschwärmen, ist die Re-gistrierung eines kleinen Erdbebenschwarmssüdwestlich Werdau, der bisher als nördlichs-ter Schwarm in dieser Region registriert wor-den ist. Eine flutungsinduzierte Seismizitätim Ronneburger Bergbaugebiet konnte bishernicht festgestellt werden.
Die Tiefenverteilung der registrierten Erd-beben variiert zwischen 5 und 20 km mit einerdeutlichen Häufung bei 13-15 km, wobei diemittlere Tiefe im Süden deutlich geringer alsim Norden ist. Die bisherigen Untersuchun-gen haben erste Ergebnisse geliefert. Sie kön-nen jedoch nur als Beginn eines längeren Pro-zesses zur Erkundung der Seismotektonik der
Region betrachtet werden. Ihre Detailkenntnisist vor allem für eine realistische Abschätzungder seismischen Gefährdung von Bedeutung.
284 Abstracts
SL28 – Do., 27.2., 12:00-12:20 Uhr · HS1Zöller, G., Holschneider, M. (Uni Potsdam), Ben-Zion, Y. (Los Angeles, USA, U.S.C.)
Analyse von Erdbebensequenzen in einem elastischen Halbraum-ModellE-Mail: [email protected]
Es wird ein elastisches Halbraum–Modellfür Erdbebensimulationen auf mittleren Ska-len (räumlich: 100 m – 100 km, zeitlich: 100m/vshear – 1000 Jahre) vorgestellt. Das Mo-dell besteht aus einer segmentierten Verwer-fung, die in einen dreidimensionalen elasti-schen Halbraum eingebettet ist. Analog zumModell von Ben-Zion & Rice (JGR 98, 14,109-14, 131, 1993) bewegen sich die Regio-nen um die Verwerfung mit konstanter Ge-schwindigkeit vpl. Diese Bewegung definiertdas tektonische Laden und die Randbedingun-gen. In einer ersten Modellversion wird „sta-tic/kinetic friction“ verwendet, d.h. beim Rut-schen einer Verwerfungszelle sinkt der Rei-bungskoeffizient instantan von einem „stati-schen“ Wert auf einen „kinetischen“ Wert undbehält diesen Wert bis zum Ende des Erd-bebens. Eine weitere Modellversion appro-ximiert das „rate and state dependent fricti-on law“ durch zusätzliche zeitabhängige Hei-lung, d.h. ein Ansteigen der Reibung wäh-rend des Erdbebenprozesses. Die Umvertei-lung der Spannung folgt der Lösung von Chin-nery (BSSA 53, 921-932, 1963) für rechte-ckige Verwerfungen in einem dreidimensio-nalen elastischen Halbraum. Während beiBen-Zion & Rice (1993) die Umverteilungder Spannung instantan erfolgt (vshear → ∞,„quasi–statische Näherung“), wird im vorlie-genden Modell eine endliche Geschwindigkeitfür die Ausbreitung seismischer Wellen an-genommen („quasi–dynamische Näherung“ ).Ferner wird auch die „mean–field“ –Näherungfür die Spannungs–Umverteilung betrachtet,in der alle Verwerfungszellen den gleichen
Betrag an Spannung erhalten. Die verschiede-nen Modellvarianten werden hinsichtlich ih-rer Größenverteilungen und der Charakteristi-ka in den Erdbebensequenzen verglichen. Eswerden Kriterien abgeleitet, für welche Para-meter ein Gutenberg–Richter–Gesetz bzw. ei-ne charakteristische Erdbebenverteilung auf-tritt. Besonderes Interesse gilt einem sponta-nen Wechsel zwischen beiden Statistiken, derin der Vergangenheit insbesondere in „mean-field“ –Modellen beobachtet wurde. Es wirdgezeigt, dass eine solche spontane Zustands-änderung von der räumlichen Wechselwir-kungslänge der Spannungs–Umverteilung ab-hängt. Außerdem wird abgeleitet, dass dasModell mit zeitabhängiger Heilung aus demModell ohne Heilung durch „effektive“ Werteder Reibung und des Spannungsverlustes er-halten wird. Das Modell ist in eine flexibleC++ – Klassenbibliothek eingebettet, die ei-ne Vielzahl weiterer Untersuchungen ermög-licht.
Seismologie 285
SL29 – Do., 27.2., 12:20-12:40 Uhr · HS1Riedel, C., Dahm, T. (Hamburg)
Optimizing the 1D-velocity model and relocating hypocenters in the Tjörnes FractureZone / North IcelandE-Mail: [email protected]
The Tjörnes Fracture Zone (TFZ) separatesthe Northern Volcanic Zone of Iceland fromKolbeinsey Ridge (Fig.1). This separationoccurs along three seismically active linea-ments, that are oriented in an angle of about30° relative to the main direction of spread-ing of the two rift zones. In between 1994and 2001 a dataset of around 28000 eventshas been automatically gathered in the regionby the South Icelandic Lowland (SIL) net-work and finally relocated using a multi-eventtechnique. However, the velocity model thathas been used to obtain the original locationswas originally conceived for the South Ice-
Figure 1: A map of the TFZ and the IcelandicSIL network in the region.
Figure 2: A geometric method for determiningthe epicenter, which is used in HYPOGRID.
land Seismic Zone (SISZ) and is shown inthis study to be non-optimal for the TFZ. In-stead a better model has been calculated byan in-house developed minimum model algo-rithm called HYPOGRID, which performs agrid-search for various 1D-velocity structures(at this point in time only p-velocities) of thesubsurface by repeated single-event relocatingand forward travel time modelling using theHuygens principle to solve the Eikonal equa-tion. The single-event locations are calculatedby binning the Wadati diagram in steps of 0.5seconds on the p-axis, a geometrical epicen-ter search using the cosine rule (Fig. 2), depthinversion by travel time minimization and fi-nally a Geiger method inversion. Most of thehypocenters are located in shallower depthsthan in the original dataset after the applica-
286 Abstracts
Figure 3: The seismicity beneath Skjalfandi trough in 3D. The small cubes mark the locationof events, the big cube the location of the only confirmed hydrothermal field.
tion of HYPOGRID. The application of Hy-poDD (Waldhauser and Ellsworth, 2000) asa multi-event technique following the appli-cation of HYPOGRID leads to a narrowingof the epicenters of the seismic lineamentscomparable to the laterally narrow zone de-picted in the original SIL dataset. However,the depth range is more comparable to theHYPOGRID output depth range. Seismicityalong the Grimsey lineament, the northern-most seismic structure of the three is concen-trated in two horizontal bands and subverti-cal finger-shaped features connecting the two(Fig. 3). One horizontal band is found ina narrow depth range centered around 5 kmwith a subtle upwelling close to Grimsey hy-drothermal field and the other in a depth in-creasing from 8 km north of Grimsey to about25 km in Öxarfjördur, i.e. on a lateral scaleof around 80 km. This second band may markthe brittle-ductile transition in the region andthus hint on the transition from oceanic crustto Icelandic crust. Most of the finger-shapedfeatures appear below the central part of Sk-jalfandi trough and may followingly be relatedto hydrothermalism. Acknowledgements: We
thank the DFG for financing our efforts in theTFZ and Vedurstofa Islands for supplying uswith the necessary data from the SIL network.References: F. Waldhauser, W.L. Ellsworth,A double-difference earthquake location algo-rithm: method and application to the NorthernHayward Fault, California, BSSA, 90, 1353-1368
Web page:
http://www.toughcone.de/RESEARCH
Seismologie 287
SL30 – Do., 27.2., 12:40-13:00 Uhr · HS1Hartmann, C. (Universität Stuttgart, Institut für Werkstoffe im Bauwesen), Wilhelm, H. (Uni-versität Karlsruhe, Geophysikalisches Institut), Grosse, C., Finck, F. (Universität Stuttgart,Institut für Werkstoffe im Bauwesen)
Charakterisierung von Quellmechanismen an Modellversuchen mit Hilfe der Schallemis-sionsanalyseE-Mail: [email protected]
Am Institut für Werkstoffe im Bauwesender Universität Stuttgart werden seit ca. 10Jahren in Kooperation mit verschiedenenForschungseinrichtungen Verfahren zur quan-titativen Schallemissionsanalyse entwickelt[1–4]. Schallereignisse werden durch Bruch-prozesse auf Grund von Spannungen einesBauteils hervorgerufen. Deren quantitativeAnalyse ermöglicht eine zeitliche und räum-liche Rekonstruktion des Schadensverlaufes.Die dabei aufgezeichneten Parameter undWellenformen werden durch Inversion vonMomententensoren ausgewertet und darausz. B. der Bruchtyp, die Orientierung derBruchfläche und die abgestrahlte seismischeEnergie ermittelt [1,2].An Hand von geeigneten Modellexperimentenwerden verschiedene Bruchtypen realisiertund deren Abstrahlcharakteristik systema-tisch untersucht. Als Versuchsobjekt dientdazu ein mit einem nahezu ideal homogenisotropen Medium gefüllter Plexiglaskubus.In den bisherigen Untersuchungen ging manzunächst auf die Probleme bei der Lokali-sierung von Ereignissen im Zusammenhangmit dem Messaufbau ein – Gehäusewellen,Fokussierungseffekte, Charakteristik derMessapparatur, usw.Im zweiten Schritt wird eine quantitativeInversion auf verschiedene Bruchmodenangestrebt. Die Problematik liegt dabei vorallem in der Datenaquisition, da die praktischeUmsetzung idealer Quellen (isotrope Explosi-
on, reine Scherung, etc.) sehr aufwendig undphysikalisch sehr schwierig umzusetzen ist.Verschiedene Ansätze, z.B. Funkenüberschlagoder kleine chemische Explosion als isotropeQuellen, werden im Augenblick näher auf ihreEignung bezüglich Aufwand, Charakteristik,Reproduzierbarkeit, usw. geprüft. Ziel istes weiterführend insbesondere Fragen derquantitativen Schallemissionsanalyse [3,4] zudiskutieren, also Untersuchungen zu Nah–bzw. Fernfeldeinfluss auf die Inversion durch-zuführen. Theoretische Vorraussetzungenfür die bestehenden Auswertungsalgorithmenwie Kriterien für Cluster, Quellausdehnung,Einfluss des Mediums sind ebenfalls zuquantifizieren.
Referenzen:[1] C. Große, H.–W. Reinhardt, T. Dahm:
Abbildung 1: Modellversuche am Plexiglas-gehäuse
288 Abstracts
Localization and Classification of FractureTypes in Concrete with Quantitative AcousticEmission Measurement Techniques. NDT&EIntern. 30, 4 (1997), pp. 223–230.[2] C. Große: Basics of Acoustic EmissionMeasurement Techniques. In: Nondestructivetesting and evaluation methods for infrastruc-ture condition assessment (Ed. S. Wooh),Chapter 9, Kluwer Academic Publishers,Hingham, MA (2002), 45 p. (in print)[3] C. Große, H.–W. Reinhardt, F. Finck:Signal-based acoustic emission techniquesin civil engineering. J. of Mat. In Civ. Eng.(2002). (in print)[4] F. Fink: Application of the moment tensorinversion in material testing. Otto–Graf–J.Vol.12 (2001), S145ff.
Seismologie 289
SL31 – Do., 27.2., 15:00-15:20 Uhr · HS1Thorwart, M., Dahm, T. (Uni Hamburg)
Die Auswertung von Ringing-Phasen auf Ozeanbodenseismometern zur Bestimmung derOrientierung des SensorsE-Mail: [email protected]
Bei Ozeanbodenseismometern (OBS,Freifall-Stationen) kann die Orientierung desSensors am Ozeanboden nicht gesteuert wer-den und ist häufig unklar. Für seismologischeUntersuchungen wie Shear Wave Splitting,Oberflächenwellenanalyse, etc. sollte dieSensororientierung möglichst genau bekanntsein. Bei einigen Systemen zeichnet mandeshalb die Sensororientierung zusätzlichauf, bei anderen versucht man diese ausWellenbeobachtungen zu rekonstruieren.Unsere Erfahrungen zeigen, daß die Auswer-tungen des Backazimuts von teleseismischenP-Phasen oder Rayleighwellen relativ großeFehlerbereiche ergeben. Eine dritte Mög-
Abbildung 1: Beispiel für eine ”ringing pha-se”(Ps) vom 10.12.2000, aufgezeichnet vonob10. Seismometerspuren in µm, hydrophonin Pa, bei 1.5 Hz Hochpass gefiltert.
lichkeit, die hier näher untersucht wurde, istdie Auswertung von sogenannten ”ringingphases” auf den Horizontalkomponenten desSeismometers, die kurz nach dem Einsatzvon hochfrequenten P-Phasen auftreten undeine nahezu monofrequente Signalenergiezwischen 2 und 7 Hz aufweisen (vgl. Abb. 1).Die Ursache der Ringing Phase ist nicht zwei-felsfrei geklärt; es werden geführte Wellen,reverberierene Raumwellen (SV) oder auchAnkopplungsprobleme zwischen Boden undSensor diskutiert.
Wir interpretieren die Phase als eine inder obersten Schlammschicht des Ozeanbo-dens konvertierte und reverberierende SV-Phase. Dafür spricht der Zeitversatz zur P-Phase und die fast horizontale Polarisation derSignale. Aufgrund der niedrigen S-Wellen-
Abbildung 2: Gewichtete Verteilung der Ori-entierung des Sensors(ob10) gegen Nord.
290 Abstracts
Geschwindigkeit in der obersten Schlamm-und Sedimentschicht wird sowohl die P- wieauch die konvertierte SV-Welle aufgesteilt.Die SV-Welle der Ringing Phase muß daherin radialer Richtung polarisiert sein.Wir haben getestet, ob sich mit diesem Ansatzdie Orientierung der Sensoren unabhängig be-stimmten läßt. Dazu wurden 117 Lokalbebenaus dem Tyrrhenischen Meer, die sowohl mitLand- wie auch OBS-Stationen genau lokali-siert wurden, ausgewertet. Für die verwend-baren Beben wurde die Rektilinearität und derscheinbare Backazimut bestimmt. Die Diffe-renz zwischen tatsächlichem und scheinbarenBackazimut gibt die Orientierung des Sensorsgegen Nord an (vgl. Abb.2). Für die Bestim-mung des Mittelwerts wurden die einzelnenAblesungen jeweils mit der Rektilinearität ge-wichtet.
Zur Zeit wird untersucht, ob sich die Am-plituden und der Frequenzgehalt der RingingPhase in synthetischen Seismogrammen re-produzieren läßt, um das Modell der rever-berierenden SV-Wellen weiter zu überprüfenund Ankopplungsprobleme der Stationen aus-zuschließen.
T. Dahm et al.(2002). Ocean Bottom Seismo-meters Deployed in Tyrrhenian Sea, EOS Vol.83, Nr. 29
Das Projekt ”Tyrrhenian Sea” wird von derDFG gefördert(DA478/2-2).
Seismologie 291
SL32 – Do., 27.2., 15:20-15:40 Uhr · HS1Oye, V. (Norsar), Ellsworth, W.L. (USGS, Menlo Park, CA, USA), Malin, P. (Duke University,Durham, NC, USA), Roth, M. (Norsar)
Orienting the three-component geophones in the San Andreas Fault Observatory atDepth Pilot Hole using earthquakes and calibration shotsE-Mail: [email protected]
In the end of July 2002, a receiverstring with 32 levels of three-componentgeophones was installed in the pilothole of the San Andreas Fault Ob-servatory at Depth (SAFOD) close tothe town of Parkfield (http://www.icdp-online.de/html/sites/sanandreas/index/). The32-geophone string covers a depth range from850 m down to 2090 m with a constant spac-ing of 40 m between each three-componentgeophone group. In the beginning continuousmonitoring with a sampling rate of 250 Hzwas performed; now the data are recordedin a triggered mode with a rate of 1000 Hz.The geophones are strapped to the outside ofa steel tubing that is lowered inside the wellcasing. Due to the weight of the tubing it istwisted like a corkscrew, pressed to the casing,
Figure 1: Z-component recordings of all 32geophones in the SAFOD pilot hole for a M3.7earthquake located 90 km NW of SAFOD at adepth of 9.5 km.
thereby coupling the geophones to the Earth.At present, only 2 out of 96 channels are notworking and one other channel is somewhatnoisy.
The vertical component of the geophonesfollows the well path (maximum deviation of5 deg from the vertical), but the orientationof the two horizontal components is arbitrary.Hence, the instruments have to be oriented.
To this end, we first perform ray-tracingfrom the known earthquake and calibration
Figure 2: 3D ray tracing from an earthquake 8km NW of SAFOD and at about 4.5 km depth.Rays are traced from the earthquake to the 32geophones of the receiver string and to the 15surface seismic stations of the Parkfield AreaSeismic Observatory (PASO). Velocity hetero-geneities cause the rays to bend and thereforeaffect the associated azimuths and incidenceangles at the receivers. The colour code showsthe P wave velocity field ranging from 2 to 6km/s.
292 Abstracts
shot locations to the receivers in the boreholeand extract the theoretical values for the az-imuth and incidence at each receiver. Sec-ondly, we conduct a P-wave polarisation anal-ysis at all receivers for the earthquake and cal-ibration shot data. To determine the polarisa-tion angles, we build the co-variance matrix ofthe three-component ground motion data fora manually picked time window that enclosesthe first cycle of the P-wave signal. The eigen-vector associated to the largest eigenvalue isthe direction of largest linear polarisation, andin this case it is the direction of the incomingwavefield. The difference between the theoret-ical azimuths and the azimuths derived fromthe polarisation analysis are the corrections wehave to apply to obtain a consistent geophoneorientation. Thereafter, we use the informa-tion of the drilling engineers about the devia-tion of the borehole at depth to put the verticalcomponent back to true vertical.
In this analysis we used two earthquakes,M3.8 and M3.7, at distances of 17 and 90 kmrespectively, away from the drill site and afewsmaller ones with distances of about 5 to 10km. For an absolute calibration of the az-imuth, the far offset events are most reliable,because an error in their location has only mi-nor effects in the azimuth. The azimuth esti-mation for the small events on the other hand,is sensitive to the location error. But the qual-ity of the P-wave onset for these events wasvery good (signal- to-noise ratio better than 6),so that we used them to determine the orienta-tion of the geophones relative to each other. Inaddition, calibration shots were fired on bothsides of the San Andreas Fault at distances ofabout 3 to 20 km from the drill site.
The relative geophone orientations for eachindividual earthquake and calibration shotagree within 10 deg. They were determinedunder the assumption of a homogeneous ve-
locity model. Part of this scatter might be dueto the choice of the velocity model. In orderto obtain more accurate calibration angles weare using now a 3D model of the site (madeavailable by Thurber, et al., 2002, AGU Fallmeeting, T71D-1190) and compute theoreti-cal azimuths and incidence angles by 3D raytracing.
Web page: http://www.norsar.no
Seismologie 293
SL33 – Do., 27.2., 15:40-16:00 Uhr · HS1Miksat, J., Wenzel, F., Sokolov, V. Yu. (Karlsruhe)
Modellierung der Intensitäten des Kocaeli-Bebens von 1999 (Türkei)E-Mail: [email protected]
Das Kocaeli–Beben mit einer Momenten-magnitude Mw von 7,4 ereignete sich am17. August 1999 um 03:02 Uhr Ortszeit.Das Epizentrum lag in der Nähe der StadtIzmit im Nordwesten der Türkei. Bei die-sem Beben brach ein 130 km langes Seg-ment der Nordanatolischen Verwerfung. Eskamen mindestens 18.000 Menschen ums Le-ben und über 25.000 wurden verletzt. Nurfünf Strong–Motion–Stationen befanden sichin unmittelbarer Nähe der Verwerfung. Diedamit aufgezeichneten maximalen Horizon-talbeschleunigungen (PGA) liegen zwischen0,14 g und 0,4 g. Die beobachteten makroseis-mischen Intensitäten erreichen einen Wert vonX. Nach Wald et al. (1999) erwartet man aberauf Grund dieser Intensität eine Horizontalbe-schleunigung von etwa 1,24 g. Die tatsäch-lichen Schäden des Bebens fallen also stär-ker aus als es die Aufzeichnungen der Strong–Motion–Stationen vermuten lassen.
Wir modellieren die Wellenausbreitungdes Kocaeli–Bebens mit einem 3D–Finite–Differenzen–Verfahren (Olsen, 1995) umeinen Überblick über die Bodenbewegung dergesamten Region zu erhalten. Die Model-lierung kann dabei bis zu einer Frequenzvon 1,25 Hz durchgeführt werden. Der vonBouchon et al. (2002) invertierte Bruchvor-gang des Bebens wird bei der Simulation mit-berücksichtigt. Die Berechnung der Wellen-ausbreitung findet mit einem einfachen Mo-dell der elastischen Parameter statt, welchesdie wichtigsten Sedimentstrukturen der Re-gion enthält. Die Ergebnisse der Finiten–Differenzen–Rechnung werden nach der Me-
thode von Sokolov und Chernov (1998) in ma-kroseismische Intensitäten umgerechnet.
Die Modellierung ergibt eine maximale Ho-rizontalgeschwindigkeit (PGV) von 2,3 m/san der Erdoberfläche. Hohe PGV–Werte tre-ten in Regionen auf, die die Bereiche großerVerschiebung entlang der Verwerfung umla-gern. Da die Versätze sehr inhomogen aufder Bruchfläche verteilt sind, zeigt sich einkomplexes Bild der PGV–Werte an der Ober-fläche. Weiterhin ergibt die Modellierung anden Standorten der Strong–Motion–Stationennur geringe bis mittlere PGV–Werte. Berech-net man nun aus den Ergebnissen der Finiten–Differenzen–Rechnung die makroseismischenIntensitäten, so erhält man ein ähnliches Bild.Keine der fünf Strong–Motion–Stationen be-findet sich in einer Region mit maximaler In-tensität (Abbildung 1). Wir schliessen daraus,dass auf Grund der Stationsverteilung und ge-ringen Stationsdichte keine hohen Beschleu-nigungswerte gemessen wurden. So warenGebiete, die während dem Beben hohe Be-schleunigungen erfahren haben, nicht durchStrong–Motion–Stationen abgedeckt. Die be-obachteten und berechneten Intensitäten stim-men recht gut überein. Maximale Intensitätenvon X treten in beiden Fällen an der Südküstedes Marmarameeres im Bereich der Bucht vonIzmit und im Adapazari–Becken auf.
Durch die Finite–Differenzen–Model-lierung des Kocaeli–Bebens mit seinemkomplexen Bruchvorgang auf einer ausge-dehnten Bruchfläche wird deutlich, dass einegeringe Stationsdichte leicht zu einem Wider-spruch zwischen beobachteten Schäden und
294 Abstracts
Abbildung 1: Die Karte zeigt die Verteilung der modellierten makroseismischen Intensitäten(MSK-Skala). Der Stern markiert die Lage des Epizentrums. Die schwarze Linie beschreibtden Verlauf der Bruchfläche. Die gestrichelten Linien entsprechen den Rändern der Sediment-strukturen. Die Strong-Motion-Stationen Gebze (GBZ), Iznik (IZN), Yarimca (YPT), Izmit(IZT), Sakarya (SKR) und Düzce (DZC) sind durch Dreiecke markiert.
aufgezeichneten Beschleunigungen führenkann. Weiterhin zeigt sich, dass ein einfa-ches elastisches Modell des Untergrundesausreicht, um die beobachtete Verteilung dermakroseismischen Intensitäten zu simulieren.
Wald, D. J., V. Quitoriano, T. H. Heaton andH. Kanamori, Relationships between Peak GroundAcceleration, Peak Ground Velocity and ModifiedMercalli Intensity in California, Earthquake Spectra,15, 557-564, 1999
Olsen, K. B., J. C. Pechmann and G. T. Schuster,Simulation of 3D Elastic Wave Propagation in the SaltLake Basin, Bull. Seis. Soc. Am., 85, 1688-1710, 1995
Bouchon, M., M. N. Toksöz, H. Karabulut, M.Bouin, M. Dietrich, M. Aktar and M. Edie, Space andTime Evolution of Rupture and Faulting during the1999 Izmit (Turkey) Earthquake, Bull. Seis. Soc. Am.,92, 256-266, 2002
Sokolov, V. Yu., Yu. K. Chernov, On the Correlationof Seismic Intensity with Fourier Amplitude Spectra,Earthquake Spectra, 14, 679-694, 1998
Seismologie 295
SL34 – Do., 27.2., 16:30-16:50 Uhr · HS1Friederich, W. (Frankfurt)
Ein Loch im lithosphärischen Mantel des nördlichen Tibet-PlateausE-Mail: [email protected]
Verschiedene geodynamische Prozesse, diebei der Bildung und Entwicklung des TibetPlateaus eine Rolle gespielt haben sollen, fin-den sich in der Literatur: Unterschiebung in-discher Lithosphäre unter Eurasische Krus-te, Verlust einer durch Verkürzung der Eu-rasischen Kruste erzeugten Lithosphärenwur-zel, und das Ablösen und die Subduktion so-wohl indischer als auch asiatischer Mantelli-thosphäre. Ein neues dreidimensionales Mo-dell der Scherwellengeschwindigkeit im Man-tel Tibets und Umgebung, das aus Wellenfor-men seismischer Scher- und Oberflächenwel-len abgeleitet wurde, liefert neue Einsichtenin die Geschichte des Plateaus. Es gibt kei-ne tief in den Mantel reichenden Zonen er-höhter Geschwindigkeit, was eine ununterbro-chene Subduktion indischer Lithosphäre aus-schließt. Indische und asiatische Lithosphäreerscheinen als subhorizontale, langgestreck-te Hochgeschwindigkeitsanomalien. IndischeLithosphäre unterschiebt Eurasische Krusteaber nur bis ungefähr zur Banggong-Nujiang-Sutur. Im nördlichen Tibet befindet sich einLoch in der Mantellithosphäre, in dem er-niedrigte S-Geschwindigkeiten von der Über-gangszone bis zur Basis der Kruste reichen.Hier befindet sich vermutlich heißer, aufstei-gender Mantel aus der Asthenosphäre. Kon-vektionsmodelle einer kontinentalen Kollisionlegen den Schluss nahe, dass diese Anordnungstruktureller Elemente vermutlich durch dasAbbrechen eines vormals existierenden Slabszustande kam, der mittlerweile bereits in denunteren Mantel eingetaucht ist.
296 Abstracts
SL35 – Do., 27.2., 16:50-17:10 Uhr · HS1Yuan, X., Kind, R. (GFZ Potsdam)
Comprehensive Seismic Images of the Crust and Upper Mantle beneath TibetE-Mail: [email protected]
New close-spaced passive array seismicdata from central Tibet have been combinedwith previously acquired data to yield two re-ceiver function profiles of the crust and uppermantle beneath Tibet of unprecedented qual-ity. The crust reaches a maximum thicknessof 78±3 km approximately 100 km north ofof the Yarlung-Zangbo suture. From thereit thins northward to about 65±3 km over adistance of 50 to 100 km, and then main-tains roughly constant thickness to the north-ern margin of the plateau. Analysis of mul-tiply reflected phases indicates that the av-erage crustal Vp/Vs does not vary substan-tially from south to north across the Tibetanplateau, and except the vicinity of the north-ern Yadong-Gulu rift, is only slightly ele-vated, in contrast to prior interpretations. The410 and 660 km mantle discontinuities aresharply defined, parallel and continuous be-neath the plateau, implying a lack of any majorstructural feature traversing the mantle transi-tion zone beneath the plateau (e.g., subduct-ing lithosphere slab). Both discontinuities ex-hibit velocity pull-down beneath northern Ti-bet, implying that the average temperature ofthe mantle above the transition zone is ap-proximately 300◦C hotter in the north rela-tive to the south. There is a prominent south-dipping converter in the uppermost mantle be-neath northern Tibet that might represent thetop of the Asian (Tsaidam basin) mantle litho-sphere underthrusting the northern margin ofthe plateau.
Seismologie – Poster 297
SLP01Mittag, R. (Berggießhübel)
Statistical analysis of intraplate seismicity in Vogtland/NW-Bohemia earthquake swarmregionE-Mail: [email protected]
A procedure for statistical seismicity anal-ysis is presented to investigate an active re-gion of intraplate seismicity with swarm-likeoccurrence of earthquakes. As a case study,Vogtland/NW-Bohemia earthquake swarm re-gion is investigated because of its special char-acter of observed microseismicity, its easy ac-cessibility for seismological research meth-ods (narrow earthquake clusters, low magni-tude and depth) and its high quality data set,provided by long-term observation over twocycles of increased seismic activity (strongswarm occurrence in 1962, 1985 and 2000).Analysis should help to reveal specifics in spa-tial, temporal and magnitude distribution ofearthquakes and to explain the special natureand the origin of the underlying seismogenicregime.
After tests for completeness of earthquakecatalogue and for self-similarity (i.e. frac-tal structure) of earthquake distribution, thewhole seismic region is searched for spatialearthquake clusters by means of cluster anal-ysis. As next, seismicity parameters like b-value and fractal dimension are calculated forsingle spatial and temporal earthquake clusters(swarms). Results are examined for statisticalsignificance, and fractal dimension spectra aredetermined for multifractal analysis. To findspecifics of intraplate seismicity, results arecompared with parameters, determined for re-gions with volcanic and mining induced seis-micity.
For Vogtland/NW-Bohemian Region, nei-ther significant perturbations nor tendency
to multifractal behaviour could be detected.Seismicity parameters are similar for all spa-tial and temporal clusters and vary only withinerror bounds, so that seismicity seems to behomogenous (i.e. unifractal) for the whole re-gion.
The swarm-like occurrence of earthquakesis specified by b-values around a mean of 1,what is not significant different from usual val-ues for inherent tectonic seismicity, conclud-ing the seismotectonic character. Interpret-ing the break of the slope of the cumulativemagnitude curve at magnitude 2 as a break inself-similarity for the last swarm in 2000, thatchange of b-value might be due to a change ofthe related rupture length at down-dip width ofseismogenic layer.
Determination of dimension values are toomuch affected by insufficient location data andweak variations do not allow any comparisonbetween clusters. In general, low dimensionvalues of spatial distribution of earthquakesonly reflect the predominantly linear configu-ration of epicentres or planar configuration ofhypocentres along faults.
In comparison to mining induced seismic-ity, significant low fractal dimension valuesof temporal earthquake distribution were ob-served for the whole period as well as for sin-gle swarms of Vogtland/NW-Bohemian seis-micity, indicating a stronger degree of tempo-ral clustering by episodic occurrence of earth-quakes. Comparing dimension spectra be-tween strong swarms, a significant drop withtime becomes obvious, what could be ex-
298 Abstracts
plained by an essential change of the seismo-genic regime, especially while the last swarmin 2000.
The uniform character of seismicity forthe whole Vogtland/NW-Bohemia earthquakeswarm region could be interpreted in terms ofa common seismotectonic regime, belongingto a unique regional fault zone. For that case,the Leipzig-Regensburger fault zone, whichcovers all seismic active clusters of the region,might be the regional acting fault system. It isalso very likely, that the uniform character ofseismicity is caused by a unique seismogenicorigin. Following the idea, that intraplate seis-micity of that region is triggered by magmaintrusions and related fluid and gas releaseinto the tectonically pre-stressed parts of thecrust, a magma body of regional scale maybe supposed to affect all parts of the broadlyspread seismicity. Thus, the increase of tem-poral clustering of earthquakes from swarm toswarm might be an indication for a recent in-crease of power and/or intensity of magma in-trusions.
Web page: http://www.geophysik.tu-freiberg.de
Seismologie – Poster 299
SLP02Carlsen, F. (Jena, Carl Zeiss Gymnasium), Hemmann, A. (Jena, Universität)
Die Erdbebenfolge nahe Plauen und Bad Elster im April 2002: Seismologische Untersu-chungen als Beitrag zum Verständnis der Mechanismen von ErdbebenschwärmenE-Mail: [email protected]
Zur „Saxothuringischen Seismotektoni-schen Provinz„ gehören unter anderem dasGebiet der Mitteldeutschen Kristallinzonein Thüringen und das Schwarmbebengebietim Vogtland. Es werden zwei Regionenmit aktiver intrakontinentaler Seismizi-tät unterschieden, zum einen die RegionVogtland/NW-Böhmen, zum anderen Ostthü-ringen/Westsachsen. Die NW-SW streichendeGera-Jachimov und die N-S streichendeRostock-Leipzig-Regensburger Störungszonekreuzen sich im Untersuchungsgebiet.
Während für das Vogtland/NW-BöhmenErdbebenschwärme charakteristisch sind,ereignen sich in der Region Ostthürin-gen/Westsachsen vorwiegend Einzelereig-nisse. Die Hypozentren der Beben imVogtland/NW-Böhmen bilden charakteristi-sche, mitunter zeitlich variable Cluster. Ander Schnittstelle beider Regionen liegt dasseismische Cluster Plauen. Hier werdenErdbebenschwärme und Einzelereignisse inenger Nachbarschaft registriert. Oft fällt dieUnterscheidung von Erdbebenfolgen undErdbebenschwärmen schwer.
Es ist davon auszugehen, dass erst diegemeinsame Untersuchung von Erdbeben-schwärmen und Einzelereignisse in verschie-denen Erdbebenclustern der Region zum Ver-ständnis der Mechanismen der Schwarmbebenführt.
Die untersuchten Ereignisse fanden vom09.04.2002 bis zum 24.04.2002 statt. DerSchwerpunkt der Aktivität lag zwischen dem19.04.2002 und dem 22.04.2002. Es wurden
über 60 Ereignisse registriert. Die Epizen-tren erstreckten sich auf einer Fläche von 2 x2.5 km. Der Bereich der Hypozentral-Tiefedehnt sich von 12 bis 14 km aus. Für dieUntersuchungen standen Daten von bis zu 283-Komponenten Stationen des Ost-ThüringerSeismischen Netzes, der Kraslice Netzes undder Vogtlandnetze der Universität Leipzig undder Bergakademie Freiberg zur Verfügung.Die Epizentraldistanz der Stationen lag zwi-schen 2 km und 60 km mit einer guten azimu-talen Verteilung.
Alle Ereignisse wurden unter Verwendunggleicher Stationen und mit dem im seismi-schen Datenbank- und Datenverarbeitungs-Programm SEISAN involvierten ProgrammHYPO71 neu lokalisiert. Der Einflussder Stationsverteilung und des verwende-ten Geschwindigkeitsmodells auf die Loka-lisierung wurden getestet. Das für dieLokalisierung verwendete eindimensionaleGeschwindigkeits- Tiefen- Modell wurde ausDaten des sprengseismischen Profils CELE-BRATION 2000 berechnet und von verschie-denen Arbeitsgruppen verifiziert.
Die Lokalisierung lieferte Untergrundstruk-turen, deren Bezug zur aktivierten tektoni-schen Störungen nachweisbar ist. Interessantsind die lateralen Änderungen der Herdtiefe.Die bestimmten b-Werte liegen über 1.5. Mitder IIDA Magnitudenformel konnten Lokal-Magnituden zwischen ML = -1.1 und ML = 1.8berechnet werden.
Heute zielt die Forschung in der Regionvor allem auf die Untersuchung von Herd-
300 Abstracts
prozessen in ihrem seismotektonischen Um-feld. Mikro- und Schwarmbeben sind für sol-che Untersuchungen besonders gut geeignet,da die Besonderheiten des Herdgebietes bes-ser charakterisiert werden können. Die in die-ser Studie mit dem Programm FOCMEC be-rechneten Herdflächenlösungen liefern Infor-mationen zur geologischen und tektonischenUrsache der Beben. Das Einfallen und Strei-chen von Bruchflächen kann verifiziert wer-den.
Seismologie – Poster 301
SLP03Kracke, D., Heinrich, R., Jentzsch, G. (Jena, Institut für Geowissenschaften)
Lokale seismische Gefährdungsabschätzung in Gebieten schwacher bzw. moderater Seis-mizität - Fallstudie für OstthüringenE-Mail: [email protected]
Die seismische Gefährdung einer Regionwird im allgemeinen als von der Zeit unab-hängig betrachtet. Das von ihr ausgehendeseismische Risiko bzw. die Verletzbarkeit da-gegen hängt von der Bevölkerungsdichte unddem allgemeinen industriellen Entwicklungs-stand der Region ab und wächst mit beiden.Solche Gebiete verfügen meistens nur übereine schwache Erdbeben–Datenbasis. AusMangel an rezenten Erdbebendaten ist man indiesen Fällen fast ausschließlich auf histori-sche Erdbebenaufzeichnungen mit ihren Un-sicherheiten, den tatsächlichen Herd und dieStärke betreffend, angewiesen.
In vorliegender Fallstudie wird die seismi-sche Gefährdung für den Ostthüringer Raummit Hilfe der probabilistischen Gefährdungs-analyse abgeschätzt. Aufgrund der Datenla-ge – seit Beginn der instrumentellen seismi-schen Registrierung vor rund 100 Jahren istkein Schadensbeben aufgetreten – werden fürdie Analyse ausschließlich historische Erdbe-ben verwendet. Wegen der nur ungenauenKenntnis der Erdbebenherde ist es erforder-lich, Gebiete mit einheitlichem Seismizitäts-charakter, sogenannte Flächenquellen, zu defi-nieren. Das muß mit Sorgfalt in Abstimmungzwischen der Seismizität und Seismotektonik,soweit bekannt, erfolgen. Sowohl die Geo-metrie als auch die Größe dieser Flächenquel-len sind von grundlegender Bedeutung für dasangestrebte Ergebnis. Eine Überdimensionie-rung der Quellen, um Ungenauigkeiten his-torischen Erdbebenherde zu berücksichtigen,hat eine Verminderung der abgeschätzten Ge-
fährdung zur Folge. Historische Erdbebenweisen aber zumeist beträchtliche Ungenau-igkeiten in ihren Herdkoordinaten auf. DieseDiskrepanz wird im vorliegenden Beitrag ge-löst, indem mehrere alternative Flächenquel-len definiert und die damit erzielten Gefähr-dungsabschätzungen am Ende überlagert wer-den. Ähnlich wird mit den makroseismischenBeobachtungen des stärksten Erdbebens die-ser Region verfahren, um eine möglichst rea-listische Abschätzung zu erzielen. Die Re-sultate dieser Fallstudie sind detaillierter alsdie bisher für den Ostthüringer Raum ermittel-ten seismischen Gefährdungen. Sie stimmenzudem gut mit den makroseismischen Beob-achtungen des Mitteldeutschen Erdbebens von1872 überein. Der beschriebene Lösungwegist generell zur lokalen Gefährdungsbestim-mung für Gebiete mit vergleichbarer Daten-verfügbarkeit geeignet.
302 Abstracts
Abbildung 1: Seismische Gefährdungskarte von Ostthüringen und den angrenzenden Gebieten.Dargestellt sind die Überschreitenswahrscheinlichkeiten von 10% innerhalb von 50 Jahren fürdie entsprechenden Intensitäten. Weiße Sterne kennzeichnen makroseismische Beobachtungendes Mitteldeutschen Erdbebens von 1872 und schwarze Kreuze Erdbebenepizentren.
Seismologie – Poster 303
SLP04Stammler, K. (SZGRF Erlangen), Wang, P. (China Seismological Bureau)
Das Yanqing-Projekt: Seismizität und Seismotektonik im Yanqing-Huailai BeckenE-Mail: [email protected]
Im Rahmen einer deutsch chinesischen Ko-operation führen die BGR und das CSB (Chi-na Seismological Bureau) ein gemeinsameswissenschaftliches Projekt in der Region Pe-king durch. Wegen der hohen Bevölkerungs-dichte und einer akuten Gefährdung durchstärkere Erdbeben ist der Großraum Pekingein Gebieten mit einem sehr hohen seismi-schen Risiko.
Das Untersuchungsgebiet liegt etwa 80kmnordwestlich der Hauptstadt, nahe der StadtYanqing. Seismizitätskarten enthalten für die-ses Gebiet eine zeitliche und räumliche Lücke.Das Gemeinschaftsprojekt überwacht die lau-fende Seismizität in diesem Gebiet und un-tersucht die dort vorkommenden Erdbebenme-chanismen. Die Dauer des Projektes ist aufmindestens 5 Jahre angelegt.
In der Startphase des Projekts wurdenStandorte für 10 moderne seismologischeMessstationen ausgesucht, bauliche Maßnah-men zur Sensorunterbringung durchgeführtund die Messinstrumente aufgestellt. 9 Sta-tionen übertragen kontinuierliche Messreihenper Funk an ein Datenzentrum, wo sie sofortausgewertet werden können, für spätere ein-gehendere Untersuchungen werden aber alleDaten kontinuierlich auf beschreibbaren CDsund auf einem RAID Festplattensystem archi-viert.
Die Ziele des Projektes sind neben der ak-tuellen Erdbebenüberwachung herdmechani-sche und seismotektonische Untersuchungen,um weitere Aufschlüsse über die Vorgänge beiIntra-Plattenbeben zu gewinnen.
304 Abstracts
SLP05Dahm, T. (Hamburg), Tilmann, F., Phipps Morgan, J. (GEOMAR, Kiel)
Seismische Langzeitmessungen südlich von IslandE-Mail: [email protected]
Motivation Die Laufzeittomographie undReceiverfunction-Auswertungen haben bisherwichtige Informationen über die seismischeStruktur des Plumes und des Mantels unter Is-land erbracht. Einige Fragen zum Island Plu-me sind dennoch kontrovers:(1) Übereinstimmend wird in unterschiedli-chen Arbeiten eine Niedriggeschwindigkeits-anomalie für den Tiefenbereich zwischen 200und 400 km aufgelöst. Weil die Apertur derInselarrays eine geringe Auflösung für dentieferen Mantel ab 400 km hat, ist unklar obsich der Plume in die Tiefe fortsetzt. Während
21
22
23
26
2524
27
28
29
20
332˚
332˚
334˚
334˚
336˚
336˚
338˚
338˚
340˚
340˚
342˚
342˚
344˚
344˚
346˚
346˚
59˚ 59˚
60˚ 60˚
61˚ 61˚
62˚ 62˚
63˚ 63˚
64˚ 64˚
65˚ 65˚
66˚ 66˚
67˚ 67˚
0 100 200
km
Abbildung 1: Positionen der ausgesetztenOzeanbodenstationen (OBS No 21-28).
Wolfe et al. (1997) und Allen et al. (2002) voneinem Mantelplume mit tiefen Wurzeln aus-gehen (evtl. an Kern-Mantel-Grenze), siehtFoulger et al. (2000) den Ursprung der An-omalie allein im oberen Mantel oberhalb von400 km Tiefe.(2) Shen et al. (2001) findet mit Receiver-functions für die ’660’ und ’410’ Diskontinui-
Abbildung 2: Gefilterte Aufzeichnung (0.04-0.1 Hz) eines Tiefherdbebens (Russia N.-E.China Border Region, 28 Juni 2002, 566 km,7.3Mw) auf der Hamburger Station 21 und23 (Seismometer und Hydrophon) und demHydrophon der Geomar Station 28. Für dieGeomar Stationen liegen aufgrund technischerProbleme keine Seismometerregistrierungenfür dieses Beben vor.
Seismologie – Poster 305
tät eine verdünnte Übergangszone im Mantelunter Island, die als eine thermisch induzier-te Verschiebung der Phasenübergänge in ei-nem heisseren Mantelplume interpretiert wird.Die maximale Ausdünnung der Übergangszo-ne liegt südlich von dem Punkt an dem derPlume die Isländische Kruste erreicht, wo-durch sich ein ’schräg aufsteigender’ Mantel-plume andeutet. Allerdings kann der vermu-tete Durchstoßpunkt des Plumes in der Über-gangszone nicht gut aufgelöst werden, da Sta-tionen am Ozeanboden fehlen.
Beide Verfahren, Tomographie und Recei-verfunctions, sind also in ihrer Auflösungbeschränkt wenn wie bisher nur seismischeStationen auf Island selbst verwendet wer-den. Wiederholt wurde deshalb auf die mög-lichen Vorteile von zusätzlichen Langzeit-Ozeanbodenmessungen hingewiesen. Groß-skalige OBS-Experimente konnten bisher al-lerdings nicht realisiert werden, zum Teil auchweil es an der erforderlichen Zahl von entspre-chenden OBSen fehlt. Außerdem ist umstrit-ten, für welchen Plume eine Ozeanbodenaus-lage am erfolgsversprechendsten wäre. Islandist hierbei kritisch zu betrachten, weil Seegangund Wetter im Nordatlantik eine erheblicheRauschquelle darstellen.
Experiment In einem ersten Pilotexperi-ment zwischen April und Juli 2002 (Abb. 1)sollte geklärt werden, wie die Signal-Rausch-Bedingungen vor Island einzustufen sind undwie sich OBS-Stationen von GEOMAR undHamburg für so einen Einsatz bewähren. DieAuswertung von Oberflächenwellen ist vor-gesehen. Beide Stationstypen (vgl. Dahmet al., 2002) waren mit breitbandigen Sen-soren (PMD-Seismometer, 0.025-32 Hz) aus-gerüstet. Von GEOMAR wurden nebenSeismometer- auch reine Hydrophonstationenausgebracht. Abb. 2 zeigt ein Beispiel für eineRegistrierung eines starken Tiefherdbebens.
Für starke Fernbeben wurden durchaus aus-wertbare Seismogramme aufgezeichnet, wo-bei die Seismometerdaten in dem gezeig-ten Frequenzbereich generell weniger Rausch-signale aufweisen als die Hydrophondaten.Die Horizontalkomponenten der Seismometersind größeren Rauschsignalen ausgesetzt alsdie Vertikalkomponenten.Bisherige Auswertungen zeigen, daß wegender starken Meeresmikroseismik im Nordat-lantik im Winterhalbjahr das Signal-RauschVerhältnis schlechter als erwartet ist. EinEinsatz über die Wintermonate scheint des-halb sehr fragwürdig. Ebenso sind signifikan-te Qualitätsunterschiede für einzelne Statio-nen und Standorte auszumachen.In dem Poster wird ein Überblick überRauschbedingungen und die aufgezeichnetenWellenformen gegeben. Die Daten werden imVergleich mit Messungen im TyrrhenischenMeer diskutiert.
Allen, et al., 2002. Imaging the mantlebeneath Iceland using integrated seismologi-cal techniques. J. Geophys. Res., 10.1029,2001JB000595, in press.Dahm, et al. 2002. Ocean bottom seismolo-gical instruments deployed in the TyrrhenianSea. EOS Trans., 83, 309, 314.Foulger et al., 2000. The seismic anomalybeneath Iceland extends down to the mantletransition zone and no deeper. Geophys. J.Int., 142, F1-F5.Wolfe et al., 1997. Seismic structure of theIceland mantle plume. Nature 385, 245-247.
Das Projekt wird von der DFG gefördert(DA 478/5-1, MO 961/3-1).
306 Abstracts
SLP08Braunmiller, J. (Zürich, ETH), Schlittenhardt, J. (Hannover, BGR)
MS - Mw scaling relations for Euro-Mediterranean earthquakes using GRF-array measu-rements of regional surface waves and regional moment tensor solutionsE-Mail: [email protected]
Recent processing of regional surface waveseismograms from earthquakes in Europe(Patton & Schlittenhardt, 2001) have revealeda strikingly low MS detection threshold downto MS ∼ 2.0 when the F-K method is used toanalyze GRF-(Gräfenberg) array data. MS de-terminations for a level this low are rare on aglobal basis mainly because of problems withthe identification of weak surface wave signalsin single station recordings. In contrast, sta-ble array estimates of slowness and azimuth ofsurface waves from different European earth-quakes help identify weak signals and indicatethe reliability of regional MS determinations atlow signal strengths.
ETH Zürich recently began compilation ofa catalogue of moment tensors for Europeanearthquakes, similar to the Harvard CMT cata-logue, which contains all earthquakes > 4.5 inEurope and the Mediterranean Sea. The ETHcatalogue, to which data for local events withmagnitudes of > 3.0 are being added, containsover 400 moment tensors for the years 2000and 2001. Newly determined regional MSmagnitudes using large aperture GRF-arraydata and mb(Lg) determinations are comparedin the poster with the uniquely comprehensiveETH data set of scalar moment values (and in-ferred Mw magnitudes) derived from regionalmoment tensors using seismograms from Eu-ropean broadband stations. The results willbe interpreted in the light of transportability,stability and calibration of regional magnitudescales. The ETH data set can be used to de-termine scatter and/or bias in MS data derived
from GRF seismograms that may be presentdue to the normal absence of correction forthe source mechanism. The empirical rela-tionships between Mw and MS derived in thisstudy will be compared to global relationshipsdeveloped by Ekström & Dziewonski (1988)for earthquakes using CMT M0 and PDE MSvalues.
References:Patton, H. J., Schlittenhardt, J., 2001. Ms
- mb(Lg) scaling from regional observationsof the Umbria-Marche earthquake sequencerecorded by the Gräfenberg array and theGerman Regional Seismic Network (GRSN).Seismol. Res. Lett., 72, 242
Ekström, G., Dziewonski, A. M., 1988. Ev-idence of bias in estimation of earthquake size.Nature 332, 319-323
Seismologie – Poster 307
SLP09Wittwer, A., Dahm, T., Thorwart, M. (Universität Hamburg), Flueh, E. (Geomar, Kiel)
Erdbebenlokalisierungen im Tyrrhennischen Meer mit kombinierten Ozeanboden- undLanddatenE-Mail: [email protected]
In dem Projekt ging es darum, erstmaligein temporäres untermeerisches Stationsnetzaus Breitbandseismometern und Breitband-hydrophonen nördlich von Sizilien und imGebiet des Tyrrhennischen Beckens (für sechsMonate) zu installieren und die gesammeltenDaten zusammen mit Landstationsdatenauszuwerten.Ziel ist es die genaue Geometrie des seis-misch aktiven ionischen Slabs unter demKalabrienbogen zu bestimmen, das Span-nungsfeld im Slab abzuleiten, zu prüfen, obes schwache Seismizität in dem als seismischinaktiv eingestuften Slabbereich unter demzentralen südlichen Appenin gibt, und dielokale Seismizität im Tyrrhennischen Beckenund im Bereich des äolischen magmatischenBogens zu erfassen und zu interpretieren.Eines der wichtigen Ziele der Auswertung istdie Hypozentrumsbestimmung der Lokalbe-ben, wobei wir uns nach Absprache mit demIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia(INGV) nur auf Ereignisse aus unserem Netzkonzentrieren, also vorwiegend aus demozeanischen Bereich. Da unser Netz Azi-mutlücken aus dem nordwestlichen Bereichdes Kalabrienbogens schliesst, können unsereDaten neue Informationen zur Lokalisierungdieser Ereignisse beitragen. Mittlerweile sindam Institut für Geophysik in Hamburg (IfG)70 lokale Ereignisse von Hand lokalisiertworden. Davon sind 19 Tiefherdbeben mitz ≥ 50 km. Die Ersteinsätze wurden mitder Software SAC (SeismicAnalysisCode,P.Goldstein et all., Universität California)
gepickt. Die Lokalisierung erfolgte mitHYPOSAT (J.Schweitzer, Norsar (Norwe-gen)). Unsere Lokalisierungen haben dieAnkunftszeiten der italienischen Stationenmitverwendet, und sollten eine Verbesserungdarstellen.Bisher wurde ein 1D-Modell verwendet, dasauf Informationen vom INGV basiert. Es istzumindest für Flachbeben bisher keine klareKonzentration auf einzelne Zonen oder Linienzu erkennen. Die bisherige Auswertung hatgezeigt, daß es systematische Laufzeitfehlerfür die Ozeanboden- und Landstationen gibt.Das ist ein Hinweis auf die nicht berück-sichtigte 3D-Struktur; die Landstationen desINGV befinden sich auf kontinentaler Krusteund die OBS-Stationen liegen auf ozeanischerKruste.Durch die Verwendung der Software JOINTHYPOCENTRAL DETERMINATION (J.Pucol, Universität Memphis) war es möglichStationskorrekturen (zwischen +/- 3 Sekun-den) zu bestimmen. Dies ist ein erster Schrittum aus den Daten ein bestes ”Kontinent-Ozean-Modell” für Sizilien, Kalabrien unddas Tyrrhennische Meer abzuleiten, umverbesserte Lokalisierungen zu erreichen.
Literatur:T. Dahm et al. (2002). Ocean Bottom Seis-
mometers Deployed in Tyrrhenian Sea, EOSVol. 83, Nr. 29
M. Thorwart et al. (2001). Tyrrhenian SeaExperiment: Zwischenbericht, AG Seismolo-gie 2001
Seismologie – Poster 309
SLP10Gossler, J., Flüh, E.R., Schnabel, M., Tilmann, F. (Geomar Forschungszentrum, Kiel), Goltz,C. (Inst. f. Geowissenschaften, Univ. Kiel), Arroyo Hidalgo, I. (Instituto Costarricense deElectricidad, San Jose, Costa Rica)
Passive seismology on- and offshore Costa RicaE-Mail: [email protected]
In subproject A2 of the SFB 574 “Fluids,Volatiles, Hazards“ a combined on- and off-shore seismic network, consisting of 23 oceanbottom and 15 land stations, had been de-ployed in April 2002 during and after RVSONNE cruise 163 in the coastal Pacific re-gion of central Costa Rica (Jaco network).After registering half a year the instrumentswere recovered and re-deployed about 100 kmsouth-east in the Quepos network during andafter RV METEOR cruise M54-3B in October2002. The final recovery of the instrumentswill take place in April/July 2003.
The main subject of our subproject, whichcombines active and passive seismic experi-ments, is the coupling and mass transfer be-tween upper and lower plate of the subductionzone in central Costa Rica. In the passive seis-mic part, we are observing the local seismicityof the area in two adjacent regions for half ayear each.
In the first deployment area (Jaco network)three major seamounts have been subducted.This is a special kind of mass transfer in thesubduction zone. The effects of seamount sub-duction on microseismicity will be studied.Active seismics indicate that material transferfrom the upper to the subducting plate takesplace in the second deployment area (Que-pos network). There, the seismicity of the socalled megalense is of further interest. Thedetailed investigation of the décollement re-flections are the main subject of further activeseismic experiments.
In both areas, we try to delineate tectonicunits by determining hypocenters and focalmechanisms of local earthquakes, and lateron if the lateral coverage with hypocenters issufficient also by seismic tomography. De-tailed velocity models are obtained from ac-tive seismic experiments done during severalRV SONNE cruises and explosions on land.
Of particular interest is the chronologicaldevelopment of the local seismicity of the re-gion during the observation period, which mayhelp us to learn more about how the sub-duction process works. A first observationis a strong increase of the seismicity in May2002, where this increase is not only due tosome major events and their aftershocks tak-ing place in the area.
Web page: http://www.geomar.de
310 Abstracts
Figure 1: Location map of the temporary passive seismic networks and the active seismicprofiles: Jaco network operated Apr-Oct’02 (grey reverse triangles); Quepos network operatingOct’02-Apr/Jul’03 (black triangles); permanent stations (black circles); wide-angle seismicprofiles shot during RV SONNE cruise 163 (black lines).
Seismologie – Poster 311
SLP12Sodoudi, F. (GeoForschungsZentrum,Potsdam)
STRUCTURE OF THE CRUST IN GREECE USING RECEIVER FUNCTIONSE-Mail: [email protected]
Data from 23 temporary seismological sta-tions across the Aegean islands and continen-tal Greece, operating in 1997, were analysedusing the receiver function approach. The sta-tions have been installed mainly in the perma-nent observatories of the National Observatoryof Athens and of the Thessaloniki Seismolog-ical Network. A total of 36 teleseismic eventshave provided useful data to investigate thecrustal and upper mantle structure. Data fromsix additional long term broadband stations ofthe GFZ Potsdam on the island of Crete andsouthern Aegean islands have also been used.
Converted P-S energy from the Moho isclearly observed beneath continental Greece ata depth ranging from 30 to 35 km. The Mohois shallowing to 23–27 km beneath the stationson the Aegean islands.
The 410 and 660 km discountinuties ofupper mantle under continental Greece havebeen seen clearly at their normal position. Inthe Aegean, no such phases are visible in ourdata. The descending slab is clearly observedin the migrated receiver functions beneath theAegean and Crete.
312 Abstracts
SLP14Rische, M., Endrun, B., Meier, T., Harjes, H.-P. (Bochum)
Seismogenic Zones of the Hellenic Arc in the area of western and central Crete mappedby temporary local seismic networksE-Mail: [email protected]
Temporary local seismic networks were in-stalled in western Crete, in central Crete andon the island of Gavdos south of western Cretein order to image shallow seismogenic zonesof the Hellenic subduction zone. More than4000 events were detected and located. Themagnitudes of these events vary between 0 and4.8. The resulting three-dimensional hypocen-ter distribution allows to localize seismogeniczones in the area of western and central Cretefrom the Mediterranean Ridge to the CretanSea. Furthermore, a three-dimensional struc-tural model of the region under considerationwas compiled based on results of wide angleseismics, surface wave and receiver functionstudies. The comparison of the hypocenterdistribution and the structure allows to identifyintraplate and interplate seismicity. High in-terplate seismicity along the interface betweenthe subducting African lithosphere and theEurasian lithosphere is found south of west-ern Crete. The lateral width of the seismo-genic zone that is due to interplate seismicityis about 100 km in NE-SW direction south ofwestern Crete and it is reduced to about 30 kmsouth of central Crete. Interplate seismicity isfound along the interface between the platesfrom about 20 km to 40 km depth.
An offset between the southern border ofEurasian lithosphere and the southern borderof active interplate seismicity is observed. Inthe area of Crete, the offset varies laterallyalong the Hellenic arc between about 50 kmto 70 km.
A southwards dipping zone of high seismic-
ity within the Eurasian lithosphere is foundsouth of central Crete. It reaches from theinterface between the plates at about 30 kmdepth towards the surface. In comparison,the corresponding seismogenic zone south ofwestern Crete is much less seismically active.Seismicity beneath Crete and north of Crete isconfined to the upper 20 km. Between 20 kmand 40 km depth beneath Crete the Eurasianlithosphere is seismically inactive. In west-ern Crete the southern and western bordersof this aseismic zone correlate strongly withthe coastline. Clusters of seismicity indicatetwo major NE-SW oriented faults: one strik-ing along the western coast of Crete, the othercrosses central Crete. Properties of the seis-micity and the structure change across thesefaults. Comparing seismicity and structure ofwestern and central Crete, it is concluded thatthe interaction between the Eurasian and theAfrican plates is different to both sides of theNE-SW fault crossing central Crete.
The comparison of the hypocenter distribu-tion of the microseismicity and that listed inthe global, relocated ISC-catalogue shows thatthe latter is probably shifted systematically to-wards the NE and to greater depths by about15 km to 20 km. Local networks are neces-sary to study intraplate seismicity within theEurasian lithosphere.
Multiplets, that means earthquakes thatshow very similar waveforms, are frequentlyfound in the interplate seismicity south ofwestern Crete and in the seismogenic zonewithin the Eurasian lithosphere south of cen-
Seismologie – Poster 313
tral Crete. Multiplets are likely to indicatefluid flow on deep reaching faults. Since mul-tiplets are assumed to occur within the limitsof resolution nearly at the same place they al-low to estimate confidently errors of the singleevent localizations. This results in an averageerror of less than 2 km in the hypocenters ofmicroseismicity that is located not more thanabout 50 km away from the networks.
314 Abstracts
SLP15Plenefisch, T., Ibs-von Seht, M. (Erlangen)
Momententensoren für einen Erdbebenschwarm im südlichen Kenia RiftE-Mail: [email protected]
Das Magadi-Gebiet bildet den südlichenAbschluss des kenianischen Teil des GregoryRifts. Die vulkanisch geprägte Region zeich-net sich durch hydrothermale Aktivität undeine hohe Seismizität mit geringen bis mo-deraten Magnituden (ML < 4) aus. Wäh-rend einer 8-monatigen Messphase (Novem-ber 1997 - Juni 1998) mit einem temporärenNetz seismischer Stationen konnte neben derHintergrundseismizität ein Erdbebenschwarmmit mehreren tausend Ereignissen und einerMaximalmagnitude von ML = 4.1 aufgezeich-net werden. Die Hypozentren der Schwarm-beben liegen zwischen 1 und 9 km Tiefe undbilden ein sich in NNE-SSW Richtung erstre-ckendes lineares Erdbebencluster.Die Räumliche Nähe der Hypozentren zuein-ander erlaubt den Einastz einer relativen Mo-mententensorinversion zur Bestimmung derHerdmechanismen. Die Ergebnisse der re-lativen Momententensorinversion werden imPoster vorgestellt und mit Scherbruchmecha-nismen verglichen, die in einer früheren Ar-beit mit dem FOCMEC-Programm bestimmtwurden. Vom Scherbruch abweichende Antei-le der Momententensoren (volumetrische undCLVD-Anteile) werden analysiert und im Hin-blick auf Fluidprozesse interpretiert. Die Er-gebnisse für das Magadi-Gebiet werden ver-glichen mit denen ähnlicher Untersuchungenfür ein intrakontinentales Schwarmbebenge-biet - die Region Vogtland/NW-Böhmen - unddiskutiert.
Seismologie – Poster 315
SLP16Ibs-von Seht, M., Plenefisch, T. (Erlangen), Braun, T. (Arezzo), Klinge, K. (Erlangen)
Beobachtung von Mikroseismizität und Schwarmbebenaktivität im zentralen Apennin(Italien)E-Mail: [email protected]
In Zusammenarbeit mit dem INGV Romund dem Seismologischen ObservatoriumArezzo (Italien) wurde im Oktober 2002 eintemporäres seismisches Stationsnetz im zen-tralen Apennin installiert. Die Arbeiten sindTeil der Untersuchungen im Rahmen des DFGForschungsvorhabens “Schwarmbeben welt-weit”. Eine Analyse von Bebenkatalogen fürdie Region zeigt, dass neben den vulkanischenund hydrothermal aktiven Gebieten südwest-lich des Apennins auch im zentralen Apenninselbst schwarmartige Bebensequenzen auftre-ten.Das Stationsnetz dient der Beobachtung derlokalen seismischen Aktivität im oberen Ti-bertal, insbesondere im Hinblick auf das Auf-treten von Bebenschwärmen. Das Netz be-steht aus fünf mobilen MARS88 Stationenmit 1-Hz Seismometern und soll im Früh-jahr 2003 um mindestens eine Breitbandsta-tion erweitert werden. Zusätzlich könnendie Aufzeichnungen der umliegenden italieni-schen Regionalnetz-Stationen verwendet wer-den.Das Poster zeigt Ergebnisse erster Seimizi-tätsuntersuchungen. Präzisionslokalisierun-gen, herdmechanische Analysen sowie die Be-trachtung von b-Wert Verteilungen sollen zurKlärung der Charakteristika und Prozesse vonSchwarmbeben-Aktivitäten beitragen.
316 Abstracts
SLP17Budweg, M., Weber, M., Bock, G. (GFZ Potsdam), Eifel-Plume-Team
The upper mantle in the Eifel Plume regionE-Mail: [email protected]
The Eifel is the youngest volcanic area ofCentral Europe. The last eruption occurred ap-proximately 11000 years ago. Little is knownabout the deep origin and the mechanism re-sponsible for the Eifel volcanic activity. Earth-quake activity indicates that the Eifel is oneof the most geodynamically active areas ofCentral Europe. We use the receiver func-tion method (RF) to investigate lithospheric-asthenospheric structure beneath the Eifel. Weanalyzed data from 125 teleseismic events (mb> 5.5) that were recorded both by perma-nent stations and by temporary network of33 broad-band and 129 short-period stations.The temporary network was operating fromNovember 1997 till June 1998 and coveredan area of approximately 400x250 km cen-tered on the Eifel volcanic fields. RF analy-sis reveals a clear image of the Moho and themantle discontinuities at 410 km and 660 kmdepth. Average Moho depth is approximately30 km and it shows little variation over the ex-tent of the network. The observed variationsof converted waveforms is possibly caused bylateral variations in crustal structure. Inver-sions of data and migrated RF from stations ofthe central Eifel array suggest that a low ve-locity zone is present at about 60 to 80 kmdepth in the western Eifel region. We alsoalso find indications for a high velocity zonearound 200 km depth, perhaps caused by de-hydration of the rising plume material. The re-sults suggest that P-to-S conversions from the410-km discontinuity arrive later than in theIASP91 reference model. This could indicatehigher than normal temperatures in the transi-
tion zone from upper to lower mantle. It alsoseems that the 410-km discontinuity is not ascontinuous as the 660-km discontinuity in theEifel region.
Seismologie – Poster 317
SLP18Jordan, M., Barth, A. (Göttingen), Ritter, J.R.R. (Karlsruhe)
Die seismische 3D-Struktur des Eifel Plumes aus teleseismischer Tomographie und ihregeodynamische InterpretationE-Mail: [email protected]
Die bisherigen Ergebnisse der regionalenLaufzeittomographie (P- und S-Wellen) sowieder Dämpfungstomographie (P-Wellen) zei-gen den Eifel Plume als Bereich erniedrig-ter Geschwindigkeiten und erhöhter Dämp-fung im oberen Erdmantel bis mindestens zurÜbergangszone in 410 km Tiefe.
In Übereinstimmung hiermit ergibt die Un-tersuchung von Receiver Functions (GFZPotsdam) eine Deflektion der Diskontinuität in410 km Tiefe um zirka 20 km.
Es stellt sich nun die Frage, ob sich der Ur-sprung des Eifel Plumes innerhalb der Über-gangszone oder in noch grösserer Tiefe befin-det, insbesondere im Hinblick auf eine mögli-che Verbindung mit der in der globalen Tomo-graphie gefundenen Plumestruktur im unterenMantel unter Mitteleuropa.
Hierzu wird ein erheblich erweiterter P-Wellendatensatz mit mehr als 12000 Lauf-zeitmessungen in einem iterativen Verfah-ren invertiert, wobei die verbesserte Strahl-überdeckung eine gute Auflösung des re-sultierenden Modells bis jenseits der Über-gangszone erlaubt. Die Ergebnisse der P-Wellentomographie werden in Temperaturan-omalien umgerechnet und geodynamisch in-terpretiert.
Webseite: http://www.geo.physik.uni-goettingen.de/ eifel
318 Abstracts
SLP19Stäbler, S., Martin, M., Wenzel, F. (Karlsruhe), Calixto Group
Teleseismische S - Wellen Tomographie Südost RumäniensE-Mail: [email protected]
Im Rahmen des Sonderforschungsbereichs461: Starkbeben: ’Von Geowissenschaftli-chen Grundlagen zu Ingenieurmassnahmen’wurde 1999 das Tomographieexperiment CA-LIXTO (Carpathian Arc LItosphere X - TO-mographie) im Südosten Rumäniens durchge-führt.Ein Ziel des Feldexperiments mit etwa 110mobilen seismischen Messstationen war es,ein hochaufgelöstes Geschwindigkeitsabbilddes oberen Erdmantels dieser Region zu erhal-ten. Dort treten in einem lokal eng begrenztenVolumen von etwa 20 km x 50 km x 100 kmGröße zwischen 70 und ca. 180 km Tiefe re-gelmäßig Erdbeben auf. In der vorgestelltenArbeit wurden zum ersten Mal die S - Pha-sen teleseismischer Beben aus dem CALIX-TO - Experiment dazu verwendet, ein Modellfür die Scherwellengeschwindigkeit im obe-ren Erdmantel für diese seismisch sehr aktiveRegion zu erstellen.Scherwellen können aufgrund ihrer höherenSensitivität gegenüber thermischen Anomali-en und eventuell im Untergrund vorhande-nen Schmelzen, im Vergleich zu Untersuchun-gen mit Kompressionswellen, einen wichtigenBeitrag zum Verständnis des Untergrundes lie-fern.Als erstes Verfahren hin zu einem hochaufge-lösten S - Wellen Modell wurde die ACH -Methode nach Aki et al. (1977) angewandt.Insgesamt umfasst der CALIXTO Datensatz453 teleseismische Fernbeben mit einer Ma-gnitude ≥ 5.0. Die Aufzeichnungen aller Be-ben wurden auf die Qualität ihrer S - Wel-len Einsätze hin untersucht. Die Datenaus-
wertung erfolgte im rotierten Strahlkoordina-tensystem (L,Q,T). Aufgrund der verschiede-nen Stationstypen wurden alle Aufzeichnun-gen restituiert und mit einem Simulationsfil-ter (T=15s) überarbeitet. Der sich daraus er-gebende Datensatz umfasst 35 Erdbeben, mitinsgesamt 1883 Laufzeitresiduen (1247 - S,636 SKS - Phasen).Erste Untersuchungen der Anisotropie zeigenkeine signifikante Richtungsabhängigkeit, dieoberhalb der sonstigen Unsicherheiten, wiez.B. durch die Laufzeitbestimmungen selbst,liegen. Deswegen war es möglich, jeweils diebesten Aufzeichnungen der T- und Q - Kom-ponente gemeinsam zu invertieren.Die ersten Inversionsergebnisse der Scherwel-len - Laufzeiten zeigen analog zu denen der P- Wellen einen Bereich erhöhter seismischerGeschwindigkeiten unterhalb der Vrancea -Zone. Bei einem Vergleich der Ergebnissebeider Wellentypen ist allerdings zu beachten,dass die für die Inversion verwendeten Daten-sätze nicht identisch sind. So ist zum Beispielder P - Wellen Datensatz erheblich größer undauch die azimutale Überdeckung vollständigerals bei dem der S - Wellen. Dies führt ins-gesamt zu einer geringeren Auflösung in denS - Wellentomogrammen. Trotzdem lassensich bereits wichtige Informationen aus diesenersten Ergebnissen ableiten. So nimmt zumBeispiel die Amplitude des Hochgeschwin-digkeitskörpers unterhalb der Vrancea - Zo-ne im Tiefenbereich von ca. 100 km ab undzeigt nur noch geringfügig erhöhte Geschwin-digkeitswerte. Dieser Tiefenbereich wurde be-reits aufgrund der dort reduzierter Seismizität
Seismologie – Poster 319
als ’seismische Lücke’ interpretiert.Die Zuverlässigkeit der gewonnenen Ergeb-nisse wurde durch verschiedene Rekonstrukti-onstests mit synthetischen Laufzeitdaten über-prüft.
320 Abstracts
SLP20Böse, M., Wenzel, F. (Karlsruhe)
Konzept eines Erdbeben-Frühwarn-Systems mit Neuronalen NetzenE-Mail: [email protected]
Erdbeben-Frühwarn-Systeme (Early War-ning Systems - EWS) bilden zeitlich be-trachtet die erste Stufe eines Erdbeben-Informationssystems zur Abschätzungen derflächenhaften Verteilung der Bodenbewegun-gen und zur Erstellung realistischer Schadens-szenarien nach einem Erdbeben.
EWS nutzen die Tatsache,dass über Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssysteme (Telemetrie) In-formationen über ein entferntes Erdbebendeutlich schneller übermittelt werden könnenals sich die zerstörerischen seismischenWellen selbst im Untergrund ausbreiten. Derzeitliche Vorsprung beträgt dabei in Abhän-gigkeit von der Hypozentraldistanz einigeSekunden bis zu über eine Minute. DieseZeitspanne ermöglicht die Triggerung undAusführung geeigneter Automatismen zurMinimierung des voraussichlichen Schadensdurch das Beben, wie z.B. das Herunterfahrenvon Großrechnern, das Stoppen von Zügenoder die Unterbrechung von Gasleitungen.
Für die Vorhersage charakteristischer Grö-ßen der Bodenbewegungen wie Intensität,peak ground acceleration (PGA) oder spek-trale Werte der Bodengeschwindigkeit oderBodenbeschleunigung werden bislang entwe-der empirische lineare/nichtlineare Beziehun-gen zwischen gemessenen und vorhergesagtenDaten verwendet, die aus Regressionsanaly-sen von Aufzeichnungen vergangener Stark-beben gewonnen werden, oder die oben ge-nannten Parameter werden mit der zu bestim-menden Magnitude und dem Hypozentrumdes Bebens sowie vorhandenen Abklingrela-
tionen geschätzt. Eine alternative Methodezur Vorhersage unter Verwendung neurona-ler Netze wird hier vorgestellt. Dabei wer-den in einem ersten Schritt die Starkbeben-parameter am Ort der Registrierung aus denersten Sekunden der Aufzeichnung prognos-tiziert. In einem zweiten Schritt werden ausdem anfänglichen Datenfluss mehrerer Statio-nen die Bodenbewegungen an entfernten Or-ten geschätzt.
Ein Frühwarn-System muss der stetigen Zu-nahme an Informationen über das Erdbebenmit fortschreitender Zeit nach dem erfolg-ten Bruch gerecht werden. Damit ist eineden eingehenden Datenströmen entsprechen-de kontinuierliche Anpassung der Vorherge-sage über die Untergrundsbewegungen ver-bunden. Eine vielversprechende Architekturder neuronalen Netze zur Realisierung einesErdbeben-Frühwarn-Systems stellen die sog.Time-Delay-Neural-Networks dar, die im Be-reich der automatischen Spracherkennung be-reits grosse Erfolge erzielt haben.
Die für den Trainingsprozess der neu-ronalen Netze erforderlichen Datensätzewerden zunächst synthetisch (stochastischePunktquellen-Methode, Beresnev und Atkin-son, 1997) erzeugt. Verwerfungsgeometrienund Lokationen der seismischen Stationenfür die Simulation der Bodenbeschleuni-gungen entsprechen bekannten Störungenim Marmara-Meer bzw. dem kürzlich umIstanbul errichteten EWS-Stationsnetz.
Seismologie – Poster 321
SLP21Hock, S. (Leoben), Korn, M. (Leipzig), Busche, H. (Hannover)
Statistische Interpretation teleseismischer Laufzeitbeobachtungen entlang des TOR-ProfilsE-Mail: [email protected]
Eine Möglichkeit, Informationen über diestatistischen Parameter eines Zufallsmediumszu erhalten, ist die Interpretation von Laufzeit-fluktuationen. Zwischen der Autokorrelati-onsfunktion (AKF) der auf einem Profil beob-achteten Laufzeitfluktuationen und der AKFder Slownessfluktuationen besteht nach Mül-ler et al. (1992) und Roth (1996) ein strahlen-seismischer Zusammenhang. Diese Metho-de wurde auf Laufzeitbeobachtungen der P-Welle vom passiven teleseismischen Experi-ment TOR (TOR Working Group 1999) ange-wandt zur Bestimmung der seismischen Streu-parameter Korrelationslänge a und RMS-Ge-schwindigkeitsfluktuation σ in der Lithosphä-re. Dafür werden Daten von Beben verwendet,deren Backazimuth ungefähr der Profilrich-tung gegen geographisch Nord (≈30◦) ent-spricht.
Betrachtet man die Laufzeitfluktuatio-nen bezüglich dem 1D-ReferenzerdmodellIASP91, so sind klar zwei unterschiedlicheNiveaus erkennbar. Diese passen genau zurgeologischen Struktur im Meßstreifen, der dasnördliche Segment der Transeuropäischen-Sutur-Zone quert, welche die phanerozoischenund proterozoischen Provinzen Nord- undMitteleuropas trennt. Daher werden dieDaten im weiteren getrennt nach den beidenGebieten Baltischer Schild (BS) und Nord-deutsches Becken/Rhenoherzynikum (NR)analysiert. Das deterministische Referenzmo-dell wird schrittweise verfeinert, um zu sehen,inwieweit sich die ermittelten statistischenParameter dabei ändern.
Um σ aus der AKF der Laufzeitfluktuatio-nen zu bestimmen, müssen Annahmen überden Typ des Zufallsmediums, die Hinter-grundgeschwindigkeit der Streuschicht undden Laufweg durch die Streuschicht gemachtwerden. Zur Abschätzung des Laufweges Ldurch die Streuschicht werden die Ergebnissevon Hock et al. (2000) aus teleseismischen P-Koda-Untersuchungen verwendet. Für BS er-gibt sich damit L≈45 km und für NR L≈100km. Für die P-Wellengeschwindigkeit wird6.5 km/s für BS und 7.65 km/s für NR ange-nommen. Die Werte für σ unterscheiden sichhier nur geringfügig hinsichtlich eines Gauß-schen oder eines exponentiellen Zufallsmedi-ums. Zuerst werden die Laufzeitfluktuatio-nen bezüglich dem IASP91-Modell interpre-tiert. Hieraus ergeben sich für BS a≈35 kmund σ≈2 % und für NR a≈30 km und σ≈3 %.Korrigiert man den Einfluß der Krustenstruk-tur werden die Korrelationslängen etwas klei-ner und die RMS-Geschwindigkeitsfluktuati-on etwas gößer. Berücksichtigt man das Er-gebnis der Tomographie, so erhält man a≈15km, σ≈1.6 % für BS und a≈13 km, σ≈1.7%. D.h. die Streuparameter sind in beidenGebieten nahezu gleich, lediglich die Streu-schichtmächtigkeit ist unterschiedlich, wäh-rend sich das Streuverhalten bezüglich dem1D-Referenzmodell stärker in den beiden Ge-bieten voneinander unterscheidet.
Prinzipiell läst sich feststellen, daß mit die-sen Daten nur eine grobe Abtastung der AKFbedingt durch den Stationsabstand erfolgt, d.h.man sieht nur große Strukturen, was bedeuten
322 Abstracts
könnte, daß man eventuell nur den langwelli-gen Anteil der Heterogenitäten erkennt. DieKorrelationslängen liegen je nach Referenz-modell in der Größenordnung des Stationsab-standes oder etwas darunter. Wir schließendaraus, daß sich diese Methode zur Erfassungder kleinräumigen das Wellenfeld streuendeHeterogenitäten mittels teleseismischer Lauf-zeitbeobachtungen nicht so eignet im Gegen-satz zu Untersuchungen der teleseismischenP-Koda (z.B. Hock et al., 2000).
LiteraturHock, S., Korn, M. and TOR Working Group,2000. Random heterogeneity of the lithos-phere across the Trans-European Suture Zone,Geophys. J. Int., 141, 57-70.
Müller, Roth, M., Korn, M., 1992. Seismic-wave traveltimes in random media, Geophys.J. Int., 110, 29-41.
Roth, M., 1996: Laufzeitem seismischerWellen in Zufallsmedien, Dissertation, In-stitut für Meteorologie und Geophysik, Jo-hann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurtam Main.
TOR Working Group 1999. Important Fin-dings Expected From Europe’s Largest Seis-mic Array, EOS, 80, 1, 6.
Seismologie – Poster 323
SLP22Martin, M., Ritter, J.R.R., Oth, A. (Karlsruhe), CALIXTO Group
Vergleich der 1D und 3D Krustenkorrekturen für teleseismische LaufzeitdatenE-Mail: [email protected]
Teleseismische Laufzeiten und ihre Resi-duen werden häufig als Eingabedaten für dieseismische Tomographie benutzt. Diese Me-thode hat aufgrund der ungünstigen Durch-strahlung i.a. allerdings nur eine schlechteAuflösung in der Kruste, wenn der Stations-abstand grösser als 2-5 km ist. Deshalb istes bei Untersuchungen von Mantelstrukturennotwendig, störende Laufzeiteffekte aus derKruste zu entfernen. Vor allem bei einer sehrheterogenen Krustenstruktur wird die Auflö-sung unterhalb der Moho sonst beeinträchtigt.Eine Möglichkeit der Korrektur ist die direk-te Berechnung der krustal verursachten Lauf-zeitresiduen, wenn man die entsprechendenStrukturen kennt. Je nach Dichte und Güteder Information kann man die Laufzeiteffek-te mehr oder weniger genau bestimmen.
Anhand der bekannten Strukturen des Ge-bietes unter der Vrancea Region in Rumänienwird versucht, die bekannten Krustenanoma-lien für den CALIXTO-Datensatz zu berech-nen. Das Krustenmodell enthält die bekann-ten Sedimentbecken und den Karpatenbo-gen, sowie die unterschiedlichen durchschnitt-lichen Strukturen der dortigen Lithosphären-blöcke (Moesische Platte, Tisia-Dacia-Blockund Osteuropäische Plattform). Es werdendie krustalen Laufzeitresiduen relativ zumIASP91 Modell mit einem schnellen 1D Ray-tracer und einem aufwendigeren 3D FiniteDifferenzen Algorithmus berechnet und diejeweiligen Ergebnisse miteinander verglichen.
324 Abstracts
SLP23Gestermann, N., Henger, M., Hunfeld, U. (Hannover, BGR)
Aufbau eines Erdbeben Informationssystems für DeutschlandE-Mail: [email protected]
Im Zusammenhang mit dem Vorhaben“Deutsches Forschungsnetz Naturkatastro-phen” sieht ein Teilprojekt die Errichtungeines Informationssystems für Erdbeben inDeutschland und benachbarten Gebieten vor.Das System soll mit hoher Zuverlässigkeitseismische Ereignisse automatisch erfassen,auswerten, eine Abschätzung über möglicheSchäden vornehmen und die Informationeninteressierten Institutionen zur Verfügungstellen. Um die Kosten in einem vertretbarenRahmen zu halten, sind insgesamt nur siebenausgesuchte seismische Stationen für dieErfassung der Seismizität vorgesehen. Zweineue Stationen wurden im Norden und in derMitte Deutschlands errichtet, da in diesenGebieten keine geeigneten Stationen zurVerfügung standen, die den Anforderungengerecht werden. Desweiteren werden Datendes GERESS Array im Bayerischen Wald undeinige Stationen des deutschen regionalenBreitbandnetzes GRSN benutzt.
In dem stillgelegten Bergwerk Niedersach-sen Riedel der Kali und Salz AG nordöstlichvon Hannover wurde in einer Tiefe von 355m eine der neuen Breitbandstationen errichtet.Der Unruhepegel dieser Station weist ähnlichgünstige Werte auf wie bei den besten GRSNStationen. Für das Erdbeben Informationssys-tem hat diese Station dadurch eine bedeutendeRolle im norddeutschen Raum. Eine weitereneue Station wurde im Bergwerk Unterbreiz-bach in der Nähe von Bad Hersfeld errichtet.Vorangegangene Unruhemessungen an meh-reren Standorten in diesem Gebiet haben erge-ben, dass der Standort in diesem Bergwerk am
besten geeignet ist. Der Pegel der seismischenBodenunruhe ist im Frequenzbereich von 1 Hzbis 4 Hz mit der sehr guten Station BFO ver-gleichbar bei einer geringen Anzahl von Stö-rungen.
Die seismischen Wellenformdaten werdenin “nahezu Echtzeit” von den Stationen zurDatenzentrale in Hannover übertragen, so dassdie kurzfristige Bereitstellung der wichtigstenHerdparameter von Erdbeben und eine vorläu-fige Schadensprognose möglich ist. Das da-bei benutzte CD-1 Protokoll für kontinuierli-che Daten ermöglicht die parallele Übertra-gung alter und neuer Daten nach einer Unter-brechung der Datenverbindung. Durch diesesVerfahren stehen sofort wieder aktuelle Datenfür die Auswertung bereit.
Um trotz der geringen Anzahl von Sta-tionen sicherzustellen, dass die Zielvorgabenim Hinblick auf die Zuverlässigkeit und diemöglichst schnelle Auswertung der Daten er-füllt werden, ist ein höherer Aufwand bei derVerarbeitung der Daten notwendig. Mit derEntwicklung verbesserter Verfahren bei derPhasenidentifikation und der Einführung vonKonsistenzprüfungen zur Bewertung der Aus-werteergebnisse, konnten gute Ergebnisse er-zielt werden. Über verschiedene Medien wiemobile Telefone, E-mail und WWW-Serverwerden sie Interessierten zur Verfügung ge-stellt.
Seismologie – Poster 325
SLP24Meidow, H. (Köln)
Realistische Umrechnungsfaktoren zwischen Komponenten und Resultierenden im Sinneder KTA 2201.1E-Mail: [email protected]
In den gültigen sicherheitstechnischen Re-geln des KTA zur Auslegung von Kernkraft-werken gegen seismische Einwirkungen fin-det sich in Teil 1: Grundsätze (KTA 2201.1)der Hinweis, dass man bei der Festlegung desBemessungserdbebens unter der Maximalbe-schleunigung „den Maximalwert der Resultie-renden der Horizontalbeschleunigungskom-ponenten in der Starkbewegungsphase desErdbebenzeitverlaufs (Amplitudenwert)“ zuverstehen hat.
Auf welche Art und Weise diese Resul-tierende zu bestimmen ist ist nicht festge-legt. Vielfach wird derzeit zunächst die mitt-lere oder die maximale Horizontalbeschleu-nigungskomponente mit Hilfe von geeignetenVerfahren bestimmt, und anschließend, sofernerforderlich, in den Maximalwert der resultie-renden Horizontalbeschleunigung umgerech-net. Als Umrechnungsfaktor wird häufig pau-schal ein Wert von F = 1,41 angesetzt. Dabeiwird davon ausgegangen, dass die Anregungin den zwei senkrecht zueinander stehendenhorizontalen Komponenten zeitgleich mit demjeweiligen Spitzenwert der Bodenbeschleuni-gung erfolgt.
In der Regel tritt die Spitzenbeschleunigungin den registrierten Erdbebenzeitverläufen derbeiden horizontalen Komponenten aber zu un-terschiedlichen Zeitpunkten auf. Es ist da-her angebracht einen geeigneteren realisti-schen Umrechnungsfaktor direkt aus regis-trierten Zeitverläufen abzuleiten.
Die Zeitverläufe der Bodenschwinggrößenvon herdnah registrierten Erdbeben werden
an den jeweiligen Erdbebenmessstationen nor-malerweise in drei senkrecht zueinander ste-henden Komponenten aufgezeichnet. Üb-licherweise in den horizontalen RichtungenNord-Süd und Ost-West sowie Vertikal. Dieresultierende horizontale Bodenschwinggrößekann durch einfache Vektoraddition aus denhorizontalen Komponenten ermittelt werden.Das Verhältnis zwischen den Maximalwer-ten der Resultierenden und den Komponentenkann als realistischer Umrechnungsfaktor her-angezogen werden.
In der Abb. 1 ist als Beispiel der an derErdbebenmessstation TGA in den beiden hori-zontalen Komponenten registrierte Zeitverlaufdes Erdbebens von Roermond 1992 darge-stellt. In der N-S-Komponente wurde währendder Starkbebenphase ein Maximalwert von a= 310 mm/s2 und in der O-W-Komponenteein Maximalwert von a = 264 mm/s2 aufge-zeichnet. Die mittlere horizontale Komponen-te betrug demnach a = 287 mm/s2. Der Ma-ximalwert der Resultierenden (Abb. 1) betruga = 364 mm/s2. Das Verhätltnis zwischen Re-sultierender und mittlerer Komponente ergibthier einen Umrechnungsfaktor von F = 1,27.
Mit der European Strong-Motion-Databasevon Ambraseys et al. (2000) steht inzwi-schen eine umfangreiche Zusammenstellungvon herdnah registrierten Erdbebenzeitverläu-fen zur Verfügung die es ermöglicht die Aus-wertung auf eine breite und belastbare Daten-basis zu stellen. Insgesamt wurden 1052 ge-eignete Erdbebenzeitverläufe aus dieser Da-tenbank entsprechend der erläuterten Methode
326 Abstracts
Abbildung 1: Seismogramm der Bodenbeschleunigung beim Erdbeben von Roermond am 13.April 1992. Registriert durch die Messstation TGA bei Bergheim in 55 km Herdentfernung.Aufgezeichnet sind die horizontalen Komponenten und die horizontale Resultierende. Ausdem Verhältnis zwischen dem mittleren Maximalwert der beiden Komponenten zu dem Maxi-malwert der Resultierenden ergibt sich ein Umrechnungsfaktor von F = 1,27.
ausgewertet.Als realistischer Umrechnungsfaktor zwi-
schen der mittleren horizontalen Komponen-te und der Resultierenden im Sinne der KTA2201.1 (1990) ergibt sich ein Wert von F =1,23 und zwischen der maximalen horizonta-len Komponente und der Resultierenden einWert von F = 1,08.
Seismologie – Poster 327
SLP25Knapmeyer, M. (Münster)
Syntaxdiagramme für die Raumwellen-Nomenklatur, mit Erweiterungen für andere ter-restrische PlanetenE-Mail: [email protected]
In den siebziger Jahren des 20. Jahrhundertswurde durch die von den Apollo–Astronautenauf dem Mond aufgebauten Seismometer dieinterplanetare Seismologie eingeläutet. DieViking-Missionen zum Mars brachten eben-falls Seismometer auf einen anderen Planeten.In den nächsten Jahrzehnten ist mit weiterenseismologischen Missionen zum Mond, zumMars und vielleicht zu anderen Planeten undMonden des Sonnensystems zu rechnen. Eswäre zweckmässig, hierfür eine Software zurBerechnung von Laufzeitkurven in beliebigenPlaneten zur Verfügung zu haben, d.h. eine,bei der sich Geschwindigkeitsmodelle leichtwechseln lassen und die an die strukturellenUnterschiede zwischen den Planeten bereitsangepasst ist.
Für solch ein Programm ist es wünschens-wert, dass es anhand der Bezeichnung derzu berechnenden Phase automatisch erkennenkann, ob es sich überhaupt um eine physi-kalisch sinnvolle Phase handelt und aus wel-chen Ästen sich der Strahlweg zusammen-setzt, um jederzeit beliebige Laufzeiten be-rechnen zu können. Dazu ist es erforderlich,schematische Syntaxregeln für die Phasen-Nomenklatur zu formulieren.
Eine Standardmethode zur Beschreibungder Syntax von Programmiersprachen sindSyntaxdiagramme. Diese funktionieren wieein Eisenbahnnetz: man bewegt sich ent-lang vorgegebener Strecken mit definierterFahrtrichtung von Bahnhof zu Bahnhof undsammelt an jeder Station Zeichen (P, S, c,K, etc.) ein, die aneinandergehängt einen
gültigen Phasennamen ergeben. Durch ei-ne geeignete Repräsentation des Syntaxdia-gramms in einer Datenstruktur ist es für einComputerprogramm umgekehrt möglich fest-zustellen, ob einer gegebene Zeichenfolge einWeg durch das Syntaxdiagramm entspricht,die Zeichenfolge also gültig ist.
Da bei anderen Planeten damit zu rechnenist, dass ihre innere Struktur sich in vielenDetails von derjenigen der Erde unterschei-det, müssen einige neue Bezeichnungen ein-geführt werden. Die Tiefenlage der Olivin-Phasentransformationen beispielsweise hängtvom Druck und damit von Schwerkraft undPlanetenradius ab. Die auf der Erde üblicheVerwendung der mittleren Tiefen (410, 520,660km) als Bezeichnung für die seismischenDiskontinuitäten wäre hier ebenso irreführendwie die Verwendung anderer Zahlen, derenWert ja erst noch bestimmt werden muss.
Damit nicht genug: Khan & Mosegaard(2001) präsentieren Ergebnisse einer Monte–Carlo–Inversion der Geschwindigkeits–Tiefen–Struktur des Erdmonds, welche imgesamten Mond von Null verschiedene S-Wellen–Geschwindigkeiten und damit alsoauch einen festen Kern zulassen. Vom Jupiter-mond Europa wird angenommen, dass er vonEis- und Wasser-Schichten von zusammen ca.150km Mächtigkeit umgeben ist (z.B. Sohlet al., 2002). Da der Ozean Europas globalist und seine Tiefe eine deutliche Separierungvon P-Wellen und SP-Konversionen vonMeeresgrund und Eisgrenze ermöglicht,sollten hierfür von Anfang an eindeutige
328 Abstracts
Phasenbezeichnungen verwendet werden, umnicht etwa den Begriff „Moho“ zu verwässern.
In den gezeigten Syntaxdiagrammen wer-den daher folgende neue Bezeichnungen vor-geschlagen:
αβ – bezeichnet den Beginn des Phasen-übergangs von α-Olivin zu β–Olivin (entspre-chend der „410“ der Erde)
βγ – bezeichnet den Abschluss des Phasen-übergangs von β-Olivin zu γ–Olivin (entspre-chend der „520“ der Erde)
γ – bezeichnet das Ende der Übergangszo-ne, wo γ-Olivin durch Perovskit und Magne-towüstit ersetzt wird (die „660“ der Erde)
o – (von Ocean) bezeichnet den Boden glo-baler Ozeane wie auf Europa
e – (von Eis) bezeichnet den Boden globalerEiskrusten wie auf Europa
[XXX] – Zeichenfolge in eckigen Klam-mern um unvorhergesehene Diskontinuitätenzu bezeichnen, z.B. „P[EisVI]S“
C – (von Core) bezeichnet S-Wellen in fes-ten äusseren Kernen oder festen einschaligenKernen, wie z.B. auf dem Erdmond möglich.
Um z.B. PS-Konversion bei Reflexion oderTransmission an einer Grenzfläche anzuzei-gen, werden ein „+“ (Reflexion von aussen),ein „–“ (Reflexion von innen) oder kein Zei-chen (Transmission) an die Bezeichnung derGrenzfläche anghängt.
Damit wäre z.B. „PeS“eine bei Transmissi-on durch Unterkante der Eiskruste von P zuS konvertierte Phase oder „PCP“ eine als S-Welle durch einen festen Kern gelaufene P-Welle. Die Bezeichnung „Po+S“ meint einephysikalisch nicht mögliche P–zu–S Konver-sion bei Reflexion von oben am Ozeanbodenund kann schon anhand der Syntaxregeln vomProgramm zurückgewiesen werden, ohne eineeinzige Berechnung auszuführen.
Sohl, F.; Spohn, T.; Breuer, D.; Nagel, K.(2002): Implications from Galileo Observati-
ons on the Interior Structure and Chemistry ofthe Galilean Satellites; Icarus, vol. 157, 104-119
Khan, A.; Mosegaard, K. (2001): New In-formation on the Deep Lunar Interior from anInversion of Lunar Free Oscillation Periods;GRL, vol. 28, No. 9, 1791-1794
Seismologie – Poster 329
SLP26Metz, T., Igel, H. (München)
Modellierung seismischer Wellenausbreitung: Herleitung und Implementierung von op-timalen Finite Differenzen Operatoren für die elastische WellengleichungE-Mail: [email protected]
Wir zeigen die Herleitung und Implemen-tierung von Finite Differenzen Operatoren, diespeziell für die seismische Wellengleichungoptimiert wurden. Anstatt die Fehler derdiskreten Differentialoperatoren in Raum undZeit einzeln zu verbessern, werden Operatorenabgeleitet, bei welchen sich der Fehler der Lö-sung der elastischen Wellengleichung in derKombination der Operatoren heraushebt. DasVerfahren basiert auf Arbeiten von Geller &Takeuchi (1995) zur allgemeinen Ableitungder Operatoren, und führt auf FD Schematadie teilweise schon von Korn (1987) benutztwurden. Während gängige Verfahren meistdie Spannungs-, Geschwindigkeitsformulie-rung der Bewegungsgleichung in Kombinati-on mit gestaffelten Gittern benutzen, stellenwir Operatoren für die zweiten Ableitungen inRaum und Zeit auf. Und lösen direkt die Ver-schiebungsgleichungen. Wir gehen von ein-fachen Taylor-Operatoren aus, und veränderndiese in geeigneter Weise. Dabei untersu-chen wir den bei Einbau aller Ableitungsope-ratoren in die Wellengleichung resultierendenFehlerterm. Ziel ist es, diesen so zu verän-dern, daß die Wellengleichung selbst als Fak-tor darin auftritt. In diesem Fall verschwindetder Fehlerterm bis zu einer weiteren Ordnungfür lokale Lösungen der homogenen Wellen-gleichung, aus denen sich letztendlich die Ge-samtlösung zusammensetzt. Zur Evaluationder Methode wurden die erzielten Ergebnis-se sowohl mit analytischen Lösungen als auchmit Ergebnissen von Rechnungen mit anderenVerfahren bzw. Operatoren verglichen. Wir
zeigen Ergebnisse dieses Vergleichs und dieDetails der Ableitung der Operatoren und diedabei verwendeten Techniken.Webseite: http://www.geophysik.uni-muenchen.de
330 Abstracts
SLP27Treml, M.W., Jahnke, G. (München), Nissen-Meyer, T. (Princton NJ), Igel, H. (München), Gar-nero, E. (Tempe, Arizona)
A Hybrid Finite-Difference Method for Global Wave PropagationE-Mail: [email protected]
Calculation of global wave propagation us-ing numerical methods is undergoing a fastprogress due to dynamically growing compu-tation power. However, to achieve high fre-quencies in full 3D for arbitrary models, hy-brid approaches are necessary. In this studywe combine finite-difference based solutionsto the elastic wave equation in spherical co-ordinates in the axisymmetric approximationand the complete 3D solution for sphericalsections. Wave propagation is initiated in theaxisymmetric code with sources centered onthe symmetry axis. Thus a high-frequencyteleseismic wavefield with correct 3D geo-metrical spreading (but 2D computational do-main) can be used as an input (boundary con-dition) to a spherical section at (e.g. large)distance from the source. The directly scat-tered wavefield from any structures inside the3D block can be studied. This approach en-ables the simulation of scattering effects aboveplumes or subduction zones from teleseismicwavefields. The advantage of this method is,that it avoids some drawbacks of the individ-ual methods. The axisymmetric method suf-fers from the restriction that either the sourceor the desired mantle structure must have theform of a ring due to the axisymmetry. Byplacing a regional 3D domain at the place ofthe desired structure it is possible to modelthe structure as extended but local deviation ofa background model (PREM). Moreover, thescattered waves can be observed in full 3D. Onthe other hand, a pure 3D-FD method wouldrequire a large amount of memory if one wants
to model the global wavefield at large dis-tances, thus limiting the frequency range ofthe calculation. We will present the combi-nation of these methods to a hybrid method indetail and show examples of results for a man-tle plume in PREM.
Web page: http://www.geophysik.uni-muenchen.de
Seismologie – Poster 331
SLP28Ceranna, L. (Hannover), Meier, T. (Bochum)
Ein hybrider Ansatz zur Modellierung von Grundmoden in lateral heterogenen MedienE-Mail: [email protected]
Die Ausbreitung von Love- und Rayleigh-grundmode wird stark von lateral heterogenenStrukturen beeinflußt. Um dies im Rahmen ei-ner numerischen Studie genauer zu untersu-chen, bedienen wir uns eines hybriden Mo-dellierungsansatzes. Unser hybrides Verfah-ren zeichnet sich durch eine Zweiteilung deszugrundeliegenden Geschwindigkeitsmodellsentlang des Laufweges zwischen der Quelleund den Empfängern mit konstantem Azimutin einen lateral homogenen (1-D) und einen la-teral heterogenen (2-D) Anteil aus. Die Er-zeugung der Love- und Rayleighgrundmodefür eine Punktquelle unter Berücksichtigungder Abstrahlcharakteristik sowie die Berech-nung ihrer Ausbreitung erfolgt dabei inner-halb des 1-D Modells mit Hilfe der WKBJ-Approximation. Das WKBJ-Wellenfeld dientim weiteren Verlauf als tiefenabhängige zeitli-che Quellfunktion, die in das 2-D numerischeModell entlang der lateralen Grenzfläche, wel-che der Quelle am nächsten liegt, überführtwird. Um die Wellenausbreitung in dem la-teral heterogenen Medium zu berechnen, ver-wenden wir die Chebyshev Pseudospektral-Methode, die zur Lösung der Bewegungsglei-chung in Kugelkoordinanten dient. Insgesamterlaubt uns dieser hybride Modellierungsan-satz eine Reduzierung der Rechenzeit um denFaktor 50 bis 100 im Vergleich zu einer aus-schließlichen spektralen Simulation. Somitsind wir in der Lage, den Einfluß verschie-denster lateraler Heterogenitäten in der Krusteund dem oberen Mantel unterhalb eines Stati-onsnetzwerkes auf die Ausbreitung der beidenGrundmoden zu untersuchen.
Um die Leistungsfähigkeit unseres Ansat-zes zu demonstrieren, zeigen wir beispiel-haft einige Ergebnisse für die Ausbreitungder Grundmoden entlang eines passiven Kon-tinentalrandes. Die Breite der Übergangszo-ne zwischen ozeanischer und kontinentaler Li-thosphäre wird dabei variiert: Zum einen wirdein scharfer Übergang betrachtet, zum andereneine auf einer Breite von 2o geglättete latera-le Heterogenität. Im Fall der scharfen Über-gangszone treten Reflexionen der Grundmo-den auf, während diese bei dem glatten Über-gang nicht beobachtet werden. Hingegen zei-gen die transmittierten Wellenfelder für bei-de Modelle kaum Unterschiede. Jedoch wirdbei dem Vergleich zum lateral homogenen Fall(keine Übergangszone) deutlich, daß im trans-mittierten Wellenfeld durch die laterale Hete-rogenität höhere Moden erzeugt werden.
332 Abstracts
SLP29Patzig, R., Gajewski, D. (Hamburg)
Lokalisierung von Beben in der Umgebung eines BohrlochsE-Mail: [email protected]
Während industrielle Geophysik (insbeson-dere die Rohstoffexploration) die aktive Seis-mik (Aufnahme eines selbsterzeugten Schal-limpulses) routinemäßig nutzte, hatten Seis-mologie (Beobachtung von Erdbeben) und in-dustrielle Geophysik über lange Zeit nur we-nige Berührungspunkte. In den 80er Jahrenbegann jedoch die systematische Beobachtungvon seismischen Ereignissen, die bei der Roh-stofförderung auftreten. Beobachtbare seis-mische Ereignisse entstehen aber in bestimm-ten Fällen auch durch Injektion von Wasserins Gestein, wodurch Gesteinsbrüche ausge-löst werden. Die systematische Beobachtungsolcher Ereignisse fand bereits in der Mitteder 70er Jahre statt und markiert den Anfangder Industrieseismologie, in welcher passiveSeismologie und industrielle Geophysik ver-einigt sind. Zuerst diente die Brucherzeu-gung mittels Flüssigkeitsinjektion (Hydrofrac-turing) jeweils der Erzeugung eines Heißwas-serkreislaufs zur Energie- und Wärmegewin-nung. Anschließend wurde Hydrofracturing inÖl- und Gas-Lagerstätten genutzt, um mittelsGesteinsbrüchen die Förderung zu erhöhen.
Da solche seismischen Ereignisse nur ge-ringe Magnituden aufweisen, ist es notwendigdie Geophone in der Tiefe zu installieren, inder die Injektion stattfindet - dies sind in derPraxis 2 Kilometer und mehr. Oft steht dannnur ein Bohrloch zur Verfügung und die Geo-phone müssen in einer Kette verlegt werden,was eine sehr ungünstige Konfiguration dar-stellt (Einlochkonfiguration). Darüberhinauskönnen aus Kostengründen nur wenige Geo-phone in dieser Tiefe installiert werden. Diese
Geophonaufstellung stellt eine besondere Her-ausforderung an die Lokalisierung der Ereig-nisse dar.
Zur Untersuchung der Lokalisierungsun-genauigkeit von seismischen Ereignissen beieiner Einlochkonfiguration (sowie zum seis-moakustischen Monitoring in der Praxis),wurde ein Lokalisierungsprogramm entwi-ckelt. Das Lokalisierungsprogramm kann, ne-ben der Einsatzzeit, auch den Azimuth zur Lo-kalisierung verwenden. Mit dieser Informati-on wird die Lokalisierungsungenauigkeit beiMessung mit einer hinreichend ausgedehntenGeophonkette erheblich verbessert. Weiterhinerlaubt das Lokalisierungsprogramm die Lo-kalisierung in inhomogenen und in anisotro-pen Medien, wie Salzstöcken oder Erdöllager-stätten.
Die Lokalisierungsungenauigkeit wurdemittels einer Monte-Carlo Simulation unter-sucht. Gezeigt werden einige Beispiele fürden Ortungsfehlerbereich in der Abhängigkeitvon der Geophonanzahl bei gleichlangenGeophonketten. Näherungsweise führt dabeieine Vervierfachung der Geophonanzahl zurHalbierung der Lokalisierungsungenauigkeit.
Diese Arbeit ist Teil des DGMK-Projektes„Tight Gas Reservoirs - Erdgas für die Zu-kunft“.
Webseite:
http://www.dgmk.de/upstream/abstracts/projects/593-3.html
Seismologie – Poster 333
SLP30 – Seismologie Uhr ·Stange, St. (Freiburg, LGRB), Stoll, D. (Tübingen, Lennartz electronic)
LE-3D als kurzperiodisches Bohrlochseismometer: neue Möglichkeiten zur Standort-wahl einer ErdbebenstationE-Mail: [email protected]
Die aktuelle Generation seismologischerDatenlogger bietet eine Vielzahl von Zugriffs-möglichkeiten für die aufgezeichneten Daten.Internet-basierende Verbindungs- und Über-tragungstechniken gewinnen immer mehr anBedeutung und erschließen neue Möglichkei-ten für die zeitnahe und unbeschränkte Ver-öffentlichung. Allerdings steht der umfang-reichen Nutzung einer schnellen und zugleichpreiswerten Anbindung (z.B. DSL) in denmeisten Fällen die Tatsache entgegen, dassdort, wo die entsprechende Infrastruktur vor-handen ist, die Registrierungsbedingungen fürseismologische Signale zu schlecht sind.
In der neuen Erdbebennorm E-DIN4149(2002) liegt Tübingen in derErdbebenzone 3 nur wenige Kilometer nörd-lich der Bebenherde von 1911, 1943 und1978 bei Albstadt/Zollernalbkreis. Unteranderem wegen der ungünstigen Noisebedin-gungen im Stadtgebiet von Tübingen wurdedie traditionsreiche, seit 1933 betriebeneErdbebenstation TUB 1971 geschlossen.Der zunehmende Verkehrs- und Industielärmmacht dort auch heute noch eine kurzperiodi-sche Erdbebenregistrierung an der Oberflächeweitgehend wertlos. Lennartz electronic ließdeshalb auf dem Werksgelände in Tübingenein Bohrloch bis auf 100m unter Geländeabteufen. Ein Gammalog wurde gefahrenund bestätigte, dass unter ca. 10m quartärenTalschottern der Gipskeuper angetroffenwurde und das Bohrlochtiefste im Grundgips(Keuper) steht. Der Muschelkalk - aus seis-mologischer Sicht noch interessanter - würde
vermutlich erst ab 130m Teufe vorliegen.In die Bohrung wurde die Bohrlochversi-
on des LE-3D-Seismometers eingebaut. Ob-wohl eine Edelstahl-Verrohrung gewählt wur-de und daher im Prinzip eine azimutale Ori-entierung mit einem Kompass möglich gewe-sen wäre, wurden stattdessen zwei allgemein(auch im Fall einer Verrohrung aus norma-lem Stahl) anwendbare Verfahren bevorzugt.Da am gleichen Standort zu Vergleichszwe-cken ein Seismometer an der Oberfläche in-stalliert ist, konnte die azimutale Abweichungdes Bohrlochsensors durch vergleichende Po-larisationsanalyse an S-Einsätzen einiger Er-eignisse recht genau bestimmt werden. Un-abhängig von der parallelen Registrierung ander Oberfläche ist die Bestimmung des Azi-muts durch Verwendung einer von Lennartzentwickelten Gyroskop-Sonde möglich, wo-bei an Stelle eines mechanischen Kreiselsein auf dem Sagnac-Effekt basierendes Laser-Ringgyroskop ohne bewegte Teile zum Ein-satz kommt.
Erste Registrierungen zeigten bereits einendurchschlagenden Erfolg: Das Dreikompo-nentenseismometer in 100m Tiefe erzielte ge-genüber der Oberflächenstation eine erhebli-che Verbesserung der Daten: frequenzabhän-gig wurden bis zu 40dB im Signal-Störabstandgewonnen.
Die Daten sind damit für die Zweckedes Erdbebendienstes für Baden-Württemberg(LED) brauchbar und werden in die automa-tische, echtzeitnahe Routineauswertung miteinbezogen. Als Abtastrate wurden 80 Hz
334 Abstracts
gewählt (wie beim Regionalnetz). Der Da-tenlogger vom Typ M24 Compact/LP ist perDSL mit dynamischer IP-Adresse ans Inter-net angebunden und kann unter http://m24.homeunix.net erreicht werden. Die M24stellt die Daten über eine web-basierte Ober-fläche sowohl grafisch als auch zum Down-load zur Verfügung. Für die automatische Ein-bindung in die LED-Auswertung wurde einzusätzlicher AutoDRM-ähnlicher Zugang (oh-ne interaktive Elemente) bereitgestellt.
Dem LED steht damit eine technisch gleich-wertige Seismometerstation zur Ergänzungdes landesweiten Überwachungsnetzes zurVerfügung. Insbesondere die schnelle undproblemlose Verfügbarkeit von echtzeitnahenDaten aus dem engeren Bereich des Herdge-bietes Zollernalb ist hier von großem Interes-se.
Webseite: http://m24.homeunix.net
336 Abstracts
SM01 – Do., 27.2., 09:30-09:50 Uhr · HS2Shapiro, S.A. (FU Berlin, Fachrichtung Geophysik), Kaselow, A. (Fu Berlin, FachrichtungGeophysik), Wenzel, F. (Univ. Karlsruhe, Geophysikalisches Institut), Kern, H. (Univ. Kiel,Institut für Geowissenschaften)
On the pressure dependent elasticity of fractured and porous rocksE-Mail: [email protected]
Stress dependences of seismic velocities areimportant for interpretation of very differentseismic data, ranging from AVO and veloc-ity analysis to overpressure prediction and 4Dseismic monitoring of reservoirs. Usually, thedependence of seismic velocities on the differ-ential stress is phenomenologically describedby the following simple relation:
V (P) = A+KP−Bexp(−PD), (1)
where P = Pc −Pp is the differential stress, Pcis the confining pressure, Pp is the pore pres-sure, and A, K, B, and D are fitting parameters.Note, that here we understand the differentialstress a different quantity than the differencebetween the maximal and minimal principalstresses, as often defined in rock mechanics.Under several, quite natural assumptions thisstress dependences of the seismic velocitieson the differential stress can be interpreted interms of a different closing behavior of twodifferent types of porosities, a stiff and a com-pliant porosity. Following this approach for-mulations can be derived for all elastic prop-erties and all velocities of rocks, relating themdirectly to the differential stress in terms ofwell known and new rock physical properties.This leads to a physical explanation of the fit-ting parameters A, K, B, and D.
It is very well known that in the reflectionseismic frequency range the Gassmann for-mula describes well the seismic velocities offluid saturated porous rocks. All parameters ofGassmann’s formula depend to some extend
on the confining or fluid pressure. However,the parameters most sensitive to differentialstress are the bulk modulus of the dry matrixKdry and the porosity φ. Since Kdry obviouslydepends on φ one has to establish a physicaland stress dependent relation between both pa-rameters.
Our considerations are based on the sepa-ration of the total porosity into two parts, aa compliant porosity φC, supported by thincracks and grain contacts vicinities and a stiffporosity supported by more or less isometricpores.
Following this assumption we show howany elastic modulus and any velocity is de-fined by rock physical equations of the formof eqn. 1, in the isotropic as well as in theanisotropic case. We obtain a new rock phys-ical parameter θC, which controls the stressdependence of elastic parameters of porousand fractured rocks. We suggest to call it thepiezosensitivity. One of our most remarkableresults is that the argument of the exponentialterm in eqn. 1 (the parameter D) is constant forall elastic parameter as well as for all veloci-ties of a certain rock.
In a similar manner one can also derive cor-responding equations for arbitrary anisotropicrocks. Even in the anisotropic case the param-eter D is constant for all elastic parameters andvelocities in all directions.
The piezosensitivity approach was appliedto a set of 10 laboratory data of anisotropicrocks from the KTB pilot hole each consist-
Seismik und seismische Methoden 337
ing of three P- and six S-wave velocity mea-surements. All velocities were fitted in atwo step non-linear fitting processes using theLevenberg-Marquardt algorithm. Our resultsare in good agreement with the theoreticallypredicted universality of the fitting parameterD.
338 Abstracts
SM02 – Do., 27.2., 09:50-10:10 Uhr · HS2Müller, T.M. (Department of Exploration Geophysics, Curtin University of Technology, Perth,Australia), Shapiro, S.A., Sick, C.M.A. (Freie Universität Berlin, Germany)
A hybrid scattering Q model for randomly layered structures with finite lateral extentE-Mail: [email protected]
We propose a scattering Q model that isapplicable in quasi 1-D random media, i.e.,randomly layered structures with finite lat-eral extent. Such structures can be oftenfound in nature. The new hybrid Q modelis based on a superposition of the approxi-mations for the scattering attenuation coeffi-cients in 1-D random media calculated withinthe O’Doherty-Anstey (ODA) approach and in3-D spatially anisotropic random media calcu-lated within the Rytov approximation, whichaccounts for random diffraction and refrac-tion. It is well-known that the diffraction andrefraction of waves at randomly distributed in-homogeneities results in a random focusingand defocusing of wave energy and conse-quently results in an increase of the amplitudefluctuations with increasing propagation dis-tance (Rytov et al., 1989). Shapiro and Kneib(1993) showed that the variance of the log-amplitude fluctuations, σ2
χ, which can be seenas an accumulative measure of scattering at-tenuation, is directly related to the coefficientof scattering attenuation of a plane wave, α,via the relation α =
σ2χ
L . Here L denotes thetravel distance. Hence the key to the descrip-tion of attenuation due to random diffractionand refraction is the computation of the log-amplitude variance.
For a 3-D anisotropic Gaussian correlatedrandom medium, the log-amplitude variancecan be approximately calculated by (see e.g.
Müller and Shapiro, 2002):
σ2χ ≈ σ2
n
√π
4a||a⊥
k3a3⊥D
[1− arctan(2D)
2D
],
(1)where σ2
n is the variance of the velocity fluc-tuations of the medium, k is the wave num-ber and a|| and a⊥ are the correlation distancesparallel and transverse to the direction of wavepropagation, respectively. D is the so-calledwave parameter which is defined as
D =2Lka2
||. (2)
In the case a⊥= a||, equation (1) exactly coin-cide with the formulation for the isotropic case(e.g. Müller et al., 2002). Therefore, the ratioγ =
a||a⊥ additionally controls the log-amplitude
variance in anisotropic random media. It isimportant to note that equation (1) is restrictedby σ2
nγ La⊥ (ka⊥)2 < 1 and it is also limited by
the high frequency restriction ka|| > 1.But typically, the wavelength of seismic
waves exceeds the correlation length that isassociated with the thin layering. In thiscase, the solely use of approximation (1) doesnot produce reliable results because the con-straint ka|| > 1 is violated. On the other hand,the exclusive application of the 1-D Q−1-estimate results in an underestimation of scat-tering attenuation while the transverse corre-lation length a⊥ is finite. To overcome theserestrictions one should look for a combinationof both attenuation estimates. The simplestway to combine the above mentioned approxi-
Seismik und seismische Methoden 339
mations is the linear combination of the atten-uation coefficients, or equivalently, the Q−1-estimates. Hence a hybrid quality factor esti-mate can be constructed in the form
Q−1 = Q−11D +Q−1
3D. (3)
In equation (3), Q−11D denotes the estimate for
1-D random media given by (for details we re-fer to Shapiro and Hubral, 1999))
α1D = k2∫ ∞
0drBa(r)cos2kr, (4)
where Ba(r) is the velocity correlation func-tion, and Q−1
3D can be computed via equation
(1) and the relation Q−1 =2σ2
χkL . Thus, the
evaluation of scattering attenuation accordingto formula (3) is then based on the corre-lation scales parallel and transverse to thepropagation direction, the strength of theinhomogeneities, the propagation distanceand the frequency. Figure 1 shows that neitherthe ODA nor the 2-D Rytov approach approxi-mates the numerically obtained log-amplitudevariances. However, the superposition of bothapproximations yields a reasonable agreementwith the seismic experiment.
Figure 1: Log-amplitude variance as a func-tion of travel distance for a numerical experi-ment
References
Müller, T.M., and Shapiro, S.A., 2002,Amplitude fluctuations due to diffractionand refraction in anisotropic random media:Implications for seismic scattering attenuationestimates: Geophys. J. Int., submitted.
Müller, T.M., Shapiro, S.A., and Sick,C.M.A., 2002, Most probable ballistic wavesin random media: A weak-fluctuation ap-proximation and numerical results: WavesRandom Media, 12, 223-246.
O’Doherty, R.F., and Anstey, N.A., 1971,Reflections on amplitudes: GeophysicalProspecting, 19, 430-458.
Rytov, S.M., Kravtzov, Y.A., and Tatarskii,V.I., 1989b, Wave propagation throughrandom media: Volume 4 of Principles ofstatistical radiophysics: Springer Verlag,Heidelberg.
Shapiro, S.A., and Hubral, P., 1999, Elasticwaves in random media: Springer Verlag,Heidelberg.
Shapiro, S.A., and Kneib, G., 1993, Seis-mic attenuation by scattering: Theory andnumerical results: Geophys. J. Int., 114,373-391.
Web page: http://userpage.fu-berlin.de/ seis/
340 Abstracts
SM03 – Do., 27.2., 10:10-10:30 Uhr · HS2Große, C., Kurz, J.H., Finck, F. (Stuttgart, IWB)
Seismologische Inversionsmethoden für die Schallemissionsanalyse in der Materialprü-fungE-Mail: [email protected]
Die klassische Schallemissionsanalyse(SEA), bei der aus den Schallemissionssi-gnalen einzelne Parameter wie z. B. dieWellenamplitude, die Anstiegszeit des Signalsoder die Signaldauer extrahiert werden, istin den vergangenen Jahren an die Grenzenihrer Leistungsfähigkeit gekommen. Diesliegt unter anderem an der mangelndenTransparenz der Registrierung und Auswer-tung und damit verbunden an der schlechtenKontrollmöglichkeit der Ergebnisse. Bei derklassischen Anwendung werden die Einzelsi-gnale nicht aufgezeichnet; eine nachträglicheUnterscheidung, ob die Parameter aus Schal-lemissionssignalen der Materialschädigungoder von Störsignalen gewonnen wurden istso unmöglich.
Am Institut für Werkstoffe im Bauwesenwerden seit etwa zehn Jahren erfolgreich Me-thoden aus der Seismologie auf Problemstel-lungen in der Materialprüfung übertragen, dieauf der Auswertung der Wellenformen der Si-gnale beruhen und so eine quantitative Ana-lyse ermöglichen. Voraussetzung ist die Auf-zeichnung der Signalformen mit möglichstvielen Sensoren. Zwar entstehen dadurchNachteile, da eine enorme Datenmenge regis-triert und bearbeitet werden muß. Allerdingserlauben diese Verfahren eine bessere Kon-trolle der Ergebnisse und eine weitergehendeAuswertung. Die relative Momententensorin-version verwendet Verfahren der Clusterana-lyse, um die Greenschen Funktionen des Me-diums (also die Einflüsse des Laufwegs aufdas Signal) sowie die Übertragungsfunktio-
nen der Sensoren zu eliminieren. Vorausset-zung dafür sind SE–Daten von eng benachbar-ten Ereignissen – und somit eine genaue 3D–Lokalisierung der SE–Quellen, die mit demProgramm HYPOAE (ein Hypo66–Derivat)durchgeführt wurde. Weiterhin ist die Auf-zeichnung der Schallemissionen mit mindes-tens sechs Aufnehmern notwendig, um diesechs unabhängigen Komponenten des Ten-sors bestimmen zu können. Werden mehr Sen-soren verwendet, ist eine statistische Auswer-tung der Daten möglich. Um die Analyse sinn-voll durchführen zu können, sind Cluster mitnicht weniger als vier Ereignissen notwendig,deren Abstand voneinander deutlich kleinerals der Abstand zum Empfänger sein muss.
Die Anwendung dieser Verfahren erlaubtanalog zur Seismologie die Bestimmung derGröße und Orientierung der Bruchflächen so-wie die Klassifizierung des Bruchtyps (z.B. ob es sich um einen Scher– oder Öff-nungsbruch handelt) und der Bruchenergie.Diese Daten können wertvolle Informationenüber die bruchmechanischen Eigenschaftenvon Werkstoffen liefern, die zum Beispiel fürdie Materialoptimierung, die Qualitätssiche-rung oder das Bauteilmonitoring eingesetztwerden. Besonders wertvoll ist der Vergleichdieser detaillierten Daten aus Experimentenmit Finite–Element–Modellierungen, was zueinem tieferen Verständnis des Schädigungs-verlaufs im Bauteil führen kann. Verschiede-ne Forschungsarbeiten betreffen zur Zeit vorallem Werkstoffe aus Beton sowie Faserver-bundwerkstoffe, die im Rahmen eines Sonder-
Seismik und seismische Methoden 341
forschungsbereichs untersucht werden.
Referenzen:C. Große, H.–W. Reinhardt, T. Dahm: Locali-zation and Classification of Fracture Types inConcrete with Quantitative Acoustic Emissi-on Measurement Techniques. NDT&E Intern.30, 4 (1997), pp. 223–230.C. Große, B. Weiler, H.–W. Reinhardt: Relati-ve moment tensor inversion applied to concre-te fracture tests. J. of Acoustic Emission, 14,3-4 (1997), pp. S64-S87.C. Große, H.-W. Reinhardt, F. Finck: Signal–based acoustic emission techniques in civil en-gineering. J. of Mat. In Civ. Eng. (2002). (inprint)C. Großße: Basics of Acoustic Emission Mea-surement Techniques. In: „Nondestructivetesting and evaluation methods for infrastruc-ture condition assessment“ (Ed. S. Wooh),Chapter 9, Kluwer Academic Publishers, Hin-gham, MA (2002), 45 p. (in print)R. C. Hidalgo, C. Große, F. Kun, H.–W. Rein-hardt, H. Herrmann: Evolution of percolatingforce chains in compressed granular media.Phys. Rev. Let. 89 (2002), No. 20, pp.205501–1 – 205501–4.
Webseite: http://iwb.uni-stuttgart.de/grosse/grosse.htm
342 Abstracts
SM04 – Do., 27.2., 11:00-11:20 Uhr · HS2Kurz, J.H., Finck, F., Große, C. (Stuttgart, IWB)
Wavelets and Time Series Analysis - an Example for Acoustic EmissionsE-Mail: [email protected]
Wavelets and Time Series Analysis - an Ex-ample for Acoustic Emissions:Introduction:The fourier transformation is able to revealthe frequencies present in a signal. But itis not possible to say when they are present.This is the starting point for the wavelet trans-formation. Using the wavelet transformationa time-scale joint representation is possiblewhere scale is proportional to frequency. Thatmeans, wavelet analysis is the breaking up ofa signal into shifted and scaled versions of theoriginal wavelet. The basic methods used forsignal decomposition in wavelet analysis arethe discrete and the continuous analysis.Thewavelet transform
C(a,b) =∫R
s(t)1√a
ψ(
t −ba
)dt
can be defined over the entire real axis (con-tinuous transform) or over a range of integers
Figure 1: Original signal (top) and wavelet fil-tered signal (bottom).
(discrete transform). Here C(a,b) are the dif-ferent wavelet coefficients, a is the scale, b isthe translation s(t) is the signal, t stands fortime and ψ is the wavelet function.That meansthe wavelet function is scaled and shiftedalong the axis and therefore the signal, too.This time-scale joint decomposition structuremakes wavelet analysis interesting for time se-ries analysis [3].Application on time series:Wavelets offer a variety of possible applica-tions on time series. De-noising is possiblythe most popular practice of wavelets on data.Acoustic emission data e.g. from concretenormally contains a lot of noise mainly causedby the testing apparatus and the surrounding.This makes the onset detection really difficult.Due to the testing process itself a low frequentsignal also caused by the testing apparatus of-ten superimposes the acoustic emission signaladditionally. Instead of classical filter tech-niques wavelet analysis is used as a bandpass
Figure 2: Original signal (top) and de-noisedsignal (bottom).
Seismik und seismische Methoden 343
filter. After decomposing the signal the extrac-tion of low frequency parts is a simple proce-dure.The rate of acoustic emissions during an ex-periment depends on the material and the test-ing programm. Often several thousand acous-tic emissions during a 30 minutes testing pro-gramm are normal. The acoustic emission oc-currence is comparable to swarm earthquakes.In both cases several thousand events happenin a short time span and in both cases theevents are clustered [5, 1]. Due to the largenumber of events an automatic onset detec-tion algorithm was developed. The use ofthis algorithm requires filtered and de-noiseddata. Therefore, all steps discussed until noware used for our acoustic emissions as a stan-dard data processing routine. Beside thesewell tested procedures there are several otherwavelet time series analysis methods that areonly tested rudimentarily. One example is theuse of so called scalegrams which measure thevariance of the wavelet coefficients as a func-tion of the time scale [4]. Another field ofapplication is the detection of self similaritiesand long term evolution processes [2].Some results:The wavelet filter technique is easy to handlebecause it is obvious from a glance at the co-efficients which one contains the signals lowfrequency part. For the wavelet decomposi-tion a biorthogonal wavelet of the order 3.7was used (Fig.1). The comparison of the orig-inal and the filtered signal shows that the lowfrequency part resulting from the testing pro-cedure is completely extracted. The remainingsignal contains now still some noise which isgenerally not of any periodic structure.De-noising is quite similar to the wavelet fil-tering. After revealing the coefficients whichcontain the noise it is possible to extract thenoise by thresholds. Again a biorthogonal
wavelet of the order 3.5 and individual thresh-olds were used (Fig.2). The onset detection atthe de-nosed signal is easier than at the origi-nal signal. That makes the use of an automaticpicking algorithm possible. Furthermore, thediscussed filter techniques and de-noising pro-cedures are used in an automatic algorithm onour acoustic emission data.References:[1] Finck, F., Motz, M., Grosse, C., ReinhardtH.-W., Kröplin, B., 2002: Integrated Interpre-tation and visualization of a Pull-out test Us-ing Finite Element Modelling and quantitativeAcoustic Emission Analysis. NDT.net Vol. 7No. 9.[2] Misiti, M. Misiti, Y. Oppenheim, G.,Poggi, J.-M., 2000: Wavelet Toolbox User’sGuide. The MathWorks, Inc.[3] Percival, D.B., Walden, A.T., 2000:Wavelet Methods for Time Series Analy-sis.Cambridge University Press.[4] Scargle, J.D., Steiman-Cameron, T.Y.,Young, K., Donoho, D.L., Crutchfield, J.P.,Imamura, J. 1993: The Quasi-Periodic Os-cillations and Very Low Frequency Noise ofScorpius X-1 as Transient Chaos: A DrippingHandrail?, Astrophysical Journal 411 , L91-L94.[5] Spicak, A., Horalek, J., 2001: Possi-ble role of fluids in the process of earth-quake swarm generation in the West Bo-hemia/Vogtland seismoactice region, Tectono-physics 336, 151-161.
344 Abstracts
SM05 – Do., 27.2., 11:20-11:40 Uhr · HS2Kravtsov, Yu. A., Kaslilar, A., Shapiro, S. A., Buske, S., Müller, T. (Freie Universität Berlin)
Estimates of elastic medium statistical parameters from traveltime of refracted wavesE-Mail: [email protected]
The random inhomogeneities which arepresent in rocks effect both the traveltime andamplitude of seismic waves. The effects ofrandom inhomogeneities depend on their sta-tistical properties. Therefore measurements offluctuations of traveltimes and amplitudes ofseismic waves serve as a power instrument forstudying statistical parameters of random me-dia. Statistical characteristics of rocks het-erogeneities became an important subject inseismics because of several reasons. Statisti-cal properties of heterogeneities are necessaryfor estimating uncertainities of seismic im-ages, especially in the case of heterogeneitiesbeyond the seismic resolution. In addition,if the statistics of small scale heterogeneitiesare known, its influence on seismic ampli-tudes can be compensated. Moreover statisti-cal properties of heterogeneities can be used inthe seismic inversion combined with geosta-tistical approaches, like it is being done quiteoften in the characterization of hydrocarbonreservoirs. Finally, statistics of heterogeneitymight be a new rock characteristic (a new seis-mic attribute) useful for making a bridge be-tween seismic and lithological rocks descrip-tions.
Detailed analysis of traveltime statistics ofreflected seismic waves was performed re-cently by Touati (1996), Iooss (1998), Ioosset.al. (2000), Gaerets et.al. (2001) andKravtsov et.al. (2002) on the basis of Geo-metrical Optics (GO), which is the most devel-oped method in the theory of wave propaga-tion through random media. In this paper GOapproach is applied for analysis of traveltime
fluctuations of the refracted seismic waves.The necessary information in GO method,
applied for random media is presented. Co-variation function for traveltime fluctuationsalong curved rays is derived with special em-phasis to the case of a plane-layered mediumwith a constant gradient of average elasticwave velocity. The basic properties of co-variance function are described for the generalcase of statistically anisotropic (anisomeric)inhomogeneities, and longitudinal and trans-verse correlation lengths for traveltime fluc-tuations are estimated. Theoretical consider-ation is illustrated by the results of numeri-cal simulations. At last, a new procedure forextracting the medium statistical characteris-tics from the single shot measurements is sug-gested.
ReferencesGaerets, D., Galli, A., Ruffo, P., andDella Rossa, E., (2001): Instantaneous veloc-ity field characterization through stacking ve-locity variography. 71th Ann. Internat. Mtg.,Soc. Expl. Geophys.,Expanded Abstracts, 1-4.
Iooss, B., (1998): Seismic reflectiontravel-times in two-dimensional statisticallyanisotropic random media. Geophys. J. Int.,135 999 – 1010.
Iooss, B., Blanc-Benon, P., and Lhuillier,C., (2000): Statistical moments of travel timesat second order in isotropic and anisotropicrandom media. Waves in Random Media, 10381 – 394.
Kravtsov, Y., Muller, T., Shapiro, S. and
Seismik und seismische Methoden 345
Buske, S., (2002): Statistical properties of re-flection travel-times in 3d randomly inhomo-geneous and anisomeric media. submitted toGeophys. J. Int.
Touati, M. (1996): Contribution géostatis-tique au traitment des données géophysique.PhD thesis, Ecole des Mines de Paris.
346 Abstracts
SM06 – Do., 27.2., 11:40-12:00 Uhr · HS2Wegler, U. (Leipzig)
Wellenausbreitung in einer streuenden Schicht über einem homogenen Halbraum: Ver-gleich von Energietransfertheorie und DiffusionsapproximationE-Mail: [email protected]
Die Standardverfahren der Seismik wiez. B. Tomographie und Reflexionsseismik ba-sieren auf der Annahme, dass im Ausbrei-tungsmedium nur Inhomogenitäten vorliegen,die groß im Vergleich zur Wellenlänge sind.Tatsächlich liegen in den meisten Mediumaber zusätzlich auch kleinräumige Störkör-per vor, die mit Standardverfahren nicht er-faßt werden. Als Alternative existiert die sto-chastische Modellierung, in der die kleinräu-migen Heterogenitäten noch durch ihr Leis-tungsspektrum beschrieben werden können,die Phasenlage der Störkörper allerdings ver-loren geht. Im Falle der stochastischen Mo-dellierung wird das Ausbreitungsmedium ge-wöhnlich durch ein stationäres und isotropesZufallsmedium beschrieben. Diese Annahmebedeutet, das sowohl die mittlere Geschwin-digkeit als auch der Streukoeffizient unabhän-gig vom Ort sind. Andererseits ist bekannt,dass in der Realität die Geschwindigkeit mitder Tiefe zunimmt und das bestimmte Regio-nen stärker streuen als andere. Um diese Pro-bleme anzugehen, wird als einfachstes mög-liches Modell eines nicht stationären Zufalls-mediums eine streuende Schicht, die zwischender freien Oberfläche und einem homogenenHalbraum liegt, untersucht. Mögliche Anwen-dungen der Theorie sind die Modellierung vonCoda-Wellen in der streuenden Erdkruste übereinem homogenen Erdmantel oder die Model-lierung eines stark streuenden Vulkangebietesüber einer homogenen Kruste. Die erste un-tersuchte Theorie ist die Energietransferglei-chung, die numerisch mit Hilfe einer Monte-
Carlo-Simulation gelöst werden kann. Im Ver-gleich hierzu wird die Diffusionsapproxima-tion untersucht. Im streuenden Vollraum darfdie Energietransfergleichung durch die Diffu-sionsgleichung ersetzt werden, falls die Quell-Empfänger-Entfernung deutlich größer als diemittlere freie Weglänge ist, d. h. falls Vielfach-streuung vorliegt. In einer streuenden Schichtüber einem homogenen Halbraum kommt alszweite Bedingung hinzu, dass die Schicht-dicke größer als die mittlere freie Weglängesein muss. Das Diffusionsmodell kann analy-tisch gelöst werden und gibt einen explizitenAusdruck für den Wert von Coda-Q. Hierbeizeigt sich, dass Coda-Q aus zwei Anteilen be-steht, nämlich erstens der intrinsischen Dämp-fung und zweitens einem Abstrahlterm, derdie Energieabstrahlung der streuenden Schichtin den homogenen Halbraum beschreibt.
Seismik und seismische Methoden 347
SM07 – Do., 27.2., 12:00-12:20 Uhr · HS2Thoma, H., Klippel, O. (K-UTEC GmbH)
Beitrag der Seismologie zur Erkennung und Abschätzung von Gefährdungsmomentenim SalzbergbauE-Mail: [email protected]
Seit Beginn des Salzbergbaus in Mittel-deutschland Ende des 19. Jahrhunderts kam esimmer wieder zu Deformations– und Bruch-prozessen, die sich in Form von Konturbrü-chen, Gebirgsschlägen bis hin zu Tagesbrü-chen äußerten und damit zu z.T. erheblichenSchäden im Grubengebäude aber auch an Ge-bäuden und Infrastruktur an der Erdoberflä-che führten. Im Folgenden soll die Bedeu-tung sowie die Möglichkeiten eines passi-ven seismischen Monitorings zur Erkennung
Abbildung 1: Ostfeld I
Abbildung 2: Benioff-Kurve
und Abschätzung von Gefährdungsmomentenan Hand ausgewählter Fallbeispiele wie dieÜberwachung der Versatzarbeiten zweier zumTeil gebirgsschlaggefährdeter Carnallititbau-felder dargelegt werden.
Die Abbildung 1 zeigt die Entwicklung derSeismizität eines Carnallititbaufeldes. Be-reits in den letzten Jahren der Produktions-phase wurde eine rasch zunehmende Seis-mizität mit Magnituden einzelner Ereignissevon ML > 1,5 registriert. In Zusammenhangmit geotechnischen Messungen (Hydrofrac–und Deformationsmessungen) wurde für dasBaufeld eine akute Gebirgsschlaggefahr pro-gnostiziert und umgehende Versatzmaßnah-men eingeleitet. Auf der Grundlage der beob-achteten Herdlagenverteilung konnten beson-ders gef?ährdete Gebiete eingegrenzt und ent-sprechende Priorit?äten für den Verwahrungs-prozeß festgelegt werden. Dadurch wurdendie Deformationsprozesse soweit abgebremst,daß bereits während der bis 1996 andauern-den Versatzarbeiten eine merkliche Verringe-rung der seismischen Aktivität zu beobachtenwar.
Neben der Identifikation von Schwächezo-nen allein durch die Herdlagenverteilung bie-tet die seismische Überwachung auch eineGrundlage für eine qualitative Bewertung derablaufenden Deformationsprozesse z.B. überdie Darstellung der kumulativen Spannungs-freisetzung nach Benioff (1951). Abbildung2 zeigt die kumulative Spannungsfreisetzungfür das oben genannte Baufeld (Feld A) sowieein weiteres Carnallititbaufeld (Feld B). Für
348 Abstracts
das Baufeld A läßt sich nach Beendigung derVerwahrungsarbeiten eine anhaltend degressi-ve Entwicklung der seismischen Aktivität unddamit auch eine stabilisierende Wirkung deseingebrachten Versatzes nachweisen. Im Ge-gensatz dazu ist für das Baufeld B dieser Ef-fekt noch nicht nachweisbar. Hier ist sogarin progressiver Trend, d.h. ein sich beschleu-nigendes Deformationsgeschehen zu beobach-ten.
Zusammen mit geotechnischen Methodenbietet die kontinuierliche seismische Überwa-chung ein wirksames Mittel zur Erkennungund Abschätzung von Gefährdungspotentialenim Bergbau, aber auch zur Kontrolle der Wirk-samkeit eingeleiteter Versatzmaßnahmen.
Webseite: http://www.kutec.de
Seismik und seismische Methoden 349
SM08 – Do., 27.2., 12:20-12:40 Uhr · HS2Manthei, G. (Ober-Mörlen, GMuG), Moriya, H. (Tohoku University, Sendai, Japan)
Collapsing Method for Delineation of Structures Inside AE Cloud Associated with Com-pression Test of Salt Rock SpecimenE-Mail: [email protected]
Acoustic emission events from a salt rockspecimen have been analyzed based on themodified collapsing method (after R. Jonesand R. Stewart, 1997), that is an advancedmapping method used for estimation of sub-surface fractures, in order to delineate struc-tures inside the rock specimen. A triaxial com-pression test of a core specimen from Assesalt mine, Germany, was performed, and AEevents were detected by using 12 sensors at-tached at the salt rock specimen. P-waveand S-wave arrival times of approximately53.000 events were automatically picked, andthe modified collapsing method has been ap-plied to AE events after JHD (Joint Hypocen-ter Determination). Using the modified col-lapsing method, the original structure of theevent distribution around each target event isidentified as point, line or plane structure, andthe target event is moved to a new location for
Figure 1: AE source locations determined byJHD.
emphasizing the belonging original structure.A total of 68% of AE events has been judgedas generated from point structures rather thanplane and line structures.
The collapsing method extracted from orig-inal clouded source distributions structuresvery clearly within the rock sample. The col-lapsed events discover a cellular structure witha cell size in the range of some centimeters.However, it seems that the events occur onlyin zones where the cell interfaces are favorablyorientated in the stress field. These events areattributed to intercrystalline cracking at graininterfaces. This type of cracking occurs inrock salt under very slow creep loading abovethe dilatancy boundary. This phenomena is re-sponsible for the generation of microcracks inthe dilatancy zones around underground cavi-ties which can be observed by AE monitoring.
Figure 2: AE source locations determined bymodified collapsing method.
350 Abstracts
SM09 – Do., 27.2., 15:00-15:20 Uhr · HS2Schopper, J. (Clausthal)
Einfluss von Wechselwirkungen Feststoff/Porenfluid auf elastische GesteinseigenschaftenE-Mail: [email protected]
In einer früheren Arbeit des Autors [Schop-per 1991] gelang es, die Gassmann–Theoriedahingehend zu erweitern, dass auch der Ge-rüstmodul theoretisch zugänglich wird undsich auf Matrixmodul und Porosität zurück-führen lässt Gl.1 (siehe unten). Hier gehtein Stukturparameter α ein, der abhängig vonder Netzwerkstruktur des Porenraum/Matrix–Systems ist und für das Model von Voigtnull, für das von Reuss unendlich wird. InVerbindung mit Gln. (3) und (4) lässt sichaus Gl.(1) auch Gl.(2) für den Gesamtmo-dul des vollständig flüssigkeitsgesättigten Ge-steins gewinnen und auf den Porenraummodulzurückführen.
Geht man von der anscheinend vernünftigenAnnahme aus, dass der Matrixmodul gegebenist durch den Modul des kompakten Festma-terials des Gesteins und der Porenraummoduldurch den Modul der sättigenden Flüssigkeit,wie er sich ausserhalb des Gesteins in vitromessen lässt, dann ist das Gleichungssystem(1) bis (4) vollständig bestimmt und lässt sichmittels einer Messung des Gerüstmoduls, Ge-samtmoduls und der Porosität nach dem Ma-trixmodul sowie den Parametern α, und ξ auf-lösen.
Anwendung der Gleichungen auf Claustha-ler Messdaten an etwa 150 Gesteinen liefer-te eine Überraschung: Für die meisten Pro-ben war das Gleichungssystem entweder nurfür physikalisch nicht zulässige Werte der Pa-rameter – z.B. negative α oder ξ >1 – oder nurfür unrealistisch grosse oder kleine Werte vonPorenraum– und Matrixmodul lösbar. D.h.,die obigen Annahmen müssen falsch sein.
An der ersten Annahme hinsichtlich Ma-trixmodul bestanden bereits gewisse Zwei-fel auf Grund der Beobachtungen von Mörig[1992] über eine Erniedrigung des Gerüstmo-duls durch aufgenommene Feuchtigkeit, z.B.allein durch Kapillarkondensation aus feuch-ter Raumluft. Eine Erniedrigung des Matrix-moduls allein reicht aber noch nicht aus, umdie Gleichungen in allen Fällen zu erfüllen. Esist zwingend, gleichzeitig auch von einer Er-höhung des Porenraummoduls auszugehen.
Physikalisch muss man von einer Wech-selwirkung an der inneren Gesteinsoberflächeausgehen, die zu einer elastischen Aufwei-chung der Matrix und einer Verhärtung derPorenflüssigkeit gegenüber dem echten Fest-stoffmodul und dem Modul der freien Poren-flüssigkeit führt.
Die Variationsbereiche beider Grössen sindgegeben durch Gln. (5) und (6). Dabei soll-te man nach dem Prinzip von Actio et Reac-tio einen symmetrischen Verlauf beider Va-riablen ansetzen, so dass die relativen Ände-rungen beider Grössen entgegengesetzt gleichsind. Für die maximale Wechselwirkung ent-sprechen dann die Werte der Variablen demhomogenen Medium (Gl. 9). Für die Wech-selwirkung null gelten Gln (10) und (11).
Wenn der Modul der freien Porenflüssig-keit als extern gemessene Grösse zur Verfü-gung steht und auch der Modul des hochtro-ckenen Gesteins bestimmt wird, ist das Glei-chungssystem (1),(2),(3),(4),(7),(8) lösbar. ImVortrag werden der Lösungsweg in GrobenSchritten dargelegt und Ergebnisse für Matrix-modul, Feststoffmodul, Porenraummodul und
Seismik und seismische Methoden 351
den Strukturparameter mitgeteilt. Die Nutz-barkeit dieser Grössen zur Gesteins– und Po-renfluidbestimmung und die Anwendung aufBohrlochmessungen und möglicherweise seis-mische Daten wird diskutiert.
Mein Dank geht an meine früheren Mitar-beiter und Studenten für die fleissige und nichtimmer ganz einfache experimentelle Daten-gewinnung und deren Verarbeitung; AndreasWeller und der gegenwärtigen ClausthalerArbeitsgruppe für die erfreuliche Zusam-menarbeit; meiner Frau für die liebevolleErduldung eines auch im Ruhestand nochimmer wissenschaftsbesessenen Mannes.
Gleichungen
M f rmMmtx
=1−Φ
1+αΦ(1)
MtotMmtx
=1−ξΦ
1+αξΦ(2)
ξ =1−ζ
1+αζ(3)
ξ =MporMmtx
(4)
Msol ≥ Mmtx ≥ Mpor (5)
M f ld ≤ Mpor ≤ Mmtx (6)M f rmMdry
=MmtxMsol
(7)
MporM f ld
=MsolMmtx
(8)
Mpor = Mmtx = Mtot = 2√
M f ld ∗ 2√
Msol (9)
Mmtx = Msol (10)
Mpor = M f ld (11)
Φ = PorositätM = ρν2 = Gassmann - Modulf rm = Gerüst-
mtx = Matrix-por = Porenraum-sol = Feststoff-tot = Gesamt-dry = Trockengerüst-f ld = Fluid-
Zitate
SCHOPPER [1991]: An Amendment toGassmann’s Theorie. Trans. Europ. Forma-tion Eval. Symp. SPWLA 14(1991).
MÖRIG [1992]. Diss. TU Berlin
352 Abstracts
SM10 – Do., 27.2., 15:20-15:40 Uhr · HS2Küperkoch, L., Bohnhoff, M., Harjes, H.-P. (Bochum)
Source Parameters from Fluid Injection Induced Microearthquakes at the KTBE-Mail: [email protected]
During the long-term fluid injection exper-iment at the KTB in summer 2000, a total of4000 cm of fresh water was injected into thewell head of the 9.1km deep main borehole.Almost 2800 induced microearthquakes weredetected at the borehole seismometer, thatwas placed at 3.872km depth in the nearbypilot borehole (Baisch et. al., 2002). Recordsof the 40-station surface network allowed usto determine 125 stable fault plane solutions(Bohnhoff et. al.,2003). Using radiation pat-terns derived from the fault plane solutions,source spectra were estimated for both surfaceand borhole recordings. The seismic momentMo was determined based on both surfacestation and borehole seismometer recordings,enabling us to get the scaling relation betweenlocal magnitude Ml based on the largerevents that were recorded by stations of theregional network and the moment magnitudeMw (calculated from Mo). Following themethod of Snoke (1978) corner frequencieswere derived for more than 70 events. Usingseismic moment and corner frequency wedetermined the dynamic source parametersstress drop, source radius, average slip at thefault, maximum slip velocity, source durationand radiated seismic energy as well as theirinternal relations. The results are discussedand compared to the results of the 1994-KTBinjection experiment (Büsselberg, 1995).
References:Baisch,S., Bohnhoff,M., Ceranna,L., Tu,Y.,Harjes,H.-P.(2002): Probing the Crustto 9-km Depth:Fluid -Injection Exper-
iments and Induced Seismicity at theKTB Superdeep Drilling Hole,Germany.Bull.Seism.Soc.Am.,Vol.92,No.6,pp.2369-2380.Bohnhoff,M., Baisch,S., Harjes,H.-P.: Faultmechanics and state of stress at mid-crustal depth levels in the vicinity of theKTB(Germany) from induced seismic events.Submitted to J.Geophys.Res.Snoke, J.A.(1987): Stable deter-mination of (Brune) stress drops.Bull.Seism.Soc.Am.,Vol.77,No.2,pp.530-538.
Seismik und seismische Methoden 353
SM11 – Do., 27.2., 15:40-16:00 Uhr · HS2Rothert, E., Shapiro, S.A., Buske, S. (Freie Universität Berlin), Bohnhoff, M. (Ruhr-UniversitätBochum)
Fluid induced microseismicity and 3D-reflectivity at the KTBE-Mail: [email protected]
The attention to microseismic monitoringduring operation of geothermal or hydrocar-bon reservoirs has grown considerably overthe last several years. The observation of mi-croseismicity occurring during borehole fluidinjections or extractions has a large potentialin characterizing rocks in terms of their hy-draulic parameters at locations up to severalkilometers from boreholes. Beyond delineat-ing conductive fracture geometry and inferringfluid-flow paths, microseismic data could po-tentially be used to measure in-situ hydraulicproperties of rocks at interwell scales.
An approach for the interpretation of mi-croseismic data was proposed to provide in-situ estimates of the hydraulic diffusivity char-acterizing a geothermal or hydrocarbon reser-voir on the large spatial scale (on the order of103m). This approach is called ’SeismicityBased Reservoir Characterization’ (SBRC).This method is based on the following mainhypothesis. The propagation of hydraulicallyinduced seismicity is expected to occur mainlydue to the pore pressure relaxation. Thisprocess is described by a diffusional wavein the low-frequency range (so-called Biotslow wave). The method now uses a spatio-temporal analysis of fluid-injection inducedmicroseismicity to reconstruct the tensor ofhydraulic diffusifity and to estimate the tensorof permeability in 3D.
However, processes that can lead to trig-gering of microseismicity are not yet fullyunderstood. The correlation of microseismichypocenters with reflection seismic structural
images can help to better understand the mainprocesses for triggering microseismicity.
Application of SBRC to KTBThe SBRC approach was several times suc-cessfully applied to real data. Recently, fluidinjection induced microseismicity at the KTBsite was analysed by the SBRC method toreconstruct the tensor of permeability at theopen hole section at 9.1 km depth. Using newdata sets created in 2000 we are able to ob-serve indications of the depth-dependency ofhydraulic diffusivity at the KTB for the firsttime.
The analysis of fluid-induced microseismic-ity leads to an estimation of the hydraulic dif-fusivity at the KTB at different depth. Alower value of hydraulic diffusivity was foundin upper parts of the rock compared with thevalues at the open-hole section. Correlationswith structural images [Buske, 1999] were ob-tained. For example, we observe that rock vol-umes characterized by larger diffusivity alsoshow larger reflectivity.
Acknowledgements and ReferencesThis work was supported in part by thesponsors of the Wave Inversion-Technology(WIT) university-consortium project an inpart by the Deutsche Forschungsgemeinschaftthrough grant SH 55/2-1 and SH 55/2-2. Dataof KTB was provided courtesy of H.-P. Harjes(Bochum). We especially want to acknowl-edge the cooperation with the geophysicalresearch group of the Bochum university(Harjes, Bohnhoff, Baisch).
354 Abstracts
• Baisch, S., Bohnhoff, M., Ceranna, L, Tu,Y. and Harjes, H.-P., 2002. Probing thecrust to 9 km depth: Unique fluid injec-tion experiments and induced seismicityat the KTB Superdeep borehole. Submit-ted to Bull. Seism. Soc. Amer.
• Buske, S., 3-D prestack Kirchhoff migra-tion of the ISO89-3D data set, Pure Appl.Geophys., 156, Nos. 1/2, 157-171, 1999.
• Rothert, E., Shapiro, S.A., MicroseismicMonitoring of Borehole Fluid Injections:Data Modeling and Inversion for Hy-draulic Properties of Rocks, Geophysics,2002, in print
• Shapiro, S.A., Rothert E., Rath V. andRindschwentner J., Characterization offluid transport properties of reservoirsusing induced microseismicity, Geo-physics, 2002, vol.67, 212-220.
• Shapiro, S.A., Audigane, P. and Royer,J.-J., Large-scale in situ permeability ten-sor of rocks from induced microseismic-ity, Geophysical Journal International,1999, vol.137, 207-213.
Web page: http://userpage.fu-berlin.de/ seis/people/shapiro/projects/sbrc.html
Seismik und seismische Methoden 355
SM12 – Do., 27.2., 16:30-16:50 Uhr · HS2Stange, St. (LGRB, Freiburg)
Induzierte Mikroerdbeben beim Injektionstest in der Geothermiebohrung Urach-3E-Mail: [email protected]
Zur weiteren Erforschung des Hot DryRock Verfahrens zur Energiegewinnung wur-de im August und September 2002 einvielseitiger Injektionstest in der seit Jah-ren bestehenden Geothermiebohrung Urach-3 (Bad Urach, Lkrs. Reutlingen, Baden-Württemberg) durchgeführt. Begleitend wur-de an fünf Seismometerstationen die indu-zierte Aktivität registriert. Die mit 2kHzabgetasteten 20Hz-Geophone erfassten insge-samt knapp 500 Ereignisse (Baisch et al.,2003). Zusätzlich hatte der Erdbebendienstfür Baden-Württemberg (LED) zwei mobi-le Stationen in weniger als 2km Distanzvon der Bohrung aufgestellt. Die 250Hz-Aufzeichnung der 1Hz-Seismometer erfass-te gut ein Viertel der bekannten Ereignis-se sowie sämtliche verifizierten Steinbruch-sprengungen in der näheren Umgebung. Zielder zusätzlichen Registrierung war vor allemein Abgleich mit den Magnituden des übri-gen LED-Netzes, d.h. eine Fortführung derMagnitudenbestimmung in den Entfernungs-bereich unterhalb 10km Hypozentraldistanz.Die Magnitudenwerte, die in so kurzen Ent-fernungen gemessen werden, sind stark ab-strahlungsabhängig und bedürfen daher einerspeziellen Eichung. Insbesondere wurden Be-ben untersucht, die auch an der Netzwerkstati-on BUCH (St. Johann-Württingen, etwa 6kmsüdlich der Bohrung) und weiter entferntenStationen erfasst wurden.
Die Aufzeichnungen der 1Hz-Seismometergestatten zudem eine bessere Bestimmung desseismischen Momentes über das Spektralpla-teau als die 20Hz-Aufnehmer.
Die Bohrung Urach-3 erreichte eine End-teufe von etwa 4.5km und ist bis unter 3kmverrohrt. Nach Ergebnissen des Überwa-chungsnetzes (Baisch et al., 2003) lag die in-duzierte Seismizität im Tiefenintervall 3.2kmbis 4.4km. Benutzt man diese Ereignisse alsground thruth, können damit die Tiefenbe-stimmungen des LED geeicht und in Abhän-gigkeit von der Stationskonfiguration und demGeschwindigkeitsmodell untersucht werden.
Baisch, S., Weidler, R. und Tenzer, H.:Injektionsinduzierte Seismizität zur Kartie-rung der hydraulischen Ankopplung am Bei-spiel des HDR-Reservoirs Bad Urach. DGG-Jahrestagung, Jena, 2003.
Webseite: http://lgrb.uni-freiburg.de
356 Abstracts
SM13 – Do., 27.2., 16:50-17:10 Uhr · HS2Baisch, S., Weidler, R. (Q-con, Kapellen), Tenzer, H. (Stadtwerke Bad Urach)
Injektionsinduzierte Seismizität zur Kartierung der hydraulischen Ankopplung am Bei-spiel des HDR-Reservoirs Bad UrachE-Mail: [email protected]
Seit den 1970er Jahren wird am StandortBad Urach Forschung im Bereich der tiefenGeothermie betrieben. Im Zentrum der Ak-tivitäten steht die Anfang der 1990er Jahre auf4.4 km vertiefte Forschungsbohrung Urach 3,die zusammen mit einer weiteren, in der Pla-nung befindlichen Bohrung Urach 4 zu ei-nem Hot-Dry-Rock (HDR) Pilotkraftwerk zurStromerzeugnis ausgebaut werden soll. ZurSchaffung von neuen Fließwegen bzw. zurErhöhung der Permeabilität des bestehendenKluftnetzwerks wurde im August 2002 erst-mals eine massive Stimulation an der Boh-rung Urach 3 durchgeführt. Innerhalb ver-schiedener Injektionszyklen wurde Frischwas-ser bzw. Salzsole mit einem Gesamtvolu-men von 5600m3 bei Fließraten bis zu 50l/s in die Bohrung verpresst. Die dabei auf-tretende induzierte Seismizität wurde mit ei-nem lokalen seismischen Netzwerk bestehendaus fünf 3-Komponenten Geophonen in 200-300 Meter tiefen Flachbohrungen beobach-tet. Ergänzend dazu wurden vom Landesamtfür Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg zwei temporäre Oberflächensta-tionen betrieben (Stange, 2003). Währendder ca. 30-tägigen Experimentphase konntenknapp 470 induzierte seismische Ereignisseim Magnitudenbereich von -0.7 bis +1.8 de-tektiert werden. Ungefähr die Hälfte dieserEreignisse wurde mit hervorragendem Signal-Rauschverhältnis aufgezeichnet und konntefür eine Hypozentrenbestimmung verwendetwerden. Die Abbildung 1 zeigt absoluteLokalisierungen der induzierten Seismizität.
Seismische Ereignisse treten im Tiefenbereichzwischen 3.3 km und 4.3 km auf und for-men eine NW-SE streichende Struktur mit ei-ner Ausdehnung von ungefähr 1.5 km. DerSchnittpunkt dieser Struktur mit der BohrungUrach 3 deutet auf ein dominierendes Injekti-onsintervall in 3.9 km Tiefe hin. Ausgehendvon diesem Injektionsintervall zeigt die raum-zeitliche Verteilung der induzierten Seismizi-tät ein systematisches Wachstum des stimu-lierten Reservoirs in nordwestliche und süd-östliche Richtung. Mittels Relativlokalisie-rungen und Verfahren zur Strukturhervorhe-bung (Collapsing, Jones & Stewart, 1997)konnten weitere Feinstrukturen in der räum-lichen Seismizitätsverteilung identifiziert wer-den, u. a. eine im Nordwesten der Boh-rung befindliche aufsteigende Struktur. ZurAbschätzung der hydraulischen Ankopplungder verschiedenen Reservoirbereiche und derdamit verbundenen Bestimmung eines opti-malen Landepunktes für die Bohrung Urach4 wurde neben der räumlichen Hypozentren-verteilung eine weitere Eigenschaft der indu-zierten Seismizität ausgenutzt: Die Beobach-tung von seismischen Ereignissen mit extremhohen Wellenformähnlichkeiten deutet daraufhin, dass auf einzelnen Kluftflächen zeitlichversetzt wiederholte Scherbewegungen statt-gefunden haben (Repeater). Unter der An-nahme, dass diese Ereignisse durch eine Er-höhung des Fluiddrucks auf der Kluftflächeund der damit verbundenen Herabsetzung dereffektiven Normalspannung getriggert wur-den (Baisch & Harjes, 2003), gibt der seis-
Seismik und seismische Methoden 357
Abbildung 1: Hypozentrenverteilung der induzierten Seismizität
misch beobachtete Spannungsabfall direktenAufschluss über den lokalen Fluiddruckan-stieg in der Inter-Ereignis-Zeit einer Repeater-Sequenz. Anschaulich bedeutet dies, dass derwährend eines seismischen Ereignisses um-gesetzte Scherspannungsabfall auf der Kluft-fläche durch nachfolgenden Fluiddruckanstiegkompensiert werden muss, um dieselbe Kluft-fläche wiederholt zu aktivieren. Damit bie-tet sich über die Auswertung von Repeater-Sequenzen ein wichtiges Werkzeug zur Un-tersuchung der in-situ Druckausbreitung undhydraulischen Ankopplung innerhalb der seis-misch aktivierten Bereiche eines Reservoirs.
LiteraturBaisch, S. & Harjes, H.-P., 2003. A mo-
del for fluid injection induced seismicity at theKTB, Germany. Geophys. Jour. Int., in press.Jones, R. & Stewart, R., 1997. A method fordetermining significant structures in a cloud
of earthquakes. J. Geophys. Res., 102 (B4),8245-8254.
Stange, S., 2003. Induzierte Mikroerdbebenbeim Injektionstest der Geothermie BohrungUrach 3. Vorliegender Band.
Webseite: http://www.q-con.de
358 Abstracts
SM14 – Do., 27.2., 17:10-17:30 Uhr · HS2Woyde, M., Lindner, H., Pretzschner, C. (TU Bergakademie Freiberg)
Spannungsinduzierte Scherwellengeschwindigkeit in der bohrlochnahen FormationE-Mail: [email protected]
Zur Unterstützung gezielter Frac–Arbeitenfür die Exploration von tight–gas Lagerstättenwird versucht, mit Hilfe akustischer Meßver-fahren Aussagen zur Spannungsverteilung inder Formation zu erhalten. Dazu ist eine Mo-dellierung der durch Spannungen induziertenScherwellengeschwindigkeiten erforderlich.Die Berechnung der erforderlichen Span-nungsverteilung erfolgt dabei in einer Ebenesenkrecht zur Bohrlochachse um ein ellipti-sches Bohrloch. Als Spannungen greifen zweizueinander senkrechte Außenspannungen SH ,Sh und ein Innendruck pin an. Außenspan-nungen und Scherwellengeschwindigkeitenwerden dabei durch Kopplungskoeffizientenmiteinander verbunden [Tang, 1999].Die spannungsinduzierte Anisotropie bewirkteine Aufspaltung von Scherwellen in einenlangsamen und einen schnellen Anteil mit
Abbildung 1: 2D–Verteilung der Scherwellen-geschwindigkeit vsx(x,y)
den Geschwindigkeiten vsx und vsy. DieScherwellengeschwindigkeiten werden durchdie Hauptspannungen σx und σy beeinflußtund die Welle in x- und y-Richtung polarisiert,während sie sich in z-Richtung fortpflanzt[Mao, 1987]:
v2sx = v2
0x +S‖σx +S⊥σy
v2sy = v2
0y +S⊥σx +S‖σy
S‖ bzw. S⊥ bezeichnen die Kopplung-koeffizienten parallel bzw. senkrecht zurPolarisationsrichtung der Scherwelle; v0x undv0y sind die Scherwellengeschwindigkeitenfür die x- und y-Richtung der Hauptspan-nungen in einer spannungsfreien Formation.Bei isotropen Verhältnissen sind v0x und v0ygleich.Zur Berechnung der 2D-Scherwellen-geschwindigkeiten werden die Spannungen
Abbildung 2: Spannungsinduzierte Scherwel-lengeschwindigkeit vsx(k)‖SH und vsx(k) ⊥SH der Formation
Seismik und seismische Methoden 359
in isotrope (winkelunabhängige) und ani-sotrope (winkelabhängige) Anteile zerlegtund auf jeden Anteil die Gleichung von Maoangewandt. Dabei erfolgt einer Kopplungisotroper und anisotroper Einflüsse (Abb.1).Die Verteilung der Scherwellengeschwin-digkeiten vsx in Abhängigkeit von der Ein-dringtiefe k in die Formation und in Profilenvsx(k) ‖ SH und vsx(k) ⊥ SH mit Kopp-lungskoeffizienten S‖ = 63000m2/s2MPa,S⊥ = 25000m2/s2MPa [Tang,1999] undSpanunngsverhältnis SH = 95MPa, pin = SHzeigt Abb.2. Für einen Kreis ergeben sichdie größten Abweichungen für vs(x,y) in denRichtungen von SH und Sh. Diese werden mitzunehmendem Abstand kleiner und konver-gieren gegen einen gemeinsamen Wert. Dabeifällt die Geschwindigkeit in Richtung derkleineren Außenspannung steiler ab, als siein Richtung der größeren ansteigt. Außerdemwird erkennbar, daß bei einer konstantenAußenspannung und konstantem Innendruckdie Geschwindigkeit mit wachsender zweiterAußenspannung zunimmt.
360 Abstracts
SM15 – Fr., 28.2., 09:30-09:50 Uhr · HS2Gajewski, D., Vanelle, C. (Universität Hamburg)
A Generalized Moveout Relation for 3-D An/Isotropic MediaE-Mail: [email protected]
The normal moveout (NMO) is an impor-tant parameter for time processing like stack-ing or time migration. We apply a gener-alized moveout (GNMO) formula which isvalid for 3-D heterogeneous isotropic andanisotropic media and any wave type. TheGNMO provides the foundation for a unifiedtime processing of reflection data and can beformulated for all shot-receiver geometries,(i.e. common shot or common midpoint).Since it depends on first and second traveltimederivatives (the NMO attributes) the GNMOis expressend in a model independent wayand is therefore applicable to isotropic andanisotropic media. The NMO-attributes leadto important applications since they are re-lated to geometrical spreading, true amplitudemigration weights and Fresnel zones just toname a few. The NMO attributes can be deter-mined from reflection data by special stackingtechniques (e.g., Common Reflection Surfacestack), traveltime picking or from traveltimetables as computed for Kirchhoff type migra-tion.
One possible application of the NMO at-tributes is traveltime interpolation, which hasa high accuracy since it acknowledges the cur-vature of the wavefront. The GNMO not onlyallows to interpolate between receivers butalso shots. This interpolation is particularlyvaluable in Kirchhoff type migration. Here al-most always only coarse gridded traveltimesare stored which are interpolated to the finegrid during migration.
Web page: http://www.agg.dkrz.de
0.2
0.4
0.6
0.8
1D
epth
[km
]
-0.5 0 0.5Distance [km]
-0.5
0
0.5
Distan
ce [k
m]
Without source interpolation
0 0.2 0.4rel. error [%]
0.2
0.4
0.6
0.8
1D
epth
[km
]
-0.5 0Distance [km]
-0.5
0Dist
ance
[km]
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Dep
th [k
m]
-0.5 0Distance [km]
-0.5
0Dist
ance
[km]
With source interpolation, ds=50 m
0 0.2 0.4rel. error [%]
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Dep
th [k
m]
-0.5 0 0.5Distance [km]
-0.5
0
0.5
Distan
ce [k
m]
Figure 1: Isochrones and relative errors be-tween directly computed traveltimes and inter-polated traveltimes for a triclinic model. Theratio between fine and coarse grid points is1:10, where the coarse grid spacing is 100m.
Seismik und seismische Methoden 361
SM16 – Fr., 28.2., 09:50-10:10 Uhr · HS2Vanelle, C., Gajewski, D. (Universität Hamburg)
Amplitude preserving migration in anisotropic media – a traveltime-based strategyE-Mail: [email protected]
Amplitude preserving migration based ona weighted diffraction stack is a task of highcomputational effort. Two major contribu-tions to the costs are the determination of thestacking surface, i.e. generation and storageof large amounts of traveltime data, and thecomputation and storage of the weight func-tions, including, e.g., geometrical spreading.Whereas the demands in CPU time and com-puter storage are already high for isotropicmedia, they become astronomical as soon asanisotropy is considered, since already thetraveltime computation in anisotropic mediarequires a magnitude more in computationaltime. We have suggested (Vanelle and Gajew-ski, 2002a) a traveltime-based method toovercome these problems for isotropic media.In this paper we propose to extend the methodto 3-D media with arbitrary anisotropy.
Our strategy is based on a hyperbolicexpression for the traveltimes. Its coefficients(i.e. slownesses and second-order derivatives)are determined from coarsely-gridded trav-eltime tables. The coefficients are used fortraveltime interpolation (including interpo-lation of complete shots) onto the requiredfine migration grid (Vanelle and Gajewski,2002b). Since second-order derivativesdescribe dynamic wavefield properties, thecoefficients also lead to the computation ofgeometrical spreading (see Figure 1 for anexample), which is a key ingredient to theweight functions for amplitude preservingmigration. Since coarsely-gridded traveltimesare the only input data, and every required
quantity is computed on-the-fly, the methodis very efficient in terms of storage and CPUtime. This indicates its high potential forapplication to amplitude preserving migrationin anisotropic media.
Vanelle, C., and Gajewski, D., 2002a,True Amplitude Migration Weights fromTraveltimes: Pure and Applied Geophysics,159, 1583-1599.
Vanelle, C., and Gajewski, D., 2002b,Second-order Interpolation of Traveltimes:Geophysical Prospecting, 50, 73-83.
Web page: http://www.agg.dkrz.de
Geometrical spreading errors
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
rel.
erro
r [%
]
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Dep
th [k
m]
-0.5 0 0.5Distance [km]
-0.5
0
0.5
Distan
ce [k
m]
Figure 1: Geometrical spreading errors for anelliptical medium, computed from coarsely-gridded traveltimes.
362 Abstracts
SM17 – Fr., 28.2., 10:10-10:30 Uhr · HS2Forbriger, T., Friederich, W. (Frankfurt a.M.)
Flachseismische WellenforminversionE-Mail: [email protected]
Wir modellieren vollständige Seismogram-me, die mit Hammerschlagseismik aufge-zeichnet wurden. Auf diese Weise wirdder volle Informationsgehalt des seismischenWellenfeldes, insbesondere der Oberflächen-wellen genutzt, um ein Modell des Unter-grundes zu erstellen. Erste Erfahrungen mit1D-Inversionen zeigen, dass Q in flachseismi-schen Medien typischerweise kleiner als zehngewählt werden muss. Bei starker Dämpfungist nicht nur die Amplitudenabnahme, sondernauch die Wellenform sehr sensitiv für Q.
Zur Durchführung einer iterativen Wellen-forminversion wird ein Startmodell benötigt,das die Ausbreitungseigenschaften der seis-mischen Wellen bereits in den wesentlichenZügen erklärt. Wir gewinnen dieses durcheine vorangehende Inversion von Frequenz-Langsamkeits-Spektren. Neben der Strukturdes seismischen Mediums muss auch der zeit-liche Verlauf der Anregung aus den Messda-ten bestimmt werden. Der Kraft-Zeit-Verlaufhat einen wesentlichen Einfluss auf die Si-gnalform, da die Zeitkonstante des Ham-merschlags im aufgezeichneten Periodenbandliegt. Zur Modellierung geeignete Impulselassen sich aber mit wenigen Parametern be-schreiben.
Die Inversion der Wellenformen fügt demModell wesentliche Aussagen über die Dämp-fung hinzu und erhärtet die Absolutwerte derseismischen Geschwindigkeiten. In Gegen-wart höherer Moden und unter Nutzung von S-Wellen ist eine tomographische Inversion nur
über die Wellenformen möglich.
Webseite: http://www.geophysik.uni-frankfurt.de/forbrig/shallow_seismics.html
Seismik und seismische Methoden 363
SM18 – Fr., 28.2., 11:00-11:20 Uhr · HS2Goertz, A. (FU Berlin), Müller, Cf. (Uni Kiel), Buske, S. (FU Berlin), Bohlen, Th., Landerer, F.(Uni Kiel), Giese, R. (GFZ Potsdam)
Seismische Abbildungsverfahren für die Vorauserkundung im TunnelbauE-Mail: [email protected]
In diesem Vortrag wird die Theorie unddie Implementierung des seismischen Abbil-dungsverfahrens für das am GFZ entwickelteIntegrierte Seismische Imaging System (ISIS)vorgestellt. Dieses System wird erstmalig zurVorauserkundung des Gebirges im Tunnelvor-trieb des Gotthard-Basistunnels (GBT) einge-setzt. Zur Anwendung kommen hierbei Ver-fahren, die auf dem Prinzip der Kirchhoff-Migration basieren.
Durch die auf den bereits ausgebauten Tun-nel begrenzte und für eine Vorauserkundungungünstige Geometrie der seismischen Mes-sungen entstehen räumliche Mehrdeutigkei-ten. Diese lassen sich beseitigen, wenn die Po-larisation einer einfallenden elastischen Wellemit 3-Komponenten-Empfängern erfaßt wer-den kann (Takahashi, 1995). Dies ermöglichteine dreidimensionale Richtungsbestimmungder einfallenden Welle und damit eine Begren-zung der Migrationsapertur um den Bereichdes stationären Punktes, d.h. des Punktes andem die reflektierte Energie bei der Stapelungkonstruktiv interferiert (siehe Abb. 1). DiesesVerfahren wurde bereits erfolgreich zur Abbil-dung von Diffraktoren angewendet (z. B. Mu-eller, 2000; Duveneck, 2000).
Ein Reflektorelement im zu erkundendenBereich läßt sich dann vollständig abbilden,wenn sich die Empfängerauslage über die ers-ten zwei projizierten Fresnelzonen erstreckt(Schleicher et al., 1997). Die erste Fres-nelzone bestimmt das kinematische Abbilddes Reflektorelements und die zweite Fres-nelzone bestimmt das dynamische Abbild des
Reflektorelements, d.h. die korrekte Abbil-dung der einfallswinkelabhängigen Reflektivi-tät. Gleichzeitig dient die Hinzunahme derzweiten projizierten Fresnelzone zur Dämp-fung von inhärenten Randeffekten der Dif-fraktionsstapelung (Hertweck et al., 2002).Es wird gezeigt, wie sich mit der Kenntnisder projizierten Fresnelzonen die Akquisiti-onsgeometrie im Hinblick auf die Abbildungvon Strukturen im Vorfeld des Tunnelvortriebsoptimieren läßt.
Ist eine Erfassung des Wellenfeldes über dieersten zwei Fresnelzonen gegeben, so kanndie Amplitude des reflektierten Signals kor-rekt wiedergegeben werden, wenn bei derStapelung eine Gewichtsfunktion angewendetwird (Schleicher et al., 1993). Derartige Ge-wichtsfunktionen lassen sich auf den Einfallvon konvertierten Wellen erweitern, soferndas elastische Wellenfeld in seine Anteile anKompressions- und Scherwellen zerlegt wird.Auf diese Art und Weise kann die Matrix vonelastischen Reflexionskoeffizienten eines Re-flektorelements erfaßt werden (Goertz, 2002).Anhand von synthetischen Daten wird gezeigt,in welcher Form sich die Reflexionsampli-tuden eines Reflektorelements bei gegebenenEmpfängerauslagen reproduzieren lassen.
Die Anwendung der elastischen Gewichts-funktionen bei gleichzeitiger Begrenzung derMigrationsapertur auf die ersten beiden Fres-nelzonen führt auf eine physikalisch begrün-dete „Vektormigration“. Mit diesem Ansatzlassen sich zum Einen räumliche Mehrdeu-tigkeiten bei eng begrenzter Apertur auflö-
364 Abstracts
sen, zum Anderen führt dies zu einer signi-fikanten Beschleunigung des Abbildungsver-fahrens, da die Summation auf die optimaleApertur begrenzt wird. Die elastische Am-plitude des gewichteten Migrationsergebnis-ses kann bau- und sicherheitsrelevante Hin-weise auf den Charakter von erfaßten Struk-turen geben.
LiteraturDuveneck, E. (2000): Abbildung von Erz-körpern in VSP-Geometrie. Master’s thesis,Christian-Albrechts-Universität Kiel.
Goertz, A. (2002): True-amplitude mul-ticomponent migration of elastic wavefields.PhD thesis, Univ. Karlsruhe.
Hertweck, T., Jäger, C., Goertz, A., andSchleicher, J. (2002): Aperture effects in2.5-D Kirchhoff migration: a geometrical ap-proach. submitted to Geophysics.
Müller, C. (2000): On the Nature of Scat-tering from Isolated Perturbations in Ela-stic Media and the Consequences for Proces-
Abbildung 1: Schnitt einer 3D-Migration vonPP Reflexionen anhand von synthetischen Da-ten. Das Modell enthielt einen steilstehendenReflektor unterhalb des Tunnels.
sing of Seismic Data. PhD thesis, Christian-Albrechts-Univ. Kiel.
Schleicher, J., Hubral, P., Tygel, M., andJaya, M. (1997): Minimum apertures andFresnel zones in migration and demigration.Geophysics, 62(1):183–194.
Schleicher, J., Tygel, M., and Hubral, P.(1993): 3-D true-amplitude finite-offset mi-gration. Geophysics, 58(8):1112–1126.
Takahashi, T. (1995): Prestack migrationusing arrival angle information. Geophysics,60(1):154 – 163.
Seismik und seismische Methoden 365
SM19 – Fr., 28.2., 11:20-11:40 Uhr · HS2Rabbel, W., Landerer, F. (Universität Kiel), DOBRE Working Groups
Scherwellen-Anisotropie am Donez-BeckenE-Mail: [email protected]
Das DOBRE-Profil ist eine reflexions- undrefraktionsseismische Traverse durch den süd-östlichen Teil des Donez-Beckens in derUkraine. Das DOBRE-Profil wurde im Jah-re 2000 in Kooperation dänischer, deutscher,niederländischer, polnischer und ukrainischerPartner erstellt. Nach einer Extensionsphase,die vom späten Devon bis zum frühen Permdauerte, wurde das Donez-Becken gehobenund schließlich unter Kompression in Kreideund Frühtertiär invertiert. Die Sedimente sindheute noch mehr als 20 km mächtig bei ei-ner Mohotiefe von ca. 40 km. Asymmetrischgegen das Beckenzentrum versetzt findet manin der Unterkruste einen fast 20 km mächti-gen Hochgeschwindigkeitskörper, möglicher-weise basische Intrusiva. Das Becken streichtNW-SE und wird nach Süden vom Uraini-schen Schild, nach Norden vom Voronezh-Massiv begrenzt. Die heutige Richtung derhorizontalen tektonischen Hauptspannung istca. NE gerichtet und durch die Orientierungvon Kaukasus und Karpaten beeinflußt. DasBecken und die angrenzenden Kristallinblö-cke stellen also sowohl in ihrer Struktur alsauch in der Abfolge und Auswirkung der De-formationen heterogene Krusteneinheiten dar.
Vor diesem Hintergrund sollte durch dieAuswertung von Scherwellen, die entlangeiner zum DOBRE-Profil parallelen Geo-phonaufstellung beobachtet wurden, ermitteltwerden, ob die o.g. Deformationsprozes-se eine Signatur in Form von seismischerAnisotropie in der Kruste hinterlassen ha-ben. Falls ja, sollte insbesondere geklärtwerden, welcher Orientierung die Symmetrie-
achsen der Anisotropie haben, ob die Ani-sotropie regional oder mit der Tiefe variiertund ob Ursachen wie Schichtung oder duk-tile Deformation an Hand des Anisotropie-musters erkennbar sind. Tatsächlich wur-de für Sg- und SmS-Einsätze Scherwellen-Doppelbrechung mit Laufzeitverzögerungender gesplitteten Wellen bis 750 ms beobachtet.Eine genauere Inspektion von Laufzeitdiffe-renzen und Polarisationsrichtungen zeigte un-terschiedliche Ausprägungen der Anisotropiein Ober- und Unterkruste sowie in Donez-Becken und Voronezh-Massiv. Die Beobach-tungen sind kompatibel mit einer N110E ge-richteten Symmetrieachse, die ungefähr derStreichrichtung des Beckens und randlicherVerwerfungszonen entspricht. Das Shear-Wave-Splitting der Sg-Phase beträgt in derOberkruste weniger als 0.5%, so daß die Ober-kruste als quasi isotrop angesehen werdenkann. Das Splitting der Moho-Reflexion SmSvariiert mit Ort und Azimut zwischen 0 und2.5% und muß wegen der geringen Anisotro-pie der Oberkruste für die Unterkruste ver-bucht werden. Die S-Wellen-Polarisation deu-tet daraufhin, daß im Voronezh-Massiv Ver-werfungssysteme oder auch das rezente tek-tonische Spannungssystem die Ursache derAnisotropie darstellen. Im Donez-Beckenwird die schwache Anisotropie der Oberkrustewahrscheinlich durch sedimentäre Schichtungbedingt, während in der Unterkruste eine Aus-richtung von Mineralen durch Kriechprozessenahegelegt wird. Das Polarisation ähnelt dabeiden von ultramafischen Mineralen her bekann-ten Mustern.
366 Abstracts
SMP01Kaschwich, T., Gajewski, D. (Insitut für Geophysik, Hamburg)
Laufzeitberechnung in 3-dimensionalen anisotropen MedienE-Mail: [email protected]
Seismische Laufzeiten werden für eineVielzahl von Anwendungen benötigt, wie z.B.die Kirchhoff Migration. Die hier vorgestell-te Technik, das „wavefront-oriented ray tra-cing “, berechnet Laufzeiten in geglätteten 3-dimensionalen anisotropen Modellen. Wel-lenfronten propagieren mit einem konstan-ten Zeitschritt durch das Medium. Nach je-dem Zeitschritt werden die berechneten Grö-ßen, wie z.B. die Laufzeit, auf ein regulä-res 3-dimensionales Gitter interpoliert. ImGegensatz zu isotropen Medien, die durchdie zwei Laméschen Parameter definiert sind,müssen im allgemein anisotropen Fall 21elastische Parameter pro Gitterpunkt bekanntsein. Um diese Größen an jedem beliebi-gen Punkt zu bestimmen, wird die Cardianal-Spline-Interpolation verwendet. Ein we-sentlicher Vorteil bei der Verwendung derCardinal-Spline-Interpolation, im Vergleichzur z.B. Kubischen-Spline-Interpolation, istdie Rechenzeit- und Speicherersparnis. Diehohe Genauigkeit der Methode wird an ei-nem homogenen anisotropen Modell verifi-ziert, da hier exakte Referenz-Laufzeiten zurVerfügung stehen. Der maximale absoluteLaufzeit-Fehler von 0.04 ms liegt in Quellnä-he, da hier die Wellenfrontenkrümmung amgrößten ist. Da keine analytischen Lösungenfür den 3-dimensionalen inhomogenen aniso-tropen Fall existieren, wird hier mit Laufzei-ten, die durch Lösen der Eikonal Gleichungmit finiten Differenzen und Störungsrechnungbestimmt wurden, verglichen.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Tief
e [k
m]
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0X [km]
abs. Laufzeit-Fehler [ms]
0 0.02 0.04
Abbildung 1: 2-dimensionaler Schnitt zeigtdie Verteilung des absoluten Fehler fürdie berechneten Laufzeiten in einem 3-dimensionalen homogenen anisotropen Mo-dell.
Seismik und seismische Methoden – Poster 367
SMP02Saenger, E.H. (FU Berlin), Bohlen, T. (U Kiel)
Anisotropic finite-difference modeling using the rotated staggered gridE-Mail: [email protected]
Numerical modeling of seismic wave prop-agation in realistic (complex) media is an im-portant tool used in earthquake and explo-ration seismology. It has been used to supportinterpretations of field data, to provide syn-thetic data for testing processing techniquesand acquisition parameters, and to improveseismologists’ understanding of seismic wavepropagation. Since the widely used finite-difference (FD) approaches are based on thewave equation without physical approxima-tions, the methods account not only for di-rect waves, primary reflected waves, and mul-tiply reflected waves, but also for surfacewaves, head waves, converted reflected waves,and waves observed in ray-theoretical shadowzones.
Staggered grid FD operators are commonlyapplied to compute the derivatives occurringin the wave equations for elastic, viscoelas-tic, and anisotropic media. However, the stan-dard FD operators cause instabilities when themedium possesses high contrasts in materialproperties. Boundary conditions of the elas-tic wavefield at high contrast discontinuitieshave to be defined explicitely in the FD al-gorithm. Instability problems can be avoidedby using the so-called rotated staggered grid(RSG) technique (Saenger et al., 2000): theboundary conditions at high contrast disconti-nuities are implicitly fulfilled by the distribu-tion of material parameters.
The objective of this paper is the applica-tion of the RSG-technique to the anisotropicelastic wave equation. Many papers reportthat there is a disadvantage in using standard
staggered grids for anisotropic media ofsymmetry lower than orthorhombic. Standardstaggering implies that off-diagonal stressand strain components are not defined at thesame location. When evaluating the stress-strain relation, it is necessary to sum over alinear combination of the elastic constantsmultiplied by the strain components. Hencesome terms of the stress components haveto be interpolated to the locations where thediagonal components are defined. This factleads to an additional error in the dispersionanalysis (Igel et al., 1995). For the RSGsuch an interpolation is not necessary. Weshow with an accuracy analysis that theRSG can be advantageous for modelinggeneral anisotropic media. The modeling ofanisotropic elastic waves using the RSG isdemonstrated with a simulation example.
References
Igel, H., Mora, P., and Riollet, B., 1995,Anisotropic wave propagation through finite-difference grids: Geophysics, 41, 2-27.Saenger, E.H., Gold, N., and Shapiro, S.,2000, Modeling the propagation of elasticwaves using a modified finite-difference grid:Wave Motion, 31, 77-92.
Web page: http://www.userpage.fu-berlin.de/ seis
368 Abstracts
SMP03Bohlen, Th. (U Kiel), Saenger, E.H. (FU Berlin)
Viscoelastic finite-difference modeling using the rotated staggered gridE-Mail: [email protected]
Staggered grid FD operators are commonlyapplied to compute the derivatives occuring inthe elastic wave equation. However, the stan-dard FD operators cause instabilities when themedium possesses high contrasts in materialproperties. Boundary conditions of the elasticwavefield at high contrast discontinuities haveto be defined explicitely in the FD algorithm(e.g. Robertsson, 1996; Hestholm and Ruud,1998). Instability problems can be avoidedby using the so-called rotated staggered grid(RSG) technique: the boundary conditions athigh contrast discontinuities are implicitelyfullfilled by the distribution of material param-eters. The RSG has been so far applied todisplacement-stress formulations of the waveequations (Saenger et al.,2000). The objectiveof this paper is to show that the RSG techniquecan also be adopted to velocity-stress formu-lations of the wave equations. Velocity-stressformulations are advantageous to model seis-mic wave absorption. By applying the RSGto the 3-D viscoelastic wave equation ist be-comes possible to simulate the propagation ofseismic wave in a viscoelastic medium con-taining voids or free surface topography with-out applying explicit boundary conditions.
In one of our modeling examples we ap-ply the new viscoelastic velocity-stress RSGFD algorithm to simulate seismic wave prop-agation in a Gaussian hill. The same modelhas been previously studied by Ohminato andChouet (1998). The objectives of this exampleare (1) to illustrate the capability of the algo-rithm to model free surface topography of aviscoelastic medium without applying explicit
boundary conditions, and (2) to evaluate theaccuracy of the algorithm in the presence ofsurface topography by direct comparison withthe numerical results published by Ohminatoand Chouet (1998).
The topography of the hill is defined by theGaussian function z = aexp(−r2/a2) with r =√
x2 + y2 and a = 1km. The seismic sourceis an explosive point source located near thesurface of the hill. The P-velocity, S-velocity,and density of the hill are 3km/s, 1.5km/s, and1200kg/m3, respectively. The parameters ofthe air are 0km/s, 0km/s, and 1.25kg/m3, re-spectively. The model was discretized witha grid spacing of 10m in each spatial direc-tion. The size of the computational grid is600x400x600 grid points. The run-time wasapproximately 10h on 100 nodes of a parallelcluster.
Figure 2 shows the wave field in the hill af-ter 1.9s. The shallow source (black star in Fig-ure 2) generates a strong Rayleigh wave thatdominates the wavefield. The Rayleigh waveis best visible in the curl of the seismic wave-field (Figure 2, top). The hill produces an am-plitude amplification of the Rayleigh wave onthe hill face opposite to the source. The am-plification is generated by energy focussing atthe summit of the hill. It cannot be observedfor Ryleigh waves which do not pass the sum-mit. The seismograms show excellent agree-ment with the modeling results obtained byOhminato and Chouet (1998). This suggeststhat both methods produce correct results.
ReferencesHestholm, S., Ruud, B., 1998. 3-D finite-
Seismik und seismische Methoden – Poster 369
Figure 1: Snapshots of the curl (top) and divergence (bottom) of the wavefield in the Gaussianhill model. The location of the isotropic explosive point source is indicated by a black star. Thewavefield is dominated by Rayleigh wave scattering at the hill.
difference elastic wave modeling includingsurface topography, Geophysics, 63, 2, 613-622.
Ohminato, T., Chouet, B.A., 1998, A free-surface boundary condition for including 3Dtopography in the finite-difference method,BSSA, 87,2,494-515.
Robertsson, J., 1996. A numericalfree-surface condition for elastic/viscoelasticfinite-difference modelling in the presence oftopography, Geophysics, 61,6,1921-1934.
Saenger, E., Gold, N., Shapiro, S., Model-ing the propagation of elastic waves using amodified finite-difference grid, Wave Motion,
31, 77-92.
Web page: http://www.geophysik.uni-kiel.de/ tbohlen/movies
370 Abstracts
SMP04Bohlen, Th. (U Kiel), Giese, R. (GFZ Potsdam), Müller, Cf., Landerer, F. (U Kiel), Buske, S.,Goertz, A. (FU Berlin)
Finite-Differenzen Modellierung der Wellenausbreitung um einen TunnelE-Mail: [email protected]
Die Modellierung des vollständigen seismi-schen Wellenfeldes um einen Tunnel im kris-tallinen Hartgestein stellt eine große Heraus-forderung an die heute verfügbaren Modellie-rungsmethoden dar. Das kristalline Gesteinin unmittelbarer Umgebung des Tunnels wur-de durch den Tunnelvortrieb stark beanspruchtund verändert. Der beanspruchte Bereich kannsich über mehrere Meter bis 10er Meter er-strecken und hat einen starken Einfluß auf dasan der Tunnelwand angeregte und registrier-te seismische Wellenfeld. Die Umgebung desTunnels ist u.a. gekennzeichnet durch
• starke Gradienten in den seismischenWellengeschwindikeiten
• starke Dämpfung seismischer Energie
• seismische Anisotropie u.a. hervorgeru-fen durch orientierte Klüfte
• Topographie der TunnelwandModellrechungen des vollständigen Wellen-feldes in diesem Milieu haben das Ziel, Hilfe-stellung bei der Interpretation gemessener Da-ten zu geben. Weiterhin können realistischesynthetische Datensätze erzeugt werden, umAbbildungsverfahren zu überprüfen bzw. de-ren Ergebnisse bei Felddaten zu interpretieren.
Für die Finite-Differenzen (FD) Methode istinsbesondere die Modellierung von Topogra-phie der Tunnelwand problematisch. Durchden starken Kontrast in den Materialparame-tern (Luft/Fels) kommt es bei den heute gän-gigen staggered-grid FD-Techniken zu Insta-bilitäten. Ein FD-Algorithmus, welcher in der
Lage ist, auch starke Kontraste ohne explizi-te Definition der Randbedingungen zu model-lieren, ist das sogenannte ”rotated staggeredgrid” (RSG). Das RSG zeichnet sich durch ei-ne für starke Kontraste optimierte Verteilungder Wellenfeldparameter und Materialparame-ter auf dem Gitter aus. Zur Modellierung derWellenausbreitung um den Tunnel wurde dasRSG auf die 3-D viskoelastische Wellenglei-chung angewendet.
3-D Modellrechnungen des viskoelasti-schen Wellenfeldes um einen Tunnel habengezeigt, daß Topographie der Tunnelwandeinen starken Einfluß auf das in Tunnelnäheangeregte und aufgezeichnete Wellenfeld aus-übt. In den Abbildungen 1 und 2 sind exem-plarisch Momentaufnahmen des Wellenfeldesbei glatter und undulierender Tunnelwand dar-gestellt. Es wurde eine mit 35 Grad zur Tun-nelachse einfallende Störungszone mit ernied-rigter Geschwindigkeit und erhöhter Dämp-fung simuliert. Die Quelle ist eine Einzelkraftin Y-Richtung (500 Hz) bei X=9m, Y=32m(Hammerschlag). Diese Quelle strahlt vo-wiegend S-Wellenenergie ab. Das Beispielzeigt, daß Topographie die Ausbildung vonRayleighwellen entlang der Tunnelwand be-hindert. Die Energie wird in Quellnähe an derTunneloberfläche in Raumwellen (P- und S)gestreut. Dies führt zu einer starken Verände-rung der abgestrahlen Signalform, der winkel-abhängigen Abstrahlchrakteristik sowie zu ei-ner bevorzugten Abstrahlung bestimmter Fre-quenzen (Resonanz). Die an der Störungszo-ne reflektierten und in der Nähe der Tunnel-
Seismik und seismische Methoden – Poster 371
wand aufgezeichneten Wellen werden eben-falls durch Topographie wesentlich beeinflußt.Entsprechende Effekte wurden auch in Fel-dexperimenten bei starker Topographie derTunnelwand beobachtet.
Abbildung 1: Schnitt durch das Wellen-feld um einen Tunnel mit glatter Wand.P=P-Welle, S=S-Welle, R=Rayleighwelle,UR=Umlaufende Rayleighwelle.
Abbildung 2: Schnitt durch das Wel-lenfeld bei Tunnelwand mit Topographie.P=P-Welle, S=S-Welle, R=Rayleighwelle,UR=Umlaufende Rayleighwelle.
372 Abstracts
SMP05Müller, Cf. (U Kiel), Goertz, A. (FU Berlin), Giese, R., Klose, C. (GFZ Potsdam), Bohlen, T.,Landerer, F. (U Kiel), Buske, S. (FU Berlin)
Anwendung der Vektormigration zur seismischen Bildgebung beim TunnelbauE-Mail: [email protected]
Vorausschauende seismische Erkundung istbereits ein fester Bestandteil der heute übli-chen geophysikalischen Meß- und Interpre-tationsmethoden beim Tunnelbau (z.B. Ge-lius and Westerdahk, 2002). Das amGFZ-Potsdam zur Zeit in der Entwick-lung befindliche Integrated-Seismic-Imaging-System (ISIS) soll während des Tunnelvor-triebs ein dreidimensionales Bild des Gesteinsum und vor dem entstehenden Tunnel er-zeugen. Wir stellen erste Ergebnisse derBildgebung von ISIS Datensätzen aus demFaido und Piora Zugangsstollen des neuenGotthard-Tunnels vor. Die Bildgebung er-folgte mit den im ISIS implementierten 3D-Vektormigrationsalgorithmen (siehe auch denBeitrag von Goertz et al., diese Tagung).
Die im Gotthardmassiv anzutreffendenGneiskomplexe (Leventina- und Lucomagno-gneis) sind in ihrer Geschichte mehrfach me-tamorph überprägt, verfaltet, sowie spröd de-formiert worden und zeigen somit eine außer-ordentlich komplexe Struktur auf, insbesonde-re durch kataklastische Störzonen, Quarz- undBiotitlinsen/-bänder (dm - m Bereich) und Fal-ten (dm - 10er m Bereich). Die geotechnischgefährlichen kataklastischen Störzonen fallensteil mit 80− 90o nach Norden bzw. Südenein und stellen Hauptziele der Vorauserkun-dung dar. Im angemeldeten Beitrag wird derVersuch unternommen die lokale Geologie mitden migrierten seismischen Daten zu korrelie-ren.
Die hier behandelten seismischen Datensät-ze wurden mit dem aktuellen ISIS Akquisiti-
onssystem gewonnen, das aus der pneumati-scher Quelle und in die Tunnelankerung in-stallierten Dreikomponenten-Geophonen be-steht (siehe auch den Beitrag von Giese et al.,diese Tagung). Akquiriert wurden sie zusam-men mit geologischen Daten im 2600 m lan-gen Faido Zugangsstollen und im 5000 m lan-gen Piora-Sondierstollen des Gotthard Basis-Tunnels. Während sich der Piora-Stollen inNordrichtung parallel zum Gotthard Basis-Tunnel und 500 m darüber horizontal er-streckt, ist der Faido-Tunnel mit ca. 12 % inNord-Ost Richtung geneigt und erreicht denGotthard Basis-Tunnel in einer Tiefe von 1400m (500 ü.NN).
Die gewonnen Daten sind im allgemeinenvon guter Qualität und zeigen Polarisations-güten (globaler Polarisationsparameter nachSamson, 1973) von τ=0,7 - 0,9 in der direktenWelle. Direkte P-und S-Wellen wurden in derVorbereitung auf die Migration durch mutingentfernt. Wie FD-Modellrechnungen zeigenenstehen beim Schlag auf die Tunnelwand inoberflächennahen Klüften an der Quelle oderden Empfängern Kavitätsschwingungen, diesich durch prominente monofrequente Störun-gen im Seismogramm äußern. Diese wurdenmit Hilfe eines adaptiven Notchfilters aus denDaten entfernt.
Die zylindrische Form des Tunnel limi-tiert die Aqkuisitionsapertur und führt beimEinsatz skalarer Migrationsmethoden zu ei-ner Vieldeutigkeit des migrierten Bildes, vor-allem um die Tunnelachse. Der eingesetz-te Vektoralgorithmus unterdrückt diese Viel-
Seismik und seismische Methoden – Poster 373
deutigkeit durch Berücksichtigung der Po-larisation des aufgezeichneten Wellenfeldes(Müller, 2000; Duveneck, 2000). UnterAusnutzung der Polarisation können außer-dem Kompressions- und Scherwellenfeldergetrennt migriert und somit die Interpretati-onsmöglichkeiten für die erhaltenen Bilder er-höht werden (Goertz, 2000).
Durch die Verwendung unterschiedlicherPolarisationsattribute in der Gewichtsfunktionder Migration entsteht ein weiterer Satz vonBildern, der ebenfalls die Interpretation unter-stützt.
LiteraturDuveneck, E. (2000). Abbildung von Erz-
körpern in VSP-Geometrie. Diplomarbeit.Christian-Albrechts-Universität Kiel.
Gelius, L. and Westerdahk, H. (2002). Tun-nel Seismics - Prediction of Rock ConditionsAhead. European Journal of Environmentaland Engineering Geophysics, (7):167-183.
Goertz, A. (2002), True-amplitude multi-component migration of elastic wavefields.PhD thesis, Univ. Karlsruhe.
Müller, C. (2000), On the Nature of Scat-tering from Isolated Perturbations in Ela-stic Media and the Consequences for Proces-sing of Seismic Data. PhD thesis, Christian-Albrechts-Univ. Kiel.
Samson, J. (1973). Description of the pola-rization states of vector processes: applicationto ULF electromagnetic fields. Geophys. J.,(34):403-419.
Webseite: http://www.geophysik.uni-kiel.de/ cmu/projekt.htm
374 Abstracts
SMP06Yoon, M., Buske, S., Lüth, S., Shapiro, S.A., Wigger, P. (Berlin, FU Berlin)
Prestack depth migration of deep seismic datasets.E-Mail: [email protected]
This paper presents the results of Kirchhoffprestack depth migration applied to two on-shore deep seismic reflection data sets (AN-CORP’96 and PRECORP’95). The prestackdepth migration was implemented in 3D (AN-CORP) and in 2D (PRECORP), respectively,from topography. The 3D velocity model wasobtained by extending a 2D velocity model re-ceived from refraction data analysis. The trav-eltime calculation was performed using a finitedifference eikonal solver. An additional "of-fline stacking"provided a final 370 km long 2Ddepth section of the ANCORP data set. Themigration procedure of the PRECORP data setconsisted of three steps: First, early arrivals(0-15 s TWT) were processed. Second, laterarrivals (15-40 s TWT) were passed to migra-tion . Finally, both depth sections have beenstacked and yielded the final 100 km deep sub-surface image. In this paper a 180 km longpart of the ANCORP section and a 110 kmlong PRECORP depth profile are presented.
In comparison to earlier processing results(ANCORP Working Group, 1999; 2002) theprestack depth images contain new aspects.The final 2D ANCORP section obtained fromoffline stacking shows a sharpened image ofthe oceanic crust. Now, two reflectors areclearly visible associated with the upper andthe lower boundary of the oceanic crust. Ex-cept for some areas a nearly complete imageof the Nazca reflector is present in both datasets between depths of 60 - 90 km. The com-pilation with local earthquake data (Gräberand Asch, 1999) shows that the seismogeniczone coincides with the upper reflector of the
oceanic crust, but not with the Nazca reflec-tor at depths larger than 80 km. The finaldepth sections contain two prominent features,the Quebrada Blanca Bright Spot (QBBS, AN-CORP) and the Calama Bright Spot (CBS,PRECORP) located 160 km further to thesouth. Besides the west dip of the QBBS,which was already known from standard post-stack processing results, a 3D analysis of theANCORP data set shows an additional north-dipping trend of the QBBS. Furthermore, theCBS is discovered for the first time.
ReferencesANCORP Working Group, 1999. Seis-
mic reflection image revealing offset of An-dean subduction-zone earthquake locationsinto oceanic mantle. Nature, 397:341–344.
ANCORP Working Group, 2002. Seismicimaging of a convergent continental marginand plateau in the Central Andes (Ancorp’96).JGR, in press.
Gräber, F. and Asch, G., 1999. Three-dimensional models of P-wave velocity and P-to S-velocity ratio in the southern Central An-des by simultaneous inversion of local earth-quake data. JGR, 104:20.237-20.256.
Yoon, M., Buske, S., Lüth, S., Schulze,A., Schapiro, S.A., Stiller, M., Wigger, P.,2002. Along-strike variations of crustal reflec-tivity related to the Andean subduction pro-cess. GRL, in press.
Seismik und seismische Methoden – Poster 375
SMP07Saenger, E.H., Krueger, O.S., Shapiro, S.A. (FU Berlin)
Numerical Rock Physics: Effective elastic moduliE-Mail: [email protected]
This paper is concerned with numericaltests of several rock physical relationships.The focus is on effective velocities and scat-tering attenuation in 3D fractured media. Weapply the so-called rotated staggered finite dif-ference grid for numerical experiments. Usingthis grid it is possible to simulate the propa-gation of elastic waves in elastic media con-taining cracks, pores or free surfaces withouthard-coded boundary conditions (Saenger andShapiro (2002) and Fig. 1). We simulate thepropagation of plane waves through a set ofrandomly cracked media. In these numericalexperiments we vary the number and the dis-tribution of cracks. The synthetic results arecompared with several theories predicting theeffective elastic properties of fractured mate-rials. We find that for randomly distributedand randomly oriented non-intersecting thinpenny-shaped dry cracks the numerical sim-ulations of effective velocities are in goodagreement with the predictions of the self-consistent approximation. We observe similarresults for fluid-filled cracks. The Gassmann-equation cannot be applied to our fracturedmedia although we have a very low poros-ity in our models. This is well explained bythe absence of a connected porosity. Thereis only a slight difference of effective ve-locities between the case of intersecting andnon-intersecting cracks. This can be clearlydemonstrated up to a crack density which isclose to the connectivity percolation threshold.For higher crack densities we observe that thedifferential effective medium theory have thebest fit with numerical results for intersecting
cracks. Additionally it is shown that the scat-tering attenuation coefficient predicted by theclassical Hudson-approach is in an excellentagreement with our numerical results.ReferencesSaenger, E.H., and Shapiro, S.A., 2002, Effec-tive velocities in fractured media: A numer-ical study using the rotated staggered finite-difference grid: Geophys.Prosp.,50, 183-194.
Figure 1: A snapshot of a plane P-wave prop-agating through a fractured 3D model.
376 Abstracts
SMP09Buness, H. (Hannover)
Hochauflösende Messungen mit einem hydraulischen VibratorE-Mail: [email protected]
Das Institut für Geowissenschaftliche Ge-meinschaftsaufgaben (GGA-Institut) unter-sucht oberflächennahe Strukturen mit hoch-auflösender Reflexionsseismik. Entscheidendfür die Qualität des seismischen Abbildes isteine hohe Auflösung, die wiederum hohe Fre-quenzen bei genügender Bandbreite des Si-gnals voraussetzt. Aus diesen Gründen ent-wickelte das GGA-Institut in Zusammenar-beit mit der Prakla-Bohrtechnik-GmbH (Ütze)einen Kleinvibrator.
In einem Testgebiet ca. 40 km SW vonHamburg ergab ein reflexionsseimisches Pro-fil das Abbild einer quartären Rinne mit einerTiefe von 70 m, die in einer weiteren Rinnevon 130 m Tiefe eingebettet ist (Wiederholdet al. 1998). Die Messungen wurden bei ei-nem ersten Test mit dem Vibrator wiederholt;es wurden nutzbare Signalfrequenzen von ca.200 Hz erreicht, bei einer Anregung von 100bis 400 Hz. Für das Ausbleiben der Nutzfre-quenzen >200 Hz waren mehrere Möglichkei-ten denkbar:
1) Die Absorbtion des Untergrundes ist beihohen Frequenzen zu stark.
2) Die Amplitude des abgestrahlten Signalsist aus technischen Gründen zu klein.
3) Das Signal kann wegen unbekannter Pha-senbeziehungen zwischen abgestrahltem Si-gnal und Korrelationssignal nicht rekonstru-iert werden.
Zur Beantwortung dieser Fragen wurdendie Beschleunigungen des Vibratorsystems ander Basisplatte sowie an der Reaktionsmasse-masse bei Frequenzen von 70 bis 380 Hz ge-messen. Zu den Ergebnissen gehören:
1) Die Basisplatte ist in sich auch bei sehrhohen Frequenzen stabil; die Phasendifferenzvon verschiedenen Positionen beträgt bei sehrhohen Frequenzen nicht mehr als ca. 20°.
2) Die Groundforce (GF, das mit den Mas-sen gewichtete und multiplizierte Mittel derBeschleunigungen der Basisplatte und derReaktionsmasse) besitzt zum Referenzsweepmaximal 45° Phasendifferenz.
3) Die harmonischen Anteile des Signals er-reichen hohe Amplituden, die 3. Harmonischeerreicht stellenweise fast diejenige des Funda-mentalsweeps.
4) In den Nutzsignalen sind Frequenzen>200 Hz vorhanden, die durch ein spektra-les Aufweissen hervorgehoben werden kön-nen. Dadurch verschlechtert sich das visu-elle S/N-Verhältnis der Einzelschüsse erheb-lich. Die gestapelte Version zeigt hingegeneine bessere Auflösung. Die Filterwirkungdes Stapelverfahrens unterdrückt wirksam dienicht kohärenten hochfrequenten Signale.
5) Die Verwendung der GF zur Korrelati-on des Signals verbessert die Auflösung wei-ter. Die in den Harmonischen enthaltene Ener-gie wird mit genutzt. Aufgrund der relativ zurgesamten Aufnahmelänge langen Sweepdau-er bei der flachgründigen Seismik spielen dieKorrelationsartefakte (“ghost sweeps“) keineRolle.
6) Eine mindestens ebenso gute Auflösungliefert die Dekonvolution der Daten mit derGF, unabhängig ob diese im Frequenzbereich(Brittle et al. 2001) oder im Zeitbereich (Ro-binson and Sagaff 2001) durchgeführt wur-de. Bei dieser Methode werden die Korrela-
Seismik und seismische Methoden – Poster 377
Profil über eine quartäre Rinne bei Tostedt: Korrelation mit Referenz-Sweep und spektrale Aufweissung bis 220 Hz
Profil über eine quartäre Rinne bei Tostedt: Dekonvolution mit groundforce
Abbildung 1: Vergleich von Korrelation (oben) und Dekonvolution (unten)
tionsartefakte unabhängig von den Sweeplän-gen eliminiert.
Brittle, K.F., Lines, L.R. and Dey, A.K.(2001): Vibroseis deconvolution: a compa-rison of cross-correlation and frequency- do-main sweep deconvolution.- Geophysical pro-specting, 49, 675- 686.
Robinson, E.A. and Saggaf, M. (2001):Klauder wavelet removal before vibroseisdeconvolution.- Geopysical prospecting, 49,335-340.
Wiederhold, H., Buness, H. and Bram, K.
(1998): Glacial Structures in northern Ger-many revealed by a high resolution reflectionseismic survey.- Geophysics, 63: 1265-1272.
Webseite: http://gga-hannover.de
378 Abstracts
SMP10Giese, R. (GeoForschungsZentrum Potsdam), Klose, C., Mielitz, S., Otto, P., Borm, G. (Geo-ForschungsZentrum Potsdam)
ISIS - Integriertes Seismisches Imaging System für die Vorauserkundung beim Tunnel-bauE-Mail: [email protected]
Am GFZ Potsdam wurde in Kooperationmit der Schweizer Firma Amberg Engineeringdas Integrierte Seismische Imaging System(ISIS) als neues Abbildungsverfahren für dieUntertageseismik entwickelt. Die zum Patentangemeldete Idee besteht darin, die Tunnel-Ankerung zu verwenden, um damit ein Ar-ray von seismischen Empfängern antennenar-tig so zu installieren, dass ein hochauflösen-des seismisches Abbild des Gebirges währendder Bauarbeiten stets aktuell zur Verfügungsteht. Als Empfänger dienen miniaturisier-te 3K Geophone. Die Anker werden in biszu mehre Meter tiefe Bohrlöcher verklebt undkönnen vom Tunnel strahlenförmig ausgehenoder in Richtung des Tunnels nach vorn ge-richtet sein.
Abbildung 1: Einsatz eines pneumatischenImpuls-Hammers als seismische Quelle imTunnelbau, die Positionierung und Anpres-sung wird mit Hilfe eines Kleinbagers reali-siert.
Als seimische Quellen kommen pneumati-sche Impulsgeber und magnetostriktive Vibra-toren zum Einsatz, die direkt an Baumaschi-nen befestigt werden können. Sie sind z.B.an einen kleinen Bagger (Abb. 1) oder ei-ne Tunnelbohrmaschine montiert und schnellpositionierbar. Sie werden gegen die Fels-wand vorgespannt und elektronisch angesteu-ert. Damit werden seismische Initialsignalevon 100 Hz bis 4 kHz in definierten Rich-tungen ausgestrahlt, die in Sekundenabstän-den wiederholt werden können. In Koopera-tion mit dem Institut für Geowissenschaftli-che Gemeinschaftsaufgaben (GGA) Hannoverwird das Schwingungsverhalten der Vibrati-onsquellen optimiert.
Die ISIS-Software ist ein Multi-WindowSystem zur interaktiven Bearbeitung der Da-ten bei gleichzeitiger 3D-Visualisierung derErgebnisse. Die Entwicklung der Softwa-re für ISIS schliesst die räumliche Wieder-gabe der durch lithologische Heterogenitä-ten verursachten Reflexionen und eine Inter-pretation hinsichtlich bautechnisch relevan-ter Gebirgsparameter ein. Für die Auswer-tung werden sowohl die direkt oder gebeug-ten Kompressions- und Scherwellen als auchdie von Diskontinuitäten reflektierten Wellenverwendet. Zusammen mit dem Institut fürGeophysik der Uni Kiel und der FachrichtungGeophysik der FU Berlin werden seismischeAbbildungsverfahren für ISIS entwickelt undan synthetischen wie an in situ gemessen Da-ten getestet.
Seismik und seismische Methoden – Poster 379
Abbildung 2: P-Wellen Tomographie aus demSondierstollen Piora (Schweiz). In der Tun-nelwand sind die kartierten Firstausbrücheund geologischen Verwerfungszone eingetra-gen.
Seit dem Frühjahr 2000 werden an ver-schiedenen Stellen der Neubaustrecken desGotthard Basistunnels in den Schweizer Zen-tralalpen seismische Testmessungen mit ISISdurchgeführt. Abb. 2 zeigt eine P-Wellen-Tomographie aus dem 5.5 km langen PioraSondierstollen, der ca. 300 m über der Trassedes GBT in der Penninischen Gneiszone liegt.Dargestellt sind die auf einer horizontalen Li-nie im Abstand von 10 m eingebrachten 2 mlangen Messanker und die im Abstand von 1m angeregten Quellpunkte an der Oberfläche.Auf der Tunnelwand sind die kartierten First-ausbrüche und geologische Verwerfungszoneneingezeichnet. Im Bereich der 150 m langenMessauslage befinden sich zwei 5 m mäch-tige kataklastische Störungszonen, die einenAbfall in den P-Wellengeschwindigkeiten von6.0 km/s auf 4.9 km/s bewirken. Da der Tun-nel für geologische Untersuchungen direkt zu-gänglich ist, können unmittelbare Vergleichezwischen der Geologie und den seismischenErgebnissen zur Überprüfung der Messungendurchgeführt werden.
Neben der Charakterisierung der Geolo-gie in Tunnelnähe lassen sich aus den P-und S- Wellen-Tomographien aus großräumi-ge Trends ermitteln, die wichtige Rückschlüs-se auf die Ausdehnung und Intensität von Stö-rungszonen im Bereich der Tunneltrasse zu-lassen.
380 Abstracts
SMP11Polom, U. (GGA-Institut), Giese, R., Mielitz, S., Otto, P., Borm, G. (GFZ-Potsdam)
Modellierungs- und Testergebnisse für eine hochfrequente seismische Vibrationsquellemit magnetostriktivem Antrieb für den Einsatz im UntertagebauE-Mail: [email protected]
Ursprünglich als hochleistungsfähige So-narquelle für die U.S. Navy entwickelt, fin-den Schwingungserreger mit magnetostrikti-vem Funktionsprinzip zunehmend auch Ein-gang in andere Anwendungsbereiche. Der ma-gnetostriktive Effekt verursacht eine Längen-änderung spezieller Metall-Legierungen (z.B.TERFENOL-D®) unter dem Einfluss einesmagnetischen Feldes. Durch Anlegen einesmagnetischen Wechselfeldes kann die Legie-rung zu mechanischen Schwingungen ange-regt werden, wobei je nach Ausführung Fre-quenzen von einigen Hz bis zu einigen kHz beiMaximalkräften in der Größenordnung meh-rerer kN erzielt werden können.
Am GFZ-Potsdam wird eine vorwiegendfür den Einsatz in bzw. an Festgesteinenkonzipierte seismische Vibrationsquelle unterVerwendung eines magnetostriktiven Schwin-gungserzeugers (Borm und Otto, 2001) ent-wickelt. Kernstück dieser Quelle ist ein vonder Fa. ETREMA Products, Inc.(USA) für dasGFZ-Potsdam entwickelter Schwingungserre-ger mit bis zu 3.0 kW Leistungsaufnahme beieinem Gesamtgewicht von ca. 25 kg.
Neben den Vorteilen einer großen Band-breite und eines hohen Wirkungsgrades be-sitzen magnetostriktive Schwingungserzeugerjedoch für seismische Anwendungen auch un-erwünschte Systemeigenschaften. So sinddie Beziehungen zwischen Ansteuerstrom undmechanischer Wirkung im Bereich der Ar-beitsbandbreite meist nichtlinear und könnendurch sog. Antiresonanz-Frequenzen beein-trächtigt werden. Darüber hinaus führen Am-
plitudenänderungen im Ansteuerstrom zu ei-ner Veränderung der Frequenzcharakteristik.
Zur Analyse und Erfassung der weitgehendunbekannten schwingungsmechanischen Sys-temeigenschaften wurde versucht, das mecha-nische Verhalten des Schwingungserregers inder am Felsuntergrund angekoppelten Situati-on nach einem von Lerwill (1981) publiziertenVerfahren zu modellieren. Dazu werden dieeinzelnen, miteinander gekoppelten Schwing-systeme durch sog. Kelvin-Vogt-Elemente be-stehend aus Masse, Feder und Dämpfer sub-stituiert. Der frequenzabhängige, komplexemechanische Gesamtwiderstand wird mittelsder Masse-Kapazitäts-Analogie ermittelt. AlsVorlage für dieses Analogon wurde ein zwei-läufiger Schwinger mit Auflast (seismischerExplorationsvibrator) verwendet, der hinsicht-lich des Systemaufbaus geeignet modifiziertwurde.
Die Ergebnisse der Modellierung zeigen,dass die Resonanzfrequenz der Reaktions-masse im Gegensatz zu üblichen seismi-schen Vibratoren oberhalb der Arbeitsband-breite liegt, wie es z.B. auch bei piezoelektri-schen Schwingungssensoren der Fall ist. Dar-über hinaus wurde festgestellt, dass der fir-menseitig vorgesehene Abgriff der mechani-schen Schwingung an der Reaktionsmasse al-lein nicht für eine Analyse des Schwingungs-verhaltens ausreicht. Im Rahmen erster Modi-fikationen wurde daher ein weiterer Sensor inder Ankoppeleinheit der Quelle integriert.
In dem Beitrag werden die Modellierungs-ergebnisse mit den Ergebnissen praktischer
Seismik und seismische Methoden – Poster 381
Tests an Probekörpern aus Festgestein ver-glichen. Die Ergebnisse dieser Tests bildendie Grundlagen für eine geeignete nichtlineareQuellenansteuerung zur Kompensation nicht-linearer Effekte der seismischen Quelle selbst,aber auch anderer Effekte, die z.B. durchdie Ankopplung der Quelle an das Untersu-chungsobjekt verursacht sind.
Lerwill, W.E., 1981, The Amplitude andPhase Response of a Seismic Vibrator, Geo-physical Prospecting 29, 503-528
G. Borm und P. Otto, 2001, Vorrichtung zurErzeugung mechanischer Schwingungen in ei-nem festen Material, DPA
382 Abstracts
SMP12Stiller, M., Krawczyk, C., Mechie, J. (GFZ Potsdam), Wigger, P., Lüth, S. (FU Berlin), Reichert,C. (BGR Hannover), SPOC Research Group
Subduktions-Prozesse Offshore Chile (SPOC) - Ergebnisse einer simultanen onshore-reflexionsseismischen Studie bei 38.2°SE-Mail: [email protected]
Fast alle verheerenden Erdbeben finden anaktiven Kontinentalrändern in der seismoge-nen Koppelzone zwischen konvergenten Plat-ten statt. Der strukturelle Aufbau und diedort stattfindenden petrophysikalischen Pro-zesse sind noch längst nicht vollständig ver-standen und daher vorrangige geodynamischeUntersuchungsziele.
Das multidisziplinäre, geowissenschaftli-che Offshore-Projekt SPOC (Subduction Pro-cesses Off Chile), gelegen zwischen 36° und39° S, wurde durch eine Onshore-Erweiterungergänzt, welche ihrerseits aus verschiedenenaktiven und passiven seismischen Experimen-ten bestand, nämlich: (1) drei je ca. 200km lange weitwinkel-seismische West-Ost-Aufstellungen, die jeweils von der Küste biszur Hauptkordillere reichten und neben eige-nen Schüssen an den Enden auch die Airgun-Anregungen aus der seeseitigen Verlängerungregistrierten, (2) ein hochauflösendes West-Ost steilwinkel-seismisches Reflexionsprofilauf dem südlichen der drei Weitwinkelprofi-le, und (3) eine 3D-Flächenaufstellung vonDreikomponenten-Stationen, die kontinuier-lich alle aktiven und passiven Quellen wäh-rend des Meßzeitraums aufzeichnete.
In diesem Beitrag werden vor allemneuere Ergebnisse der reflexionsseismischenSteilwinkel-Landkomponente (2) vorgestellt,welche (neben den anderen, mehr großräumi-gen 2D/3D-Weitwinkel-Landexperimenten)hauptsächlich als Pilotstudie für eventuelleFolgemessungen diente, um die Subduktions-
zone zwischen Nazca- und Südamerika-Plattereflexionsseismisch möglichst detailliert ab-zubilden, wobei die seismogene Koppelzonein 20 bis 40 km Tiefe eines der Hauptzielewar.
Drei Geophon-Aufbauten (jede bestehendaus 180 Geophongruppen im 100 m Abstand)registrierten insgesamt 14 Sprengstoffschüs-se, davon 10 innerhalb der insgesamt 54 kmlangen aktiven Auslage, sowie 2 entfernte-re Schüsse westlich der Auslage im Pazifi-schen Ozean und 2 entferntere Schüsse öst-lich der Auslage. Daraus ergibt sich ein ins-gesamt etwa 87 km langes West-Ost gerich-tetes 2D CDP-Reflexionsprofil. Es umfasstdie Offshore/Onshore-Übergangszone längsca. 38.2°S und verläuft von etwa 18 km west-lich der südchilenischen Pazifik-Küstenlinieüber die Präkordillere bis hinab ins Längstalim Osten. Es reicht bis in eine Tiefe von über60 km und übermisst Teile der Bruchflächedes großen Chile 1960 Erdbebens (Magnitude9.5).
Das tiefenmigrierte seismische Abbild zeigtmehrere (mindestens 3) kräftige etwa 20°Ost fallende Reflexionsbänder in verschiede-nen Krusten-Stockwerken, die als Internstruk-turen paläozoischer Akkretionstektonik inter-pretiert werden, wobei das tiefste mit derOberkante der abtauchenden Platte korreliert,wie sie durch die Wadati-Benioff Seismizitätdefiniert ist und wie sie auch durch die Ge-schwindigkeitsstruktur des simultan vermes-senen Weitwinkel-Profils bestätigt wird. Zwei
Seismik und seismische Methoden – Poster 383
weitere, eher horizontale Reflexionsbänder beica. 8 und 23 km Tiefe lassen sich ebenfallsmit zwei in der Weitwinkel-Auswertung mo-dellierten moderaten Geschwindigkeitssprün-gen in der kontinentalen Platte korrelieren.
Neben den Landschüssen wurden mit derküstennahesten 18 km Landauslage auch dieAirgun-Anregungen des Forschungsschiff RVSONNE, die in ozeanseitiger Verlängerungder Landlinie stattfanden, registriert. Kräf-tige Phasen zwischen 10 und 80 km Offset(Pg, ..., PmP) sowie zwischen 150 und 225km Offset (Pn) erlauben neben der Identifi-zierung verschiedener krustaler Grenzen eineFestlegung der ozeanischen Mantelgeschwin-digkeit auf 8.1 km/s. Die ungewöhnlich hoheStrahlüberdeckung (180 Empfängerstationenim 100 m Abstand und 3600 Airgun-Pulse im50 m Abstand) ermöglichen die Erstellung ei-ner Weitwinkel-Stapelung, die neben der klas-sischen Geschwindigkeitsinformation auch ei-ne strukturelle Abbildung zu liefern in der La-ge ist.
Webseite: http://www.gfz-potsdam.de/pb2/pb22/projects/spoc.html
384 Abstracts
SMP13Lüth, S. (FU Berlin), Mechie, J. (GFZ Potsdam), Wigger, P. (FU Berlin), Krawczyk, C., Stiller,M. (GFZ Potsdam), Flüh, E. (GEOMAR Kiel), Reichert, C. (BGR Hannover), Bataille, K. (Ude Concepcion), SPOC Research Group
SUBDUCTION PROCESSES OFF CHILE (SPOC) - RESULTS FROM THE AMPHI-BIOUS WIDE-ANGLE SEISMIC EXPERIMENT ACROSS THE CHILEAN SUBDUC-TION ZONEE-Mail: [email protected]
One component of the onshore-offshore, ac-tive -passive seismic experiment SPOC hasbeen a 2-D wide-angle seismic experimentcovering the Chilean subduction zone from theNazca Plate to the Magmatic Arc in the maincordillera. Three profiles of 52 stations eachand up to 240 km long were deployed be-tween 36ø and 39ø S. These profiles recordedchemical shots at the ends of the profiles andthe airgun pulses from RV SONNE cruisingsimultaneously on offshore profiles extend-ing the onshore profiles. On the southern-most of the three profiles OBHs/OBSs weredeployed offshore, thus providing continuouswide-angle seismic data from the Nazca Plateto the South-American continent. Data exam-ples, correlations, and velocity models alongthe three transsects will be presented. TheMoho of the subducted oceanic crust can beconstrained by PmP-reflections down to 45 kmdepth under the coastal cordillera. The P-wavevelocity field of the crust of the upper plate ischaracterized by gradually increasing P-wavevelocities from East to West. Low seismic ve-locities (Vp < 5 km/s) indicate the location ofa young accretionary complex at the westerntip of the continent. Highest seismic velocities(Vp > 6.5 km/s below 10 km depth) are ob-served at the eastern margin of the investigatedarea where a Late Paleozoic accretionary com-plex has been intruded by a batholith duringMiddle Jurassic to Neogene.
Seismik und seismische Methoden – Poster 385
SMP14Tilmann, F., Planert, L., Flueh, E., Reston, T., Weinrebe, W. (GEOMAR, Kiel)
Combined Seismicity and Wide Angle Survey of a segment of the Mid-Atlantic RidgeE-Mail: [email protected]
Slow spreading mid-ocean ridges are char-acterized by along-axis segmentation wherecrustal composition and structure varies sig-nificantly within a segment and across trans-form faults and other ridge axis discontinu-ities. In May 2000, the GERSHWIN ex-periment investigated the Mid-Atlantic Ridge(MAR) at 5 S during cruise M47-2 of RV Me-teor. Here, two spreading segments of theMAR are separated by a 70 km offset trans-form fault. This segment of the ridge is un-usual in that the inside corner high has beensplit by a change in location of active seafloor
Figure 1: Seismmicity along one segment ofthe Mid-Atlantic Ridge. Large circles: Wellconstrained events, i.e. arrivals at 5 stationsor more, azimuthal gap less than 300 degree);Hexagons: Well-constrained events with atleast one S pick; Small circles: Locatableevents, which did not fulfill above criteria.The events were located with a linearized jointhypocentre determination.
spreading. (Reston et al., 2002).Four intersecting wide-angle profiles and
six shorter profiles were shot both parallel andperpendicular to the median valley. The pro-files along the median valley extend from thecenter of one segment across the transformwell into the next segment. Two-dimensionalvelocity profiles were generated by a com-bination of forward-modeling, inversion, andfirst arrival tomography. Marked variations incrustal structure are observable in these pro-files. All velocity models show a strong ve-locity gradient in the first 2 to 3 km below theseafloor, returning to a more gradual increasein velocities in the lower crust. In the me-dian valley velocities are significantly reducedwhereas morphological highs are marked byhigher velocities. Crustal thickness varies be-tween 3 and 7 km, with the Moho becomingmore elevated as the segment boundary is ap-
Figure 2: Cross section along the Median val-ley. Depth is below sea level. Sea floor depthin the median valley is about 4 km. Errorbars indicate two standard deviation error (95perc. confidence interval) based on MonteCarlo experiments (random perturbation of ar-rival times and starting location).
386 Abstracts
proached along the median valley or across theInside Corner massif.
Just south of the 5 S transform fault, a net-work of up to 15 ocean bottom stations (13hydrophones and 2 seismometers), recordedmicro-earthquake activity for a duration of 10days (instrument numbers vary because of in-strument failures and early recovery, as a partof the instrument was used for contemporane-ous refraction profiling). Approximately, 150earthquakes produced clear arrivals on threeor more stations. Approximately half of theseevents have five or more picks and a azimuthalgap less than 300 deg, so can be consideredwell located; 49 of these have good depth con-trol. Earthquake activity is concentrated alonga narrow zone along the median valley. A fewevents occur along the transform fault, and indiffuse regions within the Inside Corner Highand the bounding massif near the centre of thesegment. Event depths vary between 5 and13 km below sea level (approx. 1-9 km be-low the seafloor), with most occurring at 7-9km depth below seafloor. Earthquake depthswithin the median valley shallow towards thesegment end, possibly related to the thinnercrust there.
Web page:
http://www.geomar.de/projekte/gershwin
388 Abstracts
UI01 – Mo., 24.2., 11:00-11:20 Uhr · HS2Wagner, U., Hauck, C. (Karlsruhe)
Combining and interpreting geoelectric and seismic tomographies in permafrost studiesusing fuzzy logicE-Mail: [email protected]
INTRODUCTIONFor many problems in environmental, engi-neering and archaeological studies geophysi-cal investigations are the main source of infor-mation concerning the structure and character-istics of the subsurface. Especially the abil-ity to gather 2-dimensional information aboutthe subsurface material is considered the mainadvantage of geophysical techniques as op-posed to the single-point information throughboreholes. However, the indirect nature ofgeophysical surveys, where material proper-ties like water content, pore size or temper-ature have to be inferred from the measuredphysical variables such as electrical resistiv-ity, can be considered a major drawback forthe application of geophysical methods in ap-plied geosciences. Nevertheless, the uncer-tainty in the interpretation of geophysical datasets is seldomly explicitly treated in geophysi-cal applications. In order to address this uncer-tainty, a model approach using fuzzy logic ispresented in this contribution, which is basedon expert knowledge about a particular prob-lem. The problem is taken from the area ofpermafrost research, where geophysical meth-ods are used for the detection of ground ice.Commonly, more than one method is used inorder to get a multivalued data set and to fa-cilitate data interpretation (e.g. DC resistivityand refraction seismics). However, due to thenon-uniqueness of the inversion results andthe range of possible values for most earth ma-terials, the interpretation of the data set is usu-ally very ambiguous.
FUZZY MODELFuzzy logic is an extension of a multivaluedlogic, where classes of objects have unsharpboundaries and membership is a matter of de-gree. It is a convenient way to map an inputspace to an output space, especially if a quan-titative output is required from imprecise in-put variables. In this case the input space iscomprised by the results from the geophysi-cal surveys (e.g. electrical resistivities or seis-mic P-wave velocities) and the output spaceis the degree of ice content, that is the pos-sibility of ground ice occurrence. The fuzzyinference system used in this study is of theso-called Mamdani-type (Mamdani & Assil-ian 1975) and is based on nine rules, all link-ing low, medium and high resistivity and ve-locity values to a corresponding output (low,medium and high ice content). High resistivityvalues and medium seismic velocities around3500m/s (velocity for pure ice) are associatedwith high ice contents. Due to the exponen-tial increase of resistivity with decreasing andnegative temperature, the logarithm of resis-tivity is used in the model.
RESULTSThe decision surface and the correspondingfuzzy model is tested using a synthetic data setof resistivity and seismic data pairs (Fig. 1).Both data sets are comprised of 4 regions withhigh, medium and low resistivity and velocityvalues, respectively, where only the upperright hand corner represents values consistentwith the material properties of ice. Accord-ingly, the resulting model output shows a
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 389
Figure 1: Resistivity (left, in log10(Ωm)) and seismic velocity (center, in km/s) of the syntheticdata set, and fuzzy model output (right).
region of high possibility for ice occurrencesin this region, whereas the possibility is lowfor all other regions. As can be seen fromFig. 1 the fuzzy model can be used to detectareas with high possibility for ground iceoccurrences from joint resistivity and velocitydata sets. The model was applied to severalfield data sets from presumed permafrost sitesin the midlands of Central Europe. There, per-mafrost occurs only in isolated patches withspecific microclimatic conditions (e.g. Haucket al., this volume). First results show patcheswith enhanced possibility for ground iceoccurrence in comparison to the neighbouringareas. In addition, the possibility for groundice can be quantitatively compared betweendifferent field sites.
REFERENCES
Mamdani, E.H. & Assilian, S. 1975. Anexperiment in linguistic synthesis with afuzzy controller. International Journal ofMan-Machine Studies, 7 (1), 1-13.
390 Abstracts
UI02 – Mo., 24.2., 11:20-11:40 Uhr · HS2Hauck, C. (Karlsruhe), Gude, M. (Jena), Kneisel, C. (Würzburg), Molenda, R. (Basel)
Looking for ground ice in low-altitude scree slopes in central Europe using DC resistivityand refraction seismic tomographyE-Mail: [email protected]
INTRODUCTIONIn many central European highlands slope sec-tions covered with blocky material display mi-croclimatic conditions that resemble those ofhigh latitude or high altitude periglacial ar-eas. In some of these so-called scree slopeseven permafrost can be found, although theyare located at altitudes below 1000m. Essen-tial preconditions for this extraordinary mi-croclimatic phenomenon are assumed to be athick layer of blocks with an open void sys-tem, i.e. steep slopes with almost no fine ma-terial. As a consequence of the air tempera-ture gradient between the boundary layer andthe interior of the scree, an intensive air cir-culation between the blocks induces cold con-ditions at the base of the slope by cold air in-flow in winter and a lack of sufficient warmingin summer. In addition to these microclimaticevidence, summer ice observations in the nearsubsurface and the occurrence of cold adapt-ing mosses and different invertebrate groups(e.g. beetles and spiders) normally living inhigh alpine or polar areas are normally used asindicators for the possible presence of groundice (Molenda 1996, Gude et al. 2003).First attempts for ground ice detection us-ing vertical electrical soundings and low-resolution refraction seismics survey havebeen conducted by Schrott et al. (2000).However, due to the extremely heterogeneoussubsurface conditions with large air-, water-and/or ice-filled cavities between the blocks,the interpretation of the results was difficultand no ground ice could be detected. In order
to resolve these multi-phase subsurface struc-tures, tomographic survey and inversion tech-niques are necessary, as plane layer approxi-mations are usually invalid. In this contribu-tion we present results from an extensive fieldstudy using DC resistivity and refraction seis-mic tomography for ground ice detection on 7different scree slopes in central Europe.
RESULTSInversion of resistivity and seismic data wasperformed using RES2DINV and a refractiontomographic inversion scheme introduced byLanz et al. (1998), respectively. As an exam-ple, Fig. 1 shows the inversion model resultsfor two scree slopes in the Czech Republic.The resistivity results (Fig. 1a) reveal a thick-ness of the blocky layer of about 10m at thescree slope at Klic indicated by the extremelyhigh resistivities due to the large air voids.As air voids without any ice content wouldresult in low velocities, the seismic results ofthe Klic scree indicate the possibility of smallice lenses within the blocky layer (Fig. 1b).The two velocity anomalies (2000-3000m/s)at horizontal distances 35 and 45 at 5m depth(marked by the white arrow) indicate thepossible occurrence of ground ice, (seismicP-wave velocity of pure ice is 3500m/s). Asthe resistivity results indicate a layer thicknessof the scree of 10m and because the velocitiesdecrease above and below the anomalies, theanomalies cannot be due to firm bedrock.In contrast to that, velocities at Kamenec(Fig. 1c) are less than 1000m/s throughoutthe uppermost 10m, indicating that no larger
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 391
Figure 1: Figure 1: (a) Resistivity and (b) seismic velocity at Klic and (c) seismic velocityresults at Kamenec (Czech Republic). (a) and (b) are orthogonal to each other and cross at thecenter. The black arrow in (a) marks the location of the scree slope, the solid and dashed linesits lateral and vertical extent, respectively.
ice volumes are present along this survey line.Similar results were obtained from the otherfield sites. In addition to these findings, moreextensive field surveys and new quantitativeinterpretation methods (e.g. using fuzzy logic,see Wagner & Hauck, this volume) are neededto determine the actual ice content within thescrees.
REFERENCES:
Gude, M., Dietrich, S., Mäusbacher, R.,Hauck, C., Molenda, R., Ruzicka, V. &Zacharda, M. 2003. Permafrost conditionsin non-alpine scree slopes in central Europe.8. Int. Conf. on Permafrost, Zurich, accepted.Lanz, E., Maurer, H. & Green, A. 1998.Refraction tomography over a buried waste
disposal site. Geophysics, 63(4), 1414-1433.Molenda, R. 1996. ZoogeographischeBedeutung Kaltluft erzeugender Block-halden im ausseralpinen Mitteleuropa.Verh. Naturw. Ver. Hamburg (NF) 35, 5-93.Schrott, L., Pfeffer, G. & Möseler, B. 2000.Geophysikalische Untersuchungen an einerBlockhalde im Mittelgebirge. Acta Univ.Purkyn., Usti, stud. biol., 4, 19-30.
392 Abstracts
UI03 – Mo., 24.2., 11:40-12:00 Uhr · HS2Geletneky, J.W. (Jena, Institut für Geowissenschaften), Fengler, H-J. (Chemnitz, WismutGmbH), Steinhau, D. (Chemnitz, analytec Dr. Steinhau), Büchel, G. (Jena, Institut für Geowis-senschaften)
Geoelektrische Erkundung und sedimentologisch/hydrogeologische Untersuchungenquartärer Sedimente im Flutungswasseraustrittsgebiet Gessental bei Ronneburg, ehema-liges Ostthüringer UranbergbaugebietE-Mail: [email protected]
Im östliches Gessental bei Ronneburg,ehem. ostthüringisches Uranbergbaugebiet,wurde im Auftrag der Wismut GmbH von derIngenieurgesellschaft analytec Dr. Steinhau(Chemnitz) im Jahre 2000 ein geoelektrischesUntersuchungsprogramm durchgeführt. Zu-vor wurden von Friedrich (1998) und Gelet-neky (2002) geoelektrische Einzelsondierun-gen vorgenommen, die in Teilbereichen ex-trem geringe Widerstände (<1 Ωm) auswie-sen.
Das Gessental befindet sich im westlichenBereich der ehemaligen Ronneburger Uran-bergbauregion und wird nach der Flutungdes Untertagebergbaus als Hauptaustrittsge-biet für anfangs hochmineralisierte Flutungs-wässer wirken.
Mit den durchgeführten Widerstandskartie-rungen und –sondierungen wurde zum ei-nem die Mächtigkeit der quartären Sedimentezum anderen die Verteilung der unterlagern-den paläozoischen Metasedimentabfolge er-fasst. Aus den Sondierungsergebnissen wurdedie lithologiebezogene Verteilung der schein-baren spez. Widerstände ermittelt. Diegeoelektrischen Ergebnisse wurden in einengeologischen, sedimentologischen, geochemi-schen und hydrogeologischen Zusammenhanggestellt.
Die scheinbaren spezifischen Widerständezeigen im östlichen Gessental eine deutlicheDifferenzierung in extrem nieder–, gering–
und hochohmige Bereiche. Die unterschied-lichen lithologischen Einheiten besitzen inAbhängigkeit von der Wassersättigung, derZusammensetzung des bergbaubeeinflusstenSickerwassers bzw. des schwebenden Grund-wassers, der geochemischen Zusammenset-zung der quartären Talsedimente und der pa-läozoischen Metasedimentabfolge und demVerwitterungsgrad der Gesteine unterschiedli-che spez. elektr. Widerstände. Die geoelek-trischen Eigenschaften werden durch die Mi-neralisation des Grund– bzw. Haldensicker-wassers und durch sekundäre Verwitterungs-prozesse an der Basis der Talsedimente be-stimmt. Mit Hilfe von 150 zusätzlich durch-geführten Rammkernsondierungen sowie derAuswertung von Altbohrungen und geologi-schen Aufnahmen aus der Zeit der Explorati-on der Uranlagerstätte konnten die Mächtig-keiten der Sedimente und die kompliziertenLagerungsverhältnisse der paläozoischen Ein-heiten nachvollzogen werden. Hierbei erwiessich der flächenhafte Informationsgehalt dergeoelektrischen Kartierungen und Sondierun-gen hinsichtlich der Interpolation der geologi-schen Punktdaten aus den Bohrungen als sehrzweckmäßig.
Zur Charakterisierung der quartärgeologi-schen und hydrogeologischen Verhältnisseder größtenteils ungesättigten Talsedi-mente wurden neunzehn geoelektrische2D–Profilschnitte (Wenner–Sondierungen)
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 393
mit Hilfe einer Multielektroden–Messungerstellt und mit den 150 Rammkernson-dierungen abgeglichen. Somit konnte diedreidimensionale Verteilung der quartärenSedimente ermittelt und in ein sedimento-logisches Raummodell überführt werden.Die Talsedimente bestehen überwiegend ausholozänen fluviatilen und umgelagerten klas-tischen Sedimenten. Das sedimentologischeModell der holozänen Sedimente zeigt dasGessental als einen proximalen Talbereichmit gegliederten Wechsellagerungen vongrobklastischen älteren und jüngeren Bach-sedimenten mit feinklastischen Aue– undHangsedimenten sowie umgelagerten Löss.Die jüngeren Talsedimente weisen interneein bis fünf Meter mächtige, rinnenförmigenStrukturen auf, welche aus schlecht sortiertensandigen Kiesen mit deutlichen Schluff– undTonanteilen bestehen.
Die gleichzeitige Ermittlung hydrogeolo-gischer Parameter mit Hilfe von Siebanaly-sen und Packertests (u.a. Solexperts 1997)zeigt eine heterogene Verteilung der Durch-lässigkeitsbeiwerte (k f –Werte) innerhalb derTalsedimente, wobei einzelne Bereiche k f –Werte bis zu 10−4 m/s aufwiesen. An dengeoelektrischen Messungen konnten teilwei-se rezente Infiltrationszonen identifiziert wer-den. Aus dem entwickelten sedimentolo-gisch/hydrogeologischen Geländemodell kön-nen bevorzugte Fließwege abgeleitet werden.Diese Fließwege spielen bei der Austragsdy-namik im Postflutungszeitraum eine entschei-dende Rolle.
LiteraturFriedrich, C. (1998): Kleinräumige geo-
physikalische Vermessung an Halden im Be-reich Ronneburg mit Hilfe der Geoelektrikund des Bodenradars. – Diplomarb., 159 S.,TU Clausthal–Zellerfeld (unveröff.).
Geletneky, J.W. (2002): Hydrogeologi-
sche/Hydrologische Untersuchungen einerPrä–Flutungssituation am Beispiel desGessentals im ehemaligen ostthüringischenUranbergbaugebiet.– Diss. Univ. Jena, 261 S;Jena.
Solexperts (1997): Hydrogeologische Test-arbeiten bei Ronneburg: Schlußbericht. –Internes Gutachten, Solexperts AG: 72 S.;Schwerzenbach, Schweiz (unveröff.).
394 Abstracts
UI04 – Mo., 24.2., 12:00-12:20 Uhr · HS2Suckow, A. (GGA)
Die isotopenhydrologische Datierung von Grundwasser: Grundlagen und Anwendungs-beispieleE-Mail: [email protected]
Die klassische Isotopenhydrologie verwen-det die Isotope δD, δ18O und Tritium alsTracer im Wassermolekül und hat sich seit30 Jahren als ein schnelles, kostengünsti-ges und universell einsetzbares Instrumen-tarium zur Untersuchung von Grundwasser-systemen etabliert. Neben der Charakteri-sierung von Grundwasserkörpern und derenMischung, sowie der Bestimmung von Ein-zugsgebieten werden die Messungen vor al-lem in nulldimensionalen „lumped parame-ter“Modellen zur Bestimmung mittlerer Ver-weilzeiten (mean residence times, MRT) ver-wendet. Dies ist keine Datierung von Grund-wasser im strengen Sinne, da es eine ma-thematisch beschreibbare Mischung von Was-ser unterschiedlichen Alters zur Grunde legt.Darüber hinaus ist für Tritium die Bestim-mung mittlerer Verweilzeiten in neu unter-suchten Systemen ohne Jahrzehnte zurückrei-chende Zeitreihen kaum noch möglich.
Die moderne Isotopenhydrologie stellt da-gegen drei Methoden zur Verfügung, das Al-ter von bis zu 40 Jahre altem Grundwas-ser zu bestimmen. Dies ist erstens Triti-um zusammen mit seinem Zerfallsprodukt,dem stabilen Heliumisotop 3He, zweitens diechemischen Spurenstoffe Schwefelhexafluo-rid (SF6) und die Fluorchlorkohlenwasserstof-fe (FCKW bzw. CFC), sowie drittens das an-thropogene radioaktive Isotop des EdelgasesKrypton, 85Kr. Damit sind prinzipiell sowohlAbsolutdatierungen unvermischter Grundwäs-ser als auch Zumischungen von verschiedenKomponenten jünger als 40 Jahre quantifizier-
bar.Die Grundlagen dieser drei Datierungsme-
thoden werden bezüglich Kosten, Aufwandbei der Probenahme und Belastbarkeit der re-sultierenden Altersaussage verglichen und derprinzipielle Unterschied zwischen einer Datie-rung von Grundwasser und der Anwendungder klassischen Tritiummethode erläutert. An-hand der Beispiele von zwei Grundwasser-störfällen (Banisveld und Dow Terneuzen inden Niederlanden) sowie einem Kooperations-projekt des GGA-Institutes in Bremerhaven-Cuxhaven werden die Anwendungsmöglich-keiten der einzelnen Methoden im praktischenEinsatz demonstriert.
Für Grundwasserfliesszeiten jenseits voneinhundert Jahren bis einige zehntausend Jah-re hat sich in der Vergangenheit besonders die14C Methode etabliert. Auch mit 14C sindim Prinzip Datierungen unvermischter Wäs-ser möglich. In der praktischen Anwendungist dies gerade der für die Trinkwasserversor-gung interessante Zeitbereich, in dem anthro-pogene Beeinflussung ausgeschlossen werdenkann, die Fördertiefen und Aquiferdurchläs-sigkeiten aber noch im wirtschaftlichen Be-reich bleiben. Leider liefert 14C aber bei wei-tem nicht so belastbare Alter wie die Metho-den für junge Grundwässer. Das liegt dar-an, dass 14C am mit dem Wasser transportier-ten Karbonatsystem gemessen wird und einegeochemische Überprägung die resultieren-den 14C Grundwasseralter massiv verfälschenkann. Am Fallbeispiel Bremerhaven Cuxha-ven wird demonstriert, wie weit eine solche
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 395
Tritium: 1-40a(admixture only)
Groundwater Dating
0.1 1 10 100 1000 10000 100000
Groundwater Age [years]
�D, �18O: 0.1-3a14C: 2ka-40ka
85Kr: 1-40a
CFC/SF6: (4)10-40a
T/3He: 0.5-35a
4He: 50- >100 000a (age estimates)
40Ar: >100 000a39Ar: 50-2000a
Abbildung 1: Zeitskalen für die Datierung von Grundwasser mit verschiedenen isotopenhy-drologischen Methoden
Verfälschung des 14C im praktischen Fall ge-hen kann, und inwieweit zusätzliche Datie-rungsinstrumente wie 4He oder 39Ar hilfreichsein können.
396 Abstracts
UI05 – Mo., 24.2., 12:20-12:40 Uhr · HS2Morgenstern, A. (Dresden, Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.)
Einbohrlochsystem zur Messung der GrundwasserbewegungE-Mail: [email protected]
Im Rahmen eines FuE-Projektes wurde amDresdner Grundwasserforschungszentrum ge-meinsam mit der LogIn Bohrlochmessgerä-te GmbH und dem Joanneum Research einMesssystem entwickelt, welches die Bestim-mung der lokalen Grundwasserfließrichtungund -geschwindigkeit unter Nutzung nur ei-ner Bohrung bzw. Grundwassermessstelle er-möglicht. Das Messsystem beruht auf der An-wendung geoelektrischer Messverfahren undVerfahren zur Temperaturmessung. Mit derZielstellung, ein System zur Messung gerin-ger Grundwasserströmungsgeschwindigkeitenim Bereich von 0,5 - 1,5 m/d zu entwickeln,ergaben sich spezielle Anforderungen an dieApparatur. Insbesondere wurde ein neues Ver-fahren zur Tracererzeugung benötigt, bei demkeine Störung des natürlichen Strömungsfel-des im Grundwasserleiter auftritt. Der ad-aptive Tracer ist sowohl elektrisch als auchthermisch detektierbar. Weiterhin konnte derNachteil der Innenraummessung (im Pegel)bisheriger Verfahren überwunden werden.
Das Messsystem besteht aus einer Sondeund peripheren Geräten zur Steuerung undDatenerfassung. Der Sondenkörper beinhal-tet die Steuerelektronik mit der Orientierungs-einheit, den Sensormodul mit elektrischen undthermischen Sensoren und eine Tracervorrats-kammer mit Pumpe. Durch diesen Aufbauund den Betrieb der Sonde an einem einadri-gen Bohrlochmesskabel können derzeit Mes-sungen bis zu einer Teufe von 100 m u. GOKvorgenommen werden. Die konstruktive Ge-staltung der Sonde und die angewendetenMessverfahren ermöglichen den Einsatz ge-
ringer Tracermengen (1000 ml). Die Anwen-dung einer an den Zustand des Aquifers an-gepassten, temperierten und gering salinarenLösung als Tracerstoff macht die Messungenunabhängig von der Hintergrundleitfähigkeitdes Grundwassers. Damit erstreckt sich derEinsatzbereich von Trinkwasserschutzgebie-ten bis hin zu Deponien.
Zur Bestimmung der Strömungsrichtungwerden die zeitabhängigen und richtungsbe-zogenen Indikationen des elektrischen Wi-derstandes und der Temperatur gemessen.Die gemeinsame Auswertung beider Mess-größen ermöglicht eine Genauigkeitsverbesse-rung. Durch die Temperaturmessung kann dieSonde auch in Grundwasserpegeln mit Metall-verrohrung eingesetzt werden.
Zur Bestimmung der Fließgeschwindigkeitdes Grundwassers im Aquifer kommt das inder Bohrlochmessung bekannte Tracerverdün-nungsverfahren zum Einsatz. Damit ist esmöglich, den Einfluss von Sonden- und Filter-rohrdurchmesser zu berücksichtigen.
Zum Test der Apparatur während der Ent-wicklungsphase und zur Überprüfung derMessergebnisse wurde ein Prüfstand mit ei-nem Volumen von etwa 1 m 3 aufgebaut, dereinen Ausschnitt aus einem Grundwasserlei-ter mit integriertem Pegel beinhaltet. Durchdie Randbedingungen werden konstante undreproduzierbare Strömungsverhältnisse in derMessebene gewährleistet. Bei Feldmessungenin realen Grundwassermessstellen und Pegeln
• im Umfeld eines Brauchwasserbrunnensin Heidenreichstein (Niederösterreich)
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 397
• im Abstrom eines ehemaligen Gaswerks-standortes in Lengenfeld und
• im NSG Saalberghau bei Dessau (vomElbepegel beeinflusste Grundwasser-fließrichtung)
konnte über den Vergleich mit unabhängi-gen Richtungsmessungen bereits der Nach-weis der Funktionsfähigkeit des Messsystemserbracht werden.
Die Sondenentwicklung wurde vom BMWiunter dem Kennzeichen 1106/01 gefördert.
Webseite: http://www.dgfz.de
398 Abstracts
UI06 – Mo., 24.2., 12:40-13:00 Uhr · HS2Hesse, G., Büchel, G. (Jena, IGW)
Einsatz von Potenzialmethoden bei der Grundwassererkundung am Beispiel von Maar-Diatrem-VulkanenE-Mail: [email protected]
In der grundwasserarmen Region der Ei-fel besteht mittelfristig der Bedarf an zusätz-lichen Grundwasserreserven. Mit der geziel-ten Erschließung von vulkanischen Poren–Grundwasserleitern ist in der Westeifel diedezentrale Sicherung des Trinkwasserbedarfsmöglich.
Vulkanische Poren–Grundwasserleiter stel-len hier häufig kleine geschlossene heteroge-ne Fließsysteme mit ausgezeichneten hydrau-lischen Eigenschaften und hoher Grundwas-serneubildungsrate dar. Trotz ihrer geringenflächenhaften Ausdehnung sind sie von hohemwasserwirtschaftlichen Nutzen. Die Schwie-rigkeiten der wasserwirtschaftlichen Erschlie-ßung liegen in der mangelnden strukturellenInformation, so dass in der Vergangenheit im-mer wieder „trockene“ Erkundungsbohrungenabgeteuft wurden. In einem von der Verbands-gemeinde Gerolstein geförderten Pilotprojektuntersuchte das Institut für Geowissenschaf-ten der Friedrich–Schiller–Universität Jena ineinem Trockenmaar (Geeser Maar) 5 km öst-lich von Gerolstein die wasserwirtschaftlichenNutzungsmöglichkeiten.
Zur Strukturaufklärung des bis 1972 uner-kannt gebliebenen Maares, wurden neben geo-logischen Arbeitsmethoden die Potenzialfeld-methoden der Geomagnetik und Gravimetrieangewandt.
Die gravimetrische Erkundung ergab imZentrum des Trockenmaares eine Bougueran-omalie von –3,2 mGal. Mittels geomagneti-schen Messungen wurden die Verbreitung so-wie die unterschiedlichen Faziesbereiche der
Kraterfüllung erkundet. Die Kraterfüllung be-steht abschnittsweise aus mächtigen vulkani-schen Schlacken, die sich durch eine zusätzli-che remanente Komponente von 400 bis 1300nT in der Magnetfeldanomalie auszeichnen.
Mit den Messergebnissen konnte die Aus-dehnung des Aquifers detailliert bestimmt, so-wie eine Bestätigung über den vorliegendenVulkantyp eines Maar–Diatrem–Vulkanes er-bracht werden.
Die geophysikalischen Ergebnisse wur-den einer kombinierten numerischen 2,5–D Modellierungen unterzogen. Das Zieldieser Modellierung war es, die geologi-sche Tiefenstruktur des vulkanischen Poren–Grundwasserleiters und die Abgrenzung un-terschiedlicher Einheiten zu ermitteln.
Die numerischen Störkörpermodelle derPotenzialfelder sind bezüglich der Freiheits-grade unterbestimmt. Ein beobachteter Zu-stand des natürlichen Feldes kann im Mo-dell durch unendlich viele Lösungsansätze re-präsentiert sein. Dieses Dilemma kann nurdurch geologisch–vulkanologische Apriori–Informationen eingeschränkt werden. Sokonnten im vorliegenden Fall die petrophysi-kalischen Größen der Dichte, Suszeptibilitätund remanenten Magnetisierung durch Mes-sungen an Probenmaterial bestimmt sowie an-hand von Literaturangaben abgeleitet und demModell als unveränderliche Parameter vorge-geben werden. Zu Form und Anordnung derStörkörper sind ebenfalls einzelne Elementefixierbar, so z.B. der Einfallswinkel des Kra-terrandes oder die Position des Übergangsbe-
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 399
reiches vom Diatrem zur Kraterfüllung.Die geologisch–vulkanologischen Apriori–
Informationen führten zu einer wesentlichenEinschränkung der verbleibenden Freiheits-grade und einer raschen und plausiblem An-passung des Störkörpermodells an die Mess-ergebnisse.
Demnach wird die Bougueranomalie zugleichen Teilen von den Gesteinen des ca.800 m tiefreichenden Diatrems (Δρ = 0,2 −0,3g/cm3) und der 100 m bis 200 m mächti-gen Kraterfüllung (Δρ = 0,6−0,7g/cm3) ver-ursacht. Die Kraterfüllung zeigt eine deut-liche Asymmetrie in ihrer Mächtigkeitsver-teilung und wird ungleichmäßig von einemSchlackenkörper ausgefüllt. Großflächig wirddieser von Kratersedimenten in variierenderMächtigkeit überlagert.
Auf Grundlage der Störkörpermodelle wur-den Erkundungsbohrungen abgeteuft und einTrinkwasserbrunnen geplant, mit dem die ge-samte Vulkanstruktur wasserwirtschaftlich er-schlossen werden kann.
400 Abstracts
UI07 – Di., 25.2., 09:30-09:50 Uhr · HS2Perk, M., Tezkan, B. (Institut für Geophysik und Meteorologie, Universität zu Köln), Hördt, A.(Institut für Geologie, Universität Bonn)
Interdisziplinäre Untersuchung einer Altlastfläche in Köln (NORISC-Projekt)E-Mail: [email protected]
Im Rahmen des 5. europäischen Rahmen-programms, welches sich mit den ThemenEnergie, Umwelt und erhaltenswerten Ent-wicklungen beschäftigt, wird im NORISC-Projekt die Altlastenerkundung in urbanenGebieten bearbeitet. Das Ziel dieses Projek-tes ist, die bisherigen standardmäßigen Unter-suchungen durch eine Mischung von innova-tiven und interdisziplinären Methoden erheb-lich zu beschleunigen und durch eine Vor-Ort-Interpretation der Messergebnisse die Kostenzur Untersuchung der Fläche drastisch zu sen-ken.
Für die Geophysik stellt dieses Projektdie Möglichkeit dar, sich in der Altlaste-nerkundung stärker zu etablieren und ihrenBekanntheitsgrad zu erhöhen. Bei weit-gehend unbekannten Untersuchungsgebietensoll die Geophysik helfen, die Untergrund-struktur aufzuschlüsseln (z.B. Detektierungdes Grundwasserspiegels) und die Chemie zuKontaminations-Hotspots zu führen und da-durch die Anzahl der Bohrungen für chemi-sche Untersuchungen erheblich zu reduzieren.
Um die geplante Zeit- und Kostenredukti-on zu verwirklichen werden zwei Software-pakete entwickelt. Einerseits soll eine opti-male Auswahl aus Methoden der (Bio-) Che-mie, (Hydro-) Geologie und Geophysik un-terstütz werden (DSS: Decision Support Soft-ware). Andererseits müssen die Messergeb-nisse, die im Feld produziert werden, auchvor Ort in einem gemeinsamen Kontext visua-lisiert werden (3D-Visualisierungsprogramm,das auf dem XML-Datenformat aufbaut und
das eine Datenbankschnittstelle besitzt), umso noch während der Untersuchung eventuelleÄnderungen im Untersuchungsbetrieb vorzu-nehmen.
Kernstück dieses Projektes ist das DSS,welches schon im Projekt an ausgewähltenFlächen getestet wird. Nur so kann gewähr-leistet sein, dass Fehler frühzeitig erkannt wer-den und so ein möglichst optimaler Outputder verschiedenen Methoden erreicht werdenkann.
Der erste Test der DSS fand auf einer Alt-last in Köln statt, welche zu einem ehemaligenRaffineriegelände gehört. Dort sollte eine ehe-malige Betankungstation für LKW untersuchtwerden. Da zum damaligen Stand die Soft-ware in den Anfangsstadien war, wurde eineEndauswahl der Methoden per Hand durchge-führt.
Die Aufgabe der Geophysik bestand inder Untersuchung des Untergrundes mit Hilfeder Geoelektrik (Detektierung des Grundwas-serspiegels, Sand/Kies-Übergänge), Georadarund EM61 (verborgene Leitungen, Kabel undBehälter).
Es wurde eine Schlumberger-Anordnungmit 2 m Elektrodenabstand und 82 m Auslage(insg. 12 Profile) gewählt, um den Grundwas-serspiegel zu detektieren. Der Profilabstandfür GPR and EM61 betrug 1 m.
Zusätzlich zu den oben definierten Aufga-benstellungen sollte getestet werden, ob dieGeophysik die Geochemie bei der Festlegungvon Bohrlokationen unterstützen kann. Umzu untersuchen, ob Kohlenwasserstoffreste
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 401
in bevorzugten Widerstandsregionen auftau-chen, wurden sowohl auffallend hochohmige,niederohmige Bereiche als auch Übergangs-Bereiche aus den vertikalen und horizonta-len 2D-Ergebnissen der Geoelektrik ausge-wählt. So sollte ein Überblick über die Ver-teilung einer möglichen Kohlenwasserstoff-Kontamination gewonnen werden. Zusätzli-che von den Chemiekern gemachte Bohrun-gen sollte die Befunden verifizieren.
Von den 16 Vorschlägen der Geophysikwurden in 9 Bohrungen nachweisbare Koh-lenwasserstoffe gefunden, wobei diese kei-nem spezifischen Widerstandsbereich zuge-ordnet waren.
Die Ergebnisse der EM61 Messung und desGPR zeigten zwei vorher nicht bekannte Pipe-lines. Ohne diese Untersuchung hätten dieseLeitungen durch Bohrungen beschädigt wer-den können.
Bisherige Untersuchungen ergeben keineaussagekräftigen Korrelationen zwischen Wi-derständen, Kohlenwasserstoffgehalt und Re-flektivitäten, jedoch ist ein leichter Trend zunegativen Korrelationen für die Reflektivitätzu erkennen.
Eine Möglichkeit für die geringe Korrelati-on kann sein, daß zum einen die Fläche seitrund 50 Jahren brach liegt und Reaktionspro-dukte mit Bakterien abgebaut und vom Grund-wasser weg transportiert wurden. So könn-ten Zonen mit erniedrigten Widerständen nichtmehr nachgewiesen werden. Eine weitereMöglichkeit liegt in der gemessenen Konzen-tration der Kohlenwasserstoffe, die möglicher-weise zu gering ist, um eine quantitative Aus-sage über mögliche Korrelationen machen zukönnen.
402 Abstracts
UI08 – Di., 25.2., 09:50-10:10 Uhr · HS2Müller, M., Mohnke, O., Schmalholz, J., Yaramanci, U. (TU Berlin)
INTERURBAN: Geophysik auf kleinen SkalenE-Mail: [email protected]
Der Wasser- und Stofftransport, die räum-liche Variabilität sowie Veränderungen imOberboden sind die zentralen Fragestellun-gen der DFG Forschergruppe 409 (INTERUR-BAN) in Berlin. Hauptziel ist es, die Um-setzungsprozesse auf urbanen Standorten zucharakterisieren und den Stofftransport zu be-stimmen. Für die Geophysik standen in derersten Projektphase zwei Frage-stellungen imVordergrund:
1. Die Untersuchung der räumlichen He-terogenität von Bodeneigenschaften und ihreEinflüsse auf Teilprozesse.
2. Die Erfassung des Wasser- undStofftransport auf urbanen Standorten unddie Übertragung von Strukturparametern vonPunkten auf die Fläche.
Neben Standardverfahren wie Geoelek-trik und ground penetrating radar (GPR),kommt die surface nuclear magnetic reso-nance (SNMR) zum Einsatz. Ziel wares, die geophysikalischen Verfahren in Meß-und Auswertetechnik weiterzuentwickeln, umdas Auflösungsvermögen im oberflächenna-hen Bereich zu erhöhen. Ein Teilziel ist dieAufdeckung grundlegender Zusammenhängezwischen den NMR-Parametern, der komple-xen elektrischen Leitfähigkeit, des komple-xen Dielektrizitätskoeffizienten und den Po-renstrukturgrößen, bzw. diese für die hier vor-liegenden heterogenen Böden und Standortbe-dingungen zu spezifizieren, vor allem die Be-stimmung der Feuchte bzw. der Feuchtever-teilung in der ungesättigten Zone.
Wir zeigen Untersuchungen von zwei urba-nen Flächen in Berlin:
1. Das Gelände Buch liegt auf ehemali-gen Rieselfeldern am Stadtrand von Berlin,auf denen bis in die 80er Jahre des 20. Jahr-hunderts Abwässer Berlins ungeklärt versi-ckert wurden. Der Boden ist dort hochgradigmit Schwermetallen und organischen Abfällenkontaminiert.
2. Der Tiergarten, eine großstädtische Park-anlage mit intensiver Nutzung durch Fußgän-ger, Freizeitsportler und Großveranstaltungen(z.B. Love Parade). Das Meßgebiet Tiergartengliedert sich in zwei Teilbereiche: Zum Einenein Profil, welches von einer der am stärkstenbefahrenen Straßen Berlins (Hofjägerallee) ca.380 m in den Park hineinreicht. Zum Ande-ren eine Intensivfläche, auf der zusammen mithochauflösender Geophysik und bodenphysi-kalischen Langzeitmessungen die kleinräumi-ge Stoffdynamik bestimmt werden soll.
Wir zeigen sowohl Ergebnisse der metho-dischen Weiterentwicklungen als auch Ergeb-nisse der Wiederholungsmessungen zur Un-tersuchung der Wasserdynamik. Die me-thodischen Entwicklungen erfolgten vor al-lem im Bereich des Bodenradars (GPR), so-wie bei der (frequenzabhängigen) Geoelek-trik und der NMR. Im Bereich GPR wur-den zum Einen zwei separate 1GHz Anten-nen genutzt um die Feuchte mittels der Bo-denwelle zu bestimmen und diese Daten mittime domain reflectometry (TDR)-Daten ver-gleichen. Zum Anderen wurde eine Tech-nik verwendet, um die Profildaten an einemPunkt mittels einer Sondierung zu Kalibrie-ren (LMS, local moisture sounding). EineGeoelektrik-Rammsonde wurde so umgebaut,
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 403
daß SIP-Messungen rauscharm durchgeführtwerden können und mit SNMR wurden miterste erfolgreiche Messungen auf städischemGebiet mit kleinen Spulenradien (12m) durch-geführt. Neben den großräumigen Messun-gen wurden auf der in Buch eingerichteten In-tensivfläche im Rahmen der Langzeitbeobach-tungen Permanentelektroden eingebracht undgeoelektrische und spektrale induzierte Pola-risations (SIP)-Messungen durchgeführt. DesWeiteren wurden fest im Boden eingebrachteTDR-Sonden genutzt, um geoelektrische Wie-derholungsmessungen durchzuführen.
In unserem Beitrag zeigen wir die integrier-ten Ergebnisse der unterschiedlichen geophy-sikalischen Verfahren in Bezug auf die Auflö-sung der Heterogenität der Wasserverteilungin vertikaler und horizontaler Richtung dieVerknüpfung dieser Daten mit den im Laborbestimmten Strukturparametern.
Webseite: http://www.interurban.de
404 Abstracts
UI09 – Di., 25.2., 10:10-10:30 Uhr · HS2Reinders, J. (Bayreuth), Hanesch, M. (Leoben), Dearing, J. (Liverpool)
Können die magnetische Eigenschaften von Böden Hinweise auf eine eventuell erhöhteSchwermetallbelastung geben ?E-Mail: [email protected]
Böden sind neben Wasser und Luft eine derdrei elementaren Ressourcen der Welt. Bei derNutzung fossiler Brennstoffe und der Metall-verhüttung werden Schwermetalle und andereGefahrstoffe in die Umwelt abgegeben. Die-se Stoffe können nach der Anreicherung imBoden in die Nahrungskette gelangen wo siebei entsprechend hoher Konzentration ein Ge-sundheitsrisiko darstellen. Es ist deshalb uner-läßlich, den Belastungsgrad von Böden so ge-nau wie möglich zu kennen. Allerdings sindquantitative, geochemische Methoden relativteuer und deshalb kaum zur ausreichend dich-ten Kartierung von Böden geeignet.
Ein anderes Nebenprodukt der Verbrennungsind kristalline Eisenoxide (Magnetit, Häma-tit), die durch ihre magnetischen Eigenschaf-ten schnell, günstig und dabei mit hoher Sensi-tivität gemessen werden können. Bei der Ver-brennung entstehen dabei vor allem grobkör-nige Magnetitkugeln, die sich durch ein cha-rakteristisches magnetisches Signal auszeich-nen.
Im Vortrag werden die Ergebnisse einer in-terdisziplinären Untersuchung Waliser Bödenzusammengefasst. An 782 Standorten, ent-sprechend einem 5x5 km Raster, wurden dieWaliser Böden vom British Soil Survey be-probt und quantitativ analysiert. An diesenProben wurde die Konzentration von 33 Ele-menten und bodenchemischen Parametern be-stimmt und kartographisch dargestellt (Mc-Grath & Loveland, 1992). Zusätzlich zu die-sem Daten haben wir die magnetische Suszep-tibilität als Maß für die Menge der magne-
tischen Minerale und die frequenzabhängigeSuszeptibilität als Indikator für die magneti-schen Korngrößen gemessen.
Zur Identifikation von Korrelationen zwi-schen den gesteinsmagnetischen Parameternund den geochemischen Parametern in diesemDatensatz wurden Unschärfestatistiken (fuzzyc− means). Die Klassifizierung in natürlicheund verschmutzte Böden gelingt schon bei ei-ner geringen Anzahl von Klassen. Ab einemKlassifizierungsmodell, das sieben Klassenannimmt kann eine Probengruppe ausgeglie-dert werden, die sich durch erhöhte Schwer-metallwerte und ein charakteristisches magne-tisches Muster auszeichnet. Zusätzlich ist diegeographische Verteilung dieser Probengrup-pe (Klasse 5) in der Nähe von aktuell oder his-torisch industriell geprägten Gebieten auffäl-lig. Eine weitere Probengruppe (Klasse 7) trittvor allem in geringen Höhen und auf eisen-reichem geologischen Untergrund auf. Die-se Klasse scheint ein natürliches magnetischesSignal zu repräsentieren.
Proben aus Klasse 5 und aus Klasse 7 wur-den weitergehend gesteinsmagnetisch unter-sucht. Die Ergebnisse weisen daraufhin, dassKlasse 5 im Vergleich zu Klasse 7 ein sehrviel engeres magnetisches Korngrößenspek-trum hat. In Klasse 7 beobachten wir das Ma-ximum des Korngrößenspektrums im Bereichunterhalb von ca. 30 nm, während es in Klas-se 5 bei einem Korndurchmesser oberhalb vonca. 10 µm auftritt. Dieser Befund stimmt mitmikroskopischen Aufnahmen von Eisenmine-ralen aus Stäuben überein, die in Schornstein-
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 405
Abbildung 1: Klassifizierung von Waliser Böden nach geochemischen und magnetischen Pa-rametern.
filtern gesammelt wurden.Die magnetische Charakterisierung von Bö-
den scheint also geeignet diejenigen Areale zubestimmen, die für Schwermetallanreicherun-gen höffig sind. Zum “Screening“ist die Me-thode deshalb sicher sinnvoll und gewinnbrin-gend einsetzbar.
EU−Projekt FMRX980247, MAG−NET
406 Abstracts
UI10 – Mi., 26.2., 09:30-09:50 Uhr · HS7Grinat, M., Sauer, J., Südekum, W. (GGA-Hannover)
Zum Nachweis von Kerosin–Kontaminationen mit Hilfe der GeoelektrikE-Mail: [email protected]
Auf dem Flughafen Schwerin–Parchim(Mecklenburg–Vorpommern) wird seit Ende1999 eine mit Kerosin kontaminierte Flächesaniert. In diesem Bereich führt das Insti-tut für Geowissenschaftliche Gemeinschafts-aufgaben (GGA–Institut) in Hannover unab-hängig von den Sanierungsarbeiten geoelektri-sche Untersuchungen durch. Dabei wird ge-prüft, ob das Kerosin mit Hilfe der Geoelek-trik nachzuweisen ist. Bei Testmessungen hat-te sich insbesondere die geoelektrische Kartie-rung als erfolgversprechend erwiesen, da derBereich mit erhöhten scheinbaren spezifischenWiderständen gut mit der aus Pegelbohrungenbekannten Ausdehnung der kerosinbelastetenZone übereinstimmt (GRINAT et al. 2000).
Neben den geoelektrischen Kartierungenin Wenner–Elektrodenanordnung liegenTiefensondierungen in Schlumberger–Elektrodenanordnung, Messungen mitverschiedenen Multielektrodenapparaturen(SYSCAL R2, RESECS) sowie erste Ver-suche mit versenkten Elektroden (etwa 6 mTiefe) vor. Ergänzend wurde das Verfahrender Spektralen Induzierten Polarisation ein-gesetzt. Darüber hinaus hat die Firma RSDynamics im November 2002 Messungen mitdem System ECOPROBE zur Analyse derBodenluft auf Kohlenwasserstoffe durchge-führt. Auf den Einsatz des Bodenradars wurdeverzichtet, da aufgrund von Testmessungenund Modellabschätzungen die Mächtigkeitder Kerosinschicht für die Ausbildung vonzwei getrennten Reflexionshorizonten ander Obergrenze der Kerosinschicht sowie ander Grenze Kerosin / Grundwasser als nicht
ausreichend angesehen wurde.Die Inversion der gemessenen geoelektri-
schen Pseudosektionen mit dem Auswertepro-gramm RES2DINV zeigt keine erhöhten spe-zifischen Widerstände im Tiefenbereich derKerosinzone (4 – 6 m unter Gelände). Dafürsind insbesondere über der Kerosinschicht diespezifischen Widerstände im Tiefenbereich bisetwa 4 m unter Gelände erhöht.
Zwei Tiefensondierungen inSchlumberger–Elektrodenanordnung mitdem Messsystem SIP–Fuchs deuten an, dassdie spezifischen Widerstände im kerosinbe-lasteten Gebiet gegenüber dem unbelastetenBereich oberhalb der Kerosinphase erhöhtsowie im Grundwasserleiter unterhalb derKerosinphase erniedrigt sind. Die aus denscheinbaren spezifischen Widerständen derFrequenzen 0,183 Hz und 5,86 Hz berechne-ten Prozentualen Frequenzeffekte (PFE) sindbei der im belasteten Bereich durchgeführtenSondierung größer als bei der Sondierungim unbelasteten Gebiet. Die PFE–Wertesind jedoch wesentlich störanfälliger als diescheinbaren spezifischen Widerstände undkönnen nur für Elektrodenauslagen bis maxi-mal 20 m L/2 angegeben werden. Ähnlichesgilt für die Phasenverschiebung zwischenStrom und Potentialdifferenz, die linear mitden PFE–Werten verknüpft ist.
Darüber hinaus finden seit Februar 2000 inAbständen von wenigen Wochen bis MonatenWiederholungsmessungen auf zwei Profilenstatt. Diese Messungen erfolgen in Wenner–Elektrodenanordnung mit einem Elektroden-abstand von 5 m (Messsystem 4–Punkt light
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 407
der Firma LGM). Ziel ist dabei herauszufin-den, ob sich die scheinbaren spezifischen Wi-derstände im belasteten Gebiet im Laufe derSanierung verringern (sofern sie mit der Ke-rosinbelastung zusammenhängen). DerartigeVeränderungen sind bisher (noch) nicht auf-getreten, obwohl von den im Untergrund ver-muteten 900 m3 Mineralölkohlenwasserstof-fen (KLOSA & UEBERSOHN 2000) bereitsetwa 90 – 100 m3 Kerosin zurückgewonnenwerden konnten.
Die Interpretation der Messungen erfolgtin Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt fürGeowissenschaften und Rohstoffe (BGR) so-wie mit dem Ingenieurbüro unp (Bad Do-beran), das die Sanierung leitet.
GRINAT, M., SAUER, J., SCHURICHT,R., SÜDEKUM, W. & ZIEKUR, R. (2000):Schadensfall Parchim: Geoelektrik und Bo-denradar zum Nachweis einer Kerosinbelas-tung auf dem Flughafen Schwerin–Parchim. –Z. angew. Geol., 46: 91–96.
KLOSA, D. & UEBERSOHN, D. (2000):Schadensfall Parchim: Entwicklung von Ver-fahren zur Schadensfeststellung sowie Unter-suchungen zur Wechselwirkung Schadstoff –Hydrochemie. – Z. angew. Geol., 46: 66–71.
408 Abstracts
UI11 – Mi., 26.2., 09:50-10:10 Uhr · HS7Weihnacht, B., Börner, F. (Dresden, Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.)
Untersuchung dielektrischer Eigenschaften von Gesteinen und Böden im Radarfrequenz-bereichE-Mail: [email protected]
Hauptziel dieser Arbeit war neben der Klä-rung des Porenfluideinflusses auf die spektra-len dielektrischen Eigenschaften die Untersu-chung der Wechselwirkungen an der innerenOberfläche des Gesteins zwischen Matrix undPorenfüllung.
Analysiert wurden wasserhaltige silikati-sche und karbonatische Gesteine und Bödenmit unterschiedlichen Gehalten an Tonminera-len und TOC. Es wurden natürliche und künst-lich hergestellte Proben verwendet. Zur Be-schreibung der dielektrischen Übertragungs-funktion wurde das sog. Leitfähigkeitsmodell(FECHNER, 2000) verwendet, welches das fre-quenzabhängige Verhalten sowohl des Real-teils als auch des Imaginärteils im Megahertz-bereich erfasst.
Bei der Auswahl des Probenmaterials wareine möglichst große Bandbreite der spezifi-schen inneren Oberfläche wichtig. Künstli-che Lockergesteinsproben wurden mit 0.15 %,1.5 % und 15 % fein zerteilter Kohle angerei-chert, um den TOC-Gehalt signifikant zu vari-ieren. Eng damit verbunden wurde der Ein-fluss der Korngröße untersucht. Die ausge-wählten Lockergesteine reichten von Ton bisFeinsand.
An Festgesteinen wurden Sand- und Kalk-steine untersucht. Bei den Sandsteinen galtdas Augenmerk dem Einfluss der Porositätund der inneren Oberfläche auf die dielek-trischen Eigenschaften. Neben diesen si-likatischen wurden als karbonatische Sedi-mentgesteine sehr reine und mit verschiede-nen Fremdmaterialien verunreinigte Kalkstei-
ne geringer Porosität als Probenmaterial aus-gewählt.
Für die Bestimmung der Transferfunk-tion wurde ein Dielektrisches Messsystem(DEMS) aufgebaut, das die Bestimmung derkomplexen dielektrischen Eigenschaften anformstabilen Gesteinsproben im Frequenzbe-reich von 0.3 bis 3 GHz erlaubt. Für die Ana-lyse nicht formstabiler Lockergesteine undFlüssigkeiten wurde ein spezieller Messzel-leneinsatz entwickelt und in das Messsystemimplementiert.
Bei der Untersuchung künstlicher Locker-gesteinsproben (Ton-Kalk, Sand-Kalk) konn-te gezeigt werden, dass die dispersiven Eigen-schaften nicht nur durch die elektrochemischeWechselwirkung an den Korngrenzen hervor-gerufen werden, sondern auch die Wassersät-tigung einen Einfluss hat.
Für die karbonatischen Festgesteinsprobenlässt sich der Einfluss von Wassergehalt undspezifischer innerer Oberfläche trennen. EineVorkenntnis des Wassergehaltes ist nicht un-bedingt erforderlich, um eine Klassifizierungder Gesteinsmatrix gemäß ihrer Zusammen-setzung vornehmen zu können.
Bei der Untersuchung der silikatischenLockergesteinsproben zeigte sich eine engeWechselwirkung der drei EinflussfaktorenSättigung, Salinität des Porenfluids undder spezifischen inneren Oberfläche. DieErhöhung des TOC-Gehaltes führte zu einerErhöhung der inneren Oberfläche mit Auswir-kung auf die Frequenzabhängigkeit.
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 409
Danksagung: Die Untersuchungen fan-den im Rahmen des von der DeutschenForschungsgemeinschaft geförderten Vorha-bens BO 1082/6-1,2 statt.Literatur: FECHNER, T. (2000): Entwick-lung eines spektralen Auswerteverfahrenszur Bestimmung von Qualitätsparameternin Kalksteinlagerstätten auf der Basis vonBohrlochradarmessungen, Diss. TU Berlin.In: Proceedings des DGFZ e.V. Heft 19,Dresden 2000.
Webseite: http://www.dgfz.de
410 Abstracts
UI12 – Mi., 26.2., 10:10-10:30 Uhr · HS7Stoffregen, H., Schmalholz, J., Täumer, K., Yaramanci, U. (TU Berlin)
Messungen der Heterogenität des Wassergehalts im Oberboden in hoher räumlicher Auf-lösung mittels GeoradarE-Mail: [email protected]
Das Georadar wird in der Bodenkundezunehmend zur Ermittlung von Standortei-genschaften und Wassergehalten eingesetzt.So wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit derBodenwelle zur Bestimmung des Wasserge-halts der obersten Bodenschicht verwendet.Die horizontale räumliche Auflösung dieserMessungen liegt dabei im Meterbereich. Fürdie Bestimmung der kleinräumigen Heteroge-nität der Wassergehalte reicht diese Auflösungallerdings nicht aus, da z.B. typische Musterder Verteilung von hydrophilen und hydropho-ben Bereichen Größenordnungen im Dezime-terbereich aufweisen.
Im Vortrag werden Untersuchungen gezeigtin denen eine Verzerrung der direkten Wa-velets ausgewertet wurde. Die Experimen-te wurden mit einem RAMAC/GPR und ei-ner abgeschirmten 1 GHz Antenne von Mala-Geoscience durchgeführt. Sender und Emp-fänger sind in einem Gehäuse, der Abstandzwischen beiden beträgt laut Herstelleranga-ben 11 cm. Bei Messungen mit dieser An-tenne konnte eine verzerrungsbedingte zeitli-che Verschiebung der direkten Wellen in Ab-hängigkeit vom Wassergehalt der obersten Bo-denschicht festgestellt werden. Die flächen-hafte Auflösung dieser Messung liegt im Be-reich von wenigen dm2. Die Untersuchun-gen wurden zunächst auf unbewachsenen Bo-den durchgeführt und die Wassergehaltsvertei-lung auf einer Fläche von 1 m2 bestimmt. Ver-glichen wurden die Messungen des Georadarsmit Wassergehaltsbestimmungen durch Time–Domain–Reflectrometry Sonden (TDR).
Weitere Messungen wurden auf einer Park-fläche im Berliner Tiergarten durchgeführt.Auf einem Transekt von 30 m Länge mit Was-sergehalten zwischen 5 und 45 Vol.% wurdenTDR Messungen sowie Messungen mit demGeoradar durchgeführt. Auch hier ergab sicheine gute Übereinstimmung zwischen beidenMessungen. Das Georadar hat dabei den Vor-teil einer noninvasiven Methode, die auf einerFläche eingesetzt werden kann. Die TDR–Messung führt dagegen bei hoher räumlicherund zeitlicher Auflösung zu erheblichen Stö-rungen des untersuchten Bodens. In zukünfti-gen Untersuchungen soll die zeitliche Verän-derung der Verteilung von hydrophoben undhydrophilen Bereichen auf einer Fläche von2m2 bestimmt werden.
Es gilt anzumerken, dass Messungen mit ei-ner 800 MHz Antenne des gleichen Herstel-lers dagegen keine einheitliche Verschiebungder Welle in Abhängigkeit des Wassergehaltsergaben. Da es sich um Messungen im reakti-ven Nahfeld der Antenne handelt, überlagernsich unterschiedlichste Effekte in Abhängig-keit von Antennengeometrie, Steuerelektronikund Abschirmung.
Webseite: http://www.interurban.de
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 411
UI13 – Mi., 26.2., 11:00-11:20 Uhr · HS7Lück, E., Spangenberg, U. (Potsdam)
Monitoring des Wasserhaushaltes von BödenE-Mail: [email protected]
Für verschiedene umweltrelevante Frage-stellungen sind Kenntnisse über den Wasser-haushalt in den obersten Bodenschichten rele-vant. In einzelnen Wissenschaftszweigen wiez.B. den Agrarwissenschaften, der Bodenkun-de, der Hydrologie und den Umweltwissen-schaften sind zahlreiche Anstrengungen zurräumlich und zeitlich dichten Bestimmung desBodenwassergehaltes zu beobachten. Haupt-sächlich kommen die direkten Verfahren wirTensiometer, TDR-Sonden und Bohrstockbe-probungen zum Einsatz. Will man nicht Un-mengen von Sensoren in das Untersuchungs-gebiet einbauen, dann sind die punktuell ge-wonnen Daten schwer in die Fläche zu extra-polieren. Eine Kopplung geophysikalischer -insbesondere geoelektrischer - Untersuchun-gen mit punktuell bestimmten Bodenfeuchtengestattet es, die Interpolation zwischen ein-zelnen Messstellen vorzunehmen. Für zweiStandorte (einen gewachsenen und einen ge-schütteten Boden) wurde ein mehrjährigesMonitoring durchgeführt. Gemessen wurdenauf zwei Profilen geoelektrische Kenngrößen(Widerstand und Aufladbarkeit), die Boden-temperatur und an ausgewählten Stellen derBodenwassergehalt. Nach der Korrektur desTemperatureinflusses zeigen sich deutlich dieaus Laboruntersuchungen bekannten Korrela-tionen zwischen den elektrischen Größen undder Bodenfeuchte. Die sich im Gelände abbil-denden Raummuster unterliegen in Abhängig-keit vom Pflanzenbestand leichten jahreszeitli-chen Schwankungen.
412 Abstracts
UI14 – Mi., 26.2., 11:20-11:40 Uhr · HS7Igel, J., Kurz, G., Schulz, R. (GGA-Institut, Hannover)
Erkundung von Problemzonen im Salinar mit dem GeoradarE-Mail: [email protected]
Das Georadar (GPR) wird schon seit An-fang der 70er-Jahre in Salzlagerstätten zur Er-kundung von Schichtgrenzen benutzt (THIER-BACH 1974). Im Salzgestein, mit seinen i.A.hohen spez. elektr. Widerständen, herr-schen fast ideale Voraussetzungen für die Aus-breitung hochfrequenter elektromagnetischerWellen, und es können Eindringtiefen von biszu mehreren 100 m erreicht werden.
Die hier vorgestellten Radar-Untersuchungen sind Teil eines vom BMBFgeförderten Projektes zur Nutzung zerstö-rungsfreier geophysikalischer Methoden alsBeitrag zur Beurteilung der Langzeitsicher-heit von Endlagern und Untertagedeponien(Fkz. BMBF 02C0851, 861, 871) (JACOBS etal. 2003, KRAUSE et al. 2003). Dabei werdenLaugenvorkommen und Feuchtezonen, dieals Problemzonen angesehen werden müssen,untersucht. Die natürlichen Laugenvorkom-men sind fast immer an Anhydritschichtengebunden, die im Vergleich mit anderenSalzen nicht so duktil sind, und deshalbmeist geklüftet sind. Neben dem Risiko derMobilisierung der Gefahrenstoffe durch dieLauge besteht insbesondere bei ungesättigtenLaugen, wenn z.B. eine Verbindung zumGrundwasser besteht, die Gefahr, dass dasSalzgestein gelöst wird und dadurch Weg-samkeiten entstehen und ggf. das gesamteGrubengebäude beschädigt wird. SolcheZonen sind v.a. durch eine erhöhte elektr.Leitfähigkeit charakterisiert, was sie leichtmit elektrischen und elektromagnetischenMethoden detektierbar macht.
Die in situ Messungen wurden im Kaliberg-
werk Sigmundshall der K+S in Niedersachsendurchgeführt. Dort wurde bei Erkundungs-bohrungen ein Laugenvorkommen im Haupt-anhydrit (A3) angetroffen, das mit mehrerengeophysikalischen Verfahren von einer etwa70 m entfernten Strecke aus erkundet wur-de. Abb. 1 zeigt das prozessierte und tiefen-migrierte Radargramm, das eine constant off-set (co) Messung mit einer 100 MHz Anten-ne über eine Profillänge von 500 m und einerErkundungstiefe von 150 m darstellt. Die Re-flexionen werden einerseits von geologischenSchichtgrenzen zu Hartsalzflözen (K2H), An-hydritschollen (A3) und Anhydritmittelsalzen(am), die im Steinsalz (Na2, Na3) liegen, her-vorgerufen, aber auch von künstlichen Struk-turen wie z.B. Strecken und Schächten.Bei untertägigen Messungen mit ungeschirm-ten Antennen, können aus Profilmessungenkeine Aussage über die Richtung, aus der eineReflexion kommt, getroffen werden. Es wur-den deshalb zusätzlich spezielle Peilmessun-gen durchgeführt, um die räumliche Lage derReflektoren zu bestimmen.
Feuchtezonen und Laugenstellen sind imRadargramm oft nicht direkt als Störkörper zuidentifizieren, da die Grenze von trockenemzu feuchtem Salz meist nicht scharf ausge-prägt ist, sondern durch einen stetigen Über-gang über mehrere Meter bis 10er-Meter ge-kennzeichnet ist. An diesen Gradientenzonenmit zunehmender elektr. Leitfähigkeit wer-den die elektromagnetischen Wellen kaum re-flektiert (PAWELLEK 1997). Parameterstudiendurch FD-Modellierungen haben gezeigt, dasssolche Gradientenzonen das zurückgeworfene
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 413
Abbildung 1: Radargramm (100 MHz): migriertes constant offset Profil
Wavelet zu niederen Frequenzen hin verschie-ben. Ähnliche Effekte werden auch durch denEinfluss des Kapillarsaumes als Gradienten-schicht bei der Bestimmung des Grundwasser-spiegels mit dem Georadar beobachtet (SHIHet al., 1986). Wegen der geringen Ausdehnungder Gradientenschicht ist der Einfluss nicht sogross, wie bei den untertägigen Laugenvor-kommen. Diese können unter gewissen Um-ständen durch einen Vergleich von Messungenmit unterschiedlichen Frequenzen aufgespürtwerden.
LiteraturTHIERBACH, R.: Electromagnetic Reflectionsin Salt Deposits, J. Geophys. 40, pp. 633-637,1974.JACOBS, F. et al.: Geophysikalische Erkun-dung als Beitrag zur Bewertung der Langzeit-sicherheit von Endlagern und Untertagedepo-nien, 63. Jahrestagung der DGG, Jena, 2003.JUST, A., KRAUSE, Y., TUCH, A.: 3D-Modellierung zur Auswertung linienhaft ge-
messener Untertage-Geoelektrikdaten, 63.Jahrestagung der DGG, Jena, 2003.PAWELLEK, C.: Modellierung der Aus-breitung elektromagnetischer Wellen in 2D-Medien mit Finiten Differenzen und deren An-wendung auf theoretische und praktische Pro-blemstellungen, Dissertation, TU Clausthal,1997.SHIH, S.F., DOOLITTLE, J.A., MYHRE,D.L., SCHELLENTRAGER, G.W.: Using Ra-dar for Groundwater Investigation, J. of Irri-gation and Drainage Engineering, Vol. 112,No. 2, 1986.
414 Abstracts
UI15 – Mi., 26.2., 11:40-12:00 Uhr · HS7Heinse, R., Grützner, C., Schwabe, J., Schikowsky, P. (Universität Leipzig)
Georadarmessungen zur Bewertung von Auelehmdeckschichten - Ein Beitrag zumGrundwasserschutz.E-Mail: [email protected]
Das Poster stellt Ziel und Ergebnisse vonGeoradarmessungen in der Elbaue bei Torgauvor. Damit verbunden sind weitere geophysi-kalische Untersuchungen zur Deckschichtbe-wertung als Beitrag zum Grundwasserschutz,die in einem gesonderten Vortrag präsentiertwerden.
Die Elbaue bei Torgau ist durch eine flä-chenhafte Auelehmdeckschicht gekennzeich-net, die sich in ihren petrophysikalischen Ei-genschaften deutlich von dem im Liegendenfolgenden fluviatilen Sandaquifer abgrenzt.Der Auelehm weist Variationen sowohl inder Mächtigkeit, wie auch in der petrogra-phischen Zusammensetzung auf. Diese Va-riationen sind eng an das Regime des mäan-drierenden Flusssystems gebunden und wei-sen Ausdehnungen von bis zu einigen Deka-metern auf. Sie stellen Schwachstellen in derFunktion der geologischen Barriere vor me-teorischen Schadstoffeinträgen in das Grund-wasser dar.
Auf einer ausgewählten Messfläche beiTorgau erfolgten im Vorfeld monostatischeGeoradar- sowie seismische- und gleichstrom-geoelektrische Messungen. Die geophysika-
Abbildung 1: Bistatische Georadarmessungüber einer sandgefüllten Tonne (2 m - 2.7 m)bei einem Antennenoffset von 0.7 m.
lischen Messungen wurden konsequent durchRammkernsondierungen mit Probennahme er-gänzt.
Die monostatische Georadarmessungen er-folgten mit der SIR 2 - Apparatur von GSSIunter Verwendung einer 200 MHz - Antenne.Sie liefern wertvolle Informationen zu Struk-tur und Mächtigkeit der Auelehmdeckschicht.Die hohe Leitfähigkeit des Auelehms und diedamit verbundene starke Dämpfung der elek-tromagnetischen Welle lassen jedoch nur Aus-sagen bei vergleichsweise geringen Auelehm-mächtigkeiten zu. Reflexionen an der Aueleh-munterkante lassen sich daher wie in Abb. 3nur bis zu Mächtigkeiten von circa einem Me-ter verfolgen.
Die bistatischen Georadarmessungen ha-ben zusätzlich eine stoffliche Charakterisie-rung zum Ziel. Untersucht werden soll, ob ausLaufzeitunterschieden der direkten Bodenwel-le Rückschlüsse auf oberflächliche Material-variationen gezogen werden können. Für dieMessungen kamen zwei Antennen mit 400MHz und 500 MHz zum Einsatz. Sie wurden
Abbildung 2: Bistatische Georadarmessung inder Elbaue bei einem Antennenoffset von 1.5m. Erkennbar ist die direkte Welle (20 ns - 30ns) und Reflexionen an der Auelehmunterkan-te (30 ns - 40 ns).
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 415
Abbildung 3: Monostatische Georadarmessung bei 200 MHz. Erkennbar sind Reflexionenan der Auelehmunterkante bei Profilmeter 15-70 und 120-160, sowie deren Ausbleiben beiProfilmeter 70-120 auf Grund starker Dämpfung.
mit konstantem Offset über die Profile bewegt,wobei kontinuierlich registriert wurde. AufGrund der Tiefpasswirkung des Bodens wur-de die 500 MHz - Antenne als Sender, die 400MHz - Antenne als Empfänger verwendet.
Erste Untersuchungen an einer im Bodeneingebrachten, sandgefüllten Kunststofftonnezeigen die prinzipielle Eignung des Verfahrensunter Verwendung der Antennenkombination.Die deutlichen Laufzeitunterschiede zwischendem bindigen Material und dem Sand sind inAbb. 1 zu erkennen. Untersuchungen mit ver-schiedenen Antennenoffsets zeigen, dass beieinem, der Dimension der Heterogenität ent-sprechenden Offset, die besten Resultate er-zielt werden.
In der Elbaue kann die direkte Bodenwel-le mit der oben angeführten Antennenkombi-nation - auf Grund der starken Dämpfung desAuelehms - jedoch nur bis zu einem maxima-len Offset von circa 1.70 m beobachtet wer-den. Wie in den Abb. 2 und 3 verdeutlicht,werden die Ergebnisse vorangegangener geo-physikalischer Untersuchungen - insbesonde-re monostatischer Georadarmessungen - durchdie bistatischen Georadarmessungen bezüg-lich ihrer Strukturaussage bestätigt. Lokatio-nen geringer Auelehmmächtigkeit zeigen da-nach starke Reflexionen an der Oberkante des
im Liegenden folgenden Sandaquifers in eini-gen Dezimetern Tiefe. Die Variationen der di-rekten Bodenwelle sind am Beispiel der Abb.2 nachweisbar. Diese weisen auf Grund gerin-ger Dielektrizitätskontraste im Auelehmkör-per jedoch nur geringe Laufzeitunterschiedevon maximal 4 ns auf.
Mit Georadarmessungen soll letztlicheinen direkter Zusammenhang zwischen denpetrophysikalischen Parametern Dielektrizi-tätszahl, Ausbreitungsgeschwindigkeit undDämpfung mit hydrogeologischen Eigen-schaften des Auelehms formuliert werden.
416 Abstracts
UI16 – Mi., 26.2., 12:00-12:20 Uhr · HS7Senitz, S., Büchel, G., Jentzsch, G. (IGW, Friedrich-Schiller-Universität Jena), Gabriel, B.,Ziegler, G. (Thür. Landesanstalt f. Umwelt und Geologie), Czerwek, D. (Weiterstadt), Köppen,K.-H. (Wasser und Boden GmbH, Boppard)
Die Leistungsfähigkeit herkömmlicher geophysikalischer Methoden bei der Grundwas-sererkundungE-Mail: [email protected]
Im Rahmen von hydrogeologischen Unter-suchungen werden unvermindert häufig geo-physikalische Mess- und Auswerteverfahreneingesetzt. Anhand von drei Beispielen wirdnachfolgend deren Leistungsfähigkeit für Fra-gestellungen der Hydrogeologie dargestellt.
Beispiel 1 betrifft den Bewertungstand bzw.-zustand von Bohrungen in Thüringen dieals Grundwassermessstellen im Landesmess-dienst fungieren. Zeitreihen zum Grund-wasserstand wurden mit der Methode derGezeiten- / Zeitreihenanalyse analysiert, daaus der Zeitreihe selbst meist nicht ersichtlichist, ob die hydraulischen Eigenschaften derMessstelle während des Messzeitraums kon-stant sind, also die Aquifereigenschaften rich-tig wiedergegeben werden. Häufig verändertsich die hydraulische Anbindung an den Aqui-fer z.B. durch Ablagerungen an den Filter-strecken. Liegt in Messstellen eine gespann-te/teilgespannte Hydraulik vor, kann mit derMethode der Gezeiten- / Zeitreihenanalyse diezeitliche Änderung des hydraulischen Zustan-des abgeschätzt werden. Hierbei wird derFrequenzinhalt für unterschiedliche Abschnit-te der Zeitreihe berechnet und verglichen. InAbb. 1 ist beispielhaft ein Vergleich vonAmplitudenspektren der Messstelle Goldbach(Thüringer Becken) dargestellt. Die drei mar-kanten Frequenzbereiche sind in beiden Ab-schnitten der Zeitreihe enthalten, woraus aufeine konstante Hydraulik der Messstelle wäh-rend des Messzeitraums geschlossen werden
kann. Unterscheidet sich der Frequenzinhalt,muss von einer veränderten Hydraulik ausge-gangen werden.
Das Beispiel 2 betrifft vulkanischePorengrundwasser-Aquifere in der quartärenVulkanzone der Westeifel. Die Erkundungs-problematik solcher Grundwasserleiter liegtvor allem in der z.T. erheblichen Abweichungder unterirdischen Einzugsgebiete gegen-über den oberirdischen. Am Beispiel desEselsberges bei Dockweiler konnte mit demEinsatz der Potenzialmethoden Geomagnetikund Gravimetrie eine Aufschlüsselung derunterirdischen Einzugsgebiete erzielt werden.Untersucht wurden vulkanische Lockermate-
Abbildung 1: Vergleich von Amplitudenspektren,berechnet aus der Zeitreihe der Messstelle Gold-bach
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 417
rialien (Schlacken, Lapillituffe, Aschen) einerausgedehnten Krater- und Diatremfüllung.Als á priori Informationen lagen hydrogeo-logische Randbedingungen und Kenntnisseüber hydraulische Eigenschaften der vulka-nischen Lockergesteine und des devonischenGrundgebirges vor. Weiterhin konnten ausAnalogieschlüssen zu anderen VorkommenAngaben über die Gesteinsdichten, Suszep-tibillitäten und die möglichen Formen dervulkanischen Vorkommen eingeschränktwerden. Die Kombination der geophysikali-schen Methoden mit den hydrogeologischenRandbedingungen und einfachen geome-trischen Annahmen ermöglichte genaueAussagen über die laterale Verbreitung derTuffe und eine Abschätzung der Tiefenerstre-ckung. Ein Quellaustritt konnte eindeutig alsÜberlaufquelle charakterisiert werden. Diegeophysikalischen Untersuchungen liefertenschließlich die Grundlage für die weiterenProduktionsauflagen der nahe gelegenen La-vasandgrube und die Schutzzonenausweisungfür eine Wassergewinnung.
In Beispiel 3 handelt es sich um quartäreSedimente bei Mechernich (Eifel), die aus ge-ring durchlässigen Schluffen und gut bis sehrgut durchlässigen Sanden und Kiesen beste-hen. Ein ehemals in der Ortschaft genutzterTrinkwasserbrunnen sollte oberhalb des Ortesund eines Neubaugebietes neu gefasst werden.Eine umfangreiche geoelektrische Schlumber-gersondierungskampagne im Anstrombereichder Ortschaft konnte die Sand- und Kiesrin-nen hinreichend genau identifizieren. Obwohlsich der Hauptabstrom des Grundwassers aufdie Rinnen konzentriert, traten hier die höchs-ten Widerstände auf, was eine Folge der ge-ringen elektrischen Leitfähigkeiten der Sandeund Kiese ist.
In allen aufgeführten Beispielen war derEinsatz der Geophysik in Kombination mit
grundlegenden geologischen und hydrogeolo-gischen á priori Informationen äußerst erfolg-reich.
418 Abstracts
UI17 – Mi., 26.2., 12:20-12:40 Uhr · HS7Schröer, K., Seiferlin, K., Spohn, T. (Institut für Planetologie, Westfälische-Wilhelms-Universität Münster), Marczewski, W., Gadomski, S. (Space Research Centre Warsaw)
EXTASE (EXperimentelle Thermalsonde für die Anwendung in Schneeforschung undErdwissenschaften) - Erste Anwendungen und ErgebnisseE-Mail: [email protected]
Auf der letzten DGG–Tagung 2002 wurdendie Funktionsweise der EXTASE - Sonde unddie möglichen Anwendungen im Rahmen ei-nes Posters präsentiert, dieses Mal sollen dieersten Meßergebnisse vorgestellt werden:Unter dem Titel „First Chance“ werden vomBMBF Vorhaben gefördert, in denen ausTechnologien, die im Rahmen von weltraum-bezogenen Projekten entwickelt wurden, An-wendungen, die nicht im Zusammenhang mitWeltraumforschung stehen, entwickelt wer-den. Im Zuge dessen hat das Institut für Pla-netologie der Universität Münster–basierendauf der MUPUS Thermalsonde - das EXTA-SE - Konzept für die Entwicklung einer Ther-malsonde für die Anwendung in der Schnee–und Lawinenforschung sowie den Geowissen-schaften (u.a. Bodenkunde, Permafrost, De-ponien) entwickelt.MUPUS ist Teil der am 15.1.03 startendenROSETTA–Mission und setzt einen dafür ent-wickelten neuartigen Typ von Temperatursen-soren sowie eine neuartige Methode zur Mes-sung der Wärmeleitfähigkeit und der thermi-schen Diffusivität ein.Kurzbeschreibung der FunktionsweiseGemessen wird die Temperatur über die Mes-sung des elektrischen Widerstandes eines dün-nen Titanium-Sensors. Der gleiche Sensorkann für Messungen der Wärmeleitfähigkeitbeheizt werden. Die 16 Zellen des Sen-sors und die elektrischen Verbindungen sindper Laser auf eine Kapton-Folie aufgedampft.Diese wird anschließend aufgerollt und an die
Innenseite einer Glasfaser-Röhre geklebt. DieLänge der gesamten Sonde beträgt knapp 40cm, der Durchmesser ca. 1 cm. Die Sondebesteht aus 16 Sensoren, wobei die Sensoren-dichte mit der Tiefe abnimmt und die Senso-rengröße mit der Tiefe zunimmt. Diese An-ordnung wurde gewählt, da in geringeren Tie-fen größere Temperaturgradienten und schnel-lere Temperaturänderungen erwartet werden.Derzeit wird das Gerät noch mit einem Da-tenlogger betrieben, der später durch eine ei-gens entwickelte Elektronik ersetzt wird, überdie dann die Messungen per Funk kontrolliertwerden können. Die Elektronik wird außer-dem benötigt, um für die Messungen der Wär-meleitfähigkeit die einzelnen Sensoren behei-zen zu können.Die Sonde bietet durch ihre Bauweise eini-ge Vorteile gegenüber den in den Geowis-senschaften üblichen Methoden zur Untersu-chung von kleinen Tiefenlagen: Ein Aushubvon zu untersuchendem Material zur Platzie-rung von Sensoren entfällt ebenso wie ei-ne zusätzliche aufwendige Verkabelung voneinzelnen Sensoren. Aufgrund des geringenDurchmessers wird die Zerstörung des Mate-rialgefüges und somit die Beeinflussung desumgebenden Temperaturfeldes möglichst ge-ring gehalten. Mit nur einer Sonde kön-nen Temperatur- und Wärmeleitfähigkeitspro-file in 16 Tiefen gleichzeitig gewonnen wer-den.Hieraus ergeben sich eine Reihe von Anwen-dungsmöglichkeiten in den Geowissenschaf-
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 419
ten, von denen nur einige genannt werden sol-len: Schneetemperatur- und Wärmeleitfähig-keitsprofile, Kontrolle des Wärmeflusses aufMülldeponien, in situ Bestimmung der Bo-denfeuchte (BF) als Funktion der Zeit, dabeiwird die BF aus der Änderung der Wärmeleit-fähigkeit abgeleitet u.v.m. Wir konzentrierenuns zur Zeit auf die Gebiete der Schnee- undBodenkunde. Da aufgrund einiger Verzöge-rungen die Feldelektronik noch nicht komplettfertiggestellt wurde, ist es derzeit nicht mög-lich, Wärmeleitfähigkeitsmessungen durchzu-führen, Temperaturprofile jedoch können auf-genommen werden. Mittlerweile wurden ei-ne Reihe von Messungen–sowohl im Labor alsauch im Feld–durchgeführt.Die ersten Testmessungen fanden an verschie-denen Lokalitäten in Polen (wo die Sensorenhergestellt werden) statt. Hierbei handelte essich um Aufnahmen von Temperaturprofilenin verschiedenen Böden. Die aktuellsten Mes-sungen wurden erneut in Polen durchgeführt,in Kooperation mit dem Institute for Agrophy-sics in Lublin.Der erste Meßeinsatz der Sonde im Schneefand auf Spitzbergen statt. In Zusammenar-beit mit dem Alfred-Wegener-Institut in Bre-merhaven wurden zwei Wochen lang Schnee-temperaturprofile gewonnen. Hierbei konn-te das System zusätzlich mit einer üblichenTemperatur–Messung (in diesem Fall mittelszehn handelsüblicher PT100 Temperatursen-soren) verglichen werden.Das Poster stellt exemplarisch einige Messun-gen und die daraus gewonnenen Erkenntnissevor.
420 Abstracts
UI18 – Mi., 26.2., 12:40-13:00 Uhr · HS7Jacobs, F., Just, A., Krause, Y., Tuch, A., Schuck, A. (Leipzig), Schulz, R., Kurz, G., Igel, J.(Hannover), Lindner, U., Schicht, T. (Sondershausen), Schwandt, A. (Erfurt), Kühnicke, H.,Schulze, E. (Dresden)
Geophysikalische Erkundung als Beitrag zur Bewertung der Langzeitsicherheit von End-lagern und UntertagedeponienE-Mail: [email protected]
Die untertägige zerstörungsfreie Erkundungder geologischen Barriere von Endlagern undUntertagedeponien (UTD) ist eine wichtigeVoraussetzung für die Planung und die Grund-lage eines qualifizierten Nachweises zur Be-urteilung der Standortsicherheit. Es existierenhierfür leistungsstarke geophysikalische Ver-fahren, die jedoch unter ungünstigen Bedin-gungen einzeln unzureichend aussagekräftigsind (z. B. an Feuchtezonen). Ebenso kanndie Interpretation der Daten im Vollraum einProblem darstellen. Die drei im Zeitraumvon 1998 bis 2001 durchgeführten gekoppel-ten BMBF-Vorhaben 02 C 0558: Geologie,Einbeziehung von Geoelektrik und Seismik(Universität Leipzig mit den Firmen Geophy-sik GGD Leipzig und K-UTEC Sondershau-sen sowie dem Geologen Dr. A. Schwandtals Vertragspartnern), 02 C 0578: Elektro-magnetische Verfahren (GGA Hannover) und02 C 0568: Sonarverfahren (Fraunhofer Ge-sellschaft, EADQ Dresden) hatten die Lö-sung dieser Probleme durch Verbesserung dergeophysikalischen Methoden, durch die kom-binierte Anwendung verschiedener Verfahren(Seismik, Geoelektrik, Georadar, Elektroma-gnetik und Sonar) und durch neue Auswerteal-gorithmen zum Ziel. Um den gesamten Infor-mationsgehalt aller geophysikalischen Mes-sungen besser auszunutzen, wurde insbeson-dere ein neues Konzept der Auswertung ent-wickelt, das auf methodenspezifischen An-omaliekriterien und der Zusammenfassung zu
einem gemeinsamen quantifizierten Problem-index einschließlich seiner visuellen Darstel-lung basiert. Im stillgelegten Kali-BergwerkBischofferode (Südharz) konnten damit bisherunbekannte salzlösungsführende Bereiche imHangenden einer Abbaustrecke detektiert undcharakterisiert werden (KULENKAMPFF etal. 2001, KURZ et al. 2002).
Das in den Ausgangsvorhaben entwickel-te komplexe Mess- und Auswerteinstrumenta-rium und die am Standort Bischofferode ge-wonnenen methodischen Entwicklungen undErfahrungen werden nun in drei Nachfolge-projekten (Fkz. BMBF 02C0851, -861, -871) mit denselben Projektpartnern weiter-entwickelt, verallgemeinert und auf Standortemit anderen Lagerstättentypen übertragbar ge-macht.
Als neues Referenzmessobjekt wurde eineStrecke im Kali-Bergwerk Sigmundshall beiWunstorf westlich von Hannover (Betreiber:K+S KALI GmbH) ausgewählt. Das Kali-werk Sigmundshall liegt auf dem Salzstockvon Wunstorf. Diese Sattel-struktur mit denVerfaltungen und Zerscherungen der steilste-henden Schichten ergibt komplizierte geolo-gische Verhältnisse. Insbesondere die Ver-schuppung des Hauptanhydrits wirft Problem-bereiche auf. In etwa 60 bis 70 m von derausgewählten Strecke entfernt existieren Salz-lösungsvorkommen im Hauptanhydrit, die inzwei Horizontalbohrungen angetroffen wur-den.
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 421
Die bisherigen Messungen mit Georadarund Seismik zeigen den vorher nicht genau be-kannten Verlauf der Schichtgrenze des Haupt-anhydrits zum Steinsalz. Infolge des vor-herrschenden sehr hohen spezifischen Wider-standes des Salzgesteins werden insbesonderemit dem Radar große Eindringtiefen bei guterAuflösung erzielt. Sowohl der erbohrte salzlö-sungsführende Bereich in 60 m bis 70 m Tie-fe als auch die vorkommenden Schichtgrenzenund Störungszonen, konnten deutlich erfasstwerden. Mit Spezialmessungen (Rundum-Messungen, Peilmessungen) wurden die Re-flektoren einer räumlichen Lage zugeordnet.Die bisherige Vorstellung über die Struktur derAnhydritschuppen konnte damit korrigiert underweitert werden. Das Geoelektrik-Verfahrendetektierte einen sich klar abzeichnenden aus-gedehnten feuchteren Bereich. Nach Durch-führung der noch ausstehenden Sonar- und derelektromagnetischen Messungen werden diegesamten geophysikalischen Ergebnisse einergemeinsamen Auswertung und Interpretationzugeführt. Dazu werden parallel zur struk-turellen Interpretation des Messgebietes auchumfangreiche 2D- und 3D-Modellierungen(siehe auch IGEL et al, KURZ et al. undKRAUSE et al.) und petrophysikalische La-bormessungen durchgeführt.
Referenzen:IGEL, J., KURZ, G., SCHULZ, R. (2003):
Erkundung von Problemzonen im Salinar mitdem Georadar. - 63. Jahrestagung der Deut-schen Geophysikalischen Gesellschaft, 24.-28.2.2003 in Jena.
KRAUSE, Y., JUST, A., TUCH, A. (2003):3D-Modellierung zur Auswertung linienhaftgemessener Untertage-Geoelektrikdaten.- 63.Jahrestagung der Deutschen Geophysikali-schen Gesellschaft, 24.-28.2.2003 in Jena.
KULENKAMPFF, J., ASCHMANN, L.,JUST, A., BERGMANN, K., MOISE, E.,
JACOBS, F., SCHUCK, A., LINDNER, U.,SCHWANDT, A., KURZ, G., FLUCHE, B.,SCHULZ, R., KÜHNICKE, H., REUTTER,O., SCHUBERT, F. (2002): Komplexes Mess-und Auswerteinstrumentarium für die untertä-gige Erkundung von Problemzonen der geolo-gischen Barriere von Endlagern und Unterta-gedeponien (UTD) im Salinar. Abschlussbe-richt zu den BMBF-Forschungsvorhaben Fkz.02C0558, 02C0568, 02C0578, Leipzig 2002.
KURZ, G, ASCHMANN, L., JACOBS, F.,KULENKAMPFF, J., MOISE, E., SCHUCK,A., SCHULZ, R (2002): Auswertekonzept zurgeophysikalischen Erkundung von Problem-zonen im Salinar.- Zeitschrift für AngewandteGeologie, 48 (2/02): 56-62; Hannover.
KURZ G., IGEL J., SCHULZ R. (2003):3D Electromagnetic modeling in frequencydomain - studies of underground measure-ments in a salt mine. - Third Internatio-nal Symposium on Three-Dimensional Elec-tromagnetics, ASEG 16th Conference, Ade-laide.
422 Abstracts
UI19 – Mi., 26.2., 15:00-15:20 Uhr · HS7Richter, I., Lindner, H., Pretzschner, C. (TU Bergakademie Freiberg), Meier, Th. (Ruhr-Universität Bochum)
Experimentelle Untersuchungen zur Abhängigkeit der Rayleighwellen-Geschwindigkeitvon der Wassersättigung poröser GesteineE-Mail: [email protected]
Für die bautechnische Einschätzung vonDenkmälern werden seit längerem Ultra-schalluntersuchungen verwendet. Dabei wirdvorwiegend die Transmissionstechnik in Ver-bindung mit Ultraschallmessungen eingesetzt.Diese Methodik besitzt insbesondere im Ober-flächenbereich vielfach nicht die angestreb-te Auflösung. Ziel ist es daher, ein Be-wertungsverfahren, zur Untersuchung des fürden Denkmalspfleger wichtigen Oberflächen-bereichs des Naturbaustoffes zu entwickeln.
Als Untersuchungsmittel bietet sich indiesem Fall die Nutzung von Oberflächen-wellen speziell der Rayleighwelle an. Dabeigeht es vor allem um die Charakterisie-rung des Zusammenhangs zwischen derRayleighwellen-Geschwindigkeit mit der Ver-witterung bzw. der Festigkeit des Gesteins.Zur Bestimmung der Rayleighwellen-Geschwindigkeit vR eignen sich prinzipiell
Abbildung 1: Regressionsanalyse
zwei Methoden. Auf der einen Seite lässtsich unter Annahme des homogenen Halb-raumes bei einer profilhaften Messung (CSP)und einer Mehrempfängeranordnung dieRayleighwellen-Geschwindigkeit über ei-ne Regressionsanalyse (Abb. 1) ableiten.Diese Methode setzt Dispersionsfreiheitder Oberflächenwelle voraus. Ist diesenicht gegeben, so muss die Rayleighwellen-Geschwindigkeit über die Berechnung derGruppengeschwindigkeit der Rayleighwelled.h. eine Dispersionsanalyse des Wellenbildeserfolgen.
Im Mittelpunkt aktueller Untersuchungensteht die Bewertung des Zusammenhangeszwischen Rayleighwellen-GeschwindigkeitvR und dem Wassergehalt des Gesteins.Diese Frage spielt insbesondere bei derrichtigen Bewertung von zeitlichen Wie-
Abbildung 2: Abhängigkeit zwischenWassersättigung und Rayleighwellen-Geschwindigkeit
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 423
derholungsmessungen (z.B. vor und nachSanierungsmaßnahmen) eine wichtige Rolle.
Sandstein als eines der häufigsten Mate-rialien historischer Bauwerke zeichnet sichdurch hohe Porositäten und damit durchein hohes Aufnahmevermögen für Wasseraus. Deshalb wurden Laboruntersuchungender Rayleighwellen-Geschwindigkeit fürverschiedene unverwitterte Sandsteine vorge-nommen:
1. Wesersandstein hellgelb2. Wesersandstein rot3. Seeberger Sandstein4. Cottaer Sandstein5. Postaer Sandstein6. Eisenberger Sandstein7. Pietra Dorata (Italien)8. Polnischer Sandstein
Für diese Sandsteine wurden sowohl imtrockenen Zustand und bei unterschiedlichenWassersättigungen S∗ profilhafte Messungendurchgeführt und die Rayleighwellen-Geschwindigkeit bestimmt. Den Zusam-menhang zwischen Wassersättigung undzugehörigen Geschwindigkeiten der Ray-leighwelle zeigt Abb. 2. Es ist zu erkennen,dass die Rayleighwellen-Geschwindigkeit vRbei abnehmender Wassersättigung signifikantzunimmt.
424 Abstracts
UI20 – Mi., 26.2., 15:20-15:40 Uhr · HS7Eberle, D. (Hannover, BGR), Lange, G. (Berlin, BGR), Stettler, E. (Pretoria, CGS)
The use of geophysical surveys in the study of potential waste dump sites in the Namibnear Luederitz-NamibiaE-Mail: [email protected]
The coastal town of Luederitz, Namibia, issituated on the shore of the Southern AtlanticOcean, with the Namib desert its hinterland.The town has been increasingly in need of adump site for industrial and house waste, sinceall waste, including waste oil from the townand harbour, is dumped in a poorly managedsite on dune sand on the edge of the town.
The area is geologically part of the mid-Proterozoic Namaqualand Metamorphic Belt.Gneissic bedrock is largely covered by un-consolidated dune sands and weathering de-bris. Geophysical methods, such as mag-netics, electromagnetics, refraction seismicsand DC geoelectrical soundings were accord-ingly used to map fractures hidden by coversediments and to determine the thickness ofthe unconsolidated sediments, respectively.A high resolution air-photo survey appearednecessary to identify the regional stress andfracture patterns. High resolution airbornegeophysical data were acquired conducting amagnetic and radiometric survey flown by amicrolite carrier. The methodology of com-bining airborne geophysics and photo-geologyenabled to confine geophysical ground survey-ing to sand covered areas. Integration of alldata provided complete fracture mapping evenwhere Namib sands cover bedrock (Eberle etal., 1999).
From ground magnetic and electromagneticprofiling reasonably dense data grids were ob-tained: (1) Where magnetisation contrasts areexistent in bedrock, magnetic data provided ahighly detailed fracture pattern revealing po-
tential zones of weakness and increased per-meability. (2) Numerous narrow conductivityanomalies suggest to indicate where rock hasbeen exposed to stress and strain. No indica-tions of ground water were identified (Eberleet al., 1999).
Concomitantly with the geophysical groundsurveys, the new airborne geophysical micro-lite technique developed by the South AfricanCouncil for Geoscience (CGS) was used to flya survey on contract for the Federal Institutefor Geosciences and Natural Resources (BGR)of Germany in the area due east of Luederitzto study the capacity of the innovative air-borne technique for environmental mappingpurposes.
Nominal line spacing was 50 m at flight
Figure 1: Airborne magnetic field as surveyed bya microlite carrier. Average flight height 40 m a.g.l.
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 425
Figure 2: Airborne magnetic field continueddownward to ground level. The rectangle (whiteline) delineates the ground survey area of Figure 3.
heights as low as 20 m a.g.l., where flightsafety and terrain allowed. Tie lines wereflown with an interval of 500 m. Sample rateof the cesium magnetometer was 10 Hz at anaverage flight velocity of 100 km/h. Naturalgamma radiation was recorded using a 4 l NaJdetector crystal.
Figure 1 displays the total magnetic inten-sity (TMI) collected in the vicinity of and overone of the pre-selected sites. Comparison ofthe downward continued magnetic field data(Figure 2) with the ground survey data shownin Figure 3 reveals that still more detail is con-tained by the latter. This appears to be obviousas ground magnetic data were collected at reg-ular grid points 10 m apart. The airborne dataare characterised by a short spacing of 3 malong, but by a much larger of 50 m at right an-gles to the flight path. Smoothing accordinglyinhered in gridding the microlite line data. De-spite this constraint, it became only elucidatedby the microlite survey that the magnetic highobserved in the south west of the ground sur-vey area (cf. Figures 2 and 3) is part of a
Figure 3: Fracture pattern as derived from groundmagnetic field.
NW/SE trending magnetic dyke (cf. Figure 1).Experience has been made that high reso-
lution airborne geophysical data flown by amicrolite carrier will be of substantial supportin environmental mapping. Should, however,a highly detailed fracture pattern be required,tedious geophysical surveying on the groundcan hardly be replaced.
ReferencesEberle, D., Kühn, F., Lange, G. and Trem-
bich, G. (1999). Remote sensing and groundgeophysical investigations of potential wastesites in the vicinity of the coastal town ofLuederitz. Technical report, BGR, Han-nover, Germany, commissioned by the Min-istry for Technical Co-operation and Develop-ment, Bonn, Germany, 59 pp.
426 Abstracts
UI21 – Mi., 26.2., 15:40-16:00 Uhr · HS7Buckup, P. (Magdeburg), Buckup, K. (DBM-Dr. Buckup), Buckup, M. (Magdeburg)
Neue methodisch-technische Aspekte des Impuls-Neutron-Neutron-VerfahrensE-Mail: [email protected]
Abbildung 1: Übertageeinschub der Moni-toringeinheit mit GPS-Terminal (im Hinter-grund ein Sondenteil)
Seit über 10 Jahren wird inzwischen dasImpuls-Neutron-Neutron-Verfahren für bohr-lochgeophysikalische Belange eingesetzt.
Die letzten Entwicklungen liefen in Rich-tung Grundwassermonitoring und haben ih-re praktische Erprobung überstanden, wobeidie Einsatzmöglichkeiten beträchtlich erwei-tert werden konnten. Die Entwicklung vollzogsich schrittweise von der Logging-Varianteüber eine Hybridmodifikation zu einer reinenMonitoringeinheit mit automatischer Daten-übermittlung.
Diese Aspekte waren Gegenstand von in-tensiven Untersuchungen und umfassten Feld-tests, Messwertanalysen, vergleichende Pro-benahme, sowie Stabilitätsbetrachtungen.
Umfassende Teste fanden unter Pra-xisbedingungen in der Ukraine, Sibirien,Magdeburg-Rothensee, Spanien,Georgienund Armenien statt.
Die Aufgaben waren weitgefächert undreichten vom Grundwassermonitoring bis hin
zur Detektierung von Schadherden und zurKomplexanwendung.
Geophysikalische Methoden werden dabeiin starken Maße mit geologischen und sonsti-gen Informationen verknüpft.
Für das Monitoring sind Fragen der An-sprechschwellen festzustellen und die Aus-wahl für die jeweils kritischen Parameter zutreffen.
Mit dem Monitoring tritt ein Offline-Processing deutlich in den Hintergrund, in denKontrollintervallen von 1 min bis 8 Tage sindSofortinformationen gefordert, um ggf. Maß-nahmen einzuleiten.
Neue Effekte, die mit vorhanden Gerätenbisher nicht beobachtet werden konnten, eröff-nen neue Dimensionen für die Untersuchungder Umstände einer ablaufenden Umweltschä-digung, Einflussfaktoren können erkannt undin ihrer Auswirkung eingeschränkt werden.
Das Impuls-Neutron-Neutron-Monitoringliefert eine Vielzahl Parameter, die auf ihreBrauchbarkeit für Bewertung oder Erkennungeiner Belastung nach Effktivitätskriterienausgefiltert werden müssen.
In der ersten Phase wurde der Prototyp inFluiden eingesetzt, dabei vorrangig für Was-sermonitoring.
In einem kritischen Gebiet am Schwarz-meerufer der Krim wurde die Sonde in einemBach installiert und Beobachtungen in Tages-intervallen über ein Jahr durchgeführt und mitsonstigen verfügbaren Ergebnissen korreliert.Derartige Ergebnisse waren Wasseranalysen,Wetterbeobachtungen und Kalibrierungen mitverfügbaren bekannten Lösungen.
Umwelt- und Ingenieurgeophysik 427
Abbildung 2: Monitoringstartphase in Simeis (Krim), dargestellt sind Ratenänderungen in aus-gewählten Fenstern (nah bis fern von oben nach unten)
In dieser Phase wurde jeweils zu den täg-lichen Einschaltzeiten über 2 min die gesam-te Abklingkurve in den beiden verfügbarenKanälen registriert.
Das Processing für die Zählraten in den ein-zelnen Zeitfenstern zeigte eine deutliche Kor-relation mit den klimatischen Bedingungen,immer nach Regenfällen bildeten sich An-omalien, allerdings z.T. mit unterschiedlichemVorzeichen, die verschiedenen Einträgen vonSchadstoffen in das Wasserreservoir entspra-chen, wobei die Werte immer noch unterhalbder Werte für die Trinkwassereignung blieben,das Verfahren erwies sich als hochempfind-lich. Intensitätsabnahmen konnten mit Eintragvon Schwermetallen korreliert werden, positi-ve Anomalien mit Phenolgehaltszunahmen.
Erstmalig besteht damit die Möglichkeit ei-nes kontinuierlichen Monitorings mit Vorwar-neffekt zur Einleitung notwendiger Maßnah-men.
Weitere methodische Untersuchungen zeig-
ten, dass eine Quantifizierbarkeit unter gewis-sen Bedingungen möglich ist, allerdings wirdim Sinne eines Monitorings eine höhere Emp-findlichkeit für das Erfassen von Änderungenerreicht.
Webseite: http://www. bohrlochmesser.de
428 Abstracts
UIP02Emiroglu, S., Petersen, N. (München), Rey García, D. (Vigo)
Magnetic properties of dissolving minerals in the Ría Arousa (Spain)E-Mail: [email protected]
High industrialisation and frequent marinetraffic contaminate the water of the rías (flu-vial valleys covered by the sea) in west Spainwith heavy metals. In many places inside therías mussels are cultivated, which are poten-tially endangered by heavy metal contamina-tion. Therefor a constant monitoring of thewater quality and sediment chemistry is car-ried out by different institutions.Here magnetic measurements on sedimentcores have been carried out - complementedby electron microscopy - in order to help char-acterising the environment. 6 gravity- and 7box-cores (depths of 25-500cm) of differentlocations in the Ría Arousa (west Spain) werestudied.
All cores show the same magnetic charac-teristics. The properties will be explained onthe 2.7 m long gravity-core BDGCAr4.
Figure 1: susceptibility
Figure 2: sIRM acquisition
Susceptibility, saturation isothermal rema-nent magnetization (sIRM) and anhystereticremanent magnetization (ARM) show thesame characteristics: high values in the upperpart of the core and low ones in the lower part(fig. 1).
Superparamagnetic particles could be de-tected between 10 and 40cm depth, where thesusceptibility has its high values. The shapeof the hysteresis also follow a typical patternwith increasing depth: a decrease of the en-closed area and a slightly decreasing param-agnetic slope (fig. 1).
The sIRM acquisition shows low-coercivematerial for the superficial samples. Startingwith 40cm the coercivities increase and reachtheir maximum at a depth of 60cm, where onlyhalf of the remanence is saturated by a pulsedfield of 100 mT. Below the coercive forces de-crease to medium-low values (fig. 2). The
Umwelt- und Ingenieurgeophysik – Poster 429
Figure 3: thermomagnetic curve
AF demagnetization of sIRM has the congru-ent shapes which the sIRM acquisition wouldlet expect. It points out the difference betweenthe middle and lower depths: it is a differ-ence in minerals which have a higher coerciv-ity than 100mT.
The hitherto described properties lead us tothe conclusion that the magnetic minerals varyin relative proportion with depth. The upperpart is dominated by a low-coercive mineralwith high susceptibility and high remanence(e.g. magnetite), the middle part is dominatedby paramagnetic particles and a ferromagnetichigh-coercive mineral with low susceptibilityand remanence (e.g. goethite, hematite), thelowest part of the cores is dominated by para-magnetic particles and by a medium-coercivemineral with low remanence and susceptibility(e.g. greigite).
For the acquisition of ARM a constant biasfield of 100µT and an increasing alternatingfield till 100mT was applied. Starting with60cm the trend is the same as for the sIRMacquisition, i.e. decreasing coercivities withincreasing depth. But in contrast to the sIRM,in the superficial depths till 60cm the coerciv-ities of the ARM acquisition are decreasing
with depth. This means that the proportions ofthe magnetic minerals changes differently indifferent grain size fractions, since the ARMeffects the smaller grains more than the IRM.
The thermomagnetic curves have the sameshape for all depths. The decrease till 120°C ispresumably caused by goethite. The increasebetween 120 and 200°C followed by a distinctdrop in magnetization is either a Hopkinson-Peak or a chemical change. Between 420and 580°C minerals (probably sulfides) trans-form into magnetite (maximum effect at 91cmdepth). The thermomagnetic curves show thesame magnetic phases for all depths, but indifferent quantities. The observed differencein coercivities and susceptibility must there-for be due to a corresponding change in grainsizes and slightly varying mineral-ratios ratherthan in magneto-mineralogy. Just the quantityof the (difficult detectable) sulfides seem to in-crease (contrary to the trend of the oxides).
All iron-oxides are dissolving with increas-ing time and depth (at different rates, so thatthe relative proportions change). The dissolu-tion of magnetite in reducing environment wasshown in earlier publications (e.g. Hilgen-feldt, 2000). The dissolution of the iron-oxides (e.g. goethite, hematite) is also likelyin a strongly reducing milieu.
430 Abstracts
UIP04Schmalholz, J., Stoffregen, H., Strehl, S. (Berlin), Kemna, A. (FZ Jülich), Yaramanci, U. (Ber-lin)
GPR-Tomography of a LysimeterE-Mail: [email protected]
A lysimeter is a vessel containing undis-turbed soil placed with its top edge to theground surface. Lysimeters are used to studyphases of the hydrological cycle, like infiltra-tion, evapotranspiration, runoff, etc. The di-electric permittivity of soils depends stronglyon the water content. Therefore, GPR wasused as it can provide non-invasive high-resolution information regarding the distribu-tion of the dielectric permittivity of a hetero-geneous medium. Because the used lysime-ter has PVC walls tomographic measurementscan be performed. In cooperation with the In-stitute of Chemistry and Dynamics of the Geo-sphere, IV Agrosphere of the Forschungszen-trum Jülich GmbH, the solute transport insidea lysimeter ought to be investigated.
Considering the relatively small dimensionsof the lysimeter (1.2 m diameter, 1.5 m height)and the armament with sensors for other meth-ods, a pair of shielded antennas was chosenwith centre frequencies of approx. 750 MHz.In April and September 2002 first measure-ments were carried out on a filled but un-equipped lysimeter to check signal quality,feasibility as well as the needed time to gathera dataset under ideal conditions. Furthermorea point irrigation test was made to estimate theactual resolution with the available equipment.
For every transmitter position several re-ceiver positions were recorded and sorted af-terwards. The datasets used in the various to-mographic investigations consisted of severalhorizontal and vertical planes. After process-ing the data, arrival times were picked and in-
verted. At this stage the tomographic toolsetprovided by the commercial software packageReflex-Win was used, which allows a tomo-graphic inversion of first arrival time data. Theapplied algorithm is based on a SIRT (Simul-taneous Iterative Reconstruction Technique)adaptation.
To derive the volumetric water content, thecalculated dielectric permittivity values haveto be transformed. Based on the soil insidethe lysimeter (approx. 80% sand, 15% silt and5% clay with approx. 40% porosity) appropri-ate mixing formulas for bulk dielectric permit-tivity have to be chosen and compared to theresults gathered from alternative methods.
At this very early stage of the experimentheterogeneities in the dimension of decimetreswith water content variations of approx. threevolumetric percent can be detected. In con-sideration of the inclusion of alternative meth-ods, e.g. time domain reflectometry, these re-sults will be further enhanced. In addition im-provements can be achieved by increased ef-forts regarding data processing or data acqui-sition layout.
Umwelt- und Ingenieurgeophysik – Poster 431
UIP05Schmalholz, J., Müller, M., Yaramanci, U. (Berlin)
Local Moisture Sounding (LMS) - Determination of Vertical Soil Moisture Distributionby GPRE-Mail: [email protected]
Within the Research-Group 409 INTERUR-BAN of the Deutsche Forschungsgemein-schaft (DFG), one of the objectives of the sub-project GEO is the detection of small-scaleheterogeneities of the water content in soils.Besides electrical methods, such as direct cur-rent (DC) geoelectrics or spectral induced po-larisation (SIP), the ground penetrating radar(GPR) is utilized for this task. Because of theinvolved research groups, e.g. soil science orgeochemistry, the interesting dimensions areof some decimetres. Therefore classical ap-plications of the GPR to determine the verti-cal distribution of the dielectric permittivity,such as common midpoint (CMP) measure-ments, offer only limited information. TheLMS can provide valuable data for the cali-bration of other methods.
LMS utilizes guided waves along a ver-tical metallic rod, which are generated andrecorded with a common commercial GPRsystem. This method is therefore compara-ble with the TDR (time domain reflectome-try), which also utilises guided waves alongan electric conductor. Placing the antennasclose to the rod, the generated electromagneticwaves couple to the rod and propagate to itsend. At the end a part of the electromagneticenergy is than reflected and would travel thesame way back to the receiver. To obtain a ver-tical profile of the dielectric permittivity, therod is lowered gradually, thus the wave trav-els through successively deeper areas. The in-terval velocity can be determined by record-ing the depth of the rod with every registered
trace. To allow monitoring, the rod is placedinside a stationary electrically insulated tube.In our work we used a hollow aluminium rodthat can be lowered in intervals of 2 cm insidea makrolon tube.
Using antennas with centre frequencies ofapprox. 750 MHz, the velocity distortioncaused by the makrolon tubing can be ne-glected and consequently the propagation ve-locity of the electromagnetic wave is domi-nated by the surrounding soil. Using appropri-ate processing steps, the reflections at the endof the rod can be easily spotted and picked.
To derive the dielectric permittivity distri-bution of LMS data two different methodshave been tested. In the first method the in-terval velocities over a range of a few record-ing steps are calculated. Because of the lim-ited time discretisation the calculation over asmaller range would lead to greater errors. Inthe second method an inversion to derive thedielectric permittivity for each step was per-formed. Both methods were tested with syn-thetic and field data.
Web page: http://www.interurban.de
432 Abstracts
UIP06Schmalholz, J., Stoffregen, H., Müller, M., Yaramanci, U. (Berlin)
Determination of Shallow Small-Scale Heterogeneities in Soils Using GPRE-Mail: [email protected]
The ground penetrating radar (GPR) is ageophysical tool, which has growing applica-tions in soil physics and for the determina-tion of soil water. One of the main objectivesof the Research-Group 409 INTERURBAN ofthe Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)is the detection of hydrophile respectively hy-drophobe regions. A common method to in-vestigate water content of shallow soils withthe GPR is the evaluation of the ground wave.The ground wave is an inhomogeneous wavethat travels along the surface inside the sub-surface. The velocity of the ground wave istherefore correlated to the medium of the sub-surface and consequently to its water content.Because of the small dimensions of the hy-drophile/hydrophobe regions new approachesto the evaluation of the ground wave have tobe made.
To obtain accurate data, concerning the di-electric permittivity of the soil as well as thespatial resolution, the ground wave has tobe evaluated in the so called profile-mode toassure that the measurements could be per-formed in a reasonable amount of time. In theprofile-mode the receiver is pulled away fromthe transmitter to determine the optimal an-tenna separation, i.e. the direct air wave doesnot longer interfere the ground wave. Thisprocedure is often called a WARR (wide anglereflection and refraction) measurement. Whenthe best offset is determined, both antennas aremoved along the profile with a fixed offset.
Although GPR antennas with centre fre-quencies of approximately 750 MHz wereused, the offsets and the covered area were
to big for the regions of interest. With anoffset in the range of 0.6m and an estimatedantenna width of 0.1 m, the surveyed areafor each trace is approximately six times big-ger than the dimension of the typical hy-drophile/hydrophobe zones. Therefore an in-version of the gathered dielectric permittivitywas performed to acquire a resolution smallerthan the actual offset.
On the other hand measurements were per-formed using a quasimonostatic GPR an-tenna and investigating the effect of soil waterchanges to the first wavelet. For further infor-mation see Stoffregen et al. in this Meeting.
The inversion of the ground wave data aswell as the change of the first wavelet werecompared to TDR (time domain reflectome-try) data gathered for different locations. Ad-ditional research has been made using syn-thetic ground wave datasets and crosscheckingthe inversion results to the model. At this stageof the measurements good spatial correlationswere achieved but have to be further improvedto provide a reliable alternative.
Web page: http://www.interurban.de
Umwelt- und Ingenieurgeophysik – Poster 433
UIP07Igel, J., Kurz, G., Sauer, A., Südekum, W., Schulz, R. (GGA-Institut, Hannover)
Kombinierte flächendeckende geophysikalische Erkundung der Stadtwüstung NienoverE-Mail: [email protected]
HistorieDie Wüstung Nienover im heutigen Nieder-sachsen, ca. 50 km westlich von Göttingen,wurde im späten 12. Jahrhundert als Stadt vonden Grafen von Dassel gegründet und wahr-scheinlich planmässig angelegt. Nach demderzeitigen Kenntnisstand (Datierung von Ke-ramikfunden) ist von einer weitgehenden Ver-ödung der Stadt ab der zweiten Hälfte des13. Jhs auszugehen (STEPHAN 2001). DieStadtwüstung wurde in der Neuzeit wiederent-deckt und wird seit 1993 archäologisch erkun-det. Da nach der Verwüstung keine erneuteBesiedelung auf dem ehemaligen Stadtgebieterfolgte, ergibt sich in Nienover die einzigar-tige Möglichkeit, systematische Forschung aneiner hochmittelalterlichen Kleinstadt zu be-treiben. Bis heute wurden etwa 6% des ca.10 ha grossen Stadtareals mittels Ausgrabun-gen erkundet und Teile der Befestigungsanla-ge, Strassen sowie Fundamente und Keller er-graben. Es wird jedoch kaum möglich sein,die ganze Fläche auszugraben, so dass dasAreal auch mit geophysikalischen Methodenerkundet wurde.
Geophysikalische ErkundungBei archäologischen Untersuchungen ist esfast unerlässlich, flächendeckende Messungendurchzuführen, da die oft schwachen Anoma-lien auf einzelnen Profilmessungen im Mess-rauschen untergehen und bei einem zu gros-sen Profilabstand kleinere Objekte oft nicht er-fasst werden. Erst durch die flächenhafte Dar-stellung genügend dichter Messwerte erkenntman auch bei schwachen Kontrasten zusam-menhängende Strukturen. Dabei ist ein einzi-
ges geophysikalisches Verfahren oft nicht aus-sagekräftig genug, so dass u.U. mehrere Me-thoden kombinieren werden müssen, um dieInterpretation abzusichern.
Das gesamte Stadtareal wurde in den letzenJahren mit geoelektrischen und magnetischenVerfahren flächendeckend vermessen.Die geoelektrischen Messungen wurden mitder am GGA-Institut entwickelten mobilenMultielektrodenanlage (SÜDEKUM 2000)kartiert, wobei eine Quadratanordnung (1m), eine 1 m und 2 m Wenneranordnung undeine 5 m Schlumbergeranordnung verwendetwurde. Die im Boden (Löss und Fließerde)liegenden Überreste der Keller, Fundamenteund Strassen treten als hochohmige Anomali-en hervor.Bei den magnetischen Messungen wurde miteinem Cs-Absorptionszellenmagnetometerder Horizontalgradient der Totalintensitätin zwei Raumrichtungen und zusätzlich fürein kleineres Testgebiet auch die räumlicheVariation der Totalintensität bestimmt. AlsAnomalien treten nicht nur die Reste derSteingebäude als solche hervor, sondern imWesentlichen organische Abfälle und Schla-ckereste der damaligen Eisenproduktion, diemeist in unmittelbarer Nähe zu den Gebäudenabgelagert wurden oder wie im Fall derSchlacke als Material für den StrassenbauVerwendung fanden, und die ehemaligeBebauung somit sichtbar machen.
Für systematische Untersuchungen wurdeein Testfeld von 50 m × 50 m zusätzlich flä-chendeckend mit dem Georadar (GPR) unter-sucht. Es wurde mit einer bistatischen 400
434 Abstracts
MHz Antenne mit senkrecht zur Laufrichtungausgerichteten Dipolen mit einem Profilab-stand von 33 cm und einem Spurabstand von10 cm gemessen, wodurch eine gute Überde-ckung auch in geringer Tiefe erreicht wurde.Dabei konnte eine Eindringtiefe von etwa 1,5m erzielt werden. In Abb. 1 ist eine Zeit-scheibe zu sehen, die einen Horizontalschnittin einer Tiefe von etwa 80 cm darstellt. Durchden hohen Kontrast im Dielektrizitätskoeffizi-enten und der elektr. Leitfähigkeit zwischendem feuchten Boden und steinigem Materialtreten v.a. die ehemalige Hauptstrasse (dia-gonale Struktur oben) als auch Kellerüberresteeinzelner Gebäude hervor, z.B. bei x = 20 m,y = 25 m.Für Ende 2002 ist noch der Einsatz eineselektromagnetisches Induktionsverfahrens ge-plant. Mit einem EM38 mit einer Messfre-quenz von 14 kHz soll das Testfeld flächen-deckend kartiert werden.
Die einzelnen Ergebnisse können vergli-chen und so kombiniert werden, dass dieAussagefähigkeit optimiert wird. Im Laufedieses Jahres sollen die georteten Objekte
Abbildung 1: Radargramm (400 MHz): Zeit-scheibe t = 20 ns, entspricht ca. 80 cm Tiefe
ergraben und archäologisch kartiert werden,wodurch eine Verifizierung der Interpretationermöglicht wird. Des weiteren kann dann einbezüglich Auflösevermögen, Tiefenaussageund Zeitaufwand optimiertes Verfahren odereine Kombination mehrerer Verfahren aufweiteren Teilgebieten angewendet werden, dienicht vollständig aufgegraben werden können.
Literatur:STEPHAN, H.-G.: Nienover - Burg und Stadt-wüstung im Solling (Südniedersachsen), NeueForschungen zur Archäologie des Mittelaltersin Schlesien und Niedersachsen, UniwersytetWrocławski, Instytut Archeologii, Wrocław,2001.SÜDEKUM, W.: Mobile Elektrodengruppezur oberflächennahen geoelektrischen Kartie-rung, Geologisches Jahrbuch, E 52: 35 - 62,Hannover, 2000.
Umwelt- und Ingenieurgeophysik – Poster 435
UIP10Thomas, R., Bram, K. (GGA-Institut, Hannover)
Dynamische Messungen bei Zugvorbeifahrten zur Untersuchung der Wechselwirkungdes Systems Schiene mit dem UntergrundE-Mail: [email protected]
Die vom Eisenbahnverkehr ausgehendenEinwirkungen über den Untergrund auf denMenschen sind seit dessen Einführung vorüber 170 Jahren bekannt und Gegenstand zahl-reicher Abhandlungen. In jüngster Zeit kon-zentrieren sich die Fragestellungen im wesent-lichen auf die beiden Bereiche: Untersuchun-gen an Bahnstrecken, bei denen Gleislage-verschlechterungen auftreten und den Neubauvon Hochgeschwindigkeitsstrecken (z.B. Kry-lov et al. 2000, Lieberenz et al. 2002).
Unter dem System ’Schiene’ wird hierdas Ensemble Schiene - Schwelle - Schot-terbett verstanden. Bei entsprechender dyna-mischer Belastung durch Zugvorbeifahrten istdie Wechselwirkung des Systems Schiene mitdem Untergrund problematisch, wo Schienenauf zum Teil gering verfestigten Böden ver-legt sind (z.B. Beilke 1993). Im norddeut-schen Raum herrschen Sedimentgesteine vor,die in Bereichen jüngster quartärer Ablage-rungen zum Teil mehrere Meter bis Zehner-meter mächtiges unverfestigtes und weiches,meist holozänes Material wie z.B. Torfe oderMudden aufweisen. Eisenbahnstrecken, dieüber derartiges Gelände führen, erfordern ei-nerseits hohe Überwachungs- und Unterhal-tungskosten, andererseits ist aus Sicherheits-gründen die dynamische Belastung durch denZugverkehr begrenzt.
Um den steigenden Anforderungen einermodernen Kommunikationsgesellschaft auchunter derartigen geologischen Bedingungengerecht zu werden, untersucht das GGA-Institut seit über 20 Jahren die durch Zü-
ge bewirkten Erschütterungen des Untergrun-des und dessen Verhalten. In einem mit derBGR und dem NLfB gebildeten Arbeitskreis’Schwingungsstabilität weicher holozäner Bö-den’ tragen entsprechende Modellrechnungenzum Verständnis möglicher Resonanzen zwi-schen Schiene und Untergrund bei (Höhn etal. 2002).
Grundlagen sind, angeregt durch unmit-telbar praxisorientierte Fragestellungen, Auf-zeichnungen von Erschütterungen bei Zug-vorbeifahrten. Als Messsignale dienen aus-schließlich die von vorbeifahrenden Schienen-fahrzeugen erzeugten Erschütterungen. Ge-genüber anderen Verfahren, bei denen spezi-ell Erschütterungen erzeugt werden, hat die-ses Vorgehen den Vorteil, dass die dynami-schen Belastungsvorgänge erfasst werden, diezu möglichen Problemen bei der Gleisstabili-tät führen (Hinzen 1995). Registriert werdendabei Vorbeifahrten von planmäßigen Zugein-heiten und/oder speziell für die dynamischenMessungen bereitgestellten Zugeinheiten.
Im frühen Stadium der Untersuchungenwurden die Messungen in der Regel nur qua-litativ ausgewertet. Ein Verfahren zur quanti-tativen Auswertung von Messungen dynami-scher Vorgänge beschreibt Möker et al. 1993.Problemzonen und Sanierungsbereichsgren-zen ließen sich damit nachweisen. Über ei-ne Abhängigkeit des dynamischen Verhaltensdes Gleisunterbaus als Folge veränderter Zug-geschwindigkeiten berichtet Reamer 2000.
Normalerweise beschränkt sich die Analyseder Daten auf einen Zeitbereich von 2 s im Be-
436 Abstracts
reich der Lokomotive, in dem die größten Las-ten und damit auch die maximalen Amplitu-den der Schwinggeschwindigkeiten zu erwar-ten sind.
Weitergehende Betrachtungsweisen desvorliegenden Datenmaterials zeigen, dasswesentlich mehr Informationen in dengemessenen Daten verborgen sind.
Generell erzeugt jeder Zug ein spezifischesSpektrum, das letztlich durch die Eigenschaf-ten des Zuges, wie Achslastverteilung, Zug-geschwindigkeit, Zustand des rollenden Ma-terials einschließlich Drehgestelllagerung (Fe-derung) bedingt ist. Überwiegend niederfre-quente Spektralanteile, die offensichtlich beiallen Zugfahrten angeregt werden, sind des-halb mit großer Wahrscheinlichkeit dem dyna-mischen Verhalten des Untergrundes zuzuord-nen. In erheblichem Maße werden auch Fre-quenzen im Bereich von 30 bis 100 Hz ange-regt.
Deshalb liegt es nahe, nicht nur das Zei-tintervall der maximalen Lasteinbringung zuuntersuchen. Entsprechend wurden in denneuesten Auswertungen unterschiedliche Zeit-bereiche einer Zugdurchfahrt mit Hilfe ihrerFourierspektren analysiert. Durch Vergleichekonnte z. B. ein Aufschaukeln des Untergrun-des nachgewiesen werden. Die Anwendungeines gleitenden Analysefensters zur Berech-nung der Fourierspektren erlaubt, den sich mitder Zeit verändernden, im Boden angeregtenFrequenzbereich hoch aufzulösen. Diese er-weiterte Auswertetechnik unterstützt und er-leichtert die Interpretation.
Ein umfangreiches, in fast 20 Jahren zu-sammengetragenes Datenmaterial, das auchWiederholungsmessungen an unterschiedli-chen Gleisabschnitten einer Bahnlinie bein-haltet, bildet die Grundlage für weitergehen-de Untersuchungen und die Entwicklung neu-er Auswerte- und Interpretationsverfahren.
Literatur: Beilke, O. (1993): Gründungvon Eisenbahnkörpern auf organischen Bö-den. Mitteilungen des Institutes für Grundbau,Bodenmechanik und Energiewasserbau, Uni-versität Hannover, S. 11-18.
Hinzen, K.-G. (1995): Auswertung dyna-mischer Messungen bei Zugvorbeifahrten DB-Strecke Oldenburg-Bremen. Bericht NLfB-GGA, Arch. Nr. 113 832, Hannover.
Höhn, J., Göbel, I., R., Bram, K., Mey-er, H. (2002): Determining dynamic proper-ties of track-soil systems on soft soils by em-pirical and theoretical methods. NumericalMethods in Geotechnical Engineering, Mestat(ed.) 2002, Presses de l‘ENPC/LCPC, Paris.
Krylov, V., V., Dawson, A., R., Heelis, M.,E., Collop, A., C. (2000): Rail movement andground waves caused by high-speed trains ap-proaching track-soil criteria velocities, Proc.Instn. Engrs., Vol. 214, Part F, pp. 107-116.
Lieberenz, K., Müller-Boruttau, F., Weise-mann, U. (2002): Sicherung der dynamischenStabilität von Unterbau/Untergrund. Heran-gehensweise und Lösungswege an der ABSHamburg-Berlin, BahnBau 2002, Berlin 25.-27.09.2002, Proceedings auf CD-ROM.
Möker, H., Behnke, C., Reamer, S. (1993):Sanierung von Eisenbahnstrecken auf derGrundlage ingenieurgeologischer und geo-physikalischer Untersuchungen, Geol. Jb., A142, 197-205.
Reamer, S., K. (2000): Auswertung vonSchwingungsmessungen zur Untersuchungder dynamischen Stabilität des Untergrundes,EI- Eisenbahningenieur, 51, 12/2000, S. 128-132.
Webseite: http://www.gga-hannover.de
Umwelt- und Ingenieurgeophysik – Poster 437
UIP11Streich, R., Lück, E., Strecker, M., Scherbaum, F. (Universität Potsdam), Schäbitz, F. (Univer-sität Essen)
Geophysikalische Erkundung vermuteter holozäner Aktivität von Störungen in der Nie-derrheinischen BuchtE-Mail: [email protected]
Das känozoische Riftsystem West- und Mit-teleuropas mit dem Niederrheingraben als ei-ner der gegenwärtig aktivsten Bereiche stellteine Zone erhöhter seismischer Gefährdungin Europa dar. Historische Erdbebenkata-loge verzeichnen große Schadensbeben inder Niederrheinischen Bucht, insbesonde-re im Bereich der Rurrand- und Peelrand-Verwerfungen.
Im Rahmen des EU-geförderten S.A.F.E.-Projektes („Slow Active Faults in Europe“),das u. a. eine Verbesserung der Gefährdungs-abschätzung im gesamten Rheingrabensystemdurch eine Kombination geophysikalischer,morphologischer und paläoseismologischerUntersuchungen anstrebt, wurden detaillier-te geophysikalische Erkundungen an drei Lo-kationen durchgeführt. Eine der Lokationenliegt im System der Rurrand-Verwerfung imEpizentralgebiet des 1756er Düren-Erdbebensmit Maximalintensität VIII, die beiden ande-ren im Erft-Swistsprung-System, der südli-chen Verlängerung der Peelrandverwerfung.
Die eingesetzten geophysikalischen Metho-den umfassen Geoelektrik (Widerstands- undAufladbarkeitsmessungen), Bodenradar undRefraktionsseismik entlang von Profilen, diejeweils senkrecht zu den an der Oberflächesichtbaren topographischen Änderungen ver-laufen, sowie elektromagnetische und magne-tische Kartierungen. Zusätzlich wurden Nivel-lements und an zwei Lokationen auch Kern-bohrungen durchgeführt.
Es zeigen sich in allen Messgebieten ausge-
prägte geophysikalische Anomalien, die einenVersatz innerhalb der obersten Boden- und Se-dimentschichten vermuten lassen. Verschiede-ne Anomalien korrelieren recht gut miteinan-der, jedoch nicht perfekt, verlaufen annäherndparallel zu den Höhenlinien und stimmen sehrgut mit lateralen Änderungen der Bodenprofi-le überein. Der Charakter der Anomalien vari-iert stark zwischen den verschiedenen Messor-ten, so dass sich klare, wiederkehrende Indika-toren für aktive Störungen allein aus geophysi-kalischen Messungen nicht bestimmen lassen.
Dennoch liefert die Kombination aller Mes-sergebnisse zumindest an zwei der LokationenHinweise auf die Existenz tektonischer Stö-rungen innerhalb des untersuchten Tiefenbe-reiches von maximal 10 m. In Kombinati-on mit den Bohrprofilen wird in beschränk-tem Maße eine Rekonstruktion der jüngstengeologischen Entwicklung möglich. Eine re-gionalgeologische Einordnung der erbohrtenoberflächennahen Schichten sowie exemplari-sche Datierungen lassen auch eine grobe zeit-liche Einordnung zu. Ein eindeutiger Be-weis für den seismogenen Ursprung der beob-achteten topographischen, geophysikalischenund geologischen Anomalien sowie Aussagenüber die Größe und Häufigkeit vermuteter Be-ben werden sich jedoch nur durch Grabungenerbringen lassen.
438 Abstracts
UIP12Heinse, R., Schikowsky, P. (Universität Leipzig), Storz, W. (Torgau, HGN GmbH)
Geophysikalische Untersuchungen zur Deckschichtbewertung - Ein Beitrag zum Grund-wasserschutzE-Mail: [email protected]
Das Grundwasser ist durch überlagerndeDeckschichten vor Kontaminationen verhält-nismäßig gut geschützt. Dieser Schutz ist je-doch stark abhängig von der Ausbildung derDeckschichten. Sandige Schichten mit gerin-ger Mächtigkeit werden zu einer raschen In-filtration von Kontaminationen in das Grund-wasser führen, während bindige, d.h. schluf-fige und tonige Schichten - bedingt durch ihregeringe hydraulische Durchlässigkeit - ein er-höhtes Schutzpotential aufweisen.
Der in der Elbaue oberflächlich anstehen-de Auelehm gilt auf Grund seiner geringenhydraulischen Durchlässigkeit und den damitwirksamen Abbau- und Rückhalteprozessenals geologische Barriere. Ihm kommt eine ent-scheidende Schutzfunktion vor Schadstoffein-trägen in das Grundwasser zu.
Zu überprüfen war, inwieweit komplexegeophysikalische Verfahren kombiniert mitgeotechnischen Untersuchungen einen Beitragzur strukturellen und stofflichen Charakteri-sierung der Auelehmdeckschicht liefern kön-nen. Insbesondere sollte versucht werden, hy-draulische Durchlässigkeiten aus geophysika-lischen Daten abzuleiten.
Die Elbaue ist durch die Ablagerung ho-lozäner Auesedimente gekennzeichnet. DerAuelehm weist im Untersuchungsgebiet eineflächenhafte Verbreitung auf. Seine Mäch-tigkeit schwankt in der Regel zwischen ei-nem und zwei Metern, wobei der Hauptan-teil der Korngrößen in der Regel im Schluff-kornbereich liegt. Im Liegenden folgen Sand-/ Kiesablagerungen, die ab circa vier Metern
gesättigt sind. Der ungebändigte Elbestromwar in viele - teilweise nur einige Meter brei-te - Teilströme aufgefächert, deren Verläufezeitlich immer wieder wechselten. Dadurchbedingt sind unterschiedliche Ablagerungsbe-dingungen, die zu strukturellen und stofflichenHeterogenitäten des Auelehmkörpers führten.Diese Heterogenitäten können Schwachstellenin der Funktion der geologischen Barriere dar-stellen.
Für eine konsequente Bewertung der Au-elehmdeckschicht sind daher die Mächtigkeitund der Sand/Ton-Gehalt bestimmende Fakto-ren.
Ein Problem beim Einsatz geophysikali-scher Methoden für hydrogeologische Auf-gabenstellungen ist, dass eine Transformati-on geophysikalischer Daten in petrophysika-lische Daten im Allgemeinen nicht gelingt.Mit Korrelationsbeziehungen zwischen deneinzelnen Parametern ist es jedoch möglich,aus den geophysikalischen Messungen hydro-geologische Kennwerte abzuleiten. Zur Er-stellung solcher Korrelationsbeziehungen sindMessungen notwendig, die sowohl hydrogeo-logische als auch geophysikalische Parameterdes Auelehms bestimmen.
Auf einer ausgewählten Fläche bei Tor-gau erfolgten Untersuchungen zur Bestim-mung struktureller und stofflicher Heterogeni-täten. Hier wurden gleichstromgeoelektrischeund seismische Verfahren sowie Georadar an-gewandt. Die geophysikalischen Messungenwurden dabei konsequent durch Rammkern-sondierungen mit Probenentnahme ergänzt.
Umwelt- und Ingenieurgeophysik – Poster 439
Abbildung 1: Spezifischer elektrischer Wider-stand in Abhängigkeit vom Tongehalt an Au-elehmböden
An den Proben erfolgte eine Bestimmung derKorngrößenverteilung sowie die Bestimmungdes Durchlässigkeitsbeiwertes.
Mit Hilfe elektrischer und elektromagneti-scher Messungen wurden wertvolle Informa-tionen zu Struktur und Mächtigkeit der Au-elehmdeckschicht gewonnen, die insbesonde-re durch die Rammkernsondierungen bestätigtwerden konnten. Monostatische Georadar-messungen lassen auf Grund der hohen Leit-fähigkeit des Auelehms und der damit verbun-denen starken Dämpfung der elektromagneti-schen Welle jedoch nur Aussagen bei geringenAuelehmmächtigkeiten von bis zu einem Me-ter zu.
Die elektrischen Messungen hatten desWeiteren eine stoffliche Charakterisierungzum Ziel. Die hydraulische Durchlässigkeitist maßgeblich von der Korngrößenverteilungund insbesondere von dem Pelitgehalt abhän-gig. Über eine geophysikalische Abschät-zung beispielsweise des Tongehalts ist es da-her möglich, Rückschlüsse auf hydraulischeDurchlässigkeiten zu ziehen. Abb.1 zeigt dieKorrelation zwischen dem Tongehalt gewon-nener Bodenproben mit den aus der Inversionder gleichstromgeoelektrischen Dipol-Dipol-Datensätze gewonnenen spezifischen elektri-schen Widerständen.
Erkennbar nehmen mit zunehmendem Ton-gehalt und damit abnehmender hydraulischerDurchlässigkeit die spezifischen elektrischenWiderstände ab. Basierend auf elektrischenMessungen ist es daher möglich, relative Än-derungen der hydraulischen Durchlässigkeitabzuleiten. Zusammen mit den strukturellenAussagen ergänzender Verfahren können so-mit erfolgreich flächendeckende Bewertungender Auelehmdeckschicht vorgenommen wer-den.
In dem Vortrag werden die angewand-ten geophysikalischen Verfahren und derenErgebnisse sowohl für die strukturelle, alsauch die stoffliche Charakterisierung disku-tiert. Besonders verwiesen werden soll auchauf das Poster „Georadarmessungen zur Be-wertung von Auelehmdeckschichten - EinBeitrag zum Grundwasserschutz“.
Verschiedenes 441
VE01 – Fr., 28.2., 11:40-12:00 Uhr · HS2Delisle, G. (BGR, Hannover), Allard, M. (Universite Laval, Quebec)
Observing the degradation of permafrost in northern Quebec in response to climatechangeE-Mail: [email protected]
We monitor since July 2000 the slowchanges of the internal temperature field ofa permafrost mound or mineralogenic palsa,which appears to enter the early stage of de-cay. The structure is located east of Umiu-jaq, Northern Territories, and near the easternshoreline of the Hudson Bay in an area of dis-continuous permafrost. Our key observationsafter two years of measurements are:
The depth of permafrost and the internaltemperature field are not controlled by the re-gional heat flow density, but rather by the tem-perature contrast of relatively warm ground-water flow at depth and the cold mean annualsurface temperatures. The soil and ice temper-atures in the central and lower portion of themound - - the structure is largely made up byice lenses - - is largely unaffected by the an-nual temperature wave imprinted upon the sur-face of the mound. An almost linear tempera-ture gradient is observed in this lower moundportion, which allows an estimate of the ver-tical heat flow. His value is at least threefoldhigher than the regional terrestrial heat flowvalue and attests to the predominant influenceof groundwater flow at depth.
We have observed a continuous warming ofthe permafrost body within the last two yearsat a rate of 0.04 °C. We expect a completedisappearance of the permafrost in the regionwithin the next ten years and a concurrentcomplete change in fauna and flora.
Fracturing of the frozen core, apparentlyin response to expansion of freezing ice andheaving of the whole structure, occurs un-
der the active layer and near the base. Sud-den inflow of water into the frozen fringe ofthe mound was observed by sudden tempera-ture increases, followed by thermal relaxationto ambient temperatures within days in somecases.
One pressure transducer was placed intothe freezing front at the base of the mound.Strong underpressure in response to cryosuc-tion was observed. The observation of ap-parently gas tight portions as well as finger-shaped unfrozen portions, pointing laterallyinto the frozen mound, suggests a soil ma-trix with fully frozen and partially frozen por-tions alike. We conclude from this observa-tion the presence of a strong hydraulic gradi-ent and episodic, maybe even permanent in-flow of fluids with depressed freezing pointsinto the frozen part of the mound. We estimatethe soil permeability to lie below ·10−15 ·m2
for this network within the permafrost mound.The groundwater temperatures in discontin-
uous permafrost are strongly influenced by thevery effective heat storage in lakes and riversduring summer time. Monitoring of the meanannual temperature of the bottom waters inshallow lakes in discontinuous permafrost ter-rain shows values above 5 °C.
442 Abstracts
VE02 – Fr., 28.2., 11:00-11:20 Uhr · HS1Barth, A. (Göttingen), Ritter, J.R.R. (Karlsruhe), Schweitzer, J. (Kjeller)
Karl Bernhard Zoeppritz (1881-1908)E-Mail: [email protected]
Karl Bernhard Zoeppritz wurde am 22. Ok-tober 1881 in Mergelstetten im Süden Heiden-heims (Württemberg) geboren. Er studierte inMünchen und Freiburg, wo er 1905 in Geolo-gie promovierte.
Später wandte er sich der Geophysik zuund ging hierfür zu Emil Wiechert nach Göt-tingen. Karl Zoeppritz war ab Winterse-mester 1906/07 Assistent Wiecherts und er-arbeitete anhand von Laufzeitkurven drei-er Erdbeben aus den Jahren 1905/06 eineGeschwindigkeits-Tiefen-Funktionen für dieErde. Wichtig dabei war die Erkenntnis, dassErdbebenwellen an Diskontinuitäten in der Er-de und auch an der Erdoberfläche reflektiertund konvertiert werden konnten, wodurch sichviele bislang unerklärte Welleneinsätze erst-mals richtig zuordnen ließen.
Der bedeutenste wissenschaftliche Beitragvon Karl Zoeppritz ist die Herleitung der nachihm benannten Zoeppritz-Gleichungen. Mitdiesen lassen sich die Amplituden für trans-mittierte, reflektierte und konvertierte Wellenan einer Grenzfläche berechnen. Diese Arbeitwurde posthum von Wiechert im Jahre 1919veröffentlicht.
In weiteren Untersuchungen befasste sichKarl Zoeppritz mit der Variation der Amplitu-de und dem Einfallswinkel seismischer Wel-len, die aus der Interferenz von direkter, re-flektierter und konvertierter Welle resultieren.
Karl Zoeppritz wohnte in Göttingen etwaein Jahr im etwas ausserhalb gelegenen Geo-physikalischen Institut im sogenannten Assis-tentenzimmer. Im August 1907 heiratete erElisabeth Ganz und zog in die Stadt, wo er
zusammen mit dem neuen Assistenten Wie-cherts, Ludwig Geiger, im selben Haus wohn-te.
Zoeppritz starb am 20.Juli 1908 in Göt-tingen im Alter von 26 Jahren und wur-de in Karlsruhe begraben. Wiechert wür-digt ihn in einer Todesanzeige „im Auftragder Kommission der Königlichen Gesellschaftder Wissenschaften für luftelektrische For-schung“ als „hochbegabten, unermüdlich täti-gen, von idealem Streben stets erfüllten Mann,der trotz seiner Jugend schon mancherlei Ver-
Abbildung 1: Karl Bernhard Zoeppritz
Verschiedenes 443
dienst um die geophysikalische Forschung er-worben hat“.
Webseite: http://www.geo.physik.uni-goettingen.de/∼eifel/Seismo_HTML/zoeppritz.htm
444 Abstracts
VE03 – Fr., 28.2., 11:20-11:40 Uhr · HS1Börngen, M. (Leipzig)
Frühe geophysikalische Veröffentlichungen in Schriftenreihen der Sächsischen Akademieder Wissenschaften zu LeipzigE-Mail: [email protected]
Die Sächsische Akademie der Wissenschaf-ten zu Leipzig wurde am 1. Juli 1846 alsKöniglich Sächsische Gesellschaft der Wis-senschaften gegründet; seit der Schaffung desFreistaates Sachsen im Jahr 1919 trägt dieAkademie ihren heutigen Namen. Zu den 13Gründungsmitgliedern gehören der PhysikerWilhelm Weber und der Geologe Karl Fried-rich Naumann. Die Akademie hat, wie es inihrer Satzung heißt, „die Aufgabe, insbeson-dere durch ihre wissenschaftlichen Arbeiten,Denkschriften und Gutachten zur Schaffungund Mehrung geistiger und materieller Güterbeizutragen“ (http://www.saw-leipzig.de/).
Die Sächsische Akademie, deren Einzugs-bereich für Ordentliche Mitglieder im wesent-lichen auf den mitteldeutschen Raum fest-gelegt ist, gliedert sich in drei Klassen:die Mathematisch-naturwissenschaftliche (bis1942: Mathematisch-physische) und diePhilologisch-historische Klasse, die bereitsseit der Gründung der Akademie bestehen, so-wie die Technikwissenschaftliche Klasse, dieerst 1996 ihre Arbeit aufnahm.
Eine Auflistung der Akademiemitglieder imJubiläumsjahr 1996 (WIEMERS, FISCHER1996) nennt rund 700 Namen, die sich et-wa gleichmäßig auf die beiden traditionellenKlassen verteilen. Etwa 60 Gelehrte vertretendie Astro- und Geowissenschaften. Als Geo-physiker sind vier Wissenschaftler ausgewie-sen: Vilhelm Bjerknes, Ludwig Weickmann(Präsident der Akademie 1940 bis 1945), MaxRobitzsch und Christian Hänsel. Alle vier sindjedoch in erster Linie Meteorologen. Gleich-
wohl haben sie wie viele weitere Akademie-mitglieder vor und nach ihnen nachhaltig diePhysik der festen Erde gefördert. Traditions-reiche Institute (z. B. das GeophysikalischeInstitut der Universität Leipzig) oder Observa-torien (Erdmagnetische Warte, Leipziger Erd-bebenwarte, Geophysikalisches Observatori-um Collm) sind dem Engagement dieser Ge-lehrten zu verdanken.
Die Forschungsergebnisse der Akademie-mitglieder wie auch anderer Autoren werdenvor allem in den „Sitzungsberichten“ und den„Abhandlungen“, jeweils getrennt nach Klas-sen, veröffentlicht. Seit Gründung der Gesell-schaft ist so ein ansehnliches Schrifttum ent-standen (HÜBNER 2000), das auch mehrereinteressante Arbeiten zur Geophysik enthält,von denen nachfolgend einige stellvertretendgenannt seien. Besonders zahlreich sind Ar-tikel zur Erforschung von Erdbeben (ZÖLL-NER 1872), wobei die Berichte zu den vogt-ländischen Beben (CREDNER 1888) sowieaus der Erdebenwarte Leipzig/Collm einenbreiten Raum einnehmen (ETZOLD 1902,WEICKMANN 1928, MILDNER 1929). DiePublikationen zum Thema Geomagnetismus(D’ARREST 1850, REICH 1848, ZÖLLNER1871) gehören zu den ganz frühen Akademie-schriften. Wegweisende Arbeiten zum Pro-blemkreis Gravimetrie - Isostasie - Gebirgsbil-dung stammen aus den 20-er Jahren (KOSS-MAT 1921). Hinsichtlich der angewand-ten Geophysik stehen geoelektrische Verfah-ren im Mittelpunkt (BUCHHEIM 1964). DasGrenzgebiet der Biogeophysik wird vorrangig
Verschiedenes 445
seitens der Medizin behandelt (DRISCHEL1975). Eine Reihe mathematischer Aufsätzehaben für die Auswertung geophysikalischerMessungen Bedeutung erlangt. Hier sei aus-drücklich die klassische Arbeit von JohannRADON (1917) genannt.
Es ist schließlich auf eine von der Akade-mie betreuten Ausgabe hinzuweisen, die eineunverzichtbare Basis für wissenschaftshistori-sche Forschungen auf dem Gebiet der Natur-wissenschaften und damit auch der Geophy-sik darstellt: das 1863 begründete Werk „J.C. Poggendorff: Biographisch-literarischesHandwörterbuch der exakten Naturwissen-schaften“, das in Biobibliographien Naturwis-senschaftler der ganzen Welt mit einem kur-zem Lebenslauf und einem Verzeichnis ihrerVeröffentlichungen erfaßt.
Literatur
BUCHHEIM, W.: Zur Theorie der geoelek-trischen Erkundungsmethodik und Systematikder geoelektromagnetischen Effekte. Ber. 105(1964), H. 5. 40 S.
CREDNER, H.: Das vogtländische Erdbe-ben vom 26. December 1888. Ber. 41 (1889),S. 76-85.
D’ARREST, H.: Bestimmung der Declina-tion im magnetischen Observatorium zu Leip-zig. Ber. 2(1850), S. 100-105.
DRISCHEL, H.: Organismus und geophy-sikalische Umwelt. Ber. 111 (1975) 2. 50 S.
ETZOLD, F.: Das Wiechertsche astatischePendelseismometer der Erdbebenstation Leip-zig und die von ihm gelieferten Seismogram-me von Fernbeben. Ber. 54 (1902), S. 283-326.
HÜBNER, M.: Die Publikationen 1846 bis2000: Sächsische Akademie der Wissenschaf-ten zu Leipzig. Stuttgart: Hirzel 2000. 210S.
KOSSMAT, F.: Die mediterranen Kettenge-birge in ihrer Beziehung zum Gleichgewichts-zustande der Erdrinde. Abh. 38 (1921)2. 63S.
MILDNER, P.: Bericht der Erdbebenwartedes Geophysikalischen Instituts der Universi-tät Leipzig, 2: Die im Jahre 1928 in Leipzigaufgezeichneten Erdbeben. Ber. 81 (1929), S.239-266.
RADON, J.: Über die Bestimmung vonFunktionen durch ihre Integralwerte längs ge-wisser Mannigfaltigkeiten. Ber. 69 (1917), S.262-277.
Reich, F.: Beobachtungen über die magne-tische Polarität des Pöhlberges bei Annaberg.Ber. 2 (1848), S. 237-247.
WEICKMANN, L.: Der Umbau des Leip-ziger Seismographen und die in den Jahren1925, 1926 und 1927 aufgezeichneten Erdbe-ben. I. Bericht der Erdbebenwarte des Geo-physikalischen Institutes der Universität Leip-zig. Ber. 80 (1928), S. 385-496.
WIEMERS, G., FISCHER E.: Die Mitglie-der von 1846 bis 1996: Sächsische Akade-mie der Wissenschaften zu Leipzig. Berlin:Akademie-Verlag 1996. 227 S.
ZÖLLNER, K. F.: Über den Ursprung desErdmagnetismus und die magnetischen Bezie-hungen der Weltkörper. Ber. 23 (1871), S.479-575.
ZÖLLNER, K. F.: Zur Geschichte des Ho-rizontalpendels. Ber. 24 (1872), S. 183-192.
446 Abstracts
VE04 – Fr., 28.2., 11:40-12:00 Uhr · HS1Kühne, K. (Hannover, GGA-Institut)
Das Fachinformationssystem Geophysik des GGA-InstitutsE-Mail: [email protected]
ZieleFachinformationssysteme speichern bzw. lie-fern - ggf. auch im Verbund mit thema-tisch verwandten Fachinformationssystemen -einen wesentlichen Teil der von unserer Ge-sellschaft benötigten Informationen.
Mit dem Aufbau eines Fachinformati-onssystem Geophysik (FIS GP) des GGA-Instituts soll ein homogen strukturierter undqualitätsgeprüfter Datenbestand als Grundlagefür eine gesicherte und komfortable Interpre-tation geophysikalischer Messungen geschaf-fen werden. Das FIS Geophysik hat als Hand-werkzeug für die Lösung von wissenschaft-lichen Problemstellungen eine wichtige Be-deutung. Über eine im Aufbau befindlicheRecherchekomponente sollen aber auch Infor-mationen bzw. Metainformationen über dasInternet zugänglich gemacht werden. DieseFunktionalität soll vor allem die wissenschaft-lichen Kooperation mit Projektpartnern un-terstützen, aber auch dem externen Interessean den Arbeitsergebnissen des GGA-Institutsentgegenkommen.
ArchitekturDie Architektur des FIS Geophysik beruht aufder folgenden Konzeption:
Die Datenbank des FIS wurde auf Grundla-ge eines relationalen Datenbanksystems (MSSQL Server) angelegt. Sie besteht ausverschiedenen Subsystemen, die den Daten-und Auswertungsbedarf der unterschiedlichengeophysikalischen Methoden realisieren. Ge-meinsame Stammdaten der Subsysteme (z.B.
von Messungen aller Art) werden in den glei-chen Datenbanktabellen (Überbau) gehalten,um subsystemübergreifende Recherchen zuermöglichen.
Ein umfangreicher und vernetzter geowis-senschaftlicher Thesaurus erlaubt die Be-schlagwortung von Messungen, Messgerätenusw. und verbessert dadurch deren Recher-chierbarkeit. Der Überbau umfasst auch Ta-bellen zur Speicherung von Bohrungen undgeologischen Profilen. Ein hierarchisch orga-nisiertes amtliches Gemeindeverzeichnis (mitUmringpolygonen) erlaubt die automatischeZuordnung von Bohrungen und Messungenzu Gemeindennamen über die Punktkoordina-ten. Bilder und Dokumente werden zwar au-ßerhalb der Datenbank gehalten, aber von derDatenbank mitverwaltet. Die Datenbank un-terstützt auch das Arbeiten mit verschiedenenKoordinatensystemen.
Die Standard-Bedienungsoberfläche aufClient/Server-Basis unterstützt die üblichenFunktionen wie Recherchieren, Visualisieren,Drucken und Pflegen, enthält aber auch Dialo-ge zum Starten von Auswertungsprogrammen.Die eingesetzten Softwarewerkzeuge sind MSAccess und Visual Basic.
Die Bibliothek von Auswertungsprogram-men wird fortlaufend erweitert und bestehtsowohl aus selbst entwickelten als auch auskommerziellen Programmen. Diese werdenüber je einen Prä- bzw. Postdialog und eineDatenbankschnittstelle an die Datenbank an-geschlossen.
Der Internet-Zugang des FIS Geophysik er-laubt das geografische und thematische Re-
Verschiedenes 447
cherchieren im Datenbestand. Recherchier-te Mess- oder Auswertungsdaten können vi-sualisiert und per Download exportiert wer-den (MAUL, A.-A.: Die Internet-Schnittstelledes Fachinformationssystems Geophysik desGGA-Instituts; in diesem Band).
EntwicklungsstandWeitgehend fertig gestellt sind inzwischen derÜberbau und die Subsysteme Bohrlochgeo-physik, Gravimetrie, Magnetik und Gleich-stromgeoelektrik. Die Integration der bis-her eigenständigen Temperaturdatenbank desGGA-Instituts in das FIS Geophysik stehtkurz vor dem Abschluss. Das gleiche giltfür das Subsystem Petrophysik, das Laborana-lysen des geothermischen Gesteinslabors desGGA-Instituts aufnehmen wird.
Derzeit besteht die Datenbank aus ca. 170Tabellen und enthält das folgende Datenvolu-men (überwiegend aus Deutschland):
• 400 (von insgesamt ca. 5.000 digital ver-fügbaren) Logs im Subsystem Bohrloch-geophysik,
• 54.000 Messpunkte im Subsystem Gravi-metrie,
• 1.200.000 Messpunkte im SubsystemMagnetik,
• 20.000 Sondierungen und 2.500 interpre-tierte Widerstandsprofile im SubsystemGleichstromgeoelektrik,
• Temperaturmessungen aus 10.000 Boh-rungen im Subsystem Geothermik.
In den beiden kommenden Jahren wird dasFIS Geophysik um die Bereiche Seismik undElektromagnetik erweitert.
Der Internet-Zugang ist konzeptionell weit-gehend fertig gestellt und bisher für den Über-bau und die Subsysteme Bohrlochgeophysik,Gleichstromgeoelektrik und Magnetik proto-typisch implementiert. Die Entwicklung einerZugangskontrolle ist gegenwärtig noch in Ar-beit. Die Freigabe über das World Wide Webist für das Jahr 2003 geplant.
AusblickNach Fertigstellung des WWW-Außenzugangs soll das Interesse bei GGA-Partnern, an einer externen Nutzung forciertwerden. Dazu gibt es verschiedene möglicheOptionen (passive Nutzung bzw. Einspeiseneigener Daten, Nutzung als Informations-bzw. als Metainformationssystem, zentra-le bzw. verteilte Architektur). In diesemZusammenhang sind aber noch vielfältigeorganisatorische und technische Probleme zulösen.
448 Abstracts
VE05 – Fr., 28.2., 12:00-12:20 Uhr · HS1Maul, A.-A. (Hannover, GGA-Institut)
Die Internet-Schnittstelle des Fachinformationssystems Geophysik am GGA-InstitutE-Mail: [email protected]
Das Institut für Geowissenschaftliche Ge-meinschaftsaufgaben (GGA-Institut) betreibtunter dem Namen FachinformationssystemGeophysik (FIS-GP) eine Datenbank für geo-physikalische Messungen und Auswertungen.
Für den universellen institutsinternen Ein-satz (Erfassen, Pflegen, Recherchieren, Visua-lisieren und Auswerten von Daten) wird einekonventionell implementierte Client/Server-Anwendung vorgehalten (s. Vortrag KÜH-NE). Für den Zugang über das Internet bzw.Intranet wurden i.w. zwei Werkzeuge ent-wickelt. FIS GP/GEO dient der geographi-schen Suche sowie der Anzeige von Messun-gen und Bohrungen; FIS GP/NET bietet the-matische Recherchemöglichkeiten, insbeson-dere in den Stammdaten. Beide Methodennutzen die Webtechnologie und sind mitein-ander vernetzt.
FIS GP/GEO erlaubt eine geographischeSuche nach Messungen und Bohrungen voreinem Topographiehintergrund und kann ins-besondere auch zur Ermittlung von benach-barten Objekten dienen. Von den Trefferob-jekten werden die Stammdaten und Messwer-te ausgegeben sowie bei Messreihen einfacheGraphiken zur Übersicht angezeigt. Weiterhinist ein Download der Daten als ASCII-Dateifür weitere Auswertungen und für autorisiertePersonen möglich.
Zentrale Komponente des FIS GP/GEO istder sogenannte MapServer, der als Open-Source-Produkt hauptsächlich bei der Uni-versity of Minnesota entwickelt wird. DerMapServer stützt sich auf eine Reihe vonfrei verfügbaren Software-Bibliotheken wie
beispielsweise gd für die Graphikerzeugung,FreeType für die Anzeige von TrueType-Fonts, Proj.4 für Projektionsalgorithmen zwi-schen verschiedenen Koordinatensystemenetc.
Der MapServer kann Vektor- und Rasterda-ten verschiedener Formate verarbeiten. BeiVektordaten bieten sich aus Performancegrün-den Shapefiles oder für flexible Anwendun-gen Datenbank basierte Formate wie z. B.ArcSDE der Fa. ESRI an. Satellitenbilderoder topographische Rasterdaten können bei-spielsweise im ERDAS- bzw. TIFF-Formatverarbeitet werden. Aus diesen Ausgangs-daten erzeugt der MapServer eine Karte imGIF- oder PNG-Format mitsamt automatischgenerierter Legende und Maßstab, die inner-halb einer vom Anwender frei gestaltbarenHTML-Seite platziert werden. Die zur in-teraktiven Navigation und Abfrage von Ob-jekten notwendige Kommunikation und Ab-laufsteuerung erfolgt clientseitig über HTML-Forms und JavaScript oder serverseitig mit derPHP-Bibliothek MapScript.
Weitere Eigenschaften des MapServers sinddas skalenabhängige Einblenden von Informa-tionen, die thematische Klassifizierung vonDaten anhand von logischen oder regulä-ren Ausdrücken sowie die kollisionsfreie Be-schriftung von Objekten.
Neben den Ausgangsdaten benötigt derMapServer zwei Konfigurationsdateien. Dassogenannte HTML-Template bestimmt dasAussehen der Anwendung und enthält Platz-halter für die vom MapServer generierten Ob-jekte. In einer zweiten Datei werden u.a.
Verschiedenes 449
die anzuzeigenden Informationsebenen mit-samt ihrer Eigenschaften definiert.
Gegenwärtig auswählbare und abfragbareInformationsebenen sind Daten zu Bohrungenund aus den Bereichen Bohrlochgeophysik,Gravimetrie, Magnetik sowie Gleichstrom-geoelektrik.
FIS GP/NET ist innerhalb der Internet-Schnittstelle für die thematische Recherchezuständig. FIS GP/NET erlaubt das Suchen,Anzeigen, Drucken, Visualisieren sowie denExport und Download von Datenbankinhal-ten. Die Bedienung erfolgt über ein hierar-chisches Menü, dessen Aufbau der Strukturder FIS-Datenbank (Überbau und Subsyste-me) entspricht.
Die Eingabe von Suchkriterien erfolgt for-mularorientiert (Query by Example). Insbe-sondere wird dabei auch die Recherche imdatenbankinternen Thesaurus und im hierar-chisch organisierten amtlichen Gemeindever-zeichnis unterstützt. Suchergebnisse könnenwahlweise in Kurzform tabellarisch oder voll-ständig in einem Formular angezeigt wer-den. Von einem Treffersatz aus kann zuPartner-Sätzen in durch Beziehung zugeord-neten Nachbartabellen der Datenbank navi-giert werden. Treffersätze aus Tabellen mitgeografischen Bezügen können auf Knopf-druck in FIS GP/GEO visualisiert werden.Koordinaten können bezogen auf unterschied-liche Referenzsysteme und Projektionen ein-gegeben bzw. angezeigt werden.
FIS GP/NET arbeitet i.w. Server basiert, sodass die Bedienung ohne die Installation zu-sätzlicher Software über einen Web-Browsererfolgt.
Die technische Grundlage von FIS GP/NETist ein ebenfalls im GGA-Institut entwi-ckeltes Entwicklungstool namens QFORM.QFORM ist ein Anwendungsgenerator, derdie in ASCII-Dateien vorliegenden formalen
Beschreibungen von Suchformularen, Treffer-tabellen, Auswertungsmöglichkeiten usw. unddes zugehörigen SQL-Codes zur Laufzeit in-terpretiert. Durch diese Technik sind relativkurze Entwicklungszeiten und (bedingt durchdie Einheitlichkeit der Bedienungsoberfläche)eine leichte Bedienbarkeit gewährleistet.
Derzeit werden FIS GP/NET und FISGP/GEO nur innerhalb des Geozentrums Han-nover eingesetzt (Stand: November 2002); in2003 wird die Anwendung im Internet ange-boten, sobald die Authentifizierungskompo-nente implementiert sein wird.
In Kürze mögliche Internet-Funktionalitäten sind der Zugriff aufStammdaten nach erfolgreicher Recher-che mit dem FIS GP/GEO sowie die Anzeigeund der Zugriff auf die Daten per Downloadfür Projektpartner nach erfolgter Authen-tifizierung. Weiterhin ist eine Annahmevon projektbezogenen Fremddaten (evtl.reduziert auf Stammdaten zwecks Nachweis)vorgesehen.
Physikalische Vulkanologie und Georisiken 451
VU01 – Mo., 24.2., 11:00-11:20 Uhr · HS6Bagdassarov, N. (Institut für Meteorologie und Geophysik, J.W. Goethe Universität Frankfurt,Frankfurt am Main), James, M. (Department of Environmental Science, I.E.N.S., LancasterUniversity, Lancaster), Müller, K. (Institut für Meteorologie und Geophysik, J.W. Goethe Uni-versität Frankfurt, Frankfurt am Main), Pinkerton, H. (Department of Environmental Science,I.E.N.S., Lancaster University, Lancaster)
Viskoelastizität basaltischer LavenE-Mail: [email protected]
Rheologische Eigenschaften basaltischerLaven vom Ätna, Vesuv und aus Hawaii wur-den im Temperaturbereich von 500 bis 1150°Cmit einem Torsionsdeformationsgerät gemes-sen. Das von Berckhemer et al. (1982) kon-struierte Gerät wurde modernisiert und mitHilfe eines PC gesteuert. Mit Hilfe des Gerätswurde eine zylindrische Gesteinsprobe von 8mm Durchmesser und ca. 20 mm Länge umeinen kleinen Winkel tordiert. Die viskoelas-tische Antwort der Lavaproben auf das kleinesinusoidale Drehmoment (< 10−3N ·m) wur-de im Frequenzbereich von 0.002 bis 20 Hzanalysiert.
Eine rein viskose Deformation konnte nurbei den basaltischen Lavaproben aus Hawaiibei Temperaturen zwischen etwa 1070°und1130°C beobachtet werden. Die gemessenenWerte der Viskosität im betrachteten Scherra-tenbereich (10−1 bis 10−2s−1) sind 4-5 Grö-ßenordnungen höher als die Felddaten fürHawaii-Laven. Dieser Unterschied wird vonder großen Amplitude der Deformation in denFeldmessungen verursacht. Bei geringer De-formation ist die innere Textur von Lavapro-ben, z. B. die einzelnen Kontakte zwischenKristallen, nicht verändert worden, weswegendie Lavaproben eine hohe Viskosität und Vis-koelastizität zeigen. Nur im Temperaturbe-reich > 1070°C konnte eine von der Scher-rate unabhängige Rheologie der Lavaproben(η > 109 Pa s) gemessen werden.
Die Lavaproben vom Ätna und Vesuv zeich-nen sich durch ihre viskoelastischen Eigen-schaften, z. B. durch eine Frequenzabhän-gigkeit von Schermodul, Viskosität und in-nerer Reibung aus. Eine zeitabhängige Än-derung der Schermodulwerte (Zunahme >∼30 % vom Anfangswert) bei einer Temperaturvon 800°C wurde über einen Zeitraum von ca.120 Stunden beobachtet. Diese Zunahme desSchermoduls zeigt die strukturellen Änderun-gen in den Lavaproben während eines langenSinterings bei einer Temperatur von >750-800°C. Eine solche Änderung des Schermo-duls entspricht einem Heilungsprozeß von Mi-krorissen und einem Härten der Lava, die beihohen Temperaturen gehalten wird. Für denErstarrungsprozeß eines Lavastroms bedeutetdas, dass die inneren Teile des Lavastroms, wodie Kühlungsrate am kleinsten ist und die ther-mische Kontraktion in eine geringere Dich-te von Mikrorissen resultiert, einen großenSchermodul im Vergleich zu den Rand- undKrustenteilen eines Ergusses haben werden.
Bagdassarov, N.S., 2000. Anelastic and vis-coelastic behaviour of partially molten rocksand lavas. In: Bagdassarov N., Laporte D.,Thompson A. (Eds.), Physics and chemistry ofpartially molten rocks. Kluwer, Dordrecht, 29Berckhemer, H. et al. 1982. Anelasticity andelasticity of mantle rocks near partial melting.In: Schreyer, W. (Hrsg.), High-Pressure Rese-arches in Geoscience. E. Schweizerbart’sche
452 Abstracts
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 113Pinkerton, H., Norton, G., 1995. J. Volc.Geoth. Res. 68, 307Ryan, M.P., Blevins, J.Y.K., 1987. U.S. Geol.Surv. Bull. 1764, Denver, 455
� � � � � � � � ��� � �� �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
! " # $ ! %& ' ( ) * + , - * - ./ 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @A B C D E F G C H I J K L M N O O PQ R S T U V W X S U W Y Z [ \ ] ^ ^ _ `a b c d e f g h i jk l m n o p q r q s
t u v w x y z v { | } u ~ x u y { } � y u � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � �� � � � � � � �
����� �� ¡ � �¢£¢¤¥¦§�
Abbildung 1: Nullscherrate-Viskosität η0der Hawai’ische Lavaprobe ist im Ver-gleich zu den dilatometrischen Messun-gen im Labor (Bagdassarov, 2000) undRotationsviskosimeter-Messungen im Feld(Shaw, 1968, 1969; Ryerson et al., 1988; Ry-an and Blevins, 1974; Pinkerton et al. 1995).Die Aktivationsenergie der Viskosität ist etwa∼950 kJ mol−1. Die Abb. zeigt eine Diffe-renz von etwa ∼5 Größenordnungen bei derTemperatur etwa ∼1155°C. Diese Temperaturist ein Übergangstemperatur zwischen Newto-nischen und viskoplastischen Rheologien. DieKurve 1 s−1 zeigt die Ergebnisse der Torsions-deformationsmessungen bei dem Scherrate 1s−1.
Ryerson, F.J. et al.,1988. J. Geophys. Res. 93,3421Shaw, H.R. et al., 1968. Am. J. Sci. 266, 225Shaw, H.R., 1969. J. Petrol. 10, 510
Physikalische Vulkanologie und Georisiken 453
VU02 – Mo., 24.2., 11:20-11:40 Uhr · HS6Leonardi, S. (Bonn)
Time evolution analysis of volcanic tremor amplitude at Mt. Etna: Implications for mag-ma dynamicsE-Mail: [email protected]
Volcanic tremor is a long period seismicevent observed during eruption stages andis supposed to be generated by the magmamovements within the Earth’s crust. Mt. Etna,Sicily, is a huge basaltic volcano characterisedby persistent activity at its summit cratersand by sporadic lateral or eccentric eruptions.As a consequence, tremor data can be herealmost continuously recorded and Mt. Etnarepresents one of the most suitable volcanicsystems to study this kind of seismic signals.Our attention is focussed on tremor timeseries, sampled at different scales - in a rangefrom 100 to 105 s - during the years 1983 -1999 at Mt. Etna. Several flank eruptionsand numerous stages of persistent activity atthe summit craters occurred in this time span(Table). On a daily scale, nine time intervalswere singled out. Each one of them compre-hends a period characterised by one type ofvolcanic activity (e.g. effusive eruptions orlava fountains) and for which the tremor timeseries may be considered stationary.The statistical properties of tremor were inves-tigated among others by means of spectral andrescaled-range analyses. The results point outthat the correlation degree within the tremordata drops during lava fountain stages, i.e.paroxystic explosive events characterised bya suddenly increase of seismic energy (up to40% more than the average tremor amplitudevalue). These results are also confirmed bysimilar analyses on fixed time intervals.Since lava fountains at Mt. Etna have anaverage duration of 102 - 104 s, periods
characterised by several paroxystic explosiveevents present tremor data with intermittentfeatures. This is evident for three of thenine time intervals investigated (1989 - 1990,1995 - 1996, 1998 -1999). Intermittenceis a fingerprint of several low-dimensionalchaotic systems, for which the near futuremay be predicted with a high degree of ac-curacy. Low-dimensional chaos analysis wasperformed to find out, whether forthcominglava fountains could be singled out on thebasis of tremor signals. The results show thatthe dynamics of lava fountains is governedby a high number of degrees of freedom andtherefore more complex than low-dimensionalchaotic systems.The tremor signals at Mt. Etna can bemodelled following well-known statisticalprocesses. Further studies of the autocorrela-tion functions point out that tremor amplitudevariations during period of quiet degassingand of eruptive activity may be approximatedto autoregressive (AR) processes with 1/f-noise features. For lava fountains stages,on the other side, the tremor signals may bemodelled by means of moving average (MA)processes with anti-persistence character.The results of the statistical analyses may beinterpreted in the frame of magma dynamicsat Mt. Etna. Different studies support thehypothesis that volcanic tremor is generatedby degassing processes. These are usuallysimulated by two-phase fluid flow models, ofliquid and gas phase, the latter of which be-gins to separate when the lithostatic pressure
454 Abstracts
Time interval Location Type of eruptionMarch – August 1983 Southern flank mainly effusive eruptionApril – October 1984 SE Crater stromb. activity and lava effusion
March – July 1985 Southern flank mainly effusive eruptionDecember 1985 Eastern flank lava fountaining and effusion
August – September 1986 NE Crater strombolian activityOctober 1986 – February, 1986 ENE flank explosive – effusive eruption
April 1987 SE Crater phreatic explosionsApril 1988 – September 1989 summit craters strombolian activity and lava effusion
September – October 1989 ENE flank, summit craters lava fountains and effusionJanuary – February 1990 SE Crater lava fountains
July 1990 – December 1991 summit craters strombolian activityDecember 1991 – March 1993 SE flank mainly effusive eruptionSeptember 1995 – August 1996 summit craters lava fountains
September 1996 – December 1997 summit craters strombolian activityJanuary 1998 – August 1999 summit craters lava fountains
encountered by the rising magma decreases(bubbly flow state). According to the ascentvelocity, the rising magma may fragmentatenear the surface or deeper in the crust. Thedeeper the fragmentation surface, the higheris the velocity to the vent and the larger isthe energy released. The present study ontremor time series points out the deepeningof fragmentation during paroxystic explosiveevents, confirming the current geophysicalmodels.
Physikalische Vulkanologie und Georisiken 455
VU03 – Mo., 24.2., 11:40-12:00 Uhr · HS6Gabriel, G., Buness, H., Pucher, R., Schulz, R., Wiederhold, H., Wonik, T. (Hannover), Jacoby,W., Wallner, H. (Mainz)
Maare im Abbild geophysikalischer VerfahrenE-Mail: [email protected]
Maare sind vulkanische Strukturen, derenEntstehung auf phreatomagmatische Explo-sionen zurückgeht: Der Kontakt von aufstei-gender Magma mit Grundwasser führt zu einerSerie von Explosionen mit dem Ergebnis ei-nes Kraters. In ihm bildet sich ein See, der an-schließend zusedimentiert. Das Auffinden sol-cher Strukturen ist über die Klärung der geo-logischen Genese hinaus attraktiv, da die See-sedimente ein hoch auflösendes Archiv der lo-kalen Klimageschichte darstellen.Untersuchungen des Instituts für Geowissen-schaftliche Gemeinschaftsaufgaben (GGA-Institut, Hannover) und der Universität Mainzan verschiedenen Maaren zeigen, dass deneinzelnen geophysikalischen Methoden un-terschiedliche Aufgaben bei der Erkundungderartiger Strukturen zukommen. Gravime-trie und Magnetik sind zusammen in der La-ge, Maare unter verschiedenartigen Struktu-ren, die ähnliche Formen aufweisen, zu iden-tifizieren: Die Seesedimente verursachen auf-grund ihrer im Vergleich zur Umgebung inder Regel geringen Dichtewerte eine negati-ve gravimetrische Anomalie. Darüber hinaustritt häufig – teilweise außerhalb des Zentrumsder Schwereanomalie – auch eine magnetischeAnomalie mit geringerer horizontaler Erstre-ckung auf. Sie wird als Indiz für vulkanischesMaterial gedeutet, das entweder schwach ma-gnetisierter Tuff oder ein stärker magnetisier-ter Basaltkörper sein kann. Reflexionsseismi-sche Messungen liefern ein hoch aufgelöstesBild der internen Struktur eines Maars, ins-besondere der Seesedimente. Unter günstigen
Bedingungen können auch tieferliegende Re-flektoren erfasst werden.Als Beispiele werden die Maare von Baruth(Sachsen) und Messel (Hessen) im Vergleichvorgestellt. In beide Strukturen wurden durchdas GGA-Institut Forschungsbohrungen abge-teuft, die aufgrund geophysikalischer Messun-gen angesetzt wurden. Die bohrlochgeophysi-kalischen Vermessungen liefern wichtige Bei-träge für die Interpretation der Oberflächen-geophysik, lassen aber auch Rückschlüsse aufdie Sedimentationsgeschichte zu.Die gravimetrischen Anomalien über den bei-den Maaren sind sowohl in ihrer Form als auchin ihrer Amplitude ähnlich (Abb. 1). Die La-ge der lokalen Schwereminima korrespondiertmit der maximalen Mächtigkeit der Seesedi-mente und definiert in beiden Projekten diePosition des Bohransatzpunktes. Quelle fürdie Schwereanomalien sind in Baruth mäch-tige Diatomite, Turbidite und Debris Flowsmit Dichten zwischen 1300 und 2000 kg/m3.In Messel wird die gravimetrische Anomalieim Wesentlichen durch Schwarzpelite (1300 -1500 kg/m3), aber auch eingeschaltete klasti-sche Sedimente (um 2000 kg/m3), verursacht.Im magnetischen Anomalienfeld zeigen sichim Vergleich Baruth/Messel deutliche Unter-schiede. Über dem Baruther Maar konnteeine positive Anomalie von 320 nT nachge-wiesen werden, während Messungen in Mes-sel eine negative Anomalie von 300 nT erga-ben (Abb. 1). Mit den ForschungsbohrungenBaruth ist es nicht gelungen, den magnetischwirksamen Störkörper zu erreichen. Modell-
456 Abstracts
0 0.5 1 km
Baruth Gravimetrie: -6.9 mGal
Magnetik: 320 nT
Messel Gravimetrie: -6 mGal
Magnetik: -300 nT
Abbildung 1: Potentialfeldanomalien über den Maaren bei Baruth (Sachsen) und Messel (Hes-sen); grau: Bouguer-Anomalien (Isolinienabstand 1mGal), schwarz: Anomalien des erdma-gnetischen Totalfeldes (Isolinienabstand 50 nT).
rechnungen legen die Annahme von zwei ge-trennten Störkörpern nahe, von denen einer alsvulkanisches Material interpretiert wird. Die-ser Körper ist etwa 300 m mächtig, seine Ma-gnetisierung wird mit 2,6 A/m angenommen.Der zweite Modellkörper muss im Bereich desZentrums des Diatrems liegen. Er bestehtmöglicherweise aus Magma, die nach Endeder Wasserzufuhr abgekühlt ist. In Messel hatdie Forschungsbohrung magnetisierte Pyro-klastika in Tiefen zwischen 230 und 370 m er-bracht, die sich in ihren magnetischen Eigen-schaften deutlich differenzieren lassen (ROLFet al., dieser Tagungsband). Aus den bohr-lochgeophysikalischen Messungen und Kern-untersuchungen liegen zuverlässige Angabenüber die magnetischen Eigenschaften der Ge-steine vor. Allerdings kann die erbohrte Se-quenz an Pyroklastika unter Berücksichtigungihrer gesteinsmagnetischen Eigenschaften nuretwa 60 % der gemessenen magnetischen An-
omalie erklären.Die reflexionsseismischen Profile über denbeiden Maaren zeigen im großen Maßstab ver-gleichbare Strukturen, im Detail finden sichjedoch wichtige, auch durch die Genese be-dingte Unterschiede. Die seismischen Profilebilden jeweils deutlich die Maarstruktur undihre Füllung mit Seesedimenten ab. Die fürdie Klimaauswertung interessanten Diatomite(Baruth) bzw. Schwarzpelite (Messel) zeich-nen sich durch eine reflexionsarme Zone aus.Reflexionen unterhalb dieses Bereichs spie-geln Turbiditlagen oder Debris Flows wider.
Webseite: http://www.gga-hannover.de
Physikalische Vulkanologie und Georisiken 457
VU04 – Mo., 24.2., 12:00-12:20 Uhr · HS6Rivalta, E., Dahm, T. (Institut für Geophysik, Universität Hamburg)
Dike emplacement in fractured mediaE-Mail: [email protected]
Introduction: Volcanoes are formed by re-peated magmatic intrusions. Only a smallfraction of the intrusions finds its way to thesurface, magmatic reservoirs can thus be gen-erated, bearing the risk of dangerous explosiveeruptions after alterations of the magmaticstate or of the stress conditions. The degassingof magmatic reservoirs produce regions ofmultifractured rocks, which are known to sig-nificantly weaken volcanoes. When loadedby intrusions-induced stress, the weakenedvolcanic flanks and rocks may fail and ini-tiate a major eruption. Seismicity and de-formation are important ways to identify andtrace intrusions and to make eruption fore-casts. Intrusion-induced stressing rate pro-portionally controls the seismicity rate duringearthquake swarms.
Dike-induced deformation and seismicityacting on already fractured rock cause a fur-ther weakening of the volcanic edifice: thestrength of the rock decreases, and the dike
Figure 1: Examples of the random realiza-tions: Case 2a (left panel) and 2b (right panel)
opening process can continue. This interac-tion between the dike and seismicity is a com-plex self-controlling phenomenon, that is im-portant to quantify.
Our aim is to answer three questions:(1) what is the effect of a cracked media on
the shape of the intrusion,(2) what is its effect on the stress intensity
factor at the tip of the intrusion, and(3) can both effects be described by ef-
fective media models and simplified analyticequations, as numerical studies of the mechni-
Figure 2: Normalized averaged crack openingor slip, numerical results and effective modulitheories predictions.
458 Abstracts
cal properties of cracked media are available.In this work we concentrate on the role of
the crack-surrounding fractures on the shapeand stability of the intrusion. We use a numer-ical boundary element approach for this pur-pose, and restrict the study to simple cases.
The model: A tensile crack (the dike) isembedded in a homogeneous medium, andmany smaller fractures are randomly dis-tributed around it (see Fig. 1). On the surfaceof the crack boundary conditions on the stressare imposed: a fluid is assumed to generate anoverpressure inside the crack. The fracturesare not allowed to intersect each other and aminimal fracture tip to tip distance is imposed.All the fractures are divided into segments ofequal length, and normal and tangential dis-placements on the surface of them are the un-knowns of the boundary element linear sys-tem. It is possible to assume several fracturingpatterns: (Case 1) the fractures are randomlyoriented, (Case 2) the fractures have the sameorientation as the dike. Furthermore, for eachcase: (a) all the small fractures have the samelength, or (b) the fracture lengths are logarith-mically distributed.
Results: Numerical results for a single runshow that:- the main crack opens wider and more irregu-larly if the medium is cracked,- in the inhomogeneous case the crack con-tracts more with respect to the homogeneouscase and the tangential displacement on thewalls is no more symmetrical (a shear dislo-cation is involved in the process),- the shape of the main crack is strongly de-pendent on the position of the small crackswith respect to it.
Because of this, results have been averagedafter 20 random realizations. Median and 1 σstandard deviation are plotted (see Fig. 2, toppanel). The crack opening increases if fractur-
ing is more intense (increasing crack densityc).
A crack is predicted to propagate if thestress intensity factor K at its tips overcomesthe fracture toughness Kc, a characteristic ofthe material. K is then a measure of the ten-dence of the dike to propagation. Resultsfor different degrees of fracturing (see Fig. 2,bottom panel) show that K approximately in-creases linearly with the crack density. Thishas at least two consequences. First, an in-trusion at static equilibrium may become in-stable and begin to open when the crack den-sity is increased in the surrounding rock. Sec-ondly, an intrusion growing at constant ve-locity may accelerate when entry into a veryfractured rock. Furthermore, as seismicity ac-companying dike emplacement is caused bythe fracturing processes around the propagat-ing structure, fracturing-enhanced dike open-ing can cause new failure in the volcanic edi-fice, to which it reacts with new dilatation, ifnew magma is available, and so on. Therefore,an auto-accelerating process can be generatedthat can lead to a possible eruption after a pe-riod of magma stability.
Models for the effective elastic parametersseem to underestimate the effects, especiallyfor tensile loading of the dike.
Acknowledgments: Work supported byEU-Project VOLCALERT.
Web page: http://www.geophysics.dkrz.de
Physikalische Vulkanologie und Georisiken 459
VU05 – Di., 25.2., 09:30-09:50 Uhr · HS6Commer, M., Helwig, S. L. (Inst. f. Geophysik, Universität zu Köln), Hördt, A. (Geolog. Inst.,Universität Bonn), Tezkan, B. (Inst. f. Geophysik, Universität zu Köln)
3-D Interpretation von LOTEM Daten vom Vulkan Merapi unter Berücksichtigung derTopographieE-Mail: [email protected]
LOTEM-Daten (Long Offset TransientElectromagnetics) von Messungen am aktivenVulkan Merapi in Zentral-Java (Indonesien)wurden mit einem 3-D Inversionsalgorithmusunter Berücksichtigung der Topographie aus-gewertet. Im Ggensatz zu einer vollen 3-D In-version mit üblicherweise großer Modellpara-meterzahl in Form von Gitterzellen, ist bei derhier vorgestellten Inversionsmethode eine re-lativ kleine Anzahl von Modellparametern va-riabel, so daß größere Strukturen des Erdmo-dells gleiche Leitfähigkeiten annehmen. Bei-spiele solcher Modellstrukturen sind horizon-tale, einfallende oder gewölbte Schichtun-gen mit eventuell zusätzlich eingebetteten 3-D Körpern. Darüberhinaus erlaubt die Me-thode, topographische Gegebenheiten, zu be-rücksichtigen. Der Inversionsalgorithmus ar-beitet mit der Marquardt-Levenberg Metho-de in Kombination mit eienm existierenden 3-D Modellierungsprogramm. Daten der zeitli-chen Ableitung des Magnetfeldes und elektri-sche Felddaten der Gipfelregion wurden un-ter Berücksichtigung der Topographie inter-pretiert.
Die Terrainstruktur wird durch ein Säulen-modell (siehe Abb.) dargestellt, das in Sek-tionen unterteilt wird, um Modellparameter inForm von Leitfähigkeiten und Schichtmäch-tigkeiten zu erlauben. Mit einem geschich-teten Vulkanmodell, dessen Schichtung nichthorizontal, sondern gemäß der Topographieverläuft, kann gute Konvergenz und Daten-anpassung für magnetische als auch für elek-
trische Daten erreicht werden. Die unters-ten aufgelösten Schichten nehmen relativ ho-he Leitfähigkeitswerte an, was die Annahmeder Existenz einer extrem leitfähigen Hydro-thermalzone bekräftigt. Die Inversionsme-thode stellt eine Alternative zu einer vollenund meistens rechenintensiven 3-D Inversiondar, falls genügend Vorinformationen vorlie-gen, um ein Startmodell mithilfe einer be-schränkten Anzahl von Modellparametern zubilden. Eine weitere Verringerung des relativgeringen Rechenaufwandes wird durch Paral-lelisierung der Berechnung der Parametersen-sitivitätsmatrix, die durch eine einfache Per-turbationsmethode gebildet wird, erreicht.
Webseite: http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/geo/index.html
Abbildung 1: Merapi-Säulenmodell
460 Abstracts
VU06 – Di., 25.2., 09:50-10:10 Uhr · HS6Nurcaya, B. (UGM, Jogjakarta), Brodscholl, A. (VSI, Bandung)
BB-Seismograms from external and internal events of Mt. Merapi show unique patternin time-frequency domain derived by the Continuos Wavelet TransformationE-Mail: [email protected]
Seismic broadband data from Mt. Merapi,Central Java recorded between 1994 and 1998at two sites at the slope of the volcano havebeen analyzed to find unique characteristics ofdistinct volcanic activity mainly occurring atthe summit or close to the summit. Those spe-cific events partly commonly defined as Mer-api type, include various kind of avalanches aslava and ash, pyroclastic lava flows and com-mon rockfalls. In addition to the here calledexternal events we also concentrate our at-tention on hybrid quakes, sometimes calledmulti-phase, which frequently are emergingprior to volcanic crisis. All data were recordedwith Streckeisen Seismometers using a cut-offfrequency at 0.00833 Hz, which are deployedabout 900m below the summit at the most ac-tive part of the volcano with relative safe ac-cess. Our focus is definitely addressed to thelow frequency content of the volcano-seismicdata to discriminate between unique events.
Unfortunately, standard analysing tools asusually applied in physical volcanology didnot match the frequency resolution necessar-ily to unravel and localize small low frequencysignals precisely. The well-known Fourierspectrum would be good enough to estimatethe amplitude of a certain signal calculatedwith the common Fourier transform. But theFourier transform only provides informationabout the frequency content of a certain sig-nal and nothing about its location in the timedomain. Other tools must be applied in orderto figure out a compromise between time andfrequency resolution. The Short Time Fourier
Transform (STFT) applied as a time frequencymethod could be an appropriate method butdid not match the necessary frequency reso-lution for signals with periods of about 1 sec-ond. Therefor the Continuos Wavelet Trans-formation (CWT) using the Morelet Wavelethas been applied. A tool well known in Geo-physics but just recently introduced in physi-cal volcanology. CWT and STFT have simi-lar properties but are distinguished in their de-pendencies of the analysis frequency. ThoughCWT in comparison to STFT owns a betterfrequency resolution at lower frequencies withsome loss in time resolution. This characteris-tic of CWT is so well pointed to an applicationfor seismograms, where small and short tran-sient signals with low frequencies are super-imposed from a dominant major signal con-taining frequencies in a wider range partlyclose to the low frequency event of the hiddensignal.
Specific seismo-volcano events analysedwith CWT provide some prominent results:Seismic events generated by lava and ashand pyroclastic lava flows strikingly show dif-ferent patterns in the time-frequency domaincompared with those derived from seismo-grams of cold avalanches. All of these eventsexcept the latter one are initialed by lower fre-quency signals at about 1Hz. Similar precur-sor signals are also detected in hybrid quakes.This feature is well established in processeddata initially recorded somewhere north of thesummit of Merapi. However, it is sometimesalmost missing or only weakly detectable in
Physikalische Vulkanologie und Georisiken 461
broad band data recorded at a site of the west-ern slope of Merapi. Therefore it is very im-portant to now the site response of any seis-mometer station which could be very differentat a volcano due to the complex structure. Thediversity of the attenuation factor from site tosite is surely very high. To discriminate be-tween those volcanic events it is therefor cru-cial to know how the body of the volcano af-fects the source signal travelling along differ-ent ray-paths. The method we used is help-ful to unravel such features. It is also effectiveto detect camouflaged hybrid quakes hidden involcanic tremor.
Background:The broadband seismometers were installed
from GFZ in collaboration with Gadjah MadaUniversity (UGM) during 1994 and 1995. Endof the last decade more seismometers and in-fra sonic tools were included from Univer-sity of Potsdam in a joint venture with GFZ,Volcanological Survey of Indonesia (VSI),BPPTK, and UGM. Currently the whole net-work consisting of 48 components is the heartof a modern early warning system working inreal time and feeding the earthworm program(USGS) upgraded from University of Potsdamfor use in physical volcanology.
462 Abstracts
VU07 – Di., 25.2., 10:10-10:30 Uhr · HS6Serfling, U. (Leipzig)
Registrierung von elektrischen Feldern am Vulkan Merapi und am GeophysikalischenObservatorium Collm. Methodik, Ergebnisse, Vergleiche.E-Mail: [email protected]
Der 3000 m hohe Vulkan Merapi befindetsich in Indonesien im zentralen Teil der InselJava. Diese Insel hat eine sehr hohe Bevöl-kerungsdichte von 870 Einwohnern pro km2.Allein in der näheren Umgebung des Merapileben mehr als 3 Millionen Menschen. Diemeisten von ihnen im Großraum der Stadt Yo-gyakarta. Vulkanische Krisen mit eruptivenEreignissen und partiellem Kollaps des Mag-mendoms setzen die Region einer permanen-ten Gefahr aus. Im Januar 2001 fand das letzteEreignis dieser Art statt.
Am Vulkan Merapi wurden und werdengeophysikalische Untersuchungen zur Struk-turerkundung durchgeführt. Neben der Daten-erfassung durch aktive Experimente (Seismik,Geochemie, elektrische Leitfähigkeit, Dopp-lerradar) ist auch breitgefächertes Monitoring(Seismologie, Magnetik, Tilt, Gaschromato-graphie) vertreten.
Nach der Durchführung von aktiven Experi-menten zur Erfassung der Verteilung der elek-trischen Leitfähigkeit wird seit August 2000eine Monitoringstation zur Registrierung dernatürlichen elektrischen Felder (Eigenpoten-tiale, SP) am Gipfel des Merapi betrieben.Dabei wird davon ausgegangen, daß das hy-draulische Strömungssystem im Vulkan durchelektrokinetische Effekte Eigenpotentiale her-vorruft. Die Wechselwirkungen von magma-tischem System und System der strömendenFluide haben maßgeblichen Einfluß auf dieAktivität und die Stabilität eines Vulkans. DieZusammenhänge zwischen vulkanischer Akti-vität und Eigenpotentialen wurden schon viel-
fach beschrieben.Es wird angestrebt mit Hilfe der an der Sta-
tion gewonnenen Meßdaten, die Voraussagevulkanischer Ereignisse zu verbessern.
Im August 2000 installierte eine Forscher-gruppe der Universität Leipzig an der Solfata-re Woro unterhalb des Gipfels des Merapi ei-ne Monitoringstation. Diese ist für den aut-arken Dauerbetrieb konzipiert und dient zurAufzeichnung von Eigenpotentialen an dreiDipolen unterschiedlicher Länge (25 m bis75 m). Die Samplingrate beträgt fürd ieseKanäle 20 Hz. Parallel dazu werden die Tem-peraturen an den Ag/AgCl-Elektroden (unge-fähr einen halben Meter im Boden versenkt)und die Lufttemperatur registriert (mit 4 Hz).Die Basiseinheit der Station ist ein primär fürdie seismologische Datenerfassung konzipier-ter Datenlogger der Firma Guralp, UK, deraus einem Digitizer und einer Speicherein-heit besteht. Die anfallenden Daten (circa10 MByte/Tag) werden vor Ort komprimiertund per Funk in die Stadt Yogyakarta übertra-gen, dort archiviert und (nach einem Down-sampling) per E-mail nach Deutschland ge-schickt. Wegen der exponierten Lage der Sta-tion und der dadurch gegebenen Gefahr durchBlitzschlag machte eine mehrfache Absiche-rung jedes Kanals mit Blitzschutzschaltungennotwendig. Die Spannungsversorgung erfolgtüber eine Solaranlage. Für den Einsatz in derunmittelbaren Umgebung der Solfataren wares unerläßlich, alle empfindlichen Geräte vonschädlichen Umwelteinflüssen (hier vor allem:Schwefelverbindungen, Witterung) fernzuhal-
Physikalische Vulkanologie und Georisiken 463
ten. Aus diesem Grund wurden die Geräte ineiner Mehrfachkapselung aus Plastik und Alu-minium installiert. Die Meßleitungen sind mitNeopren ummantelt.
Die widrigen Umwelteinflüsse in der Sol-fatarenregion führten im Jahr 2001 zu einemTeilausfall der Station, so daß im Jahr 2002alle Komponenten bis auf die Solaranlage unddie Funkantennen ausgetauscht wurden. Mitden noch funktionsfähigen Geräten sollte amGeophysikalischen Observatorium Collm öst-lich von Leipzig eine ähnliche Monitoring-station installiert werden. An dieser Stationsollten neben apparativen Verbesserungen undNeuentwicklungen auch andere Elektroden-konfigurationen (flächenhafte Verteilung derDipole, Ringaufstellungen etc.) erprobt wer-den. Die Vorteile der Lokation am Collm lie-gen darin, daß neben den elektrischen Fel-dern noch weitere geophysikakische Meßgrö-ßen erfaßt werden (z. B. magnetisches Feld).
Ziel ist es, das Monitoring der elektrischenFelder als flexible und schnell zu realisieren-de Meßmethode nutzbar zu machen. Außer-dem soll mit Hilfe der anderen Meßgrößen ei-ne Trennung der Quellmechanismen der regis-trierten Felder ermöglicht werden.
Vortrag und Poster werden sich mit der Me-thodik und dem Aufbau der Monitoringstatio-nen beschäftigen. Vergleiche zwischen denMeßdaten der beiden Stationen sollen gezogenwerden. Ansätze zur Interpretation der Daten-sätze sollen vorgestellt und diskutiert werden.
Webseite: http://www.geo.uni-leipzig.de/
464 Abstracts
VUP02Kalscheuer, T., Commer, M., Helwig, S. L., Tezkan, B. (Inst. f. Geophysik, Universität Köln)
LOTEM-Messungen am Südhang des Vulkans Merapi (Indonesien) und ihre Interpreta-tionE-Mail: [email protected]
LOTEM-Daten (Long Offset TransientElectromagnetics) von Messungen am Süd-hang des aktiven Vulkans Merapi in Zentral-Java (Indonesien) werden unter Verwendungeindimensionaler und zweidimensionaler Mo-delle interpretiert. Die Meßdaten verteilensich auf ein im Jahre 2001 gemessenes und12 km in nord-südlicher Richtung verlaufen-des Profil. An insgesamt 38 Stationen wurdendie Horizontalkomponenten des elektrischenFeldes sowie Horizontal- und Vertikalkompo-nenten des Magnetfeldes aufgezeichnet. Auf-grund der Senderposition im äußersten Sü-den des Profils ergeben sich wichtige ergän-zende Informationen zu den Messungen ausdem Jahre 1998 (Müller, 2000). Hier befandsich der Sender im nördlichen Teil des Pro-fils und es wurden Daten nördlich und süd-lich davon aufgezeichnet. Bei den südlichenStationen der ersten Messung wurden Effektebeobachtet, die sich nicht eindimensional in-terpretieren lassen. Die Auswertung von Na-noTEM Messungen auf diesem Profil bestätigtebenfalls die Existenz einer Anomalie (Koch,2002). In bisherigen LOTEM-Modellen konn-te eine ost-westlich streichende gerade 3D-Struktur unter den entsprechenden Stationendie 3D-Effekte lediglich qualitativ erklären.Die dichtere Stationsverteilung und die Vertei-lung der Sender zu beiden Seiten der Störungerlauben es, diese besser zu charakterisieren.
Generell werden mit der gemeinsamen In-terpretation der Daten von 1998 und 2001zwei Ziele verfolgt. Zum einen interessiert diegenerelle Schichtenabfolge und speziell die
Frage, ob die Schichtgrenzen wie im Gipfelbe-reich der Topografie folgen (Commer, 2001)oder nicht. Zum anderen sollen die beobachte-ten anomalen Strukturen mithilfe eines zwei-dimensionalen Modells erklärt werden. Fürbeide Ziele werden möglichst viele Ergebnisseanderer Disziplinen, wie z.B. DC-Geoelektrik(Friedel, 2000) und MT (Müller, 2000) heran-gezogen.
Eine eindimensionale Interpretation desProfils unter Verwendung verschiedener In-versionsmethoden (Occam- und Marquardt-Methode) wurde durchgeführt, ergab aber kei-nen eindeutigen Verlauf der Schichtgrenzen.Generell spiegeln die bisher vorliegenden Er-gebnisse eine Schichtenabfolge wider, die be-reits von anderen Disziplinen beobachtet wur-de. In einer Tiefe von ca. 500 bis 1000 Meternwird ein guter Leiter mit spezifischen Wider-ständen im Bereich von ca. 1 bis 10 Ωm be-obachtet.
Durch Joint-Inversion verschiedener Kom-ponenten einer Station soll die Aussagekraftdes entsprechenden 1D-Modells erhöht unddie Anzahl an Äquivalenzmodellen einge-schränkt werden. Aufgrund der relativ großenSchwankungsbreite des Verlaufs der Über-gangsschicht bei Betrachtung der einzelnenInversionsmodelle, soll eine Bewertung desgenerellen Verlaufs dieser Schicht bzgl. derGeländeoberkante unter besonderer Berück-sichtigung der Ergebnisse der Joint-Inversionerfolgen. Als grober Trend ist bereits erkenn-bar, daß der Übergang zur leitfähigen Zone inRichtung zum Gipfel in größerer Tiefe statt-
Physikalische Vulkanologie und Georisiken – Poster 465
findet. Im Bereich der bereits beobachtetenAnomalie existieren auf dem Profil ebenfallsnicht eindimensional interpretierbare Statio-nen, die in einem abschließenden 2D-Modellberu"cksichtigt werden sollen.
Literaturhinweise:-Commer: 3-D inversion of LOTEM da-ta under strong boundary conditions, 19.Kolloquium „Elektromagnetische Tiefenfor-schung“, Burg Ludwigstein, 2001.-Friedel, S., Brunner, I., Jacobs, F., Rücker,C.: New Results from DC Resistivity Ima-ging along the flanks of Merapi Volcano, DGGSonderband IV/2000.-Koch, O.: Central-Loop-TEM Messungenam Vulkan Merapi in Indonesien, Tagungs-band DGG 2002 Hannover.-Müller, A.: Identification of good ElectricConductors below Merapi Volcano (Central-Java) by Magnetotellurics, Add. to DGG Son-derband IV/2000.-Müller, M.: Elektromagnetik an Vulkanen,Dissertation, Inst. f. Geophysik, Uni Köln,2000.
466 Abstracts
VUP04Buness, H., Wiederhold, H., Wonik, T. (Hannover)
Reflexionsseismische Erkundung von Maar-Diatrem-StrukturenE-Mail: [email protected]
Maar-Diatrem-Strukturen entstehen durchden Kontakt von heißem Magma mit Grund-wasser. Bei einer Serie von phreatomagma-tischen Eruptionen verlagert sich der Explosi-onsherd mehr und mehr in die Tiefe. Über ihmentsteht durch Nachfall von Nebengestein undvulkanischen Komponenten ein Sedimentati-onstrichter, der als Diatrem bezeichnet wird(Lorenz 1998). Über dem Diatrem entstehteine Hohlform, die als Maar bezeichnet wirdund die durch klastische und später zuneh-mend biogene Sedimentation aufgefüllt wird.
Das GGA-Institut hat in den letzten Jahrenzwei Maar-Diatrem- Strukturen mit geophysi-kalischen Methoden und mit Forschungsboh-rungen intensiv erkundet: Zum einen eine ver-deckte tertiäre Maarstuktur bei Baruth (Sach-sen) (Goth et al. 2003), zum anderen den ehe-maligen Ölschiefer-Tagebau der Grube Mes-sel (Hessen), der ein eozänes Alter aufweist(Schulz et al. 2002).
Die reflexionsseismische Erkundung ergibtin beiden Fällen sehr gute Ergebnisse für dengesamten Bereich der Seesedimentation derMaare. Der Grund hierfür ist zum einen die re-lativ zur Diatremfüllung geringe Neigung derStrukturen und zum anderen die ausgepräg-te Schichtung der Sedimente, die mit starkenImpedanzkontrasten vor allem in dem in derAnfangszeit gebildeten Teil eines Maares ein-hergeht. Im zentralen Teil des Kraters fin-det sich eine Wechsellagerung von Trümmer-strömen und Turbiditen, die aus klastischenAblagerungen des zertrümmerten Nebenge-steins sowie vulkanischen Tuffiten bestehenund sehr unterschiedliche Korngrößen aufwei-
sen. Viele Schichten weisen eine beträcht-liche laterale Kontinuität auf, einige von ih-nen lassen sich im gesamten zentralen Bereichdes Maares nachweisen, so dass sie zur Glie-derung der geologischen Formation verwen-det werden können. Im oberen Teil der See-sedimente findet dann die ungestörtere Still-wassersedimentation statt, deren seismischesAbbild fast transparent erscheint. Die Ähn-lichkeit der seismischen Abbilder der Struk-turen bei Baruth und Messel führte schonvor der Niederbringung der Forschungsboh-rung Messel 2001 zu der Annahme, dassdie Maar-Hypothese zur Genese des Eozän-Vorkommens in Messel gegenüber anderenVorstellungen als wahrscheinlicher anzusehensei (Buness and Harms 2000).
Die unterhalb der Seesedimente vorhande-nen Strukturen können nur unter günstigenBedingungen abgebildet werden. Ausgehendvon einem Maar-Diatrem-Modell von Lorenz(1998, 2000) besitzen die Diatrembegrenzun-gen im Festgestein ein Einfallen von rund 80°.Solch steile Strukturen können mit der Re-flexionsseismik aus geometrischen Gründennicht nachgewiesen werden. Es können je-doch Reflexionen aus der Diatremfüllung re-gistriert werden, wenn die Reflektoren nichtzu steil stehen. Dies ist im oberen Teil einesDiatrems durchaus wahrscheinlich. Aufgrundder Maardurchmessers des Messeler Vorkom-mens von 700-1200 m und des Baruther Maarsvon 1000 m muss nach Lorenz (2000) miteiner Tiefenerstreckung des Diatrems in derGrößenordnung von 2 km gerechnet werden.In Messel konnten sowohl eine fast horizonta-
Physikalische Vulkanologie und Georisiken – Poster 467
le Schichtung als auch mit bis zu 40° einfallen-de Reflektoren bis zu einer Tiefe von ca. 600m, bezogen auf die vor dem Abbau bestehendeOberfläche, nachgewiesen werden.
Buness, H. and Harms, F.-J. (2000): Is theformer Grube Messel oil shale oit a maar ? -First results from a seismic survey.- Terra No-stra 2000/6: 86-90; Berlin.
Goth, K., Suhr, P. and Schulz, R. (2003):Zwei Forschungsbohrungen in das verdeck-te Maar von Baruth (Sachsen). - Z. Angew.Geol., 1/2003.
Lorenz, V. (1998): Zur Vulkanologie von
SW NEFB 4 (1980) FB 2001
100
NN
-100
-200
- 400
- 500
m
100 m200 m300 m400 m
teoMFm
teoMFu(2)
teoMFu(1)
+VT
^b/vu
100
NN
- 100
- 200
-300- 300
-400
-500
m
Lithologische Gliederung der Bohrungen:
„Ölschiefer“ (Schwarzpelit)
Breccie aus Amphibolit-und Granitblöcken
TuffTon(stein), Sand(stein), Kies, Gerölle, Konglommerat Diatrembreccie
Wechsellagerung„Öl-schiefer“ mitTon, Sand, oder Kies
Abbildung 1: Reflexionsseismisches Profil inder Grube Messel
diamantführenden Kimberlit- und Lamproit-Diatremen.- Z. dt. gemmol. Ges. 47/1: 5-30.
Lorenz, V. (2000): Formation of maar-diatreme-volcanoes.- Terra Nostra 2000/6:284-291, Berlin.
Schulz, R., Harms, F.-J. and Felder, M.(2002): Die Forschungsbohrung Messel 2001:Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Geneseeiner Ölschieferlagerstätte. - Z. Angew. Geol.,4/2002: 9-17; Hannover (im Druck).
Webseite: http://gga-hannover.de
468 Abstracts
VUP06Rolf, C., Pucher, R. (Hannover, GGA-Institut), De Wall, H. (Würzburg, Geologisches Institut)
Erkenntnisse zu den Ursachen magnetischer Anomalien in den Vulkaniklastika des Mes-seler Maar-DiatremsE-Mail: [email protected]
Geophysikalische Messungen im Gebietdes Sprendlinger Horstes ergaben ausgepräg-te Anomalien in der Bouguer-Karte und in derTotalintensität des erdmagnetischen Feldes imBereich der Fossilienfundstätte Grube Messel.Durch die im Sommer 2001 niedergebrach-te „Forschungsbohrung Messel 2001“die denphreatomagmatischen Ursprung der HohlformMessel belegt, wurden vulkanoklastische Ab-folgen erbohrt, die teilweise magnetisiert sindund die ca. 60% der magnetischen Anomalieerklären.
Bohrlochgeophysikalische Messungen undgesteinsmagnetische Analysen der erbohrtenBohrkerne ermöglichen eine Strukturierungder erbohrten Anomalie in Bereiche unter-schiedlicher Stärke der natürlichen remanen-ten (NRM) und der induzierten Magnetisie-rung (IRM; Abb. 1).
Thermomagnetische Analysen belegen Ma-gnetit als Träger der Remanenz (Abb. 2).Die teilweise hohe Suszeptibilität wird durchferrimagnetische Komponenten in den Lapil-li verursacht. Es ergeben sich weder inder Magnetomineralogie noch in den Rema-nenzrichtungen innerhalb und außerhalb derBohr–Anomalie größere Unterschiede. DieHomogenität der magnetischen Richtungenspricht für einen in–situ Erwerb der Magne-tisierung (nach der Ablagerung). Die Befundeder ersten Entmagnetisierungs-Experimente(Abb. 3) sprechen für unterschiedliche Sta-bilität der magnetischen Remanenz. Die Sta-bilität hängt von der Temperatur ab, bei dernach Ablagerung die Partielle Thermorema-
Abbildung 1: Bohrloch- und Kernmessungenin den Pyroklastika der Forschungsbohrung Mes-sel 2001 (Suszeptibilität und NRM)
nenzen (PTRM) als wahrscheinlicher Prozesserworben wurde. Einfluss durch Fluidzirkula-tion wird weitgehend ausgeschlossen, weil pe-trographisch bisher keine Hinweise erkennbarsind.
An jeweils einer Probe innerhalb und au-ßerhalb der Anomalie wurde der Erwerb ei-ner im Labor erzeugten Remanenz bei stei-gender Maximaltemperatur untersucht. DieIntensität der Aufheizkurven ist sehr ähnlich,was erneut auf einheitliche Magnetomineralo-
Physikalische Vulkanologie und Georisiken – Poster 469
Abbildung 2: Thermomagnetische Experimentezur magnetischen Suszeptibilität
Abbildung 3: Intensitätsdiagramme für die ther-mische Entmagnetisierung an 2 Proben aus denPyroklastika: normierte Intensität der Magnetisie-rung (linke Ordinate) und Spektrum der Blockung-stemperatur (rechte Ordinate) gegen die Tempera-tur
gie hindeutet. Ein Vergleich der künstlichenTRM mit der natürlichen Remanenz (NRM)zeigt jedoch, dass beide Proben eine gleicheErwerbsfähigkeit haben (Abb. 4), diese wirdjedoch bei Proben aus dem oberen Bereich derPyroklastika nur zum Teil genutzt, ganz imGegenteil zu Proben aus den tieferen Berei-chen. Hiermit zeigt sich, dass sich die zumErwerb der NRM innerhalb und außerhalb derBohr–Anomalie benötigte Temperatur signifi-kant unterscheidet.
Durch weitere detaillierte gesteinsmagne-tische Untersuchungen in Kombination mitDurchlicht– und Auflichtmikroskopie soll dieBohrung genauer charakterisiert werden, mitdem Ziel, u.a. die folgenden Fragestellungen
Abbildung 4: Intensitätsdiagramme für Aufheiz-experimente an Proben aus den Pyroklastika: nor-mierte Intensität der Magnetisierung (linke Or-dinate) und Spektrum der Blockungstemperatur(rechte Ordinate) gegen die Temperatur. Normiertwird auf die Intensität der thermoremanenten Ma-gnetisierung nach Aufheizen auf 600 oC; dazu imVergleich auf der Ordinate als Punkt die natürlicheremanente Magnetisierung (NRM)
zu beantworten:
• Welche Schwankungen der Blockung-stemperaturen können aus den Erwerbs-experimenten abgeleitet werden?
• Wie mächtig sind die Ablagerungseinhei-ten mit charakteristischer Blockungstem-peratur?
• Welche Abkühlraten ergeben sich für dieAblagerungseinheiten?
• Wie beeinflusst eine Variation im Gehaltund in der Korngröße von Nebengesteins-fragmenten die Temperatur einer Ablage-rungseinheit?
• Welchen Einfluss hat neben der Maxi-maltemperatur die Abkühlungsrate derAblagerungseinheiten auf den Remanen-zerwerb?
470
Autorenverzeichnis
Fettdruck: VortragenderKursiv: Poster-Abstract findet man beim
dazugehörigen Vortrag
A
Aboulel, H. ……………………....……….MGV03Agnon, A. ....................................................GDP04Ahmed, I. ……………...……………….…MGP07Aksnes, K. ...................................................EXP05Allard, M. …………………………………VEV01Anderson, J.D. .............................................EXP05Arbeitsgruppe MASI ……………………...SLV20Arroyo Hidalgo, I. ........................................SLP10Asch, G. …………………………….……..SLV15Asmar, S.W. ...............................…….........EXP05
B
Bagdassarov, N. ..........................................VUV01Bagdonat, T. ...............................................EXV44Baisch, S. ………...………...……………..SMV13Baker, J. …………………………..………EXV37Bala, A. ........................................................SLV09Barckhausen, U. …...…MGV08, MGP07, MGP08Barriot, J.P. ....................................……......EXP05Barth, A. .........................................VEV02, SLP18Bartov, Y. ...................................……….....GDP03Bataille, K. ..................................................SMP13Baumgardner, J. ...........................GDV02, GDV03Beblo, M. ........................................EEV02, EEP15Becken, M. …………………….…EEV10, EEP10Becker, D. .......................................SLV14, SLP13Behain, C. ...................................................MGP05Behain, D. ...................................MGV08, MGP08Ben-Avraham, Z. .........................MGV04, MGP14Bendisch, J. ……………………………….EXV50Benne, I. .....................................................KOV03Ben-Zion, Y. ………………………..……..SLV28Berger, D. ...................................................MGP10Berhorst, A. ………………..………….…MGP07Bialas, J. .......................MGV05, MGP01, MGP02Bibring, J.P. ………………………………EXV41Binot, F. ............................EEV03, EEV07, EEP12Bird, M.K. .............................………..........EXP05Bischoff, M. .................................................SLV13Björnsson, A. ...............................................EEV02Bock, G. .......................................................SLP17Bönnemann, C. ...........................MGV07, MGP05Börner, F. .....................................................UIV11Börner, R.-U. ...............................................EEP01Börngen, M. ………………………………VEV03Böse, M. .......................................................SLP20Boess, J. .....................................................KOV03BOHEMIA working group …………….…VOP05Bohlen, T. ..................... SMP02, SMP03, SMP04,
SMP05, SMV18, MGP03
Bohnhoff, M. ..................SLV14, SMV10, SMV11, KTP01, SLP13
Bohrmann, G. ...............................GDV18, MGP12Borm, G. ........................................SMP10, SMP11Bormann, P. …………………….…………SLV01Borrmann, T. ...............................................EXV16Bouhram, M. ...............................................EXV36Bram, K. .......................................................UIP10Braun, M. ....................................................EEV11Braun, T. .......................................................SLP16Braunmiller, J. ..............................................SLP08Breitzke, M. .................................MGP01, MGP02Brenker, F. E. …….……….…...………….EXV23Breuer, M. ………………….………….....GDV01Brodscholl, A. ..............................VUV06, VUP03Brost, E. ..........................................EEV03, EEP12Brottka, K. ..................................................VOP02Brueggen, M. ..............................................EXV06Buckup, K. ...................................................UIV21Buckup, M. ...................................................UIV21Buckup, P. ....................................................UIV21Budweg, M. ..................................................SLP17Büchel, G. ..........................UIV03, UIV06, UIV16Büchner, J. ..................................................EXV30Buness, H. .......................VUV03, SMP09, VUP04Burkhardt, H. .....................EEV10, EEP09, EEP10Busche, H. ....................................................SLP21Buske, M. …………….……………...……EXV21Buske, S. ..................... SMV05, SMV11, SMV18,
SMP04, SMP05, SMP06
C
CALIXTO Group ………...SLV08, SLP19, SLP22Carlsen, F. ………….………………..…….SLP02Casten, U. ..........................…........GGP02, GGP06Ceranna, L. ………...……………..SLV18, SLP28Chambodut, A. ...……….…………………EXV35Christensen, U. ..............EXV21, MAV02, PLV08Cochard, A. ..................................................SLV10Commer, M. .................................VUV05, VUP02Comte, D. ……………………......…......…GDP05Czerwek, D. .................................................UIV16
D
Dachev, T. ...................................................EXV38Dahm, T. …..….GDV08, SLV29, SLV31, VUV04,
SLP05, SLP09, VUP05Damm, V. ...................................................MGP16Danckwardt, E. ………………..…EEV08, EEP13Dearing, J. ....................................................UIV09Dehghani, G. A. ..........MGV03, GDV17, MGV04,
MGP14, MGP15Delisle, G. ………...………………………VEV01Demetrescu, C. …………………..……….GDV19De Nil, D. ……………………….………..MGP04DESERT Group ........................... GDP03, GDP04De Wall, H. .................................................VUP06Dietrich, K. ..................................................SLV13Dohmann, M. ...............................................SLV18
471
Domsch, H. .................................................KOV03
E
Ebbing, J. ....................................................GGP07Eberle, D. .....................................................UIV20Ehrhardt, A. ...............................................MGV03Eifel-Plume-Team ........................................SLP17El-Kelani, R. ...............................................GDP04Ellsworth, W.L. …………………………...SLV32Emiroglu, S., ................................................UIP02Endrun, B. ............SLV13, SLV14, SLP13, SLP14Enns, A. ………………………...………...GDP06Erard, S. ………………..…………………EXV41Erzinger, J. ..................................................PLV09
F
Fahr, H.-J. ......................................EXV17, EXP01Falcke, H. ………………………………....EXV09Fassbinder, J. ..............................................KOV04Fedorova, T. ...............................................GDV10Fekete, N. …………………...………...….MGP06Fengler, H-J. .................................................UIV03Ferrando, P. .................................…............EXP09Ferreira, S. E. S. ………...EXV27, EXP09, EXP11Fertig, J. .....................................................MGV08Fichtner, H. ..... EXV16, EXV25, EXV27, EXV46,
EXP02, EXP03, EXP09, EXP10, EXP11
Fielitz, W. ....................................................SLV09Finck, F. .........................SLV30, SMV03, SMV04Fischer, K. D. ................................GDV16, SLV05Fischer, V. ...............…….............................EEP15Flaws, A. ......................................................SLV10Flueh, E. R. ………..…...GDV18, SLV16, SMP14,
GDP05, MGP07, SLP09, SLP10, SLP11, SMP13
Flury, J. ......................................………….GDV21Flury, W. ....................................……….....EXV47Förster, M. ………………………..………EXV37Forbriger, T. .................................SMV17, MGP03Franke, D. ...................................MGV08, MGP08Frechen, M. ................................................MAV05Fricke-Begemann, C. ..................................EXV32Friederich, W. ..................SLV19, SLV34, SMV17Füllekrug, M. ………………….………….EXV33Funke, S. ......................................................SLV19
G
Gabriel, B. ................................................…UIV16Gabriel, G. ..................................................VUV03Gadomski, S. …………...………………….UIV17Gaedicke, C. ……………………......…..…GDP05Gajewski, D. ………...MGV03, MGV04, MGV05,
SMV15, SMV16, MGP14, SLP29, SMP01
Garfunkel, Z. ...........…................................GDP03Garnero, E. ...................................................SLP27Gaw, V. .......................................................MGP09Geißler, W. …...………..SLV23 (VOV02),VOP05
Geletneky, J.W. ............................................UIV03GEMME Working Group ………………..MGV04Germaschewski, K. ......................................EXP03Gerstermann, N. ...........................................SLP23Giese, B. …………………………….……EXV40Giese, R. ........................SMV18, SMP04, SMP05,
SMP10, SMP11Glassmeier, K. ..............................EXV15, EXV28Goertz, A. .......................SMV18, SMP04, SMP05Götze, H.-J. .....................GGP01, GGP03, GGP04Gohl, K. .....................................................MGV04Golden, S. ......................................EEV02, EEP15Goldman, M. ..................................EEV05, EEV06Goltz, C. .......................................................SLP10Gombosi, T. ................................................EXV15Gossler, J. ...........................SLV16, SLP10, SLP11Gottschaldt, K.-D. ......................................GDV03Gräsle, W. ......................................KTV03, KTP03Grasse, T. .....................................................SLV18Grauer, R. ......................................EXV25, EXP03Greenwald, R. ……………………….……EXV37Grießmeier, J.-M. ........................................EXV28Grinat, M. ......................................EEV07, UIV10Grobys, J. ...................................................MGV05Grosse, C. .......................SLV30, SMV03, SMV04Grün, E. .........................................EXV12, EXP05Grützner, C. ..................................................UIV15Gude, M. ………..……....…………………UIV02Günther, Th. ..................................EEP03, VOP02Gutdeutsch, R. .............................................SLV02
H
Haase, K. ....................................................MGP15Haberland, C. ..............................................GDP04Häder, D.-P. ................................................EXV38Häusler, B. .....................................EXP05, EXP06Häusler, M. .................................................EXV43Hainzl, S. ....................................SLV24 (VOV03)Hagedoorn, J. ………...…………………...GDP01Hagermann, A. ............................................EXP05Hagfors, T. ..................................................EXV13Hambach, U. ..............................................MAV05Hanesch, M. .................................................UIV09Hansen, K. ...................................................EXV15Hansen, U. ....................GDV01, GDV04, GDV05,
GDV06, MAV01, MAP01Hanstein, T. ..................................................EEP08Harder, H. ..............…..GDV05, MAV01,MAP01Harjes, H.-P. …GDV15, SLV13, SLV14, SMV10*,
KTP01*, SLP13, SLP14Hartmann, C. ...............................................SLV30Hartmann, G. ...............................................SLV18Hatzes, A. ....................................................EXV20Hauck, C. ...........................UIV01, UIV02, UIP01Hauser, F. .....................................................SLV09Heber, B. .........................EXV27, EXP11, EXP09Heibey, W. ..................................................EXV14Heide, K. .....................................................VUP07Heinbockel, R. .............................GDV17, MGP15Heinlein, D. ................................................EXV24Heinrich, R. .....................................SLV27, SLP03
472
Heinse, R. ........................................UIV15, UIP12Heit, B. …………………………...……….SLV15Helbert, J. .....................................................EXP13Helwig, S. L. ..…............EEV04, EEV05, EEV06,
VUV05, EEP08, EEP11, VUP02
Hemmann, A. .............................SLV22 (VOV01), SLV23 (VOV02), SLP02
Hendel, R. ....................................GDV02, GDV03Hengel, M. ....................................................SLP23Henger, M. ...................................................SLV18Hergarten, S. ................................................SLV26Hertrich, M. .................................................EEV11Hesse, G. ......................................................UIV06Heuer, B. .......................................VOP04, VOP05Heyde, I. ......................................................GGP04Hezel, D.C. …….……………………...….EXV23Hilchenbach, M. .........................................EXV07Hinz, K. ......................................................MGP08Hock, S. .......................................................SLP21Höffner, J. ...................................................EXV32Hölz, S. ……...................................EEP09, EEP10Hördt, A. ......................... VUV05, UIV07, EEP07Hofmann, Y. ...............................SLV25 (VOV04)Holschneider, M. …………………...……..SLV28Hübscher, C. .............................MGV03, MGV04,
MGV05, MGP14Hühnerbach, V. ...........................................GDV18Huguen, C. ..................................................GDV18Hunfeld, U. ...................................................SLP23
I
Ibs-von Seht, M. ..............................SLP15, SLP16Igel, H. ...............................SLV10, SLP26, SLP27Igel, J. ....UIV14, UIV18*, UIP07, UIP08, UIP09*Imre, B. ………………….………….…….EXV42Ip, W.H. ....………......................................EXP05Ismail-Zadeh, A. ..........................GDV12, GDV19
J
Jacobs, F. ……..…EEV08, UIV18, EEP13, UIP09Jacoby, W. ....................GDV09, GDV10, VUV03Jahnke, G. .....................................................SLP27Jahr, T. ...........KTV01, SLV05, SLV25 (VOV04),
GGP08, GGP09, VOP01James, M. ........…........................................VUV01Jaroschek, C. ...............................................EXV29Jentzsch, G. ...………......KTV01, UIV16, GGP09,
SLP03, VOP01Jokat, W. .....................................MGV09, MGP13Jorda, L. .......................................................EXP13Jordan, M. .....................................................SLP18Junge, A. ...........................EEV02, EEP15, GDP07Just, A. ………..…UIV18, EEP04, EEP13, UIP09
K
Kafri, U. .......................................................EEV06Kaiser, D. .....................................................SLV02Kalscheuer, T. .............................................VUP02
Kaschwich, T. ……….……………………SMP01Kaselow, A. ...................................SMV01, SMP08Kaslilar, A. ……..…………….…………..SMV05Keller, H.-U. ................................................EXP12Kemna, A. ..........................EEV12, EEP14, UIP04Kempf, S. ....................................................EXV12Kennett, B.L.N. ...........................................SLV21Kern, H. ..........................…...........SMV01, SMP08Kessls, W. .......................................KTV03, KTP03Kesten, D. ...................................................GDP03Kind, R. …………..……..SLV11, SLV15, SLV35Kirsch, R. ...................................................KOV02Kissmann, R. .................................EXV27, EXP11Kistler, L. ....................................................EXV36Klaeschen, D. ………….GDP05, MGP09, MGP11Klaucke, I. ....................................GDV18, MGP12Klecker, B. ..................................................EXV36Kleimann, J. ..................................EXV25, EXP03Klein, G. .....................................................MGP03Kliem, B. .......................................EXV03, EXP08Klinge, K. ............SLV03, SLP07, SLP16, VOP04Klinkmann, W. ...........................................EXV18Klippel, O. ……………………….SMV07, SLP06Klose, C. ........................................SMP05, SMP10Knapmeyer, M. ..............................SLP25, EXV22Kneisel, C. ………..…………………..……UIV02Knollenberg, J. .............................................EXP13Koch, O. ……………..…………..EEV04, EEP11Köhler, U. ...................................................EXV24Köhler, W. ...................................................EXV34König, M. ...................................MGV09, MGP13Köppen, K.-H. ..............................................UIV16Kopp, A. ....................................... EXV25, EXP03Kopp, H. ………..………...SLV16, GDP05, SLP11Kopsch, C. .................................................MGV09Korn, M. .......................................................SLP21Korotkii, A. .................................................GDV12Korth, A. ......................................................EXP12Kracke, D. ......................................SLV27, SLP03Krause, Y. …….......…...…UIV18, EEP04, UIP09Kravtsov, Yu. A. …………………...……..SMV05Krawczyk, C. .................................SMP12, SMP13Kreutzmann, A. ...........................................GDP07Kroner, C. .......................SLV05, GGP08, GGP09Krueger, F. ...................................................SLV20Krüger, H. .....................................EXV12, EXV11Krueger, O.S. ..............................................SMP07KTB Science Team ……………………….PLV09Kühn, D. .....................................................GDV08Kühne, K. ....................................................VEV04Kühnicke, H. ....................................UIV18, UIP09Kührt, E. ......................................................EXV44Kümpel, H.-J. ..............................................PLV09Küperkoch, L. ...............................SMV10, KTP01Kugler, S. ...................................................MGP03Kukowski, N. .............................................MGV05Kulenkampff, J. ............................KTV02, KTP04Kunow, H. ...................................…........... EXP09Kurz, G. ..UIV14, UIV18*, UIP07, UIP08, UIP09*Kurz, J. ...........................SMV03, SMV04, VOP01Kutzner, C. .................................MAV02, MAV03
473
L
Laitinen, T. ……………..…………..……..EXP02Landerer, F. ......SMV18, SMV19, SMP04, SMP05Landes, M. ...................................................SLV09Lange, G. ......................................................UIV20Lange, J. .........................................EEV05, EEP08Lauche, H. ...................................................EXP12Lebert, M. ...................................................EXV38Leonardi, S. ……………………...……….VUV02Lerche, I. ………………………………….EXV46Lindner, H. ....................................SMV14, UIV19Lindner, U. .......................................UIV18, UIP09Li, X. ……………………………..……….SLV11Liu, H. .........................................................EXV34Loddoch, A. ................................................GDV06Loesel, G. ...................................................KOV03Lorenz, K. ..................................................KOV01Lübken, F.-J. .………………...….EXV31, EXV32Lück, E. ...........................................UIV13, UIP11Lühr, H. .......................................EXV34, EXV35Lüth, S. ………..………..SMP06, SMP12, SMP13
M
Maercklin, N. ..............................................GDP04Malin, P. ……………………………...…...SLV32Malischewsky, P. G. ....................................SLV17Mandea, M. ...………….…………………EXV35Mann, G. .......................................EXV02, EXV04Manthei, G. .................................................SMV08Marczewski, W. …………...……...…...…..UIV17Marouf, E. ...................................................EXP05Marquart, G. ................................................GDP07MaRS Team ................................................EXV43Marsch, E. …………….................EXV05, EXP04Martin, M. ….…..GDV19, SLV08, SLP19, SLP22Martinec, Z. ………………...…...GDP01, GDP02Masson, D. ..................................................GDV18Maul, A.-A. ……………………………….VEV05McIntosh, K.D. …………………..…….…MGP07Mechie, J. ......................................SMP12, SMP13Meidow, H. …………………………….….SLP24Meier, T. ............GDV15, SLV13, SLV14, UIV19,
SLP13, SLP14, SLP28Metz, T. ........................................................SLP26Meyer, H. ......................MGV08, MGP05, MGP08Mielitz, S. ......................................SMP10, SMP11Mihalffy, P. ................................................GDV11Miksat, J. .....................................................SLV33Miller, H. ...................................................MGV09Mittag, R. ………………………………….SLP01Mohnke, O. .....................................UIV08, EEP05Mojid, M. .....................................................EEP14Molenda, R. ………..………………………UIV02Moragas-Klostermeyer, G. .........................EXV12Morgenstern, A. ………………...…………UIV05Moriya, H. ..................................................SMV08Morley, T. ...................................................EXP05Motschmann, U. ...........................EXV44, EXV28Müllemann, A. ............................................EXV32Müller, B. ...................................................GDV19
Müller, C. ....................................MGV07, MGP05Müller, Cf. .....................SMV18, SMP04, SMP05Müller, K......................................GDV07, VUV01Müller, M.............................UIV08, UIP05, UIP06Müller, T. ....................................................SMV05Müller, T.M. ...............................................SMV02Mueller-Mellin, R. .......................................EXP09Münch, H.-M ...............................................EEP14
N
Nasdala, L. …….………………………….EXV23Neben, S. ......................MGV07, MGP05, MGP16Netzeband, G. ............................................MGV05Neubauer, F. M. EXV14, EXV45, EXP05, EXP07Neukum, G. ................................................EXV24Neumayer, J. ...............................................GDV20Neunhöfer, H. .............................SLV22 (VOV01)Nissen-Meyer, T. ..........................................SLP27Noell, U. ..........................EEV03, EEV07, EEP12Nurcaya, B. ....................................VUV06, VUP03
O
Oberst, J. ........................EXV24, EXV39, EXV22Olson, P. ………………………………….MAV03Oswald, M. ...................................EXV48, EXV49Oth, A. ………………………....…………..SLP22Ott, N. ………………………….…………GDV14Otto, P. .....….................................SMP10, SMP11Oye, V. …………………………………....SLV32
P
Pätzold, J. ...................................................MGV04Pätzold, M. ..………….. EXV43, EXV45, EXP05,
EXP06, EXP10Paizis, C. ......................................…………EXP09Palme, H. …….………..………………….EXV23Papenberg, C. .............................................MGP11Parotidis, M. ……………………….…..... VOP03Paschmann, G. ……………..……EXV37, EXV36Patzig, R. ......................................................SLP29Perez-Gussinye, M. ………………………MGV01Perk, M. .......................................................UIV07Petersen, J. ..................................................MGP11Petersen, N. ...................................................UIP02Petzold, G. ...................................................EEV08Phipps Morgan, J. …………...…..MGV01, SLP05Pinkerton, H. ...............................................VUV01Planert, L. ...................................................SMP14Plenefisch, T. ....………....SLV03, SLP07, SLP15,
SLP16, VOP04Polom, U. ………………………..………..SMP11Posner, A. .......................…….......EXV26, EXP09Potgieter, M. S. P. ........................................EXP09Pretzschner, C. ……………...……SMV14, UIV19Prodehl, C. ...................................................SLV09Pucher, R. .....................................VUP06, VUV03Puhl-Quinn, P. ............…..………EXV37, EXV36
474
Q
Qabbani, I. ..................................................GDP04Quinn, J. M. …………………..…..………EXV37
R
Rabbel, W. .....................PLV09, SMV19, MGP04Radic, T. ......................................................EEV14Raileanu, V. .................................................SLV09Ranero, C.R ..GDV18, MGV01, MGP07, MGP09Rapp, M. ………………………………….EXV31Rauer, H. ......................................................EXP13Raviart, A. ...................................................EXP09Reichert, C. ...................................SMP12, SMP13Reinders, J. ...................................MAV05, UIV09Reitmayr, G. ………………………...……GGP05Reme, H. .....................................................EXV36Reston, T. …..MGV01, SMP14, MGP06, MGP09Rey García, D. …………………………..…UIP02Richter, I. .....................................................UIV19Richter, P. ...................................................EXV38Rickmann, H. ..............................................EXP05Ridley, A. ....................................................EXV15Riedel, C. .....................................................SLV29Rietveld, M. T. ............................................EXV13Rifai, H. .........................................KTV03, KTP03Ringelhan, A. ...............................................EEV07Rische, M. .........................SLV14, SLP13, SLP14Ritter, J.R.R. ……...……..SLP18, SLP22, VEV02Rivalta, E. ………..………...……VUV04, VUP05Röttger, B. ..................................................KOV03Röttger, J. ....................................................EXV13Rolf, C. .......................................................VUP06Roßberg, R. ...................…...........................EEP15Roth, M. …………………………………...SLV32Rother, M. ...................................................EXV34Rothert, E. ..…..........…………....SMV11, VOP03Rücker, C. ………………….……………..EEV13Ruedas, T. ...................................................GDP07Rümpker, G. ................................................GDP04Ryberg, T. .....................................GDP03, GDP04
S
Saenger, E.H. ...................SMP02, SMP03 SMP07Sahling, H. ..................................................GDV18Sari, G. .........................................…………EXP09Sauer, A. .......................................................UIP07 Sauer, J. ..............EEV03, KOV03, UIV10, EEP12Sauter, M. …………………………………KTV01Schäbitz, F. ...................................................UIP11Schenk, A. ...................................................EEV10Scherbaum, F. .................................GDP04, UIP11Scherer, K. ....................................EXV17, EXP01Scherer, K. ..................................................EXV16Schicht, T. ........................................UIV18, UIP09Schikowsky, P. ..MGV06, UIV15, MGP10, UIP12Schlickeiser, R. ............................................EXP10Schlittenhardt, J. ..........................................SLP08Schmalholz, J. ...................UIV08, UIV12, UIP04,
UIP05, UIP06
Schmeling, H. ...............GDV07, GDV11, GDP06, GDP07
Schmitt, J. E. .................................EXV45, EXP05Schmidt, S. ..................................................GGP04Schmucker, U. .............................................EEV01Schnabel, M. .................................................SLP10Scholer, M. .................................................EXV29Scholl, C. ........................EEV04, EEV05, EEV06,
EEP07, EEP11Schopper, J. ................................................SMV09Schreckenberger, B. ....................................GGP04Schreiber, U. ................................................SLV10Schröer, K. …………...…………..………..UIV17Schuck, A. .......................................UIV18, UIP09Schulz, R. ..........….........UIV14, UIV18*, VUV03,
UIP07, UIP08, UIP09*Schulze, A. ....................................GDP03, GDP04Schulze, E. .......................................UIV18, UIP09Schuricht, R. ...............................................KOV03Schwabe, J. ...................................................UIV15Schwandt, A. ...................................UIV18, UIP09Schwarte, J. ...…………………….....……EXV35Schwarzbach, C. .........................................EEV09Schweitzer, J. ...................SLV20, SLV21, VEV02Sedlmayr, E. ...............................................EXV10Seiferlin, K. ..................................................UIV17Senitz, S. .....................................................UIV16Serfling, U. ....................................VUV07, VUP01Shapiro, S.A. ................SMV11, SMV01, SMV02,
SMV05 SMP08, SMP06, SMP07, VOP03, PLV09
Sick, C.M.A. ...............................................SMV02Sidorenko, I. ................................................EXV29Siemon, B. ......................................EEV03, EEP12Silin, I. ........................................................EXV30Silver, E.A. …………………………….…MGP07Snopek, K. ………………………….…….GGP06Sodoudi, F. ………………………..……….SLP12Sokolov, V. Yu. ………….………………..SLV33Solanki, S. K. ……………………………..PLV06Spangenberg, E. ................KTV02, UIV13, KTP04Spiess, V. ……………………………...….MGP06Spitzer, K. ......................................EEP03, VOP02SPOC Research Group ..................SMP12, SMP13Spohn, T. ........................................EXV22, UIV17 Srama, R. ....................................................EXV12Staackmann, M. ...........................................GGP06Stadelmann, A. ............................................EXV15Stadtler, C. ..................................................GGP02Stäbler, S. .....................................................SLP19Stammler, K. ...........…........SLV03, SLP04, SLP07Stanek, K.-P. ...............................................VOP02Stange, St. .....................................SMV12, SLP30Stanzel, C. …………………………..…….EXP07Stavrakakis, G. ................................SLV14, SLP13Stawicki, O. ....................EXV46, EXV16, EXP10Stegman, D. ................................................GDV03Stein, C. ......................................................GDV04Steinberger, B. ............................................GDV11Steinhau, D. ..................................................UIV03Stemmer, K. ...............................................GDV05Stettler, E. .....................................................UIV20
475
Stiller, M. ........................GDP03, SMP12, SMP13Stoffregen, H. ......................UIV12, UIP04, UIP06Stoll, D. ........................................................SLP30Storz, W. .......................................................UIP12Strassmeier, K. G. .......................................EXV01Streb, C. ......................................................EXV38Strecker, M. ..................................................UIP11Strehl, S. .......................................................UIP04Streich, R. .....................................................UIP11Stubenrauch, A. ..........................................MGP09Suckow, A. ..........EEV03, EEV07, UIV04, EEP12Südekum, W. ...................................UIV10, UIP07SVEKALAPKO Seismic Tomography Working Group …………………………….………..SLV19
T
Täumer, K. ...................................................UIV12Tenzer, H. ...................................................SMV13Tessensohn, F. ............................................MGP16Tezkan, B. ......................EEV05, EEV06, UIV07,
VUV05, EEP06, VUP02Thiemer, M. ……………………………….EEP06Thierer, P. O. ..................................SLV16, SLP11Thoma, H. …………….…….…….SMV07, SLP06Thomas, N. ..................................................EXP05Thomas, R. ...................................................UIP10Thomsen, S. .................................................GGP02Thorwart, M. ...................................SLV31, SLP09Tillmann, A. ................................................EEV12Tilmann, F. .......………...SLV16, SMP14, SLP05,
SLP10, SLP11Titov, D. ……………………..……………EXV41Tittel, B. …………………………………...SLV04Török, T. ........................................……….EXP08Torbert, R. B. ……………………..………EXV37Treml, M.W. ..........................……..............SLP27Treumann, R. A. .........................................EXV29Tsepelev, I. .................................................GDV12Tsurutani, B. ..............................…….........EXP05Tu, C.Y. ……………………….....EXV05, EXP04Tuch, A. …….........…….…UIV18, EEP04, UIP09
V
Vainio, R. ……………..………….………..EXP02Vaith, H. …………………………..………EXV37Vanelle, C. ...................................SMV15, SMV16VeRa Team ..................................................EXP06Verweerd, A. ...............................................EEV12Vocks, C. ………………………………….EXV04Vogt, J. ........................................................EXV15Voigt, R. ......................................................EEV08von Kienlin, A. .............................EXV08, EXP14
W
Wagner, M. ................................................MGV05Wagner, N. ………………………..………VUP07Wagner, U. .......................................UIV01, UIP01Walker, I. ....................................................MGP09Wallner, H. ...................................GDV10, VUV03
Walther, A. .................................................GGP08Walzer, U. ....................................GDV02, GDV03Wang, L.H. ..............................……............EXP04Wang, P. .......................................................SLP04Weber, M. ........................GDV13, GDP04, SLP17Webers, W. A. ...........................................MAV04Wegener, P. ...................................EXV48, EXV49Wegler, U. ..................................................SMV06Weidle, C. ....................................................SLV07Weidler, R. .................................................SMV13Weihnacht, B. ..............................................UIV11Weiler, M. ...................................................EXP13Weinrebe, W. ...............GDV18, SMP14, MGP12Wennmacher, A. .........................................EXP05Wenzel, F. .........GDV19, SLV06, SLV08, SLV33,
SMV01, SLP19, SLP20, SMP08,Werner, S. .....................................EXV41, EXP12Weßling, S. …………………………….....GDV01Wibberenz, G. .............................……….....EXP09Wicht, J. .....................................................MAV03Widiyantoro, S. ............................................SLV07Wiedemann, C. .............................EXV48, EXV49Wiederhold, H. .............................VUV03, VUP04Wienecke, S. ...............................................GGP03Wigger, P. ……………...SMP06, SMP12, SMP13Wilhelm, H. .................................................SLV30Wimmer-Schweingruber, R. .......................EXV19Wirth, W. ………………………………….SLV06Wittwer, A. ...................................................SLP09Wölbern, I. ………………………….……..SLV12Wolf, D. ……………………….....GDP01, GDP02Wonik, T. ........................EEV07, VUV03, VUP04Woyde, M. ………………………………..SMV14Wu, X. .........................................................EEP02
Y
Yaramanci, U. .....EEV11, UIV08, UIV12, EEP05, UIP04, UIP05, UIP06
Yoon, M. …………………….…..………..SMP06Yuan, X. …………………………..………SLV35Yuan, Y. …………………………….……..SLV15
Z
Zieger, B. ....................................................EXV15Ziegler, G. ....................................................UIV16Ziekur, R. ....................................................KOV03Zimmermann, E. ..........................................EEP14Zöller, G. .....................................................SLV28Zöller, L. ....................................................MAV05Zöllner, H. ..................................MGV06, MGP10
476
Abstracts zu Vortrag und Poster
Hier finden Sie die Liste aller Abstracts, die ein Poster zum Vortrag beinhalten. Das Abstract zum Poster (ersterCode) finden Sie beim zugehörigen Vortrag (zweiter Code).
Brost, E., Binot, F., Noell, U., Sauer, J., Suckow, A. (GGA-Institut), Siemon, B. (BGR): Eine Süßwasserlinse im Wattenmeer – EEP12 – EEV03
Küperkoch, L., Bohnhoff, M., Harjes, H.-P. (Bochum): Source Parameters from Fluid Injection InducedMicroearthquakes at the KTB – KTP01 – SMV10
Gräsle, W., Kessls, W., Rifai, H. (Hannover, Leibniz Institute for Applied Geosciences (GGA)): A new flow-logtechnique suitable for small flow rates tested in the 4000 m pilot borehole of the KTB – KTP03 – KTV03
Kulenkampff, J., Spangenberg, E. (Geoforschungszentrum Potsdam): Gesteinsphysikalische Charakterisierunggashydrathaltiger Sedimente – KTP04 – KTV02
Harder, H., Hansen, U. (Münster): Eine Finite Volumen Methode zur numerischen Lösung desDynamoproblems – MAP01 – MAV01
Thoma, H., Klippel, O. (K-UTEC GmbH): Beitrag der Seismologie zur Erkennung und Abschätzung vonGefährdungsmomenten im Salzbergbau – SLP06 – SMV07
Klinge, K., Stammler, K., Plenefisch, T. (SZGRF Erlangen): Lokalisierung und Herdparameter-Bestimmungseismischer Ereignisse am SZGRF unter Einbeziehung von Wellenformdaten verschiedener Stationsnetze –SLP07 – SLV03
Thierer, P. O., Tilmann, F., Flueh, E. R., Kopp, H., Gossler, J. (Kiel, Geomar): Seismologische Untersuchungen des zentralen chilenischen Kontinentrandes – SLP11 – SLV16
Bohnhoff, M. (Bochum), Rische, M., Meier, T., Becker, D., Endrun, B. (Bochum), Stavrakakis, G. (Athen),Harjes, H.-P. (Bochum): Monitoring seismicity at the volcanic arc of the Hellenic subduction zone using acombined broadband/short period temporary seismic network on the Cyclades (CYC-NET) – SLP13 – SLV14
Shapiro, S.A. (FU Berlin, Fachrichtung Geophysik), Kaselow, A. (Fu Berlin, Fachrichtung Geophysik), Wenzel, F. (Univ. Karlsruhe, Geophysikalisches Institut), Kern, H. (Univ. Kiel, Institut für Geowissenschaften): On thepressure dependent elasticity of fractured and porous rocks – SMP08 – SMV01
Wagner, U., Hauck, C. (Karlsruhe): Combining and interpreting geoelectric and seismic tomographies inpermafrost studies using fuzzy logic – UIP01 – UIV01
Igel, J., Kurz, G., Schulz, R. (GGA-Institut, Hannover): Erkundung von Problemzonen im Salinar mit demGeoradar – UIP08 – UIV14
Jacobs, F., Just, A., Krause, Y., Tuch, A., Schuck, A. (Leipzig), Schulz, R., Kurz, G., Igel, J. (Hannover), Lindner, U., Schicht, T. (Sondershausen), Schwandt, A. (Erfurt), Kühnicke, H., Schulze, E. (Dresden): GeophysikalischeErkundung als Beitrag zur Bewertung der Langzeitsicherheit von Endlagern und Untertagedeponien – UIP09 –UIV18
Serfling, U. (Leipzig): Registrierung von elektrischen Feldern am Vulkan Merapi und am GeophysikalischenObservatorium Collm. Methodik, Ergebnisse, Vergleiche. – VUP01 – VUV07
Nurcaya, B. (UGM, Jogjakarta), Brodscholl, A. (VSI, Bandung): BB-Seismograms from external and internalevents of Mt. Merapi show unique pattern in time-frequency domain derived by the Continuous WaveletTransformation – VUP03 – VUV06
Rivalta, E., Dahm, T. (Institut für Geophysik, Universität Hamburg): Dike emplacement in fractured media –VUP05 – VUV04
479
Anfahrt zur TagungÖffentliche Verkehrsmittel vom Bahnhof:Jena-Paradies: Linie 1 (Zwätzen) bis Holzmarkt, Umsteigen in Linie 5 (Ernst-Abbe-Platz) bis Endhaltestelle.Jena-West: Linie 15 (Rautal) bis Holzmarkt (2 Haltestellen), Umsteigen in Linie 5 (Ernst-Abbe-Platz) bis Endhaltestelle.Anfahrt mit dem Auto:Von der A4: Bis Abfahrt Jena-Lobeda, nach links Richtung Zentrum (6 km), unter dem Bahndamm geradeaus durch und dann sofort links (der Straßenbahnlinie folgend), bis ans Ende der Straße, an der Ampel rechts (über die Tramschiene weg), nächste Straße links (100m), links ins Parkhaus (Krautgasse).Von der B7 aus Weimar kommend: Bis Zentrum, am Pulverturm rechts, vor dem Jenoptik-Hochhaus rechts,links ins Parkhaus (Krautgasse).Von der B7 von der A9 kommend: Bis Zentrum, Richtung Weimar auf der B7 bleiben, nach dem Botanischen Garten (rechterhand) an der 1. Ampel links, vor dem Jenoptik-Hochhaus rechts, links ins Parkhaus (Krautgasse).
Entwicklung und Fertigung von- Strichplatten- Beleuchtungssystemen- Mechanischen Komponenten- Sondermikroskopen- Mikroskopumbauten sowie- Schulungen und Seminare
OptoSysOptische Komponenten und Systemlösungen GmbHRobert-Bosch-Straße 764293 DarmstadtTel:+49 6151 44329Tel:+49 3641 472295 in JenaFax:+49 6151 [email protected]
Standardproduktpalette:- Auf- und Durchlichtmikroskope für Ausbildung , Routine und Forschung
für alle Kontrastverfahren- Stereomikroskope und Messmikroskope- Videomikroskope, Videomeßsysteme- Mikroskopkomponenten- Mikroskopbeleuchtungen- Ergonomische Komponenten- Endoskope- Analoge und digitale Videosysteme- Bildarchivierung, Bildanalyse- PC-Hardware und Objektive- Mikrotome



































































































































































































































































































































































































































































































































![Der Gebirgsbote 1910 [Jg. 63] - Biblioteka Cyfrowa](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63249a4e3a06c6d45f06a28d/der-gebirgsbote-1910-jg-63-biblioteka-cyfrowa.jpg)