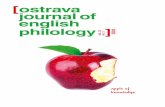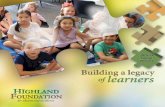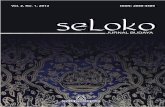2012c Bhatta Jayanta (Highland Philology)
Transcript of 2012c Bhatta Jayanta (Highland Philology)
Wann, wo und weshalb schrieb Bhatta Jayanta seine
„Blütenrispe am Baum des Nyäya"?
Walter S laj e
Bhatta Jayanta ist vor allem als Autor der Nyäyamafijarf bekannt, einer umfangreichen Abhandlung, in der er den Stoff des alten Nyäya aufnimmt und in eigenständiger Weise darstellt, sowie als Theaterdichter, der den Agamacjambara, ein ,Dokumentarspieln mit religionspolitischem Hintergrund und philosophischer Thematik, verfaßt hat.
Spätestens seit FRAUWALLNER (1936)2 wird die nachfolgend dargestellte Genealogie Jayantas von der Forschung akzeptiert. Sie beruht im wesentlichen auf Angaben Jayantas in seiner Nyäyamafijarf (NM) sowie auf denen seines Sohnes Abhinanda in seinem Kädambarrkathäsära (KKS).
Jayantas Patrilinie: 1) Sakti, ein Gaw;la-Brahmane in Därväbhisära (KKS 5) 2) Mitra (KKS 6)
3) Saktisvämin, Minister des Königs Muktäpic;ia Lalitäditya (KKS 7)
4) Kalyär:i.asvämin, Besitzer des Dorfes Gauramülaka (NM 1 653, 11 f.; KKS 8) 5) Candra (NM II 718, 7; KKS 9)
6) Jayanta, Minister des Königs Sari.karavarman (r. 883-902), (AQ)3
Die genannte Genealogie bildet den gegenwärtigen Forschungsstand ab, allerdings ist dieser unter folgenden Vorbehalt zu stellen. Die Interpretation der Angaben Abhinandas, darunter auch die jüngsten von DEZSÖ und KATAOKA, beruht allein auf dem unkritisch edierten Text einer KSS-Druckausgabe von 18884• Zumindest in einem Fall, nämlich in dem von Jayantas Urgroßvater Saktisvämin, läßt sich relativ mühelos zeigen, daß es
„[ ... ] keiner der anerkannten, normativ festgelegten Gattungen des indischen Schauspiels zuzuordnen, hat es im wesentlichen den Charakter eines, wie wir sagen würden, Dokumentarspiels, das jene religionspolitische Maßnahme König Sankaravarmans, ihre Vorgeschichte und ihre Folgen zum Gegenstand hat." (WEZLER 1976: 34 0); vgl. aber unten, S. 138 . - Ich danke ROLAND STEINER ( Halle) für philologische Kritik. Ohne ANDRE AS POHLUS' (Halle) vorzügliche Literaturversorgung wäre die Untersuchung schon auf halbem Wege ins Stocken geraten. Auch dafür sei an dieser Stelle ausdrücklich Dank gesagt.
2 FRAUWALLNER 1936: 267 [Kl. Sehr. 149]. In Details ergänzt und präzisiert von GUPTA 1963: 10; DEZSÖ 2004 : Vff.; KATAOKA 2007: 312ff.
3 Für Stellenangaben vgl. n. 29. 4 „Ki!dambarzkathilsilra, Kävyamälä 11, ed. Pt. Durgäprasäd and KäSinäth Pät:t<;lurang Parab. Bombay, 18 8 6."
[recte: 18 8 8 , WS] (DEZSÖ 2005: 296). Vgl. auch HACKER 1951: 160 [Kl. Sehr. 110].
122 Walter Slaje
nicht unproblematisch ist, wenn man diese Ausgabe gutgläubig als verbindliche Quelle akzeptiert:
sa saktisväminatp putram avapa srutasalinam 1 räjnal:z karkotavarrisasya muktäpirjasya mantrir:tam 11 KKS 7 11
He [seil. Mitra, W.S.] obtained a son, Saktisvämin, versed in the Vedas, the minister of king Muktäpi<;la of the Karkota dynasty5•
Tatsächlich hatte AUREL STEIN 6 Jahre nach Drucklegung des von den o.a. Autoren als beweiskräftig herangezogenen Kadambarlkathäsära, also bereits 1894, auf ein Manuskript aus Jammü hingewiesen, das an dieser Stelle einen anderen Königsnamen, nämlich den des Candräpi<;la überliefert6, und gab seiner Überzeugung, daß es sich hierbei um keine graphische Verwechslung handeln könne, ein Jahr später in einem Brief an ARTHUR
VENIS Ausdruck7• Muktäpi<;la, jüngster Sohn Pratäpädityas II., war ein berühmter Herrscher, der seine Eroberungszüge weit wie kein anderer kaschmirischer Fürst über die Grenzen seines Landes hinaus ausdehnte (Afghanistan, Panjäb, Teile Zentralasiens, Dekkan, Bengalen, Orissa)8, so daß HERMANN GOETZ ihn gar mit Karl dem Großen, Napoleon, Ma]:imud von Ghazni und anderen Eroberern verglichen sehen wollte. Muktäpi<;la konnte annähernd 40 Jahre lang seine Macht behaupten, unterhielt diplomatische Beziehungen mit der chinesischen Tang-Dynastie, und investierte einen großen Teil der als Beute und durch Tributzahlungen erworbenen Reichtümer in die Etablierung eines neuen Baustils in Kaschmir9• Im Vergleich zu ihm war der älteste Sohn Pratäpädityas, sein Bruder und Vorvorgänger auf dem Thron, Candräpi<;la, relativ unbedeutend und wenig bekannt. Er hatte knapp 8 Jahre regiert, als er von seinem jüngeren Bruder Täräpi<;la ermordet wurde10• Variantengenetisch gesprochen läge es daher näher, anzunehmen, daß der in der Bombayer Ausgabe gedruckte Name Muktäpi<;la sekundär
5 DEZSÖ 2004: V-VI; KATAOKA 2007: 313- 314. 6 rlljilab karkotavarrzsasya carrzdräp!ljasya marrztrir;arrz (zit. bei STEIN 18 94: XIX, n. 3; vgl. im Katalog unter „XI I.
Fables, Novels" , Ms Nr. 304). 7 „I must, however, bring to your notice before closing my remarks on this point that the Jammu MS. of the
Kadambari kathasara reads in verse 7 of the Introduction for muktäpltjasya the name candr!lpltjasya, a reading which would throw back still further the dates of <;aktisvamin and Jayanta. " [Bodleian Library. Papers of Sir Mark Aurel Stein (18 62- 1943), Ms 396. Letter to Mr. A. Venis, Benares, despatched 8 th April 18 95]. In diesem Brief nimmt STEIN übrigens seine Spekulation (18 94: XIX) über eine mögliche Identität von Jayanta und Jayaditya (Käsikllvrtti) zurück.
8 Seine schwer gepanzerte Kavallerie wurde von einem tocharischen Buddhisten namens Cailkuna, der ihm als Minister diente, nach dem Vorbild sassanidisch-chinesischer Reiterei ausgerüstet und - auch taktischmodernisiert (zwischen ca. 713/720 und 730). Ihr hatten die konventionellen Truppen der eroberten Regionen wenig entgegenzusetzen (GOETZ 1969: 1lf.; 16; 22).
9 „lt absorbed new Indian and even some Chinese inspirations in its sculpture. And it took over a considerable Roman-Byzantine tradition into its architecture." (GOETZ 1969: 33).
10 RT 4.112; GOETZ 1969: 22.
Wann, wo und weshalb schrieb Bhatta Jayanta seine „ Blütenrispe am Baum des Nyäya "? 123
ist, besonders, da der Text von Kaschmir ausgehend in die indische Ebene weiterwanderte und dann dort, wo man mit den lokalen Herrschernamen der Herkunftsregion nicht mehr so vertraut war, eines fernen Tages gedruckt wurde. Jammü, von wo das Manuskript mit der Lesart Candräpi<;la stammt, liegt demgegenüber unweit von Abhinandas, des Verfassers, Heimatdorf Gauramülaka (s. u.) entfernt. Es wäre unwahrscheinlich, daß man in Jammü den Namen Muktäpi<;la, wäre er ursprünglich gewesen, durch den des unbedeutenden Candräpi<;la ersetzt haben sollte. Die relative Unbekanntheit dieses Königsnamens wie auch die Tatsache, daß er sich in einem Manuskript in unmittelbarer Nähe des vermutlichen Entstehungsortes des Textes erhalten hat, zwingt dazu, die Lesart Candräpi<;la vorerst - d.h. in Unkenntnis weiterer Evidenz - gegenüber Muktäpi<;la als primär zu bewerten.
Für die Datierung Saktisvämins hätte das entsprechende Konsequenzen, denn seine Ministerschaft könnte damit ziemlich genau auf die etwa 8 Jahre währende Regierungszeit Candräpi<;las (ca. 713-719/720) eingeschränkt werden, wohingegen bei Muktäpi<;la 36 Jahre (ca. 724-760)11 in Frage gekommen wären.
So erhalten wir für die absolute Datierung12:
1) Sakti 2) Mitra 3) Saktisvämin, Minister des Königs Candräpi<;la (r. 713-720)
4) Kalyäi:i.asvämin 5) Candra 6) Jayanta, Minister des Königs Sankaravarman (r. 883-902)
Die Regierungszeiten der Herrscher zwischen Saktisvämin und Jayanta liegen maximal 189 Jahre (713-902) oder minimal 163 Jahre (720-883) auseinander. Bei vier Generationen ergibt das einen mittleren Abstand von (maximal) 47,25 bzw. (minimal) 40,75 Jahren zwischen den Generationen. Legt man das Mittel dieser Abstände (44 Jahre)13 auch auf die beiden vorangegangenen Generationen um, so erhalten wir 88 Jahre. Der Begründer der Karkota-Dynastie war Durlabhavardhana-Prajftäditya, Candräpi<;las Großvater. Er
11 GOETZ ( 1969: 8 ) datiert Muktäpi<;las Regierungszeit mit „ca. 725-756" . 12 Nach STEIN ( 1900, 2: 67f.; 8 8 ff.) und WITZEL: „[ . . . ] the 25 year difference between Kalhai:ta's dates for the
Karko\a dynasty and the dates of its kings that can be confirmed from other sources, e.g. that of Chinese travellers, seems to be due to such a confusion [of different eras with incoming new dynasties ]. lt can easily be resolved if we take into account the beginning date of Laukika Sarpvat of Kashmir which corresponds to Kali Sarpvat 25 ( expired). lt is curious that Stein did not notice the reason for this confusion." (WITZEL 1990: 28 ). „Tue discrepancy extends throughout the Kärko\a reign, [.„]." (WITZEL 1990: 51, n. 103).
13 HACKER, der die Lesart Muktäpi<;la vor sich hatte, rechnete mit einer „mittleren Generationendauer von etwa 35 Jahren" , gibt aber nicht an, auf welcher Grundlage er diese ermittelt hat (HACKER 1951: 162 [Kl. Sehr. 112]).
124 Walter Slaje
regierte etwa 36 Jahre, CandräpI<;ias Vater etwa 50 Jahre. Zusammen ergibt das eine Regierungszeit von ca. 86 Jahren. Im Lichte der 88 Jahre Generationenabstand vor Saktisvämin wäre Jayantas ältester Ahne, Sakti, somit genau zu Beginn der neu etablierten Karkota-Dynastie, annähernd um 634, zugewandert14.
Eine Zuwanderung Saktis aus Bengalen erschließt die Forschung aus dem Namenszusatz gaucj,a15• Dieser wird im allgemeinen so interpretiert, daß Sakti aus Bengalen (Gaw;ia) stammte. Allerdings kann der Begriff gaucj,a sich auch generell auf die nordindische Region beziehen16, bzw. als Oberbegriff der sog. Paficagaw;ia-Brahmanen verwendet worden sein, womit die fünf Brahmanengruppen nördlich des VindhyaGebirges bezeichnet werden17•
14 Möglicherweise darf man eine Bemerkung Kalhru:ias über Dorfschenkungen an Brahmanen durch Durlabhavardhana in einen Zusammenhang mit Brahmanen-Zuwanderungen stellen. Eine massive Förderung mußte jedenfalls stattgefunden haben. Das ergibt sich aus der Tatsache, daß Kalhai:ta der Herrschaft Durlabhavardhanas nur fünf Strophen ( RT 4 .2- 6) widmet, davon eine aber explizit seinen Schenkungen vorbehält: „Der König, [der] Schenkungen in der [Umgebung der] Festung und anderswo auf der anderen Seite der Visokä gemacht hatte, schenkte den Brahmanen [auch das Dorf] Candragräma" (pärevisokakotadau pradattapratipattinil 1 adryata dvijendrebhyas candragräma/:z k?amäbhuja 11 RT 4 .5) Die Angabe der Lage „pilrevisoka" könnte in Richtung des Pir Pantsäl weisen, da die Visokä ( mod. Vesau) dem Kramasaras ( mod. Konsar Näg) unterhalb des Naubandhana-Gipfels entspringt, der gewissermaßen auf der Wasserscheide liegt. Auf der entgegengesetzten Seite der Visokä am Pir Pantsäl fließt der Pai\jgabbar-Strom nach Westen ab in das Gebiet. wo Jayantas Heimatdorf Gauramülaka zu vermuten ist; vgl. auch unten, n. 53. Insofern könnte „jenseits der Visokä" (pärevisoka) das Gebiet „auf der anderen Seite" bezeichnen, wo Kalyäi:tasvämin später sein Dorf geschenkt bekam.
15 saktinämäbhavad gautf,o bhäradväjakule dvija/:z I därväbhisäram äsädya krtadäraparigraha/:z llKKS 511„There was a gauefa Brahman by the name Sakti, [born] in the Bhäradväja family, who moved to Därväbhisära and married [there]. " ( DEZSÖ 2004 : V). Als Randbemerkung sei auf eine wohl nur zufällige Namens- und Herkunftskoinzidenz im Kathäsaritsagara hingewiesen, wo ein König namens Sakti-kumära erwähnt wird, der einer Region Gaw;ia zugeordnet wird: gauij,alJ saktikumäro 'yam, kartJäto 'yarrz jayadhvaja/:z I läto vijayavartnäyarrz käsmrro 'yarrz sunandanal:z 11 gopala/:z sindhuräjo 'yarrz, bhillo vindhyabalo 'py ayam 1 nirmükal:z pärasrko 'yarrz nrpa/:z pral)amati prabho 1 (KSS 18 . 3. 3- 4 ).
16 Inschriftlich seit 926 AD. belegt und auch von Kalhai:ta ( RT 4 .4 68 ) in solchem Sinne gebraucht (SIRCAR 1971: 129, n. 3).
17 Neben der namensgleichen regionalen Untergruppe der Gauefa-s von Bengalen fallen unter diesen Oberbegriff aber eben auch Särasvata-Brahmanen aus dem Norden. Zudem ist auffällig, daß diejenigen Brahmanen, die sich selbst als Gaw;ias bezeichnen, am häufigsten in der Gegend um Delhi ansässig sind. Die Tatsache, daß die Region der Pai\ca-Gauc;liya einen größeren Teil Nordindiens umfaßt hat, wie aus inschriftlicher Evidenz zu schließen ist, hat nach DESHPANDE zu der seit Colebrooke gebräuchlichen Verschiebung der Familien- hin zu einer linguistischen Klassifizierung der nördlichen, indo-arischen Sprachen (Gauc;lian/ ,Gaurian Idioms': Hindi, Bengali, Marathi, Gujarati und Sindhi) in Abgrenzung von den dravidischen geführt ( 2002: 57 f. ). DESHPANDEs Argumente wurden von KATAOKA ( 2007: 314 , n. 2) für Jayanta als unzutreffend zurückgewiesen: „No one has raised questions about the interpretation of gauqo . . . dvija/:z as implying that Sakti hailed from Gauc;la, i.e. Bengal. lt is unlikely that Abhinanda, in describing his family history, used such concrete words in a secondary sense, for example, , a brahmin who has some connection with Gauc;la' without actually living or having lived there, or that he intended some reference to the ,Gauc;!a' subdivision of brahmins, on which, see DESHPANDE ( 2002)." Zu den zahlreichen Untergruppen von ,Gaur-;.Brähmans' und ,Gaur-Räjpüts', die demgegenüber von nördlich und nordwestlich von Delhi bis hin zur North-Westem Frontier Province lebten, vgl. allerdings die Angaben bei SIRCAR 1971: 129, n. 2. Zu den ,Gaur Räjputs of Chambä', vgl. auch GOETZ 1969: 102.
Wann, wo und weshalb schrieb Bhafta fayanta seine „ Blütenrispe am Baum des Nyaya "? 125
Därväbhisära, ursprünglich nach den dort ansässig gewesenen Stämmen der Därvas und Abhisäras benannt, ist die geographische Bezeichnung für einen Landstrich außerhalb des eigentlichen Kaschmirtales, im Osten begrenzt vom Pir Pantsäl und zwischen den Flüssen Vitastä ( = Jhelum im Westen) und Candrabhägä ( = Cinäb im Südosten) gelegen 18, traditioneller Wintersitz der kaschmirischen Könige. Im Süden dieses Gebiets liegt Jammü, im Norden Pan:10tsa (Poonch) und Räjapuri (Räjauri). Jayantas Heimatdorf hieß Gauramülaka19, das seinem Großvater Kalyäi:i.asvämin geschenkt worden war20• Nördlich von Räjauri situiert, hätte es tatsächlich im Großraum Därväbhisära gelegen. So jedenfalls gemäß dem Identifikationsversuch von STEIN, der Kalhai:i.as Ghoramülaka mit dem bei Abhinanda genannten Gauramülaka gleichsetzte21• Die phonetischen Differenzen der beiden Ortsnamen erklären sich ohne weiteres aus der kaschmirischen Phonologie, da sie keine stimmhaften Aspiraten kennt (daher wird -gh- artikulatorisch als -grealisiert) und zwischen -au- und -o- kaum differenziert22• STEIN hält Ghoramülaka daher für eine Sanskritisierung von Gauramülaka, das aus seiner Sicht „perhaps with an intentional approximation to his own surname the Gam;ia" von Abhinanda so gebraucht worden sein könnte. Eine aussprachebedingte Verwechslung von annähernd gleichlautendem !j.a und ra, die ihren orthographisch entsprechenden Niederschlag fand, wäre ebenfalls möglich23• Somit wäre in einem nächsten Schritt die plausible Frage zu stellen, ob das Dorf nicht ursprünglich sogar *Gam;iamülaka geheißen haben könnte, was auf Jayantas Familie und die Tatsache der Schenkung des Dorfes an seinen Großvater hin-
18 STEIN 1900, 1: 32 (note ad RT 1.18 0); DEZSÖ 2004: VI. 19 gauramiilakäkhyo granthakrdabhijanagrilmab (NMGr p. 35, 3). 20 asmatpitamaha eva grilmakilmab stt.r,tgrahalJlr/1 krtaviln 1 sa i$fisamaptisamanantaram eva gauramiilakar,t gramam
aväpa II (NM 1653, 10). „My own grandfather, desiring a village, performed the silrrzgrahalJl sacrifice. Immediately after the completion of the sacrifice he obtained the village of Gauramülaka." (DEZSÖ 2004: Vif.). Vgl. auch RAGHAVAN 1964: II, n. 1. Die i$fi findet sich beschrieben bei CALAND 1908 : 106- 109 (Nr. 164). „Mit der
i$ti soll in der Tat ein grtt.makäma opfern, aber auch ein sarvabhauma riljan kann sie in ein asvamedha einbauen. Einschlägig sind für den grllmakäma TS 2, 3, 9, lff„ Baudhäyana-Srautasütra 13, 30; 23, 3; Apastamba-Srautasütra 19, 23,6 ; für den rajan T B 3, 8 , 1, lff.; Baudhäyana-Srautasütra 15, 3; Apastamba-Srautasütra 20, 1, 4." (Schrift!. Mitteilung von KONRAD KLAUS, 17.03.2010). Da Kalyäl).asvämin der Sohn von Saktisvämin - Minister unter Candräpic;la (r. bis 720) - war, könnte die Schenkung an ihn während der Regierungszeit Muktäpic;las (r. ab 724) vorgenommen worden sein. Jayanta nennt gauramiilaka in seiner NM noch weitere sieben Male, vor allem im Zusammenhang mit Beispielen, die er bei der Diskussion der sinnlichen Wahrnehmung von Fehlendem (abhäva) verwendet, vgl. NM 1134, 2; 4f.; 142, 10; 143, 11; 536, 4.
21 STEIN 1900, 2: 144f. (note ad RT 8 .18 61); DEZSÖ 2004: V II. Mit 0miila(ka) gebildete kaschmirische Ortsnamen waren nicht selten, so etwa Süryä-mülaka (RT 7.952) oder Tära-müla(ka) (STEIN 1900, 1: (note ad RT 7. 1314), STEIN 1900, 2: 48 6, n. 11) sowie - um nur die bekanntesten herauszugreifen - Väraha-müla (STEIN 1900, 2: 48 2) oder Tüla-mülya (STEIN 1900, 2: 48 8 ).
22 STEIN, loc. cit. Vgl. WITZEL 1994: 22ff.; 31 (au pronounced as o; gh as g). 23 Obwohl man eher -la//a- für -!ja- erwarten würde. Doch scheint „[e]ine Aussprache als /r/, die der neu
indischen entspricht, [„.] weit in die Vergangenheit zurückzureichen, wie die Gändhäri (Niya) nahelegt." von HINÜBER 2001: § 201 (S. 168 ). Für Beispiele der kaschmirischen Region vgl. Äc;lavin--+ (mod.) Ar'win (STEIN 1900, 2: 415) sowie WITZEL 1994: 32; 51, n. 175 und oben, n. 17. Auch SIRCAR verweist darauf, daß Gaulja im Englischen - wohl in Anlehnung an lokale Aussprachegewohnheiten - allgemein mit Gaur wiedergegeben wird (SIRCAR 1971: 118 ).
126 Walter Slaje
deuten würde. *Gaw;lamülaka Gräma könnte bedeutet haben, „das in den Gaw;las wurzelnde / von ihnen herrührende Dorf". Vielleicht in Anspielung auf seine Bewohneranzahl und Besitzverhältnisse - „das Dorf der Gauc;la-Brahmanen"?
Abgesehen davon ist nicht uninteressant, daß AKLUJKAR (2008) Patafijalis Herkunft ebenfalls in etwa derselben Region verortet24• Zudem führt er Gründe dafür an, daß Patafijali ein Paippalädin gewesen sein könnte25, was gemäß KATAOKA (2007) bekanntlich auch auf Jayanta zutreffen soll26• Zu den vier Qualitäten (gUJJa), die Patafijali dem Brahmanentum als innewohnend zuschreibt27, zählt auch gaura (,fair-skinned, one having a light complexion ')28. Man könnte demzufolge auch darüber spekulieren, ob das brahmanische Dorf nicht nach einer spezifischen Eigenschaft der dort ansässigen Brahmanen benannt worden sein und Abhinandas gaurj.a nicht umgekehrt auf ein falsch artikuliertes bzw. verschriebenes gaura zurückzuführen sein könnte.
Dieses geographische Szenario soll den Hintergrund für die Frage nach einer möglichen Lösung für eine änigmatische Bemerkung Jayantas über den Ort und die Umstände der Abfassung seiner NM bilden.
Jayanta hatte ein Minister- bzw. Berateramt (amätya, mantrin) unter König Sari.karavarman (883-902) aus der den Karkotas nachgefolgten Utpala-Dynastie inne29• Sari.karavarman erbaute sich eine neue, ursprünglich nach ihm selbst benannte Residenz
24 „[ ... ] the region between Madra and Punjab, namely Kashmir" {AKLUJKAR 2008: 194 ). 25 AKLU)KAR 2008: 181f. 26 Daraus ergäbe sich eine gewisse Paippaläda-Belegdichte für diesen Raum. In diesem Zusammenhang wäre
auch auf den Reimport der Paippaläda-Saqlhitä nach Kaschmir hinzuweisen, wie er nach der Vertreibung der Brahmanen unter Sikandars Herrschaft unter seinem Sohn und Nachfolger Sultän Zayn al-'Äbidin im 15. Jh. möglich wurde (SLAJE 2007).
27 MBh ad Päl). 2.2.6 und 5.1.115 {Text bei AKLU)KAR 2008: 183f.). 28 „Three of the four adjectives - gaura , fair-skinned, one having a light complexion', pifzgalä�a , cat-eyed or
brown-eyed' and kapila-kesa , one with tawny hair' - refer to physical appearance. All three apply to Kashmirian Brahmins, and are unlikely to be thought of as germane or widely applicable in the case of Brahmins from other parts of India. Hence, the passage very probably reflects a local Kashmirian association that naturally occurs to Pat0." {AKLUJKAR 2008: 183f.; vgl. dort auch n. 15, p. 184 f.). Das Nllamatapurä1;1a kennt einen Väsi�tha-Brahmanen aus Kaschmir namens GauraparMara ( NM 1177ab: rnsi�tho brähma1;1as tv eko nämnil gaurapartlsara� 1).
29 ÄI;> 2.150 {DEZSÖ 2005: 122); 3.10 {DEZSÖ 2005: 130); 3.75 {DEZSÖ 2005: 14 8); NM 1.64 9, 7 {DEZSÖ 2005: 16; 23, n. 11). DEZSös Vermutung, daß Jayanta ein politischer Gesandter ( DEZSÖ 2005: 18) gewesen oder gar das Amt eines drnrtldhipa, dvärapati ( =Oberkommandierender über alle befestigten Zugänge ins Land) bekleidet haben könnte ( DEZSÖ 2004 : XIII, n. 64 ), ist haltlos, da es sich hierbei um einen der höchsten militärischen Ränge von vitaler Bedeutung für das Reich handelte, der dementsprechend nur an kampferprobte Heerführer vergeben wurde, vgl. RT 5.214 , n. ; STEIN 1900, 2: 291f.; 391f. Die strategisch hohe Bedeutung des Amtes zeigt sich auch daran, daß es sogar als Kompensation für eine verhinderte Thronnachfolge übertragen werden konnte: , , ,Alä' ad-Din knew this was not the time for confrontation and offered [his] brother the position of a Gates Commander that same day with a view to settling their dispute." (jtlnann Alävadeno lha tarrz killarrz kalahä�amam 1 drnraisvaryarrz dadau bhrätus sadyo vighnanivrttaye II JRT 339 II ). Auch wenn es zahllose Belege dafür gibt, daß kaschmirische Brahmanen Kriegsdienst in unterschiedlichen Rängen leisten konnten, sich im Waffenhandwerk übten sowie Gefallen am Reiten und an der Fuchsjagd fanden- so etwa
Wann, wo und weshalb schrieb Bhatta fayanta seine „ Blütenrispe am Baum des Nyäya "? 127
(Sati.karapura), die bald nur noch als pattana („die Stadt") bekannt war, ein Name, den sie heute noch trägt (Pattan)30• Die Stadt liegt nur etwa 20 Straßenkilometer von Värähamüla (Baramulla), der westlichsten Talgrenze entfernt. Dort, wo auch die Vitastä (Jhelum) das Tal verläßt, gab es bis zur Mogulherrschaft eine Befestigung, das ,Tor' (dvära) nach Kaschmir. Von diesem Punkt an beträgt die Wegstrecke nach Räjauri unter 100 km. Hielt Jayanta sich am Hofe Sati.karavarmans auf, so mußte er sich vielleicht sogar noch weniger weit von seinem Heimatdorf entfernen31•
Das von der Indologie wiederholt behandelte problematische Selbstzeugnis, das im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen stehen wird, stellt sich im Wortlaut folgendermaßen dar32:
räjfiä tu gahvare sminn asabdake bandhane vinihito 'ham 1 grantharacanävinodäd iha hi mayä väsarä gamitä/:l II (NM II 199, 9f.)
Die Strophe wurde in folgender Weise übersetzt bzw. gedeutet33:
„Aber der König hat mich in dieses einsame (asabdaka), tiefe Verließ [sie] gesperrt. Und da habe ich mir die Zeit dadurch vertrieben, daß ich dieses Werk verfaßte." (GUPTA
1963: 11).
auch Kalhar:ia und sein Vater Car:ipaka (PANDIT 1935: 740)-, so kann manJayanta, der sich nur als philosophisch-literarischer Schöngeist einen Namen gemacht hat, unmöglich eine militärisch so herausragende Position zuschreiben, zumal nicht die geringste Evidenz dafür vorliegt. Vielleicht ist hier der Ort, in diesem Zusammenhang ergänzend zu SLAJE (2008: 320f„ n. 16) RANJIT SITARAM PANDIT selbst zu Wort kommen zu lassen, dessen Räjatarangi1;H-Übersetzung sein Schwager JAWAHARLAL NEHRU mit einem im Dehra Dun Jail geschriebenen Vorwort (28 June 1934) geehrt hat, nachdem sie vier
Jahre zuvor gemeinsam im Naini Central Prison gesessen hatten (PANDIT 1935: IX) und PANDIT sein „Invitation" im Bareilly District Jail verfaßt hatte (26 March 1933, PANDIT 1935: XLI) -ein offenbar kaschmirisches Brahmanenschicksal, das sie mit Jayanta teilten. In der Person PANDITS scheint sich noch etwas von der eigentümlichen Wildheit der dort ansässigen Brahmanen erhalten zu haben, wenn er schreibt: „Horses, arms - the favourite Rajput Katar and armour used by men - real men - what fascinating things to dream about! Like Kalha,,a most of us still regard killing and being killed as the display of virile action and we have a deep-set, though generally unavowed attraction, for them [ ... ]In the solitude of my present abode, Kalhar:ia's descriptions of fighting make me yearn for action! I often wonder, however, whether it is true that the love of fighting is part of our nature." (PANDIT 1935: 741). Zwei aus dem Paftjab stammende, brahmanische Generäle der Sikh-Armee werden von GARDNER (1898: 263f.; 267f.) so beschrieben: „Two more contemptible poltroons than the two generals of the Khalsa army- Lai Singh and Tej Singh, both Brahmans - never breathed. [ „. ]"
30 STEIN 1900, 1: 206f. (notes ad RT 5.156-158) sowie RT 5.213. Die Überreste der beiden von ihm gestifteten Tempel Sankaragaurisvara und Sugandhesa stehen heute unter Denkmalschutz.
3 1 Von Räjauri nach Pattan sind es- über den Tos'maidan Paß- etwa 85 km (Luftlinie). 32 Ich danke Herrn Dr. KEI KATAOKA für die Kollationierung mit drei der von ihm für seine in Teilausgaben
erscheinende kritische Edition der NM verwendeten Handschriften (Srinagar ms no 1933; Adyar ms no 70719; Calicut ms). Sein Vergleich ergab, daß der Wortlaut - mit Ausnahme von 'yam [Calicut] für 'ham -als variantenlos überliefert anzusehen ist (briefl. Mitteilung vom 13. November 2009).
33 FRAUW ALLNER verweist auf die Stelle als „ein allerdings merkwürdiges Selbstzeugnis" Jayantas, zitiert sie in ihrem engeren Kontext, enthält sich aber ihrer Übersetzung und Deutung (1936: 269 [Kl. Sehr. 151]).
128 Walter Slaje
GUPTA deutet die Aussage so, daß Jayanta „vom König ins Gefängnis geschickt wurde". Als Erklärung formuliert er zwei Hypothesen (loc. cit., n. 11):
1) Jayanta geriet im Verlaufe der Kämpfe Sari.karavarmans gegen Därväbhisära in Gefangenschaft.
2) Jayanta wäre in eine Streitigkeit mit Sari.karavarman verwickelt worden, als dieser seine Untertanen mit Steuern hart bedrückte.
RAGHA V AN spricht von
„a somewhat dark reference to Jayanta having been confined by the King to a solitary cellar,34 where, to while away his time, he seems to have written his NM." (RAGHAVAN 1964: II).
WEZLER (übersetzt auszugsweise):
„von dem König [Sari.karavarman] an diesem unzugänglichen Ort, der still (d. h. einsam) ist" [oder: „der ohne [Sanskrit-]Sprachlaute ist (d.h. wo man kein Sanskrit vernimmt)" oder: „der ohne [passendes] Wort [für ihn] ist (d.h. der jeder Beschreibung spottet)"] „in Gefangenschaft gehalten worden". (WEZLER 1976: 344).
WEZLER, der die Erklärung Cakradharas (NMGr) mit heranzieht35, gelangt zu einer weiteren Deutungsmöglichkeit. Er sieht zwar das „prima facie-Verständnis" eines Gefängnisaufenthalts für gerechtfertigt an und will diesen Fall nicht grundsätzlich ausschließen36, weist allerdings darauf hin, daß es sich ebensogut um „eine Art Verbannung" oder einen „jahrelange[n] Zwangsaufenthalt" im Siedlungsgebiet der Khasas gehandelt haben könnte.
„1 had been transferred by the king to this forest, a wordless place of confinement. 1 have spent the years here in the pastime of writing a book." (DEZSÖ 2005: 18).
Wie WEZLER stützt auch DEZSÖ sich auf Cakradharas Erklärung und hält sogar eine Art von politischer Abordnung („political commission") Jayantas in seine „Heimatregion" für möglich37.
34 In einer Fußnote als „solitary confinement" bezeichnet (1964: II, n. 2). 35 Vgl. unten, S. 129. MUROYA (2010: 215) führt einen Plausibilitätsbeweis zugunsten der Möglichkeit, Cakra
dhara und den Lexikographen K�irasvärnin als kaschrnirische Zeitgenossen des 11. Jh.s zu bestimmen. Beide hätten demnach unter dem Grammatiker Sasankadhara studiert.
36 „Ob es sich [ ... ] doch um einen Gefängnisaufenthalt gehandelt hat, [.„]." (WEZLER 1976: 344). 37 „[. „] it is unlikely that Jayanta wrote the Nyayalmaiijarl as a political prisoner like Gandhi or Nehru. [. „] The
word 'confinement' suggests that this may not have been a promotion; but it was not a life-long exile either,
Wann, wo und weshalb schrieb Bhatta fayanta seine „ Blütenrispe am Baum des Nyäya "? 129
Die Erklärung Cakradharas lautet folgendermaßen:
kasmrre kvacit khasadese38 cirakälam armJyanyäm39 asau srrsankaravarma1Jo räjfia äjfiayä sthitavän iti värtta40 (NMGr 167, 3f.).
„Denn auf Cakradhara war noch die ,Kunde' (värttä) gekommen, daß sich Jayanta ,auf Befehl des Königs Sar'lkaravarman lange Zeit in der Wildnis an einem bestimmten Ort in der Gegend der Khasa in Kaschmir aufgehalten hat'." (WEZLER, loc. cit.)
„The report runs that he spent a long time by His Majesty king Sankara·varman s order in the forest, somewhere in Khasa-land in Kashmir." (DEZSÖ 2005:18).
Nun kann, worauf bereits WEZLER (loc. cit.) und DEZSÖ (loc. cit.) unter Zitierung einschlägiger Belege bei STEIN hingewiesen hatten, kaum ein vernünftiger Zweifel daran bestehen, daß die Region Därväbhisära weitgehend von Angehörigen der Khasa-Stämme besiedelt war, was insbesondere auf die westlich und südöstlich des Pir Pantsäl gelegenen Gebiete außerhalb des Kaschmirtales und die tributpflichtigen Herrscher von Räjauri zutrifft41• Wie erinnerlich, hatte schon STEIN vermutet, daß Ghoramülaka als Heimatdorf Jayantas nördlich von Räjauri gelegen haben könnte42, woraus sich ein gebietsmäßiger Zusammenfall dieses Dorfes mit dem von Cakradhara genannten Distrikt der Khasas ergeben könnte43•
Unklar sind vor allem drei Begriffe (gahvara, asabdaka, bandhana) der ersten beiden Zeilen sowie die möglicherweise idiomatische Verwendung von vini--Vdha mit einem Lokativ:
räjfiä tu gahvare sminn asabdake bandhane vinihito 'ham
since he seems to have returned to the circle of his students as their professor." (DEZSÖ 2005: 18f.); vgl. auch oben,n. 29.
38 khasa0 (em.)] khasa0 (ed.) 39 ara1:iyanyam (conj.)] ärar;yllm (ms.) arar;yilnyilm (em. ed.); afavyilm asau / tlrar;ye 5au (conj. DEZSÖ 2005: 24, n.
23). An dieser Stelle gilt es allerdings festzuhalten, daß der von NAGIN J. SHAH edierte Text, auf den auch WEZLER und DEzsö sich stützten, nicht völlig mit dem Wortlaut des von ihm benutzten Manuskripts übereinstimmt. Vielmehr scheint SHAH sich bei der Wiedergabe stillschweigend erhebliche Freiheiten genommen zu haben. Ich verdanke diesen wichtigen Hinweis Herrn Dr. YASUTAKA MUROYA (Leipzig), der die fragliche Stelle im Manuskript („J" bei MUROYA 2010: 214f.) nachprüfte und mir die Lesung in einem Schreiben vom 27. Juni 2011 freundlicherweise wie folgt mitteilt (Abweichungen vom edierten Text hier in Fettdruck): [fol. 164'6] riljntl tu gahvare sminn iti kasmfre�u kvacit khasadese cirakälam ilrabdhyilm asau 5risarrzkaravarmar;o rtljna äjnäyä: [fol. 164vl] sthitaviln iti 1värttil1.
40 värttä] vilrtä (DEZSÖ 2004: XIII; 2005: 24, n. 23). 41 Vgl. STEIN 1900, 2: 430; 519 (s.v. Khasa). 42 STEIN, Note ad RT 8.1861, vgl. oben, S. 125. 43 Vgl. auch DEZSÖ 2004: XII-XIII.
130 Walter Slaje
Die bisherigen Übersetzungen von gahvara lauten:
1) tief (GUPTA) 2) unzugänglicher Ort (WEZLER) 3) forest (DEZSÖ)
Jeder der drei Übersetzer konstruiert den Satz auf seine eigene Weise:
1) GUPTA nimmt gahvare als Attribut zu bandhane („tiefes Verlies") und bandhane vinihitalJ als Syntagma („ins Verlies gesperrt"). [RAGHAVAN übergeht gahvare, konstruiert aber erkennbar bandhane vinihita!J („confined to a ... cellar")].
2) WEZLER versteht gahvare als Ortsangabe („unzugänglicher Ort"), wo Jayanta „in Gefangenschaft gehalten" (bandhane vinihita/J) worden sei. Auch Wezler konstruiert vinihita/J mit bandhane.
3) Anders DEZSÖ, der vinihita/J mit gahvare („transferred to this forest ... ") und bandhane appositionell konstruiert („ ... a place of confinement").
Einigkeit scheint hier nur hinsichtlich der Bestimmung von asabdaka als Wortart und Satzglied zu bestehen. Alle drei nehmen es adjektivisch als Attribut, verstehen und konstruieren es aber unterschiedlich:
1) GUPTA: „einsames" [asabdake] Verlies (Attribut zu bandhane). [RAGHAVAN: „solitary [asabdake] cellar" (Attribut zu bandhane)].
2) WEZLER: „Ort, der still (d. h. einsam) [asabdake] ist''44 (Attribut zu gahvare). 3) DEZSÖ: „a wordless [asabdake] place of confinement" (Attribut zu bandhane).
Jeder der unterschiedlichen Bedeutungsansätze (gahvara, asabdaka) ist durch die Wörterbücher prinzipiell gedeckt, und keine der vorgeschlagenen Satzkonstruktionen wäre für sich genommen unmöglich.
In einem solchen Fall ist es methodisch naheliegend, den linguistischen Gebrauch bei Jayanta selbst sowie in Texten mit derselben regionalen Herkunft zu prüfen.
1) gahvara Jayanta gebraucht gahvara - abgesehen von der fraglichen Stelle - sonst nur noch dreimal in der NM, und dies ausschließlich in Komposita. Einmal als auf 0giri-gahvara endendes
44 „[ oder: ,der ohne [Sanskrit-]Sprachlaute ist (d. h. wo man kein Sanskrit vernimmt)' oder: ,der ohne [passendes] Wort [für ihn] ist (d.h. der jeder Beschreibung spottet)']".
Wann, wo und weshalb schrieb Bhafta fayanta seine „Blütenrispe am Baum des Nyaya "? 131
Bahuvrihi-Kompositum mit der Bedeutung „Gebirgsschlucht/Gebirgshöhle"45• Ein weiteres Mal als"';,Schluchten/Höhlen des Himälaya" (tu$ilragirigahvara)46•
Zunächst, adri- oder giri-gahvara kommt in kaschmirischen Texten, insbesondere in den Rajatarailgilfis, da diese naturgemäß topographische Angaben machen, sehr häufig vor. Dort bedeutet es praktisch ausnahmslos47 Gebirgsschlucht oder Felshöhle:
adrigahvara: girigahvara:
„depth of the mountains"48• „(deep [= gahana, sankata]) mountain-gorge, hill-gorge, deep in the
mountains"49; ,,mountain cave"50•
Sodann aber als pratyanta-gahvara-janapada (= „die angrenzende Gahvara-Region")51• Das könnte ein Schlüssel zum richtigen Verständnis der hier untersuchten Stelle sein.
Es findet sich ein Anklang bei Kalhal).a, wo von gahvara-vasins die Rede ist. Hier ist es König Muktäpi<;la, der sehr konkrete politische Grundsätze äußert:
aparadha1J1 vinapy atra datJ-i;/.ya gahvaravasinab (RT 4.346ab)
Deshalb wird man die Stelle auch in einem etwas konkreteren Sinne, als STEIN das tat52, zu interpretieren haben:
„auch wenn sie sich in Bezug [auf das Reich] hier keines Vergehens schuldig gemacht haben, sind die Bewohner Gahvaras [hart] mit Steuern zu belegen."
45 gambhiragarjitarambhanirbhinnagirigahvariil;t 1 [.„] vr$firrz vyabhicarantlha naivarrzprayal;t payomucal;t II (NM I 338, 6-9) „Solche Wolken verfehlen es hier nicht, loszuregnen: wenn beim Einsetzen ihres tiefen Grollens Gebirgsschluchten/Gebirgshöhlen auseinandergespalten werden [ ... ]."
46 svacche?u jyotsn11vadätadyuti?u tu$ilragirigahvaragatatuhinasilakarpüradarpai:ze?U pratibimbitani drsyeran 11 (NM II 483, 11) „Abbilder könnten/würden gesehen werden in transparenten, mondlichtklar glänzenden kampfer[gleich weißen] Spiegeln, die Eisfelsen sind in Schluchten/Höhlen des Himälaya." (Ist hier von Eisformationen in Gletscherspalten die Rede?) Vgl. auch himavadgahvara (MV III.84.2a).
47 gahvara ist auch im Sinne von ,dense thicket' belegt und findet sich entsprechend gebraucht (RT 7.1071a [STEIN 1900, 1: 351]).
48 RT 1.263a [STEIN 1900, 1: 40]; 7.973b [STEIN 1900, 1: 344]; [ ... ] 0!1drigahvare 1 [ ... ] abhüd rajapurfyojane 'bhyadhike sthita 11 7. 97311 („[ ... ] Räjapuri was at [a distance of] more than one Yojana.", STEIN. loc. cit.)
49 RT 8.253b; 255b [STEIN 1900, 2: 22]; 8.1577b [STEIN 1900, 2: 124]; SRT 1.7,207d; SuRT 2.52b. 50 Ps-JRT B 172d;JRT 343d. 51 Silkafikadipratyilyanarrz tu pratyantagahvarajanapade$U gri!myasadasi liibh!ldikilmasya /casyacit prayojanavad
bhaved api kadacit, na tu mok?asästre tathävidhopadesal;t pe5ala iti II (NM II 647, 18-648, 2) „Obwohl gelegentlich für jemanden, der das Verlangen nach Gewinn usw. hat, eine Darlegung in der Dorföffentlichkeit über die Zuckerrohr-, etc.-[Vorkommen] in der angrenzenden Gahvara-Region durchaus von Nutzen sein mag, [ist] eine ebenso geartete Unterweisung über Mok�asästras keineswegs ratsam."
52 „Those who dwell there in the [mountains] difficult of access, should be punished, even if they give no offence; [ . .. ] " (STEIN 1900, 1: 154). Die Übersetzung von PANDIT ist der STEINS hier eindeutig überlegen: „Even for no offence in this country the dwellers in the depths of the mountains should be fined, [ ... ]. " (1935: 148)
132 Walter Slaje
Tatsächlich wurde die von Khasas besiedelte Region östlich von Räjauri in mittelalterlichen Texten als Paflcagahvara - der Hauptfluß Äns zu STEINS Zeit noch als Pafljgabbar53 - bezeichnet. Es handelt sich um eine zerklüftete Landschaft an den Westausläufern des Pir Pantsäl, durchzogen von den Betten zahlreicher Gletscherflüsse.
So nennt etwa Jonaräja ein paficagahvara-slman („Grenze zu Paftcagahvara")54, was an Jayantas Ausdrucksweise pratyanta-gahvara-janapada erinnert. Srivara bezieht sich mehrfach auf Personen, die aus der Region (desa) Paflcagahvara stammen (paficagahvaradesaja, paficagahvaraja)55• In ähnlicher Weise spricht auch Suka von einer Region Paflcagahvara (paficagahvarabhü)56•
Man wird daraus schließen dürfen, daß sich Jayanta mit gahvara-janapada auf genau diese Region bezogen hat, und es läge daher nahe, daß er bei seiner Formulierung der -nur für den heutigen Leser obskuren - Stelle ganz dieselbe Region im Auge hatte57• Die von ihm an dieser Stelle verwendete Kurzform gahvara wäre dann metrischen Gründen geschuldet. Darauf weist auch das Demonstrativpronomen idam hin: Das Gahvara-Gebiet hier (asmin), nämlich wo Jayanta sich gerade aufhielt, und von dem er annehmen durfte, daß seine regionale Zuhörerschaft58 - an eine überregionale oder internationale dachte man damals noch nicht - es kennen mußte.
2) bandhana Hier liegt der Fall ein wenig einfacher, da Ausdrücke für Fesseln, Gefangennehmen, Einkerkern, Verbannen etc. besonders in der wirklichkeitsnahen Literatur der RäjataraizgilJIS praktisch durchgängig vorkommen.
Wie erinnerlich, konstruierte nur DEZSÖ vini-'1dhä mit gahvara („transferred to this forest"), die anderen Übersetzer mit bandhana. Nun ist von beiden die zweite Alternative die einzig belegbare, allerdings mit einfachem Verbalpräfix (vi-'1dhä) statt mit zweifachem (vini-'1dhä) wie bei Jayanta. Solche Stellen sind geradezu zahllos (Auswahl):
53 STEIN 1900, 1: 47 (note ad RT 1.317). Der Panjgabbar fließt von Kramasaras (Konsar Näg) am Pir Pantsäl nach Westen ab. Westlich davon liegt Räjauri, wo fünf Flüsse zusammenfließen, vgl. auch oben, n. 14. Ob dies den sprachlichen Hintergrund für die Bezeichnung paiica-gahvara („fünf Schluchten/Talbetten") bilden könnte?
54 Pärtho 'nya iva Partho 'bhüt Paiicagahvaraszmani 1 yo Garbharapurarrz cakre [ ... ]II JRT 132a--<: II („Once there was Pärtha, a second Arjuna as it were. He founded the town of Garbhara within the limits of the Pancagahvara [district].")
55 SRT 3.lOlb; 4.212a. 56 SuRT App. I, B 491 (vgl. JRT 132). 57 „Could the word gahvare in Jayanta's verse refer to this territory?" (DEZSÖ 2004: 13, n. 63). 58 Vgl. auch unten, n. 69.
Wann. wo und weshalb schrieb Bhatta f ayanta seine „ Blütenrispe am Baum des Nyäya "?
bandhana: „to be captured/to be bound"59• bandhan1'vi--./dha: „to place in prison"60• bandhanät-./cyu/'l/muc: „to escape/to be freed from prison"61.
133
Analog wird auch „in den Kerker (kärä) werfen" bzw. „aus dem Kerker freikommen" konstruiert:
käräyäyt1 vi-'l/dhä: „thrown into the dungeon"62• kärayä nir-'l/gam: „escape from the dungeon"63•
Die „Verbannung" an einen Ort drückt Kalhar:i.a ganz anders, nämlich mittels des Kausativs von -./sthä in Verbindung mit einem Lokativ (sthane) aus, z.B.:
[ ... ] sthäpayati sma tarn 1 [ . • . ] dinnagrämäbhidhe sthäne khasakanäyt1 nivesane II 8.291711
He [„.] put him [ . .. ] into a place (sthane) called Dinnä.grama, a seat (nivesane) of Khasakas (Khasas)64•
Die gewöhnliche Ausdrucksweise für ,ins Exil schicken' bzw. ,verbannen' sind seit alters Kausativableitungen von nir-'lfvas65• Keines von beiden trifft auf die Stelle bei Jayanta zu. Gebraucht Jayanta bandhana an anderen Stellen in seiner NM, so - wenngleich in philosophischen Konnotationen der Gebundenheit - ebenfalls nur in Bedeutungen der ,Fessel' und des ,Bandes'66•
3) asabdaka Was nun asabdaka betrifft, so bedeutet dieses Attribut an anderen Stellen bei Jayanta ,ohne Sprachlaut', worunter dort ,ohne begriffliches Erkennen' zu verstehen ist. Das ergibt sich zwingend aus dem Kontext, da Jayanta avyapadesya aus Nyäyasütra 1.1.4 und damit den Charakter des nichtprädikativen (avikalpa) Erkennens erklärt, welches im ersten Moment der sinnlichen Anschauung des Objekts, bevor ein Begriff dafür in der Erkenntnis hin-
59 RT 5.147b [STEIN 1900, 1: 205]; JRT 307c; 8 55b; SRT 3.113b; 119c. 60 RT 3.104d [STEIN 1900, 1: 8 2]; SRT 3.98 d. 61 RT 4.58 0b; 58 1c [STEIN 1900, 1: 173]; SRT 2.SOc. 62 JRT 309d. 63 JRT 293a. 64 STEIN 1900, 2: 230. 65 RT 2.155c; 6.215c; JRT 645d; 8 40d. Srivara verwendet auch bahir niv./kas (kaus.) (SRT l.l.71c). 66 tasya bandhaniiya katharp na pravarteta nirmaryiida prakrtil;z (NM II 396, 17f.); bandhanimittarp mana iti manas
vina yatnato heyam (NM II 412, 15); vitanuta/l [ .. . ] nigalavad [ ... ] dharmiidharmau rujarp bhavabandhane (NM II 414, 15f.); icchi1dve$aprayatnadi bhogayatanabandhanam 1(NM II431, 7); sarpsarabandhaniidhlnadu/lkhaklesady
adii$ilam II (NM II 431, 16); dehabandhanam (NM II 458 , 9); bandhanidhanabhütarp (NM II 520, 4).
134 Walter Slaje
zutritt, eben noch ,ohne Sprachlaute', mithin a-sabda bzw. anullikhitasabda(ka) ist: Der Begriff für die angeschaute Sache hat sich (noch) nicht eingestellt67•
Den erkenntnistheoretischen Aspekt beiseitegestellt, bleibt als Ansatz zur Lösung des vorliegenden Problems, daß asabdaka als - durch suffigiertes 0ka deutlich als Bahuvrihi markiertes - Attribut68 in der Bedeutung von ,lautlos' gebraucht wird, wobei an der problematischen Stelle unter ,ohne Laut' weniger auf das Fehlen von ,Schall' als auf das von ,Sprachlauten' abgehoben werden dürfte, wie es aus dem thematischen Zusammenhang der Stelle hervorgeht.
Es wird daher kaum einem Zweifel unterliegen, daß asabdaka im gegebenen Kontext sinnvoll nur von einem Kerker bzw. Gefängnis (bandhana) ausgesagt werden kann. Denn das ausgedehnte Gebiet Paficagahvara mit seiner Khasa-Bevölkerung, seinen Duodezfürsten und (Brahmanen-)Dörfern wird man schwerlich als ,lautlos' akzeptieren können. WEZLERs Versuch, die Region als „Ort, der ohne [Sanskrit-]Sprachlaute ist (d.h. wo man kein Sanskrit vernimmt)" zu verstehen, ist deshalb weniger überzeugend. Auch, weil in diesem oder in einem benachbarten Gebiet mit einiger Wahrscheinlichkeit Jayantas brahmanisches Heimatdorf gelegen hatte, das im 8./9. Jh. ganz gewiß nicht das einzige seiner Art war. Für die zweite von WEZLER erwogene idiomatische Alternative, daß es sich bei dieser Region um einen Ort handle, „der ohne [passendes] Wort [für ihn] ist (d.h. der jeder Beschreibung spottet)", müßten erst Belege beigebracht werden, die sie wahrscheinlich machen könnten.
So bleibt m.E. nur übrig, die Stelle tatsächlich so zu verstehen, daß Jayanta auf Befehl Sankaravarmans längere Zeit in einem Kerker im Gebiet von Paftcagahvara zubrachte, in den kein Laut von außen drang.
Die hier vorgeschlagene Konstruktion wird m.E. auch durch die Strophenhälften gestützt. Denn es handelt sich um eine Aryä-Strophe. Strukturiert man sie als solche, etwas, das vorangegangene Untersuchungen unterlassen haben, treten die aufeinanderbezogenen Satzglieder (asmin gahvare und asabdake bandhane) noch deutlicher hervor:
räjfiä tu gahvare sminn asabdake bandhane vinihito 'ham 1
67 anullikhitasabdake�v api pratyaye$V (NM I 209, 5); jili1nam anullikhitasabdaka111 sabdanusmaral)e hetubhütam upajäyate. tat asabdam asabdavacchinnavi�ayam avyapadesyam indriyi1rthasannikar$aikakara1)am avikalparrz pratyak!;am (NM I 209, 11 f.)
68 Was auch auf nicht-suffigiertes a-sabda ebenso zutreffen könnte: „Vgl. aber Kasikil ad Päl).. 6. 2. 172, wo ausdrücklich von Bahuvrlhis die Rede ist (Beispiele: ayava�, avrihi�, ami1$a/z). Vielleicht muß man unterscheiden zwischen Tatpuru�as wie a-brahmal)a oder an-asva ,kein ( = etwas anderes als) Brahmane' �zw. ,Pferd' (eben tatpuru�a-isch: ,Nicht-Pferd, Un-Pferd') und Bahuvrihis wie a-vrfhi und a-sabda , ohne Reis' bzw. , Laut' (,keinen Laut habend'). Vgl. auch AiG II, 1: § 113. b. a (S. 291f.)." (R. STEINER, schriftl. Mitteilung vom 20. 08 . 2010).
Wann, wo und weshalb schrieb Bhatta Jayanta seine „ Blütenrispe am Baum des Nyäya "? 135
Es fällt auf, daß Jayanta besonders dann gerne zu Ortsangaben greift, wenn er konkrete Beispiele geben möchte. So auch im Falle seines Heimatdorfes Gauramülaka. Hier etwa, um Anwesenheit, Abwesenheit, Entfernungen usw. zu veranschaulichen. Das zeigt seinen eigenen engen Bezugspunkt, und daß er sich nur an eine Zuhörerschaft gewandt haben konnte, die diesen, bzw. die Kenntnis über dessen genaue Lage, mit ihm teilte. Die größte Distanz lag für Jayanta zwischen Kanyäkubja und seinem Dorf Gauramülaka. Ersteres wird jedermann wenigstens vom Hörensagen bekannt gewesen sein, Letzteres konnten aber nur Einheimische identifizieren. Wenn „Garga" als Name der sonst in Beispielen „Caitra" genannten, unbestimmten Person ,,nicht im Dorfe ist", so war sie für Jayanta ,,nicht in Gauramülaka". Wenn die Wirksamkeit einer Opferhandlung bewiesen werden sollte, dann konnte das bei Jayanta dadurch geschehen, daß sein Großvater mit ihrer Hilfe sein Heimatdorf Gauramülaka erhalten hatte69• Das alles kann Aussagekraft doch nur für eine Zuhörerschaft besitzen, die mit den näheren Umständen, auf die Jayanta sich ständig bezieht, bestens vertraut ist. Und es besagt einiges für den Horizont des Gedankens bei Jayanta und seinem Auditorium.
Ersichtlich ähnlich verhält es sich mit Jayantas deiktischem Gebrauch von asmin, wenn er - wie hier - das Pronomen auf gahvare bezieht: von seinem Standpunkt aus betrachtet befand Gahvara sich in der Tat ,,hier" (idam), nämlich da, wo er sich selbst zum Zeitpunkt der Bezugnahme aufhielt.
So muß man wohl nach dem Grund fragen, weshalb Jayanta ausgerechnet an dieser Textstelle direkt auf seine Kerkerzelle und die ,lautlosen' Umstände, die sich mit ihr verbanden, hinweisen zu müssen glaubte. Das bringt uns abschließend noch kurz zur kontextuellen Einbettung der Strophe, die auch ein Schlüssel zur Intentio auctoris sein könnte. Die Strophe steht dort nämlich im erweiterten Kontext der Sprachtheorie im Rahmen der Diskussion der Erinnerung (smrti) an vollständige Wörter (pada) und deren Phoneme (van:za), wie sie von Jayanta als erforderlich für das Aufgehen des Verständnisses eines vollständigen Satzes angesehen wird. Dies allerdings unabhängig von der Zeitdauer ihres lautlichen Verklungenseins, da am Ende des fertigen Satzes die Erinnerung an die einzelnen Wörter und ihre Bedeutung den latenten Prägungen (sarrzskära), die sie infolge vorangegangener Artikulation hinterlassen haben, entspringe und die resultierende Satzbedeutung insofern auf keinerlei vernehmbare Artikulation mehr angewiesen wäre70• In diesem erweiterten Zusammenhang also erklärt Jayanta, daß er selbst keine eigene Idee etablieren könne, die völlig neu sei und noch nie von den Alten vor ihm
69 Stellenangaben zu den Beispielen für Jayantas häufige Bezugnahmen auf seine heimatliche dörfliche Umgebung finden sich oben, in n. 20.
70 In Kategorien einheimischer Sprachtheorie vertrat Jayanta eine modifizierte, auch von Abhinavagupta akzeptierte abhihitänvaya-Theorie, gemäß der die einzelnen Wörter eines Satzes die Satzbedeutung mittels kumulativer Kausalität (sal'/Jhatyakäritä) hervorrufen, wie sie sie ihnen ihre tätparyasakti verleiht, die auch das Bedeutungsverhältnis der Wörter untereinander regelt. Näheres bei RAJA 1963: 215; 219ff.
136 Walter Slaje
gedacht worden wäre. Auf die Frage eines Gegners, warum er denn dann das Verlangen hege, überhaupt ein solches Werk zu verfassen, antwortet er, daß, erstens, ein Verlangen als solches unergründlich und nicht weiter hinterfragbar sei, und, zweitens, daß Verlangen nicht bloß dadurch aufhörten, daß man sie anderen erklärte. Vor diesem Hintergrund führt er aus, daß er seine Nyäyamafijarl aus eben einem solchen unerklärlichen Verlangen heraus zum bloßen Zeitvertreib verfaßt habe während er in einer totenstillen Kerkerzelle einsaß.
,Ruhig, lautlos' (asabdaka) ist dann gewissermaßen das Stichwort, um auf Sprachlaute (van:ia) und die Bedingungen des sich ihrer Erinnerns eingehen und damit den Hintergrund für die Bildung und das Verstehen von Sätzen - was die Komposition seines Werkes berührt - erhellen zu können71:
na vayam ätmlyäm abhinaväf!l käm api kalpanäm utpädayituf!l k?amäl:z. Wir sind nicht imstande, auch [nur] irgendeine eigene Auffassung auszubilden, [die] völlig neu [wäre]. na hiyaf!l kavibhil:z pürvair adr?ta1f172 sük?madarsibhil:z 1 saktä tri:iam api dra?tuf!l matir mama tapasvinl 1 173 Denn mein gequälter Geist hier ist nicht fähig, auch nur einen Grashalm74 zu erspähen, [den] nicht [schon] die früheren Literaten mit Scharfblick gesichtet hätten.' kas tarhi vidvanmatitarkar:iiyagranthopabandhe tava dohado 'yam 1 na dohadal:z paryanuyogabhümil:z paropadesäc75 ca na tasya säntil:z 1 1 76 [Einwand]: „Was hegst Du dann ein solches Verlangen, ein Werk zu verfassen, das der Dialektik gelehrter Geister unterworfen werden soll?" [Antwort]: „Ein Verlangen hat keinen hinterfragbaren Grund. Und es hört nicht [bloß deshalb] auf, weil man es einem anderen auseinandersetzt. räjfiä tu gahvare 'sminn asabdake bandhane vinihito 'ham 1
71 N M II 199,2-19 (= Kashi I 363, 5--1 6). 72 adr�\aqi. (ed. Kashi)] adr?ta. 73 Anu�\ubh.
74 Jayanta verwendet tri:za an allen anderen Stellen der N M stets nur in der konkreten Bedeutung von Gras(halm) bzw. Stroh (als Brennstoff), aber nirgendwo - so weit ich es erkennen kann - in der ausschließlich übertragenen Bedeutung von Wertlosigkeit oder Winzigkeit („symbol of minuteness and worthlessness", MW), vgl. NM I 67, 1; II 286, 1; 364, 11; 376, 16; 389, 13 (Gras); I 485, 7f.; 496, 5f. (wildwachsendes Gras); II 38, 3 (frisches Weidegras); II 26, 9 (Gras als belangloser Gegenstand (vastu)); I 31s, 3f. (Stroh als Brennstoff).
75 °opadesäc] 0opadesas ca (ed. Kashi). 76 Upajäti.
Wann, wo und weshalb schrieb Bhatta Jayanta seine „ Blütenrispe am Baum des Nyäya "? 137
grantharacanävinodäd iha hi mayä väsarä gamitä� 1 177 Doch hat mich König [Sankaravarman] in ein Verlies, [wo] Schweigen herrscht, in diesem Gahvara[-Distrikt] gesteckt. Hier drin nämlich habe ich die Tage damit zugebracht, daß [ich mir die Zeit] mit der Abfassung [meines] Werkes [Nyäyamafijari] vertrieb." tathäpi vaktavyarrz katharrz van:iebhyo väkyärthapratrtir iti. [Einwand]: „Dennoch bleibt [etwas] zu erklären, [nämlich], wie [Du unter diesen Umständen absoluter Stille] Satzbedeutungen aufgrund von Phonemen verstehen [konntest]." ucyate: cirätikräntatvam acirätikräntatvarri vä na smrtikärm:iam. sarrzskärakarm;akarrz78 hi smarm:iarri bhavati. „Darauf wird so geantwortet: Ob [Phoneme schon] seit langem oder [erst] kürzlich verklungen sind, ist [gar] nicht Ursache für eine Erinnerung. Sicherinnem wird nämlich von latenten Prägungen hervorgerufen."
Mit diesem Beispiel, daß er sein Werk in einem totenstillen Verlies in der Region Paficagahvara aus der Erinnerung geschaffen habe, versucht Jayanta - ein weiteres Mal unter Rückgriff auf die eigene konkrete Situation - zu beweisen, daß ein Sicherinnem an Satzglieder nicht durch eine zeitnah realisierte Artikulation von Sprachlauten, sondern durch latente psychische Prägungen aktualisiert wird.
Mit all dem verbindet sich ein ganzer Komplex von Fragen, die schlüssig zu beantworten unsere ungenügende Kenntnis der Realien im vormodernen Indien vorerst nicht zuläßt. Was wissen wir denn schon über konkrete Haftbedingungen im Kaschmir der JayantaZeit? Wo - oberhalb oder unter der Erde - gelegen und wie beschaffen war ein mittelalterliches Kerkerloch bzw. ,Gefängnis'?79 Wie wurden Insassen behandelt? Wie streng hat
77 Äryä. 78 Anders als 0kllra1Jaka ist ein von den Druckausgaben hier überliefertes 0kara1Jaka in den Wörterbüchern nicht
verzeichnet. Es könnte sich gleichwohl um eine mit -ka markierte Bahuvrihi-Bildung von kara1Ja („Bewirken, Hervorbringen") handeln.
79 Die spärlichen Angaben in HDhS (III: 406f.) legen beredtes Zeugnis für die entsprechende Quellenlage ab. Srivara [SRT 3.106-123] macht ein paar detailliertere Angaben über die Einker kerung (nach dem Jahre 1472) von Bahräm I:;län durch seinen Neffen I;Iasan I:;län: Kerker befanden sich üblicherweise innerhalb der Residenz [JRT 289-295; SRT 3.98; 122]; in den Zellen gab es Grillen (jhilli), Sperlinge (cataka) und Wanzen (matku1Ja), sie waren durchzogen von Spinnennetzen (lütlltantu) (114-116]; Bahräm I:;län's Einkerkerung
ging die keineswegs ungebräuchliche (132] Blendung (netrotpllfana) voran (106-108]; der Gefangene trug eiserne Fußfesseln (aya/lsrnkhalabaddhilnghri) (113], schlief am nackten Boden (bhupr?tha! (117], flehte um Gaben (118]; zum Skelett abgemagert (asthise?atanu) starb Bahräm I:;län nach drei Jahren qualvoll erfahrenen
Leidens (anubhütamahllvyatha) an den Plagen (klesa) der Gefangenschaft (123]. Die Kerker in Girishk (Afghanistan), in denen Alexander Gardner im Jahre 1830 neun Monate verbrachte, waren unterirdisch angelegt („subterranean d ungeons of the castle. [ . . . ] Gardner was kept for nine months a prisoner beneath ground"). Vgl. GARDNER 1898: 161f.
138 Walter Slaje
man sich die Einkerkerung eines Angehörigen des höchsten Standes, eines Brahmanen wie Jayanta, der noch dazu am Hofe augenscheinlich reputiert war, überhaupt zu denken? Darf man sich unter Jayantas Situation etwas der Einzel- bzw. der Schweigehaft, oder etwa eines erleichterten Hausarrests Vergleichbares vorstellen? Was könnte überhaupt ein möglicher Grund für seine Gefangensetzung gewesen sein?
WEZLER hat dazu als bestechende Hypothese formuliert, daß die Inhaftierung Jayantas in einem unmittelbaren Zusammenhang mit seiner Behandlung der „Maßgeblichkeit sämtlicher Überlieferungen" (sarviigamapriimätJya) und der eingehenden Schilderung von Sankaravarmans religionspolitischen Maßnahmen gegen eine sexuell ausschweifende „Observanz der Blaugewandigen" gestanden haben könne80•
PHYLLIS GRANOFF vertritt hierzu eine erheblich abweichende Position, indem sie, erstens, Jayantas Bericht über die Verfolgung und Vertreibung der „Blaugewandeten" (nllapata), hinter denen sie tantrische Jainas vermutet, nicht zwingend als historische Begebenheit lesen möchte, wie sie sich zur Zeit Jayantas in Kaschmir zugetragen habe, und, zweitens, die von Jayanta berührte Thematik in einen völlig anderen Kontext, nämlich in den einer Reflexion über die in philosophischen Zirkeln jener Zeit geführten Diskussionen zur Gültigkeit von (tantrischen) Offenbarungstexten stellt. Vor diesem Hintergrund erschiene es ihr denkbar, „to regard the Agamalf.ambara as a light parody on the fears that the Kashmiri discussion of scripture occasioned: not that all would be persecuted, [ .. . ], but that all would be allowed"81• Träfe GRANOFFs Deutung zu, wäre die seit WEZLER als plausibel akzeptierte Wahrscheinlichkeitshypothese82 für den Inhaftierungsgrund hinfällig.
Sollte es sich denn - völlig spekulativ - bei dem Grund für Jayantas temporäre Gefangensetzung gar um eine vom Herrscher auf einen Brahmanen, der es mit vorwitziger Geschwätzigkeit am Hof vielleicht eine Spur zu weit getrieben hatte, einfallsreich verhängte Lex talionis gehandelt haben, um ihn auf spöttische Art Schweigen zu lehren?
Wie mag ein so umfangreiches Werk wie die Nyäyamafijarl es ist, unter den Bedingungen einer Einkerkerung überhaupt zuwegegebracht worden sein? Auf welchen Schaffensprozeß genau hebt Jayanta ab, wenn er dafür den Begriff racanä gebraucht? Auf die geistige Konzeption des Buches und seine thematische Strukturierung, oder auf die konkrete Ausführung einschließlich der Niederschrift? Hätte man ihn als ,Gefangenen' denn mit Schreibutensilien ausgestattet, deren Gebrauch man zu seiner Zeit voraussetzen
8 0 Vgl. dazu WEZLER 1976: 344f., wo sich auch der überlieferungswerte Satz nachlesen läßt, daß sich Jayanta als „Verfasser des Agamac;iambara [ . . . ] in gewissem Umfang tendenziöser Schönfärberei und schmeichlerischer Lobhudelei schuldig gemacht" habe.
8 1 GRANOFF 1992: 296- 298 , n. 14- 15. Demgegenüber - und insofern in Übereinstimmung mit 1fEZLERS Position - bestimmt SANDERSON (2007: 391 f.) Jayantas Bericht in der Nyllyamaiijarr über eine zeitgenössische Unter
drückung der Anhänger des nrlllmbaravrata („Saiva Black-Blanket Observance") ausdrücklich als historisch. 8 2 Zuletzt DEZ SÖ ( 2004 : XXIII; 2005: 16ff.), der GRANOFFs Arbeit allerdings nicht zur Kenntnis genommen hat.
Wann, wo und weshalb schrieb Bhatta f ayanta seine „ Blütenrispe am Baum des Nyaya "? 139
darf? Oder hat Jayanta erst nach seiner Freilassung, aus der Erinnerung, all das zu Birkenrinde gebrecht, was er während der Haft konzipiert hatte? Seine eigene Wortwahl („Erinnerung" und „totenstill") sowie sein Rückblick auf die im Kerker zwischenzeitlich verbrachte Haftzeit (,,habe ich die Tage [ . . . ] zugebracht") deuten jedenfalls auf das Fehlen schriftlicher Quellen und mündlicher Informanten hin. Jayanta scheint hier betonen zu wollen, daß er ausschließlich auf sein Gedächtnis angewiesen war. Das wiederum legt nahe, daß die Abfassung solcher Werke in der Regel anders, also zumindest auch im lebendigen Dialog mit Gelehrten stattgefunden haben wird. Vielleicht unter konsultierender Abschöpfung des in deren Gedächtnis gespeicherten, rezitativ freigegebenen, oder durch psalmodierende Selbstrezitation aufgerufenen eigenen Textwissens, aber doch wohl kaum, wie in unserem modernen westlichen Kulturkreis üblich, im schweigend über den Schreibtisch gebeugten, geistigen Monolog.
Zusammenfassung:
1) Die Zuwanderung von Sakti, Jayantas Ahne, ereignete sich zu Beginn der neu etablierten Karkota-Dynastie (ca. 634), indem er sich als Nutznießer der brahmanischen Förderpolitik König Durlabhavardhanas in Därväbhisära, einem Siedlungsgebiet der Khasas, niederließ. Die Wahrscheinlichkeit, daß Sakti ein Vertreter nordindischer Paficagaw;ia-Brahmanen war, ist plausibler als die Vermutung einer Zuwanderung aus Bengalen aufgrund des bloßen Namenszusatzes gauif.a.
2) Jayanta verfaßte seine Nyäyamafijarl in der Stille eines Verlieses in derselben Region Paficagahvara, in der auch sein Heimatdorf Gauramülaka zu vermuten ist, in den zerklüfteten Tälern an den Westausläufern des Plr Pantsäl, nördlich des heutigen RäjaurL
3) Als Intentio auctoris für die Abfassung der Nyäyamafijarl wird die Forschung einen vom Verfasser selbst ausdrücklich als „unergründbar" bezeichneten ,Schaffensdrang' zu akzeptieren haben.
Verwendete Primärquellen
ÄQ
JRT
(Jayanta, Agamacjambara), s. DEZSÖ 2004; 2005.
(Jonaräja, Rajataraizgii:zf). Räjatarangir:ti of Jonaräja. Ed. with text comparative and critical annotations and an elaborate introduction by SRIKANTH KAUL. [Vishveshvaranand Inst. Pub!. 432 = Woolner Indological Ser. 7]. Hoshiarpur 1967.
140
MU
NM
NMGr
Ps-JRT
RT
SRT
SuRT
Walter Slaje
(Mok�opäya). Mok$opäya. Das Dritte Buch. Utpattiprakarar:i.a. Kritische Edition. Von JÜRGEN HANNEDER, PETER STEPHAN und STANISLAV JAGER. (Anonymus Casmiriensis: Mok$opäya. Historisch-kritische Gesamtausgabe. Herausgegeben unter der Leitung von WALTER SLAJE. Textedition. Teil 2). [Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Veröffentlichungen der lndologischen Kommission]. Wiesbaden 2011.
(Jayanta, Nyäyamaiijari). Nyäyamaftjari of Jayantabhatta with Tippar:i.i Nyayasaurabha by the Editor. Ed. K. S. VARADÄCÄRYA. Vol. 1.2. [Oriental Research Institute Series 116. 139.] Mysore 1969-1983.
Nyäyamaftjari of Jayantabhatta. Ed. SORYA NÄRÄ YANA SUKLA. 2. ed. Pt. 1.2. [Kashi Sanskrit Series. 106.] Varanasi 1969-1971.
(Cakradhara, Nyäyamaiijarlgranthibhailga). Cakradhara's NyäyamaftjariGranthibhali.ga. Ed. by NAGIN J. SHAH. [L.D. Ser. 35.] Ahmedabad 1972.
(Pseudo-Jonaräja, RäjatarailgilJl). In: JRT.
(Kalhar:i.a, Räjatarailgii:zi). Kalhar:i.a's Räjatarali.gir:i.L Chronicle of the kings of Kasmir. Sanskrit text with crit. notes. Ed. by M. A. STEIN. Bombay 1892.
(Srivara, Räjatarailgii:zi). Räjatarailgii:zl of Srlvara and Suka. Ed., critically, and annotated with text-comparative data from original manuscripts and other available materials by SRIKANTH KAUL. [Vishveshvaranand Inst. Pub!. 398 = Woolner lndological Ser. 8]. Hoshiarpur 1966.
(Suka, Räjataraitgit.zi). Räjataraitgi�ll of Srlvara and Suka. Ed., critically, and annotated with text-comparative data from original manuscripts and other available materials by SRIKANTH KAUL. [Vishveshvaranand Inst. Pub!. 398 = Woolner Indological Ser. 8]. Hoshiarpur 1966.
Verwendete Sekundärquellen
AKLUJKAR 2008 ASHOK AKLUJKAR, Pataftjali: a Kashmirian. In: Linguistic Traditions of Kashmir. Ed. by MRINAL KAUL, ASHOK AKLUJKAR. New Delhi 2008: 173-205.
BHATTACHARYYA 2004 SIBAJIBAN BHATTACHARYYA, Development of Nyäya Philosophy and Its Social Context. [History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization. III, 3.] Delhi 2004.
CALAND 1908 WILLEM CALAND, Altindische Zauberei. Darstellung der altindischen „Wunschopfer". [Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschapen te Amsterdam. Afd. Letterkunde, N.R. X, 1. 1908]. Nachdr. Wiesbaden 1968.
DASGUPTA 1947 N. N. DASGUPTA, On the Date of Lalitäditya MuktäpiQ.a. Indian Culture 14, 1 (1947): 11-19.
Wann, wo und weshalb schrieb Bhatta Jayanta seine „ Blütenrispe am Baum des Nyaya "? 141
DESHP ANDE 2002
DEzsö 2004
DEZSÖ 2005
FRAUWALLNER 1936
GARDNER 1898
GOETZ 1969
GRANOFF 1992
GUPTA 1963
HACKER 1951
HDhS
von HINÜBER 2001
KATAOKA 2007
MUROYA 2010
MADHA V M. DESHPANDE, Paftca-Gaw;ia und Paftca-Drävic;la. Umstrittene Grenzen einer traditionellen Klassifikation. In: "Arier" und "Draviden". Hrsg. V. MICHAEL BERGUNDER und RAHUL PETER DAS. [Neue Hallesche Berichte. 2). Halle 2002: 57-78.
CSABA DEZSÖ, 'Much Ado About Religion'. A Critical Edition and Annotated Translation of the Agamac;lambara, a Satirical Play by the ninth century Kashmirian philosopher Bhatta Jayanta. Thesis, submitted in Hilary Term 2004 for the Degree of Doctor of Philosophy, Balliol College, Oxford. [http: / /www.claysanskritlibrary.org/ downloads.php ].
id„ Much Ado about Religion (Agamac;iambara). Ed. and transl. [Clay Sanskrit Library). New York 2005.
ERICH FRAUWALLNER, Beiträge zur Geschichte des Nyäya: I. Jayanta und seine Quellen. WZKM 43 (1936): 263-278. [ = Kl. Sehr. 145-160).
ALEXANDER GARDNER, Soldier and Traveller. Memoirs of Alexander Gardner. Ed. by HUGH PEARSE. With an introduction by Sir RICHARD TEMPLE. Edinburgh 1898.
HERMANN GOETZ, Studies in the History and Art of Kashmir and the Indian Himalaya. [Schriftenreihe des Südasien-Instituts der Universität Heidelberg. 4) Wiesbaden 1969.
PHYLLIS GRANOFF, Tolerance in the Tantras: Its Form and Function. Dr. S. S. JANAKI Felicitation Volume. The Journal of Oriental Research, Madras LVI-LVII (1986-1992): 283-302.
BRAHMANANDA GUPTA, Die Wahrnehmungslehre in der NyäyamaftjarL Walldorf-Hessen 1963.
PAUL HACKER, Jayantabhatta und Väcaspatimisra, ihre Zeit und ihre Bedeutung für die Chronologie des Vedänta. In: Beiträge zur indischen Philologie und Altertumskunde: Walther Schubring zum 70. Geburtstag dargebracht von der deutschen Indologie. Hamburg 1951: 160-169 [= Kl. Sehr. 110-119).
p ANDURANG V AMAN KANE, History of Dharmasästra. 3. ed. Vol. III [Government Oriental Ser. B, 6). Poona 1993.
OSKAR von HINÜBER, Das ältere Mittelindisch im Überblick. 2„ erw. Aufl. [ÖAW Philos.-hist. Kl. Sitzungsberichte. 467. = VKSKS 20). Wien 2001.
KEI KATAOKA, Was Bhatta Jayanta a Paippalädin? In: The Atharvaveda and its Paippalädasäkhä: historical and philological papers on a Vedic tradition ed. by ARLO GRIFFITHS and ANNETTE SCHMIEDCHEN. [Geisteskultur Indiens. 11 . Texte und Studien]. Aachen 2007: 313-327.
YASUTAKA MUROYA, A Study on the Marginalia in Some Nyäyamaftjari Manuscripts: The Reconstruction of a Lost Portion of the Nyäyamaftjarigranthibhali.ga. WZKS 52-53 (2009-2010): 213-267.
142
PANDIT 1935
RAGHA V AN 1964
RAJA 1963
SANDERSON 2007
SIRCAR 1971
SLAJE 2007
SLAJE 2008
STEIN 1894
STEIN 1900
WEZLER 1976
WITZEL 1990
WITZEL 1994
Walter Slaje
RANJIT SITARAM PANDIT, RäjatarangiI.li. The Saga of the Kings of Kasmir. Trans!. from the original Sarpskrta „. [Reprint]. New Delhi 1935.
V. RAGHAVAN, ANANTALAL THAKUR, Ägama<;iambara. Otherwise called $aI_lmatanätaka of Jayanta Bhatta. [Mithila Institute Ser. Ancient text No. 7]. Mithilä 1964.
K. KUNJUNNI RAJA, Indian Theories of Meaning. [The Adyar Library Series. 91] . Madras 1963.
ALEXIS SANDERSON, The Saiva Exegesis of Kashmir. In: Melanges tantriques il la memoire d'Helene Brunner. Sous la direction de DOMINIC GOODALL & ANDRE PADOUX. [Collection Indologie. 106]. Pondichery 2007: 231-442.
D. C. SIRCAR, Studies in the Geography of Ancient and Medieval India. 2. ed„ rev. and enl. Delhi 1971.
WALTER SLAJE, Three Bhattas, Two Sultäns, and the Kashmirian Atharvaveda. In: The Atharvaveda and its Paippalädasäkhä. Historical and Philological Papers on a Vedic Tradition. Ed. by ARLO GRIFFITHS and ANNETTE SCHMIEDCHEN. [Geisteskultur Indiens. 11. Texte und Studien]. Aachen 2007: 329-353.
id„ Geschichte schreiben: Vier historiographische Prologe aus Kaschmir. ZDMG 158,2 (2008): 317-351.
MARC AUREL STEIN, Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Raghunatha Temple Library of His Highness The Maharaja of Jammü and Kashmir. Bombay1894.
id„ KalhaI_la's RäjatarangiI.li. A Chronicle of the Kings of Kasmir. Trans!., with an introd„ comm. and app. Vol. 1. 2. Westminster 1900.
ALBRECHT WEZLER, Zur Proklamation religiös-weltanschaulicher Toleranz bei dem indischen Philosophen Jayantabhatta. Saeculum 27 (1975): 329-347.
MICHAEL WITZEL, On Indian Historical Writing: The Role of Va!118ävalis. Journal of the Japanese Association of South Asian Studies 2 (1990): 1-57.
id„ Kashmiri Manuscripts and Pronunciation. In: A Study of the Nilamata-Aspects of Hinduism in Ancient Kashmir. Ed. by YASUKE !KARi. Kyoto 1994: 1-53.