Biomechanische Aspekte von Wechselkomponenten für den Kniegelenkersatz
2000a Zur Erklärung der sog. Tobiasnächte (Aspekte des Weiblichen)
Transcript of 2000a Zur Erklärung der sog. Tobiasnächte (Aspekte des Weiblichen)
102 PETER SKILLJNG
WILLIS, JANICE D. 1 992 "Female Patronage in Indian Buddhism'', in: MILLER 1 992:
46-53.
WOODWARD, F(RANK) L(EE) 1 948 (Übers.), The Minor Anthologies of the Pali Canon, Part II.
Udiina: Verses of Uplift and Itivuttaka: As lt Was Said, London.
ZWALF, W(LADIMIR) 1 996 A Catalogue ofthe Gandhiira Scu/pture in the British Museum,
2 vols., London.
t
1 ··-
./ 1
-1 ( l
. t
f l � j r
l.
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' im vedischen Indien•
WALTER SLAJE, Halle
Über die Einzelheiten einer altindischen Hochzeit sind wir aufgrund diesbezüglicher Vorschriften, wie sie in den 'Leitfäden für
die häuslichen [Rituale]' (grhyasütra) niedergelegt sind, bemerkenswert gut informiert.' Bedeiikt -
man, daß andere literate Völker des indogermanischen Sprachkreises derlei Handbücher offenkundig nicht besaßen - zumindest sind uns keine überliefert - , so wird unmittelbar einsichtig, weshalb dieser Teil der indischen Ritualliteratur für die indogermanische sowie für die vergleichende Altertums- und Kulturkunde als erstrangige Quelle geschätzt wird . Diese Leitfäden gehören zum Überlieferungsgut der einzelnen vedischen Schulen und bilden zusammen mit anderen Werken den Abschluß ihrer Text-Corpora, welche in der Hauptsache aus einer Hyrnnensammlung (sa'!lhitil), den daran sich anschließenden
·[Der hier abgedruckte Beitrag war Gegenstand meines Marburger Vortrags vom 8. Juli 1 997. Er erschien dann ursprünglich in den Studien zur Indologie und Iranistik 21 ( 1997): 207-234 und war dort "Albrecht Wezler zum 60. Geburtstag am 2. März 1 998" gewidmet. Zum vedischen Hochzeitsritual vgl. nunmehr aber auch ÜBERLIES 1 998: 3 1 6-325; ZINKO 1 998. W.S.] Für ihr der vorliegenden Untersuchung entgegengebrachtes Interesse und für die damit verbundene förderliche Kritik fühle ich mich den Herren Prof. Dr. J. C. HEESTERMAN (Leiden/Wien), PD Dr. THOMAS ÜBERLIES (Freiburg/Br.), Prof. Dr. ALBRECHT WEZLER (Hamburg) sowie - für wichtige bibliographische Hilfestellungen - a. o. Univ.-Prof. Dr. CHLODWIG WERBA (Wien) ganz außerordentlich verbunden!
1 WINTERNITZ 1 892; SCHMIDT 1 922: 488-533.
1 04 WALTER SLAJE
spekulativen Ritualdeutungstexten (brähmm:za) sowie aus der präskriptiven Ritualliteratur bestehen. Zu letzterer zählen die genannten Grhyasütren, welche �ie am häuslichen Fe\ler zu vollziehend�_n Opferhandlungen des täglichen Lebens, wozu auch die Hochzeit gehört, regeln. 2
Trotz zahlreicher Unterschiede in der Anordnung des Stoffes, trotz gelegentlicher Weglassungen oder Hinzufügungen, die verschiedentlich Überarbeitungen erkennen lassen, obwohl sie also im Detail infolge schulischer oder regionaler Sonderentwicklungen zuweilen voneinander und sogar sehr stark abweichen können, stimmen alle Grhyasütren nun darin überein, daß ein n�lLY.ernlähltes Paar nach der Hochzeit zunächst noch 3 Tage uruLNächte.in Keuschh.eit zuzubringen habe, bevor der körperliche V oHzug der Ehe in der vierten Nacht in Form eines von Opfern und Sprüchen begleiteten Rituals als 'Opferwerk der vierten [Nacht]' (caturthfkarman) erfolgen dürfe.
Man wird für die Verlockung Verständnis aufbringen, daß vor dem Hintergrund dieses textlich so deutlich bezeugten Brauches des indischen Altertums vergleichbare Erscheinungen bei einigen anderen indogermanischen Völkern3 damit in Verbindung gebracht und als für einen gemeinsamen indogermanischen Ursprung beweiskräftig ins Treffen geführt wurden.4 Jedoch erkannte man sehr bald, daß derselbe, in Anlehnung an die im Buch Tobit des
2 Zur Standortbestimmung der häuslichen Rituale innerhalb des vedischen Ritualismus vgl. SMITH 1986. Die vedischen Geburtsrituale mit denen der Hethiter verglichen bei ZINKO 1 994.
3 Besonders bei germanischen und romanischen Völkern, vgl. WINTERNITZ 1 892: 87f.
4 SCHRÖDER 1 888: 193f ("altindogermanisches Erbtheil").
11�· l �. l J
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 1 05
Alten Testaments enthaltene Vorschrift, sich drei Nächte von der frisch vermählten Gattin fernzuhalten, unter der Bezeichnung 'Tobiasnächte'5 in die Literatur eingegangene Brauch auch von einigen nichtindogermanischen Völkern befolgt wurde. Zudem berichten indische Kommentare von regionalen Gepflogenheiten, wonach die drei Nächte überhaupt nicht beobachtet wurden.6 Die These eines ausschließlich gemeinindogermanischen Brauches wurde daraufhin nicht mehr so vehement vertreten. Die Sitte als solche gilt hinsichtlich der Gründe, die zu ihrer Entstehung führten, bis heute als ungeklärt. 7
5 Die im griechischen Text fehlende Stelle (Tob 6. 1 8ff) ist in der Vulgata als Interpolation anzusehen. Auf dieses Fehlen wird auch die Tatsache zuriickzuführen sein, daß die slavischen, am griechisch-orthodoxen Ritus ausgerichteten Völker diesen Brauch nicht, die süddeutschen, italienischen und französischen des römisch-katholischen Ritus ihn demgegenüber durchaus kannten. Vgl. dazu SCHRADER 1 929: 540; ferner P. SAINTYVES, "Les trois nuits de Tobie ou Ja continence durant !es premiers nuits du marriage", in: Revue anthropologique 44 ( 1 934): 266ff [letzterer mir nicht zugänglich, zit. nach DRESDEN 1 941 : 73]. Da die Enthaltsamkeit hier den Dämon Asmodi (= Aeshma Daeva, parsischer Dämon der Begierde) vertreiben soll, könnte eine Spur in den alten Iran führen.
6 Näräyar.ta ad ÄGS 1 . 7 .2: vaidehe$u sadya eva ryaväyo dtßal:z 1 grhye tu brahmacärifJaU trirätram [vgl. ÄGS 1 .8. 1 Of] iti brahmacaryaf!I vihitaf!I. tatra grhyoktam eva kuryän na desadharmam iti siddham. Haradatta ad ÄGS 1 . 7.2: ke$ucid dese$u sadyal:z samävesanaf!I d[$!Of!I vak.ryamälJena trirätra'!I dväda.Sarätram iti brahmacaryelJa bädhyate. [Haradatta zit. nach HDh 2, 1 : 441 , n. 1 049.]
7 WINTERNITZ 1 892: 88. HDh 2, 1 : 304, n. 723; DRESDEN 194 1 : 73. Vgl. zuletzt SCHMIDT 1 987 ( 108, n. 19), der auch - anders als GONDA 1 956: [ 197] und KUIPER 1996: 241 - Zusammenhänge mit dem römischen trinoctium ganz zu Recht ausschließt. Die Jahresfrist, nach der die Frau in die eheliche Vollgewalt (manus) des Mannes eintritt, gilt nach altrömischem Privatrecht dann als unterbrochen, wenn sie während eines trinoctium, d.h. während dreier
1 06 WALTERSLNE
Als mögliches Motiv für den indischen Brauch wurde mehrfach die Furcht vor bösen Geistern geltend gemacht, da diesen durch die Defloration eine Eintrittsmöglichkeit eröffnet werde. Um sie zu
täuschen, schliefen die alten Inder demnach drei Nächte in Keuschheit nebeneinander. 8 Oder, wie ÜLDENBERG ( 1917: 273) vermutete, es könne sich um ein aus der Furcht vor bösen Geistern, die 'beim Beilager in das Weib miteinschlüpfen, der Frucht Gefahr bringen, auch ihrerseits das Weib befruchten .. .' erwachsenes Täuschungsmanöver handeln, 'indem man ihnen Unterlassung der Ehevollziehung vorspiegelt' .9
Allen bislang vorgebrachten Deutungsversuchen ist gemeinsam, daß man der Frage, welche Textzeugen die in Rede stehenden drei Nächte eigentlich überliefern und wie sie dort eingeordnet seien, nicht weiter nachging. Vielmehr fügte man diese Keusch-
aufeinanderfolgender Nächte, vom Haus ihres Mannes ferngeblieben ist. Das trinoctium dient demnach der Aufrechterhaltung einer manus-freien Ehe (LEIST 1 892: 1 74; KASER 1 977: 230; 235) und ist von daher etwas völlig anderes als die drei 'Hochzeitsnächte' im alten Indien, die dem ersten Beischlaf vorangehen!
8 l<EITH 1925: 376; SCHRADER 1 929: 540; MEYER 197 1 : 3 12-3 1 4; THIEME 1 985: 245. KEITH führt loc.cit. als weitere Möglichkeit an, daß, da die vedische Hochzeit keinerlei Hinweise auf einen Ritus enthalte, der die Gefahren einer Zerstörung der Jungfernschaft bändige, die ersten drei Nächte für einen sofortigen Vollzug der Ehe als zu gefährlich angesehen worden sein könnten.
9 "Dumme Teufel" bei MEYER 1 97 1 : 3 1 3; "Dumme Teufel, [ ... ] Furcht vor bösen Geistern" bei TmEME 1 985: 245. Anders SCHMIDT 1 922: 5 19f("die andächtige Stimmung nur langsam irdischen Gedanken weichen zu lassen ... "), P ANDEY 1 969: 223 (''to give a lesson of moderation to the married couple in the sexual life") sowie HERMANN 1 904/05: 384, der die Enthaltsamkeit mit länger andauernden Hochzeitsfeierlichkeiten und Verschärfung des asketischen Gedankens in Zusammenhang bringt.
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 107
heitsnächte auf Grundlage des Zeugnisses der Gyhyasütren den in den Sarphitäs beschriebenen Hochzeitsgebräuchen hinzu und entwarf so ein möglichst vollständiges -jedoch zweifellos auch im selben Maße kontaminiertes - Bild einer altindischen Hochzeit.10
Was also sonst in der historischen Philologie als methodisches Prinzip gilt, nämlich zeitlich auseinanderliegende Text- und Literaturschichten auch interpretativ auseinanderzuhalten, wurde in diesem Fall versäumt, und dies, wie es scheinen will, nicht ohne Konsequenzen für ein adäquates Verständnis des Brauches.
Mit der folgenden diachronen Untersuchung, die auf der Prüfung des diesbezüglichen Materials der Sarphitäs und Bräluruu).as, der Upani�aden sowie von 17 Grhyasütren beruht, soll - durch Beobachtung des genannten Prinzips - gezeigt werden, daß und wie 1.) die 'Tobiasnächte' ihre eigene, durchaus nachvollziehbare Geschichte innerhalb der vedischen Ritualliteratur haben, und 2.) welche Motive zu ihrer Entstehung geführt haben dürften.
A. Das Zeugnis der Sarphitäs und Brähmal}as
Weder deskriptiv noch präskriptiv, aber in 'lyrischer' Umsetzung der Beobachtung frühvedischer Ritualwirklichkeit überliefern bereits die ältesten Teile der vedischen Sammlungen im Süryä-
10 TIIlEME 1 985 deutete RV X 86 (V�äkapi) u.a. im Lichte der davor angeordneten Hochzeitslieder aus RV X 85 als burleske, eine erotisierende Stimulierung bewirkende 'Überbrückung' der Keuschheitsnächte, deren Evidenz jedoch auch für TmEME nur anhand von Grhyasütren gegeben war (S. 245). Doch vgl. demgegenüber die Belege von WINTERNITZ (1 892: 86) über das V erbot von Scherzen und der Gedanken an den Beischlaf. Erst F ALK ( 1 993: 9 1 ) bemerkte ausdrücklich, daß sich die besagten Nächte im RV nicht aufspüren ließen.
108 WALTER SLAJE
Sükta (RV X 85) einen Hochzeitsmythos nebst angeschlossenem Ritual. Viele Strophen aus dieser eher lose gehandhabten Zusammenstellung einzelner, auf einem Mythos von der Hochzeit der Süryä mit Soma beruhender Lieder des �gveda 11 finden sich -bei teilweiser Modifikation des Wortlauts und der Anordnung -auch im Atharvaveda (A V XIV) wieder. In ihnen zeichnet sich bereits eine große Anzahl der in späteren Texten dann kodifizierten Bräuche ab. Verschiedene Grhyasütren verwenden sie als - oft entstellte - Sprüche (mantra) zur Begleitung ihrer Ritualhandlungen.12 Was hierbei auffällt, ist, daß einige der später konstitutiv gewordenen Hochzeitsriten (z.B. saptapadf, 13 asmäropm;a, /äjahoma) nicht erwähnt werden, 14 und dazu zählen vor allem auch die drei Tobiasnächte. Da die Sarphitä-Texte andererseits nur die Zufälligkeiten einer kompilatorischen Überlieferung bieten, beweist diese Tatsache für sich allein genommen für das Alter der Bräuche wenig. Zunächst einmal wäre deshalb einfach als Faktum festzuhalten, daß die Sarphitäs nichts über drei enthaltsame Nächte vor dem Ehevollzug berichten.
1 1 Von MENSK.1 1 991 : 55f gedeutet als rituell dramatisiertes Modell einer idealen Hochzeit, das die schrittweise Ablösung der Braut von ihrer Familie und die Aufnahme in die Familie des Mannes darstellt. Gemäß FALK 1 993: 76 (in Anlehnung an VON SIMSON 1986) entsprechen diesen beiden Gottheiten auf der astralen Ebene wahrscheinlich ein Frühstadium der Morgendämmerung und der Mond, auf der menschlichen Ebene Braut und Bräutigam.
•• '..2 Daß die jeweilige Zuordnung zu einzelnen Riten dort allerdings schon früh außerst schwankend gehandhabt wurde, merkt bereits OLDENBERG in seinen Noten (II 287) an.
13 Vgl. dazu MENSK.1 1 989: 373. 14 ÜLDENBERG, Noten (II) 287.
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 109
Doch geht seit A. WEBERs diesbezüglicher Deutung von 186215 die opinio communis der Veda-Exegeten dahin, daß in einigen Strophen des Süryä-Liedes (RV X 85,28-30; 34-35) von dem in der Hochzeitsnacht durch Defloration befleckten Brautgewand (viidhüya) die Rede sei. Es handle sich bei diesen teilweise sehr schwer verständlichen Aussagen um ein vedisches Jungfrauenbluttabu.16 Selbst wenn diese Ansicht mit LUDWIG ALSDORF für den �gveda aufzugeben wäre,17 so beziehen sich dieselben, bloß etwas anders angeordneten und mit Erweiterungen versehenen Hymnen im Atharvaveda (XIV 1,25-30), wie selbst ALSDORF einräumt, auf das Weggeben des Brautgewandes,18 der späteren Tradition gemäß19 auf
15 WEBER 1 862: 1 87. 16 WINTERNITZ 1 892: 1 00; O'FLAHERTY 1 98 1 : 273f (= notes 27-34);
MENSKI 1 985; vgl. auch dens. 1 989 über die magischen Gefahren, die vom jungfräulichen Blut ausgehen können (RV X 85,34) sowie ders. 1 99 1 : 57f.
17 ALSDORF 1 961 weist unter der Voraussetzung einer einigermaßen geordneten Darstellung des menschlichen Hochzeitszuges ( vahatU) in Entsprechung zum zuvor geschilderten Mythos (X 85, 1 - 19) diese Annahme für den �gveda zurück. ALSDORF sieht im viidhüya ('hochzeitlich', 'zur vadhü in Beziehung stehend') das in einer Kuh (vgl. AV V 1 8) bestehende Trauungshonorar für den amtierenden Priester, welches vor der Hochzeit übergeben wird. Selbst wenn es sich um ein Kleid handle, so gemäß ALSDORF um eines, welches vor der Fahrt zum Haus des Bräutigams dem Priester übergeben wurde, da es mit schädlichen Fluida der Sippe der Braut behaftet sei. Ähnlich auch MENSK.1 ( 1 989: 376), wonach die Vorzüge einer Kuh auf die Braut übertragen werden. Zu einer naturmythologischen Deutung des Süryäsükta vgl. VON SIMSON 1 986: 208ff.
18 Die Parallelen des �gveda (X 85), Übersetzung und Deutung bei WEBER 1 862: 1 87- 1 90; WINTERNITZ 1 892: 100; WHITNEY 1905: 744f. GONDA 1 964/65; KRICK 1 982: 80, n. 208. Zu den thematisch verwandten Stellen A V XN 2,41 -42; 47-50 vgl. WEBER 1 862: 212f, ÜONDA 1 964/65: 1 5f und MENSK.1 1985: 293 (Resümee) sowie 1991: 58; 6 1 . Der Letztgenannte deutete A V XIV 2,47 (- RV VIII 1 , 1 2) dahingehend, daß der Priester darüber wache, daß die
110 WALTER SLAJE
das durch dunkelrotes (nflalohita) Blut verunreinigte Untergewand bzw. Hüfttuch der Braut. 2° Für uns aber kommt es in diesem Zu
magischen Gefahren des jungfräulichen Blutes der ersten Nacht dem Bräutigam und seiner Familie keinen Schaden zufügten.
19 Z.B. Kal!S 79,20ff(dazu GoNDA 1980: 397); ÄGS 1.8.12; ÄpGS 3.9.11; vgl. GONDA 1980: 143 sowie das über die präyascittas im caturthikarman weiter unten (S. 127ff) Bemerkte.
20 Vgl. zu diesem AV XIV 2,49-50 (upaviisana, niv1) nebst Kommentar von GONDA 1964/65: 16f. Zu väsas als Bekleidung des Unterleibs vgl. HDh 2, 1: 278f. Gemäß SYED 1993 bezeichnet nivi (in der von ihr untersuchten epischen und nachepischen Zeit) ein um den Unterleib gewickeltes, vom Nabel bis zu den Knöcheln reichendes Gewand. Allein wurde dieses nur im häuslichen Bereich sowie von menstruierenden Frauen - anders als die öffentlich getragene zweiteilige Kleidung der Oberschicht ( 121 ff) - angelegt ( 114 ff). Das Menstrualblut floß dabei in den Stoff (116; 130ff), der dann blutgetränkt war. Das fügt sich nun natürlich gut zur Stelle A V XIV 2,49f. Aber ob mit der Auslegung von adhonivi [MBh 2.60.15ab] dann nicht V AN BUITENEN (1975: 141) als "knotted below" gegenüber SYED ( 1993: 117) als "unterhalb des Nabels getragen" das Richtigere traf? Zur sichereren Klärung wären außerdem aus der Sütrenliteratur auch noch SGS 2.1.18, MGS 1.9.27, PGS l .4.12f, GGS 2.1.18 sowie WINTERNITZ 1892: 46f heranzuziehen.
nilalohita (AV XIV 1,26; RV X 85,28) von den früheren Exegeten über GoNDA (1964/65: 3), MYLIUS 1981: 63, n. 105, bis zu MENSKI (1991: 63) mit dem Deflorationsblut in Beziehung gebracht. Gemäß FALK (1993: 88f; 92) würden die Farben des Zobelfells dem Heilwerden des Himmels (blau, rot, gelb) entsprechend genannt. In den medizinischen Sästras jedenfalls wird die Farbe -allerdings des Menstrualblutes - als leicht schwärzlich (i�atk;�IJa) geschildert (z.B. AH, Sär. I ,23a). Gemäß ZACHARIAE 1903 sind rot und blau furchterregende, übelabwehrende Zauberfarben (155 = 523), vorzugsweise Unglücksfarben, als Hochzeitsfarben allerdings 'offenbar' [!] Glücksfarben (231 = 544). Rot jedoch häufig auch als Ersatz für Blut (226 = 539) sowie als sexuelles Symbol in Verwendung (GoNDA 1980: 45). ALSOORF (1961: 494f= 3 l t) neigt dazu, mit Säitkhäyana an ein blaurotes Band zu denken, welches der Braut von den Verwandten bei der Übergabe an den Bräutigam umgebunden wird. A V XIV 2 von MENSKI (1991: 59ff) als Auseinandersetzung mit dem Problem der
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 1 1 1
sammenhang auf jene Aussage an, wonach der Gatte, wenn sein Glied mit ihrem befleckten Gewand (sämulyiz)21 in Berührung kommt, sein Wohlergehen gefä.hrde22 durch eine unheilvolle, magisch wirksame23 Macht (k[tyit), die daran haftet, und die jetzt -
Verunreinigung durch das jungfräuliche Blut behandelt, das ein zweites Hochzeitsritual nach dem Vollzug erforderlich mache.
21 MYLIUS 1981: 64; KRICK 1982: 97. Von FALK 1993 als Zobelfell gedeutet welches vom Bräutigam getragen wurde. Ein solches Fell wäre nur anläßlich vo� blutigen Zeremonien - wie etwa dem Schlachten von Rindern - ange�egt worden und daher mit einer entsprechenden Symbolkraft behaftet. Diese Deutun� hat überaus viel für sich, doch muß man den Akt der D�flo�t�on unter dem Gesichtspunkt eines 'blutigen Handwerks' - ganz so wie die m Fn. 24 zitierte Stelle es nahelegt - betrachten. Leider wurde gerade das von F ALK abgelehnt, da ihm "Termini des Schlachtens ... zu einer Defloration nur müh� [zu] passen ... " schienen (78t). Wenn aber das Fell "ein Symbol der Aggressivität" war weshalb sollte "dabei das Sexuelle in Indien sicher nicht im Vordergrund" '(93) gestanden haben, zumal es doch anläßlich von (blutiger) Defloration - und (blutigem) Zeugungsakt [SLAJE 1995] - verwendet worden war? Denn gemäß ÄpDhSü (2. I . I .20) hatte der Mann anläßlich der Zeugung ein besonderes, nur dem Verkehr mit seiner Frau vorbehaltenes Kleid (striväsas) anzulegen: striväsasaiva sarrmipäta/J syät. Dazu Haradatta: stryupabhogärthaf!! väsalJ [=] striväsas. tena saf!lnipätalJ syät. na tena pra/cyälitenäpi brahmayajnädi !q:tyam. Vgl. auch Haradatta ad ApDhSü 2.1.2.1: „. retas� rajasas ca ye /epäl; „. Es steht dies natürlich in direktem Zusammenhang mit der Tatsache, daß dabei auch das als zeugungskräftig angesehene 'Menstrualblut' der Frau floß (SLAJE 1995: 124, n. 26). Im Lichte von AV XIV 2,49f allerdings, wo in verwandtem Zusammenhang von upavi!isana und nivi die Rede ist (oben, Fn. 20), neige ich für die Atharvaveda- und die Folgezeit aber eher dazu, hier an eine Art Hüfttuch der Braut zu denken. 22 A V XIV 1,27: aslilii tanilr bhavati, ritsati päpayämuyii 1 patir yad vadhvo viisasah, svam angam abhyürTJute 11[- RV X 85,30]. Interpretation gemäß GONDA
.1964/65: 3f. Vgl. auch AV XIV 2,50. 23 Die Charakteristika magischer Wirksamkeiten bei DAS 1984: 234f. Zur
Stelle auch FALK 1993: 91.
1 12 WALTER SLAJE
nach erfolgreicher Defloration, 24 welche im übrigen die Brauteltern nun endgültig ihrer Verantwortung für die Braut entbindet25 - auf ihn überzugehen droht.26 Einern Priester aber übergeben, der dadurch, daß er das Süryä-Lied rezitiert ('kennt'), sich einer Zeremonie unterzieht, die die schädlichen Konsequenzen aus der Defloration tilgt (priiyascitti), soll das Kleidungsstück demgegenüber glückverheißend werden.27 Von Signifikanz sind hierbei die Bemerkungen über die verhängnisvollen Folgen für den Bräutigam, die durch Weitergabe des Untergewandes an einen Priester dann verhindert werden können, wenn dieser sich der genannten übelabwehrenden28 Zeremonie (priiyascitti) unterzieht. Denn genau
24 A V XIV 1,28: äsasana'!I viStisanam, titho adhivikiirtanam 1 süryayä/:l pasya rüpa!Ji, tani brahmota sumbhati 1128 11[- RV X 85,35]. Gemäß GoNDA
(1964/65: 4t) "three aspects of the 'bloody cutting', appearing in the act of defloration ... ".
25 Auf /q"tya aus dem vorangehenden Vers bezogen. A V XIV 1,26: nilalohitti'!I bhavati, /q"tyasakJfr ry ajyate 1 edhante asyä jfiätayaJ:i, patir bandhe$U badhyate 11[- RV X 85,28]. Interpretation gemäß GoNDA 1964/65: 3. Vgl. auch AV XIV 2,49.
26 A V XIV 1,25: parä dehi sämu/yil'!I, brahmtibhyo vi bhajä vtisu 1 /q"tyai$a padvati bhütva, jäya visate patim 11[- RV X 85,29]
27 A V XIV l ,29cd-30: sürya'!I yo brahma veda, sti id viidhüyam arhati 1129 11[- RV X 85 34] sa it tat syonti'!I harati, brahma vasa/:l sumanga/am 1 prayascitti'!I yo adhyeti, yena jäya na ri$J!ati 1130 11. Päda d doch im Zusammenhang mit AV XIV 1,25 (Fn. 24) so zu verstehen: Die Frau kann nun keinen Schaden mehr bewirken! Vgl. auch noch AV XIV 2,41-42 sowie 2,48-50, wonach das Untergewand an einem Baumstamm befestigt wird. Dazu GONDA 1964/65: 16f, bes. n. 78 (Bannung von Krankheit und Übel an einen Baum).
28 Vgl. dazu GAMPERT 1939: 23ff; LOMMEL 1950: [217-219]; GONDA 1980:288f.
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 1 1 3
dasselbe wird uns anläßlich der Untersuchung der Grhyasütren in etwas modifizierter Form wieder begegnen.
Daß aber bis hierher, soweit RV und AV betroffen sind, von Enthaltsamkeit noch gar nicht die Rede war, das wäre fürs erste einmal - und mit Nachdruck - festzuhalten.
Drei enthaltsame Nächte kommen meines Wissens 1m Zusam
menhang mit dem Problemkreis der Ehe zuerst im Yajurveda vor.
Hier wird eine Observanz von drei Nächten für den durch einen
vorangestellten Mythos als prototypisch ausgewiesenen Fall vorge
schrieben,29 daß die Frau während ihrer fruchtbaren Periode (ftviya)
noch ein blutbeflecktes Kleid trägt (malavadviisas).30 Das Tragen
des so befleckten Kleides ist nun nicht nur nach Ausweis der
späteren Kommentare,31 sondern auch nach dem älterer Textzeu
gen32 Merkmal für den Fluß des als zeugungskräftig angesehenen
Menstrualblutes. Nun wurde der Beginn der fruchtbaren Zeit zwar
mit dem Einsetzen der Menses gleichgesetzt, eine Begattung
unmittelbar zu Beginn dieser Periode jedoch durch die Vorschrift
29 TS 2.5.1. 7: tisro ratrir vratti'!I cared ...
30 TS 2.5.1.5: ttismäd ftviyät striya/:l pra}af!I vindante, kiimam a vijanito/:l SOf!I bhavanti 1 . . . sa ma/avadväsä abhavat 1. "Darum erlangen die Frauen aus [ihrem] zur fruchtbaren Periode gehörenden [Zeugungsstoff] Nachkommenschaft, nach Lust vereinigen sie sich [danach], bis sie gebären . ... Dieser [dritte Teil von Indras Brahmanenmord] wurde eine [Frau, die] ein blutbeflecktes Kleid trägt". Dazu SLAJE 1995: l 12ff; 134; 136ff.
31 malavadväsä/:l [ =] rajasvalä (Bhattabhäskaramisra). sä malavadväsä [ =] rajasvalä yo$it abhavat (Säyai:iäcärya).
32 Vgl. Fn. 20 und unten, S. l l 6f.
1 1
114 WALTER SLAJE
einer dreitägigen Observanz untersagt. 33 In dem vorliegenden Textstück des Yajurveda nun, in dem die menstruierende Frau in mythischer Begründung als 'Teil eines Brahmanenmordes' (brahmahatyii)34 dargestellt wird, und die nun die Farbe/Umhüllung ( var�a, womit auf das Kleid angespielt wird) des Brahmanenmordes trägt,35 findet sich zum ersten Mal eine Vorschrift, sich von der Gattin während dieser Periode fernzuhalten, wie dort auch gewisse Verhaltensregeln für die Frau nebst einer Schilderung der üblen Folgen bei Überschreitung derselben niedergelegt sind.36 Wichtig für unsere Fragestellung aber ist, daß dieses Textstück, welches im größeren Zusammenhang die Anwartschaft von Frauen auf eine Mitwirkung bei den Opfern erläutert, unzweifelhaft dem Topos Fruchtbarkeit und Empfängnis zugeordnet wird, wie sich aus dem einleitenden Teil (" ... erlangen die Frauen aus [ihrem] zur
fruchtbaren Periode gehörenden [Zeugungsstoff] Nachkommenschaft, nach Lust vereinigen sie sich [danach], bis sie gebären"37)
33 Einzelheiten bei SLAJE 1995. Die Thematik unter dem Aspekt abendländischen 'Verstehens' fremder Kulturen bei SLAJE 1998.
34 Nämlich des Mordes Indras an Visvarüpa, Tv�trs dreiköpfigem Sohn. Vgl. dazu SMITH 1991: 21; SLAJE 1995: l 13f; 136f
35 TS 2.5.1.6: brahmahatyayai hy e�a wirr.zaf!l pratimucyaste . . . 1- SLAJE 1995: 137, n. 66-67.
36 TS 2.5.1.6-7 (SLAJE 1995: 126ff). Zur Tabuisierung menstruierender Frauen vgl. GoNDA 1980: 20 l f.
37 Vgl. oben, Fn. 30. Gemeint ist, daß nach einer Empfängnis kein rtu mehr sichtbar wird, und alle weiteren Vereinigungen deshalb ausschließlich dem Lustgewinn dienen. Dieselbe Unterscheidung spiegelt sich ja im Grunde auch in den betreffenden Sästra-Kategorien wieder. Denn die Dharrna5ästras und Gfhyasütras erörtern nur die 'Zeugungsperiode', die Käma5ästras konsequenterweise nur die sich daran anschließende 'Lustperiode'. Vgl. SLAJE 1995: 135, n. 61.
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 1 15
und aus dem Schluß des Abschnitts, wonach die im Vorangehenden geschilderte dreinächtliche Observanz dem Schutz der (zu erzeugenden) Nachkommenschaft (prajiiyai gopfthiiya) diene, klar ergibt. Auch die spätere Tradition verbindet diesen Mythos ausdrücklich mit Fruchtbarkeit und Menstruation.38
Von einer Hochzeit ist hier jedoch nicht einmal andeutungsweise die Rede. Wir haben es vielmehr mit einer Vorstufe dessen zu tun, was in der späteren häuslichen Ritualliteratur als die vorschriftsmäßige Vereinigung während jeder fruchtbaren Periode, um
Nachkommenschaft zu erzeugen (,rtusarrzgamana), kodifiziert wiederkehrt. Festgehalten zu werden verdient, daß die drei Nächte hier in einen Zusammenhang mit Blut, und zwar mit dem Menstrualblut der Frau, gebracht erscheinen.39
Einige weitere, diesbezüglich aufschlußreiche Stellen werden in einer Upani�d des Weißen Yajurveda (BÄU 6.4) überliefert. In diesem Textstück,40 welchem in signifikanter Weise ein Zeugungsmythos ('Prajäpati') vorausgeschickt wird (BÄU 6.4.1-3), sind bereits eine größere Anzahl von Topoi, die von der Zeugung bis zur Geburt reichen, in ähnlicher Weise zusammengestellt, wie
38 VDhS 5.6-9. Vgl. SLAJE 1995: 120f 39 Auch im TB (3. 7.1.9) findet sich eine Vorschrift, die sich auf die frucht
bare, von der Menstruation eingeleitete Periode bezieht. Vgl. SMITH 1991: 23; SLAJE 1995: 121. Die Ansicht, daß eine Empfängnis nur utu-samaye möglich sei, auch im Buddhismus aufrechterhalten. Dazu sowie über die verschiedenen Möglichkeiten einer 'Fruchteinsetzung' (garbhädhäna � gabbhaf!l gar.zhati), vgl. Samantapäsädikä 213,30-214,30 (briefl. Mitteilung Dr. Ute Hüsken, 15.4.96; vgl. auch Fn. 67).
40 Zur Kategorisierung vgl. WEZLER 1993: 287.
1 16 WALTER SLAJE
sie später als sarrzskäras in den Grhyasütren eine systematischere Behandlung finden. Von einer dreitägigen Observanz ist hier ebenfalls die Rede, und zwar wiederum im Zusammenhang mit dem Beginn der 'fruchtbaren Periode' (ärtava), solange die Frau noch ihr ungewaschenes Kleid (ahataväsas)41 zum Zeichen des Andauems ihrer Menstruation trägt. Am Ende der dritten Nacht soll sie dann ein Bad nehmen, und danach kommt es, nachdem ein in der Pfanne fest gekochtes Reismus (sthälfpäka) geopfert wurde, zum Akt der Zeugung. Dies geschieht unter Hersagung von Mantren aus Atharvaveda (XIV 2,71) und �gveda (X 184,1-3), die sich allesamt42 ausdrücklich auf eine erhoffi:e Empfängnis beziehen (BÄU 6.4.13-22).
Das frühe Muster jener Riten, die später in den Grhyasütren Bezeichnungen wie rtusarrzgamana oder garbhädhäna tragen,43 und die eine Empfängnis unmittelbar nach der Menstruation sicherstellen sollen, ist hier mit Händen greifbar.44 Eine Hochzeit oder gar
41 So, nämlich im Sinne von 'ungeschlagen' = 'ungewaschen' im Lichte von TS (vgl. oben) und BÄU 6.4.6 zu interpretieren, wo von der Frau die Rede ist, die man zum Beischlaf auffordern soll: die, die ihr blutbeflecktes Kleid abgelegt hat (malodväsas). Dies aber bedeutet, daß die ersten Tage ihrer vom �enstrualblut charakterisierten, ersichtlich 'fruchtbaren' Zeit bereits vergangen smd.
42 Mit Ausnahme einer an RV X 85,21 angelehnten Stelle. 43 Fügungen wie garbhaf!l ./dhä werden in den verwendeten Mantren (RV
X 183, AV V 25 etc.) sowie in BÄU 6.4 wiederholt gebraucht. So dürfte auch der Name dieses saf!lskiira geprägt worden sein. Vgl. auch HDh 2,1: 202, n. 470.
44 Vgl. GONDA 1980: 366f, wo ebenfalls frühe Spuren von samskiiras in den Brähmai:ias aufgezeigt werden, sowie SMITH 1986: 80.
.
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 1 17
eine hochzeitliche Enthaltsamkeit wird hier ebensowenig wie im Y ajurveda erwähnt!
Damit kommen wir für die älteren vedischen Texte zunächst zu folgendem Befund:
Es liegen voneinander unabhängige Rituale vor, was auch anhand ihrer vorangestellten Mythen, die dabei rituell evoziert werden, deutlich wird. Dies sind
zur Hochzeit gehörig: 1.) im �gveda der nach dem Süryä-Mythos modellierte
Hochzeitszug (vahatu). Ob dabei vom Gewand der deflorierten Braut oder von einem Rind als Geschenk (viidhüya) die Rede ist, bleibt umstritten.
2.) Im Atharvaveda dasselbe, doch diesmal unter ritueller Lösung des Problems eines blutbefleckten Hüfttuches, dessen unerwünschte Wirkungen vom Priester aufgehoben werden sollen.
Zur Fruchtbarkeit/Zeugung gehörig: 1.) in der TS des Yajurveda ein nach dem 'Brahmanenmord
Mythos' modelliertes Menstruationsritual, welches mit einer diesem Mythos subsumierten Empfängnis-Sicherstellung in Zusammenhang gebracht wird. Erstmals werden drei enthaltsame Nächte sowie auch die Vorschrift genannt, die vierte Nacht für das Zeugungswerk zu nützen.
2.) In BÄU ein auf einem 'Prajäpati-Mythos' aufbauendes, primär der Zeugung dienendes Ritual, in welches sich jedoch auch die drei enthaltsamen Nächte während der Menstruation und der Beischlaf in der folgenden vierten Nacht integriert finden.
1 1 8 WALTER SLAJE
Die beiden erstgenannten, mit der Hochzeit befaßten Rituale aus IJ.gveda und Atharvaveda, wissen von einer enthaltsamen Periode noch nichts zu berichten. Demgegenüber wird eine solche Periode von den beiden letzteren, TS des Yajurveda und BÄU, im Kontext von Menstruation und Zeugung überliefert.
Was bisher nur unzulänglich getan wurde, nämlich gerade diese Fakten auseinanderzuhalten, scheint mir grundlegend zu sein für die nun folgenden Ausführungen, welche sich auf die zeitlich nächstjüngere Textgruppe richten, nämlich auf das Zeugnis der Gfhyasütren.
B. Das Zeugnis der Grhyasütren
In dieser Textschicht finden wir scheinbar ganz unvermittelt neue Verhältnisse vor. Denn darin stimmen plötzlich alle Sütren überein, daß zwischen Hochzeit und erstem Beischlaf eine unter Einschluß der dritten Nacht dreitägige - und insofern vielleicht genauer: dreinächtliche - Frist der Keuschheit zu beobachten sei. Das Beilager darf erst in der vierten Nacht erfolgen.45 Die Grhyasütren verwenden dafür den Begriff caturthfkarman ('Opferwerk der vierten [Nacht]'). Es sind diese Vorschriften, die man als 'Tobiasnächte' zu
45 Es wird daher - auch von einigen jener Sütren, die gewisse Abweichungen von diesem Zeitraum zulassen (des �gveda: ÄGS 1.8.!0f; Kau�GS 1.10.18; des l<f$i:i.a-Yajurveda: KGS 30.1; MGS 1.14.14; VGS 15.24) - als 'Opferwerk der vierten [Nacht]' (caturthlkarman) bezeichnet, was zeigt, daß diese Erweiterungen bzw. Verkürzungen den als Grundnorm geltenden drei Nächten später hinzugefügt worden waren. Vgl. Kau�GS 1.18.19: tririitram antata}J,. VGS 15.25: evam eva caturthyä'fl /q;tvä ... BGS 1.7.9-21 behandelt die längeren Fristen in einem mit BÄU verwandten Zusammenhang in einem eigenen Textstück.
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 1 1 9
bezeichnen und für die vedische Hochzeit schlechthin als konstitutiv darzustellen pflegt.46
Die Gfhyasütren unterscheiden allerdings eine weitere dreinächtliche Observanz, die ebenfalls in der vierten Nacht (caturthyii'!l riitrau) durch ein ritualisiertes Beilager beendet wird. Dieses wird konventionell zwar als ein sa,,,skära,47 d.i. eine '[zeremonielle] Präparierung [zur Risikominimierung beim Übergang in ein neues Lebensstadium]' unter uneinheitlichen Bezeichnungen wie nb;eka (Insemination), garbhädhäna (Empfängnis der Leibesfrucht) oder rtusa'!lgamana (Vereinigung während der 'fruchtbaren Periode') dargestellt, doch erst die spätere Dharma-Literatur sowie das jüngste aller Gfhyasütren (Vaikhänasa) sehen dieses Ritual explizit als einen solchen sa,,,skära an (ni$eka).48 Ein consensus omnium hinsichtlich der Abgrenzung der genannten sa,,,skäras voneinander bzw. hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit dem
46 Der erste, der auf die grundsätzliche Tatsache veränderter Verhältnisse in den Grhyasütren überzeugend aufinerksam machte, war m. W. MENSKI
( 1985). Er deutete diese neuen Verhältnisse als Reinterpretation des vedischen Jungfrauenbluttabus, und erklärte die Ursachen dafür so, daß die vedischen Priester ihre Rolle als rituelle Sündenböcke, die ihnen im Atharvaveda deutlich zukam, loszuwerden versuchten durch Uminterpretation bzw. Unterdrückung des Tabus in Gestalt von nicht geschlechtsreifen Bräuten ('Kindmädchenheirat'; dazu auch BHANDARKAR 1928: 538-602; THIEME 1963). Aber in den GSü wird der Vollzug doch in der vierten Nacht bereits in Erwartung von Nachkommenschaft vorgeschrieben [vgl. unten, Fn. 63 und 67]. Naheliegender scheint daher die Erklärung, daß der Gedanke, keine fiuchtbare Periode zu 'vergeuden' ( bhrül}ahatyä [dazu WEZLER 1994 ]), immer stärker in den Vordergrund trat. Vgl. dazu und zu iranischen Parallelen SCHMIDT 1987: 78-82.
47 Zur Geschichte des Begriffs KAPANI 1992-93; vgl. GONDA 1980: 199; 364ff; WEZLER 1993: 287, n. 27.
48 Vgl. HILLEBRANDT 1897: 41; GOPAL 1983: 255; 285.
120 WALTER SLNE
caturthtkarman findet sich schon in den indischen Quellen nicht und wurde auch von der Forschung nicht erreicht.49 Und damit kommt die hier durchgeführte Untersuchung zu ihrem eigentlichen Kern, nämlich der Frage, wie sich diese beiden textlich eng verwobenen Observanzen ganz gleicher Dauer eigentlich zueinander verhalten. Die Indologie wich diesem Problem zu jener Zeit, als das Studium der Gfhyasütren noch vom Impetus der Fragestellung bezüglich einer gemeinindogermanischen Vergangenheit beflügelt war, also vor allem im 19. Jh., aufgrund einer vielleicht allzu viktorianischen Gesinnung eher aus. Exemplarisch zeigt sich dies an jener wichtigen Stelle von BÄ U 6.4, die für die Klärung des vorliegenden Problems hilfreich ist, von deren Übersetzung und Behandlung aber - mit wenigen Ausnahmen - aus dem genannten Grund Abstand genommen wurde.50 In dieser zweiten von den Grhyasütren überlieferten Keuschheitsperiode nämlich liegt eine direkte Fortführung jener Handlungen vor, wie sie bereits im Yajurveda und in der BÄU zur Bewältigung des Menstruationsproblems zusammen mit der Erzielung erwünschter Nachkommenschaft gelehrt werden. Es handelt sich um den bereits genannten vorschriftsgemäßen ersten Verkehr mit der Gattin am vierten Tag nach Beginn ihrer 'fruchtbaren Periode' (rtu), wie man sie vom Einsetzen der Menses an zu berechnen pflegte.51
49 Vgl. HILLEBRANDT 1897: 68; HDh 2,1: 201-203; GOPAL 1983: 256f; GONDA 1956: [ l 98f]; 1980: 367f; 394ff.
50Vgl. WEZLER 1993: 286. BOEHTLINGK 1889 z.B. vermochte gewisse Abschnitte einfach "nicht wiederzugeben"; HDh 2, l: 202: " ... cannot be literally translated for reasons of decency".
51 Vgl. ÄpGS 3.8. l 2f: yadä ma/avadväsäb syäd ... 1 rqjasab prädurbhävät snätäm r;tusamävesan[e] ... 1; VKhGS 3.9: ... atha trirätram r;tau ma/avadväsäb . . . 1 ... rturätrayo dvädasa bhavanti, �o<jaseti cäca/cyate 1 prathamäs tisro na
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 121
Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Texten des (schwarzen und weißen) Y ajurveda mit bzw. ihr Fortwirken in den Textstücken zur Empfängnissicherung in den Gfhyasütren liegt auf der Hand. Nicht nur ist hier von der fruchtbaren Periode (rtu) explizit die Rede,52 sondern es wird die menstruierende Frau als 'fleckige Kleider tragend' (malavadväsas) ebenso erwähnt, wie auch - von den Gfhyasütren der Taittiriyas - auf die im Yajurveda (TS 2.5.1.Sft) für diesen Fall vorgeschriebenen dreitägigen Observanzen ausdrücklich verwiesen wird, über die der Gatte seine Frau zu instruieren habe.53 Diesen gemäß darf die Frau während dieser Zeit weder mit ihrem Mann sprechen, noch bei ihm sitzen, ihm kein Essen bereiten, nicht mit ihm verkehren. Sie darf auch nicht in den Wald oder an einen weit entfernten Ort gehen, sich nicht baden und danach einölen, nicht kämmen, schminken, die Zähne putzen, nicht die Nägel schneiden, nicht spinnen, kein Seil drehen, usw.54 Diese Textstücke werden gleichzeitig in den Kontext der Erzielung von Nachkommenschaft eingebunden,55 wodurch die
gamyäb 1- SLAJE 1995: 122 ff. 52 SGS 1.19; Kau$GS 1.12.l; KGS 30.4; MGS l .14.20; BGS l . 7.46;
VKhGS 3.9; PGS l. l l.7; KauthGS 7; KhGS l .5.15; GGS 2.5.8. JGS l.22; ÄGS 1.13.l verweist bezüglich der Empfängnislehre nur auf eine Upani�ad (- BÄU 6.4 ?): upani�adi garbha/ambhanam ...
53 BGS l.7.22ff; 37; BhGS l .20; ÄpGS 3.8.12; HGS l .24.7; VKhGS 3.9. 54 Vgl. hierzu TS 2.5.1.5-7 (SLAJE 1995: l37f), BÄU 6.4.13, die oben Fn.
53 zitierten Stellen der Taittiliya-Grhyasütren sowie WINTERNITZ 189 2: 92f. 55 Dies erfolgt explizit durch den Wortlaut der Sütren und/oder implizit
durch Verwendung von 'garbhädhäna'-Mantren, nämlich vor allem RV X 184 etc. Vgl. WINTERNITZ 1892: 93f. SGS l .19 und Kau$GS l.12.1-6: prajanayi$.)!amä�a- / Mantren; KGS 30.4 - MGS l .16-20 - VGS 16.1- 4: ... r;tau prajäkämau saT{lvisatab / Mantren; BGS l .7.37-46 - ÄpGS 3.8.13-9.l: pra-
122 WALTER SLAJE
Verwandtschaft mit den beiden älteren Texten (TS und BÄU), wo dieser Kontext ja erstmals deutlich zutage tritt, endgültig offenkundig wird. Zugleich bilden die während dieser Zeremonie verwendeten Sprüche (mantra) eine deutliche Demarkation, um diese Handlung gegen jene des caturthtkarman abzugrenzen. Denn das hier verwendete Spruchrepertoire bezieht sich unmißverständlich auf eine erfolgreiche Schwängerung bzw. Empfä.ngnis.56 Diese Verwandtschaft erstreckt sich aber auch auf den folgenden vierten Tag, wo nun in gleicher Weise ein Bad, das Reinigen des Körpers und der Zähne, das Anlegen von Schmuck und eines frischen Kleides vorgeschrieben werden. 57 In diesem Kleid hat die Frau sich dann zu ihrem Gatten zu begeben, für den dies dann das unmittelbare Signal für den pflichtgemäßen Verkehr in der Nacht desselben vierten sowie in den Nächten der folgenden geraden oder ungeraden Tage bis hin zum 16.Tag ist, und zwar abhängig davon, ein Kind welchen Geschlechts zu erzeugen gewünscht wird. 58 Die
jäni�sreyasam [!ugamanam ... ; BhGS 1 .20: Mantra / upasalflvisati; HGS 1 .24.8- 1 .25.4: .. . iti vfralfl haiva janayati; VKhGS 3 .9: ... pumän ... strf jäyate; PGS 1 . 1 1 .7; 1 3. 1 : ... yathartu pravesanam ... ;sä yadi garbhalfl na dadhfta . .. ; GGS 2.3.5.8-10: Mantren / sambhavata�; KhGS 1 .5 . 1 6: sambhaved garbham dhehfti; JGS 1 .22: Mantren / ity [läv [läv evam eva sa,,,vesane.
56 Derleiyoni- bzw. garbha-Sprüche, unter denen vor allem RV X 1 84 (vi$1JUr y6ni1f! kalpayatu, . .. ) durch bevorzugten Gebrauch hervorragt (z.B. yathä bhümir agnigarbhä ... evalfl garbhalfl dadhämi te ... ii te yonilfl garbha etu [A V III 23,2) ... etc.) finden sich dem Topos [tu subsumiert bei SGS 1 . 19 (dazu GoNDA 1 980: 300, n.6); Ka�GS 1 . 12 . 1 -6; BGS 1 .7.37-46; ÄpGS 3.8 . 12-3.9. 1 ; VKhGS 3.9; KGS 30.4; KauthGS 7; GGS 2.5.9; KhGS 1 .5 . 1 5f; JGS 1 .22.
57BhGS 1 .20; BGS 1 .7 .37; HGS 1 .24.8; VKhGS 3 .9; PGS 1 . 1 3 . 1 ; KauthGS 7 . Vgl. auch BÄU 6.4.6; 1 3 .
58 Zwölf Nächte, beginnend mit der vierten und daher mit der sechzehnten endend, werden als für eine Empfängnis grundsätzlich geeignet angeführt.
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 123
Unterlassung des Beischlafs in der von der Frau durch Anlegen des frischen Kleides als solche kenntlich gemachten vierten Nacht wird in den späteren Texten der Rechtsliteratur als schweres Vergehen des Mannes im Sinne eines Embryonenmordes ( bhrü!J.ahatya) bewertet, wie umgekehrt das AS die siebenmalige Unterdrückung dieses Signals durch die Gattin als Grund für eine Scheidungsmöglichkeit anführt.59
Das sind im wesentlichen die gemeinsamen Elemente, die jenen an den Menses ausgerichteten Zeugungsritus charakterisieren, der bereits im Yajurveda und in der BÄU zu beobachten ist.
Da nun der Hintergrund dieser Textstücke in den Grhyasütren mit den betreffenden Abschnitten im Yajurveda textgeschichtlich als verwandt und inhaltlich als Empfängnis-Gewährleistung bestimmt werden konnte, steht der Abgrenzung dieses Ritus gegen den Brauch des caturthfkarman60 bereits weniger im Wege. Wir können uns deshalb dieser Vorschrift über den ersten Beischlaf in der
Davon die Geradzahligen (mit der vierten beginnend) für die Erzeugung von Söhnen. Vgl. auch WINTERNITZ 1 892: 94f; GOPAL 1 983: 248f; HDh 2, 1 : 204f. [Nachtrag: vgl. nunmehr auch ZINKO 1 998.]
s9 WEZLER 1 99 1 : 801 f.
60Vgl. HDh 2, 1 : 1 95f; 202f; 441 ; 530. SCHMIDT 1 922: 5 1 9-52 1 . GONDA 1 980: 394. PANDEY 1 969: 222ff. GOPAL 1 983: 246f. Bemerkenswert die Darstellung Säyal).as (A VBh, Einleitung zu AV XIV, p. 1 534), der gemäß ein priesterlicher Offiziant den Ehevollzug begleitet. Damit wären - insofern man auch das Zeugnis der Mediziner ins Treffen führen kann (z.B. CarS, sär. 8,4-6; 1 5) - die diesbezüglichen Mutmaßungen von WINTERNITZ ( 1 892: 92) und DRESDEN ( 1941: 74f) zumindest für die Atharvan-Tradition bestätigt. Vgl. auch SLAJE 1 995: 1 27, n. 37.
124 WALTER SLAJE
vierten Nacht nach der eigentlichen Hochzeit61 zuwenden, dem ja die drei 'Tobiasnächte' vorangehen, die zeitlich allerdings vor den Gfhyasütren noch nirgendwo zu fassen sind.
Über die einzuhaltende Frist von drei Nächten sind sich, wie gesagt, alle Sütren einig. In Erweiterung62 dieses Zeitraumes empfehlen manche Texte jedoch, die Keuschheit länger auszuüben, nämlich sechs oder zwölf Nächte, zuweilen sogar ein ganzes Jahr.63
61 Gemäß Manu (8.227) erlangt die Ehe bereits Rechtsgültigkeit in dem Sinne, daß bei dem Tod des Gatten die Frau als Witwe anzusehen wäre, mit dem getanen siebten Schritt des Saptapadi-Rituals. Funktion und Wandel dieses Rituals bis in die neueste Zeit untersucht bei MENSKI 1989: 377-380 (vgl. auch Fn. 79). Der Vollzug durch Beischlaf ist keinesfalls ehebegründend, sondern bloß Bestandteil ehelicher Zeugungspflicht.
62 Daß es sich hier um eine Abweichung von der generellen Regel handelt, zeigt sich am weiterhin beibehaltenen Terminus caturthikarman. Vgl. oben Fn. 45.
63 ÄGS 1.8.1 l f: trirätra'!l dvädasarätram II saf!1vatsara'!l vä ... II; Ka�GS l . l 0.18: saf!Zvatsaraf!l na mithunam upeyätäf!I dvädasarätraf!Z :ja<f,rätram II; KGS 30. l : saf!1vatsaraf!1 brahmacaryaf!l carato d�ädasa rätrfl; !faf tisra ekäf!l vä II - MGS 1.14.14-VGS 15.24. Die von den drei letzteren Sütren genannte Alternative von nur einer einzigen Keuschheitsnacht begründen die Kommentatoren, indem sie ein volles Jahr als erste Alternative ansehen, mit einem Übermaß an jugendlichem Verlangen (vgl. Devapäla und Ädityadar8ana ad KGS 30.l ). Solche Verkürzungen gibt es ja auch öfters im Srauta-Ritual, gegründet auf die Identifikation mit Zahlen. Baudhäyana bringt die erstreckten Fristen in einen Zusammenhang mit der Erzeugung von solchem Nachwuchs, der für ein V edastudium in gesteigertem Maße befähigt ist (BGS l . 7. 9ff: atha yadi kämayeta srotriyaf!l janayeyam ... trirätram ... brahmacäri�äv äsäte; ... anücänaf!l ... dvädasarätram ... ; f!fikalpaf!l ... mäsam . .. ;etc. Vgl. auch ÄGS l . l 0.1 l: .. . f!fir jäyata iti. ). Das reicht vom gewöhnlichen V edagelehrten (srotriya), der eine Säkhä beherrscht, über stets hervorragendere Gelehrte (anücäna, f!fikalpa, bhrü�a, f!fi) bis zu einem deva, der mehr als sogar die vier Veden kennt (BGS l .7.3-8. Vgl. WINTERNITZ 1892: 86f.). Am Rande wäre zu
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 125
In diesen drei Nächten also muß das Brautpaar gemeinsam auf dem Boden schlafen und dabei Keuschheit beobachten. 64 Dies ist das Grundmuster, wonach das Paar während dieser Zeit auch weder gesalzene noch gewürzte Speisen zu sich nehmen darf.65 Nach manchen Quellen legen beide zudem noch Schmuck an und tragen schöne Kleider.66 Gemäß ÄpGS und BGS muß ein Stab aus Udum
bemerken, daß Baudhäyana dies in einem gesonderten Textstück überliefert, welches, insofern es die Fähigkeit zum V edastudium zu beeinflussen lehrt, an BÄU ( 6.4.14-18) erinnert ("preconceptional or prenatal determination of one' s children's qualities", WEZLER 1993: 287. Anders als die CJrhyasütren lehrt BÄU diese Beeinflussung jedoch durch eine spezifische Nahrungsaufnahme. Berührungspunkte mit der altindischen Medizin bei WEZLER 1993: 295ff.). Hinweise darauf, daß die Braut eventuell noch zu jung, d.h. noch gar nicht empfängnisfähig sei, fehlen jedoch. Bhavaträta (ad Ka�GS 1.10.18) diskutiert das Problem mit Hinblick auf die Frage, ob ein vorgeschriebener Verkehr zur fruchtbaren Zeit ([tu) das (z.B. einjährige) brahmacärya überhaupt unterbreche (dazu Kau�GS 3.11.48). Auch bei Näräyai:ia (ad ÄGS 1.8. l l f) findet sich nichts dergleichen, im Gegenteil. Er berichtet doch (ad ÄGS 1.7.2), daß in gewissen Regionen Videhas die Ehe sogleich nach der Hochzeit vollzogen werde (vgl. oben, Fn. 6). Nur Bhattanäräyai:ia thematisiert (ad GGS 2.5. 7-8) tatsächlich die Frage, ob mit Bräuten noch ohne entwickelte Schambehaarung bereits geschlechtlich verkehrt werden solle. Vgl. dazu SLAJE 1995: 129, n. 46.
64 KGS 30.l -MGS l .14.14-VGS 15.24; BGS 15.16. 65 ÄpGS 3.8.8: trirätram ubhayor adhaf:zSayyä brahmacarya'!l /cyärala
va�avmjanaf!l ca. Damit in sachlicher Übereinstimmung ÄGS 1.8. l O; Kau�GS l .10.15; BhGS l .15; GGS 2.3.15; JGS 1.22. So übrigens auch KämS III 2,1. Das die Nahrung betreffende und wohl auf der Ansicht beruhende Verbot, daß Salz und Gewürze den Sexualtrieb fürderten, ist eine Keuschheitsgelübde auch anderswo begleitende Maßnahme z.B. in Todesfällen und bei der Schülerweihe (unten, Fn. 79), und von daher als die Enthaltung begleitend anzusehen. Vgl. GONDA 1980: 336.
66 ÄGS 1.8.10: a/af!lkurvä�au ... -HGS 1.23.10; BGS 1.5.29; VKhGS 3.8: ... dhautavastravratacäri�au ... Ob dies mit den 'auspicious signs/ substances
126 WALTER SLNE
bara-Holz zwischen dem Paar liegen.67 Ein Sütra schließlich schreibt den Verzehr von gekochtem Reis und Sauermilch sowie ein morgendliches und abendliches Umwandeln des Hochzeitsfeuers vor.68
Als angemessene Zeit für den ersten Beischlaf wird häufig die zweite Hälfte der vierten Nacht ( caturthyäm apararätre) genannt. 69 Dieser Handlung geht jedoch eine rituell von der Gattin zubereitete70 und gemeinsam eingenommene Mahlzeit (sthälfpäka) voran. Die ganze, von dieser ersten gemeinsamen Mahlzeit des neuen Haushalts charakterisierte Begehung wird durch den sthiilfpäka zu einem formalen Gfhya-Opfer (päkayajna71 ). Dem schließt sich allerdings eine bemerkenswert neue Sinnzuweisung als
as precaution against this fear of unseen diseases .. .' (MENSKI 1 99 1 : 57) zusammenhängt? Dazu auch GoNDA 1980: 266. Die Parallele zu dem Schmuck der vierten Nacht ;tau ist jedenfalls auffällig!
67 ÄpGS 3.8.9; BGS 1 .5 . 1 7. Vgl. dazu WINTERNITZ 1 892: 88f. Zum lebenskräftigen Symbolismus des udumbara (Ficus glomerata) vgl. GoNDA 1 980: 109; MINKOWSKI 1 989; SYED 1 990: 1 32ff. EWAia I,3 : 2 1 7. Der Stab des milchigen Saft enthaltenden Baumes wurde von MEYER 1 937(3): 1 92fphallisch gedeutet. Der Baum trägt dreimal jährlich zahlreich rote Früchte! In signifikanter Weise werden dann auch beim Brauch des slmantonnayana der Schwangeren unreife Udumbara-Früchte umgebunden (GONDA 1 956: [ 187]). Frau Dr. Ute Hüsken (Göttingen) verdanke ich den Hinweis (brieft. , 29.1 .96), daß gemäß Samantapäsädikä (932, 15- 17) ad Vin IV 289 auch buddhistische Nonnen beim Schlafen durch z.B. einen zwischen sie gelegten Stab getrennt lagen. Ob hier brahmanisches Ritual das Modell war? Übernahmen sind nicht auszuschließen, vgl. oben Fn. 39 und VON HINÜBER 1996: 1 12 (nebst n. 32).
68 SGS 1 . 1 7.
69 BhGS 1 . 1 9 - ÄpGS 3.8. 10 - HGS 1 .23. 1 1 - VKhGS 3.8 - PGS 1 . 1 1 . 1 .
70 WINTERNITZ 1 892: 79f. 71 Dazu SMITH 1 986: 84.
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 127
präyaicitta an, insofern nämlich nacheinander Göttern (Agni, Väyu, Sürya, etc.) mit der Aufforderung gespendet wird, nun diese Wesenheit in der Braut zu bannen, die den Gatten, die Nachkommenschaft und das Vieh etc. schädigt!72 Mit Ausnahme des Äsvaläyana-, des Äpastambiya- sowie von drei Sütren des Schwarzen Y ajurveda, die dem ritualisierten Geschlechtsverkehr nur eine Wechselrede des Paares vorangehen lassen, 73 schreiben alle GSü diese präyascittas an dieser Stelle vor. Darauf folgt das Beilager, von den drei genannten Texten des Yajurveda bis zur
Ejakulation im Detail präskriptiv ( ! ) geschildert. Es finden sich sogar Spruch-Vorschriften für den Fall, daß die Braut bei der deflorierenden Penetration weinen sollte. 74
72 Z.B. SGS 1 . 1 8: sthälipäkasya juhoti. agne ... väyo . .. sürya ... präyascittir asi ... patighni / aputriyä / apasavyä ... tanü}J. yasyä}J., täm asyä apa Jahi. - Ka�GS 1 . 1 1 . 1 -5 - BGS 1 .6 . 1 - 10; 12ff- BhGS 1 . 1 9 - HGS 1 .23. 1 1 - 1 .24. 1 - VKhGS 3.8 - PGS 1 . 1 1 . 1 -4 - GGS 2.5 . 1 -2 - KhGS 1 .4 . 12 - JGS l.22. Vgl. auch ÄgGS 1 .5.5; 6.3.
73 - RV X 1 83. Vgl. WINTERNITZ 1 892: 90; DRESDEN 1 941 : 74f. Es sind dies die zu den ältesten Säkhäs des Yajurveda gehörigen Sütren KGS 30.2-3 -MGS 1 . 1 6-20 - VGS 1 6. 1-4. Ob diese Säkhäs textlich etwa noch eine striktere Trennung beobachteten? Immerhin handelt es sich bei den ältesten Texten, die ein Menstruationsritual überliefern, auch um dem Yajurveda zugehörige (TS, TB, BÄU).
74 BGS l .6.25f: athäsyäs tokoti'!I vivr:wti prajäyai tvä iti II sä yady asru kuryät täm anumantrayate . . . [- RV X 40, 1 0] I I - Es handelt sich um denselben Vers ("Die Lebende beweinend .. . "), den der Bräutigam anläßlich des zeremoniellen Weinens der Braut bei ihrer Abreise vom väterlichen Heim zu sprechen hat (WINTERNITZ 1 892: 42f; GONDA 1 980: 3 1 5). Daß Bodhäyana an dieser Stelle ebenfalls ein rituelles Weinen vorschreibt, ist unwahrscheinlich. Vielmehr dürfte dem als unheilvoll angesehenen Tränenfluß ein apotropäisch wirksamer, euphemistisch formulierter Spruch, der anderswo ja bereits in Verwendung stand, entgegengesetzt worden sein.
128 WALTER SLNE
Man wird, und zwar aufgrund des Inhaltes dieser präyascittas und aufgrund der Tatsache, daß ÄGS und ÄpGS, die diese präyascittas nicht, aber dafür die Vorschrift überliefern, das Hüfttuch einem Kenner des Süryä-Liedes zu übergeben,75 hier doch unmittelbar und ganz unzweideutig an das Brautnachtsgeschehen im A V erinnert. Dort wurde ja ebenfalls mit Hilfe eines präyascitta, und zwar in Form einer Rezitation des Süryä-Liedes, die von der Defloration ausgehende Bedrohung gebannt.
Da somit die Voraussetzung geschaffen ist, die beiden Riten des caturthlkarman und des r,tusa.,,,gamana sicherer auseinanderzuhalten, läßt sich die historische Filiation der betreffenden Textstücke bereits deutlicher vor Augen führen: Wie nämlich der r,tusa'!lgamana-Ritus eine Fortführung dessen ist, was in der TS des Yajurveda im Zusammenhang mit der fruchtbaren Periode (.rtu) der Frauen beschrieben wurde, und zwar einschließlich der drei Menstruationsnächte, so ist das caturthlkarman im selben Maße eng an die im Atharvaveda geschilderte Hochzeitsnacht gebunden. Dies jedoch mit einem markanten Unterschied: die drei Tobiasnächte fehlen im Veda, und zudem ist ein Verantwortungstransfer76 vom Priester auf den Bräutigam zu konstatieren, da in der Sütraperiode nun letzterer das Bannungs-präyascitta vollzieht.
Man kann nun nach den Gründen für die Enthaltsamkeit fragen. Läßt sich denn ein Grund für eine dreitägige Enthaltsamkeit nach der Hochzeit anführen? Bislang war das - von Vermutungen wie
75 ÄGS 1 . 8 . 12 : caritavratal:z süryävide vadhüvastrarrz dadyiit; - ÄpGS 3. 9 . 1 1 . Vgl. ferner Kaus 79 .20ff.
76 Vgl. MENSKI 1 991 : 63.
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 129
z.B. Dämonenfurcht abgesehen77 - nicht der Fall. Ist es aber nicht so, daß die Enthaltsamkeit während der Menses wegen des Blutflusses ohnehin nahelag? Und historisch betrachtet wird man, weil neben dem Vorliegen des biologischen Grundes auch alle Hinweise auf die Praxis eines caturthlkarman in den älteren Texten überhaupt fehlen, davon auszugehen haben, daß die rituelle Auseinandersetzung mit der weiblichen fruchtbaren Periode ([tu), die von einem magisch gefährlichen Blutfluß und einziger Möglichkeit der Erzeugung erwünschter Nachkommenschaft charakterisiert war, all das also, was bereits im Y ajurveda und BÄ U unter Einschluß von dreitägigen Observanzen überliefert und später von den CJrhyasütren unter derselben Vorschrift als rtusa,,,gamana bzw. garbhädhäna vorgeschrieben wird, doch wesentlich älter sein müsse als die unmittelbar an die Hochzeit sich anschließenden 'Tobiasnächte', für deren Vorhandensein vorläufig gute Gründe zu fehlen scheinen. Und noch etwas spricht für die relative Ursprünglichkeit des rtusa.,,,gamana-Ritus. Diesem nämlich wird in BÄU ein eigener Mythos vorangestellt, wodurch - bei aller wegen der Frage nach einem eindeutigen Verhältnis zwischen Mythos und Ritual walten zu lassender Vorsicht - die rituelle Komplettierung jedenfalls gegeben ist. Gleiches gilt auch für das Menstruationsritual im Y ajurveda. Kein Mythos ist uns demgegenüber für das caturthlkarman der Hochzeit überliefert.
Man rufe sich nun nochmals in Erinnerung, daß das Süryäsükta - im �gveda vielleicht, im Atharvaveda dann aber gewiß - die Bannung der magischen Gefahren des jungfräulichen, in der Hochzeitsnacht durch Defloration vergossenen und am Brautgewand sichtbar werdenden Blutes enthält. Die Bannung der damit
77 Vgl. oben, Fn. 8-9.
130 WALTER SLNE
verbundenen Gefahr erfolgte dort durch Weitergabe des befleckten Hüfttuches an einen Priester, der sich aber einem schützenden priiyaicitta unterzog. Es wäre nun doch mehr als befremdlich, wenn das Problem des jungfräulichen Blutes, das ja im Grunde bei jeder Eheschließung78 zu bewältigen gewesen war, nun plötzlich - wie es in den Ritualhandbüchern der Fall zu sein scheint - überhaupt nicht mehr behandelt würde. Denn in der Tat fehlt in den CJrhyasütren eine explizite Bezugnahme auf die blutigen Folgen der Defloration! Stattdessen schreiben sie die drei 'Tobiasnächte' vor und überantworten dem Bräutigam die Durchführung von priiyaicittas.
Die Erklärung, die ich hierfür anzubieten habe, lautet, daß die spätere Tradition in diesem Fall der Gefahr des Deflorationsblutes ein bereits vorhandenes, der Bewältigung von weiblichem Blut und der Empfängnissicherung dienendes Ritual entgegensetzte, nämlich das fertig ausgebildete Modell des [tusa'!lgamana. Dieses konnte als ein geeignetes rituelles Versatzstück deshalb in das Hochzeitsritual eingebaut werden, weil sich ja dieselben Probleme, Blut und Empfängnis, auch in der Hochzeitsnacht stellten.
Die 'Tobiasnächte' halte ich daher im Grunde für eine rituelle Nachahmung der drei als Brauch viel älteren, enthaltsam zu verbringenden Menstruationsnächte. Nachgeahmt symbolisieren sie ja einen Blutfluß und nehmen damit den der Defloration gewissermaßen vorweg. Und daran schließen die Bannungs-priiyascittas sich an, die ja unmittelbar nach diesen drei Nächten ganz so zu vollziehen sind, als müsse man nun die Folgen einer Defloration tilgen. Im Atharvaveda unterzog der Priester sich dieser Zeremonie ja erst nach der Defloration. Durch dieses Vorschalten des [tusa'J'lgamana-
78 Zur Virginität als vorauszusetzendem Normalfall vgl. THIEME 1 963.
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 13 1
Modells vor die eigentliche Hochzeitsnacht erzielten die Grhyasütren in ihrer Epoche aber nicht nur die Bannung schädlicher Wirkungen des jungfräulichen (anstelle des Menstrual-) Blutes, sondern zugleich auch alle positiven Konsequenzen einer erfolgreichen Empfängnis.
Eine solche Fusion zweier ursprünglich getrennter Rituale (Fruchtbarkeit/Menstruation - Deflorationlpriiyascitta) wäre m. E. zureichend zur Erklärung des unvermittelten Auftretens des caturthikarman bei gleichzeitiger Unterdrückung von expliziten Bezugnahmen auf die Defloration, gewissermaßen die brahmaniSche Art, die Tatsache einer Defloration zu verdecken.
Das Herausnehmen einzelner Elemente aus dem oft kompliziert verschachtelten Bau indischer Rituale und der zuweilen modifizierte Wiedereinbau solcher Elemente in andere Ritualteile ist aus dem Srauta-Ritual, wo es als 'Baukastensystem' für die Bildung neuer Rituale dient, seit HILLEBRANDT hinlänglich bekannt. Verwandte Beobachtungen liegen auch für die häuslichen Rituale vor.79 Weitere, noch unbekannte Kombinationen ritueller
79 Und zwar u.a. für den Ritus der saptapadi, der sieben Hochzeitsschritte, ursprünglich (vgl. RV X 8,4) der zur Besiegelung von Vertragsworten getane 'Siebenschritt'. Gemäß MENSKI ( 1989: 375ff: Im BGS rituelle Übergangsform, im ÄGS Fortsetzung des Funktionswandels aus BGS) handelt es sich hierbei um eine spätvedische Weiterentwicklung, die durch 'Fusion mehrerer ritueller Versatzstücke' zum Ausbau des klassischen Hochzeitsrituals erreicht wurde. Vgl. auch oben (Fn. 74), wo in der Maßnahme gegen die Folgen des Weinens der Braut bei der Defloration ein verwandter Fall des Einbaus vorhandener Ritualteile vorliegen dürfte. Ich verweise auch noch auf die Vorschrift für einen Brahmacärin (HDh 2, 1 : 304 f), sich nach dem upanayana drei Nächte (oder auch mehr) ganz so wie ein fiisch vermähltes Paar in den Tobiasnächten zu verhalten (Speise ohne Salz und Gewürze, am Boden Schlafen, Keuschheit beobachten, vgl. oben Fn. 65). Wenn dann am vierten Tag sogar ein medhäjanana (Ver-
111' 1 . 1!
r 1·1 · · 1 ' ' · 132 WALTER SLAJE
Versatzstücke sind daher keineswegs auszuschließen, 80 und ich denke, daß die hier aufgenommene Spur vielversprechend sein könnte.81 Dies nicht zuletzt auch unter dem Aspekt, daß sich möglicherweise ältere Symbolismen und Handlungen aus der Zeit vor der Ausbildung der 'Tobiasnächte', die nicht aufgegeben wurden, in anderen, die Hochzeit immer noch begleitenden Riten erhalten haben. Auf sie ist im Augenblick jedoch, weil dies nämlich noch genauerer Untersuchungen bedarf, nicht einzugehen.
Das Fazit der vorangegangenen Ausführungen? - Insofern, als -und aufgrund dessen, wie - sie sich allein aus der indischen
standeserzeugung) durchgeführt wird, das sonst Bestandteil desjätakarman ist, wird klar, daß hier nicht nur eine zweite Geburt rituell nachgeahmt wird, sondern - durch Übernahme des Versatzstückes 'drei Nächte' - sogar die Zeugung selbst! Vgl. auch CALAND 1 898.
80 MENSKI 1 989: 379. 81 Die Zeugungs-Vorschriften sind in den Grhyasütren textlich mit den
'Hochzeitsnächten' zuweilen derart verflochten, daß man - besonders bei den Sütren des Yajurveda - den Eindruck von Exkursen gewinnt. Die Eingliederung hier im einzelnen zu untersuchen und darzustellen würde am augenblicklichen Ziel, das Verhältnis der Sütren zur älteren vedischen Überlieferung genauer zu bestimmen, vorbeiführen. Doch generell läßt sich sagen, daß drei textlich in sich geschlossene Gruppen unterscheidbar sind, was für die Untersuchung der relativen Chronologie sowie der Schichtung der einzelnen Sütren hilfreich sein mag: die erste - gebildet von Sütren des �gveda (SOS 1 . 19; Ka�GS 1 . 12 . 1 ) und des SV (GGS 2.5.7f; KhGS l .5 . 15f) - lehrt ohne modale oder konditionale Unterordnung das Verhalten rtukäle. Die zweite, nämlich Käthakas und Maiträyai:iiyas des Yajurveda (KGS 30.4; MGS 1 . 14.20), schließen an die drei Keuschheitsnächte der Hochzeit die Empfängnissicherung modal an: 'In derselben Weise .. . ' . Und die dritte schließlich, ausschließlich Taittiriyas des Yajurveda (ÄpGS 3.8. 1 2; BGS 1 .7.22; BhGS 1 .20), tut dies mit einer konditionalen Verschränkung: 'Wenn .. . ' .
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 133
Überlieferung erklären lassen, dürften die sog. 'Tobiasnächte' nicht nur kein alter gemeinindogermanischer Brauch sein, sondern es wird sich bei ihnen um ein vergleichsweise junges Ritual handeln, welches erst sekundär in Analogie zu den Menstruations- und Fruchtbarkeitsriten in das Hochzeitsritual integriert wurde.
Natürlich ist auch nicht auszuschließen, daß u. U. RV X 85,40-41 und A V XIV 2,2-4 mit der Dreinächtefrist maßgeblich zusammenhängen. 82 Denn diesen Stellen zufolge gehörte die Braut vor ihrer Verheiratung nacheinander den drei göttlichen Gatten Soma, Gandharva [Visvävasu] und Agni an, und erst danach - als viertem - einem menschlichen. Bei einer solchen Herstellung von Bezügen ist aber Vorsicht angebracht, denn zum einen wird immer nur der Gandharva - der zweite also in der Reihe der göttlichen Liebhaber - aufgefordert, die Braut dem menschlichen Gatten zu überlassen,83 zum andern aber verwenden die GSü diese Aufforderung rituell nicht während des eigentlichen caturthfkarman, sondern im Rahmen der 'Befruchtung' (garbhädhana), also im Zusammenhang mit der 'fruchtbaren Periode' (rtu) der Frau.84 Wenn
82 KIRSTE 1 892: 1 75; ÜONDA 1 956: [ 1 90]; 1 964/65: 8f; 1 2f; THIEME 1 963: 433f; 465. Zuletzt KUIPER ( 1 996: 241 -252): "The three nights when the bride is under the custody ofVisvavasu [ . . . ] are paralleled by the three nights which the Soma plant spends under the care of the Gandharva(s). The two parallel cases confirm the conclusion that the Vedic 'Tobiasnächte' involved a kind of quarantine [ . . . ] in order to divest the bride and Soma oftheir inauspicious nature." (S. 252). [Nachtrag: jetzt auch ÜBERLIES 1 998: 3 1 7, n. 8 1 6.]
83 RV X 85,20-2 1 ; AV XIV 2,33; vgl. auch MEYER 1 97 1 : 31 l fund TS VI J ,6.43: strfkämä vai gandharva}:i. Hier steht der Gandharva Visvavasu in Rede. Verdächtig, daß in diesem Abschnitt auch Soma und Agni erscheinen. Er könnte demnach bei dem Versuch einer Klärung der Rolle dieser drei Liebhaber von Bedeutung sein.
84 Vgl. SOS 1 . 19; Kau1>GS 1 . 12. 1 ; BGS l .6.22ff; BÄU 6.4. 1 9.
111. 1 .• r 111 : : ! 1 1 , 1 ! ,' I 1 ''
1
1 34 WALTER SLAJE
hier tatsächlich eine tiefere Beziehung bestehen sollte, dann wohl eher zum Topos 'Fruchtbarkeit/Menstruation'. Was nun die auf den ersten Blick bestechende These V ASILKOVs85 angeht, wonach die unverheiratete männliche Jugend des Kriegerstandes die gesellschaftliche Wirklichkeit zu den mythischen Gandharven dargestellt habe, so wäre folgendes zu bedenken: V ASILKOV, der annimmt, daß die jungen Männer von Mädchen (nagnikä) in der Sabha initiiert wurden und zu diesen bis zur Verheiratung freie sexuelle Beziehungen unterhielten, berücksichtigt nämlich nicht das sich dann auftuende Problem der Virginität.86 Es erhebt sich bei dieser These ja doch die Frage, woher die nagnikiis denn stammten, und von wem sie dann später - und vor allem auch an wen -verheiratet werden konnten!
Nicht eingegangen wurde in dieser Untersuchung auf Zusammenhänge mit möglichen vorklassischen Ritualstrukturen. Dazu nur soviel: Unter der Voraussetzung der eben demonstrierten, offenkundigen Verbindung von Hochzeit und Menstruation drängt sich auch die Frage auf, ob die drei Nächte nicht ursprünglich etwa eine Art von weiblicher Initiation (Bewältigung der ersten Menstruation) darstellten. Das Feuer des neuen Haushalts, das doch die Grundlage für die Srauta- und Totenfeuer des Gatten bildet, stammt immerhin aus der weiblichen Linie, denn es wird bei der Hochzeit (vaiviihikiigni) aus dem Haushalt der Brauteltern gewonnen.87 Es schiene demnach nicht undenkbar, daß zusammen mit der artifiziell-mechanistisch gelösten Überführung der Frau in
85 1 989/90: 395ff. 86 Oben, Fn. 78. 87 Vgl. HEESTERMAN 1 983: 79f.
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 135
die eigene Patrilinie auch ihre dreinächtliche Initiation (wenn es sie denn gab) rituell mitüberführt und umgebaut wurde.
Und schließlich mußte auch die Frage nach dem Fortleben der 'Tobiasnächte' in der Gegenwart offengelassen werden. Gedruckte Berichte aus der jüngeren Vergangenheit bestätigen zumindest die dreitägige Menstruations-Seklusion von Frauen Südindiens.88 Das caturthfkarman aber soll - den indischen Autoren KANE, PANDEY
und GOPAL zufolge - nun nicht mehr praktiziert werden. Allerdings dürften auch die Ritualhandbücher, die ursprünglich vor der Hausstandsgriindung - also noch während der Schülerzeit -studiert wurden, ihre soziale Funktion auf diesem besonderen Gebiet nun doch weitestgehend eingebüßt haben. Man wird sich diese Funktion so zu denken haben, daß die Grhyasütren da eine Sicherheit zu bewirken vermochten, wo ein unerfahrenes junges Paar, dem zuvor keine Gelegenheit sich näherzukommen geboten worden war, sich doch völlig hilf- und führerlos89 fühlen mußte. Ein bis in alle Einzelheiten genau vorgegebenes rituelles Verfahren konnte diese Unsicherheiten vermutlich weitgehend beseitigen und eine angemessene Bewältigung gewährleisten. Daß aber die Umstände später einen tiefgreifenden Wandel erfuhren, läßt sich u.a. daran erkennen, daß z.B. der Ehevollzug erst anläßlich der 'zweiten' Hochzeit (punarviviiha, bezeichnenderweise auch garbhiidhiina genannt), wenn die Frau ein gebärfähiges Alter erreicht hatte, erfolgte.
88 DUBOIS 1 906: 708f(Beobachtungen aus den Jahren 1 792-1823); BoULNOIS 1 939: 29 (Beobachtungen aus den Dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts).
89 Eine Ausnahme bildet allerdings die Atharvan-Tradition, zu der auch die medizinischen Sästras in enger Beziehung stehen. Dort diente ein priesterlicher Offiziant als Anleiter und Zeuge des ersten Beischlafs. Vgl. oben Fn. 60.
136
Bibliographie
A. Texte
ÄGS
ÄgGS
AH
ÄpGS
AV BÄU
BGS
BhGS
CarS
GGS
WALTER SLNE
(ÄSvaläyanagrhyasütra, RV). Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch hrsg. V. ADOLF FRIEDRICH STENZLER. 1 . Äsvaläyana. 1 . Heft. Text. [Abhandlungen der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 3,4.] Leipzig 1 864. (Ägnivesyagrhyasütra, YV: Vädhülas). Ed. by L.A. RAVI
V ARMA. [Trivandrum Sanskrit Ser. 144 = Sri Chitrodayamanjari. 33 = Univ. Ser. 2.] Trivandrum 1 940. A#iingahrdayam (I'he core of octopartite Äyurveda) composed by Viigbhafa. „ . Ed. by HARISÄSTRI PARÄKARA V AIDYA. 7. ed. [Jaikrishnadas Ayurveda Ser. 52.] Varanasi 1 982. (Äpastambiyagrhyasütra, YV: Taittirtyas). The .Äpastambfya G[ihyasütra with extracts from the comm. of Haradatta and Sudarsaniirya. Ed. by M. WINTERNITZ.
Vienna 1 887. (Atharvaveda, Saunaka). Brhadärll!J.yaka-Upani�ad. In: Eighteen Principal Upani�ads. Ed. by V.P. LIMAYE, R.D. VADEKAR. Vol. 1 . Poona 1 958. (Bodhäyanagrhyasütra, YV: Taittirtyas). Ed. by R. SHAMA
SASTRI. [Univ. of Mysore. Oriental Library Publ. Sanskrit Ser. 55.] Mysore 1 920. (Bhäradväjagrhyasütra, YV: Taittirtyas). Het hindoesche huisritueel volgens de school van Bhäradväja. „ . HENRIETTE
JOHANNA WILHELMINA SALOMONS. Leiden 1 9 1 3. Carakasa,,,hitii mahar�i1Jii bhagavatiignivesena pra1;iftii mahiimuninii carakelJa pratisa,,,s/q'tii. Srijayadevavidyiilankiiref}a prat:iftayii tantriirthadfpikiikhyayii hindfvyiikhyayii {ippa!Jyii ca samanvitii. 1 . bhägal;t. 9. saipskarll!J.a, punarmudraQa. Dilli 1 979. (Gobhilagrhyasütra, SV: Kauthumas). Das Gobhilagrhyasütra. Hrsg. u. übers. V. FRIEDRICH KNAUER. 1 . Heft. Text (nebst Einl.). Dorpat 1 884.
HGS
JGS
KimS
Kau�GS
KauthGS
KGS KbGS
Kaus
MBh
MGS
PGS
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 1 37
id„ With BhattanäräyaQa's comm. crit. ed. „. by CHINTAMANI BHATTACHARYA. [Calcutta Sanskrit Ser. 1 7.] Calcutta 1 936. (Hifll!J.yakesigrhyasütra, YV: Taittirtyas). The G[ihyasütra of Hirat:iyakesin with extracts from the comm. of Miitridatta. Ed. by J. KIRSTE. Vienna 1 889. (Jai�inigrhyasütra, SV: Jaiminiyas). The Jaiminigrhyasütra belonging to the Siimaveda. With extracts from the comm. ed. with an introd. and transl. into Engl. by W. CALAND. Reprint. Delhi 1 99 1 . (Kämasütra). Th e Kiimasütram of Sri Viits('iiyana Muni. With the Jayamangalii Sanskrit comm. of Srf Yasodhara. Ed. with Hindi comm. by SRI DEVDUTIA SASTRI. 4. ed. [The Kashi Sanskrit Ser. 29.] Varanasi 1 992. (Kau�Itakagrhyasütra, RV). With the comm. of Bhavaträta. Ed. by T.R. CHINTAMANI. [Panini Vaidika Granthamala. 7.] New Delhi 1 982. (Kauthumagrhyasütra, SV: Kauthumas). Ed. with introd„ notes and indices by SORY AKÄNTA [Bibliotheca Indica. 279]. Calcutta 1 956. (Käthakagrhyasütra, YV: Carakas ). (Khädiragrhyasütra, SV: RäQäyaniyas). The Khadira Grihyasutra with the comm. of Rudraskanda. Ed. by A. MAHADEVA SASTRI and L. SRINIVASACHARY A. [Government Oriental Library Ser. Bibliotheca Sanskrita. 4 1 .] Mysore 1 9 1 3. (Kausikasütra, A V). The Kiiu<;ika-Sütra of the AtharvaVeda. With extractsfrom the comm. ofDiirila and Kesava. Ed. by MAURICE BLOOMFIELD, in: JAOS 1 4 ( 1 890). The Mahiibhiirata. Text as constituted in its critical edition. Vol. 2. Poona 1 972. (Mänavagrhyasütra, YV: Maiträyll!J.iyas). Das MiinavaGrhya-Sütra nebst Komm. in kurzer Fassung. Hrsg. v. FRIEDRICH KNAUER. St. Petersburg 1 897. (Päraskaragrhyasütra, Sukla-YV). Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch hrsg. V. ADOLF FRIEDRICH STENZLER.
2. Päraskara. Heft 1 . Text. [Abhandlungen der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 6,2.] Leipzig 1 876.
1 1 , l ! ,j l '. 1 i i 1 1 I ' 1 38
RV SGS
TB
TS
VDhS
VGS
VKhGS
YV
WALTER SLAJE
(Rgvedasaqlhitä). (Säilkhäyanagrhyasiitra, RV). Das Sänkhäyanag[ihyam. [Hrsg. v.] H. ÜLDENBERG, in: /S 15 (1 878): 1 - 166. The Taittirfya BrähmalJa. With the comm. of Bha{{a Bhäskara Misra. A�ta,ka III, part 1 . Ed. by A. MAHADEVA SASTRI and L. SRINIVASACHARYA. Reprint. Delhi 1 985. Taittirfya Sa,,,hitä. With the Padapäfha and the comm. of Bha{{a Bhäskara Misra and Säya1Jäcärya. [Vol. 2,L] Ed. by T.N. DHARMADHIKARI. Poona 1 98 1 . Srfväsi${hadharmasästram. Aphorisms on the sacred /aw of the Äryas, as taught in the school of Vasi$fha. By ALOIS ANTON FÜHRER. 3. ed. [Bombay Sanskrit and Prakrit Ser. 23.] Poona 1 930. (Värähagrhyasiitra, YV: Maiträyai:iiyas). Un rituel domestique vedique. le Värähagrhyasütra. Trad. et annote par PIERRE ROLLAND. Aix-en-Provence 1 97 1 . (Vaikhänasagrhyasiitra, YV : Taittiriyas). Vaikhänasagrhyasiitram and Vaikhänasadharmasiitram . . . . Crit. ed. by W. CALAND. Reprint. New Delhi 1 989. (Yajurveda). Vgl. TS.
B. Sekundärliteratur
ALSDORF, LUDWIG 1 961 "Bemerkungen zum Siiryäsiikta", in : ZDMG 1 1 1 ( 1961 ):
492-490 [= K/. Sehr. 29-35].
BHANDARKAR, R. G. 1 928 Col/ected Work.s of Sir R.G. Bhandarkar. Vol. II. Ed. by
NARA Y AN BAPUJI UTGIKAR. [Government Oriental Ser. B,2.] Poona.
BHAT, G. K. 1 979 "Marriage of Siiryä (�gveda X 85)", in: Ludwik Sternbach
Felicitation Volume. Part 1 . Lucknow 1 979: 63-75.
BOULNOIS, J. 1 939
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 1 39
Le caducee et la symbolique dravidienne indomediterraneenne, de / 'arbre, de la pierre, du serpent et de la deesse-mere. Paris.
CALAND, WILLEM
1 898 "Von der Wiedergeburt Totgesagter", in: Urquell N.F. II ( 1 898): 1 93-194. [= Kl. Sehr. 1 2 1 - 1 22].
DAS, RAHUL PETER 1 984 [Rez.: G.U. Thite, Medicine. Its magico-religious aspects
according to the V edic and later literature. Poona 1 982. ], in: JIJ 27 (1 984): 232-244.
DELBRÜCK, BERTHOLD
1 888 Altindische Syntax. [Syntaktische Forschungen. 5.] Halle.
DRESDEN, MARK JAN 1 941 Mänavagrhyasütra. A Vedic manual of domestic rites.
Trans!., comm. and pref. Groningen.
DuBOIS, ABBE J. A. 1 906 Hindu manners, customs and ceremonies. . . . ed. . . . by
HENRY K. BEAUCHAMP. 3. ed. Oxford.
EWAia MANFRED MA YRHOFER, Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Bd 1 . Heidelberg 1 992.
FALK, HARRY 1 993 "Der Zobel im �gveda", in: Indogermanica et lta/ica. FS
für Helmut Rix zum 65. Geburtstag. Unter Mitarb. v . . . . hrsg. v. Gerhard Meiser. [IBS. 72.] Innsbruck 1 993: 76-94.
ÜAMPERT, WILHELM
1 939 Die Sühnezeremonien in der altindischen Rechtsliteratur. [Monografie Archivu Orientälniho. 6.] Prag.
GONDA, JAN 1 956
1 976
"The sfmantonnayana as described in the Grhyasiitras'', in: East & West 7 ( 1 956): 12-3 1 [= Sei. Stud. 4 (1 975): 1 86-206]. Triads in the Veda. [V erhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van W etenschappen, afd. Letterkunde, N.R. 9 1 .] Amsterdam.
1 . 1 1
140 WALTER SLNE
1 980 Vedic Ritual. The non-solemn rites. [HbO 2,4, 1 .] Leiden.
ÜOPAL, RAM
1 983 India of Vedic Kalpasütras. 2. ed. Delhi.
HAAs, E. 1 862
HDh
"Die Heirathsgebräuche der alten Inder, nach den Grihyasütra", in: IS 5 ( 1 862): 267-41 2.
PANDURANG VAMAN KANE, History of Dharmasiistra. 2. ed. Vol. 2 , 1 -2. [Govemment Oriental Ser. B,6.] Poona 1 974.
HEESTERMAN, J. C. 1 983 "Other folk's fire'', in: Agni. Ed. by Frits Staal. Vol. 2.
Berkeley 1 983 : 76-94.
HERMANN, EDUARD
1 904/05 "Beiträge zu den idg. Hochzeitsgebräuchen'', in: Indogermanische Forschungen 1 7 ( 1 904/05): 373-387.
HlLLEBRANDT, ALFRED
1 897 Ritual-Litteratur. Vedische Opfer und Zauber. [Grundriss der indo-arischen Philologie und Altertumskunde. 3,2.] Strassburg.
HINÜBER, ÜSCAR VON
1 996 "Zu einer Göttinger Dissertation über das buddhistische Recht", in: WZKS 40 (1 996): 1 0 1 - 1 1 3.
KAPANI, LAKSHMI
1 992-93 La notion de Sa,,,skiira. 1 .2. [Publications de !'Institut de Civilisation Indienne. 59, 1 -2.] Paris.
KASER, MAx
1 977 Römisches Privatrecht. 1 0. verb. Aufl. München.
KEITH, ARTHUR BERRIEDALE
1 925 The Religion and philosophy of the Veda and Upanishads.
KEWA
The I st and 2nd half. [HOS 3 1 -32.] Reprint. Delhi 1 989.
MANFRED MA YRHOFER, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd III. Heidelberg 1 976.
KIRSTE, JOHANN ÜTTO FERDINAND
1 892 [Rez.] WINTERNITZ (1892), in: WZKM 6 (1 892): 1 74-1 77.
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 141
KRICK, HERTHA
1 982 Das Ritual der Feuergründung (Agnyiidheya). Hrsg. v. GERHARD ÜBERHAMMER. [ÖA W Sb 399. = VKSKS 1 6.] Wien.
KUIPER, F. B. J. 1 996 "Gandharva and Soma", in: Stll 20 ( 1996) [= FS PAUL
THIEME]: 225-255.
LEIST, B . W. 1 892 Alt-arisches Jus civile. 1 . Abth. Jena.
LOMMEL, HERMANN 1 950 "Bhrigu im Jenseits", in: Paideuma 4 (1 950): 93- 109 [ = Kl.
Sehr. 209-225].
MENSKI, WERNER F.
1 985 "Bemerkungen zur Kindmädchenheirat: Die Bedeutung von Atharvaveda 14.2 (Resümee)", in: ZDMG Suppl. 6 ( 1985): 293.
1 989 "Das Ritual des [sie ! ] Saptapadi'', in: ZDMG Suppl.7 ( 1989): 371-380.
1 99 1 "Marita! Expectations as dramatized in Hindu marriage rituals'', in: Roles and rituals for Hindu warnen. Ed. by Julia Leslie. London 1 99 1 : 47-67.
1 993 "Legal Pluralism in the Hindu marriage'', in: Institutions and Ideologies. A SOAS South Asian Reader. Ed. by David Arnold and Peter Robb. [Collected Papers on South Asia. 1 0.] London 1 993 : 1 48-1 64.
MEYER, JOHANN JAKOB
1 937 Trilogie altindischer Mächte und Feste der Vegetation. Drittes Stück. Indra. „. Leipzig.
1 97 1 Sexual life in ancient India. A study in the comparative history of Indian culture. Repr. Delhi 1 989.
MINKOWSKI, CHRISTOPHER
1 989 "The Udumbara and its ritual significance'', in: WZKS 33 (1 989): 5-23.
MYLIUS, KLAUS
1 98 1 Äiteste indische Dichtung und Prosa. „ . Wiesbaden.
142 WALTER SLAJE
[OBERLIES, THOMAS
1 988 Die Religion des IJ.gveda. 1 . Teil - Das religiöse System des �gveda. [Publications of the De Nobili Research Library XXVI.] Wien.]
O'FLAHERTY, WENDY DONIGER
1 98 1 The Rig Veda. One hundred and eight hymns, selected, transl. and annotated. [Penguin Classics] London.
0LDENBERG, HERMANN
1 9 1 7 Die Religion des Veda. [Nachdr. d. Ausg. 1 9 1 7] Stuttgart, o.J.
PANDEY, RAJBALI
1 969 Hindu Sa'!lskiiras. Socio-religious study of the Hindu sacraments. 2. rev. ed. Repr. Delhi 1 99 1 .
ROCHER, Luoo 1 979 "Tue Sutras and Sästras on the eight types of marriage'', in:
Ludwik Sternbach Felicitation Volume. Part 1 . Lucknow 1979: 208-214.
SCHMIDT, RICHARD
1 904 Liebe und Ehe im alten und modernen Indien. Berlin. 1 922 Beiträge zur indischen Erotik. 3 . Aufl. Berlin.
SCHMIDT, HANNS-PETER
1 987 Some Women 's Rites and Rights in the Veda. [Post-graduate and Research Department Ser. 29. Professor P.D. Gune Memorial Lectures, 2. Ser.] Poona.
SCHRADER, OTTO
1 929 Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. 2. verm. u. umgearb. Aufl. Bd. 2. Hrsg. v. A. Nehring. Berlin.
SCHROEDER, LEOPOLD VON
1 888 Die Hochzeitsbräuche der Esten und einiger anderer finnisch-ugrischer Völkerschaften in Vergleichung mit denen der indogermanischen Völker . . . . Berlin.
S!MSON, GEORG VON
1 986 "�sya8piga: Ursprung und Hintergrund'', in: Kalyät:1amiträräga1Jam. Essays in Honour of Nils Simonsson. Ed. by Eivind Kahrs. [Tue Institute for Comparative Research in
Zur Erklärung der sog. 'Tobiasnächte' 143
Human Culture, Oslo. Ser. B: Skrifter. 70.] Oxford 1 986: 203-228.
SLAJE, WALTER
1 995 "�ru-, ftv(i)ya-, ärtava-. �eibliche "Fertilität" im Denken vedischer Inder", in: JEAS 4 ( 1 995): 1 09- 148.
1 998 "Bekanntes "entdecken": Projektionen eigener Leitvorstellungen in fremde Denkmuster", in: ZDMG, Supplement XI (1 998): 1 7-24. [Tagungsband des XXVI. Deutschen Orientalistentages in Leipzig].
SMITH, BRIAN K. . . . 1 986 "The Unity of Ritual. Tue Place of the Domest1c Sacnfice m
V edic Ritualism'', in: JJJ 29 (1 986): 79-96. 1 991 "Indra's Curse, VaruIJa's Noose, and the Suppression ofthe
Woman in the Vedic Srauta Ritual", in: Roles and rituals for Hindu women. Ed. by Julia Leslie. London 199 1 : 1 7-45.
SYED, RENATE
1993 "Draupadi in der Sabhä. rajasvalä, ekavasträ, prakirnakesi". Humboldt-Univ. zu Berlin. Beiträge des Südasi�n-lnstitutes 4 ( 1 993 ): 1 1 3-142.
THIEME, PAUL 1 963 "Jungfrauengatte'', in: KZ 78 ( 1 963): 16 1 -248. [= Kl. Sehr.
426-5 1 3]. 1 985 "Bemerkungen zum Vp;;äkapi-Gedicht (RV 1 0.86)'', in:
ZDMG Suppl. 6 (1 985): 238-248.
V AN BUITENEN, J. A. B. 1 975 The Mahäbhärata. Trans!. and ed. 2: Tue Book of the
Assembly Hall. 3 : Tue Book ofthe Forest. Chicago.
VASILKOV, YA. V. 1 989/90 "Draupadi in the assembly-hall, Gandharva-husbands and
the origin ofthe Gai:iikäs", in: IT 1511 6 ( 1989/90): 387-398.
WEBER, ALBRECHT 1 862 "Vedische Hochzeitssprüche'', in: IS 5 ( 1 862): 1 77-266.
WEZLER, ALBRECHT 1 99 1 " 'Divorzio all' indiana'. Einige Bemerkungen zum Ver
ständnis des Abschnitts über die Ehescheidung bei Kautilya
i ! ! .
. ' !
1 44
1 993
1 994
WALTER SLAJE
(Untersuchungen zum 'Kautiliya' Arthasästra I)", in: Papers in Honour of Prof. Dr. Ji Xianlin on the occasion of his 80th birthday. Eds.: Li Zheng et. al. Nanchang (Jianxi) 1 99 1 : 801-824 . "On a prose passage in the Yuktidlpikä of some significance for the history of Indian medicine", in: JEÄS 3 ( 1993): 282-304. "A Note on Sanskrit bhrüTJ,a, and bhrüTJ,ahatyä ", in: Festschrift Klaus Bruhn zur Vollendung des 65. Lebensjahres dargebracht von Schülern, Freunden und Kollegen. Hrsg. v. N. Balbir und J. K. Bautze. Reinbek 1 994: 623-646.
WHITNEY, WILLIAM DWIGHT
1 905 Atharva-Veda-Sa1{1hitä. Transl. with a critical and exegetical comm. Rev., . . . by Charles Rockwell Lanman. 2. half. [HOS 8.] Cambridge, Mass.
WINTERNITZ, MORIZ
1 892 Das altindische Hochzeitsrituell nach dem ÄpastambiyaG[ihyasütra und einigen anderen verwandten Werken. Mit Vergleichung der Hochzeitsgebräuche bei den übrigen indogermanischen Völkern. [Denkschriften der k. Akademie der Wiss. in Wien. Philos.-hist. Kl. 40.] Wien.
ZACHARIAE, THEODOR
1 903 "Zum altindischen Hochzeitsritual", in: WZKM 1 7 ( 1 903): 1 35-155; 2 1 1 -23 1 [= Kl. Sehr. 503-544].
ZINKO, CHRISTIAN 1 994 "Hethitische und vedische Geburtsrituale im sprach- und
kulturgeschichtlichen Vergleich. Ein Arbeitsbericht", in:
[ 1 998
Studia lranica, Mesopotamica & Anatolica 1 ( 1994): 1 19-148. "Das altindische pwrzsavana-Ritual", in: Wort - Text -Sprache und Kultur. FS für Hans Schmeja zum 65. Geburtstag. Hrsg. v. Peter Anreiter und Hermann M. Ölberg. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Sonderheft. 1 03.] Innsbruck 1 998: 1 99-230.]
Göttinnenverehrung im Jainismus
ROBERT J. ZYDENBOS, Köln
In allgemeinen Einführungen zur religiösen Theorie und Praxis Indiens begegnen wir oft dem schablonenhaften Gedanken, daß der Jainismus eine Lehre für W eltverneiner sei, die nur ganz am Rande einer vollständigen menschlichen Gesellschaft, als peripheres Phänomen, überhaupt bestehen kann. Die Jainas sind heute zwar eine kleine Minderheit in der indischen Gesellschaft, weniger als 1 % der Gesamtbevölkerung, 1 aber die große Mehrheit der Jainas sind keine Mönche und Nonnen, sondern Laien, und zudem darf ihr heutiger Minderheitsstatus uns nicht über die enorme Rolle hinwegtäuschen, die der Jainismus in der kulturellen und religiösen Geschichte Indiens gespielt hat. So können wir z.B. nach den Studien von ALSDORF, DUMONT und anderen es wohl als erwiesen betrachten, daß die Verbreitung des Vegetarismus unter den höheren hinduistischen Kasten dem Einfluß des Jainismus zugeschrieben werden darf. Schon dieses eine Beispiel genügt, um
klarzumachen, daß der Jainismus gar nicht eine periphere weltanschauliche Strömung gewesen sein kann, auch wenn es jetzt schwer ist, etwas annähernd Genaues über Prozentzahlen von Jainas in der indischen Bevölkerung in früheren Zeiten zu sagen, die in
1 Die jainistische Bevölkerung ist ungleich verteilt, mit deutlichen Konzentrationen, so daß die Jainas in manchen Teilen Indiens noch heute einen beträchtlichen kulturellen Einfluß haben. Zu nennen sind z.B. SüdwestKarnataka, das Grenzgebiet von Südwest-Maharashtra und Nordwest-Karnataka sowie Teile von Gujarat und Rajasthan.



























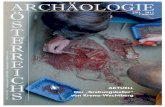








![“Das Geld in der japanischen Literatur: Aspekte von Haben und Sein” [Money in Japanese Literature: Aspects of Having and Being]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6316e422c5ccb9e1fb03e621/das-geld-in-der-japanischen-literatur-aspekte-von-haben-und-sein-money-in.jpg)






