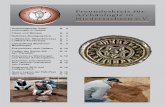Zwischen Glasperlenspiel- und Ingenieurssemantiken. Diskursanalytische Untersuchungen zur Hegemonie...
Transcript of Zwischen Glasperlenspiel- und Ingenieurssemantiken. Diskursanalytische Untersuchungen zur Hegemonie...
Zwischen Glasperlenspiel- und Ingenieurssemantiken Diskursanalytische Untersuchungen zur Hegemonie
neoklassischer Wissenschaftskultur nach 19451
HANNO PAHL
1. EINLEITUNG
Bezugnahmen auf ästhetische Werte durch Mathematiker und Naturwissenschaftler sind gut dokumentiert. Von dieser Seite wurde immer wieder auf Faktoren von Schönheit, Einfachheit, Symmetrie oder Harmonie als offensichtlich nicht immer unwichtigen Momenten von Theoriekonstruktion hingewiesen. So zum Beispiel bei dem Mathematiker Godfrey Harold Hardy: »The mathematician’s patterns, like the painter’s or the poet’s, must be beautiful; the ideas, like the colours or words, must fit together in a harmonious way. Beauty is the first test: there is no permanent place in the world for ugly mathematics« (Hardy 1940: 85). Oder wenn es in einem Brief Heisenbergs an Einstein (aus dem Jahr 1926) heißt: »If nature leads us to mathematical forms of great simplicity and beauty – by forms I am referring to coherent systems of hypotheses, axioms, etc. – [...] we cannot help thinking that they are ›true‹, that they reveal a genuine feature of nature« (Heisenberg 1971: 68). Es gibt nur wenige Arbeiten, die Fragen von Ästhetik mit Bezug auf die Wirt- schaftswissenschaften abgehandelt haben. Eine der vorliegenden Studien kommt zu einer eher skeptischen Einschätzung und stellt hierzu auf die spezifische Beschaf- fenheit des ökonomischen Gegenstandsbereichs und damit verbundene Limitierun- gen an ästhetische Stringenz ab:
»The primary explanation lies in the nature of the subject of economics. As economics attempts to model the behaviour of real world agents in real world markets, the subject matter of the discipline is constantly changing as the markets, regulations and institutions of the real
1 Erscheint in: Inga Klein, Sonja Windmüller (Hg.) (2014): Kultur der Ökonomie. Zur Materialität und Performanz des Wirtschaftlichen. Bielefeld (Transcript).
2 | HANNO PAHL
world constantly change. In the language of those who have sought beauty in other disci- plines, economic models and theories lack generality. They have a high degree of time speci- ficity and sometimes location specificity. Consequently, they are extended or replaced as market circumstances change. The predictions of the models are subject to empirical verifica- tion or rejection. This conditional nature of economic models and the other objects derived from them restricts our appreciation of their worth and their beauty« (Lee/Lloyd 2005: 83).
Dieses Urteil kollidiert allerdings gerade mit Befunden in einem Bereich ökonomi- schen Wissens, der eine Zentralstellung in der Ökonomik des 20. Jahrhunderts be- sitzt, der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie. Diese wurde und wird bis heute stetig mit Attributen wie Schönheit, Eleganz und Einfachheit in engen Zusammenhang gebracht (vgl. Köllmann 2006), so erstmals in einer bekannten Charakterisierung ihres Schöpfers Walras aus den 1870er Jahren: »Thus the system of the economic universe reveals itself, at last, in all its grandeur and complexity: a system once vast and simple, which, for sheer beauty, resembles the astronomic universe« (Walras 1954 [1874]: 374). Hier erscheint die (ökonomische) Wirklichkeit nicht als diffuses und kontingentes »Gewimmel von Willkür«, sondern als gerichteter Ordnungszu- sammenhang, dessen »ontologische« Struktur vermittelst eines äußerst elegant an- mutenden Theorietypus konzise abgebildet werden kann.
Wie gehen diese divergierenden Befunde zusammen? Ich möchte zunächst (Teil 2) nachzeichnen, dass die Zuschreibung ästhetischer Werte im Fall der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie zu einem großen Teil theoriepolitisch motiviert war und ist.1
Da die Wirtschaftswissenschaft zwar – anders als alle anderen Sozial- und Kultur- wissenschaften – im Verlauf des 20. Jahrhunderts eine recht rigide Form disziplinä- rer Identität ausgeprägt hat, aber hieraus gerade kein fachweiter Konsens hervorge- gangen ist,2 gehören andauernde Kämpfe rivalisierender Ökonomengruppen um disziplinäre Hegemonie bis heute zum Normalfall (dies mag damit zu tun haben, dass die Wirtschaftswissenschaft die »most important academic discipline for the ideological legitimization of capitalism« (Elsner/Lee 2010: 1333) sein dürfte). Es
1 Diese Schwerpunktsetzung impliziert zugleich, dass der bis heute kontrovers diskutierten Frage der kognitiven Bedeutung ästhetischer Faktoren (vgl. dazu McAllister 1999) nicht im Detail nachgegangen wird. Von Interesse ist allein der Einsatz ästhetischer Attribuie- rungen als Ressource im Kampf um disziplinäre Hegemonie.
2 Siehe hierzu die Einschätzung bei Backhouse (2010: 4): »The field has a much stronger disciplinary identity than most other social sciences, with greater agreement on what the core of the subject comprises. […] But economic’s strong disciplinary identity does not translate into agreement like that found in the natural sciences, for there remain econo- mists who dissent from what, in the eyes of most of their colleagues, are basic presuppo- sitions that all economists should accept«.
ZWISCHEN GLASPERLENSPIEL- UND INGENIEURSSEMANTIKEN | 3
sollen jene auf Ästhetik referierenden diskursiven Strategien ausfindig gemacht werden, die jeweils von Befürwortern wie Kritikern der Allgemeinen Gleichge- wichtstheorie zum Einsatz gebracht werden. Im anschließenden dritten Teil wende ich mich einem anderen semantischen Register zu. Die (mit zu erläuternden Ein- schränkungen) bis heute als Kern ökonomischen Mainstreams geltende Allgemeine Gleichgewichtstheorie war bis mindestens in die Zwischenkriegszeit hinein nur eine von vielen äußerst disparaten Richtungen ökonomischer Forschung.3 Als harter Kern einer nahezu zu fachuniversaler Geltung gelangten Wissenschaftskultur konn- te sie sich erst etablieren, als ihr Programm einer hochgradig stilisierten mikroöko- nomischen Totalanalyse durch eine Verkopplung mit ökonometrischen Modellie- rungstechniken und Systemen volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (VGR) neuar- tig situiert und »geerdet« wurde (ich bezeichne dieses Amalgam im Folgenden als »neoklassische Wissenschaftskultur« und komme detaillierter darauf zu sprechen). Es wird stichprobenartig aus den Selbstbeschreibungen früher ökonometrischer Texte die dort vorherrschende Semantik herauspräpariert, wobei ich der Vermutung nachgehe, dass es sich hierbei – im Verhältnis zur künstlerisch-ästhetischen Seman- tik der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie – um eine Komplementärsemantik han- delt, die starke Anleihen bei Aussagen und Begrifflichkeiten macht, die einem in- genieurwissenschaftlichen Register oder Archiv entstammen. Diese haben mit dazu beigetragen, so die Vermutung, der Gleichgewichtstheorie qua wissenschaftlicher Arbeitsteilung jene Bodenhaftung zu verleihen, die ihren Aufstieg zu einem diszip- linbeherrschenden Paradigma erst ermöglicht hat.
Das Ziel dieser Fallstudien besteht darin, einen Beitrag zur Genese jener kogni- tiven Autorität zu leisten, die die Wirtschaftswissenschaften in der Mitte des 20. Jahrhunderts erlangt haben und von der die Disziplin – trotz einer erneuten Vielzahl kritischer Stimmen besonders seit der Krise 2007ff. – bis heute zehrt. Dies wird in Teil 4 unter Rückgriff auf Ludwik Flecks Konzepte des Denkstils und Denkkollek- tivs theoretisch unterfüttert. Das Begriffspaar Denkstil/Denkkollektiv referiert auf die Genese und Konsolidierung distinkter Wissenschaftskulturen, denen es – zu ei- ner bestimmten Zeit – gelingt, Objektbereich, Fragestellungen und als legitim er- achtete wissenschaftliche Verfahrensweisen hegemonial zu besetzen und andere Strömungen an den Rand zu drängen, bis hin zu deren Degradierung zu einer »Pseudowissenschaft«. Dieser Abschnitt endet – auch um aktuelle Anschlussfähig- keit und Relevanz zu untermauern – mit einem kurzen Ausblick auf den Wandel der ökonomischen Forschungslandschaft in den letzten ca. drei Jahrzehnten. Die im
3 Konkurrierende Forschungsrichtungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren zum Beispiel der ältere US-amerikanische Institutionalismus, die deutsche Historische Schule, der Marginalismus österreichischer Prägung oder Fortschreibungen der Klassi- schen Politischen Ökonomie von Smith und Ricardo.
4 | HANNO PAHL
Text verhandelte neoklassische Wissenschaftskultur zeichnet sich als epistemisches Format vor allem durch eine Anlehnung an physikalische Wissenschaftsstandards und Methodenideale aus, was sich in einem epistemologischen und ontologischen Reduktionismus manifestiert. Neuere Forschungsansätze hingegen machen oftmals stärkere Anleihen bei Biologie, Evolutionstheorie und Komplexitätstheorien, was epistemologisch wie ontologisch auf Emergenz(konzepte) verweist. Wenn sich letz- tere Trends durchsetzen sollten – ich diskutiere dies kurz am Beispiel agentenba- sierter Modellierung – stellen sie auch die sich bis heute als Alternative zur Mainstream-Ökonomik positionierenden anderen Abteilungen von Sozial- und Kul- turwissenschaft (etwa die Wirtschaftssoziologie oder die Wirtschaftsanthropologie) vor neue Herausforderungen.
Der abschließende fünfte Teil reflektiert die Befunde der Fallstudie kurz vor dem Hintergrund einer bisher erst in Ansätzen bestehenden Wissenschaftssoziolo- gie der Wirtschaftswissenschaften. Es wird diskutiert, inwieweit und warum auch ein hochgradig formalisierter und im Medium von Mathematik und Modellbildung prozessierender Wissenschaftstyp wie die moderne Mainstream-Ökonomik grund- sätzlich diskursanalytisch durchleuchtet werden kann (aber zugleich markiert, dass solche Zugriffe einer Ergänzung durch eine an Praxen orientierte Wissenschaftsfor- schung bedürfen). Bezüglich der in diesem Text zur Anwendung gebrachten hoch- selektiven Verfahrensweise und Materialauswahl möchte ich vorab auf Mary Mor- gans (2012: XV) Buch The World in the Model. How Economists Work and Think verweisen, das sicherlich zu den gewichtigeren Beiträgen zur Erforschung moder- ner Wirtschaftswissenschaft zu zählen ist. Sie hat diese Monographie als eine Art »detective’s casebook« gekennzeichnet. Die Autorin folgt minutiös einzelnen Epi- soden der Konstruktion ökonomischer Modelle, die in den späteren Bestand öko- nomischen Wissens als Kompakteinheiten aufgenommen wurden ohne ihre Entste- hungskontexte adäquat zu berücksichtigen, um herauszufinden, »what economic modelling is all about«. Das Genre von Fallstudien scheint – auch über den bei Morgan bearbeiteten (gewichtigen) Spezialfall ökonomischer Modellierung hinaus – besonders geeignet, um sich schrittweise in die opaken Welten einer überaus for- malen wie komplexen sozialwissenschaftlichen Disziplin hineinzuarbeiten.
2. ÄSTHETISCHE ZUSCHREIBUNGEN ALS FAKTOR EINES KAMPFES UM HEGEMONIE INNERHALB DER WIRTSCHAFTS- WISSENSCHAFTEN
Bei der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie, wie sie erstmalig in den 1870er Jahren von Walras (1954 [1874]) ausgearbeitet und dann in den 1950er Jahren von Arrow und Debreu (1954) in der noch heute akzeptierten Form weiterentwickelt wurde,
ZWISCHEN GLASPERLENSPIEL- UND INGENIEURSSEMANTIKEN | 5
handelt es sich um eine Art mathematisierte mikroökonomische Totalanalyse der gesamten Wirtschaft. Schumpeter (2009: 1177) hat sie in seiner Dogmengeschichte in den Rang einer »Magna Charta der exakten Volkswirtschaftslehre« gehoben. »In der Werkstatt von Walras«, so referiert Schumpeter das dort Geleistete,
»entstand die statische Theorie des ökonomischen Universums in der Form einer großen An- zahl quantitativer Beziehungen (Gleichungen) zwischen ökonomischen Elementen oder Vari- ablen (Preisen und Mengen von Konsum- und Produktionsgütern oder Leistungen), die als sich gegenseitig simultan determinierend aufgefaßt wurden« (ebd.).
Düppe betont insbesondere die Bedeutung der Gleichgewichtstheorie für die Kon- solidierung und weitere Ausdifferenzierung der Wirtschaftswissenschaften als ei- genständiger, von anderen Sozialwissenschaften abgesonderter Disziplin:
»Without general equilibrium theory, economics would have remained one among myriad other social and political fields of inquiry. [...] It establishes the economy as a closed system and thus economics as a separate discipline. It differs from anything else social scientists could study in that in markets there is social order independent of the nature of that which is ordered – the individual, its needs, culture, morals, and so forth« (Düppe 2011: 72).
Mit anderen Worten: Die Allgemeine Gleichgewichtstheorie hat dazu beigetragen (zu welchen Kosten auch immer), »Wirtschaft« als intelligibles Erkenntnisobjekt zu konstruieren, indem der Mannigfaltigkeit und Heterogenität empirischer Erschei- nungen eine eindeutige mathematische Struktur gegeben wurde. »Wirtschaft«, das bedeutet nun ein System universaler Interdependenz aller Kaufs- und Verkaufsakte auf allen Märkten, eine Begriffsstrategie, die – nicht nur in popularisierenden Ver- dolmetschungen – oftmals als exakte und rigorose mathematische Einlösung jener vagen und interpretationsoffenen Smithschen Metapher der unsichtbaren Hand aus- gegeben wurde (vgl. dazu Pahl 2013).
Wie eingangs anhand eines Zitates von Walras demonstriert, finden sich bei Protagonisten und Befürwortern der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie zahlreiche ästhetische Attribuierungen des Theorieunternehmens, die zu den ebenfalls oben genannten Beispielen aus Mathematik und Physik eine große Nähe aufweisen. Der Walras-Experte und Übersetzer von dessen Hauptwerk, Jaffé, formulierte in dieser Linie:
»I shall devote myself almost entirely to pure economic theory, for that is the part of Walras’s work that has had the greatest impact and is most relevant in the present. It is also the most aesthetically pleasing part. Any great scholar, whether it be a Newton, or a Henri Poincaré, or an Einstein, is a poet who creates beauty. For me, the principal attraction of Walras’s theory of general equilibrium is its aesthetic aspect« (zit. n. Walker 2006: 129).
6 | HANNO PAHL
Dies unterstreicht Jaffé weiter durch einen Vergleich mit den Arbeiten Marshalls, der als wichtiger Vertreter von Theorien partiellen Gleichgewichts prototypisch für eine pragmatischere beziehungsweise eklektizistischere Theorietradition steht:
»Since I was then in charge of a graduate course on the economics of Alfred Marshall, I was struck by the contrast between the sheer formal architectonic beauty of Walras’s pure theory and Marshall’s muddling blend of theory and miscellaneous reflections and opinions« (zit. n. Walker 2006: 270).
Auch noch aus größerer historischer Distanz heraus geschrieben finden sich analoge Befunde zur ursprünglichen Version der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie, bei- spielsweise in Shackles The Years of High Theory:
»The forty years from 1870 saw the creation of a Great Theory or Grand System of Econom- ics, in one sense complete and self-sufficient, able, on its own terms, to answer all questions which those terms allowed. [...] In its arresting beauty and completeness this theory seemed to need no corroborative evidence from observation. It seemed to derive from these aesthetic qualities its own stamp of authentication and an independent ascendancy over men’s minds« (Shackles 1967: 4 f.).
Auch bei Debreu, der gemeinsam mit Arrow den als am gewichtigsten bewerteten Beitrag zur Fortschreibung der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie geleistet hat, finden sich das eigene Schaffen kommentierende Stellungnahmen, die prominent auf ästhetische Werte abstellen:
»Akin in motivation, execution, and consequences is the pursuit of simplicity. One of its ex- pressions is the quest for the most direct link between the assumptions and the conclusions of a theorem. Strongly motivated by aesthetic appeal, this quest is responsible for more transpar- ent proofs in which logical flaws cannot remain hidden, and which are more easily communi- cated. In extreme cases the proof of an economic proposition becomes so simple that it can dispense with mathematical symbols. The first main theorem of welfare economics, according to which an equilibrium relative to a price system is a Pareto optimum, is such a case« (Debreu 1986: 1267).
Debreus Leistungen im Bereich der mathematischen Ökonomie wurden von ande- ren Fachvertretern mit »the great gothic cathedrals« verglichen, der Autor selbst als »great master builder« (Hildenbrand 1983: 29) angepriesen. Und noch in einer Kursbeschreibung aus der Gegenwart finden sich entsprechende Referenzen auf ästhetische Qualitäten der Gleichgewichtstheorie:
ZWISCHEN GLASPERLENSPIEL- UND INGENIEURSSEMANTIKEN | 7
»One of the complaints that students sometimes make about their experience in microeco- nomics courses is that microeconomics ›appears to be a disjointed collection of topics‹ and that it lacks ›a unifying context and narrative‹. From the title page on, this course makes an implicit claim that the presentation and student experience of microeconomics needn’t be like that. This is so because there exists a deep, unifying and beautiful context for the field of mi- croeconomics in the form of the Arrow-Debreu model of general equilibrium« (Bryant 2012: 2).
Das ist allerdings nur die eine Seite der Medaille, zugleich lassen sich ebenso zahl- reiche Aussagen auffinden, wo die gesamte Theorietradition in kritisch motivierter Weise als ästhetisch (fehl)geleitetes Unterfangen qualifiziert wird. Flasbeck, ein Kritiker der Mainstream-Ökonomik, klassifiziert die Allgemeine Gleichgewichts- theorie als »das Glasperlenspiel, das die moderne Ökonomie ausmacht« (Flasbeck 2004: 1074), Davidson, ein Postkeynesianer, versieht das dortige Theorieprogramm mit der Bemerkung, man habe zwar »a magnificently polished analytical structure« ausgearbeitet, diese sei aber »hopelessly flawed and arid« (Davidson 1990: 299). Solche Einschätzungen finden sich nicht nur in den Reihen dezidiert heterodoxer Ökonomen, sondern auch bei Vertretern die – in einem weiteren Sinne – dem Mainstream des Fachs zugerechnet werden können, so in Friedmans Besprechung Leon Walras and his Economic System:
»His problem is the problem of form, not of content: of displaying an idealized picture of the economic system, not of constructing an engine for analyzing concrete problems. His achievement cannot but impress the reader with its beauty, its grandeur, its architectonic structure; it would verge on the ludicrous to describe it as a demonstration how to calculate the numerical solution to a numerically specified set of equations« (Friedman 1955: 904 f.).
Walras’ Leistungen werden dort anerkannt, aber zugleich – sieht man in ihnen nicht nur »an essential part of a full-blown economic theory, but that economic theory itself« (ebd.: 908 f.) – als geradezu gefährlicher Irrweg gekennzeichnet.
Die ausgewählten Textstellen mit positiven Bezügen auf ästhetische Qualitäten referieren auf selbige nur selten im Sinne eines Selbstzwecks, am ehesten noch wenn der Vergleich mit gotischen Kathedralen angestellt wird (deren Architektur erfüllt zwar auch funktionale Zwecke, ihre Spezifik dürfte aber gerade nicht in ihrer Funktionalität aufzufinden sein beziehungsweise darin aufgehen). Dominant sind hingegen Narrative, die eine Verbindung zwischen ästhetischen Werten und kogniti- ven Leistungen herstellen (etwa: Vereinheitlichung von Forschungsgebieten, Trans- parenz von Beweisen, rein deduktiv zu erreichende Wissensvermehrung, heuristi- sche Funktionen in der Wissensvermittlung), obgleich – auch in den nicht wieder- gegebenen Kontexten, in denen die referierten Textstellen situiert sind – kaum prä- zisiert wird, wie diese Verknüpfungen im Detail zu denken sind. Kritiker gleichge-
8 | HANNO PAHL
wichtstheoretischen Denkens lassen solche Verkopplungen von Ästhetik und Kog- nition nicht gelten, ihre negativen Bezugnahmen können mit Köllmann in dem Vorwurf zusammenfasst werden, die Allgemeine Gleichgewichtstheorie »kultiviere ihre ästhetischen Qualitäten um den Preis der empirischen Irrelevanz und prämiere mathematische Virtuosität statt ökonomischen Sachverstand. [...] Hier wird offen- bar Ästhetik gegen empirische Relevanz ausgespielt« (Köllmann 2006: 81, Herv. H.P.).
3. DIE KOMPLEMENTÄRSEMANTIKEN DER ÖKONOMETRIE
Wie einleitend vermerkt war die Allgemeine Gleichgewichtstheorie zunächst nur eines von vielen konkurrierenden Theorieunternehmen, während sie ab der Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer Art hartem Kern eines nun tendenziell monoparadig- matischen ökonomischen Mainstreams avancierte. Blickt man auf die Genese dieses Mainstreams, eine Entwicklung, die in der Literatur auch als Übergang From In- terwar Pluralism to Postwar Neoclassicism (Morgan/Rutherford 1998) beschrieben wird, so werden vor allem die Herausbildung und Durchsetzung ökonometrischer Modellierungstechniken sowie Praktiken volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung als weitere entscheidende Komponenten genannt (vgl. dazu Backhouse 2002: 237 ff.). Vereinfacht ausgedrückt kann formuliert werden, dass durch die Konstruktion von Kategorien Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung ein Bezug zu statistischen Daten hergestellt wurde, wobei die Ökonometrie als eine Art Scharnier zwischen (Gleich- gewichts-)Theorie und (volkswirtschaftlichen) Daten fungierte.4 Boumans charakte-
4 Ich kann die epistemische Dimension ökonometrischer Modelle hier nur ganz knapp um- reißen: Bei mathematischen Modellen handelt es sich im Kern um Systeme von Glei- chungen, die eine bestimmte Anzahl endogener (durch das Modell determinierter) sowie exogener (nicht durch das Modell determinierter, aber auf das Modell einwirkender) Va- riablen enthalten. Ökonometrische Modelle liegen dann vor, wenn zumindest die Werte einiger Variablen auf empirischen Daten fußen. Boumans bezeichnet Modelle als »econ- omist’s instruments of investigation, just as the microscope and the telescope are tools of the biologist and the astronomer« (Boumans 2005: 2). Als solche erlauben sie einen be- stimmten Typus von Beobachtung, nämlich Messung, eine nummerische Repräsentation des jeweils untersuchten Phänomenbereichs. Morgan (1990: 9 f.) erblickt die Bedeutung von formalen Modellen in den Wirtschaftswissenschaften primär in ihrer Rolle als Substi- tut für experimentelle Methoden, wie sie in den modernen Naturwissenschaften prakti- ziert werden: Weil Messungen in den Wirtschaftswissenschaften in der Regel nicht unter kontrollierten (reproduzierbaren) (Umwelt-)Bedingungen durchgeführt werden können – der Wissenschaftler hat es mit einem sich permanent wandelnden Objekt zu tun – bleibe
ZWISCHEN GLASPERLENSPIEL- UND INGENIEURSSEMANTIKEN | 9
risiert das Forschungsprogramm der Cowles Commission (ab 1943), die zur wich- tigsten institutionellen Geburtsstätte des neuen Wissenschaftstypus zu zählen ist, als »a combination of the Walrasian method, which attempts to construct a mathemati- cal skeleton of system, and econometrics, to put empirical flesh on the bones of the system« (Boumans 2005: 75). Hierin zeigt sich sehr gut das neuartige Arrangement oder auch die Allianz beider Forschungslinien: Wurden mathematische Theorie (zum Beispiel die Allgemeine Gleichgewichtstheorie) und Wirtschaftsstatistik im 19. Jahrhundert in zahlreichen Selbstbeschreibungen von Ökonomen noch als ein- ander diametral entgegengesetzte Zugriffsweisen interpretiert – hier eine deduktiv verfahrende Nutzenmechanik, dort ein induktives Sammeln und Klassifizieren em- pirischer Daten (vgl. Morgan 1990: 4 f.) –, so wurden sie nun als komplementäre Unternehmungen rekonfiguriert.
Diese Konstellation war für die weitere Entwicklung der Wirtschaftswissen- schaften hin zu einer tendenziell monoparadigmatischen Disziplin überaus ent- scheidend. Es wurden Forschungsraster kodifiziert, die eine solche Synthesekraft entfalten konnten, dass konkurrierende Theorieunternehmen entweder als Spezial- fall integriert werden konnten. Hierfür wäre das bekannteste Beispiel die unter dem Namen der neoklassischen Synthese bekannt gewordene Formalisierung und mik- roökonomische Fundierung der Keynes’schen Theorie (vgl. Fourcade 2009: 160). Oder sie wurden an den Rand der Disziplin gedrängt und mussten fortan eine insti- tutionell prekäre Existenz als sogenannte heterodoxe Schulen fristen (Beispiele hierfür wären die österreichische Ökonomik oder der amerikanische Institutiona- lismus).5 Wenn nun in exemplarischer Weise Selbstbeschreibungen aus dem Kor- pus früher ökonometrischer Texte als eine zu den Attribuierungen der Gleichge- wichtstheorie passförmige Komplementärsemantik diskutiert werden sollen, dann geht es darum, Aspekte der Suggestivkraft der neoklassischen Wissenschaftskultur als neuartige Verbindung von Theorie und empirischer Forschung zu rekonstruie- ren.6 Ludwik Fleck prägte für solche Phänomene des blackboxing im Kontext seiner
das Verhältnis zwischen Daten und theoretischen Gesetzmäßigkeiten prekär. Modelle er- lauben eine Stabilisierung des Objektbereichs, indem die zur Messung notwendige Inva- rianz der Umwelt in das Modell selbst eingebaut wird.
5 Bei Yonay (1998: 188 ff.) wird detaillierter erläutert, wie durch die neuartigen, zur Gleichgewichtstheorie passenden Formen ökonometrischer Modellbildung statistische und empirische Kompetenz zu einem Markenzeichen neoklassischer Ökonomik wurde, während diese zuvor als Domäne des ökonomischen Institutionalismus galt.
6 Den Bereich der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) klammere ich aus Platz- gründen aus. Deren Wirkungsmächtigkeit entfaltete sich – nachdem die VGR zunächst vor allem im Zuge der Great Depression als nationalstaatliches Analyseinstrumentarium in wenigen westlichen Ländern entwickelt wurde – nach dem Zweiten Weltkrieg insbe-
10 | HANNO PAHL
wissenschaftssoziologischen Arbeiten zu Denkstilen und Denkkollektiven den Beg- riff der »Harmonie der Täuschungen« um zu beschreiben, wie
»verschiedene Elemente derart ineinander greifen, dass sie in ihrer Gesamtheit nicht mehr als kontingentes Phänomen erscheinen. Sie verlieren scheinbar ihre ontologische Verhandelbar- keit und täuschen in ihrem harmonischen Zusammenwirken vor, dass die Welt – und das Wissen und Beforschen von Welt – immer nur so sein kann, wie es gerade ist« (Niewöhner 2012: 71).
Im Unterschied zu den oben genannten Attribuierungen der Allgemeinen Gleich- gewichtstheorie rekurrieren die Selbstbeschreibungen der Ökonometriker nicht auf Faktoren wie Einfachheit, Eleganz, Geschlossenheit oder Schönheit, also vielfach kunstaffine Semantiken, sondern schöpfen eher aus einem ingenieurswissenschaft- lichen beziehungsweise technokratischen Reservoir. Neben der operativen Ebene der Verknüpfung von Allgemeiner Gleichgewichtstheorie und Wirtschaftsstatistik scheint mir auch diese Tatsache semantischer Komplementarität – gerade mit Blick auf die Außendarstellung der Wirtschaftswissenschaften – eine wichtige Erfolgs- komponente neoklassischer Wissenschaftskultur gewesen zu sein.
Ein wiederkehrendes Motiv besteht in der Betonung eines neutralen, objektiven und politisch indifferenten Status ökonometrischen Wissens, wozu auf die Rigorosi- tät der Naturwissenschaften als Vorbild Bezug genommen wird. Gleich zu Beginn der Constitution der Econometric Society wurde herausgestellt:
»The Society shall operate as a completely disinterested, scientific organization without polit- ical, social, financial, or nationalistic bias. Its main object shall be to promote studies that aim at a unification of the theoretical-quantitative and the empirical-quantitative approach to eco- nomic problems and that are penetrated by constructive and rigorous thinking similar to that which has come to dominate in the natural sciences«. (Roos 1933: 106)
sondere über das Lancieren von Standards beziehungsweise Leitfäden für möglichst ein- heitliche Berichterstattung. Bos veranschlagt die Bedeutung dieser Leitfäden als »empiri- cal frame of reference for thinking and communicating about national economies« (Bos 2007: 20). Auf Grund der »monopolistic position of national accounts statistics and their world-wide use and acceptance« spricht er von ihnen auch als »universal facts and lan- guage«. Speich zu Folge konstituierten diese Leitfäden nationalökonomischer Berichter- stattung einen »homogenous space in which it became possible to acquire comparative knowledge about global economic issues. One might call this an epistemic space in which the discipline of development economics found its well-suited niche. [...] The new tool presented an inscription device that increasingly stabilized itself by virtue of its connec- tivity« (Speich 2011: 19).
ZWISCHEN GLASPERLENSPIEL- UND INGENIEURSSEMANTIKEN | 11
In der ersten Ausgabe der neu gegründeten Zeitschrift Econometrica betont Schum- peter den schulenübergreifenden Charakter der Ökonometrie:
»We do not impose any credo – scientific or otherwise –, and we have no common credo beyond holding: first, that economics is a science, and secondly, that this science has one very important quantitative aspect. We are no sect. Nor are we a ›school‹. For all possible differences of opinion on individual problems, which can at all exist among economists, do, and I hope always will, exist among us« (Schumpeter 1933: 5, Herv. i. Orig.).
Die Ökonometrie wird hier ausdrücklich nicht als weitere Variante konkurrierender und möglicher Weise zueinander inkompatibler Forschungsrichtungen ausgeben, sondern als formale Technik, die an den kleinsten gemeinsamen Nennern aller Spielarten von Ökonomik ansetzt: dass die Analyse der Wirtschaft eine wichtige quantitative Komponente besitzt. Gleichwohl bemüht sich Schumpeter, die Öko- nometrie innerhalb der ökonomischen Tradition zu verankern und als konsequente Fortschreibung oder Kulmination von Bemühungen auszuweisen, die im Fach be- reits seit Langem verfolgt wurden. So wird Walras – als »the greatest of all econo- mists« – bereits zugestanden, einen »decisive step in the quantitative« gemacht zu haben, aber noch dabei gescheitert zu sein, »to move in the numerical line, the junc- tion of which two is characteristic of econometrics« (Schumpeter 1933: 9, Herv. i. Orig.). Noch stärker eingemeindet wird Cournot, dem Schumpeter bereits die Kon- struktion eines analytischen Apparates »with a clear perception of the ultimate econometric goal« bescheinigt: »every part of it being thought out so as to fit it to grip statistical fact when the time should come« (ebd.: 8). Hier wird den Wirt- schaftswissenschaften ein linearer beziehungsweise inkrementeller Modus von Wissensakkumulation zugesprochen: Was besonders talentierte frühe Fachvertreter bereits antizipiert hätten, aber noch nicht durchzuführen in der Lage waren, wird nun in der Gegenwart praktisch wahr.
Diesen frühen Dokumenten aus den 1930er Jahren merkt man noch deutlich die äußerste Vorsicht beim Promoten der neuen Analysetechniken an, keine der existie- renden Ökonomengruppierungen sollen sich angegriffen oder in ihrer Existenz be- droht fühlen, ökonometrische Verfahren können ihnen allen gleichermaßen zu Gute kommen. Aus den Texten der unmittelbaren Nachkriegszeit spricht hingegen bereits das Selbstbewusstsein eines Forschungszweiges, der gleichermaßen innerhalb der Disziplin eine erfolgreiche Reputation und Position erworben hat wie auch im Feld der Politikberatung zunehmend nachgefragt wird. So macht Ragnar Frisch die Öko- nometrie insbesondere als Instrument von Wirtschaftsplanung stark, als »important factor in eliminating maladjustments between fundamental economic sectors and assure a smooth and progressive utilization of resources« (Frisch 1946: 1). Die Ö- konometriker stellt er als »humble and devoted servants« der Gesamtgesellschaft
12 | HANNO PAHL
dar (ebd.). Am Beispiel der norwegischen Gewerkschaften wird ökonometrisch an- geleitete Wirtschaftspolitik als klassen- und verteilungstheoretisch neutraler Modus von Entscheidungsfindung präsentiert. Die Gewerkschaften hätten
»adopted a policy of solving the labor problem without strikes during the period of recon- struction. [...] the fact that they want to use enlarged and improved computations as a means of avoiding strikes, one could almost say as an alternative to strikes, is indeed significant. It seems to open a new era. Also in the part of the employers there is a considerable willingness to let decisions be influenced by objective computations that indicate the underlying facts and relations« (ebd.: 2, Herv. i. Orig.).7
Die Welt sei jetzt »ready and willing to listen to economists and statisticians whose thinking is constructive and disciplined by the rigor of the natural and physical sci- ences« (Roos 1948: 130), Ökonometriker – »adequately armed with facts« – seien nun in die Lage versetzt, »to affect profoundly the course of economic history« (ebd.: 133). Erstmals sei es möglich, »to forecast with considerable accuracy the […] level of production, income, and employment, months and even years ahead« (ebd.). Hier manifestiert sich ein deutlicher Planungsoptimismus. Die Sphäre der Wirtschaft prozessiert zwar eigenlogisch, ist aber durch wissenschaftliche Durch- dringung nahezu vollständig intelligibel gemacht worden, so dass sie zum Objekt steuernder politischer Eingriffe avanciert.
4. NEOKLASSISCHE ÖKONOMIK ALS HERAUSBILDUNG EINES NEUEN DENKSTILS UND HEUTIGE TRANSFORMATIONEN
Auch wenn die Mainstream-Wirtschaftswissenschaften im Zuge der Krise 2007ff. vielfach kritisiert wurden und werden, dürfte es als weithin offene Frage gelten, in- wieweit dies eine nachhaltige Beschädigung ihrer kognitiven Autorität impliziert.
7 Auch Halsmayer/Huber diagnostizieren ein ähnlich gelagertes Selbstverständnis, hier im Fall des ersten neoklassischen Wachstumsmodells: »Solow [sieht] ökonomisches Model- lieren als eine Art Handwerk, das sich am besten mit Ingenieursarbeit vergleichen lässt. Wie BauingenieurInnen eine Brücke modellieren, um sie erdbebenstabil zu machen, kon- struieren ÖkonomInnen ein Modell der Ökonomie. [...] Im Gegensatz zu social engi- neers, die konkrete politische Ziele umsetzen, sei es die Rolle von ÖkonomInnen, diese Umsetzung im Vornhinein zu designen. Solow nimmt jedenfalls keine Position in Bezug auf konkrete wirtschaftspolitische Eingriffe ein: Nicht um Wirtschaftspolitik anzuleiten, kreiert Solow ein möglichst einfaches Modell, sondern um zu zeigen, what happens if.« (Halsmayer/Huber 2013: 40, Herv. i. Orig.)
ZWISCHEN GLASPERLENSPIEL- UND INGENIEURSSEMANTIKEN | 13
Und es dürfte zum gegenwärtigen Zeitpunkt ebenfalls unklar sein, ob mögliche Im- pulse der Reformation eher von innerhalb oder außerhalb der Disziplin ausgehen. Die obigen Fallstudien sind gegenüber der Situation der Gegenwart historisch ein ganzes Stück zurückgegangen und haben sich der genuinen Konstitution der kogni- tiven Autorität ökonomischer Expertise gewidmet. Es ging um »Vorstadien« jenes Selbstbewusstseins, das die neoklassische Ökonomik dann vor allem in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ausgezeichnet hat. Nützenadel (2005) charakterisiert diese Periode als Zeitalter der Ökonomen, wobei er vor allem auf den flächendeckenden Einbezug ökonomischer Expertise im Feld der Politikbe- ratung abstellt. Aus dieser Zeit stammt zugleich Samuelsons (2005 [1948]: 5) Dik- tum der Wirtschaftswissenschaft als Queen of the Social Sciences, das auch von führenden Wissenschaftstheoretikern dieser Zeit sekundiert wurde. Popper (1987 [1957]: 48; siehe dazu auch Grabas 2002) beispielsweise hat die Wirtschaftswissen- schaft als am weitesten fortgeschrittene Sozialwissenschaft gepriesen, weil diese »ihre Newtonsche Revolution durchgemacht« habe, während die anderen Sozial- wissenschaften noch auf ihren Galilei warten würden.
Wir haben es offensichtlich mit einer Doppelbewegung zu tun, einer wechsel- seitigen Verstärkung eines spezifischen Modus interner Differenzierung mit einem Geländegewinn bezüglich gesellschaftsweiter Ausstrahlung. Innerhalb des Fachs ist es zur Herausbildung eines tendenziell homogenen und theoretisch-methodisch in- tegrierten Mainstreams gekommen, der an die Stelle vormaligen Theorienpluralis- mus getreten ist. Dies hat dazu beigetragen, den gesellschaftlichen Status der Öko- nomik zu stärken, eine Entwicklung, die dann ihrerseits die innerdisziplinären Zent- ralisierungsprozesse weiter gestärkt haben dürfte. Vergegenwärtigt man sich zudem den sozialstrukturell-politischen Kontext der Nachkriegsjahrzehnte mit seinen steti- gen Wachstumsraten und egalitärer werdenden Reichtumsverteilungen in allen westlichen Industrienationen, dann erscheint die Transformation der Ökonomik auch von dieser Seite unterfüttert worden zu sein. Was ich mit dem provisorischen Term der »neoklassischen Wissenschaftskultur« gefasst habe, lässt sich durch Be- zug auf das Begriffspaar Denkstil/Denkkollektiv verdeutlichen, wie es bei Fleck definiert und oben bereits kurz angesprochen wurde:
»Wir können also Denkstil als gerichtetes Wahrnehmen, mit entsprechendem gedanklichen und sachlichen Verarbeiten des Wahrgenommenen, definieren. Ihn charakterisieren gemein- same Merkmale der Probleme, die ein Denkkollektiv interessieren; der Urteile, die es als evi- dent betrachtet; der Methoden, die es als Erkenntnismittel anwendet. Ihn begleitet eventuell ein technischer und literarischer Stil des Wissenssystems« (Fleck 1994 [1935]: 130, Herv. i. Orig.).
War es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch abhängig von der Zugehö- rigkeit zu einer bestimmten Richtung ökonomischer Forschung, was überhaupt als
14 | HANNO PAHL
ökonomischer Sachverhalt und als ökonomisches Problem zu klassifizieren ist, und worin eine wissenschaftliche Fragestellung und Herangehensweise zu bestehen hat, wurden diese Kriterien im Fortgang deutlich homogenisiert. Mit Blick auf die glo- bale Diffusion der neoklassischen Wissenschaftskultur nach dem Zweiten Welt- krieg (über Medien wie einführende Lehrbuchliteratur und Curricula, vgl. Pahl 2011) und die parallel verlaufende Marginalisierung vormals gleichrangig konkur- rierender Ansätze zu sogenannten heterodoxen Schulen8 kann mit Fleck formuliert werden, dass der »kollektive Denkstil« eine »soziale Verstärkung« erhalten hat:
»Er wird zum Zwange für Individuen, er bestimmt ›was nicht anders gedacht werden kann‹. Ganze Epochen leben dann unter dem bestimmten Denkzwange, verbrennen Andersdenken- de, die an der kollektiven Stimmung nicht teilnehmen und den Kollektiv-Wert eines Verbre- chers haben, solange als nicht andere Stimmung anderen Denkstil und andere Wertung schafft« (Fleck 1994 [1935]: 130).
Damit möchte ich nicht suggerieren, dass die neoklassische Wissenschaftskultur ein gänzlich statischer Block war/ist, wo bereits die anfänglich hinzugegebenen Ingre- dienzien den Fortgang des Denkstils oder Paradigmas eindeutig determiniert haben. Aber sie hat »Spielregeln« vorgegeben, die den Variationsgrad von als wissen- schaftlich valide und solide betrachteten Zugriffsweisen eingegrenzt haben. Ausei- nandersetzungen wie solche zwischen Monetarismus und Keynesianismus, die ganz bestimmten Interessenkonstellationen innerhalb der Gesellschaft entspra- chen/entsprechen (siehe Blyth 2009; Janssen 2006), wurden auf einem vorforma- tierten analytischen Terrain ausgetragen.9 Und auch noch die innerhalb der Mainstream-Ökonomik als Zäsur gehandelte Lucas-Kritik (vgl. Lucas 1972), wo- nach die großen makroökonomischen Modelle der 1970er Jahre allesamt und kate- gorisch defizitär seien, weil sie die Antizipationen der Marktakteure auf staatliche Maßnahmen nicht berücksichtigen würden, war kein Ausscheren, sondern vielmehr eine Umstrukturierung innerhalb des Sets kodifizierter Spielregeln neoklassischer Wissenschaftskultur. Die Erblast der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie in der
8 Mehr noch: Heterodoxien galten fortan, wie Backhouse dies referiert, oftmals als »(o)rganized groups of economists who hold views that are regarded as beyond the pale – in much the same way that orthodox scientists have no time for parapsychology, homeo- pathy, phrenology, etc« (Backhouse 2004: 265).
9 Dazu führt Yonay aus: »Milton Friedman, the monetarist, and Paul Samuelson, the Keynesian, share the acceptance of mathematical economics, to which both have made numerous contributions, and of econometrics as the methodological armory for deciding between their models. The differences between them are about the coefficients of certain equations, not about the methodology or the general approach« (Yonay 1998: 193).
ZWISCHEN GLASPERLENSPIEL- UND INGENIEURSSEMANTIKEN | 15
Formatierung der Gesamtdisziplin besteht zum Beispiel in der Omnipräsenz von Optimierungshandeln als fixem Orientierungspunkt von Akteuren und im Rekurs auf sogenannte repräsentative (untereinander gleichartige) Akteure. Die Gesamt- wirtschaft wird als Aggregat aller stilisierten Einzelhandlungen konzipiert und weist diesen gegenüber keine emergenten Eigenschaften auf. Es bilden sich über den Gleichgewichtsmechanismus stets markträumende Preise; Dynamik und Neu- heit können nur über externe Schocks in die Modellwelten eingeführt werden. Inso- fern bleibt es nicht nur aus wissenschaftshistorischem Experteninteresse wichtig, die Genese ihres Aufstiegs zu einem disziplinbeherrschenden Standard von so vie- len Seiten wie möglich auszuloten, sondern auch, wie Kocyba mit Blick auf die Foucault’schen Forschungen zu einer Geschichte der Wahrheit formuliert, um »das Apriori unserer Gegenwart sichtbar zu machen« (Kocyba 2010: 105).
Ein ganz kurzer Blick in diese Gegenwart zeigt einerseits zahlreiche aktuelle Forschungen, die deutlich in der Tradition neoklassischer Wissenschaftskultur ste- hen. Dies betrifft nicht nur dominante Vermittlungsformen des Fachs in der Lehre, wo es vergleichsweise evident sein mag, dass Curricula und Lehrmittel Verände- rungstendenzen nur mit einiger Verspätung abbilden – »Most new textbooks are, generally speaking, clones of existing ones« (Hill/Myatt 2007: 58). Und es betrifft auch nicht nur die Omnipräsenz neoklassischer Deutungsmuster im Wirtschafts- journalismus oder in massenmedialen Verlautbarungen prominenter ökonomischer Fachvertreter (vgl. Maeße 2012). Sondern es bezieht sich auch auf Expertise und Beratung in den zentralen Organisationen der Weltverwaltung: Im Verlauf der Kri- se sind insbesondere die sogenannten DSGE-Modelle (Dynamic Stochastic General Equilibrium-Modelle) in Kritik geraten, die seit wenigen Jahren in vielen Zentral- und Notenbanken für Prognosezwecke (und insofern mittelbar auch als Determi- nanten von Geldpolitik) zum Einsatz kommen. Dogmenhistorisch betrachtet gelten sie als modelltheoretische Manifestation beziehungsweise Operationalisierung einer »zweiten neoklassische Synthese« (Goodfriend 2007; Woodford 2009), weil sie er- neut, wie bereits bei Hicks und Samuelson ab den späten 1930er Jahren praktiziert, eine Verknüpfung von mikroökonomischer Totalanalyse à la Gleichgewichtstheorie und Keynesianischer Makroökonomik beanspruchen.
Andererseits gibt es mehr oder minder deutliche Anzeichen für einen Wandel der Wirtschaftswissenschaften. Colander, Holt und Rosser (2004) sehen innerhalb des Mainstreams eine Reihe wichtiger Entwicklungen, die eine pauschale Klassifi- kation als »neoklassisch« korrekturbedürftig erscheinen lassen. Ihre Argumente sind um das Auftreten von Forschungsrichtungen zentriert, die mit einem oder mehreren der tradierten neoklassischen Axiome brechen: »We argue that economics is moving away from a strict adherence to the holy trinity – rationality, selfishness, and equilibrium – to a more eclectic position of purposeful behavior, enlightened self-interest and sustainability« (ebd.: 485). Ansätzen wie den Behavioral Econo- mics, den Experimental Economics oder dem Bereich der Komplexitätsökonomik
16 | HANNO PAHL
wird das bereits teilweise realisierte Potenzial zugesprochen, den Mainstream gleichsam von innen aufzusprengen und damit eine Transformation herbeizuführen, wie sie seitens der klassischen heterodoxen Schulen im Verlauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stets vergeblich angestrengt wurde.10 Wird in Rechnung ge- stellt, dass maßgebliche Wandlungsprozesse in der modernen Ökonomik über die Ausarbeitung neuartiger Modellierungstechniken stattfinden, dann rückt hier insbe- sondere der Bereich des Agent-Based Modeling in den Fokus. Originär aus dem in- terdisziplinären Bereich der Komplexitätsforschung herkommend werden diese Modellierungstypen – verstärkt seit der Krise 2007ff. – nun auch innerhalb der Ökonomik als vielversprechende Erkenntnismedien verhandelt. Sie werden mit- unter beschrieben als »only game in town capable to transform the prosaic descrip- tions of large scale evolution in human societies into somewhat more formal de- scriptions« (Hanappi u.a. 2009: 1), als »balance between the two methodological poles of formal mathematical modeling and verbal reasoning« (ebd.: 6). Agentenba- sierte Modellierungen sind kaum denkbar ohne den Einsatz von Software, sie wer- den vor allem als Simulationen durchgeführt. Im Unterschied zu traditionellen Varianten mathematischer Modellierung ermöglichen sie einen gänzlich neuartigen Umgang mit Komplexität, an die Stelle linear zu aggregierender repräsentativer (homogener) Akteure rücken lernfähige Agenten (teilautonome Programmbestand- teile). Auf der Ebene der Gesamtwirtschaft lassen sich auf diesem Weg Ordnungs- konfigurationen abbilden, die aus dem emergente Zustände generierenden Zusam- menspiel einer Vielzahl heterogener Akteure resultieren, ohne immer schon – wie in der gleichgewichtstheoretischen Tradition – auf analytisch vordefinierte Synthe- semechanismen zu rekurrieren. Gleichgewichtszustände werden in dieser Modell-
10 Auch bei vormaligen Big Shots neoklassischer Ökonomik finden sich Indizien für grund- legende Wandlungsprozesse, so besonders pointiert bei Arrow, der anlässlich einer Be- fragung von bekannten Fachvertretern zur Zukunft ihrer jeweiligen Disziplin seitens der Zeitschrift Science ausgeführt hat: »The foundations of economic analysis since the 1870s have been the rationality of individual behavior and the coordination of individual decisions through prices and the markets. There has already been a steady erosion of these viewpoints, particularly with regard to the coordination function. Now the rationali- ty of individual behavior is also coming under attack. What is still lacking is an overall coherent point of view in which individual analysis can be embedded and which can serve as a basis for new studies. What I foresee is a gradual systematization of dynamic adjustment patterns both at the level of individual behavior and at the level of interactions and transactions among economic agents. [...] In the course of this development, the very notion of what constitutes an economic theory may well change. For a century, some economists have maintained that biological evolution is a more appropriate paradigm for economics than equilibrium models analogous to mechanics« (Arrow 1995: 1617 f.).
ZWISCHEN GLASPERLENSPIEL- UND INGENIEURSSEMANTIKEN | 17
klasse nicht pauschal negiert, sondern als hochgradig voraussetzungsvolle Spezial- fälle rekonstruierbar (vgl. Axtell 2006).
Inwieweit sich die erwähnten Alternativen weiter durchsetzen, dürfte zwar un- klar sein, es lässt sich aber vermuten, dass die Krise 2007ff. ein eher günstiges Um- feld bereitstellt. Schon Fleck hat festgestellt, dass
»große Denkstilumwandlungen [...] sehr oft in Epochen allgemeiner sozialer Wirrnis entste- hen. Solche ›unruhigen Zeiten‹ zeigen den Streit der Meinungen, Differenzen der Standpunk- te, Widersprüche, Unklarheit, Unmöglichkeit eine Gestalt, einen Sinn unmittelbar wahrzu- nehmen – und aus diesem Zustande entsteht ein neuer Denkstil« (1994: 124 f.).
Krisen können zu einer schnelleren Entwertung von in ruhigen Zeiten akkumulier- ten wissenschaftlichen Kapitalien beitragen und so alternativem Wissen zum Durchbruch verhelfen. Eine solche Denkstilumwandlung, ob eruptiv à la Thomas Kuhn ausbrechend oder eher langsam fortschreitend, würde aber auch die nicht pri- mär auf Wirtschaft geeichten Stränge der Sozial- und Kulturwissenschaften dazu veranlassen müssen, ihre Rolle gegenüber der Mainstream-Ökonomik zu überden- ken. Forschungsrichtungen wie die New Economic Sociology oder die Wirtschafts- anthropologie konnten bis dato vor allem »parasitär« prosperieren, als Korrektiv gegenüber einer Ökonomik, die sich allzu stark auf Rationalität und Gleichgewicht »eingeschossen« hat. Kieserling erklärt den Erfolg solcherlei häretischer Zweitbe- schreibungen nicht zuletzt dadurch, dass sie den latenten Funktionen einzelner ge- sellschaftlicher Sphären nachspüren, wohingegen die – systemtheoretisch formuliert – offiziellen Reflexionstheorien dieser Bereiche nur auf deren manifeste Funktionen reflektieren:
»Man denke hier etwa an Religionssoziologie: der Protestantismus als Vorschule des Kapita- lismus; das Gottessymbol als Selbstbeschreibung der Gesellschaft; die eigentliche Religion als unsichtbar in den Kirchen, die sie zu repräsentieren beanspruchen. Oder an Rechtssozio- logie: Gesetzgebung als symbolische Politik; Strafverfolgung als kontingente Kriminalisie- rung; Interaktion im Gerichtsverfahren als symbolischer Beitrag zur Auskühlung und sozialen Isolierung derjenigen, die das Verfahren verlieren. Oder an die Erziehungssoziologie: Schule als Agentur der Reproduktion von Schichtung; Primat des heimlichen Lehrplans vor dem of- fiziellen Curriculum; Reformprogramme als Selbstbefriedigung eines pädagogischen Estab- lishments, das andernfalls wenig zu tun hätte« (Kieserling 2004: 27).
Eine mögliche neue Mainstream-Ökonomik, die sich – wie für den Fall agentenba- sierter Modellierung skizziert – aus dem doppelten kognitiven Gehäuse der Hörig- keit von Homo Oeconomicus und Gleichgewichtstheorie zu befreien in der Lage ist, zugleich aber einen relativ rigiden methodischen Stil beibehalten kann, würde dann
18 | HANNO PAHL
auch soziologische und anthropologische »Zweitbeschreibungen« der Wirtschaft unter deutlichen Anpassungsdruck setzen.
5. ZUR MÖGLICHKEIT EINES DISKURSANALYTISCHEN ZUGRIFFS AUF DIE WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
Zum einen sollte deutlich geworden sein, dass eine Besonderheit moderner (Mainstream-)Wirtschaftswissenschaft, wie sie uns heute selbstverständlich ist, in ihrem hochgradig formalen Charakter liegt, in der Verwendung von Mathematik als genuinem Medium von Theoriekonstruktion (vgl. Weintraub 2002) sowie von Mo- dellbildung als ubiquitärer epistemischer Praxis (vgl. Morgan 2012). Schumpeter hat die Eigenlogik oder den »Mehrwert« der Mathematik pauschal in den Worten festgehalten: »[M]athematische Theorie bedeutet mehr als eine Übersetzung von nichtmathematischer Theorie in die Sprache von Symbolen« (Schumpeter 2009 [1954]: 1163), um dieser Einschätzung aber noch hinzuzusetzen: »aber ihre Ergeb- nisse lassen sich im allgemeinen in die nichtmathematische Sprache übersetzen«. Wer nicht über das entsprechende Rüstzeug beziehungsweise die formale mathema- tische Ausbildung verfügt, kann sich zwar weiterhin über Resultate wirtschaftswis- senschaftlicher Forschung informieren, ist aber zunächst einmal von der Überprü- fung ihrer Herleitung ausgeschlossen. Morgan spricht bezogen auf den Aufstieg von Modellbildung als dominantem »Betriebsmodus« moderner Ökonomik von ei- ner »introduction of a new way of reasoning to economics« (Morgan 2012: 2 f., Herv. H.P.), akzentuiert also ebenfalls die Abhängigkeit der Kognition vom jeweils eingesetzten Erkenntnismedium. Dieser Text sollte aber zum anderen aufzeigen, dass es die Möglichkeit gibt, diesen für Außenstehende opak anmutenden Wissen- schaftsbereich mit diskursanalytischen Mitteln ein Stück weit aufzuschließen. Ge- rade weil die Mathematisierung und Formalisierung der Ökonomik auf Kosten an- dersgelagerter Kompetenzen und Reflexionsformen ging – »[t]he result has been that economists have been able to sustain an uncritical positivist self-image longer than has been possible in other social sciences. The role of language has, generally, not been seen by economists as raising any significant issues« (Backhouse u.a. 1993: 2) – ermöglicht ein diskursanalytischer Zugriff das Ausloten von weithin un- beobachtet gebliebenem Terrain. So verweisen auch die Arbeiten McCloskeys (1998) zu den Rhetorics of Economics darauf, dass Ökonomik keinesfalls als sprachfreie Sphäre rein mathematischer Symbolmanipulation prozessiert, sondern immer auch Vehikel der Überzeugung und Überredung enthält. Weil die Wirt- schaftswissenschaften trotz allem Ausmaß an Formalisierung eine empirische Dis- ziplin darstellen, bleiben die dortigen mathematischen Symbolzusammenhänge ka- tegorisch auf Referenzierungen in narrativer Form verwiesen. Düppe spricht von der »interpretive labor of the economics instructors. They literally invent narratives
ZWISCHEN GLASPERLENSPIEL- UND INGENIEURSSEMANTIKEN | 19
for mathematical objects, producing the impression of actual reference« (Düppe 2010: 13). Modelle und Formeln bedürfen, genau wie literarische Texte, der steti- gen Deutung und Interpretation (vgl. Horvath 2011: 59).
Mit dem Fallbeispiel ästhetischer Attribuierungen der Allgemeinen Gleichge- wichtstheorie und Selbstbeschreibungen aus dem Korpus früher ökonometrischer Texte wurde von mir freilich eine recht »oberflächliche« Schicht ökonomischer Diskursivität analysiert. Damit sind die Grenzen einer im weitesten Sinne diskurs- analytischen wissenschaftssoziologischen Strategie keineswegs erschöpft. Mirowski hat beispielsweise in More Heat than Light (1999) herausstellen können, in welcher Weise bereits das originäre »mathematische Skelett« der Allgemeinen Gleichge- wichtstheorie metaphorisch »kontaminiert« ist, weil es sich massiven Konzeptüber- nahmen aus der Physik des 19. Jahrhunderts verdankt. Es kam zu einer Übernahme dortiger Mathematik durch Austausch dessen, wofür die einzelnen Variablen inner- halb der mathematischen Symbolzusammenhänge standen, zu einer Ersetzung phy- sikalischer durch ökonomische Referenzen: »the core of the neoclassical research program is a mathematical metaphor appropriated from physics in the 1870s which equates potential energy to ›utility‹, forces to ›prices‹, commodities to spatial coor- dinates, and kinetic energy to the budget contraint« (Mirowski 1989: 176). Dies wirft Fragen danach auf, inwieweit es wissenschaftlich sinnvoll ist, ökonomische Strukturzusammenhänge entlang der Vorgaben einer anderen Disziplin zu modellie- ren und welche Probleme an einen solchen Import geknüpft sein können. Eine in- termediäre Ebene habe ich andernorts analysiert (vgl. Pahl 2013), wo gezeigt wer- den konnte, dass der Wandel der mathematischen Theoriebestandteile einerseits und der narrativen Ausdeutungen/Referenzierungen dieser abstrakten Symbolzusam- menhänge andererseits zwar nicht gänzlich unabhängig voneinander prozessiert, dass aber die Dimension der Erzählungen ganz eigenen Imperativen der Anschluss- fähigkeit und Aufmerksamkeit gehorcht als die Weiterentwicklung mathematischer Nachweisverfahren. Weil die mathematischen Strukturen – bei Walras ein System einander simultan determinierender Differentialgleichungen – mit Blick auf das, wofür sie stehen (sollen/können), notorisch unterbestimmt sind, eröffnen sie ganz verschiedenartige narrative Horizonte. So wurde Walras’ Theorie als strenger ma- thematischer Beweis der Überlegenheit freier Marktwirtschaften interpretiert, aber gleichzeitig von Marktsozialisten verschiedener Couleur als Nachweis der Mög- lichkeit effizienter Ressourcenallokation ohne Privateigentum an Produktionsmit- teln.
Diskursanalytische Interventionen ermöglichen es, solchen Deutungskämpfen auf die Spur zu kommen und sie als genuinen Bestandteil der Fachentwicklung ernst zu nehmen. Damit ermöglichen sie es zugleich, den stromlinienförmig gebau- ten Fortschrittsnarrativen der offiziellen dogmenhistorischen Selbstbeschreibungen der Mainstream-Ökonomik mit Skepsis zu begegnen, ohne sich automatisch den Verfallsgeschichten heterodoxer Kritiker anzuschließen. Während das erste Seg-
20 | HANNO PAHL
ment vergangene Theoriegestalten über Verfahren rationaler Rekonstruktion unmit- telbar in aktuellstes Theoriedesign übersetzt – »by dressing up past ideas in modern garb, often in the form of mathematical models that look just like something that might have appeared in the latest issue of the American Economic Review or the Journal of Political Economy« (Blaug 2001: 150, Herv. i. Orig.) – präsentieren mainstream-kritische Dogmengeschichten oftmals bloße Negativfolien, die spiegel- bildlich zu den Selbstbeschreibungen des Mainstreams gearbeitet sind. Die vorge- stellten diskursanalytischen Zugriffsweisen machen hingegen ein genealogisches Moment stark, indem sie die Konstitution eines ökonomischen Mainstreams zwar als faktischen Prozess diskutieren, aber auf die Unwahrscheinlichkeit eines solchen Vorgangs abstellen, auf Kontingenz, Fissuren und den Einfluss sozialer Faktoren. Mit Latour (1987: 15) ließe sich formulieren, dass die neoklassische Wissen- schaftskultur nicht als Ready Made Science adressiert wird, sondern Einblicke in den Prozess von Science in the Making gegeben werden.11
LITERATUR
Arrow, Kenneth (1995): Viewpoint: The Future. In: Science. New Series 267, H. 5204, S. 1617 f..
Arrow, Kenneth/Debreu, Gerard (1954): Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. In: Econometrica 22, H. 7, S. 265-290.
Axtell, Robert L. (2006): Multi-agent Systems Macro: A Prospectus. In: David C. Colander (Hg.): Post Walrasian Macroeconomics. Beyond the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Cambridge/New York, S. 203-220.
11 Der Stichwortgeber Latour verweist dabei zugleich auf einige Grenzen diskursanalyti- scher Beobachtungen moderner Ökonomik. In einem Kommentar zu Vogls (2010) Das Gespenst des Kapitals, das die Entwicklung moderner Ökonomik konzise von kulturwis- senschaftlicher Warte analysiert, wurde bei Halsmayer und Huber (2013: 49) der Ein- wand erhoben, wonach die Welt der Wirtschaftswissenschaften bei Vogl – entgegen des- sen eigenen Intentionen – wesentlich textuell verfasst erscheint, »sodass die Praxis in Gestalt von Produktionsweisen und Darstellungstechniken, die ihrerseits ökonomische Diskurse formatieren, reduzieren und normieren, in den Hintergrund tritt«. Die dort ge- nannte Limitierung trifft zweifelsohne auch auf den hier verfolgten Zugriff zu. Im Unter- schied zu den Naturwissenschaften, wo seitens der Social Studies of Science recht früh auf die konkrete Forschungspraxis reflektiert wurde (vgl. Pickerings (1995) Arbeiten oder die Laborstudien), hat es der dominante Eindruck von Ökonomik als Pen-and-Paper- Science lange Zeit verhindert, der Materialität beziehungsweise Medialität ihrer epistemi- schen Genres Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
ZWISCHEN GLASPERLENSPIEL- UND INGENIEURSSEMANTIKEN | 21
Backhouse, Roger E. (2002): The Penguin History of Economics. London. Ders. (2004): A Suggestion for Clarifying the Study of Dissent in Economics. In:
Journal of the History of Economic Thought 26, H. 2, S. 261-271. Ders. (2010): The Puzzle of Modern Economics. Science or Ideology. New York. Ders./Dudley-Evans, Tony/Henderson, Willie (1993): Exploring the Language and
Rhetoric of Economics. In: Willie Henderson/Tony Dudley-Evans/Roger Backhouse (Hg.): Economics and Language. London/New York, S. 1-20.
Blaug, Mark (2001): No History of Ideas, Please, We’re Economists. In: Journal of Economic Perspectives 15, H. 1, S. 145-164.
Blyth, Mark (2009): Great Transformations. Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. Reprinted. Cambridge.
Bos, Frits (2007): Use, Misuse and Proper Use of National Accounts Statistics (National Accounts Occasional Paper, NA-096). http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2576/ vom 18.05.2012.
Boumans, Marcel (2005): How Economists Model the World into Numbers. New York.
Bryant, Tony (2012): ECON490/860. Advanced Microeconomics Semester 1, 2012 (Kursbeschreibung). http://www.businessandeconomics.mq.edu.au/postgraduate_coursework_progra ms/postgraduate_units/postgraduate_units_2012/ECON860_490UnitOutline_S1 _2012.pdf.
Caballero, Ricardo. J. (2010): Macroeconomics after the Crisis: Time to Deal with the Pretense-of-Knowledge Syndrome. In: Journal of Economic Perspectives 24, S. 85-102.
Colander, David/Holt, Richard P. F./Rosser, J. Barkley (2004): The Changing Face of Mainstream Economics. In: Review of Political Economy 16, H. 4, S. 485- 499.
Davidson, Paul (1990): A Post Keynesian Positive Contribution to Theory. In: Journal of Post Keynesian Economics 13, H. 2, S. 298-303.
Debreu, Gerard (1986): Mathematical Form and Economic Content. In: Econometrica 54, H. 6, S. 1259-1270.
Düppe, Till (2010): Debreu’s Apologies for Mathematical Economics After 1983. In: Erasmus Journal for Philosophy and Economics 3, H. 1, S. 1-32.
Ders. (2011): The Making of the Economy. A Phenomenology of Economic Science. Lanham u.a.
Elsner, Wolfram/Lee, Frederic S. (2010): Editors’ Introduction. In: The American Journal of Economics and Sociology 69, H. 5, S. 1333-1344.
Flasbeck, Heiner (2004): Glasperlenspiel oder Ökonomie. Der Niedergang der Wirtschaftswissenschaften. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 9, S. 1071-1079.
22 | HANNO PAHL
Fleck, Ludwik (1994 [1935]): Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftli- chen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. 3. Aufl. Frankfurt a.M.
Friedman, Milton (1955): Leon Walras and his Economic System. In: The American Economic Review 45, H. 5, S. 900-909.
Frisch, Ragnar (1946): The Responsibility of the Econometrician. In: Econometrica 14, H. 1, S. 1-4.
Goodfriend, Marvin (2007): How the World Achieved Consensus on Monetary Poli- cy. Cambridge MA. (= NBER Working Paper Series, 13580). http://www.nber.org/papers/w13580 vom 17.12.2012.
Grabas, Margrit (2002): Große Nationalökonomen zwischen Glorifizierung und Verachtung – Einige Überlegungen zum Zusammenhang von Rezeptions-, Wis- senschafts- und Wirtschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert. In: Historical Social Research 27, H. 4, S. 204-241.
Halsmayer, Verena/Huber, Florian (2013): Ökonomische Modelle und brüchige Welten – Joseph Vogls Das Gespenst des Kapitals. In: Hanno Pahl/Jan Sparsam (Hg.): Wirtschaftswissenschaft als Oikodizee? Diskussionen im Anschluss an Joseph Vogls Das Gespenst des Kapitals. Wiesbaden, S. 27-52.
Hanappi, Hardy/Radax, Wolfgang/Rengs, Bernhard/Wäckerle, Manuel (2009): Modelling Global Institutional Networks. Paper Presented at the EAEPE Confe- rence 2009, November 6-8 in Amsterdam. http://ftp.vwl.tuwien.ac.at/hanappi/Papers/EAEPE_2009_07_11_09.pdf vom 29.11.2012.
Hardy, Godfrey Harold (1940): A Mathematician’s Apology. Cambridge. Heisenberg, Werner (1971): Physics and Beyond: Encounters and Conversations.
New York. Hildenbrand, Werner (1983): Introduction. In: Gerard Debreu (Hg.): Mathematical
Economics. Twenty Papers of Gerard Debreu. Introduction by Werner Hilden- brand. 1. Aufl. Cambridge/New York, S. 1-29.
Hill, Roderick/Myatt, Anthony (2007): Overemphasis on Perfectly Competitive Markets in Microeconomics Principles Textbooks. In: Journal of Economic E- ducation 38, H. 1, S. 58-77.
Horvath, Michael (2011): Vielfalt der Deutungen statt exakter Modelle? Möglich- keiten und Grenzen des interdisziplinären Dialogs zwischen Ökonomik und Kulturwissenschaft. In: Christine Künzel/Dirk Hempel (Hg.): Finanzen und Fik- tionen. Grenzgänge zwischen Literatur und Wirtschaft. Frankfurt a.M./New Y- ork, S. 45-66.
Janssen, Hauke (2006): Milton Friedman und die monetaristische Revolution in Deutschland. Marburg.
Kieserling, André (2004): Selbstbeschreibung und Fremdbeschreibung. Beiträge zur Soziologie soziologischen Wissens. Frankfurt a.M.
ZWISCHEN GLASPERLENSPIEL- UND INGENIEURSSEMANTIKEN | 23
Kocyba, Hermann (2010): Diskursanalyse als neue Wissenssoziologie? Über einige Schwierigkeiten der disziplinären Verortung Foucaults. In: Robert Feustel/Ma- ximillian Schochow (Hg.): Zwischen Sprachspiel und Methode. Perspektiven der Diskursanalyse. Bielefeld, S. 99-117.
Köllmann, Carsten (2006): Das elegante Universum und seine hemdsärmelige Wirt- schaft: Ästhetische Aspekte der Wirtschaftswissenschaft. In: Wolfgang Krohn (Hg.): Ästhetik in der Wissenschaft. Interdisziplinärer Diskurs über das Gestal- ten und Darstellen von Wissen. Hamburg, S. 79-104.
Latour, Bruno (1987): Science in Action. Cambridge MA. Lee, Cassey/Lloyd, Peter L. (2005): Beauty and the Economist: The Role of
Aesthetics in Economic Theory. In: Kyklos 58, H. 1, S. 65-86. Lucas, Robert E. (1972): Expectations and the Neutrality of Money. In: Journal of
Economic Theory 4, S. 103-124. McAllister, James William (1999): Beauty & Revolution in Science. Ithaca, Lon-
don. McCloskey, Deirdre N. (1998): The Rhetoric of Economics. 2. Aufl. Madison WI. Maeße, Jens (2012): Ökonomisches Expertentum und transversale Öffentlichkeit.
In: Anja Peltzer/Kathrin Lämmle/Andreas Wagenknecht (Hg.): Krise, Cash & Kommunikation. Die Finanzkrise in den Medien. Konstanz, S. 113-137.
Mirowski, Philip (1989): The Probabilistic Counter-Revolution, or How Stochastic Concepts came to Neoclassical Economic Theory. In: Oxford Economic Papers, New Series 41, H. 1, S. 217-235.
Ders. (1999): More Heat Than Light. Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics. Cambridge.
Morgan, Mary S. (1990): The History of Econometric Ideas. Cambridge. Dies. (2012): The World in the Model. How Economists Work and Think. Cam-
bridge. Dies./Rutherford, Malcolm (Hg.) (1998): From Interwar Pluralism to Postwar Neo-
classicism. Durham NC. Niewöhner, Jörg (2012): Von der Wissenschaftstheorie zur Soziologie der Wissen-
schaft. In: Stefan Beck/Jörg Niewöhner/Estrid Sørensen (Hg.): Science and Technology Studies. Eine sozialanthropologische Einführung. Bielefeld, S. 49- 75.
Nützenadel, Alexander (2005): Stunde der Ökonomen. Wissenschaft, Politik und Expertenkultur in der Bundesrepublik 1949-1974. Göttingen.
Pahl, Hanno (2011): Textbook Economics. Zur Wissenschaftssoziologie eines wirt- schaftswissenschaftlichen Genres. In: Prokla. Zeitschrift für kritische Sozialwis- senschaft 164, S. 369-388.
Ders. (2013): Disziplinierung und Popularisierung ökonomischen Wissens als wechselseitiger Verstärkungsprozess: Konstituentien der Oikodizee. In: ders./ Jan Sparsam (Hg.): Wirtschaftswissenschaft als Oikodizee? Diskussionen im Anschluss an Joseph Vogls Gespenst des Kapitals. Wiesbaden, S. 53-76.
24 | HANNO PAHL
Pickering, Andrew (1995): The Mangle of Practice. Time, Agency, and Science. Chicago, Ill.
Popper, Karl R. (1987): Das Elend des Historizismus. 6., durchges. Aufl. Tübingen. Roos, Charles F. (1933): Constitution of the Econometric Society. In: Econometrica
1, H. 1, S. 106-108. Ders. (1948): A Future Role for the Econometric Society in International Statistics.
In: Econometrica 16, H. 2, S. 127-134. Samuelson, Paul Anthony/Nordhaus, William D. (2005): Economics. 18. Aufl.
Boston, Mass. Schumpeter, Joseph A. (1933): The Common Sense of Econometrics. In: Econo-
metrica 1, H. 1, S. 5-12. Ders. (2009 [1954]): Geschichte der ökonomischen Analyse. Göttingen. Speich, Daniel (2011): The Use of Global Abstractions: National Income Accoun-
ting in the Period of Imperial Decline. In: Journal of Global History 6, S. 7-28. Vogl, Joseph (2011): Das Gespenst des Kapitals. 2. Aufl. Zürich. Walker, Donald Anthony (Hg.) (2006): William Jaffe’s Essays on Walras. Cam-
bridge. Walras, Leon (1954 [1874]): Elements of Pure Economics, or The Theory of Social
Wealth. London. Weintraub, Eliot Roy (2002): How Economics Became a Mathematical Science.
Durham. Woodford, Michael (2009): Convergence in Macroeconomics: Elements of the New
Synthesis. In: American Economic Journal: Macroeconomics 1, H. 1, S. 267- 279.
Yonay, Yuval P. (1998): The Struggle over the Soul of Economics. Institutionalist and Neoclassical Economists in America between the Wars. Princeton NJ.