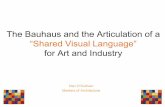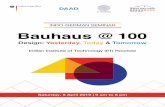Not the Bauhaus: The Breslau Academy of Art and Applied Arts
"Das Bauhaus nach 1933: Migrationen und semantische Verschiebungen." Mythos Bauhaus: Zwischen...
Transcript of "Das Bauhaus nach 1933: Migrationen und semantische Verschiebungen." Mythos Bauhaus: Zwischen...
Mythos Bauhaus setzt sich kritisch mit dem Bauhaus als Ikone der Moderne auseinander und stellt das Bild in Frage, das wir vom Bauhaus haben. Dabei wird die Vielfalt und Widersprüchlichkeit der schule offenbar, die in vielen aspekten die Geschichte der Weimarer Republik spiegelt. Die autoren behandeln die architekten und die architektur ebenso wie die Maler und die Rezeption der Bauhaus-Moderne in der Nachkriegszeit.
Die autoren: anja Baumhoff, Loughborough; Peter Bernhard, Erlangen; Irene Below, Bielefeld; Klaus von Beyme, heidelberg; Kathleen James-Chakraborty, Dublin; Magdalena Droste, Cottbus; Regina Göckede, Cottbus; Nicola hille, tübingen; helmuth Lethen, Wien; Dietrich Neumann, New haven; Paul Paret, salt Lake City; Wolfgang Ruppert, Berlin; sigrid schade, Zürich; Karl schawelka, Weimar; Robin schuldenfrei, Chicago; Frederic J. schwartz, London; Christoph Wagner, Regensburg.
hg. anja Baumhoff und Magdalena Droste
Mythos Bauhaus
ReimerMyt
ho
s Bau
hau
s
Zentrum für interdisziplinäre ForschungCenter for Interdisciplinary ResearchUniversität Bielefeld
Herausgegeben von Anja Baumhoff und Magdalena Drostein Kooperation mit Sigrid Schade, ICS ZürichRedaktion: Anja Baumhoff, Magdalena DrosteÜbersetzungen der Beiträge von Kathleen James-Chakraborty, Dietrich Neumann, Paul Paret, Robin Schuldenfrei und Frederic J. Schwartz: Anja Baumhoff
Gefördert durchHOCHTIEFBTU CottbusZIF BielefeldICS Zürich
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Gestaltung: Studierende der Fakultät Architektur der BTU BrandenburgischenTechnischen Universität Cottbus, inbesondere Sophie Reinisch und Matthias AbendSchrift: Poynter OSTextTWOL (12pt), Dictrict (6 pt, 12pt, 72pt) Umschlagfoto: Walter Gropius, Meisterhaus Klee-Kandinsky, Dessau, 1926Restaurierung: HOCHTIEF, 1999Foto: Dominik Lengyel, 2009
© 2009 bei den einzelnen Autoren und Dietrich Reimer Verlag GmbH, Berlinwww.reimer-verlag.de
Alle Rechte vorbehaltenGedruckt auf alterungsbeständigem PapierDruck: Elbe Druckerei Wittenberg GmbHPrinted in Germany
ISBN 978-3-496-01399-0
© VG Bild-Kunst, Bonn 2009 (s. S. 363)
Zwischen Selbsterfindung und EnthistorisierungHg. Anja Baumhoff und Magdalena Droste
Reimer
MYTHOSBAUHAUS
277
Spätestens seit Anfang der 1990er Jahre avanciert die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte des Bauhauses zu einem eigenständigen Forschungsfeld der Bauhausforschung. Für diese Entwicklung stehen Studien wie die von Margret Kentgens-Craig zur Rezeption der Bauhaus-Architektur in den USA der 1920er und 1930er Jahren,1
Gabriele Graves Untersuchung zum Wirken und zur Wirkung ehemaliger Bauhäusler und Bauhäuslerinnen im amerikanischen Exil,2 aber auch der von Winfried Nerdinger herausgegebene Sammelband zur »Bauhaus-Moderne im Nationalsozialismus«3 sowie das vom Deutschen Forum für Kunstgeschichte realisierte bilaterale Forschungsprojekt »Das Bauhaus und Frankreich«.4 Den spezifisch deutsch-israelischen Bauhaus-Effekten wird etwa in Jeannine Fiedlers »Social Utopias of the Twenties: Bauhaus, Kibbutz and the Dream of the New Man«5 oder in Herbert und Sosnowskys »Bauhaus on the Carmel and the Crossroads of Empire«6 nach-gegangen.
Im Fokus dieser und zahlreicher weiterer Einzelbeiträge steht offenbar nicht zufällig der Sektor der Architektur. Sehr früh verengt sich keineswegs nur der populäre Diskurs über das Bauhaus auf die wohl öffentlichste aller Kunstformen. Hier gelingt es den Auto-rinnen und Autoren anscheinend am leichtesten, den dominanten unilinearen Geschichtsentwurf einer sich fortschreitend internation-alisierenden Bauhaus-Moderne zu verifizieren.
Mit dem vorliegenden Beitrag riskiere ich insofern, mich meiner-seits dem Verdacht auszusetzen, an den vielfach kritisierten se- m antischen Verengungen des Bauhaus-Idioms zu partizipieren. Denn auch im Folgenden soll die Geschichte der Bauhaus-Repräsentation zuvorderst aus architekturhistoriographischer Perspektive diskutiert werden. Diese Entscheidung ist zum einen dem Forschungsschwer-punkt der Autorin – der Transformation der Architekturmoderne unter den Bedingungen des Exils – geschuldet; sie erwidert aber zum anderen die Tatsache, dass jene historischen Verschiebungen der Bauhaus-Bedeutung, die kritisch zu rekapitulieren das zentrale Motiv meines Unterfangens bildet, nirgendwo so deutlich zu Tage treten, wie in den ungebrochen virulenten Debatten über die so ge-nannte »Bauhaus-Architektur«, ihren Stil und ihre Protagonisten.
Rezeptionstheoretische Positionsbestimmung
An dieser Stelle erscheint eine erste rezeptionstheoretische Klärung des hier gewählten Zugangs geboten: Bei vielen Fachwissenschaft-lern geschieht das Fragen nach den wechselnden Orten, Akteuren, Medien und Formen der historischen Bauhaus-Rezeption anschei-
1 Margret Kentgens-Craig, Bauhaus-Architektur. Die Rezeption in Amerika, 1919–1936. Frankfurt a. M. 1993.
2 Gabriele Diana Grave, Call for Action. Mitglie-der des Bauhauses in Nordamerika. Weimar 2002.
3 Winfried Nerdinger (Hg.), Bauhaus-Moderne im Nationalsozialismus. Zwischen Anbiederung und Verfolgung. München 1993.
Regina Göckede Das Bauhaus nach 1933: Migrationen und semantische Verschiebungen
4 Isabelle Emig/Thomas W. Gaehtgens/Matthias Noell (Hg.), Das Bauhaus und Frankreich. 1919–1940. Le Bauhaus et la France. Berlin 2002.
5 Vgl. Jeannine Fiedler (Hg.), Social Utopias of the Twenties. Bauhaus, Kibbutz and the Dream of the New Man. Wuppertal 1995.
6 Gilbert Herbert/Silvina Sosnovsky, Bauhaus on the Carmel and the Crossroads of Empire: Archi-tecture and Planning in Haifa during the British Mandate, Jerusalem 1993.
Abb.14.01 Bauhaus-Schriftzug mit Schattenwurf an der Südseite des Werkstättentrakts, Dessau um 1930.
278 Regina GöckedeDas Bauhaus nach 1933: Migrationen und semantische Verschiebungen
nend zuvorderst in Sorge um das phänomenale Objekt ihres Aus-gangstopos, um die historische Wahrheit der 1933 endgültig aufge-lösten pädagogischen Einrichtung. Sie schreiben in Sorge um die in ihrer Lehrpraxis zum Ausdruck gebrachte Idee ebenso wie in Sorge um ihre materiellen Errungenschaften und internationalen Transfer-leistungen. Ihnen geht es primär um die Sicherung des Bauhauserbes durch die genaue und möglichst widerspruchsfreie Bestimmung des historischen Standortes des Bauhauses, jenseits der allseits be-klagten Mythologisierung.
Dieses Vorgehen ist durchaus notwendig und legitim, führt aber in rezeptionskritischer Hinsicht zu durchaus folgenreichen Selbst-begrenzungen. Die Setzung eines ontologisch begriffenen Ur-sprungsereignisses Bauhaus als zentrale Referenz und wichtigsten Vergleichs punkt riskiert nämlich, den unerlässlichen Blick auf die kaum überschaubare Fülle gänzlich anders gelagerter soziopoliti-scher, ideologischer und kulturgeschichtlicher Kontingenzen inner-halb des kritisierten Rezeptionsprozesses zu verlieren.
Da das Reden und Schreiben über das Bauhaus besonders nach 1933 vor dem Hintergrund von Flucht, Migration und Exil mit seinen ehemaligen Protagonisten in alle Welt verstreut wurde, hat sich das sprachliche Zeichen seitdem fortschreitend von seinem erstmals 1919 kodifizierten Verweisungssystem entfernt. An dessen Stelle sind im Laufe eines keineswegs gleichgerichteten Resignifizierungs-prozesses zahlreiche neue Referenzkorpora getreten, die eher auf die partikularen Korrelate ihrer divergierenden Entstehungskontexte als auf das Architekturgeschehen der Weimarer Republik verweisen. Sollen also das Bauhaus beziehungsweise die mit dem Bauhaus-Begriff konnotierten Architekturen und Architekturdiskurse nicht als ein abgeschlossenes kulturgeschichtliches Ereignis, sondern als fortgesetzter Rezeptionsgegenstand mit zum Teil widersprüchlichen, aber nichts desto weniger traditionsbildenden Wirkungsgeschich-ten – als Konglomerat von großen Erzählungen und marginalisierten Nebengeschichten – behandelt werden, dann müssen eine Reihe überkommener Postulate der architekturhistoriographischen Praxis zurückgewiesen werden. Das betrifft genauso die traditionelle Konzeption von authentischen Ursprüngen und linearen Kontinui-täten wie das Primat von herkömmlichen Entwicklungsfragen. Die geforderte theoretisch-methodologische Revision richtet sich jedoch zuvorderst gegen die vereinfachende Konzeptionalisierung von Umdeutungsprozessen als Fehldeutungsprozesse. Es geht an dieser Stelle nicht darum, die retrospektive Demontage oder Verzerrung historischer Ereignisse sowie deren materiellen Manifestationen zu rechtfertigen. Vielmehr wirbt der folgende Beitrag für eine rezep-
279
tionskritische Architekturhistoriographie, welche die divergierenden Nachleben des historischen Bauhauses zwar zunächst um ihrer selbst Willen erforscht, aber diese Nachleben in einem zweiten Schritt nichtsdestoweniger als Bestandteile der Bauhausgeschichte begreift.
Bedeutungswechsel und Ideenreisen: fachfremde Anleihen
Die initialen Parameter für die theoretische Fundierung des im Vor-angegangenen skizzierten rezeptionskritischen Vorhabens lassen sich besonders aus den Schriften zweier Intellektueller im amerika-nischen Exil gewinnen, die allerdings kaum für ihre Architektur-kritik, geschweige denn für ihre Bauhaus-Rezeption bekannt sind: Theodor W. Adorno und Edward W. Said.
Theodor W. Adorno stellt in seinen zwischen 1944 und 1947 in Brentwood, Los Angeles verfassten »Reflexionen aus dem beschä-digten Leben«,7 den »Minima Moralia«, nicht nur fest, dass aus »der Entfernung (...) der Unterschied von Wiener Werkstätte und Bauhaus nicht mehr so erheblich (ist)«,8 sondern formuliert dort vor allem auch seine radikale Kritik des positivistischen Moderni-tätsverständnisses. Im Mittelpunkt seiner pessimistischen Diagnose steht die Kritik jener Ontologie der Moderne, die das Neue zum begrifflichen Schema zu verhärten sucht. »Über die ›Urgeschichte der Moderne‹« – heißt es in dem 150. Fragment seiner Aphorismen-sammlung – könne »die Analyse des Bedeutungswechsels belehren, der mit dem Worte Sensation sich zutrug, dem exoterischen Syno-nym fürs Baudelairesche Nouveau.«9
Das amerikanische Exil, das Leben in dem neuen Zentrum der sich fortschreitend globalisierenden Kulturindustrie lässt den Philo-sophen der negativen Dialektik erkennen, dass die kulturelle Logik der Moderne aufs Engste mit dem Prozess der Bedeutungsver-schiebung verflochten ist. Eben diesen Gedanken der entfernten Entlehnungen, selektiven Umdeutungen und interpretativen Syno-nymisierung als notwendig konstitutives Moment in der kulturellen Dynamik transnationaler Zirkulationen greift beinahe vierzig Jahre später der palästinensisch-amerikanische Kulturkritiker und Adorno-Interpret Edward W. Said in seinem Essay »Traveling Theory« auf.10 Said fragt danach, was geschieht, wenn Denkschulen, Theorien oder Ideen von einem Ort zum anderen, von einer Zeit in die andere wandern. Er behandelt die von ihm herangezogenen Untersuchungen – etwa Lucien Goldmanns Adaption von Georg Lukács‘ »Geschichte und Klassenbewusstsein« – nicht als zu nivellierende Fehlinterpretation, sondern als kreativen Prozess
7 Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt a. M. 231997.
8 a. a. O., S. 41.
9 a. a. O., S. 317.
10 Erstmals erschienen als: Edward W. Said, Tra-veling Theory, in: Raritan 1, H. 3, 1982, S. 41–67. Ich beziehe mich im Folgenden auf die deutsche Übertragung von Brigitte Flickinger, Theorien auf Wanderschaft, in: Edward W. Said, Die Welt, der Text und der Kritiker. Frankfurt a. M. 1997, S. 263–292.
280 Regina GöckedeDas Bauhaus nach 1933: Migrationen und semantische Verschiebungen
und notwendigen Bestandteil kreativer Ideentransfers im Zeitalter kultureller Transnationalisierung. Nicht die Kontinuitäten sich linear verbreitender geschlossener Konzepte, sondern die Widerstände, Kollisionen und Brüche bei dem Versuch der Domestizierung und Affiliierung zirkulierender Ideen avancieren zum eigentlichen Ge-genstand der Kritik: »Ob diese Zirkulation nun in Form eines be-wussten oder unbewussten Entschlusses geschieht, als schöpferische Anleihe oder als vollkommene Vereinnahmung,« – so heißt es bei Edward Said – »die Bewegung von Ideen und Theorien von einem Ort zum anderen ist eine Lebenstatsache und eine Ausgangsbedin-gung intellektueller Tätigkeit.« Man müsse untersuchen – schreibt der um die Dezentrierung der westlich-europäischen Perspektive bemühte Theoretiker weiter – »ob eine Idee oder Theorie durch ihre Wanderung (...) an Kraft gewinnt oder verliert und ob sie in der einen geschichtlichen Phase und nationalen Kultur zu etwas ganz anderem wird, als in einer anderen Phase oder Situation.«11
Die hieraus resultierenden Fragmentierungen, Verwirrungen und Unregelmäßigkeiten können demnach fruchtbar gemacht werden, um den homogenen Erzählraum zu stören, den die traditionellen Wissenschaften zusammenhalten sollen.
(Be-)Deutungen, welche die Unterschiede machen: kritische Bauhaus- Rezeption und Déconstruction
Worauf sowohl Adorno als auch Said hinweisen, ist die Notwendig-keit, jeden Akt moderner Bedeutungsherstellung als intentionalen Äußerungsakt der Verschiebung einer vorgefundenen Bedeutung zu begreifen. Beide legen damit, auch wenn dies nicht explizit ge-schieht, ein semiotisches Verfahren bei der Analyse der historischen Bauhaus-Rezeption nahe.
Zwar wird in der einschlägigen Sekundärliteratur zum Topos Bau-haus auf die besondere phonetische Qualität des aus zwei einsilbi-gen Wortstämmen mit dem Diphton »au« gebildeten Schlagworts »Bauhaus« hingewiesen, die diesem gerade im angelsächsischen Sprachraum mit einem hohen Grad an Eingängigkeit und Erinner-barkeit ausstattet, zumal das deutsche »Haus« und das englische »house« sich in der Aussprache nicht wesentlich unterscheiden.12 Darüber hinaus sucht man aber vergeblich eine theoretische In-dienstnahme von Ferdinand de Saussures strukturaler Linguistik oder von Claude Levi-Strauss‘ Strukturanalyse gesellschaftlicher Symbolsysteme für die Analyse der das Bauhaus betreffenden Repräsentationssysteme. In Saussures Perspektive ist bekanntlich Bedeutung der Effekt eines differentiellen sprachlichen Systems.
12 So z.B. bei Kentgens-Craig (wie Anm. 1), S. 117.
11 a.a.O., S. 263.
281
Bedeutungen erklären, heißt im Sinne Saussures, Gegensatzbezie-hungen und Kombinationsmöglichkeiten, die eine Sprache konstitu-ieren, darzulegen. Levi-Strauss überträgt dieses Erklärungsmuster auch auf nicht linguistische Formen gesellschaftlichen Austausches und begreift jeden Akt sozialer Bedeutungsherstellung als Pro-duktion von Differenzbeziehungen. Jacques Derrida wendet sich schließlich gegen die logozentristische Annahme, dass Bedeutung als etwas zu behandeln ist, das irgendwo präsent sei. Ihn interessiert nicht länger das Verhältnis einer ontologischen Präsenz zu deren Repräsenz, sondern der Akt des Unterscheidens, die Herstellung eines Systems von Differenzen durch Bedeutungsaufschübe. Er be-zeichnet sowohl die passive Differenz, die als Bedingung des Be-deutens immer bereits gegeben ist, als auch die performative Ak-tivität der Differenzerzeugung als différance.
An dieser Stelle soll nicht die Konsistenz und Widersprüchlichkeit der philosophischen déconstruction diskutiert werden. Vielmehr steht der Versuch im Vordergrund, eine nicht kunstwissenschaft-liche kritische Rezeptionsmethode für die Zwecke der architektur-geschichtlichen Rezeptionskritik selektiv in Dienst zu nehmen. Eine Methode, die, anstatt den einheitsstiftenden Inhalt oder Gegenstand eines historischen Textes in einer widerspruchsfreien Ausgangs-referenz sucht, sich dem Wechsel kontextueller Determinanten bei der Genese disjunktiver Äußerungsakte zuwendet; eine Methode, welche die Funktionsweise solcher Äußerungsakte erklärt, die Un-terscheidungen hervorbringen. Geschichte und Geschichtsschrei-bung werden so nicht länger als losgelöste Autorität idealistisch pri-vilegiert, sondern schlicht als Bestandteil dessen behandelt, was Derrida »le texte général«, den allgemeinen Text nennt.
Wenn nun aber Sinn – historischer Sinn – aus ernsthaften wie auch aus nicht ernsthaften Repräsentationsakten von neuen Verbindungen, Korrelationen und Kontexten entsteht, wenn also Bedeutung aus Aufpfropfungen resultiert, wie der französische Philosoph argumen-tiert, welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die kritische Analyse der Bauhaus-Rezeption? 13 Wie ließen sich besonders in den Geschichtserzählungen über die Karriere des Bauhaus-Idioms, der Bauhaus-Architektur oder des Bauhaus-Stils dieses Aufpfropfen (greffe) identifizieren? Wo sind die Verbindungspunkte, Akzente und Gegensatzkonstruktionen durch die ein Ableger, ein neuer Argumentationsstrang, eine neue Konnotation oder ein neues natio-nales Referenzsystem dem Symbol »Bauhaus« aufgepfropft wird, so dass bei Beibehaltung des alten Namens, wenn nicht eine völlig neue Bedeutung, so zumindest eine reduzierte oder aber erweiterte entsteht? Wie geschieht also in diesem Sinne die Dissemination,
13 Das Aufpfropfen als Denkmodell führte Derri-da 1972 in dem Aufsatz »La double séance« ein (Jacques Derrida, La doube séance, in: ders., La dissémination. Paris 1972, S. 199–317).
282 Regina GöckedeDas Bauhaus nach 1933: Migrationen und semantische Verschiebungen
die Verbreitung oder Ausstreuung des Bauhauses? Und vielleicht ebenso wichtig: Welche neuen Gegensatzbeziehungen geht das Idi-om, der Stilbegriff oder die spezifische Konzeption der Architektur-moderne in wechselnden raum-zeitlichen Hintergründen ein – welches konstituierende Gegenüber verliert sich vielleicht innerhalb dieses Prozesses?14
Zwei Fallstudien
Es wäre eine immense Aufgabe, alle Stadien der weltweiten Wan-derung der Bauhaus-Idee, ihre divergierenden Darstellungen und Institutionalisierungsprozesse sowie deren soziopolitischen und ideologischen Möglichkeitsbedingungen für die Geschichte der modernen Architektur zu beschreiben. Eine derartige Untersuchung stellte eine enorme Herausforderung dar und würde den hier zur Verfügung stehenden Raum zweifelsohne sprengen. Dennoch er-scheint es geboten, die konstatierten Probleme in der Analyse der Bauhaus-Rezeption nicht nur mit alternativen theoretisch-methodo-logischen Vorschlägen zu erwidern, sondern dieselben auch zu illustrieren. Dies soll im Anschluss mittels zweier exemplarischer Einzelanalysen geschehen. Wenn es auf diese Weise gelänge, das allgemeine Verständnis von der Bauhaus-Moderne zu vervielfälti-gen, wäre mehr als nur ein Nebeneffekt erzielt.
Bei den folgenden Analysen der amerikanischen und israelischen Bauhaus-Rezeption konzentriere ich mich im Wesentlichen auf die Bedeutung ideologisch auferlegter Gegensätze, da diese fraglos auch für das Verständnis der Bauhaus-Rezeption in der Weimarer Republik, im Nationalsozialismus sowie im geteilten Nachkriegs-deutschland von großer Relevanz sind. Gleichzeitig dürfen aber die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen nationalen Rezep-tionsdiskursen nicht ausgeschlossen werden. Auch dies zeigen die Beispiele des amerikanischen und israelischen Bauhaus-Diskurses überaus deutlich.
Das Bauhaus und die spätkapitalistische Hegemonialisierung der US-amerikanischen Kulturindustrie
Margret Kentgens-Craig hat ausführlich dargelegt, dass die Rezep-tion der Bauhaus-Architektur in den USA – sie begreift diese als die »bewußte Übernahme eines fremden (sprich deutschen; Hinzufü-gung d. Verf.) geistigen Kulturgutes«15 – bereits unmittelbar nach der Gründung des Bauhauses im Jahre 1919 einsetzte und sich im Zuge der Ende der 1920er Jahre intensivierten nationalen Diskussion
14 Vgl. Jonathan Culler, Dekonstruktion. Derrida und die poststrukturalistische Literaturtheorie. Reinbek bei Hamburg 1999, S. 107ff (engl. Origi-nalausgabe: On Deconstruction: Theory and Criti-cism after Structuralism, Ithaca 1982).
15 Kentgens-Craig (wie Anm. 1), S. 12.
283
16 a.a.O., S. 14.
17 a.a.O.
18 a.a.O., S. 13.
19 a.a.O., S. 134.
20 Walter Gropius, The New Architecture and the Bauhaus. London 1935.
Abb.14.02 Umschlaggestaltung Gilbert Herbert, Silvina Sosnovsky. Bauhaus on the Carmel and the Crossroads of Empire: Architecture and Plan-ning in Haifa during the British Mandate. Jerusa-lem: Yad Izhak Ben-Zvi, 1993.
um die Krise beziehungsweise Zukunft der amerikanischen Moderne nochmals und nun über die Grenzen der Fachmedien hinweg inten-sivierte. Ihr Arbeitsbegriff »Bauhaus-Architektur« wird dabei als »Komplex jener Prinzipien und Werke (ge)faßt, die die im Bauhaus gelehrte und praktizierte Architektur prägten.«16 Insofern ließe sich rechfertigen, »vom Bauhaus an sich«17 zu sprechen. Trotz Ein-bekennen der komplexen Einflussgrößen und divergierenden Positi-onen hält sie an einer »originalen Fassung«18 von Bauhausgedan-kengut fest, die sich deutlich von dessen Rezeption unterscheiden ließe. Erst seit der einflussreichen International Style-Ausstellung, die Hitchcock und Johnson 1932 in New York unter dem Titel »Modern Architecture: International Exhibition« realisierten, so Kentgens-Craig, sei das anfänglich ganzheitliche und authentische Bild der Bauhaus-Architektur sowie der dieser zugrunde liegen-den Ideen in den USA auf einen reduktionistischen Stilbegriff zu-sammengeflossen.19
Zweierlei ist an dieser Argumentation bemerkenswert. Zum einen adaptiert Kentgens-Craig hier mit der von Walter Gropius 1935 in »The New Architecture and the Bauhaus«20 lancierten selbstaffir-mativen Konzeption der neuen Baukunst eine ebenso individuelle wie selektive Bilanz des Neuen Bauens als authentische und ver-bindliche Definition dessen, was unter Bauhaus-Architektur zu verstehen sei, obwohl Gropius selbst diese Begrifflichkeit vermeidet und lediglich von einer Bauhaus-Idee spricht. Zweitens ist, anders als Kentgens-Craig evoziert, auch bei Philip Johnson und Henry-Russel Hitchcock keinesfalls die Rede von Bauhaus-Architektur, vom Bauhaus-Stil oder gar Gropius-Stil. Sie repräsentieren die von den Architekten des Bauhaus gedachten oder realisierten Projekte als Teil eines umfassenden Internationalen Stils. Die Idiome Bauhaus-Moderne oder Bauhaus-Architektur sucht man in der die Ausstellung erläuternden Publikation jedenfalls vergeblich.21
Welche Funktion erhält das Bauhaus-Idiom also im öffentlichen Diskurs der sich internationalisierenden amerikanischen Architek-turmoderne, in welche lokalen Gegensatzbeziehungen wird es ein-gebunden und welche neuen Bedeutungen erhält es auf diese Weise?
Zur Beantwortung der hier aufgeworfenen Fragen erscheint es wichtig, nicht stehenzubleiben und den Verlust einer alten Bedeu-tung zu beklagen. Stattdessen ist zuvorderst an jene Anforderungen zu denken, die sich spätestens seit Ende des Zweiten Weltkriegs an eine sich fortschreitend weltweit hegemonialisierende nationale Kulturindustrie stellten. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg und zur Zeit der als New Deal bekannt gewordenen Wirtschafts- und Sozial-reformen formierten sich in Wissenschaft, Ökonomie, Politik und
21 Vgl. Philip Johnson/Henry-Russell Hitchcock, Der Internationale Stil 1932. Bauwelt-Fundamen-te 70, hg. v. Ulrich Conrads. Braunschweig 1985 (engl. Originalausgabe: The International Style: Architecture since 1922, New York 1932).
284 Regina GöckedeDas Bauhaus nach 1933: Migrationen und semantische Verschiebungen
Kunst zahlreiche Stimmen, welche die Erneuerung des Landes als moderne globale Weltmacht forderten. Diese sogenannte ameri-kanische Renaissance umfasste alle Bereiche des Lebens, also auch und besonders den der Architektur ebenso wie den der Architek-tenausbildung. Insofern zielte die Bauhaus-Rezeption in den USA der 1930er, 1940er und 1950er Jahre nicht auf die Internationalisie-rung oder Nationalisierung des Bauhauses als vielmehr auf die Anreicherung des angestrebten amerikanischen Internationalismus durch die universalistischen Geltungsansprüche der mit dem Bau-haus und seinen prominenten Figuren konnotierten Architektur-Moderne.
Als Gegner dieser nationalen Modernisierung galten nicht nur die traditionellen Vertreter der amerikanischen Architektur, sondern auch die kommerziell erfolgreichen Wolkenkratzer-Architekten der Zwischenkriegszeit, die nun als Bauherren-Funktionalisten dis-kreditiert werden: »Amerikanische Wolkenkratzer-Architekten mit ausgeprägt zynischem Humor waren gewillt, ihre verspielten Fassadenornamente ›funktional‹ zu nennen – ›eine Funktion des Gebäudes ist es, dem Bauherrn zu gefallen‹. Wir sind aufgefordert, den Architekturgeschmack von Grundstücksspekulanten, Versi-cherungsagenten und Hypothekenhändlern ernst zu nehmen!«22
Besonders gegen den »amerikanischen Kult des Individualis-mus«23 wie er bei Frank Lloyd Wright ausgemacht wird und gegen sozialromantische Stadtbautheoretiker wie Lewis Mumford werden die planerische Rigorosität und die strengen ästhetischen Prinzipien des von Gropius und anderen prominenten Individualgestalten repräsentierten Architekturvorstellungen ins Felde geführt. Erst die autonom-stilgeschichtliche Identifizierung des Bauhauses mit ausgewählten erfolgreichen Immigranten erla ubte es, das Bauhaus als Teil eines transhistorischen amerikanischen Erbes in Dienst zu nehmen, dessen wirtschaftliche Elite bemüht war, eine Allianz von Kunst und Kommerz zu propagieren.
Im kalten Krieg avancierte das Bauhaus dann zum kulturpoliti-schen Symbol für das transatlantische Bündnis zwischen den USA und der Bundesrepublik. Die Ambivalenz dieser Koalition zwi-schen freiheitlich-demokratischen und antifaschistischen Kräften zeigte sich freilich während der McCarthy Ära, als zahlreiche ehemalige Bauhäusler des Kommunismus‘ verdächtigt wurden. Nichts desto weniger konnte sich bis in die 1980er Jahre hinein das dominante Bild einer als geschichtliches Telos entworfenen Archi-tekturmoderne – der Entwurf einer erfolgreichen Fortsetzung der Bauhaus-Moderne in Harvard, New York und Chicago – behaupten. Dieses Geschichtsmodell wurde auf bundesdeutscher Seite maß-
22 Alfred H. Barr, Vorwort, in: Johnson/Hitch-cock, Der Internationale Stil 1932, S. 20–23, hier S. 22.
23 a.a.O.
285
24 Hans Maria Wingler, Bauhaus in America: Resonanz und Weiterentwicklung des Bauhauses in Amerika. Berlin 1972.
25 Tom Wolfe, From Bauhaus to our House. New York 1981.
geblich von dem ehemaligen Direktor des Bauhaus-Archivs, Hans Maria Wingler getragen.24
Erst mit der Funktionalismuskritik im architektonischen Diskurs der 1970er Jahre kehrte sich das dem Bauhaus aufgepfropfte Image eines zweckrationalistischen Universalstils gegen das historische Ausgangsphänomen selbst. Tom Wolfes »From Bauhaus to our House«25 aus dem Jahre 1981 steht für eine nicht selten bewusst polemisch geführte Debatte über das, was von nun an die Post-moderne genannt werden sollte. Diese Reflexion führte bekanntlich gleichzeitig zu der erneuten Auseinandersetzung mit einer als orthodox empfundenen und mit unangemessenen Totalitätsaspi-rationen versehenen Architekturmoderne und zur manchmal er-barmungslosen Abrechnung mit ihren nun als »White Gods« ver-spotteten Stars. Unter negativen Vorzeichen diente das Motiv des Bauhaus-Transfers bei Wolfe – jetzt repräsentiert als quasi koloniale Bewegung – als strategisches Vehikel zur Emanzipation von einem längst überwunden geglaubten Europa-Komplex.
Die israelische DissemiNation des Bauhauses
An dieser Stelle erfolgt ein zugegeben recht abrupter Sprung in eine andere Zeit und an einen anderen Ort der Bauhaus-Rezeption. Anhand des folgenden Beispiels wird besonders deutlich, dass die Ausbreitung des Bauhaus-Motivs nicht nur mit selektiven Bedeu-tungsaufschüben durch partikulare Gegensatzkonstruktionen ein-hergeht. Die nationale Repräsentation der israelischen Architektur-moderne demonstriert noch stärker als andere Beispiele der in-ternationalen Bauhaus-Rezeption, wie groß der Anteil der Aus-breitung einer neuen Bedeutung Bauhaus an dem performativen Prozess nationaler Selbsterzeugung, am Erzählen der Nation 26 sein kann.
Wenn in diesem spezifischen historischen Fall das Idiom der Bauhaus-Architektur durch die Nation eingefordert wird, um als Zeichen des Selbst zu fungieren, das sich von einem kategorischen Anderen unterscheidet, dann erscheint es angebracht, Derridas Begriff der Dissemination – so wie es der postkoloniale Theoretiker Homi Bhabha in seinem gleichnamigen Essay über »Zeit, narrative Geschichte und die Ränder der modernen Nation«27 vorschlägt – gerade auch mit Blick auf die israelische Bauhaus-Rezeption mit großem »N« zu schreiben.
Die früheste Ausbildung einer genuin nationalen jüdischen Archi-tektur wird allgemein auf die frühen 30er Jahre des 20. Jahrhunderts zurückdatiert, als das 1909 gegründete Tel Aviv zum Zentrum der
26 Siehe Homi K. Bhabha (Hg.), Nation and Nar-ration. London, New York 1990. Vgl. auch Bene-dict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York 1991.
27 Homi K. Bhabha, DissemiNation. Zeit, narrative Geschichte und die Ränder der modernen Nation, in: ders., Die Verortung der Kultur. Tübingen 2000, S. 207–253 (engl. Originalausgabe: Locati-on of Culture. London, New York 1994).
286 Regina GöckedeDas Bauhaus nach 1933: Migrationen und semantische Verschiebungen
progressiven Architekten des Jischuw28 avancierte. Dort formier-te sich 1932 unter Bezugnahme auf das historische Vorbild der deut-schen Architektenvereinigung Der Ring der Chug (neuhebräisch Ring).29 Zu den Gründungsmitgliedern zählten so einflussreiche Personen wie Arieh Sharon, der bei Hannes Meyer am Bauhaus studierte und später in dessen Büro arbeitete, Joseph Neufeld, der in Wien bei Clemens Holzmeister lernte und später in den Berliner Büros von Erich Mendelsohn und Bruno Taut tätig war, oder der weniger bekannte Shmuel Mestechkin, der bis 1933 Schüler von Mies van der Rohe am Bauhaus war. Ihre Nähe zur Histradut, der zionistischen Arbeitergewerkschaft, erlaubte es den in Deutsch-land ausgebildeten und gut vernetzten Planern und Architekten bereits vor der israelischen Staatsgründung, die Entwicklung des Wohnungsbaus in Palästina entscheidend mit zu prägen. Das von der Gruppe publizierte Magazin wurde seit 1937 von Julius Posener herausgegeben.
Folgt man den dominanten Darstellungen zur Geschichte der modernen Architektur in Palästina und im späteren Staat Israel, dann begann die israelische Architekturmoderne erst mit Einset-zen der europäisch-jüdischen Bauaktivität um 1900. Der viel älteren osmanischen beziehungsweise palästinensisch-arabischen Bauge-schichte kommt in den der Suche eines nationalen Stils gewidmeten frühen Untersuchungen kein Einfluss zu. Es war demnach vor allem die fünfte Alija,30 mit der Einwanderung einer großen Anzahl von deutschen und in Deutschland ausgebildeten Architekten, die eine neue Phase der Architekturentwicklung einleiteten. Der von ihnen vollzogene Übergang von Eklektizismus zur Modernismus reflek-tiere zuvorderst die Philosophie des Bauhauses, schreibt Amiram Harlap Anfang der 1980er Jahre.31 Demnach gelang es dem Chug um den Bauhaus-Absolventen Arieh Sharon mit Unterstützung der politischen Führungsriege, die Pluralität der Debatte um die anzu-strebende Architektur der neuen Gesellschaft lange vor 1948 in einen breiten Konsens zu überführen. Die an europäischen Vorbildern orientierte Architektursprache sollte fortan die zionistische Bewe-gung symbolisieren und nach Ende des britischen Mandats zur quasi offiziellen Architektur des jungen jüdischen Staates avan-cieren.32
Als Shimon Peres im Mai 1994 anlässlich einer International Style Konferenz in Tel Aviv erklärte, die Architektur des Bauhaus-Stils sei eine authentische nationale Errungenschaft, dann ging es frei-lich um mehr als um die politisch neutrale Wiedergabe einer tat-sächlich weitaus komplexeren architektonischen Ereignisgeschichte. Wie konnte es geschehen, dass das hebräische Signon ha-Bauhaus
30 Für das späte osmanische und britisch ver-waltete Palästina unterscheidet man gemeinhin fünf Alijot. Die vor dem expandierenden National-sozialismus fliehenden Juden sind in der fünften Alija (1932–1938) erfasst.
31 Amiram Harlap, New Israeli Architecture, East Brunswick 1982, S. 47.
Abb.14.03 Inserat zur französischen Ausgabe von The New Architecture and the Bauhaus mit Eckansicht des Pan Am Building (1960–63) von Walter Gropius. Entnommen aus Cimaise: art et architecture actuels Jg. 16, H. 91-92 (1969).
29 Zum Chug siehe Alona Nitzan-Shiftan, Conte-sted Zionism – Alternative Modernism. Erich Mendelsohn and the Tel Aviv Chug in Mandate Palestine, in: Architectural History 39, 1996, S. 147–180.
32 Siehe zu diesem Themenkomplex ausführlich Architekturräume und ideologische Grenzen – zum Problem der Perspektivität bei der Re-Kon-struktion einer Baugeschichte, in: Regina Göcke-de, Adolf Rading (1888–1957): Exodus des Neu-en Bauens und Überschreitungen des Exils. Berlin 2005, S. 201–217.
28 Bezeichung für die jüdische Bevölkerung in Palästina vor der Gründung des Staates Israel 1948.
288 Regina GöckedeDas Bauhaus nach 1933: Migrationen und semantische Verschiebungen
sich gleichzeitig als universelles Idiom und nationales Symbol durchsetzte?
Eine der zentralen Voraussetzungen schaffte der Architekt und Planer Arieh Sharon selbst bereits 1977 mit seiner Buchpublikation »Kibbutz + Bauhaus«.33 Nachdem Politiker und Fachleute auch in den 1950er und 1960er Jahren daran festhielten, ausschließlich die Moderne der 1930er Jahre als relevantes zivilisatorisches Manifest zu behandeln und eine der euroamerikanischen Funktionalismus-kritik vergleichbare Debatte ausblieb, konnte Sharons biographisch-monographische (Selbst-)Darstellung nicht nur die Kibbuzbewegung als eine die nationale Planung entscheidend determinierende Größe festschreiben, sondern mit seiner individuellen Erfolgsgeschichte gleichsam das Bauhaus als zentrale Referenz der nationalen Bau-geschichte etablieren.
75 Jahre nach Gründung Achusat Baijts, dem späteren Tel Aviv, schuf der Kurator und Architekturhistoriker Michael Levin 1984 mit der Ausstellung »White City – International Style Architecture in Israel« ein breites öffentliches Bewusstsein für den identitätsstif-tenden Wert der israelischen Architekturmoderne. Sie repräsentiere Israels Verbindung mit der westlichen Zivilisation im Allgemeinen und mit der europäischen Kultur im Besonderen. Die Architektur-schau wollte mit dem Sieg der modernen Architekturschule die historische Entscheidung des Landes für den Westen dokument-ieren.34 Zahlreiche Publikationen dieser Jahre heben zur Affirmation dieser These die Sonderstellung und Bedeutung der am Bauhaus ausgebildeten Architekten hervor, obwohl unter rein quantitativen Gesichtspunkten der Anteil anderer Ausbildungshintergründe weitaus größer war.35
Das arabische Palästina diente derweil für die als geschlossen ima-ginierte Architekturwelt des Jischuw lediglich als Negativfolie. Als Symbol des Nicht-Modernen, des Nicht-Rationalen und Traditionel-len komplettiert das palästinensische Andere ein Muster, das dem der europäischen Architekturmoderne folgend in dem Bruch mit der als vormodern entworfenen Vergangenheit seine zentrale Voraus-setzung findet. Dass dabei ausgerechnet an eine architektonische Formensprache angeknüpft wird, die noch anlässlich der Stuttgarter Weißenhofsiedlung von 1927 auf dem Höhepunkt des deutschen Streites um das ›richtige‹ nationale Bauen als orientalische Imitation und die Siedlung schließlich im Nationalsozialismus als Araberdorf diskreditiert wurde, unterstreicht die Ambivalenz der mit dem Bau-hausbegriff zusammenhängenden Bedeutungsverschiebungen.36 Selbst in jenen im Vergleich zu Michael Levins »White City« jünge-ren Publikationen wie »Bauhaus on the Carmel«37 und »Social
34 Michael Levin, White City. International Style Architecture in Israel. A Portrait of an Era, Tel Aviv 1984, S. 9.
35 Vgl. Gilbert Herbert/Ita Heinze-Greenberg, The Anatomy of a Profession. Architects in Palestine During the British Mandate, in: architec-tura, Jg. 22, H. 2, 1992, S. 149–162.
33 Arieh Sharon, Kibbutz + Bauhaus. An Architect’s Way in a New Land. Stuttgart, Tel Aviv 1976.
36 Vgl. Wolfgang Pehnt, The ‘New Man’ and the Architecture of the Twenties, in: Social Utopias of the Twenties. Bauhaus, Kibbutz and the Dream of the New Man. Wuppertal 1995, S. 15–21, hier S. 21.
Abb. 14.04 Deckblatt eines Stadtplans anlässlich der Konferenz Bauhaus in Tel Aviv, Mai 1994.
37 Vgl. Herbert/Sosnowsky (wie Anm. 6).
290 Regina GöckedeDas Bauhaus nach 1933: Migrationen und semantische Verschiebungen
Utopias of the Twen ties«38 oder zuletzt in den mit Blick auf die Welterbedebatte populärwissenschaftlich orientierten »Bauhaus Tel Aviv«39 sowie der Ausstellungskatalog des Tel Aviver Bauhaus Center »Bauhaus in Jaffa«,40 die auf den ersten Blick allesamt be-müht sind, das Erbe des Bauhauses in Israel zu würdigen, wird nicht nur die historische Faktizität und Aktualität der palästinensischen Präsenz verdrängt, sondern gerät – wie der israelische Architekt und postzionistische Historiker Daniel Bertrand Monk vermutet – die Narration vom Transfer des Bauhaus-Stils nach Palästina/Israel gleichzeitig zur symbolischen Rechtfertigung der israelischen Ver-treibungspolitik nach 1948.41 In seiner Bewertung fungiert die spezi-fisch israelische Indienstnahme des westlichen Bauhaus-Mythos als ideologisches Instrument einer ästhetischen Okkupation.42
Die Mehrzahl der Historiographen des israelischen Architektur-geschehens – und es handelt sich keineswegs ausschließlich um israelische Autoren, sondern genauso um deutsche und US-amerika-nische, bezeichnen nicht nur nach wie vor arabische Positionen als illusorisch, sondern marginalisieren auch andere nicht mit der semi-otischen Hegemonie der nationalen Bauhaus-Rezeption kompatible Phänomene. Das gilt genauso für zahlreiche nicht-jüdische Immi- granten wie etwa den Architekten und Urbanisten Adolf Rading oder für die Rolle der kolonial-britischen Administration wie für weitere Architekten, deren Arbeiten von der mit dem Bauhausidiom versehenen modernen Bewegung abweichen. Selbst so interna- tional anerkannte Figuren wie etwa Erich Mendelsohn konnten auf diese Weise sehr lange von einer seriösen Rezeption ausgeschlossen werden.43
Andere Geschichten
Es ist offensichtlich, dass vor allem die prominenten und erfolg-reichen Individualfiguren der Architektenmigration wie Gropius und Sharon teils bewusst und aktiv, aber auch instrumentalisiert als symbolische Repräsentanten nationaler Kollektiverzählung er-heblichen Anteil an der beschriebenen selektiven Aktualisierung des Bauhauses in veränderten Kontexten hatten. Andere abwei-chende Migrationsschicksale blieben dadurch freilich von den etab-lierten Erzählmustern weitestgehend ausgeschlossen.
Im Vorangegangenen ging es mir keineswegs darum, die bekann-ten Mythen der Bauhaus-Rezeption auf eine einzige und wider-spruchsfreie Wahrheit zurückzuführen. Eine solche hierarchische Umkehrung liefe allzu leicht Gefahr, alte Mythen schlicht durch neue Mythen zu ersetzen. Zwei weitere selbstkritische Einschrän-
39 Nahoum Cohen, Bauhaus Tel Aviv: An Archi-tectural Guide. London 2002.
40 Shmuel Yavin, Bauhaus in Jaffa: Modern Ar-chitecture in an Ancient City. Tel Aviv 2006.
41 Daniel Bertrand Monk, Autonomy Agreements. Zionism, Modernism and the Myth of a ‘Bauhaus’ Vernacular, in: Architectural Association Files Jg. 28, 1994, S. 94–99, hier S. 97.
42 So lautet der Titel einer 2002 erschienenden Studie des Autors zur Funktion der Architektur im palästinensisch-israelischen Konflikt: Daniel Bertrand Monk, An Aesthetic Occupation.The Im-mediacy of Architecture and the Palestine Con-flict, Durham/NC 2002.
43 Siehe hierzu Ita Heinze-Mühleib, Erich Mendelsohn, Bauten und Projekte in Palästina (1934-1941). München 1986.
38 Vgl. Fiedler (wie Anm. 5).
291
kungen müssen mit Blick auf die Herleitung der vorgebrachten Kritik ausgeführt werden: Die vorliegende Argumentation stützte sich wiederholt auf historiographische Unterscheidungen, die an anderer Stelle in Frage gestellt wurden. Gleichzeitig wurden binäre Gegensatzkonstruktionen ausgebeutet, deren theoretische Impli-kationen der generellen Intention nach eigentlich vermieden werden sollten. Statt ein neues umfassendes Rezeptionssystem anzubieten, blieb also auch der vorliegende Text dem kritisierten System zu-mindest latent verhaftet.
Es war jedoch nicht die mit diesem Essay verbundene Absicht, eine alte architekturhistorische Wissensordnung schlicht durch eine neue zu ersetzen. Meine Bemühungen zielten vielmehr darauf ab, die Möglichkeitsbedingungen für das Erzählen alternativer Ge-schichten zu erhellen und vielleicht bisher übersehene oder mar-ginalisierte Erklärungsversuche hinzuzufügen. Denn in kritischer Komplettierung und nicht in totaler Substitution liegt die vorderste Aufgabe rezeptionskritischer Lektüren – auch und besonders auf dem Feld der modernen Architekturgeschichte. Eine kritische Bauhaus-Forschung verstanden als Erforschung der historischen Bauhaus-Rezeptionen bildet in diesem Zusammenhang ein beson-ders vielversprechendes Tätigkeitsfeld mit zum Teil erheblichen Forschungsdesideraten. Das Spektrum möglicher Untersuchungs-richtungen – soviel scheint jedenfalls sicher – ist längst noch nicht vermessen.