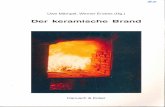Zur Gründung von Alexandreia: Die Quellen im Kontext des spätklassischen Urbanismus der...
Transcript of Zur Gründung von Alexandreia: Die Quellen im Kontext des spätklassischen Urbanismus der...
Contents
Krzysztof Nawotka – Volker Grieb Alexander the Great and Egypt: History – Art – Tradition: An Introduction .............. 7
Burkhard Meißner Egypt in Fourth Century Greek Strategies and Strategical Considerations ............... 15
Krzysztof Ulanowski Divine Intervention during Esarhaddon and Alexander’s Campaigns in Egypt ........ 29
Agnieszka Wojciechowska – Krzysztof Nawotka Alexander in Egypt: Chronology ............................................................................... 49
Francisco Bosch-Puche Alexander the Great’s Egyptian Names in the Barque Shrine at Luxor Temple ....... 55
Stefan Pfeiffer Alexander der Große in Ägypten: Überlegungen zur Frage seiner pharaonischen Legitimation ...................................................................................... 89
Nicholas Sekunda The Importance of the Oracle of Didyma, Memphis 331 BC ................................ 107
Agnieszka Fulińska Son of Ammon. Ram Horns of Alexander Reconsidered ...................................... 119
Krzysztof Nawotka – Agnieszka Wojciechowska Alexander the Great kosmokrator ........................................................................... 145
Donata Schäfer Pharao Alexander „der Große“ in Ägypten – eine Bewertung ............................... 153
Volker Grieb Zur Gründung von Alexandreia: Die Quellen im Kontext des spätklassischen Urbanismus der südöstlichen Ägäiswelt und der nautischen Bedingungen im östlichen Mittelmeer .......................................................................................... 169
Ivan A. Ladynin The Argeadai Building Program in Egypt in the Framework of Dynasties’ XXIX–XXX Temple Building ............................................................. 221
Jan Moje Die privaten demotischen Quellen zur Zeit Alexanders des Großen. Ihre Entwicklung am Beginn einer neuen Epoche der ägyptischen Geschichte im 4. Jh. v.Chr. ..................................................................................... 241
Contents 6
Gościwit Malinowski Alexander and the Beginning of the Greek Exploration in Nilotic Africa ............. 273
Micah T. Ross The Role of Alexander in the Transmission of the Zodiac ..................................... 287
Adam Łukaszewicz Alexander and Alexandria: A View from Kom el-Dikka ....................................... 307
Philippe Matthey Alexandre et le sarcophage de Nectanébo II : élément de propagande lagide ou mythe savant ? ......................................................................................... 315
Gunnar R. Dumke The Dead Alexander and the Egyptians: Archaeology of a Void ........................... 337
Elizabeth Brophy Placing Pharaohs and Kings: Where were Royal Statues Placed in Ptolemaic Egypt? .................................................................................................... 347
Artem Anokhin Antiochus IV of Syria and Ptolemaic Symbolism: An Example of Anti-Ptolemaic Propaganda .................................................................................... 357
Dan-Tudor Ionescu Nectanebus II as Father of Alexander the Great ..................................................... 367
Aleksandra Szalc Kandake, Meroe and India – India and the Alexander Romance ........................... 377
Aleksandra Klęczar Bones of the Prophet and Birds in the City: Stories of the Foundation of Alexandria in Ancient and Medieval Jewish Sources ............................................. 391 Bibliography ............................................................................................................. 401 Index of names ......................................................................................................... 433 Index of places ......................................................................................................... 441 Index of sources ....................................................................................................... 447
Zur Gründung von Alexandreia: Die Quellen im Kontext des spätklassischen Urbanismus der südöstlichen Ägäiswelt und der nautischen Bedingungen im
östlichen Mittelmeerraum*
Volker Grieb (Hamburg)
Alexanders Aufenthalt in Ägypten ist in den antiken Quellen und der modernen Forschung eng verbunden mit der von ihm gegründeten und alsbald zu einem der größten antiken Handelszentren anwachsenden Hafenstadt Alexandreia. Die literarischen Quellen, die über den Gründungszusammenhang der Stadt Auskunft geben, sind sowohl in Einzelbeiträgen als auch in Darstellungen zu Alexander dem Großen beziehungsweise zur Geschichte der Stadt vielfach erörtert worden.1 Dabei verwundert jedoch, dass die Forschung sich vor
!* Die hier vorangestellten Überlegungen zur südöstlichen Ägäis sind entstanden in Zusammenarbeit mit
Martin Tombrägel (Leipzig) während zweier Forschungsreisen in den Jahren 2008 und 2009. Für die zahlreichen Diskussionen zu archäologischen und historischen Zusammenhängen dieser Region sei ihm an dieser Stelle herzlich gedankt. Weiterhin danke ich Sabine Todt (Hamburg) und Jan Breder (Halle) für eine kritische Durchsicht des Textes. Gewidmet ist der Beitrag Erich Seeliger im Gedenken an eini-ge Tausend gemeinsame Seemeilen auf Mittelmeer und angrenzendem Ozean – ἡ θάλασσα ἐδίδαξε καὶ ἐπαίδευσε.
1 Neben den in den folgenden Anmerkungen zitierten Beiträgen sind dies etwa: V. EHRENBERG, Alexander und Ägypten, Leipzig 1926; A. BERNAND, Alexandrie la Grande, Paris 1966, 28–41; J. SEIBERT, Alexander der Große, Darmstadt 1972, 112f. (jeweils mit umfangreicher Berücksichtigung der älteren Literatur); P. M. FRASER, Ptolemaic Alexandria, I, Oxford 1972, 3–37; R. CAVENAILE, „Pour une histoire politique et sociale d’Alexandrie. Les origines“, Ant. Class. 41 (1972), 94–112; N. G. L. HAMMOND, Alexander the Great. King, Commander and Statesman, London 1981, 124–126; A. B. BOSWORTH, Conquest and Empire. The reign of Alexander the Great, Cambridge 1988, 72–74; P. GREEN, Alexander of Macedon 356–323 B.C. A Historical Biography, Berkeley/Los Angeles/Oxford 21991, 270f.; H. SONNABEND, „Zur Gründung von Alexandria“, in: E. Olshausen, H. Sonnabend (Hrgg.), Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 2/3, 1984/1987, Stuttgart 1991, 515–532; P. HÖGEMANN, „Die Gründung von Alexandrea ad Aegyptum als Folge und Ursache des Niedergangs von Phönikien und Babylonien“, in: E. Olshausen, H. Sonnabend (Hrgg.), Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 2/3 (1984/1987), Stuttgart 1991, 533–558; A. B. BOSWORTH, „Alexander the Great“, in: D. M. Lewis et al. (Hrgg.), The Fourth Century B.C., CAH2
VI, Cambridge 1994, 810f.; 867; P. GREEN, Alexander’s Alexandria, in: Alexandria and Alexan-drianism. Papers delivered at a symposium organized by the J. Paul Getty Museum and the Getty Center for the History of Art and the Humanities, Malibu 1996, 3–28; G. HÖLBL, Geschichte des Ptolemäerreiches. Politik, Ideologie und religiöse Kultur von Alexander dem Großen bis zur römischen Eroberung, Darmstadt 1994; 10–12; N. G. L. HAMMOND, The Genius of Alexander the Great, London 1997, 99f.; G. SHIPLEY, The Greek World after Alexander. 323–30 BC, London/New York 2000, 214f.; D. J. THOMPSON, „Alexandria. The City by the Sea“, Bulletin of the Archaeological Society of Alexandria 46 (2001), 73–79; M. CLAUSS, Alexandria. Schicksale einer antiken Weltstadt, Stuttgart 2003, 10–17; G. GRIMM, Alexandria. Die erste Königsstadt der hellenistischen Welt, Mainz 1998, 16–
Volker Grieb 170
allem auf diejenigen historischen Zusammenhänge bezieht, die direkt der Stadtgründung und Alexanders Aufenthalt in Ägypten zugrunde liegen.2 Im folgenden Beitrag sollen demgegenüber die signifikanten urbanen Veränderungen in der südöstlichen Ägäiswelt in den Jahrzehnten, die Alexanders Eroberungen vorausgingen, als Bezugspunkt für eine Beurteilung des Gründungszusammenhanges herangezogen werden. Einerseits bieten die dortigen Veränderungen eine naheliegende und alternative Perspektive auf die mitunter allzu offensichtlich eine spätere Großstadt voraussetzenden Quellen zur Gründung von Alexandreia. Andererseits wurden in jener Region bereits wesentliche urbanistische Aspekte Alexandreias vorweggenommen, sodass nicht nur die Frage gestellt werden kann, inwieweit die Anlage einer neuen und großen Hafenstadt am Rande des westlichen Nildelta als eine konsequente Fortführung der vorangehenden südostägäischen Entwicklung verstan-den werden muss, sondern auch, inwieweit Alexander mit seiner Gründung nicht eher auf bestehende Bedingungen reagierte als diese selbst maßgeblich zu beeinflussen. Damit ist freilich auch die Frage nach der genaueren Rolle des Makedonenkönigs bei der Gründung aufgeworfen. Die Quellen, die Alexander die prominente Rolle und zentrale Intention zur Gründung einer großen Stadt im westlichen Nildelta zuweisen – und denen in dieser Hinsicht der größte Teil der Forschung gefolgt ist – stammen aus einer Zeit, als Alexan-dreia sich bereits zu einer Metropole3 entwickelt hatte und damit eine städteplanerische Weitsicht des Makedonen leicht vorauszusetzen war. Auch wäre es wenig verwunderlich, wenn der weitreichende Erfolg dieser Gründung zu einer baldigen Legendenbildung um den namhaften ktistes geführt und eine gegebenenfalls zunächst weniger prominente Rolle entsprechend überstrahlt hätte.4 Zahlreiche Stadtgründungen wurden Alexander jedenfalls
!33; C. MOSSÉ, Alexander der Große. Leben und Legende, Düsseldorf/Zürich 2004 (orig. Alexandre. La destinée d’un mythe, Paris 2001), 31–33; W. HUSS, Ägypten in hellenistischer Zeit. 332–30 v.Chr., München 2001, 63–65; R. LANE FOX, Alexander der Große (aus dem Englischen von G. Beckmann), Stuttgart 32005 [1973], 249–251; P. BARCELÓ, Alexander der Große, Darmstadt 2007, 134–137; J. MCKENZIE, The Architecture of Alexandria and Egypt c. 300 BC to AD 700, New Haven/London 2007, 37–40; A. DEMANDT, Alexander der Große. Leben und Legende, München 2009, 166–170; K. NAWOTKA, Alexander the Great, Oxford 2010, 207f.
2 Eine Ausnahme hiervon stellt die Interpretation der Gründung als „neues Tyros“ dar; z.B. D. G. HOGARTH, „Alexander in Egypt and Some Consequences“, JEA 2, 1915, 53–60; W. W. TARN, Alexander the Great, I, Oxford 1948, 41f.; HÖGEMANN, „Alexandrea“ (Anm. 1); siehe dazu die Kritik unten, Anm. 184.
3 Der Begriff Metropole wird im folgenden im metaphorischen Sinne eines weit überregional einflussreichen und großen städtischen Zentrums gebraucht; vgl. dazu Cl. NICOLET, „Introduction“, in: ders. (Hrg.), Mégapoles méditerranéennes. Géographie urbaine rétrospective, Paris 2000, 11–23.
4 Kritisch etwa SONNABEND, „Alexandria“ (Anm. 1), 518, mit einem „Argwohn“ gegenüber dem in den späteren Quellen und aufgrund des späteren Glanzes der Stadt wohlmöglich als allzu genial und vorausschauend dargestellten Stadtgründers Alexander (ohne dies in seiner weiteren Diskussion der Quellen jedoch erkennbar zu berücksichtigen); vgl. weiterhin mit knappen kritischen Bemerkungen, die sich ebenfalls nicht in einer Quellenkritik widerspiegeln, etwa W. LESCHHORN, „Gründer der Stadt.“ Studien zu einem politisch-religiösen Phänomen der griechischen Geschichte, Stuttgart 1984, 203f.; CLAUSS, Alexandria (Anm. 1), 11. Kritisch jetzt auch A. ERSKINE, „Founding Alexandria in the Alexandrian Imagination“, in: S. Ager, R. Faber (Hrgg.), Belonging and Isolation in the Hellenistic World, Toronto/London 2013, 169–183, dessen allgemeiner Zweifel an der Historizität der literarischen Überlieferung zur Gründung hier allerdings nur bedingt geteilt wird (siehe unten, Anm. 99). Vgl. zur Position von Erskine bereits die kritischen Bemerkungen von F. DE POLIGNAC, „L’ombre d’Alexandre“, in: Ch. Jacob, F. de Polignac (Hrgg.), Alexandrie IIIe siècle av. J.-C. Tous les savoirs du monde ou le
Zur Gründung von Alexandreia 171
erst durch die spätere Überlieferung zugeschrieben,5 und bei den wenigen ihm sicher zuzu-weisenden Gründungen nimmt Alexandreia nicht zuletzt wegen der Größe und des schnel-len Wachstums eine Ausnahmestellung ein.
Im folgenden wird zunächst ein knapper Überblick über die strukturelle urbane Verän-derung in der südöstlichen Ägäis gegeben, die als zusammenhängendes Phänomen offen-sichtlich ist, allerdings in der literarischen Überlieferung in dieser Form – wie bereits Simon Hornblower hervorhob – unerwähnt blieb.6 Da diese Veränderung in der Forschung überwiegend unter politischen Aspekten und zumeist bezogen auf die einzelnen Orte betrachtet wurde, sollen hier die auch für die Gründung von Alexandreia nach Ansicht des Verfassers wesentlichen Voraussetzungen stärker in den Vordergrund gerückt werden, nämlich die spezifischen nautischen Bedingungen der südöstlichen Ägäis und des östlichen Mittelmeerraumes. Von diesen Voraussetzungen waren sowohl die lokalen als auch die überregionalen Handelsverbindungen zu einem wesentlichen Teil abhängig, sie bestimmten die genaue Lage und mitunter städtebauliche Details der neuen Zentren und sind somit für das Verständnis der angeführten urbanen Veränderung grundlegend. Im größeren Zusam-menhang des östlichen Mittelmeerraumes lässt dies erkennen, dass gerade in den Handels-städten der südöstlichen Ägäis ein besonderes Interesse an einer weiteren Öffnung Ägyptens schon vor Alexander bestanden haben muss, da für sie sowohl eine solche Öff-nung als auch eine große griechische Hafenstadt an der Küste des westlichen Nildelta in jedem Fall förderlich gewesen wäre.
!rêve d’universalité des Ptolémées, Paris 1992, 37–42. Die in Anm. 1 angeführte Literatur übernimmt ganz überwiegend das in den Quellen vermittelte Bild eines vorausschauenden Makedonenkönigs, dem die zukünftige Bedeutung dieser Stadt scheinbar bereits bewusst war. Exemplarisch für zahlreiche Beurteilungen etwa GREEN, „Alexandria“ (Anm. 1), 14: „Alexander’s dream city“; BARCELÓ, Alexander (Anm. 1), 135f.: „Die Gründung Alexandrias unterstrich die Weitsicht, aber auch das Sendungsbewußtsein ihres Erbauers“. Beinahe apodiktisch HAMMOND, Alexander (Anm. 1), 126: „It is a remarkable instance of Alexander’s confidence in the future and his foresight in many aspects of human affairs that he founded Alexandria where, when, and as he did“. Vgl. bereits U. WILCKEN, Alexander der Große, Leipzig 1931, 109; FRASER, Alexandria (Anm. 1), 133. Derartige Beispiele ließen sich zahlreich fortsetzen, weshalb der vorausschauende Gründer Alexander wohl mittlerweile selbst zum literarischen Topos geworden ist. Eine nur scheinbare Ausnahme hierzu ist die Position von B. R. BROWN, „How Deinokrates invented Alexandria“, in: N. W. Goldman (Hrg.), New Light from Ancient Cosa. Classical Mediterranean Studies in Honor of Cleo Rickman Fitch, New York u.a. 2001, 227–247, die zwar Alexanders Rolle bei der architektonischen und auch konzeptionellen Planung der Stadt relativiert, diesen Aspekt allerdings sogleich auf Deinokrates projiziert (siehe dazu die Kritik unten, Anm. 120 und 185). Alexanders postume Rolle für das hellenistische und kaiserzeitliche Alexandreia hat hinsichtlich seines Leichnams und der Gründungsgeschichte der Stadt wohl treffend HOGARTH, „Consequences“ (Anm. 2), 53, charakterisiert, wonach der Makedonenkönig „in death (...) became a tourist attraction“.
5 Vgl. H. BERVE, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage I, München 1926, 291–301 (mit einer Übersicht über die Quellen); TARN, Alexander II (Anm. 2), 232–259 (mit einer Diskussion der Quellen und 13 wahrscheinlichen Alexandergründungen); P. M. FRASER, Cities of Alexander the Great, Oxford 1996, 201 (mit insgesamt sechs sicher zuweisbaren Gründungen). Vgl. V. TSCHERIKOWER, Die hellenistischen Städtegründungen von Alexander dem Großen bis auf die Römerzeit, Leipzig 1927. Die geringe Zahl von Gründungen bei Fraser relativiert nun wieder N. G. L. HAMMOND, „Alexander’s Newly-founded Cities“, GRBS 39 (1998), 243–269 (ebd. 244–247 mit einer knappen Übersicht über die Quellenlage); vgl. dazu aber die Kritik unten, Anm. 188.
6 S. HORNBLOWER, Mausolus, Oxford 1982, 101.
Volker Grieb 172
Vor dem Hintergrund eines vorangehenden urbanen Wandels, der zur Zeit des Alexan-derzuges strukturell weitgehend abgeschlossen war, und einer bereits zuvor bestehenden engen maritimen Vernetzung im östlichen Mittelmeerraum sollen in einem zweiten Abschnitt die Quellen zur Gründung von Alexandreia diskutiert werden. Mehrere Details der literarischen Überlieferung lassen sich aus dieser Perspektive als offensichtliche spätere Konstrukte erkennen, wohingegen andere Details an Plausibilität gewinnen, letztlich aber keiner Quellenversion zur Gründung eine besondere Autorität zugesprochen werden kann; auch nicht derjenigen von Arrian. Dass die Stadt kaum als eine außergewöhnliche urbane Neuschöpfung verstanden werden kann, sondern vielmehr eng an den vorangehenden urbanen Wandel in der südöstlichen Ägäis anknüpfte, mögen die konzeptionellen und funktionalen Merkmale der Stadt, soweit diese für die anfängliche Gesamtkonzeption noch ersichtlich sind, nahelegen. In mehrerlei Hinsicht sind weiterhin deutliche Zweifel an der in Quellen und Forschung hervorgehobenen Rolle und persönlichen Intention Alexanders zur Gründung einer zukünftigen Metropole vorzubringen. Eng damit verbunden ist zugleich die Frage nach dem Gründungszeitpunkt, setzt doch ein zweimaliger Aufenthalt Alexanders vor Ort und eine Gründung nach seinem Siwa-Aufenthalt, wie ein Teil der Quellen nahelegen könnte, ein besonderes Interesse des Makedonen an der zukünftig seinen Namen tragenden Stadt bereits in der Gründungsphase voraus. Vor dem Hintergrund der disku-tierten Aspekte, insbesondere aufgrund der engen nautischen Verbindungen zwischen südöstlicher Ägäiswelt und Ägypten sowie den dadurch bestehenden Möglichkeiten, sei abschließend der Frage nachgegangen, für wen ein maßgebliches Interesse an der Grün-dung einer neuen Metropole am westlichen Rand des Nildeltas bestanden haben dürfte.
1. Stadtgründungen und neuer Urbanismus in der südöstlichen Ägäis in spätklassischer Zeit und die nautischen Bedingungen im östlichen Mittelmeerraum Gleich mehrere Städte, die bereits zu Beginn der hellenistischen Zeit zu wichtigen Zentren in der Region der südöstlichen Ägäis herangewachsen waren, wurden nicht lange vor Alexanders dortigem Auftreten gegründet und etablierten einen neuen Urbanismus, der sich deutlich von dem der archaischen und vorangehenden klassischen Zeit unterschied. Gewis-sermaßen am Anfang dieses Wandels stehen im ausgehenden 5. Jh. v.Chr. die Rhodier, die im Jahre 408/7 v.Chr. ein neues städtisches Zentrum an der Nordspitze der Insel gründeten.7 Zwar blieben die drei alten Hauptorte der Insel – Ialysos, Lindos und Kamiros – auch im folgenden als lokale Zentren bestehen, jedoch erlangte die Neugründung bald die wesentliche politische und wirtschaftliche Bedeutung der nunmehr auch politisch geeinten Insel.8 Etwas später, 366/5 v.Chr., wurde auch auf Kos eine neue Stadt gegründet, die
!7 Diod. XIII 75,1; Strab. XIV 2,9–11 (654–655). 8 Zur Neugründung siehe M. MOGGI, I sinecismi interstatali greci. Introduzione, edizione critica,
traduzione, commento e indici, I, Pisa 1976, 213–226; R. M. BERTHOLD, Rhodes in the Hellenistic Age, Ithaca 1984, 15–37, bes. 21f.; V. GABRIELSEN, „The Synoikized Polis of Rhodes“, in: P. Flensted-Jensen, Th. H. Nielsen, L. Rubinstein (Hrgg.), Polis and Politics. Studies in Ancient Greek History. Presented to Mogens Herman Hansen on his Sixtieth birthday, Kopenhagen 2000, 177–205; Th. H. NIELSEN, V. GABRIELSEN, „Rhodos“, in: M. H. Hansen, Th. H. Nielsen (Hrgg.), An Inventory of Archaic and Classical Poleis, Oxford 2004, 1205; L. M. CALIÒ, „Theatri curvaturae similis: note sull’urbanistica delle città a forma di teatro“, Archeologia Classica 56 (2005), 91–101. Zur Stadt-topographie W. HOEPFNER, E.-L. SCHWANDNER, Haus und Stadt im klassischen Griechenland,
Zur Gründung von Alexandreia 173
darauffolgend zum zentralen Ort der Insel wurde und in der Bewohner aus den bestehenden Siedlungszentren der Insel zusammengezogen wurden.9 Der neue Hauptort lag an der Ostseite an der Stelle des alten Kos Meropis, wobei auch auf dieser Insel lokale Siedlungs-zentren fortbestanden, zu denen etwa Astypalaia im Südwesten und Halasarna an der südlichen Küste zu zählen sind.10 In der gleichen Zeit, in der die Neugründung von Kos-Stadt erfolgte, wird zudem der Ausbau des alten dorischen Poliszentrums Halikarnassos ab etwa 377/6 v.Chr. unter dem persischen Satrapen Maussollos begonnen, der den Hauptort der Hekatomniden von dem weiter im Inland gelegenen Mylasa an die Küste nach Halikarnassos verlegen und die Stadt durch einen Synoikismos kleinerer umliegender Siedlungen vergrößern ließ.11 Und weiterhin hat es wenig südlich von Halikarnassos auf der Knidos-Halbinsel im 4. Jh. v.Chr. ebenfalls eine signifikante Veränderung der urbanen Situation gegeben, die in diesem Fall nicht durch schriftliche Quellen, sondern durch den archäologischen Befund belegt wird. Während sich das ältere Siedlungszentrum von Knidos an der Südküste und etwa auf halber Strecke der langgestreckten Halbinsel befand, ist an deren äußerster westlicher Spitze zu einem nicht genau zu bestimmenden Zeitpunkt wohl um die Mitte des 4. Jhs. v.Chr. ein umfangreiches städtisches Zentrum gebaut wor-den.12
!München 21994, 51–67.
9 Diod. XV 76,2: Ἅµα δὲ τούτοις πραττοµένοις Κῷοι µετῴκησαν εἰς τὴν νῦν οἰκουµένην πόλιν καὶ κατεσκεύασαν αὐτὴν ἀξιόλογον· πλῆθός τε γὰρ ἀνδρῶν εἰς ταύτην ἠθροίσθη καὶ τείχη πολυτελῆ κατεσκευάσθη καὶ λιµὴν ἀξιόλογος. ἀπὸ δὲ τούτων τῶν χρόνων αἰεὶ µᾶλλον ηὐξήθη προσόδοις τε δηµοσίαις καὶ τοῖς τῶν ἰδιωτῶν πλούτοις, καὶ τὸ σύνολον ἐνάµιλλος ἐγένετο ταῖς πρωτευούσαις πόλεσιν. Strab. XIV 2,19 (657). Siehe dazu MOGGI, Sinecismi (Anm. 8), 325–333; S. SHERWIN-WHITE, Ancient Cos. An Historical Study from the Dorian Settlement to the Imperial Period, Göttingen 1978, 63–67; N. H. DEMAND, Urban Relocation in Archaic and Classical Greece: Flight and Consolidation, Bristol 1990, 127–132; G. REGER, „The Mykonian Synoikismos“, RÉA 103 (2001), 171–174; G. REGER, „Kos“, in: M. H. Hansen, Th. H. Nielsen (Hrgg.), An Inventory of Archaic and Classical Poleis, Oxford 2004, 753; CALIÒ, „Theatri curvaturae“ (Anm. 8), 81–91.
10 SHERWIN-WHITE, Cos (Anm. 9), 43–70, bes. 50–65, zum Synoikismos und den lokalen Siedlungen. 11 Verlegung um 370 v.Chr. mit Diod. XV 90,3 (vor 362 v.Chr.); Zusammenlegung: Strab. XIII 1,59
(611); MOGGI, Sinecismi (Anm. 8), 263–271; HORNBLOWER, Mausolus (Anm. 6), 82; DEMAND, Urban relocation (Anm. 9), 123. P. FLENSTED-JENSEN, „Halikarnassos“, in: M. H. Hansen, Th. H. Nielsen (Hrgg.), An Inventory of Archaic and Classical Poleis, Oxford 2004, 1115; CALIÒ, „Theatri curvaturae“ (Anm. 8), 53–59. Zur Stadttopographie HOEPFNER/SCHWANDNER, Haus und Stadt (Anm. 8), 226–234; P. PEDERSEN, „The City Wall of Halikarnassos“, in: R. van Bremen, J.-M. Carbon (Hrgg.), Hellenistic Karia. Proceedings of the First International Conference on Hellenistic Karia, Bordeaux 2010, 269–316, hier 275–313. Vgl. jetzt auch W. HOEPFNER, Halikarnassos und das Maussolleion, Darmstadt 2013.
12 HORNBLOWER, Mausolus (Anm. 6), 101; D. BERGES, „Alt-Knidos und Neu-Knidos“, MDAI(I) 44 (1994), 5–16 (gegen N. Demand); A. BRESSON, „Cnide à l’époque classique: la cité et ses villes“, RÉA 101 (1999), 83–114; P. FLENSTED-JENSEN, „Knidos“, in: M. H. Hansen, Th. H. Nielsen (Hrgg.), An Inventory of Archaic and Classical Poleis, Oxford 2004, 1123; CALIÒ, „Theatri curvaturae“ (Anm. 8), 74–76; A. BRESSON, „Knidos. Topography for a Battle“, in: R. van Bremen, J.-M. Carbon (Hrgg.), Hellenistic Karia. Proceedings of the First International Conference on Hellenistic Karia, Oxford 2006, Bordeaux 2010, 440.
Volker Grieb 174
Abb. 1: Südöstliche Ägäis mit den urbanen Zentren der spätklassischen Zeit
Im Gegensatz zu den alten Siedlungsstrukturen mit ihren kleineren und über das Territorium verteilten städtischen Zentren, die zumeist bereits seit der frühen griechischen Zeit bestanden, zeigen die angeführten Beispiele, zugleich die wichtigsten in dieser Region,13 eine deutliche Fokussierung auf das neue Zentrum, was im Falle von Rhodos, Kos und Halikarnassos zudem mit einer übergreifenden politischen Zentralisierung einherging.14 In der Forschung wurde dieser urbane Wandel unterschiedlich begründet. Simon Hornblower hat in seiner Interpretation zurecht betont, dass neben der stärkeren Gewichtung von größeren politischen Einheiten, die mit den verlagerten Siedlungszentren einhergingen, eine nicht unerhebliche Rolle gespielt zu haben scheint, „to achieve greater command of the sea“.15 Eine Kontrolle des umliegenden Meeres machte sicherlich einen
!13 Weitere Neugründungen bzw. Stadtverlagerungen im 4. Jh. v.Chr. in dieser Region sind Priene und
Herakleia am Latmos im Bereich der Mäandermündung. Vgl. dazu unten, Anm. 16 und 41. 14 Siehe die oben zu den jeweiligen Orten angeführte Literatur. 15 HORNBLOWER, Mausolus (Anm. 6), 101. Hornblower legt dafür die Annahme zugrunde, dass ein
Synoikismos allgemein eine zukünftige Stärke, ein Dioikismos hingegen Schwäche bedeutete (ebd. 81). Kritisch gegenüber der Position von Hornblower im Falle der Gründung von Rhodos GABRIELSEN, „Synoikized Polis“ (Anm. 8), Anm. 44, für den ein Streben nach „Stärke“ für diese Polis nicht nachzuweisen ist. Ebenso etwa SHERWIN-WHITE, Cos (Anm. 9), 70, die Kos in dieser Zeit militärisch nicht als sonderlich einflussreich erachtet und diesen Aspekt überzeugend gerade nicht mit der Gründung verbindet. Eine offensichtliche Konzentration auf die Geschichte Athens und des griechischen Festlandes hat die angeführten strukturellen Veränderungen in Darstellungen zum 4. Jh. v.Chr. bis in jüngste Zeit mitunter sogar unberücksichtigt bleiben lassen. Beispielhaft in diesem Sinne J. BUCKLER, Aegean Greece in the Fourth Century BC, Leiden/Boston 2003, der zwar die peloponnesischen Neugründungen von Megalopolis und Messene anführt, den urbanen Wandel in der
Zur Gründung von Alexandreia 175
nicht unerheblichen Aspekt der neuen Zentren aus, denn es ist offensichtlich, dass diese an exponierten Küstenorten lagen (vgl. Abb. 1). Allerdings bestand eine küstenferne Lage zuvor freilich nur für den Herrschaftssitz der Hekatomniden in Mylasa, während auf Rhodos, Kos und der Knidos-Halbinsel auch die früheren Siedlungszentren eine Küstenlage aufwiesen. Eine stärkere Beherrschung des Meeres erklärt somit noch nicht die spezifische Lage der neuen Orte und damit auch nur bedingt die ursächliche Motivation, diese Städte an eben diesen Orten auszubauen. Und ebenso begründet das in der Forschung vorge-brachte Bestreben nach politischer Einigung nicht, weshalb man zukünftig gerade diese Standorte wählte, zumal das Phänomen neuer urbaner Zentren in der spätklassischen Zeit bei Küstenorten weitestgehend auf den aus gesamtgriechischer Perspektive eher peripheren Bereich der südöstlichen Ägäis beschränkt blieb.16 Der wesentliche Grund für die neue topographische Orientierung ist vielmehr – wie bereits Dietrich Berges für die Knidos-Halbinsel gezeigt hat17 – in den spezifischen nautischen Bedingungen in dieser Region zu sehen, die für die Beurteilung sowohl der militärstrategischen also auch der handels-politischen Zusammenhänge von übergeordneter Bedeutung waren und gewissermaßen den gemeinsamen Nenner der Veränderung darstellen.18 Im folgenden wird dazu ein knapper Überblick über die lokalen und regionalen nautischen Bedingungen in der südöstlichen Ägäis gegeben, die im Rahmen der überregionalen ostmediterranen Verhältnisse erkennen lassen, dass mit der speziellen Lage dieser neuen Orte bereits die zentralen Punkte für einen sich im östlichen Mittelmeerraum weiter verstärkenden Handelsverkehr besetzt wurden.
!Südostägäis jedoch unerwähnt lässt.
16 Größere Neugründungen bzw. Stadtverlagerungen sind im 4. Jh. v.Chr. außerhalb der südöstlichen Ägäis zumeist nicht an Küstenorten und damit nicht im eigentlich maritimen Kontext vorgenommen worden, so etwa Kassope, Mantineia (Neugründung nach Dioikismos), Megalopolis und Messene; vgl. weiterhin Olynth in der 2. Hälfte des 5. Jhs. v.Chr. Die Neugründung von Tenos-Stadt um die Mitte des 4. Jhs. ist zwar den Kykladen zuzuordnen, erfolgte aber in einem ähnlichen Zusammenhang wie die hier näher betrachteten Städte (siehe unten, Anm. 41). Priene und Herakleia am Latmos zählen im weiteren Sinne zum maritimen Kontext der südöstlichen Ägäis, wobei allerdings die Neugründung von Priene wohl auf die Verlandung des Mäander zurückzuführen ist und damit eine andere Ursache hätte als die hier berücksichtigten Orte an den überregionalen Seewegen. Zu Herakleia am Latmos und Priene siehe CALIÒ, „Theatri curvaturae“ (Anm. 8), 61–64 bzw. 77–81 (jeweils mit weiterer Literatur). Zu den urbanen Veränderungen in Ionien im frühen Hellenismus vgl. R. A. BILLOWS, „Rebirth of a Region. Ionia in the Early Hellenistic Period“, in: H. Elton, G. Reger (Hrgg.), Regionalism in Hellenistic and Roman Asia Minor, Bordeaux 2007, 33–43.
17 D. BERGES, „Maritime Verkehrsrouten und ihr Einfluß auf die Stadtentwicklung in klassischer Zeit. Das Beispiel der griechischen Polis Knidos/Karien“, in: Veränderungen europäischer Lebenskultur durch Fluß- und Seehandel. Beiträge zum Internationalen Kongreß für Unterwasserarchäologie (Sassnitz 1999), Lübstorf 2000, 163–169. Ebenso wie Hornblower versteht Berges die urbane Veränderung unter dem Aspekt einer Kontrolle des Schiffsverkehrs (ebd. 167). Vgl. D. BERGES, „Knidos und das Bundesheiligtum der dorischen Hexapolis“, Nürnberger Blätter zur Archäologie 12 (1995/96), 110f.
18 Für die Interpretation des südostägäischen Phänomens ist die spezifische neue Lage auch deshalb grundsätzlich zu berücksichtigen, weil erst daraus die Gemeinsamkeit dieser Stadtverlagerungen bzw. Stadtgründungen und ihr typologischer Unterschied zu ähnlichen Phänomen andernorts (z.B. Kassope, Megalopolis, Messene) ersichtlich wird, denn die in den literarischen Quellen genannten ‚Gründe‘ sagen nichts über die jeweils charakteristische Wahl des Ortes aus, sondern nennen nur die Anlässe der Verlegungen. Stadtgründung, Siedlungsstrukturen und nautische Bedingungen sind für die südöstliche Ägäis in ihrem komplexen Zusammenhang und im Vergleich zu Stadtgründungen der (spät-)klassischen Zeit in anderen Regionen bislang kaum ausreichend diskutiert worden. Vgl. dazu Anm. 41 (Tenos).
Volker Grieb 176
Mit den in den Sommermonaten regelmäßig auftretenden und meist über mehrere Tage beständig wehenden, dabei mitunter bis zur Sturmstärke sich verstärkenden Etesien, den aus nördlichen Richtungen wehenden Winden,19 bestehen in der Ägäis im allgemeinen nahezu ideale Voraussetzungen für einen umfangreichen Schiffsverkehr zwischen klein-asiatischer Küste und griechischem Mutterland. Dieser charakteristische Wind variiert trotz seiner vermeintlichen Einheitlichkeit in einzelnen Regionen allerdings in Stärke und Rich-tung erheblich, was insbesondere durch die Lage der Inseln und des Festlandes mit ihrer jeweiligen geomorphologischen Gestalt beeinflusst wird.20 Ein typisches Beispiel der über-regionalen Windverteilung innerhalb der Ägäis zeigt Abbildung 2. Eine Zone von starken und stürmischen Winden verläuft in der zentralen nördlichen Ägäis bis zu den Kykladen und teilt sich dort im wesentlichen in eine Starkwindzone in der südwestlichen Ägäis und eine in der südöstlichen Ägäis.21 Betrachtet man die Region der südöstlichen Ägäis detail-lierter (Abb. 3), so wird deutlich, dass die Starkwindzone bei einer typischen Etesien-Konstellation keineswegs die gesamte Region betrifft, sondern vor allem den Bereich direkt westlich der an das kleinasiatische Festland angrenzenden Inseln. Für die nautischen Möglichkeiten hatte dies weitreichende Konsequenzen: Eine westliche Passage von Rhodos war in nördlicher Richtung mit der Gefahr von einsetzenden Etesien für Handelsschiffe und ihren eingeschränkten navigatorischen Möglichkeiten22 nur mit schwer kalkulierbaren Risi-
!19 Die Bezeichnung Etesien wird im folgenden in der heute gängigen Weise verwendet für die im Bereich
der Ägäis aus spezifischer Druckverteilung resultierenden und über einige Tage anhaltenden nördlichen Winde (auch als Meltemi bekannt). Dieser Name war in der Antike zumeist nur für die nördlichen Winde in den Sommermonaten gebräuchlich (vgl. etwa Hdt. II 20), da in dieser Jahreszeit die Etesien konstanter und länger anhaltend wehen. Im Winterhalbjahr, in dem sich diese Druckverteilung jedoch ebenso aufbauen kann, werden diese Nordwinde häufiger von durchziehenden Druckgebieten überlagert. Eine genaue Eingrenzung auf einen bestimmten Zeitraum ist für den vorliegenden Beitrag und in der antiken Weise nicht notwendig, zumal damit der in der griechischen und römischen Antike – letztlich erfolglose – Versuch einherging, die Ursache des insbesondere sommerlichen Windphänomens zu erklären. Siehe dazu A. REHM, RE VI.1 (Stuttgart 1907), Sp. 713–715, s.v. Etesiai.
20 Im lokalen Bereich kommen zudem noch verschiedene Einflüsse und Effekte hinzu, die bei bestehenden Etesien-Wetterlagen charakteristische örtliche Wind- bzw. Wettererscheinungen ausprägen lassen.
21 Zu diesen allgemeinen bzw. übergeordneten Windkonstellationen und –verhältnissen im Mittelmeer P. ARNAUD, Les routes de la navigation antique. Itinéraires en Méditerrannée, Paris 2005, 16–22; 207–211 (östliches Mittelmeer); J. BERESFORD, The Ancient Sailing Season, Leiden/Boston 2013, 51–86 (jeweils mit älterer Literatur).
22 Antike Handelsschiffe besaßen bei stärkeren Winden nicht die Möglichkeit, effektiv gegen den Wind zu kreuzen, sondern konnten weitestgehend nur ihre jeweilige Höhe am Wind halten. Wenngleich bei Testfahrten mit der KYRENIA II bei schwachen Winden (Bft. 2) Kurse von 50–60° zur Windrichtung erreicht wurden (dazu M. L. KATZEV, „An Analysis of the Experimental Voyages of Kyrenia II“, in: H. E. Tzalas [Hrg.], Second International Symposium on Ship Construction in Antiquity, Delphi 1990, 254), gilt, dass bei stärkeren Winden, also den für einen ägäischen Handelsverkehr zu berück-sichtigenden Verhältnissen, auch die Abdrift zunimmt und stärkerer Seegang zugleich die Fahrtge-schwindigkeit verringert. Bei starken und stürmischen Winden muss insofern für Handelsschiffe, die beladen ohnehin eingeschränktere navigatorische Möglichkeiten besaßen, vielmehr von effektiven Kursen von ca. 80–90° zum Wind ausgegangen werden. Dies schließt freilich nicht aus, dass mit einer entsprechenden Segeltrimm und Segelführung bei moderateren Windverhältnissen und auch über längere Strecken durchaus effektive Kurse von etwa 70° erreicht werden konnten; vgl. ARNAUD, Navigation antique (Anm. 21), 38–42; BERESFORD, Sailing Season (Anm. 21), 163–166 (mit älterer Literatur); S. MEDAS, „Le attrezzature veliche nel mondo antico. La vela a tarchia, la vela latina e altre tipologie minori“, in: J. Pérez Ballester, G. Pascual (Hrgg.), Comercio, redistribución y fondeaderos. La
Zur Gründung von Alexandreia 177
ken verbunden und damit als Alternative im Grunde gegenstandslos.23 Stellt man weiterhin in Rechnung, dass in den Sommermonaten die Etesien zwar nicht dauerhaft wehen, jedoch die weitaus überwiegende Windkonstellation in der Ägäis darstellen (70–80%; siehe Abb. 4b) und dabei sowohl recht unverhofft eintreten als auch über mehrere Tage anhalten können,24 so blieb für Schiffe aus östlicher Richtung – wollten sie nicht nach Kreta, zur südlichen Peloponnes oder weiter zum Ionischen Meer gelangen – als sinnvoller Kurs in dieser Region einzig die östliche Passage von Rhodos und entlang der kleinasiatischen Küste.25 Die von Horden und Purcell für den zentralen Ägäisbereich angeführte enorme Vielfalt von Kursen,26 die in der Praxis und bei effektiver Zielsetzung allerdings deutlich relativiert werden muss, besteht im Bereich der südöstlichen Ägäis bei Nordkursen also gerade nicht. Dass die Windverhältnisse insbesondere im 4. Jh. v.Chr. denen der heutigen Zeit entsprachen, kann dabei sicher vorausgesetzt werden.27
!navegación a vela en el Mediterráneo, Valencia 2008, 79–111. Für den allgemeinen Handelsverkehr und die sich daran anschließenden Überlegungen zu Hafenorten und urbanen Zentren sind allerdings weniger die möglichen Spitzenwerte als vielmehr durchschnittliche navigatorische Werte sowie die Minimierung nautischer Risiken maßgebend.
23 Siehe dazu Abbildung 3, die erkennen lässt, dass bereits bei einsetzenden Etesien im Bereich der Südspitze von Rhodos durch den Kapeffekt schnell starke Winde entstehen. Dass Frachtschiffe des 4. Jhs. v.Chr. mit ihrer Bauweise Sturm und schweren Sturm (Beaufort 9–10) wohl gemeinhin standhielten, legen die Fahrten mit dem Nachbau der KYRENIA nahe; vgl. BERESFORD, Sailing Season (Anm. 21), 120–122; 145 (mit weiterer Literatur). Die eigentliche Schwierigkeit unter solchen Bedingungen besteht im Freihalten von Küsten auf der vom Wind abgewandten Seite. Beim Einfluss des Seeganges auf navigatorische Möglichkeiten ist weniger die absolute Wellenhöhe entscheidend als vielmehr die Wellenhöhe in Abhängigkeit zur Wellenlänge. Besonders in Kap- und Küstennähe von Starkwindzonen ergeben sich so zusätzliche Gefahren. Im Bereich von Rhodos besitzt in dieser Hinsicht beispielsweise die Südspitze der Insel widrige Bedingungen. Zum Einfluss des Seegangs auf Ruderschiffe BERESFORD, Sailing Season (Anm. 21), 136–140.
24 Einen knappen, aber trefflichen Überblick für die Ägäis bietet jetzt BERESFORD, Sailing Season (Anm. 21), 68f. Die für die moderne Seefahrt wichtigen Monatskarten mit den jeweils vorherrschenden und aus langjährigen Messungen und Beobachtungen gemittelten Windverhältnisse und -häufigkeiten finden sich etwa in den ADMIRALTY SAILING DIRECTIONS, Mediterranean Pilot Volume IV (Auflage 15, 2012); vgl. BERESFORD, Sailing Season, 309–312, mit den Karten für die Ägäis in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober (Stand 2000); W. M. MURRAY, „Ancient Sailing Winds in the Eastern Mediterranean: The Case for Cyprus“, in: V. Karageorghis, D. Michaelides (Hrgg.), Cyprus and the Sea. Proceedings of the International Symposium, Nicosia 1993, Nicosia 1995, 41f., mit vier Karten zu den Windhäufigkeiten im östlichen Mittelmeer (jeweils zusammengefasst für drei Monate).
25 Die nordwestlich der Nordspitze von Rhodos bei Etesien auftretenden stärkeren Winde waren für die antike Schiffahrt weitgehend unproblematisch, da sie nur in einem kleinen Bereich auftreten und den Hafenverkehr von Rhodos-Stadt nicht betreffen. Mit den abends und nachts grundsätzlich leicht abflauenden Etesien und dann wenigstens in den Sommermonaten einsetzenden Landwinden ist dieser Bereich bei Nordkursen – im Gegensatz zur offeneren See im Süden der Insel – leicht zu passieren. Zu den Routen von der südöstlichen Ägäis nach Kreta und Kap Maleas siehe ARNAUD, Navigation antique (Anm. 21), 217f.
26 P. HORDEN, N. PURCELL, The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean History, Oxford 2000, 140. 27 Grundlegend und mit einem Vergleich der Angaben von Aristoteles (meteorologica) und Theophrast
(de ventis) mit den modernen Verhältnissen: W. M. MURRAY, „Do Modern Winds Equal Ancient Winds?“, Mediterranean Historical Review 2 (1987), 139–167. Zur Vergleichbarkeit der Angaben von Theophrast außerdem V. COUTANT, V. L. EICHENLAUB (Hrgg.), Theophrastus, de ventis. Introduction, Translation and Commentary, Notre Dame 1975, XXVII–XXXV. Siehe weiterhin die für den hier betrachteten Zusammenhang wichtige Fallstudie zu Zypern von MURRAY, „Ancient Sailing Winds“
Volker Grieb 178
Abb. 2: Beispiel einer Etesien-Wetterlage mit charakteristischen Windfeldern (Höhe 10m)28 Abb. 3: Beispiel der Windverteilung (Höhe 10m) bei einsetzenden Etesien in der süd-
östlichen Ägäis29
!(Anm. 24), 33–44; weiterhin S. MCGRAIL, „Sea Transport, Part 1: Ships and Navigation“, in: J. P. Oleson (Hrg.), The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World, Oxford 2008, 606–637, hier 613f.
28 Die Pfeile zeigen Windrichtung und -stärke (Skala in Bft). Die Grauabstufungen kennzeichnen die entsprechenden Windfelder gleicher Stärke. Starke Winde (6 Bft) z.B. zwischen Kreta und der Pelo-ponnes sowie östlich der Kykladen. (Beispiel vom 01.11.2013; Quelle: Hellenic Center for Marine Research – www.poseidon.hcmr.gr)
29 Das Beispiel zeigt die bei einsetzenden Etesien schnell starken Winde (Bft 6) an der Südspitze von
Zur Gründung von Alexandreia 179
a) b)
Abb. 4: a) Starkwindzone in der südöstlichen Ägäis bei ausgeprägten Etesien (Höhe 10m)30 b) Prozentuale Windverteilung im Bereich westlich von Rhodos31
Auf der Grundlage dieser nautischen Bedingungen wird ersichtlich, dass die Insel Rhodos bei Passagen aus dem östlichen Mittelmeergebiet in die südöstliche Ägäis nicht nur allgemein eine Schlüsselposition besaß, sondern diese vor allem lokal zu differenzieren ist.32 Eine vergleichbare Situation liegt für Kos vor. Auch dort führt eine westliche Passage in den Sommermonaten in den Bereich der mitunter stark bis stürmisch wehenden Etesien (Abb. 4a). Für Handelsschiffe, die aus dem östlichen Mittelmeer kommend in die zentrale bzw. nördliche Ägäis gelangen wollten, ist dort ebenfalls die östliche Passage entlang der Insel und damit vorbei an der 366/5 v.Chr. neugegründeten Stadt Kos die angemessenere Route, die für den Weg weiter zum Bosporos ohnehin obligatorisch war. Für eine Fahrt entlang der kleinasiatischen Küste und eine Ostpassage von Rhodos und Kos sprachen aus nautischer Sicht zudem noch zwei weitere wichtige Gründe. Einerseits lagen die dortigen Häfen und Hafenbuchten so dicht beieinander, dass Schiffe auch bei unvorhergesehenen Wetterbedingungen problemlos einen Hafen oder eine geschützte Bucht erreichen konn-ten.33 Andererseits sollten Handelsschiffe, die aus dem südöstlichen Mittelmeerraum kom-mend das griechische Mutterland und das für den überregionalen Handelsverkehr wichtige
!Rhodos sowie die gleichzeitig schwachen Winde östlich der Insel (Beispiel vom 31.10.2013; Quelle: Hellenic Center for Marine Research).
30 Westlich von Samos, Kos und Rhodos mit einem Bereich von durchgehend 7 Bft, während östlich und südöstlich von Rhodos zugleich nur schwache Winde wehen (Quelle: Hellenic Center for Marine Research).
31 Ausschnitte zusammengestellt aus ADMIRALTY SAILING DIRECTIONS. Mediterranean Pilot Vol. IV: Aegean Sea and Approaches with Adjacent Coasts of Greece and Turkey, hrg. vom Hydrographic Office, Great Britain, Taunton 112000, Abb. 1.124,1–4. Die Windrosen zeigen entsprechend der Skala Häufigkeit (%), Stärke (Bft) und Richtung der Winde im jeweiligen Monat gemittelt aus langjährigen Messwerten; die Zahl im Kreis zeigt die Häufigkeit der Windstille (%).
32 Im Gegensatz zur jüngeren Literatur hat die nautischen Bedingungen für das antike Rhodos eingehender berücksichtigt H. VAN GELDER, Geschichte der alten Rhodier, Haag 1900, 3f., der allgemein die vor-herrschenden Winde in dieser Region anführt, ohne dabei allerdings auf eine Differenzierung zwischen Nord- und Südspitze der Insel einzugehen.
33 Vgl. BERGES, „Verkehrsrouten“ (Anm. 17), 167.
Volker Grieb 180
Athen anlaufen wollten, mindestens bis auf die geographische Breite von Kos gelangen, um ihre Fahrt unter angemessener Ausnutzung der Etesien fortzusetzen.34 Alle diese Routen führten, sofern nicht umfangreiche zeitliche Verluste und vor allem schwer zu kalkulierende Risiken in Kauf genommen werden sollten, direkt an Rhodos-Stadt, Neu-Knidos, Kos-Stadt und Halikarnassos vorbei – mit anderen Worten: Die weitaus größte Zahl der (Handels-)Schiffe, die in dieser Region in nördliche Richtung fuhr, nutzte den Weg entlang der in spätklassischer Zeit neuangelegten städtischen Zentren, sodass die nautischen Bedingungen für den neuen Urbanismus in der südöstlichen Ägäis zu einer ent-scheidenden Beurteilungsgrundlage werden.35 Die Lage der nunmehr zentralen Orte orientierte sich also ganz offensichtlich direkt an den überregionalen Verkehrswegen und nicht vice versa. Selbst geringfügig abseits gelegene Orte, die in der archaischen Zeit und im 5. Jh. wichtige Siedlungszentren waren, rückten in der Folgezeit in den Hintergrund. Auf Rhodos hätte beispielsweise die große Hafenbucht von Lindos36 ebenso wie auf Kos die Bucht von Astypalaia37 oder wie auf der Knidoshalbinsel der Bereich von Alt-Knidos38 ein umfangreiches städtebauliches Potential sowohl für einen politischen als auch wirt-schaftlichen Hauptort geboten, nur lagen diese Orte eben jeweils einige Seemeilen abseits der Hauptverkehrsrouten und waren damit unter den Bedingungen der spätklassischen Zeit ganz offensichtlich keine adäquaten Alternativen für umfangreiche städtebauliche Neukon-zeptionen.39 Betrachtet man diese strukturellen urbanen Veränderungen in der südöstlichen Ägäis in einem größeren geographischen Kontext, so wird deutlich, dass eine ehemals am Rande der griechischen Welt liegende Region innerhalb einer recht kurzen Zeit einen signifikanten und für die zeitgenössische griechische Welt in dieser Form singulären Wandel durchlief.40
!34 Bei einer in Stadiasmus maris magni 273 (K. Müller, Geographi Graeci Minores I, Paris 1882, 497)
überlieferten Route von Rhodos zur Argolis handelt es sich um eine Alternative, die südlich von Kos, Naxos und Paros in Richtung des Saronischen Golfes führte und dementsprechend für das Anlaufen der südlichen Kykladen sinnvoll war. Eine östliche Passage von Kos bot hingegen bei den starken Winden in der zentralen Ägäis einen größeren Spielraum für Kurse zum Saronischen Golf. Die östliche Küste der Peloponnes bietet zwischen Astros und der südlichen Spitze kaum geeignete Häfen und nahezu keine adäquaten Verkehrswege in die innere Peloponnes, war also für Handelsverbindungen über See wenig attraktiv. Weitere Quellenbelege für die Routen innerhalb der Ägäis bei ARNAUD, Navigation antique (Anm. 21), 223–228.
35 Mit BERGES, „Verkehrsrouten“ (Anm. 17), 163–169. Vgl. dazu RUTISHAUSER, Athens and the Cyclades. Economic Strategies 540–314 BC, Oxford 2012, 218, zur Bedeutung der Kykladen als Verbindungsglied zwischen Athen und dem südöstlichen Mittelmeer. Anders, aber ohne eine Berücksichtigung dieser Orientierung an den Handelswegen, DEMAND, Urban Relocation (Anm. 9).
36 Heute Órmos Líndou mit Ákre Aimilianós. 37 Heute Kólpos Kephálou 38 Heute Bucht von Datça. Dazu BERGES, „Verkehrsrouten“ (Anm. 17), 165f. 39 Dies schließt freilich Heiligtümer mit ihrer Ortsgebundenheit aus (z.B. Lindos). Dass Maussollos sein
Herrschaftszentrum an die Küste nach Halikarnassos verlegte und nicht etwa nach Myndos, das hinsichtlich der überregionalen Verkehrsrouten geeigneter lag, ist dem größeren städtischen Areal von Halikarnassos und dessen vorteilhafter Hafenbucht geschuldet gewesen. Beides war in Myndos nur eingeschränkt vorhanden und außerdem bestand dort für den Hafen eine offensichtliche Verlandungs-problematik. Zudem sind die Verkehrswege von Halikarnassos ins Hinterland vorteilhafter. Vgl. zu Myndos etwa CALIÒ, „Theatri curvaturae“ (Anm. 8), 59–61 (mit weiterer Literatur).
40 Ein gewisses Aufblühen des Städtewesens ist in jener Zeit zudem an der Südküste Kretas zu beobachten (dazu RUTISHAUSER, Economic Strategies [Anm. 35], 222 mit den Nachweisen) und steht dort ebenfalls
Zur Gründung von Alexandreia 181
Offensichtlich wird dies etwa durch einen Blick auf die benachbarte Region der Kykladen, wo im zentralen Bereich des großen griechischen Handelsraumes der Ägäis seit jeher etablierte Verkehrswege bestanden und vergleichbare Neugründungen in dieser Zeit mit der Ausnahme von Tenos-Stadt nicht vorgenommen wurden.41 In der Region der südöstlichen Ägäis ergaben sich mit einer zunehmenden Vernetzung und Intensivierung des Handels-verkehrs im östlichen Mittelmeer hingegen neue Möglichkeiten, die mit den alten, noch aus frühgriechischer Zeit stammenden Siedlungsmustern kaum angemessen ausgeschöpft werden konnten. Diese im Detail zumeist auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführende Entwicklung, die wenigstens auch auf dem jeweiligen Einfluss von Ägypten42 und den Städten der Levante43 sowie der wichtigen und nicht nur vermittelnden Rolle Zyperns44 beruhte, ist in der Tendenz hin zu einer stärkeren Vernetzung und Intensivierung des Handels jedoch offensichtlich, zumal der politische und mitunter auch konfrontative Ge-gensatz zwischen Achaimenidenreich und Griechen im 5. und 4. Jh. v.Chr. anscheinend nur
!im Zusammenhang mit einem intensiveren Handelsverkehr; in diesem Fall auf der Route vom östlichen Mittelmeer in Richtung Ionisches Meer bzw. Sizilien.
41 Die Neugründung von Tenos-Stadt an der südöstlichen Spitze der Insel, die kurz vor der Mitte des 4. Jhs. v.Chr. erfolgte, liegt ebenso wie die neuen Hauptorte in der südöstlichen Ägäis an einer zentralen Stelle für den überregionalen Schiffsverkehr. Charakteristisch ist in diesem Fall, dass Tenos zuvor von Alexander von Pherai geplündert und ein Teil der Einwohner in die Sklaverei verkauft wurde, die Neugründung im Gegensatz zu den vorherigen inländischen Siedlungen dann jedoch an der Küste vorgenommen wurde, also an einem für mögliche Übergriffe sogar exponierteren Platz. Zu den Routen in westlicher bzw. östlicher Richtung innerhalb der Ägäis vgl. Abbildung 2. Die Neugründung von Tenos-Stadt zeigt ebenso wie diejenigen der südöstlichen Ägäis im Sinne eines form follows function und entgegen der von HORDEN/PURCELL, Corrupting Sea (Anm. 26), 140, innerhalb der Kykladen angenommenen enormen Vielfalt an möglichen Kursen die Bedeutung der überregionalen Handelswege, die sich ihrerseits zuvorderst an den vorherrschenden nautischen Bedingungen orientierten. Zur Neugründung von Tenos-Stadt zuletzt RUTISHAUSER, Economic Strategies (Anm. 35), 218–223 (mit älterer Literatur), der zurecht darauf verweist, dass dieser Ort in dem hier diskutierten Zusammenhang mitunter unberücksichtigt geblieben ist (etwa in DEMAND, Urban Relocation [Anm. 9]).
42 Siehe dazu die beiden knappen Überblicke von St. PFEIFFER, „Naukratis, Herakleion-Thonis and Alexandria – Remarks on the Presence and Trade Activities of Greeks in the North-West Delta from the Seventh Century BC to the End of the Fourth Century BC“, in: D. Robinson, A. Wilson (Hrgg.), Alexandria and the North-Western Delta, Oxford 2010, 15–24; (mit der einschlägigen älteren Literatur). Weiterhin S. PASEK, Griechenland und Ägypten im Kontext der vorderorientalischen Großmächte. Die Kontakte zwischen dem Pharaonenreich und der Ägäis vom 7. bis zum 4. Jahrhundert vor Christus, München 2011, 281–338 (zu den Griechen in Ägypten im 4. Jh. v.Chr.). Vgl. auch den Beitrag von B. Meißner im vorliegenden Band.
43 Dazu V. S. JIGOULOV, The Social History of Achaemenid Phoenicia. Being a Phoenician, Negotiating Empires, London 2010; vgl. F. G. MAIER, „Cyprus and Phoenicia“, in: D.M. Lewis et al. (Hrgg.), The Fourth Century B.C., CAH2 VI, Cambridge 1994, 317–325.
44 Jüngst hat A. Mehl die entsprechenden schriftlichen Belege des kyprischen Außenhandels der klassischen Zeit zusammengefasst: „Zyperns Rolle im Überseehandel mit dem Ägäisraum (5.–4. Jh. v.Chr.)“, in: A. Slawisch (Hrg.), Handels- und Finanzgebaren in der Ägäis im 5. Jh. v.Chr., Istanbul 2013, 135–153. – Ein bis auf kleine Nuancen identischer Beitrag des Autors ist nochmals erschienen unter dem Titel „Handel zwischen dem achaimenidischen Zypern und dem Ägäisraum“, in: N. Zenzen, T. Hölscher, K. Trampedach (Hrgg.), Aneignung und Abgrenzung. Wechselnde Perspektiven auf die Antithese von ‘Ost’ und ‘West’ in der griechischen Antike, Heidelberg 2013, 321–340.
Volker Grieb 182
geringe Auswirkungen auf den überregionalen Handelsverkehr gehabt zu haben scheint45 und dieser ohnehin ganz überwiegend von der Initiative Einzelner getragen wurde.46
Neben der im 4. Jh. wichtigen Getreideversorgung Athens aus dem östlichen Mittel-meerraum47 sei hier für einen aus griechischer Perspektive stärker zusammenwachsenden ostmediterranen Handelsraum exemplarisch das Vorgehen von Euagoras I. erwähnt, der 411/0 v.Chr. die Herrschaft über Salamis erlangte.48 Euagoras begann dort ein – wohl um-fangreiches – Bauprogramm, das u.a. auch die Flotte, den Hafen und die Stadt umfasste,49 und er lud gleichzeitig Griechen zur Übersiedlung nach Salamis ein.50 Da Euagoras zunächst in keinem offensichtlichen Gegensatz zum persischen König Dareios II. stand und auch gute Verbindungen zu Athen pflegte, ist sein Vorgehen vor allem vor dem Hinter-grund handelsstrategischer Überlegungen zu verstehen.51 Mit seinen Maßnahmen verbes-serte er zugleich die Möglichkeiten griechischer Handelsverbindungen im östlichen Mittel-meer und machte Salamis allgemein als Anlaufstelle für Händler attraktiver.
!45 Zum ökonomischen und kulturellen Austausch siehe Ch. G. STARR, „Greeks and Persians in the Fourth
Century B.C. A Study in Cultural Contacts before Alexander“, IrAnt 11 (1975), 39–99; DERS., „The Meeting of Two Cultures“, IrAnt 12 (1977), 49–115. In jüngerer Zeit wurde dies nochmals betont etwa von J. WIESEHÖFER, „Persien, der faszinierende Feind der Griechen. Güteraustausch und Kulturtransfer in achaimenidischer Zeit“, in: R. Rollinger, C. Ulf, K. Schnegg (Hrgg.), Commerce and Monetary Systems in the Ancient World: Means of Transmission and Cultural Interaction. Proceedings of the Fifth Annual Symposium of the Assyrian and Babylonian Intellectual Heritage Project, Innsbruck 2002, Stuttgart 2004, 295–310; weiterhin jetzt N. ZENZEN, „Wirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ost und West: Der Handel im östlichen Mittelmeergebiet achaimenidischer Zeit“, in: N. Zenzen, T. Hölscher, K. Trampedach (Hrgg.), Aneignung und Abgrenzung. Wechselnde Perspektiven auf die Antithese von ‘Ost’ und ‘West’ in der griechischen Antike, Heidelberg 2013, 292–321.
46 Einen zeitgenössischen Einblick in die Möglichkeiten, die der Fernhandel zwischen Ägäis und östlichem Mittelmeer ermöglichte, bietet etwa das Vorgehen des bekannten Atheners Andokides, der sich nach seiner Verbannung aus Athen ab 415 v.Chr. als Schiffbesitzer im Fernhandel betätigte, weitgehend von Zypern aus tätig war und seine persönlichen Beziehungen in seine Heimat für entsprechende Handelsgeschäfte nutzte; vgl. C. M. REED, Maritime Traders in the Ancient Greek World, Cambridge 2003, 16–19 (mit den Quellenverweisen). Wenngleich diese Betätigung für Andokides als vormals einflussreichem athenischen Bürger nur eine aus der Not geborene Lösung war, und er eine Rückkehr in seine Heimat anstrebte, werden an seinem Vorgehen doch grundsätzlich auch die in jener Zeit bestehenden Möglichkeiten ersichtlich, die sich im überregionalen Handelsverkehr u.a. mit dem östlichen Mittelmeer für viele Griechen und Phönizier mit entsprechenden Kontakten ergeben haben müssen. M. F. BASLEZ, „Le rôle et la place des Phéniciens dans la vie économique des ports de l’Égée“, in: E. Lipiński (Hrg.), Phoenicia and the East Mediterranean in the First Millennium B.C., Leuven 1987, 267–285, mit einer Übersicht über die nachweisbaren phönizischen Händler in der Ägäis in klassischer und hellenistischer Zeit. Zu den Händlern aus Kition in Athen der 330er Jahre vgl. etwa die Angaben bei MEHL, „Zyperns Rolle“ (Anm. 44), 141, Anm. 15. Vgl. allgemein REED, Maritime Traders, 6–26.
47 Siehe dazu RUTISHAUSER, Economic Strategies (Anm. 35), 212–214 mit Belegen und den Verweisen auf die ältere Literatur.
48 Zu Euagoras E. A. COSTA, „Euagoras I and the Persians, ca. 411 to 391 B.C.“, Historia 23 (1974), 40–56; MAIER, „Cyprus and Poenicia“ (Anm. 43), 312–317.
49 Isokr. or. IX 47. 50 Isokr. or. IX 51. 51 COSTA, „Euagoras“ (Anm. 48), 44. Dass Euagoras damit insgesamt auch seine eigene Position und
Herrschaft, die er im folgenden auf weitere Teile Zyperns auszudehnen versuchte, stärken wollte, ist offensichtlich. Zum Zusammenhang von Flotte und Handelsort in klassischer Zeit vgl. unten, Anm. 152 und 153.
Zur Gründung von Alexandreia 183
Der Umfang des phönizischen und vor allem griechischen Handelsverkehrs im südöst-lichen Mittelmeerraum des frühen 4. Jhs. v.Chr. wird indes anhand der großen Inschriften-stelen aus Naukratis und nunmehr Herakleion-Thonis aus der Zeit des Nektanebos I. nahegelegt. Das Meer, das sich an das Nildelta anschloss, wurde aus ägyptischer Perspektive als Meer der Griechen bzw. Phönizier gesehen.52 Die in den Stelen angeführten Handelsbestimmungen setzen dabei einen weitgehend etablierten Handelsverkehr im öst-lichen Mittelmeer voraus53 und lassen für diese Zeit von einer deutlichen Öffnung Ägyp-tens für einen auswärtigen Handel ausgehen.54 Dies schließt wiederum treffend an die Beo-bachtungen von Vadim Jigoulov an, wonach phönizische Städte an der Levanteküste in der ersten Hälfte des 4. Jhs. v.Chr. einen offensichtlichen wirtschaftlichen Aufschwung er-fuhren,55 der naheliegend mit einem insgesamt umfangreicheren Handelsverkehr im öst-lichen Mittelmeerraum erklärt werden kann.56 Für den ostmediterranen Raum ist dabei freilich zu berücksichtigen, dass das nautische Potential für Handelsverbindungen vor allem dann umfangreich und effektiv ausgenutzt werden konnte, wenn Ägypten in den Handelskreislauf einbezogen wurde. Abbildung 4a zeigt die bei entsprechenden Wetterlagen weit nach Süden reichenden Etesien. Für Schiff-fahrten boten sich damit über weit mehr als die Hälfte des Jahres häufig sehr günstige Be-dingungen, ohne größere Zeitverluste und in kürzester Zeit (ca. 4 Tage)57 weit nach Süd-osten zu gelangen, während eine direkte Ansteuerung der Levanteküste oder Zyperns zwar ähnlich lange dauerte, aber aufgrund der weniger konstanten Windbedingungen mit deutlich größeren navigatorischen Schwierigkeiten verbunden war.58 Die Routen aus dem
!52 A.-S. VON BOMHARD, The Decree of Saïs, Oxford 2012, 75f. Anm. e und 86f. Anm. p. 53 VON BOMHARD, Decree of Saïs (Anm. 52), 94–102 (mit weiterer Literatur). Einen regen
Handelsverkehr belegt für das 5. Jh. v.Chr. das Zollregister in den Elephantine-Papyri mit dem Verzeichnis fremder Schiffe in einem nicht zu bestimmenden Hafen an der Küste von Ägypten: P. Briant, R. Descat, „Un registre douanier de la satrapie d’Égypte à l’époque achéménide (TAD C3,7)“, in: N. Grimal, B. Menu (Hrgg.), Le commerce en Égypte ancienne, Kairo 1998, 59–105; bes. 62–69 (zu den Schiffen). Für das 4. Jh. v.Chr. vgl. weiterhin die Angaben oben, Anm. 42–44.
54 Ein höherer Finanzbedarf resultierte für die Ägypter in der Zeit zwischen 404–343 v.Chr. aus den Auseinandersetzungen mit den Persern: Siehe dazu den Überblick bei PFEIFFER, „Trade Activities“ (Anm. 42), 19f. (mit weiterer Literatur). Zur Rolle des Münzgeldes als Indiz enger Handelsbeziehungen zwischen Ägypten und der Ägäiswelt vor Alexander siehe G. LE RIDER, „Le rôle monétraire d’Alexandrie“, in: J. Leclant (Hrg.), Alexandrie: Une Mégapole cosmopolite, Paris 1999, 15–17.
55 JIGOULOV, Achaemenid Phoenicia (Anm. 43), 105–111. Beurteilungsgrundlage sind bei Jigoulov die Münzfunde.
56 Dass ethnische Gegensätze, etwa zwischen Griechen und Phöniziern, in dieser Zeit gerade im Überseehandel eine immer geringere Rolle spielten, hat für die Verhältnisse auf Zypern MEHL, „Zyperns Rolle“ (Anm. 44), 141, betont.
57 Diod. III 34,7, wonach bei jeweils guten Winden die Strecke vom Asowschen Meer bis Rhodos etwa zehn Tage in Anspruch nahm, weiter bis Alexandreia etwa vier Tage und von dort nilaufwärts bis Äthiopien nochmals etwa zehn Tage nötig waren, die bekannte Welt von Nord nach Süd bei günstigen Bedingungen also innerhalb eines Monats zu befahren war. Zur den entsprechenden Routen im östli-chen Mittelmeer siehe die in den weiteren antiken Quellen überlieferten Fahrtzeiten bzw. daraus zu errechnende Geschwindigkeiten in den Übersichten von ARNAUD, Navigation antique (Anm. 21), 102–104 (Taf. 3); 128–131 (Taf. 5); ebd. 212f. mit den überlieferten Strecken im östlichen Mittelmeer. Grundsätzlich ist wegen der Abhängigkeit von Wetter- bzw. Windverhältnissen von einer größeren Variabilität der Fahrtzeiten auszugehen.
58 Vgl. dazu die entsprechenden Abschnitte zu den überregionalen Schiffahrtsrouten im östlichen
Volker Grieb 184
östlichen Mittelmeer in die Ägäis hingegen führten wegen der in Gegenrichtung weit weniger vorteilhaften Windbedingungen jeweils entlang der Levanteküste und über Zypern bzw. entlang der kilikischen Küste zu der oben beschriebenen Passage vorbei an Rhodos und Kos.59 Eine direkte Passage von Ägypten zur südöstlichen Ägäis, wie sie Pascal Arnaud als Möglichkeit anführt, spielte für den Handelsverkehr gerade wegen der beschrie-benen nautischen Bedingungen allerdings nur eine ganz marginale Rolle.60 Die gängigste und den naturräumlichen Bedingungen folgende Route im östlichen Mittelmeer war der gegen den Uhrzeigersinn verlaufende Handelsweg, der Händler aus den einzelnen Regionen zudem leicht wieder an ihre Ausgangsorte zurückgelangen ließ.61
!Mittelmeer in ARNAUD, Navigation antique (Anm. 21); BERESFORD, Sailing Season (Anm. 21); jeweils mit weiterer Literatur. Strabons Verweis auf eine häufige griechische Piraterie gegen das Nildelta in früherer Zeit, die einen ägyptischen Flottenstützpunkt im Bereich von Rhakotis notwendig machte, kann in dieser Hinsicht als indirekter Beleg dieser sehr guten Überseepassage von Nord nach Süd verstanden werden: Strab. XVII 1,6 (792), wonach frühere Könige der Ägypter voller Hass gegen sämtliche Seefahrer gewesen seien, besonders die Griechen. Weil sie plünderten und wegen Landmangel fremdes Land begehrten, hätten die Pharaonen an der Stelle Rhakotis eine Wache stationiert, um die Heran-kommenden abzuwehren. Vgl. demgegenüber FRASER, Alexandria (Anm. 1), 5, der diesen Stützpunkt weniger unter militärischen als vielmehr ökonomischen Aspekten versteht.
59 Strab. II 5,24 (125), führt an, dass die direkte Strecke von Rhodos nach Alexandreia 4000 Stadien betrage, diejenige entlang der Küste hingegen die doppelte Strecke. Nach L. CASSON, The Ancient Mariners. Seafarers and Sea Fighters of the Mediterranean in Ancient Times, Princeton 21991, 102, sei Rhodos „a port of call for all ships from Egypt“ gewesen. Eine solche strikte Interpretation des Handelsverkehrs lässt sich allerdings nicht nachweisen und dürfte in Anbetracht der zahlreichen privaten Händler, die sich an der Belagerung von Rhodos-Stadt durch Demetrios Poliorketes im Jahre 305/4 v.Chr. beteiligten (nach Diod. XX 82,5 nahezu 1.000 Schiffe) eher unwahrscheinlich sein. Spricht dies keineswegs gegen die Notwendigkeit der Passage in die Ägäis, muss für die Interpretation der Neugründung Rhodos-Stadt und ihrer jeweiligen zeitgenössischen maritimen Bedeutung also dahin-gehend unterschieden werden, ob die Passage einen notwendigen oder nur einen möglichen Aufenthalt mit sich brachte; dies wiederum betrifft dann die grundsätzliche Frage der Konkurrenz von Hafenorten in dieser Region, die hier nicht weiter erörtert werden kann.
60 P. ARNAUD, „Navigeur entre Égyte et Grèce. Les principales lignes de navigation d’après les données numériques des géographes anciens“, in: J. Leclant (Hrg.), Entre Égypte et Grèce. Actes du Colloque du 6–9 octobre 1994, Paris 1995, 102f. Arnaud bezieht sich auf die Angabe in Agathemeros’ Geographiae Informatio 18 (K. Müller, Geographi Graeci Minores II, Paris 1882, 479), der dort allerdings nur die Distanz von Alexandreia nach Lindos mit 4500 Stadien angibt. Die Einschätzung von Arnaud ist zuletzt übernommen worden von W. HUSS, Die Wirtschaft Ägyptens in hellenistischer Zeit, München 2012, 29, was ohne eine kritische Anmerkung das Bild der gängigen ägyptischen Exportrouten verfälscht. Die für eine solche Passage relevanten westlichen oder südlichen Winde treten gerade in den Wintermonaten auf und sind weitaus weniger konstant, da sie sich zumeist aus durchziehenden Druckgebieten ergeben, nicht aber aus den großräumigen, über mehrere Tage beständigen und zumeist frontlosen Druckver-teilungen wie bei den Etesien (vgl. dazu oben, Anm. 24 und 31, die Angaben zu den Monatskarten zur Windverteilung sowie unten, Anm. 62). Eine überregionale Route von der ägyptischen Küste auf direktem Wege zur südöstlichen Ägäis wäre also grundsätzlich mit erheblichen navigatorischen respek-tive nautischen Risiken verbunden und ihr Nutzen dementsprechend nur sehr gering gewesen.
61 Eine allgemeine Charakterisierung dieser Routen etwa in L. CASSON, „Mediterranean Communi-cations“, in: D. M. Lewis et al. (Hrgg.), CAH2 VI, The Fourth Century B.C., Cambridge 1994, 519–522; ARNAUD, „Navigeur“ (Anm. 60), 98f.
Zur Gründung von Alexandreia 185
a) b)
Abb. 5: Beispiel der Windverteilung im östlichen Mittelmeer bei einer Etesien-Wetterlage (a). Etesien-Wetterlage verstärkt durch ein Tiefdruckgebiet südöstlich von Zypern (b).62
Ein zunehmender Handelsverkehr zwischen südöstlichem Mittelmeer und Ägäis ging also immer auch mit einem zunehmenden Handelsverkehr entlang der neuen Zentren des 4. Jhs. v.Chr. in der südöstlichen Ägäis einher. Im überregionalen Kontext hatte diese Region also bereits deutlich vor Alexander dem Großen und spätestens seit dem frühen 4. Jh. v.Chr. für den Schiffsverkehr wesentlich an Bedeutung gewonnen und rückte von der Peripherie der griechischen Welt stärker in das Zentrum eines ostmediterranen Handels- und Verkehrs-netzes. Dass dabei der Handel und die damit verbundenen Einnahmen eine wesentliche Voraussetzung für den städtebaulichen Erfolg der Gründungen bedeutete, macht ein Blick auf Xenophons Poroi deutlich, indem die dort angeführten Möglichkeiten einer am Über-seehandel beteiligten Polis, staatliche Einnahmen – mitunter deutlich – zu erhöhen, gerade in jener Region wegen der Konzentration der Schiffahrtswege und der notwendigen Pas-sage entlang der neuen Städte beträchtlich gewesen sein müssen.63
!62 a) Beispiel vom 08.11.2013; b) Beispiel vom 05.12.2013 (Quelle: MeteoEarth – www.meteoearth.com).
Ein starkes Druckgefälle zwischen hohem Luftdruck über dem Balkan und einem Tiefdruckgebiet über der Libyschen Wüste bewirkt eine Ausdehnung der Etesien bis zur libyschen Küste mit entsprechend stärkeren Winden in der Ägäis. Eine ganz ähnliche Windverteilung kann sich u.a. auch durch ein Tiefdruckgebiet im Bereich der mittleren Levanteküste einstellen (hier Abb. 5b). Auf die meteo-rologischen Einzelheiten kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden; vgl. dazu etwa J. BLÜTHGEN, Allgemeine Klimageographie, Berlin/New York 31980.
63 Xen. por. 3. Vgl. zur Prosperität von Kos-Stadt SHERWIN-WHITE, Cos (Anm. 9), 68, 225f. Zum Hafen und dem schnell wachsenden Wohlstand von Kos Diod. XV 76,2; die schnelle Fertigstellung des Hafens geht aus Ps.-Skylax (Periplous 99; ca. 338/7 v.Chr.; siehe unten Anm. 89) hervor. Das große wirtschaftliche Potential, das Küstenorte an entsprechend vorteilhaften Handelsrouten gegenüber inländischen Orten (oder auch abgelegenen Küstenorten) besaßen, zeigt das Beispiel Lesbos, wo in klassischer und hellenistischer Zeit die Städte Hiera, Pyrrha und Arisbe zwar jeweils eine große landwirtschaftlich nutzbare Fläche besaßen, die Küstenorte Methymna und Mytilene, die weitaus besser an der wichtigen Handelsroute zum Schwarzen Meer lagen, jedoch deutlich stärker prosperierten; A. BRESSON, La cité marchande, Bordeaux 2000, 101–108. Die Abhängigkeit eines städtischen Ausbaus von den wirtschaftlichen Möglichkeiten zeigt ein Blick auf die spätklassische Neugründung von
Volker Grieb 186
Für die Beurteilung einer im Bereich des westlichen Nildeltas neuzugründenden grie-chischen Hafenstadt, die an den überregionalen Handelsströmen beteiligt werden sollte (s.u.), ist die urbane Entwicklung in der südöstlichen Ägäis dementsprechend der direkte Vorläufer und offensichtlicher Bezugspunkt, zumal mit den neuerrichteten Stadtanlagen auch ein zeitgenössisches städtebauliches Know-how vorausgesetzt werden kann, das kaum in einer anderen griechischen Region dieser Zeit so umfangreich bestanden haben dürfte.64 Gleiches gilt wegen der Rolle als nautischem Knotenpunkt, den diese Region darstellte, letztlich auch für die dortige Kenntnis maritimer Möglichkeiten und Handelsverbindungen zwischen griechischer Welt und östlichem Mittelmeerraum. Dass Rhodier – wie Lykurg berichtet – zu seiner Zeit Handel in der gesamten bewohnten Welt getrieben hätten, bestätigt dieses Bild.65 Stellvertretend für das offensichtlich vorhandene Potential der über-regionalen Schiffahrts- und Handelsrouten spätestens ab dem ausgehenden 5. Jh. v.Chr. kann dann auch die maritime Gesamtkonzeption und schiere Dimension der Gründung von Rhodos-Stadt stehen, deren Gesamtfläche nur wenig kleiner war als das erst zwei Gene-rationen später gegründete Alexandreia (s.u.) und die ganz offensichtlich als zentraler Hafenort der Insel angelegt wurde.66
!Megalopolis, die anfänglich eine vor allem politisch-militärische Funktion besaß und nach einem ersten umfangreichen Ausbau nicht zuletzt wegen des wenig fruchtbaren Umlandes und fehlenden Zugangs zum Meer in späthellenistischer und römischer Zeit nur noch eine rudimentäre städtebauliche Ausgestaltung erfuhr; dazu V. GRIEB, „Bürger für die Große Stadt. Megalopolis, die oliganthropia und die megale eremia“, in: L.-M. Günther (Hrg.), Migration und Bürgerrecht in der hellenistischen Welt, Wiesbaden 2012, 107–126 (mit weiterer Literatur).
64 Da in der südostägäischen Region gleich mehrere maritime Stadtanlagen entstanden, ist von einer förderlichen Konkurrenz zwischen den beteiligten – allerdings unbekannten – Baumeistern auszugehen. Auf ein vorauszusetzendes städtebauliches Know-how gibt der zeitgenössische Anspruch des Pytheos einen trefflichen Hinweis (siehe unten, S. 198f. mit Anm. 121 und 122). Entgegen der Angabe von Strab. XIV 2,9 (654) ist Rhodos-Stadt kein Werk des Hippodamos von Milet, dessen Name vielmehr mit dem Ausbau von Piräus zu verbinden ist (J. SZIDAT, „Hippodamos von Milet. Seine Rolle in Theorie und Praxis der griechischen Stadtplanung“, BJ 180 [1980], 31–44). Hippodamos spielt für den hier betrachteten Zusammenhang keine Rolle und betrifft die vorgebrachten Argumente weiter nicht. Siehe zum maritimen Städtebau D. J. BLACKMAN, „Sea Transport, Part 2: Harbors“, in: J. P. Oleson (Hrg.), The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World, Oxford 2008, 654f. (dort auch zur Einbindung von Hafenanlagen in die Stadtkonzeption im Falle von Neu-Knidos und Rhodos-Stadt). Vgl. demgegenüber DEMANDT, Alexander (Anm. 1), 166, wonach Alexandreia „die erste planmäßige Hafenanlage für den Weltverkehr seit dem Umbau des Piräus durch Hippodamos um 440“ gewesen sei.
65 Lyk. Leok. 15 (330 v.Chr.): (…) καὶ τῶν ἐµπόρων τοῖς ἐπιδηµοῦσιν ἐκεῖ [sc. Rhodos], οἳ πᾶσαν τὴν οἰκουµένην περιπλέοντες δι’ ἐργασίαν (…). Der maritime Knotenpunkt, der sich im Bereich von Rhodos in der spätklassischen Zeit ausgeprägt hatte, ist durchaus vergleichbar mit demjenigen, den Korinth in der archaischen Zeit zwischen der Ägäiswelt und dem Ionischem Meer besaß.
66 Nach HOEPFNER/SCHWANDNER, Haus und Stadt (Anm. 8), 52, ist für Rhodos-Stadt mit einer Größe von ca. 290 ha in spätklassischer Zeit zu rechnen (vgl. Th. H. NIELSEN, V. GABRIELSEN, „Rhodos“ [Anm. 9], 1206, mit 300 ha); für Halikarnassos HOEPFNER/SCHWANDNER, Haus und Stadt, 228, mit ca. 200 ha (FLENSTED-JENSEN, „Halikarnassos“ [Anm. 11], 1115, mit 220 ha). Für Alexandreia legt W. HOEPFNER, „Von Alexandria über Pergamon nach Nikopolis. Städtebau und Stadtbilder hellenistischer Zeit“, in: Akten des XIII Internationalen Kongresses für Klassische Archäologie, Berlin 1988, Mainz 1990, 275–285, hier 275–278, eine Größe von ca. 350 ha zugrunde (für das Wohngebiet 250 ha). Vgl. dazu die entsprechenden Pläne bei HOEPFNER/SCHWANDNER, passim, sowie unten, Anm. 110. Zur ursprünglichen Größe von Alexandreia vor einer Erweiterung der Stadt nach Osten bereits in hellenis-
Zur Gründung von Alexandreia 187
2. Die historische Glaubwürdigkeit der literarischen Überlieferung zur Gründung von Alexandreia67 Nach der Einnahme der Levanteküste mit den Belagerungen von Tyros und Gaza gelangte Alexander über die Grenzfestung Pelusion in die alte ägyptische Herrschaftsmetropole Memphis, wo ihm der persische Satrap Mazakes förmlich die Herrschaftsgewalt über das Nilland übergab.68 Das Vorgehen Alexanders in Ägypten nach seinem ersten Aufenthalt in Memphis stellen die Quellen in unterschiedlicher Weise dar. Während unstrittig ist, dass er mit einer Gefolgschaft über den Nil und vorbei am griechischen Handelsstützpunkt Nau-kratis am kanopischen Nilarm bis an die Mittelmeerküste gelangte,69 setzen Arrian und Plutarch vor die weitere Reise nach Siwa zunächst den Aufenthalt an der Küste des west-lichen Nildeltas, bei dem Alexander den Ort für die zukünftig seinen Namen tragende Stadt ausgewählt und deren Gründung beschlossen haben soll.70 Curtius Rufus, Diodor und Iustin (Pompeius Trogus) lassen den Makedonenkönig hingegen erst zum Orakelheiligtum des Zeus-Ammon in die libyische Wüste reisen,71 wobei Curtius und Diodor ihren Alexander zunächst an der Mittelmeerküste Gesandte aus Kyrene treffen lassen, von denen er Ge-schenke entgegen nahm und mit denen er einen Freundschafts- und Bündnisvertrag abschloss.72 Ebenso wie Curtius, Diodor und Iustin schildert der griechische Alexander-roman die Episode der Stadtgründung im Anschluss an den Besuch des Ammon-Heilig-tums, wo Alexander der Überlieferung nach sogar von Zeus-Ammon einen Hinweis auf den Ort der Gründung zu erhalten wünschte.73
Die Forschung hat für diese widersprüchliche chronologische Überlieferung bislang keine einheitliche Position erreicht (s.u.), und in Darstellungen zu Alexander bzw. Alexan-
!tischer Zeit siehe auch GRIMM, Alexandria (Anm. 1), 33.
67 Die Abschnitte zur Gründung von Alexandreia in den antiken Quellen brauchen hier nicht eigens vorgestellt zu werden. Siehe dazu die unter Anm. 1 angeführte Literatur sowie zuletzt etwa ERSKINE, „Imagination“ (Anm. 4). Es handelt sich dabei insbesondere um: Arr. an. III 1,5–2,2; Curt. IV 8,1–2; 5–6; Diod. XVII 52; Iust. XI 11,13; Plut. Alex. 26; Ps.-Kallisth. I 30,6–32,6 (hier Handschrift A [ed. Kroll] mit Rezension β nach Handschrift λ [Thiel]); Strab. XVII 1,6 (792); Val. Max. 1,4 ext. 1; Plin. nat. hist. V 62.
68 Zum Übergang von persischer zu makedonischer Herrschaft in Ägypten vgl. S. M. BURSTEIN, „Alexander in Egypt: Continuity or Change?“, in: H. Sancisi-Weerdenburg, A. Kuhrt, M. Cool Root (Hrgg.), Achaemenid History VIII. Continuity and Change, Leiden 1994, 381–387; M. CHAUVEAU, „L’Égypte en transition: des Perses aux Macédoniens“, in: P. Briant, F. Joannès (Hrgg.), La transition entre l’empire achéménide et les royaumes hellénistiques (vers 350–300 av. J.-C.). Actes du colloques Paris 2004, Paris 2006, 375–404; A. B. LLOYD, „From Satrapy to Hellenistic Kingdom. The Case of Egypt“, in: A. Erskine, L. Llewellyn-Jones (Hrgg.), Creating a Hellenistic World, Swansea 2011, 83–105.
69 Von einer nach Curt. IV 7,5 zunächst unternommenen Fahrt nilaufwärts nach Theben, an die sich die Fahrt nilabwärts über den westlichen Nilarm und die Mittelmeerküste nach Siwa anschloss, berichten die übrigen Quellen nicht: a Memphi eodem flumine vectus ad interiora Aegypti penetrat compositisque rebus ita, ut nihil ex patrio Aegyptiorum more mutaret, adire Iovis Hammonis oraculum statuit. Dazu NAWOTKA, Alexander (Anm. 1), 207, sowie insbesondere der Beitrag von G. Malinowski im vorliegen-den Band.
70 Arr. an. III 1,4–5; Plut. Alex. 26; vgl. Strab. XVII 1,43 (814). 71 Curt. IV 8,1–2; Iust. XI 11,13; Diod. XVII 49,2 (siehe zu Diodors Darstellung die einschränkenden
Bemerkungen unten, S. 208. 72 Diod. XVII 49,2–3; Curt. IV 7,9. Nach Curtius trafen ihn die Gesandten am Mareotis-See. 73 Ps.-Kallisth. I 30,6.
Volker Grieb 188
dreia wird die Gründung bis in die jüngste Zeit mal vor und mal nach seinem Siwa-Aufenthalt gesetzt.74 Demgegenüber werden die einzelnen Details zum Gründungsvorgang, die in den Quellen überliefert sind, und Alexanders persönliche Rolle bei der Gründung, den Verlauf der Gründung sowie stadtplanerische und städtebauliche Details betreffen, in modernen Darstellungen häufig in beinahe patchwork-artiger Weise zusammengefasst, wobei der Makedonenkönig in Anlehnung an die eingängige Überlieferungsvariante zumeist a priori als die zentral handelnde Person angenommen wird.75 Eine Überein-stimmung, welche Details der Gründung zutreffend sein mögen, sich gegebenenfalls überzeugend auf Alexander zurückführen ließen und welcher Quelle in dieser Hinsicht eine gewisse Autorität zukäme, besteht dabei nicht. Dies verwundert insofern, weil die Chro-nologie der Gründung demgegenüber auf der angeführten widersprüchlichen Überlie-ferung mit den gegenteiligen Forschungspositionen beruht.76 Da für die Frage der Chrono-logie von nicht unerheblicher Bedeutung ist, ob dem Makedonenkönig anhand der Quellen überhaupt eine besondere persönliche Intention zur Gründung einer zukünftigen Metropole zugesprochen werden kann, diese jedoch nur anhand der überlieferten Details des Grün-dungsvorganges und deren Plausibilität zu beurteilen ist, sollen im folgenden zunächst diese Details diskutiert werden. In der literarischen Überlieferung nimmt die Schilderung zum Auffinden des späteren Ortes eine zentrale Rolle ein. Sowohl Arrian als auch Plutarch gehen in ihrer Darstellung von einem unbekannten Ort aus, den Alexander für seine zukünftige Stadt entdeckte.77 Am weitreichendsten leitet dies jedoch der Alexanderroman her, wonach sich Alexander zuerst in Siwa durch ein Orakel des Zeus-Ammon den Ort der zukünftigen Stadt habe weissagen lassen und er diesen Ort nach einiger Suche auch erreichte.78 Eine Beurteilung, inwieweit diese Angaben glaubwürdig sind, der Makedonenkönig den Ort also entdecken konnte, ist letztlich abhängig davon, ob die Topographie der Küstenabschnitte um das spätere Alexan-dreia bereits vor Alexander wenigstens unter den Griechen im Nildelta sowie griechischen Händlern, die regelmäßig in diese Region kamen, als bekannt vorausgesetzt werden kann.
!74 Siehe unten, S. 206 mit Anm. 156 und 157. 75 Vgl. dazu die in Anm. 1 genannte Literatur. Zur Kritik an Alexanders Rolle siehe oben, Anm. 4. 76 Eine hinsichtlich der Datierung quellenkritische Position mit einem jedoch auf die Person Alexanders
bezogenen quellenübergreifenden Gründungszusammenhang etwa bei HUSS, Ägypten (Anm. 1), 63–69; vgl. weiterhin etwa FRASER, Alexandria (Anm. 1), der Arrian als Autorität der literarischen Überlie-ferung zur Gründung anführt (3f.), in der folgenden Darstellung zu Gründung und Topographie der Stadt (3–37) den Gründungszusammenhang jedoch quellenübergreifend darstellt.
77 Arr. an. III 1,5; Plut. Alex. 26. 78 Ps.-Kallisth. I 30,6–31,6. Diese Ausschmückung im Alexanderroman knüpft wohl an vergleichbare
ägyptische Legenden an, wie plausibel dargelegt hat M. EL-ABBADI, „The Island of Pharos in Myth and History“, in: W. V. Harris, G. Ruffini (Hrgg.), Ancient Alexandria between Egypt and Greece, Leiden/Boston 2004, 263f. (mit den ägyptischen Legenden, in denen Ammon ähnliche Anweisungen zur Auffindung eines Ortes etwa an Hatschepsut und Amenemhet III. gibt). Dies legt wiederum eine ägyptische Tradition dieser Episode im Alexanderroman nahe, die dementsprechend wohl an ein ägyptisches Publikum gerichtet gewesen sein dürfte. Vgl. ERSKINE, „Imagination“ (Anm. 4), 177f. Anders noch nachdrücklich C. B. WELLES, „The Discovery of Sarapis and the Foundation of Alexandria“, Historia 11 (1962), 271–298, der das Aufsuchen des Orakels als notwendige Voraus-setzung für die Gründung sieht, um damit nicht zuletzt das ebenfalls im Alexanderroman überlieferte traditionelle Gründungsdatum 25. Tybi (= 7. April) zu begründen.
Zur Gründung von Alexandreia 189
Eine weiterreichende historische Relevanz erhält dies sodann dadurch, weil mit diesen Schilderungen in der literarischen Überlieferung zugleich die besondere persönliche Intention Alexanders zur Gründung einer zukünftigen Metropole verbunden wird, indem er mit der ihm zugeschriebenen Wahl des geeigneten Platzes genau diejenigen Voraus-setzungen schuf, die Alexandreia ein schnelles Wachstum ermöglichten und zu der großen Stadt werden ließen, die die späteren Autoren kannten.79 Dass an einem solchen, für Griechen topographisch gewissermaßen unbekannten Platz allerdings erhebliche Zweifel bestehen und dementsprechend auch Alexanders literarische Rolle bei der Gründung einer Kritik zu unterzuziehen ist, zeigen mehrere Quellenhinweise, die auf eine weitreichende Bekanntheit der Region um Pharos und Rhakotis unter Griechen bereits in der voran-gehenden Zeit schließen lassen und einzelne mythische Orte im Küstenbereich des west-lichen Nildeltas betreffen. So soll sich etwa auf der Alexandreia vorgelagerten Insel Pharos nach den in der griechischen Tradition tief verankerten homerischen Epen der Wohnsitz des Sehers Proteus befunden haben,80 während nach einer anderen Episode der Ilias-Erzählung Paris und Helena auf ihrem Weg von Lakedaimonien nach Troja gerade in die der Insel Pharos benachbarte Gegend von Herakleion-Thonis gelangt seien.81 Dorthin habe es auf dem Rückweg von Troja gemäß der Odyssee dann auch Menelaos an die ägyptische Küste verschlagen;82 die der westlichen Nilmündung wenig vorgelagerte Insel Kanopos (heute Île Nelson) trug ihren Namen deshalb, weil dort nach griechischer Vorstellung Menelaos’ gleichnamiger Schiffskapitän den Tod gefunden habe.83 Es dürfte keineswegs dem Zufall geschuldet sein, dass diese mythischen Orte gerade dort lagen, wo ein Großteil der Grie-chen aufgrund der charakteristischen nautischen Bedingungen im östlichen Mittelmeer ohnehin seit alters her den ägyptischen Herrschaftsbereich erreichte (vgl. Abb. 5a/b).84 Dies wiederum scheint in einer nicht genauer zu bestimmenden früheren Zeit für die Pharaonen sogar eine derartige Bedrohung dargestellt zu haben, dass in Rhakotis ein ägyptischer Flot-tenstützpunkt zum Schutz vor Eindringlingen, u.a. ausdrücklich Griechen, eingerichtet worden sein soll.85 Und direkt an der Mündung des kanopischen Nilarms bestand weiterhin
!79 Exemplarisch für eine weitgehend direkte Übernahme der Quellenangaben zuletzt etwa DEMANDT,
Alexander (Anm. 1), 166 („Alexander mit sicherem Blick für die Gunst der Lage“). Siehe zudem die Angaben oben, Anm. 4.
80 Dazu die Proteus-Episode in Hom. Od. IV 349–570 (Menelaos erzählt Telemachos von seinem dortigen Aufenthalt); vgl. Hdt. II 113–116; Ps.-Kallisth. I 32,1 (mit dem angeblichen Grab des Proteus auf Pharos). Dazu H. HERTER, RE XXIII,1 (Stuttgart 1957), Sp. 940–975, hier 944f., s.v. Proteus.
81 In der Version bei Hdt. II 113–116. 82 Sie gelangten nach Thonis: Strab. XVII 1,16 (800) mit Hom. Od. IV 228. Zum mythischen Kontext der
Region um Kanopos vgl. GRIMM, Alexandria (Anm. 1), 16f.; CLAUSS, Alexandria (Anm. 1), 35–39; EL-ABBADI, „Island of Pharos“ (Anm. 78), 260–262.
83 Ps.-Skylax 106,5; vgl. Strab. XVII 1,17 (801). Der Name Kanopos wird in den Quellen nicht nur für einen Ort, sondern auch für die Region gebraucht; dazu die Übersicht und die Lokalisierungen in Y. STOLZ, „Kanopos oder Menouthis? Zur Identifikation einer Ruinenstätte in der Bucht von Abuqir in Ägypten“, Klio 90 (2008), 193–207, hier 198f.; 203f.
84 Die mythischen Erzählungen spiegeln dabei ein durchaus realistisches Schicksal wider, das Seeleuten aufgrund der angeführten Bedingungen in der südlichen Ägäis bei unvorhergesehen Winden oder navigatorischen Nachlässigkeiten widerfahren konnte.
85 Der Stützpunkt bei Strab. XVII 1,6 (792): οἱ µὲν οὖν πρότεροι τῶν Αἰγυπτίων βασιλεῖς ἀγαπῶντες οἷς εἶχον καὶ οὐ πάνυ ἐπεισάκτων δεόµενοι, διαβεβληµένοι πρὸς ἅπαντας τοὺς πλέοντας καὶ µάλιστα
Volker Grieb 190
noch im 4. Jh. v.Chr. der ägyptische port of entry Herakleion-Thonis86 mit dem namens-gebenden Herakles-Heiligtum, das zugleich wohl eine Kultstätte für griechische Seefahrer darstellte.87
Abb. 6: Alexandreia und Umgebung
!τοὺς Ἕλληνας (πορθηταὶ γὰρ ἦσαν καὶ ἐπιθυµηταὶ τῆς ἀλλοτρίας κατὰ σπάνιν γῆς), ἐπέστησαν φυλακὴν τῷ τόπῳ τούτῳ κελεύσαντες ἀπείργειν τοὺς προσιόντας· Siehe dazu die von Hdt. II 30 und Thuk. I 104,1 angeführte Grenzsicherung in diesem Bereich. G. GRIMM, „Fatal Evidence?“, in: D. Robinson, A. Wilson (Hrgg.), Alexandria and the North-Western Delta, Oxford 2010, 141–149, führt die attische Keramik an, die in diesem Gebiet gefunden wurde und eher gegen einen Wachposten spreche, wie ihn Strabon überliefert; ein früherer Handelsort lasse sich aufgrund dieser Funde jedoch auch nicht belegen. GREEN, „Alexandria“ (Anm. 1), 11, verweist wegen dieser Keramik allgemein auf die Bekanntheit des Ortes bei den Griechen. Zur Vorgängersiedlung am Orte Rhakotis sowie zur Namensgebung: M. CHAUVEAU, „Alexandrie et Rhakotis. Le point de vue des Égyptiens“, in: J. Leclant (Hrg.), Alexandrie: une mégapole cosmopolite, Paris 1999, 1–10; M. DEPAUW, „Alexandria, the Building Yard“, CdÉ 75 (2000), 64f.; J. BAINES, „Appendix: Possible Implications of the Egyptian Name for Alexandria“, JRA 16 (2003), 61–63; K. MÜLLER, Settlements of the Ptolemies. City Foundations and New Settlements in the Hellenistic World, Leuven/Paris 2006, 15–21 (v.a. Namens-gebung); J.-D. STANLEY et al., „Alexandria, Egypt, before Alexander the Great. A Multidisciplinary Approach Yields Rich Discoveries“, Geological Society of America Today, August 2007, 4–10 (geologische Untersuchungsergebnisse zur Besiedlung des Ortes).
86 Diod. I 19,4 mit Herakleion-Thonis als dem zentralen Emporion. Dieser Hafenort konnte erst vor wenigen Jahren durch die unterwasserarchäologischen Forschungen des Teams um Franck Goddio wiederentdeckt und sicher zugewiesen werden, sodass er – obwohl aus den literarischen Quellen bekannt – in der älteren Forschung zur Gründung von Alexandreia nur eine untergeordnete Rolle spielte. Zu den jüngsten Ergebnissen der Prospektionen und unterwasserarchäologischen Arbeiten siehe F. GODDIO, The Topography and Excavation of Heracleion-Thonis and East Canopus (1996–2006), Oxford 2007, bes. 29–68 (Kanopos) und 69–130 (Herakleion); DERS., „Geophysical Survey in the Submerged Canopic Region“, in: D. Robinson, A. Wilson (Hrgg.), Alexandria and the North-Western Delta, Oxford 2010, 3–13 (v.a. zur Verbindung zwischen Kanopos und Herakleion-Thonis); DERS., „Heracleion-Thonis and Alexandria. Two Ancient Egyptian Emporia“, in: D. Robinson, A. Wilson (Hrgg.), Maritime Archaeology and Ancient Trade in the Mediterranean, Oxford 2011, 121–137.
87 Zum Herakleskult im westlichen Nildelta seit der archaischen Zeit siehe U. HÖCKMANN, „Heracleion, Herakles and Naukratis“, in: D. Robinson, A. Wilson (Hrgg.), Maritime Archaeology and Ancient Trade in the Mediterranean, Oxford 2011, 25–32; dort auch mit der Bedeutung des örtlichen Herakleskultes für die griechischen Seeleute.
Zur Gründung von Alexandreia 191
Der Bereich um die Mündung des kanopischen Nilarmes bis hin zur Insel Pharos war somit im 4. Jh. v.Chr. insgesamt eine für die Griechen wichtige mythische Region, über die detaillierte Kenntnisse nicht nur im Nildelta und unter denjenigen Griechen, die über das Mittelmeer ins Nilland bzw. nach Naukratis kamen, bestanden haben müssen, sondern die auf den oben beschriebenen Seefahrtrouten mit den griechischen Händlern und Seeleuten wenigstens auch in die südöstliche Ägäiswelt zurückgelangten. Für eben diesen Perso-nenkreis ist aus nautischen Gründen sogar eine Detailkenntnis der lokalen westägyptischen Küstentopographie durchweg vorauszusetzen, denn Überfahrten zum Nilland auf der Route von der Ägäis mit den Etesien nach Süden brachten mit sich, dass die Schiffsbesatzungen sich in der Zielregion zunächst anhand topographisch signifikanter Details genauer zu orientieren hatten (vgl. Abbildung 5).88 Die Kenntnis der dortigen Küste und ihrer Beschaf-fenheit war für Seefahrer (respektive Händler) also eine wichtige Voraussetzung für zielgerichtete und sichere Überfahrten. Ein literarischer Reflex solcher nautischen Erforder-nisse liegt in den antiken Küstenbeschreibungen vor, von denen aus dem 4. Jh. v.Chr. der Periplous des Ps.-Skylax überliefert ist, der in einer für dieses literarische Genre typischen Weise knappe Beschreibungen einzelner Küstenabschnitte bietet.89 Im Vergleich zu den allerdings nur summarischen Angaben von Ps.-Skylax, die mehr zu einer allgemeinen Orientierung als der seefahrerischen Praxis dienten, müssen entsprechende Beschreibungen wegen ihrer Relevanz für sichere Überfahrten sowie aus handelsstrategischem Interesse wenigstens an dem für den ostmediterranen Handelskreislauf wichtigen Knotenpunkt der südöstlichen Ägäis weitaus umfassender vorhanden gewesen sein.90 Eine vorgelagerte Insel wie Pharos stellte aus navigatorischer Sicht jedenfalls einen wichtigen topographischen Bezugspunkt dar: In der zeitgenössischen Überlieferung des späten 4. Jhs. wird dies noch daran ersichtlich, dass das neuzugründende Alexandreia in Ps.-Aristoteles’ Oikonomika als „eine Stadt bei der Insel Pharos“ bezeichnet wird.91
!88 Zur Navigation über das offene Meer ARNAUD, Navigation antique (Anm. 21), 50–59; BERESFORD,
Sailing Season (Anm. 21), 175–180. Allzu drastisch schätzt allerdings CLAUSS, Alexandria (Anm. 1), 81, die über das Meer erfolgende Anfahrt zur Küste Ägyptens ein, die wegen der dort im Vergleich zu griechischen Küsten durchaus flachere Küstenlinie seines Erachtens „praktisch blind“ erfolgt sei.
89 G. SHIPLEY, Pseudo-Skylax’s Periplous. The Circumnavigation of the Inhabited World. Text, Translation and Commentary, Exeter 2011. Die Datierung des Werkes lässt sich nach Shipley auf das Jahr 338/7 v.Chr. eingrenzen: ebd. 6–8.
90 Gegen einen praktischen Gebrauch von Ps.-Skylax’ Periplous für die zeitgenössische Seefahrt auch SHIPLEY, Pseudo-Skylax (Anm. 89), 10–13 (gegen ältere Positionen). Wenngleich die Überliefer-ungslage in dieser Hinsicht überaus dürftig ist, legt die schiere Notwendigkeit solcher Beschreibungen, die sich letztlich aus dem umfangreichen Schiffs- bzw. Handelsverkehr ergibt, nahe, dass ein Großteil solcher Quellen, die möglicherweise auch nur lokale Aufzeichnungen waren, nicht erhalten ist oder dieses Wissen weitgehend auf einer oral tradition beruhte; J.-M. KOWALSKI, Navigation et géographie dans l’Antiquité gréco-romaine. La terre vue de la mer, Paris 2012, 27–37, zur literarischen Über-lieferung. Die Möglichkeit einer umfangreichen und durchaus schnellen Kommunikation zwischen der südöstlichen Ägäis und Ägypten ist spätestens in der Zeit Alexanders durch den Informationsaustausch zwischen Kleomenes von Naukratis und seinen Consorten zu aktuellen Preisen belegt: [Dem.] or. 56,8–10; Ps.-Arist. oik. II 33a (1352a16–23); 33e (1352b15–20); dazu A. MÖLLER, „Classical Greece, Distribution“, in: W. Scheidel, I. Morris, R. Saller (Hrgg.), The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World, Cambridge 2007, 368f. (mit weiterer Literatur).
91 Ps.-Arist. oik. II 33c (1352a29–30): οἰκίσαι πόλιν πρὸς τῇ Φάρῳ. Pharos als natürliche Anlaufstelle der über das Meer kommenden Seefahrer auch bei EL-ABBADI, „Island of Pharos“ (Anm. 78), 266. Vgl.
Volker Grieb 192
Mit einer unter Griechen auch im Detail bekannten Küstentopographie um das spätere Alexandreia ist nun aber, so ist das Vorangehende zusammenzufassen, nicht nur die Episode eines unbekannten, aber wegen seiner Beschaffenheit für eine Stadtgründung vorteilhaften Ortes, wie sie im Alexanderroman überliefert ist, in der vorliegenden Form für den historischen Gründungszusammenhang ebenso wenig haltbar wie Plutarchs Darstel-lung, wonach ein bereits gewählter Ort für die Stadt aufgegeben wurde, nachdem Alex-ander eine Traumerscheinung hatte, die ihn auf einen geeigneteren Platz bei der Insel Pharos hinwies.92 Und man wird weiterhin auch nicht dem Wortlaut von Arrian folgen können, wonach Alexander, nachdem er den kanopischen Nilarm abwärts gefahren war, am Mareotissee scheinbar zufällig den Ort der späteren Stadt erblickt und diesen für die Grün-dung einer prosperierenden Stadt als derart bewundernswert empfand, dass er diese sogleich befahl.93 Alle diese Schilderungen sind in der auf Alexander zugeschnittenen Form offensichtliche nachträgliche literarische Konstruktionen.94 Die vorteilhafte Lage dieses Platzes, der nach Strabon der einzige gewesen sein soll, der in dieser Gegend für eine größere Stadtgründung an der Küste geeignet war,95 kann zu Alexanders Zeit vielmehr als weithin bekannt vorausgesetzt werden. Insbesondere denjenigen Personen, die mit mari-timer Stadtplanung und nautischen Erfordernissen vertraut waren, können die örtlichen Vorteile, zu denen die Verbindung von See- und Binnenschiffahrt, die kühlenden Winde
!dazu Ps.-Skylax 107,1.
92 Plut. Alex. 26,4–6: καί τινα τόπον γνώµῃ τῶν ἀρχιτεκτόνων ὅσον οὐδέπω διεµετρεῖτο καὶ περιέβαλλεν. εἶτα νύκτωρ κοιµώµενος ὄψιν εἶδε θαυµαστήν· ἀνὴρ πολιὸς εὖ µάλα τὴν κόµην καὶ γεραρὸς τὸ εἶδος ἔδοξεν αὐτῷ παραστὰς λέγειν τὰ ἔπη τάδε (Hom. Od. IV 354)· „νῆσος ἔπειτά τις ἔστι πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ, Αἰγύπτου προπάροιθε· Φάρον δέ ἑ κικλήσκουσιν.“ εὐθὺς οὖν ἐξαναστὰς ἐβάδιζεν ἐπὶ τὴν Φάρον, ἣ τότε µὲν ἔτι νῆσος ἦν τοῦ Κανωβικοῦ µικρὸν ἀνωτέρω στόµατος, νῦν δὲ διὰ χώµατος ἀνείληπται πρὸς τὴν ἤπειρον.
93 Arr. an. III 1,5: ἐλθὼν δὲ ἐς Κάνωβον καὶ κατὰ τὴν λίµνην τὴν Μαρίαν περιπλεύσας ἀποβαίνει, ὅπου νῦν Ἀλεξάνδρεια πόλις ᾤκισται, Ἀλεξάνδρου ἐπώνυµος. καὶ ἔδοξεν αὐτῷ ὁ χῶρος κάλλιστος κτίσαι ἐν αὐτῷ πόλιν καὶ γενέσθαι ἂν εὐδαίµονα τὴν πόλιν. πόθος οὖν λαµβάνει αὐτὸν τοῦ ἔργου (...).
94 So bereits unter Verweis auf Strabon und Homer B. A. VAN GRONINGEN, „À propos de la fondation d’Alexandrie“, in: Raccolta di scritti in onore di Giacomo Lumbroso, Milano 1925, 201. In der Forschung wird mitunter kritisch angemerkt, dass der Ort bereits bekannt war, ohne daraus jedoch die quellenkritische Konsequenz zu ziehen und Alexanders zentrale Rolle bei der Gründung dement-sprechend infrage zu stellen; vgl. etwa EHRENBERG, Alexander (Anm. 1), 24; H. BRAUNERT, „Das Mittelmeer in Politik und Wirtschaft der hellenistischen Zeit“, in: ders., Politik, Recht und Gesellschaft in der griechisch-römischen Antike, Stuttgart 1980, 136 (mit Rückverweis auf H. Berve); BOSWORTH, Conquest and Empire (Anm. 1), 246; NAWOTKA, Alexander (Anm. 1), 207. Die von BROWN, „Deinokrates“ (Anm. 4), 231f. vorgebrachte Einschätzung, dass ein Auffinden auf Deinokrates und Alexander zurückzuführen sei, da es sich bei Deinokrates um den eigentlich Sachverständigen handele, projiziert die literarische Überlieferung letztlich nur auf beide Personen. Quellenkritisch findet eine solche Einschätzung auch keine Bestätigung in der Aussage von Amm. Marc. XXII 16,7, wonach „the crown of all cities is Alexandria, which is made famous by many splendid things, through the wisdom of its mighty founder and the cleverness of the architect Dinocrates“ (BROWN, ebd. 232).
95 Strab. XVII 1,12 (798): τῆς δ’ εὐκαιρίας τῆς κατὰ τὴν πόλιν τὸ µέγιστόν ἐστιν ὅτι τῆς Αἰγύπτου πάσης µόνος ἐστὶν οὗτος ὁ τόπος πρὸς ἄµφω πεφυκὼς εὖ, τά τε ἐκ θαλάττης διὰ τὸ εὐλίµενον, καὶ τὰ ἐκ τῆς χώρας ὅτι πάντα εὐµαρῶς ὁ ποταµὸς πορθµεύει συνάγει τε εἰς τοιοῦτον χωρίον ὅπερ µέγιστον ἐµπόριον τῆς οἰκουµένης ἐστί. Sowie XVII 1,6 (791) zu der ansonsten hafenlosen Küste beiderseits von Pharos: ἀλιµένου γὰρ οὔσης καὶ ταπει νῆς τῆς ἑκατέρωθεν παραλίας, ἐχούσης δὲ καὶ χοιράδας καὶ βράχη τινά.
Zur Gründung von Alexandreia 193
sowie die im Gegensatz zum Nildelta und dessen Küste weitgehend versandungsfreie Bucht von Rhakotis zählten,96 nicht entgangen sein. Wenn nun die Angaben, die das Auffinden von Rhakotis/Pharos mit dem Zufall, einem Orakelspruch oder einer Eingebung des Herrschers verbinden, in der vorliegenden Form aus historischer Perspektive weder aussagekräftig noch belastbar sind, ist dies eben auch von entscheidender Bedeutung für die Beurteilung von Alexanders persönlicher Rolle bei der Gründung, denn es handelt sich hierbei – wie angeführt – um diejenigen Aussagen, die dem Makedonenkönig überhaupt den entscheidenden Impuls und die besondere persönliche Ambition für die Gründung einer zukünftigen Großstadt zuweisen. Diese Alexander zuge-schriebene Rolle überzeugt also historisch gerade nicht,97 und in einem auffälligen Kontrast zu den späteren Schilderungen steht dann auch eine kurze zeitgenössische Notiz in Ps.-Aristoteles Oikonomika. Dort heißt es knapp: Ἀλεξάνδρου ⟨τε⟩ τοῦ βασιλέως ἐντειλα-µένου αὐτῷ [sc. Kleomenes von Naukratis] οἰκίσαι πόλιν πρὸς τῇ Φάρῳ [...].98 In nüchterner Weise wird über den für Händler schon bald wichtigen Anlaufpunkt einzig konstatiert, dass der Makedonenkönig den Kleomenes mit der Gründung einer Stadt beauf-tragte. Eine mögliche zeitgenössische Besonderheit der Stadtgründung ist in dieser Angabe nicht zu erkennen. Vielmehr legt sie sogar eine gewisse Beiläufigkeit des Vorhabens nahe, das zunächst auch keine besondere weitere Aufmerksamkeit des Makedonenkönigs erfor-derte (s.u.).
Betrachtet man den Gründungszusammenhang sodann aus einer eher sachbezogenen Perspektive, bieten die überlieferten Quellen ein klareres Bild, bei dem die Entschei-dungsgewalt des Makedonenkönigs über Gründung, Gesamtanlage und städtebauliche Details keineswegs infrage gestellt zu werden braucht.99 Insbesondere der Alexanderroman führt – von seinem Orakelmythos zur Lage der Stadt und Alexanders omnipräsenter Rolle
!96 Verbindung von See- und Binnenschiffahrt: Strab. XVII 1,12 (798). Winde: Diod. XVII 52,2; Strab.
XVII 1,6 (793). Strömungsverhältnisse: siehe unten, Anm. 115. 97 Plut. Alex. 26,5–6 mit der Traumerscheinung; Arr. an. III 1,5 mit dem bewundernswerten Ort,
woraufhin Alexander ein Verlangen ergriff, die Gründung sogleich in die Tat umzusetzen. Ps.-Kallisth. I 30,6–31,7 mit der Weisung des Orakels, dem Auffinden des Ortes und der Festlegung der Größe. Der von Plut. Alex. 26,3–4 angeführte Herakleides, der berichtet habe, dass Alexander, nachdem er Ägypten erobert hatte, beschloss, eine große und vielbevölkerte Stadt zu gründen, ist wohl dem 2. Jh. v.Chr. zuzuordnen (J. R. HAMILTON, Plutarch, Alexander: A Commentary, Oxford 1969, 66; N. G. L. HAMMOND, Sources for Alexander the Great. An Analysis of Plutarch’s ‘Life’ and Arrian’s ‘Anabasis Alexandrou’, Cambridge 1993, 58) und dürfte nach der vorangehenden Angabe Plutarchs zur Traumerscheinung somit ebenfalls in der Tradition stehen, den späteren Erfolg der Stadt auf den Ktistes zurückzuprojizieren. Diodor (XVII 52,1–4; 7) spiegelt in seiner Darstellung keine besondere Motivation Alexanders wider, sondern gibt an, dass der Makedonenkönig die Befehle zum Bau gab. Vgl. demge-genüber Curt. IV 8,1–2 mit Alexanders Motivation, ursprünglich eine Stadt auf der Insel Pharos zu errichten (dazu unten, S. 194).
98 Ps.-Arist. oik. II 33c (1352a29–30). 99 Vgl. zum folgenden die jüngst von ERSKINE, „Imagination“ (Anm. 4), vorgenommene, allerdings sehr
pauschale Kritik an der Überlieferung zur Gründung von Alexandreia. Erskine hebt zwar durchaus berechtigt eine in mehreren Punkten naheliegende spätere Entstehungszeit der Überlieferung hervor, bietet aber keine Differenzierung, welche Details dann überhaupt auf die historische Gründung zu beziehen wären.
Volker Grieb 194
entkleidet – wertvolle Hinweise an.100 So wird dort von einer Unstimmigkeit über die genaue Größe der anzulegenden Stadt berichtet, bei der der Makedonenkönig sich letztlich von den Argumenten der ihn beratenden Kleomenes von Naukratis und Deinokrates von Rhodos101 überzeugen und deren Plan umsetzten ließ.102 In dieser Episode scheint durch, dass für eine Stadtanlage unterschiedliche oder wohl sogar konkurrierende Pläne bestanden haben dürften, womit eben auch verschiedene stadtplanerische Konzepte einhergegangen wären. In ähnlicher Weise klingt dies auch in Plutarchs Alexanderbiographie an, wonach ein bereits bestehendes Konzept von den Baumeistern nach der – freilich mythischen – Traumerscheinung und Verlegung des Ortes im Grundriss an den neuen Ort anzupassen war.103 Und auch die von Curtius Rufus überlieferte, möglicherweise ursprüngliche Über-legung Alexanders, auf der Insel Pharos eine Stadt anzulegen, die zugunsten der späteren größeren Lösung verworfen wurde,104 deutet darauf hin, dass anfänglich verschiedene Kon-zeptionen bestanden und nicht nur von einer einzigen Alexandreia-Lösung ausgegangen werden kann. Offensichtlich wird dies, wenn man die Situation betrachtet, die Alexander und seine Berater im westlichen Nildelta vorfanden. Mit Kanopos respektive Herakleion-Thonis an der Nilmündung105 – nach Strabon ein sehr gutes Emporion,106 von Aischylos als
!100 FRASER, Cities (Anm. 5), 44f.; 214–216, zur literarischen Tradition von Stadtgründungsmythen, die
spätestens im 3. Jh. v.Chr. mit Apollonios Rhodios einsetzte und mit einer Ἀλεξανδρείας κτίσις Einfluss zumindest auf die Darstellung im Alexanderroman genommen haben dürfte.
101 Zu den unterschiedlichen Schreibweisen und Namensformen des Deinokrates, der in Versionen des Alexanderromans auch als Nomokrates angeführt wird, siehe G. A. MANSUELLI, „Contributo a Deinokrates“, in: N. Bonacasa, A. di Vita (Hrgg.), Alessandria e il mondo ellenistico-romano. Studi in onore de Achille Adriani, I, Rom 1983, 78–90. Dort auch zu seiner wahrscheinlichen Herkunft aus Rhodos (entgegen einer Nennung als Makedone in Vitr. II praef. 2). Vgl. BERVE, Alexanderreich II (Anm. 5), n. 249 (Deinokrates). Die Rolle des Deinokrates als führender Architekt beim Ausbau von Alexandreia (Vitr. II praef. 4) ist in der Forschung unstrittig.
102 Da im Roman an dieser Stelle die beiden für den historischen Ausbau der Stadt wesentlichen Personen angeführt werden, ist diese Episode grundsätzlich als glaubhaft einzuschätzen. Allerdings ist Alexanders dort geschilderter Plan, eine ursprünglich noch viel größere Stadt anlegen zu wollen, den er aber zugunsten des Vorschlages von Kleomenes und Deinokrates aufgab, seiner im Roman omnipräsenten Rolle bei der Stadtgründung, die er schon wegen des Orakelspruches einnehmen musste, geschuldet und insofern in dieser Form nicht glaubwürdig.
103 Plut. Alex. 26,7: ὡς οὖν εἶδε τόπον εὐφυΐᾳ διαφέροντα (...), εἰπὼν ὡς Ὅµηρος ἦν ἄρα τά τ’ ἄλλα θαυµαστὸς καὶ σοφώτατος ἀρχιτέκτων, ἐκέλευσε διαγράψαι τὸ σχῆµα τῆς πόλεως τῷ τόπῳ συναρµόττοντας. 26,4 zum vorherigen Platz, den die Architekten ausgesucht hatten und der beinahe abgemessen war: λέγουσι γὰρ ὅτι τῆς Αἰγύπτου κρατήσας ἐβούλετο πόλιν µεγάλην καὶ πολυάνθρωπον Ἑλληνίδα συνοικίσας ἐπώνυµον ἑαυτοῦ καταλιπεῖν, καί τινα τόπον γνώµῃ τῶν ἀρχιτεκτόνων ὅσον οὐδέπω διεµετρεῖτο καὶ περιέβαλλεν.
104 Curt. IV 8,1–2: Alexander ab Hammone rediens ad Mareotin paludem haud procul insula Pharo sitam venit. Contemplatus loci naturam primum in ipsa insula statuerat urbem novam condere; <de>inde ut apparuit magnae sedis insulam haud capacem esse, elegit urbi locum, ubi nunc est Alexandrea, appellationem trahens ex nomine auctoris. Siehe dazu unten, S. 210f.
105 Das in Ps.-Arist. oik. II 33c (1352a30–32) genannte Emporion von Kanopos dürfte in dieser Erwähnung den Hafenort Herakleion mit einschließen, der nur etwa 3,5 km östlich von Kanopos lag. Zur Verbindung beider Bereiche F. GODDIO, „Heracleion-Thonis and Alexandria. Two Ancient Egyptian Emporia“, in: D. Robinson, A. Wilson (Hrgg.), Maritime Archaeology and Ancient Trade in the Mediterranean, Oxford 2011, 124. Zur Lage allerdings jetzt die kritischen Bemerkungen von STOLZ, „Kanopos“ (Anm. 83), 193–207.
106 Strab. XVII 1,18 (801): µάλιστα µέντοι τῷ Κανωβικῷ στόµατι ἐχρῶντο ὡς ἐµπορίῳ, τῶν κατ’
Zur Gründung von Alexandreia 195
Hafen gerühmt107 und von Poseidippos als eine bei Sturm sichere Anlaufstelle gepriesen108 – sowie mit Naukratis109 etwas nilaufwärts existierten bereits wichtige Umschlagplätze. Es bestand also vielmehr grundsätzlich die Frage, ob ein weiterer Hafenort überhaupt not-wendig war. Eine ursprünglich kleine Lösung mit der Insel Pharos (Curtius Rufus), die von ihren Ausmaßen her bereits größer gewesen wäre als etwa die wichtigen phönizischen Han-delsorte Tyros oder Arados und auf der durchaus eine griechische Hafenstadt durchschnitt-licher Größe hätte angelegt werden können,110 wäre insofern sinnvoll gewesen, wenn dieser Ort nur zu einem weiteren, nicht aber zu dem zentralen Umschlagplatz hätte ausgebaut werden sollen, zumal die Insel sich nach der zeitgenössischen Angabe von Ps.-Skylax bereits zuvor, also ohne die Anlage von Alexandreia, durch eine gute Hafensituation
!Ἀλεξάνδρειαν λιµένων ἀποκεκλειµένων, ὡς προείποµεν. Strabon nennt allgemein die Mündung dieses Nilarmes, weshalb sich diese Angabe auf die genannten Hafenanlagen beziehen muss. Die Keramikfunde von Herakleion-Thonis hat Catherine Grataloup ausgewertet („Occupation and Trade at Herakleion-Thonis. The Evidence from the Pottery“, in: D. Robinson, A. Wilson [Hrgg.], Alexandria and the North-Western Delta, Oxford 2010, 151–159). Besonders die Stücke des 7./6. Jhs. v.Chr. mit Keramik aus Klazomenai, Chios, Milet und Samos belegen, dass Naukratis in dieser Zeit für die Griechen nicht der einzige Ort des Handels im Nildelta war. In einem sog. „Bereich C“ sei nach Grataloup dann hauptsächlich Keramik des 5. und 4. Jhs. v.Chr. gefunden worden. Dies deutet auf eine Verlagerung einzelner Hafenbereiche hin. Nach Diod. I 19,4 sei vor der Gründung von Alexandreia, also wenigstens im vorangehenden 4. Jh. v.Chr., Herakleion-Thonis das einzige Emporion in dieser Region Ägyptens gewesen. Vgl. für das 5. Jh. v.Chr. weiterhin die Angaben zu griechischen Schiffen im Zollregister eines unbekannten Ortes im Nildelta (BRIANT, DESCAT, „Registre douanier“ [Anm. 53], 93). Hdt. II 179 führt an, dass ursprünglich Naukratis der einzige Handelsplatz der Griechen im Nildelta gewesen sei. Wie und wann sich lokale Schwerpunkte der griechischen Handelsaktivitäten im (westlichen) Nildelta jeweils verschoben, lässt die Quellenlage nur ganz eingeschränkt erkennen und bedarf hier keiner weiteren Diskussion.
107 Aischyl. Prom. 847–848. 108 Poseidippos bei Athen. VII 318d, der die ruhige See hinter Kap Zephyrion rühmt, wenn „draußen der
Sturm tobt“, also stärkere Winde aus nördlicher, nordwestlicher oder westlicher Richtung wehten, von denen wenigstens auch erstere für die Bucht von Rhakotis/Pharos ein Problem darstellen konnten, solange noch keine Molen im Bereich der Einfahrten zu dieser Bucht und für die Häfen selbst angelegt worden waren.
109 Zu Naukratis als früherem port of trade A. MÖLLER, Naucratis. Trade in Archaic Greece, Oxford 2000, 214f.
110 Curt. IV 8,2. Pharos besaß – nach den Plänen in den gängigen Publikationen zu Alexandreia – eine Länge von etwas mehr als 2km und eine Breite von durchschnittlich ca. 0,4km. Die Inselstadt Tyros hatte demgegenüber nur eine Größe von ca. 1km*0,4km. Ein weiteres Vergleichsbeispiel einer wichtigen Handelsstadt bietet das phönizische Arados (heute Aruad/Arwad). Dieses Handelszentrum lag auf einer nur ca. 0,7km*0,5km großen Insel in strategisch günstiger Position etwa 2,9km südwestlich von Antarados (Tartus) direkt vor der Levanteküste (dazu H. FROST, „Harbours and Proto-Harbours. Early Levantine Engineering“, in: V. Karageorghis, D. Michaelides [Hrgg.], Cyprus and the Sea, Nikosia 1995, 7–12). Als Vergleich mögen weiterhin die folgenden Größenangaben (jeweils annähernde Werte) von Poliszentren des 5. und 4. Jhs. dienen: Das Stadtgebiet von Milet zwischen Kalbak Tepe und Humeitepe: ca. 2km*0,6km; Olynth: ca. 1,2km*0,3km (Wohngebiet); Kassope: ca. 0,6km*0,4km (Wohngebiet); Priene: ca. 0,6km*0,4km (Wohngebiet unterhalb der Akropolis); Dura Europos: ca. 0,7km*0,5km (Wohngebiet); Halikarnassos: ca. 1,8km*1km (Wohn-gebiet); die Angaben nach den Plänen in HOEPFNER/SCHWANDNER, Haus und Stadt (Anm. 8), 72; 120; 191; 260. Für eine griechische Stadt durchschnittlicher Größe wäre die Insel Pharos also sicher-lich ausreichend groß gewesen.
Volker Grieb 196
auszeichnete: Ps.-Skylax charakterisiert Pharos eben als εὐλίµενος.111 Mit einer solchen kleinen Lösung wären jedenfalls die nicht geringen Umsiedlungsmaßnahmen, die für eine große Lösung Alexandreia notwendig wurden,112 überflüssig gewesen. Auch kann nicht vorausgesetzt werden, dass die umfangreichen Baumaßnahmen, die mit einer großen Lösung erforderlich wurden und die etwa mit dem Heptastadion eine zwar nicht unbe-kannte, aber in dieser Größe bislang einzigartige Hafeninstallation notwendig machte,113 anfänglich ohne Alternative waren, würde dies ansonsten bereits den späteren Erfolg der Stadt und überhaupt Alexanders letztlich aber nicht belegbares Bestreben, gerade eine solche große Stadt gründen zu wollen, bei der Quelleninterpretation voraussetzen. Die in den Quellen überlieferte Unsicherheit bei der Auswahl des endgültigen Platzes scheint vielmehr ein offensichtlicher Hinweis auf ursprünglich bestehende alternative Überle-gungen zu sein und schließt damit schlüssig an die vorliegende urbane Situation im westlichen Nildelta an.114
!111 Ps.-Skylax 107,1: ἐκ Θώνιδος δὲ πλοῦς εἰς Φάρον νῆσον ἔρηµον, εὐλίµενος δὲ καὶ ἄνυδρος (…). ἐν
δὲ Φάρῳ λιµένες πολλοί. Das Werk datiert in die Zeit direkt vor der Gründung von Alexandreia, wobei das von G. Shipley angeführte Jahr 338/7 v.Chr. wohl den spätesten Zeitpunkt ausmachen dürfte (siehe oben, Anm. 89). Der zweimalige Hinweis auf die Hafensituation von Pharaos hebt die Insel nachdrücklich als guten Anlaufpunkt für Schiffe hervor. Mit den λιµένες πολλοί dürften allerdings weniger ausgebaute Hafenanlagen als vielmehr gute Anlande- bzw. Anlegestellen gemeint sein. Das vorangehende εὐλίµενος beschreibt in dieser Angabe in adjektivischer Form (vgl. das folgende ἄνυδρος) zusammenfassend die Vorzüge der Insel, sodass die Angabe der λιµένες πολλοί nicht unbedingt als Wiederholung „due to compilation“ verstanden werden muss (so aber SHIPLEY, Pseudo-Skylax [Anm. 89], 185).
112 Umsiedlungsmaßnahmen: Curt. IV 8,5; Ps.-Kallisth. I 31,8; Ps.-Arist. oik. II 33c (1352a29–1352b3), wonach das Emporion von Kanopos mitsamt den Bewohnern nach Alexandreia verlegt werden sollte. Da es sich hier allgemein um das Emporion von Kanopos handelt, dürfte damit auch der Hafen von Herakleion-Thonis gemeint sein. Dieser Ort bestand als Hafen in hellenistischer Zeit fort (vgl. dazu die zahlreichen Schiffswracks noch aus ptolemäischer Zeit: D. FABRE, „The Shipwrecks of Heracleion-Thonis. A Preliminary Study“, in: D. Robinson, A. Wilson [Hrgg.], Maritime Archae-ology and Ancient Trade in the Mediterranean, Oxford 2011, 13–16), sodass die in Ps.-Aristoteles angeführte Anweisung Alexanders, sofern sie in der Form überhaupt gegeben wurde, nicht konsequent bzw. dauerhaft wirksam umgesetzt worden sein kann.
113 Zu vergleichbaren Dammbauten K. LEHMANN-HARTLEBEN, Die antiken Hafenanlagen des Mittel-meeres. Beiträge zur Geschichte des Städtebaus im Altertum, Leipzig 1923, 60f., 132; BROWN, „Deinokrates“ (Anm. 4), 237.
114 Die Alternative Kanopos führt auch VAN GRONINGEN, „Fondation“ (Anm. 94), 203–205, in seiner Diskussion zur Gründung an, ohne dies aber auf die Unsicherheit bei der Platzwahl in der Quellenüberlieferung zu beziehen. Die von GRIMM, Alexandria (Anm. 1), 23, vorgebrachte Über-legung, Alexander sei beim ersten Anblick der Topographie von Rhakotis/Pharos deshalb von einer Sehnsucht ergriffen worden, weil die dortigen Bedingungen mehreren theoretischen Überlegungen zu Stadtgründungen bei Aristoteles entsprochen hätten (Arist. pol. VII 5–6; 11–12 [1326b26–1327b21; 1330a34–1331b23]), ist durchaus ansprechend, nur geht sie von der Prämisse der Quellen aus, wonach dieser Ort gewissermaßen unbekannt war und Alexander ihn entdeckte. Dies ist jedoch in der oben dargelegten Form als literarische Fiktion anzusehen, und auch Aristoteles’ theoretische Überlegungen zur günstigen Lage von Stadtgründungen können in den Fachkreisen insbesondere zu dieser Zeit und nach der Entwicklung in der südöstlichen Ägäis als weithin bekannt vorausgesetzt werden. Aristoteles selbst schreibt, dass etwa über die Vorteile einer Nähe bzw. Ferne einer Stadt zum Meer bereits viel diskutiert worden sei (pol. VII 6 [1327a11–1327b21]).
Zur Gründung von Alexandreia 197
Dass die Wahl schließlich auf Rhakotis/Pharos fiel, lässt die Hintergründe der Ent-scheidung genauer eingrenzen. Für den Bau bzw. Ausbau einer großen und zentralen Hafenstadt kam den örtlichen Strömungsverhältnissen insofern eine besondere Bedeutung zu, weil dadurch ein weitgehend verlandungsfreier Hafen angelegt werden konnte, dessen Größe wiederum für die Zukunft ein erhebliches städtisches Wachstumspotential bot.115 Der kanopische Nilarm und die dort gelegenen Hafenorte brachten hingegen wenigstens auf lange Sicht immer auch das Problem einer Versandung von Hafenzufahrten und Hafen-becken mit sich.116 Auch hätte ein möglicher Ausbau von Herakleion-Thonis und Naukratis bedeutet, dass dort ein bestehender Stadtplan hätte übernommen werden müssen. Eine Neugründung an einem zuvor nicht oder nur wenig bewohnten Ort bot in dieser Hinsicht einen größeren Gestaltungsrahmen, wobei insbesondere die vorangehenden Gründungen von Kos-Stadt und Rhodos-Stadt aufzeigen konnten, welche urbanen Möglichkeiten sich mit einer geographisch und topographisch günstigen Lage ausschöpfen ließen. Vor dem Hintergrund der südostägäischen Neugründungen und Stadtverlagerungen sowie der charakteristischen nautischen Bedingungen im östlichen Mittelmeerraum war der Erfolg einer großen neuen Stadt am Rande des westlichen Nildeltas zudem weitgehend kalkulier-bar, zumal im Falle von Alexandreia eine umfangreiche Konzentration des ägyptischen Exportes möglich war und die Stadt somit einen Standortvorteil bot, den die südost-ägäischen Städte in diesem Maße nicht besaßen. Aus zeitgenössischer Sicht kann demnach die für Alexandreia gewählte Größe, die diejenige von Rhodos-Stadt ohnehin nur wenig übertraf,117 allenfalls für ein allgemeines Publikum, das diese Zusammenhänge nicht über-blickte, beeindruckend gewesen sein. Für eine möglicherweise noch während Alexanders Aufenthalt vor Ort weitgehend festgelegte konzeptionelle Ausgestaltung der Stadt, die wegen der Größe entsprechend aufwendig gewesen sein muss, bietet der Alexanderroman eine zwar knappe, aber nach-vollziehbare Schilderung, wohingegen Arrian, Diodor und Curtius Rufus diesen Aspekt nur
!115 Die günstigen Strömungsverhältnisse etwa hervorgehoben von R. LANE FOX, Alexander der Große,
Stuttgart 32005, 249f.; FRASER, Alexandria (Anm. 1), 21f.; 134; SONNABEND, „Alexandria“ (Anm. 1), 524; HUSS, Ägypten (Anm. 1), 64. EHRENBERG, Alexander (Anm. 1), 24, verweist auf die Wissenschaftler und Philosophen in seinem Umfeld und darauf, dass „einer von ihnen gewußt haben mag, daß die Strömung des Mittelmeeres den Nilschlamm von West nach Ost weiterträgt, so daß die Küste des Deltas und das südliche Syrien völlig verschlammt ist. Erst westlich des westlichsten Nilarms, eben des kanopischen, den Alexander hinabfuhr, ist die Küste frei“. Ähnlich bereits A. PHILIPPSON, Das Mittelmeergebiet. Seine geographische und kulturelle Eigenart, Leipzig 41922, 74f. Die Neugründungen von Rhodos-Stadt und Kos-Stadt besaßen günstige Strömungsverhältnisse und liegen jeweils im Strömungsschatten der Nord- bzw. Nordostspitze der Insel. Ebenfalls eine vorteil-hafte Lage besitzt Halikarnassos, während der nördliche Hafen von Neu-Knidos weniger vorteilhaft gelegen ist. Die lokalen Strömungsverhältnisse können als gängige Erfahrungswerte etwa der einheimischen Fischer und Seefahrer auch im Detail als bekannt vorausgesetzt werden. Dafür brauchte es nicht, wie noch Ehrenberg vermutete, eigens Wissenschaftler oder Philosophen. Die Verlandungsproblematik bei Flüssen in spätklassischer Zeit ist aus griechischer Perspektive etwa durch die Beispiele am Mäander ebenfalls bekannt gewesen. Vgl. allgemein zur Verlandungspro-blematik HORDEN/PURCELL, Corrupting Sea (Anm. 26), 312–320; zu der von Hafenanlagen BLACKMAN, „Harbors“ (Anm. 64), 662.
116 GODDIO, „Two Egyptian Emporia“ (Anm. 105), 129. 117 Siehe oben, Anm. 66.
Volker Grieb 198
in einer stark verkürzten und einzig auf Alexander zugeschnittenen Weise schildern.118 Im Roman heißt es, dass der Makedonenkönig, nachdem Ort und Plan der Stadt festgelegt waren, weitere Baumeister hinzuzog, die ihm rieten, die Stadt u.a. auf steinernen Funda-menten zu errichten und mit Wasserleitungen und Kanälen, die ins Meer mündeten, auszu-statten.119 Wenngleich unklar bleiben muss, welche Details für die Stadt anfänglich geplant und umgesetzt wurden,120 spricht für diese Angabe im Roman, dass sowohl die Gesamt-anlage als auch die einzelnen Bauten ausführlicher Planungen bedurften, an denen neben Deinokrates mit großer Wahrscheinlichkeit eben noch weitere Baumeister beteiligt waren und Alexander kaum mehr als die grundsätzlichen Entscheidungen über die ihm vorgeleg-ten Pläne traf. Offensichtlich wird dies, wenn man den zeitgenössischen Anspruch berück-sichtigt, der im 4. Jh. an das Können von Architekten und damit auch an den Städtebau gestellt wurde. In einer kurzen Notiz über den aus dem 4. Jh. stammenden Architekten Pytheos berichtet Vitruv, dieser habe gefordert, dass herausragende Baumeister durch ein spezialisiertes Wissen auf allen Gebieten jeweils sogar mehr leisten sollten als diejenigen, die es in einem Wissensgebiet durch Fleiß und Übung zu höchster Berühmtheit gebracht hätten.121 Mag man hierin zunächst eine persönliche Ambition des Architekten sehen, so
!118 Arr. an. III 1,5; Diod. XVII 52,2; Curt. IV 8,1–2. 119 Ps.-Kallisth. I 31,9–10: σκέπτεται δὲ Ἀλέξανδρος καὶ ἑτέρους ἀρχιτέκτονας τῆς πόλεως, ἐν οἷς ἦν
Νουµήνιος λατόµος καὶ Κλεοµένης µηχανικὸς Ναυκρατίτης καὶ Καρτερὸς Ὀλύνθιος. εἶχε δὲ ἀδελφὸν ὁ Νουµήνιος ὀνόµατι Ὑπόνοµον. οὗτος συνεβούλευσεν τῷ Ἀλεξάνδρῳ τὴν πόλιν ἐκ θεµελίων κτίσαι, ἐν αὐτῇ δὲ καὶ ὑδρηγοὺς πόρους καὶ ὀχετηγοὺς ἐπιρρέοντας εἰς τὴν θάλασσαν. In diesem Sinne bereits EHRENBERG, Alexander (Anm. 1), 24f., wonach Deinokrates den Plan unter Anteilnahme Alexanders und in starker Anpassung an das Gelände entworfen habe. Ebenso und mit besonderer Hervorhebung der Rolle des Deinokrates, die allerdings in der von Ps.-Kallisthenes angeführten Weise zu relativieren wäre, BROWN, „Deinokrates“ (Anm. 4), 227–247, hier 231f. Demgegenüber wenig überzeugend etwa FRASER, Alexandria (Anm. 1), 3, wonach Alexander selbst den Plan entworfen habe, den Deinokrates dann umsetzte. Ähnlich zuletzt etwa BARCELÓ, Alexander (Anm. 1), 135. Allgemein zu Entwurf und Ausführung klassisch-griechischer Stadtplanung siehe HOEPFNER/SCHWANDNER, Haus und Stadt (Anm. 8), 314f.
120 Der von Kleomenes und Deinokrates umgesetzte ursprüngliche Stadtplan ist allenfalls indirekt anhand der literarischen Quellen zu erahnen, kann aber keineswegs mehr von möglichen Umbau-maßnahmen oder Planänderungen, die Ptolemaios I. nach seiner Herrschaftsübernahme in Ägypten beauftragte und die somit anderen machtpolitischen Voraussetzungen unterlagen als noch im Winter 332/1 v.Chr., unterschieden werden. Nicht überzeugend ist in dieser Hinsicht das methodische Vorgehen von BROWN, „Deinokrates“ (Anm. 4), 227–247 (ebenso DIES., „Deinokrates and Alexandria“, BullAmSocPap 15 [1978], 39–42), die auch die in den späteren Quellen (etwa Strabon) überlieferten Details des Stadtplanes in ihrem Ursprung auf die Gründungsphase und so zugleich auf Deinokrates zurückgehen lässt. Beispielhaft: „It was a collaboration, then, between an architect who has been famous since antiquity as the deviser of an extraordinary, ingenious plan and a king who was ‚delighted’ with his conception“ (ebd. 232). Zum literarischen Hintergrund des Gründungs-mythos FRASER, Cities (Anm. 5), 44f.; 214–216.
121 Vitr. I 1,12. Pytheos, Zeitgenosse Alexanders, verfasste eine Schrift über den Bau des Athenatempels von Priene (Vitr. ebd.; vgl. VII praef. 12). Zudem war er am Bau des Maussolleions in Halikarnassos beteiligt. Zu Pytheos siehe H. RIEMANN, RE XXIV (Stuttgart 1963), Sp. 371–513, s.v. Pytheos (bes. 507–513); W. Koenigs, „Pytheos, eine mythische Figur in der antiken Baugeschichte“, in: Bauplanung und Bautheorie der Antike, Berlin 1984, 89–94; W. HOEPFNER, „Pytheos“, in: R. Vollkommer (Hrg.), Künstlerlexikon der Antike (München/Leipzig 2001), 770–774. In der Grün-dungszeit von Alexandreia war etwa Dexiphanes von Knidos, Vater des später berühmten und in Alexandreia tätigen Sostratos von Knidos, aktiv, der seinerseits als Architekt weithin bekannt war,
Zur Gründung von Alexandreia 199
spiegelt diese Aussage doch grundsätzlich einen hohen praktischen wie theoretischen Anspruch an Architektur bzw. Baumeister in dieser Zeit wider, der auch für einen Deino-krates und seine Mitwirkenden gegolten haben sollte,122 sodass die im Alexanderroman angeführte Kompetenz und tragende Rolle der Architekten für die Stadtgründung durchaus begründet erscheint. Demgegenüber bleiben die weiteren literarischen Quellen mit ihren Ausführungen zur Gründung in dieser Hinsicht durchweg so allgemein, dass sie weder eine für die Planung und Ausführung zugrundeliegende zeitgenössische Gelehrsamkeit noch eine detailliertere Perspektive der beteiligten Fachgelehrten wiedergeben. Auch in dieser Hinsicht konnte also der Makedonenkönig in zentraler Rolle als Stadtgründer dargestellt werden und ihm gewissermaßen summarisch der Ruhm für die architektonische Ausgestaltung der Stadt zukommen. Die einzelnen Details zu Stadtplan und Stadtplanung tragen weiterhin nur noch bedingt zur Klärung des Gründungszusammenhanges bei. Zwei charakteristische Vorzüge, die in der Überlieferung gerade für Rhakotis/Pharos als Ort der Neugründung gesprochen hätten, sind bei genauerem Hinsehen jedenfalls nicht einzig auf diesen Ort zu beziehen. So hat keineswegs eben nur dort die Möglichkeit bestanden, Binnenschiffahrt und Seeschiffahrt auf engem Raum miteinander zu verbinden.123 Bereits in Herakleion-Thonis, dem zuvor zentralen Emporion an der Küste des westlichen Nildeltas, war ein solcher Warenumschlag möglich und dürfte, darauf lassen die archäologischen Funde schließen, dort bereits über lange Zeit und auch nachfolgend noch praktiziert worden sein.124 Der zweite scheinbare Vorzug, nämlich die von Diodor angeführten kühlenden Etesien, die in den heißen Som-mermonaten das örtliche Klima von Alexandreia erträglich machten,125 taten ihre natürliche Wirkung freilich auch entlang der übrigen Küste des westlichen Deltas und damit bis Hera-kleion und darüber hinaus (vgl. Abb. 5b). Die Wahl des Ortes für eine zukünftige Stadt-gründung hätte also wegen dieser beiden Vorzüge keineswegs einzig auf Rhakotis/Pharos zu fallen brauchen.
!was für Knidos seit spätklassischer Zeit eine besondere lokale Gelehrsamkeit hinsichtlich der Architektur nahelegt; dazu F. HEICHELHEIM, RE Supp. VII (Stuttgart 1940), Sp. 1221f., s.v. Sostratos (11a).
122 Siehe dazu Arist. pol. VII 6 (1327a11–1327b21) mit dem Hinweis auf die in seiner Zeit bereits viel diskutierten theoretischen Überlegungen zum Städtebau (vgl. oben, Anm. 114). In der Antike wurden keine Schriften verfasst, die sich ausschließlich mit der Theorie der Stadtplanung befassten. Diese war vielmehr ein Problemfeld mehrerer Wissensbereiche wie der Staatstheorie, der Geometrie oder der Architektur, was somit eine notwendige allgemeine wie auch spezielle Bildung der stadt-planenden Architekten erforderte (SZIDAT, „Hippodamos“ [Anm. 64], 39f.). Für das 4. Jh. v.Chr. lag das zu erschließende theoretische Reflektions- und Diskussionsniveau der führenden Architekten im staatstheoretischen Bereich somit auf dem Niveau der entsprechenden Schriften eines Platon und eines Aristoteles. Vgl. zur Theorie der Stadtplanung in dieser Zeit R. MARTIN, L’urbanisme dans la Grèce antique, Paris 21974, 18–29, bes. 24–29 (28: „théories et techniques se sont amalgamées“); F. KOLB, Die Stadt im Altertum, München 1984, 113–120.
123 Vgl. demgegenüber Strab. XVII 1,13 (798). 124 Zum Emporion Ps.-Arist. oik. II 33c (1352a29–33); Diod. I 19,4. Auf einen Umschlagplatz lassen die
zahlreichen, gerade auch ägyptischen Schiffswracks von Herakleion-Thonis (FABRE, „Shipwrecks“ [Anm. 112]) sowie die dortigen Funde griechischer Keramik (GRATALOUP, „Occupation“ (Anm. 106)] schließen.
125 Diod. XVII 52,2.
Volker Grieb 200
Dass weiterhin der Grundriss der Stadt, der einer makedonischen Chlamys geglichen habe, der lokalen topographischen Situation folgte und hierin nicht etwa eine ursprüngliche Motivation erkannt werden kann, die Stadt in dieser Form als makedonische Reminiszenz anzulegen, ist offensichtlich.126 Durchaus naheliegend erscheint es mit Arrian demge-genüber, dass Alexander die Zahl der Tempel für die entsprechenden Götter, griechisch wie ägyptisch, bestimmt haben könnte,127 zumal dies in keinem Widerspruch stehen muss zu den urbanistischen Details eines Planes, den die Baumeister entworfen und angepasst hat-ten.128 Ebenso ist es naheliegend, dass Alexander bei der Markierung der Lage von Agora und Stadtmauer im Gelände anwesend war bzw. daran möglicherweise sogar mitwirkte.129 Eine offensichtliche Überhöhung Alexanders liegt hingegen in der von Diodor überlieferten Episode vor, wonach es der Makedonenkönig gewesen sein soll, der mit einer Festlegung der Straßenführung dafür gesorgt habe, dass die Stadtluft im Sommer durch die Etesien gekühlt werde.130 Dieses Detail ist zunächst der Gesamtkonzeption der Stadtanlage unter-geordnet gewesen und damit auf die Sachverständigen zurückzuführen, wobei jedoch ein in der Sommerzeit kühlender Wind für zeitgenössische Baumeister kaum mehr als einen ohnehin zu berücksichtigenden und in dieser Region weithin bekannten Aspekt dargestellt haben wird. Für ein eher unbedarftes Publikum ließ sich damit hingegen ein städtebaulicher Vorzug der später dichtbewohnten Metropole an der Küste des Nillandes anführen und trefflich auf Alexanders persönliches Wirken vor Ort übertragen. Insgesamt zeigt also eine kritische Betrachtung der Details zur Gründung, dass in der literarischen Überlieferung gleich mehrfach ein persönliches Handeln und eine persönliche Ambition Alexanders in einer Weise in den Vordergrund gerückt wird, die eine historische Glaubwürdigkeit deutlich übersteigt. Auch überrascht die scheinbar beeindruckende Größe der Neugründung gerade im zeitgenössischen Vergleich zu Rhodos-Stadt keineswegs und eine in den Quellen offensichtlich noch fassbare Unsicherheit bei der Wahl des endgültigen
!126 Mit CLAUSS, Alexandria (Anm. 1), 12. Die Quellen zu dieser Gleichsetzung: Diod. XVII 52,3; Strab.
XVII 1,8 (793), Plin. nat. hist V 11,62; Plut. Alex. 26,5. Vgl. etwa GREEN, „Alexandria“ (Anm. 1), 15, der Deinokrates für diese Form der Stadt verantwortlich sieht.
127 Arr. an. III 1,5. Ob die im Alexanderroman (Ps.-Kallisth. I 32,4) überlieferte Einteilung der Stadt in die fünf Stadtviertel, die nach den Buchstaben Alpha bis Epsilon bezeichnet wurden und als Abkürzung für Ἀλέξανδρος Βασιλεὺς γένος zιὸς ἔκτισεν standen, in die Gründungsphase zu datieren ist, muss offen bleiben; belegt ist diese Aufteilung zuerst im späteren 3. Jh. v.Chr. (FRASER, Alexandria [Anm. 1], 34f.).
128 Diod. XVII 51,1; Ps.-Kallisth. I 31,7; (Curt. IV 8,2). 129 Arr. an. III 1,5: πόθος οὖν λαµβάνει αὐτὸν τοῦ ἔργου, καὶ αὐτὸς τὰ σηµεῖα τῇ πόλει ἔθηκεν, ἵνα
τε ἀγορὰν ἐν αὐτῇ δείµασθαι ἔδει καὶ ἱερὰ ὅσα καὶ θεῶν ὧντινων, τῶν µὲν Ἑλληνικῶν, Ἴσιδος δὲ Αἰγυπτίας, καὶ τὸ τεῖχος ᾗ περιβεβλῆσθαι. Zu der in mehreren Quellen angeführten und als gutes Omen gedeuteten Episode, dass zahlreiche Vögel durch das Getreide, das man hilfsweise zur Markierung des Stadtgrundrisses im Gelände verwendete, angelockt wurden, Ch. LE ROY, „Les oiseaux d’Alexandrie“, BCH 105 (1981), 393–406, mit der Zusammenstellung der Quellen und einer mythologischen Einordnung.
130 Diod. XVII 52,2: εὐστοχίᾳ δὲ τῆς ῥυµοτοµίας ποιήσας [sc. Alexander] διαπνεῖσθαι τὴν πόλιν τοῖς ἐτησίοις ἀνέµοις καὶ τούτων πνεόντων µὲν διὰ τοῦ µεγίστου πελάγους, καταψυχόντων δὲ τὸν κατὰ τὴν πόλιν ἀέρα πολλὴν τοῖς κατοικοῦσιν εὐκρασίαν καὶ ὑγίειαν κατεσκεύασεν. Zur Ausrichtung von klassisch-griechischen Stadtanlagen A. VON GERKAN, Griechische Stadtanlagen, Berlin/Leipzig 1927, 79.
Zur Gründung von Alexandreia 201
Platzes lässt sich naheliegend mit der urbanen Situation im westlichen Nildelta sowie einer grundsätzlichen konzeptionellen Diskussion, welche Zielsetzung mit der Stadt verfolgt werden sollte, erklären.131 Eine endgültige Entscheidungskompetenz des Königs über die Anlage und Ausgestaltung der zukünftigen Stadt, die freilich durchaus in seinem Sinne vorgenommen worden sein konnte, braucht dafür insgesamt nicht infrage gestellt zu wer-den.
3. Die Gründung von Alexandreia als Fortführung eines neuen Urbanismus in der südöstlichen Ägäis: konzeptionelle Merkmale Betrachtet man die wesentlichen konzeptionellen Merkmale von Alexandreia, die aus den Quellen zur Gründungsgeschichte hervorgehen, lässt sich erkennen, dass die Stadt – sieht man einmal von ihrer aus griechischer Sicht fernen Lage nahe dem westlichen Nildelta ab – kaum außergewöhnlich war und in mehrfacher Hinsicht an die neuen urbanen Zentren der südöstlichen Ägäis anknüpfte. Mit der Anlage einer gänzlich neuen Hafenstadt an einem zuvor nicht urbanisierten Ort bot freilich Rhodos-Stadt ein naheliegendes und zugleich erfolgreiches Vergleichs-beispiel.132 Zugleich hätte ein möglicher Ausbau von Herakleion und/oder Naukratis als Alternative zu einer großen Neugründung an Vorläufer in der Ägäisregion anknüpfen können. Dort wurden in Halikarnassos und bis zu einem gewissen Grad wohl auch in Kos-Stadt bestehende Hafenstädte mit dem Synoikismos umfangreich um- bzw. ausgebaut.133 Alle drei Orte, Rhodos-Stadt, Kos-Stadt und Halikarnassos, boten weiterhin konzeptionelle Vorlagen für eine Ansiedlung zahlreicher Bewohner in einer neugegründeten Stadt sowohl in politischer als auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Während Rhodos-Stadt bzw. Kos-Stadt jeweils als politischer Synoikismos mit Personen der Polis besiedelt wurden und als genuin griechische Städte zu sehen sind, bot Halikarnassos ab Maussollos’ Zeit das Beispiel einer regionalen Metropole, in der neben Griechen auch die indigene Bevölkerung in größerer Zahl aufgenommen wurde, und es somit zu einer stärkeren urbanen Durch-mischung von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen kam.134 Für das neu anzulegende Alexandreia, in das nach Ausweis der Quellen eben auch zahlreiche Bewohner der Umgebung zusammengezogen wurden und das trotzdem eine starke griechisch-make-donische Prägung besitzen sollte,135 liegt insofern ein Rückbezug zum Vorgehen von Maussollos in Halikarnassos nahe. Dieser Vergleich bot sich in stadtplanerischer Hinsicht zudem deshalb an, weil die karische Stadt um den Herrschaftssitz des Hekatomniden und damit um eine entsprechend monarchische Facette in Stadtkonzeption und Stadtbild
!131 Dazu weiterhin unten der Abschnitt „Alexander als maßgeblicher Initiator der Stadtgründung?“. 132 Ebenfalls wäre hierbei an Kos-Stadt als Neugründung an der Stelle des alten Kos Meropis zu denken,
das insbesondere wegen seines Hafens nach dem Synoikismos ein rasches städtisches Wachstum verzeichnen konnte. Vgl. Diod. XV 76,2.
133 Siehe oben, Anm. 7–11. 134 Strab. XIII 1,59 (611); HOEPFNER, Halikarnassos (Anm. 11), 37f.; siehe weiterhin die Verweise
oben, Anm. 11. 135 Ps.-Arist. oik. II 33c (1352a29–1352b3); Curt. IV 8,5; Ps.-Kallisth. I 31,8.
Volker Grieb 202
erweitert wurde.136 Sofern ein herrschaftlicher Bereich in Alexandreia von Beginn an überhaupt geplant war – was allerdings wiederum eine Intention Alexanders zur Gründung einer zukünftigen Metropole voraussetzt, die gerade nicht zu belegen ist –,137 hätte die neue Stadt auch an dieses konzeptionelle Merkmal der Hekatomniden in Halikarnassos anschlie-ßen können. Sicherlich wird man in dieser Hinsicht dann auch einen Blick nach Make-donien richten müssen, doch unterschieden sich die dortigen Herrschaftssitze ihrem Stadt-typus nach bereits grundsätzlich von der zukünftigen ägyptischen Metropole, da sie nicht als genuine Handels- und Hafenorte, in denen auch ein Herrschaftssitz bestand, verstanden werden können.138
Indem die wesentliche Funktion der neuen Metropole neben dem möglicherweise früh vorgesehenen Herrschaftssitz jedoch in ihrer Rolle als Handelsknotenpunkt lag,139 dürften
!136 HOEPFNER, Halikarnassos (Anm. 11), 53–62 mit neuen, durchaus bedenkenswerten Überlegungen
zur Lage der Basileia in Halikarnassos. Nach Vitr. II 8,13 habe Maussollos sogar eine regia domus, also einen Königspalast, nach eigenem Plan errichten lassen.
137 Kritisch in dieser Hinsicht auch CLAUSS, Alexandria (Anm. 1), 12, wonach Alexander keinen Anlass gehabt habe, einen Palast erbauen zu lassen; dieser stamme möglicherweise erst aus der Herrschaftszeit des Ptolemaios I. Vgl. auch HUSS, Ägypten (Anm. 1), 65. Auffällig ist tatsächlich, dass nur Diodor überliefert, Alexander habe den Bau eines Königspalastes befohlen (XVII 52,4; vgl. auch Plin. nat. hist. V 62). Diodor könnte hier durchaus eine spätere Sichtweise auf die Gründungs-phase projizieren. Auch die oben angeführte Quellenkritik zum Gründungszusammenhang spricht deutlich gegen eine von Alexander bereits 332/1 v.Chr. geplante Basileia, zumal für ihn einzig ein mythisches bzw. kultisches persönliches Interesse an der Gründung zweifelsfrei zu belegen ist. Siehe demgegenüber etwa R. TOMLINSON, „The Town Plan of Hellenistic Alexandria“, in: N. Bonacasa, A. di Vita (Hrgg.), Alessandria e il mondo ellenistico-romano, Rom 1995, 236–240, der für seinen Vergleich zwischen Pella und Alexandreia für letztere den frühhellenistischen Zustand zugrunde legt und diesen mit Alexanders Gründung gleichsetzt.
138 Vgl. etwa HAMMOND, Alexander (Anm. 1), 125, der für die Gründung von Alexandreia ohne weiteren Vergleich einzig auf makedonische Vorbilder verweist (Dion, Pella, Amphipolis) und dabei ebenfalls voraussetzt, dass Alexander eine entsprechend große Stadt hat gründen wollen. Wegen der Unsicherheit in der diesbezüglichen Überlieferung (siehe Anm. 137) und der notwendigerweise gleich mehreren vorauszusetzenden Annahmen scheint es sinnvoll, eine bereits 332/1 v.Chr. von Alexander beauftragte Basileia gänzlich aus der Diskussion zur Gründung der Stadt auszunehmen. Alexanders Umgang mit Ilion, dem er erst nach dem Sieg über Dareios eine umfangreiche urbane Ausgestaltung versprach, dürfte auch für das ägyptische Alexandreia als Maßstab seines zeitge-nössischen Herrscherverständnisses dienen; vgl. dazu unten den Abschnitt 5. Zu griechischen und orientalischen Palästen dieser Zeit vgl. jetzt allgemein F. KNAUSS, T. MATTERN, „Orientalische und griechische Paläste: Eine Strukturanalyse“, in: N. Zenzen, T. Hölscher, K. Trampedach (Hrgg.), Aneignung und Abgrenzung. Wechselnde Perspektiven auf die Antithese von ‘Ost’ und ‘West’ in der griechischen Antike, Heidelberg 2013, 421–464 (mit weiterer Literatur).
139 Dass Alexandreia bereits in seiner ersten umfangreichen Konzeption als zentrale Hafenstadt und Handelsknotenpunkt geplant war, ist vor dem Hintergrund der oben dargelegten überregionalen Handelsrouten aus maritimer städtebaulicher Perspektive sowie aufgrund der zeitgenössischen Angabe von Ps.-Arist. oik. II 33c (1352a29–31), wonach der Handelsplatz von Kanopos, der zuvor der zentrale Handelsplatz an der Küste des westlichen Nildeltas war (Diod. I 19,4), nach Alexandreia verlegt werden sollte, unzweifelhaft. Vgl. etwa WILCKEN, Alexander (Anm. 4), 108; FRASER, Alexandria (Anm. 1), 132. Anders etwa SONNABEND, Alexandria (Anm. 1), 526, wonach die konzep-tionelle Funktion als Herrschersitz wegen der umfangreichen persönlichen Beteiligung Alexanders und der Repräsentanz und Monumentalität überwogen habe. Sonnabend lässt allerdings die südostägäischen Städte als Vergleich unberücksichtigt und sieht die in den Quellen angeführte Rolle Alexanders bei der Gründung weitgehend unkritisch. Nach A. B. BOSWORTH, A Historical
Zur Gründung von Alexandreia 203
freilich auch die südostägäischen Städte, allen voran Rhodos, zahlreiche Anhaltspunkte für die maritime Konzeption und adäquate Verknüpfung der Hafeneinrichtungen mit der übrigen Stadt geboten haben,140 zumal dort die Häfen weitestgehend künstlich angelegt wurden, wofür wiederum ein erheblicher baulicher Aufwand notwendig war.141 Ob das für Alexandreia verwendete Hafenkonzept, wonach ein Damm den gesamten Hafenbereich zunächst in zwei Bereiche teilte und die Insel Pharos mit dem Festland verband,142 auf Tyros und den dort unter Alexander angelegten Damm zur Belagerung der Stadt zurück-ging, muss fraglich bleiben.143 Typologisch schließt dies an ältere, allerdings baulich kleinere Vorbilder etwa in Syrakus oder Neu-Knidos an,144 setzt letztlich aber nur den verbreiteten Stadttypus einer Hafenstadt mit Doppelhafen fort: An Küsten wurden dafür bevorzugt diejenigen Kaplagen gewählt, die aufgrund ihrer natürlichen Situation alternative Hafenbereiche boten, um diese entweder entsprechend ihres Schutzes bei unterschiedlichen Wetterlagen anlaufen oder aber grundsätzlich in funktionaler Hinsicht verschiedenartig nutzen zu können.145 Die künstliche Unterteilung einer Hafenbucht konnte zudem die Strömungen im Hafenbereich minimieren, die in der ursprünglich offenen Bucht von Rhakotis bei den häufigen nördlichen und nordwestlichen Winden durchaus relevant gewesen sein dürfte.146 Der für Alexandreia charakteristische Umschlag zwischen Seeschif-fahrt und Flussschiffahrt spielte für Griechenland hingegen eine nur marginale Rolle und stellte in der Form, wie er etwa bereits an der Nilmündung in Herakleion-Thonis in der vorangehenden Pharaonenzeit ausgeprägt war, aus griechischer Sicht wohl eher eine stadt-planerische Herausforderung dar, wenngleich er den Griechen im Nildelta als grund-sätzliche Problematik des ägyptischen Außenhandels bekannt war.147
!Commentary on Arrian’s History of Alexander, Vol. I, Oxford 1980, 264, seien die ökonomischen Gründe zwar wichtig, andere Gründe aber entscheidender gewesen, wofür er ohne weitere Spezifi-zierung das Militärische anführt.
140 BLACKMAN, „Habors“ (Anm. 64), 654f. (mit weiterer Literatur). Mit den Schiffshäusern des Philon in Piräus und dem Ausbau des Hafens von Syrakus fallen zwei weitere große Hafenbauprojekte in das 4. Jh. v.Chr.
141 D. BLACKMAN et al., „Die Schiffshäuser am Mandrakihafen in Rhodos“, AA 1996, 371–426, bes. 372–378, HOEPFNER/SCHWANDNER, Haus und Stadt (Anm. 8), 64.
142 Das Heptastadion zwischen Pharos und dem Festland bei Strab. XVII 1,6 (792). Ohnehin muss unsicher bleiben, ob der Verbindungsdamm bereits im ursprünglichen Konzept vorgesehen war; vgl. FRASER, Alexandria (Anm. 1), 21.
143 Der Vergleich z.B. bei VAN GRONINGEN, „Fondation“ (Anm. 94), 206–208; BERNAND, Alexandrie (Anm. 1), 41f.; SONNABEND, „Alexandria“ (Anm. 1), 527; GREEN, „Alexandria“ (Anm. 1), 10. Kritisch demgegenüber HUSS, Ägypten (Anm. 1), 64.
144 LEHMANN-HARTLEBEN, Hafenanlagen (Anm. 113), 60f. 145 LEHMANN-HARTLEBEN, Hafenanlagen (Anm. 113), 60f., 132. 146 FRASER, Alexandria (Anm. 1), 21f. zum Heptastadion, u.a. mit dieser durchaus wichtigen Funktion
eines solchen Bauwerkes. Die Häufigkeit der nordwestlichen Winde beträgt in Alexandreia von Juni bis September etwa 70-90% und liegt für den Rest des Jahres etwa bei der Hälfte der Winde. Von Oktober bis Mai bestehenden zudem häufiger nordöstliche Winde. Vgl. dazu etwa Atlas of Pilot Charts. North Atlantic Ocean 2002 (Mediterranean Inset), hrg. von United States. National Geospatial-Intelligence Agency, Annapolis 2007.
147 FABRE, „The Shipwrecks“ (Anm. 112), 13–32, mit den zahlreichen Schiffsfunden ägyptischen Typs, die ebenso auf einen Umschlagplatz verweisen wie die dort gefundene griechische Keramik (GRATALOUP, „Occupation“ [Anm. 106], 151–159). Ein solcher Warenumschlag dürfte freilich auch im Mündungsbereich des Mäander eine – wenngleich deutlich geringere – Rolle gesielt haben.
Volker Grieb 204
Dass der neuen Stadt neben ihrer Funktion als große Hafen- und Handelsstadt auch eine militärische Funktion zukam, kann als sicher angenommen werden.148 So wird von Diodor in seiner knappen Darstellung der Gründung die strategisch günstige Lage der Stadt mit ihren zwei Wasserseiten als wichtiger Aspekt hervorgehoben.149 Es ist zurecht darauf verwiesen worden, dass noch zur Zeit Alexanders ein Bedrohungspotential von See exis-tierte,150 dass eine militärische Sicherung des westlichen Nildeltas – und damit gewisser-maßen als Pendant zu Pelusion im östlichen Delta – durchweg plausibel erscheinen lässt.151 Ebenso wie das Gebiet um Rhodos im Norden stellte Alexandreia nun im Süden des öst-lichen Mittelmeeres zudem einen wichtigen Knotenpunkt des transmediterranen Handels-verkehrs dar, an dem nicht nur die Route aus der Ägäis zum Nildelta vorbeiführte, sondern auch die von Karthago beziehungsweise dem phönizischen Westen entlang der Küste in das alte phönizische Kernland an der Levanteküste.152 Einen größeren Handelsknotenpunkt
!148 Anders H.-U. WIEMER, Alexander der Große, München 2005, 108. Vgl. demgegenüber – allerdings
ohne genauere Begründung – etwa MOSSÉ, Alexander (Anm. 1), 31; KOLB, Stadt (Anm. 122), 123; siehe weiterhin unten, Anm. 150.
149 Diod. XVII 52,3 καὶ τὸν µὲν περίβολον αὐτῆς ὑπεστήσατο τῷ τε µεγέθει διαφέροντα καὶ κατὰ τὴν ὀχυρότητα θαυµάσιον· ἀνὰ µέσον γὰρ ὢν µεγάλης λίµνης καὶ τῆς θαλάσσης δύο µόνον ἀπὸ τῆς γῆς ἔχει προσόδους στενὰς καὶ παντελῶς εὐφυλάκτους. Demgegenüber etwa LANE FOX, Alexander (Anm. 115), 250f., der gerade keine gutgeschützte Lage für den Ort sieht. Bei der von Diodor erwähnten „bewundernswerten Festigkeit“ der Stadtmauer muss offen bleiben, inwieweit diese bereits kurz nach der Gründung bestand. Diodor dürfte in seiner Zeit wenigstens im Osten der Stadt die späteren, aus einer Erweiterung resultierenden Stadtmauern gemeint haben; siehe dazu GRIMM, Alexandria (Anm. 1), 33; vgl. Arr. an. III 1,4; Curt. IV 8,2. Mit Tac. hist. IV 83 wird ein Ausbau u.a. der Stadtmauer unter Ptolemaios I. überliefert, jedoch ist unsicher, ob hier frühere Maßnahmen von Kleomenes auf Ptolemaios projiziert wurden. In der Zeit des 4. Jhs. v.Chr. waren Stadtmauern in ihrer Funktion als umfangreiches Verteidigungsbauwerk durchaus ein konstitutives Element einer Neugründung größeren Ausmaßes; vgl. dazu etwa Megalopolis, Messene, Priene und die angeführten Städte der südöstlichen Ägäis.
150 Zur Zeit der Gründung bestanden die persisch-makedonischen Gegensätze in der Ägäis zunächst fort, und Kreta wurde zu einer wichtigen Anlaufstelle für antimakedonische Kontingente: J. D. GRAINGER, Hellenistic and Roman Naval Wars, Barnsley 2011, 7–11 (mit den Quellen). Mit Sparta bestand auf der Peloponnes ein möglicher Konkurrent makedonischer Herrschaft, der im Verbund mit den sich nach Kreta geflüchteten propersischen Einheiten und vor dem Hintergrund der oben angeführten nautischen Bedingungen im östlichen Mittelmeerraum eine offensichtliche Bedrohung für das nordwestliche Nildelta darstellen musste. In diesem Sinne bereits BRAUNERT, „Mittelmeer“ (Anm. 94), 136, der als eine wesentliche militärische Funktion der Stadt wenigstens für die Gründungsphase die Sicherung Ägyptens gegen Übergriffe von Nordwesten sieht; weiterhin etwa CAVENAILE, „Alexandrie“ (Anm. 1), 102–107; GREEN, „Alexandria“ (Anm. 1), 10.
151 Arr. an. III 5,2–6, führt an, dass Alexander in Ägypten ein östliches und ein westliches Grenz-kommando habe aufstellen lassen. Es ist naheliegend, mit HAMMOND, Genius (Anm. 1), 96f., für einen Teil der von Curt. IV 8,4 (vgl. Arr. an. III 5,5) genannten 30 Kriegsschiffe, die Alexander zur Sicherung der Nilmündung einsetzen ließ, Alexandreia als Stützpunkt anzunehmen. Vgl. dazu die bei Hdt. II 30 und Thuk. I 104,1 erwähnten früheren Grenzsicherungen in diesem Bereich des westlichen Nildeltas; ebenso Strab. XVII 1,6 (792) mit dem alten Flottenstützpunkt der Pharaonen in Rhakotis gegen die u.a. griechische Piraterie.
152 Schutz und Kontrolle der Seewege wenigstens im Gebiet um die Neugründung konnten den überregionalen Seehandel, der sich absehbar in einem zusammenhängenden ostmediterranen Herr-schaftsgebiet intensivieren würde, an einem wichtigen Punkt sichern helfen. Vgl. allgemein zum maritimen Handel der spätklassischen und hellenistischen Zeit, der in der Ägäis häufig mit dem Problem der Piraterie verbunden gewesen sein konnte, V. GABRIELSEN, „Economic Activity,
Zur Gründung von Alexandreia 205
ohne einen solchen militärischen Schutz zu belassen, stünde nicht zuletzt den zeitge-nössischen Notwendigkeiten entgegen, wie etwa ein Blick auf Rhodos-Stadt lehrt, für das eine enge Verknüpfung von Handelsknotenpunkt und Flottenstützpunkt bereits in spätklas-sischer Zeit charakteristisch war.153 Insgesamt knüpfen die konzeptionellen und funktionalen Merkmale der neugegründeten Stadt mit der Ausnahme eines umfangreicheren Warenumschlags zwischen Binnen- und Seeschiffahrt also durchweg an bekannte Vorgänger der südöstlichen Ägäis aus der spät-klassischen Zeit an und lassen das frühe Alexandreia, soweit dies die Quellen noch zu erkennen geben, als eine konsequente Fortführung der vorangehenden Entwicklung in der südöstlichen Ägäis verstehen und nicht, wie die literarischen Quellen und der spätere Erfolg der Gründung prima facie suggerieren könnten, als eine besondere Leistung Alexanders oder außergewöhnliche urbane Neuschöpfung.154 Allenfalls die Lage der Gründung an der westlichen Küste des Nillandes könnte außergewöhnlich erscheinen, jedoch war diese wiederum vor dem Hintergrund der oben aufgezeigten nautischen Bedingungen im östlichen Mittelmeerraum durchaus naheliegend. Dass das alte Naukratis im 4. Jh. v.Chr. schlichtweg keine Alternative zu einem Handelsort an der Küste mehr bot, wird durch einen Vergleich mit der vorangehenden Entwicklung in der südöstlichen Ägäis ersichtlich. In Analogie zu den dortigen neuen Zentren und deren Lage an den überregionalen Verkehrsrouten (s.o.) wird man vermuten dürfen, dass den Griechen des Nildeltas die abseitige Lage von Naukratis sicherlich ebenso bewusst war wie auch die Möglichkeiten, die sich im 4. Jh. v.Chr. mit einer stärkeren Orientierung an den überregionalen Routen ergeben hatten (vgl. Abb. 1; 6). Die von Peter Green vorgebrachte Überlegung, Kleomenes von Naukratis könnte während Alexanders Aufenthalt auf diesen eingewirkt haben „to turn Naukratis into the city of his deams“,155 erscheint somit aus der Perspektive der handels-strategischen und urbanistischen Entwicklungen wenig überzeugend. Eine Stadt seiner Träume dürfte für einen rational denkenden und an Handelsgeschäften interessierten Kleo-menes in dieser Zeit dennoch angenommen werden können, nur hätte diese eben eher an einem geeigneteren Platz direkt an der Küste gelegen.
!Maritime Trade and Piracy in the Hellenistic Aegean“, REA 103 (2001), 219–240 (mit Quellen und weiterer Literatur).
153 Dazu zuletzt V. GABRIELSEN, „Rhodes and the Ptolemaic Kingdom: the Commercial Infrastructure“, in: K. Buraselis, M. Stefanou, D. J. Thompson (Hrgg.), The Ptolemies, the Sea and the Nile: Studies in Waterborne Power, Cambridge 2013, 73–76, der die aus der militärischen Präsenz resultierende Förderung des rhodischen Handels hervorhebt. Zur navalen Infrastruktur als wichtigem Aspekt bei Handelsorten siehe etwa Neu-Knidos mit seinem kleinen Militärhafen innerhalb des Stadtgebietes. Weitere wichtige Handelsorte mit separatem Kriegshafen sind Athen, Aigina, Thasos und im Westen Karthago (vgl. BLACKMAN, „Harbors“ [Anm. 64], 654). Vgl. zum Zusammenhang von Piraterie und Seehandel in der Mitte des 4. Jhs. v.Chr. RUTISHAUSER, Economic Strategies (Anm. 35), 225–228.
154 Stellvertretend hierfür etwa HOEPFNER/SCHWANDNER, Haus und Stadt (Anm. 8), 235, wonach die Gründung Alexandreias durch Alexander eine Tat sei, die die griechische Klassik weit hinter sich gelassen habe. Einen Vergleich mit den Städten der südöstlichen Ägäis führen Hoepfner und Schwandner nicht an. Irreführend ist dort die Angabe, dass „die Größe der Metropole (...) mehr als zehnmal so groß ausfallen sollte wie bisherige Städte“ (237). Dies mag annähernd für kleinere Orte wie Priene zutreffen (37ha; ebd. 193), nicht aber für die Neugründungen von Rhodos-Stadt und Halikarnassos (ca. 290ha bzw. 200ha; ebd. S. 52 bzw. 228); vgl. dazu oben, Anm. 66 und 110.
155 GREEN, „Alexandria“ (Anm. 1), 9.
Volker Grieb 206
4. Zur zeitlichen Stellung der Gründung während Alexanders Aufenthalt in Ägypten Die Frage, wann genau die Gründung an dem ausgewählten Ort vorgenommen wurde, beruht letztlich auf den oben angeführten zwei Überlieferungssträngen, wonach Arrian und Plutarch diesen Vorgang eben vor dem Besuch von Siwa schildern, während Curtius Rufus, Diodor und Iustin zunächst von dem Aufenthalt in Siwa berichten und daran die Gründung der Stadt anschließen (s.o). Wegen der Autorität von Arrians Darstellung, in diesem Fall der von ihm ausdrücklich genannten Quellen Aristoboulos und Ptolemaios, sowie durch eine Umrechnung des im Alexanderroman als traditionellem Gründungsdatum angeführten 25. Tybi auf den 20. Januar des Jahres 331 v.Chr.156 nahm vor allem die ältere und ein Teil der jüngeren Forschung eine Gründung vor dem Besuch von Siwa an.157 Die Überliefer-ungsversion mit einer Gründung nach dem Besuch von Siwa, die v.a. auf der überzeu-genderen Umrechnung des 25. Tybi auf Anfang April 331 v.Chr. beruht,158 ist hingegen in jüngerer Zeit stärker in den Vordergrund gerückt.159 Brian Bosworth hat den möglichen Gegensatz durch eine Verbindung der beiden Überlieferungsversionen aufzulösen versucht, indem er argumentierte, dass es sich bei den überlieferten Quellen jeweils um eine verein-fachte und eher zusammenfassende Erzählung der Ereignisse handele, die eine Gründungs-episode einmal vor und einmal nach dem Orakelbesuch in die Darstellungen einfließen ließ;160 mit einem entsprechend zweimaligen Aufenthalt Alexanders am Gründungsort, der
!156 Arr. an. III 4,5 mit den Quellen. Die Datumsangabe 25. Tybi im Alexanderroman (I 32,6) fällt nach
dem römischen Kalender, der ab 26/5 v.Chr. in Ägypten in Gebrauch war und der wegen einer möglichen kaiserzeitlichen Entstehungszeit des Alexanderromans zugrunde gelegt wurde, auf den 20. Januar, nach dem ägyptischen Kalender des Jahres 331 v.Chr. jedoch auf den 7. April. Der 20. Januar würde Arrians und Plutarchs Version und einer Gründung vor dem Siwa-Aufenthalt entsprechen, wohingegen deren Angaben nicht mit einer Datierung auf den 7. April und einer Gründung nach Siwa einhergingen. Vgl. dazu aber den Beitrag von Agnieszka Wojciechowska und Krzysztof Nawotka im vorliegenden Band.
157 Z.B. WILCKEN, Alexander (Anm. 4), 109; TARN, Alexander I (Anm. 2), 41f.; FRASER, Alexandria (Anm. 1), I 3f. sowie II 2f. Anm. 6 und 9; CAVENAILE, „Alexandrie“ (Anm. 1), 95–102; GREEN, „Alexandria“ (Anm. 1), 13; vgl. BOSWORTH Commentary I (Anm. 139), 263; nachdrücklich zuletzt nochmals HUSS, Ägypten (Anm. 1), 63f.; Weiterhin SEIBERT, Alexander (Anm. 1), 112f. (zur älteren Forschungsdiskussion); J. SEIBERT, Die Eroberung des Perserreiches durch Alexander des Großen auf kartographischer Grundlage, Wiesbaden 1985, 85. Ohne Diskussion etwa: LANE FOX, Alexander (Anm. 115), 249f.; HAMMOND, Alexander (Anm. 1), 124; GRIMM, Alexandria (Anm. 1), 19; SONNABEND, „Alexandria“ (Anm. 1), 519; BARCELÓ, Alexander (Anm. 1), 134; MOSSÉ, Alexander (Anm. 1), 31 (mit Einschränkung); S. HORNBLOWER, The Greek World 479–323 BC, London/New York 42011, 305.
158 Eine Rückrechnung des Datums auf den Januar ergibt die notwendige Annahme, dass der im Alexanderroman angeführte 25 Tybi nach 26/5 v.Chr. von dem ursprünglichen 8. Hathyr 331 v.Chr. des ägyptischen Kalenders (20. Januar) auf das Datum des iulianischen Kalenders umgerechnet und wieder in den ägyptischen Kalender (25. Tybi) übertragen worden sein muss. Auf diese methodische Schwierigkeit der Datierungsfrage hat nachdrücklich hingewiesen R. S. BAGNALL, „The Date of the Foundation of Alexandria“, AJAH 4 (1979), 46–49 (mit der älteren Literatur).
159 Z.B. P. JOUGUET, „La date alexandrine de la fondation d’Alexandrie“, REA 42 (1940), 192–197; WELLES, „Discovery“ (Anm. 78), 271–298; E. N. BORZA, „Alexander and the Return from Siwah“, Historia 16 (1967), 369; BAGNALL, „Foundation“ (Anm. 158), 48. Ohne weitere Diskussion etwa: HÖLBL, Ptolemäerreich (Anm. 1), 10; CLAUSS, Alexandria (Anm. 1), 10; NAWOTKA, Alexander (Anm. 1), 207.
160 A. B. BOSWORTH, „Errors in Arrian“, CQ 26 (1976), 137f.; nochmals in BOSWORTH, Commentary
Zur Gründung von Alexandreia 207
aus einer Quellenkombination resultieren würde, wäre dann der scheinbare Widerspruch der unterschiedlichen Versionen aufgehoben.161 Allerdings muss Bosworth mit seiner Inter-pretation eine kleine, aber wichtige Unstimmigkeit unerklärt lassen, die den Rückweg von Siwa nach Memphis betrifft und sich aus der kurzen Notiz bei Arrian ergibt. Dieser berichtet über die Version des Ptolemaios, dass Alexander gerade auf anderem Wege und zudem direkt (ἄλλην εὐθεῖαν) wieder nach Memphis gelangt wäre (s.u.).162 Den sich daraus ergebenden Widerspruch unberücksichtigt zu lassen,163 überzeugt nicht, zumal gerade „a strong personal interest“ Alexanders an der Gründung, den Bosworth für seine Deutung argumentativ voraussetzen muss und der letztlich die spätere Bedeutung der Stadt bereits zugrunde legt,164 bei genauerem Hinsehen nicht zu belegen ist. Die vorangehende Diskussion einzelner Details des Gründungszusammenhanges hat zudem gezeigt, dass weder aus einer einfachen Kombination der Quellenbelege, wie sie Bosworth für die Frage des Gründungszeitpunktes vorschlägt, noch einzig aufgrund einer möglicherweise beson-deren Glaubwürdigkeit einer einzelnen Quelle überzeugende Argumente für den zeitlichen Zusammenhang zu gewinnen sind.165
Betrachtet man die sogenannte Vulgata-Tradition, die eine erst später erfolgte Gründung annimmt, gilt es zu berücksichtigen, dass Curtius Rufus und Iustin (Pompeius Trogus) bei ihren Schilderungen des Aufenthaltes in Ägypten den Schwerpunkt insgesamt deutlich auf die Siwa-Episode legen und die Stadtgründung nur als Nebenaspekt schildern.166 Beide Darstellungen sind also vor allem auf die aus dem Orakelbesuch hervorgehenden Zusam-menhänge fokussiert. Mit einer inhaltlichen Abhängigkeit von Siwa schildert sogar der Alexanderroman den zeitlichen Verlauf, indem er das Auffinden des geeigneten Ortes einem Orakelspruch zuweist.167 Da nun der Siwa-Besuch weder eine notwendige Voraus-
!(Anm. 139), 263f. (Arr. an. III 1,5); BOSWORTH, Conquest and Empire (Anm. 1), 74; BOSWORTH, „Alexander“ (Anm. 1), 811.
161 Nach Bosworth wäre die Festlegung des Ortes der zu gründenden Stadt vor Alexanders weiterer Reise nach Siwa erfolgt, und beim zweiten Aufenthalt hätte dann die eigentliche Gründung vollzogen werden können, sodass einerseits das in der späteren Zeit als traditionell erachtete Gründungsdatum des 25. Tybi (=7. April) in der Rekonstruktion der historischen Zusammenhänge eingeflochten und andererseits die Version der Vulgata zutreffen würde.
162 Arr. an. III 4,5. Zur Version des Aristoboulos, der den Makedonenkönig auf gleichem Wege wieder aus Siwa zurückkehren lässt, siehe unten, S. nach Anm. 171.
163 BOSWORTH, „Errors“ (Anm. 160), 137f. (BOSWORTH, Conquest and Empire [Anm. 1], 74) führt als Argument gegen die Version des Ptolemaios an, dass die Quellen zu einer späteren Gründung wegen des „weight of evidence“ für die Version des Aristoboulos sprächen. Inhaltliche Gründe spielen dabei keine Rolle.
164 BOSWORTH, „Alexander“ (Anm. 1), 867; BOSWORTH, Conquest and Empire (Anm. 1), 246, führt zudem an, dass Alexander mit der Gründung diejenige von Philippi durch seinen Vater übertreffen wollte. Einen Quellenbeleg oder entsprechende Hinweise gibt es dafür nicht.
165 Vgl. hierzu DEMANDT, Alexander (Anm. 1), der die Gründung zunächst ausführlich bespricht (166–169), die Quellendiskussion zum Zeitpunkt der Gründung und zum Rückweg von Siwa dann aber mit einem ebenso knappen wie fragwürdigen „nihil interest“ abkürzt (179). Vgl. weiterhin etwa MCKENZIE, Architecture (Anm. 1), 39, die sich nicht auf eine Gründung vor oder nach dem Siwa-Aufenthalt festlegen möchte, durch diesen aber ein „local divine support“ sichergestellt sieht.
166 Iust. XI 11,1–10 (Siwa); 11,13 (Gründung); Curt. IV 7,6–7,32 (Siwa); 8,1–2 (Gründung). 167 Ps.-Kallisth. I 30,6: ἡξίου δὲ καὶ χρησµὸν λαβεῖν παπ᾿ αὐτοῦ, ποῦ κτίσει πόλιν κατὰ τὸ ὄνοµα
αὐτοῦ, ὅπως ἀειµνηµόνευτος µείῃ ἡ πόλις. Vgl. dazu EL-ABBADI, „Island of Pharos“ (Anm. 78), 259–267, sowie jetzt ERSKINE, „Imagination“ (Anm. 4), 177f.
Volker Grieb 208
setzung für das Auffinden eines geeigneten Ortes noch für die Stadtgründung, wie sie bei Curtius Rufus und Iustin fassbar ist, darstellt, bieten die Quellen letztlich auch kein überzeugendes Argument für eine erst später erfolgte Gründung. Sie lassen vielmehr die sich historisch aufdrängende Frage unbeantwortet, warum der Makedonenkönig erst auf dem Rückweg dort entweder zufällig vorbeigekommen sein soll oder aber auf dem Hinweg diesen für eine Stadtgründung ja anscheinend so geeigneten Ort unbeachtet gelassen habe, obwohl Alexander dort zuvor längere Zeit verweilte.168 Und auch kann Diodors Version, die gemeinhin diesem Überlieferungsstrang zugerechnet wird, letztlich nicht als Beleg für eine spätere Gründung angeführt werden. Zwar schildert dieser die Gründung nach dem Aufenthalt in Siwa, erwähnt dann aber einzig, dass Alexander in Ägypten beschlossen habe, eine große Stadt zu gründen, ohne allerdings den Zeitpunkt oder das Zeitverhältnis zum Siwa-Besuch zu bestimmen.169 Der gesamte Überlieferungsstrang einer erst auf den Siwa-Besuch folgenden Gründung bleibt vor dem Hintergrund der vorangehenden Betrach-tungen also ohne ein historisch belastbares Argument – zum 25. Tybi im folgenden.
Demgegenüber war Alexander – und das wiegt für sein weiteres Vorgehen argumentativ weitaus schwerer – mit dem Aufenthalt in Siwa und dem Orakelspruch ein wichtiger Baustein seiner zukünftigen pharaonischen Legitimation zuteil geworden,170 um deren Ausgestaltung es im folgenden ging, nicht zuletzt um den im Vergleich zur Stadtgründung nun deutlich wichtigeren Aspekt der Herrschaftssicherung und Herrschaftsorganisation in Ägypten voranzutreiben. Über allem ist freilich die weitere Verfolgung des Perserkönigs zu berücksichtigen, der bislang nicht endgültig besiegt war und somit sogar weiterhin als rechtmäßiger Pharao des Nillandes hätte angesehen werden können. Man wird in diesem Sinne also durchaus einer der beiden von Arrian überlieferten Angaben zum Rückweg folgen müssen: nach Ptolemaios auf anderem Wege nach Memphis, nach Aristoboulos hingegen auf dem gleichen Wege wie auf der Hinreise.171 Letztere Angabe ist dann aller-dings in dem von Arrian grundsätzlich angeführten Sinne zu verstehen, dass nämlich der Weg zurück zwar dem Hinweg entsprochen habe, dieser aber nicht mehr im Zusam-menhang mit der Stadtgründung stand; dies schließt die konsequente Darstellung Arrians
!168 Nach Curtius hatte Alexander auf dem Hinweg an der Küste bereits Gesandte aus Kyrene getroffen.
Auf dem Rückweg sei ihm dann die Beschaffenheit des Ortes in der Gegend von Pharos aufgefallen, wo er die Stadt zu gründen beabsichtigte. Iust. XI 11 berichtet nur über den Rückweg von Siwa. BOSWORTH, Conquest and Empire (Anm. 1), 72, interpretiert den ersten Aufenthalt dahingehend, dass „for the moment he [sc. Alexander] did no more than decide upon a new city“.
169 Diod. XVII 51,4–52,1: ὁ δ’ Ἀλέξανδρος ἡσθεὶς ἐπὶ τοῖς κεχρησµῳδηµένοις καὶ τὸν θεὸν µεγαλο-πρεπέσιν ἀναθήµασι τιµήσας ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Αἴγυπτον. Κρίνας δ’ ἐν ταύτῃ πόλιν µεγάλην κτίσαι προσέταξε τοῖς ἐπὶ τὴν ἐπιµέλειαν ταύτην καταλειποµένοις ἀνὰ µέσον τῆς τε λίµνης καὶ τῆς θαλάσσης οἰκίσαι τὴν πόλιν. Vgl. XVII 52,7, wonach er Freunde mit der Anlage von Alexandreia betraute und, nachdem er sämtliche Angelegenheiten in Ägypten geregelt hatte, nach Syrien zurückkehrte. Auch hierin ist kein Zeitverhältnis zum Siwa-Aufenthalt ausgedrückt.
170 Dazu der Beitrag von Stefan Pfeiffer im vorliegenden Band. 171 Arr. an. III 4,5: καὶ ἀκούσας ὅσα αὐτῷ πρὸς θυµοῦ ἦν, ὡς ἔλεγεν, ἀνέζευξεν ἐπ’ Αἰγύπτου, ὡς
µὲν Ἀριστόβουλος λέγει, τὴν αὐτὴν ὀπίσω ὁδόν, ὡς δὲ Πτολεµαῖος ὁ Λάγου, ἄλλην εὐθεῖαν ὡς ἐπὶ Μέµφιν. P. M. FRASER, „Current Problems Concerning the Early History of the Cult of Sarapis“, Opuscula Atheniensia 7 (1967), 30 Anm. 27 mit alternativen Routen für einen Rückweg, der nicht über Alexandreia führte; dazu weiterhin SEIBERT, Eroberung des Perserreiches (Anm. 157), 86. Gegen die Version des Ptolemaios WELLES, „Discovery“ (Anm. 78), 272–274.
Zur Gründung von Alexandreia 209
mit dem Verweis auf seine Quellen und der klaren Aussage einer Gründung vor dem Siwa-Aufenthalt aus. Ohnehin hätte Alexander selbst nach einer baldigen Rückkehr an den Ort der späteren Stadt dort kaum mehr vorfinden können als eine – im Wortsinne – große Strichzeichnung der Stadt im Gelände mit möglicherweise gerade begonnenen ersten Bau-maßnahmen.172 Strategische oder herrschaftspolitische Gründe, nochmals an der Küste zu verweilen, bieten die Quellen nicht.173
Als einziger Anhaltspunkt für eine erst nach Siwa erfolgte Gründung bliebe somit das im Alexanderroman überlieferte traditionelle Gründungsdatum 25. Tybi (=7. April), für das sich ein plausibler historischer Zusammenhang aber nur dann ergibt, wenn man den von Bosworth vorgeschlagenen zweimaligen Aufenthalt vor Ort annimmt. Das hierfür notwendig vorauszusetzende übergeordnete Interesse Alexanders an der Gründung ist jedoch anhand der vorliegenden Quellen nicht zu belegen und vielmehr offensichtliche spätere Konstruktion (s.o.). Auch wiegen die herrschaftsorganisatorischen Aspekte, die sich aus dem Siwa-Besuch für Alexander ergaben, und die übergeordnete Zielsetzung eines zukünftig noch zu erringenden Sieges über Dareios argumentativ deutlich schwerer und entsprechen ganz der Version von Arrian mit einem zielstrebigen Rückweg nach Memphis, weshalb ein nochmaliger Aufenthalt zur weiteren urbanen Ausgestaltung im westlichen Nildelta gerade nicht überzeugt. Dass mit dem 25. Tybi ein Datum vorliegt, das einer späteren Tradition entstammt, lässt sich weiterhin wahrscheinlich machen, wenn man die einzige zeitgenössische Quelle zur Gründung stärker in den Vordergrund rückt: Nach Ps.-Aristoteles habe Alexander Kleomenes eben zunächst nur mit der Gründung beauftragt – Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως ἐντειλαµένου αὐτῷ οἰκίσαι πόλιν πρὸς τῇ Φάρῳ. Hiernach erscheint es vielmehr naheliegend, dass eine wie auch immer vorgenommene offizielle Gründung erst nach einer siegreichen Rückkehr aus dem Osten stattfinden sollte und zuvor in Alexanders Anwesenheit wohl nur eine konzeptionelle Ausgestaltung erfolgte.174 Grundsätzlich ist der Angabe von Ps.-Aristoteles jedenfalls ein hoher Quellenwert bei-zumessen, weil sie als eine von der Alexander-Geschichtsschreibung unabhängige zeitge-nössische Quelle gänzlich unverdächtig ist, bereits eine spätere Metropole voraussetzen und die Rolle des Makedonenkönigs bei der Gründung dementsprechend hervorheben zu wollen. Der Quellenwert dieser Angabe ist auch deshalb hoch einzuschätzen, weil Informa-tionen über eine neue und zentrale griechische Hafenstadt an der ägyptischen Küste auf überregionales Interesse insbesondere in den Handelsorten der Ägäiswelt gestoßen sein müssen und zugleich mit den Seefahrern eine schnelle, weite und unabhängige Verbreitung
!172 In diesem Sinne u.a. auch WILCKEN, Alexander (Anm. 4), 119; HUSS, Ägypten (Anm. 1), 72. Anders
Bosworth. Vgl. hinsichtlich der langen Bauzeit von Alexandreia die Einschätzung von GERKAN, Stadtanlagen (Anm. 130), 78; weiterhin HOEPFNER/SCHWANDNER, Haus und Stadt (Anm. 8), 314–317, allgemein zum langwierigen Bauvorgang bei Stadtgründungen.
173 Siehe dazu Kallisthenes FGrH 124 F 14, der Gesandte anführt, die vom Apollonorakel in Didyma und von der Sibylle in Erythrai kamen und bald nach Alexanders Rückkehr aus Siwa bei ihm in Memphis eintrafen, um ihm seine Gottessohnschaft zu bestätigen. Wegen des zeitlich gedrängten Ablaufes müssten diese Gesandten bereits vorher dorthin bestellt worden sein (HÖLBL, Ptolemäerreich [Anm. 1], 12), was ebenfalls eher für einen direkten Rückweg ohne abermaligen Aufenthalt an der Küste spräche.
174 HÖLBL, Ptolemäerreich (Anm. 1), 10 Anm. 4, hat zurecht und sehr treffend gefragt: „Muß Alexander beim Gründungsfest selbst anwesend, ja überhaupt noch in Ägypten gewesen sein?“
Volker Grieb 210
fanden. Ist also bei Ps.-Aristoteles erst von einer zukünftig vorzunehmenden Gründung die Rede, dürfte dies mit großer Sicherheit den tatsächlichen status quo der späteren Metropole zur Zeit ihres anfänglichen Ausbaus unter Kleomenes widerspiegeln. Ein offizielles Datum für die Feierlichkeiten zur Stadtgründung, das schließlich Aufnahme im Alexanderroman fand, von dem die historiographischen Quellen jedoch nichts berichten, obwohl (sic!) sie die Gründungsgeschichte und Alexanders Rolle mitunter offensichtlich an die spätere Bedeutung der Stadt als Mittelmeermetropole anpassten, scheint also auch im Kontext der zeitgenössischen Angabe von Ps.-Aristoteles nicht auf Alexanders Aufenthalt in Ägypten zurückzugehen und wird daher aller Wahrscheinlichkeit nach erst nach dem Tode des Makedonenkönigs etabliert worden sein.
5. Alexander als maßgeblicher Initiator der Stadtgründung? Abschließend sei auf die Frage eingegangen, wem die treibende Kraft hinter der Gründung der Stadt zugeschrieben werden kann, wenn die in den literarischen Quellen hervor-gehobene Rolle Alexanders, eine zukünftige Metropole gründen zu wollen, in wesentlichen Punkten zu relativieren und in der überlieferten Form vielmehr als nachträgliches literarisches Konstrukt zu verstehen ist. Peter Fraser hat zuletzt ausführlich dargelegt, dass die späteren Quellen den Stadtgründer Alexander in dieser Rolle allzu sehr in den Vordergrund rücken und dessen diesbezügliche Ambition wohl wesentlich geringer war.175 Auf seinem Eroberungszug bis zur Einnahme von Ägypten ist für den Makedonen nur eine Gründung sicher zu belegen, nämlich die Umwandlung eines bereits bestehenden Ortes in eine Stadt an dem für den griechischen Mythos zentralen Ort des trojanischen Krieges – nämlich Ilion.176 Nimmt man dies als Ausgangspunkt auch für eine Betrachtung der Quellen zur Gründung des ägyptischen Alexandreia, so ergibt sich ein naheliegendes alter-natives Szenario. Das von Curtius Rufus angeführte177 sowie in leichter Abwandlung auch von Plutarch178 und weiterer Ausschmückung dann im Alexanderroman179 überlieferte Interesse Alexanders an der Insel Pharos, die als Ort des Sehers Proteus ebenfalls in den homerischen Kontext fällt, korrespondiert in auffälliger Weise mit Alexanders Vorgehen in der Troas, indem in beiden Fällen also zunächst ein in der Fremde gelegener mythischer Ort der homerischen Epen im Mittelpunkt von Alexanders Interesse gestanden hätte.180 Legt
!175 FRASER, Cities (Anm. 5), 170–201, bes. 174f. zu Alexandreia in Ägypten. Die Quellen zur Gründung
des ägyptischen Alexandreia unterzieht Fraser vor diesem Hintergrund und hinsichtlich der darin angeführten Rolle Alexanders allerdings keiner eingehenderen Kritik.
176 Strab. XIII 1,26 (593), wonach Alexander an der Stelle des Dorfes Ilion eine Stadt gründete, für die er später einen weiteren Ausbau versprach: Ἀλέξανδρον δὲ ἀναβάντα µετὰ τὴν ἐπὶ Γρανίκῳ νίκην ἀναθήµασί τε κοσµῆσαι τὸ ἱερὸν καὶ προσαγορεῦσαι πόλιν καὶ οἰκοδοµίαις ἀναλαβεῖν προσ-τάξαι τοῖς ἐπιµεληταῖς ἐλευθέραν τε κρῖναι καὶ ἄφορον· ὕστερον δὲ µετὰ τὴν κατάλυσιν τῶν Περσῶν ἐπιστολὴν καταπέµψαι φιλάνθρωπον, ὑπισχνούµενον πόλιν τε ποιῆσαι µεγάλην καὶ ἱερὸν ἐπισηµότατον καὶ ἀγῶνα ἀποδείξειν ἱερόν. Dazu HAMMOND, „Newly-founded Cities“ (Anm. 5), 259f.
177 Curt. IV 8,1. 178 Plut. Alex. 26. 179 Ps.-Kallisth. I 30,7–8; 32,1. 180 Die Quellen zu Alexanders Religiosität sind zusammengestellt bei BERVE, Alexanderreich I (Anm.
5), 85–100; ein allgemeines Interesse an Orten wie Pharos bzw. der homerischen Tradition wird dadurch offensichtlich. Ebd. 90–92 mit der Bedeutung der Mantik für Alexander und den Feldzug,
Zur Gründung von Alexandreia 211
man eine solche ursprüngliche Motivation Alexanders auch für die Gründung des ägyptischen Alexandreia zugrunde, ließen sich gleich mehrere scheinbare Unstimmigkeiten in der Überlieferung auflösen. Alexander hätte demnach bei seinem Aufenthalt am Mareo-tissee naheliegenderweise das Heraklesheiligtum mit der namenstragenden Stadt Heraklei-on sowie den aus mythisch-historischer Sicht für die Griechen bedeutenden Küstenab-schnitt an der Mündung des kanopischen Nilarmes besucht. Als Parallele zu der überliefer-ten Neugründung von Ilion wäre es berechtigt, auch an der Küste des westlichen Nildeltas den Wunsch – nach Arrian sein innerer Drang (πόθος) – nach einer Stadtgründung zu unterstellen, die dort die berühmte Proteus-Insel einbeziehen sollte.181 Eine solche Inter-pretation berücksichtigt somit zunächst Alexanders bekannte Affinität zum Mythos, die einen wesentlichen Aspekt seiner persönlichen Motivation ausmachte.182 Für die Gründung einer Stadt von durchschnittlicher Größe hätte Pharos – wie dargelegt – auf jeden Fall ausreichend Platz geboten und zudem eine exponierte und für die Griechen weithin bekannte Lage besessen.183 Eine zunächst kleinere und stärker im griechisch-mythischen Kontext zu verstehende Stadtgründung würde neben den im westlichen Nildelta bestehen-den urbanen Alternativen auch die in den Quellen noch durchscheinende Diskussion über den genauen Ort der Gründung, deren Größe und Funktion erklären. Handels- und herr-schaftspolitische Faktoren der modernen Stadtplanung ganz im Sinne der Erfahrungen, die man mit den neuen urbanen Zentren in der südöstlichen Ägäis gemacht hatte, konnten freilich bei einer großen Lösung umfassender berücksichtigt werden und wären – im Gegensatz zur Neugründung von Ilion – vor allem den Bedingungen im nunmehr eroberten und für die griechische Welt auch wirtschaftlich umfangreicher zu öffnenden Nilland geschuldet gewesen.184 Mit Deinokrates von Rhodos und Kleomenes von Naukratis sind
!die, wie Berve überzeugend hervorhebt, aufgrund der charakteristischen Häufung der Belege gerade für die erste Phase des Feldzuges keine spätere literarische Erfindung sein könne. In diesem Kontext wäre dann auch Alexanders Interesse an der Insel Pharos zu verstehen, die eben Ort des Sehers Proteus aus den homerischen Epen war.
181 Arr. an. III 1,5 mit dem inneren Drang. Ein Überblick über die umfangreiche Literatur zu dieser Eigenschaft Alexanders bei SEIBERT, Alexander (Anm. 1), 183–186; S. LAUFFER, Alexander der Große, München 1978, 22 mit Anm. 6; 203–205 mit Anm. 7. Zu Proteus und Pharos siehe jetzt auch EL-ABBADI, „Island of Pharos (Anm. 78), 259–267, der zwar das in den Quellen geschilderte Auffinden des geeigneten Platzes durch Alexander relativiert, Alexanders Wunsch, gerade auf der Insel Pharos eine Stadt gründen zu wollen, aber nicht weiter diskutiert.
182 Z.B. Arr. an. III 3,1–2; siehe besondere I 11–12 (zu Ilion). Vgl. allgemein E. FREDRICKSMEYER, „Alexander’s Religion and Divinity“, in: J. Roisman (Hrg.), Alexander the Great, Leiden/Boston 2003, 253–278; B. DREYER, „Heroes, Cults, and Divinity“, in: W. Heckel, L. A. Tritle (Hrgg.), Alexander the Great. A New History, Oxford 2009, 218–234 (jeweils mit weiterer Literatur). Alexanders Affinität zu Sagengestalten wird nicht zuletzt durch seine nach Issos geprägten Tetra-drachmen offensichtlich, die ihn als Herakles zeigen: LE RIDER, „Rôle monétaire“ (Anm. 54) 12, was auch Alexanders Besuch des Herakles-Heiligtums von Herakleion-Thonis nahelegen würde.
183 Siehe oben, S. 194–196 mit Anm. 110. 184 Die in der Forschung mehrfach vorgebrachte, jedoch nicht auf Quellenbelegen beruhende Über-
legung, Alexandreia habe in seiner ursprünglichen Konzeption die vorangehende Funktion von Tyros ersetzen sollen, überzeugt nicht. Sie ist deshalb kaum naheliegend, weil mehrere und hinsichtlich ihrer Verkehrsanbindung an die Handelswege des dortigen Hinterlandes deutlich besser gelegene Orte an der Levanteküste weiterhin bestanden. Es ergibt wenig Sinn, Handelsgüter aus dem Hinter-land der (südlichen) Levanteküste zunächst umständlich an den Rand des westlichen Nildeltas zu bringen, um sie dann auf den Schiffsrouten in die Ägäis doch wieder entlang der Levanteküste zu
Volker Grieb 212
jedenfalls in der Überlieferung gerade zwei zentrale Persönlichkeiten an Gründung und Ausbau beteiligt, die gewissermaßen stellvertretend für die moderne zeitgenössische Stadt-planung bzw. Handelsinteressen im östlichen Mittelmeerraum stehen können.185 In jedem Fall korrespondiert eine solche Interpretation der Quellen mit dem einzigen zeitgenös-sischen Beleg in Ps.-Aristoteles Oikonomika, wonach eine Gründung der Stadt von Alexan-der zunächst nur „beauftragt“ war und von Kleomenes umgesetzt werden sollte.186 Für Alexander braucht dies zunächst kaum mehr als ein weitgehend formaler Akt gewesen zu sein, zumal das Beispiel Ilion zeigt, dass der Makedonenkönig dieser Gründung erst in späterer Zeit eine größere Bedeutung beimaß, indem er nach (!) dem endgültigen Sieg über den Perserkönig einen weiteren, nun aber umfangreichen Ausbau zusicherte.187 Wenig überzeugend erscheint es jedenfalls, etwa mit William Tarn oder Brian Bosworth die anhand der Quellen sicher zu belegende Stadtgründung von Ilion weitgehend unberück-sichtigt zu lassen und davon auszugehen, dass Alexandreia Alexanders erste richtige Stadt-gründung gewesen sei, setzt dies doch bereits eine genaue Zielsetzung des Makedo-nenkönigs als bekannt voraus.188
!befördern. Für diesen Handel kann Alexandreia nicht als „neues“ Tyros geplant worden sein. Außer-dem bestand an der kanopischen Nilmündung mit Herakleion-Thonis bereits ein Umschlagplatz. Vgl. demgegenüber HÖGEMANN, „Alexandrea“ (Anm. 1), 533–558, der die griechischen Bezüge unbe-rücksichtigt lässt und die Einnahme von Tyros als Maßnahme eines Plans sieht, der in der Eroberung von Ägypten gipfelte (554). Ebenfalls mit Alexandreia als Nachfolgerin von Tyros als Tor des Orients etwa TARN, Alexander I (Anm. 2), 41f.; SEIBERT, Alexander (Anm. 1), 112 (mit weiterer älterer Literatur); GREEN, Alexander (Anm. 1), 270f.; DEMANDT, Alexander (Anm. 1), 166. Zurückhaltender etwa EHRENBERG, Alexander (Anm. 1), 23.
185 Wenig überzeugend hierzu BROWN, „Deinokrates“ (Anm. 4), die Deinokrates zum Mitgründer der Stadt macht (ebd. 238), nahezu alle urbanistischen Ausgestaltungen von Alexandreia Deinokrates selbst zuschreibt und urteilt: „To conceive of such a city, to invent this complex configuration, took a power of projection and an imaginative overview, both physical and economic. To bring it to realization and make it function took an ambitious, vigorous, massive intervention with nature and, correlatively, a massive work force.“ (S. 239). Ein Blick auf die vorangehende urbanistische Ent-wicklung in der südöstlichen Ägäis – bei Brown unerwähnt – lässt eine solche Einschätzung deutlich relativieren.
186 Ps.-Arist. oik. II 33c (1352a29–30): Ἀλεξάνδρου <τε> τοῦ βασιλέως ἐντειλαµένου αὐτῷ [sc. Kleomenes] οἰκίσαι πόλιν πρὸς τῇ Φάρῳ (...).
187 Strab. XIII 1,26 (593) (Textzitat oben, Anm. 176). Inkonsequent bleiben mitunter solche Forschungs-positionen, die Alexander einerseits im Sinne der späteren Quellen ein nachdrückliches Interesse an der Stadt und besondere persönliche Ambitionen zuweisen, dann allerdings mögliche Pläne, diese Stadt hätte (s)eine Hauptstadt in einem auch nach Westen noch zu erweiternden Reich werden sollen, als unzutreffend ansehen (z.B. GREEN, „Alexandria“ [Anm. 1], 18, gegen EHRENBERG, Alexander [Anm. 1]). Folgt man der ersten – entsprechend dem Vorangehenden jedoch abzulehnenden – Inter-pretation, müsste man freilich auch konstatieren, dass das ägyptische Alexandreia mit der Ausnahme von Ilion im Westen seine einzige Gründung blieb und sogar die größte und eindrucksvollste Neu-gründung überhaupt hätte werden sollen, also eine zentrale Rolle für den Westen seines Reiches somit nicht ganz von der Hand zu weisen wäre.
188 Das ägyptische Alexandreia als erste richtige Gründung von Alexander bei TARN, Alexander II (Anm. 2), 233; FRASER, Cities (Anm. 5), 65; BOSWORTH, Conquest and Empire (Anm. 1), 245; weiterhin etwa HORNBLOWER, Greek World (Anm. 157), 302. Zurückhaltender hingegen TSCHERIKOWER, Städtegründungen (Anm. 5), 142. Diese Interpretation wirft die Frage auf, welche Merkmale eine richtige Stadtgründung Alexanders besitzen musste. Einer in dieser Hinsicht unver-dächtigen Angabe wie der von Strabon zu Ilion sollte durchaus ein hoher Quellenwert zukommen.
Zur Gründung von Alexandreia 213
Ein nachdrückliches Interesse für die Anlage eines großen griechischen Hafenortes an der ägyptischen Küste dürften demgegenüber freilich diejenigen Griechen des Nildeltas gehabt haben, die in Handelsgeschäften im östlichen Mittelmeer involviert waren, da der bisherige port of entry Herakleion-Thonis eine ägyptische Stadt war189 und das griechische Naukratis – wie zuvor die alten lokalen Zentren in der südöstlichen Ägäis – für den Über-seehandel geographisch allzu weit abseits der Seehandelsrouten lag. In jedem Fall wird man für die Griechen im Nildelta voraussetzen können, dass ihnen sowohl der Erfolg und die Möglichkeiten der rhodischen Neugründung als auch insgesamt die stärkere Orientierung von Hafenstädten an Hauptverkehrsrouten und damit der strukturelle urbane Wandel in der Südostägäis bekannt waren. Es ist aus dieser Perspektive wenig überraschend, dass mit Kleomenes gerade ein Grieche aus dem alten griechischen Handelszentrum Naukratis belegt ist, der einerseits von Alexander zum obersten Finanzverwalter des Nillandes einge-setzt, auch mit dem Ausbau der Neugründung beauftragt wurde190 und der andererseits bereits kurz darauf mit umfangreichen Handelsverbindungen im östlichen Mittelmeer, u.a. mit Zwischenhändlern in Rhodos-Stadt, belegt ist.191 Dass Kleomenes aus athenischer Sicht dabei in ein negatives Licht gestellt wird, weil er für athenische Getreidehändler (und damit eine ausreichende Getreideversorgung Athens) eine veritable Konkurrenz darstellt,192 bestä-tigt in diesem Fall seinen handelspolitischen Einfluss im östlichen Mittelmeer nachdrück-
!HAMMOND, „Newly-found Cities“ (Anm. 5) hat zuletzt darauf verwiesen, dass vielleicht doch mehr als nur die von FRASER, Cities (Anm. 5), 201, angeführten sechs oder die von TARN, Alexander II (Anm. 2), 237, angeführten 13 Gründungen auf Alexander zurückgegangen sein könnten. Dies erscheint insofern möglich, wenn man einige unsichere Alexander-Gründungen im Osten als Alexanders Versprechen für zukünftig zu gründende Städte versteht, die erst von seinen Nachfolgern (im Sinne von Strab. XIII 1,26 [593]) eingelöst wurden bzw. werden sollten. Das Beispiel Ilion muss hiervon allerdings faktisch und methodisch ausgenommen werden und kann als tatsächliche Gründung gelten, da ausdrücklich überliefert ist, dass Alexander die Gründung am alten Ort Ilion beauftragte und dort Weihungen vornahm, nach dem Sieg über die Perser dann versprach, die Stadt sogar umfangreicher auszubauen, wobei letzteres allerdings erst von Lysimachos umgesetzt wurde.
189 Allgemein zur ägyptischen Hafenorganisation vor Alexander siehe D. FABRE, Le destin maritime de l’Égypte ancienne, London 2004, 133–142.
190 Dazu und zu Kleomenes in Ägypten siehe Arr. an. III 5,4; Ps.-Kallisth. I 31; Iul. Val. I 25–26; Curt. IV 8,5; Iust. XIII 4,11; Ps.-Arist. oik. II 33c (1352a29–1352b4); F. STÄHELIN, RE XI.1 (Stuttgart 1921), Sp. 710–712, s.v. Kleomenes (8).
191 [Dem.] or. 56,7–8 mit Ps.-Arist. oik. II 33a, (1352a16–23). Kleomenes kann diese Handelsver-bindungen kaum erst seit Alexanders Aufenthalt in Ägypten etabliert haben und wird daher aller Wahrscheinlichkeit nach bereits früher in Handelsgeschäften des östlichen Mittelmeeres involviert gewesen sein.
192 Kleomenes von Naukratis ist in der Forschung unterschiedlich beurteilt worden: Gegen das überwiegend negative Urteil über ihn in den Quellen hat J. SEIBERT, Untersuchungen zur Geschichte Ptolemaios I., München 1969, 39–51, argumentiert; dagegen aber J. VOGT, „Kleomenes von Nau-kratis, Herr von Ägypten“, Chiron 1 (1971), 153–157. Zu den handelspolitischen Zusammenhängen der Zeit und Kleomenes’ Rolle siehe H. KLOFT, „Kleomenes von Naukratis. Probleme eines hellenistischen Wirtschaftsstils“, Grazer Beiträge 15 (1988), 191–222, sowie G. LE RIDER, „Cléomène de Naucratis“, BCH 121 (1997), 71–93. Vgl. R. ZOEPFFEL, Aristoteles. Oikonomika. Schriften zu Haus und Finanzwesen. Übersetzt und erläutert von R. Zoepffel, Darmstadt 2006, 626–629. Ein skrupelloser Kleomenes zuletzt wieder bei PFEIFFER, „Trade Activities“ (Anm. 42), 20. Mit einer ausgewogenen Beurteilung von Kleomenes Rolle in Ägypten B. LEGRAS, „Καθάπερ ἐκ παλαιοῦ. Le statut de l‘Égypte sous Cléomène de Naucratis”, in: J.-Ch. Couvenhes, B. Legras (Hrgg.), Transferts culturels et politique dans le monde hellénistique, Paris 2006, 83–101.
Volker Grieb 214
lich und ist vor allem vor dem Hintergrund einer zunehmenden Handelskonkurrenz zu verstehen, die sich mit der Öffnung Ägyptens weiter verstärkte, zugleich aber auch in ihrer regionalen Gewichtung verschob. Es liegt insofern nahe anzunehmen, dass eine in Handels-geschäften des östlichen Mittelmeeres wichtige Person wie Kleomenes auch ein nachdrück-liches Interesse an einem im Vergleich zu Piräus oder Rhodos-Stadt für Händler ähnlich vorteilhaften Hafenort an der Mittelmeerküste des westlichen Nildeltas besaß, stärkte dies doch im zeitgenössischen Machtgefüge des östlichen Mittelmeerraumes gerade auch seine persönlichen Möglichkeiten.193
Die Städte der südöstlichen Ägäis und allen voran die Rhodier, die in spätklassischer Zeit nach Lykurgs Aussage Handel in der gesamten bewohnten Welt trieben,194 dürften ebenfalls ein hervorgehobenes Interesse an einer großen Lösung Alexandreia besessen haben. Diesen Orten kam bereits vor Alexanders Zeit jede weitere Öffnung Ägyptens für den Absatzmarkt der Ägäis zugute, da – wie dargelegt – eine effektive Handelsschiffahrt in jedem Fall am Knotenpunkt der südöstlichen Ägäis und entsprechend an den neuen Zentren vorbeiführen musste. Einem weiteren, bislang noch nicht angesprochenen nautischen Aspekt kommt hierbei eine wesentliche Bedeutung zu: Die mitunter angeführten zeitlichen Beschränkungen der antiken Handelsschiffahrt auf die Sommermonate im Sinne eines in den Wintermonaten bestehenden mare clausum sind keineswegs für das gesamte östliche Mittelmeer gleichermaßen vorauszusetzen. In dem Gebiet südlich beziehungsweise süd-östlich der Ägäis, also letztlich auf der Handelsroute zwischen Rhodos, Ägypten, der Levante und Zypern war es aufgrund der klimatischen Bedingungen möglich, innerhalb des Jahres deutlich länger Schiffahrt zu betreiben als in der nördlicher gelegenen Ägäis.195 Dies
!193 LEGRAS, „Cléomène“ (Anm. 192) hat zuletzt hinsichtlich der starken Position, die Kleomenes in
Ägypten besaß, überzeugend dargelegt, dass Kleomenes für Alexander „était bien placé pour connaître les principes fondamentaux de la monarchie pharaonique“ (99). Seine starke Position und die umfangreiche Kenntnis der herrschafts- und handelspolitischen Zusammenhänge in Ägypten boten freilich gerade für den Ausbau von Alexandreia und Kleomenes’ Handelsaktivitäten im öst-lichen Mittelmeer, die Legras jeweils nicht weiter diskutiert, hervorragende Voraussetzungen. Inwieweit Baumaßnahmen, die unter ihm durchaus bereits begonnen worden sein konnten, in der späteren Überlieferung seinem prominenten Nachfolger Ptolemaios I. zugeschrieben wurden, muss offen bleiben; siehe dazu die von Tac. hist. IV 83 knapp erwähnte Ausgestaltung unter dem ersten Ptolemaier.
194 Lyk. Leok. 15. Rhodos als wichtiges Handelszentrum in den 320er Jahren: zuletzt GABRIELSEN, „Rhodes and the Ptolemaic Kingdom“ (Anm. 153), 77. Siehe zum Umlauf des rhodischen Geldes als einem Indikator für den Handel und die Bedeutung der Stadt in dieser Zeit R. DESCAT, „Aspects d’une transition: l’économie du monde égéen (350–300)“, in: P. Briant, F. Joannès (Hrgg.), La transition entre l’empire achéménide et les royaumes hellénistiques (vers 350–300 av. J.-C.), Actes du colloques Paris 2004, Paris 2006, 364f.
195 Der zentrale Quellenbeleg ist [Dem.] or. 56,29–30 zur Handelsschiffahrt zwischen Alexandreia und Athen, wobei die Strecke von Alexandreia nach Rhodos im Gegensatz zu derjenigen weiter nach Piräus das gesamte Jahr zu befahren war: οἱ γὰρ ἐκ τῆς Αἰγύπτου δανείσαντες τούτοις ἑτερόπλουν τἀργύριον εἰς Ἀθήνας, ὡς ἀφίκοντο εἰς τὴν Ῥόδον καὶ τὴν ναῦν ἐκεῖσε οὗτοι κατεκόµισαν, οὐδὲν οἶµαι διέφερεν αὐτοῖς ἀφεµένοις τῶν τόκων καὶ κοµισαµένοις τὸ δάνειον ἐν τῇ Ῥόδῳ πάλιν ἐνεργὸν ποιεῖν εἰς τὴν Αἴγυπτον, ἀλλ’ ἐλυσιτέλει πολλῷ µᾶλλον τοῦτ’ ἢ δεῦρ’ ἐπαναπλεῖν. ἐκεῖσε µέν γε ἀεὶ ὡραῖος ὁ πλοῦς, καὶ δὶς ἢ τρὶς ὑπῆρχεν αὐτοῖς ἐργάσασθαι τῷ αὐτῷ ἀργυρίῳ· ἐνταῦθα δ’ ἐπιδηµήσαντας παραχειµάζειν ἔδει καὶ περιµένειν τὴν ὡραίαν. ὥστ’ ἐκεῖνοι µὲν οἱ δανεισταὶ προσκεκερδήκασιν καὶ οὐκ ἀφείκασι τούτοις οὐδέν. Das Zollregister in den Elephantine-Papyri (1. H. 5. Jh. v.Chr.) verzeichnet für einen unbekannten ägyptischen Hafen
Zur Gründung von Alexandreia 215
wiederum ließ der südöstlichen Ägäis in einem sich überregional stärker ausprägenden Handelsraum des gesamten östlichen Mittelmeerraumes zusätzliche Bedeutung zukommen, indem die dortigen Städte zugleich auch als Stapelorte fungieren konnten, die über einen Teil des Jahres gewissermaßen den Endpunkt für die weiteren Handelsrouten in die zentrale und nördliche Ägäis darstellten. Aus handelspolitischer Sicht gab es demnach bereits mit den Eroberungen von Alexander bis zum Jahre 332 v.Chr., sofern diese dauerhaft zu sichern waren, kaum einen größeren Handelsprofiteur als die Region um Rhodos, Kos und das angrenzende kleinasiatische Festland.196 Ein zentraler und im Sinne der griechischen Handelsschiffahrt organisierter Hafenort an einem aus jener Region gut erreichbaren Ort an der ägyptischen Küste dürfte insofern im Interesse der südostägäischen Städte gewesen sein, weil damit eine weitere Erleichterung, bessere Planbarkeit und effektivere Nutzung des bestehenden ägyptischen Handelspotentials möglich wurde.197 Handelsfahrten entspre-
!eingehende und ausgehende Schiffe aus dem östlichen Mittelmeer vornehmlich zwischen März und Dezember (BRIANT, DESCAT, „Registre douanier“ [Anm. 53], 79–81); vgl. dazu Pind. Isth. 2,40–42; Heliod. Aithiopika V 18,2; extrapolierend HORDEN/PURCELL, Corrupting Sea (Anm. 26), 565. In der Praxis war der Schiffverkehr in den Wintermonaten (v.a. Januar/Februar) auf der Route Rhodos–Alexandreia zwar möglich, wegen häufig durchziehender Tiefdruckgebiete und den einhergehenden unstetigeren Windbedingungen jedoch mit größeren Risiken verbunden und daher insgesamt wohl deutlich geringer als in der Herbst- und Frühjahrszeit. Vgl. dazu FABRE, Destin (Anm. 189), 22f. Dass die Seefahrt im Winterhalbjahr allgemein ruhte, vertritt – in Anlehnung z.B. an Vegetius (mil. IV 39) – etwa noch J. ROUGÉ, La marine dans l’antiquité, Paris 1975, 22f. Zur Problematik CASSON, „Mediterranean Communications“ (Anm. 61), 514; ARNAUD, Navigation antique (Anm. 21), 15f. Vgl. dazu die Literatur oben, Anm. 24, sowie M. ZIMMERMANN, „Die lykischen Häfen und die Handelswege im östlichen Mittelmeer. Bemerkungen zu PMich I 10“, ZPE 92 (1992), 201–216, hier 213 mit Anm. 61 (zur philologischen Interpretation der Angabe von Demosthenes).
196 Vgl. dazu den Athener Parmeniskos, der in den 320er Jahren und im Zusammenwirken mit Kleomenes seine Operationsbasis von Athen nach Rhodos verlegte, zuvor aber bereits auf der Strecke Athen–Ägypten tätig war [Dem.] or. 56,8–10.
197 Wenngleich die bisherigen geophysikalischen Prospektionen und unterwasserarchäologischen Arbeiten im ägyptischen Herakleion-Thonis zeigen, dass dieser Ort größere Hafenanlagen besaß und insofern auch weiterhin als zentraler Anlaufpunkt im Nildelta hätte genutzt werden können, entsprach diese Hafenstadt im Vergleich zum moderneren Rhodos-Stadt und den sich am späteren Ort Alexandreia ergebenden Möglichkeiten offensichtlich nicht den zeitgenössischen Anforderungen. Das grundsätzliche Problem, einen versandungsfreien und großen Hafen anzulegen, blieb für Herakleion-Thonis wegen seiner Lage an der Nilmündung evident. Vgl. dazu die Ergebnisse der geophysikalischen und archäologischen Surveys in GODDIO, „Two Egyptian Emporia“ (Anm. 105), 124–129; dort v.a. mit den engen Hafeneinfahrten vom Kanopischen Nil, der durchaus kleinteiligen Hafentopographie sowie der Versandungsproblematik. Vgl. allgemein zu diesem Emporion FABRE, Destin (Anm. 189), 60–62. Den durchaus bestehenden Vorteil einer sicheren Anlaufstelle bei Kap Zephyrion nahe Kanopos bei nordwestlichen Winden hebt demgegenüber zurecht BERNAND, Alexandrie (Anm. 1), 28–31, hervor, wohingegen die Bucht von Rhakotis ohne die späteren Molen gegenüber solchen Winden weitgehend offen lag; ebd. 40f. zu den Hafenanlagen von Alexandreia. Eine aktuelle Hafentopographie von Alexandreia in GODDIO, „Two Egyptian Emporia“, 130–134 (mit älterer Literatur); A. BERNAND, F. GODDIO, L’Égypte engloutie, Alexandria/London 2002, 146–163. Vgl. auch F. GODDIO et al. (Hrgg.), Alexandria. The Submerged Royal Quarters, London 1998, bes. 1–58 zu den Ergebnissen der Hafenprospektionen und –surveys. Siehe auch M. CLAUSS, „Claustra Aegypti. Alexandria und seine Häfen“, Millenium 2 (2005), 297–328 (epochen-übergreifend). Grundsätzlich fraglich bleiben muss, welche Einrichtungen, die Strabon für das 1. Jh. v.Chr. in seiner ausführlichen Beschreibung von Alexandreia erwähnt, bereits im Gründungskonzept vorgesehen waren bzw. alsbald umgesetzt wurden. Vereinzelte Funde wohl von Hafeninstallationen,
Volker Grieb 216
chend den naturräumlichen Möglichkeiten, in diesem Fall den nautisch effektiven Strecken im östlichen Mittelmeerraum, also von der südöstlichen Ägäis, über Ägypten, die Levante, Zypern und zurück zur südöstlichen Ägäis, waren damit häufiger innerhalb eines Jahres möglich,198 zumal sich auch im regionalen Bereich des östlichen Mittelmeerraumes, der mit der Eroberung durch Alexander erstmals überhaupt unter einer einzigen Oberherrschaft stand, per se vielfältigere Handelsmöglichkeiten ergaben.
Selbst wenn man Alexander und seinem makedonischen Beraterstab eine nachdrück-liche Initiative bei der Gründung zugestehen möchte, führt dies im größeren Kontext doch sogleich immer auch zu dem Ergebnis, dass die Makedonen mit der Anlage eines neuen Zentralortes dann eben nur auf die bestehenden Bedingungen im östlichen Mittelmeer reagiert und dadurch sowohl die bereits bestehenden Handelsstrukturen im östlichen Mittelmeerraum gestärkt als auch die städtischen Vorbilder in der südöstlichen Ägäis kopiert hätten. Gegen eine in dieser Hinsicht allzu nachdrückliche Initiative Alexanders spricht allerdings, dass der Makedone mit Kleomenes gerade einem einheimischen Griechen die Oberaufsicht über den Ausbau der Stadt und die Finanzverwaltung von Ägyp-ten zuwies, der sogleich persönlich von den neuen Möglichkeiten umfangreich profitieren konnte. Misst man also – was letztlich aufgrund ihrer detaillierten Kenntnis regionaler und überregionaler Bedingungen weitaus naheliegender erscheint – dem Personenkreis um Kleomenes von Naukratis sowie Protagonisten aus den südostägäischen Städten einen wesentlichen Impuls zur Gründung eines großen Handelsortes an der Küste des westlichen Nildeltas zu, so mag man in der schließlich umgesetzten Anlage der neuen Stadt viel eher Alexanders Fähigkeit erkennen, bestehende überregionale Zusammenhänge und Entwick-lungen in einer für die eigenen Machtinteressen förderlichen Weise zu nutzen. Dafür braucht Alexanders Entscheidungsgewalt über eine Gründung ebenso wenig in Frage gestellt zu werden wie die grundsätzlich ehrenvolle Rolle, die ihm als Stadtgründer zukam und die ihn – wie die Quellen und Forschungsinterpretationen zeigen – ohnehin als Prota-gonisten in die Überlieferung eingehen ließen.
!die nach dendrochronologischer Datierung aus der Zeit um 400 v.Chr. stammen, sind im Bereich von Antirhodos gemacht worden (dazu J. MCKENZIE, „Glimpsing Alexandria from Archaeological Evidence“, JRA 16 [2003], 35–63; hier 37); diese belegen zwar eine frühere Nutzung, jedoch ist dies aufgrund der Angabe von Strabon zu einem frühen ägyptischen Flottenstützpunkt kaum verwun-derlich.
198 Die aus dem Zollregister des 5. Jhs. v.Chr. bekannten Aufenthaltszeiten für den unbekannten Hafen im Nildelta betragen zwischen ein bis drei Wochen, wobei der längste Aufenthalt mit 26 Tagen verzeichnet ist (BRIANT, DESCAT, „Registre douanier“ [Anm. 53], 79f.). Für einen der im Register angeführten Schiffsführer, Glaphyros, ist belegt, dass er innerhalb eines Jahres zweimal im Hafen war. Nach der Abfahrt am 16. August kehrte er zwei Monate später, am 20. Oktober zurück und fuhr am Ende dieses Monats abermals ab. Legt man diese Aufenthaltszeiten zugrunde und geht davon aus, dass in der dazwischenliegenden Fahrtzeit von zwei Monaten die Route zur südöstlichen Ägäis und zurück nach Alexandreia auch mit mehreren Stationen in anderen Häfen zurückgelegt werden konnte (vgl. E. LIPINSKI, „Aramaic Documents from Ancient Egypt“, OLP 25 [1994], 61–68, hier 66f., der mit 20 Tagen auf dem Meer bis Rhodos rechnet), sind bei einem effektiven Hafenumschlag in einem großen Hafen Alexandreia bis zu vier Fahrten innerhalb eines Jahres zwischen der südöstlichen Ägäis und dem westlichen Nildelta problemlos möglich gewesen.
Zur Gründung von Alexandreia 217
6. Zusammenfassende Beurteilung Bereits vor Alexanders Eroberungszug gegen das Perserreich hatte sich im 4. Jh. v.Chr. in der südöstlichen Ägäis ein struktureller urbaner Wandel mit einer offensichtlichen Abkehr von den alten Siedlungsstrukturen vollzogen. Die neuen Zentren und Stadtanlagen orientierten sich mit ihrer Lage direkt an den überregionalen Schiffahrtsrouten, wobei die nautischen Bedingungen den Wandel und die Lage der neuen Zentren diktierten. Ein um-fangreicherer Handelsverkehr im östlichen Mittelmeerraum brachte mit sich, dass die aus griechischer Sicht zuvor eher periphere Region zu einem wichtigen Knotenpunkt im öst-lichen Mittelmeerraum wurde. Für die Fahrt aus südöstlicher Richtung in die Ägäis war die Passage vorbei an den neuen Zentren in nautischer Hinsicht weitgehend alternativlos. Die Rhodier, denen hierbei ohnehin die regionale Schlüsselposition zukam, reagierten mit der Anlage einer gänzlich neuen Großstadt in entsprechender Lage an der Nordspitze der Insel gleich in großem Maßstab auf die überregionalen Bedingungen und stießen damit gewis-sermaßen für die spätklassische Zeit einen urbanen Wandel an, der vergleichbar in anderen Regionen der griechischen Welt in dieser Form nicht stattfand. Die urbane Entwicklung der südöstlichen Ägäis, die bereits wesentliche Charakteristika von Alexandreia vorwegnimmt, bietet dabei mehrere Anknüpfungspunkte für eine Beurteilung des Gründungszusam-menhanges der späteren Nilmetropole, zumal schon vor Alexander jede weitere Öffnung Ägyptens für den Handel des östlichen Mittelmeerraumes insbesondere jene Ägäisregion profitieren ließ – dies lassen die nautischen Bedingungen sicher voraussetzen.
In der literarischen Überlieferung zur Gründung von Alexandreia wird allgemein Alex-ander die prominente Rolle zugeschrieben und dabei zumeist eine besondere persönliche Ambition zur Anlage einer zukünftigen Großstadt zum Ausdruck gebracht. Dass es sich in der vorliegenden Form jedoch um eine offensichtliche spätere literarische Konstruktion handelt, ist in mehrfacher Hinsicht zu erkennen und tritt am deutlichsten in den Passagen hervor, die das Auffinden des späteren Ortes, der unter Griechen auch unter topogra-phischen Gesichtspunkten weithin bekannt gewesen sein muss, Alexanders besonderem Wirken zuweisen. Mit einer notwendigen Relativierung dieser Passagen ist dement-sprechend auch die damit auf das Engste verknüpfte prominente Rolle Alexanders grund-sätzlich in Frage zu stellen und eine besondere Intention zur Schaffung einer zukünftigen Metropole, zu der Alexandreia ohnehin erst deutlich nach seinem Tod wurde, anhand der Quellen letztlich nicht zu belegen. Vielmehr stellt die spätere Überlieferung die Gründung in einer erkennbaren literarischen Vereinfachung dar, die an ein breites Publikum gerichtet war und in der Alexander offensichtlich die Hauptrolle einzunehmen hatte. Die zeitge-nössische urbane Situation im westlichen Nildelta lässt demgegenüber einen durchaus kom-plexeren Gründungszusammenhang erkennen, bei dem zunächst keineswegs die letztlich umgesetzte große Lösung Alexandreia angestrebt worden sein muss, zumal mit Herakleion-Thonis bereits ein wichtiger Hafenort an der Nilmündung bestand. Die in den Quellen noch deutlich fassbare Unsicherheit bei der Festlegung des zukünftigen Ortes kann einerseits mit den bestehenden Alternativen sowohl hinsichtlich der Größe als auch der Lage erklärt werden. Andererseits lassen die Quellen erkennen, dass Alexander selbst wohl ein persön-liches Interesse an einer Stadtgründung im mythischen Kontext (Pharos) gehabt zu haben scheint (v.a. Curtius Rufus) und damit eine Parallele zu der auf dem Perserzug bis dahin einzigen sicher zuweisbaren Gründung bestünde, nämlich derjenigen von Ilion. Eine im
Volker Grieb 218
Vergleich zu der späteren literarischen Konstruktion weniger prominenten Rolle Alexan-ders bei der Gründung des ägyptischen Alexandreia entspräche damit den ansonsten eher geringen urbanistischen Ambitionen des Makedonenkönigs, der, wie zuletzt die Unter-suchungen von Peter Fraser gezeigt haben, weder vor noch nach seinem Ägyptenaufenthalt als ehrgeiziger Stadtgründer aufgetreten ist.199 Alexanders Entscheidungsgewalt über Grün-dung und Gesamtkonzept der Stadt braucht dafür nicht infrage gestellt zu werden. Die konzeptionellen und funktionalen Bezüge der Neugründung zu den neuen Zentren der südöstlichen Ägäis sind in mehrerlei Hinsicht evident und lassen Alexandreia kaum als eine wie auch immer geartete konzeptionelle Neuschöpfung, sondern vielmehr als eine kon-sequente Fortführung des vorangehenden südostägäischen Städtebaus verstehen. Auch folgt die Neugründung den südostägäischen Vorbildern offensichtlich darin, dass ihre unmit-telbare Orientierung an der überregionalen Schiffahrtsroute die abseitigere bzw. ungüns-tigere Lage der älteren Handelszentren (Naukratis bzw. Herakleion-Thonis) hinter sich ließ. Mit dem erfolgreichen und zwei Generationen zuvor gegründeten Vorbild von Rhodos-Stadt, das in seinen urbanen Dimensionen nur wenig kleiner war als das zu gründende Alexandreia, dabei aber über ein deutlich kleineres Hinterland verfügte, konnte wenigstens im Kreise der Sachverständigen eine zukünftige Entwicklung der scheinbar großen neuen Stadt weitgehend sicher vorhergesehen werden. Es ist insofern wenig verwunderlich, dass mit Kleomenes von Naukratis und Deinokrates von Rhodos gerade zwei Personen als nam-hafte Protagonisten am Ausbau von Alexandreia beteiligt waren, die diese überregionalen handelspolitischen Zusammenhänge sowie die urbanistischen Details sicherlich fachgerecht einzuschätzen in der Lage waren. Von diesen bzw. entsprechenden Personen dürften wohl auch wesentliche Impulse für eine große Lösung Alexandreia ausgegangen sein200 – nicht zuletzt, weil gerade Kleomenes sowie die Städte der südöstlichen Ägäis von einem solchen neuen Handelsplatz besonders profitierten. Will man dennoch Alexander ein besonderes Interesse an der Gründung einer späteren Metropole zuweisen, führt dies letztlich nur zu dem Ergebnis, dass er mit dieser Maßnahme gerade Kleomenes bzw. die Städte der südöstlichen Ägäis gestärkt hätte.
Auf die Frage, wann die Gründung am Orte Rhakotis/Pharos während des Aufenthaltes in Ägypten erfolgte, bieten die Quellen, die dafür einen Zeitpunkt nach dem Siwa-Besuch angeben, letztlich kein belastbares Argument. Auch die von Bosworth vorgeschlagene Kombination der Quellen und ein zweimaliger Aufenthalt vor Ort überzeugen argumentativ nicht, weil dies ein nachdrückliches Bestreben Alexanders zur Gründung einer – aus Sicht der späteren Überlieferung – zukünftigen Metropole voraussetzt, das die Quellen bei genau-
!199 FRASER, Cities (Anm. 5). Anders zuletzt HAMMOND, „Cities“ (Anm. 5); vgl. HORNBLOWER, Greek
World (Anm. 157), 303–305. Dazu die Bemerkungen oben, Anm. 188. 200 Für die Gründung von Alexandreia wäre zu berücksichtigen, inwieweit Alexanders Aufenthalt in den
achaimenidischen Herrschaftszentren und ein allmähliches Bewusstsein, ein Weltreich erobert zu haben, auch eine Vorstellung einer zukünftigen Metropole im westlichen Nildelta und damit nun ganz im Westen des Reiches geprägt haben könnte. Im Falle von Ilion versprach er jedenfalls erst nach seinem Sieg über die Perser einen weiteren Ausbau seiner vorherigen Gründung (s.o.). Alexanders Anweisung an Kleomenes im Jahr 324, auf Pharos und im Stadtgebiet jeweils einen Tempel für den verstorbenen Hephaistion anzulegen (Arr. an. VII 23,6–8), bestätigt letztlich die hervorragende Bedeutung des mythischen Ortes Pharos für Alexander, kann aber in der Retrospektive nicht als Beleg für eine bereits anfänglich angestrebte große Lösung Alexandreia gelten.
Zur Gründung von Alexandreia 219
erem Hinsehen aber nicht belegen lassen. Ptolemaios’ Angabe einer direkten Rückkehr nach Memphis,201 eine weitere Herrschaftslegitimierung im Nilland und die anstehende Fortsetzung des Zuges gegen Dareios III. wiegen hierbei argumentativ deutlich schwerer. Mit Ps.-Aristoteles’ Angabe, dass Alexander Kleomenes zunächst nur mit der Gründung einer neuen Stadt beauftragte, liegt sodann eine zeitgenössische Quelle vor, die dieses Vorhaben in gänzlich unprätentiöser und glaubhafterer Weise als eine noch durchzu-führende Handlung schildert, die dementsprechend wohl erst nach Alexanders geplanter Rückkehr in den Mittelmeerraum vorgenommen werden sollte. Aus dieser Perspektive wird ersichtlich, dass das im Alexanderroman überlieferte traditionelle Gründungsdatum 25. Tybi (=7. April), von dem die historiographischen Quellen trotz ihrer späteren Aus-schmückung der Gründungsgeschichte nichts wissen, nicht auf den Aufenthalt Alexanders in Ägypten zu beziehen ist.
Im ostmediterranen Kontext und unter Berücksichtigung der vorangehenden urbanen Entwicklung in der südöstlichen Ägäis stellt die Gründung von Alexandreia letztlich keine überraschende Maßnahme dar und ist vielmehr als ein naheliegendes Vorgehen zu ver-stehen, für das mit der griechisch-makedonischen Eroberung des Nillandes die notwen-digen Voraussetzungen geschaffen wurden. Es drängt sich daher insgesamt der Eindruck auf, dass die seit archaischer Zeit bestehenden engen Verbindungen zwischen den Poleis der südöstlichen Ägäis und den Griechen im Nildelta, zuvor eben vor allem mit Naukratis, auch noch in spätklassischer Zeit eine nicht unbedeutende Rolle spielten,202 der voran-gehende urbane Wandel jener Region mit der Eroberung Ägyptens dorthin vermittelt wurde und aus der Anlage einer neuen Hafenstadt – wie in archaischer Zeit – ein eigener ökono-mischer Nutzen gezogen werden konnte. Die in der Forschung zurecht bestehende commu-nis opinio, dass aus der Öffnung Ägyptens durch Alexander und der Gründung von Alexandreia für die Städte der südöstlichen Ägäis eine wirtschaftliche Blüte resultierte, wäre also dahingehend zu ergänzen, dass die Gründung der Nilmetropole zunächst als eine konsequente Fortführung der urbanen Entwicklung in der südöstlichen Ägäis zu verstehen ist, die Poleis dieser Region also an den Voraussetzungen ihrer späteren urbanen Blüte einen nicht unerheblichen eigenen Anteil hatten.
!201 Oder alternativ in der von Aristoboulos überlieferten Weise auf dem vorherigen Wege, dann aller-
dings ohne weitere Umwege bzw. längere Aufenthalte nach Memphis. 202 Vgl. dazu A. BRESSON, „Rhodes, l’Hellénion et le statut de Naucratis (VIe–IVe siècle a.C.)“, DHA 6
(1980), 291–349; A. BRESSON, „Naucratis: de l’emporion à la cité“, Topoi 12/13 (2005) 133–155.