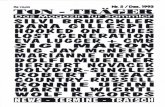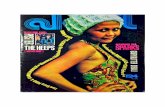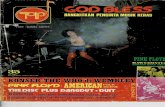Gesellschaftspolitische Argumente einer Artistenmetaphysik im Vorfeld der Geburt der Tragödie aus...
Transcript of Gesellschaftspolitische Argumente einer Artistenmetaphysik im Vorfeld der Geburt der Tragödie aus...
HECTOR JULIO P£REZ LÖPEZ
Gesellschaftspolitische Argumente einer Artistenmetaphysik im Vorfeld der Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik
Der vorliegende Aufsatz befaßt sich mit einem Text, in dem Nietzsche seine Vorstellung des griechischen Staates zum ersten Mal skizziert. Der Text befindet sich in Ursprung und Ziel der Tragödie, einer nichtveröffentlichten Schrift von 1871.1 Die Abhandlung enthält ver-schiedene Passagen, die später in der Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik er-scheinen sowie weitere Nachgelassene Fragmente} Die Betrachtungen über Politik und Kunst von Ursprung und Ziel der Tragödie sind bereits durch einen späteren Text, Der griechische Staat, bekannt. Hierzu liegen verschiedene Kommentare vor.3
Warum jetzt ein Kommentar zu einem Text, dessen Perspektiven bereits durch einen anderen Text aufgezeigt wurden? Thema dieses Aufsatzes ist das Verhältnis zwischen
1 Die Kenntnis dieses Textes sowie Hinweise auf seine Bedeutung für die Entstehungsgeschichte von Die Geburt der Tragödie verdanke ich der Studie von B. v. Reibnitz, Ein Kommentar zu Friedrich Nietzsche. „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik" (Kap. 1-12), Stuttgart 1992. Auch der Zugang zu dem Text in der Stiftung „Weimarer Klassik, Goethe-Schiller-Archiv", wurde mir durch die freundliche Unterstützung von Frau Barbara von Reibnitz erleichtert. Ich zitiere den Text nach einer maschinen-schriftlichen Kopie, die sich in der Stiftung „Weimarer Klassik" unter der Signatur GSA 72/2079 befin-det. Dieser Text wurde von Nietzsche in den ersten Wochen des Jahres 1871 als „Fragment einer erweiterten Form der .Geburt der Tragödie'" ausgegliedert und liegt als Fragment 10 [1], KSA 7, 333-349, gedruckt vor. Die angekündigte Veröffentlichung eines Teiles von Ursprung und Ziel der Tragödie (= UZ) war im Dezember 1996 in der Kritischen Gesamtausgabe (= KGW), Nachbericht zur III. Abteilung 5, Bd. I, hg. v. W. Groddeck u. M. Kohlenbach, 142-203. Zu diesem Zeitpunkt war die Arbeit an diesem Aufsatz fast abgeschlossen. Die Zitation nach der maschinenschriftlichen Kopie GSA 72/2079 habe ich beibehalten, weil diese den gesamten Text von UZ umfaßt und ich auch Teile der Abhandlung zitiere, die nicht in KGW erschienen sind. Bei KGW erscheinen die Kapitel 8-24 von UZ. Ggf. werde ich die in KGW und KSA veröffentlichten Teile parallel zitieren.
2 Sowohl die Beschreibung des Inhalts von UZ als auch die genaue Korrespondenz seiner verschiedenen Teile mit den anderen Texten seiner Produktion in dieser Zeit finden sich in B. v. Reibnitz, Ein Kom-mentar, 43-53.
3 Alle wichtigen Beiträge über die frühen politischen Vorstellungen Nietzsches befassen sich mit dem Text: Der Griechische Staat. Siehe vor allem B. v. Reibnitz, „Nietzsches .Griechischer Staat' und das Deutsche Kaiserreich", in: Der altsprachliche Unterricht 30 (1987), H. 3, 76-89; H. Ottmann, Philosophie und Politik bei Nietzsche, Berlin/New York 1987, 11-113; und G. Mattenklott, „Nietzsches Geburt der Tragödie als Konzept einer bürgerlichen Revolution", in: Positionen der literarischen Intelligenz zwischen bürgerlichen Reaktion und Imperialismus, Kronberg 1973,103-120. Vgl. auch dazu die Studie von J.-W. Lee, „Die mythische Rechtfertigung des Politischen: ,Der Griechische Staat'", in: Politische Philosophie des Nihilismus, Berlin/New York 1992, 173-185. Seine Interpretation stellt das Verhältnis zwischen Meta-physik und Politik in Anbetracht des späteren Werke dar.
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
102 Hictor Julio Perez Lopez
Nietzsches politischen Betrachtungen und seinen ästhetischen Ideen, die den Kern der Geburt der Tragödie darstellen. Man kann Der griechische Staat unter derselben Fragestellung betrachten, da die wesentlichen Äußerungen über Kunst und Politik aus UZ trotz aller Überarbeitungen geblieben sind.4 Gleichwohl besteht zwischen beiden Texten ein Unter-schied: UZ entsteht im Winter 1870/71. Der griechische Staat stellt getrennt nur die gesell-schaftspolitische Auffassung von UZ im Jahre 1872 dar, also nachdem Nietzsche bereits entschieden hatte, sie nicht in Die Geburt der Tragödie aufzunehmen.
Meine Entscheidung, mich mit einem Text aus dem Jahre 1871 zu befassen, ist vor dem Hintergrund zu verstehen, daß Nietzsche kurze Zeit zuvor die wichtigsten Aspekte seiner Artistenmetaphysik entwickelt hat. Die Reflexionen über Kunst und Politik sind Teil einer Schrift (UZ), die eine grundsätzliche Fassung der Artistenmetaphysik bietet, die später in der Geburt der Tragödie ausgeführt worden ist. Die Berücksichtigung der politischen Argu-mente im Kontext der Artistenmetaphysik im Rahmen von UZ bestimmt und stimuliert die im folgenden dargestellte Perspektive. Ziel dieses Aufsatzes ist die Rekonstruktion der Wirkungen, die die künstlerische Kosmodizee auf die Entstehung der gesellschaftspolitischen Betrachtungen über das alte Griechenland hat.
I. Ursprung und Ziel der Tragödie
Nietzsches Schrift begründet zwei Thesen, eine über die Gesellschaft, davon ausgehend, daß deren Struktur von einer privilegierten Stellung des Künstlers bestimmt ist, und eine weitere These über den Staat als eine Einrichtung, deren Ziel die Kunst ist.
a) Die sklavische Gesellschaft
Das erste Kapitel, in dem Nietzsche sich mit Politik beschäftigt, führt die Hauptthese über die Gesellschaftsstruktur im alten Griechenland ein.5 Nietzsche rechtfertigt das Sklaventum: Es wird als eine notwendige Bedingung für die Existenz der Kunst betrachtet. Er begründet seine Argumentation anhand des Begriffes Arbeit. In diesem Zusammenhang ist die Rede von dem Genie, das keine Arbeitstätigkeit ausübt. Der Figur des Genies stellt Nietzsche die des Sklaven gegenüber. Die Arbeit ist die kennzeichnende Tätigkeit des Sklaven. Sein Leben ver-geht nicht nur im Kampf um die eigene Existenz, er muß auch die für das Fortleben des Ge-nies notwendige Arbeit übernehmen: „Damit der Boden für eine grössere Kunstentwicklung vorhanden ist, muss die ungeheure Mehrzahl im Dienste einer Minderzahl über das Mass ihrer individuellen Nothwendigkeit hinaus der Lebensnoth sklavisch unterworfen sein." (UZ, 52; KGW, 146)
Die negative Kennzeichnung der Arbeit ist sehr deutlich. Einige Passagen betonen das Gefühl der Arbeiter einer Schmach zu unterliegen. Nietzsche behauptet, daß die Arbeit im
4 Der Griechische Staat ist das Ergebnis einer mehrfachen Überarbeitung der Kapitel über Politik und Ästhetik in UZ. Er wurde von Nietzsche als dritte der Fünf Vorreden zu flinf ungeschriebenen Büchern verfaßt und Cosima Wagner zu Weihnachten 1872 geschenkt.
5 In UZ entspricht das dem 8. Kapitel.
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
Gesellschaftspolitische Argumente einer Artistenmetaphysik 103
alten Griechenland eine schamhafte Aktivität war. Aber er hebt dieses Gefühl als eine positive Haltung der Griechen hervor. Den Begriff der „Würde der Arbeit" kritisiert er dagegen. Daß die Arbeit würdig ist, sei eine moderne betrügerische Illusion, deren Ziel es sei, die Wirklichkeit zu verbergen. Aus welchem Grund wird der Arbeit eine derart negative Bedeutung zugewiesen? „[...] bei ihnen [den Griechen] spricht sich rein aus, dass die Arbeit eine Schmach sei - nicht etwa weil das Dasein eine Schmach ist, sondern im Gefühl der Unmöglichkeit, dass der um das nackte Fortleben kämpfende Mensch Künstler sein könne." (UZ, 49; KGW, 144) Die Arbeit ist es, die den Menschen am Künstlersein hindert. Somit erscheint die Kunst als eine besondere Tätigkeit, die von jeder anderen getrennt ist.
Mit seiner Kritik an der „Würde der Arbeit" unterstellt Nietzsche der Kunst jene andere Möglichkeit des Menschen, aktiv zu werden. Alle anderen Aktivitäten bedeuten nichts, ihre einzige Wirkung ist das Gefühl von Schmach. An diesem Punkt zeigen die Argumente am deutlichsten den Radikalismus von Nietzsches Position. Das einzige, wodurch das mensch-liche Leben erhöht werden kann, ist die Kunst, so daß jede Handlung, jede materielle oder geistige Verbesserung des Lebens nicht wesentlich ist, wenn sie nicht auf die Entwicklung der Kunst zielt. Deshalb kann Arbeit nur positiv für die Kunst sein, wenn der Sklave auch die Arbeit des Genies übernimmt, damit dieses den Kampf um das Fortleben vergessen kann. Der Charakter dieser Trennung ist so absolut, daß Nietzsche sogar zwischen dem künstlerischen Schaffen und der für dieses Schaffen erforderlichen Arbeit unterscheidet: „Das künstlerische Schaffen fällt für den Griechen ebenso unter den unehrwürdigen Begriff der Arbeit, wie jedes banausische Handwerk. [...] Dasselbe Gefühl mit dem der Zeugungs-akt als etwas schamhaft zu verbergendes betrachtet wird, obwohl in ihm der Mensch einem höheren Ziele dient als seiner individuellen Erhaltung." (UZ, 50 f.; KGW, 145 f.)
Der Sklave hat jedoch das unbewußte Wissen, daß sein Sklaventum notwendig ist: Damit das Schöne existieren kann, muß es als Vorbedingung ein schmerzhaftes Fundament geben. Das ist die Dialektik, die Nietzsche in verschiedenen Perspektiven in der Geburt der Tragö-die entwickelt und die den Hintergrund des Begriffspaares Apollinisch-Dionysisch bildet. So weist Nietzsche als Hauptmerkmal des griechischen Charakters die zentrale Auffassung sei-ner künstlerischen Kosmodizee auf: der Sklave weiß auf unbewußte Weise, daß sein Opfer, die Grausamkeit seiner Situation, das Fundament des Schönen, der Kunst ist. Das unbewußte Wissen des Sklaven ist das wichtigste Element für sein Verständnis seines sozialen Status. Im politischen Bereich führt Nietzsche nochmals die den Griechen innerhalb seiner künst-lerischen Kultur bezeichnende Qualität einer besonderen Verbindung mit dem Schmerz aus. Durch die Verbindimg von Gesellschaft und Kunst erhält das unbewußte Wissen einen ent-scheidenden politischen Wert: Es ermöglicht der Gesellschaft, eine sklavische zu sein.
Will man die politische Bedeutung dieser These verstehen, so ist zunächst danach zu fragen, ob Nietzsche die griechische Gesellschaft aus einer politischen Perspektive betrach-tet. Falls es an dem ist, hätte er zumindest auf die wichtigste Tatsache der politischen Kultur Griechenlands aufmerksam gemacht, die Entstehung der Demokratie. Wenn er sich für die Entstehimg der Gleichheit und ihrer politischen Verwirklichung interessiert hätte, dann würde er, so läßt sich vermuten, nach den Formen der sozialen Isonomie gefragt haben.6
Gleichwohl sind keine in diese Richtung weisenden Aussagen zu finden. Das Gegenteil ist
6 Zum Begriff des Politischen im alten Griechenland vgl. C. Meier, Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, Frankfurt a.M. 1980. Zu einer aktuellen Zusammenfassung über die Entstehung der griechi-schen Polis siehe K.-W. Welwei, „Die griechische Polis", in: Die Alte Stadt 23 (1996), 311-330.
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
104 Hector Julio Perez Lopez
der Fall. Wenn Nietzsche das Sklaventum gegenüber allen anderen sozialen Phänomenen herausstellt, betrachtet er die griechische Politik genau wie andere sklavische Staatsformen. Nietzsche ersetzt die Verschiedenheit sozialer Beziehungen durch eine einzige soziale Bezie-hung, die auf Kunst gegründet ist. Gleichheit oder Ungleichheit wurde nicht durch die Verhältnisse fundiert, die sich im praktischen Leben ergeben, sondern durch die Beziehung eines jeden Menschen zur Kunst.
Mit dem Begriff des Genies setzt Nietzsche eine radikale Trennung in der Gesellschaft an. Mit seiner außerordentlichen Begabung für die Kunst nehme das Genie eine privilegierte soziale Stellung ein. So außerordentlich seine Fähigkeiten sind, so außerordentlich ist auch sein Recht gegenüber den Sklaven. Die Exklusivität seiner Fähigkeiten gilt als Rechtferti-gung der Ungleichheit innerhalb der griechischen Demokratie. Die Exklusivität des Genies besteht im unbewußten Wesen des künstlerischen Schaffens. Es hat einen offenen Zugang zum Unbewußten. Die Macht des reinen Unbewußten verursacht eine Kluft zwischen der Aktivität des Künstlers und der Aktivität des Nichtkünstlers. Nietzsche verneint, daß bewuß-te Aktivitäten in der Kunst eine Rolle spielen können; er schließt das Handwerkliche, die techne, von der Produktion des Kunstwerkes aus. Die bewußten Operationen des Künstlers bilden nicht das Wesen des Kunstwerkes. Dieses entsteht als eine unbewußte Ausströmung. Es existiert völlig getrennt von sonstigen menschlichen Aktivitäten, als ob es Produkt einer göttlichen Eigenschaft wäre, die sehr wenige Menschen besitzen. Wie aber kommt es zu solcher Überlegenheit?
b) Ursprung und Ziel des Staates
Wurde früher das Sklaventum als notwendige Bedingung für die Existenz des Genies be-trachtet, so postuliert Nietzsche nun die Notwendigkeit des Staates für die Existenz der Kunst. Dabei werden ähnliche Perspektiven deutlich wie bei der Darstellung des Sklaven-tums. Auch der Staat wird als ein Phänomen beschrieben, dessen „grausamen Ursprung" Nietzsche besonders betont.
Zunächst zeigt er allerdings eine Reihe von Ideen, um sie als Illusionen zu charakterisie-ren. Sie betreffen Ursprung und Ziel des Staates. Nietzsche enthüllt die wahre Wirklichkeit des Staates, welche sich hinter jenen Illusionen verbirgt. „Patriotismus", „politischer Trieb" oder „Fürstenliebe" werden als solche Illusionen gesehen, als Ideen, die das Verständnis für den Ursprung des Staates verhindern. Nietzsche gibt eine kurze Erklärung über das Wesen dieser Ideen sowie über den Grund ihrer weiten Verbreitung. Er behauptet einen qualitativen Unterschied zwischen der Art des Denkens von Individuen, je nachdem, ob sie allein oder in einer Gruppe sind. Der Patriotismus ζ. B. ist eine politische Vorstellung, die nur von Menschen innerhalb einer Gruppe gedacht wird. Der Ursprung solcher Illusionen ist ein Wille, den Nietzsche als magisch bezeichnet. Bei der Masse entsteht dabei eine „chemische Affinität", die der Grund dafür ist, daß sie über Ursprung und Ziel des Staates dieselben Vorstellungen hat. Ohne sich in die Natur des Phänomens zu vertiefen, will Nietzsche lediglich kundtun, daß jener magische Wille der rätselhafte Ursprung ist, der hinter Patrio-tismus oder politischen Trieben verborgen ist. Es handelt sich hier um eine Intuition, „die doch schwerlich der Entstehung des Staates gelten kann". (UZ, 56; KGW, 149)
Ebenso ist für Nietzsche die Auffassung völlig fremd, daß in der Entstehung des Staates ein bewußtes Ziel intendiert ist. Er bezweifelt, daß der Staat zum Zweck der Schaffung sozialer Harmonie entsteht. Aus diesem Grund meint er, daß bewußte Entscheidungen keine
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
Gesellschaftspolitische Argumente einer Artistenmetaphysik 105
Rolle für den Ursprung des Staates gespielt haben können. Gerade deshalb verwirft er die Erklärung, daß der Staat mit dem Ziel, ein Benefiz für die Individuen zu schaffen, entstand:
„Ist es wirklich nur die dankbare Empfindung, dass der Einzelne jetzt nicht mehr als Einzelner gegen Alle zu kämpfen habe? Ist es das behagliche Sicherheitsgefühl, jetzt in einer Rettungsanstalt und unter Dach und Fach zu Leben? Sind selbst nur alle diese An-nahmen berechtigt? kann man nicht im Staat so gut wie ausser dem Staate verhungern? und beginnt nicht der Kampf des Einzelnen gegen Alle im Staate wieder von Neuem?" (UZ, 56; KGW, 150)
Im Gegensatz zu jenen Illusionen und zu der Hobbesschen Auffassung geht es Nietzsche ausschließlich darum, ein Phänomen zu deuten. Aus dem Schmerz erklärt er den Ursprung des Staates: „Und wo kann man nicht die Denkmäler jener Entstehung sehen, verwüstete Völker, zertretene Städte, die Saat des verzehrendsten Volkshasses und vor allem: das Sklaventhum!" (UZ, 56; KGW, 150) Man hat das Sklaventum früher gerechtfertigt, weil es die Existenz eines „nicht um das Fortleben kämpfenden" Genies garantierte. Für Nietz-sche ergab sich eine Verbindung zwischen Sklaventum und Schmerz, indem Sklaventum das ausschließlich entsprechende Phänomen zu dem metaphysischen Begriff Schmerz geworden ist. Zugleich rechtfertigt Schmerz die Existenz des Staates, dessen unbewußtes Ziel die Kirnst ist. Dies ist der Angelpunkt seiner politischen Teleologie.
Nietzsches Ansatz ist das Ziel des Staates mit seiner Idee der Welt als Kunstwerk zu verknüpfen. Man muß vor allem sehen, daß diese Idee durch die Dialektik Schmerz-Lust teleologisch konzipiert wurde. Im elften Kapitel von UZ wird behauptet, daß es in der Natur einen schöpfenden Mechanismus von Schönheit gibt. In diesem Abschnitt äußert Nietzsche sein Ziel. Die Erwähnung der Natur ist ein Muster, um analog den Staat mit der Produktion der Schönheit zu identifizieren. Genau wie die Pflänzchen, „im rastlosen Kampfe um das Dasein", endlich blühen und uns „mit dem Auge der Schönheit" anblicken, ist der Staat, („so wenig auch der grausame Ursprung und das barbarische Gebahren desselben auf solche Ziele hindeutet"), „seinem letzten Zweck nach, eine Schutz- und Pflegeanstalt für den Genius [für schöne Einzelblühten, für Einzelne]". (UZ, 57 f.; KGW, 150 f.)
Nietzsche hat das Sklaventum als wichtigstes Element im Ursprung des Staates betont. Sein Ansatz läuft auf die Behauptung hinaus, daß der Staat auf Schutz und Pflege des Genies zielt. Auf diese Weise entstand eine Verbindung zwischen der Zweckmäßigkeit in der Gesellschaft und der Zweckmäßigkeit der wichtigsten politischen Einrichtung. Die Zweck-mäßigkeit des Staates paßt zu dem teleologischen Schema der Gesellschaft. Die Produktion der Kunst hing vom Genie ab und das Genie war auf die Existenz des Sklaven angewiesen, und der Staat richtet sich auf die Entwicklung der Kunst ein, indem er das Genie pflegt: Das Sklaventum ermöglicht die Existenz des Genies. Deshalb hat Nietzsche das Sklaventum als ein inhärentes Phänomen im Ursprung des Staates gekennzeichnet.
Eine weitere Behauptung des Textes ist, je stärker der politische Trieb, desto eher ist das Fortleben des Genies garantiert. Wie kommt diese Garantie zustande? Nietzsche denkt an eine Wechselwirkung zwischen dem Genie und dem Staat. Dieser wird als eine Macht dargestellt, „als magische Kraft kann (sie) die egoistischen Einzelnen zu den Opfern und Vorbereitungen zwingen, die eine Verwirklichung grosser Kunstpläne voraussetzt". (UZ, 60; KGW, 152) Sein Wert liegt abermals darin, daß sich die Individuen notwendigerweise opfern würden. Das Opfer des egoistischen Individualismus bezieht sich deutlich darauf, daß bestimmte Individuen durch ihre „Extra-Arbeit" die Existenz des Künstlers unterstützen.
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
106 Hictor Julio Perez Lopez
Diese Betonung der Macht des Staates für die Opfer der Individuen verdeutlicht erneut die Bedeutung der Beziehung von Staat und Sklaventum. Nietzsche erwähnt kein Mittel mehr, durch das der Staat die Kunst fördern könnte.
Die andere Seite der Beziehung zwischen Staat und Kunst besteht darin, daß die künst-lerische Produktion durch den Staat bestimmt wurde:
„Der griechische Künstler richtet sich mit seinem Kunstwerk nicht an den Einzelnen, son-dern an den Staat: und wiederum war die Erziehung des Staates nichts als die Erziehung Aller zum Genuss des Kunstwerks. Alle grossen Schöpfungen, der Plastik und Architek-tur sowohl als der griechischen [musischen] Künste, haben grosse, vom Staate gepflegte, Volksempfindungen im Auge. Insbesondere ist die Tragödie alljährlich ein feierlich von Staats wegen vorbereiteter und das ganze Volk vereinigender Akt." (UZ, 59; KGW, 152)
Vermag der erniedrigte Sklave den erhabenen Künstler überhaupt zu verstehen? Wozu also bedarf die Gesellschaft eines genialen Künstlers? Oder anders gefragt, was eigentlich ist an der Kunst so wichtig?
II. Wagner - Die Revolution für die Kunst
Wagner und Nietzsche teilen dieselbe kritische Stellung in bezug auf die zeitgenössische Kultur, beide weisen auf ein ideales Bild von Griechenland. Wagner nimmt die griechische Tragödie zum Muster seines Kunstwerkes, auf diese Weise formuliert er seine Idee der modernen Kultur. Nietzsche rezipiert die Betrachtung Wagners, daß die Kunst der Motor für die Erneuerung der Kultur sein soll, und sucht in der Interpretation der griechischen Kultur auch ein ursprüngliches Muster. Nietzsches Empfindlichkeit für die innovative Prägung der Theorie und des Kunstwerkes Wagners hing nicht nur mit seiner Bewunderung des Genies zusammen, sondern auch mit der kritischen Distanz, die er zur modernen Gesell-schaft hatte. Ein wichtiger Teil des Wagnerschen Erbes ist die Kritik der künstlerischen Kultur, die der Musiker in seinen Züricher Kunstschriften entfaltete.7 Nietzsche folgt grund-sätzlich der Opernkritik von Oper und Drama. Es gibt andere Aspekte in seiner Kulturkritik, die jedoch vor einem eigenen Hintergrund zu betrachten sind.8 Interessant ist die Frage, wie Nietzsches Position zu den von Wagner gedachten politischen Dimensionen der Tragödie ist.
7 Vgl. Franke, Richard Wagners Züricher Kunstschriften, Hamburg 1983. Über Nietzsches Rezeption von Wagners Zürcher Kunstschriften gibt es keine philosophisch hinreichende Studie.
8 Nietzsches Skeptizismus gegenüber der Wissenschaft z .B. entfaltet sich noch vor seiner Begegnung mit Wagner und findet in den theoretischen Schriften Wagners eine interessante Übereinstimmung. Die Unterschiede liegen jedoch in den Grundsätzen: Während die Zürcher Kunstschriften eine anthropologi-sche Basis haben, fangt Nietzsche mit der Konstruktion eines transanthropologischen Denkens an. Wichtig für das Verständnis dieser Unterschiede ist vor allem die Kenntnis der philosophischen Bildung Nietz-sches durch Autoren wie Schopenhauer, Friedrich Albert Lange und Eduard von Hartmann. Vgl. hierzu K. Schlechte u. A. Anders, Friedrich Nietzsche: Von den verborgenen Anfängen seines Philosophierens, Stuttgart 1962; A. Mittasch, Friedrich Nietzsche als Naturphilosoph, Stuttgart 1952; G. J. Stack, Lange and Nietzsche, Berlin/New York 1983; J. Salaquarda, „Nietzsche und Lange", in: Nietzsche-Studien 7 (1978); C. Crawford, The Beginnings of Nietzsche's Theory of Language, Berlin/New York 1988; und F. Gerratana, „Der Wahn jenseits des Menschen", in: Nietzsche-Studien 18 (1989), 391-433.
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
Gesellschaftspolitische Argumente einer Artistenmetaphysik 107
Wie U. Bermbach behauptet, kehrt Wagner die Beziehung zwischen Kunst und Politik in Griechenland um. Für die Griechen befindet sich das Zentrum des Politischen im öffentli-chen Leben der politischen Institutionen. Sie sind die Orte, wo sich die maßgeblichen Formen der sozialen Synthese der griechischen Demokratie erkennen lassen. Wagner sieht den Ort jener sozialen Synthese im Theater. Die Vorstellung der Tragödie, in einem sehr kultischen Sinne, wird zum Zentrum des politischen Lebens. Im Theater erreicht die soziale Synthese ihren Gipfel.9
Die Erfahrungen, durch die die Bürgerschaft innerhalb der Polis die konstitutive Identifi-kation des Individuums mit den anderen als gleich wahrnimmt und die im öffentlichen Leben der Institutionen entstanden sind, werden im Theater ihre Vervollständigung erreichen. So gewann die Identität aller, die von den Griechen als Kern der politischen Praxis angesehen wurde, ihre höchste Form dann, wenn das Volk in der Aufführung der Tragödie das Gefühl von „innigster Einheit" erreicht hatte.10
Im welchem Sinne versteht sich die politische Prägung dieses Begriffes der theatralischen Feste im Vergleich zu dem, der von Nietzsche benutzt worden ist? Diese Frage erhellt eine Passage in Die Kunst und die Revolution. Dort beginnt Wagner mit einem Vergleich zwi-schen der alten Tragödie und dem modernen Theater. Auch die Begriffe von Kunst und Arbeit erfahren eine radikale Gegenüberstellung. Kunst ist eine Tätigkeit mit einem imma-nenten Sinn: „sein Produzieren ist ihm [dem Künstler] an und für sich erfreuende und befriedigende Tätigkeit, nicht Arbeit."11 Die Arbeit aber, als handwerkliche Aktivität ver-standen, ist an einem völlig anderen Zweck orientiert. Ihre Zweckmäßigkeit ist von der Notwendigkeit beherrscht. Die Arbeit produziert an sich keine Lust. Wie Nietzsche denkt auch Wagner, daß die Künstler von der Arbeit befreit sein müssen. Nicht nur sie, sondern auch alle anderen Bürger. Seine Idee ist es, daß alle Menschen mit politischen Rechten frei von Arbeit bleiben müssen, damit sie sich dem öffentlichen Leben widmen können. Für die Bürger bestand keine Notwendigkeit zur Arbeit, weil die Sklaven auch solche groben Auf-gaben übernommen haben sollten: „Und wo er irgend auf die Notwendigkeit des Handwer-kes stiess, lag es eben in seiner Natur, diesem alsbald die künstlerische Seite abzugewinnen und es zur Kunst zu erheben. Das gröbste der häuslichen Hantierung wies er aber von sich ab - dem Sklave zu."12 Mit der Gegenüberstellung der Begriffe von Arbeit und Kunst bestimmt Wagner die Unterschiede zwischen dem politischen Menschen und dem Sklaven. Der Bürger braucht seine Zeit nicht mit notwendigen Aufgaben zu verbringen. Alles, was er macht, gewinnt einen künstlerischen Sinn. Der Sklave dagegen führt diejenigen Aufgaben aus, die an sich nicht Lust produzieren, sondern nur durch die Notwendigkeit motiviert sind.
Jedoch verteidigt Wagners Position das Sklaventum nicht als notwendige Bedingung des Systems. Im Gegenteil:
9 Zum Begriff der tragischen Feste in Athen siehe C. Maier, Die politische Kunst der griechischen Tragö-die, München 1988. Zu den historischen Quellen Nietzsches Interpretation der Dionysosfeste, wie B. v. Reibnitz in dem Kommentar, 87, andeutet; siehe Bachofens „Die Unsterblichkeitslehre der orphi-schen Theologie", in: Gesammelte Werke, Bd. VII, Stuttgart/München 1943, 96-198, „Versuch über die Gräbersymbolik der Alten", in: ebd., Bd. IV, 238 ff., „Die Sage von Tanaquil", Bd. VI, 98 ff.
10 Vgl. U. Bermbach, Der Wahn des Gesamtkunstwerkes. Richard Wagners politisch-ästhetische Utopie, Frankfurt a.M. 1994, 146-166.
11 R. Wagner, „Die Kunst und die Revolution", in: Dichtungen und Schriften, Bd. 5, Frankfurt a.M. 1983, 290.
12 Ebd., 293.
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
108 Hictor Julio Perez Lopez
„Dieser Sklave ist nun die verhängnisvolle Angel alles Weltgeschickes geworden. Der Sklave hat, durch sein blosses, als notwendig erachtetes Dasein als Sklave, die Nichtigkeit und Flüchtigkeit aller Schönheit und Stärke des griechischen Sondermenschentumes aufge-deckt, und für alle Zeiten nachgewiesen, dass Schönheit und Stärke, als Grundzüge des öffentlichen Lebens, nur dann beglückende Dauer haben könne, wenn sie allen Menschen zu eigen sind."13
Das Sklaventum setzt eine Grenze für den allgemeinen Wert dieser Kultur, so daß sie nicht ein absolutes Muster für unsere Kultur sein kann. Wagner meint gleichwohl, daß die griechi-sche Kunst Ausdruck einer demokratischen Kultur sei, allerdings von einer eingeschränkten Demokratie. An diesem Punkt werden die Grenzen der Kunst explizit. Die Tragödie kann als Gipfel des sozialen Lebens in Griechenland betrachtet werden.
Weil die Tragödie der Raum für die soziale Synthese des politischen Lebens ist, werden an ihr nur diejenigen Teilnehmer sein können, die eine wirkliche Erfahrung der Demokratie haben. Das waren nur die Bürger, die Sklaven waren ausgeschlossen. Die Voraussetzung einer politischen Erfahrung für die Individuen, die an der tragischen Kunst teilnehmen, bedeutet eine sehr deutliche Bestimmung der Beziehung zwischen Kunst und Politik. Die Politik ist für das soziale Leben grundlegend, die Kunst bringt zum Ausdruck, was in der Politik stattfindet. Insofern ist die der griechischen Kultur angemessene Kunst weder gültig für die Moderne, noch einem absoluten Muster der Zukunft oder irgendeiner revolutionären Ideologie verpflichtet.
Die Kunst kann die Produkte des sozialen Leben nicht ersetzen. Dies zeigt sich sehr deutlich in der Ordnung der Erfordernisse, die Wagner für die künftige Gesellschaft auf-stellt. Zuoberst steht die Revolution als eine Umwandlung des Politischen, die nicht durch die Kunst betrieben werden kann. Darauf deutet Wagners Verwendung der Begriffe von Kraft und Schönheit hin. Kraft ist die Eigenschaft, mit der das Volk die Revolution durch-führen würde. Sie ist die menschliche Eigenschaft der politischen Praxis, während die Schönheit die notwendige Eigenschaft für die Entwicklung der Kunst ist. Bei der Beziehung zwischen beiden kommt es grundsätzlich darauf an, ihre Ordnung zu bemerken. Die Politik steht an erster Stelle, danach kommt die Kunst als ein Gipfelpunkt derselben. Wagners zentrale Idee einer revolutionären Kunst meint, daß die höchste Form der Kunst nur als Ausdruck der Gleichheit erscheinen würde. Er versucht nicht, die politischen Zeichen der neuen utopischen Gesellschaft zu beschreiben, er nimmt ein Muster der griechischen Kultur, das als Bild der genuinen Menschheit gilt: Wagner entwirft sein Ideal der Versöhnung des Menschen mit der Natur. Im Gegensatz zur griechischen Demokratie geht Wagner davon aus, daß sich Demokratie in der ganzen Menschheit verwirklichen muß.
III. Erlösung, Auflösung der Demokratie
Inwiefern unterscheiden sich die Ideen Nietzsches davon? Ein Unterschied ist von Anfang an sehr explizit vorhanden: Wagner betrachtet die soziale Gleichheit als eine Bedingung für die Existenz der Kunst, da sie der Ausdruck der politischen Erfahrung der Gesellschaft ist.
13 Ebd.
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
Gesellschaftspolitische Argumente einer Artistenmetaphysik 109
Nietzsche wiederum verteidigt die soziale Ungleichheit als notwendige Bedingung der Kunst. Der Unterschied gründet sich darauf, daß während für Wagner das soziale Erlebnis sich innerhalb der Politik entwickelt, für Nietzsche dieses Erlebnis nicht in der Politik stattfindet. Stellt die Kunst eine alternative soziale Erfahrung zu der reinen Ungleichheit des Sklaven-tums dar?
Eine Passage aus der Geburt der Tragödie weist in eine positive Richtung: Das dionysi-sche Fest wird als gesellschaftliches Phänomen dargestellt. Alle sozialen Verhältnisse wan-deln sich radikal: „Unter dem Zauber des Dionysischen schließt sich nicht nur der Bund zwischen Mensch und Mensch wieder zusammen: auch die entfremdete, feindliche oder unterjochte Natur feiert wieder ihr Versöhnungsfest mit ihrem verlorenen Sohne, dem Menschen." (KSA I, 29; vgl. auch UZ, 5) Bis hin zu dem Punkt, daß alle Bestimmungen, die aus dem Zusammenleben entstanden sind, überwunden werden: „Jetzt ist der Sclave freier Mann, jetzt zerbrechen alle die starren, feindseligen Abgrenzungen, die Noth, Willkür oder ,freche Mode' zwischen den Menschen festgesetzt haben." (KSA I, 29)
Wenn in der griechischen Demokratie bestimmte Formen von Gleichheit entstanden sind, verlieren sie überhaupt ihre Gültigkeit, da die Bedeutung des außerordentlichen Phänomens des Festes radikal über sie erhoben wird. Der Wechsel der sozialen Verhältnisse basiert auf der Erfahrung der menschlichen Erlösung. Sie kann von allen erlebt werden. Durch ihren Sinn können sich alle Menschen gleich fühlen. Sie ist auch eine gleiche Erfahrung für alle. Die Identität, die die Gleichheit aller begründet, besteht in der Auflösung der Individuation und in der Vereinigung mit der Welt. Der Sklave kann seine grausame Wirklichkeit nur ertragen, weil in der Kunst noch eine andere wesentlichere Erfahrung zu erreichen ist. Das dionysische Fest wäre das Phänomen, das alle anderen, die die politischen Dimensionen der griechischen Kultur bestimmen, ersetzt. Auf diese Weise wird die Kunst zum Ersatz der Politik.
In Wagners Denken ist die Politik nicht durch die Kunst ersetzt, deshalb ist die Kunst auf ein bestimmtes politisches Publikum begrenzt: die Bürgerschaft. Wenn man sich nun, wieder in bezug auf Nietzsches Text, fragt, in welchem Element des tragischen Festes sich der Ersatz der Politik durch die Kunst äußert, wird man wiederum eine zu Wagner entgegen-gesetzte Position feststellen. Die Kunstauffassimg Nietzsches ist im Grunde genommen die Basis eines neuen Modells der Erlösung des Menschen. Wenn alle Menschen an dem tragi-schen Fest teilnehmen, um in ihm die Erlösung zu finden, dann betrifft dies sowohl die Bürger als auch die Sklaven. Nietzsche ignoriert gerade die Begrenzung der Tragödie auf die Bürgerschaft, da er ihr Wirkungsgebiet auf alle Menschen erweitert.14 Dies deutet die Verabsolutierung der Kunst anstelle einer verschwindenden Politik an. Die Utopie einer neuen Beziehung zwischen den Menschen würde sich in dem Moment des Teilnehmens an der Kunst verwirklichen.
Es ist hier äußerst problematisch zu bestimmen, inwiefern Nietzsche an einen künst-lerischen Akt denkt, an dem das ganze Volk teilnehmen darf. Man kann einige Argumente finden, die auf eine andere Möglichkeit hindeuten. Dann gäbe es nicht nur die Möglichkeit, daß alle Menschen erlöst würden, weil sie alle an dem Kimstakt teilnehmen, sondern auch die, daß nicht alle Menschen an dem Kunstakt teilnehmen und ihre Erlösung unwichtig wird.
14 Nur Menschen, die apollinisch-dionysische Kunst treiben können, werden innerhalb des Staates betrach-tet: „Der apollinische Einzelne ausserhalb des Staats [...] Der dionysische ausserhalb des Staats." (KSA 7, 153)
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
110 Hector Julio Pirez Lopez
Man findet aber in UZ eine Reihe von Passagen gegen die Idee, daß alle Menschen völlig an der Erlösung, die der Genius erreicht, teilnehmen:
„Der ungeheure Aufwand des Staates und Gesellschaftswesen wird schliesslich doch nur für einige Wenige aufgeführt: dies sind die grossen Künstler und Philosophen - die nicht beanspruchen sollen, mit hinein zu treten in das politische Wesen, wie es Plato's Staat fordert. Für sie braucht die Natur die höchsten Wahngebilde, während für die Masse nur die Abfälle des Genius ausreichen." (UZ, 197 f.; vgl. KSA 7, 142)
Es scheint, als sei Nietzsche nicht bereit anzunehmen, daß die Erfahrung des Genius von den anderen geteilt werden kann. Welchen Charakter aber hat diese Erfahrung?
Die allgemeine Bedeutung des künstlerischen Geschehens wird mit einem Akt der Recht-fertigung der Welt identisch. In einem solchen Sinne ist letztendliches Ziel der Kunst die Versöhnung des Menschen mit der Natur. Sowohl der Mensch als auch die Welt sind innerhalb derselben teleologischen Strukturen gedacht, weil beide Produkte eines ursprüng-lichen Fundaments sind: Das Ur-Eine. Der Mensch aber versöhnt sich nicht mit der Natur, weil er von ihr eine direktere Erfahrung hat, ζ. B. durch eine tiefere Erkenntnis von ihr. Er betrachtet alle direkte Erfahrung der Natur als Erscheinung, d. h. nicht als Wahrheit, weswegen die Welt der Phänomene der Kunst keinen direkten Zugang bietet. Nietzsche denkt die Welt und die Natur als Kunstwerk. Nur insofern der Mensch als Teil des Kunst-werkes sich darstellt, wird er sich mit der Natur versöhnen.
Die These der Welt als Kunstwerk wurde als Ergebnis des teleologischen Gedankens vom Ur-Einen abgeleitet. Das Ur-Eine ist das ursprünglich schöpfende Element der Welt. Damit werden der ursprüngliche Schmerz und der Widerspruch als produktiv beschrieben. Schmerz und Widerspruch produzieren die Welt der Erscheinung. Man weiß, daß das Paradigma der Kunst bei Nietzsche im Zusammenhang von Dionysischem und Apollinischem besteht, wobei das erste Schmerz und das zweite Lust bedeutet. Der Zusammenhang besteht darin, daß das Apollinische aus dem Dionysischen entsteht. Dem Dionysischen entspricht das Apollinische als ein aus ihm entstandenes Produkt. Das ist es, was sich in der Form einer Kosmodizee darstellt, dem Ur-Einen als Schmerz entspricht die Welt als Erscheinung.
Die Menschen sind ein Teil des künstlerischen Prozesses der Welt: Der Mensch wird selbst zum Kunstwerk. Alle Kategorien der menschlichen ästhetischen Erfahrung orientiert Nietzsche auf diese Idee. Sowohl das Genie als auch der Nicht-Künstler nehmen an dem künstlerischen Akt teil, insofern beide zum Willen der Welt gehören. Das Genie hat einen privilegierten Zugang zum Willen der Welt, d. h. es ist fähig, mit dem aus dem Ur-Einen entstandenen Willen in Kontakt zu treten. Durch diese Erfahrung erhält der Künstler eine ursprünglichere Beziehung zur Natur, zum Ur-Einen. Die Annäherung an das Ur-Eine ist eine Annäherung an den Schmerz. Schmerz bleibt, wie der Nicht-Künstler auch, auf dem Niveau der Erscheinung. Sie können nicht den ursprünglichen Schmerz des Ur-Einen emp-finden. Nietzsche sagt: „Der Wille gehört zum Schein." (UZ, 170; KSA 7, 203) In der Welt des Scheins also findet die künstlerische Erfahrung des Genius statt, er ist „das als rein Anschauend Vorgestellte". (UZ, 173; KSA 7, 206) Die Spezifität seiner Erfahrung liegt eben darin, daß er die Erscheinungen rein als Erscheinungen anschaut. Durch diesen Akt erkennt und erlebt er die Welt der Erscheinungen als Welt der Erscheinungen; insofern er selbst ein Bild des Schmerzes ist und sich als bildhafte Erscheinung erkennend Lust erfährt, bildet er denselben Prozeß des Kosmos ab und vereinigt sich mit ihm. So erreicht der Genius die Lust als „die reine Versenkung in den Schein - das höchste Daseinsziel: dorthin,
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
Gesellschaftspolitische Argumente einer Artistenmetaphysik 111
wo der Schmerz u. der Widerspruch nicht vorhanden erscheint. [...] Der Mensch, der Nicht-Genius, schaut die Erscheinung als Realität an oder wird so vorgestellt". (UZ, 173; KSA 7, 205 f.)
Was benötigt die Masse für ihre Erlösung? Wenn sie sich durch die Teilnahme am diony-sischen Fest erlöst, dann muß sie auch die Lust der Erscheinung als Erscheinung haben. Es ist möglich, daß die Behauptung, die Masse brauche nur die Abfälle des Produktes des Genius, die Unmöglichkeit ihrer tatsächlichen Erlösung bedeutet. Eine Passage bekräftigt diese Idee. In bezug auf den dionysischen Dithyrambus betont Nietzsche, daß es sich dabei um ein vollständiges Kunstwerk handelt, daß die Intensivierung alle symbolischen Fähigkei-ten des Menschen fördert, sowohl die musikalischen als auch die schauspielerischen. Für Nietzsche ist dieses Kunstwerk explizit als eine spezifisch künstlerische Form, deren Natur anders ist als ein rein instinktiver und natürlicher Rausch: „nicht mehr ist die dionysisch erregte Chormasse die unbewusst vom Frühlingstrieb gepackte Volksmasse." (UZ, 34; DW, KSA I, 571) Die Masse spielt nicht im Dithyrambus. Sein künstlerisches Wesen erfordert eine Erziehung und eine spezifische Vorbereitung, die die Sklaven sich nicht leisten konnten. Das würde bedeuten, daß seine künstlerischen Teilnehmer aus der Bürgerschaft stammen müssen. In einer anderen Passage über das Ziel des Staates als Erzieher meint er jedoch, der Staat müsse für die Vorbereitung aller auf den Genuß des tragischen Werkes Sorge tragen. Obwohl er nichts über die Art und Weise dieses Genusses sagt, meint er, daß sich das Volk durch die Teilnahme an dem Fest vereinigt. (Vgl. dazu UZ, 59; KGW, 152)
Einerseits deutet Nietzsche die Niedrigkeit des Teilnehmens der Masse an der Erfahrung des Genius an, andererseits redet er von künstlerischen Erfordernissen für den Dithyrambus, die die Teilnahme der Masse an dem Kunstwerk nicht erleichtert. Außerdem behauptet er, daß der Staat alle zu einem künstlerischen Akt vorbereitet, in dem sich das Volk vereinigt. Unter allen diesen Bedingungen bleiben wenige Möglichkeiten für die Erlösung des Volkes. Zwar bestände die Möglichkeit, daß sogar denjenigen, die mehr Schwierigkeiten und wenig Vorbereitung für die Teilnahme an dem tragischen Fest hätten, ein offener Weg zur äs-thetischen Erfahrung bliebe. Diese Möglichkeit befindet sich in den Reflexionen über den dionysischen Dithyrambus, wo Nietzsche die passive Teilnahme an dem Fest erörtert und sich nach dem Element fragt, durch das die Zuschauer die Welt des Scheines als solche empfinden: „Wo aber ist die Macht, die ihn in die wundergläubige Stimmung versetzt, durch die er alles verzaubert sieht? Wer besiegt die Macht des Scheins und depotenziert ihn zum Symbol? Dies ist die Musik. - " (UZ, 35; DW, KSA I, 571)
Die Musik ist die magische Kraft, die, wie ein Wunder, den passiven Zuschauer zur Erfahrung der erlösenden Verwandlung hebt. Die Musik ist letztlich das mögliche Element einer Kette, die den Sklaven bisher allein durch sein Opfer mit der Kunst verknüpfte.
IV. Schlußfolgerung
Haben die Äußerungen von UZ eine Verbindung mit Nietzsches Position zur Politik in der modernen Gesellschaft? Sollte dieses Bild der antiken Kultur ein Muster für die der Moderne sein?
Daß Nietzsche die griechische Kultur als ein Muster für die der Moderne interpretiert, bedeutet keinen absoluten Wert dieses Musters, tatsächlich unterscheidet er zwischen moder-ner und alter Kultur. Sogar zwischen seiner Idee der alten Tragödie und der modernen trifft
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
112 Hector Julio Perez Lopez
er eine Unterscheidung. Nietzsche hätte auch explizit die gesellschaftspolitischen Bedingun-gen für die moderne Tragödie formulieren können. Man kann zudem vermuten, daß diese Bedingungen ähnlich der der alten Tragödie waren. In der Tat, er entschied sich, seine politischen Betrachtungen über das alte Griechenland von GT auszuschließen, und außerdem äußerte er sich nicht über moderne Politik. Es ist notwendig, diese Tatsache zu beachten, bevor man eine Hypothese wie die von H. Cancik aufstellt.15 Cancik meint, der politische Hintergrund von GT, und damit auch UZ, sei durch die Ereignisse der Pariser Kommune geprägt, sodann wäre Nietzsches Verteidigung des kulturellen Elitarismus eine Reaktion auf die Kommune. In seiner Argumentation werden zwei Elemente hervorgehoben, erstens: Nietzsche hätte mit Wagner den Inhalt der Abhandlung diskutiert, zweitens: Nietzsche schrieb über den griechischen Staat in der Zeit, als die Ereignisse der Pariser Kommune stattfanden. Die dokumentierten Beweise der Beziehung zwischen UZ und der Kommune sind jedoch nicht hinreichend, um die Hypothese von Cancik zu beweisen. Es existiert nur ein Brief von Nietzsche an C. von Gersdorff, in dem er sich negativ über den Pariser Brand vom Mai 1871 äußert.16
Diese Reaktion bezieht sich auf ein Ereignis, welches nach dem Verfassen von UZ stattgefunden hat. Es handelte sich um die Nachricht der Inbrandsetzung der Tuilerien durch die Kommunarden am 24. Mai 1871, gleichzeitig wurde die falsche Nachricht propagiert, daß auch der Louvre in Flammen stehe.17 Es ist eher zu vermuten, daß Nietzsche einen definitiven Impuls für seine politisch-kulturelle Auffassung des Elitarismus durch die Kom-mune erfuhr, aber dieser Impuls wäre in seinen späteren politische Reflektionen, vor allem in Oer griechischen Staat von 1872 zu finden.
Nietzsches gesellschaftspolitische Auffassung von UZ ist eng mit seiner radikalen Kritik der modernen Kultur verbunden. Diese ist auch konsequent in bezug auf die Idee der Er-neuerung der Kultur durch die Kunst.18 Er zeigt sich mißtrauisch gegenüber der Politik insgesamt, nicht nur gegenüber der Demokratie oder dem Kommunismus, denn er betrachtet fast alle Phänomene der modernen Kultur als entartete Früchte. Ein solches allgemeines Mißtrauen entwickelt sich auf dem Boden der Kritik an dem Schopenhauerschen Grundge-
15 Vgl. H. Cancik, Nietzsches Antike, Stuttgart/Weimar 1995, 61. 16 „Als ich von dem Pariser Brande vernahm, so war ich für einige Tage völlig vernichtet und aufgelöst
in Thränen und Zweifeln: die ganze wissenschaftliche und philosophisch-künstlerische Existenz erschien mir als eine Absurdität, wenn ein einzelner Tag die herrlichsten Kunstwerke, ja ganze Perioden der Kunst austilgen konnte; ich klammerte mich mit ernster Überzeugung an den metaphysischen Werth der Kunst, die der armen Menschen wegen nicht da sein kann, sondern höhere Missionen zu erfüllen hat." (Brief von Nietzsche an Carl von Gersdorff am 21. Juni 1871, KSB, 203-205)
17 Am 27. Mai berichtet Cosima Wagner: „Pr. Nietzsche kommt nicht, die Ereignisse in Paris haben ihn zu sehr erschüttert." Am 28. Mai jedoch geht Nietzsche nach Triebschen und kommentiert die Nach-richt mit Wagner: „R. spricht nun heftig über den Brand und seine Bedeutung, ,wenn ihr nicht fähig seid, wieder Bilder zu malen, so seid ihr nicht wert, sie zu besitzen'. Pr. N. sagt, dass für den Gelehr-ten die ganze Existenz aufhöre bei solchen Ereignissen." (C. Wagner, Die Tagebücher, Bd. I, 1869-1872, München 1982, 392)
18 Vor der Abfassung von UZ sprach Nietzsche über die Gründung einer „neuen griechischen Akademie" in Verbindung mit Wagners Bayreuther Projekt. Auch die Pläne, über den griechischen Staat zu schrei-ben, sind ein Jahr vorher gefaßt worden. Siehe seinen Entwurf für die Abhandlung Socrates und der Instinkt in KSA 7, 79. Noch eine konkretere Bedeutung über seine Pläne enthält die Aussage: „Die Kunst hat die Aufgabe, den Staat zu vernichten. Auch dies ist in Griechenland geschehen." (KSA 7, 62)
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
Gesellschaftspolitische Argumente einer Artistenmetaphysik 113
danken, daß die Menschen sich als Instrumente des Willens auf dem Niveau der Erscheinung ziellos bewegen.
Im Grunde dieser Auffassung liegt Nietzsches Beschäftigung mit der Problematik der Sprache: als Basis des Bewußtseins wurde sie wie ein Produkt des Unbewußten betrachtet, somit hatte er im Unbewußten zum ersten Mal eine Teleologie erkannt. Das Problem des Menschen mit dem Willen wird dann sein, daß er als Individuum allein durch seine Gefühle unvollständige Spiegelungen von ihm erfährt. Das Bewußtsein als Produkt der Teleologie des Willens zeigt sich ungenügend, unperfekt, weil es keine vollständige Spiegelung von ihm sein kann. Von dieser Perspektive aus betrachtet Nietzsche die Sprache als eine entartete Ausdrucksform, durch die die gesamte Erfahrung des Menschen bedingt ist. Daher verneinte Nietzsche alle Möglichkeiten einer Teleologie der bewußten Handlungen:
„Wo fangt die That an? Sollte ,That' nicht auch eine Vorstellung, etwas Undefinirbares sein? Eine sichtbar werdende Willensregung? [...] Was ist das Bewusstwerden einer Wil-lensregung? [...] Ein immer deutlicher werdendes Symbolisieren. Die Sprache, das Wort nichts als Symbol. Denken d. h. bewusstes Vorstellen ist nichts als die Vergegenwärti-gung Verknüpfung von den Sprachsymbolen. Der Urintellekt ist darin etwas ganz Ver-schiedenes: er ist wesentlich Zweckvorstellung, das Denken ist Symbolerinnerung." (KSA 7, 113)
Nietzsches Interpretation über den griechischen Staat basiert auf der Entwicklung einer absoluten Gegenüberstellung zwischen der Teleologie des Unbewußten und der Falschheit der bewußten Ziele. Deshalb lehnte er die bewußten Vorstellungen über den Zweck des Staates ab und identifizierte diesen Zweck mit einem Unbewußten. Die Charakterisierung einer staatlichen Teleologie als einer durch Instinkte geführten Teleologie ist schon als genetische Idee von UZ in der unmittelbar vorangehenden Phase (beim Verfassen seines Textes über den griechischen Staat) vorhanden: „In den grossen Organismen wie Staat Kirche kommen die menschlichen Instinkte zur Geltung, noch mehr im Volk, in der Gesell-schaft, in der Menschheit."19
Die Schopenhauersche Metaphysik des Willens wird in der Kunst umgesetzt, und in diesem Versuch wird seine Hoffnung in einer neuen Kultur liegen. Nietzsches Lösung des Problems ist die Betrachtung einer höheren Erfahrung des Willens, in der der Mensch nicht mehr durch seine eigenen Gefühle eine Verbindung zu ihm entfaltet, sondern durch den Kontakt zu einer allgemeineren Form des Willens, die nur dem Genie reserviert ist. Das Genie wird seine künstlerische Erfahrung durch die Musik in einen reineren Ausdruck des Willens verwandeln, weil die Musik als reiner Ausdruck des Willens die einzig gültige Sprache ist.20
Kann man wie Jochen Schmidt behaupten, daß das Erbe der nihilistischen Komponenten des Schopenhauerschen Geniebegriffs Nietzsche zu einer bestimmten politischen Position
19 NF von September 1870 - Januar 1871, 111, KSA 7. 20 Das Verhältnis von Sprache und Wille wurde von Nietzsche in Verbindung mit dem Verhältnis von
Musik und Wille betrachtet, im Rahmen einer allgemeinen Reflexion über die Symbole. Der Einfluß von Eduard von Hartmann ist hier so deutlich, daß Nietzsche die Schopenhauerschen Begriffe des Symbols, indem er die Begriffe von Hartmann akzeptiert, modifiziert.
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
114 Hictor Julio Pirez Lopez
bringt?21 Er rezipiert den Schopenhauerschen Begriff von Genie in einer früheren Phase der Entwicklung der Artistenmetaphysik. In dieser Phase besteht die wichtigste Erkenntnis seiner Rezeption in der Teilnahme des Künstlers an der überirdischen Macht des Unbewuß-ten, was ihm durch die Beschreibung des Musikers vermittelt wurde. Aber bei dem Begriff vom Genie wird es nicht nur Elemente von Schopenhauer geben.22 Die Zeit der Abfassung der Schrift über den griechischen Staat fällt genau mit der Zeit der Entfaltung der Artisten-metaphysik zusammen. Als Gipfel seiner theoretischen Konstruktion entwickelt er seinen Begriff vom Genie weiter, und er versucht, sich von dem Schopenhauerschen Nihilismus zu unterscheiden.
Verbürgt der metaphysische Ansatz dieser Formulierung inhärente politische Elemente? Der letzte Schritt der Teleologie vervollständigt Nietzsches Umkehrung der Schopenhauer-schen Bewertung des Willens. Die letzten Ergebnisse, die er mit seiner Teleologie erreicht, zeigen dann, inwiefern die politischen Implikationen des Schopenhauerschen Nihilismus verwandelt werden.23
Die Überwindung des Schopenhauerschen Nihilismus versteht sich unter der Bedingung, daß das Genie eine aktive Rolle in der künstlerischen Kosmodizee spielt.24 Bei Nietzsches Genie findet der ideale Zustand des Schaffens nicht in Anwesenheit des Willens statt, son-dern im Gegenteil, wenn er an dem Willen teilnimmt. Das Genie erfährt den Willen als reine Anschauung, er ist reine Lust. Die Teleologie der Welt zeigt, daß der Wille ein Ziel hat, die Schönheit. Das Genie wird einen Gipfel der Teleologie des Willens darstellen, indem es die Darstellung der reinen Erscheinung als reine Entzückung der Lust ist. Durch die Erfahrung des sich in reine Lust Verwandeins erreicht das Genie das Bewußtsein, daß er reiner Schein ist. Woher entsteht diese Lust? Diese Lust kann nur ein Produkt des reinen Schmerzes des Willens sein. Das Bewußtsein des Scheines als Schein ist eine Erfahrung, deren Wurzeln im Unbewußten liegen. Nietzsche fand hier das Phänomen, das mit höchster Radikalität die Entwicklung seiner Teleologie vervollständigte, ein Phänomen, in dem das höchste Bewußtsein durch das tiefste Unbewußte produziert wurde. In diesem Punkt ver-einigen sich Unbewußtes und Bewußtsein harmonisch. Die Erfahrung des Genies ist der Gipfel der Teleologie an sich.
Der Ausgangspunkt des Genie-Erlebnisses schließt eine alltägliche Erfahrung des Willens aus. Impliziert die Kunst einen Ausgang aus dem metaphysischen Gebiet der Reinheit, irgendeine Art von Rückkehr in die Welt? Die ursprüngliche Erfahrung ist nicht das Erken-nen des Scheines der alltäglichen Welt des Menschen. Das bewußte Erkennen des Künstlers impliziert für Nietzsche jedoch eine neue Position in bezug auf die Wirklichkeit: Der Nicht-
21 Vgl. J. Schmidt, Die Geschichte des Genie gedankens, Darmstadt 1988, Bd. I: Schopenhauers Geniali-tät als Fähigkeit zu erlösender Identität in der „Welt als Wille und Vorstellung", 467-476, Bd. II: Nietzsche: Gegengeschichtliche Revolte und Kulturkritik im Namen des Genies, 129-146.
22 Auch zum Unterschied zwischen Nietzsches und Wagners Begriff von Genie siehe K. Joisten, „Nietz-sches Verständnis des .Genius' in der frühen Phase seines transanthropologischen Denkens", in: Nietz-scheforschung, Bd. 2 (1995), 193-204.
23 Um Nietzsches Entwicklung gegen den Nihilismus zu verstehen, ist es notwendig, seine Rezeption von E. von Hartmann zu beachten. C. Crawford zeigt diesen Zusammenhang in The Beginnings, vor allem in „Nietzsche and Hartmann: Unconscious Nature of Language", 128, bis „Nietzsches Worldview in Anschauung", 178.
24 Vgl. G. Goedert, „Nietzsches dionysische Theodizee, Höhepunkt seiner Abwendung von Schopen-hauer", in: Schopenhauer, Nietzsche und die Kunst, Wien 1991, 45-54.
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
Gesellschaftspolitische Argumente einer Artistenmetaphysik 115
Genius schaut die Erscheinungen als Realität, während der Genius die Erscheinungen als Erscheinungen schaut. Das aber ist eine Schlußfolgerung, die Nietzsche als Rückkehr in die Welt im Bereich der Kunst definieren wird. Sodann wird er seine positive Wertung des Willens in dem praktischen Prozeß des Kunstschaffens entwickeln.
Bei der Hauptform der apollinisch-dionysischen Wechselwirkung läßt sich eine Entwick-lung zeigen, in der die aktive Rolle des Willens nicht nur auf die Erfahrung der Erlösung begrenzt sein konnte. Das ist zu betrachten bei seinen ständigen Vorschlägen zur Musik als Ursprung der Sprache, der Poesie und der Tragödie.25 Die Musik bleibt dabei nicht in ihrer Ausschließlichkeit als Sprache des Willens isoliert, Nietzsche stellt sie durch ihre Wirkung in der Sprache dar. Somit erscheint die Form, daß der Wille mit seiner Reinheit in der Welt wieder als Phänomen kristallisiert. Dies ist der Weg, durch den Nietzsche die Rückkehr des Willens in die Welt zeigt. Wird aber eine solche neu geprägte Sprache irgendein Instrument für das praktische Leben werden?
Nietzsche formuliert einen Prozeß als praktische Seite der erlösenden Erfahrung des Genies, indem das Genie durch die Musik eine sprachliche Form produziert, die ihm als Schein des Scheines sich darzustellen ermöglicht. So sagt Nietzsche in einer paradigmati-schen Beschreibung dieser Erfahrung von GT:
„In Wahrheit ist Archilochus, der leidenschaftlich entbrannte liebende und hassende Mensch nur eine Vision des Genius, der bereits nicht mehr Archilochus, sondern Weltge-nius ist und der seinen Urschmerz in jenem Gleichnisse vom Menschen Archilochus symbolisch ausspricht." (KSA I, 55)
Hier spielt die inhärente Zeitlichkeit des Willens eine wichtige Rolle. Wenn die Musik den Willen in die Form von Sprache vermittelt, geschieht dies unter der zeitlichen Struktur des Willens.26 Der Wille wurde als eine kontinuierliche Produktion dargestellt, eine Kreation, die einen Anfang und ein Ende in jedem Augenblick hat. Diese Zeitlichkeit entspricht der produktiven Struktur des Ur-Einen. Als Quelle, als ursprünglicher Schmerz, produziert das Ur-Eine ein Bild in jedem Augenblick. So wie der Wille und die Musik, als aus dem Ur-Einen geborene Produktionen, muß jeder Moment im Ursprung der Sprache vorhanden sein.
Nietzsche kümmerte sich nicht um das Poetische oder Tragische als Kunstobjekte, er beschrieb die Formen, in denen sie als künstlerische Akte sich verwirklichen.27 Die Mög-
25 Interessant ist der Einfluß dieses Verhältnis auf seine späteren Arbeiten über Rhetorik, wie es E. Behler gezeigt hat, „Nietzsches Sprachtheorie und der Aussagecharakter seiner Schriften", in: Nietzsche-Studien 25 (1996), 64-86; vgl. dazu auch C. Crawford, „Nietzsche's Great Style: Educator of the Ears and of the Heart", in: Nietzsche-Studien 20 (1991), 211-236.
26 Dieser Aufsatz ist ein Niederschlag einer breiteren Untersuchung über Nietzsches musikästhetische Problematik in GT. Ein zentraler Teil meiner Arbeit stellt einen Vergleich zwischen dem metaphysi-schen Hintergrund der Musik bei Schopenhauer und Nietzsche dar. Ich zeige, wie die Variationen in Nietzsches Begriff vom Willen wirken, auch auf seine Benutzung musikalischer Begriffe. Die Begriffe von Rhythmus und Melodie, durch die sich eine implizite Zeitlichkeit der Musik bei Schopenhauer zeigt, erfahren tiefe Schwingungen bei Nietzsche aufgrund der neuen Bedeutung der Zeit des Willens.
27 Der Ansatz wird so bestimmend für Nietzsche, daß er ζ. B. seine Beschäftigung mit Shakespeares Tragödien, als einzige echte tragische Erscheinungen in der Moderne, allein durch diese Perspektive betrachtet. Die Bestimmung des tragischen Charakters von Shakespeares Werken bringt Nietzsche nicht dazu, ihre konstitutiven Elemente zu untersuchen, er sucht einfach die Form der Vorstellung, die am besten mit ihren musikalischen Ursprüngen zusammenpaßt. Die Lösung ist in extremis eine untheatrali-
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
116 Hictor Julio Pirez Lopez
lichkeiten der ästhetischen Erfahrung sind nur auf diese Perspektive orientiert, das Wir-kungsgebiet des Kunstwerks begrenzt sich auf die Teilnehmer an der Vorstellung. Die Forderung, daß der Zuschauer nun Teilnehmer an dem Kunstwerk sein solle, läßt nur eine einzige Möglichkeit für seinen Kontakt mit dem Willen: Er nimmt daran nur durch die Musik teil. Die Erfahrung des Willens wird wieder zu einer Erfahrung seiner Kundgebung innerhalb der Kunst.
Aus diesem Grund wird jede Erfahrung in der Kunst wieder in den auf ihn begrenzten Raum des Willens zurückgeführt. Der politische Wert der Kunst bleibt ein utopischer. Man kann UZ als eine vollständige Antizipation der politischen Implikationen der Kunst in der Geburt der Tragödie bezeichnen. In der Betrachtung des Verhältnisses zwischen der Arti-stenmetaphysik und der politischen Auffassimg Nietzsches von UZ zeigt sich ein Vakuum in der Teleologie des öffentlichen Lebens. Stattdessen wird der Aufführung der griechischen Tragödie die Bedeutung einer sozialen Gleichsetzung aller Menschen zugewiesen. Die Erfüllung der Gleichheit als utopische soziale Bedeutung der Kunst ersetzt alle Hoffnungen auf Gleichheit im politischen Leben. Der politische Wert einer sozialen Situation wird annul-liert und durch eine Teleologie ersetzt, deren Frucht ein flüchtiger Moment der ästhetischen Erfahrung als sozial harmonische Identität aller anbietet.
Kann es der Fall sein, daß Nietzsche somit versucht, den Weg in eine neue Gesellschaft zu weisen? Er benutzt die Kunst, um eine einzigartige Utopie vorzustellen, und er schließt keine Praxisformen aus dem Gebiet der Kunst aus. Das Problem wäre nun folgendes: Obwohl die politische Utopie, wie ζ. B. die Wagnersche in Die Kunst und die Revolution, unerreichbar ist, bleibt Nietzsches Utopie eine utopische Form des Kunstcharakters, die sich nur in der Kunst verwirklichen kann.
Der Radikalismus, mit dem Nietzsche seine metaphysische Teleologie der Kunst als seine einzig mögliche Antwort auf den Schopenhauerschen Nihilismus entfaltet, bringt die Kon-sequenz eines Glaubens, daß die Kunst das einzige Mittel für eine neue Rekonstruktion der Kultur ist. So lassen sich zwei Linien im Programm seiner Kulturkritik erkennen: zum einen die allgemeine Charakterisierung der abendländischen Kultur als einer, die auf dem Ver-trauen in das Bewußtsein basiert und daher auf einem falschen Fundament; zum anderen eine „historische" Re-Interpretation der Kultur, ausgehend von seinem Begriff des Genies, um den positiven Horizont der eigenen Zeit zu bestimmen. Der erste Teil des Programms impliziert eine Ablehnung der Betrachtung der politischen und wissenschaftlichen Formen. Der zweite Teil vervollständigt den ersten durch das Ersetzen der Politik durch die Kunst und der Wissenschaft durch die tragische Erkenntnis.28
sehe Rezitation: „Es gelingt nicht: denn noch im Munde des innerlich überzeugendsten Schauspielers klingt uns ein tiefsinniger Gedanke, ein Gleichniss, ja im Grunde jedes Wort wie abgeschwächt, verkümmert, entheiligt; wir glauben nicht an diese Sprache, wir glauben nicht an diese Menschen und was uns sonst als tiefste Weltoffenbarung berührte, ist uns jetzt ein widerwilliges Maskenspiel. Ver-suchen wir aber nun selbst einmal, das was wir in schweigsamer Ergriffenheit gelesen haben, uns laut mit mimischer Differenzierung der Stimme vorzulesen, so werden wir wiederum darüber perplex, dass uns die eigne Vortragsweise im Gegensatz zu jener Ergriffenheit gänzlich unadäquat, ja unwürdig erscheint." (KSA 7, 290)
28 Über die Konkretisierung von Nietzsches Kulturkritik und die Entwicklung der Ansätze von GT siehe Y. Maikuma, Der Begriff der Kultur bei Warburg, Nietzsche und Burckhardt, Königstein (Ts.) 1985, 56-220.
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM
Gesellschaftspolitische Argumente einer Artistenmetaphysik 117
Das inhärente Unpolitische seines Ausgangspunkts (bei seiner Reaktion auf die Mas-senaktionen der Revolten der Pariser Commune war im übrigen die einzige Tat, deretwegen Nietzsche seine große Enttäuschung äußert, die Zerstörung von Kunstwerken)29 löste eine Radikalisierung von Nietzsches Ansichten in bezug auf die Politik und die Ästhetik aus. In der Politik die Annahme des Elitarismus, in der Ästhetik die Verabsolutierung der Position des Genies. Eine radikalisiertere Tendenz in den politischen Ideen zeigen die später folgen-den Reflexionen über den griechischen Staat, vor allem aber Der griechische Staat selbst. Als Beispiel dieser Richtung gelten die Argumente gegen die Teilnahme der Masse an der Kunst, die wir oben erwähnten. Bei solchen Vorstellungen verliert die Teleologie der Kunst ihre letzte soziale Prägung, überdies zeigen die Vorstellungen das Bild eines Sklaven, dessen Opfer nur für die Kunst ist, da er in seinem Leben keine weitere positive Wirkung erfährt. Die Kunst war auch nicht Selbstzweck, ihr Ziel war der Genius. Allein durch seine Ver-wandlung ist die Welt erlöst. Es ist unwichtig, ob alle erlöst werden oder nicht. Nun bleibt kein utopisches politisches Ideal als letzter Zweck der Kunst mehr. Stattdessen findet man den ausschließlich metaphysischen Sinn der Kunst als einen Verwandlungsakt. Der Genius stellt den Gipfel in der Teleologie der Kosmodizee dar.
Aus beiden Positionen kann Nietzsche verstanden werden. Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? Es scheint, als ob Nietzsche selbst eine wichtige Unterscheidung getroffen hätte. Er entschied sich, alle seine politischen Betrachtungen in UZ aus der Geburt der Tragödie auszuschließen, damit verliert die Erstlingsschrift ihr explizites politisches Pro-fil.30 Andererseits entwickelt und radikalisiert er die entsprechende politische Betrachtung der Geburt der Tragödie als ein unabhängiges Thema in Der Griechische Staat.
Letztlich teilen beide Positionen die Idee einer elitären sozialen Ordnung und einer nicht-demokratischen Auffassung von der politischen Macht, obwohl in der nicht radikalisierten Version die „Gleichheit aller" in der höchsten ästhetischen Erfahrung stattfindet, rechtfertigt sie, wie die andere, eine grausame, elitäre und ungerechte Wirklichkeit.
29 Vgl. den oben genannten Brief an Carl von Gersdorff, in dem Nietzsche sich auf die falsche Nachricht vom Brand des Louvre bezieht.
30 UZ wurde Wagner gezeigt, wahrscheinlich diskutierte er mit Nietzsche über die politischen Aspekte; es kann nicht belegt werden, ob Wagner Nietzsche vorschlug, die politischen Äußerungen von GT auszuschließen.
Brought to you by | provisional accountUnauthenticated
Download Date | 4/12/15 9:07 PM