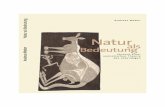Zu Adornos ästhetischer Theorie
Transcript of Zu Adornos ästhetischer Theorie
1
Zu Adornos Ästhetischer Theorie
Von Ruth Sonderegger
»ich drücke das jetzt krass und meiner Gewohnheit entsprechend überspitzt aus«
Adorno, Ästhetikvorlesung, 13. 11. 1958
Vorab
Obwohl Adorno ein aus dem Nachlass herausgegebenes Buch mit dem Titel Ästhetische
Theorie geschrieben hat, kann man nicht in dem Sinn von Adornos ästhetischer Theorie
sprechen wie etwa von Hegels Ästhetik die Rede ist. Grund dafür ist weniger die
Tatsache, dass Adorno seine Ästhetische Theorie nicht fertig stellen konnte (er hatte im Juli
1969 immerhin noch die dritte Umarbeitung des Materials durchführen können: GS 7:
540). Viel schwerer wiegt der Umstand, dass Adornos Theorie des Ästhetischen in erster
Instanz eine Untersuchung über die Möglichkeit solcher Theorie ist. Das meint er nicht
im transzendentalphilosophischen Sinn, wonach erst einmal die notwendigen kategorialen
Fundamente eines Gegenstandsbereichs rekonstruiert werden müssen, bevor die Theorie
loslegen kann. Adorno fragt in einem eminent historischen und letztlich gesellschaftlichen
Sinn, ob es so etwas wie ästhetische Theorie noch gibt und ob es sie – moralisch und
politisch gesehen – überhaupt geben darf. Nicht zuletzt fragt er damit auch nach dem
Vorhandensein und dem Existenzrecht von Kunst. Zusammen mit den Kunstwerken
bleiben Möglichkeit und Sinn ihrer Theorie über das ganze Buch hinweg, welches den
Hauptgegenstand dieses Textes darstellt, prekär. Prägnant und unmissverständlich lautet
deshalb schon der erste Satz der Ästhetischen Theorie: »Zur Selbstverständlichkeit wurde,
dass nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist, weder in ihr noch in ihrem
Verhältnis zum Ganzen, noch nicht einmal ihr Existenzrecht.« (GS 7: 9)
Adorno zufolge war und ist ästhetische Theorie selbst dann ein prekäres Unterfangen,
wenn sie sich um die Existenz ihrer Objekte keine Sorgen machen müsste. Denn
ästhetische Objekte sind so ephemer und Kunstwerke derart singulär, dass theoretische
Verallgemeinerungen und Vergleiche zwischen ihnen Gefahr laufen, schlicht und einfach
zu verpassen, was sie begreifen wollen. Die Tatsche, dass Adorno bis fast zum Ende
seines Lebens keine Ästhetik geschrieben hat, dafür aber unzählige kunstkritische Texte
sowie Abhandlungen zu einzelnen Künstlern und Künsten kann man auch als Ausdruck
2
der Auffassung verstehen, dass ästhetische Phänomene nach anderen Formen der
theoretischen Reflexion verlangen als nach großen theoretischen Gebäuden. Gleichwohl
hat Adorno seit den 1950-er Jahren wiederholt Vorlesungen zur Ästhetik gehalten und in
seinen letzten Jahren intensiv an der Ästhetischen Theorie gearbeitet. Vor diesem
Hintergrund ist es so wichtig wie schwierig, die Ästhetische Theorie mit den Formaten der
kunstkritischen und kunsttheoretischen Essays und nicht zuletzt mit den
kunstsoziologischen Abhandlungen Adornos ins Verhältnis zu setzen.
In der Ästhetischen Theorie geht es um die reflexive (im Unterschied zu einer induktiven)
Entwicklung eines normativen Begriffs des Kunstwerks im Ausgang von spezifischen
Objekten: Kunstwerken der Gegenwart. Gelingt diese Reflexion, dann sind auch
Antworten auf Herausforderungen der Gesellschaftskritik gefunden, ja es ist sogar etwas
über die Möglichkeit von Glück gesagt. Fast alle Wörter dieser knappen Umschreibung
von Adornos Projekt sind klärungsbedürftig. Womit man bei der Klärung anfängt, ist
nach Adorno einerlei. Stärker noch: Die Abwesenheit eines Grundbegriffs oder
ursprünglichen Phänomens, von dem alles andere abhinge, ist eine leitende Hypothese
der Ästhetischen Theorie.
Krass falsch wäre demnach die Suggestion einer Reihenfolge oder gar Hierarchie der
Probleme, welche Adorno in der Ästhetischen Theorie durchdenkt. Mit Grund hat er die
ursprünglich geplante Einteilung in Kapitel oder Paragraphen schließlich zugunsten eines
nur durch Spatien gegliederten, durchlaufenden Texts aufgegeben. (GS 7: 540) Dieses
anti-hierarchische Denken setzt sich fort in der Konstruktion des parataktischen, d. h.
neben- statt unterordnenden Verhältnisses zwischen den Sätzen – sie lesen sich oftmals
beinahe wie Listen von Thesen –, ja bis in die Sätze hinein. Die Haupt- und Nebensachen
üblicher deutscher Sätze werden bei Adorno häufig umgedreht. Es wurde nicht zur
Selbstverständlichkeit, »dass nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist ...«
sondern: »Zur Selbstverständlichkeit wurde, dass ...«. So bemerkt der Herausgeber und
Übersetzer der neuen englischen Ausgabe, dass die Ästhetische Theorie einem
amerikanischen Kontext feindlich gesinnt sei, weil sie sich nicht an die Leser richte,
sondern an die Sache an sich (Hullot-Kentor: 2004, IX). Man kann sich mit Grund
fragen, ob dasselbe nicht genauso für den deutschen Kontext gilt.
Adornos Konstruktion ernst nehmend soll im Folgenden nicht der gesamte Verlauf der
Ästhetischen Theorie rekonstruiert werden. Wir springen mitten hinein. Ich werde mich
3
dabei auch auf Adornos Ästhetik Vorlesungen von 1958/59 (NL 4/3) sowie von 1961/62
(im Adorno-Archiv der Akademie der Künste in Berlin einsehbar) stützen, die wichtige
Vorarbeiten enthalten. Darüber hinaus erreicht Adornos Denken in den Vorlesungen
zeitweise einen Grad an Lebendigkeit, ja eine Leichtigkeit, der einen an der
Notwendigkeit mancher hermetischen, aber auch düsteren Zügen der Ästhetischen Theorie
zweifeln lässt. Es ist, als hätte Adorno im Austausch mit Studierenden, auf deren
Nachfragen er ganze Vorlesungen lang eingeht, sowohl der Kunst als auch der
Kunsttheorie mehr zugetraut als im einsamen Schreiben.
I. Steinbruchstücke ästhetischer Theorie
Obwohl Kunstwerke im Zentrum seines Interesses stehen, hat Adorno Vorlesungen zur
»Ästhetik« gehalten und seinem letzten großen Buch den Titel Ästhetische Theorie gegeben.
Er hat seine kunsttheoretischen Überlegungen also nicht, wie man erwarten könnte, mit
»Kunsttheorie« oder »Philosophie der Kunst« überschrieben, sondern den viel weiteren
Begriff der Ästhetik bevorzugt. Dieser ist bekanntlich seit der Antike für Theorien des
Schönen und der Wahrnehmung benutzt worden, seit A. G. Baumgarten zudem für
Theorien der sinnlichen Erkenntnis. Adornos Festhalten am Ästhetik-Begriff hat
einerseits wohl damit zu tun, dass er das Naturschöne, welches gewöhnlich dem
Kunstschönen entgegen gesetzt wird, als integralen Bestandteil der Kunst begreift. Hinzu
kommt andererseits, dass Adorno Züge des Schönen, wie sie insbesondere von Plato im
Symposium und im Phaidros beschrieben worden sind, gerade auch für eine gegenwärtige
Kunst geltend macht, die er als notwendig dissonant und »von der Grundfarbe schwarz«
(GS 7: 65) charakterisiert.
Naturschönes
Noch bevor das Kunstschöne an der Reihe ist, widmet die Ästhetische Theorie einen
längeren Abschnitt dem Naturschönen. (GS 7: 97-121) Adorno zufolge ist es skandalös,
dass das Kunstschöne seit Hegel als das glatte Gegenteil des Naturschönen gilt, sofern
ihm im Zusammenhang mit Kunst überhaupt Aufmerksamkeit geschenkt wird. Für
Adorno ist Kunst ohne das Naturschöne gar nicht zu begreifen. Dabei geht es ihm weder
um (antike) Nachahmungstheorien noch um eine Wiederbelebung von Kants Theorie der
4
subjektiven Erfahrung des Naturschönen. Während die Nachahmung des jeweils als
natürlich Geltenden sich alles vom jeweiligen status quo vorgeben lässt und diesen
reproduziert, ist Kants Theorie des Schönen letztlich nur an den Erfahrungen und
Vermögen des Subjekts interessiert. Beides ist für Adorno gleichermaßen inakzeptabel.
Seine These lautet, dass Kunst nicht die Natur, sondern das Naturschöne nachahmt oder
vielmehr nachahmen soll. Der Ästhetischen Theorie geht es nämlich nicht nur um eine
empirische Bestandsaufnahme gegenwärtiger künstlerischer Praktiken. Mindestens ebenso
wichtig ist die Entwicklung normativer Kriterien gelungener Kunstwerke im Ausgang von
Beobachtungen an einzelnen Objekten und Analysen von Begriffen der
kunsttheoretischen Tradition. Oder anders gesagt: konkrete ästhetische Erfahrungen,
Begriffs- und Kunstkritik sind die Grundlagen von Adornos Überlegungen zu einem
normativen Kunstbegriff. Mit dieser Normativität geht es ihm um Kriterien des
ästhetischen Urteils – letztlich um eine grundlegende Möglichkeit von Kritik. Die
Beschäftigung mit Kriterien des ästhetischen Urteils ist Adorno zufolge allerdings keine
Spezialaufgabe für Kunstphilosophen. Sich mit einem (modernen) Kunstwerk zu befassen
bringt die Erfahrenden fast zwangsläufig dahin, Beurteilungskriterien aus dem jeweiligen
Kunstwerk heraus zu entwickeln. Adorno geht nämlich davon aus, dass Kunstwerke nach
dem Zerfall von Regelästhetiken ihre eigene Logik und damit auch Beurteilbarkeit jeweils
erst herstellen müssen, indem sie die im Singular »Kunst« aufgespeicherten Kriterien
weiterentwickeln. Dieses durch und durch frühromantische, vor allem an Schlegel
orientierte Verständnis von Kunstkritik übernimmt Adorno von Benjamin (Benjamin
1980).
Im Horizont dieses normativen Kunstverständnisses sind auch Adornos Ausführungen
zum Naturschönen zu begreifen. Adorno zufolge wandelt sich das Naturschöne im Lauf
der Geschichte. Der Übergang zwischen Natur- und Kulturlandschaften beispielsweise ist
ständig im Fluss begriffen. Deshalb kann das Naturschöne nicht losgelöst von der
menschlichen Wahrnehmung sowie ihren gesellschaftlichen Voraussetzungen begriffen
werden. Gleichwohl ist das Entscheidende am Naturschönen – aus der Perspektive der
Kunst, aber letztlich weit über diese hinaus –, dass hier »ein nicht von Menschen
Gemachtes spricht«, was Adorno auch als den »Ausdruck« des Naturschönen bezeichnet.
(GS 7: 111) Obwohl das Naturschöne als zwingend, ja umwerfend und überwältigend
5
erfahren werde, bleibe es in seiner »Nichtgemachheit« unverständlich und fremd – auf
Distanz.
So steht Naturschönes für das ein, was Adorno seit der Dialektik der Aufklärung »Vorrang
des Objekts« nennt – oder vielmehr fordert. Er klagt damit ein Verhalten zu
menschlichen, aber gerade auch nicht-menschlichen Phänomenen ein, welches das
Gegenüber im Wahrnehmen, Handeln und Denken nicht unter vorgefertigte
Erwartungen und Kategorien einordnet, sondern in seinem Eigenrecht, ja seiner
Unverständlichkeit und der damit verbundenen Übermacht zur Geltung kommen lässt.
Auf diese Weise könnte ein Ausweg aus jener Logik der zwanghaften Kontrolle gefunden
werden, die Fremdes entweder unter schon Bekanntes subsumiert oder es real bzw. durch
Verdrängung vernichtet. Dieses identifizierende Verhalten ist Adorno zufolge bekanntlich
dafür verantwortlich, dass die gewaltsame abendländische (Eroberungs-)Geschichte von
Anfang an mit großer Konsequenz auf die massenhafte Vernichtung von Menschen und
Natur zusteuerte, welche das 20. Jahrhundert zur selbstverschuldeten Katastrophe werden
ließ. Dagegen erhebt das Naturschöne Einspruch, denn es »ist die Spur des
Nichtidentischen an den Dingen im Bann universaler Identität«. (GS 7: 114) Diese Spur
und vor allem ihr »Doppelcharakter« (GS 7: 111), demgemäß das Naturschöne etwas für
Menschen Zwingendes hat, obwohl es sich menschlicher Verständlichkeit entzieht, ist es,
welchen das Kunstwerk Adorno zufolge nachahmt. Deswegen ist »Kunst, anstatt
Nachahmung der Natur, Nachahmung des Naturschönen« (GS 7: 111).
Wie eine solche Nachahmung von Naturschönem in der Kunst aussehen könnte,
verdeutlicht Adorno an den Dramen Shakespeares: Sie bilden nicht Wolken ab, sondern
inszenieren das dramatische, so logische wie unverständliche Spiel der Wolken auf der
Ebene von Handlungskonstellationen. (GS 7: 111) Vor diesem Hintergrund ist nichts
falscher als die Schlussfolgerung Hegels, die Unbestimmtheit des Naturschönen sei der
Beweis seiner Unterlegenheit gegenüber der Kunst. In den Augen Adornos ist dieses
Unbestimmte gerade der Kern von Kunst – wenngleich in einer signifikanten
Verwandlung: Während das Naturschöne nur im Modus vollkommener Flüchtigkeit
existiert und sich jedem Versuch, es zu präparieren, willentlich herbei zu zitieren oder gar
zu wiederholen – kurz: es mit menschlichen Mitteln zu machen – entzieht, besteht die
Pointe des Kunstschönen darin, das Sich-Entziehende auf Dauer zu stellen. Darin ist das
Kunstschöne noch paradoxer und wunderlicher als das Naturschöne.
6
Mimesis und Konstruktion des Kunstwerks
Adornos Kategorien für dieses Sich-Entziehende auf der Ebene der Kunst sind
»Mimesis« und »Ausdruck«. Ihren Gegenpol, den Aspekt des intentional Gemachten der
Kunstwerke, bezeichnet er als »Geist« oder »Konstruktion«. Für all diese – nicht zuletzt
von der traditionellen Ästhetik geprägten und vorbelasteten – Begriffe gilt, dass Adorno
ihnen im Kontext seiner Kunsttheorie neue Bedeutungen zuwachsen lässt. Sein Verfahren
der Begriffsverschiebung ist keine einfache (Neu-)Definition, denn Definitionen sind ihm
»rationale Tabus« (GS 7: 24). Adornos Zentralbegriffe kommen dadurch in Bewegung –
und bleiben es durch die ganze Abhandlung hindurch –, dass Adorno das unabgegoltene
normative Potential von Begriffen der Ästhetik-Tradition im Licht einiger
paradigmatischer Kunstwerke immer wieder neu von ihrem Ideologischen zu trennen
versucht. Das ist einer der Gründe für die rhizomartige Struktur des Textes und auch für
alle Probleme, die man sich aufhalst, wenn man beginnt, Adornos Ästhetische Theorie
zusammen zu fassen.
Ganz nebenbei schreiben Adornos Begriffsanalysen auch eine Geschichte der
Veränderung ästhetischer Kategorien. Dabei erweist sich gerade die Geschichte der Kunst
und des Kunstdiskurses als viel mehr denn jene Ansammlung von Leid und Barbarei, die
Adorno oft zum Vorwurf gemacht wurde. In Bezug auf die Geschichte der Kunst ist
sogar häufig von einem Fortschritt die Rede, den man leicht übersieht, wenn man Adorno
einmal in den Topf der Verblendungszusammenhangsliebhaber geworfen hat: »Alle
Musik war einmal Dienst, um den Oberen die Langeweile zu kürzen, aber die Letzten
Quartette sind keine Tafelmusik« (GS 5: 47).
Am Begriff der Mimesis hebt Adorno weniger das (aristotelische) Moment des
Nachmachens hervor als vielmehr den Aspekt des Sich-gleich-Machens und passiven
Sich-Überlassens. Es geht ihm um die rückhaltlose Hingabe an ein Gegenüber, ohne zu
wissen, wohin das führt. So wird Mimesis zum Gegenteil des Nachmachens, welches
einen status quo bestätigt oder eine Ähnlichkeit nur zum Zweck der listigen Täuschung
eingeht. Diese repressiven Züge der Mimesis haben Adorno und Horkheimer in der
Dialektik der Aufklärung mit Bezug auf die Entstehung der abendländischen Rationalität
und ihre antisemitischen und rassistischen Effekte analysiert. Im Gegensatz dazu steht
7
»Mimesis« im Kontext von Adornos Kunsttheorie für eine Öffnung auf das hin, was jede
Aneignung, ja jede Kalkulation übersteigt.
In der fortgeschrittenen Moderne – exemplarisch bei Kafka und Beckett – ist rückhaltlose
Mimesis vor allem eine ans Verdinglichte und an das Tote geworden. Die künstlerisch-
mimetische Erforschung dieser Adorno zufolge allgegenwärtig gewordenen Phänomene
ist oft als Übertreibung oder Parodie von Entfremdung gesehen worden. Das zeigt aber
nur, welche verfremdende Sprengkraft eine radikale Hingabe an Realität haben kann. Man
mag darüber streiten, ob das Verdinglichte und das Tote die einzig relevanten
Gegenstände künstlerisch-mimetischer Strategien in der Gegenwart sind; Adorno ist es
vor allem darum zu tun, mimetische Angleichung vom Abbilden ebenso zu unterscheiden
wie vom Protest gegen das Verdinglichte: »Moderne ist Kunst durch Mimesis ans
Verhärtete und Entfremdete; dadurch, nicht durch Verleugnung des Stummen wird sie
beredt ... Weder eifert Baudelaire gegen Verdinglichung noch bildet er sie ab; er
protestiert gegen sie in der Erfahrung ihrer Archetypen.« (GS 7: 39)
Mimesis taucht in der Ästhetischen Theorie aber auch noch in einem ganz anderen Kontext
auf: dort nämlich, wo es um die Ähnlichkeit des Kunstwerks mit sich selbst und damit um
seine Abgeschottetheit gegenüber dem Außen – letzten Endes also um die Autonomie
der Kunst – geht. Adornos Reflexionsweg von der Mimesis zur Autonomie ist dabei
folgender: Die Mimesis der Kunst verweist auf Praktiken, die dem vergleichbar und
funktional Machen – all dem, was Adorno Tausch oder »Füranderssein« (GS 7: 159) im
Gegensatz zu einem Sein um seiner selbst willen nennt – diametral entgegen gesetzt sind.
Deswegen sorgen gerade die mimetischen Züge von Kunstwerken dafür, dass sich solche
Gebilde aus der Welt umso mehr zurückziehen, je stärker sie sich der Vergleichbarkeit,
Verstehbarkeit und Funktionalisierung widersetzten; d. h. je rückhaltloser sie sich dem
verschreiben, was sie nur um seiner selbst willen praktizieren und sind. Deshalb kann
Adorno sagen: »Die Mimesis der Kunstwerke ist Ähnlichkeit mit sich selbst.« (GS 7: 159)
Adornos verzweigte Überlegungen zum Mimesisbegriff verdeutlichen nicht nur
beispielhaft, wie grandios er in der Lage ist, der traditionellen ästhetischen Theorie
Begriffe zu entwenden und sie von randständigen, noch kaum realisierten
Bedeutungssplittern her wieder neu zusammen zu setzten. Sie zeigen auch, wie unmöglich
es ist, Bedeutungskerne eines Konzepts herauszulösen oder gar zu isolieren, wenn man
Adornos Begriffsarbeit folgt. Vor allem deshalb, weil seine Reflexion bei der
8
Rekonstruktion emphatischer, bislang kaum beachteter Gehalte nicht stehen bleibt,
sondern sich auch gleich den Problemen der soeben rekonstruierten Potentiale zuwendet:
Soweit die Mimesis Sichselbstgleichheit als Autonomie des Kunstwerks erzeugt,
produziert sie auch Schein. Sie behauptet eine Losgelöstheit der Kunst vom Rest der
Welt, die ganz und gar verlogen ist: »Die mimetische Verhaltensweise selbst, durch welche
die hermetischen Werke gegen das bürgerliche Füranderessein angehen, macht sich
mitschuldig durch den Schein des reinen An sich ...« (GS 7: 159).
Nicht besser ist es um das Ideal der mimetischen Hingabe ans Andere, sei es das
Lebendige oder das Tote, bestellt. Es läuft immer Gefahr regressiv zu werden und ist
deshalb genauso auf eine kritische Gegenkraft angewiesen wie die scheinhafte Autonomie
des Kunstwerks. Wenn Adorno von solchen kritischen Gegenbewegungen spricht und sie
als Theoretiker auch selbst vollzieht, dann geht es nie um einen Punkt, an dem die gute
Autonomie oder die richtige Mimesis ein für allemal erreicht und gegen mögliche Feinde
und Ideologien abgesichert wäre. Das Ziel lautet vielmehr, im Wissen um das Prekäre
alles temporär erreichten Richtigen alert genug zu sein für die Momente, wo es wieder
falsch wird. Deshalb sagt Adorno schon am Beginn der Ästhetischen Theorie, Kunst und
Kunsttheorie seien bestenfalls prekäre Phänomene. Wie für alle anderen Begriffe, die
Adorno für seine Ästhetische Theorie rekonstruiert, gilt auch für den der Mimesis, dass er
nicht als solcher gut oder richtig ist. Gut und richtig ist, die verborgenen Potentiale und
ideologischen Abgründe von Begriffen zu erforschen. Und Begriffe adäquat zu
reflektieren heißt, sie als Kraftfelder, ja als Kampfschauplätze zu entfalten und sich in den
Kampf einzumischen.
Die Gegenkraft, die im stimmigen Kunstwerk die mimetischen Züge davor bewahrt, sich
regressiv im Anderen aufzulösen – und damit das Tote oder das Verdinglichte
beispielsweise einfach nur zu affirmieren oder den Schein einer vollkommenen
Kunstautonomie zu bestärken –, diese Gegenkraft bezeichnet Adorno als »Konstruktion«.
Damit ist die Seite des aktiven, ja kontrollierenden Produzierens gemeint. Adornos
Ästhetischer Theorie zufolge ist die Konstruktion aus der Montage hervorgegangen und stellt
eine radikalisierte Form des Komponierens dar. An der Montagetechnik bemängelt er in
diesem Kontext, dass sie noch zu viele vorgefundene Elemente einfach übernimmt, ohne
sie bis in alle Einzelheiten zu zerlegen und zu analysieren. Ganz Ähnliches gilt für den
Kompositionsbegriff. Wie die Montage ist die Komposition Adorno zufolge eine
9
überholte Vorform der Konstruktion: »Von Komposition in einem weitesten Verstande,
der die Bildkomposition deckt, unterscheidet Konstruktion sich durch die rückhaltlose
Unterwerfung nicht bloß alles von außen ihr Zukommenden sondern aller immanenten
Teilmomente; insofern ist sie die verlängerte subjektive Herrschaft, die, je weiter sie
getrieben wird, desto gründlicher sich verdeckt.« (GS 7: 91)
Damit ist schon angesprochen, dass auch in Hinsicht auf den Konstruktionsaspekt des
Kunstwerks die Probleme nicht auf sich warten lassen. Sofern das Kunstwerk
Konstruktion ist, täuscht es über Herrschaft ebenso hinweg wie die Konstruktion letztlich
– eben weil sie so konsequent und logisch verfährt – etwas Glättendes, ja Harmonisches
hat. (GS 7: 90 f.) Während die mimetischen Kräfte des Kunstwerks eine regressiv
anpasslerische Tendenz haben, neigen die konstruktiven dazu, sich umwillen der
Konstruktionsprinzipien über alles hinweg zu setzten. Interessanterweise sind die
Konsequenzen beide Male dieselben: Es entsteht eine harmonischen Einheit oder
zumindest der falsche Schein davon.
Notwendig geworden sind diese radikalen – im Sinn von: selbstzerstörerischen –
Bewegungen der Mimesis und der Konstruktion in dem Moment, wo es keine
verbindlichen Formen, Genres, Stilvorgaben, kurz gesagt: Regeln mehr gab. Nun müssen
Kunstwerke auf immer singulärere Weise die eigenen Regeln aus dem Material heraus
entwickeln und dazu dieses Material seinerseits unbarmherzig Gesetzen unterwerfen, die
ihm äußerlich, ja gänzlich fremd sind: »Nachdem [...] verpflichtende Normen der
künstlerischen Gestaltung ... für die moderne Kunst nicht mehr existieren [...], kann all
das eben nur dadurch geleistet werden, dass die verschiedenen einzelnen Momente eines
Kunstwerks in einen Strukturzusammenhang treten, der in sich selbst, in jedem einzelnen
Kunstwerk, ein ganz und gar durchgebildeter, ein ganz und gar konsequenter im Sinn
einer bestimmten nun wirklich nur der Kunst eigentümlichen Logik ist [...]; und der
Inbegriff eben dieser inneren Organisation des Kunstwerks, das wäre der Begriff seiner
Konstruktion.« (NL 4/3: 211 f.)
Verzeitlichung des Kunstwerks und seines Gelingens
Indem Adorno Kunstwerke von den Praxisformen Mimesis und Konstruktion her
erläutert, die gegeneinander prozessieren und sich darin auch korrigieren, versteht er das
Kunstwerk als einen stillgestellten Prozess. Es wohnt ihm eine zeitliche Dynamik inne,
10
und zwar nicht nur, wenn das Kunstwerk eine Performance, ein Film oder ein Stück
Musik ist, sondern auch im Fall von Bildern oder minimalistischen Skulpturen. Adorno
betont in diesem Zusammenhang immer wieder, dass diese Prozessualität nicht mit der
Zeit der ästhetischen Erfahrung identisch ist; und er hebt noch viel energischer hervor,
dass es nicht das Subjekt der ästhetische Erfahrung ist, welches diese Dynamik
produziert. So sehr Kunstwerke auch Adorno zufolge auf einen Nachvollzug durch
Rezipienten angewiesen sind, so wenig würde die subjektive Erfahrung die
antagonistische Prozess-Struktur mimetischer und konstruktiver Momente aufweisen,
wenn diese Dynamik nicht objektiv im Werk aufgespeichert, zum »Bild« stillgestellt wäre.
Adornos Prozessualisierung der Kunst impliziert, dass an die Stelle der üblichen
Aufteilungen in Inhalt und Form oder Techniken des Darstellens im Unterschied zum
Dargestellten ein weitaus komplexeres Modell tritt: Zwei einander entgegengesetzte
Praktiken – Mimesis und Konstruktion – verhalten sich wechselseitig kritisch
korrigierend, ja sogar einander ausschließend zu dem, was Adorno »Material« nennt. Zu
diesem Material gehören Figurenkonstellationen, die üblicherweise auf die Seite des
Inhalts geschlagen wurden, ebenso wie Reste von Stilelementen, Formprinzipien,
technische Errungenschaften, Gegenstände der Alltagskultur oder der Wissenschaft,
Theoreme und Theorien, Handlungsszenarien, Orte etc. Mimesis und Konstruktion
müssen sich an solchem vorgefundenen Material entzünden und mimetisch aus ihm
heraus bzw. konstruktiv in es eingreifend praktiziert werden. In beiden Fällen geht es
darum, Aspekte am jeweiligen historisch indexierten Material zu (er-)finden, die sowohl
im künstlerischen als auch im nichtkünstlerischen Umgang mit ihm bislang verdeckt
waren. Nur so entsteht jenes Neue, welches Adorno zufolge ein essentielles Moment der
Kunst der Moderne darstellt, und zwar ein Moment des Glücks: das Glückvolle des noch
nicht Domestizierten (NL 4/3: 66; GS 7: 31-56; in seinen Ästhetik Vorlesungen von 1961
hat Adorno dem Neuen ein halbes Semester gewidmet.) Eine nur selten explizit gemachte
Unterstellung Adornos ist dabei, dass die aus der Realität entführten Materialien der
jeweiligen Gegenwart entstammen oder für diese (wieder bzw. noch immer) relevant sein
müssen. Diese Unterstellung erklärt auch Adornos Forderung, dass Kunsttheorie von
Gegenwartskunst ausgehen müsse, sowie seine These, wonach Kunstwerke vor allem zur
Zeit ihrer Entstehung kritisch sind (GS7: 339).
11
Adorno zufolge führt das Ineinander von mimetischen und konstruktiven Impulsen im
Fall gelungener Kunstwerke zu einer (nur) der Kunst eigenen, in diesem Sinn also
autonomen »Logizität«. Sie unterscheidet sich von der außerkünstlerischen Logik
dadurch, dass sie a-teleologisch vorgeht und dementsprechend nicht in Urteilen
kulminiert, wenngleich Urteile, Thesen oder Weltanschauungen als Material sehr wohl
eine Rolle spielen. Dass Kunstwerke an solchem durchaus verständlichem Material durch
Mimesis neue, fremde Schichten zutage fördern, dürfte der Grund dafür sein, dass der
Kunst welterschließendes Potential auch dann zugesprochen wird, wenn man keine
Urteile oder Aussagen aus ihr herauspressen kann. Unverständlich bleibt insbesondere der
Zusammenhang der materialen, wie auch immer Neues erschließenden Elemente, und
zwar aufgrund der Konstruktionslogik von Kunstwerken. Sie besteht darin, dass
Materialien nach Gesetzen etwa der Gestalt, des Klangs, der Laute, Buchstaben, etc. so
aufeinander bezogen werden, dass äußer-ästhetische Verknüpfungen – zumal die logisch-
argumentativen – außer Kraft gesetzt werden. Adorno spricht angesichts dieser
unlogischen künstlerischen Logizität auch von der Sprachähnlichkeit der Kunst. Man
meint, ihre Logik verstehen zu können als wäre sie eine sprachliche, und kann doch nicht
sagen, was das Kunstwerk sagt. (Wellmer 2009)
Gerade in der verknappten Form einer Zusammenfassung lesen sich Adornos
Ausführungen zum agonalen Verhältnis zwischen Mimesis und Konstruktion wie eine
Rezeptur für das Gelingen von Kunst; wie ein Maßstab, der die guten von den schlechten
Kunstwerken trennt. Adorno schiebt solchem Rezept-Denken jedoch nicht nur durch
seine explizite Kritik an Regelästhetiken zugunsten einer Theorie, wonach jedes Werk
seinen eigenen Maßstab etabliert, einen Riegel vor. Er stellt solche Referenzen auf
Regelästhetiken auch dadurch in Frage, dass er die Gefahren der mimetischen und
konstruktiven Verfahrensweisen ins Zentrum stellt – kaum dass er sie genannt hat.
Unablässig weist er darauf hin, dass die welterschließende Kraft der Mimesis sich immer
am gefährlichen Abgrund der Verwandlung von Kunst in (nützliche) Erkenntnis aufhält.
Nicht weniger groß ist die Gefahr, dass die konstruktive Herstellung eines formal
stimmigen Zusammenhangs das Kunstwerk zum angenehmen Spielwerk verkommen zu
lassen. (GS 7: 26; NL 4/3: 78) Letzteres ist das vielleicht schlimmste Vergehen gegen eine
Hegelsche Forderung, auf die sich Adorno immer wieder affirmativ beruft: »Denn in der
12
Kunst haben wir es mit keinem bloß angenehmen oder nützlichen Spielwerk, sondern [...]
mit einer Entfaltung der Wahrheit zu tun« (HW 15: 573).
Adornos Zweifel an Anleitungen zum gelungenen Kunstwerk kommen auch darin zum
Ausdruck, dass er in seinen theoretischen Reflexionen alle nur möglichen Zweifel am
Gelingen von Kunst und ihrer Theorie betont; gemäß der Maxime aus der Dialektik der
Aufklärung, wonach »nicht das Gute sondern das Schlechte [...] der Gegenstand der
Theorie« ist. (GS 3: 247) In seinen kunstkritischen Texten zu einzelnen Werken oder
Künstlern geht Adorno den umgekehrten Weg. Getreu dem Schlegelschen Diktum, dass
nur die gelungensten Werke es verdienen, kritisiert zu werden, schreibt Adorno fast nur
über solche Kunst, die er große oder emphatische nennt. Auf diese Weise macht er
deutlich, dass – wenn überhaupt – Maßstäbe der Beurteilung aus einzelnen Kunstwerken
gewonnen werden müssen. Und er lässt keinen Zweifel daran, dass man mit
»Invarianten«, die aus den gelungensten Kunstwerken herausdestilliert wurden, nicht weit
kommt – selbst wenn es solche Invarianten gibt. Sie sind keine Wesensmerkmale, sondern
helfen, die geschichtlichen Bewegungen der Kunst zu registrieren: »Nun meine ich, dass
diese sogenannten Invarianten, also die abstrakte Neige, auf die die Kunstwerke zu
bringen sind, nicht ihr Wesen abgibt und dass diese Invarianten [...] mit dem, was an den
Gebilden, den Stilen, den ästhetischen Ideen geschichtlich ist, in Konfigurationen treten
und dass sie je nach der Konfiguration, in der sie sich finden, selbst auch eine ganz andere
Bedeutung und einen ganz anderen Stellenwert annehmen.« (Ästhetikvorlesung 1961/62:
11, Theodor W. Adorno Archiv, Frankfurt am Main, Vo 6365.) Denn ein essentieller Zug
und Aspekt der Stimmigkeit des Kunstwerks ist der Bezug auf konkrete Orte und Zeiten.
Oder anders gesagt: Qualität und Gelingen sind temporäre, prekäre Phänomene.
Rätsel und Wahrheit der Kunst
Sowohl den mimetischen als auch den konstruktiven Züge eignet, wie gesagt, aufgrund
ihrer Konsequenz auch eine gewisse Verständlichkeit: In Bezug auf die mimetischen
spricht Adorno von Ausdruckshaftigkeit, in Bezug auf die konstruktiven von Logizität.
Doch in ihrer gegeneinander prozessierenden Verschränkung produzieren diese
Verhaltensweise – idealiter zumindest – rätselhafte Gebilde; vor allem dann, wenn man sie
mit den Augen der außerästhetischen Logiken von Ursachen und Wirkung, Grund und
Folgerung, Prämissen und Schlüssen betrachtet; also mit den Augen von Wesen, die wir
13
auch sind: konsequent, ja strategisch denkende, pragmatisch handelnde, Lösungen
suchende Tiere. Sätze, welche nicht in Folgerungsbeziehungen stehen, wirken aus dieser
Perspektive ebenso rätselhaft oder einfach lächerlich wie Opernfiguren, die im Sterben
Arien singen.
Die Rezeptionshaltung, die es bei der Rätselhaftigkeit – und damit letztlich Verrätselung –
der Kunst bewenden lässt, wird dem Kunstwerk allerdings nicht gerecht. Ebenso
inakzeptabel ist es für Adorno, das Kunstwerk als sinnloses (oder auch lukrativ
verwertbares) Chaos behandelt. In beiden Fällen akzeptiert man die autonome
Sondersphäre der Kunst auf eine ideologische Weise und entwertet damit die Kunst.
Angemessen ist dem Kunstwerk nur jene Haltung, die das Verhältnis zwischen seiner
internen Logizität und der Logik seines gesellschaftlichen Kontexts zu begreifen versucht.
Dieses Verhältnis bezeichnet Adorno als den Wahrheitsgehalt – manchmal auch einfach
Gehalt oder Wahrheit – des Kunstwerks.
Dieser Wahrheitsgehalt ist nicht mit dem sog. Inhalt zu verwechseln und schon gar nicht
mit Intentionen oder Weltanschauungen der Künstlerin. Er verweist vielmehr auf etwas
Objektives im zweifachen Sinn: auf bewusstlose Geschichtsschreibung (NL 4/3: 256),
aber auch auf Verhältnisse, die das hier und jetzt Machbare übersteigen. Genau
genommen ist »Wahrheitsgehalt« ein relationaler Begriff. Er bezieht sich auf das
Verhältnis zwischen dem Kunstwerks und der Welt, aus der es kommt und von der es nie
ganz loskommt. Anders gesagt: Der Wahrheitsgehalt betrifft das Verhältnis von Kunst
und Gesellschaft. Eine der vorsichtigsten, aber auch prägnantesten Formulierungen des
Wahrheitsgehalts findet sich in Adornos Ästhetik Vorlesungen von 1958/59: »Das, was
man nun vielleicht als den Gehalt des Kunstwerks definieren könnte [...] das würde dann
vielleicht die Art sein, in der diese Synthesis – also dieser Prozess der Momente des
Kunstwerks in ihrer Beziehung zueinander, der dann zugleich auch das Resultat des
Ganzen ist –, die Beziehung, in der diese Synthesis nun steht zu der Realität. Dieses
Verhältnis – dieser Quotient [...] – zwischen dem lebendig gefüllten Formgesetz eines
Werkes und der Realität, auf die es wie immer auch vermittelt, bezogen ist, das könnte
man vielleicht sinnvollerweise als den Gehalt des Kunstwerks bezeichnen, der damit
etwas Verschiedenes wäre nicht nur von dem Stoffgehalt, sondern etwa auch von dem
sogenannten ideellen Gehalt oder gar der sogenannten ›message‹« (NL 4/3: 330 f.).
14
Der Wahrheitsgehalt als dieser Quotient, den das Kunstwerk durch die a-teleologische
Verknüpfung seiner materialen Elementen gewissermaßen verkörpert statt ihn als
Aussage oder Liste von Thesen zu formulieren, muss Adorno zufolge von der Kritik oder
der Philosophie ausbuchstabiert und ineins damit auch beurteilt werden. Dabei versteht er
unter Philosophie weniger eine bestimmte Disziplin als den »Gedanke(n), der sich nicht
Halt kommandieren lässt« (Ästhetikvorlesung 1961/62: 33) und Phänomene welcher Art
auch immer ihrer Unmittelbarkeit entreißt. Erst aus einer solchen denkenden
Außenperspektive, welche so normative Fragen stellt wie die, was das denn soll, was man
als Kunstwerk erfahren oder vielleicht aus Mangel an passenden Begriffen auch nur so
bezeichnet hat, welchen Anforderungen es (nicht) gerecht wird etc. Mit anderen Worten:
Adorno zufolge braucht das Kunstwerk – weniger zu seiner Vollendung als vielmehr zum
bloßen Existieren – die Kritik.
Erst die Konfrontation mit normativen Fragen, die Adorno mit dem Sammelbegriff
Wahrheit umschreibt, kann das Kunstwerk aus der Harmlosigkeit seiner bloßen
Gegebenheit oder Andersheit befreien. Im Idealfall verläuft diese philosophische
Konfrontation so, dass dabei auch die Maßstäbe, mit denen man zu kritisieren beginnt,
verändert werden, und eben kein Halten ist beim Fragen und Antworten. Dabei macht
Adorno explizit darauf aufmerksam, was für verschiedene Dimensionen gemeint sind,
wenn von der Wahrheit der Kunst die Rede ist: erstens eine gegenständliche Dimension
in Bezug auf das Dargestellte, zweitens eine psychologische Wahrheit bzw. Wahrheit des
Ausdrucks, drittens der formalen Stimmigkeit und schließlich viertens der
Wahrheitsgehalt, der alles mit einer »bewusstlosen Geschichtsschreibung« zu tun haben
soll. Diesem Wahrheitsgehalt arbeiten die ersten drei Wahrheitsdimensionen zu bzw. sie
schmälern ihn, wenn einer der beteiligten Wahrheitsansprüche verlogen ist. (NL 4/3: 249-
256)
Meines Erachtens bedeutet Adornos Insistieren auf dem zentralen Stellenwert des
Wahrheitsgehalts der Kunst weder, dass er Kunstwerke zum Ort höchster Wahrheiten
verklärt, wie häufig moniert wurde (Bubner 1973; Wellmer 1985 in Anknüpfung an
Habermas und Seel). Noch verwechselt Adorno Wahrheit im Sinn der formalen,
ästhetischen Stimmigkeit mit der Wahrheit von Aussagesätzen, d. h. mit der von
Sprachphilosophen auch apophantisch genannten Wahrheit. Wellmer hat hellsichtig
schon 1983 gegen Adorno die Unterscheidung zwischen »›apophantischer‹ Wahrheit,
15
›endeetischer‹ Wahrheit (Wahrhaftigkeit) und moralisch-praktischer Wahrheit« sowie die
Differenz all dieser Wahrheitsdimensionen zur ästhetischen Wahrheit als Stimmigkeit ins
Spiel gebracht. (Wellmer 1985: 30) Spätestens seit der Veröffentlichung der Ästhetik
Vorlesungen von 1958/59 erweisen sich diese Unterscheidungen jedoch als Adornos
eigenstes Anliegen.
Entscheidend ist dabei, dass Adorno die zitierte Differenzierung zwischen verschiedenen
Dimensionen der Normativität des Kunstwerks nicht einführt, um seine Wahrheit auf die
Dimension der formalen Stimmigkeit zu reduzieren. Das obige Zitat, aber auch unzählige
Formulierungen, denen zufolge die Wahrheit des Kunstwerks »nur vermittelt durch sein
Formgesetz hindurch« (NL 4/3: 257) erreicht werden kann, machen deutlich, dass der
Wahrheitsgehalt die »Resultante der Kräfte« (NL 4/3: 226) eines als Kraftfeld
verstandenen Werks ist – also das interferentielle Resultat der verschiedenen Dynamiken
des Kunstwerks und ihrer normativen Ansprüche. Dann kommt es auf die Auswahl und
Darstellung künstlerischer und nichtkünstlerischer Materialen und den damit
verbundenen apophantischen Wahrheitsaspekt ebenso an wie auf die zwischen
Wahrhaftigkeit und Moralität angesiedelte mimetische Bearbeitung dieser Materialien; und
nicht zuletzt auf die Stimmigkeit ihrer formalen Konstruktion. Denn wenn eine dieser
Verhaltensweisen normativ problematisch ist, wird der ganze Wahrheitsgehalt in
Mitleidenschaft gezogen.
Wo Kunstwerke eine neue Konstellation des Bestehenden präsentieren, zeigen sie das
Bestehende als veränderbar. Aufgrund ihrer Abstinenz von allem Urteilen sagen sie aber
nicht, dass die neue Anordnung die bessere oder die schlechtere ist. Sie eröffnen lediglich
einen Vergleichsraum und damit den für Beurteilung und Kritik nötigen Abstand
zwischen Sein und Anderssein. Das impliziert zweierlei: Kunstwerke führen in
naturalisierte Verhältnisse Differenzen ein, und es gelingt ihnen, das Unterschiedene in
einem Verhältnis des kritischen Bezugs statt der Indifferenz zu präsentieren. Den nicht
nur kunst-kritischen Diskurs, den sie auf diese Weise ermöglichen, ja provozieren,
können Kunstwerke selbst aber nicht führen. Er ist mit nichtkünstlerischen Mitteln zu
leisten – Adorno zufolge mittels einer Philosophie, die, wie schon angemerkt, nichts
anderes meint als ungeschütztes, haltloses Denken.
16
Unter der Adornoschen Prämisse, dass gegenwärtige Gesellschaften von maximaler
Eindimensionalität und selbstverschuldeter Alternativlosigkeit geprägt sind, ist auch
schon das bloße Herstellen einer normativen Spannung zwischen Kunst und Nicht-
Kunst, also das bloße Vorhandensein eines »Quotienten« etwas Positives; unabhängig
davon, ob die von Adorno »philosophisch« genannte Interpretation zum Schluss kommt,
der im Kunstwerk präsentierte Umgang mit Fragmenten der bekannten Realität sei besser
als der üblicherweise praktizierte. Das wird ohnehin umstritten bleiben, sobald man das,
was Adorno Kritik, Kommentar und philosophische Analyse des Wahrheitsgehalts nennt,
nicht als Praxis eines einzelnen oder gar einsamen Denkers auffasst, wie Adorno
suggeriert, sondern als kritischen, mehrstimmigen und plurimedialen Diskurs.
Problematisch ist in meinen Augen weniger die oft kritisierte Rolle, die Adorno der
Philosophie im Umgang mit Kunstwerken zuschreibt, zumal Adornos
Philosophieverständnis auf ein anti-expertokratisches, ungeschütztes und unnachgiebiges
Denken zielt und mit den Institutionen gleichen Namens nicht allzu viel zu tun hat. Das
Problem besteht eher darin, dass Adorno bei Kritik, Kommentar und Philosophie viel
eher einzelne Kritiker- oder Denker-Individuen – schon Denkerinnen kann man sich in
seinem Universum schwer vorstellen – vor Augen zu haben scheint als jenes schwer
überschaubare Stimmengewirr, das kritische Diskurse üblicherweise sind. Deshalb scheint
mir nur die Hälfte des Vorwurfs, der Adorno seit der Kritik von Jauss immer wieder
gemacht wurde, plausibel: »Er [Adorno] musste darum auch der rezipierenden Seite einen
aktiven Anteil an der Sinnkonstitution versagen.« (Jauss 1982: 64; Wellmer 1985;
Rebentisch 2003: 134 ff.) Adorno hat der »philosophischen« Rezeption sehr wohl ein
Gewicht in Bezug auf den Wahrheitsgehalt der Kunst zugemessen, und zwar eines,
welches größer gar nicht sein könnte. Aber er hat diese Rezeption derart monologisch
zugerichtet, dass ihre fruchtbarsten Dynamiken gar nicht in den Blick kommen konnten.
(Zur Frage inwiefern schon die Dynamik des Kunstwerks bei Adorno monologische
Momente aufweist: Nesbitt 2004)
Bei der philosophischen Beurteilung des Wahrheitsgehalts eines Kunstwerks geht es m. E.
aber nicht nur um die Frage, ob es ihm gelingt, einen wie auch immer kleinen Spalt
zwischen Sein und Anderssein zu öffnen bzw. um die Frage, ob ein Kunstwerk diesen
Spalt zu (wenig) weit öffnet. Darauf reduziert beispielsweise Geuss den Wahrheitsgehalt.
(Geuss 2005: 170 ff.) Er meint, dass es Adornos Ästhetik um den Nachweis gehe, dass
17
dieser Spalt im Lauf der Geschichte immer kleiner werde und dass nur die gelungensten
Werke diesem Verschließungsgeschehen adäquat Rechnung trügen. Während es den
Schönbergschen Kompositionen noch möglich sei, das Andere des Bestehenden negativ
zu charakterisieren – als verschieden von allem, was wir kennen –, so halte Beckett einer
an Freiheit und Kritik glaubenden Gesellschaft ein Spiegelbild vor, in dem jede Differenz
der Kritik unmöglich geworden ist. Wäre Geuss’ Interpretation wahr, so bräuchte man
pro Epoche nur ein Kunstwerk bzw. alle Kunstwerke einer Epoche würden auf dasselbe
hinauslaufen. Die konkreten Elemente der jeweiligen Welt, welche im Kunstwerk
entwendet und verwandelt erscheinen, würden keine Rolle spielen.
Nicht nur was die Breite des Spalts betrifft, der Adorno zufolge im Übrigen auch wieder
größer werden kann, sondern insbesondere hinsichtlich der Elemente einer jeweils
geschichtlich bestimmten Wirklichkeit scheint mir Geuss’ These zu abstrakt. Adornos
problematische Rede von einem historischen »Materialstand«, aber auch von einem
»gesellschaftlichen Gesamtsubjekt«, welches – gar von einem Künstler als »Statthalter« –
im authentischen Kunstwerk vertreten sein soll (GS 11: 114-126), leistet solchen
Abstraktionstendenzen zweifelsohne Vorschub. Insbesondere in den Ästhetik
Vorlesungen jedoch betont Adorno die geschichtliche und geopolitische Situiertheit der
Kunst. Er geht sogar so weit zu behaupten, dass selbst die eigene Kultur und Gesellschaft
so vielschichtig ist, dass von einem gesellschaftlichen Gesamtsubjekt ebenso wenig mehr
die Rede sein kann, wie es möglich ist, ein bestimmtes Set von Elementen zum
Materialstand einer Epoche zu erklären: »Es ist zum Beispiel für uns wohl schon kaum
mehr auch nur möglich, chinesische Musik in einem irgend adäquaten Sinn zu hören, zu
verstehen oder zu realisieren [...]. Und schließlich müssen wir, damit wir ein Kunstwerk
verstehen können, auch bereits in einem gewissen Sinn wissen, wo es lokalisiert ist.
Benjamin hat das einmal sehr provokativ in der Form ausgesprochen, dass er gesagt hat,
er könne eigentlich nur dann ein Bild beurteilen, wenn er wisse, von wem es sei; eine
Formulierung, die natürlich der üblichen Vorstellung, dass die Qualität rein aus sich
heraus wirke, ins Gesicht schlägt, die aber genau das bezeichnet, worum es hier geht«
(NL IV.3, 245 f.).
Berücksichtigt man derartige Einwände Adornos gegen einen falsch verstandenen
Universalismus, dann muss man den Wahrheitsgehalt konkreter verstehen als etwa Geuss.
Zum Maßstab der Gelungenheit – also dazu, dass man dem Kunstwerk einen
18
Wahrheitsgehalt, der zunächst einmal nur ein Wahrheitsanspruch sein kann, tatsächlich
zuspricht – gehört dann nicht allein seine Kraft, einen Keil zwischen Sein und Anderssein
zu treiben. Es muss dem Kunstwerk auch gelingen, in Bezug auf genau jene Elemente der
Wirklichkeit, die es entstellt und verschiebt – sei es utopisch, sei es die Wirklichkeit
polemisch krass verdoppelnd – ein Verhältnis der Nicht-Indifferenz herzustellen. Und ob
das gelingt, zeigt sich wesentlich in seiner Kraft, einen kritischen Diskurs zu entzünden.
Im Zentrum der Beurteilung steht somit die Frage, ob ein Kunstwerk in der Lage ist, in
Bezug auf genau die konkreten Realitätsfragmente, die es mimetisch und konstruktiv neu
erfindet, einen Raum des kritischen Diskurses zu eröffnen; nicht ob es diesen Diskurs
und den ihm zugrunde liegende Spalt ganz generell gibt.
D.h. es kommt auf die Frage an, ob die verwandelten Realitätsfragmente ausreichend
relevant sind, um diesen Spalt erzeugen zu können. Denn letztlich scheint es auch an ihrer
Relevanz zu hängen, ob sich ein Spalt der Kritik statt der Indifferenz auftut. Und nur ein
sehr autoritäres Denken könnte behaupten, dass es zu jeder Zeit nur ein einziges Set von
Realitätsfragmenten gibt, die von so entscheidender Relevanz sind, dass Kunstwerke,
welche diese Elemente zum Material ihrer Experimente machen, gelingen können. Einmal
ganz abgesehen davon, dass »eine Zeit«, »gesellschaftliche Verhältnisse« oder »Epochen«
weder geopolitisch und historisch noch in ihren internen hierarchischen Stratifizierungen
so klar vermessen und begrenzen lassen, dass man ihnen einen Materialstand zuteilen
könnte.
Adorno sagt explizit, dass der Wahrheitsgehalt etwas »unbeschreiblich Armes und
Eintöniges« wäre, wenn »alle Kunstwerke, die von derselben Weltanschauung, von
denselben substantiellen Gesamtkategorien getragen werden, eben darum auch den
gleichen geistigen Gehalt« hätten (NL 4/3: 219). Insbesondre Adornos Einzelanalysen
lassen keinen Zweifel daran, dass Büchner durch seine Quasi-Zeitgenossen Hölderlin und
Eichendorff nicht überflüssig wird und dass z. B. der Wahrheitsgehalt von Büchners
Danton nicht derselbe ist wie der seines Lenz. Analog dazu wäre es heutzutage absurd,
beispielsweise die Theaterstücke von Elfriede Jelinek gegen die TV Serie The Wire
auszuspielen. Nicht zuletzt weil in Rechnung zu stellen ist, dass der Spalt zwischen Sein
und Anderssein zu ein und derselben Zeit in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen
und Schichten verschieden groß sein könnte. Diese Situiertheit des Kunstwerks und
seines potentiellen Wahrheitsgehalts in einem geopolitischen und historischen Raum
19
markiert auch die Differenz zwischen Adorno und den dekonstruktiven Kunsttheorien
Derridas und de Mans, welche die paradoxe Kunstwahrheit ontologisieren, jedoch
zweifelsohne eine Menge mit Adornos Kunstphilosophie teilen. (Menke 1991; kritisch
Scholze 2000: 322)
Gesellschaftsbezüge
Kunst ist demnach in mehreren Hinsichten ein gesellschaftliches Phänomen: in der
Arbeitsteiligkeit ihrer Produktion, vermittels des Materials, welches den Ausgangspunkt
der künstlerischen Arbeit darstellt, aber ebenso aufgrund ihrer Angewiesenheit auf
Rezeptionsprozesse der Kunst- und Gesellschaftskritik, die ihrerseits von Fragen der
Distribution, des Kunstmarkts und von Kunstinstitutionen nicht getrennt werden
können; nicht zuletzt aufgrund des Wahrheitsgehalts, der auf das Verhältnis zwischen
Kunst und gesellschaftlichen Wirklichkeiten zielt. Gleichwohl beharrt Adorno auf einer
zumindest relativen Autonomie der Kunst, wie sie etwa in dem vielzitierten Diktum zum
Ausdruck kommt, wonach Kunst autonom und fait social (GS 7: 16) sei.
Die Autonomie der Kunst zeigt sich in ihrer Absage an das Urteil und alles Teleologische.
Kunst folgt einer anderen Logik als das strategische, aber auch als das kommunikativ-
dialogische Handeln – eine an sich nützliche Unterscheidung, die Habermas und Wellmer
gegen Adorno in Stellung gebracht haben, die m. E. aber wenig zur Klärung des
Verhältnisses zwischen Kunst und Gesellschaft beiträgt. Denn beide sind teleologisch
strukturiert: Macht oder Herrschaft ist das Ziel des strategischen Handelns, um
Verständigung geht es dem kommunikativen. Von beidem ist der Prozess des Kunstwerks
durch eine gewisse Ziellosigkeit unterschieden. Sie meint nichts anderes als dass ein
Kunstwerk nicht in einem Urteil terminiert, welches man – sei es strategisch oder
kommunikativ – einsetzen könnte. Das Besondere von Adornos Konzeption der
ästhetischen Differenz besteht darin, dass die Kunst auf eine solche Weise ihrer eigene,
ziellose Logik verfolgt, dass die interpretierende und beurteilende Auseinandersetzung mit
dem Kunstwerk in Kritik – auch in Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen – übergeht.
Die schon fast zum Kalauer gewordene Bemerkung Adornos, die gesellschaftliche
Funktion der Kunst sei ihre Funktionslosigkeit (GS 7: 336 f.), ist Adornos paradoxe
Formulierung eines eigentlich gar nicht so paradoxen Sachverhalts. Kunst kann eine
kritisch fruchtbare Andersheit bewerkstelligen, ist aber zu keinem Eingriff, nicht einmal
20
zu einem diskursiven in der Lage. Kritisch relevant werden Kunstwerke erst in Prozessen,
die sie nicht steuern können. Vor diesem Hintergrund ist auch verständlich, dass Adorno
ein avantgardistisches Aufgehen der Kunst im Leben ebenso ablehnt wie Tendenzkunst,
die der Gesellschaft Lehren oder Schlimmeres erteilt.
Diese Ohnmacht hat Adorno bisweilen auch als Schuld, ja Schuldzusammenhang der
Kunst bezeichnet – oder schlicht als Ersatzfunktion (NL 4/3: 60). Er stellt sogar in
Rechnung, dass »gerade die radikale Kunst zu einem Alibi für den Verzicht auf
eingreifende Praxis werden kann« (NL 4/3: 195). Auch die für Adorno
paradigmatischsten Kunstwerke sind also nicht frei von diesem schuldhaften Schein, der
darin besteht, dass die Kunst den Anschein erweckt, sie könne etwas tun, kritisieren,
verändern. Angesichts dieser Reserve gegenüber den unzweifelhaftesten Werken ist
Adorno immer wieder vorgeworfen worden, er messe menschliche Artefakte, nämlich
Kunstwerke, an übermenschlichen, metaphysischen Maßstäben; er operiere insgeheim mit
der Norm einer erlösten Gesellschaft, in der Kunst als Kritik nicht mehr nötig wäre,
sondern das Zusammenleben der Menschen vielmehr selbst in die Nähe künstlerischer
Konstellationen gerückt wäre (zum Vorwurf der Metaphysik Wellmer 1993; Scholze
2000).
Ich denke, es ist aus kunst- und gesellschaftstheoretischer Perspektive fruchtbarer, die
»Schuld« auch noch der gelungensten Kunst als die Gefahr zu sehen, dass ein Kunstwerk
eines Tages nicht mehr in der Lage ist, kritische Differenzen zu erzeugen, sondern nur
indifferente Andersheit. Dagegen ist keines gefeit. Aus Adornos genereller
Schuldvermutung in Bezug auf Kunst ein Problem schlechter Metaphysik zu machen
scheint auch deshalb unangemessen, weil Adorno am Ende seiner Ästhetischen Theorie das
Szenario einer durchaus versöhnten Gesellschaft beschreibt, aus der die Kunst jedoch
nicht verschwunden ist (Wellmer 1985: 43). Er schreibt ihr in diesem Kontext einmal
mehr die Funktion kritischer Funktionslosigkeit zu, auf welche offenbar auch die beste
aller Gesellschaften nicht verzichten kann. Auch in einer richtigen Einrichtung der
Gesellschaft droht unablässig Rückfall; denn Freiheit ist kein Besitz. Man kann sich
fragen, ob es neben Kunst und Philosophie nicht noch andere Möglichkeiten gibt,
kritische Differenz zu erzeugen. Rancière etwa stellt die Kunst, welche er in großer Nähe
zu Adorno konzeptualisiert (Rancière 2008), auf eine Ebene mit emanzipatorischem
politischen Handeln. Fest steht jedenfalls, dass Adorno nicht nach einer jenseitigen
21
Versöhnung aller gesellschaftlichen Bereiche strebt, sondern nach möglichst fruchtbaren
Differenzen der Kritik
Gegen die metaphysische Vertagung alles Guten bis zum Ende der Geschichte sprechen
in Sachen Kunst insbesondere jene Passagen aus Adornos Ästhetik Vorlesungen von
1958/59, in denen er sich mit Platos Konzeption des Schönen im Symposium und im
Phaidros auseinandersetzt. Adorno verteidigt hier einen von Sinnlichkeit und Glück
unabtrennbaren Schönheitsbegriff. An Plato fasziniert ihn vor allem der Vorschlag,
Schönheit weder als Eigenschaft noch als Besitz zu denken, sondern als eine Dynamik des
Strebens und Sehnens, welches gleichzeitig Glück bereitet und Schmerz zufügt (NL 4/3:
161 f.)
Wo Adorno diese Konzeption der Schönheit auf Kunstwerke bezieht und sich damit von
Platos göttlichen Ideen distanziert – »Kunstwerke sind keine göttlichen Manifestationen,
sondern Menschenwerk« (NL 4/3: 192) – schreibt er: »dass das Kunstwerk eigentlich das
Glück dadurch bereitet, dass es ihm gelingt, einen [...] in sich hineinzuziehen [...] und dass
es einen dadurch allerdings der entfremdeten Welt, in der wir leben, entfremdet, und
durch diese Entfremdung des Entfremdeten die Unmittelbarkeit oder das unbeschädigte
Leben selber eigentlich wiederherstellt.« Mit anderen Worten: Die Dynamik zwischen
Autonomie und fait social, welche ja nichts anderes als das relationale Verhältnis des
Wahrheitsgehalts meint, wird hier in im Ausgang von platonischer Schönheit
durchgespielt. Oder anders gesagt: Adornos Versuch, den Wahrheitsgehalt als ein
Verhältnis der Kritik zu denken, findet in Platos Schönheitsverständnis ein Verbündetes.
In beiden Fällen geht es um eine Glückserfahrung, auf der Basis und mit dem Resultat der
Sehnsucht nach mehr davon. Und es scheint mir angesichts des immer wieder erhobenen
Vorwurfs der negativistischen Miesepetrigkeit Adornos – Bohrer etwa spricht von banal-
vulgärem Nihilismus (Bohrer 2002: 174; dazu kritisch: Scholze 2004) – wichtig
hervorzuheben, dass dieses Glück der Entfremdung von der Entfremdung kein halbes ist,
nur weil es sich aus der Entfremdung entwickelt. Ich glaube, man kommt der Sache
näher, wenn man sich Adornosches Glück so groß und uneingeschränkt vorstellt wie die
Entfremdung es auch ist.
Dass Adorno zumindest komplexer denkt, als viele Kritiker wahrhaben wollen, lässt sich
nicht zuletzt im Bezug auf seine Auseinandersetzung mit populärer, niedriger Kunst
zeigen, welche Adorno vielleicht die meiste Kritik eingebracht hat. Nicht nur weil er weil
22
U-Phänomene oft angemessener beschrieben hat als manche ihrer Fans (Diederichsen
2003) und auch in der Ästhetischen Theorie immer wieder bemerkenswerte
Berührungspunkte zwischen U und E nennt: die zwischen Avantgarde und Music Hall
sowie Varieté (GS 7: 62; GS 3: 308 f.), oder auch die Nähe zwischen Potpourri und
Montage (GS 7: 375) – eine Debatte, die einen eigenen Handbuchartikel verdienen würde.
(Wellmer 1985: 39 ff.; Früchtl 2003; Sonderegger 2006)
Gerade in Hinsicht auf die Frage des Glücks sind Adornos Überlegungen zur leichten
Kunst insofern äußerst aufschlussreich, als er hier wie nirgendwo sonst das Recht auf
Unterhaltung, Amüsement und eben auch sensuelles Glück der Kunst thematisiert. Die
immer rationaler konstruierte und zum Verstummen neigende hohe Kunst lasse dafür
keinen Platz, während die leichte Kunst nur zurechtgestutztes Glück vermittle. Darin ist
sie für Adorno »das gesellschaftlich schlechte Gewissen der ernsten« (GS 3: 157).
Gleichwohl gibt Adorno in seinem düstersten, mit Horkheimer geschriebenen Buch
Dialektik der Aufklärung ganz ähnliche Hinweise auf die glückhaften Berührungen
zwischen U und E wie später auch in der Ästhetischen Theorie: »Amüsement, ganz
entfesselt, wäre nicht bloß der Gegensatz zur Kunst, sondern auch das Exterm, das sie
berührt. [...] In manchen Revuefilmen, vor allem aber in der Groteske und den Funnies
blitzt für Augenblicke die Möglichkeit dieser Negation selber auf. Zu ihrer
Verwirklichung darf es freilich nicht kommen. Das reine Amüsement in seiner
Konsequenz, das entspannte sich Überlassen an bunte Assoziationen und glücklichen
Unsinn wird vom gängigen Amüsement beschnitten« (GS 3: 164). Offenbar hat die
niedrige Kunst Adorno mehr Material geboten, um Ansätze zu einer Theorie des
(ästhetischen) Glücks zu entwerfen als die hohe. Das sollte keine Kritik an Adornos
Kritik der Populärkultur aus dem Auge verlieren.
Aktualität und Fruchtbarkeit der Adornoschen Ästhetik
Mein bewusst tendenziöser Versuch, Adorno so zu erläutern, dass seine potentiellen
Antworten auf die geläufigsten Einwände gegen seine Ästhetik besonderes Gewicht
erhalten, bedeutet nicht, dass Adorno bestenfalls das Niveau seiner Kritiker erreicht.
Oder, was noch vernichtender wäre, dass man immer eine parierende Stelle bei ihm
findet, sobald eine Kritik laut geworden ist. In mancherlei Hinsicht sind Adornos
Überlegungen auch heute über alle mit Grund monierten Probleme hinaus fruchtbar wie
23
wenige Ästhetiken sonst. In erster Instanz hat das wohl damit zu tun, dass er als
Komponist, Kunstkritiker, Soziologe und Kunstphilosoph das Feld der Kunst bearbeitet
hat und schon allein deshalb zu nuancierteren, aber auch rabiater selbstkritischen
Positionen kommt als jene, die sich nur in einer der genannten Funktionen mit Kunst
auseinandersetzen. Diese Polyperspektivität hinsichtlich ein- und desselben Feld wirft
beinah automatisch Fragen zur Kompatibilität der verschiedenen Ansätze auf und
befördert die wechselseitige Kritik in einem Ausmaß, wie sich das einseitigere
Kunstfreunde oder -theoretikerinnen kaum vorstellen können. Adorno hat seiner an
Kunst und Kunsttheorie von der ersten bis zur letzten Seite zweifelnden Ästhetischen
Theorie hymnische Kritiken einzelner »großer« Werke entgegen gehalten und letzteren den
ernüchternden Blick des Soziologen auf Kunstinstitutionen und das, was eine
überwältigende Mehrheit hört, schaut und liest. Eine derart ungeschützte Konfrontation
deskriptiver mit normativen Ansätzen ist negative Dialektik im großen Format. Sie macht
es möglich, kulturindustrielle Produkte an ihrem Kunstanspruch zu messen und
vergeistigter Kunst vorzuhalten, dass sie – bar jedes entfesselten Amüsements – zu einem
genauso harmlosen Spielwerk wird, wie es die leichte oft ist.
Fruchtbar scheint mir heute auch eine erneute Auseinandersetzung mit der zentralen
Stellung des Kunstobjekts in Adornos Ästhetik sowie mit dem damit verknüpften
Wahrheitsanspruch. Diesen Faden wieder aufzunehmen ist nicht einfach darum eine
zeitgemäße Herausforderung, weil Adornos Vorrang des Objekts angesichts der
Dominanz von Theorien ästhetischer Erfahrung insbesondere in der deutschsprachigen
Diskussion in Vergessenheit geraten ist. (Koch/Voss 2005; Küpper/Menke 2003) Denn
dieses Vergessen könnte ja sachlich gerechtfertigt sein; etwa dann, wenn Adornos Theorie
des Kunstwerks die Rolle der ästhetischen Erfahrung gänzlich leugnen oder unzureichend
beschreiben würde. Wie ich aber zu rekonstruieren versucht habe, trägt Adornos Theorie
des Kunstwerks nicht nur der ästhetischen Erfahrung durchaus Rechnung; sie kann
darüber hinaus auch die problematischen Züge subjektiver Erfahrungstheorien
korrigieren: etwa ihren Relativismus, vor allem aber das Problem, dass ästhetische
Theorien, die die Aktivierung der Vermögen des Subjekts ins Zentrum stellen, schwer
begründen können, warum nicht eine Handvoll Kunstwerke ausreicht, um die
immergleiche subjektive ästhetische Erfahrung zu machen. (Sonderegger 2005)
24
Nicht zuletzt ist Adornos Kunsttheorie voller unabgegoltener Potentiale, weil sie gegen
sich selbst denkt; etwa gegen die Tendenz, eine Logik des Zerfalls zu konstruieren. So
stellt Adorno in Rechnung, dass irgendwann auch scheinbar überholte Formen und
Genres wieder glaubwürdig werden und das Amüsement mit dem kritischen
Wahrheitsgehalt gemeinsame Sache machen könnte. Noch nicht einmal die Sondersphäre
der Kunst, also ihre von Adorno bis zur Verzweiflung verteidigte Autonomie, ist ihm
sakrosankt. Vielmehr räumt er ein, dass aus der Kunst heraus legitime Bewegungen gegen
die Kunst entstehen können und – etwa im Surrealismus oder »in den letzten großen
Produktionen des großen Malers Picasso« (NL 4/3: 83) – auch schon stattgefunden
haben. In den Vorlesungen heißt es: »Sie dürfen also auch etwa eine solche Bestimmung
wie die des Ausgegliedertseins des Ästhetischen aus der empirischen Realität nicht als ein
Absolutes nehmen, sondern Sie müssen das selber auch nehmen als ein Moment, das in
der geschichtlichen Dialektik steht und das prekär ist« (NL 4.3: 83). Damit trifft Adorno
Tendenzen, mit denen gerade heute im Spannungsfeld von Kunst und kritischem Design,
in der sogenannten künstlerischen Forschung und in der aktivistischen Kunst
experimentiert wird.
Adorno beklagt solche Bewegungen gegen die Autonomie nicht als Niedergang oder als
das x-te Ende der Kunst. Er verteidigt sie als plausible Entwicklungen, wo immer die
Gefahr besteht, dass Kunst zu einer »Art ›Naturschutzpark der Kultur‹« (NL 4.3: 83)
entwertet wird. Das macht einmal mehr deutlich, dass Adorno einen Kunstbegriff vertritt,
der sich wesentlich dadurch am Leben erhält, dass die einzelnen Werke ihn fortlaufend
kritisieren, sich gegen ihn entwickeln. Kunstwerke, die Adorno als wahre auszeichnet,
sind solche, die an ihren eigenen Überlebensfäden zerren, als wären es Fesseln. Je
autonomer sich das Feld der Kunst gestaltet, desto anti-autonomer müssen die einzelnen
Kunstwerke demzufolge sein, aber auch umgekehrt. Zu Zeiten Kants war die Forderung
nach Autonomie der Kunst auch Ausdruck neuer politischer Freiheitsforderungen.
II. Essay und System
Adornos Philosophie – und besonders seine Ästhetische Theorie – ist immer wieder mit dem
Vorwurf konfrontiert worden, sie seien selbst ästhetisch bzw. flüchteten sich in eine
pseudokünstlerisch hermetische Schreibweise statt Argumente für das zu geben, was wild
25
oder verrätselt behauptet werde (zur Zusammenfassung und Kritik dieser Vorwürfe:
Scholze 2000: 290). Damit steht das Verhältnis zwischen Philosophie, Kunst und Ästhetik
zur Disposition, welches zweifelsohne das Zentrum von Adornos Denken darstellt.
Deshalb soll abschließend Adornos Konzeption der Philosophie und ihr Verhältnis zu
Kunst und Ästhetik skizziert werden (Demirovi� 1999: 669-695). Schon in seiner Antrittsvorlesung geht Adorno auf das ein, was ihm andere als Mangel
ankreiden: Ästhetisierung der Philosophie. Er weist den Vorwurf nicht ab, sondern
umarmt ihn gewissermaßen, indem er erläutert, was das Potential, ja die
Alternativlosigkeit jenes Philosophierens ist, das mit dem Schimpfwort des Essayistischen
abgetan wird. »Ich kann mich diesen Einwänden [»eines ästhetischen Bilderspiels, das die
Philosophie um jeden konstanten Maßstab bringt«] gegenüber nur so verhalten, dass ich
das meiste, was sie inhaltlich besagen, anerkenne, aber als philosophisch legitim vertrete.«
(GS 1: 343)
Von Anfang an also hat Adorno sich mit Fragen der Form philosophischer Texte und
ihrer irreduziblen Verschlingung mit bestimmten inhaltlichen Fragestellungen so sehr wie
Ergebnissen befasst. In diesem Zusammenhang erteilt er dem philosophischen
Systemdenken und allen Formen einer prima philosophia harsche Absagen. (GS 1: 325-344;
GS 5: 12-47). Gegen die Prätention, Wirklichkeit in ihrer Totalität denkend erfassen oder
sie gar aus irgendwelchen ersten Prinzipien erklären zu können, hält Adorno in seinen
Frühschriften eine deutende Philosophie, die er später immer häufiger als essayistisches
Denken – ein Denken in Versuchen und Versuchanordnungen – bezeichnen wird:
»Schlicht gesagt: die Idee der Wissenschaft ist Forschung, die der Philosophie Deutung.«
(GS 1: 334)
Deutendes Denken und Experimentieren mit immer neuen Versuchsanordnungen richten
sich mit der Absage an System und erste Prinzipien auch gegen die Forderung nach einer
gesicherten Methode, wie sie Descartes Discours de la méthode ausgearbeitet hat; Prinzipien,
wonach man etwa immer vom Einfachen zum Komplizierten gehen, das Problem in
möglichst elementare Teile zerlegen, Vollständigkeit anstreben soll etc. (GS 11: 22 f.).
Damit ist Adorno zufolge jede wirklich neue Erkenntnis ausgeschlossen: »ein Tabu ergeht
über die Zukunft« (GS 5: 40). Denn »mit Axiomen wie dem der Vollständigkeit und
Lückenlosigkeit setzt Identitätsdenken eigentlich immer schon totale Überschaubarkeit,
Bekanntheit voraus« (GS 5: 40). Adorno hingegen strebt nach einer Erkenntnis, die die
26
Reduktion des Unbekannten auf schon Bekanntes und deshalb letztlich Immergleiches
durchbricht und sich dabei von der jeweils zu begreifenden Sache, die auch eine Situation,
eine Praxis oder ein menschliches Gegenüber sein kann, leiten lässt.
Diesen Vorrang des Objekts klagt er im Wissen ein, dass begriffliche, historische und
soziale Vermittlungen unhintergehbar sind. So fordert er von der philosophischen
Erkenntnis, dass sie auch noch mitreflektiere, in welchem Sinn die Erkenntnis eines
reinen Objekts an sich gar nicht gelingen kann. Das deutende Denken, welches letztlich
die vernünftige Einrichtung der Gesellschaft, ja Glück vor Augen hat, muss selbst die
Risiken des Scheiterns und des Irrtums eingehen samt der daraus resultierenden
Verantwortung. So leuchtet Adorno auch nicht ein, warum das Glück eines von
Methoden befreiten Geistes vom Risiko des Irrtums notwendig gemindert wird (GS 5:
23). Adorno zufolge sind die Risiken des durch Prinzipien gesicherten Denkens nicht
kleiner, sie sind dort nur besser verschleiert. Denn statt um die Freiheit des Objekts und
des erkennenden Geistes geht es der methodischen Erkenntnis letztlich um Macht:
»Indem das Subjekt das Prinzip angibt, aus dem ein jegliches Sein hervorgehe, erhöht es
sich selber« (GS 5: 22); Unwiderleglichkeit ersetzt eine Machtposition, welche die
solcherart Wissenden real nicht haben. (GS 5: 23)
Zwei Formen essayistischen Denkens
Es scheint zwei – von Adorno nicht wirklich unterschiedene – Praxisformen des
deutenden, essayistischen Denkens zu geben: eine tendenziell immanente Kritik und eine
eher transzendierende. (Ziermann 2004: 41). Die erste Denkpraxis ist die von negativer
Dialektik. Sie entzündet sich an der Spannung zwischen der Idee, d. h. dem normativen
Anspruch und Potential eines Dings, Verhältnisses oder Begriffs einerseits und seiner
Realisierung andererseits. Dabei distanziert Adorno sich von Hegels dialektischer
Gewissheit, dass man mit der Negation – mit dem Wissen um den Mangel der
Realisierung einer Idee im Licht ihrer Verwirklichung – auch schon einen Hinweis darauf
bekommen hätte, wie weiter gedacht werden kann. Noch viel weniger bietet die bloße
Differenz zwischen Begriff und Realisierung eine Aussicht auf irgendein mögliches Ende
der Bewegung des Denkens; zumal das negativ dialektische Denken Adornos nicht nur
die eigene Fehlbarkeit in Rechnung stellen muss. Es sieht sich mit der noch viel größeren,
geradezu anti-hegelschen Herausforderung konfrontiert, dass die Wirklichkeit nie in
27
Begriff und Geist aufgehen kann, sondern aller deutenden Erkenntnis zum Trotz immer
ein Eigenleben führen wird.
Die zweite Praxisform deutenden Denkens besteht darin, Konstellationen und
Konstruktionen, die auch als Versuchsanordnungen bezeichnet werden, herzustellen, um
mithilfe ihrer Verfremdung die Wirklichkeit aufzuschlüsseln. Bei derartigen Experimenten
stehen Spontaneität, »exakte Phantasie« (GS 1: 342) und Einbildungskraft im Zentrum.
Hier soll sich auch radikal Neues ereignen können. Durch die glückliche – d. h.
intentional trotz allem exakten Vorgehen nie kontrollierbare Anordnung von Elementen
der Wirklichkeit – ist es möglich, zumindest Fragmente der Realität in einem vollkommen
neuen Licht zu sehen.; in einem so neuen Licht, wie es im Rahmen der geduldig
insistierenden Meditationen negativer Dialektik kaum vorstellbar ist. Nicht umsonst ist
alle Metaphorik der Plötzlichkeit, des Aufspringens eines Schlosses, welche die
Erläuterungen des konstellativen Denkens grundiert, gänzlich abwesend, wo Adorno die
Bewegung negativer Dialektik beschreibt.
In seiner Antrittsvorlesung charakterisiert Adorno das konstellative Denken
folgendermaßen: »Bei der Handhabung des Begriffsmaterials durch Philosophie rede ich
nicht ohne Absicht von Gruppierung und Versuchsanordnungen, von Konstellation und
Konstruktion. [...] Sie liegen nicht organisch in Geschichte bereit; [...] sie müssen vom
Menschen hergestellt werden und legitimieren sich schließlich allein dadurch, dass in
schlagender Evidenz die Wirklichkeit um sie zusammenschießt.« (GS 1: 341) Ganz analog
zu den Ausführungen in seiner Antrittsvorlesung (die Schlüsselmetaphorik in GS 1: 340)
wird Adorno auch in der viel später verfassen Negativen Dialektik schreiben: »Als
Konstellation umkreist der theoretische Gedanke den Begriff, den er öffnen möchte,
hoffend, dass er aufspringe etwa wie die Schlösser wohlverwahrter Kassenschränke: nicht
nur durch einen Einzelschlüssel oder eine Einzelnummer sondern eine
Nummernkombination.« (GS 6: 166)
Das negativ dialektische Denkmodell ist – wie auch immer verwandelt – Hegel
verpflichtet, das konstellative Benjamin. Und es ist keineswegs deutlich, inwieweit sie sich
ausschließen oder ob Adorno davon ausgeht, dass die beiden Denkpraktiken nur in enger
Verschlungenheit ihr Ziel erreichen können. Die Tatsache, dass er naheliegende
Spannungen oder Ausschlussverhältnisse zwischen den beiden noch nicht einmal
thematisiert, spricht für die zuletzt genannte Möglichkeit. Eine Kombination aus
28
negativer Dialektik und Konstellationsdenken könnte man sich vielleicht folgendermaßen
denken: An die Stelle des zweipoligen Verhältnisses zwischen Idee und Realität tritt ein
Kraftfeld, in dem unterschiedliche normative Vorstellungen einer Sache einer Vielzahl
von relevanten Realisierungen gegenüber steht. Hier müsste auf beiden Seiten das
Vergleichsmaterial mit »exakter Phantasie« hergestellt werden; negative Dialektik würde
eine in die dritte Dimension erweiterte Bewegung. Kombinierbar sind die beiden,
analytisch durchaus trennbaren, Praktiken deutender Philosophie deshalb, weil beide auf
Formen des Denkens bzw. Schreibens zielen, die zu Beginn nicht wissen, was am Ende
herauskommt. Ja noch nicht einmal ihren Beginn können sie hieb- und stichfest
begründen.
Am prägnantesten werden die Implikationen und Potentiale deutend-essayistischen
Denkens in »Der Essay als Form« formuliert, welcher Adornos Noten zur Literatur (GS 11)
eröffnet. Dieser metatheoretische Essay ist für unseren Zusammenhang deshalb
besonders aufschlussreich, weil Adorno hier explizit auf das Verhältnis zwischen
essayistischem Schreiben und Kunstwerken eingeht und unzweideutig die Unterschiede
zwischen ihnen festhält. Er verteidigt erneut ein Denken, das nicht bei irgendeinem
angeblich Ersten oder Fundamentalstem ansetzt, sondern bei »kulturell vorgeformten«
Objekten; genauer gesagt bei Objekten, mit denen man in Leidenschaft – sei es Liebe,
Verachtung, oder Ohnmacht – verbunden ist.
Das essayistische (Denk-)Experiment besteht darin, diese Objekte so aufzuschlüsseln,
dass die Spannungen zwischen normativen Ansprüchen und ihrer Realität sichtbar
werden; dass aus dem, was einfach da zu sein scheint, eine widerspruchsvolle Bewegung
wird. Damit gerät auch das aufgeladene Verhältnis der Denkenden zu diesen Objekten in
Bewegung. Erkenntnis des Objekts, Selbsterkenntnis sowie die Erkenntnis des
gesellschaftlichen Unbewussten auf allen Seiten sind unter solchen Umständen nicht
mehr sinnvoll voneinander trennbar. Dass die Begriffe und Denkformen in einem
solchen Experiment ebenso zur Disposition stehen wie alles andere, versteht sich von
selbst. Deutendes oder essayistisches Denken ist immer auch Begriffs- und Sprachkritik.
(Djassemy 2002)
Zur Ästhetik des essayistischen Denkens
29
Als ästhetisch kann man essayistisches Denken insofern bezeichnen, als es nicht nur aus
Argumenten, sondern auch aus räumlichen oder formalen Anordnungen oder Klängen
von Begriffen und Sätzen Erkenntnis gewinnen kann. In dieser Hinsicht ist es ein
sinnliches, ein an Wahrnehmungsqualitäten interessiertes Denken. Ja sogar von einer
gewissen »Autonomie der Form« (GS 11: 11) ist die Rede. Aber es bleibt – im
Unterschied zum Kunstwerk – den Begriffen treu. Denn es ist die sinnliche Schicht und
Anordnung von Begriffen, welche die zentrale Rolle spielt; nicht aber von beispielsweise
körperliche Bewegungen, wie sie im Tanztheater im Medium der Bewegung auf ihre
Sozialgeschichten hin erforscht und auflöst werden. Von der Kunst unterscheidet sich der
Essay, so schreibt Adorno, »gleichwohl durch sein Medium, die Begriffe [...] und durch
seinen Anspruch auf Wahrheit bar des ästhetischen Scheins. (GS 11, 11) Mit anderen
Worten: Adornos Denken gegen das Denken, welches Urteile und Konklusionen zwar
fortlaufend wieder aufhebt, liegt gleichwohl das unnachgiebige Bedürfnis nach einer
Scheidung zwischen wahr und falsch zugrunde. Sein Denken ist ein zutiefst
wahrheitsorientiertes, wenngleich Wahrheit dabei vielmehr als »Störfaktor« (Scholze 2000:
316) denn als Ergebnis eine Rolle spielt.
So steht das essayistische Denken, das man nicht auf Aufsatzformen im 20-Seiten-Bereich
begrenzen sollte, sondern die Dimension von Adornos Ästhetischer Theorie annehmen
kann, zur traditionellen Philosophie dort quer, wo es um die Ablehnung bestimmter
Forderung nach Fundierung und methodischen Prinzipien geht, vor allem aber dort, wo
philosophisches Denken seine eigene Ästhetizität im Sinn der Darstellungstechniken in
Abrede stellt. Die Gattung des heute so beliebten papers verfügt aus Adornos Perspektive
nicht weniger über eine Ästhetik als die Essays von Montaigne. Nur verhält sich letzterer,
und dasselbe gilt für Adorno, zu diesem Sachverhalt – und zwar immer auch
selbstkritisch.
Zusammenfassend ist festzuhalten: Die Konstruktionen des Kunstwerks sind mit den
Konstellationen des Essays verwandt, sofern beide darstellungsreflexiv konstruieren. Aber
anders als Essays werden künstlerische Konstellationen nicht von vornherein und nur
hergestellt, um zu einem (neuen) Urteil zu kommen. Wenn es an der häufig zitierten Stelle
bei Adorno heißt »Philosophie und Kunst konvergieren in deren Wahrheitsgehalt: die
fortschreitend sich entfaltende Wahrheit des Kunstwerks ist keine andere als die des
philosophischen Begriffs« (GS 7: 197), so ist dieses »konvergieren« wohl am ehesten im
30
Sinn eines Treffpunkts oder einer Wegkreuzung zwischen Kunst und Philosophie zu
verstehen und nicht als Identitätsbehauptung.
Adorno sagt nicht, dass die höchste philosophische Wahrheit im Kunstwerk wohnt, wie
etwa Heidegger, sondern dass Kunstwerke – aber nicht nur sie, sie tun es lediglich auf
eine besonders herausfordernde Weise – dazu motivieren, bestimmte Ausschnitte der
Wirklichkeit neu zu beurteilen, an bestimmten Stellen erneut auf die gänzlich
unkünstlerische Wahrheitssuche zu gehen. Adornos »Kunstwahrheit« ist auch nicht darin
von der Wahrheit gewöhnlicher Satzzusammenhänge unterschieden, dass es ihr um das
Große-Ganze einer Heideggerschen »Welt« ginge. Denn derart Großes hat er mit der
prima philosophia von Anbeginn an verworfen. Es kann bei Adorno allenfalls darum gehen
herauszufinden, wie gesellschaftliche Zusammenhänge an bestimmten historischen und
geopolitischen Stellen eingreifen: »Wenn wahrhafte Deutung allein durch
Zusammenstellung des Kleinsten gerät, dann hat sie an den großen Problemen im
herkömmlichen Sinn keinen Anteil mehr« (GS 1: 336). Genauso wenig wie Kunst bei
Adorno die höchste Wahrheit ist, so wenig erniedrigt er sie instrumentalisierend für die
philosophische Wahrheitssuche. Wer sich der Kunst nur zuwendet, um Antworten auf
oder Exemplifikationen von schon bekannten Problemen zu bekommen, wird nichts
herausfinden, war sie oder er schon lange gewusst hat. Wer sich von ihr abstoßen und
gefangen nehmen lässt, kann auf ein Problem stoßen, das der unbedingten Beantwortung
bedarf – aber im Denken, das keinen Halt kennt, und handelnd.
Zitierte bzw. erwähnte Literatur:
Benjamin, Walter: Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik. In: Ders.: Gesammelte Schriften 1/1. Hrsg. v. Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a. M. 1980
Bohrer, Karl Heinz: Ästhetische Negativität. Wien/München 2002 Bubner, Rüdiger: »Über einige Bedingungen gegenwärtiger Ästhetik«. In: Neue Hefte für
Philosophie 5 (1973). 38-73. Demirović Alex: Der nonkonformistische Intellektuelle. Die Entwicklung der Kritischen Theorie zur
Frankfurter Schule. Frankfurt a. M. 1999. Diederichsen, Diedrich: »Zeichenangemessenheit: Adorno gegen Jazz und Pop. ‚Der
farbige Duke Ellington, ein ausgebildeter Musiker ... «. In: Hirsch, Michael/Müller, Vanessa Joan/Schaffhausen, Nikolaus (Hrsg.): Adorno. Die Möglichkeit des Unmöglichen, Frankfurt a. M. 2003. 33-46.
Djassemy, Irina: Der »Productivgehalt kritischer Zerstörerarbeit«. Kulturkritik bei Karl Kraus und Adorno. Würzburg 2002
31
Früchtl, Josef, »›But I like it‹. Adorno und die Popkultur«. In: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 48/2. 2003. 171-173
Geuss, Raymond: »Art and Criticism in Adorno’s Aesthetitics«. In: Ders.: Outside Ethics. Princeton/Oxford 2005: 161-183.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Vorlesungen über die Ästhetik III. Theorie Werkausgabe 15. Frankfurt a. M. 1986 (HW).
Hullot-Kentor, Robert: »Translators Introduction«. In: Adorno: Aesthetic Theory. London 2004 (1997). IX-XXIII.
Jauss, Hans Robert, »Kritik an Adornos Ästhetik der Negativität«. In: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Frankfurt a. M. 1982. 44-71.
Küpper, Joachim/Menke, Christoph (Hrsg.): Dimensionen der ästhetischen Erfahrung. Frankfurt a. M. 2003.
Menke, Christoph, Die Souveränität der Kunst. Ästhetische Erfahrung nach Adorno und Derrida. Frankfurt a. M. 1991
Nesbitt, Nick: »Deleuze, Adorno, and the Composition of Musical Multiplicity«. In: Buchanan, Ian/Swiboda, Marcel (Hrsg.): Deleuze and Music. Edinburgh 2004. 54-75. Rancière, Jacques: Ist Kunst widerständig? Berlin 2008 Rebentisch, Juliane: Ästhetik der Installation. Frankfurt a. M. 2003. Scholze, Britta: Kunst als Kritik. Adornos Weg aus der Dialektik. Würzburg 2000. Scholze, Britta: »Die Kunst der Provokation. Adornos philosophischer Optimismus«. In:
Zuckermann, Moshe (Hrsg.): Theodor W. Adorno. Philosoph des beschädigten Lebens. Göttingen. 2004. 46-60.
Sonderegger, Ruth: »Zur Ideologie der ästhetischen Erfahrung. Versuch einer Repolitisierung«. In: Koch, Gertrud/Voss, Christiane (Hrsg.): Zwischen Ding und Zeichen, München 2005. 86-106
Sonderegger, Ruth: »Zwischen Amusement und Askese. Bei Adorno, im Theater von René Pollesch und darüber hinaus«. In: Westend. Neue Zeitschrift für Sozialforschung. 2006. H. 1. 131-145.
Wellmer, Albrecht: »Wahrheit, Schein, Versöhnung. Adornos ästhetische Rettung der Modernität«. In: Ders.: Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. Vernunftkritik nach Adorno. Frankfurt a. M. 1985. 9-47.
Wellmer, Albrecht: »Metaphysik im Augenblick ihres Sturzes«. In: Ders.: Endspiele: Die unversöhnliche Moderne. Essays und Vorträge. Frankfurt a. M. 1993. 204-223
Wellmer, Albrecht: Versuch über Musik und Sprache. München 2009. Ziermann, Christoph: »Dialektik und Metaphysik bei Marx und Adorno«. In: Ette,
Wolfram (Hrsg. u. a.): Adorno im Widerstreit. Zur Präsenz seines Denkens. Freiburg/München 2004. 24-56
Kurzvita: Ruth Sonderegger (* 1967) studierte Philosophie und Literaturwissenschaft in Innsbruck, Konstanz und Berlin; 1998 Promotion in Philosophie an der FU Berlin; 1993-2001 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Philosophischen Institut der FU Berlin; 2001-2009 Professorin am Philosophischen Institut der Universiteit van Amsterdam; seit 2009 Professorin für Philosophie und ästhetische Theorie an der Akademie der bildenden Künste Wien.
32
Nicht zitierte Literatur
Baumeister, Thomas und Jens Kuhlenkampf, „Geschichtsphilosophie und philosophische Ästhetik. Zu Adornos ‚Ästhetischer Theorie‘, in: Neue Hefte für Philosophie, 5, 1973, S. 74-104
Bernstein, Jay M., The Fate of Art. Aesthetic Alienation from Kant to Derrida and Adorno, 1992
Buck-Morss, Susan, „Theory and Art: In Search of a Model“, in: Buck-Morss, Susan, The Origin of Negative Dialectics. Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, and the Frankfurt Institute, New York 1979, 122-135 (= chapter 8)
García Düttmann, Alexander, „Anspruch der Kunst“, in: Michael Hirsch, Vanessa Joan Müller und Nikolaus Schaffhausen (Hg.): Adorno. Die Möglichkeit des Unmöglichen, Ffm. 2003, S. 89-96
Eichel, Christine, Vom Ermatten der Avantgarde zur Vernetzung der Künste. Perspektiven einer interdisziplinären Ästhetik im Spätwerk Theodor W. Adornos, Ffm. 1993
Figal, Günther, Theodor W. Adorno. Das Naturschöne als spekulative Gedankenfigur, Bonn 1977
Früchtl, Josef, Mimesis. Konstellation eines Zentralbegriffs bei Adorno, Würzburg 1986
Füllsack, Manfred, Politische Kunst: Adorno im post-sowjetischen Kontext, Wien 1995
Hamilton, Andy, „Adorno and the Autonomy of Art“, in: Stefano Giacchetti Ludovisi (Hg.), Nostalgia for A Redeemed Future: Critical Theory, Rome 2009
Hindrichs, Gunnar, „Scheitern als Rettung. Ästhetische Erfahrung nach Adorno“, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 74. Jahrgang, Heft 1, März 2000, S. 146-175
Huhn, Tom and Lambert Zuidervaart, The Semblance of Subjectivity: Essays in Adorno's Aesthetic Theory (= Studies in Contemporary German Social Thought), Cambridge Mass. and London 1999
Hullot-Kentor, Robert, „Aesthetic Theory: The Translation“, in: Telos, no. 65, 1985, 147-152
Jameson, Frederic, Late Marxism: Adorno, or, the Persistence of the Dialectic, London 1990
Lehr, Andreas, Kleine Formen: Konstellation / Konfiguration, Montage und Essay bei Theodor W. Adorno, Walter Benjamin und anderen, Books on Demand Gmbh, 2003
Lindner, Burckhardt und W. Martin Lüdke, Materialen zur ästhetischen Theorie Th. W. Adornos. Konstruktion der Moderne, Ffm. 1980
Liessmann, Konrad P., Ohne Mitleid. Zum Begriff der Distanz als ästhetische Kategorie mit ständiger Rücksicht auf Theodor W. Adorno, Wien 1991
Prokop, Dieter, Mit Adorno gegen Adorno. Negative Dialektik der Kulturindustrie, Hamburg 2003
Recki, Birgit, Aura und Autonomie. Zur Subjektivität der Kunst bei Walter Benjamin und Theodor W. Adorno, Würzburg 1988
Seel, Martin, Adornos Philosophie der Kontemplation, Ffm. 2004
33
Seubold, Günther, Das Ende der Kunst und der Paradigmenwechsel in der Ästhetik. Philosophische Untersuchungen zu Adorno, Heidegger und Gehlen in systematischer Absicht, Freiburg/München 1997
Welsch, Wolfgang, „Adornos Ästhetik: Eine implizite Ästhetik des Erhabenen, in: Christine Pries (Hg.), Das Erhabene zwischen Grenzerfahrung und Größenwahn, Weinheim 1989, S. 185-213
Wilson, Ross, „Aesthetics“, in: Deborah Cook (Hg.), Theodor Adorno. Key Concepts, Acumen: Stocksfield 2008, S. 147-160
Zuidervaart, Lambert, Adorno's Aesthetic Theory: The Redemption of Illusion, Cambridge Mass. 1991