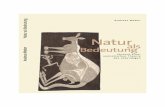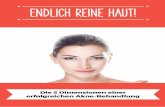Theorie in praktischer Absicht: Leo Koflers Linkssozialismus
Äquilibration und Synkretismus. Überlegungen zu einer interaktionistischen Theorie der...
-
Upload
fh-muenster -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Äquilibration und Synkretismus. Überlegungen zu einer interaktionistischen Theorie der...
Lars C. Grabbe, Patrick Rupert-Kruse, Norbert M. Schmitz (Hg.)
büch
ner B
eweg
tBilde
r
Gra
bbe,
Rup
ert-
Krus
e, S
chm
itz
M
ult
imo
da
le B
ild
erbü
chne
r
Von einer Entschlüsselung der strukturellen Beson-derheiten des Films ist die Forschung noch immer weit entfernt. Zwar wurde bereits früh erkannt, dass die ›siebente Kunst‹ Elemente verschiedener Medien in sich vereint, mehrere Sinne gleichzeitig anspricht und ihre Bild- und Tonebene einander wechselseitig beeinflussen. Eine konsequent verfolgte Methode, die der Vielschichtigkeit des filmischen Repräsentati-onssystems gerecht wird, wurde bislang jedoch nicht entwickelt.
Die Analyse des komplexen Verhältnisses von In-termedialität, Intermodalität und Intercodalität innerhalb des filmischen Rezeptionsprozesses steht im Zentrum dieses Bandes. Die einzelnen Beiträge ori-entieren sich an diesen drei Kerndimensionen, um der synkretistischen Struktur des Films auf die Spur zu kommen. Auf diese Weise tragen sie zur Etablierung einer interdisziplinären Bewegtbildwissenschaft bei.
www.buechner-verlag.de
ISBN 978-3-941310-36-0 Zur synkretistischen Struktur des Filmischen
Multimodale Bilder
www.bewegtbildwissenschaft.de
Lars C. Grabbe, Patrick Rupert-Kruse, Norbert M. Schmitz (Hg.)
Multimodale BilderZur synkretistischen Struktur des Filmischen
verlagwissenschaft und kultur
büchner-
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Besuchen Sie uns im Internet:www.buechner-verlag.de
ISBN 978-3-941310-36-0
Copyright © 2013 Büchner-Verlag, DarmstadtJoachim Fischer, Florian Gernhardt und Andreas Kirchner GbR
Umschlaggestaltung: Büchner-Verlag, DarmstadtDruck und Bindung: Docupoint GmbH, MagdeburgPrinted in Germany
Das Werk, einschließlich all seiner Teile, ist urheberrechtlich durch den Verlag geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung des Verlags unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Bibliografische Informationen der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Inhalt
Dank ............................................................................................................... 7
Einleitung ...................................................................................................... 9 Lars C. Grabbe, Patrick Rupert-Kruse und Norbert M. Schmitz Äquilibration und Synkretismus. Überlegungen zu einer interaktionistischen Theorie der Filmbildrezeption ............................ 16 Lars C. Grabbe und Patrick Rupert-Kruse Intermedialität als Selbstverständlichkeit: Zur Diskursgeschichte des multimodalen Mediums Film in der Moderne .............................. 42 Norbert M. Schmitz Zu einer Geschichte des asynchronen Bewegtbildes .......................... 63 Birk Weiberg Trompeten, Fanfaren und orangefarbene Tage: Zur Intersemiose in Die fabelhafte Welt der Amélie ................................. 81 Janina Wildfeuer Verkörperung von Rollenstereotypen im DEFA-Film ..................... 102 Doris Schöps Bildbasierte Interessensmodellierung im zeitgenössischen Musikclip: Beitrag zu einer multimodalen Filmanalysepraxis .......... 129 Florian Mundhenke
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
6 I N H A L T
Antike Bilder als Signifikanten kultureller Einheiten im Film ......... 148 Jacobus Bracker Susanne K. Langer und Parker Tyler über Film als »multimodales« Medium ......................................................................... 171 Henning Engelke Filmische Selbstreflexion als gespiegelter Filmtraum: Ingmar Bergmans Persona ....................................................................... 188 Stefanie Kreuzer Sound & Vision: Szenen intermedialer Reflexion in Blowup, The Conversation und Pulp Fiction ............................................................. 214 Tanja Prokić
Abbildungsverzeichnis ............................................................................. 240 Autorinnen und Autoren ....................................................................... 243
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Äquilibration und Synkretismus. Überlegungen zu einer interaktionistischen Theorie der Filmbildrezeption
Lars C. Grabbe und Patrick Rupert-Kruse
Einleitende Vorüberlegungen
Der Film ist als eine multimodal bzw. multimedial organisierte Struktur zu verstehen, die auf der Basis der dispositiven Grundmodi Bewegung und Zeit innerhalb einer audiovisuellen Repräsentation Bedeutung generiert. Der systemische Zusammenhang filminhärenter Modalitäten und Medialitäten erlaubt so eine Wirksamkeit über un-terschiedliche Ebenen der kommunikativen Vermittlung hinweg. Daher sollte in Bezug auf bedeutungsgenerierende Prozesse während der Rezeption vielleicht besser von einer Intermedialität oder Inter-modalität – und damit auch von einer Intercodalität – gesprochen werden. Schließlich geht es darum, welche Effekte1 sich aus dem Zusammenspiel2 zwischen unterschiedlichen Medien, die der Film inkorporiert und abbildet, und unterschiedlichen Modalitäten, die dem Film zu eigen sind, ergeben.
Im vorliegenden rezeptionsästhetisch-kognitivistischen Ansatz wird das Filmbild als ein multimodal organisiertes Repräsentations-feld begriffen, welches die Sinnlichkeit über audiovisuelle Elemente affiziert und zudem differente Codes und Codeebenen inkorporiert.
—————— 1 Der Begriff Effekt soll bewusst weit verstanden werden, damit Zeit- und Bild-
verstehen, Zeit- und Bildwahrnehmung, Verstehen, Bedeutung, Affekt, Synäs-thesie, Symbolizität etc. subsummiert werden können.
2 Janina Wildfeuer hat für eine semiotische Beschreibung dieses Zusammenspiels den Begriff der Intersemiose geprägt, um die Dekodierungsleistung innerhalb unterschiedlicher Symbolsysteme hervorzuheben, die sich über die Sinnes-modalitäten des Visuellen und des Akustischen artikulieren: »The principles operate not only on the level of one single mode, but in particular across different modes. Their intersemiosis accounts for the diverse meanings which have to be identified by a recipient when watching the movie« (Wildfeuer 2013: 14).
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Ä Q U I L I B R A T I O N U N D S Y N K R E T I S M U S 17
Neben dem zentralen Moment der Bewegung als differentia specifica zu statischen Bildern ist dem Film grundsätzlich eine autonome Zeit-lichkeit zuzuschreiben – Filme haben eine Dauer des Zeigens und Gezeigt-Werdens. Daraus folgt, dass sich dieses Repräsentationsfeld innerhalb der Rezeptionssituation als Interaktion zwischen dem Bil-derstrom auf dem jeweiligen audiovisuellen Display und in der Erin-nerung des Rezipienten artikuliert. In dieser Perspektive erstreckt sich die filmische Wahrnehmungssituation über das eigentliche Ton/Bild bis hin zur mnemonischen Repräsentation des filmischen Gesche-hens.
Ziel der folgenden Ausführungen ist es, die Relationen, Interakti-onen und semiotischen Leistungen der filmischen Modalitäten des Visuellen und Akustischen3 funktional zu bestimmen, zu erkunden und den Vorrang des Visuellen vor dem Akustischen, der in der Lite-ratur zum Film, aber auch zum Filmton, stets hervorsticht, grundle-gend zu problematisieren und vielfältig exemplarisch zu analysieren. Schließlich ist die Beziehung zwischen Bild und Ton als eine der medienspezifischen Eigenschaften des Films anzusehen.
Hierzu orientieren sich die folgenden Ausführungen unter ande-rem an Autoren wie Maurice Merleau-Ponty, Michel Chion, Gilles Deleuze und Peter Wuss, dessen Begriff der Äquilibration4 als ein angemessenes Strukturprinzip für eine Schärfung dieses Problembe-
—————— 3 Diese können in Bild (bewegt/statisch), Sprache (gesprochen/geschrieben) und
Ton (Musik, Geräusch) unterteilt werden (vgl. Schneider/Stöckl 2011: 29). 4 Hervorzuheben ist die paradoxe modale Struktur des filmischen Ton/Bildes:
Nicht nur geht Wuss von einer grundlegenden Asymmetrie der Wahrnehmungs-systeme (vgl. Wuss 1999: 292) in Bezug auf die filmische Rezeption aus, auch Chion spricht den filmischen Modalitäten eine – vor allem raumbezogene – Asymmetrie zu (vgl. Chion 1994: 67–71). Trotz einer allgemeinen Asymmetrie von Bild und Ton wird Film dennoch als Einheit wahrgenommen, da er einerseits durch eine filminterne Synchronizität der Modalitäten imstande ist Symmetrie herzustellen, und andererseits auch die rezipientenseitigen Prozesse eine Synthese des Wahrgenommenen forcieren (Chion nennt dies mental fusion, vgl. Murch 1994: XIX). Hierdurch kommt es zu einer Erweiterung und Transformation des rein Bildlichen – daher haben wir für unsere Ausführungen den Begriff des Ton/Bildes gewählt. Da sich der Film somit als eine Form artikuliert, die sich sowohl über einen visuellen als auch über einen akustische Raum ausdehnt – oder sich zwischen diesen Räumlichkeiten spannt –, kann man ihn wohl am besten als synkretistische oder synästhetische Repräsentation bezeichnen.
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
18 L A R S C . GR A B B E U N D P A T R I C K R U P E R T -KR U S E
reichs erscheint. Denn obwohl Bild und Ton bereits im Produktions-prozess getrennt aufgenommen bzw. kreiert werden und auch über die jeweiligen Dispositive und deren visuelle und akustische Displays getrennt übermittelt werden, gibt es innerhalb der Wahrnehmung des Rezipienten eine erstaunliche Interaktion zwischen diesen Elementen (vgl. Anderson 1998: 80):
»The fact that the sound actually comes not from the lips on the screen but from a small speaker in the back of the room is not something evo-lution has prepared us to take into account. Lip sync is so retrieving, the cross-modal confirmation of identity of speaker and speech is so com-pelling, that we apparently ignore any cue that the actual sound energy is emanating from a source other than the mouth of the speaker« (Ander-son 1998: 84).
Versteht man also Film als multidimensionales Gestaltphänomen – welches auf sinnlicher Ebene auf die Dimensionen Bild und Ton heruntergebrochen werden kann – kann ein hierarchischer Analyse-ansatz bezogen auf das filmische Ton/Bild nicht mehr als adäquat angesehen werden. Daher steht zwar vor allem der Gedanke von Ähnlichkeit und Differenz von Bild und Ton im Fokus unserer Überlegungen, der eigentliche Ausgangspunkt ist jedoch immer die Wahrnehmung des filmischen Ton/Bildes als (phänomenale) Entität, deren interaktionistische Wirkungsstrukturierung exemplarisch (kog-nitiv-semiotisch) beschrieben werden kann.
Das Ton/Bild I: Film als audiovisuelle Repräsentation
Wird Film als eine multimodale – sprich: audiovisuelle – Repräsenta-tion bezeichnet, kann mit Maurice Merleau-Ponty festgestellt werden, dass der Tonfilm eine zeitliche Form ist, die nicht als nebeneinander-gestellte Einzelteile wahrgenommen wird, sondern als eine überge-ordnete Struktur der (Re)Präsentation (2010: 77). Der Tonfilm ist »keine Summe von Wörtern oder Geräuschen«, sondern ebenfalls eine Form (ebd.: 78). Denn die Vereinigung von Bild und Ton bildet »ein neues Ganzes, das sich nicht auf die Bestandteile reduzieren läßt, aus denen es zusammengesetzt ist. Ein Tonfilm ist kein Stummfilm,
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Ä Q U I L I B R A T I O N U N D S Y N K R E T I S M U S 19
der mit Tönen und Worten ausgeschmückt wird […]. Das Band zwischen Ton und Bild ist viel enger, und das Bild wird durch die Nachbarschaft des Tons transformiert« (ebd.: 79).
An diesem Strukturmoment kommt der Prozess der Äquilibration zum Tragen, und damit der Wechsel vom Begriff Multimodalität zu Intermodalität, da sich der Begriff der Äquilibration auf ein interakti-onistisches Relationsgefüge bezieht und nicht auf separate Modalitä-ten ohne jegliche Beziehung zueinander:
»Filmische Produkte stellen eine Einheit von akustischer und visueller Bewegung dar. Bei dem Verhältnis von visueller und akustischer Dimen-sion handelt es sich hier keineswegs um ein additives5, sondern durchweg um ein integrales Verhältnis: der Klang fügt dem Bild nicht nur etwas hinzu, der Klang verwandelt6 das Bildgeschehen, das seinerseits das modifiziert, was akustisch vernehmbar ist. Gesprochene Sprache, Musik und andere Geräusche bilden eine integrale Dimension des filmischen Bewegungsbildes« (Keppler 2010: 447).
Nach Deleuze besitzt das filmische Ton/Bild drei visuelle Dimensio-nen (Länge, Breite, Höhe) und eine vierte, auditive Dimension, als dessen irreduzible Bestandteile. Diese inhärente Multimodalität gilt es zu beachten, wenn simplifizierend das Filmbild oder der Film thema-tisiert werden. An diese Ausführungen anknüpfend soll im Folgenden der Film als Gestalt oder als synästhetische Einheit angesehen wer-den – eben als ein multidimensionaler Synkretismus.7
—————— 5 Trotz der Hervorhebung der Neuartigkeit seines Ansatzes, der die Beschäftigung
mit dem Film auf eine tonale Ebene hebt, spricht Chion von einem added value, mit dem der Ton das Bild bereichert (vgl. 1994: 4) und bleibt somit dem Primat des Visuellen verhaftet, zu welchem der Ton lediglich hinzutritt.
6 »Je besser der Ton desto besser das Bild« fasst Walter Murch das interaktionis-tische Verhältnis von Bild und Ton zusammen (vgl. 1994: VIII) und tatsächlich kann das Ohr aufgrund seiner feineren Auflösung das Auge bei dem Sehen und Verstehen einer Szene unterstützen: Es kann in einem kurzen Zeitraum eine komplexe Serie akustischer Verläufe oder verbaler Phoneme erkennen, während das Auge im selben Zeitraum lediglich wahrnehmen kann, dass sich etwas be-wegt, ohne dies genauer analysieren zu können (vgl. Chion 1994: 134f.).
7 Nicht ohne Grund postuliert Michel Chion für den Film eine spezifische Wahr-nehmungsweise, die er Audio-vision nennt (vgl. 1990: 3). Damit unterdrückt er die mögliche Betonung der Dominanz eines Wahrnehmungssystems, indem er weiter ausführt, dass die Tonspur eines Films losgelöst vom Bild in sich keine innere
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
20 L A R S C . GR A B B E U N D P A T R I C K R U P E R T -KR U S E
Das Ton/Bild II: Filmische Multimodalität
In der aktuellen kommunikations- und medienwissenschaftlichen Forschung, die sich mit der Analyse multimodaler Texte beschäftigt, steht die Formulierung eines leistungsfähigen, semiotisch und kom-munikationstheoretisch fundierten Medienbegriffs zunächst am An-fang aller Ausführungen (vgl. Bateman/Schmidt 2011; Stöckl 2011). Und obwohl sich die Filmwissenschaft bei der Definition von Film als multimodalem Medium lediglich auf die beteiligten Sinne des Sehens und Hörens beschränkt (und sich somit auf einen biologi-schen Medienbegriff bezieht)8, erscheint für die Analyse von semioti-schen Prozessen, die gleichermaßen an der Darstellung und Rezep-tion beteiligt sind, ein differenzierteres Theoriemodell notwendig zu sein.
Film kann aufgrund seiner Integration unterschiedlichster semio-tischer Ressourcen als multimodales Medium angesehen werden, wobei deren Zusammenspiel, welches sich über verschiedene Sin-nesmodalitäten artikuliert, die Bedeutung des Films konstruiert: »[We] see multimodal texts as making meaning in multiple articulations« (Kress/van Leeuwen 2001: 4).
Die modalen Dimensionen beinhalten also unterschiedliche Codesysteme, denn als »Zeichensystem zweiter Stufe bedient sich jeder Film vorgegebener primärer Zeichensysteme, die an seine ihn konstituierenden Informationskanäle gebunden sind (Sprache/ Schrift, Filmbilder, Ton/Musik)« (Decker & Krah 2009: 225). Denn Film bildet diese differenten Dimensionen unter der Verwendung spezifischer kinematografischer Codes (wie Kamerahandlung oder Montage) ab. Sobald im Folgenden also der Begriff Film fokussiert und thematisiert wird, ist stets ein komplexes semiotisches System gemeint, in welchem diese wahrnehmungsrelevanten Elemente inter-agieren.
—————— Einheit bildet und damit nicht der Bildspur als Ganzes gegenüber gestellt werden kann (vgl. Flückinger 2010: 132; Chion 1990: 36).
8 Nach Roland Posner charakterisiert der biologische Medienbegriff »die Zeichen-systeme nach den Körperorganen, die an der Produktion, Distribution, und Rezeption von Zeichen beteiligt sind« (1986: 293).
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Ä Q U I L I B R A T I O N U N D S Y N K R E T I S M U S 21
Dennoch kann das filmische Repräsentationsfeld relativ einfach heruntergebrochen als bimodal – im biologischen Sinne – beschrieben werden (vgl. Anderson 1998: 80): der Rezipient sieht und hört die Ereignisse, die auf dem audiovisuellen Display des filmischen Appa-rates – wie auch immer dieser strukturiert sein mag – erscheinen.9
Synkretismus, Synchresis, Synästhesie
Nach Wuss bezeichnet Synkretismus
»die Verschmelzung heterogener Momente auf den unterschiedlichsten Ebenen der Gestaltung. Aufgrund dieser strukturellen Besonderheit er-reicht der Film gelegentlich Wirkungen, die man als Synthese-Effekt be-zeichnen kann, weil darin die Konstituenten der verschiedenen in die Kinematographie zusammengeführten kulturellen Systeme zu einer neuen Einheit verschmolzen werden« (1993: 308).
Mit Michel Chion kann diese Verschmelzung unterschiedlicher Mo-dalitäten ebenfalls auf der Seite des Zuschauers als zentraler Prozess der Filmrezeption ausgemacht werden. Mit dem Begriff der Synchresis beschreibt Chion eine intermodale Naht, »the spontaneous and irre-sistible weld produced between a particular auditory phenomenon and visual phenomenon when they occur at the same time« (1994: 63). Durch das Zusammenspiel bzw. die Synchronizität dieser Ver-schmelzungsmomente ist es möglich, den Film als einheitliche Form wahrzunehmen. Dennoch soll festgehalten werden, dass Synthese-prozesse innerhalb der Rezeption ebenfalls vorgenommen werden, wenn keine Synchronizität zwischen Bild und Ton herrscht, da der
—————— 9 Daher ist Multimodalität bzw. Intermodalität als ein Phänomen anzusehen, das
sich in unserer Perspektive zunächst einmal innerhalb seiner aisthetisch-phäno-menologischen Dimension äußert, bevor es über den Prozess der Semiose oder treffender Intersemiose (vgl. Wildfeuer 2013: 14) in ein Bedeutungskonstrukt überführt wird. Dies kann als interner Synkretismus bezeichnet werden, also als das sinnliche Zusammenwirken unterschiedlicher Signifikationssysteme. Denn sobald wir über das filmische Ton/Bild sprechen, ist mit einer potentiellen Interaktion aller konstituierenden Dimensionen zu rechnen (vgl. Keppler 2010: 449).
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
22 L A R S C . GR A B B E U N D P A T R I C K R U P E R T -KR U S E
Synthese-Effekt etwas dem Film Inhärentes zu sein scheint und somit sowohl der Ausgangspunkt als auch das Ziel des Rezeptions-prozesses bildet.
»Als ein Spezialfall des Synthese-Effekts mag der Synästhesie-Effekt gelten. Er beruht darauf, daß Gestaltungsmittel, die dem visuellen und dem auditiven Wahrnehmungssystem zuzuordnen sind, so zur Korres-pondenz gebracht werden, daß sie einander im kunstsemantischen Pro-zess temporär ersetzen. Bei dieser Grenzüberschreitung der Sinnesberei-che, wo sich im Akustischen fortsetzt, was im Optischen entwickelt wurde oder umgekehrt, entsteht für den Rezipienten der Eindruck höchster Empfindungsintensität« (1993: 308).
Diese Grenzüberschreitung bzw. das semantische Netz, »das die Grenzen der Wahrnehmungssysteme überschreitet« (Wuss 1999: 297f.) und sich eben auf den komplexen Zusammenhang und die visuelle und auditive Dimension des filmischen Ton/Bildes bezieht, kann man auch auf andere medienexterne Sinnesempfindungen aus-weiten.
Hier steht eine Involvierung des Rezipienten als (modaler) Kon-text der Bilder im Vordergrund, was nach Joachim Paech eine we-sentliche Komponente der Beteiligung des Betrachters innerhalb der filmischen Erfahrung ist: »Die Konstellation von einerseits im Aus-stellungsraum relativ fixierten und andererseits im Vorstellungsraum heftigsten Bewegungen und Intensitäten ausgesetzten Körpern ist als medienspezifische Distanz wesentlich für ästhetisches und synästhe-tisches Miterleben« (Paech 2000: 134).
Man kann diese Ausführungen mit Michel Chion in eine ent-scheidende Richtung präzisieren. Für ihn bringen Bild und Ton zwei für die Filmwahrnehmung bedeutende Eigenschaften mit sich: Die Wahrnehmung über eine gewisse Distanz hinweg und die Erzeugung rhythmischer, dynamischer, zeitlicher, taktiler und kinetischer Emp-findungen über die Kanäle des Auditiven und des Visuellen. Dies geschieht, so Chion, durch etwas, dass sich als transsensorische bzw. metasensorische Wahrnehmung bezeichnen lässt:
»In the transsensorial or even metasensorial model […] there is no sen-sory given that is demarcated and isolated from the outset. Rather, the senses are channels, highways more than territories or domains. If there exists a dimension in vision that is specifically visual, and if hearing in-
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Ä Q U I L I B R A T I O N U N D S Y N K R E T I S M U S 23
cludes dimensions that are exclusively auditive (those just mentioned), these dimensions are in a minority, particularized, even as they are cen-tral. When kinetic sensations organized into art are transmitted through a single sensory channel, through this single channel they can convey all the other senses at once« (Chion 1994: 136).
Hier dient der Rezipient in persona als modaler Kontext, der die film-inhärenten Modalitäten imaginativ ergänzt und sogar körperlich auf die phänomenale Präsenz des Films reagieren kann. Eine ähnliche Behauptung findet sich bei der Filmphänomenologin Vivian Sob-chack. In Carnal Thoughts spricht sie diesbezüglich von einer »embo-died vision« (2004: 70), einer Form der Umwandlung visueller Daten in u.a. olfaktorische oder taktile Empfindungen durch den Körper des Rezipienten.10
Aktivierung und Synchresis
Die angeführten filmischen Strukturkomponenten des Visuellen und Auditiven verfügen notwendigerweise über einen besonderen Akti-ons- und Wirkungsradius innerhalb der Rezeption – oder präziser: über einen Aktivierungsmodus. Das filmische Aktivierungspotenzial löst komplexe Sinn- und Bedeutungsbezüge aus, die während der Rezep-tion in einer komplexen Geschehenswahrnehmung münden können. Dies bestätigt auch Joachim Paech, wenn er den filmischen Bildern eine teleologische Entwicklung hin zu »überwältigenderen, erschüt-ternderen und rasanteren Bildern« (2000: 133) attestiert, die auf eine interne Bewegtheit des Körpers zielen. Darüber hinaus verweist der Begriff der Aktivierung auf ein dezidiert kognitivistisches Argument, dass nämlich beim Rezipienten eine mentale Repräsentation der
—————— 10 Sobchack spricht hier auch vom cinästhetischen Subjekt (cinesthetic subject), um mit
dieser Begrifflichkeit die Komplexität der filmischen Erfahrung beschreibbar zu machen und die Art und Weise hervorzuheben, wie Kino unsere dominanten Sinne des Sehens und Hörens benutzt, um zu unseren anderen Sinnen zu sprechen: »cinema uses our dominate senses of vision and hearing to speak com-prehensibly to our other senses« (vgl. Sobchack 2004: 67).
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
24 L A R S C . GR A B B E U N D P A T R I C K R U P E R T -KR U S E
durch die Wahrnehmung vermittelten Inhalte angenommen werden muss – auch wenn diese asymmetrisch vermittelt sind:
»Einzelne Gedächtnisspuren überlagern sich dabei und werden über ein parallel-distributives Verarbeitungssystem gespeichert, in dem die einfa-chen Verarbeitungseinheiten jeweils bestimmte Aktivationswerte an-nehmen, die dann als Signale an die anderen Einheiten weitervermittelt werden. Diese Signalausbreitung geschieht parallel und führt zur Etablie-rung komplexer Aktivationsmuster, die, einem Gesetz von Selbstorgani-sation folgend, zeitweilig zu einem stabilen Gleichgewichtszustand fin-den« (Wuss 1999: 433).
Somit bildet das Aktivierungspotenzial des Films eine eigenständige Handlungsdimension aus, beispielsweise durch den Einsatz von Schrift, Bild, Sound, Musik, Beleuchtung, Perspektive etc., die den Film sowohl über eine wahrnehmungstheoretische als auch eine zeichentheoretische Perspektive beschreibbar macht. Denn Film operiert mit audiovisuellen Strukturkomponenten, die ein direktes Erlebnispotenzial generieren, dessen tiefer liegende Bedeutungen allerdings auf interne Codemuster und externe kulturelle Codes zu-rückzuführen sind.
»Wie freilich die Einbindung jener Kunstwirkungen in das neuartige Ganze praktisch geschieht und theoretisch darzustellen ist, hängt dann in hohem Maße von den Auffassungen zum gattungsspezifischen Synkre-tismus ab. Übrigens verschmilzt der Film nicht nur traditionelle Kunst-wirkungen, die einem künstlerischen Code folgen, sondern es werden auch die verschiedenen kulturellen Codes jenseits der Kunst in die medi-ale Kommunikation einbezogen« (Wuss 1999: 287).
Interne Synchronizität: Repräsentation und Äquilibration
Darüber hinaus ist es ein konstitutives Merkmal der Multimodalität, dass sie asymmetrische bzw. heterogene Sinndimensionen integriert. Diese Divergenz – hier primär des Visuellen und Akustischen – manifestiert sich jedoch nicht als Widerstreit, Wahrnehmungsblo-ckade oder Irritationselement, sondern wird vom Film selbst, durch
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Ä Q U I L I B R A T I O N U N D S Y N K R E T I S M U S 25
die sich perfekt artikulierende Technizität im dispositiven Strukturan-gebot, und durch die Imaginations- und Wahrnehmungsfähigkeit des Rezipienten, stabilisiert. Es lässt sich demnach annehmen, dass der Film komplexe »Funktionsmechanismen unseres Wahrnehmungs-systems aufnimmt und sie in seinem Abbildungsverfahren instru-mentalisiert. Seine Komposition simuliert gewissermaßen die natürli-che Wahrnehmungsstrategie« (Wuss 1999: 290).
Dies führt zu einer zentralen These: Der Film selbst konstituiert eine Einheitsform asymmetrischer Elemente und generiert eine ei-gene filmische Äquilibration, er überwindet einerseits die inneren Spannungszustände, die notwendigerweise von der multimodalen Teleologie determiniert sind, und andererseits verschmilzt er die komplexesten kulturellen Diskurse und Codes. Der Rezipient hat dann die komplexe Aufgabe zu lösen, seine eigenen asymmetrischen Wahrnehmungen in eine einheitliche Geschehenswahrnehmung zu überführen und die intra- und intertextuelle Decodierung zu leisten.
»Charakteristisch für die gesamte Wirkungsweise ist nicht nur die Exis-tenz heterogener Momente, sondern die Tatsache einer Äquilibration und Selbststeuerung, die hinter den Verschmelzungstendenzen des ›Synkretismus‹ steht. Die ständige Vermischung von Heterogenem ist interpretierbar als Resultat eines Regulierungsvorganges, der ein span-nungsgeladenes Wechselverhältnis stabil hält, wie dies in vielen Kunst-psychologien gefordert wird. Eisenstein hat in seinem umfangreichen theoretischen Werk intuitiv wesentliche der hier benannten Funktions-prinzipien erfasst, als er etwa vom Kontrapunkt von Bild und Ton sprach, von Polyphonie in der Anlage der Komposition und von Synäs-thesie« (Wuss 1999: 293).
Eine Erklärung für diesen Regulierungsvorgang wird durch eine Analyse derjenigen Prozesse möglich, die sich durch die Strukturie-rung des filmischen Repräsentationsfeldes innerhalb der aktuellen Rezeption zwischen Zuschauer und filmischem Bild ergeben. Dazu gehört u.a. die Beschreibung der Modellierung und Struktur der mentalen Verweisungsganzheit bzw. der mentalen Repräsentation des Films während der Rezeption. Das Filmbild artikuliert sich in diesem Diskurs grundsätzlich gleichzeitig in zwei Medien bzw. auf zwei Er-scheinungsflächen: Zum einen existiert es als sukzessive dynamische Erscheinung in einem Strom der Bilder auf der Leinwand, dem Fern-
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
26 L A R S C . GR A B B E U N D P A T R I C K R U P E R T -KR U S E
seher oder Monitor, zum anderen kommt es auf einer mentalen Mat-rix zur Erscheinung. Diese ist ebenfalls als dynamisch anzusehen, jedoch weniger im Sinne einer technischen Sukzessionslogik, als vielmehr in Bezug auf eine symbolische Koexistenz der Bilder und deren Bedeutungsebenen. Auf der materiellen Erscheinungsfläche manifestiert sich demgemäß das flüchtige Jetzt der Bilder, während sich auf mentaler Ebene ein vielgestaltiges Konstrukt entwickelt, das sowohl Protention, Retention11 sowie die aktuelle Rezeption in sich vereint und sich in einer Verweisungsganzheit (Iser 1994: 245), als rein virtuelle phänomenale Wirkungsmacht, strukturiert.
Durch die Klassifizierung der einzelnen Strukturebenen des Films während der Rezeptionssituation zeigt sich Film dann als ein kom-plexes Repräsentationsfeld, wodurch die Performanz der Äquilibra-tion, die Neutralisierung von Spannungszuständen und der Ausgleich divergierender Modalitäten adäquat erfasst und beschrieben werden kann: Erst die rezeptive Aneignung finalisiert die Äquilibration zwi-schen den Polen des Wahrnehmen-Machens und des Wahrnehmens.
Auf der materiellen Erscheinungsfläche manifestiert sich gemäß dieser Theorie das flüchtige Jetzt der multimodalen Elemente, die in ihrer jeweiligen Ausprägung ein spezifisches Aktivierungspotenzial bereithalten. Auf mentaler Ebene entwickelt sich ein Konstrukt, dass einer repräsentationalen Kognitionslogik folgt, das sowohl Protention (Erwartungsinhalte), Retention (Erinnerungen/Vergegen-wärtigun-gen) als auch die aktuelle Rezeption in sich vereint. Diese temporale Kognition bildet einen umfassenden System-zusammenhang von Rezipient und filmischem Repräsentationsfeld: Hier lässt sich auch von einem Relationenbild sprechen, welches die Grenzen des bloß Aktuellen um eine rein virtuelle Bedeutungspotenzialität ergänzt.
Einerseits verlangt der Film folglich nach einer rezeptiven Über-führung einzelner Sinnesinhalte in eine komplexe Geschehenswahr-nehmung, andererseits erzeugt er sie durch immanente perzeptions-geleitete Strukturen selbst (vgl. Wuss 1999: 58). Diese steuern bzw. beeinflussen ein komplexes Aktivierungspotenzial. Wir müssen daher
—————— 11 Retention ist »für die Konstitution der Dauer von Daten entscheidend« (Lohmar
2008: 9), als Funktion einer erinnernden Vergegenständlichung und Aktuali-sierungsmoment. Die Protention hingegen manifestiert die »Erwartung des Kom-menden« (Lohmar 2008: 95).
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Ä Q U I L I B R A T I O N U N D S Y N K R E T I S M U S 27
bei der filmischen Äquilibration von einem überaus komplexen Akt der Rezeption ausgehen: Denn das Aktivierungspotenzial des filmi-schen Repräsentationsfeldes sowie auch die rezeptive Bedingung zur Gewährleistung einer konsistenten Geschehenswahrnehmung struk-turieren sich grundlegend über das zeitlich-narrative Moment des Films.
»Die spezifische Rezeptionsleistung ist das Generieren von Konsistenz und Kontinuität der zentralen Elemente der Handlung im zeitlichen Verlauf, wobei retentionale Bild-Erinnerung, Jetzt-Bild-Situation und retentional-protentionale Bild-Erwartung konsistent zu einem Szeni-schen-Bild synthetisiert werden müssen« (Grabbe/Rupert-Kruse 2013: 33).
Der zeitliche Fluss der filmischen Ton/Bilder auf der Leinwand lenkt die Aufmerksamkeit und die bedeutungsgenerierenden Prozesse des Rezipienten, indem zeitlich und dramaturgisch geordnete Figuren, Objekte, Situationen und Geschehnisse zur Anschauung gebracht werden. Der ständige Blickpunktwechsel12 ist in der Montage der Einstellungen festgelegt, durch den Schnitt zwischen den Einstellun-gen kommt es zu einer Abhebung der textuellen Perspektiven vonei-nander, so dass diese sich gegenseitig organisieren. Das Gesehene sinkt in die Erinnerung und bildet den Horizont, den aktuell artiku-lierten Rezeptionsaugenblick, indem protentionale Vektoren13 geformt werden, die wiederum den Blick auf bestimmte Elemente des Kom-menden und schließlich Aktuellen lenken. Auf diese Weise bleiben innerhalb des Rezeptionsprozesses Vergangenheit und Zukunft immer bis zu einem gewissen Grad gegenwärtig, so dass der Rezipi-ent die Segmente des Films mental als ein virtuelles Beziehungsnetz modelliert14. Somit bestimmt nicht nur das Vorher, das, was im Jetzt gesehen wird, und beides zusammen wiederum das Kommende,
—————— 12 Für den Film siehe Edward Branigans Ausführungen zur Point-Of-View-Struktur
(1984: 2ff.). 13 Iser spricht von »protentionalen Richtungsstrahlen« (1994: 189). 14 In der Perspektive der kognitiven Filmtheorie beeinflussen die Informationen aus
dem Strukturangebot des Films die Konstitution mentaler Modelle auf Seiten des Rezipienten. Hier prägt sich dann ein Situationsmodell aus, welches die hand-lungstragenden Aspekte einer Geschichte in Bezug auf Figuren, Handlungsräume und Ereignisse verfügbar macht (vgl. Wuss 1999: 44f.; Van Dijk/Kintsch 1983).
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
28 L A R S C . GR A B B E U N D P A T R I C K R U P E R T -KR U S E
sondern so finden ebenfalls Aushandlungsprozesse – eine gegensei-tige Modifikation und Transformation – zwischen der visuellen und der auditiven Ebene statt.
Das filmische Aktivierungspotenzial äußert sich innerhalb dieser Verweisungsganzheit als synkretistisches Phänomen, wobei die Sys-temgrenzen der Wahrnehmung – in temporaler Perspektive – über-wunden werden und neue semiotische Referenzen entstehen. Dabei kann die virtuelle Gegenwart der Verweisungsganzheit in Filmen auf unterschiedlichste Weise wirksam werden.
In dem spanischen Thriller Buried (Buried – Lebend begraben, Ro-drigo Cortés, ESP 2010), einem dramatischen Kammerspiel in einem hölzernen Sarg, lässt sich gleich zu Beginn eine rezeptive Operation identifizieren, die der rezeptiven Äquilibration zugeordnet werden kann: Der Film beginnt mit einem Schwarzkader, der insgesamt fast zwei Minuten steht, bevor der Protagonist Paul Conroy (Ryan Rey-nolds), ein amerikanischer Lastwagenfahrer, die Dunkelheit mit ei-nem Benzinfeuerzeug erhellt (Abb. 1–4). Doch bevor wir überhaupt etwas zu sehen bekommen, ist nach dreißig Sekunden völliger Dun-kelheit und Stille ein Husten zu hören, gefolgt vom Hämmern von Händen gegen Holz und lauten Hilferufen.
Abb. 1–4: Das Bild liefert sukzessiv Informationen, mit denen der Rezipient seine Bilderwartung abgleichen muss.
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Ä Q U I L I B R A T I O N U N D S Y N K R E T I S M U S 29
Während uns das filmische Bild also keinerlei inhaltliche Informatio-nen über die piktoriale Wirkungsdimension, sondern allein über die auditive Ebene liefert, schreibt sich der Rezipient mit seinen Vor-stellungen über die vermutete Person und ihrer Situation in den Schwarzkader ein. Dadurch erfüllt er ihn mit einem bildhaften Inhalt, der nicht zwangsweise optisch wahrgenommen werden muss, der aber dennoch Emotionen wie Verwirrung, Spannung und Beklem-mung hervorruft. Die auditive Ebene strukturiert somit die visuelle Ebene vor und lässt den Rezipienten aufgrund des Gehörten zu erwartende oder erhoffte Situationen und Ereignisse imaginieren, die sich in den anschließenden Szenen erfüllen oder eben nicht. Um mit Jean-Paul Sartre zu sprechen, bildet der auditive Horizont hier ein unformuliertes, quasi-bildhaftes Wissen in der Vorstellung aus, das geradezu an den gesehenen Bildern auf der Leinwand oder dem Bild-schirm klebt und im Akt der Rezeption mit diesen verschmilzt (vgl. 1994: 193).15 Die visuelle und die akustische Ebene sind damit intern-synchron, d.h. der Ton artikuliert diejenigen visuellen Erscheinungen (bzw. Geschehnisse), die sich innerhalb des Bildkaders abspielen.16 Mit einem kognitivistischen Argument lässt sich ergänzend folgendes Resümee ziehen:
»Wenn man über jene gattungsspezifische Wirkungsweise des Films spricht, die ihn zu einem neuen Synkretismus werden läßt, dann meint man eine Erscheinung, die eigentlich weder auf einer Ebene noch auf zwei Ebenen der Wahrnehmung zu lokalisieren ist, sondern in einem ›Dazwischen‹, in einem Prozeß von Interaktion oder Verschiebung« (Wuss 1999: 298).
—————— 15 Wuss spricht hier auch von einem semantischen Netz, »das die Grenzen der Wahr-
nehmungssysteme überschreitet« (1999: 298) und sich eben auf den komplexen Zusammenhang und die visuelle und auditive Dimension des filmischen Ton/ Bildes bezieht.
16 Trotz dieser internen Synchronizität kann dennoch von einer auralen Erweiterung des Bildkaders durch den Ton gesprochen werden, da beide zwar ihre Quelle innerhalb des Bildkaders haben, der Ton jedoch – im Gegensatz zum Bild – nicht vom Kader begrenzt wird.
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
30 L A R S C . GR A B B E U N D P A T R I C K R U P E R T -KR U S E
Externe Synchronizität: Der Ton und das Nicht-Sichtbare
Es gibt eine grundlegende Asymmetrie von Bild und Ton: Die Lein-wand ist der (zweidimensionale) Ort der sichtbaren Bilder; der (drei-dimensionale) Ort des Tons ist der Aufführungsraum.17 Dennoch ist die Quelle des Tons meist im Bild verankert, obwohl der Ton nicht den Limitierungen des Bildes unterliegt: »What ›the image‹ designates in the cinema is not content but container: the frame. […] So there is no auditory container for film sounds, nothing analogous to this visual container of the images that is the frame. Film sound is that which is […] nor contained in an image; there is no place of the sounds […]« (Chion 1994: 66–68). Daher ist die Frage nach dem Ort des Tonphänomens die Frage nach dem Ort seiner Quelle. Und diese Verortung geschieht stets in Bezug auf die Grenzen des sichtbaren filmischen Bildes.
Diese wiederum sind durch die Grenzen der Leinwand definiert: sie schaffen ein Innen und ein Außen, definieren das Sichtfeld – das On – und das Off, das hors-champ, das Nicht-Sichtbare des Bildes. Dieser Bereich kann nur vom Ton bevölkert werden und ist damit immer noch dem Ton/Bild als konstitutiver Teil zuzuordnen, »das Hörbare verleiht dem visuell Unzugänglichen eine spezifische Prä-senz« (Deleuze 1997: 301). Das relative hors-champ des dynamischen Ton/Bildes verweist auf einen virtuellen Raum, der den im Bild sichtbaren Raum fortsetzt: »[Das] Off lässt dann erahnen, wo der Ton herkommt, nämlich von etwas, was man bald sehen wird oder das in einem folgenden Bild auftauchen [kann]« (Deleuze 1997: 302). Dem Ton aus dem Off liegt folglich ein virtuelles Bild inne, eine Möglichkeit zur visuellen und bildhaften Antizipation, zur Erweite-rung und Entgrenzung des Sichtbaren ins Nicht-Sichtbare hinein.
Ergänzend sei angemerkt, dass neuere filmtheoretische Theorien für die Etablierung des hors-son, als »Umkehrung und Weiterführung des hors-champ« (Martin 2010: 146) plädieren. Im hors-son zeigt sich gemäß dieser Überlegungen die im postmodernen Film beginnende
—————— 17 Die aurale Erweiterung des sichtbaren Bildes ist folglich ein spezifisch Filmisches
Phänomen.
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Ä Q U I L I B R A T I O N U N D S Y N K R E T I S M U S 31
akustische Macht über das Bild, als Form der Äußerlichkeit oder Randbezirk tonaler Strukturen:
»Ebenso wie sich nichtsichtbare Bilder im hors-champ, im Umfeld des Bil-des – oder besser: im Außerhalb des Bildrahmens – befinden, die durch die Kamerabewegung jederzeit in die visuelle Kadrierung des Films ge-rückt werden können, können sich auch nichtsichtbare Bilder im hors-son befinden, die, vom Ton hervorgebracht, auf der Leinwand sichtbar wer-den können. Das hors-son ist somit im Kontext eines generativen Prinzips als Äußerlichkeit des Akustischen zu sehen« (ebd.: 147).
Zu einem besonders geeigneten Beispiel für die Entstehung eines hors-son zählt der Vorspann von Star Wars: Episode IV – A New Hope (Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung, George Lukas, USA 1977):
»Hört man die Raumschiffe zunächst nur von hinten, so kommen sie, nachdem sie akustisch über die Köpfe der Zuschauer geflogen sind, schließlich von oben ins Bild. Die Raumschiffe werden also erst, nach-dem sie zu hören sind, auch sichtbar. Das heißt, nichtsichtbare Bilder, die sich im hors-son […] befinden, werden, initiiert vom Ton, sichtbar« (Martin 2010: 147).
Der Ton nimmt das Bild vorweg und verweist auf eine zeitphäno-menologische Struktur im Kontext einer tonalen Temporalität: Eine auditive Protention wird zum präjudizierenden Schema, wobei hier nicht nur Bedeutung akustisch im Vorfeld generiert wird, sondern der Ton das Bild selbst in concreto hervorbringt.
Eine weitere Verbindung von Sichtbarem und Nicht-Sichtbarem in Verbindung mit dem Ton zeigt sich in Alejandro González Iñár-ritus 21 Grams (21 Gramm, USA 2003). Das zentrale Ereignis des Films – der Unfalltod von Cristina Pecks (Naomi Watts) Ehemann und ihren zwei Töchtern – wird nicht gezeigt und lediglich über die tonale Ebene vermittelt. Denn während die Kamera auf einem jun-gen Mann mit einem Laubgebläse verharrt, den die Drei gerade pas-siert haben, bevor sie (nach links) aus dem Kader herausspaziert sind, erweitert der Ton das Bild nun eben in den linken hors-champ hinein. Es sind deutlich die quietschenden Reifen des Unfallwagens zu hö-ren, der kurz nach dem Mann und seinen Töchtern von rechts nach links durch das Bild gefahren ist und weit außerhalb des Kaders in die kleine Gruppe hineinfährt und diese tötet (Abb. 5–12).
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
3
Aim
Dalnalbsediei
32 L A R S
Abb. 5–12: Wäm Off ein furchtb
Die visuelle unls extern-synchrungen (bzw. ls diejenigen, eiden Repräseen sind, die deie Spannung, ine Erweiteru
S C . GR A B B E
ährend der jungebarer Unfall.
nd die akustiscron anzusehenGeschehnissedie sich innerentationsebenennoch in eindie sich trans
ung des Sicht
U N D P A T R I C
e Mann mit La
che Ebene sinn, d.h. der Toe) aus dem Nrhalb des Bild
nen unterschiener Gleichzeitismodal artikultbaren ins Vi
K R U P E R T -KR
aubbläser im Bi
nd in diesem Bon artikuliert aNicht-Sichtbardkaders abspiedliche Modaligkeit erscheinliert, auf der Rirtuelle hinein
R U S E
ild bleibt, geschie
Beispiel folglicandere Erscheren (hors-champelen. Da dieselitäten zuzuwenen, wird durcRezipientensein indiziert, w
ieht
ch ei-
mp), en ei-ch ite
was
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Ä Q U I L I B R A T I O N U N D S Y N K R E T I S M U S 33
einer Vernähung von Bild und Ton zu einem Relationenbild gleich-kommt (vgl. Grabbe/Rupert-Kruse 2013: 26).18
Temporalität von Ton-Bild-Relationen
Diese erwähnten Beispiele verweisen auf eine interdependente Inter-aktion von Bild und Ton. Diese Interaktion sollte jedoch nicht auf eine einseitige Art und Weise beschrieben werden, die ausschließlich aus einer technischen Perspektive argumentiert und den Ton dem Bild nachordnet. Innerhalb der Beschreibung der Ton-Bild-Relation im Film nach Schneider kommt diese verkürzte Perspektive zum Tragen, obwohl sie das Potenzial besitzt, in eine funktional-semioti-sche Perspektive überführt werden zu können. Schneider unterschei-det mit Paraphrase, Polarisation und Dissonanz bzw. Kontrapunkt (vgl. 1990: 24) drei Relationsmöglichkeiten von Ton und Bild und ordnet diese in ein Ähnlichkeitsspektrum ein. Hier steht die Para-phrase auf der linken Seite für die maximale Ähnlichkeit von Bild und Ton, während auf der rechten Seite die Dissonanz als Differenz-struktur angesiedelt ist. Zwischen diesen beiden Merkmalsausprägun-gen liegt dann die Polarisation. Schneiders Schlussfolgerung erweist sich jedoch in der Konsequenz als problematisch, da er das perfor-mative Verhältnis von Bild und Ton nicht vollständig zu fassen ver-mag. Er setzt prinzipiell das Bild als Ursprung der Argumentation. Dass letztendlich die Bedeutung der multimodalen Repräsentation ein semiotischer Aushandlungsprozess ist, wird durch ihn nicht ex-plizit berücksichtigt.
Dennoch sollte darauf hingewiesen werden, dass die Beschrei-bung und Festsetzung einer jeweiligen Referenzmodalität sinnvoll zu sein scheint, vorausgesetzt das analytische Schema bleibt flexibel genug. Dies korrespondiert mit zwei spezifischen Wahrnehmungs-weisen die Michel Chion vorbringt, um die Prozesse der Bedeutungs-generierung zwischen den Ebenen von Ton und Bild zu beschreiben: —————— 18 Vgl. dazu auch Hans-Dieter Hubers Ausführungen zu den Konzepten kognitive
Irritation und zu Unsicherheitsabsorption, die er für eine bildwissenschaftliche Re-flexion der Fotografie stark macht (2002: k.S.).
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
34 L A R S C . GR A B B E U N D P A T R I C K R U P E R T -KR U S E
Audio-Vision und Visu-Audition. Während Audio-Vision den Typ der Wahrnehmung bezeichnet, »bei dem das Bild der bewusste Fokus der Aufmerksamkeit ist, aber bei dem der Klang in jedem Moment eine Reihe von Effekten, von Sinneseindrücken und Bezeichnungen hin-zufügt« (Chion 2010: 145), bezeichnet die Visu-Audition »die Art von Wahrnehmung, die sich bewusst auf das Auditive« (Chion 2010: 150) konzentriert, allerdings vom visuellen Kontext beeinflusst und »para-sitär besetzt wird« (Chion 2010: 150).19
In medientheoretischer Perspektive erscheint es als äußerst plau-sibel und erforderlich, auf der Basis eines Ähnlichkeit-Differenz-Schemas, verschiedene Ebenen der Bild-Ton-Interaktion zu erarbei-ten. Die jeweiligen Facetten dieses Schemas sollten jedoch nicht ausschließlich einen primär piktorialen Fokus aufweisen, sondern den Ton als eigenständige Sinn- und Handlungsdimension integrieren. In dieser semiotischen Perspektive wird das Verhältnis von Bild und Ton grundlegend als ein Resonanzphänomen20 beschreibbar, bei dem die tonale Dimension die Wahrnehmung des Visuellen – im Sinne einer akustischen Deutungsschablone – vorweg nehmen kann. Diese höherstufige und semiotische Perspektive scheint sich allerdings wesentlich stärker auf eine rezeptive bzw. funktionale Ebene zu be-ziehen, auf der sich die höherstufigen Modi der Bild-Ton-Interaktion artikulieren. Notwendige Grundlage für höherstufige Rezeptionen bildet eine technische Ebene, als Bedingung der Möglichkeit zur Präsentation variabler Sinnesinhalte.
—————— 19 Um das Verhältnis von Bild und Ton innerhalb eines interaktionistischen
Prinzips beschreibbar zu machen, könnten für weiterführende Überlegungen Konzepte wie Figur und Grund, Thema und Horizont herangezogen werden. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass diese Konzepte eine dynamische Figuration beschreiben, die einer stetigen Transformation unterliegt und die sich aus der intersemiotischen Aktualisierungstätigkeit des Rezipienten in Interaktion mit den Bildern und dem Ton des Films ergibt.
20 Walter Murch äußert im Vorwort von Michel Chions Audio-Vision: Sound on Screen die Annahme, dass es zwischen Bild und Sound zu einer »conceptual resonance« (Murch 1994: XXII) kommen kann. »The sound makes us see the image differently, and then this new image makes us hear the sound differently […]« (Murch 1994: XXII). Zur Topologie der Resonanz, als Wechselwirkung zwischen Key Sound und narrativem Kontext, sei an dieser Stelle zusätzlich auf Barbara Flückinger verwiesen (vgl. 2001: 174).
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Ä Q U I L I B R A T I O N U N D S Y N K R E T I S M U S 35
In technischer Perspektive integriert die Verhältnisbestimmung von Bild und Ton ein Ähnlichkeit-Differenz-Schema, in welchem Paraphrase, Polarisation und Dissonanz drei zu unterscheidende Merkmalsausprägungen konstituieren. Diese drei Ausprägungen sind prozessbasiert und finden in den Variablen Ähnlichkeit, Zentralität und Differenz ihre Entsprechung. Die Paraphrase basiert auf der Ausprägung von Ähnlichkeit, womit die identitätslogische Überein-stimmung von Bildinhalt und Ton gemeint ist (z.B. Klingelndes Tele-fon innerhalb der Diegese; Meeresrauschen und Einstellung auf das Meer). Polarisation beschreibt die Intensivierung eines Bildinhalts durch die tonale Attribuierung zusätzlicher Bedeutungsspektren: der Bildinhalt wird akustisch überformt. Bild und Ton sind bei der Pola-risation zentrisch verklammert, um ein filmisches Artefakt um eine symbolische Bedeutung bzw. Konvention zu erweitern und bei-spielsweise Emotionen auf Seiten des Rezipienten zu evozieren (z.B. Klaviersonate innerhalb einer Liebesszene). Die Dissonanz folgt schließlich einer Logik der Differenz, wobei gezielt ein Gegensatz von Bild und Ton – bis hin zum Kontrapunkt – erreicht werden kann (z.B. Extreme und dissonante Scratch-Geigenmusik in der Dusch-szene von Psycho (Alfred Hitchcock, USA 1960)).
Das Ähnlichkeit-Differenz-Schema wird über die technische Ebene des filmischen Repräsentationssystems vermittelt und konsti-tuiert die erste Tonebene der auditiven Aktualrezeption. Hier kann sich eine akustische Dimensionierung des Visuellen, ein tonales In-terpretament visueller Informationen, vollziehen. Die Tonebene selbst sollte prinzipiell als ein dynamisches Konstrukt aufgefasst werden, dass zwar von der technischen Ebene abhängt, jedoch eines funktionalen und somit rezeptiven Horizonts bedarf, um ein voll-ständiges Filmerleben zu gewährleisten. Dieser funktionale Horizont wird zusätzlich zum Zeithorizont, in der Annahme einer temporalen Tonalität des filmischen Repräsentationssystems.
Die erste Ebene der auditiven Aktualrezeption findet ihre Erwei-terung auf nächst höherer Ebene der auditiven Retention. Auf dieser Prozessstufe ist Rezeption stets bezogen auf ein inter- und intratex-tuelles Tongedächtnis. Intertextuelle Tonalität fungiert als akustisches Stereotypenphänomen, durch das zurückliegende akustische Erfah-rungen auf den Filminhalt (Dramaturgie, Requisite, Emotionalität
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
36 L A R S C . GR A B B E U N D P A T R I C K R U P E R T -KR U S E
etc.) bezogen werden können (z.B. der spezifische Klang amerikani-scher Polizeisirenen ermöglicht die raumzeitliche Lokalisierung des Bildinhalts). Auch können intratextuelle Tonmotive durch Repetition eine leitmotivische Funktion übernehmen, durch die Aufmerksamkeit fokussiert, Spannung evoziert oder Emotionen gesteigert werden können. Bei spezifischer Rezeptionswirkung können intratextuelle Motive dann selbst zu intertextuellen Leitmotiven werden, die mit Situationen, Genres oder Heldentypen gekoppelt sind (z.B. Leitmotiv in der Indiana Jones – Reihe, der imperiale Marsch in den ersten Star Wars – Filmen.
Wie stark die temporale Tonalität mit den Prozessen aktiver Re-zeption verknüpft ist, wird besonders anhand einer dritten Ebene des Auditiven deutlich. Hier zeigt sich die auditive Protention als ein präjudizierendes Schema, durch welches mögliche visuelle Informati-onen auditiv eingeleitet oder in Gänze vorbereitet werden. Mit dieser tonalen Hypothese gelingt dann ein akustischer Fokus auf eine visuell und zeitlich absente oder noch nicht realisierte Dimension (z.B. Das Ton-Leitmotiv in Jaws (Der weiße Hai, Steven Spielberg, USA 1975) kündigt den Hai an, noch bevor man ihn sieht).
Die komplexe Verhältnisbestimmung des Tonalen und Visuellen betont eine wechselseitige Bezogenheit dieser beiden Elemente des Films. Versteht man Film nicht nur als technisches Artefakt, sondern als spezifisch funktionale Rezeptionsbedingung, dann sollten Ton, Bild und Zeit als konstitutive Faktoren des filmischen Repräsentati-onssystems verstanden werden.21 Es ist daher plausibel, dass die multimodale Komplexität des Films in das Konzept eines holonisch-mnemonischen Meta-Ton-Bild-Systems überführt wird, um ganzheit-liche Strukturebenen des Films zu klassifizieren, die in ihrer tempo-ralen Wechselseitigkeit das Wesen der Rezeption maßgeblich beein-flussen.
Während sich die visuelle Dimension des kinematographischen Repräsentationssystems über die Elemente Photogramm, Einstellung, Szene und Sequenz bestimmen lässt, kann die tonale Dimension mit dieser visuellen Schematisierung korreliert werden. Auf Ebene der —————— 21 Die Steuerung der Bilderwartung des Rezipienten erfolgt folglich nicht allein
durch das Bild, sondern gleichermaßen durch den Ton bzw. deren Interaktion untereinander.
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Ä Q U I L I B R A T I O N U N D S Y N K R E T I S M U S 37
Photogramme lässt sich noch keinerlei Relevanz für eine entfaltete Tonstruktur bestimmen, da das photogrammatische System noch zu kleinteilig ist für einen akustischen Artefaktstatus.22 Hingegen bezieht sich die Einstellung direkt auf die auditive Aktualrezeption. Die komplexere Szene ist dann gleichermaßen von einer ausgeprägten temporalen Bildlichkeit sowie Tonalität abhängig, so dass hier eben-falls die auditive Retention und auditive Protention maßgebliche Bestimmungsgrößen für Bedeutungsprozesse werden. Die Sequenz verdichtet diese Annahme und überführt die Elemente in ein kom-plexeres System, in welchem eine Vielzahl auditiver Retentionen und Protentionen zur Äußerung kommen können.
Schluss
Widmet man sich aus der Perspektive einer Bewegtbildwissenschaft dem filmischen Repräsentationssystem, dann impliziert ein analyti-sches Vorgehen zwei notwendige Grundannahmen: Bild und Ton ereignen sich innerhalb der aktiven Rezeption in Form der Resonanz, d.h. die akustische Dimension ist in der Lage als rezeptive Deutungs-schablone für visuelle Informationen zu dienen. Zudem befinden sie sich in temporaler Referenz zueinander, denn die Resonanzstruktur ereignet sich innerhalb einer variablen Zeitdynamik von auditiver Aktualrezeption über auditive Retention bis hin zur auditiven Pro-tention.23
—————— 22 Gibt es für das Photogramm, die visuelle Einstellung oder die Szene Ent-
sprechungen auf tonaler Ebene (vgl. Chion 1994: 66–71)? Hier sollten Über-legungen für eine transmodale Typologie angestrebt werden.
23 Die phänomenale Relation bzw. Interaktion von Bild und Ton wird stets über eine technische Ebene vermittelt (technischer Fokus), die während der Rezeption in eine funktionale sowie rezeptiv gestützte Ebene überführt wird. Es ist dem-nach nur plausibel, dass spezifisch apparative Dispositive und Arrangements, wie Kino (Sitzanordnung, Dolby, THX, 3D etc.) oder der heimische Fernseher (HD, Plasmabildschirm etc.), ebenfalls Anteil nehmen an der Konfiguration spezi-fischer Rezeptionssituationen. Hierdurch wird das intermodale Strukturangebot des Films, z.B. Bild, Ton, Schrift, Perspektive, Beleuchtung etc., um eine disposi-tive und interfacebasierte Wirkungsdimension ergänzt.
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
38 L A R S C . GR A B B E U N D P A T R I C K R U P E R T -KR U S E
Damit soll innerhalb der hier eingeleiteten Interaktionstheorie ei-nerseits der Fokus auf die Aushandlungsprozesse zwischen Bild und Ton gelegt und andererseits die Bestimmung des Rezipienten als modale Referenzebene in persona ermöglicht werden. Dies zeigt, dass sich Ton und Bild im Film in einem dynamischen und Bedeutung generierenden Verhältnis befinden. Walther Murch spricht diesbe-züglich auch von einer Spannung, die durch eine metaphoriche Distanz (metaphoric distance) zwischen Ton und Bild erzeugt wird und durch welche diese beiden Dimensionen des Filmischen in eine höhere Ebene überführt werden (vgl. Murch 1994: XX; Wuss 1999: 293).24
Zusätzlich sollte das rezeptive Potenzial eine explizite Berück-sichtigung finden, dass es erlaubt, über den technisch-apparativen Status des Films hinweg eine konsistente Geschehenswahrnehmung herauszubilden. Diese Geschehenswahrnehmung unterscheidet sich maßgeblich von der Alltagswahrnehmung, und bildet im Kontext der Wahrnehmung von Kunst bzw. Artefakten einen Sonderfall. Denn die Motivation des Rezipienten einzelne Wahrnehmungsinhalte wäh-rend der Filmrezeption mit einer sinnhaften Bedeutungsbeziehung zu korrelieren, zeigt sich als zentrale Bestimmungsgröße für die Mög-lichkeit einer Vermischung differenter Codes.
In kognitivistischer Perspektive lässt sich mit Peter Wuss folgern, dass die rezeptive Handlungsintention, nämlich bestimmte semanti-sche Beziehungen in einem Film zu erfassen, eine Sensibilisierung zur Folge hat, welche die normalen Schwellenwerte der sensorischen Systeme verschiebt. Resultat ist eine intercodale Geschehenswahr-nehmung, bei der »alle Sinnesorgane aktiviert werden, Informationen aus dem Geschehen zu extrahieren« (Wuss 1999: 297). Die synkretis-tische und äquilibrale Tiefendimension intra- und interfilmischer Codeebenen verweist folglich auf ein synästhetisches Bezugssystem auf Seiten des Rezipienten, durch welches die Intermodalität zu Gunsten einer kohärenten Geschehenswahrnehmung harmonisiert werden kann.
Die künftige Herausforderung an die Präzisierung der filmischen Äquilibration zeigt sich in der Verknüpfung der holonischen Struktur —————— 24 Dies entspricht Sergej M. Eisensteins Überlegungen zum Metaphern bildenden
Prinzip der Montage, welches auch als eine frühe Bildtheorie des Films be-zeichnet werden könnten (2006: 158–201, 238–251).
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Ä Q U I L I B R A T I O N U N D S Y N K R E T I S M U S 39
des Tonalen mit den variationsreichen Eigenschaften des Bildsys-tems. In welcher Art und Weise technische und funktionale Ebene interagieren und in welchem Maß die rezeptiv-semiotischen Aneig-nungsprozesse davon beeinflusst werden, sind Fragen, denen man sich künftig widmen sollte. Vor allem eine empirische Herangehens-weise, als unterstützende Theorieperspektive, dürfte evidente Ergeb-nisse im rezeptiven Umgang mit filmischen Strukturen versprechen. Zudem scheint die Annahme als gesichert, dass sich die stabilisierte Geschehenswahrnehmung des Rezipienten als eine interaktionistische Wahrnehmung konstituiert, deren Resultat mit den Konzepten des semantischen Netzwerks, kausalen Feldes oder Situationsmodells in Zusammenhang steht.25
Und dies scheint dringend notwendig zu sein, da allein eine ganz-heitliche Fassung, also eine multimodale Analyse des filmischen Re-präsentationssystems es erlaubt, sich diesem Gegenstand adäquat zu nähern.
Vor allem der Fokus des vorliegenden Artikels auf das Verhältnis von Bild und Ton innerhalb des Mediums oder der Form Film soll betonen, dass nur unter Einbeziehung der tonalen Dimension eine bildwissenschaftliche Näherung an den Film erfolgen kann. Dies klingt zunächst paradox, doch sollten diese einführenden Überlegun-gen zu einer interaktionistischen Theorie des filmischen Ton/Bildes gezeigt haben, dass eine alleinige Konzentration auf die visuelle Di-mension des Films innerhalb einer bildwissenschaftlichen Herange-hensweise schnell zu einem ikonografischen Verfahren verkümmern würde, das den Film als kulturelles Artefakt nicht adäquat zu fassen vermag.
Literatur
Anderson, Joseph D. (1998), The Reality of Illusion. An Ecological Approach to Cognitive Film Theory. Carbondale/Edwardsville.
—————— 25 Inwiefern hier phänomenologische, semiotische und kognitivistische Parameter
in ein sich ergänzendes Bezugsfeld miteinander treten, müssen zukünftige Ana-lysen klären.
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
40 L A R S C . GR A B B E U N D P A T R I C K R U P E R T -KR U S E
Bateman, John A./Schmidt, Karl-Heinz (2011), Multimodal Film Analysis: How Films Mean, London/New York.
Chion, Michel (1994), Audio-Vision - Sound on Screen, New York. Decker, Jan-Oliver/Krah, Hans (Hg.) (2008), Zeichen(Systeme) im Film, in:
Zeitschrift für Semiotik 30, Heft 3-4, Tübingen, S. 225–235. Deleuze, Gilles (1997), Das Bewegungs-Bild, Kino 1, Frankfurt/M. Eisenstein, Sergej M. (2006), Jenseits der Einstellung. Schriften zur Filmtheorie,
hrsg. von Felix Lenz und Helmut H. Diederichs, Frankfurt/M. Flückinger, Barbara (2001), Sound Design. Die virtuelle Klangwelt des Films,
Zürcher Filmstudien, Bd. 6., Marburg. Grabbe, Lars C./Rupert-Kruse, Patrick (2013), Filmische Perspektiven
holonisch-mnemonischer Repräsentation. Versuch einer allgemeinen Bildtheorie des Films, in: Rebecca Borschtschow/Lars C. Grabbe/ Patrick Rupert-Kruse (Hg.), IMAGE – Zeitschrift für interdisziplinäre Bildwissenschaft, Ausgabe 17, Köln, S. 23–36.
Huber, Hans Dieter (2002), Ästhetik der Irritation, 01.09.2013, http://www. khm.de/kmw/kit/pdf/huber.pdf.
Iser, Wolfgang (1994), Der Akt des Lesens, München. Keppler, Angela (2010), Die wechselseitige Modifikation von Bildern und
Texten in Fernsehen und Film, in: Arnulf Deppermann und Angelika Linke (Hg.), Sprache intermedial. Stimme und Schrift, Bild und Ton, Ber-lin/New York, S. 447–467.
Kress, Gunther/van Leeuwen, Theo (2001), Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication, London.
Lohmar, Dieter (2008), Phänomenologie der schwachen Phantasie. Untersuchungen der Psychologie, Cognitive Science, Neurologie und Phänomenologie zur Funktion der Phantasie in der Wahrnehmung (Phaenomenologica 185), Dordrecht.
Martin, Silke (2010), Die Sichtbarkeit des Tons im Film. Akustische Modernisierun-gen des Films seit den 1920er Jahren, Marburg.
Merleau-Ponty, Maurice (2010), Das Kino und die neue Psychologie, in: Dimitri Liebsch (Hg.), Philosophie des Films, Paderborn, S. 70–79.
Murch, Walter (1994), Foreword, in: Michel Chion, Audio-Vision – Sound on Screen, New York, S. VII–XXIV.
Paech, Joachim (2000), Eine Szene machen. Zur räumlichen Konstruktion filmischen Erzählens, in: Hans Beller u.a. (Hg.), Onscreen/Offscreen. Gren-zen, Übergänge und Wandel des filmischen Raums, Ostfildern bei Stuttgart, S. 93–122.
Posner, Roland (1986), Zur Systematik der Beschreibung verbaler und nonverbaler Kommunikation. Semiotik als Propädeutik der Medienana-lyse, in: Hans-Georg Bosshardt (Hg.), Perspektiven auf Sprache. Interdiszipli-näre Beiträge zum Gedenken an Hans Hörmann, Berlin/New York, S. 293–297.
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt
Ä Q U I L I B R A T I O N U N D S Y N K R E T I S M U S 41
Sartre, Jean-Paul (1994), Das Imaginäre. Phänomenologische Psychologie der Einbil-dungskraft, Reinbek bei Hamburg.
Schneider, Jan Georg/Stöckl, Hartmut (2011), Medientheorien und Multi-modalität: Zur Einführung, in: ebd. (Hg.), Medientheorien und Multimodali-tät. Ein TV-Werbespot – Sieben methodische Beschreibungsansätze, Köln, S. 10–44.
Schneider, N. J. (1990), Handbuch Filmmusik I. Musikdramaturgie im neuen deutschen Film, 2. überarbeitete Auflage, München.
Sobchack, Vivian (2004), Carnal Thoughts. Embodiment ans Moving Image Culture, Berkeley/Los Angeles/London.
Van Dijk, Teun A./Kintsch, Walter (1983), Strategies of Discourse Compre-hension, Orlando.
Wildfeuer, Janina (2013), The Logic of Film Discourse Interpretation. Towards a New Paradigm for Multimodal Film Analysis, London/New York.
Wuss, Peter (1999), Filmanalyse und Psychologie. Strukturen des Films im Wahr-nehmungsprozeß, Berlin.
© 2013 Büchner-Verlag, Darmstadt