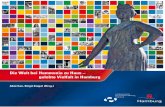Die Schlangenkandelaber zu Darmstadt
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Die Schlangenkandelaber zu Darmstadt
Die Schlangenkandelaber zu Darmstadt
Entdeckung und Rekonstruktion einer verschwundenen Lichtinstallation in der klassizistischen Residenzstadt Darmstadt zwischen Wienerkongress und Vormärz
von Gerhard Roese
© Das vollständige Werk unterliegt dem Copyright von Gerhard Roese.
Atelier Gerhard Roese 2014
ISBN 978-3-00-045426-4
3
Ausgangssituation
Das Stadtbild von Darmstadt wurde seit dem Barock maßgeblich vom Residenzschloss geprägt. Als am 10. Februar 1810 Georg Moller sechsundzwanzigjährig großherzoglich hessischer Stadtbaumeister wurde, gab es die Schlangenkandelaber noch nicht. Ausweislich der erhaltenen Veduten (im Stadtarchiv Darmstadt) erscheinen die Schlangenkandelaber erst ab etwa 1813 und sind letztmalig um die Baugrube des Ludewigmonuments bezeugt. Bei dessen Enthüllung, am 25. August 1844, sind sie verschwunden. Aus der großen Vielzahl von Darstellungen der Schlangenkandelaber auf Darmstädter Veduten, sei diese exemplarisch herausgegriffen:
Dieses Blatt gibt den Blick vom Luisenplatz die Wilhelminenstraße Richtung Süden gen St. Ludwig. Links das alte Palais (schadhaft), rechts das Ständehaus (intakt), davor ein Schlangenkandelaber mit vom Maul der Schlange abgehängter Kette zur Befestigung der Laterne. Zeichnung von Gladbach (Zeichner u. Architekt), um 1830, gestochen von E. F. Grünewald. Diese Darstellung sei deshalb gewählt, weil sie sehr deutlich mit Hilfe einer Camera obscura erstellt worden ist.
4
Die Architektur auf unserem Blatt ist wie auf dieser Darstellung zu sehen, als Projektion nachgezeichnet worden. Diese Vorgehensweise stand im frühen 19. Jahrhundert in hoher Blüte. Ihr verdanken wir eine Zeichnung mit dem Zeugniswert einer Fotografie. Allein die Figuren dieses Blattes sind als Staffage offenbar nachträglich eingefügt worden. Leider sind alle Pläne, die Georg Moller hinterlassen hat, beim großen Angriff auf Darmstadt am 11. September 1944 verbrannt. So haben wir weder einen Beweis dafür, dass diese eigenartigen Gebilde
1) tatsächlich von Georg Moller stammen, noch wissen wir 2) was sie bedeuten sollten, 3) aus welchen Materialien sie bestanden, oder 4) wie sie konstruiert waren.
Und schließlich hätte man vielleicht auch gerne eine Rekonstruktion dieser einzigartigen Objekte. Ohne einen einzigen materiellen Rest der Schlangenkandelaber zu haben, scheint es ausgeschlossen dieses Objekt zu rekonstruieren. Auffällig erweise hat sich noch nicht einmal ein Teil der ehemaligen Schlangen – beispielsweise ein Schlangenhaupt – erhalten. Wenn man es sich als Gussobjekt aus Messing oder Bronze vorstellt, wäre es als Souvenir geradezu dazu prädestiniert gewesen auch in Privatbesitz überdauert zu haben. Dem Mollerschen Schlangenkandelaber können wir uns von heute aus also nur annähern, wenn wir ein Überbleibsel davon finden.
5
1973 stellte der Architekt Ott Hoffmann aus Darmstadt auf der von ihm gestalteten Piazza, im Westen hinter der Stadtkirche, auf der Südseite des Turmes, sieben sandsteinerne Säulenstämme auf, die zuvor im Stadtgebiet bei Baggerarbeiten gefunden worden waren.
Niemand wusste, wo diese Säulenstämme ursprünglich einmal verbaut worden waren. Noch in den achtziger Jahren waren sie vollzählig zu sehen, doch sehr bald fehlte eine Säule nach der anderen. Sie waren beim Rangieren der LKW auf der Piazza umgefahren und abgebrochen worden.
Dieses Bild ist eine Rekonstruktion des Zustandes um 1980, als noch fast alle Säulenstämme standen und deren Köpfe noch nicht durch Frost abgeplatzt waren. Einen Säulenstumpf im Boden kann man erkennen.
6
Im Jahre 2005 ist der Innenraum von St. Ludwig, der Rundkirche von Georg Moller, in Darmstadt renoviert worden. Dazu hat der Verfasser die östliche Hälfte der Kuppelkirche als aufgeschnittenes Modell gebaut, in dem neue Entwürfe des Altars ausprobiert werden konnten und in dem die spätere Farbfassung vorgestellt wurde. Da alle originalen Pläne Mollers in der Nacht des 11. Septembers 1944 verbrannt und die verfügbaren Pläne ungenügend sind, erstellte der Verfasser ein eigenes Aufmaß des Inneren des Kirchenraumes. Dabei offenbarte sich wieder – wie bereits im Zuge der Rekonstruktion des Aufrisses des Ludewigsmonuments, (Roese, 1999, ISBN 3-00-004746-8) die ganze Genialität und Raffinesse Georg Mollers als Baukünstler, als Form-Erfinder und kühner, moderner Konstrukteur. Diesermaßen, als Bildhauer und Architektur-Rekonstrukteur, mit Georg Moller und dessen Arbeitsweise vertraut, glaubte der Verfasser im Jahre 2005, beim Vorbeigehen an den nur noch zwei oder drei stehenden Sandsteinsäulen, in diesen spontan die Stämme der ehemaligen Mollerschen Schlangenkandelaber zu erkennen. Diese Hypothese lässt sich nur verifizieren, indem man prüft, wie tief die zentralen Bohrungen der Säulenstämme unten ausgeführt worden sind. Sind es nur wenige Zentimeter, so steht fest, dass die ehemalige Säule unter Last verbaut war, also als Glied einer ehemaligen Architektur diente und kein Relikt der Schlangenkandelaber gewesen sein kann. Ist diese sehr aufwändig herzustellende Bohrung aber sehr tief – geht sie vielleicht über die halbe Höhe des Stammes – so ist klar, dass es sich um eine ehemals freistehende Säule gehandelt hat, welche mit Hilfe eines Eisenstabes im Kern, der sich in einem unterirdischen Ankerstein fortgesetzt haben muss, am Umfallen gehindert wurde. Um diese Prüfung durchzuführen, hätte mindestens einer der Säulenstämme gezogen werden müssen. Dies zu veranlassen ist dem Verfasser nicht gelungen. Allerdings ist von einem der im Boden verbliebenen Stümpfe einer der umgefahrenen Säulenstämme, in der Mitte ein Betonsiegel entfernt worden und unter diesem kam eine viereckige Bohrung von ca. 30 x 30 mm zu Tage. Da der Säulenstumpf ca. 50 cm tief im Erdreich steckt, kann man sagen, dass die zentrale Bohrung der Säulenstämme mindestens so tief war. Definitiv viel zu tief für eine Verbauung als Architekturglied. Man kann auch sagen, dass sich diese Bohrung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fortsetzt. Das konnte leider nicht verifiziert werden, weil die Stämme plötzlich verschwunden waren.
7
Nachdem hinreichend klar ist, dass es sich bei den ehemals sieben Sandstein-Säulenstämmen an der Stadtkirche tatsächlich um Relikte der ehemaligen Schlangenkandelaber handelt, und dass die Stämme gut 50 cm tief in den Boden eingelassen sind, kann auf der Grundlage der Gladbachschen Zeichnung eine Rekonstruktion der Schlangenkandelaber gewagt werden.
Auf dieser Abbildung rechts sieht man einen Ausschnitt aus einer rückseitigen Darstellung eines Schlangenkandelabers auf dem Luisenplatz mit Blick auf das Schloss von Gladbach. Für sie gilt wie für die obenstehende Zeichnung, dass sie offenbar mit Hilfe einer Camera obscura erstellt wurde. In der Grafik „ERSTE NÄHERUNG“ sind metrische Maße (so weit bekannt) eingetragen. Rechts daneben ist die Gladbachsche Zeichnung als kolorierter Kupferstich von Grünewald zu sehen. Die hellblau gestrichelten Linien verdeutlichen die angegebenen Konturen und sind Grundlage der nebenstehenden Maßzeichnungen. In der Grafik „ZWEITER NÄHERUNG“ sind nur die oberirdischen Teile des Schlangenkandelabers gezeigt und alle Maße in ein Proportionsschema gebracht, das auf einem Modul beruht, welches 1 Fuß sein könnte.
8
Der Urheber des Entwurfes der Schlangenkandelaber
Während des gesamten Zeitraumes, in dem die Schlangenkandelaber im Stadtbild von Darmstadt anhand von Veduten bezeugt sind (zwischen ca. 1813 und 1841), war Georg Moller großherzoglicher Stadtbaumeister. Außer ihm hatte sicher niemand (außer dem Großherzog selbst) die notwendigen Befugnisse, eine solch spektakuläre Maßnahme, wie die Einführung der Schlangenkandelaber durchzuführen – zumindest ist davon nichts überliefert. Außerdem sind die Schlangenkandelaber genau so eine Fürstenverherrlichung, wie das Ludewigsmonument, welches vorgeblich das Monument der Verfassungsgebung ist.
Die Bedeutung der Schlangenkandelaber
In der Epoche des Klassizismus, der Epoche Georg Mollers in Darmstadt, spielte die Kenntnis der klassischen, antiken Mythologie eine große Rolle. Entsprechend war ihre Kenntnis sehr viel allgemeiner und größer als heute. Noch heute ist der Äskulapstab das Zeichen der Ärzte und Apotheker, doch wer – wenn man den Begriff überhaupt kennt - weiß noch, wer Äskulap, oder griechisch Asklepios war? Wer ist mit seinem Mythos vertraut, kennt sein Schicksal und die Familie des Halbgottes? In der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts dürften die Betrachter der Schlangenkandelaber durchaus gewusst haben, dass es sich bei dem Schlangenkandelaber um eine Variante des Äskulapstabes handelt. Dass Äskulap, Sohn des Gottes Apollon und der sterblichen Königstochter Koronis, ein Halbgott war. Auch durfte man allgemein gewusst haben, dass die Tochter des Äskulap Hygieia war. Von ihrem Namen wird unser Begriff: „Hygiene“ hergeleitet. So, wie man gewusst haben dürfte, dass Äskulap dadurch starb, dass sein Großvater Zeus ihn mit einem Blitz aus dem Blitzebündel in seiner rechten Faust erschlug – verbrannte. Zur Strafe dafür, dass der Gott der Heilkunst seine Kompetenzen überschritten hatte, indem er in das göttliche Privileg Leben zu schaffen eingriff, als er einen an seiner Krankheit Verstorbenen wieder zum Leben erweckte. Den unsterblichen Genius des getöteten Äskulaps hingegen sah man in der Zeit der Klassik in der Tempelschlange weiterleben: Der Schlange, die man auf den Mollerschen Schlangenkandelabern dargestellt fand. Wenn man sich die hygienischen und gesundheitlichen Verhältnisse – zumal in der Altstadt – vor Augen führt, so wird einsichtig, weshalb Moller aus der griechischen Mythologie den Äskulap-Mythos für Darmstadt ausgewählt hat. Dieser hatte für Moller sicher auch noch den Vorteil, dass im Zusammenhang mit dem Äskulap-Mythos das Licht der Laterne, welche an der der Schlange aus dem Maul hängenden Kette hing, eine ganz besondere Bedeutung bekam. Es wurde so nämlich zur Erinnerung an den hell aufflammenden Blitz, mit dem der Halbgott verbrannt wurde. Insgesamt also eine doppelte Botschaft:
9
Einerseits versprachen die Schlangenkandelaber den Untertanen des Großherzogs Fortschritt: Es gab eine – wenn auch nur im Bereich des Schlosses punktuelle – Stadtbeleuchtung und das Versprechen von Gesundheit und (durch) Hygiene. Andererseits signalisierten sie die klare Warnung, sich nicht in das „göttliche“ Herrschaftsprivileg des regierenden Großherzogs einzumischen. Eine Warnung vor einer Bestrafung wie sie Äskulap durch seinen Großvater erfuhr.
Die Materialien der Schlangenkandelaber
Die Schlangenkandelaber waren rund um das Schloss aufgestellt. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus und um den Luisenplatz. Zwischen Schloss und Exerzierhaus (heute Standort des Landesmuseums), Hoftheater und längs des Paradeplatzes. Also an den repräsentativsten Orten der Residenzstadt.
Die 16 Kandelaberstandorte, welche sich anhand der erhaltenen Veduten ungefähr angeben lassen, in einen Stadtplan eingetragen, der die städtebauliche Situation um 1830 zeigt.
10
Den repräsentativen Standorten entsprechend und ihrer ikonografischen Bedeutung gemäß, sollten die Schlangenkandelaber also nicht nur in witterungsbeständigen, sondern auch in hochwertigen, repräsentativen Werkstoffen angenommen werden dürfen. Mit Ölfarbe gestrichenes Holz für die Säulen käme demnach eher nicht in Frage. Sandstein – das Material aus dem die hinter der Stadtkirche eingepflanzten Säulenstämme bestehen – passte in jeder Hinsicht sicher sehr viel besser. Für die Schlangen kann man dasselbe annehmen. Auch sie sollte man sich in einem wetterfesten und hochwertigen Material vorstellen, weswegen Holz sicher nicht anzunehmen ist. Wegen des hohen Gewichts und der verhältnismäßig geringen Querschnitte, scheidet Stein ebenfalls aus. Am wahrscheinlichsten sind die Schlangen also in Metall anzunehmen. Kupfer dürfte es nicht gewesen sein, weil dessen Farbkontrast zu Sandstein von vornherein zu gering ist. Aluminium wurde 1825 erstmals hergestellt und kostete noch mehr als Gold. Eisen wäre weder witterungsfest noch repräsentativ gewesen und außerdem zu schwierig zu bearbeiten. Zinn oder Blei wären sehr kostspielig, sicher viel zu schwer, viel zu weich, nicht standfest genug und farblich in matt grau unattraktiv. Bleibt also nur Messing als Material für die Schlangen. Dessen goldenes Blinken im Sonnenlicht hätte fürstlich gewirkt und wunderbar zum Licht der Lampen gepasst, welche nachts leuchteten, wenn die Sonne das Metall nicht erstrahlen ließ.
Die Konstruktion der Schlangenkandelaber
Die Säulen
Da wir mit den Säulenstämmen von der Piazza an der Stadtkirche mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit originale Relikte der ehemaligen Schlangenkandelaber besitzen, sollten wir die Betrachtung der Rekonstruktion hier beginnen. Zunächst fällt die tiefe Bohrung im Säulenstamm auf. Aus ihr kann man schließen, dass eine freie Aufstellung der Säule mit Hilfe eines armierenden Stahlstabes im Inneren standfest möglich war. Den zeitgenössischen Stichen kann man entnehmen, dass das Kapitell nicht unmittelbar über dem Stamm begann, sondern sich dieser in dem Block aus dem das Kapitell gearbeitet war noch ein Stück weit fortsetzte, bevor Ring, Kissen und Platte des Kapitells erscheinen. Diese technisch unklassische Lösung wäre insbesondere am Übergang der Basis zum Stamm sinnvoll, weil so die Fuge zwischen den beiden Gliedern weiter nach oben verlegt wird und weiter aus dem Spritzwasserbereich der Straße gehoben würde. Eindringende Nässe könnte an dieser Stelle den eisernen Kern der Säule erreichen. Der Eisenstab würde rosten, aufquellen und den umgebenden Sandstein absprengen, der Kandelaber würde umkippen. Nach unten muss der Schlangenkandelaber ähnlich den Wurzeln eines Baumes – eine Verankerung besessen haben. Wahrscheinlich einen schweren, hohen Stein, dessen oberirdischer, sichtbarer Teil als Basis und unteres Ende des Säulenstammes ausgeformt war. In seinem Zentrum muss es – wie im Stamm – eine sehr tiefe, zentrale Bohrung gegeben haben. In ihr muss die eiserne Armierung verankert gewesen sein. Mit Hilfe dieser beiden Maßnahmen: Ankerstein und eiserne Armierung im Kern, kann die Säule des Schlangenkandelabers tatsächlich standfest gewesen sein.
11
Die Schlangen
Bei den Schlangen gibt es prinzipielle zwei mögliche Konstruktionen: Außenskelett Ein Außenskelett der Schlangen bedeutet, dass der Schlangenkörper als eine starre Metallröhre ausgeführt wird. Das wäre theoretisch auf zwei Wegen möglich gewesen: Man hätte die Schlangen galvanoplastisch herstellen können - doch nicht zur Mollerzeit. Die notwendigen Mittel dazu standen erst nach der Epoche der Schlangenkandelaber zur Verfügung. In Frage käme also nur der Metallguss. Hier gäbe es zwei Fertigungstechniken, eine preisgünstigere und eine sehr viel teurere. Die teure Technik wäre das Wachsausschmelzverfahren. Man hätte Positive der Schlangen in Wachs serienmäßig herstellen müssen. Man hätte sie also in einer Negativform gießen müssen. Man hätte das klebrige Wachspositiv aus dieser Form wieder herausbringen müssen. Aus modernen Silikonformen ist das kein Problem. Zur Mollerzeit wäre so eine Negativform aus Sackleinen und Gips gemacht worden – man hätte das Wachspositiv aus einer solchen Form nicht wieder heraus gebracht. Diese Methode kommt also auch nicht in Frage. Die preisgünstigere Variante ist der Sandguss. Dieser erfordert Positivmodelle des Gußkörpers. Man hätte diese Modelle problemlos aus Holz herstellen können. Das Problem ist allerdings der Sandkern, welcher vor dem Guss mit gleichmäßigem Abstand zur Gussform in deren Innerem fixiert werden muss. Auf diesem Wege sind daher nur relativ große Wandstärken realisierbar. Diese bedeuten ein hohes Gewicht des Gussteiles, das bedeutet hohen Materialaufwand, hohe Schmelzkosten – wahrscheinlich insgesamt viel zu hohe Kosten - und bedingt statische Probleme. Es bringt viel zu viel Masse an den höchsten Punkt der Konstruktion. Vor allem ist es unmöglich die schwere – bei einer Wandstärke von 4 – 5 mm, ca. 100 kg in Messing – Schlange um den Säulenstamm herum zu legen und gleichzeitig auf die Kapitellplatte zu bekommen. Man kann also ausschließen, dass die Schlangenkörper gegossen waren, weil ein starres Außenskelett konstruktiv nicht in Frage kommt. Bleibt die Möglichkeit, der Konstruktion der Schlangenkörper mit einem Innenskelett. Dieses Innenskelett würde sich am sinnvollsten und billigsten mit einem schmiedeeisernen Stab realisieren lassen. Von des Spitze des Schwanzes bis in die Öse, welche der Schlange aus dem Maul ragte könnte dieser geschmiedete Stab sich um die Säule gelegt haben und auf der Kapitellplatte mit Blei verdübelt worden sein. Um ihn herum lässt sich der Schlangenkörper in Rohrsegmenten arrangieren. Diese Messing-Blechrohrsegmente müssen an ihrem einem Ende einen gewissen Überstand haben. Mit diesem müssten sie in das anschließende Rohrsegment eingegriffen haben. Stück für Stück hätte man den Schlangenkörper rohrabschnittsweise auf den Eisenstab „gefädelt“ und alles zusammen,
12
lose um Stamm und Kapitell der Säule gefügt. Nachdem man alles in die gewünschte Lage gebracht hatte, hätte man den Eisenstab durch Bleiverguss eines angeschmiedeten Astes auf dem Kapitell fixiert und die Rohrabschnitte untereinander verlötet. So hätte man einen doch wieder starren Schlangenkörper um die Säule und auf das Kapitell gebracht und gleichzeitig gegenüber der Variante mit Außenskelett ca. 80 % Gewicht eingespart. Außerdem wäre durch diese Gewichtsreduktion die Standfestigkeit der Säule nicht überfordert. Um die Messingbleche in die Form der Rohrsegmente zu bringen, hätte es hölzerner Klopfmodelle der Segmente (vielleicht aus Eichenholz) – mit Überstand als Muffe zum ineinanderstecken der Rohrabschnitte – bedurft. Dieser Aufwand hätte sich bei einer Serienproduktion – wir können heute noch 16 Kandelaber-Standorte nachvollziehen – gelohnt. Insgesamt scheint allein diese Methode der Herstellung der Schlangenkörper mit Innenskelett technisch und finanziell wahrscheinlich. Nachteil dieser Konstruktion ist, dass sich im Innern der Schlangenkörper im Winter Kondenswasser ansammelt. Dadurch rostet der Eisenstab. Dessen Korrosion wird noch durch den Kontakt zu dem edleren Messing begünstigt. Es entsteht ein elektrisches Element. Auch das Messing dürfte gelitten haben. Nicht allein durch Oxydation seiner Oberfläche, sondern auch durch Ermüdung in Folge ständigen Temperaturwechsels. Dieser dürfte recht bald Haarrisse und später auch größere Schäden verursacht haben. Dennoch sind dreißig Jahre Lebenserwartung dieser Konstruktion sicher nicht unrealistisch.
Die Laternen
Die an Ketten - welche an Ösen befestigt waren, die den Schlangenköpfen aus den Mäulern ragten - abgehängten Laternen, brauchten keinen anderen Anforderungen zu genügen, als den technischen, denen auch alle anderen Straßenlaternen genügen mussten. Für die Schlangenkandelaber mussten keine „schlangenkandelaberspezifischen“ Laternen konstruiert werden. Es können Laternen wie auf diesem Bild gewesen sein: Ausschnitt aus einem Kunstwerk, das eine Ansicht der Westseite (Wilhelminenstraße) des alten Palais gibt. Bei dem Schlangenkandelaber dessen Laterne wir hier sehen, handelt es sich um dasselbe Objekt, das in der Vorbemerkung dieser Schrift in der Abbildung von Gladenbach zu sehen ist. Das Interesse des Künstlers an der Laterne war sichtlich größer als an dem Schlangenkandelaber. Gut möglich, dass die Laterne genau so frei dargestellt ist, wie der Kandelaber. Dennoch wäre dieses eine durchaus denkbare Form der Laternen. Es können auch verschiedene Laternentypen zum Einsatz gekommen sein. Diese Abbildung ist entnommen: „Die Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt Darmstadt, von Georg Haupt, Darmstadt, 1954, Bd. II, S. 205 b.
13
Sinn und Nutzen einer möglichen Rekonstruktion
Nachdem nun die Rekonstruktion der Schlangenkandelaber im Maßstab 1:1 möglich ist – sogar unter Einbeziehung eines originalen Bauteils – stellt sich die Frage nach dem Sinn so eines Unterfangens. Diese Frage könnte man unter verschiedenen Aspekten diskutieren: Denkmalschutz: Der Stadtraum ist insbesondere nach den Zerstörungen im zweiten Weltkrieg so tiefgreifend umgestaltet worden, dass noch nicht einmal ein einziger, ehemaliger Standort eines Schlangenkandelabers im Originalzustand erhalten geblieben ist. Auch von keinem einzigen Ankerstein im Boden weiß man heute. Insofern kann man wohl sagen: Wo es kein Denkmal gibt, kann man auch keines schützen. Denkmalwürdig scheint allein die Tatsache, dass man die Schlangenkandelaber als Symbole des vergangenen Absolutismus entfernte, als man das Ludewigsmonument als Symbol des Vormärz, der Verfassungsgebung, der kommenden Demokratie errichtete. Die Aufstellung einer 1:1-Rekonstruktion im Stadtraum wäre ahistorisch und hätte etwas von einer Jahrmarktsdekoration - sollte man dafür einen von nur noch zwei erhaltenen, originalen Säulenstämmen verbrauchen? Stadtmarketing: Die Schlangenkandelaber sind weltweit einzigartig und ein Alleinstellungsmerkmal von Darmstadt. Ihre Rekonstruktion wäre eine Attraktion für die Stadt. Darmstadt kann nur gewinnen, wenn es auch seine klassizistische Seite als Moller-Stadt zeigt. Alltagstauglichkeit: Unter diesem Aspekt stellt sich die Frage nach dem statischen Nachweis der Standsicherheit einer originalgetreuen Rekonstruktion. Ist so ein Bauwerk heute überhaupt genehmigungsfähig? Müsste man den Entwurf sichtlich abändern, um ihn genehmigungsfähig zu machen, so käme eine Aufstellung eigentlich gar nicht mehr in Frage. Wie will man das Objekt vor Vandalismus schützen? Wie kann man verhindern, dass daran geklettert wird und Menschen zu Schaden kommen – etwa indem die Konstruktion umfällt, weil ein Kletterer sie aus dem Gleichgewicht bringt? Wie will man dem Problem der materialbedingten, relativen Kurzlebigkeit der frei bewitterten Schlangen begegnen? Museale Präsentation: In einem stets gleichmäßig temperierten Innenraum könnte eine Rekonstruktion weitestgehend originalgetreu unter Verwendung originaler Materialien präsentiert werden. Im musealen Umfeld entfielen die baurechtlichen Anforderungen, die bei einer Aufstellung im Stadtraum zu erfüllen sind. Gleichzeitig würden so Vandalismus oder Klettereien an dem Objekt verhindert. Man könnte eine Rekonstruktion auch als eine Videoanimation, die auf einem Bildschirm läuft präsentierten - vielleicht neben einem originalen Säulenstamm? Eine weitere Option wäre, das Video der Rekonstruktion zusammen mit einem maßstäblich verkleinerten Modell eines oder besser einer Gruppe von Schlangenkandelabern zu zeigen.
14
Schließlich könnte man sich im Falle einer 1:1-Rekonstruktion auch entscheiden dem originalen Säulenstamm die fehlenden Teile als farblich abgesetzte – vielleicht weiße – Elemente hinzuzufügen um deutlich zu machen, was original und was Rekonstruktion ist.