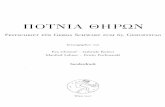Überlegungen zu Fiktionalität und Medientheorie
Transcript of Überlegungen zu Fiktionalität und Medientheorie
1
Jens Schröter
Überlegungen zu Medientheorie und Fiktionalität
Hartmut Winkler hat eine kumulative Definition von ›Medium‹ vorgeschlagen. Dabei
werden sechs Basisdefinitionen verbunden. Eine davon betrifft den »symbolischen Cha-
rakter« der Medien. Er schreibt zur Erläuterung:
$Z$ Die wohl plausibelste Definition der Medien ist, dass sie ein symbolisches
Probehandeln erlauben. Medien etablieren innerhalb der Gesellschaft einen Raum,
der die Besonderheit hat, von tatsächlichen Konsequenzen weitgehend entkoppelt
zu sein. Handlungen in diesem Raum sind – im Gegensatz zu tatsächlichen Hand-
lungen – reversibel; geschieht auf der Bühne ein Mord, steht der Ermordete danach
auf und verneigt sich. Dies gilt, vermittelt, für symbolische Prozesse allgemein.1
Winkler bestimmt hier also als die ›plausibelste‹ Definition von Medien, einen Raum zu
eröffnen, der, wie er sagt, ›symbolisches Probehandeln‹2 eröffnet. Das Beispiel, ein Mord
auf der Bühne, ist eindeutig eine Fiktion.3 Mithin erscheint im Zentrum der medientheore-
tischen Reflexion, offenbar konstitutiv für die Medialität der Medien selbst – die Fiktiona-
lität. Ausgehend von diesem Hinweis sollen im folgenden Aufsatz verschiedene Aspekte
und Facetten des Verhältnisses von Medien und Fiktionalität bzw. des Stellenwerts von
Fiktionalität in der Medientheorie untersucht werden.4 Es geht hier jedoch nicht im enge-
1 Hartmut Winkler, »Mediendefinition«, in: Medienwissenschaft – Rezensionen, 4.1 (2004), S. 9–27, hier S. 13. Die anderen fünf Basisdefinitionen sind: »Kommunikation«, »Technik«, »Form und Inhalt«, »Medien überwin-den Raum und Zeit« und »Medien sind unsichtbar«. 2 Es kann diskutiert werden, was ›Probehandeln‹ in Bezug auf andere Medien als das Theater (vorausgesetzt man versteht Theater überhaupt als Medium) bedeutet. Dass der Schauspieler im Theater probehandelt (also nur so tut, als ob er tot sei), kann man verstehen, aber inwiefern gilt das z. B. für Literatur, in der ja – anders als der Schauspieler – niemand handelt, sondern vielmehr nur Beschreibungen von Handlungen vorliegen? Ist dann die Handlung des Schreibenden eine Probehandlung? Aber der Autor schreibt doch tatsächlich und schafft einen wirklichen Gegenstand, nämlich einen Text? Oder geht es um das Handeln der fiktiven Charaktere? Das Beispiel der Literatur wird uns in IV wiederbegegnen. 3 Zu den zahlreichen verschiedenen Ansätzen, Fiktionalität zu definieren vgl. Frank Zipfel, Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität. Analysen zur Fiktion in der Literatur und zum Fiktionsbegriff in der Literaturwissenschaft, Berlin: Schmidt 2001 und Remigius Bunia, Faltungen. Fiktion, Erzählen, Medien, Berlin: Schmidt 2007. Ich kann mich im vorliegenden Text nur selektiv auf bestimmte Fiktionstheorien beziehen, vorrangig wird dies der Ansatz von Kendall L. Walton sein. 4 Es gibt zwar einige Publikationen zu diesem Themenfeld, siehe etwa Gertrud Koch / Christiane Voss (Hg.): »Es ist, als ob«. Fiktionalität in Philosophie, Film und Medienwissenschaft, München: Fink 2009, allerdings werden die Fragen, die ich hier anschneide, dort nicht behandelt.
Preprint, vor peer review, erscheint in: Remigius Bunia/Anne Enderwitz/Irina Rajewsky: Fiktionalität in den Medien und Künsten, vorauss. 2014.
2
ren Sinne um narratologische Überlegungen, z. B. wie in bestimmten Medien fiktionale
Figuren konstruiert werden.5
In Teil I wird Winklers oben zitierte These aufgegriffen. Dabei wird der Frage nachge-
gangen, ob und auf welche Weise Medien konstitutiv für Fiktionalität sind. Anscheinend
ist Sprache das zentrale Medium der Fiktionsbildung – was aber auch bedeutet, dass sich
die in Analogie zur Trennung von Zuschauer- und Bühnenraum durchgeführte klare Ab-
grenzung eines ›Raums der Medien‹, in dem Fiktionen möglich sind, und eines Raums
außerhalb, in dem das offenbar nicht der Fall ist, brüchig wird. In Teil II und III wird da-
von ausgehend eine spezifisch medienwissenschaftliche Kontroverse aufgegriffen, inso-
fern in dieser ebenfalls ›Fiktionalität‹ zur Differenzierung und Bestimmung benutzt wird,
dieses Mal einerseits von analogen und andererseits von digitalen Bildern. Zunächst soll
die Behauptung, fotografische Bilder seien qua ihres indexikalischen, also über Kausalität
mit dem Referenten des Bildes verbundenen, Charakters nicht zu Fiktionalität fähig, am
Beispiel von Sean Connery-/James Bond-Bildern6 kritisiert werden (Teil II). Dann wird es
um die komplementäre These gehen, digitale Bilder seien qua ihrer Digitalität gleichsam
immer fiktional (Teil III). Es wurden diese, eigentlich etwas kurios anmutenden, Thesen
gewählt, weil sie Fiktionalität nicht mit Bildern überhaupt oder z. B. der Frage, ob und
wenn wie die ›abstrakte Kunstform‹ Musik fiktional sein kann, in Verbindung bringen.
Solche Fragen wurden in der philosophischen Ästhetik schon mehrfach diskutiert.7 Viel-
mehr geht es eben um die Frage, ob spezifisch medientechnische Eigenschaften, wie die
analoge und digitale Aufzeichnung, etwas mit dem Fiktionspotential zu tun haben können
– wenig verwunderlich ergibt sich, dass das nicht der Fall ist. Aber diese Erkenntnis
macht die Frage nach der Rolle von Fiktionalität in der Medientheorie, wie sie sich im
einleitenden Zitat Winklers andeutet, umso dringlicher. In Teil IV soll Winklers Argu-
ment mit einem Aufsatz Friedrich Kittlers – Fiktion und Simulation – kontrastiert werden.
Wie und warum wird hier auf Fiktion rekurriert? Welchen Platz hat Fiktionalität in medi-
entheoretischen Diskursen? In Teil V folgt ein Fazit.
5 Vgl. z. B. Jens Eder / Fotis Jannidis / Ralf Schneider (Hg.): Characters in Fictional Worlds, Berlin / New York: De Gruyter 2010. 6 ›Bond-Bilder‹ und nicht ›Bilder-von-Bond‹ vgl. dazu Catherine Z. Elgin, With Reference to Reference, Indi-anapolis: Hackett 1983, S. 43–50. 7 Um nur zwei Beispiele von sehr vielen mehr zu nennen: Marie Laure Ryan, »Fiktion, Kognition und nichtver-bale Medien«, in: Koch / Voss (Hg.): »Es ist, als ob« (Anm. 4), S. 69–86 untersucht die Möglichkeit der Fiktio-nalität von Bildern überhaupt; zur Frage der Fiktionalität von Musik vgl. etwa Kendall L. Walton, »Listening with Imagination: Is Music Representational?«, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 52.1 (1994), S. 47–61.
3
$Ü$ Medien als Bedingung für Fiktionalität
Winkler verbindet also Medien mit Fiktionalität. Dafür ein weiteres Beispiel: »Medien
bilden Zeichensysteme aus. Zeichensysteme stellen das Spielmaterial bereit, mit dem
symbolisches Probehandeln möglich wird. [...] Mit Zeichen sind auch Spiel, Fiktion und
rein mechanische Operationen möglich.«8 Winkler will sicher nicht sagen, Medien er-
zeugten nur Fiktionen – denn offensichtlich haben sie ja auch wichtige Funktionen in
nicht-fiktionalen Vorgängen, z. B. kann man mit einem Handy einen Profikiller anrufen
und (im Unterschied zum reversiblen Mord auf einer Bühne) einen wirklich-irreversiblen
Mord durchführen lassen.9 Das Argument scheint zu sein: Fiktionen gibt es nur in und mit
Medien – eine These, die durchaus plausibel ist, denn ›James Bond‹ etwa wurde außerhalb
von Büchern, Filmen, Plakaten etc. noch nicht gesichtet. Allerdings drängt sich gleich ein
Einwand auf: Kendall Walton hat in seiner Studie Mimesis as Make-Believe die Möglich-
keit von Fiktion gleichsam anthropologisch an make-believe games gebunden.10 So kön-
nen auch Kinder z. B. ›James Bond‹ spielen, ein Stöckchen ist eine Pistole etc. – gewiß:
In diesem Beispiel haben die Kinder das Wissen um ›James Bond‹ ziemlich sicher aus
Medien, man könnte mithin behaupten Fiktionen entstehen in Medien und expandieren
dann in die Welt. Aber das Beispiel könnte auch sein: ›Die Kinder häufen einen Matsch-
haufen auf und sagen, es sei ein Kuchen‹, die Fähigkeit Dinge anders zu nennen, muss
sich nicht auf Muster aus den Massenmedien beziehen. Entscheidend ist offenbar, dass die
Fähigkeit besteht, etwas umzubennen, »etwas als etwas anderes [zu] betrachten«.11 Das
gilt auch für – wie man mit Oliver Scholz sagen könnte12 – ›Bildspiele‹ (s. u.). Winkler
selbst hat in seinem Buch Basiswissen Medien unter der programmatischen Überschrift
»Medien-Definition« wiederholt, die »plausibelste Definition« von Medien sei, dass sie
»symbolisches Probehandeln« erlauben – und daran wird eine Fußnote angeschlossen, in 8 Winkler, »Mediendefinition« (Anm. 1), S. 13/14; vgl. auch Hartmut Winkler, »Zeichenmaschinen. Oder wa-rum die semiotische Dimension für eine Definition der Medien unerlässlich ist«, in: Stefan Münker / Alexander Rösler: Was ist ein Medium?, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2008, S. 211–221, hier S. 212/213. 9 Und sicher will er auch nicht sagen, die Entkopplung von Fiktionen vom ›Realen‹ sei vollständig – denn dann wären die Fiktionen nicht mehr intelligibel. Fiktionen stehen immer zwischen Realem und Imaginärem, vgl. Wolfgang Iser, Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie, Frankfurt a.M.: Suhr-kamp 1991. 10 Vgl. Kendall L. Walton, Mimesis as Make-Believe. On the Foundations of the Representational Arts, Cambridge/MA: Harvard University Press 1990. 11 Ryan, »Fiktion, Kognition und nichtverbale Medien« (Anm. 7), S. 73. 12 Oliver Scholz, Bild, Darstellung, Zeichen. Philosophische Theorien bildhafter Darstellung, Freiburg / Mün-chen: Alber 1991, S. 126/127.
4
der Krämer und Huizinga jeweils mit Arbeiten zum Spiel zitiert werden, eine Nähe zu
Waltons bevorzugten Beispiel, eben dem Kinderspiel, scheint auf der Hand zu liegen.13
Symbolisches Probehandeln tritt also auch außerhalb von technischen Medien bzw. genau
abgegrenzten medialen Räumen wie Theater- oder Kinoarchitekturen auf, kann also nicht
als spezifische Eigenschaft derselben angesehen werden. Die fiktionale Leistung von Me-
dien scheint eher vom symbolischen Probehandeln in der Welt abgeleitet zu sein.14 Und
wieder genauer: Von der Sprache, vorausgesetzt man versteht diese als Medium, die noch
jeden alltäglichen Vorgang mediatisiert – und insofern wäre es nicht überraschend, dass
Winkler, in dessen (durchaus semiotisch geprägtem) medientheoretischem Ansatz die
Sprache eine zentrale Rolle spielt15, auch die Fiktion in den Kern seines Medienbegriffs
rückt.
Daher müsste auch eine mögliche Fiktionalität von Bildern als von der Sprache abgeleite-
te erscheinen, was im Zeitalter des iconic turns ohne Zweifel auf Widerspruch stoßen
dürfte. Aber dennoch kann man argumentieren, dass kein Bild aus sich heraus sicherstel-
len kann, fiktional verstanden zu werden und in der Regel sprachliche Paratexte dies er-
möglichen oder nahelegen – es sei denn eine etablierte Ikonographie (die als Ikonographie
durchaus auch eine historisch-systematische Nähe zur Sprache hat16) übernimmt diesen
Part (siehe Abschnitt II). Wie dem auch sei: Es ist Winkler also zuzustimmen, dass Medi-
en – insofern man Sprache dazuzählt – die Bedingung für Fiktionalität sind. Man kann
Fiktionalität aber nicht auf klar markierte mediale Räume eingrenzen – wie Winkler mit
dem Beispiel des vom Zuschauerraum sorgsam abgegrenzten Bühnenraums nahelegt. Sie
ist gewissermaßen an bestimmten medialen Orten (und z. B. aus rituellen oder eskapis-
tisch-kommerziellen Gründen etc.) konzentrierter vorhanden als anderswo – im Theater
13 Hartmut Winkler, Basiswissen Medien, Frankfurt a.M.: Fischer 2008, S. 63 und die Anmerkungen auf S. 316. Auf S. 64 geht er ausführlicher auf das Probehandeln ein, dabei rangieren am reversiblen, symbolischen Pol ausdrücklich nebeneinander: »Spiel, Fiktion, Simulation«. Siehe Abschnitt IV zur Simulation. 14 Vgl. Walton, Mimesis as Make-Believe (Anm. 10), S. 11: »In order to understand paintings, plays, films and novels, we must look first at dolls, hobbyhorses, toy trucks, and teddy bears.« Zur fundamentalen und schon aus der Kindheit erwachsenden Rolle der ›Phantasie‹ vgl. auch Sigmund Freud, »Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens«, in: ders., Gesammelte Werke, Bd. 8, Frankfurt a.M.: Fischer 1969, S. 230–238. 15 Vgl. Hartmut Winkler, Docuverse. Zur Medientheorie der Computer, München: Boer 1997, S. 108: »Leroi-Gourhan zu folgen also heißt, die gesamte Technik nach dem Muster der Sprache zu denken« und auf S. 366 unterstreicht er, »daß grundsätzlich alle Technik von der Sprache her gedacht werden muß.« 16 Vgl. Thomas Hensel, »Text / Bild«, in Stefan Jordan / Jürgen Müller (Hg.): Lexikon Kunstwissenschaft. Hun-dert Grundbegriffe, Stuttgart: Reclam 2012, S. 321–323, hier insbesondere S. 322. Walton, Mimesis as Make-Believe (Anm. 10), S. 75/76 insistiert aber darauf, dass es auch genuin nicht-sprachliche Fiktionalität gäbe. Wie in Abschnitt II zu zeigen sein wird, ist bildliche Fiktionalität ohne jeden sprachlichen Kontext (und sei er ikono-graphisch sedimentiert) aber schwer vorstellbar.
5
kommen mehr fiktive Figuren vor als im Straßenverkehr, dennoch ist es möglich, etwa im
Zusammenhang mit einem Autounfall erleichtert über einen ›Schutzengel‹ zu sprechen.
Und die medialen Orte wie Theater und Kino bieten viel Material für Fiktionsbildung im
Alltag – siehe oben das Beispiel mit den Kindern, die James Bond nachspielen oder um
nochmals auf den Autounfall Bezug zu nehmen: ›Kein Wunder, du fährst ja auch wie Ja-
mes Bond‹.
Wenn man annimmt, dass die Bedingung der Möglichkeit des Fiktionalen mit Sprache
gegeben ist und nicht mit Medien wie Theater und dann später den (im engeren Sinne)
technologischen Medien wie Film erst erfunden, aber verstärkt und konzentriert wird,
ergibt sich die Vermutung, dass kein Medium per se zu Fiktionen unfähig ist: Da der
sprachliche Vollzug noch jeden Matschhaufen in einen Kuchen verwandeln kann, kann
man sich nicht vorstellen, dass es irgend etwas geben könnte, was per se nicht fiktional
verwendbar ist.
$Ü$ Operationen der Fiktionalisierung fotografischer Bilder
Dennoch gibt es diese Behauptung – Roger Scruton hat explizit die These vertreten, das
Medium Fotografie sei von einer prinzipiellen »fictional incompetence«17 bestimmt. Diese
Behauptung ist von gravierender Bedeutung, denn wenn sie richtig wäre, würde das ers-
tens bedeuten, dass die Möglichkeit des (mutmaßlich in letzter Instanz sprachlich vermit-
telten) fiktionalen Gebrauchs bestimmten Begrenzungen unterliegt, dass es also prinzipi-
elle Grenzen des Fiktionalisierbaren gibt. Zweitens würde es bedeuten, dass diese Grenzen
in der Ontologie (zumindest) eines Mediums – nämlich der Fotografie – liegen. Dies wäre
in der Tat eine fundamentale Erkenntnis der Theorie der Fiktion wie der Medientheorie.
Überdies hätte die Bestätigung dieser Annahme den eigentümlichen Effekt, dass – zumin-
dest wenn man Winklers Definition folgt – Fotografie kein Medium wäre (insofern ja
Medien bei Winkler prinzipiell über Fiktionsfähigkeit bestimmt sind).
Bei der Fotografie entzündete sich diese Diskussion an ihrer Eigenschaft Aufzeichnung
des Lichts einer einstmals real existierenden Szene gewesen zu sein – es geht also um den
indexikalischen und analogen Charakter der Fotografie.18 Dieses Beispiel ist für die Dis-
17 Roger Scruton, »Photography and Representation [1983]«, in: Noël Carroll / Jinhee Choi (Hg.): Philosophy of Film and Motion Pictures, Malden/MA 2006, S. 19–34, hier S. 25. 18 Klassisch: André Bazin, »Ontologie des fotografischen Bildes«, in: ders.: Was ist Kino? Bausteine zu einer Theorie des Films, hg. v. Hartmut Bitomsky u. a., Köln: DuMont 1975, S. 21–27.
6
kussion deswegen so interessant, da es dezidiert um eine medientechnische Eigenschaft
der Fotografie geht, nämlich dass das von Objekten reflektierte Licht von einem Linsen-
system fokussiert und von einem fotoempfindlichen Sensor aufgezeichnet wird.19 Scru-
tons vernichtendes Urteil über die fiktionale Kompetenz rührt genau daher, denn ausge-
hend von der Bestimmung »that the relation between a photograph and its subject is a
causal relation« schließt er:
$Z$ Of course I may take a photograph of a draped nude and call it Venus, but in-
sofar as this can be understood as an exercise in fiction, it should not be thought of
as a photographic representation of Venus but rather as the photograph of a re-
presentation of Venus. In other words, the process of fictional representation oc-
curs not in the photograph but in the subject: it is the subject which represents Ve-
nus; the photograph does no more than disseminate its visual character to other
eyes.20
Scruton unterstellt der Fotografie, qua ihrer ›spezifischen‹ Eigenschaft der indexikali-
schen Aufzeichnung von Licht, eine prinzipielle ›fictional incompetence‹. Diese These
und die Erwiderungen auf sie wurden andernorts ausführlich diskutiert,21 dies soll hier
nicht wiederholt werden. Das Ergebnis war: Auch Fotografien und näherhin Fotografien
eines nicht bereits fiktional vorkonstituierten Szenarios (Verkleidungen etc.) können ent-
gegen dem, was Scruton behauptet, fiktional gebraucht werden. So kann man sich prob-
lemlos vorstellen, aus gefundenen, ursprünglich nicht fiktional intendierten bzw. insze-
nierten, fotografischen Bildern zusammen mit einem entsprechenden Text eine Bilderge-
schichte zu konstruieren, die sich um irgendwelche fiktiven Charaktere dreht. Nun könnte
Scruton einwenden, dass dieses Beispiel gar nichts beweist, da wieder nicht die Fotos fik-
tional sind, sondern der Text – und die Fotos illustrieren ihn ›bloß‹. Doch stellen wir uns
eine Geschichte über die Abenteuer des fiktiven ›Mr. Jones‹ vor und nehmen an, dass der 19 Obwohl Bazin das Argument der kausalen Aufzeichnung der Fotografie (er greift noch nicht auf die schon im 19. Jahrhundert geprägte Terminologie des Index zurück, das wird die Fototheorie erst später tun, Bazins Essay ist von 1945) natürlich auf die chemische Fotografie bezieht (eine andere konnte er nicht kennen), gilt es auch (obwohl das bestritten worden ist) für die digitale Fotografie – denn auch der digitale Sensor (das CCD) wird durch den Lichteinfall kausal verändert, auch wenn diese Veränderung reversibel ist, anders als jene lichtemp-findlicher chemischer Emulsionen (z. B. aus Silberhalogeniden in der s/w-Fotografie). 20 Scruton, »Photography and Representation« (Anm. 17), S. 25. Siehe auch S. 29. Auch bei Scruton ist die Sprache für Fiktionalisierung zentral: ›Of course I may take a photograph of a draped nude and call it [!] Venus‹. 21 Vgl. Jens Schröter, »Fotografie und Fiktionalität«, in: Lars Blunck (Hg.): Die fotografische Wirklichkeit. In-szenierung, Fiktion, Narration, Bielefeld: transcript 2010, S. 143–158.
7
Text nicht spezifiziert, ob Mr. Jones dick oder schlank ist. Ein beigefügtes Foto, vielleicht
im Netz gefunden, von irgendeiner beliebigen männlichen Person und in dokumentari-
scher Hinsicht aufgenommen (z. B. von einer Website, die das Personal einer Firma vor-
stellt), illustriert die Einführung von Mr. Jones. Das Foto zeigt einen dicken Mann, d. h. es
fügt der fiktiven Figur Mr. Jones hinzu, dick zu sein – es illustriert nicht ›bloß‹ den Text,
es fügt etwas Genuines hinzu zur Konstruktion der fiktiven Figur. In diesem, keineswegs
exotischen (s. u.), Fall hat die Fotografie, obwohl nicht auf der prä-fotografischen Ebene
fiktional inszeniert, einen irreduziblen Anteil an der Fiktionsbildung (oder genauer: an der
Bereitstellung von Informationen, die fiktional verstanden werden können).
Abbildung 1
Zum fiktionalen Gebrauch von Fotografien ein weiteres Beispiel (das vielleicht etwas un-
glücklich ist, es wurde aber extra so gewählt, s.u.): Abbildung 1 zeigt Sean Connery und
es zeigt James Bond. Es wurde im Netz in Folge einer Suche nach ›James Bond‹ gefun-
den. Was es zeigt, hängt dezidiert von seiner Kontextualisierung ab. Schreibt man dane-
ben: ›Wie man sieht, war Sean Connery ein attraktiver Mann‹, dann zeigt das Foto Sean
Connery (offenbar kann jede fiktionale auch als nicht-fiktionale Darstellung verstanden
werden). Schreibe ich daneben: ›007 besticht wie immer durch seine Eleganz‹, dann zeigt
das Foto den fiktionalen Charakter James Bond.22 Man kann schlussfolgern:
(i) Sprachlicher Kontext: Offenkundig ist die Fähigkeit eines Fotos eine fiktive Figur zu
bezeichnen, abhängig von intermedialen, genauer: vom sprachlichen Kontext – schon
Barthes hat die radikale Bedeutungsoffenheit und daher Kommentarbedürftigkeit von Fo-
tografien (trotz ihrer Indexikalität) unterstrichen.23 Die Rolle der Sprache für die Fiktiona-
lisierung könnte in der Fähigkeit der Sprache zur Negation liegen. Harald Weinrich be-
22 Es ergibt jedenfalls keinen Sinn zu sagen: ›Nein, es ist falsch, dies ist nicht Bond, sondern Sean Connery‹. Die Lage wird verkompliziert dadurch, dass Bond in verschiedenen Körperbildern erscheinen kann, auch ein Foto von Roger Moore oder Daniel Craig kann als Bond-Bild fungieren (aber auch Fotos von unbekannten Privatper-sonen mit entsprechenden Attributen können zumindest als ironische Bezugnahme auf Bond-Bilder operieren). Das zeigt aber letztlich nur, dass die Fiktionalisierung sogar verschiedene fotografisch-indexikalische Aufzeich-nungen (von Körpern) unter ein und dasselbe fiktionale Label subsumieren kann (sonst könnte man nicht einmal diskutieren, wer von den verschiedenen Schauspielern, also z. B. Connery, Moore oder Craig, der ›bessere Bond‹ ist). 23 Vgl. Roland Barthes, »Fotografie als Botschaft«, in: ders., Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1990, S. 11–27, hier S. 21/22.
8
zeichnete die Negation als eines der wichtigsten Fiktionssignale24: ›Dies ist nicht (oder
nicht nur) Connery, sondern auch Bond‹. Ein Foto zu fiktionalisieren, bedeutet, das gege-
ben Sichtbare in gewisser Hinsicht zu negieren, in gewisser Hinsicht den indexikalisch-
referentiellen Bezug zu negieren. Bilder selbst können aber keine Negationen
ausdrücken.25
(ii) Pragmatik: Mehrfach wurde der Begriff Fiktionalisierung verwendet: Eine gegebene
Entität ist an sich weder fiktional noch ist sie es nicht – Fiktionalität wird also performativ
und pragmatisch hergestellt. Es geht darum, was man mit etwas macht, statt darum, was
etwas ist. Auch das ist natürlich keine neue Einsicht, sondern u. a. schon Kendall Waltons
Argument. Aber es ist eine, die gegen das gleichsam medientheoretische Argument von
Scruton, die Fotografie erlaube keinen fiktionalen Gebrauch, errungen werden muss. Al-
lerdings ist es tautologisch und insofern nutzlos, einfach zu sagen, fiktional ist, was fikti-
onal gebraucht wird. Man muss Bedingungen angeben können, wann von einem fiktiona-
len Gebrauch die Rede sein kann. Das ist eine schwierige Frage, die ich hier nicht disku-
tieren kann, zumal das andernorts in der Literatur viel ausführlicher geschehen ist. Der
semiotische und kognitive Prozess26 der Fiktionalisierung wird manchmal durch konven-
tionalisierte Markierungen ausgelöst, in der Literatur z. B. ›es war einmal‹ oder einfach
die Deklaration eines gegebenen Buchs als ›Roman‹.27 Auch erleichtert der Fund eines
Bildes von Sean Connery bei der Suche nach ›James Bond‹ im Netz die Klassifikation des
Bildes als Bond-Bild.28 Die Fiktionalisierung kann nicht im leeren Raum stattfinden, wie
das Beispiel von den Kindern, die ›James Bond‹ spielen und dabei z. B. ein Stöckchen als 24 Harald Weinrich, »Fiktionssignale«, in: ders. (Hg.): Positionen der Negativität, München: Fink 1975, S. 525/526, hier S. 526: »Es ist nun sicher kein Zufall, daß unter den Signalen der Fiktion gerade die Negation [...] eine verhältnismäßig starke Signalwirkung hat. Denn in den meisten Situationen wird man beim hörenden oder lesenden Kommunikationspartner die allgemeine Erwartung einer gemeinsamen Realitätsbasis für Umwelt und Buchwelt als normal annehmen können. Es bedarf dann besonderer Signale, um ihn aus dem Raum der Erwar-tung hinauszuführen in ein fernes und möglicherweise sehr fremdes Reich der Phantasie und Fiktion.« Vgl. auch den auf ›negative free logic‹ basierenden fiktionstheoretischen Ansatz von R. M. Sainsbury, Reference without Referents, Oxford: Clarendon Press 2005, Kapitel 6. 25 Vgl. Edward Branigan, »›Here is a Picture of no Revolver‹. The Negation of Images, and Methods for Ana-lyzing the Structure of Pictorial Statements«, in: Wide Angle, 8.3 (1986), S. 8–17. Vgl. Ryan, »Fiktion, Kogniti-on und nichtverbale Medien« (Anm. 7), S. 76. 26 Vgl. in Bezug auf Film etwa Edward Branigan, Narrative Comprehension and Film, London / New York: Routledge 1992, Kapitel 7. 27 Vgl. Zipfel, Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität (Anm. 3), S. 232–234 und S. 243–247. Branigan, Narrative Com-prehension and Film (Anm. 26), S. 200/201, zählt verschiedene Beispiele für solche Markierungen im Film auf. In der Fotografie kann man etwa auf solche Beispiele wie die auffällige und der Bühnenbeleuchtung des Thea-ters entlehnte Lichtregie in den ansonsten wie ›dokumentarische‹ Straßenfotos wirkenden Fotografien von Phi-lip-Lorcia DiCorcia verweisen, vgl. Philip-Lorca DiCorcia, Philip-Lorca diCorcia, New York: MoMA 2003. 28 Das Bild wird sozusagen fiktional ›gelabelt‹, vgl. Elgin, With Reference to Reference (Anm. 6), S. 43–50.
9
Pistole verwenden, zeigt. Ein solches Spiel setzt – ganz banal – voraus, dass es irgendwel-
che medialen Präsentationen von ›James Bond‹ gibt.
(iii) Transmedialität, historische Sedimentation und Aufhebbarkeit der Fiktionalität:
• Transmedialität: Fiktionale Entitäten wie etwa James Bond können transmedial
existieren und tun dies in der Regel auch: Sie existieren z. B. in Literatur, Film und
Fotografie, ja James Bond kann sogar von dem Körperbild verschiedener Schau-
spieler repräsentiert werden. Die Frage, wie über eine solche transmediale Disper-
sion die Identität einer fiktiven Entität sichergestellt wird, ist ein u. a. im artefaktu-
alistischen Diskurs diskutiertes Problem.29 Der Artefaktualismus ist ein fiktions-
theoretischer Ansatz, der der Medientheorie darin nahesteht, dass er Fiktionen
zentral als etwas Gemachtes und in medialen Artefakten wie Büchern oder Filmen
Realisiertes betrachtet (anders als beispielsweise meinongianische Ansätze). Eine
Frage, die sich medientheoretisch daran anschließt, ist, was die verschiedenen me-
dialen Elemente zu der Konstruktion z. B. einer fiktiven Figur und ihrer Instantia-
tion beitragen.30 Übrigens kann ein solches Element auch der bloße mediale ›look‹
sein: Als der Film The Hobbit – An Unexpected Journey (2012, R.: Peter Jackson)
in dem so genannten ›High Frame-Rate-3D‹-Verfahren ins Kino kam, wurde in
29 Vgl. Amie L. Thomasson, Fiction and Metaphysics, Cambridge: Cambridge University Press 1999, S. 55–69. 30 Fiktive Charaktere zeichnen sich durch eine prinzipielle ›incompleteness‹ aus (vgl. Charles Crittenden, »Ficti-onal Characters and Logical Completeness«, in: Poetics, 11 (1982), S. 331–344). Wenn kein fiktionaler Text z. B. Informationen über Muttermale von James Bond gibt, kann prinzipiell nicht in Erfahrung gebracht werden, ob James Bond Muttermale hat, während bei realen Personen dies in Erfahrung zu bringen zumindest im Prinzip möglich ist, selbst wenn es empirisch nicht gelingt. In verschiedenen medialen Kontexten tauchen fiktive Figu-ren aber verschieden auf – und so wird durch Bilder und Töne ihre incompleteness ›aufgefüllt‹ (wie bei dem Beispiel von ›Mr. Jones‹ oben) – selbst wenn die einschlägigen Romane offenlassen, welches Timbre die Stim-me von James Bond genau hat, so muss eine Verfilmung doch diese Leerstelle irgendwie ausfüllen. Dass Bond wie Connery (und Moore und Dalton und Brosnan etc.) aussieht, bzw. dass Bond eine spezifische Stimme hat, ist eine Leistung, die das Bild und der Ton zu der Konstruktion fiktionaler Identität beisteuern. Bei diesen Kon-kretionsprozessen spielt dann nun die Materialität der Medien zumindest in gewisser Hinsicht eine Rolle: Die fotografische Aufzeichnung bindet die fiktive Entität an einen realen Körper, den Starkörper (und die akustische Aufzeichnung die fiktive Entität an eine Stimme, die dann z. B. wiederum in der Werbung genutzt werden kann) – und umgekehrt. So gesehen ist eine fiktive Figur, um bei diesem Beispiel zu bleiben, weniger eine transmedia-le Entität, ein »abstract artifact« (Thomasson, Fiction and Metaphysics (Anm. 29), S. 37/38 und 40–42) als eine Art historisch sedimentierte Assemblage verschiedener medialer Elemente. Von einer anderen, aber sowohl an medientheoretische wie artefaktualistische Perspektiven anschließbaren Position, nämlich der der Akteur-Netzwerk-Theorie, schrieb Bruno Latour (Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft, Frankfurt a.M.: Suhr-kamp 2007, S. 246): »Mit Akteur-Netzwerk beschreibt man etwas, das überhaupt nicht wie ein Netzwerk aus-sieht – einen momentanen Geisteszustand, ein Stück Maschine, einen fiktionalen Charakter.« Einen fiktionalen Charakter als ein Akteur-Netzwerk zu beschreiben hieße also ihn als historisch sich entfaltende Verkettung me-dialer Artefakte – aber auch menschlicher Performanzen (z. B. Fan Fiction, vgl. u. a. Rebecca W. Black, Adole-scents and Online Fan Fiction, New York: Lang 2008, oder verkleidetes Auftreten auf Fan-Partys etc.) zu be-schreiben, eben als ein – wie Latour sagen würde – Netzwerk menschlicher und nicht-menschlicher Akteure.
10
den Rezensionen unter anderen bemängelt, dass das extrem scharfe und klare Bild
der Fiktionsbildung abträglich sei.31
• Historische Sedimentation: Die transmediale Dispersion und Zirkulation von fikti-
ven Entitäten verweist auf die historische Sedimentation von Fiktionen: So wird
meine obige Diskussion des Bilds von ›James Bond‹ einen Hardcore-Scrutonianer
wohl nicht überzeugen (daher habe ich es ›etwas unglücklich‹ genannt). Denn ge-
rade das Sean Connery/James Bond-Bild erfüllt ja Scrutons Kriterium, dass die fik-
tionale Inszenierung auf der prä-fotografischen Ebene statthat. Der Anzug, die ge-
gelten Haare, das selbstbewusste Lächeln und v.a. die Waffe, die zugleich ein biss-
chen Körperkontakt hat (und somit vielleicht auf das hübsche Bond-Girl voraus-
verweist), markieren dieses Bild eindeutig als Bond-Bild und nicht als Bild-von-
Connery. Historisch hat sich eine intermediale Ikonographie ausgebildet, die die
Konstruktion fiktiver Identität massiv erleichtert. Ist eine solche Ikonographie
etabliert, kann auch ohne weitere sprachliche Hinweise ein solches Bild als Bond-
Bild erkannt werden. Man könnte Abb. 1 einem Publikum vorlegen und auch ohne
weiteren Hinweis würde eine Mehrheit sicher das Bild als Bond-Bild identifizie-
ren. In Abbildung 2 sieht man ein Bild, das auf rein bildlicher Ebene auch ein Bild
des Privatmanns Sean Connery sein könnte. Die Bildunterschrift macht das Bild
aber mindestens auch als Bond-Bild lesbar und knüpft daran die in den Filmen,
soweit mir bekannt ist, in der Regel wenig beachtete Frage, was Bond lese.
Abbildung 2
Connery war nicht immer Bond, aber wenn diese Verbindung einmal etabliert ist,
wird es schwer sie wieder aufzutrennen.32 Dass auf diese Weise fiktive Entitäten
historisch entstehen, sich sedimentieren und so stabilisieren – aber auch wieder
verschwinden können, wenn z. B. alle Aufzeichnungen und Erinnerungen an sie
verschwänden, ist ein weiteres zentrales Argument des artefaktualistischen Ansat-
zes.33 Dass Connery-Bilder aber nicht immer auch Bond-Bilder haben sein können,
zeigt überdies, dass Scrutons Argument im Grunde tautologisch ist. Denn Scruton
31 http://www.newyorker.com/arts/critics/cinema/2012/12/17/121217crci_cinema_lane?currentPage=2, 06.05.13. 32 Solche stabilisierten Identifikationen erklären, warum Leonard Nimoy dereinst ein fast verzweifeltes Buch mit dem Titel »Ich bin nicht Spock« geschrieben hat. 33 Vgl. Thomasson, Fiction and Metaphysics (Anm. 29), S. 10/11.
11
spricht gar nicht über die Rekontextualisierung eines nicht-fiktionalen Fotos: Er
beschreibt, wie eine (über Kostüme, Dekor etc.) fiktionalisierte Szene fotografiert
wird, um dann zu argumentieren, dass die prä-fotografische Szene fiktionalisiert
sei und ergo nicht das Foto selbst. Das beweist nicht, dass es nicht möglich, ist
auch ein Foto einer nicht-fiktionalisierten Szene kontextuell zu fiktionalisieren.
• Grenzen der Sedimentation: Die historische Stabilisierung des Connery/Bond-
Clusters bedeutet nicht, dass jedes Connery-Bild nun (leicht) als Bond-Bild lesbar
ist. Sucht man nach Abbildungen von Sean Connery bei Google, bekommt man,
neben zahlreichen Bond-Bildern auch solche Bilder (Abbildung 3a, b).
Abbildung 3a, b
Eines ist ein Zed- oder Zardoz-Bild, also eine fiktionale Darstellung, die Connery
in der Rolle des Zed in dem ökotopischen Science Fiction-Film Zardoz (GB 1974,
R.: John Boorman) zeigt, das andere ein Bild des mittlerweile gealterten Privat-
manns Sean Connery. Beide würden kaum oder nur mit Mühe als Bond-Bild
durchgehen, wenn man »007 besticht wie immer durch seine Eleganz« daneben
schriebe. Das Zardoz-Bild nicht, eben weil die Kostümierung mit dem Wissen über
Bond-Repräsentationen kollidiert, das Connery-Bild nicht, weil Bond-
Repräsentationen in der Regel einen jüngeren Mann, sei’s Bond, sei’s Connery,
zeigen. Beide könnten aber dennoch als ironische und/oder metaphorische Bezug-
nahme auf Bond gebraucht werden – wie es hier gerade eben durchgeführt wurde.
• Aufhebbarkeit des Fiktionalen: Schließlich gilt, dass auch die stabilisierten fiktio-
nalen Zuschreibungen wieder aufgebrochen werden können. So gilt auch, dass je-
des Bond-Bild z. B. nicht als Repräsentation von ›James Bond‹, also als fiktional,
sondern gerade dokumentarisch als Ausweis eines historisch spezifischen Bond-
Darstellungsstils verstanden werden kann. Dies ist keineswegs abwegig, sondern
kann die ganz alltägliche Beschäftigung von Film- und Medienwissenschaftlern
sein. Wieder hängt es an der Be-Schriftung der Bilder, z. B. in wissenschaftlichen
Aufsätzen (wie hier). Das gilt ebenso für Texte: Jeder noch so fiktional intendierte
Text kann selbstverständlich nicht-fiktional behandelt werden, z. B. als ein litera-
turhistorisches Dokument – wie etwa in der Literaturwissenschaft.
12
Es sollte deutlich geworden sein, dass die Möglichkeit der Fiktion nicht durch die medien-
technische Eigenschaft der indexikalischen Aufzeichnung prinzipiell limitiert wird.
$Ü$ Fiktionalität des Digitalen?
Jetzt kommen wir zu der schon erwähnten Möglichkeit, dass es Medien oder mediale Pro-
zeduren geben könnte, die umgekehrt immer Fiktionen hervorbringen. Auch das wäre,
wenn auch umgekehrt, ein Argument gegen den pragmatischen (und wenn man so will:
performativen) und historischen Charakter des Fiktionalen (was dieses auch sonst sei).
Wieder wäre es eine mediale Ontologie, die a priori zur Fiktionalität zwingen würde. Die
Annahme, es gäbe eine solche a priori fiktionalisierende mediale Ontologie, war insbe-
sondere beim Aufkommen der digitalen Medien zu beobachten. So hat z. B. Geoffrey
Batchen bemerkt: »The main difference seems to be that, whereas photography still
claims some sort of objectivity, digital imaging is an overtly fictional process.«34 Damit ist
gemeint – ein zentraler Topos der Diskussion um digitale Fotografie der frühen 1990er
Jahre –, dass man digitalen Bildern, anders als den analogen Fotografien, nicht trauen
könne, da digitale Bilder soviel leichter zu manipulieren seien. Mit den nur fotografisch
aussehenden digitalen Bildern – wobei oft digitalisierte und digital generierte Bilder ver-
mischt wurden – schien eine Ära der ›referenzlosen Simulation‹35 und ihrer Bilder zu be-
ginnen. Daher schien sich offenbar die Frage nach Wahrheit oder Fiktionalität gar nicht
mehr zu stellen – bzw. im Sinne einer Fiktionalisierung der ganzen Welt vorentschieden
zu sein.36 Diese Thesen sind in gleich mehrfacher Hinsicht problematisch:
(i) Zunächst (und eigentlich reicht das als Gegenargument schon) unterstellte die Debatte
der 1990er Jahre bzgl. digitaler Bilder oft, dass die Absicht (durch Bild-Manipulationen
z. B.) zu täuschen, dasselbe sei wie fiktional zu repräsentieren. Doch Fiktionen werden
34 Geoffrey Batchen, »Ectoplasm. Photography in the Digital Age«, in: Carol Squiers (Hg.): Over Exposed. Es-says on Contemporary Photography, New York: New York Press 2000, S. 9–23, hier S. 15. 35 Kritisch dazu: Jochen Venus, Referenzlose Simulation?, Würzburg: Könighausen & Neumann 1997. 36 In diesem Sinne schreibt Batchen, »Ectoplasm« (Anm. 34) auf S. 10: »[W]e are entering a time when it will no longer be possible to tell any original from its simulations.« Hier steht der ›irrealistische‹ Simulationsbegriff Jean Baudrillards (siehe Abschnitt IV) im Hintergrund. Eine konzise Darstellung der Debatte zum Fiktionsbe-griff vor dem Hintergrund dieser in den 1980er und 1990er Jahren starken baudrillardschen Tendenz zur ›Panfik-tionalisierung‹ liefert K. Ludwig Pfeiffer, »Zum systematischen Stand der Fiktionstheorie«, in: ders.: Von der Materialität der Kommunikation zur Medienanthropologie. Aufsätze zur Methodologie der Literatur- und Kul-turwissenschaften 1977-2009. Hg. v. Ingo Berensmeyer und Nicola Glaubitz. Heidelberg: Winter 2009, S. 87–108. Vgl. auch Aleida Assmann, »Fiktion als Differenz«, in: Poetica 21 (1989), S. 239–260.
13
nicht mit der Absicht zu täuschen hergestellt, worauf u. a. Searle verwiesen hat.37 Viel-
mehr befindet sich fiktionale Repräsentation jenseits der Unterscheidung wahr/falsch.
Noch ein Beispiel aus der Diskussion zu digitalen Bildern: Martina Heßler schrieb (erneut
unter Bezug auf den Begriff der ›Simulation‹):
$Z$ Die grundlegende Frage ist die nach der Geltung der Bilder sowie nach der
Differenz zwischen Fiktionalität und Indexikalität. Allerdings scheinen auch hier
Differenzierungen hilfreich. Die Spannbreite von Simulationen, ihr jeweiliges
Verhältnis von Indexikalität und Fiktionalität, erweist sich als komplizierter. Neh-
men wir das Beispiel der Archäologie oder der Kunstgeschichte, die Gebäude oder
gar ganze Städte simulieren und damit wiedererstehen lassen, obgleich sie zuwei-
len nur auf einem rudimentären Datengerüst basieren. Diesen Simulationen liegen
damit Daten und empirische Kenntnisse, beispielsweise aufgrund von Ausgrabun-
gen, zugrunde, während Lücken des Nichtwissens visuell gefüllt werden. Imagina-
tion und Analogieschlüsse, Annahmen und Theorien sind dabei das Material, mit
dem die visuellen Lücken gefüllt werden. [...] [D]ie entscheidende Frage ist viel-
mehr, wie sich das Verhältnis von Indexikalischem, von den Bildern vorgängigen
Daten und Fiktionalität darstellt. Auf der einen Seite implizieren Simulationen
zwar empirische Daten, doch ist ihr fiktionaler Anteil zum Teil erheblich. Umge-
kehrt fließen gerade in den von Schröter genannten CCD-Bildern der Astronomie,
die Licht in elektrische Ladung umwandeln und damit auf realen Daten basieren,
also indexikalisch sind, gleichfalls zu einem nicht unerheblichen Teil abstrakte,
theoretische Modelle der Astronomie ein. In einer populärwissenschaftlichen Ast-
ronomie-Zeitschrift wurde dies gewissermaßen implizit thematisiert, indem eine
bearbeitete CCD-Aufnahme kommentiert wurde mit: ›So könnte es aussehen‹.38
37 Vgl. John R. Searle, »The Logical Status of Fictional Discourse«, in: New Literary History, 6 (1975), S. 319–332. 38 Martina Heßler, »Von der doppelten Unsichtbarkeit digitaler Bilder«, http://www.zeitenblicke.de/2006/3/Hessler, 02.05.13. Sie bezieht sich auf Jens Schröter, »Das Ende der Welt. Analoge vs. digitale Bilder – mehr und weniger ›Realität‹«? in: ders. / Alexander Böhnke (Hg.): Analog / Digital – Opposition oder Kontinuum? Zur Theorie und Geschichte einer Unterscheidung, Bielefeld: transcript 2004, S. 335–354, zum CCD (den ›Charge Coupled Devices‹, den Sensoren, die im Prinzip allen heutigen digitalen Foto-vorrichtungen zugrunde liegen) dort S. 343–345.
14
Es wäre ein eigener Artikel notwendig, um das Verhältnis von Modellen und Fiktionen
detaillierter zu diskutieren.39 Allerdings ist es, im Einklang mit manchen Positionen aus
der Wissenschaftstheorie40, problematisch, Modelle mit Fiktionen gleichzusetzen und
zwar aus einem einfachen Grund: Es ergibt schlicht keinen Sinn zu sagen: ›Was Arthur
Conan Doyle geschrieben hat, ist falsch, denn es gibt gar keinen Sherlock Holmes‹. Eine
Fiktion hat nicht den Anspruch eine (zumindest zeitlich vorübergehend) gültige Beschrei-
bung der Wirklichkeit zu sein (auch wenn Fiktionen unter bestimmten Umständen so ver-
standen werden können) – ein Modell schon, weswegen z. B. die Vorhersagen von Model-
len in der theoretischen Physik durch immens teure Beschleunigertechnologien am empi-
rischen Datenmaterial geprüft und ggf. falsifiziert werden. Und auch der von Heßler er-
wähnte Astronom, der vermutet, dass ›es so aussehen könnte‹, müsste ggf. im Lichte an-
dersartiger Belege diese Annahme zurücknehmen, ja er würde sie gar nicht machen, wenn
er nicht annähme, sie könnte nicht bestätigt oder widerlegt werden.41 Daher kann man
nicht sagen, dass Modelle, die in der digitalen Bildgenerierung zum Einsatz kommen, die
Bilder fiktionalisieren. Simulationen, sofern man sie als dynamische und ggf. interaktive
Modelle (im Sinne von Licklider) versteht, sind nicht per se fiktional (s. Abschnitt IV).
(ii) Unabhängig von der systematischen Beobachtung, dass Fiktionen und Unwahrheit
nicht dasselbe sind, ist es sachlich und historisch schlicht falsch, dass digitale Bildbearbei-
tung wesentlich zur Produktion von Täuschungen verwendet worden ist. Ihr früher militä-
39 Vgl. Mauricio Suárez (Hg.), Fictions in Science. Philosophical Essays on Modeling and Idealization, New York: Routledge 2009. 40 Vgl. v. a. Ronald N. Giere, »Why Scientific Models Should not be Regarded as Works of Fiction«, in: Suárez (Hg.), Fictions in Science (Anm. 39), S. 248–258. Vgl. auch Bernd Mahr, »Cargo. Zum Verhältnis von Bild und Modell«, in: Ingeborg Reichle / Steffen Siegel / Achim Spelten (Hg.): Visuelle Modelle, München: Fink 2008, S. 17–40. 41 Heßler spielt möglicherweise darauf an, dass Bilder in der Astronomie oft in beliebig gewählten Falschfarben koloriert werden, um erstens den Bildern eine deutlichere Binnenstruktur zu verleihen und/oder um sie zweitens für eine massenmediale Vermittlung attraktiver zu machen. Obwohl diese Kolorierungen sich nicht immer auf Modelle im engeren Sinne stützen, sind sie dennoch kaum als Fiktionen beschreibbar. Im ersten Fall dienen sie erneut der Verbesserung der referentiellen Vermittlung, im zweiten Fall sind sie zwar insofern fiktional, als sie Vorstellungen über die bunte Erscheinung von Planeten oder Ähnlichem verbreiten, die sich nicht mit der Wirk-lichkeit decken mögen (wiewohl die Falschfarben oft einfach farbige Repräsentationen real existierender, aber für menschliche Augen unsichtbarer Strahlung sind), aber auch ein unnatürlich buntes Bild des Planeten Jupiter bezeichnet ein real existierendes Objekt (nämlich den Planeten Jupiter) und nicht vielmehr eine nicht existente Entität (wie das bei Fiktionen der Fall ist) – es gibt Bond nicht in dem Sinne, in dem es Jupiter gibt.
15
rischer und wissenschaftlicher Einsatz war genau gegenteilig. Es sollte mehr – wenn man
so will: nicht-fiktionale – Referenz produziert werden.42
(iii) Aber selbst wenn man die ersten beiden Einwände nicht berücksichtigt, haben die
Überlegungen in Abschnitt II gezeigt, dass auch analoge und chemische Fotos je nach
Kontext durchaus verschiedenes bezeichnen können, sie sind nicht qua ihres analogen und
indexikalischen Charakters auf eine ›objektive‹ Darstellung eines Sachverhaltes festge-
legt, auch wenn sie z. B. in der Wissenschaft, in der Kriminalistik, in der Medizin, aber
auch in der Familienfotografie so genutzt werden können. Man kann analoge Spuren ›fik-
tional‹ oder dokumentarisch nutzen.43 Es ist in keiner Weise zu sehen, warum sich dies
mit der Art der Aufzeichnung ändern sollte. Wie schon bemerkt, kann das auch nicht
überraschen: Walton zumindest argumentiert ja, dass man die Funktionsweise von Fiktio-
nen als ›games of make-believe‹ verstehen kann und illustriert dies z. B. mit Kinderspie-
len, in denen etwa Matschhaufen – fiktional – als Kuchen verstanden werden. Wenn das
geht, wieso sollten technische Bilder, gleich ob analog oder digital, nicht als ›props‹ in
›games of make believe‹ verwendet werden können?
$Ü$ ›Fiktion‹ und ›Simulation‹ im Diskurs der Medientheorie
42 Vgl. Schröter, »Das Ende der Welt« (Anm. 38) und Jens Schröter, »Gestaltung und Referenz in analoger und digitaler Fotografie«, in: Claudia Mareis / Christof Windgätter (Hg.): Long Lost Friends. Wechselbeziehungen zwischen Design-, Medien- und Wissenschaftsforschung, Berlin: diaphanes 2013, S. 63–76. 43 Vgl. dazu, dass auch die Nutzung eines Fotos als Spur eines Realen eine Nutzung, mithin nicht die unumgäng-liche Ontologie des fotografischen Bildes ist, Martin Lefebvre, »The Art of Pointing: On Peirce, Indexicality, and Photographic Images«, in: James Elkins (Hg.): Photography Theory, New York: Routledge 2007, S. 220–244, hier S. 222: »Yet indexicality only becomes important when a sign (a photograph) is interpreted in such a way that its epistemic value is understood to rely chiefly on its existential connection to what it stands for.« Dies zu sagen bedeutet keineswegs den indexikalischen Aspekt der chemischen wie quantenelektronischen Fotografie in Frage zu stellen. Das Foto ist und bleibt (auch) eine Spur eines Objekts oder Ereignisses. Doch dass ein gege-benes Foto eine Spur ist, bedeutet noch nicht, dass BetrachterInnen verstehen, was das Foto zeigt, ja nicht ein-mal, dass es als Spur verstanden wird. Oft sind Bildbeschriftungen oder andere Ergänzungen (z. B. der rote Kreis des investigativen Journalismus) vonnöten, um zu verstehen, auf was die fotografierte Spur verweist. Dies kann auch am Einsatz der Fotografie in Naturwissenschaften gesehen werden. Das Foto wird dort verwendet, weil es tatsächlich eine Spur eines realen Objekts oder Ereignisses festhält, nichtsdestotrotz benötigt das Foto Interpretation, um verstanden werden zu können. Vgl. z. B. zu ›Reading Regimes‹ von Fotografien in der Ge-schichte der Teilchenphysik Peter Galison, Image and Logic. A Material Culture of Microphysics, Chicago: Chicago University Press 1997, S. 370–384. Walton, Mimesis as Make-Believe (Anm. 10), S. 351 behauptet, dass Bilder per se fiktional seien, auch und gerade, wenn sie in nicht-fiktionalen Praktiken eingesetzt würden. Mir scheint die Behauptung, eine nicht-fiktionale Verwendung von Bildern sei eine andere Form von Fiktionali-tät, eine unplausible Einebnung einer notwendigen Differenz zu sein. Vgl. kritisch dazu Ryan, »Fiktion, Kogni-tion und nichtverbale Medien« (Anm. 7), S. 80.
16
Wenn aber Fiktionalität eine Eigenschaft ist, die sich nicht auf mediale Ontologien zu-
rückführen lässt44 als vielmehr von transmedialen Praktiken (wie z. B. ›games of make-
believe‹) produziert wird, welche Rolle kann Fiktionalität dann in einer Medientheorie
überhaupt haben? Bei Winkler war es Fiktionalität, die den Bereich der Medien von ei-
nem nicht- oder außermedialen Bereich abtrennte. Das scheint auch nachvollziehbar zu
sein, aber nur unter der Bedingung, dass man auch (und wohl zuallererst) sprachliche
Vollzüge dazurechnet – was zwar nicht bedeutet, dass es keinen außermedialen Raum
geben kann, aber dass eine klare Separierung fiktionstauglicher von fiktionsfreien Berei-
chen, wie in Winklers Gegenüberstellung der Theaterbühne zu einem Außen, nicht mehr
möglich ist.
Im Grunde scheint hier eine basalere Frage durch, nämlich die nach der wirklichkeitskon-
stitutiven Kraft von Medien. Eben weil Medien nicht einfach transparent etwas vermitteln
(wären sie bloß transparent, würde eine Beschäftigung mit ihnen nicht lohnen), sondern
dabei auch konstituieren45, stellte und stellt sich immer wieder die Frage, wie man diese
Konstitutionsleistung beschreiben soll. Mit dem Hinweis auf das Probehandeln hat
Winkler unterstrichen, dass Medien einen Abstand zur Welt erzeugen, der aber u. a. auch
eine Vorbereitung auf die Welt erlaubt (eben im Sinne des ›Ausprobierens‹). Da das Pro-
behandeln dem Handeln vorhergeht, ist es konstitutiv für letzteres. Das Handeln wäre oh-
44 Dass Fiktionalität nicht von medialen Ontologien abhängt, heißt aber nicht, dass mediale Differenzen gar keine Rolle spielen für die Möglichkeit des Fiktionalen. So bemerkt Monika Fludernik, Towards a ›Natural‹ Narratology, London / New York: Routledge 1996, S. 39: »Fictionality typically surfaces in narrative form (in-cluding narrative poetry, drama and film); it is not generally employed to define poetry, sculpture or music, and in painting is restricted to specifically narrative representations.« In der Regel ist Fiktion mit dem Prozess der Narration verbunden und zwar deswegen, weil in diesem Prozess Schritt für Schritt Annahmen über den referen-tiellen Status der präsentierten Objekte und ihre Eigenschaften gebildet, bestätigt oder verworfen werden kön-nen. Für ein selbst temporal nicht ausgedehntes Gebilde wie ein Gemälde oder eben ein Foto ist dieser Prozess schwieriger herstellbar. D. h. die bekanntlich schon von Lessing in etwas anderer Hinsicht eingeführte Differenz von tendenziell sukzessiven oder sukzessiv wahrzunehmenden Darstellungen von solchen, die ihr Material eher simultan präsentieren – das kann nur eine graduelle Differenz sein – spielt hinsichtlich der zeitlichen Entfaltung der Fiktionalisierung eine Rolle. Wie das Bond-Beispiel oben aber zeigt: Ist einmal eine fiktionale Semantik sedimentiert (z. B. durch Filme), sind auch Einzelbilder leichter fiktionalisierbar. Branigan, Narrative Compre-hension and Film (Anm. 26), S. 1 bemerkt, dass es auch nicht-narrative Fiktionen wie »lyric poetry« gibt. Ob ein Gedicht aber nicht-narrativ ist bzw. ob es überhaupt unter die Unterscheidung fiktional/nicht-fiktional fällt, ist eine schwierige Frage, die ich Spezialisten überlasse. Im Regelfall sind Fiktionen jedenfalls narrativ. 45 Exemplarisch: Sybille Krämer, »Das Medium als Spur und als Apparat«, in: dies (Hg.): Medien Computer Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue Medien, Frankfurt a.M. 1998, S. 73–94, hier S. 73 hat bemerkt, dass sich in der »Vielfalt medienbezogenen Forschens [...] ein gemeinsamer Nenner« herauskristallisiere: »Es ist dies die Überzeugung, dass Medien nicht nur der Übermittlung der Botschaften dienen, vielmehr am Gehalt der Botschaften [...] selbst beteiligt sein müssen.« Wie ist das gemeint? Es geht nicht allein darum, dass Medien etwas hervorbringen, was es ohne sie nicht gibt (z. B. eine fiktive Figur) – denn auch in funktionalen Verwen-dungen macht ein Medium etwas anderes und zugleich sich selbst vorstellig: Ein Foto des Großvaters zeigt den Großvater und zugleich, dass das Sichtbare des Großvaters ohne den leibhaftigen Großvater (verkleinert, s/w etc. pp.) an einem anderen Ort erscheinen kann, also sich selbst.
17
ne seine ›fiktive‹ Antizipation nicht durchführbar. Das mag nicht für jedes Handeln gel-
ten, für komplexere Vollzüge aber durchaus. Bemerkenswerterweise hat Dieter Weller-
shoff schon 1969 zur Literatur bemerkt:
$Z$ Literatur ist in meinem Verständnis eine Simulationstechnik. Der Begriff ist in
letzter Zeit populär geworden durch die Raumfahrt, deren vollkommen neuartige
Situationen, der praktischen Erfahrung vorauslaufend, zunächst künstlich erzeugt
und durchgespielt werden. Die Astronauten [...] lernen an Geräten, die die realen
Bedingungen fingieren, das heißt, ohne um den Preis von Leben und Tod schon
zum Erfolg genötigt zu sein. Das ist, wie mir scheint, eine einleuchtende Analogie
zur Literatur. Auch sie ist ein der Lebenspraxis beigeordneter Simulationsraum,
Spielfeld für ein fiktives Handeln, in dem man als Autor und als Leser die Grenzen
seiner praktischen Erfahrungen und Routinen überschreitet, ohne ein wirkliches
Risiko einzugehen.46
Auch wenn dies Winklers Beschreibung des Probehandelns als zentraler Möglichkeit der
Medien sehr nahe zu kommen scheint, benutzt er neben ›fingieren‹ und ›fiktiv‹ noch einen
anderen Begriff, der eben schon bei der Diskussion der digitalen Medien auftauchte, näm-
lich den der Simulation. Wellershoffs Text heißt bereits »Fiktion und Praxis«, d. h. bei
Wellershoff werden Fiktion und Simulation im Sinne eines Probehandelns parallelisiert.
Der Begriff der ›Simulation‹ hat in der im weiteren Sinne medienwissenschaftlichen Dis-
kussion vor allem der 1990er Jahre eine bedeutende Rolle gespielt und wird heute in ver-
änderter Weise wieder aufgegriffen.47 Ganz knapp könnte man sagen, dass im Anschluss
an die Verwendung des Simulationsbegriffs bei Baudrillard zunächst eine (sagen wir: ›ir-
realistische‹) Bedeutung dominierte, in der Simulation als eine Art ›referenzloses‹ Spiel
von (z. B. massenmedialen) Zeichen, das an die Stelle der ›Realität‹ tritt, verstanden wur-
de. Diese Bestimmung des Simulationsbegriffs wurde rasch kritisiert, sowohl hinsichtlich
seiner inneren Stimmigkeit als auch bezüglich der empirischen Validität.48 Dabei wäre ein
46 Dieter Wellershoff, »Fiktion und Praxis«, in: ders., Werke, Bd. 4, Köln: Kiepenheuer & Witsch 1997, S. 202–217, hier S. 210. Mit Dank an Nicola Glaubitz. 47 Vgl. zur langen und komplizierten Begriffsgeschichte von ›Simulation‹, die sich letztlich immer um die beiden hier nur ganz verkürzt aufgegriffenen Pole dreht, Bernhard Dotzler, »Simulation«, in: Karlheinz Barck (Hg.): Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, Band 5, Stuttgart: Metzler 2003, S. 509–533. 48 Neben Venus, Referenzlose Simulation? (Anm. 35), siehe Lorenz Engell, Das Gespenst der Simulation. Ein Beitrag zur Überwindung der »Medientheorie« durch Analyse ihrer Logik und Ästhetik, Weimar: VDG 1994.
18
solcher ›referenzloser‹ Begriff von Simulation noch vergleichsweise nah an der Bestim-
mung von Fiktionen, insofern man z. B. mit ›James Bond‹ zwar alle möglichen Zeichen-
und Bildspiele spielen kann, obwohl ›James Bond‹ strenggenommen auf keinen realwelt-
lichen Referenten verweist – und immerhin gibt es Fiktionstheorien, die ausdrücklich eine
›Reference without Referents‹ in den Mittelpunkt stellen.49 So schienen sich hier Fiktion
und Simulation sehr nahe zu kommen.50
Mit der Zeit setzte sich eine andere (sagen wir: ›realistische‹) Version des Simulationsbe-
griffs durch, die mehr auf die tatsächlichen Anwendungen von Simulationen in den Wis-
senschaften, aber auch in Militär und Medizin abstellten, v. a. in der Form – womit wir
wieder bei den digitalen Medien wären – der Computersimulation.51 Diese Simulationen
haben gerade nicht das Ziel, irgendwie ein leeres Trugbild zu errichten, vielmehr sind es
dynamische Modelle52, die auf der Basis von empirischen Daten über zu modellierende
Phänomene errichtet sind. Heßlers oben zitierte Wendung – »Auf der einen Seite implizie-
ren Simulationen zwar empirische Daten, doch ist ihr fiktionaler Anteil zum Teil erheb-
lich« – geht genau in diese Richtung. Was sie hier mit ›fiktionalem Anteil‹ meint, sind die
unvermeidlichen Zusatzannahmen und Idealisierungen bzw. gezielten Filterungen bzw.
Selektionen der Daten, die vorgenommen werden müssen, um das Modell zu konstruie-
ren. Wie oben schon bemerkt, sind solche Modellannahmen aber etwas anderes als Fikti-
onen, denn Modellannahmen können und müssen per Definition im Prinzip falsifizierbar
sein (wenn das Modell Unsinn vorhersagt, was sich durch empirische Prüfungen heraus-
finden lässt, dann könnten die Annahmen falsch sein), was für Fiktionen gerade nicht gilt. 49 Vgl. Sainsbury, Reference without Referents (Anm. 24). 50 Vgl. Jean Baudrillard, »Die Präzession der Simulakra«, in: ders., Agonie des Realen, Berlin: Merve 1978, S. 7–69, hier S. 10: »Dissimulieren heißt fingieren, etwas, das man hat, nicht zu haben. Simulieren heißt fingieren, etwas zu haben, was man nicht hat. Das eine verweist auf eine Präsenz, das andere auf eine Absenz. Doch die Sache ist noch komplizierter, denn simulieren ist nicht gleich fingieren: ›Jemand, der eine Krankheit fingiert, kann sich einfach ins Bett legen und den Anschein erwecken, er sei krank. Jemand, der eine Krankheit simuliert, erzeugt an sich einige Symptome dieser Krankheit‹ (so das Wörterbuch von Littré). Beim Fingieren oder Dissi-mulieren wird also das Realitätsprinzip nicht angetastet: die Differenz ist stets klar, sie erhält lediglich eine Mas-ke. Dagegen stellt die Simulation die Differenz zwischen ›Wahrem‹ und ›Falschem‹, ›Realem‹ und ›Imaginä-rem‹ immer wieder in Frage.« Diese Passage suggeriert also zunächst eine Nähe von Simulieren und Fingieren, um sie dann zu widerrufen – mit dem merkwürdigen und wenig einleuchtenden Beispiel des Unterschieds der Vortäuschung einer Krankheit durch die ›Erweckung des Anscheins‹ vs. ›Erzeugung von Symptomen‹. 51 Vgl. zur Computersimulation Jens Schröter, »Computer/Simulation. Kopie ohne Original oder das Original kontrollierende Kopie«, in: Gisela Fehrmann / Erika Linz / Eckhard Schumacher / Brigitte Weingart (Hg.): Ori-ginalKopie – Praktiken des Sekundären, Köln: Dumont 2004, S. 139–155 und näherhin zur Bedeutung in den Naturwissenschaften Gabriele Gramelsberger (Hg.), From Science to Computational Sciences. Studies in the History of Computing and its Influence on Today’s Sciences, Zürich: diaphanes 2009. Aktuell wird die Compu-tersimulation im DFG-Forscherkolleg »Medienkulturen der Computersimulation« an der Universität Lüneburg erforscht, siehe: http://mecs.leuphana.de/, 06.05.13. 52 Vgl. J. C. R. Licklider, »Interactive Dynamic Modeling«, in: George Shapiro / Milton Rogers (Hg.): Prospects for Simulation and Simulators of Dynamic Systems, New York / London: Spartan Books 1967, S. 281–289.
19
Simulationen in diesem Sinne sind etwas dezidiert anderes als Fiktionen (s. u.)53 – man
könnte sich sogar den Fall vorstellen, dass Simulationen wiederum in ›games-of-make-
believe‹ fiktional gebraucht werden (was eben zeigt, dass sie nicht immer fiktional sind):
Das ist sogar ganz alltäglich im kommerziellen Kino, wenn ›realistische‹ Simulationen
fotografischer Bildlichkeit54, die auf einem auf empirischen Daten basierten Modell der
Fotografie basieren, genutzt werden, um fotorealistisch erscheinende fiktionale Entitäten
(Monster, Aliens, Raumschiffe, Architekturen, Landschaften etc. pp.) zu erschaffen.
Bemerkenswerterweise hat 1989 niemand geringeres als Friedrich Kittler einen Text mit
dem Titel »Fiktion und Simulation« veröffentlicht. Ziel des Textes ist »das Neue an der
technischen Datenverarbeitung durch ihre Abgrenzung von hergebrachten Künsten zu
umschreiben.«55 Dabei geht es nicht darum, in traditioneller Weise Kunst gegen Technik
auszuspielen – alle vorherigen Künste waren auch schon Techniken56 –, sondern darum,
»welche Techniken historisch und ästhetisch an der Stelle gestanden haben, die heute
durch Elektronik besetzt wird.«57 Die Technik, die an der Stelle, die nun von der ›Elektro-
nik‹ besetzt wird, gestanden hat, wird einen Satz später benannt: »Künste hießen mithin
ein Maximum dessen, was unter Bedingungen eines alltagssprachlichen Codes machbar
war.« Die hergebrachten Künste scheinen also fundamental von einem ›alltagssprachli-
chen Code‹ geprägt zu sein – diese Bevorzugung der Sprache vor dem Bild in Hinsicht
auf die ›hergebrachten Künste‹ (als ob es keine Malerei gegeben hätte58) setzt sich auch
im Rest des Textes fort. Die Differenz ›neue technische Datenverarbeitung‹ vs. ›herge-
brachte Künste‹ entspricht der Differenz Simulation vs. Fiktion: »Dann schlagen Manipu-
lationen an einem Code auf die Seele von Lesern und Hörern durch, dann ist das Maxi-
mum ästhetischer Machbarkeit erreicht. Es verdient den Titel Fiktion, wie umgekehrt das
Maximum datenverarbeitender Manipulation (mit Baudrillard) den Titel Simulation ver-
53 Die bedeutenden operativen Funktionen digitaler Medien und insbesondere digitaler Simulationen werden durch die Einschätzung digitaler Medien und Simulationen als ursprünglich fiktional sogar verdeckt und sind insofern ideologisch. Die eigentliche Macht digitaler Medien und Simulationen liegt weit weniger in ihrem Po-tential zur Täuschung als in dem der Kontrolle. 54 Vgl. z. B. zur Simulation von Kamera und Bewegungsunschärfe Michael Potmesil / Indranil Chakravarty, »Synthetic Image Generation with a Lens and Aperture Camera Model«, in: ACM Transactions on Graphics, 1.2 (1982), S. 85–108; dies., »Modeling Motion Blur in Computer-Generated Images“, in: SIGGRAPH Proceedings (1983) (= Computer Graphics, 17.3), S. 389–399. 55 Friedrich Kittler, »Fiktion und Simulation«, in: ARS ELECTRONICA (Hg.): Philosophien der neuen Techno-logie, Berlin: Merve 1989, S. 57–79, hier S. 58. 56 Vgl. auch Friedrich Kittler, Kunst und Technik, Basel: Stroemfeld 1997. 57 Kittler, »Fiktion und Simulation« (Anm. 55), S. 58. 58 Was Kittler natürlich selber besser weiß, vgl. Friedrich Kittler, Optische Medien. Berliner Vorlesungen 1999, Berlin: Merve 2001.
20
dient.«59 Fiktion wird von Kittler also ganz eindeutig als »alphabetische[...] Fiktion[...]«60
verstanden. Es geht darum, dass fiktionale Literatur LeserInnen anhält, »Manipulationen
im Symbolischen als sinnliche Daten zu halluzinieren«61 – also beim Lesen sich allerlei
fiktionale »Figuren«62 und Ähnliches vorzustellen, den Text als Tor zu einer fiktionalen
Welt zu gebrauchen. Dies steht im Einklang mit einer zentralen These aus Kittlers 1985
erschienener Habilitationsschrift Aufschreibesysteme 1800 1900, in der als ein Effekt des
Aufschreibesystems 1800 beschrieben wird, dass die »Alphabetisierung alle Möglichkei-
ten [versperrte], Zeichenbedeutungen zu negieren, bis die Fiktion eine wirkliche sichtbare
Welt nach den Worten entließ.«63 Das Aufschreibesystem 1900 wird hingegen durch die
technischen Medien bestimmt, die am Verstand und Bewusstsein vorbei Daten aufzeich-
nen können (wie z. B. das Grammophon64). Diese Opposition wird 1989 von Kittler in
»Fiktion und Simulation« auf den Gegensatz eben von Fiktion und Simulation abgebildet.
Daher kann Kittler die Simulation (obwohl das heute naheliegt) nicht auf die digitalen
Medien beschränken: »Simulationen starteten bescheiden – in den Analogmedien der
Jahrhundertwende.«65 Im Grunde will Kittler darauf hinaus, dass das, was er Simulation
nennt, auf »Abtastungen«66, also auf empirischen Daten des Realen beruht. Hier steht –
trotz der anfänglichen Referenz auf Baudrillard und eine zunächst eindeutig ›irrealisti-
sche‹ Bestimmung der Simulation: »Unter Computerbedingungen wird es also machbar,
maschinell zu affirmieren, was nicht ist: Siegeszug der Simulation«67 – ein ›realistisches‹
59 Kittler, »Fiktion und Simulation« (Anm. 55), S. 60. 60 Kittler, »Fiktion und Simulation« (Anm. 55), S. 76. 61 Kittler, »Fiktion und Simulation« (Anm. 55), S. 62/63. 62 Kittler, »Fiktion und Simulation« (Anm. 55), S. 60. 63 Kittler, »Fiktion und Simulation« (Anm. 55), S. 63. Vgl. als nur ein Beispiel Friedrich Kittler, Aufschreibesysteme 1800 1900, München: Fink 1995, S. 157: »Im Überspringen des Lesens, das unter einer halluzinatorischen Medialität verschwindet, feiert die Universalpoesie ihren Endsieg.« 64 Vgl. Kittler, Aufschreibesysteme 1800 1900 (Anm. 63), S. 289 unter Bezug auf das Aufschreibesystem 1900 (Film und Grammophon): »Zur symbolischen Fixierung von Symbolischem tritt die technische Aufzeichnung von Realem in Konkurrenz.« 65 Kittler, »Fiktion und Simulation« (Anm. 55), S. 69. Auf S. 68 benennt Kittler (mit Arnheim) die ›Selbstauf-zeichnung‹ (etwa in Photographie und Grammophonie), die man mit dem, von Kittler nicht genutzten, Begriff der Indexikalität (s. o.) bezeichnen kann, als eine »notwendige [...] Unterscheidung [...] zwischen Medien und Künsten«. 66 Kittler, »Fiktion und Simulation« (Anm. 55), S. 70. 67 Kittler, »Fiktion und Simulation« (Anm. 55), S. 65. Dieser Satz spielt auf eine These Kittlers auf S. 64 an: »Während Affirmieren nur bejaht, was ist, und negieren nur verneint, was nicht ist, heißt simulieren, was nicht ist, zu bejahen und dissimulieren, was ist, zu verneinen.« Diese These ist u.a. von Engell, Das Gespenst der Simulation (Anm. 48) detailliert kritisiert worden, u. a. mit dem Hinweis, dass zu bejahen, was nicht ist und zu verneinen, was ist, schlicht und ergreifend bedeutet, zu lügen. Außerdem sei Negieren nicht zu verneinen, was nicht ist, sondern zu verneinen, was ist – denn was nicht ist, kann man weder negieren noch affirmieren (weswe-gen Fiktionen ja jenseits von wahr / falsch stehen). Daher ist Kittlers Kommentar zu den Visualisierungen von Fraktalen auf S. 67 so schwer zu verstehen: »Wenn simulieren besagt, zu bejahen, was nicht ist, und dissimulie-ren besagt, zu verneinen, was ist, dann hat die Computerdarstellung komplexer, zum Teil also imaginärer Zahlen
21
Modell der Simulation im Hintergrund, denn, wie Kittler weiß, kommen »auch Lehrbü-
cher der reinen Mathematik beim Kapitel ›Simulation‹ plötzlich auf eine Wirklichkeit und
deren Gefahr zu sprechen.«68 Diese operative Funktion von Simulationen – und heute zu-
mal Computersimulationen – verdeutlicht Kittler mit dem Beispiel der »Simulation des
Krieges« im Schachspiel und dann in militärischen Sandkastenspielen.69 Dies bezeichne
»sehr genau den Schritt von Künsten zu Analogmedien, von Fiktionen und Simulatio-
nen.«70 Diese Funktion der Modellierung von Realem und den damit gegebenen Möglich-
keiten der Kontrolle, wie sie tatsächlich heute eine der bedeutenden Funktionen der Com-
putersimulation ist, setzt Kittler also den gleichsam bloß imaginären Fiktionen entgegen.71
Auch wenn der Text bestimmte Ungereimtheiten aufweist72, ist es doch klar, dass hier
Fiktion ähnlich wie bei Winkler letztlich an die Sprache gebunden ist, aber anders als bei
diesem tritt mit den technischen Medien laut Kittler die Möglichkeit der Simulation hinzu.
Zwar klingt es so, als seien die technischen Medien ausschließlich durch ›Simulation‹
eine sogenannte Wirklichkeit buchstäblich dissimuliert, nämlich auf Algorithmen gebracht.« Es ist schwer zu verstehen, inwiefern die Visualisierung mathematischer Funktionen, die z. B. wie »Wolken und Uferlinien« aussehen, eben jene Wolken und Uferlinien ›verneint‹. Interessanterweise stellt Kittlers Symmetrie zwischen Simulieren und Dissimulieren gerade in Widerspruch zu Baudrillards Entgegensetzung zwischen beiden Begrif-fen, vgl. Baudrillard, »Die Präzession der Simulakra« (Anm. 50), S. 10. 68 Kittler, »Fiktion und Simulation« (Anm. 55), S. 73. Auf S. 79 spricht Kittler vorausschauend von einer »Wel-le« (gemeint ist: eine Welle des Meeres am Strand), die dereinst mit ihrem »Computeralgorithmus« zusammen-fällt – eine solche Formulierung impliziert ein ›realistisches‹ Modell von Simulation. 69 Kittler, »Fiktion und Simulation« (Anm. 55), S. 73. Vgl. John Raser, Simulation and Society. An Exploration of Scientific Gaming, Boston: Allyn and Bacon 1972, der Simulationen ebenfalls in die Genealogie von Kriegs-spielen einreiht. 70 Kittler, »Fiktion und Simulation« (Anm. 55), S. 73. 71 Daher muss man auch Wellershoffs und Winklers Versuch, Fiktion (z. B. in der Literatur) und Simulation in eine Ecke zu rücken (vgl. Winkler, Basiswissen Medien (Anm. 13), S. 64), problematisieren: Literatur wird in der Regel gerade nicht gelesen, um eine schwierige Situation vorzubereiten (selbst wenn sie ermöglicht, schwie-rige oder riskante Situationen aus der Distanz zu erleben), sondern zur (horribile dictu) Entspannung oder zur Stimulation ästhetischer Wahrnehmung, z. B. um die Form der Darstellung (etwa die Weise der narrativen Kon-struktion fiktiver Objekte) selbst zu beobachten. Ein Abenteuerroman wird nicht gelesen, um dann an den aben-teuerlichen Ort zu reisen, zumal diese Orte oft eben fiktiv sind, d. h. man kann dort gar nicht hinreisen, selbst wenn man wollte. Außerdem bleibt die Fiktion in der Regel – ein Punkt, auf den Kittler gerade insistiert – im Kopf (oder beginnt dort und mag dann auch Handeln anleiten). Zumindest in interaktiven Simulatoren, wie z. B. in den von Wellershoff genannten Flug- oder Raumfahrtsimulatoren, hingegen geht es oft um a) das Reagieren auf Situationen (was im Falle des von Winklers genannten Theaters gerade nicht der Fall ist, die Zuschauer se-hen zu und reagieren beim ›Mord‹ nicht bzw. bestenfalls mit Affekten), und b) z. B. um das Einüben von Kör-perbewegungen, von automatisierten Abläufen – ganz egal, was im Kopf vorgeht. Zur Frage der Erkenntnisleis-tung von Fiktionen vgl. Maria E. Reicher, »Fiktion, Wahrheit und Erkenntnis« und Catherine Z. Elgin, »Die kognitiven Funktionen der Fiktion«, in: Alex Burri / Wolfgang Huemer (Hg.): Kunst denken, Paderborn: Mentis 2007, S. 25–46 und 77–90. 72 In Kittler, »Fiktion und Simulation« (Anm. 55), S. 61 heißt es etwa: »Fiktionen als analoges Medium verfügen über keine Negation« – dieser Satz ist m. E. in mehrfacher Hinsicht schwer zu verstehen. Wieso sind Fiktionen, wenn sie von Kittler doch so sehr mit der Sprache verbunden werden, ein ›analoges‹ Medium, schließlich sind Sprache und Schrift doch eher digitale Codes? Wieso verfügen Fiktionen über keine Negation – was in deutli-chem Widerspruch der Einschätzung bei Iser oder Weinrich steht? Oder ist damit gemeint, dass es keinen Sinn hat auf Fiktionen die Wahrheitsfrage anzuwenden (bzw. man zwischen wahr/falsch innerhalb des fiktionalen Raums und wahr/falsch in Bezug auf die fiktionale Äußerung selbst unterscheiden muß)?
22
ausgezeichnet – aber das kann Kittler angesichts der offenkundigen Fähigkeiten z. B. von
Filmen, fiktionale Geschichten zu erzählen, nicht wirklich meinen. Er versucht zwar die
Erfindung des fiktionalen Films bei Meliès zur Simulation zu erklären, doch das kann
nicht recht überzeugen, bzw. es deutet – wieder eher ›irrealistisch‹ – darauf hin, dass Kitt-
ler angelegentlich (in der Spur Baudrillards) die bloße Tatsache, dass im Film z. B. fiktio-
nale Charakter audio-visuell erscheinen, der Halluzinierung solcher Figuren durch Buch-
leser entgegensetzt. Das Argument wäre gleichsam: Der Film präsentiert die fiktionale
Welt (Simulation), während sich der Leser jene vorstellen muss (Fiktion). Man muss die-
ser Konstruktion nicht folgen und könnte dennoch festhalten: Während die Schrift Lese-
rInnen zum Halluzinieren fiktionaler Welten anhält, haben die technischen Medien dar-
über hinaus (und neben der Möglichkeit fiktionale Welten zu erzeugen) noch die Mög-
lichkeit zum (nicht-symbolischen, sondern indexikalischen) Zugriff auf reale Daten, um
mit diesen (und Modellierungen) die Wirklichkeit beherrschbar, das »Unvorhersehbare
vorhersehbar«73 zu machen.
Welche Funktionen hat also der Rekurs auf Fiktionalität? Kittler schreibt seinen Text
1989, in einem Band zur Ars Electronica mit dem Titel Philosophien der neuen Techno-
logie. Am Vorabend des anhebenden Wirbels um die Neuen Medien74 versucht Kittler
seine Thesen aus Aufschreibesysteme 1800 1900 und unter Rückgriff auf den Begriff der
Simulation75, der zu dieser Zeit durch Baudrillard Konjunktur hatte, deren Neuheit – wie
er zu Beginn des Textes explizit sagt – zu bestimmen. Die Neuen Medien sind die, die
nicht mehr (oder jedenfalls: nicht mehr nur) Fiktionen, sondern Simulationen hervorbrin-
gen. Fiktionalität und Simulation dienten als Differenzkriterien. Doch während bei
Winkler Fiktionalität dazu dient, Medien überhaupt von außermedialen Vorkommnissen
abzugrenzen (was aber nur unter Voraussetzung der Sprache konsistent argumentiert wer-
den kann), soll Fiktionalität bei Kittler als Merkmal des Sprachlichen gerade dazu dienen,
die ›hergebrachten Künste‹ (womit wesentlich die Literatur gemeint ist) von den neuen
technischen Medien zu differenzieren (wobei damit bei Kittler schon die analogen Medien
73 Kittler, »Fiktion und Simulation« (Anm. 55), S. 71. 74 Vgl. Jens Schröter, »Medienästhetik, Simulation und ›Neue Medien‹«, in: Zeitschrift für Medienwissenschaft, 8 (2013), S. 88–100. ›Neue Medien‹ wird oben im Text mit großem ›Neu‹ geschrieben, da es sich um einen stehenden Ausdruck handelt – jedenfalls der Mediendiskussion der 1990er Jahre. 75 Der Begriff der ›Simulation‹ spielt bereits in Kittler, Aufschreibesysteme 1800 1900 (Anm. 63), eine gewisse Rolle, z. B. auf S. 289: »[E]rst experimentelle Zerlegungen der Wahrnehmung machen ihre analoge Synthese oder Simulation möglich« oder auf S. 390 unter offenbarer Bezugnahme auf Baudrillard: »Die referenzlose Si-mulation löst die alte Verbindung von Wahnsinn und Krankheit auf, um eine ganz andere herzustellen: die Ver-bindung von Wahnsinn und Schreiben.«
23
des 19. Jahrhunderts und nicht erst die digitalen ›Neuen Medien‹ gemeint sind). Diese
Figur wiederholt sich auch bei weiteren AutorInnen, z. B. bei Elena Esposito, die unter
Rückgriff auf ein systemtheoretisches Vokabular Fiktion, Virtualität und (eine realistisch
gefasste) Simulation voneinander zu differenzieren sucht:
$Z$ Diese besondere Beziehung des Virtuellen zu der Unterscheidung Reali-
tät/Fiktion muss also berücksichtigt werden. Das ist die Basis z. B. der oft vernach-
lässigten Unterscheidung von Virtualität und Simulation. Man spricht von den
möglichen Welten als simulierten Realitäten, und dadurch geht ihre Spezifität
weitgehend verloren. Die Simulation erlaubt wie die Modellierung, fiktionale Ob-
jekte zu schaffen, die ›so tun‹, als ob sie etwas anderes wären, doch dies innerhalb
eines immer noch semiotischen Paradigmas. Das Modell ›steht für‹ das reale Ge-
bäude, die graphische Darstellung der Bewegungen der Wolken ›steht für‹ die rea-
len atmosphärischen Ereignisse. Die Simulation beabsichtigt, so treu wie möglich
einige Eigenschaften dessen zu reproduzieren, was ein Referent bleibt. Die Virtua-
lität im eigentlichen Sinne verfolgt eine viel reichhaltigere Absicht; sie geht über
die Eigenschaften der Simulation hinaus und kann nicht mehr auf die Unterschei-
dung von Zeichen und Referent bezogen werden.76
Zu einem späteren Zeitpunkt des Textes77 lässt sie keine Zweifel, dass sich die Fragestel-
lung letztlich an den Neuen Medien, u. a. dem, was 1995 noch als Virtual Reality mehr
oder minder phantasmatisch in den Diskursen zu digitalen Medien herumgeisterte, ent-
zündet hat. Wieder soll durch eine Abgrenzung von der bisherigen Operationsweise von
Fiktion, deren Geschichte in dem Aufsatz skizziert wird, die Neuheit der Neuen Medien
konturiert werden. Mir scheint, dass Esposito mit Virtualität gleichsam fiktional ge-
brauchte und zudem interaktive Simulationen meint – und es ist ihr zuzustimmen, dass es
zumindest zu diskutieren wäre, was es für den Begriff der Fiktion (zumal wenn man ihn
mit Kittler streng halluzinatorisch auffasste) bedeutet, mit fiktionalen Szenarien interaktiv
umzugehen.78
76 Elena Esposito, »Fiktion und Virtualität«, in: Sybille Krämer (Hg.): Medien Computer Realität. Wirklichkeits-vorstellungen und Neue Medien, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1998, S. 269–296, hier S. 270. 77 Elena Esposito, »Fiktion und Virtualität« (Anm. 76), S. 286–289. 78 Eine Frage, die unter den Bedingungen der Popularität von Computerspielen viel von ihrer früheren ›ontologi-schen‹ Brisanz verloren hat – aber nicht im negativen Sinne: Es ist heute selbstverständlich geworden mit fiktio-nalen Szenarien zu interagieren, deswegen kann man darin kaum noch einen radikalen Einschnitt sehen.
24
Aber das sei, wie es sei, entscheidend bleibt, dass immer wieder die Frage nach dem Sta-
tus der Fiktion bemüht wird, wenn es darum geht, Medien überhaupt oder Einschnitte in
der Geschichte der Medien zu verstehen. Das kann den Grund nur darin haben, dass es
seit dem Zeitpunkt, an dem die Frage nach den Medien überhaupt auftauchte, immer wie-
der zur Frage wird, ob und wie sie ›Realität‹ wiedergeben, vermitteln, konstruieren, ver-
fremden etc. pp. Und das ist auch naheliegend. Als Medien sind sie, zumindest im Wort-
sinne, etwas Vermittelndes, doch was wird da vermittelt? Das oben angeführte Zitat von
Geoffrey Batchen: »The main difference seems to be that, whereas photography still
claims some sort of objectivity, digital imaging is an overtly fictional process«79 taucht
historisch genau zu dem Zeitpunkt auf, als die Einführung digitaler Neuer Medien, genau-
er: der digitalen Fotografie und generierter fotorealistischer Computerbilder die Frage
aufzuwerfen schien, ob man den Bildern noch trauen könne. Die Diskussion darum nahm
teilweise absurde und hysterische Züge an.80 Können fotografisch aussehende Bilder noch
›Realität‹ vermitteln – oder zeigen sie nur noch Fiktionen? Was wird dann aus dem Jour-
nalismus und aus den Massenmedien, aus denen wir, einem Wort Niklas Luhmanns zu-
folge, doch alles über die Welt wissen? Espositos Text wurde zuerst in einem von Sybille
Krämer herausgegebenen Band mit dem Titel Medien Computer Realität. Wirklichkeits-
vorstellungen und Neue Medien veröffentlicht. In dessen Vorwort wird der hier behaupte-
te Zusammenhang mit aller wünschenswerten Klarheit formuliert (es sei gestattet diese
Passage ausführlich zu zitieren):
$Z$ Digitalisierung, Virtualisierung und Interaktivität sind also diejenigen Phäno-
mene, die wir zu untersuchen haben, wenn wir den Computer in der Perspektive
betrachten, ein Medium zu sein. Der Medienbegriff, der eine solche Perspektive zu
akzentuieren erlaubt, rückt ab von der Vorstellung, daß Medien der bloßen Über-
mittlung von Botschaften dienen. [...] Medien übertragen nicht einfach Botschaf-
ten, sondern entfalten eine Wirkkraft, welche die Modalitäten unseres Denkens,
Wahrnehmens, Erfahrens, Erinnerns und Kommunizierens prägt. Damit aber er-
weitert sich die Frage nach der ›Natur‹ von Medien zur Frage nach der Medialität
unseres Weltverhältnisses. Denn wie wir denken, wahrnehmen und kommunizie-
ren, hat immer auch Folgen für die Art und Weise, in der unsere Umwelt für uns
79 Batchen, »Ectoplasm. Photography in the Digital Age« (Anm. 34), S. 15. 80 Vgl. Schröter, »Das Ende der Welt« (Anm. 38).
25
zur Welt wird, in der sich die Vorstellung über das, was für uns wirklich ist und
was ›Wirklichkeit‹ heißt, ausbildet und verdichtet. Nun gibt es eine eingängige und
weitverbreitete Auffassung, nach der die Techniken der Virtualisierung unser Kon-
zept von Wirklichkeit verflüssigen und instabil machen. Überdies mehren sich
Stimmen, die ausgehen von einer Komplizenschaft zwischen den realitätsauflösen-
den Wirkungen der Neuen Medien und den im Umkreis des Radikalen Konstrukti-
vismus gebildeten Positionen, die Realität als bloße Konstruktion bzw. Interpreta-
tion verstehen. [...] Doch wo angenommen wird, daß die Differenz zwischen Wirk-
lichkeit und Simulation, zwischen Realität und Fiktion verschwindet, da verlieren
mit dem Wirklichkeits- und Realitätsbegriff zugleich auch die Begriffe ›Simulati-
on‹ und ›Fiktion‹ ihren Sinn.81
Krämer wendet sich gegen den irrealistischen und allzu expansiven Begriff von Simulati-
on, wie er von Baudrillard geprägt wurde; die Beiträge des Bandes streben differenziertere
Betrachtungen an. Aber ganz unabhängig von der Frage, ob man sich dieser Kritik an-
schließen will oder nicht – entscheidend ist an dieser Passage erneut, dass das Auftauchen
›Neuer Medien‹ letztlich mit der Frage nach der Realität ihrer Vermittlung und folglich
nach dem Status von Begriffen wie ›Simulation‹ und eben auch ›Fiktion‹ verbunden ist.
Die Frage nach den Medien (oder nach ihrer Geschichte und ihren Wandlungen) wirft so
gesehen unweigerlich die Frage nach der Fiktion auf.
$Ü$ Fazit
Doch wie passen die Ergebnisse der Abschnitte II und III und die knappe diskurshistori-
sche Rekonstruktion in IV zusammen? In Abschnitt II und III schien doch deutlich zu
werden, dass zumindest die Unterscheidung analog/digital, die bei so verschiedenen Auto-
ren wie Batchen, Kittler, Esposito und Krämer im Hintergrund lauert, wenn es um die
Verschiebungen hinsichtlich Realität, Fiktion und Simulation durch ›Neue Medien‹ geht,
gerade nichts mit der Möglichkeit von Fiktionalität zu tun hat. Wie kann man diesen ei-
gentümlichen Befund interpretieren? Auffällig ist, dass die Überlegungen, die die Frage
nach den Medien oder dem Medienwandel angehen, stets theoretischer und bzgl. be- 81 Sybille Krämer, »Was haben die Medien, der Computer und die Realität miteinander zu tun? Zur Einleitung in diesen Band«, in: dies. (Hg.): Medien Computer Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue Medien, Frank-furt a.M.: Suhrkamp 1998, S. 9–26, hier S. 14/15.
26
stimmter (z. B. digitaler) Medien genereller Art sind, während die Beschreibungen in Teil
II und III stärker konkrete Gebrauchsweisen von analogen und digitalen Fotografien (und
was diese mit Fiktionalität zu tun haben oder nicht) in den Blick nahmen. Vielleicht ist es
einerseits so, dass die eher generellen Überlegungen, ohne den tatsächlichen Gebrauch
neuer Technologien wirklich im Blick zu haben, allgemeine Verunsicherungen reflektie-
ren, die mit dem Auftauchen Neuer Medien verbunden sind – denn grundsätzlich ist es
kein neuer Befund, dass neue Technologien und näherhin Neue Medien jedenfalls zu-
nächst zu Verunsicherungen führen.82 Doch sind solche spekulativen Mutmaßungen meist
stark übertrieben: So ist z. B. die von Esposito und zumindest indirekt auch von Krämer
bemühte ›Virtual Reality‹ inzwischen praktisch von der Bildfläche verschwunden und hat
›alltagstauglicheren‹ und in diesem Sinne angepassteren Praktiken wie der ›Augmented
Reality‹ Platz gemacht.83 Medien wird zumeist, wenn sie noch neu und unbekannt sind,
geradezu Revolutionäres zugetraut – mit ihrer massenhaften Einführung werden viele ih-
rer radikalen Potentiale, wie Brian Winston schon vor langer Zeit argumentierte84, ge-
bremst. So hat auch die Einführung der digitalen Fotografie nicht dazu geführt, dass alle
fotografisch erscheinenden Bilder jetzt als rein fiktional wahrgenommen werden – es gibt
z. B. immer noch (nun digitale) Familienfotografie, deren Funktion unbestreitbar doku-
mentarisch ist. So gesehen sind die Diskurse, die die grundlegenden ontologischen Fragen
nach Realität, Fiktion und Simulation aufwerfen und an den Medienwandel knüpfen, eher
fiktionale Symptome dieses Wandels selbst als Reflexionen über die tatsächlichen Opera-
tionen Neuer Medien. Andererseits bedeutet die Tatsache, dass der Unterschied ana-
log/digital nicht mit dem Unterschied dokumentarisch/fiktional gleichgesetzt werden
kann, nicht, dass alle Praktiken mit analogen bzw. digitalen Medien gewissermaßen
gleichverteilt dokumentarisch und fiktional waren und sind – es kann ja durchaus sein,
dass in verschiedenen historischen Epochen bestimmte Medien eher dokumentarische
Aufgaben übernahmen als fiktionale; und dass diese Frage von der diskursiven Praxis ab-
hängt ist evident: In den Naturwissenschaften werden analoge wie digitale Technologien
eher benötigt, um Spuren, Daten etc. von Phänomenen ›dokumentarisch‹ zu verzeichnen,
82 Vgl. die Rekonstruktionen der euphorischen und apokalyptischen Erzählungen zu neuen Technologien bzw. Medien in Carolyn Marvin, When Old Technologies were New. Thinking about Electric Communication in the Late Nineteenth Century, New York: Oxford University Press 1990 und Albert Kümmel / Leander Scholz / Eck-hard Schumacher (Hg.), Einführung in die Geschichte der Medien, München: Fink 2004. 83 Vgl. Jens Schröter, »Echtzeit und Echtraum. Zur Medialität und Ästhetik von Augmented Reality-Applikationen«, in: Augenblick. Marburger Hefte zur Medienwissenschaft, 51 (2012), S. 104–120. 84 Vgl. Brian Winston, Media Technology and Society. A History: From the Telegraph to the Internet, New York: Routledge 1998, S. 11–13.
27
während es im Massenmedien- und im Kunstsystem (neben dokumentarischen) auch zahl-
reiche fiktionale Verwendungen gibt.85
Daher ist festzuhalten: Die (manchmal hypertrophen) Rhetoriken einer ›Panfiktionalisie-
rung‹ (Pfeiffer) geben in der Regel Aufschluss über Umbruchsituationen in der Medien-
landschaft. Die tatsächlichen Operationen verschiedener Medien für dokumentarische
oder fiktionale (oder gemischte) Praktiken lassen sich aber nicht generell aus den Eigen-
schaften von Medien deduzieren, sondern grundsätzlich nur historisch und/oder in teil-
nehmender Beobachtung nachvollziehen. So wären eine ›Mediengeschichte des Fiktiona-
len‹ oder Studien zu ›Medienethnographien fiktionaler Praktiken‹ denkbar, die kleinteili-
ger und näher am Material operieren. Dabei könnte Winklers große These – »Medien
etablieren innerhalb der Gesellschaft einen Raum, der die Besonderheit hat, von tatsächli-
chen Konsequenzen weitgehend entkoppelt zu sein«86 – in die Analyse vieler kleiner
Räume und Praktiken ausdifferenziert werden.
85 Und es gibt Bereiche wie das Kunstsystem, wo es ohnehin fraglich ist, ob eine Unterscheidung wie ›fiktional‹ und ›nicht-fiktional‹ überhaupt angewendet werden kann. Vgl. Ryan, »Fiktion, Kognition und nichtverbale Me-dien« (Anm. 7), S. 83/84. 86 Winkler, »Mediendefinition« (Anm. 1), S. 13.