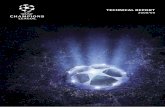Aigeira 2011. Bericht zu Aufarbeitung und Grabung
Transcript of Aigeira 2011. Bericht zu Aufarbeitung und Grabung
alle rechte vorbehalten
issn 0078-3579isBn 978-3-900305-73-4
copyright © 2013 byÖsterreichisches archäologisches institut
Wien
satz und layout: andrea sulzgrubergesamtherstellung: holzhausen druck gmbh
herausgeber Österreichisches archäologisches institut franz Klein-gasse 1 a-1190 Wien http://www.oeai.at
redaktionskomitee Maria aurenhammer Barbara Beck-Brandt Michael Kerschner sabine ladstätter helga sedlmayer
scientifc Board necmi Karul, istanbul stefanie Martin-Kilcher, Bern Marion Meyer, Wien felix Pirson, istanbul susan i. rotroff, st. louis, Mo r. r. r. smith, oxford lutgarde Vandeput, ankara
redaktion Barbara Beck-Brandt
sigel ÖJh
die verwendete Papiersorte ist aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt,frei von säurebildenden Bestandteilen und alterungsbeständig.
Das Österreichische Archäologische Institut ist eine Forschungseinrichtung des Bundeministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Inhalt
Martin Auer – Florian BleiBinhAus – Michael TschurTschenThAler – Michael unTerwurzAcher
Municipium Claudium Aguntum – Georadar-Messungen in geologisch schwierigem Terrain ................................................................................................................. 7
Christoph BAier
Attolitur monte Pione. Neue Untersuchungen im Stadtviertel oberhalb des Theaters von Ephesos .............................................................................................................. 23
Walter GAuss – Rudolfine smeTAnA – Jeremy B. ruTTer – Julia Dorner – Petra eiTzinGer – Christina Klein – Andrea Kurz – Asuman läTzer-lAsAr – Manuela leiBeTseDer – Christina reGner – Harald sTümpel – Alexandra TAnner – Conor TrAinor – Maria TrApichler
Aigeira 2012. Bericht zu Aufarbeitung und Grabung .............................................................. 69
Stefan Groh – Sabine lADsTäTTer – Alice wAlDner
Neue Ergebnisse zur Urbanistik in der Oberstadt von Ephesos: Intensive und extensive Surveys 2002 – 2006 ................................................................................................. 93
Stefan Groh – Helga seDlmAyer. Mit Beiträgen von Peter Kiss und Silvia renhArT
Ein italisch geprägtes Grabinventar mit dem Beinrelief eines Eros aus der nördlichen Nekropole von Savaria-Szombathely, Pannonien (Ungarn) .................................................... 195
Erich KisTler – Birgit ÖhlinGer – Marion sTeGer
»Zwischen Aphrodite-Tempel und spätarchaischem Haus.« Die Innsbrucker Kampagne 2011 auf dem Monte Iato (Sizilien) ......................................................................................... 227
Alessandro nAso
Amber for Artemis. Preliminary Report on the Amber Finds from the Sanctuary of Artemis at Ephesos .................................................................................................................. 259
Robert nAwrAcAlA
Untersuchungen zum Rebhuhn und zu anderen Hühnervögeln in antiken Text- und Bildquellen .............................................................................................................. 279
Marco peDrAzzi
La cosiddetta terrazza di Zeus a Velia ...................................................................................... 305
Ludovico reBAuDo
Gli scavi della famiglia Ritter (1862 – 1876) e la topografia di Aquileia ................................. 339
Inge uyTTerhoeven – Hande KÖKTen – Markku corremAns – Jeroen poBlome – Marc wAelKens
Late Antique Private Luxury. The Mosaic Floors of the ›Urban Mansion‹ of Sagalassos (Ağlasun, Burdur – Turkey) .............................................................................. 373
Wa l t e r G a u ß – R u d o l f i n e S m e t a n a – J e r e m y B . R u t t e r – J u l i a D o r n e r – P e t r a E i t z i n g e r – C h r i s t i n a K l e i n –
A n d r e a K u r z – A s u m a n L ä t z e r - L a s a r – M a n u e l a L e i b e t s e d e r – C h r i s t i n a R e g n e r – H a r a l d S t ü m p e l – A l e x a n d r a Ta n n e r –
C o n o r T r a i n o r – M a r i a T r a p i c h l e r
Aigeira 2012Bericht zu Aufarbeitung und Grabung
Allgemein
Die archäologischen Arbeiten in Aigeira konzentrierten sich im Jahr 2012 auf folgende Bereiche (Abb. 1)1:
1. Die Fortsetzung der Ausgrabungen am sog. Sattel (Abb. 1, 1)2. die Bauaufnahme im Flurbereich Solon2 (Abb. 1, 2)3. Untersuchungen zur Wasserversorgung3 (Abb. 1, 3)4. geophysikalische Messungen südlich und östlich der Akropolis sowie im Bereich des
Theaters (Abb. 1, 1. 4)5. die Bauaufnahme im Bereich der hellenistischen Naiskoi (Abb. 1, 4) 6. die Durchsicht und Neuorganisation der Funde aus den Grabungen der 1970-iger und 1980-
iger Jahre im Bereich der hellenistischen Naiskoi, des Tycheions und vom Grabungsbereich ›Palati‹ (Abb. 1, 4. 5).
Hier soll ein Überblick über die wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeiten gegeben werden4.
1 Gesamtleitung der Arbeiten W. Gauß; Grabungsbereich Solon: G. Ladstätter, Mitarbeiter H. Staub (Universität Freiburg); Grabungsbereich sog. Sattel: W. Gauß, Mitarbeiter A. Kurz (Universität Salzburg), C. Regner (Mün-chen); Fundaufnahme prähistorische Keramik: J. B. Rutter (Dartmouth College), Mitarbeit J. Dorner (Universität Wien); Fundaufnahme und Materialdurchsicht der Altfunde: R. Smetana (Universität Salzburg), J. Dorner (Uni-versität Wien), P. Eitzinger (Universität Salzburg), A. Lätzer-Lasar (Universität Köln), M. Leibetseder (Universität Salzburg), M. Trapichler (Universität Wien); Wasserversorgung: W. Gauß, G. Ladstätter; Architekturaufnahme: A. Tanner (ETH-Zürich); Geophysik: Leitung H. Stümpel, C. Klein, Mitarbeit K. Burmeister, A. Fediuk (Uni-versität Kiel); Restaurierung: S. Kalabis (ÖAI Wien, Ferdinandeum Innsbruck); Vermessung und Planerstellung: H. Birk (Esslingen). Finanzierung: Österreichisches Archäologisches Institut/Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und Institute of Aegean Prehistory (Philadelphia). 2012 wurde in Aigeira im Rahmen der Gra-bung auch die Lehrgrabung des Instituts für Klassische Archäologie der Universität Wien durchgeführt (Leitung: W. Gauß, Co-Leitung A. Kurz, C. Dorner [Tutor], Teilnehmer: C. Dahled, N. Riegler, L. Lazarova, H. Liedl, M. Lucbauerova, A. Steininger, C. Trabitzsch; Finanzierung: Universität Wien). Die Verfasser danken E. Kolia, A. Vordos und G. Koutsantoni von der ΣT-Ephorie für Prähistorische und Klassische Altertümer (Patras) für die freundliche Unterstützung während der Aufarbeitung und Grabung. Für eine kritische Durchsicht des Manuskripts danken wir G. Klebinder-Gauß, F. Ruppenstein und J. B. Rutter.
2 Zu den Grabungen in Solon s. Jahresberichte ÖJh 68, 1999 – ÖJh 78, 2009 sowie ab 2010 <http://www.oeai.at/index.php/jahresberichte.html>. Ein umfassender Bericht zu den Arbeiten in Solon ist in Vorbereitung.
3 Bereits unter der Grabungsleitung von W. Alzinger wurde mit der Untersuchung der Wasserversorgung begonnen (G. Neeb in: Alzinger u. a. 1986, 314 – 318) und seit 1996 kontinuierlich fortgesetzt; s. Bammer 1997, 54 – 55; Jah-resberichte ÖJh 68, 1999 – ÖJh 78, 2009 sowie ab 2010 <http://www.oeai.at/index.php/jahresberichte.html>. Die Untersuchung eines 2011 neu entdeckten Stollens ist noch nicht abgeschlossen.
4 Eine gekürzte Version des Berichts 2012 unter <http://www.oeai.at/index.php/jahresberichte.html>.
71Aigeira 2012
1. Grabungen am sog. Sattel
Die Arbeiten am Sattel und östlichen Abhang der Akropolis wurden 2011 nach 30-jähriger Unterbrechung wieder aufgenommen und im Jahr 2012 fortgesetzt. Die Ergebnisse des Jahres 2011 wie auch die Grabungen der 1970-iger Jahre zeigten die Bedeutung des Platzes, besonders für die Späte Bronzezeit5.
1.1 Grabungen am östlichen Abhang der Akropolis
Die 2011 durchgeführten Reinigungsarbeiten am östlichen und südöstlichen Abhang der Akro-polis zeigten klar, dass dieser teilweise bebaut war. Reste einer Nord-Süd orientierten Struktur konnten 2011 bei der Reinigung festgestellt werden6. Die Grabungen des Jahres 2012 offen-barten, dass es sich um eine massive Befestigungsmauer mykenischer Zeit handelt, die den östlichen Abhang der Akropolis schützt (Abb. 2 – 4). Weitere Teile dieser Mauer wurden bereits bei den Grabungen der 1970-iger Jahre im westlichen Teil der Akropolis freigelegt und der zweiten Phase der mykenischen Siedlung (SH IIIC Mitte bis Spät) zugewiesen7. Die Neuanlage der Befestigungsmauer in SH IIIC stellt einen besonders interessanten Befund auf dem griechi-schen Festland dar, und Aigeira unterscheidet sich dadurch von anderen befestigten Orten, deren Umfassungsmauern bereits in SH IIIB errichtet wurden8.
Die Grabungen am östlichen Abhang konzentrierten sich insbesondere auf zwei Bereiche:a. den Bereich am Fuß des östlichen Abhangs (Q615-420)b. den Bereich unmittelbar hinter der Befestigungsmauer (Q610-420, Q615-420 und Q615-
415)
1.1.1 Bereich am Fuß des östlichen Abhangs (Q615-420)Der Bereich am Fuß der Akropolis (Abb. 2 – 4) wurde in zwei Abschnitten gegraben. Im südli-chen Abschnitt fanden sich vor allem Reste der spätklassischen und hellenistischen Zeit. Hier wurden auch die Reste von mehreren Mauern freigelegt, wahrscheinlich Reste des spätklas-sischen oder hellenistischen Befestigungssystems, das möglicherweise zu einem Diateichisma gehören könnte9.
Im nördlichen Teil von Planquadrat Q615-420 fand sich in den obersten Schichten wiederum Spätklassisches bis Hellenistisches. Die ältesten Funde gehen hier allerdings bis in die Frühe Eisenzeit zurück, wie ein teilweise erhaltener Skyphos aus Mittel- bis Spätgeometrischer Zeit (MG II – SG) zeigt (Abb. 5, 1)10.
Besonders interessant ist eine Mauer aus unbearbeiteten und unterschiedlich großen Steinen, die an oder gegen den vorspringenden natürlichen Felsen gebaut ist. Die Mauer und der teilweise abgearbeitete Felsen aus Konglomeratgestein könnten zur untersten Lage oder zu den Fundamenten der spätbronzezeitlichen Befestigungsmauer gehören. Bestätigt sich diese Annahme, so ist die Befestigungsmauer einschließlich der Fundamente ca. 2,7 m breit.
5 Alram-Stern – Deger-Jalkotzy 2006; Alram-Stern 2003; Deger-Jalkotzy 2003; Giannopoulos 2008, 83 – 93; Gauß 2009; Gauß u. a. 2012.
6 Gauß u. a. 2012, 34 – 36 Abb. 2 – 3. 7 Alzinger u. a. 1985, 405 – 407. 8 Hope Simpson – Hagel 2006 führen keine Neubefestigung in SH IIIC an. In Kreta führt Nowicki vier befestigte Zi-
tadellen und Rückzugssiedlungen aus SM IIIB/C an (Rogdia Kastrokefala, Iouktas, Kofinas und Zakros Gorge Kato Kastello), die als Gemeinsamkeit über eine dicke Befestigungsmauer verfügen, sowie zwei weitere Siedlungen (Kritsa Kastello und Orne) mit einer ähnlichen Anlage (Nowicki 2000, 42. 44 – 48. 120. 200).
9 Zu Diateichisma s. Sokolicek 2009. 10 Abb. 5, 1: Q615-420/019-001 (KLQ 11); vgl. Blegen u. a. 1964, 28 Kat. 20-2 (T 2209) Taf. 6. Coldstream 1968,
95 – 104.
72 Walter Gauss u. a.
2 Aigeira 2012. Plan des östlichen Abhangs und des ›Sattels‹ mit den hervorgehobenen Grabungsbereichen
73Aigeira 2012
3 Aigeira 2012. Grabung am Fuß der Akropolis, Planquadrat Q615-420, südlicher und nördlicher Teil; Blick von Westen nach Osten
4 Aigeira 2012. Grabung am Fuß der Akropolis, Planquadrat Q615-420, südlicher und nördlicher Teil; Blick von Osten nach Westen
74 Walter Gauss u. a.
5 Keramik aus dem nörd-lichen Bereich von Q615-420
1
23
1 2
3
46 Mykenische Keramik
aus dem Bereich der Befestigungsmauer
Der Anteil der prähistorischen Keramik aus diesem Grabungsabschnitt ist sehr gering, obwohl der natürliche Boden erreicht wurde. Die zum Teil kleinteilig zerscherbte prähistorische Keramik lag fast ausschließlich in einer Schicht von dunkler, rötlich brauner Erde, direkt neben den oben erwähnten Resten der Mauern. Derzeit wird diese dunkle, rötlich braune Erdschicht als verwitterte Lehmziegelerde interpretiert, doch sind weitere Untersuchungen notwendig, um diese Annahme zu bestätigen.
Unter den Funden aus der ›verwitterten Lehmziegelerde‹ sind besonders die zwei anpassenden Fragmente eines mykenischen Skyphos hervorzuheben. Aufgrund seines charakteristischen Dekors gehört der Skyphos zur Gruppe A und kann in die Phase SH IIIB datiert werden (Abb. 5, 2)11. Auch das große Fragment eines chalkolithischen Gefäßes stammt aus der ›verwitterten Lehmziegelerde‹ (Abb. 5, 3)12.
11 Abb. 5, 2: Q615-420/036-001 (KLQ 52) anpassend an Q615-420/055-001 (KLQ 53); vgl. Podzuweit 2007, Taf. 2, 4.
12 Abb. 5, 3: Q615-420/038-001 (KLQ 51); zur chalkolithischen Keramik Aigeiras s. Alram-Stern – Deger-Jalkotzy 2006, 23 – 34.
75Aigeira 2012
1.1.2 Bereich hinter der Befestigungsmauer (Q610-420, Q615-420 und Q615-415)Unmittelbar hinter der Mauer wurden zwei Schnitte angelegt, um möglichst viele Aufschlüsse über die zeitliche Einordnung der Mauer zu erhalten (Abb. 2 – 3).
Nach der Entfernung der obersten Erdlage folgte eine bis zu 0,5 m dicke Schicht aus dunkler, brauner Erde, die z. T. stark durchmischt ist mit bis zu faustgroßen Konglomeratsteinen. Diese Schicht lag über einem Fußboden oder Laufhorizont aus festgetretenem Mergel bzw. der obersten Steinlage der spätbronzezeitlichen Befestigungsmauer.
In der Auffüllung über dem festgetretenen Boden aus Mergel wurden u. a. die Reste eines teilweise erhaltenen Skyphos gefunden. Die sehr dünne Wandung, der hohe konische Ringfuß und die dünnen Henkel des Gefäßes sprechen für eine zeitliche Einordnung in SH IIIC Spät (Abb. 6, 2)13. In der Auffüllung fanden sich darüber hinaus noch einige Fragmente der sog. White Ware, einer chronologisch aussagekräftigen Keramikgattung (Abb. 6, 1)14. Die bisher beobachtete stratigrafische Abfolge legt nahe, dass die Befestigungsmauer auf dem festgetretenen Boden aufsitzt oder der Boden gegen diese läuft und somit gleichzeitig oder älter als die Mauer ist.
Zu diesem Boden gehören auch die Reste einer Struktur, wahrscheinlich eine in sich zusammengestürzte Mauer (in Q610-420 KLQ 24, 25), die im ungefähr rechten Winkel zur Befestigungsmauer verläuft (Abb. 2 – 3). Die bisherige Analyse der Keramik legt nahe, dass der oberste Boden in die Phase SH IIIC Mitte zu datieren ist. Die Funde, die mit dem Boden selbst in Verbindung stehen, gehören ausschließlich in die Phasen SH IIIC Früh bis Mitte; dies gilt im Übrigen auch für die Funde, die unter dem Boden festgestellt wurden. Entsprechend sollte die Befestigungsmauer nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand in die Phase SH IIIC Mitte bis Spät datiert werden. Dieser zeitliche Ansatz passt auch sehr gut zu der Datierung des Mauerabschnitts, der am westlichsten Teil der Akropolis bei den Grabungen der 1970-iger Jahre entdeckt wurde15. Die bislang freigelegte Mauer ist in ihren untersten Lagen 1,9 m breit, könnte aber bis zu 2,7 m breit sein, sollten die im Planquadrat Q615-420 freigelegten Reste auch dazu gehören.
Für die Außenseite der Mauer wurden sehr große Konglomeratbrocken verwendet, für die innere Seite und die Füllung dazwischen kleinere Steine. Aufgrund der Lage am steilen Hang sind die oberen Steinreihen der Mauer verloren und nur noch die untersten Lagen erhalten (Abb. 3). Daher ist gegenwärtig noch nicht klar, ob die Mauer aus einem Steinsockel mit Lehmziegelaufbau bestanden hat oder zur Gänze aus Steinen errichtet war.
Die bisherigen Grabungsergebnisse könnten jedoch auf einen Aufbau aus Lehmziegeln hinweisen. In einem Grabungsabschnitt, der in der Mitte der Mauer liegt, wurden besonders klein zerscherbte und abgerundete Keramikfragmente gefunden, die aufgrund ihres Erhaltungszustandes und ihrer nicht homogenen zeitlichen Einordnung (SH IIIB bzw. von SH IIIC Früh bis SH IIIC Mitte bis Spät) sehr wahrscheinlich von einer Bodenpackung oder von Lehmziegelerde stammen. Auch die dunkle, rötlich braune Erdschicht, die direkt bei den vermutlichen Fundamenten der Befestigungsmauer gefunden wurde, ist ein weiterer Hinweis auf die Existenz zerfallener Lehmziegel im Bereich der Mauer. Wir hoffen, dass die geplante Untersuchung des Erdmaterials weitere Aufschlüsse liefern wird.
Unter dem eben erwähnten obersten Boden konnten eine Anzahl von Füllschichten und mindestens zwei weitere Böden aus festgetretenem Mergel festgestellt werden. Zusammen mit dem bislang untersten Boden wurden die Reste einer schlecht gebauten Mauer freigelegt (Abb. 2 – 3), die tiefer als die Befestigungsmauer liegt und diagonal zu dieser verläuft. Der dazugehörige Boden konnte derzeit nur nördlich der Mauer erfasst werden. Gegenwärtig weisen alle Indizien darauf hin, dass diese Mauer und der dazugehörige Boden die bislang ältesten Bebauungsreste
13 Abb. 6, 2: Q615-415/010-001 (KLQ 51); zur Form vgl. Rutter 1979, 376 Abb. 6, 74 (hier allerdings ausgespartes Band und vollständig bemalter Fuß); Mountjoy 1999, Abb. 79, 219 (Korinth); Abb. 239, 597 (Attika).
14 Abb. 6, 1: Q615-415/006-001 (KLQ 52); Alzinger u. a. 1985, 419 wird die ›white ware‹ als Innovation der Sied-lungsphase II angeführt. Zur ›white ware‹ aus Aigeira auch Mountjoy 1999, 399 Anm. 202. Zur ›white ware‹ aus Lefkandi s. Evely 2006, bes. 151 (Phase 2A). 169 (Phase 2B). 175 (Phase 3).
15 Alzinger u. a. 1985, 405 – 407.
76 Walter Gauss u. a.
am Abhang sind. Die Keramik, die aus den Füllschichten über dem Boden stammt, gehört in die Phase SH IIIC Früh bis Mitte. Die Ausgrabungen wurden mit dem Erreichen des Fußbodens vorläufig eingestellt und sollen 2013 wieder aufgenommen werden.
Die bisherigen Ergebnisse der Grabungen am östlichen Abhang der Akropolis sind aus folgenden Gründen von Bedeutung:
1. Der steile östliche Abhang war vor dem Bau der Befestigungsmauer besiedelt. Die Fortsetzung der Ausgrabungen wird dabei sicherlich zeigen, ob der Hang dafür terrassiert werden musste.
2. Die bislang festgestellte stratigrafische Abfolge verdeutlicht, dass mit einer größeren Anzahl an Siedlungsphasen zu rechnen ist, als bislang angenommen. Denn obwohl der natürliche Boden noch nicht erreicht wurde, konnten im Bereich der Befestigungsmauer bereits mehrere direkt aufeinanderfolgende Siedlungsphasen festgestellt werden als in vielen Bereichen des Akropolis-Plateaus, wo maximal zwei aufeinanderfolgende Phasen beobachtet werden konnten.
3. Bislang wurden keine eindeutigen Reste des Zugangs zur Akropolis festgestellt. Die weiteren Forschungen und Grabungsarbeiten werden klären müssen, an welcher Stelle der Zugang zur spätbronzezeitlichen und früheisenzeitlichen Akropolis lag.
Die erste Analyse der spätbronzezeitlichen Keramik aus dem Bereich der Befestigungsmauer durch J. B. Rutter erlaubt folgende interessante Beobachtungen: Die Konzentration und Zahl von Krateren oder Fragmenten von Krateren fällt auf (Abb. 6, 3 – 4)16. Skyphoi, Tassen (Furumark Form 215), mittelgroße bis große Kannen/Krüge/Amphoren/Hydrien und Kochtöpfe/-amphoren sind die häufigsten weiteren Gefäßformen. Einige der Fragmente haben mehrfache Anpassungen oder sicher zugehörige, aber nicht anpassende Fragmente. Die relativ große Anzahl von Fragmenten der sog. Handgemachten und Geglätteten Ware (HGW) ist ebenfalls bemerkenswert17. Es handelt sich dabei vor allem um Kannen mit einem durch die Wandung gedrückten Henkel.
Einige wenige Fragmente (vor allem unbemalte Kylikes, unbemalte Schöpfer und musterbemalte kleine Bügelkannen) sind wahrscheinlich SH IIIC Früh oder sogar SH IIIB. Erhärtet sich ein zeitlicher Ansatz in SH IIIB, so würde dies eine wichtige Ergänzung der vor SH IIIC-zeitlichen Funde von Aigeira bedeuten.
2. Grabungen im Bereich des sog. Sattels
Die Grabungen des Jahres 2012 wurden nach der Reinigung des Geländes in den Planquadraten Q625-400 fortgesetzt und in Q625-410 sowie Q625-415 aufgenommen.
2.1 Planquadrat Q625-410, Q625-415
In diesem Grabungsabschnitt sind 1973 Reste einer Aschenlage bzw. einer Brandzerstörung beobachtet worden18. In Erwartung ähnlich reicher früheisenzeitlicher und archaischer Funde wie 2011 (Q615-410 und Q620-410) wurden nach einer Reinigung die Arbeiten in den benachbarten Grabungsabschnitten Q625-410 und Q625-415 fortgesetzt19 (Abb. 2).
Von besonderem Interesse für die spätbronzezeitliche Besiedlung war eine Ansammlung von Gefäßen, die auf einem dem Feuer ausgesetzten Fußboden aus festgetretenem Mergel lag. Sie wurden in der nordöstlichen Ecke des Planquadrats gefunden, in einem Bereich, den die
16 Abb. 6, 3: Q610-420/017-001 (KLQ 34); 6, 4: Q610-420/018-006 (KLQ 43); vgl. zum Fransendekor etwa: Alzinger u. a. 1985, 418 mit Anm. 52 Abb. 17. 18, 2; 19, 2; Gauß 2009, 179 Abb. 10, 7. 8.
17 Zuletzt zur HGW-Keramik aus Aigeira mit weiterführender Lit.: Jung 2006, 43 – 46; s. auch Rutter 1990. 18 Dies kann aus der Grabungsdokumentation geschlossen werden; s. auch Alzinger 1974, 160 – 162. 19 Gauß u. a. 2012, 38 – 39 Abb. 6.
77Aigeira 2012
Grabungen der 1970-iger Jahre nicht erreicht hatten. Bislang konnten zwei fast vollständige Gefäße geborgen werden, eine Knickwandkylix auf niedrigem Fuß, die aufgrund derzeitiger stratigrafischer Beobachtungen der Phase SH IIIC Mitte zugewiesen werden kann, und eine handgemachte Kanne mit flachem Boden, vertikalem Henkel und eingedrücktem Ausguss (Abb. 7)20. Die Reste eines weiteren wahrscheinlich handgemachten Gefäßes zeichnen sich im Erdprofil ab. Die Vergesellschaftung von HGW und scheibengedrehter mykenischer Keramik ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich21, allerdings handelt es sich nur in seltenen Fällen um mehr oder weniger vollständig erhaltene Gefäße22.
Unter dem erwähnten Boden konnten die Reste eines weiteren Bodens aus festgetretenem Mergel festgestellt werden, und darunter kam eine graue stark verbrannte Aschenlage zu Tage, wahrscheinlich noch ein weiterer verbrannter Boden. Die Grabungen wurden mit dem Erreichen der stark verbrannten Aschenlage eingestellt und sollen 2013 fortgesetzt werden.
Die Abfolge der spätbronzezeitlichen Fußbodenhorizonte im Grabungsbereich Q625-415 ist von großer Bedeutung. Sie zeigt klar, dass die Siedlung der späten Bronzezeit am Sattel auf Terrassen angelegt war, die wahrscheinlich dem Verlauf des natürlichen Bodens (Mergel) folgten. Zum anderen zeichnet sich ab, dass hier, wie auch im weiter südlich und tiefer gelegenen Grabungsabschnitt Q625-400 (s. im Folgenden) mit mindestens zwei architektonischen und chronologisch klar aufeinanderfolgenden Siedlungsphasen zu rechnen ist.
2.1.1 Planquadrat Q625-400Im Jahr 2011 wurden die wichtigsten prähistorischen Reste im Grabungsbereich Q625-400 fest-gestellt (Abb. 2)23. Es konnte eine Abfolge von SH IIIC-zeitlichen Böden beobachtet werden, die erstmals zweifelsfrei zeigte, dass der Bereich des Sattels in der späten Bronzezeit besiedelt war. Die Grabungen mussten 2011 vor Erreichen des natürlichen Bodens (Mergel) unterbrochen
20 Abb. 7, 1: Q625-415/013-001 (KLQ 54); 7, 2: Q625-415/013-002 (KLQ 54). Die Knickwandkylix ist auf der Au-ßen- und Innenseite vollständig bemalt, mit einem ausgesparten Band innen am Rand sowie außen unterhalb des Knicks und am Stiel. Zur Gefäßform s. Podzuweit 2007, 109 – 111.
21 Vgl. etwa Tiryns: Kilian 2007, 50. 22 Weitgehend erhaltene HGW und scheibengedrehte mykenische Keramik etwa aus Korakou, ›Beirut Section‹ (Rut-
ter 1974, 399 – 401, CP377. CP2779. CP2780) und Korakou, ›House L, phase 3‹ (Rutter 1974, 112 – 117, CP130. CP135. CP255).
23 Gauß u. a. 2012, 39 – 40 Abb. 3. 5. 7.
1 2
7 Planquadrat Q625-415, Keramik aus Gefäßansammlung nach der Restaurierung
78 Walter Gauss u. a.
werden. Zudem war der Verlauf von zwei mit verstürzten Steinen bedeckten Strukturen nicht klar. Im Jahr 2012 wurden die Arbeiten fortgesetzt. Nach dem Entfernen der verstürzten Steine zeichnete sich der Verlauf von zwei nebeneinanderliegenden massiven spätbronzezeitlichen Mauern klar ab (Abb. 2).
Die erste Analyse der Keramik zeigt, dass die beiden spätbronzezeitlichen Mauern zu unterschiedlichen Phasen von SH IIIC gehören und wahrscheinlich sogar aufeinanderfolgen. Die für die stratigrafische Abfolge wichtigsten Abhübe enthalten aussagekräftige Keramik der Phasen SH IIIC Mitte bis SH IIIC Spät (Abb. 8)24. Es scheint, also ob im Grabungsabschnitt Q625-400 mit einer Reihe von aufeinanderfolgenden Bauphasen mit anschließender Zerstörung zu rechnen ist. Im Zuge der Zerstörung dürfte dabei das Baumaterial des vorhergehenden Baus teilweise wieder verwendet worden sein; dies würde auch den schlechten Erhaltungszustand der älteren Reste erklären.
3. Geophysikalische Messungen
2012 wurden in Aigeira erstmals geophysikalische Messungen durchgeführt, die sich auf das östlich der Akropolis gelegene Plateau und den Bereich des Theaters konzentrierten (Abb. 9)25. Von den angewandten Methoden lieferten Geoelektrik und Georadar die aufschlussreichsten Ergebnisse, während mit der Geomagnetik nur eingeschränkt Informationen gewonnen wurden26.
Im östlichen Teil des Plateaus zeichnen sich nach den Messungen zwei unterschiedliche Bereiche klar ab (Abb. 9). Der nördlichere Teil besteht aus einer mehrere Meter starken Auffüllung aus Erd- und Steinmaterial. In diesem Bereich konnten bis in eine Tiefe von ca. 3,5 – 4 m keine Anomalien festgestellt werden. Dies bestätigt auch ein 1976 im Bereich des östlichen Plateaus angelegter, ungefähr Nord-Süd verlaufender Suchschnitt. Im nördlichen Teil stieß man erst in einer Tiefe von etwa 4 m unter dem heutigen Gehniveau auf eine Kulturschicht, die große Mengen chalkolithischer Keramik, aber auch spätmykenische und spätbronzezeitliche handgemachte Keramik enthielt27.
Im südlicheren Teil konnten dagegen zahlreiche Anomalien aufgrund ihrer höheren Widerstände gemessen werden. Neben mehreren linearen Strukturen mit schwachen Signalwerten zeichnet
24 Abb. 8, 1: Q625-400/033-001 (KLQ 22); 8, 2: Q625-400/034-003 (KLQ 32); 8, 3: Q625-400/027-001 (KLQ 22). 25 Die geophysikalischen Untersuchungen finden im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit dem Institut für Geo-
wissenschaften, Abteilung für Geophysik der Christian-Albrechts-Universität Kiel statt. 26 Geomagnetik: Magnetometer-Array mit 4-6 Fluxgate Sonden der Firma Dr. Förster (Sondentyp Ferrex DLG
4.032.82); Georadar: SIR-20 Apparatur der Firma GSSI (Antennen bei 400 MHz); Geoelektrik: RESECS-Mehr-kanal-Apparatur der Firma GEOSERVE (Konfiguration nach Dipol-Dipol-Methode, Wenner-alpha und Wenner-beta).
27 Alram-Stern – Deger-Jalkotzy 2006, 21.
2 3
8 Mykenische und HGW-Keramik aus Q625-400
1
80 Walter Gauss u. a.
sich hier besonders eine sehr markante ca. 10 × 7 m große Struktur ab, die in einer Tiefe von ca. 1,5 m unter der heutigen Oberfläche liegt (Abb. 9).
Im westlichen Bereich des Plateaus, in unmittelbarem Anschluss an die derzeitigen Grabungsflächen wurden zahlreiche lineare Strukturen (wahrscheinlich Mauerzüge) erkannt, die z. T. unmittelbar unter der Erdoberfläche liegen. Somit dürften die teilweise an der Oberfläche sichtbaren Reste einer Ost-West orientierten Mauer noch deutlich weiter nach Osten verlaufen, als bisher angenommen. Weitere Mauern sind ungefähr Nord-Süd orientiert und liegen auf einem deutlich tieferen Niveau (Abb. 9).
Die Messungen im Bereich des Theaters lieferten ebenfalls interessante erste Ergebnisse. So konnten im zentralen Bereich des archäologischen Geländes keine auffallenden Anomalien festgestellt werden, wohingegen sich besonders im Bereich zwischen dem Tycheion und Tempel F lineare Strukturen zeigten, die wahrscheinlich die Fortsetzung teilweise freigelegter Mauerzüge darstellen. Die Messungen sollen hier fortgesetzt werden, um weitere Aufschlüsse über den Verlauf der Strukturen zu erhalten28.
4. Neuaufnahme von Tempel E und Tempel F
Im Rahmen der Aufarbeitung der Funde aus den Grabungen der 1970-iger Jahre sollen auch die hellenistischen Naiskoi (Tempel D, E und F) neu bearbeitet und veröffentlicht werden. Zu diesem Zweck wurde 2012 die zeichnerische Dokumentation von Tempel E fortgesetzt und jene von Tempel F begonnen. Im Zuge der Vermessungs- und Zeichenarbeiten konnte auch der Rest des von Otto Walter 1916 teilweise ausgegrabenen Gebäudes C zweifelsfrei identifiziert werden (Abb. 10)29. Die erneute Freilegung des Gebäudes C und die der ebenfalls von O. Walter nur teilweise erforschten Bauten A und B ist für die nächsten Jahre geplant30.
5. Aufarbeitung der Altfunde aus dem Bereich der Naiskoi und des Tycheions sowie von ›Palati‹
Im Jahr 2012 konzentrierten sich die Durchsicht und Organisation der Funde auf zwei Bereiche: das sog. Tycheion (Abb. 1, 4), das südlich des Theaters liegt und von W. Alzinger in den 1980-iger Jahren teilweise freigelegt worden war, und den Grabungsbereich ›Palati‹ (Abb. 1, 5), der im nördlichen Stadtbereich nahe der hellenistischen Umfassungsmauer liegt.
5.1 ›Palati‹
Bereits in den Reiseberichten des späteren 19. Jahrhunderts werden die gut erhaltenen Terras-sierungen im Bereich von ›Palati‹ erwähnt31. Von O. Walter stammen die ersten ausführlicheren Beschreibungen32, Grabungen wurden unter W. Alzinger zwischen 1980 und 1982 begonnen, aber nicht abgeschlossen33. Die gut erhaltenen Terrassenmauern, die das Areal an der Nord- und Ostseite einfassen, dürften bereits in hellenistischer Zeit errichtet worden sein34. Die Grabungen
28 Nach Abschluss der für 2013 geplanten Messungen soll ein ausführlicher Bericht zu den angewandten Methoden und ersten Ergebnissen der Messungen veröffentlicht werden.
29 Walter 1916/1917; Walter 1932. 30 Walter 1916/1917; Walter 1932. 31 Von Duhn 1878, 61. 32 Walter 1916/1917, 31 – 34. 33 E. Lanschützer in: Alzinger u. a. 1986, 309 – 314. 34 E. Lanschützer in: Alzinger u. a. 1986, 311 – 312.
82 Walter Gauss u. a.
legten Reste einer Hallenanlage aus römischer Zeit frei35 sowie die Reste eines etwas tiefer lie-genden, wahrscheinlich älteren Fundaments36.
Bislang konnten 116 Fundgruppen dem Grabungsbereich ›Palati‹ zugewiesen werden37. Die Funde gehören überwiegend in späthellenistische Zeit (2. und frühes 1. Jh. v. Chr.). Besonders auffallend, auch im Vergleich zu den Funden aus dem Bereich des Theaters und der Naiskoi, sind die zahlreichen Fragmente von Trinkgefäßen und der im Verhältnis geringere Anteil an Gebrauchskeramik sowie die zahlreichen Tierknochen.
Hellenistische Glanztonware ist schwächer vertreten als im Bereich des Theaters und der Naiskoi. Am ›Palati‹ sind besonders Fragmente kleiner Knickwandschalen charakteristisch (Abb. 11, 1)38. Auch Keramik mit Westabhangdekor ist relativ selten, wobei fast ausschließlich Fragmente vorhanden sind, die Ritzung und Malerei kombinieren oder nur Ritzdekor zeigen (Abb. 11, 2 – 3)39. Fast alle Fundgruppen enthielten kleine Fragmente von Reliefbechern, aber anders als im Bereich des Theaters keine Model40. Der überwiegende Teil der Reliefbecher stammt, sieht
35 E. Lanschützer in: Alzinger u. a. 1986, 312. 36 E. Lanschützer in: Alzinger u. a. 1986, 314. 37 Zur Definierung der Fundgruppe s. Gauß u. a. 2012, 41 Anm. 21. 38 Abb. 11, 1: FG02098-001; vgl. Edwards 1975, Taf. 3, 74 (ca. 250 v. Chr.); Rotroff 1997, Abb. 60, 903 (150 – 125 v.
Chr.). 39 Abb. 11, 2: FG02014-011; 11, 3: FG02049-008. Zum kombinierten Dekor vgl. Rotroff 1997, Taf. 96, 1279. 1280
(120 – 86 v. Chr.). 40 Gauß u. a. 2012, 41 Abb. 8, 4 – 5.
1 2 3
4 5 6 7
1098
11 Funde vom ›Palati‹
83Aigeira 2012
man von einigen wenigen Fragmenten von Blattkelchbechern ab (Abb. 11, 4)41, von Langblatt- oder Zungenbechern (Abb. 11, 5)42, die zur spätesten Gruppe der Reliefbecher gehören und zeitlich nicht vor dem ausgehenden 2. und beginnenden 1. Jahrhundert v.Chr. anzusetzen sind43.
Die jüngsten Funde vom ›Palati‹ gehören in den Übergang zur frühen Kaiserzeit. Sie sind bislang nur in geringer Zahl und in wenigen Fundgruppen vertreten. Charakteristisch sind Fragmente von dünnwandig unbemalten Bechern, Trichterrandbechern mit Überzug, Kragenrandschalen mit Ratter- oder Kerbdekor und Teller oder Platten mit hochgestelltem Rand in Grauer Ware oder in rotem Glanzton (Abb. 11, 6 – 10)44.
5.2 ›Tycheion‹
Bei den Grabungen im Bereich des Theaters wurde der Baukomplex des sog. Tycheions in den 1980-iger Jahren unter W. Alzinger teilweise freigelegt45. Im Jahr 2012 konnten 616 Fundgrup-pen dem Tycheion zugeordnet werden. Die Funde zeigen gegenüber jenen aus dem Theater und der Naiskoi bzw. vom ›Palati‹ ein verändertes Bild: Ungestörte Kontexte aus hellenistischer bis späthellenistischer Zeit sind sehr selten. Der Großteil der Funde gehört der römischen Epoche an, und zwar überwiegend der fortgeschrittenen Kaiserzeit. Eine klare Trennung zwischen mit-telrömischem und spätrömischem Material konnte bislang nicht getroffen werden.
Die für den Hellenismus typische helltonige und feine Keramik verschwindet fast vollkommen und Keramik aus gröberem und dunklerem Ton, der im Hellenismus vor allem für Kochkeramik verwendet wurde, ist nun dominant. Die vermehrt festgestellten Fehlbrände gehören ausschließlich zu römischen Formen.
Im Unterschied zu den wenigen rein hellenistischen Kontexten mit Fragmenten von Kantharoi, Skyphoi, Schalen und Tellern ist das Spektrum des römischen Tafelgeschirrs stark eingeschränkt. Am häufigsten vertreten sind die dünnwandige unbemalte Keramik und die Feinware mit Überzug (Abb. 12, 1 – 3)46. Fehlbrände zeigen, dass diese Keramikgattung in der mittleren Kaiserzeit lokal in Aigeira hergestellt wurde. Bei den deutlich weniger häufigen Sigillaten handelt es sich in erster Linie um italische Importe der frühen Kaiserzeit (Abb. 12, 4)47. Im Vergleich dazu ist der Anteil der wahrscheinlich lokal hergestellten Keramik hoch; ihre Formen lassen sich von den Sigillaten ableiten, wie etwa Kragenrandschalen mit rotem Überzug und Ratterdekor (Abb. 12, 5)48 oder Teller mit aufgestelltem Rand oder Steilrand. Die ebenfalls zu den charakteristisch römischen Funden gehörenden Schüsseln mit sog. Spachteldekor sind in Aigeira bislang nur vereinzelt vertreten (Abb. 12, 6)49.
Unter den Importen sind besonders die kleinen Fragmente von afrikanischer Sigillata bemerkenswert. Sie können aufgrund von Vergleichsbeispielen in die mittel- bis spätrömische Kaiserzeit datiert werden50. Ebenfalls importiert und bislang nur in geringer Anzahl vertreten sind sog. Pompejanisch Rote Platten (Abb. 12, 7), die z. T. auch als Backplatten verwendet werden konnten (Abb. 12, 8)51.
41 Abb. 11, 4: FG02029-010. 42 Abb. 11, 5: FG02029-008. 43 Zur Datierung der Langblattbecher s. Rotroff 1982, 34 – 36; Smetana-Scherrer 1982, 81. 44 Abb. 11, 6: FG02043-001; 11, 7: FG02001-004; 11, 8: FG02093-001; 11, 9: FG02090-007; 11, 10: FG01996-004.
Zur sog. Grauen Ware vgl. Hayes 2008, 59 – 62 Abb. 29, 905 (ca. 50 – 25 v. Chr.). 45 Zusammenfassend Hagn 2001. 46 Abb. 12, 1: FG02332-005; 12, 2: FG02477-003; 12, 3: FG02320-001; vgl. Abadie-Reynal 2007, 201 Taf. 49, 329,
2; 330, 1. 47 Abb. 12, 4: FG02415-001; vgl. Ettlinger u. a. 1990, 68 Form 10, Taf. 9. 10, 1. 2. 48 Abb. 12, 5: FG02371-001. 49 Abb. 12, 6: FG02368-001. Die im Museum von Patras ausgestellten Exemplare dokumentieren die regionale Ver-
breitung. 50 Hayes 2008, 221 Abb. 31, 990 (3./4. Jh. n.Chr.). 51 Abb. 12, 7: FG02311-001, 12, 8: FG02712-001. Allgemein s. Peacock 1977, 147 – 162.
84 Walter Gauss u. a.
Als Leitform für die römische Epoche (früh- bis mittelrömisch) kann die Schüssel angesehen werden. Sie ist in den unterschiedlichsten Formen in Aigeira besonders zahlreich vertreten (Abb. 13, 1)52. Krüge, Kannen oder Tischamphoren sind im Fundmaterial ebenfalls häufig vorhanden. Die für die hellenistische Keramik typischen ausbiegenden Ränder fehlen; charakteristisch sind dagegen Wulstränder oder kurze flache Ränder, die teilweise gerillt sind. Auch die meistens dreifach kantig gerillten Henkel und die profilierten Standflächen sind ein weiterer Hinweis
52 Abb. 13, 1: FG02492-002; Abadie-Reynal 2007, 203 Taf. 49, 332 (1. Hälfte 1. Jh. n. Chr.).
1 2 3
45
6
8
7
12 Keramik (Tafelgeschirr) aus dem Bereich des Tycheions
85Aigeira 2012
auf eine Entstehung in römischer Zeit (Abb. 13, 2 – 3)53. Erstaunlich ist, dass die im Bereich des Theaters häufig festgestellten Mortarien unter den Funden des Tycheions vollkommen fehlen.
Besonders bemerkenswert sind auch die z. T. sehr individuell gestalteten Fragmente von Thymiaterien, die bislang ausschließlich aus dem Bereich des Tycheions stammen. Einige der Fragmente können aufgrund von Vergleichen in das 1. Jahrhundert n. Chr. datiert werden (Abb. 13, 4)54, andere sind so individuell gestaltet, dass bislang keine Vergleichsbeispiele gefunden wurden.
Der Anteil der Kochkeramik in den Fundgruppen des Tycheions ist im Verhältnis zur Gebrauchskeramik relativ gering. Wie die zahlreichen Fehlbrände aus dem Bereich des Theaters und des Tycheions zeigen, wurde Kochkeramik seit dem Hellenismus bis in die spätrömische Zeit in Aigeira lokal hergestellt. Gegenüber ihren hellenistischen Vorläufern wird die römische Kochkeramik durch scharfe Umbrüche und Knicke insbesondere auf der Innenseite des Randes charakterisiert. Die Gefäße haben häufig eine nach innen abgeschrägte Lippe und eine einzelne Rille außen, knapp unter dem Rand, aber auch an der Gefäßwandung (Abb. 14, 1)55. Kochtöpfe mit Deckelauflage und einem auffällig dreieckig ausgezogenen Rand mit gerillter Lippe treten sehr vereinzelt auf und sind anhand von Vergleichsbeispielen ausschließlich in das 1. Jahrhundert n. Chr. zu datieren (Abb. 14, 2)56. Erstmals im Fundmaterial von Aigeira belegt, ist eine sehr kleine Pfannenform mit aufgestelltem Rand und geteilter Lippe (Abb. 14, 3)57. S. Rotroff datiert Vergleichsbeispiele in späthellenistische Zeit und erwähnt für die Athener Agora die vereinzelte Vergesellschaftung mit frührömischen Funden58. Die mittlere und späte Kaiserzeit ist durch einige
53 Abb. 13, 2: FG02569-2; 13, 3: FG02592-001. 54 Abb. 13, 4: FG02532-003; vgl. Slane 1990, 68 – 69 Abb. 14 Kat. 145 – 146 (1. Jh. n. Chr.). 55 Abb. 14, 1: FG02462-007; vgl. Slane 1986, Abb. 6, 22. 56 Abb. 14, 2: FG02571-001; vgl. Lüdorf 2006, Taf. 9, T101. 57 Abb. 14, 3: FG02464-004; vgl. Di Giovanni 1996, 78 tipo 2130 (mit älterer Lit.). 58 Vgl. Rotroff 2006, 193 Abb. 89, 702 – 704.
1
2
3 4
13 Keramik (Gebrauchskeramik) aus dem Bereich des Tycheions
86 Walter Gauss u. a.
wenige charakteristische Kochtopfformen vertreten, die in zahlreichen Fundgruppen nachgewiesen sind. Hierzu zählen vor allem Töpfe mit enger Mündung, blockartig verdicktem, geteiltem Rand und vertikalen Bandhenkeln (Abb. 14, 4)59. Lopas- oder Kasserollenformen bleiben lange dem hellenistischen Formenspektrum verbunden und können nur in den seltensten Fällen als eindeutig römisch angesprochen werden. Umso wichtiger ist das fast vollständige Profil einer römischen Kasserolle mit Flachrand, das einen besonderen Scherbentyp aufweist und wahrscheinlich ein Import ist (Abb. 14, 6)60.
Im Tycheion wurde eine relativ große Zahl von Transportamphoren festgestellt. Die bisher gewonnen Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass in der römischen Kaiserzeit auf der nördlichen Peloponnes ein größeres Produktionszentrum für Transportamphoren mit charakteristischen Formen existiert haben muss. Dabei zeigen die Fehlbrände, dass auch in Aigeira zumindest in eingeschränktem Umfang Transportamphoren hergestellt wurden.
6. Ausblick
Die Grabungen von 2012 erbrachten wichtige neue Erkenntnisse zur spätbronzezeitlichen Sied-lung von Aigeira. Dies gilt insbesondere für die massive Befestigungsmauer am östlichen Hang, die nach gegenwärtiger Kenntnis in SH IIIC Mitte oder sogar SH IIIC Spät errichtet wurde. Ihr Bau geht mit großer Wahrscheinlichkeit mit der Neuanlage der Akropolis (Siedlungsphase II) nach der massiven Brandzerstörung (Siedlungsphase Ib) einher. Im Unterschied zu anderen befestigten Siedlungen der Späten Bronzezeit handelt es sich in Aigeira um eine neu angelegte Befestigung; Reste einer älteren Befestigungsmauer konnten bislang nicht identifiziert werden. Unter der Befestigung wurden aber die Reste von älterer Architektur identifiziert, wahrscheinlich ein spätbronzezeitliches Haus. Dies zeigt, dass der östliche Abhang der Akropolis zumindest
59 Abb. 14, 4: FG02329-002; vgl. ähnlich Slane – Sanders 2005, 252 Abb. 3/1-35 (1. Hälfte 5. Jh. n. Chr.). 60 Abb. 14, 6: FG02319-009; vgl. Di Giovanni 1996, 82 – 89 tipo 2210.
14 Keramik (Kochkeramik) aus dem Bereich des Tycheions
1 2
3
654
87Aigeira 2012
teilweise bebaut war. Die Frage der Nutzung des Hangs soll durch die Fortsetzung der Grabung geklärt werden, ebenso wie die Frage, an welcher Stelle der Zugang zur spätbronzezeitlichen Akropolis lag.
Die Grabungen am tiefer gelegenen ›Sattel‹ belegen eine intensive Nutzung während der jüngsten Phase der Späten Bronzezeit (SH IIIC). Dabei ist allerdings noch unklar, ob die massive Brandzerstörung auf der Akropolis auch am ›Sattel‹ in dieser Intensität nachgewiesen werden kann. Einige Indizien sprechen dafür, dass die hier gelegene Siedlung (›Unterstadt‹) durch mindestens einen Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Fortsetzung der Grabungen wird hoffentlich Klarheit darüber bringen, ob die am ›Sattel‹ in verschiedenen Bereichen beobachteten, z. T. starken Brandspuren synchronisiert werden können und mit der Brandzerstörung auf der Akropolis gleichzeitig sind.
Die ersten geophysikalischen Untersuchungen in Aigeira zeigten im Bereich des östlich der Akropolis gelegenen Plateaus zahlreiche lineare Anomalien, die teilweise in größerer Tiefe liegen und vermutlich zur spätbronzezeitlichen Siedlung gehören. Von besonderem Interesse ist dabei die Entdeckung einer rund 7 × 10 m großen, ungefähr viereckigen Anomalie im Zentrum des Plateaus. Beim Theater konnten ebenfalls zahlreiche lineare Anomalien vor allem zwischen Tempel F und dem Tycheion nachgewiesen werden, die auf eine intensive Bebauung deuten, wohingegen der Bereich unmittelbar vor dem Theater nicht verbaut war.
Die Bauaufnahme und Baubeschreibung der hellenistischen Tempel E und F wurde fortgesetzt. Besonders wichtig für die Topografie des Platzes ist die erneute Identifizierung von Bau C, einem Gebäude, das von O. Walter teilweise ausgegraben, dessen genaue Lage aber seitdem unbekannt war.
Die Fortsetzung der Materialdurchsicht und Aufarbeitung der Funde aus den Grabungen der 1970- und 1980-iger Jahre (Theater, Naiskoi, ›Palati‹ und Tycheion) brachten wichtige neue Erkenntnisse zur Chronologie und Nutzung dieser Bereiche. Durch den hohen Anteil von qualitätsvoller hellenistischer Feinkeramik unterscheiden sich die Funde vom ›Palati‹ von jenen aus dem Bereich des Theaters. Aus dem Tycheion stammt überwiegend Keramik der römischen Kaiserzeit. Hier ist besonders interessant, dass Fehlbrände eine lokale Produktion bis in die mittlere Kaiserzeit belegen. Die Fortsetzung der Arbeiten wird sicher wichtige neue Aufschlüsse zur zeitlichen Einteilung und Abfolge der verschiedenen Bauphasen des Tycheions liefern.
Abgekürzt zitierte Literatur
Abadie-Reynal 2007 C. Abadie-Reynal, La céramique romaine d’Argos. (fin du IIe siècle avant J.-C. – fin du IVe siècle après J.-C.), Études péloponnésiennes 13 (Athen 2007).
Alram-Stern 2003 E. Alram-Stern, Ageira – Acropolis: The Stratigraphy, in: S. Deger-Jalkotzy – M. Zavadil (Hrsg.), LH III C Chronology and Synchronisms. Proceedings of the International Workshop held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, May 7th and 8th, 2001, VMykKomm (Wien 2003) 15 – 21.
Alram-Stern – E. Alram-Stern – S. Deger-Jalkotzy (Hrsg.), Aigeira I. Die mykenische Akropolis. Deger-Jalkotzy 2006 Faszikel 3. Vormykenische Keramik, Kleinfunde, archäozoologische und
archäobotanische Hinterlassenschaften, naturwissenschaftliche Datierungen, SoSchrÖAI 43 (Wien 2006).
Alzinger 1974 W. Alzinger, Ausgrabungen in Aigeira 1973, AAA 7, 1974, 157 – 162.Alzinger u. a. 1985 W. Alzinger – E. Alram-Stern – S. Deger-Jalkotzy, Aigeira-Hyperesia und die Siedlung
Phelloë in Achaia. Österreichische Ausgrabungen auf der Peloponnes 1972 – 1983. Teil I: Akropolis, Klio 67, 1985, 389 – 451.
Alzinger u. a. 1986 W. Alzinger – E. Lanschützer – G. C. Neeb – R. Trummer, Aigeira-Hyperesia und die Siedlung Aigeira-Hyperesia und die Siedlung Phelloë in Achaia. Österreichische Ausgrabungen auf der Peloponnes 1972 – 1983. Teil III: Palati, zur Wasserversorgung, Phelloë, Klio 68, 1986, 309 – 347.
Bammer 1997 A. Bammer, Aigeira, ÖJh 66, 1997, Beibl. 49 – 56.Blegen u. a. 1964 C. W. Blegen – H. Palmer – R. S. Young, The North Cemetery, Corinth 13 (Princeton,
N.J. 1964).
88 Walter Gauss u. a.
Coldstream 1968 J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery. A Survey of ten Local Styles and their Chronology (London 1968).
Deger-Jalkotzy 2003 S. Deger-Jalkotzy, Stratified deposits from the Late Helladic IIIC settlement at Aigeira/Achaia, in: S. Deger-Jalkotzy – M. Zavadil (Hrsg.), LH III C Chronology and Synchronisms. Proceedings of the International Workshop held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, May 7th and 8th, 2001, VMykKomm (Wien 2003) 53 – 75.
Di Giovanni 1996 V. Di Giovanni, Produzione e consumo di ceramica da cucina nella Campania Romana (II a.C.–II d.C.), in: M. Bats (Hrsg.), Les céramiques communes de Campanie et de Narbonnaise: (Ier s. av. J.-C. – IIe s. ap. J.-C.); la vaisselle de cuisine et de table. Actes des journees d’étude organisées par le Centre Jean Bérard et la Soprintendenza Archeologica per le Province di Napoli e Caserta, Collection du Centre Jean Bérard (Bonn 1996) 65 – 103.
von Duhn 1878 F. von Duhn, Bericht über eine Reise in Achaia, AM 3, 1878, 60 – 81.Ettlinger u. a. 1990 E. Ettlinger – B. Hedinger – B. Hoffmann – P. M. Kenrick – G. Pucci – K. Roth-Rubi –
G. Schneider – S. von Schnurbein – C. M. Wells – S. Zabehlicky-Scheffenegger, Conspectus Formarum Terrae Sigilatae Italico Confectae, Materialien zur römisch-germanischen Keramik 10 (Bonn 1990).
Evely 2006 D. Evely (Hrsg.), Lefkandi 4. The Bronze Age. The Late Helladic IIIC Settlement at Xeropolis, BSA Supplement 39 (London 2006).
Gauß u. a. 2012 W. Gauß – R. Smetana – J. Dorner – P. Eitzinger – A. Galik – A. Kurz – A. Lätzer-Lasar – M. Leibetseder – C. Regner – A. Tanner – M. Trapichler – G. Weißengruber, Aigeira 2011. Bericht zu Aufarbeitung und Grabung, ÖJh 81, 2012, 33 – 50.
Gauß 2009 W. Gauß, The Last Mycenaeans at Aigeira and Their Successors, in: S. Deger-Jalkotzy – A. Elisabeth Bächle (Hrsg.), LH IIIC Chronology and Synchronisms III. LH IIIC Late and the Transition to the Early Iron Age. Proceedings of the International Workshop Held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, February 23rd and 24th, 2007, VMykKomm (Wien 2009) 163 – 182.
Giannopoulos 2008 T. G. Giannopoulos, Die letzte Elite der mykenischen Welt. Achaia in mykenischer Zeit und das Phänomen der Kriegerbestattungen im 12.–11. Jahrhundert v. Chr., UPA152 (Bonn 2008).
Hagn 2001 T. Hagn, Das Tycheion von Aigeira und daran anschließende Bauten, in: J.-Y. Marc – J.-C. Moretti (Hrsg.), Constructions Publiques et Programmes Édilitaires en Grèce entre le IIe siècle av. J.-C. et le Ier siècle ap. J.-C. Actes du Colloque organisé par l’École Française d’Athènes et le CNRS, Athènes 14 – 17 Mai 1995, BCH Suppl. 39 (Athen 2001) 297 – 311.
Hayes 2008 J. W. Hayes, Roman Pottery. Fine-ware Imports, Agora 32 (Princeton, N.J. 2008).Hope Simpson – Hagel 2006 R. Hope Simpson – D. K. Hagel, Mycenaean fortifications, highways, dams and canals,
SIMA 133 (Sävedalen 2006).Jung 2006 R. Jung, Χρονολογία Comparata. Vergleichende Chronologie von Südgriechenland und
Süditalien von ca. 1700/1600 bis 1000 v.u.Z., VMykKomm 26 (Wien 2006).Kilian 2007 K. Kilian, Die handgemachte geglättete Keramik mykenischer Zeitstellung, Tiryns 15
(Wiesbaden 2007).Lüdorf 2006 G. Lüdorf, Römische und frühbyzantinische Gebrauchskeramik im westlichen
Kleinasien. Typologie und Chronologie, Internationale Archäologie 96 (Rahden 2006).Mountjoy 1999 P. A. Mountjoy, Regional Mycenaean Decorated Pottery (Rahden/Westf. 1999).Nowicki 2000 K. Nowicki, Defensible sites in Crete c. 1200 – 800 B.C. (LM IIIB/IIIC through early
geometric), Aegaeum 21 (Liège 2000).Peacock 1977 D. P. S. Peacock, ›Pompejan red ware‹, in: D. Philip Spencer Peacock (Hrsg.), Pottery
in early commerce: Characterization and trade in Roman and later ceramics (London 1977) 147 – 162.
Podzuweit 2007 C. Podzuweit, Studien zur spätmykenischen Keramik, Tiryns 14 (Wiesbaden 2007).Rotroff 1982 S. I. Rotroff, Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Moldmade Bowls, Agora 22
(Princeton, N.J. 1982).Rotroff 1997 S. I. Rotroff, Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Tableware and
Related Material, Agora 29 (Princeton, N.J. 1997).Rotroff 2006 S. I. Rotroff, Hellenistic pottery. The plain wares, Agora 32 (2006).Rutter 1974 J. B. Rutter, The Late Helladic III B and III C periods at Korakou and Gonia in
the Corinthia (Ph.D. Thesis, University of Pennsylvania) Universtiy Microfilms International 75-2771 (Ann Arbor, MI 1974).
Rutter 1979 J. B. Rutter, The Last Mycenaeans at Corinth, Hesperia 48, 1979, 348 – 392.Rutter 1990 J. B. Rutter, Some comments on interpreting the dark-surfaced handmade burnished
pottery of the 13th and 12th century B.C. Aegean, JMedA 3, 1990, 29 – 48.
89Aigeira 2012
Slane 1986 K. W. Slane, Two deposits from the Early Roman cellar building, Corinth, Hesperia 55, 1986, 271 – 318.
Slane 1990 K. W. Slane, The sanctuary of Demeter and Kore. The Roman pottery and lamps, Corinth 18, 2 (Princeton, NY 1990).
Slane – Sanders 2005 K. W. Slane – G. D. R. Sanders, Corinth. Late Roman horizons, Hesperia 74, 2005, 243 – 297.
Smetana-Scherrer 1982 R. Smetana-Scherrer, Spätklassische und Hellenistische Keramik, Alt-Ägina 2, 1 (Mainz 1982) 56 – 91.
Sokolicek 2009 A. Sokolicek, Diateichismata. Zu dem Phänomen innerer Befestigungsmauern im griechischen Städtebau, ErghÖJh 11 (Wien 2009).
Walter 1916/1917 O. Walter, Eine archäologische Versuchsgrabung in Aigeira, ÖJh 19/20, 1916/1917, Beibl. 5 – 42.
Walter 1932 O. Walter, Versuchsgrabung in Aigeira, ÖJh 27, 1932, Beibl. 223 – 234.
Dr. Walter GaußÖsterreichisches Archäologisches Institut, Zweigstelle Athen, Leoforos Alexandras 26, GR-10683 AthenE-Mail: [email protected]
Dr. Rudolfine SmetanaFachbereich Altertumswissenschaften, Klassische und Frühägäische Archäologie, Universität Salzburg, Residenzplatz 1, A-5020 SalzburgE-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Jeremy B. RutterDepartment of Classics, Dartmouth College, 6086 Reed Hall Room 201, US-Hanover, NH 03755E-Mail: [email protected]
Julia Dorner, M.A.Institut für Klassische Archäologie, Universität Wien, Franz Klein-Gasse 1, A-1190 WienE-Mail: [email protected]
Petra Eitzinger, M.A.Fachbereich Altertumswissenschaften, Klassische und Frühägäische Archäologie, Universität Salzburg, Residenzplatz 1, A-5020 SalzburgE-Mail: [email protected]
Dip. Geophys. Christina KleinInstitut für Geowissenschaften, Abteilung für Geophysik, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Otto-Hahn-Platz 1, D-24118 KielE-Mail: [email protected]
Mag. Andrea KurzFachbereich Altertumswissenschaften, Klassische und Frühägäische Archäologie, Universität Salzburg, Residenzplatz 1, A-5020 SalzburgE-Mail: [email protected]
Asuman Lätzer-Lasar, M.A.Internationales Kolleg Morphomata, Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, D-50923 KölnE-Mail: [email protected]
90 Walter Gauss u. a.
Manuela Leibetseder, M.A.Fachbereich Altertumswissenschaften, Klassische und Frühägäische Archäologie, Universität Salzburg, Residenzplatz 1, A-5020 SalzburgE-Mail: [email protected]
Mag. Christina RegnerDöbereinerstraße 1, D-81247 MünchenE-Mail: [email protected]
Dr. Harald StümpelInstitut für Geowissenschaften, Abteilung für Geophysik, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Otto-Hahn-Platz 1, D-24118 KielE-Mail: [email protected]
Dipl. Arch. ETH Alexandra Tanner, M.A.Institut für Geschichte und Theorie der Architektur (gta), ETH Zürich, Wolfgang-Pauli-Strasse 15, CH-8093 ZürichE-Mail: [email protected]
Dr. Conor TrainorTrinity College Dublin, University of Dublin, College Green, IR-Dublin 2E-Mail: [email protected]
Dr. Maria TrapichlerInstitut für Klassische Archäologie, Universität Wien, Franz Klein-Gasse 1, A-1190 WienE-Mail: [email protected]
Abbildungsnachweis: Alle Abbildungen © ÖAI Athen, Grabungsarchiv Aigeira. Abb. 1: Gesamtplan von Aigeira basierend auf Vorlage von G. Ladstätter mit Ergänzungen. Gestaltung H. Birk, W. Gauß; Abb. 2: Detailplan der Grabung basierend auf Vorlage von F. Glaser mit Ergänzungen. Aufnahme A. Kurz, Um-zeichnung W. Gauß, Gestaltung H. Birk, W. Gauß; Abb. 3. 4: Aufnahme W. Gauß; Abb. 5 – 8. 11 – 14: Auf-nahme W. Gauß, digitale Nachbearbeitung R. Smetana; Abb. 9: Ausschnitt aus Gesamtplan basierend auf Vorlage von F. Glaser mit Ergänzungen; geophysikalische Messungen (Institut für Geowissenschaften, Abteilung für Geophysik der Christian-Albrechts-Universität Kiel), Gestaltung H. Birk, W. Gauß; Abb. 10: Ausschnitt aus Gesamtplan, Bereich Theater; Aufnahme von O. Walter (Bauten B, C, D) mit Ergänzungen 2011 – 2012; Aufnahme A. Tanner, C. Regner; Gestaltung H. Birk, W. Gauß.
AbstractWalter Gauß – Rudolfine Smetana – Jeremy B. Rutter – Julia Dorner – Petra Eitzinger – Christina Klein – Andrea Kurz – Asuman Lätzer-Lasar – Manuela Leibetseder – Christina Regner – Harald Stümpel – Alexandra Tanner – Conor Trainor – Maria Trapichler, Aigeira 2012. Report on Documentation and ExcavationThe most important results of the 2012 excavations at Aigeira are the discovery of the LH IIIC fortification wall of the acropolis and the unambiguous proof of a ›lower town settlement‹. At this time, the LH IIIC Middle/Late fortifications are amongst the latest newly constructed Bronze Age fortifications on the Greek mainland. They were built after a disastrous fire, represented by a massive destruction horizon on the acropolis. The stratigraphic sequence already recovered at the fortification wall and in selected parts of
91Aigeira 2012
the ›lower town settlement‹, even before the completion of the excavations, permits a clearer and more detailed definition of the LH IIIC through Early Iron Age (MG/LG) occupation of these sectors of the site. Geophysical measurements on the eastern plateau of the acropolis were conducted, in order to examine the extent of the LH and Early Iron Age settlements. Numerous linear structures, presumably walls, were measured, the most interesting of which is a ca. 7 × 10 m large rectangular anomaly in the central plateau. In the area of the Hellenistic theatre the study and reorganisation of the finds from the old excavations were continued and already permit a clearer and better picture of the chronology of the various buildings. Geophysical research in this area showed building activity between Naiskos F and the Tycheion, whereas the area in front of the theatre does not seem to have been occupied. Most important for the topography of the theatre area is the unambiguous identification of Building C. Its exact location was unknown since the building was reburied after O. Walter’s partial excavation.
KeywordsAigeira – Achaia – Geophysics – Tycheion – Naiskoi