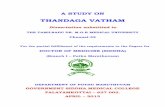1. Zwischenbericht Grabung Schützen am Gebirge
Transcript of 1. Zwischenbericht Grabung Schützen am Gebirge
PannArch
1. Zwischenbericht – Grabung Schützen am GebirgeGräberfeld – 30021.12.02
Mag. Kurt Fiebig, Patrick Hillebrand, Iris Reiter, Gregor Schönpflug, MMag. Ruth Steinhübl
Einleitung:
Im Oktober 2012 wurde mit dem Bau der Umfahrungsstraße Schützen am Gebirge, Burgenland, begonnen.
Betroffen waren die Katastralgemeinden Oslip. Schützen und Donnerskirchen, alle PB Eisenstadt
Umgebung. Das Gemeindegebiet von Donnerskirchen wurde an seiner westlichen Grenze nur gestreift.
Gleichzeitig mit den Bauarbeiten begann der Verein PannArch mit der archäologischen Baubegleitung und
daran anschliessend mit der Ausgrabung. Die archäologischen Maßnahmen, wovon der erste Teil hier
vorgelegt wird, wurden in mehrere Einheiten aufgeteilt, die sich über die Jahre 2012, 2013 und 2014
erstreckten.
Seite - 1 -
Forschungsgeschichte Oslip und Schützen (Autor K. Fiebig)
Wie auch in vielen anderen Landesteilen des Burgenlandes zu beobachten ist, zeigt sich im ausgehenden 19.
Jahrhundert ein reges Interesse an der Vergangenheit der Gegend zwischen Eisenstadt und Neusiedl/See, die
Alexander (Sandor) Wolf als seine fruchtbare Heimat an der Nordgrenze des alten Pannonien, zwischen den
Hügeln des Leithagebirges und des Neusiedlersees, geografisch umriß.1
Wolf ist es auch, der in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts die ersten Grabungen organisierte und
finanzierte. So pachtete er die Felder, die südlich an die damalige Militär-Unterrealschule, die heutige
Martinskaserne, angrenzten und ließ seine Arbeiter unter dem Architekten Braun die dort im Boden
liegenden Reste eines römischen Gutshofes ausgraben.2 In Müllendorf legte er 1903 und 1904 u. a. diverse
römische Mauerreste, Gräber und einen Töpferofen frei. Weiters weist er auf Gräber hin, die 1880 beim Bau
der Ödenburgerbahn in der Gegend von „Mühlendorf“ aufgedeckt wurden.3 In St. Georgen stellte er auf den
Mitterfeldäckern mehrere römische Gebäudereste fest.4 Ab 1910 wurde in mehreren Grabungen unter der
Leitung von M. Groller in Donnerskichen eine römische Anlage freigelegt.5 1913 und 1914 setzte Groller
seine Grabungstätigkeiten in Purbach, Donnerskirchen und Schützen am Gebirge mit dem Ziel, Reste der
römischen Militärstraße zu finden, fort. In Purbach wurde die Straße über eine Strecke von einigen 100m
aufgedeckt, links und rechts des Straßenzuges mehrere Gebäude, wovon Groller das nördlich der Straße
gelegene, als Wachturm anspricht. Weiters wurde der Straßenverlauf auf den Getreidefeldern neben dem
Donnerskirchener Meierhof festgestellt. Der
Straßendamm wurde hier auf einer Länge von
ca. 5m aufgedeckt. Entlang des Straßenzuges
fanden sich auch hier mehrere Gebäudereste.
In Schützen deckte er die Straße auf einer
Länge von 1000m! auf. Links und rechts der
Straße ebenfalls mehrere Gebäudereste, die er
als römisches Reihendorf anspricht.6
1923 fand Wolf auf Osliper Gebiet ebenfalls
römische Mauerreste, die später als Villa
Rustica von Oslip in der Literatur Eingang
fanden.7
Anhand der Grabungsergebnisse skizziert Wolf
ein römisches Wegenetz (s. Abb. 1).
1 S. Wolf, 1926 S 32 Ebenda und W. Kubitschek, 1926 S 26ff3 W. Kubitschek, 1926 S 98f4 S. Wolf, 1926 S 75 W. Kubitschek, 1926 S 39ff und S 48ff6 W. Kubitschek 1926 S 41f7 u. a. FÖ II S 5
Seite - 2 -
Abb. 1: römisches Wegenetz nach Wolf, Kubitschek 1926 S.6
Als Hauptverbindung nennt er die Straße von Scarabantia nach Carnuntum. Eine Nebenstraße südlich von
Eisenstadt Richtung Müllendorf, von da weiter nach Neufeld. In östliche Richtung von Eisenstadt nach
Oslip, um dort auf die Hauptverbindung nach Scarabantia zu treffen. Östlich der Hauptstraße postuliert er
einen Nebenweg von Schützen über Oggau, Rust, Mörbisch und Kroisbach, das heutige Fertörakos.8
Wolf zeichnete hier also bereits das Bild eines dicht besiedelten und bewirtschafteten Gebietes während der
provinzialrömischen Kaiserzeit mit allen Attributen, die so einen Wirtschafts- und Lebensraum
kennzeichnen. Zum einem sind diese Betriebe im Agrarbereich angesiedelt, die ihren Absatzbereich sowohl
lokal wie auch in Richtung der größeren Ansiedlungen hatten, hinzu kommt aber auch der Rohstoffhandel
mit lokal abgebautem Leithakalkstein, wie dies die mehr als 40 bekannten Steinbrüche zwischen Eisenstadt
und Jois belegen.9
Wolf und Kubitschek beschränken sich auf die römischen Funde und erwähnen nur das Vorhandensein von
prähistorischen und mittelalterlichen Fundmaterial. Dass dieses ebenso zahlreich vorhanden ist, zeigen die
zahlreichen Fundmeldungen in den Ortsakten von Oslip, Schützen und Donnerskirchen10, wie dies
nachfolgend gezeigt wird..
Oslip:
Im Juni 1931 wurde das Landesmuseum über den Fund mehrerer Skelette informiert. Diese wurden beim
Anlegen eines Gartens am Ostrand von Oslip ausgegraben. Die Lage der eng aneinander liegenden Toten war
ost-west orientiert, die Füße im Osten. Die Bestattungen waren beigabenlos. Wolf vermutete eine
Massenbestattung infolge einer kriegerischen Auseinandersetzung oder die Opfer einer Epidemie.11
Im Jahre 1933 erfolgten mehrere Fundmeldungen aus Oslip. Alle von der Flur, die auch Wolf als Fundplatz
nennt. Die Fundmeldungen führten dann im Herbst 1933 zu einer Grabung auf der damals als Flur Kreischitz
bezeichneten Stelle, südlich der Bahnlinie Eisenstadt – Schützen in unmittelbarer Nähe des Meierhofes. Die
Grabungen werden durch den FAD (Freiwilliger Arbeitsdienst) durchgeführt, der davor die römischen
Gebäude in St. Georgen freigelegt hatte. Neben den vier Gebäuderesten werden Fundstellen des jüngeren
Neolithikums, der Bronze- Hallstatt- und Laténezeit festgestellt.12
Während der Grabungsarbeiten auf der Flur Kreischitz kam es zu einer weiteren Fundmeldung in
unmittelbarer Nähe der Grabungsstelle. Nördlich der Bahnlinie und 180m südlich der Tiergartenmauer fand
der Besitzer Alfons Kreischitz auf seinem Acker ein leeres Steinkistengrab und ein verziertes Säulenkapitel.13
Entlang der Tiergartenmauer kam es 1934 wiederholt zur Aufdeckung von Gräbern. In der Nähe des Osliper
Tiergartentores, auf der Flur Große Waldäcker, wurden insgesamt fünf Körperbestattungen beim Rigolen
angefahren. In zwei Gräbern fanden sich völker–wanderungszeitliche Keramiken. Laut Angabe des Finders
8 S. Wolf, 1926 S 6f9 Freundliche mündliche Mitteilung A. Rohatsch; Institut f. Geotechnik TU Wien.10 Ortsaktenarchiv der Burgenländischen Landesmuseen11 Fundprotokoll 50/1931 Ortsaktenarchiv Ortsakt Oslip BLM12 FÖ II S 513 Fundprotokoll 59/1933 Ortsaktenarchiv Ortsakt Oslip BLM
Seite - 3 -
lagen die Körper Ost-West ausgerichtet, der Kopf im Westen.14 Kurz nach diesem Fund, im selben Jahr
wurde eine weitere Bestattungen im Bereich der Tiergartenmauer beim Ackern aufgedeckt. Dabei handelte es
sich allerdings um einen provinzialrömischen Grabbau, dessen Reste aus dem oberen Teil eines Grabsteines
mit vier Porträtbüsten und, mehreren Relieffragmenten bestand.15
Ebenfalls 1934 wurden auf der Flur Wulkaried mehrere neolithische Funde, sowie Reste mehrerer
römerzeitlicher Brandbestattungen geborgen. Ende des Jahres kamen wieder auf der Flur Große Waldäcker
zwei viereckige, beigabenführende Steinossuarien an Tageslicht.16 Im Jänner 1936 setzte sich die Fundserie
auf dieser Flur in Form eines weiteren Brandgrabes fort. In diesem Fall befand sich der Leichenbrand in
einer Glasurne, die in einer Steinkiste verwahrt wurde.17
Beim Bau der Straße Eisenstadt -Schützen in
den 30er Jahren des 20. Jhdts. wurde
ebenfalls von mehreren Fundstellen,
hauptsächlich Gräbern, berichtet, wobei
Teile der Fundstellen sicherlich auch zerstört
wurden, wie sich dies anhand der, vom
damaligen Bauleiter Glaser nach Abschluss
der Bauarbeiten, dem Landesmuseum
übergebenen Funde, vermuten lässt.
Darunter Keramiken mit unterschiedlichen
Zeitstellungen.18
1937 wurden nördlich der Bundesstraße
zwischen den damaligen Kilometersteinen 58,6 und 58,9 zahlreiche neolithische Keramikfragmente
aufgesammelt. Darunter notenkopfverzierte Scherben, lengyelzeitliche Keramik, sowie Keramik der
Badener- und Hallstattkultur. In den Feldern zeigten sich zahlreiche dunkle Verfärbungen ,deren Verfüllung
teilweise mit Hüttenlehm und Holzkohle vermengt war. Im selben Jahr wurden weitere Brandbestattungen,
ähnlich der Bestattung mit Glasurne, auf der selben Flur, Große Waldäcker, bekannt.19
Vom südlichen Ende des Osliper Hotters wird 1937 von der Entdeckung einer neolithischen Siedlung
berichtet. Auf der selben Flur Funde aus der Bronzezeit sowie Funde römischer Zeitstellung.20
Aufgrund der Kriegsereignisse der folgenden Jahre dünnen die Fundmeldungen in diesem Zeitabschnitt aus.
So liegen lediglich aus dem Jahr 1940 linearbandkeramische und hallstattzeitliche Scherben von der Flur
14 FÖ II S 5215 ebenda16 FÖ II S 13117 FÖ II S 13218 FÖ II S 13219 FÖ II S 22620 ebenda
Seite - 4 -
Abb. 2: römischer Grabstein aus Oslip, Brgl. Landesmuseen Inv. Nr.: 25339
Waldäcker und aus dem Jahr 1944 römische Funde beim Stellungsbau neben der Bahn vor.21
Neben zahlreichen Münzfunden, die vom Gemeindegebiet Oslip stammen, wurden 1976 auf dem Silberberg
nahe der Abbruchkante eines Steinbruches achtzehn antoninische Münzen (im Umlauf ab 260 n. C.)
gefunden.22
Bei der Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens, beim Zusammenfluss von Wulka und Eisbach
wurden bei den Baggerarbeiten mehrere frühneolithische Keramikfragmente und Tierknochen freigelegt. Die
Funde wurden vom Baggerfahrer im Landesmuseum abgegeben. Die Fundstelle selbst war bereits zerstört
und nicht mehr im Gelände sichtbar.23
Schützen:
Ein ähnliches Bild wie Oslip zeigt sich in
Schützen. Ist die prominenteste Fundstelle in
Oslip ein römischer Gutshof, befindet sich auf
Schützener Gemeindegebiet neben einem Teil
der Strassentrasse der Bernsteinstraße inklusive
Brücke24 über die Wulka auch ein römischer
Vicus (von Groller noch als Reihendorf
angesprochen25) auf der Flur Wulkaäcker der
durch die Zeit immer wieder Ziel von
Ausgrabungen war. Weniger bekannt ist eine
Höhle, die sich im Bereich des Tiergarten
befindet. Von dieser wird in einem Brief 1922 berichtet, dass sich im Inneren ein versiegelter Brunnen
befände und Knochen gefunden wurden. Weiters eine „turmähnliche Rundung mit gotischer Zuspitzung“. Im
selben Schreiben wird auch von mehreren alten Gräbern (zwischen Schwarzhotter und Hainzenkreuz) und
„von einer Römerstraße hinter Gschiess“ gesprochen 26 O. Christopharo überbringt 1938 ebenfalls von den
Wulkaäckern spätneolithische und hallstattzeitliche keramische Funde.27 Christopharo steht damit mit seinen
Funden in einer Reihe von Artefakten dieser Fundstelle, die vermutlich bereits 1886 mit einem Votivstein
begann, der von Bella gefunden wurde. Neben diesem Stein barg er einen Altar und legte die Fundamente
eines Hauses frei.28
Neben den dominierenden römischen Funden kommt es aber auch auf Schützener Hotter zu Funden anderer
Zeitstellungen. So werden 1978 von einem deutschen Touristen mehrere Keramikfragmente mit
21 FÖ IV S 3, 34 u. 5022 G. Dembski, 197723 Ortsakt Oslip, Fundbericht 7/97 BLM24 Ortsakt Schützen Fundprotokoll 9/5825 W. Kubitschek 1926 S 39ff26 Ortsakt Schützen, Schreiben an Wolf 192227 Ortsakt Schützen Fundprotokoll 47/193828 L. Bella 1888 S 234
Seite - 5 -
Abb. 3: Airbornlaserscann v. Schützen, bekannte röm. Fundstellen entlang der röm. "Bernsteinstraße", ALS-Daten LandesGIS Burgenland 2012
Notenkopfverzierung und ein Schuhleistenkeil dem Landesmuseum übergeben, die dieser südlich der
Tiergartenmauer auf der Flur Százas aufgelesen hatte. 29
Im Jahr 1928 soll es bei Abbrucharbeiten zur Auffindung eines Grabes gekommen sein, das latènezeitlich
angesprochen wurde. Von dem im Grab befindlichen Inventar (neben dem Skelett u. a. ein Schwert aus
Eisen) wurden 1930 nur mehr Reste im Landesmuseum abgegeben.30 Im Jahr 1933 erhielt das
Landesmuseum Nachricht über ein weiteres Grab, das bei Bauarbeiten aufgedeckt wurde. Die Fundstelle
befand sich in direkter Nachbarschaft zur Fundstelle von 1928. Als Beigaben wurden u. a. ein Eisenschwert
und eine Lanzenspitze geborgen.31 Beide Fundstellen liegen am westlichen Ortseingang.
Entsteht nun auf den ersten Blick der Eindruck, dass die Fundmeldungen aus Schützen zahlenmäßig deutlich
hinter Oslip zurückstehen, erkennt man aus den Ortsakten bei genauerem Hinsehen, dass sich in Wirklichkeit
hier der lokale Umgang mit dem Thema Archäologie widerspiegelt. Wurden aus Oslip sehr viele Funde von
der ansässigen Bevölkerung an das Landesmuseum gemeldet, so verblieben in Schützen sehr viele Funde
vermutlich in privater Hand, so dass die Landesstellen keine Kenntnis davon erhielten. Ein beredtes Beispiel
hierfür sind die beiden Grabfunde aus Schützen (s. weiter oben). Beim ersten Fund wurden angeblich alle
Beigaben zerstört, beim zweiten Fund ist das mehr oder weniger gleiche Grabinventar noch erhalten. Im
Zusammenhang mit dem ersten Fund taucht, wie des öfteren in Schützen, der Name Oberger auf, der zwar
immer wieder Funde ans Museum meldete, man muss aber davon ausgehen, dass eine bedeutende Anzahl an
Funden von ihm nicht gemeldet wurde. Auch hier liefert der Ortsakt den Anhaltspunkt, dass im ersten Drittel
des 20. Jhdts. offenbar jeder Fund in Schützen automatisch bei Oberger landete und es in seiner persönlichen
Gebarung lag, wie mit den Funden verfahren wurde.
Tatsächlich, und dies zeigte auch die aktuelle Grabung, haben wir es im gesamten Arbeitsgebiet, das auf der
einen Seite durch das Leithagebirge und auf der anderen Seite durch den Neusiedlersee begrenzt wird, mit
einem intensiv genutzten Wirtschaftsraum zu tun, der durch alle Zeiten bewohnt, bebaut und begangen
wurde und wird und dadurch entsprechende Spuren im Boden hinterlassen wurden. Auch die
vorherrschenden Bodenverhältnisse (s. Bodenkarte Oslip, Abb. 4) sowie die Landschaftstopografie sind eine
Einladung zur intensiven Nutzung und den damit verbundenen wirtschaftlichen Erträgen. Bespiele hierfür
sind die nachgewiesene römische Hauptverkehrsverbindung von Nord nach Süd (Bernsteinstraße), die sicher
auch in davor liegenden Zeiten schon begangen wurde, zumindest vier römische Gutshöfe zwischen
Eisenstadt und Donnerskirchen, und wenn man den aktuell ausgegrabenen provinzialrömischen Gräberbezirk
als Teil einer Villa Rustica sieht, sogar fünf Gutshöfe, einen Vicus, sowie eine weitere römische
Siedlungsstelle, die bei der gegenständlichen Grabung zu Tage kam. Auch das von Wolf skizzierte Wegenetz
(s. Forschungsgeschichte) zeigt in die selbe Richtung, sodass man in diesem Gebiet ständig mit Bodenfunden
rechnen muss, wie dies die gegenständliche Rettungsgrabung im Zuge des Baues der Nordumfahrung
Schützen auch belegt.
29 Ortsakt Schützen Fundbericht 6/7830 Ortsakte Schützen ohne nähere Bezeichnung31 Ortsakt Schützen Fundprotokoll 80/1933
Seite - 6 -
Bedenken muss man bei Rettungsgrabungen und Notbergungen, das nicht der Archäologe die Schnittfläche
festlegt, sondern diese durch die verursachende Maßnahme definiert ist. Jedes archäologische Ereignis ist
eine Projektion vergangener menschlicher Aktivitäten, eingebunden in ein Netzwerk aus sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Ereignissen auf uns. Eine archäologische Fundstelle ist somit ein Ausschnitt
vergangener Lebensweise und Kultur.32 Baut man eine z. B.. Straße, durch diese Kulturlandschaft, so
schneidet man im Zuge der archäologischen Maßnahme nur auf Breite der Straßentrasse einen Teil dieses
Lebensraumes heraus. Die angeschnittenen archäologischen Ereignisse sind zwar immer noch Teil eines
Gesamten, das Erkennen der horizontalen, sprich kontextuellen Zusammenhänge, ist aber zumeist nur
interpretativ möglich. Die Möglichkeiten dieser Interpretation insbesondere bei Siedlungsfundstellen sind
daher durch die Kleinräumigkeit der Grabungsfläche stark limitiert.33 Nimmt man z. B. die hier
gegenständliche Grabungsmaßnahme, so erbrachte die Grabung u. a. mehrere römische Bestattungen, sowie
einen Umfassungsgraben. Diese beiden Befunde bilden auf Grund ihrer geografischen Anordnung ein
zusammenhängendes Objekt . Die Anordnung der Gräber, sowie der Umfassungsgraben, deuten einen
Gräberbezirk innerhalb eines größeren Objektes an, auch weil der Umfassungsgraben deutlich größere
Ausmaße hat, als das von den Gräbern in Anspruch genommene Areal. Dieses größere Objekte könnte ein
römischer Gutshof sein, oder aber ein wesentlich größerer Friedhof, der heute größtenteils vergangen wäre.
32 K. H. Eggert 2005 S 10033 H. Jankuhn 1977
Seite - 7 -
Abb. 4: Bodentypenkarte Oslip und Schützen, Bernhauser 1968
Alleine die Tatsache, dass in der Villa Rustica von Eisenstadt Gölbesäckern eine ähnliche Befundsituation
vorliegt34 und ebenso in Donnerskirchen Gräber aufgedeckt wurden, die der Villa zugerechnet wurden 35,
macht die Annahme wahrscheinlich, dass die Gräber zu einem Gutshof gehören. Beweisen läßtt sich dies
aber auf Grund der dargestellten Situation zum heutigen Zeitpunkt nicht.
Gleiches gilt im umgekehrten Sinne ebenso. So ist nur auf Grund der Tatsache, dass innerhalb der Bautrasse
keine archäologischen Spuren aufgefunden wurden, der Schluss unzulässig, dass links und rechts der Trasse
ebenfalls keine Bodendenkmale vorhanden sind. Es ist nicht auszuschliessen, dass sogar unmittelbar im
Anschluss an die Baufläche das nächste archäologische Ereignis stattfand und entsprechende Spuren
hinterlassen hat.
Sinngemäß gilt dies für alle Befunde, die nachfolgende vorgestellt werden.
Bestattungen (Autoren: I. Reiter, R. Steinhübl):
Bei Bestattung 1 handelt es sich um eine
Körperbestattung, die in einem Sarkophag
niedergelegt wurde (Abb. 5). Der Sarkophag ist
aus einheimischem Lithotamnienkalksandstein
gefertigt und stammte laut geologischer
Einschätzung aus einem Steinbruch in Winden
am See oder Oslip36. Der Sarkophag besitzt die
Innenmaße von 80x30x17 cm bei einer
Wandstärke von durchschnittlich 9 cm. Der
Sarkophag war mit einer Sandsteinplatte aus
dem gleichen Material bedeckt, die durch
Ackertätigkeit verlagert wurde. Aufgrund der
sichtlich älteren Beschädigungen des Deckels kann eine Beraubung nicht ausgeschlossen werden. Das
Fehlen von Metallfunden ist ein weiteres Indiz für diese
Einschätzung. Die Skelettfragmente entsprechen einem
subadulten Individuum und sind nicht vollständig erhalten.
Es konnten Schädelfragmente sowie Fragmente von
Langknochen geborgen werden. Zu den Grabbeigaben
zählen ein Faltenbecher sowie ein Töpfchen mit kleiner
Standfläche (Abb. 6), weiters stark zerscherbte
Glasfragmente. Der Faltenbecher ist aus rottonigem
34 E. Thomas 1964 S 137ff35 A. Barb 1953 S 10336 s. Anm 9
Seite - 8 -
Abb. 6: Grabbeigaben aus Grab 1Foto: PannArch 2012.
Abb. 5: Grab 1, Sarkophag mit Kinderbestattung,Foto: PannArch 2012
feinkörnigem Ton gefertigt und stark mit Glimmerflitter gemagert und wurde auf einer Drehscheibe
modelliert. Bei einer Höhe von 15 cm und einer maximalen Breite von 9 cm besitzt dieser sechs Falten mit
ebenso vielen Rippen. Die originale Wandstärke ist nicht mehr nachzuweisen, da die äußere Schicht bereits
abgefroren war. Das scheibengedrehte, grautonige Töpfchen ist ebenfalls aus feinkörnigem Ton gefertigt.
Das bauchige Gefäß mit einer Höhe von 10,8 cm und einer maximalen Breite von 9,5 cm weist einen
Standfuß mit einem Durchmesser von 3,5 cm auf.
Die Bestattung 2 beinhaltet ein sehr schlecht
erhaltenes Skelett von 166 cm Körperlänge in
gestreckter Rückenlage mit neben dem Körper
liegenden gestreckten Armen sowie Beigaben
in Form von zwei Münzen, einer Ringfibel,
eines kleinen Töpfchens (Abb. 8) und eines
Messers. Nördlich des rechten Fußes befand
sich ein Eisennagel, welcher potentiell auf
hölzerne Grabeinbauten, beziehungsweise
einen Sarg hinweist. Die beiden Münzen mit
einem Durchmesser von annähernd 2,2 cm
bestehen aus Buntmetall und weisen teils starke
Korrosion auf. Die Münze, welche sich im Rippenbereich der Bestattung befand, erlaubt keine nähere
Bestimmung der Darstellung ohne weitere Restaurierung. Die
zweite Münze, positioniert auf dem linken Handgelenk, weist
vorderseitig einen menschlichem Kopf mit umlaufender
Inschrift, rückseitig zwei sich gegenüberstehende Personen,
jeweils mit Umhang, auf, welche je einen Arm zur Mitte
ausgestreckt halten. Eine genau Einordnung wird nach der
Restaurierung erfolgen. Die stark korrodierte Ringfibel mit
einem Durchmesser von 7 cm wurde auf der rechten Schulter
positioniert. Südlich des Kopfes befanden sich das 12 cm hohe
und maximal 10,5 cm breite, grautonige Töpfchen mit einem Henkel und ein Messer aus Eisen, welches in
zwei Fragmenten von 7 cm und 4,5 cm Länge erhalten ist.
Bei Bestattung 3 handelt es sich um ein West-Ost orientiertes
Schachtgrab mit einer Tiefe von 80 cm. Das in gestreckter
Rückenlage befindliche Skelett mit einer Körperlänge vom 155
cm wies im Beckenbereich überkreuzte Hände auf. Eine
eindeutige Geschlechtsbestimmung kann erst nach einer
anthropologischen Untersuchung folgen. Aufgrund des
schlechten Erhaltungszustands des Skelettes waren die
Seite - 9 -
Abb. 7: Grab 2, Körperbestattung in Doppelgrab,Foto: PannArch 2012
Abb. 8: Grabbeigabe und Trachtbestandteil aus Grab 2Foto: PannArch 2012.
Abb. 9: Grabausstattung aus Grab 3Foto: PannArch 2012.
gesamten Fußknochen zum Zeitpunkt der Freilegung bereits vergangen. Zur Grabausstattung gehörten zwei
stark korrodierte Münzen aus Buntmetall, welche im Beckenbereich lagen, ein Keramikkrug südlich des
linken Fußes sowie 20 Glasperlen (Abb. 9), welche im Bereich der Halswirbel situiert waren. Bei den
Glasperlen weisen 16 eine doppelkonische Form mit schwarzer Farbe auf, 4 zeigen eine bläuliche Färbung
bei tropfenförmiger Gestalt. Der grautonige Krug mit einer Höhe von 21,5 cm und einer maximalen Breite
von 13 cm war komplett erhalten. Es konnten keinerlei Hinweise auf etwaige Grabeinbauten nachgewiesen
werden.
Aufgrund der starken Beeinträchtigung durch Ackertätigkeit konnten die zwei Brandgräber (Bestattung 5
und Bestattung 6) nur als flache, ovale Gruben mit Resten von Leichenbrand ohne jegliche Beigaben
dokumentiert werden.
Bei Bestattung 7 ist ebenfalls eine starke Beeinträchtigung
durch Ackertätigkeiten vorzuweisen. Bei diesem Grab waren
jedoch vier eiserne Schuhnägel sowie ein 29,6 cm langes, in
zwei Fragmenten erhaltenes Eisenmesser mit einer Griffplatte
mit Ringabschluss in der Verfüllung enthalten.
Die Bestattung 8 ist ausschließlich in die Ackerschicht
eingetieft und reicht nicht in den gewachsenen Boden. Auch
diese ist stark durch die Ackertätigkeiten beeinträchtigt. Aus diesem Grund ist das Skelett nicht mehr als in
situ zu bezeichnen. Neben einigen wenigen Resten des Skeletts zählen eine zerbrochene Ringfibel mit einem
Durchmesser von 5,2 cm sowie ein eisernes Griffangelmesser mit einer Länge von 16,4 cm zu den Funden.
Bei Bestattung 9 (Abb. 11) handelt es sich um eine
Urnenbestattung. Das Grab ist im nordöstlichen Eck
des Grabgartens zu lokalisieren. Der Grabschacht
wurde beim Oberbodenabtrag freigelegt, und ist im
obersten Bereich vermutlich durch moderne
Beackerung beschädigt. Die Urne samt Inhalt wurde
im Block geborgen. In weiterer Folge wurde der
Inhalt cm für cm freigelegt und abgebaut. Bei der
Freilegung der Urnenverfüllung konnten zwei
Glasbalsamare freigelegt werden. Diese waren bereits
zerscherbt und nicht mehr im Verband. Neben den Balsamaren enthielt die
Urne einen sehr stark korrodierten Nagel sowie ein Eisenfragment,
welches aufgrund des starken Korrosionsfortschrittes nicht mehr
identifiziert werden konnte. Am Boden der Urne konnte ein einzelner Kern
geborgen werden. Nach botanischer Bestimmung handelt sich hierbei um
den Kern einer Weintraube (Vitis Vinifera).
Seite - 10 -
Abb. 10: Eisenmesser aus Grab 7Foto: PannArch 2012.
Abb. 11: Grab 9 Urnenbestattung,Foto: PannArch 2012.
Abb. 12: Glasbalsamer aus Grab 9 Foto: PannArch 2012.
Anhand der Beigaben und der stratigraphischen Abfolge kann man die Bestattungen 1, 2, 3, 4, 7, 8 und 9
ohne Bedenken der römischen Kaiserzeit zu ordnen. Eine feinchronologische Einordnung wird erst nach
Restaurierung der Metallobjekte möglich, jedoch scheint zum jetzigen Zeitpunkt eine Zuordnung in das 2 bis
3 nachchristliche Jahrhundert am wahrscheinlichsten.
Gräben (Autor P. Hillebrand):
Auf der Fläche 1 befanden sich insgesamt vier stratigraphisch voneinander unabhängige Grabensysteme.
Zwei davon, die Objekte 10 („Grabgartengräbchen“) und 11 (Begrenzungsgraben) waren Teil, des als
Gräberfeld bezeichneten Bereiches. Die anderen Beiden (Graben 1 und Graben 2 befanden sich außerhalb
davon.
Bei Objekt 11 handelt es sich um einen geraden Graben,
der durch die Schnitte 1 und 2 verfolgt werden konnte. Er
verläuft in Schnitt 1 sowie im Osten von Schnitt 2 von
Osten nach Westen und biegt im Westen von Schnitt 2 im
rechten Winkel nach Süden ab, wo er bis zum Schnittrand
weiterverfolgt werden konnte. Da sich sämtliche Gräber
des Gräberfeldes innerhalb dieses Grabenwerkes befunden
haben, handelt es sich hierbei wohl um den dazugehörigen
Begrenzungsgraben.
Der Graben selbst ist ein an beiden Flanken abgetreppter
Sohlgraben mit flachschrägen Wandungen, gerundeten
Ecken und konkaver Sohle. Er ist zwischen 0,7 und 1,20m
breit. Die durchschnittliche Tiefe des Grabens beträgt rund
40cm, die Abtreppungen befinden sich ca. 20cm unterhalb
der Grabenoberkante. Die Tiefe der Grabensohle und die
Ausprägung der Treppen variieren jedoch innerhalb des
gesamten Verlaufes. Im Bereich der Kurve verbreitert sich
sowohl der Graben im Ganzen auf 2,3 m als auch die
Abtreppungen.
Das Fundspektrum der Grabenverfüllung besteht zu einem Großteil aus Wandfragmenten rot- und
grautoniger römischer Keramik, wobei die rottonige Ware leicht überwiegt, sowie vereinzelten Rand- und
Bodenfragmenten.
Im Bereich der Grabenecke fanden sich nebeneinander auf gleicher Höhe drei Scherbenlagen, eine davon
direkt auf dem Scheitelpunkt des Grabenecks. Scherbenlage 1 besteht aus 28 rottonigen Wandfragmenten,
Scherbenlage 2 aus insgesamt 12 rottonigen Wandfragmenten. Hiervon weisen 5 als Verzierung ein
Strichdekor in mehreren parallelen Reihen auf. Außerdem fand sich ein ebenfalls rottoniges Fragment eines
Seite - 11 -
Abb. 13: Teil des östlichen Umfassungsgraben,Foto: PannArch 2012.
stark nach außen gebogenen und durch eine Wulst von der Wandung abgesetzten Randes. Scherbenlage 3
besteht aus 27 rottonigen Wand- und Bodenfragmenten.
Ausser den keramischen Funden enthielt die Verfüllung neben Knochen und Ziegeln auch das Fragment
einer kräftig profilierten Fibel aus Buntmetall.
Der Begrenzungsgraben schneidet im Schnitt 1 eine unregelmäßige Grube mit vertikaler Wandung und
unebenem Boden (SE 148). In der Verfüllung dieser Grube fanden sich unter anderem ein größeres Fragment
einer dickwandigen Reibschale mit horizontal verlaufendem Krempenrand und innen umlaufender Kerbe
sowie Teile einer Buntmetallfibel.
Innerhalb des Begrenzungsgrabens befand sich Objekt 10
(Abb. 14), ein annähernd quadratischer
Umfassungsgraben (11,30 m x 12 m Kantenlänge) mit
steilschräger Wandung, gerundeten Ecken und
waagrechtem Boden, dessen nördliche und östliche
Kanten parallel zum Begrenzungsgraben verlaufen. Die
Umfassung wird östlich durch einen Eingangsbereich
unterbrochen. Der Graben war durchschnittlich 80 cm
breit und etwa 35cm tief.
Aufgrund einer Brandbestattung, die sich im Inneren
dieses Umfassungsgrabens befand und auf Grund von
Vergleichen mit anderen Gräberfeldern der gleichen
Zeitstufe kann man den Befund als Grabgartengräbchen
ansprechen.37
Das Gräbchen war zweiphasig verfüllt, wobei die ältere
Verfüllung größtenteils aus Steinen mit bis zu 15cm
Durchmesser bestand, die jüngere aus feinem Sediment.
Das Fundspektrum der jüngeren Verfüllung besteht zu
einem Großteil aus römischer Keramik (ca. 80 Stück), meist rottonigen Wandfragmenten aber auch einigen
Rand- und Bodenfragmenten sowie Henkel. Das der älteren Verfüllung umfasst nur einige wenige
Wandfragmente.
In die ältere Verfüllung an der östlichen Flanke des Gräbchens eingetieft, befand sich eine Bestattung (Objekt
4, Bestattung 4). Es handelt sich hierbei um eine Nord-Süd orientierte Körperbestattung von 1,53 m Länge in
gestreckter Rückenlage. Der Grabschacht selbst ist sehr knapp bemessen, so dass der bzw. die Bestattete mit
einem Arm sowie mit den Füßen die Grabschachtwände berührt. Eventuell existierende Grabeinbauten
konnten nicht beobachtet werden, ebenso wenig waren Beigaben vorhanden.
37 Vgl. Ortsakt Halbturn, Burgenländischen Landesmuseum
Seite - 12 -
Abb. 14: Umfassungsgraben,Foto: PannArch 2012.
Bei Objekt 12 (Graben 1) handelt es sich um ein gerades, von Osten nach Westen parallel zum
Begrenzungsgraben und weiters im rechten Winkel abbiegend von Süden nach Norden verlaufendes
Gräbchen. Der Graben ist knapp 15 cm tief, hat flachschräge Wandungen und eine konvexe Basis.
Bis auf zwei kleine Wandfragmente war die Grabenverfüllung fundleer. Aufgrund seiner Lage und
Ausrichtung parallel zum Begrenzungsgraben kann der Befund in die provinzialrömische Kaiserzeit datiert
werden.
Ein weiterer Graben verläuft von Süden nach Norden parallel zum Begrenzungsgraben und biegt im rechten
Winkel nach Westen ab. Hierbei ähnelt er dem Objekt 12 (Graben 1). Der Befund ist ca. 25 cm breit und
maximal 15 cm tief und im Querschnitt konkav. In der Verfüllung befand sich reliefverzierte Terra Sigilata.
Auf dem kleinen Bruchstück ist florales Dekor zu erkennen, wahrscheinlich Efeu. Auch dieser Befund datiert
in die provinzialrömische Kaiserzeit.
Bronzezeitliche Materialentnahmegrube (Autor: G. Schönpflug):
Die unregelmäßig geformte, annähernd rechteckige Grube (Objekt 14) weist eine maximale Länge von 15,8
Metern sowie eine maximale Breite von 13,5 Metern auf. Bei einer durchschnittlichen Tiefe von 0,55
Metern ergibt sich ein Rauminhalt von 117,3 Kubikmetern. Im Südosten verläuft das Objekt in die
Schnittkante und konnte aus diesem Grund nicht zur Gänze ergraben werden, allerdings erlaubt die geringe
Tiefe in diesem Bereich die Vermutung, dass die Befundgrenzen nicht allzu weit außerhalb der gegrabenen
Fläche zu erwarten sind. Die Konturen des Objekts zeigen keinerlei regelhafte Strukturen, ganz im Gegenteil
besteht es aus mehreren, scheinbar wahllos angeordneten, kleineren Gruben, deren Form und Tiefe wiederum
völlig verschieden ist. Die Tiefen dieser kleineren Objekte liegen meist zwischen 0,5 und 1,3 Metern, wobei
kessel- bis trichterförmige Profile vorherrschen. (s. Anhang Detailansicht Interface Objekt 14).
Die sehr einheitliche, meist scharf abgrenzbare Verfüllung der Grube besteht aus dunkelbraunem, sandigem
Schluff, an Einschlüssen sind Holzkohle sowie Steine von bis zu 30 Zentimeter Durchmesser zu erwähnen.
Auffällig sind weiterhin eingeschlossene Blöcke von hellgelbem, sandigem Material, die wohl als Versturz
anzusprechen sind.
Das Fundmaterial setzt sich aus Keramik- und Knochenfragmenten zusammen, wobei die Keramik den
Hauptanteil ausmacht. Von insgesamt etwa 50 Kilogramm Gesamtgewicht entfallen nur 0,5 Kilogramm auf
das Knochenmaterial.
Der Großteil (88 Gewichts-%) des keramischen Fundmaterials besteht aus wenig aussagekräftigen, meist
stark fragmentierten Wandbruchstücken, 4 Gewichts-% entfallen auf Bodenfragmente, 3 Gewichts-% auf
Randfragmente, 4 Gewichts-% auf Henkel und nur 1 Gewichts-% weist Verzierungen auf.
Technologisch zeigt sich das Material sehr einheitlich, es herrscht grobe, poröse, Keramik mit kleinen
Steinchen (bis 3 Millimeter Durchmesser) und wenig Glimmerflitter vor, die Oberflächen sind in den
meisten Fällen schlecht geglättet. Die handgeformte Keramik wurde bei Mischbrand nicht sehr hart gebrannt.
Seite - 13 -
Bei einer ersten Sichtung des Materials konnten bereits anhand einzelner größerer Bruchstücke einige
Aussagen über vorhandene Gefäßformen getroffen werden. Festgestellt wurden Henkeltöpfe mit schwach
trichterförmig ausgebogenen Rändern sowie ausladendem Hals, wenig ausladendem Bauch und geraden
Standflächen. Gelegentlich konnte ein Knick an der Gefäßschulter beobachtet werden, durch den der Hals
vom übrigen Gefäß abgesetzt ist. Weiters weisen einige Bodenfragmente mit geraden Standflächen und sehr
flach ansetzenden Wänden auf das Vorhandensein von Schüsseln hin. Hierbei ist in manchen Fällen die
Wand scharf abgesetzt. Einzigartig bleibt das Fragment einer Fußschüssel mit flacher Schüsselwand und
schräg ansetzendem, geradem Fuß.
Ein nahezu vollständiges Gefäß zeichnet sich durch einen
schwach ausladenden Rand, einen annähernd
zylindrischen Hals sowie einen bauchigen Gefäßkörper
und eine gerade Standfläche aus. Der Schulterumbruch ist
durch einen kleinen Knick vom Hals abgesetzt. Knapp
unterrandständig sowie an der Gefäßschulter setzen
gegenständig zwei weitlichtige Bandhenkel an (Abb. 16).
Aussagekräftig ist die relativ große Anzahl an
Henkelfragmenten, die mehrheitlich als weitlichtige,
unterrandständige Bandhenkel angesprochen werden
können, und zwar entweder mit parallel laufenden oder in
der Mitte einziehenden, schwach sanduhrförmigen Seiten.
Der untere Ansatzpunkt liegt an der Gefäßschulter. Im
Falle eines wohl zu einer Schüssel gehörenden Fragments
setzen an beiden Henkelansätzen horizontal verlaufende
Leisten an. Als singuläre Erscheinungen sind das
Fragment eines Stabhenkels, ein kleiner Ösenhenkel sowie
ein unterrandständig horizontal ans Gefäß angesetzter
Bandhenkel zu betrachten.
An einigen wenigen Stücken konnten Verzierungen festgestellt werden, die mehreren Gruppen zuzuordnen
sind.
An Rillen treten einerseits horizontal umlaufende, schwach eingetiefte Rillen auf, die mehrfach einzeln und
in einem Fall als Bündel von drei Rillen beobachtet werden konnten, andererseits zeigen drei Fragmente tief
eingekerbte, horizontal verlaufende Rillenbündel von vier Rillen, die direkt unterhalb eines stark geknickten
Bauchumbruchs liegen. In einem Fall konnte bei letzteren der Ansatz eines weiteren, mindestens zwei Rillen
umfassenden Bündels festgestellt werden, das am unteren Rand des horizontalen Bündels im rechten Winkel
ansetzt und vertikal zum Gefäßfuß hin verläuft.
Weiters konnten zwei Formen von Leisten beobachtet werden, und zwar einmal eine etwa einen Zentimeter
Seite - 14 -
Abb. 15: Ganzgefäß mit zylindrischem Hals,Foto: PannArch 2012.
Abb. 16: diverse Henkel-und Randfragmente aus der Lehmentnahmegrube, Foto: PannArch 2012.
breite, horizontale Fingertupfenleiste, die an einem geknickten Gefäßumbruch sitzt, allerdings nicht das
ganze Gefäß umläuft, und in zwei Fällen Fragmente einer einen Zentimeter breiten, horizontal verlaufenden
Leiste von rechteckigem Querschnitt, die von vertikal verlaufenden Rillen durchbrochen ist. Da es sich
hierbei nur um sehr kleine Fragmente handelt, kann keine Aussage über die Länge dieser Leisten getroffen
werden.
Mehrfach konnten auch zwei bis drei Zentimeter lange, horizontal verlaufende Lappen festgestellt werden,
die in zwei Fällen von einer Kerbe mittig durchbrochen sind.
Als Einzelstück ist ein Bauchumbruch zu betrachten, das drei parallele, vertikal verlaufende Lappen von fünf
Zentimetern Länge und 0,5 Zentimetern Breite aufweist. An jeweils einem Ende der beiden äußeren Lappen
setzen oben erwähnte, horizontal verlaufende Leisten von rechteckigem Querschnitt an.
Ein einziges, leider sehr schlecht erhaltenes Wandfragment zeigt Reste von Litzenzier, und zwar in Form von
zwei horizontalen Zwirnrabdruckbündeln einmal zu sechs und einmal zu mindestens drei Zwirnabdrücken.
Das Stück zeichnet sich außerdem durch eine, vom übrigen Fundmaterial abweichende, feine, graue
Konsistenz aus.
Zu erwähnen ist außerdem ein Randbruchstück feiner Ware mit glatter Oberfläche, das einen horizontal
ausgebogenen, gerade abgestrichenen Rand sowie eine dicht unter dem Rand sitzende, mittig eingedrückte
Knubbe aufweist und sich somit vom übrigen Fundmaterial unterscheidet.
Abschließend sei noch ein in annähernd kreisrunde Form gebrachtes Wandbruchstück genannt, das an einen
nicht vollendeten Wirtel denken lässt.
Zur Datierung der vorliegenden Funde kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur eine grobe Einordnung
getroffen werden. Die reichlich vertretenen Bandhenkel sowie die Form der Töpfe verweisen in die
Bronzezeit, die sanduhrförmige Henkel sind der Wieselburger Kultur zuzuordnen, wenngleich die
Gefäßformen nicht der klassischen Ausformung dieser Erscheinung entsprechen. Das Auftreten von
Litzenzier spricht für eine etwas spätere Einordnung, was auch das übrige Fundmaterial, so wie das oben
erwähnte, nahezu vollständig erhaltene, doppelhenkelige Gefäß, andeutet. Der vorläufige
Datierungsvorschlag lautet also auf späte Frühbronzezeit oder beginnende Mittelbronzezeit.
Die Funktion der Grube (Objekt 14) kann hier aufgrund der unregelmäßigen Form sowie den Ausmaßen
wohl als Materialentnahmegrube angegeben werden, wenngleich noch zu klären ist, ob das anstehende,
schluffig-sandige Material sich überhaupt für die Verwendung beispielsweise als Wandbewurf eignete. Die
sekundäre Nutzung als Abfallgrube einer Siedlung erscheint vor allem aufgrund der geringen Menge an im
aufgefundenen Tierknochen als wenig wahrscheinlich.
Seite - 15 -
Zusammenfassung:
Im Zuge der Errichtung der Nordumfahrung Schützen am Gebirge wurde ein römerzeitliches Gräberfeld
ergraben.
Die dokumentierten Befunde umfassen zwei Objektgruppen, Gräber und Gräben des römerzeitlichen
Gräberfeldes einerseits und eine bronzezeitliche Siedlungsgrube anderseits.
Bei den römerzeitlichen Gräbern handelt es sich um Körpergräber und Brandbestattungen. Die Körpergräber
waren mit einer Ausnahme beigabenführend. Die Grabinventare waren bescheiden. Neben keramischen
Gefäßen wurden Trachtbestandteile und Münzen geborgen. Die Niederlegung der Erwachsenen erfolgte in
zwei Gräbern in Ost-West-Richtung. Die dritte Körperbestattung befand sich in einem Graben, war
beigabenlos und folgte in ihrer Lage der Grabenausrichtung. Die vierte Bestattung war ein Kindergrab in
einem Sarkophag, der ebenfalls Ost-West orientiert war. Der Kopf dürfte sich in diesem Fall, im Gegensatz
zu den ersten beiden Körperbestattungen, wo der Kopf im Osten situiert war, allerdings im Westen befunden
haben.
Die Brandbestattungen waren einheitlich sehr seicht in den Boden eingetieft und nur in marginalen Knochen-
und Holzkohleresten erhalten. Diese Gräber waren mit einer Ausnahme beigabenlos. Bei einem Brandgrab
befand sich auf der Sohle der Grabgrube ein Eisenmesser.
Einen weiterer Befund innerhalb dieses Gräberbezirkes stellte ein annähernd rechteckiger Graben mit
mittigem gegen Osten gerichtetem Eingang dar. Innerhalb dieses umlaufenden Grabens befanden sich zentral
mehrere Ausrißgruben. In der Nordwest-Ecke innerhalb des Gevierts wurde eine Brandbestattung in einer
Urne geborgen. In der Ostseite des Grabens befand sich die bereits erwähnte beigabenlose Körperbestattung,
deren Grabschacht direkt in die Aussenflanke gegraben war.
Neben anderen Grabenbefunden konnte auch der Umfassungsgraben des Gräberfeldes in seinen Resten
dokumentiert werden ohne jedoch die Gesamterstreckung des Gräberbezirkes feststellen zu können, da nur
ein Teil des Gräberfeldes von Straßenbaumaßnahmen betroffen war.
Die zweite Objektgruppe umfasste einen großflächigen bronzezeitlichen Befund, der durch eine
unregelmäßig geformte Grube gebildet wurde. Der Fundinhalt dieser Grube war einheitlich in die Bronzezeit
zu datieren.
Anhang Pläne:
Übersichtsplan
Detail Interface Objekt 14, bronzezeitliche Materialentnahmegrube.
Seite - 16 -
Literatur:
Alfons Augustinus Barb Burgenländische Heimatblätter Eisenstadt 1953 S 103
Laslo Bella Arch. Ért. VIII Sopron 1888 S 23
Anton Bernhauser Geologische Bodentypen des Nordburgenlandes Eisenstadt 1968
Günter. Dembski Pro Austria Romana Jg. 27/1977 Heft 9 – 10
Nachrichtenblatt f. d. Forschungsarbeit ü. d.
Römerzeit Österreichs Wien 1977
Manfred K. H. Eggert Prähistorische Archäologie, Konzepte u. Methoden Tübingen 2005
Hans Jankuhn Einführung in die Siedlungsarchäologie Berlin 1977
Wolfgang Kubitschek Römerfunde von Eisenstadt Wien 1926
Edit. B. Thomas Römische Villen in Pannonien Budapest 1964
Alexander (Sandor) Wolf Bericht über die Eisenstädter Grabungen 1902 – 1914
in Römerfunde von Eisenstadt Wien 1926 2 – 11
Fundberichte Österreich II Wien 1934/1937
Ortsaktenarchiv der Burgenländischen Landesmuseen Eisenstadt
Seite - 17 -
SE148
SE184
SE136
SE600
SE115
SE150SE137
SE604
SE113
SE144SE145
20283,470
20283,470
20310,842
20310,842
20338,214
20338,214
20365,586
20365,586 30113
0,786
30116
5,651
30116
5,651
30120
0,516
30120
0,516
30123
5,381
Maßnahmennummer 30021.12.02Übersichtsplan
LegendeSchnittkanten
archäologische BefundeDatierung
Bronzezeit
römische Kaiserzeit
undatierbar
±
0 10 20 30 405Meter
KG Schützen am GebirgeMaßnahmenbezeichnung: GräberfeldErstellungsdatum: 10. Jänner 2014Planerstellung: Gregor Schönpflug/PannArchKoordinatensystem GK M34
Plannummer 006
Graben 2
Begrenzungsgraben
Graben 1
Grabgartengräbchen Bestattung 1
Bestattung 2Bestattung 3
Bestattung 4
Bestattung 5
Bestattung 6
Bestattung 7
Bestattung 8
Objekt der Bronzezeit
Bestattung 9
Schnitt 1
Schnitt 2
Schnitt 3
134
133,8
133,9
133,7
133,6
134,1
134,2
133,5
134,3
133,4
133,3
133,2
133,1
133
132,9
134,2
133133
,1134,3
134,1
133,8
133,1
134
133,6
133,6
134,1
134,2
133,6
133,8
134
133,2
133,1
133,7
133
133,6
133,3
134,1
133
133,4
133,6
133,7
133,1
133,113
3,8
133,3
133,6
133,2
134,1
133,9
133,6
133,6
133
134
133,7
133,2
134
134
134
133,4
133,9
133,2
133,6
133
133,8
133,3
133,1
133,9133,7
134,1
133,4
133,5
133
133,2
133,5
133,9
133,5
133,5
134,2
133,6
133,5
134,1
133,7
133,4
133,4
134,2
133,1
133,5
133,2
133,2
133,8
133,2
133,6
133,2
133,9
133,1
133,5
134
133,1
133,4
133,7
133,4
134,2
133,2
134,2
133,3
134,2
133,9
134,1
133,5
133,6
133,3
133,1
133
133,4
133,6
133,7
134,2
133,1
133,1
133,4
133,1
133,7
133,3
134,1
133,9
133,4
134,2
133,6
133,8
134,1
133
134
133,9
134
133,1
134,1
133,4
133,3
134
133,5
133,6
133,4
134,3
133,5
133,9
134,1
133,8
133,4
133,2
134,1
133,2
132,9
134,1
134,1
133,9
133,6
133,8
133,2
133
133,1
133,4
134,2
133,4
133,1
133,2
133,7
133,6
133,6
134,1
133,3 133,8
134,2
133,3
133,5
133,6
133,8
133,1
20317,898
20317,898
20319,898
20319,898
20321,898
20321,898
20323,898
20323,898
20325,898
20325,898
20327,898
20327,898
20329,898
20329,898
20331,898
20331,898
20333,898
20333,898 30115
4,307
30115
7,307
30115
7,307
30116
0,307
30116
0,307
30116
3,307
30116
3,307
30116
6,307
30116
6,307
30116
9,307
30116
9,307
30117
2,307
30117
2,307
Maßnahmennummer 30021.12.02Detail Objekt der Bronzezeit
LegendeHöhenschichtlinien
Schnittkante
Befundgrenze
±
0 2 4 6 81Meter
KG Schützen am GebirgeMaßnahmenbezeichnung: GräberfeldErstellungsdatum: 10. Jänner 2014Planerstellung: Gregor Schönpflug/PannArchKoordinatensystem GK M34
Plannummer 010