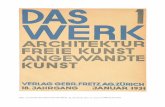Fotografien beleben Mehr vom Bild im digitalen Raum - The ...
Zivilgesellschaft als politischer Raum. Ein diskurstheoretisches Konzept von Zivilgesellschaft.
-
Upload
uni-hamburg -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Zivilgesellschaft als politischer Raum. Ein diskurstheoretisches Konzept von Zivilgesellschaft.
Die Zivilgesellschaft
als politischer Raum
Ein diskurstheoretisches
Konzept von Zivilgesellschaft
Masterarbeit zur Erlangung der Würde des Master of Arts in Soziologie am
Institut für Soziologie der Universität Hamburg
vorgelegt von
Conrad Lluis Martell
Wintersemester 2013/2014
Matrikelnummer: 6366809
Schedestraße 3
20251 Hamburg
Erstgutachter
Prof. Dr. Urs Stäheli
Institut für Soziologie
Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie und soziologische Theorie
Zweitgutachterin
Ute Tellmann, PhD
Institut für Soziologie
Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie und soziologische Theorie
La Révolution incarne l’illusion de la politique [...]
Elle inaugure une monde où tout changement social est
imputable à des forces connues, répertoriées, vivantes.
(François Furet, Penser la Révolution française)
Man könnte konkret die Herausbildung einer historischen
kollektiven Bewegung untersuchen […] Es handelt sich
um einen molekularen, äußerst feinen Prozess, um
radikale, in die Verästelungen reichende Analyse, deren
Quellenmaterial von einer unbegrenzten Menge von
Büchern, Broschüren, Zeitschriften- und Zeitungsartikeln
gebildet wird, von mündlichen Gesprächen und Debatten,
die sich unendlich oft wiederholen und in ihrem riesigen
Ensemble jene Betriebsamkeit darstellen, aus der ein
Kollektivwille mit einem gewissen Grad an Homogenität
hervorgeht.
(Antonio Gramsci, Gefängnishefte)
Inhaltsverzeichnis
Einleitung 1
A) Die Diskurstheorie von Laclau und Mouffe 6
I. Der poststrukturalistische Blick: das Soziale als Diskursgewebe 7
1) Diskurs und Relation (Saussure) 8
2) Brüchige Strukturen (Derrida) 9
II. Die Konzepte und Grundaxiome der Hegemonietheorie 12
1) Grundbegriffe: vom Diskurs zum Antagonismus 12
a) Diskurs 12
b) Artikulation 14
c) Differenz- und Äquivalenzlogik 15
d) Antagonismus 17
2) Diskurstheorie als Gesellschaftstheorie 19
a) Diskursformation 19
b) Hegemonie 20
c) Das Primat des Politischen 23
III. Politische Ontologie und die Verdrängung des Sozialen 25
1) Eine postfundamentalistische politische Ontologie 25
2) Das Soziale als Gegenbegriff des Politischen 26
a) Politisches und Soziales – ein ontologisches
Gegensatzpaar 27
b) Die ontische Polarisierung von Politik und Gesellschaft 30
IV. Überleitung: Das Soziale und die Tradition 32
B) Dreh- und Angelpunkt des Politischen: die Zivilgesellschaft 37
I. Lefort: Gespalten, konflikthaft, politisch – die Zivilgesellschaft 39
1) Ursprüngliche Spaltung 40
2) Radikale Konflikthaftigkeit 41
3) Politische Aufladung 42
II. Gramsci: Die Zivilgesellschaft als hegemoniales Kräftefeld 44
1) Die Zivilgesellschaft als kulturelle Sphäre 45
2) Organische Ideologie 47
a) Kultureller Ausdruck: Alltagsverstand (senso comune) 48
b) Materielle Struktur: kulturelle Institutionen 50
c) Artikulierende Kraft: die Intellektuellen 52
3) Historische Blöcke 53
Exkurs: Zwischen normativer Aufladung und peripherer Stellung – zum
Stand der Debatte um den Begriff der Zivilgesellschaft 55
C) Ein diskurstheoretisches Zivilgesellschaftskonzept 59
I. Von der organischen Ideologie zur politischen Kultur 60
1) Politische Kulturen als sedimentierte Diskursformationen 61
2) Eine „befriedete“ Artikulationsweise 63
a) Differenzlogik 63
b) Entpolitisierte Grenzen („borders“) 64
c) Iterative Stabilisierung 66
3) Sedimentierungsdimensionen: Zeichen, Praktiken, Institutionen 68
a) Semiotische Dimension 69
b) Praxeologische Dimension 70
c) Institutionelle Dimension 73
II. Vom Alltagsverstand zur kollektiven Serie 76
1) Kollektive Serien – gestaltlose Kollektivitäten 77
2) Stabilisierungsfaktoren: Kontext, Regel, Wiederholung 78
3) Entstehungsformen: von der Performanz zur Lebensform 81
III. Von kulturellen Institutionen zu öffentlichen Sphären 85
1) Institutionelle Akteure als Diskursproduzenten 86
2) Umkämpfte Signifikationspolitiken 89
3) Öffentliche Sphären 91
IV. Die Struktur der Zivilgesellschaft 95
D) Die Zivilgesellschaft als politischer Raum 101
1) Die soziale und politische Verfasstheit der Zivilgesellschaft 102
2) Hegemonie revisited: die passive Hegemonie politischer
Kulturen 105
3) Die Dynamiken der Zivilgesellschaft 107
4) Die Relativierung der Dichotomie Soziales vs. Politisches 109
Fazit: Perspektiven einer politischen Gesellschaftstheorie 111
Literatur 114
1
Einleitung
Gesellschaft und Politik erscheinen meist als Gegenbegriffe, die auf vollkommen Gegensätzli-
ches zielen. Steht das Gesellschaftliche für die Sphäre des privaten Verkehrs, der lebensweltli-
chen Reproduktion und der friedlichen Überlieferung von Werten und Normen, so erscheint
das Politische als der Bereich, in der Willensbildungsprozesse geschehen, sich Regierungen
konstituieren und Entscheidungen fallen. Der Gesellschaftsbegriff erfährt damit – in der Öffent-
lichkeit, aber auch in der Sozialtheorie und politischen Theorie – eine Entpolitisierung, er wird
zur „Kehrseite“ der Politik. Die Gegenüberstellung von Gesellschaft und Politik führt gleich-
wohl in die Sackgasse, blickt man diagnostisch auf das politische Zeitgeschehen: Wie erklärt
sich, dass von Spanien über Brasilien bis zur Türkei neue Protestbewegungen entstehen, die
sich abseits tradierter Konfliktlinien positionieren und deren Organisationsweisen, Forderungen
und Kollektivitätsformen aus dem scheinbaren Nichts „emergieren“? Von wo stammt die unge-
brochene kulturelle und politische Kraft religiöser Traditionen, wie sie etwa der französische
Katholizismus in seinen massiven Mobilisierungen gegen die Legalisierung der Homosexuel-
lenehe zur Schau stellte? Oder wie ist es dem „staatenlosen“ schottischen oder katalanischen
Nationalismus gelungen, zu einem mittlerweile mehrheitsfähigen Commonsense zu werden?
Diese Phänomene zeigen exemplarisch, dass Gesellschaft und Politik in einem engeren
Verhältnis stehen als gemeinhin angenommen. Die Artikulation von Protestbewegungen, die
Langlebigkeit religiöser Traditionen oder die Ausbreitung von Nationalismen mögen jenseits der
Politik und ihrer institutionellen Formen stehen und oftmals im Medium der Kultur erfolgen,
unpolitisch sind sie deshalb aber keineswegs. In dieser Arbeit vertrete ich die These, dass die
binäre Gegenüberstellung von Gesellschaft und Politik durch einen dritten Begriff transzendiert
werden muss: den der Zivilgesellschaft. Diese Kategorie soll einerseits zeigen, dass die umkämpf-
te politische Instituierung und Infragestellung sozialer Ordnung nicht in einem luftleeren Raum
stattfinden, sondern in einem geschichtlich vorstrukturierten Terrain. Er muss andererseits aber
auch offenlegen, dass die scheinbar friedliche gesellschaftliche Reproduktion sozialer Verhält-
nisse in ihren Tiefenwirkungen, und Brechungen, ein bereits in sich politischer Vorgang ist. In
der Zivilgesellschaft laufen Gesellschaft und Politik zusammen, überlagern einander und gehen
ineinander über. Gegenüber dem aktuell vorherrschenden Verständnis dieser Kategorie1 ver-
fechte ich eine Reaktivierung von Antonio Gramscis (1891-1937) Zivilgesellschaftskonzept.
1 Siehe dazu schon die Zivilgesellschaftsdefinition des DUDEN-Wörterbuchs, nach der die Zivilgesellschaft jene
Gesellschaftsform sei, „die durch selbstständige, politisch und sozial engagierte Bürger[innen] geprägt ist“ (Du-
den 2013). Zur Gleichschaltung von Zivilgesellschaft und Zivilität paradigmatisch Kocka 2007 oder die Beiträge
in Edwards 2011. Siehe zur Diagnose der Debatte um den Zivilgesellschaftsbegriff auch meinen Exkurs, S. 55-58).
2
Für Gramsci ist die Zivilgesellschaft eine kulturelle Sphäre: In ihr verankern sich die Werte und
Normen, die für den sittlichen Zusammenhalt des Gemeinwesens sorgen. Diese sittliche Kohä-
sion ist indes keine unpolitische Gegebenheit, die aus individuellen Einstellungen oder friedli-
chen Sozialisationsprozessen hervorginge, sondern ein komplexer Ausdruck sozialkultureller
Kräfteverhältnisse. Der gesellschaftliche Konsens ist nicht gegeben, sondern wird durch kollek-
tive Deutungs- und Gestaltungskämpfe organisiert. Mit Gramsci ist die Zivilgesellschaft als
ein kulturelles Kräftefeld zu begreifen, in der Hegemonie ausgeübt und herausgefordert wird.
In dieser Arbeit möchte ich Gramscis Konzeption der Zivilgesellschaft aufgreifen und
aktualisieren, indem ich sie als den Bezugspunkt aller sozialen und politischen Beziehungen
begreife. Dafür plädiere ich für ein starkes, politisch aufgeladenes Verständnis von Zivilgesell-
schaft. Meine Leitthese lautet, dass die Zivilgesellschaft als politischer Raum der Ausgangs-
punkt politischer Prozesse ist und diese strukturiert. Zugleich ist aber die zivilgesellschaftliche
Struktur ihrerseits das Ergebnis hegemonialer Auseinandersetzungen und wird fortwährend
durch diese umgestaltet. Die Struktur der Zivilgesellschaft steht genau an der Schnittstelle zwi-
schen dem Sozialen als der entpolitisierten Reproduktion sozialer Verhältnisse und dem Politi-
schen als ihrer umkämpften Instituierung und Infragestellung. Indem ich so mit Gramsci die
Zivilgesellschaft als Dreh- und Angelpunkt politischer Prozesse und als Herausbildungsort kul-
tureller Hegemonie lese, lanciere ich eine Umbesetzung dieser Kategorie, die ihr über den Weg
ihrer konzeptuellen Neufassung eine theoretische und politische Schlüsselstellung zuweist.
Eine hegemonietheoretische Lektüre von Zivilgesellschaft
War Gramscis zentraler Bezugspunkt noch ein (unorthodoxer) Marxismus, so orientieren sich
die vorliegenden Überlegungen an einer diskurstheoretischen Gesellschaftsanalyse, die sozia-
le Prozesse als immanent symbolische Prozesse liest und die diskursive Verfasstheit des Sozi-
alen betont.2 Ich erarbeite mein Zivilgesellschaftsverständnis im Anschluss an die poststruktu-
ralistische Theoriebildung im Allgemeinen und an die diskursanalytische Hegemonietheorie
Ernesto Laclaus und Chantal Mouffes im Besonderen. Laclaus und Mouffes Ansatz ist einer der
gegenwärtig ambitioniertesten Versuche im Feld des Poststrukturalismus, Diskurstheorie als
Gesellschaftstheorie zu entwerfen. Die Zivilgesellschaft gilt mir – anders als herkömmlichen
Ansätzen – nicht als eine sozialstrukturelle und klar eingrenzbare Sphäre, sondern als ein
höchst dynamisches Diskursfeld, das auch vermeintlich „vorpolitische“ Lebenswelten und
2 Auf die Prämissen, Grundkonzepte und Forschungsperspektiven poststrukturalistischer Kultur- und Diskurs-
theorien kommt das nächste Kapitel detailliert zu sprechen.
3
Sinnhorizonte durchdringt.3 Die Zivilgesellschaft avanciert damit zu einem symbolisch-
kulturellen Handlungs- und Repräsentationsrahmen,4 in den politische Prozesse eingefasst
sind. Die Zivilgesellschaft strukturiert politische Artikulationen, aber sie wird ihrerseits auch
fortwährend durch Artikulationsprozesse umstrukturiert. Die Strukturen der Zivilgesellschaft
resultieren aus der erfolgreichen Fixierung von Bedeutung und ihrer Gerinnung zu einer soli-
den Topographie. Die jeweils instituierte zivilgesellschaftliche Struktur bildet ein sedimen-
tiertes Terrain von Machtverhältnissen, das sich aber stets repolitisieren lässt. Durch diese
Repolitisierungen verschiebt sich die Bedeutungstopographie der Zivilgesellschaft: Möglich-
erweise werden dann dominante Diskurse und symbolische Praktiken zurückgedrängt, margi-
nalisierte Bedeutungsgehalte reaktiviert oder sogar neue Bedeutungen artikuliert – in jedem
Fall verändern sich die Eckpfeiler des politischen Raumes. Die Zivilgesellschaft ist ein sym-
bolisches Kräftefeld mit einer hegemonial verfassten und stets umkämpften Struktur.
Mein Anschluss an die Hegemonietheorie Laclaus und Mouffes ist aber insofern unor-
thodox, als ich mich dagegen verwehre, die Kategorie der Zivilgesellschaft einer der beiden
Logiken des Sozialen oder des Politischen zuzuordnen, die nach Laclau und Mouffe eine sozial-
ontologische Natur aufweisen. Versteht man unter dem Politischen die konflikthafte Neugrün-
dung und Infragestellung sozialer Verhältnisse und unter dem Sozialen die „befriedete“ Sedi-
mentierung und Reproduktion dieser Verhältnisse (vgl. Laclau 1990: 34f), dann bewegt sich die
Kategorie der Zivilgesellschaft an der Schnittstelle, wo diese beiden Logiken in ihren jeweiligen
ontischen Ausprägungen zusammenkommen und einander überlagern: Ist die Struktur der Zi-
vilgesellschaft einerseits ein sedimentierter Ausdruck hegemonialer Verhältnisse (Soziales), so
wird diese Struktur andererseits fortwährend kraft der ergebnisoffenen Dynamik politischer
Instituierungsakte umgestaltet (Politisches). Meine Akzentsetzung ist, dass in der ontischen
Kategorie der Zivilgesellschaft die ontologischen Kategorien des Sozialen und Politischen zu-
sammenlaufen. Ich widerspreche so der Hegemonietheorie in ihrer – explizit oder implizit –
getätigten Zuordnung des Politischen zum ontischen Feld der Politik und des Sozialen zum on-
tischen Feld der Gesellschaft. 5
Damit verschiebe ich nicht nur etablierte hegemonietheoretische
Kategorien, sondern führe auch neue Begrifflichkeiten ein, um die von Laclau und Mouffe nur
bruchstückhaft theoretisierten Prozesse der sozialen Sedimentierung und politischen Reaktivie-
rung in den Fokus zu rücken. Auf diese Weise leiste ich einen Beitrag zur Einlösung des hege-
monietheoretischen Versprechens, Diskurstheorie als Gesellschaftstheorie zu entwerfen.
3 Zur kulturtheoretischen Perspektivierung politischer Phänomene und Prozesse siehe Reckwitz (2004: 51-54).
4 Diese Lektüre teilt mit Gramsci die Betonung der Kultur als dem zentralen Definiens der Zivilgesellschaft (S. 45f).
5 Zum synthetischen Entwurf einer postfundamentalistischen Gesellschaftskonzeption siehe Marchart 2013.
4
Methodologie
Die Ausführungen zu meinem hegemonietheoretischen Verständnis von Zivilgesellschaft als
politischem Raum fungieren als konzeptueller Vorgriff. Sie sollen für die Leitgedanken sensi-
bilisieren, die diese Arbeit und ihren Argumentationsgang anleiten und die der Untersu-
chungsgang Schritt für Schritt plausibilisieren wird. Methodologisch gehe ich so vor, dass ich
zunächst immanent an die Hegemonietheorie von Laclau und Mouffe anschließe und vor-
schlage, ihren Ansatz grundbegrifflich um ein diskurstheoretisches Zivilgesellschaftskonzept
auszubauen. Die konzeptuellen Hauptstränge dieser Erweiterung werden dabei inspiriert durch
die grundlegenden Konzepte von Gramscis Zivilgesellschaftsverständnis. Diese Erweiterung
tätige ich im Rückgriff auf das Feld der poststrukturalistischen Theoriebildung – wobei ich
mich zuweilen auch jenseits herkömmlicher disziplinärer Grenzen bewege und auch auf ande-
re kulturtheoretische Theorielinien zurückzugreife (etwa der Kulturgeschichte, der Wissens-
soziologie oder der Sozialphänomenologie).
Da sich die Arbeit nicht auf dem Terrain empirischer Forschung, sondern auf dem sozial-
theoretischer Auseinandersetzung bewegt, ist ihr Fokus stets hermeneutisch-verstehender Na-
tur. Meine Ausführungen offerieren kontingente Deutungsvorschläge, die sich anzweifeln und
zurückweisen lassen. Sowohl die Rekonstruktion des Ansatzes von Laclau und Mouffe und
anderer Theoriestränge als auch die Entfaltung meines Zivilgesellschaftskonzeptes und seiner
grundlegenden Kategorien müssen als theoretische Interventionen gelten (vgl. Howarth 2005:
321). Als solche folgen sie nicht neutralen und scheinbar „objektiven“ Prinzipien, sondern mei-
nen forschungsstrategischen Zielsetzungen (vgl. Glynos/Howarth 2007: 201f). Die Arbeit er-
hebt aber insofern den Anspruch auf methodologische Kontrollier- und Nachvollziehbarkeit, als
sie das Verständnis von Zivilgesellschaft als politischem Raum keineswegs ex nihilo entwirft,
sondern es immanent aus Laclaus und Mouffes Diskurstheorie ausarbeitet. Die zu entwickelnden
Kategorien ergänzen und verschieben das hegemonietheoretische Vokabular, sie konstituieren
nicht einen eigenen und für sich stehenden Ansatz. Auch dort, wo ich Laclau und Mouffe kriti-
siere, ist dies keine Fundamentalkritik, sondern vielmehr ein Erweiterungsvorschlag. Des Wei-
teren bewegt sich mein Vokabular eine Ebene unter der eines voll ausgereiften sozialtheoreti-
schen Modells (vgl. Joas/Knöbl 2004: 26). Meine Konzepte stellen erste Analysekategorien
dar, deren empirische Schlagkraft erst noch zu prüfen ist. Das primäre Anliegen dieser Arbeit
ist, eine Analyseheuristik zu entwerfen, die Diskursanalysen dann in ein empirisch operatives
Vokabular überführen müssten (vgl. dazu generell Bachmann-Medick 2010: 25ff).
5
Vorgehen und Gliederung
Die Untersuchung ist in vier übergeordnete Argumentationsschritte unterteilt, die schrittweise
mein Verständnis von Zivilgesellschaft als politischem Raum entfalten. Im ersten Kapitel (A
Die Diskurstheorie von Laclau und Mouffe) gehe ich auf den Ansatz von Laclau und Mouffe
ein und rekonstruiere systematisch jene grundlegenden Prämissen und Grundbegrifflichkeiten
der Hegemonietheorie, die für mein Zivilgesellschaftskonzept zentral sein werden. Ich schlie-
ße dieses Eröffnungskapitel mit einer generellen Kritik, in der ich die hegemonietheoretische
Unterscheidung zwischen den Logiken des Politischen und des Sozialen und ihrer Zuordnung
zu den ontischen Kategorien von Politik und Gesellschaft fokussiere. Dieser Unterscheidung
stelle ich eine heterodoxe Lektüre des Verhältnisses zwischen dem Sozialen und dem Politi-
schen bei Laclau und Mouffe entgegen, die über den ontischen Begriff der Tradition die faktische
Verwobenheit dieser ontologischen Logiken betont. Sodann setze ich mich im zweiten Kapitel (B
Dreh- und Angelpunkt des Politischen: die Zivilgesellschaft) mit dem Begriff der Zivilgesellschaft
auseinander und konturiere sie als den zentralen Bezugspunkt des Politischen. Um das Potential
eines solchen Zivilgesellschaftsverständnisses freizulegen, werde ich gezielt und bereits in im-
pliziter Orientierung an meine eigenen Kategorien die Eckpfeiler von Gramscis Zivilgesell-
schaftsverständnis vorstellen. Dabei plädiere ich dafür, dass seine Erklärungskraft durch die
Verbindung mit der Demokratietheorie Claude Leforts noch erhöht werden kann. Das zweite
Kapitel schließt mit einem Exkurs, in dem ich den derzeit abgeflachten Diskussionsstand um
den Begriff der Zivilgesellschaft in der Sozial- und politischen Theorie rekapituliere. Dabei ist
meine Diagnose, dass die Kategorie der Zivilgesellschaft in gegenwärtigen Debatten eine perip-
here Rolle einnimmt: Als gesellschaftstheoretischer Schlüsselbegriff aufgegeben, überlebt die
Zivilgesellschaft heute als normativer Kampfbegriff ohne tiefergehenden deskriptiven Gehalt.
Diese Diagnose dient als negative Kontrastfolie, von der aus ich im dritten Kapitel (C
Ein diskurstheoretisches Zivilgesellschaftskonzept) mein eigenes Zivilgesellschaftsverständnis
entfalte. In diesem Kapitel führe ich die Ausführungen der beiden ersten Kapitel zusammen
und verdichte sie zu einem diskurstheoretischen Zivilgesellschaftskonzept. Dieses baut, inspi-
riert durch Gramsci und Lefort, den Ansatz von Laclau und Mouffe grundbegrifflich aus. Auf
Basis dieser grundlegenden Ausführungen zieht das vierte Kapitel (D Die Zivilgesellschaft als
politischer Raum) die generellen sozialtheoretischen Schlussfolgerungen und reißt die erwei-
terte Perspektive auf gesellschaftliche und politische Prozesse vor, die daraus erwächst, wenn
aus hegemonietheoretischer Warte Zivilgesellschaft als politischer Raum neu begriffen wird.
6
A) Die Diskurstheorie von Laclau und Mouffe
Die Hegemonietheorie von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe6 ist einer der gegenwärtig
ambitioniertesten Versuche im Feld poststrukturalistischer Theoriebildung, Diskurstheorie als
Gesellschaftstheorie zu entwerfen. Ihr durch die Verschränkung poststrukturalistischer und
gramscianischer Kategorien entwickelter Ansatz konzipiert die Gesellschaft als ein brüchiges
Diskursgewebe, dessen konstitutive Instabilität immer wieder aufs Neue durch politische Ar-
tikulationsakte stabilisiert werden muss. Für die Hegemonietheorie wird Gesellschaft zu ei-
nem zutiefst kontingenten und dynamischen Geschehen, „in dem sich politische Einheiten
und Frontlinien unaufhörlich etablieren, auflösen und neu bilden“ (Saar 2008: 199). Dabei
stellen Laclau und Mouffe dem poststrukturalistischen Hinweis auf die grundlegende Kontingenz
aller sozialen Verhältnisse das Moment der politischen Ordnungsbildung an die Seite (vgl.
Critchley/Marchart 2004: 5). Laclau und Mouffe entwerfen eine Theorie der Hegemonie, die
die Dimensionen des Diskursiven und des Politischen verwebt. Ihr postfundamentalistisches
Begriffsrepertoire behauptet die diskursive Verfasstheit und den politischen Ursprung jeder
Identität, Kollektivität und sozialen Ordnung. Die Autoren entwickeln ihren Ansatz an der
Schnittstelle zwischen Sozial-, Kultur- und Politiktheorie und unterziehen die tradierten Kon-
zepte dieser Disziplinen (Macht, Identität, Emanzipation, etc.) einer systematischen Dekon-
struktion, um eine deontologische und nachmetaphysische Rekonstruktion des Sozialen in
Angriff zu nehmen (vgl. Laclau/Mouffe 2001: 142f., auch Rüdiger 1996: 215).
Dieses erste Kapitel bettet den Ansatz von Laclau und Mouffe theoretisch ein, legt im-
manent seine grundlegenden Kategorien dar und kennzeichnet die Kritikstellen, die ich in den
folgenden Kapiteln weiterverfolgen werde. Unter Rückgriff auf Saussure und Derrida stelle
ich zunächst das poststrukturalistische Verständnis des Sozialen als einer relationalen und
brüchigen Struktur vor (I). Sodann konturiere ich das konzeptuelle Grundgerüst der Hegemo-
nietheorie entlang der Kategorien Diskurs, Artikulation, Differenz- und Äquivalenzlogik und
Antagonismus (II.1). Im Anschluss stelle ich dar, wie Laclau und Mouffe mit den Kategorien
Diskursformation und Hegemonie ihre Diskurstheorie als Gesellschaftstheorie entwerfen. Von
hier aus präsentiere ich ihre Grundthese von der Primatstellung des Politischen. Die Autoren
lesen das Politische als Gründungsdimension sozialer Verhältnisse, die sich durch die beiden
6 In dieser Arbeit wähle ich eine traditionelle Lektüre von Laclau und Mouffe und deute ihre Werke als einen –
durch Hegemony and Socialist Strategy (2001) [1985] verklammerten – Theorieansatz, den die Autoren in ver-
schiedene Richtungen ausbuchstabieren: Laclau stärker sozialtheoretisch grundiert und auf die Entwicklung
einer formalen Populismustheorie gerichtet, während sich Mouffe mit ihrem „agonistischen Pluralismus“ stärker
im Feld der Demokratietheorie verortet. Somit bezieht sich meine Theorierekonstruktion undifferenziert auf die
Schriften beider Autoren. Zur Kritik an der „symbiotischen“ Einheit Laclau/Mouffe vgl. aber Wenman 2003.
7
verwobenen Dimensionen von hegemonialen Entscheidungen und konstitutiven Antagonis-
men auszeichnet (II.2). Das anschließende Fazit verdichtet die immanente Rekonstruktion des
Ansatzes von Laclau und Mouffe, indem es den grundlegenden Status der Hegemonietheorie
als einer postfundamentalistischen politischen Ontologie unterstreicht, die die Momente von
Kontingenz und Ordnung zusammendenkt (III.1). Das erste Kapitel setzt sich abschließend
mit der zentralen Unterscheidung zwischen dem Politischen und dem Sozialen auseinander.
Ich präsentiere zwei alternative hegemonietheoretische Lektüren des Verhältnisses zwischen
der Sedimentierung hegemonialer Verhältnisse (Soziales) und ihrer umkämpften Institution
und Reaktivierung (Politisches). Während die erste „orthodoxe“ Deutung auf der Trennung
zwischen den ontologischen „Logiken“ des Politischen und des Sozialen beharrt (III.2) und
sie jeweils den ontischen Kategorien von Politik (Politisches) und Gesellschaft (Soziales) zu-
ordnet (III.3), eröffnet die zweite „heterodoxe“ Deutung über den ontischen Begriff der Tradi-
tion eine dynamischere Lesart der Beziehung zwischen dem Sozialen und dem Politischen
(IV). Diese zweite Deutungslinie werde ich in den folgenden Kapiteln vertreten und zu einem
diskurstheoretischen Zivilgesellschaftskonzept ausbauen.
I. Der poststrukturalistische Blick: das Soziale als Diskursgewebe
Wenn Laclau und Mouffe behaupten, dass ihre Hegemonietheorie ein postfundamentalisti-
scher Ansatz ist und sich im Horizont der Postmoderne bewegt (vgl. Laclau 1988), dann op-
tieren sie damit für eine Theorietradition, die den Glauben daran aufgegeben hat, dass die
Gesellschaft durch essentielle Strukturen (etwa der ökonomischen Basis) oder durch meta-
physische Letztprinzipien (etwa dem transzendentalen Vernunftbegriff) zusammengehalten
wird. Die konzeptuellen und methodischen Ressourcen, aus denen Laclau und Mouffe schöp-
fen, um ihr Theorieprojekt zu lancieren, entstammen – neben Gramsci – maßgeblich dem
Poststrukturalismus.7 Die beiden Autoren rezipieren die archäologische Diskurstheorie Michel
Foucaults und die Psychoanalyse Jacques Lacans, aber vor allem die Sprachtheorie Ferdinand
de Saussures und die Dekonstruktion Jacques Derridas, auf die ich im Folgenden eingehe. Im
systematischen Rückgriff auf Saussure und Derrida entwickeln Laclau und Mouffe das Be-
griffsinstrumentarium ihres Ansatzes und markieren ihre grundlegenden sozialontologischen
Auffassungen.
7 Dabei erschöpft sich der theoretische Horizont, in dem sich Laclau und Mouffe verorten, nicht im Poststruktu-
ralismus, sondern erstreckt sich – wie sich herausstellen wird – auf den Kulturmarxismus Gramscis, die Ideolo-
gietheorie Althussers, die Phänomenologie oder die Sprachphilosophie Wittgensteins (vgl. Laclau 1990: 191).
8
1) Diskurs und Relation (Saussure)
Dass soziale Verhältnisse diskursiv und relational verfasst sind, wird von allen semiotisch
ansetzenden Varianten des Poststrukturalismus geteilt.8 Das Verhältnis von Sprache und sozi-
aler Welt steht dabei im Zentrum der Überlegungen. Zum einen wird die Referenzfunktion
von Sprache auf eine objektiv gegebene Ordnung in Frage gestellt und behauptet, „that our
language does not merely mirror the world, but is instead partially constitutive of it“ (Norval
2000: 314, Hervorhebung CLM). Zum anderen lesen kulturalistisch-linguistisch orientierte
Ansätze die soziale Welt nach dem Muster der Sprache als eine immanent symbolische Ord-
nung, die durch kollektive Sinnsysteme organisiert wird und die den handlungskonstitutiven
Hintergrund aller sozialen Praktiken abgibt (vgl. Reckwitz 2008: 25).
Der Poststrukturalismus als die Tradition, in der sich Laclau und Mouffe verorten, fasst
die symbolische Konstitution des Sozialen durch die Analogisierung zwischen Sprache und
sozialer Welt. Dafür dient die Linguistik Ferdinand de Saussures als theoretischer Referenz-
punkt. Saussures Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft legen die Grundzüge einer
strukturalen Linguistik, die für den Poststrukturalismus im Allgemeinen und für die Hegemo-
nietheorie im Besonderen enorm einflussreich sind. In nuce lässt sich der Einfluss Saussures auf
Laclau und Mouffe in drei Gedankenkomplexen festhalten. Erstens liest Saussure die Sprache
als eine soziale Institution, die in keinem natürlichen Referenzverhältnis zur Außenwelt steht,
sondern aus gesellschaftlichen Konventionen hervorgeht (vgl. Saussure 1967: 80, auch
Laclau/Mouffe 1990: 109). Nach Saussure folgt die Bedeutung eines Wortes nicht aus der Refe-
renz des Sprachzeichens auf ein äußerlich gegebenes Objekt, sondern gehorcht den immanen-
ten Gesetzen der Sprache. Die Sprache wird zu einer sozialen Tatsache, deren Gesetzmäßigkei-
ten sich nicht von der Rede des Einzelnen her bestimmen lassen, sondern nur durch das Sprach-
system als Ganzes erklärt werden können (vgl. Saussure 1967: 16f, auch Quadflieg 2008: 95).9
Zweitens deutet Saussure diese als Ganzheit begriffene Sprache als geschlossenes Zei-
chensystem. Die Sprache bildet ein Gefüge von Zeichen, die aufeinander verweisen. Die
sprachlichen Zeichen bestehen nach Saussure aus zwei Bestandteilen: dem Signifikat (dem
8 Die diskursive Perspektivierung sozialer Phänomene bettet sich ein in die linguistische und kulturelle Wende
der Kultur- und Sozialwissenschaften seit den 1960er Jahren. In so verschiedenen Theorielagern wie der Kultur-
anthropologie (Geertz, Turner), den interpretativ-sozialphänomenologischen Sozialtheorien (Schütz, Ber-
ger/Luckmann), der postanalytischen Philosophie (Wittgenstein) und eben dem Strukturalismus und Poststruktu-
ralismus wurde das Gesellschaftliche zusehends als eine symbolische Ordnung begriffen, die die soziale Wirk-
lichkeit als bedeutungsvolle konstituiert und die in Form von Wissensordnungen das Handeln der Akteure er-
möglicht und einschränkt (vgl. Reckwitz 2000: 84, Moebius 2009a: 77-122). 9 Die Sprache als ein grammatikalisches System, das dem Einzelnen als objektives Faktum gegenübersteht,
nennt Saussure langue. Er grenzt sie von der Rede der einzelnen Sprecher ab, die er als parole bezeichnet.
9
Bezeichneten bzw. der Bedeutung) und dem Signifikant (dem Bezeichnenden). Das Signifikat
entspricht dem inhaltlichen Konzept eines Zeichens, während der Signifikant der Bedeutungs-
träger ist, der dieses Konzept in einer gegebenen Sprache zum Ausdruck bringt. Während also
das Signifikat „Pfeife“ die Vorstellung einer Pfeife ausdrückt, ist das deutsche Wort „Pfeife“
das Lautbild, das diese Bedeutung in der deutschen Sprache bezeichnet. Saussure denkt dabei
die Sprache als ein geschlossenes Netz von Zeichen, als ein Netz von Signifikaten und Signi-
fikanten, die sich „gegenseitig bedingen und in dem Geltung und Wert des einen nur aus dem
gleichzeitigen Vorhandensein des andern sich ergeben“ (Saussure 1967: 137).
Dies führt drittens zum grundlegenden strukturalistischen Axiom, dass die Bedeutung
der Sprachzeichen keine für sich stehende und positiv gegebene ist, sondern rein negativ ist:
Bedeutung erwächst nur aus den Relationen der Zeichen (vgl. Saussure 1967: 143f). Das ei-
gentlich bedeutungsstiftende Moment liegt im sprachlichen System, das Saussure als ein relati-
onales Ganzes begreift. Indem Saussure das Primat der Relationalität setzt und den Sprachzei-
chen jede apriorische Präsenz abspricht, ebnet er den Weg für eine formale Sprachbetrachtung,
die von der grundsätzlichen Arbitrarität der einzelnen Sprachelemente ausgeht. Dabei sind die
Sprachrelationen durch zwei grundsätzliche Regeln beherrscht: Substitution (paradigmatische
Beziehungen) und Kombination (syntagmatische Beziehungen) (vgl. ebd.: 136, 147f). Erstens
können Zeichen durch andere substituiert werden, etwa wenn das Wort „Mutter“ durch „Ma-
ma“ oder „Alte“ eingetauscht wird. Zweitens können Zeichen aber auch kombiniert werden.
So etwa, wenn das Wort „Mutter“ anderen Konzepten wie „Vater“, „Großmutter“, „Tochter“,
etc. gegenübergestellt wird und durch diese Abgrenzungen seinen Eigenwert erhält.
2) Brüchige Strukturen (Derrida)
Die Linguistik Saussures eröffnet das Feld, in dem sich das strukturale und poststrukturale
Denken entfaltet. Saussures Deutung der Sprache als sozialer Institution, die ein arbiträres Zei-
chensystem bildet und deren Einzelglieder in substitutiven oder kombinatorischen Relationen
stehen, sind allesamt einflussreiche strukturalistische Grundsätze und begründen maßgebliche
hegemonietheoretische Axiome. Bevor ich mich der Saussure-Rezeption von Laclau und Mouf-
fe zuwende, behandle ich die dekonstruktivistische Radikalisierung der saussureschen Sprach-
theorie durch Derrida. Die konstitutive Brüchigkeit, die nach Derrida jede Diskursstruktur
durchzieht, ist der systematische Ausgangspunkt von Laclaus und Mouffes Diskursverständnis.
Derridas Kritik an Saussure entzündet sich an dessen Unterscheidung zwischen Sprache
und Schrift, also dem gesprochenen Wort einerseits und dem geschriebenen Wort andererseits
10
(vgl. Saussure 1967: 28ff). Nach Saussure kommt der mündlichen Sprache das Primat vor der
Schriftsprache zu: Es bringt die Sprachzeichen ursprünglich zum Ausdruck, wohingegen sie
vom geschriebenen Wort bloß auf abgeleitete Weise repräsentiert bzw. abgebildet werden. Ich
möchte nur die Pointe von Derridas Argumentation in der Grammatologie (1990: 53-77) fest-
halten: Nach Derrida gibt es einen Widerspruch zwischen dem Vorhaben Saussures, eine all-
gemeine Zeichentheorie zu entwickeln und seiner Grenzziehung zwischen dem gesprochenen
und dem geschriebenen Wort – wobei er nur ersteres als legitimen Bestandteil der Sprache
konturiert und letzteres ausschließt. Nur das gesprochene Wort verdient es, durch die Sprach-
wissenschaft studiert zu werden. Das geschriebene Wort wird nicht einfach aus dem Bereich
der Sprache ausgeschieden, sondern bleibt als „bedrohliches“ Moment bestehen. Nach Saus-
sure übt die Schrift eine historisch gewachsene Autorität über die gesprochene Sprache aus,
die unrechtmäßig ist und sprachverunstaltend wirkt (vgl. Saussure 1967: 32-37).
Diese Abtrennung der Schrift- von der Wortsprache und die Setzung des Wortes als
vorrangig vor der Schrift ist aber, so Derrida, die notwendige Folge von Saussures Ansicht, dass
die Sprache ein geschlossenes und sich signifizierendes System sei. Dagegen zeigt aber Saus-
sures Dichotomisierung, dass ein geschlossener Sprachraum nur durch ein Außen (Schrift) ge-
bildet werden kann. Die Sprache lässt sich nur deshalb als geschlossenes Zeichensystem lesen,
weil eine Grenze zwischen einem legitimen inneren (gesprochenes Wort) und einem illegiti-
men äußeren Sprachbereich (geschriebenes Wort) gezogen wird. Kraft dieser Grenzziehung
wird ein stabiles Innen erzeugt. „Das Draußen ist das Drinnen“ (1990: 77), wie Derrida poin-
tiert, um die paradoxe Struktur der saussureschen Argumentation offenzulegen. Während Saus-
sure einerseits die Arbitrarität und radikale Relationalität der Sprachzeichen unterstreicht, hält
er andererseits an der quasi transzendentalen Gegenüberstellung zwischen Wort und Schrift
fest. Diese Unterscheidung leitet sich nach Derrida nicht immanent aus einer relationalen
Sprachauffassung ab, sondern gehorcht einem verborgenen metaphysischen Leitmotiv, dem
Logozentrismus. Saussures logozentrische Perspektive bestimmt den „Sinn des Seins als Prä-
senz“ und leistet so der Privilegierung des gesprochenen Wortes vor dem geschriebenen Wort
Vorschub, dessen „Ursprung und Status“ es ausklammert und suspendiert (Derrida 1990: 76).
Derridas Deutung von Saussure offenbart auf einer allgemeinen Ebene, wie dem Post-
strukturalismus nach diskursive Strukturen beschaffen sind: Die Letztschließung eines Dis-
kurses (hier: das geschlossene Sprachsystem) ist nur über die Einsetzung eines „transzendenta-
len“ Moments (hier: der Logozentrismus) möglich. Die Paradoxie dieser nicht mehr immanen-
ten Schließung liegt darin, dass sie nicht nur außerhalb des Diskurses operiert, sondern im
11
Diskursinnen wieder auftaucht (hier: die Unterscheidung gesprochenes vs. geschriebenes Wort).
Dadurch enthüllt sich die Idee eines transzendentalen Zentrums, das alle anderen Beziehungen
organisiert, als erkenntnistheoretische Chimäre. Nach Derrida gibt es kein „zentrales, originäres
oder transzendentales Signifikat“ (vgl. Derrida 1972: 424). Vielmehr sind alle scheinbar trans-
zendentalen Signifikate – seien sie als Logozentrismus, Vernunft oder Subjekt bestimmt – stets
zugleich innerhalb und außerhalb des Systems von Differenzen verortet (vgl. ebd.: 423).
Die dekonstruktivistische Lektüre der Saussureschen Sprachtheorie legt exemplarisch
dar, wie der Poststrukturalismus diskursive Strukturen liest: Er sieht sie als brüchige Strukturen,
die sich nicht mittels fester Fixpunkte stabilisieren lassen. Diese vermeintlichen Fixpunkte ver-
decken nur die Bewegung, die nach Derrida primär ist, nämlich das freie Spiel der Differenzen,
das jede stabile Präsenz (eines Einzelelements) in Frage stellt und durch das erst stabile Entitä-
ten hervorgebracht werden (vgl. Derrida 1972: 440, auch Derrida 1986: 70). Das Primat der
Differenz untergräbt grundsätzlich jedes organisierende Zentrum und raubt ihm damit seine
(scheinbar) transzendentale Grundlage. Das Spiel der Differenzen entleert das Zentrum, um es
dann immer wieder aufs Neue zu bestimmen und neu zu besetzen. Jede Neubesetzung des
Zentrums ist eine Bewegung der Supplementarität: Jedes eingesetzte Zeichen fügt sich dem
leeren Zentrum hinzu, es besetzt das Zentrum auf ganz spezifische Art und Weise (vgl. Derri-
da 1972: 437). Das Spiel der Differenzen stellt die Idee eines transzendenten Zentrums in
Frage und deutet es deontologisch um: Sowohl das Zentrum selbst als auch die Bewegung
seiner Besetzung enthüllen sich nun als Effekte des primären Spiels der Differenzen.
Derrida radikalisiert die Linguistik Saussures, indem er die Vorrangstellung der Differenz
bis zum Äußersten treibt. Anders als bei Saussure wird aber bei Derrida die primäre Differenz
nicht mehr durch eine geschlossene Struktur stabilisiert, sondern bewegt sich in einer brüchigen
und dezentrierten Struktur. Sie ist ein unaufhörliches Geschehen der Differenz oder, mit Derri-
da, einem Spiel der Differenzen. Dieses Spiel bringt der Begriff der différance auf den Punkt
(vgl. Derrida 1986: 67, auch Moebius 2009b: 426). Die différance als Spiel der Differenzen
schafft Bedeutung, indem sie ein Netz von Oppositionen unaufhörlich unterscheidet und aufei-
nander bezieht. Die différance avanciert dadurch zu einer generativen Bewegung, die jedes
Bedeutungssystem als „Gewebe von Differenzen konstituiert“ (Derrida 1999: 41).
Die dekonstruktivistische Bewegung zeigt, dass jede Differenzbeziehung eine kontin-
gente Beziehung ist, die stets auch anders ausfallen kann. Das ständige Knüpfen und Auflösen
von Relationen macht jede Struktur zu einer dezentrierten Struktur, die sich nur vorüberge-
hend stabilisiert – und immer wieder durch die Bewegung der différance zerbirst.
12
II. Die Konzepte und Grundaxiome der Hegemonietheorie
1) Grundbegriffe: vom Diskurs zum Antagonismus
Der vorhergehende Schritt hat durch die Lektüre von Saussure und Derrida gezeigt, was den
poststrukturalistischen Blick auf das Soziale auszeichnet. Erstens werden soziale Verhältnisse
nach einem linguistischen Muster begriffen. Das Soziale erscheint als Bedeutungsfeld, das
durch Arrangements von Zeichen, bestehend aus Signifikaten (Bedeutungen) und Signifikanten
(Bedeutungsträgern), strukturiert wird. Zweitens ist das Soziale als Bedeutungsfeld relational
verfasst: Identität konstituiert sich erst in ihrer Relation – von Kombinations- und Substituti-
onsbeziehungen – zu anderen Identitäten. Drittens legte Derridas Begriff der différance dar,
dass relationale Strukturen immer offene und brüchige Strukturen sind, die sich nur durch von
außen kommende Schließungsakte prekär stabilisieren lassen.
Im Folgenden werde ich Schritt für Schritt die Grundbegriffe der Hegemonietheorie
einführen: Zunächst stelle ich ihren breiten Diskursbegriff vor. Dann erarbeite ich die Konzepte
der Artikulation, der Logiken von Differenz und Äquivalenz sowie des Antagonismus.
a) Diskurs
Der Diskursbegriff von Laclau und Mouffe schließt unmittelbar an die oben ausgeführten Kon-
zepte Saussures und deren poststrukturale Radikalisierung durch Derrida an. Der erkenntnisthe-
oretische Ausgangspunkt Laclaus und Mouffes ist, dass alle sozialen Verhältnisse als diskursive
Verhältnisse zu lesen sind. In dem Augenblick, in dem Entitäten zu Momenten in relationalen
Konfigurationen werden, sind sie diskursive Objekte. Insofern ist schon das Verständnis des
Objektes „Stein“ als „Stein“, d.h. als natürliches und lebloses Naturobjekt, in diskursive Prozesse
eingebettet, die es verbieten, die schlichte Faktizität natürlicher Dinge einfach vorauszusetzen.10
Laclau und Mouffe (2001: 108) bedienen sich Wittgensteins Beispiel des Mauerbaus in
den Philosophischen Untersuchungen, um ihr weites Diskursverständnis zu verdeutlichen.
„A führt einen führt einen Bau auf aus Bausteinen; es sind Würfel, Säulen, Platten und Balken
vorhanden. B hat ihm die Bausteine zuzureichen, und zwar der Reihe nach, wie A sie braucht. Zu
dem Zweck bedienen sie sich einer Sprache, bestehend aus den Wörtern: „Würfel“, „Säule“, „Plat-
te“, „Balken“. A ruft sie aus; – B bringt den Stein, den er gelernt hat, auf diesen Ruf zu bringen“
(Wittgenstein 1984: 238)
10
Laclau und Mouffe (vgl. 1990: 104) erkennen zwar die Gegebenheit einer außerdiskursiv-natürlichen Sphäre
an, sprechen ihr aber jeden ontologischen Status ab: In ihr haben Objekte kein Sein, sondern nur eine stumme
„Existenz“. Entscheidend ist, dass Objekte erst dann „Seins-Status“ besitzen, wenn sie Bedeutung erhalten.
13
Das Beispiel verdeutlicht drei zentrale Facetten des hegemonietheoretischen Diskursbegriffes:
Erstens lesen Laclau und Mouffe diskursive Strukturen (hier: den Mauerbau) als komplexe
Strukturen, in denen sowohl manifeste Sprechakte (A ruft nach Würfeln, Säulen, etc.) als auch
nichtsprachliche Praxen (B bringt diese Gegenstände, ohne dazu etwas zu sagen) enthalten sind.
Diskurse bestehen gleichzeitig aus linguistischen Gehalten und Praktiken. Die Dimensionen
von Semantik (Bedeutung) und Pragmatik (Gebrauch) sind insofern miteinander verschach-
telt, als Bedeutung stets in bestimmte Praxiskontexte eingebettet ist und durch diese mither-
vorgebracht wird: „every identity or discursive object is constituted in the context of an action“
(Laclau/Mouffe 1990: 102). Im gleichen Zuge betonen aber Laclau und Mouffe, und das führt
zum zweiten Punkt, dass Praxiskontexte stets in umfassende Bedeutungskonfigurationen ein-
geflochten sind. Beim Mauerbau sind nichtsprachliche Praktiken und materielle Objekte
(Würfel, Säulen, etc.) verwoben mit einer übergreifenden symbolischen Zeichenordnung (die
Sprache, die aus den Wörtern „Würfel“, „Säule“, etc. besteht). Die Ebenen von Materie und
Zeichen werden durch umfassende Diskurstotalitäten verbunden, die als holistische Bedeu-
tungszusammenhänge zu lesen sind (vgl. ebd.: 100). Wie noch deutlich werden wird, betonen
Laclau und Mouffe diese makrologische Dimension gerade wegen ihrer politiktheoretischen
Wendung des Diskursbegriffes: Für sie entsteht eine Gesellschaftsformation erst durch „tota-
lisierende“ Diskurse (vgl. Laclau 1990: 91), die durch politische Artikulationen ihre partikula-
ren Bedeutungsgehalte in universale Bedeutungshorizonte transformieren (S. 22f).
Drittens ist für Laclaus und Mouffes Diskursverständnis zentral, dass sie – in klassisch
poststrukturalistischer Manier – betonen, dass sich Diskurse als umfassende Bedeutungskon-
figurationen durch eine radikale Relationalität auszeichnen (vgl. Laclau/Mouffe 1990: 111).
Die Bedeutung der Diskursmomente geht erst aus ihrer Beziehung zu anderen hervor. Und
diese relationale Konstitution gilt nach Laclau und Mouffe für Sprachzeichen genauso wie für
nichtsprachliche Praktiken und materielle Objekte.11
Wenn etwa im Kontext einer Demonstra-
tion Pflastersteine aus dem Boden gerissen und auf die Polizei geschleudert werden, dann
werden diese Steine zu ganz anderen diskursiven Momenten als wenn sie einfach den Grund
und Boden ausmachen, auf dem die Passanten spazieren. Die Steine stehen nicht mehr im Kon-
text des „Spazierengehens“, sondern in dem des „Demonstrierens“ und werden so zu anderen
Momenten (schleudernde Aktivisten, Motive der Demonstration, kaputte Fenster) in Bezie-
hung gesetzt. Diskursstrukturen gehen aus jeder sprachlichen und nicht-sprachlichen Form
des In-Beziehung-Setzens von Elementen hervor (vgl. Nonhoff 2004: 76f).
11
Laclau und Mouffe pointieren ihre These von der relationalen Konstitution sowohl linguistischer als auch
nichtlinguistischer Momente mit dem Plädoyer für ein „radical relationism“ (Laclau/Mouffe 1990: 110).
14
b) Artikulation
Die Vorrangstellung einer radikalen Relationalität und die konstitutive Offenheit und Brüchig-
keit diskursiver Strukturen sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Diskursmomente stets
auch zueinander in Beziehung gesetzt werden und sich auf diese Weise zu größeren Einheiten
aggregieren, denen durchaus Stabilität zukommt. Diese Relationierung von Momenten fassen
Laclau und Mouffe mit dem Konzept der Artikulation. Der Artikulationsbegriff ist dabei nicht
ein weiteres Glied im „Begriffsarsenal“ der Hegemonietheorie, sondern gehört zusammen mit
den Begriffen Antagonismus und Hegemonie zu ihrer konzeptuellen Schlüsseltrias. Der Arti-
kulationsbegriff erklärt, wie durch kontingente Diskursverkopplungen gefestigte Diskurse
oder, präziser, Diskursformationen entstehen. Wie ich unten ausführe (S. 19f), sind diese ver-
meintlichen Subjekte von Artikulationen tatsächlich deren Produkt.
Den Begriff der Artikulation kann man in einer ersten Annäherung als In-Beziehung-
Setzung von Momenten definieren, die sich dadurch definiert, dass sie erstens kontingent ist
und zweitens die Identität der artikulierten Momente verändert (vgl. Laclau/Mouffe 2001:
105). Wie Hall festhält (vgl. 2000: 65), koppeln Artikulationen Momente miteinander, die a
priori in keiner notwendigen Verbindung standen. Ihre Verknüpfung ist immer kontingenter
Natur. Die Artikulation kann unter gewissen Umständen eine Einheit schaffen, muss dies aber
nicht zwangsläufig oder unumstößlich: „Es ist eine Verbindung, die nicht für alle Zeiten not-
wendig, determiniert oder wesentlich ist“ (ebd.).
Zudem wirkt die Artikulation identitätsverändernd. Hier muss man sich die Trennung
zwischen Signifikant (Bedeutungsträger) und Signifikat (Bedeutung) ins Gedächtnis rufen,
die Saussure als die beiden Dimensionen des Sprachzeichens konturierte (S. 8). Nach Laclau
und Mouffe wird im Zuge der derridaschen Dekonstruktion zusammen mit der Geschlossen-
heit diskursiver Strukturen auch die starre Gegenüberstellung von Signifikanten und Signifi-
katen überfällig (vgl. Laclau 1993: 432f). Das poststrukturale Axiom ist, dass die Bedeutung
(das Signifikat) nicht a priori feststeht, sondern vielmehr selbst ein Konstruktionseffekt dis-
kursiver Relationierungen ist.12
Die Bedeutung jedes Objekts – sei es als Naturphänomen,
personale Identität oder umfassende Kollektivität bestimmt – erwächst nicht aus einer fixier-
ten und ontologisch „tiefer“ liegenden Substanz, sondern geht erst aus diskursiven Artikulati-
onsbewegungen hervor. Pointiert formuliert: Artikulationen erzeugen Bedeutung, indem sie
Momente aufeinander beziehen und dann diese Beziehungen fixieren.
12
In diesem Sinne ist die oben vorgestellte These der radikalen Relationalität erkenntnistheoretischer Natur: Sie
erhebt das Diskursive zum primären Konstitutionsterrain jeder Objektivität (vgl. Laclau 2005: 68).
15
c) Differenz-und Äquivalenzlogik
Artikulationen als Praktiken der Beziehung und Fixierung folgen nach Laclau und Mouffe zwei
grundlegenden und weitgehend formalisierten Logiken, die sie als Logiken der Differenz und
der Äquivalenz beschreiben. Diese Logiken entnehmen die Autoren den Axiomen der saus-
sureschen Sprachtheorie, dass in der Sprache einzig zwei grundsätzliche Operationen möglich
sind, Kombination (syntagmatische Beziehungen) und Substitution (paradigmatische Bezie-
hungen). Laclau und Mouffe orientieren sich nicht nur an dieser Unterscheidung, sondern
„übersetzen“ sie in die diskursiven Logiken von Differenz und Äquivalenz (vgl. Laclau/Mouffe
2001: 130, auch Laclau 2000b: 194). Die beiden Logiken werden dadurch zu den ontologisch
verankerten Bedingungen jedes Artikulationsvorganges (vgl. Laclau 1996: 42f).
Die Logik der Differenz (zugeordnet zu Kombination) erweitert das Feld der Relationen
innerhalb eines Diskurses und insistiert in den Unterschieden zwischen den Diskursmomenten
– womit sie die für sich stehende Identität der einzelnen Diskursmomente unterstreicht. Die
Logik der Äquivalenz (zugeordnet zu Substitution) negiert dagegen die Unterschiede zwischen
den Diskursmomenten, indem sie ihren spezifischen Charakter auslöscht und sie als füreinan-
der austauschbar konturiert. Für Laclau und Mouffe sind Differenz und Äquivalenz die beiden
grundlegenden Logiken diskursiver Beziehungen (vgl. Laclau 2005: 80). Jedoch ist es nicht
möglich, dass eine dieser Logiken absolut vorherrscht. Diskursive Strukturen bestehen sowohl
aus Unterscheidungen (Differenzlogik) als auch aus Gemeinsamkeiten (Äquivalenzlogik). Es
gibt immer nur eine graduelle Vorherrschaft der einen über die andere Logik.
Um zu verdeutlichen, wie in Diskursen die Logiken der Äquivalenz und Differenz zum
Einsatz gebracht werden, bediene ich mich Oliver Marcharts (2008: 185f) heuristischem Bei-
spiel eines kolonisierten Landes. In ihm bilden die Kolonisierten und die Kolonialherren zwei
quasi getrennte Welten und besitzen scharf differenzierte Identitäten. Die Kolonisierten
zeichnen sich durch eine Reihe von Eigenheiten aus, etwa spezifische Kleidungsweisen, eine
eigene Sprache, gewisse Umgangsformen und eine bestimmte Religionszugehörigkeit. Durch
die Kolonialisierung und bedingt durch das feindliche Verhältnis gegenüber den Kolonialher-
ren versucht nun ein Teil der Kolonisierten, die zuvor unverbundenen Momente äquivalent zu
setzen – und so eine übergreifende Identität der „Kolonisierten“ zu konstruieren. Diese Äqui-
valentsetzung versucht, die Gemeinsamkeiten zwischen einer spezifischen Kleidungsweise,
der eigenen Sprache, Umgangsformen und Religionszugehörigkeit hervorzuheben. Der derart
durch Äquivalentsetzungen gestiftete Diskurs lässt sich graphisch wie folgt illustrieren:
16
Das Beispiel soll deutlich machen, dass die Logiken von Äquivalenz und Differenz nicht bloß
formale Mechanismen sind, um Diskurse zu artikulieren, sondern dass sie desgleichen eine
politische Aufladung besitzen. Die Logik der Äquivalenz dehnt nämlich gewissermaßen Dis-
kurse aus, indem sie dafür sorgt, dass immer mehr Momente in einen Diskurs eingegliedert
und einander gleichwertig gesetzt werden. Die Differenzen zwischen den Diskursmomenten
werden damit tendenziell unterlaufen: „The differences cancel one other out insofar as they
are used to express something identical underlying them all” (Laclau/Mouffe 2001: 127). In
den Termini unseres Beispiels gesprochen, erlaubt die Äquivalentsetzung der Momente des
Kolonisiertendiskurses, das politische Subjekt „Kolonisierte“ zu kreieren, das sich den Kolo-
nialherren entgegensetzt. Andererseits enthält aber auch die Logik der Differenz eine politi-
sche oder, besser gesagt, eine entpolitisierende Komponente. Um dem wachsenden Diskurs der
Kolonisierten entgegenzutreten, könnten die Kolonialherren versuchen, die Differenzen der
Momente des Kolonisiertendiskurses zutage zu fördern und ihn damit zu desartikulieren. Die
jeweils differentiellen Momente von Kleidung, Umgangsformen, Religion, etc. können sich, so
der Diskurs der Kolonialherren, problemlos in den geltenden Ist-Zustand einfügen.
Während einerseits die Logik der Äquivalenz politisierende und „diskursvergrößernde“
Effekte zeitigt, wirkt andererseits die Logik der Differenz entpolitisierend und „diskurszerset-
zend“. Auf diese politische Aufladung von Äquivalenz (Politisierung) und Differenz (Entpoli-
tisierung) werde ich später noch ausführlicher zurückkommen (S. 63f). An dieser Stelle sei
nochmals unterstrichen, dass es in Diskursstrukturen nur eine graduelle Vorherrschaft der
einen über die andere Logik gibt. Ein Diskurs, der eher über die Logik der Differenz operiert
(hier: die Kolonialherren), wird zuweilen auch Äquivalentsetzungen schaffen – etwa um sei-
nerseits die Identität der Kolonialherren zu konstruieren. Und ein Diskurs, in dem die Logik
der Äquivalenz vorherrscht, wird immer auch von Differenzen durchsetzt sein: Wären die
Momente des Kolonisiertendiskurses vollends gleichwertig, dann würden sie zusammenfallen
und keine voneinander abgrenzbare Identität mehr beinhalten.13
13
Wie ich noch zeigen werde, sind Äquivalentsetzungen nicht ohne die Einrichtung übergeordnete diskursiver
Knotenpunkte und die Konstruktion außerdiskursiver Bezugspunkte möglich. Diese außerdiskursive Rolle
machte im Beispiel die Figur der Kolonialherren deutlich. Sie erfüllen idealtypisch die Rolle eines Antagonisten
(s.u.), der ex negativo die Schließung und Stabilisierung des Kolonisiertendiskurses ermöglicht.
Umgangs-
formen Religion Kleidung
Äquivalenzen
Rituale „Kolonialherren“
„Kolonisierte“
17
d) Antagonismus
Der Antagonismus ist das Schlüsselmoment des „rein negativen“ Außen, das über Negationen
Äquivalentsetzungen im Diskursinnen stabilisiert (vgl. Mouffe 2013: 26). Der Antagonismus
ist eine äußerliche Instanz, die die positive Identität der internen Diskursdifferenzen zugleich
stabilisiert und blockiert. Der Antagonismus lädt Derridas Figur des konstitutiven Außen
(vgl. 1999: 55) politisch auf und steht jeder Diskursstruktur als „radikal Anderes“ gegenüber
(vgl. Marchart 2010: 190). In der Hegemonietheorie hat das Antagonismuskonzept eine zwei-
fache Schlüsselposition inne. Erstens führt die außerdiskursive Instanz des Antagonismus die
Äquivalentsetzung von Diskursmomenten zu Ende. Antagonismen schließen und stabilisieren
Diskurse, indem sie sie von einem negativen Diskursaußen abgrenzen. Zweitens steht der An-
tagonismus für die Unmöglichkeit definitiver Diskursstabilisierungen: Das antagonistische
Außen taucht im Diskursinnen als Blockade der etablierten Bedeutungsmomente wieder auf
(vgl. Reckwitz 2006b: 345) und verunmöglicht endgültige Diskursfixierungen. Der Antago-
nismus entfaltet also sowohl diskursstabilisierende als auch diskursdestabilisierende Effekte.
Erstens wirken Antagonismen stabilisierend, indem sie Diskursen ex negativo erlauben,
eine Einheit zu bilden. Wie anhand des Beispiels der Kolonisierten angerissen, ist der Antago-
nismus die Möglichkeitsbedingung für Äquivalentsetzungen im Diskurs. Man muss sich diese
Bewegung so vorstellen, dass eine Reihe von Momenten (a, b, c) nur deshalb gleichgesetzt wer-
den kann (a = b = c), weil sie alle einer äußeren Instanz entgegengestellt werden (d ≠ (a, b, c))
(vgl. Howarth 2000: 106f). Dadurch wird der Antagonismus zum hegemonietheoretischen
„Supplement“ einer poststrukturalen Bedeutungstheorie. Erst der Antagonismus ermöglicht
die (zeitweilige) Schließung und Stabilisierung inhärent instabiler Bedeutungsstrukturen. In
den Begriffen des Beispiels gesprochen, ist es erst der Feindstatus der Kolonialherren, der den
Kolonisiertendiskurs als eine in sich zusammenhängende Einheit hervorbringt. Für Laclau
und Mouffe beinhalten Artikulationen immer auch antagonistische Grenzziehungen gegen-
über einem bedrohlichen und inakzeptablen Anderen (hier: die Figur der Kolonialherren).
Wie Laclau festhält: „The characteristic structure [of an objective identity], its ‘essence’ de-
pends entirely on that which it denies” (Laclau 1990: 32).
Die Grenzziehungen zwischen einem stabilisierten Diskursinnen und einem bedrohli-
chen Diskursaußen dürfen indes nicht als absolute und unwiderrufliche Gegenüberstellungen
zwischen einem präexistenten Diskursinnen und einem gefährdenden Diskursaußen missver-
standen werden (vgl. Stäheli 2000: 37). Es ist stattdessen eine der Pointen des Antagonismus-
18
begriffes, dass er Konflikte gerade nicht als ein starres Aufeinanderprallen von präexistenten
sozialen Akteuren begreift, sondern als Ineinandergreifen des Diskursinnen und des Diskurs-
außen. Antagonismen sind identitätskonstituierend, sie machen Identitäten in ihrer Selbstdefi-
nition von einem „diskriminierten Außen“ notwendigerweise abhängig: „Der Zusammen-
bruch der kulturellen Definition des ‚Anderen‘ würde den Zusammenbruch des ‚Eigenen‘
bedeuten“ (Reckwitz 2004: 44, vgl. auch Laclau 1990: 17).
Wenn aber, zweitens, konflikthafte Spaltungsbewegungen für Identitäten konstitutiv sind
(vgl. Laclau 1996: 28f), dann wohnt dem Antagonismus auch eine bedeutungsdestabilisierende
Dimension inne. Der Antagonismus tritt im Diskursinnen wieder auf und erscheint dort als
Moment der „Negativität“ (Marchart 2010: 193f), als Unterbrechung des diskursiven Differenz-
systems. Der Antagonismus steht damit für die „passage through negativity“ (Laclau 1990:
213), die Diskurse notwendig durchlaufen müssen, wenn sie eine stabilisierte Struktur anneh-
men. Der Antagonismus stellt gewissermaßen die Präsenz des Feindes auf Dauer und verun-
möglicht, dass Bedeutungshorizonte als einzig mögliche und unumstrittene Ordnungen Gestalt
annehmen: „Antagonism is the limit of all objectivity“ (ebd.: 17). Jeder Diskurs verweist auf
das, was er negiert. Wenn im Falle einer rechtspopulistischen Formation der „parasitäre Aus-
länder“ als Antagonist konturiert wird, so stabilisiert dies einerseits den Diskurs, etwa indem
sich die rechtspopulistische Formation als wirksames Gegenmittel gegen das Ausländerprob-
lem in Szene setzt. Andererseits erinnert die Figur des Ausländers aber auch daran, dass die
angestrebte imaginäre Fülle (etwa die kulturell homogene Nation) dauerhaft blockiert ist und
in unerreichbare Ferne entrückt (vgl. Howarth 2000: 105). Wie Žižek (1990: 249) pointiert,
setzen Antagonismen diskursinterne Dislozierungen in Gang „which cannot be symbolized”.
Der Antagonismus als diskursinterne „Blockade“ verunmöglicht, dass das Diskursinnen
eine stabilisierte Struktur (vgl. Laclau/Mouffe 2006: 27) oder, mit Derrida, eine volle Präsenz
annimmt. Während der Antagonismus einerseits die Brüchigkeit des Diskurses bewältigt, ver-
unmöglicht er anderseits, dass sich der Diskurs zufriedenstellend selbst bezeichnen kann. Der
Antagonismus kann die Einheit der differentiellen Diskursmomente immer nur negativ stiften,
nämlich indem er sie blockiert und sie an das rückkoppelt, was sie eigentlich ausschließen. So
ist das „Sein“ und die „Systematizität“ des Diskurses letztlich unerreichbar (vgl. Laclau 1996:
39f). Immer wieder tritt seine Brüchigkeit zutage und macht neue politische Artikulationen
und antagonistische „Diskursvernähungen“ notwendig. Mit Laclau und Mouffe gesprochen:
Die strukturelle Unentscheidbarkeit des Diskurses muss stets wieder durch neue politische
Entscheidungsakte überwunden werden (vgl. Laclau 1999: 137).
19
2) Diskurstheorie als Gesellschaftstheorie
a) Diskursformation
Die Erläuterungen zu den Grundbegriffen von Laclau und Mouffe lassen sich auf drei Punkte
verdichten: Erstens strukturieren Artikulationen Diskurse. Zweitens operieren Artikulationen
über die grundlegenden Logiken von Differenz und Äquivalenz. Führt die Logik der Diffe-
renz einerseits entpolitisierende Unterscheidungen zwischen den diskursiven Momenten ein,
so hebt die Logik der Äquivalenz andererseits ihre politisierenden Gemeinsamkeiten hervor.
Die Äquivalenz der Diskursmomente bedarf aber, drittens, antagonistischer Grenzziehungen.
Indem sich ein Diskurs gegenüber einem antagonistisch aufgeladenen Außen abgrenzt, geschieht
ex negativo die diskursive Einheitsstiftung – die stets auch eine Destabilisierung ist.
Die bisherigen Ausführungen haben bewusst die Frage umgangen, welche Instanz Arti-
kulationen und antagonistische Grenzziehungen ausführt. Denn die Debatte darüber, wer die
konfliktgeladene Artikulation von Bedeutung antreibt, wäre für Laclau und Mouffe dann falsch
gestellt, wenn diese Instanzen als Kollektivsubjekte erschienen, die Artikulationsakten auf äu-
ßerliche und gleichsam souveräne Weise gegenüberstünden. Für die Hegemonietheorie geht es
dagegen zunächst einmal darum zu bestimmen, wie Artikulationen ihre vermeintlich artikulie-
renden Subjekte hervorbringen: „One cannot ask who the agent of hegemony is, but how so-
meone becomes the subject through hegemonic articulation instead” (Laclau 1990: 210f).
Die Hegemonietheorie lässt sich insofern als „Theorie der Artikulation“ (Hildebrand
2010: 24) bezeichnen. Denn nach Laclau und Mouffe bringen erst Artikulationsbewegungen
und die mit ihnen einhergehenden antagonistischen Ausschlussakte feste Bedeutungsordnun-
gen hervor. Wie Hildebrand betont, ist „die Praxis der Artikulation der Diskursstruktur lo-
gisch vorgeschaltet“ (ebd.). Diskurse entstehen durch Artikulationen und Antagonismenbil-
dungen. Erst durch Artikulationen werden Diskurse zu beständigen und signifizierbaren
Strukturen. Diskurse sind gewissermaßen das „Produkt“ von Artikulationen (vgl. Akerstrom
2003: 50). Als gefestigte Artikulationsprodukte werden Diskurse zu soliden Formationen.
Das Konzept der Diskursformation präzisiert die bisherige Rede von Diskursen bzw.
Diskursstrukturen. Laclau und Mouffe (2001: 105f) bedienen sich hierbei – auf selektive Art
und Weise14
– des Begriffs der Diskursformation, wie ihn Foucault in der Archäologie des
Wissens einführt. Foucault definiert Diskursformationen als Menge von Aussagen, die einem
gemeinsamen Formationssystem angehören (vgl. Foucault 1973: 106f). Dieses Formations-
system bildet ein „System der Streuungen“ (ebd.: 58), in dem sich bestimmte Formationsre-
14
Zur Abgrenzung der Hegemonietheorie gegenüber dem frühen archäologischen Foucault vgl. Laclau 1993: 433f.
20
geln und Aussagepraktiken wechselseitig durchdringen. Zum einen werden die Praktiken
durch Regeln strukturiert und erhalten durch sie eine bestimmte Regelmäßigkeit. Zum ande-
ren sind die Regeln in keiner „höheren“ ideellen Struktur (etwa dem Bewusstsein) verankert
(vgl. Foucault 1973: 69), sondern werden durch Praktiken aktualisiert und damit verschoben
und transformiert. Diskursformationen sind sowohl strukturell als auch ereignishaft, sie sind
formierte und sich ständig formierende Gebilde (vgl. Nonhoff 2006: 35).
Es ist dieses Verständnis von Diskursformationen als strukturell-ereignishaften Gebil-
den, das Laclau und Mouffe übernehmen, um die partielle Äußerlichkeit von Diskursformati-
onen gegenüber Artikulationsprozessen zu fassen. Durch Artikulationsbewegungen entsteht
eine strukturierte Diskursformation. Ihr gelingt es, sich als Formation zu bezeichnen und zu
einem Kollektivakteur zu konstituieren: Sie artikuliert Diskursmomente im Sinne spezifischer
Strategien (vgl. Laclau/Mouffe 2001: 135, auch 144). Man denke an das Beispiel der Koloni-
sierten, die versuchten, sich von den Kolonialherren abzugrenzen und sich gegen sie durchzu-
setzen. Artikulationen fungieren in diesem Sinne stets als politische Praktiken: Sie bringen
Formationen hervor, die sich gegen andere behaupten müssen. Durch ständige Re- und Dearti-
kulationsprozesse von Bedeutung verwandeln Formationen schrittweise ihre partikularen Be-
deutungsgehalte zu universalen Bedeutungshorizonten.
b) Hegemonie
Um die gesellschaftstheoretische Dimension der Hegemonietheorie vollends zu dechiffrieren,
muss das Konzept der Diskursformation um den Begriff ergänzt werden, der neben dem Anta-
gonismuskonzept für Laclau und Mouffe im Zentrum steht, dem der Hegemonie. Die Autoren
lancieren dafür eine diskurstheoretische Überarbeitung von Gramscis Hegemonieverständnis.15
Gegen gängige Auffassungen von Macht und Herrschaft als inhärent gewaltförmigen Phäno-
menen,16
meint Hegemonie bei Gramsci eine Herrschaftsform, die nicht primär über Gewalt
ausgeübt wird, sondern über die Organisation von Konsens. Hegemonie ist eine Herrschaft
15
Ich stelle hier Laclaus und Mouffes Gramsci-Lektüre im Sinne eines immanenten Rückgriffes vor. An sie, dies
nur als Vorbemerkung, schließt meine eigene Deutung Gramscis und vertieft sie – wobei ich zu Teilen auch eine
erweiterte Lesart der gramscianischen Kategorien unternehme (S. 44-54). 16
Gramscis Hegemoniekonzeption unterläuft die klassische Unterscheidung zwischen „power to“ und „power
over“ (vgl. Imbusch 1998: 10-15). Erstens („power to“) wird Macht als ein Vermögen betrachtet, handelnd etwas
zu bewirken. Macht ist in dieser Traditionslinie (z.B. Arendt, Parsons, Giddens) positiv und symmetrisch: Macht
ist die Möglichkeit, individuell oder kollektiv gesetzte Ziele zu erreichen. Zweitens („pover over“) meint Macht-
ausübung die gewaltförmige Stabilisierung asymmetrischer Verhältnisse: Macht wird über andere ausgeübt. Aus
dieser Sicht (z.B. Hobbes, Weber, Marx) erhält Macht ein negatives Gepräge, das von Zwang und Gewalt bestimmt
wird. Das gramscianische Hegemonieverständnis macht sich dagegen für eine Verschränkung beider Machtdimen-
sionen stark: Asymmetrische Machtverhältnisse werden von konsensualen Momenten durchzogen, während auch
scheinbar symmetrische soziale Verhältnisse durch Macht- und Herrschaftsformen geprägt sind.
21
oder, so Gramsci, eine Führung, die über das Einverständnis aller Eingebundenen operiert,
auch der Beherrschten bzw. Geführten. In hegemonialen Verhältnissen entsteht ein „instabiles
Gleichgewicht“ zwischen Herrschenden und Beherrschten, in dem die Interessen der jeweiligen
Gruppen gegenseitig aufeinander einwirken (vgl. Gramsci 2012: 1561, Hall 2002b: 294f). He-
gemonie aggregiert die sozialen Gruppen zu einer neuen, sie umschließenden Einheit und ver-
schiebt so ihre Identität grundsätzlich. Die gesellschaftlichen Einheiten, die durch hegemoniale
Prozesse entstehen, beschreibt Gramsci als historische Blöcke. Ähnlich zu Lenins Konzept des
Klassenbündnisses sind in historischen Blöcken unterschiedliche Klassen eingebunden. Aller-
dings handelt es sich bei Gramsci (anders als bei Lenin) nicht um ein Nullsummenspiel, in dem
die Klasseninteressen schlicht „addiert“ werden (etwa revolutionäres Klassenbündnis = Indust-
rieproletariat + Bauernschaft + Parteikader). Vielmehr sind in historischen Blöcken die unter-
schiedlichen Klassen zu einer „organischen Einheit“ verbunden (Gramsci 2012: 490), die ihre
Interessen und ihre Identität verändert. Historische Blöcke kreieren übergreifende Kollektiv-
willen, die die Einzelwillen der Klassen auflösen und sie in einen übergreifenden Aggregati-
onszustand überführen. Um ein Beispiel zu nennen, das Gramsci besonders präsent ist, entsteht
aus dem Zusammenschluss der katholischen Kirche, des süditalienischen Landadels und der
norditalienischen Industriebourgeoisie ein konservativ-katholischer Kollektivwille, in den auch
das Proletariat der norditalienischen Städte und die Bauernschaft Süditaliens eingebunden ist.
Laclau und Mouffe machen sich Gramscis Hegemonieverständnis in einem konzeptuel-
len Zweischritt für ihren poststrukturalistischen Ansatz zunutze. Erstens verstehen sie histori-
sche Blöcke als hegemoniale Projekte, die diskursive Kämpfe um Deutungshoheit und Gestal-
tungsmacht ausfechten. Zweitens lesen die Autoren den Prozess der Hegemonialwerdung einer
Diskursformation als Einrichtung leerer Signifikaten, denen es gelingt, partikulare Bedeutungs-
gehalte in universale und stabilisierte Signifikationssysteme zu verwandeln.
Der erste Schritt bei der diskurstheoretischen Überarbeitung von Gramscis Hegemonie-
begriff ist die Lektüre von historischen Blöcken als hegemoniale Projekte. Bereits bei Gramsci
ist die Einheit historischer Blöcke nicht a priori gegeben, sondern ein kontingentes Produkt, das
durch artikulatorische Praktiken hergestellt wird (vgl. Laclau/Mouffe 1981: 20). Fasste aber
Gramsci diesen Prozess als komplexe und identitätsverändernde Aggregation objektiver Klas-
seninteressen, so beschreiben ihn Laclau und Mouffe als kontingente Artikulation verschiede-
ner Diskursmomente, die in einem relationalen Verhältnis stehen. So grenzen sich die Autoren
von den Restbeständen eines orthodox marxistischen Materialismus ab und tätigen ihre anties-
sentialistische Neubeschreibung historischer Blöcke. Um zu unterstreichen, dass Artikulati-
22
onsprozesse stets politisch und konflikthaft aufgeladen sind, definieren sie die foucaultschen
Diskursformationen als hegemoniale Projekte. Als solche stehen sich verschiedene Diskursfor-
mationen konflikthaft gegenüber und versuchen, sich gegen andere durchzusetzen: Hegemo-
niale Projekte „attempt to weave together different strands of discourse in an effort to dominate
or structure a field of meaning, thus fixing the identities of objects and practices in a particular
way” (Howarth 2000: 102).
Aber wie gelingt es hegemonialen Projekten, eine übergreifende Welt- und Lebensauf-
fassung im Sinne Gramcis herzustellen? Das führt zum zweiten Schritt der diskurstheoretischen
Überarbeitung des Hegemoniebegriffes. Laclau und Mouffe beschreiben die Hegemonialwer-
dung von Diskursformationen als Einrichtung leerer Signifikaten, die partikulare Bedeutungs-
gehalte in universale Signifikationssysteme verwandeln. Der von Laclau eingeführte (1996,
bereits 1988: 80f) – und besonders durch ihn gebrauchte – Begriff des leeren Signifikanten
buchstabiert die Universalisierungsfunktion der Diskursmomente aus. Das Konzept des leeren
Signifikanten beschreibt, wie Grenzziehungen verarbeitet und mit innerdiskursiven Repräsenta-
tionsfunktionen verbunden werden. Ein Diskursmoment verliert an eigenständiger Bedeutung
und wird als weitgehend entleerter Signifikant zur Repräsentationsinstanz der anderen Momente
in ihrer gemeinsamen Abgrenzung gegenüber dem antagonistischen Außen. So kann etwa der
Signifikant „Volk“ zum übergreifenden Symbol für die Kämpfe der populären Klassen gegen
die Eliten werden. „This emptying of a particular signifier of its particular, differential signified
is […] what makes possible the emergence of ‚empty‘ signifiers as the signifiers of a lack, of an
absent totality“ (Laclau 1996: 42). Leere Signifikanten nehmen eine Platzhalterrolle ein, die das
bezeichnet, was eigentlich nicht bezeichnet werden kann: die Identität des Diskurses (vgl.
Stäheli 2009: 201). Entleerte Signifikanten symbolisieren damit die abwesende, weil vom
Antagonismus verunmöglichte, Fülle des Diskurses.
Leere Signifikanten als Symbole einer abwesenden Totalität produzieren weite diskursi-
ve Horizonte, die darüber bestimmen, „was gedacht werden kann und was ausgeschlossen ist“
(Stäheli 2009: 262). Laclaus Beispiele für leere Signifikanten sind weit gestreut und umfassen
sowohl generelle Ordnungsprinzipien („Freiheit“, „Demokratie“, „Ordnung“) als auch kollektive
Identitäten („Volk“, „Proletariat“, „Nation“) (S. 77). Im bolschewistischen Diskurs ist etwa die
kollektive Identität des „Proletariats“ der leere Signifikant, der andere Forderungen (Land, Um-
verteilung) und Identitäten (Industriearbeiter, Bauern, Soldaten) in ihrer gemeinsamen Abgren-
zung gegenüber dem zaristischen Regime und der Aristokratie repräsentiert und zum Symbol
wird, das die Utopie einer sozialistischen Gesellschaft ausdrückt (vgl. Laclau 2000c: 302f).
23
Leere Signifikanten – mit Lacan: „master signifiers“ – bewegen sich fortwährend in der
Spannung zwischen Universalität und Partikularität. Zum einen müssen sich leere Signifikan-
ten möglichst weitgehend entleeren, damit sie zur quasi universalen Einschreibungsfläche ei-
ner breiten Äquivalenzkette unterschiedlicher Bedeutungen werden können (vgl. Laclau 1988:
81). Zum anderen aber haften leeren Signifikanten stets die Spuren ihrer partikularen Bedeu-
tungsgehalte an. Der leere Signifikant „Proletariat“ etwa mag die Forderungen und Identitäten
der Arbeiter- und Unterklassen wirksam bündeln, die Anliegen der Bourgeoisie wird er dagegen
weniger gut repräsentieren. Die von leeren Signifikanten ausgeübte Universalisierungsfunktion
(„the general form of fullness“) ist zu unterscheiden von den partikularen Akteuren (hier: die
konkrete Arbeiterklasse), die diese Funktion in gewissen historischen Konjunkturen ausüben
(vgl. Laclau 2001: 5). So ist zwar die Errichtung einer hegemonialen Ordnung durch die Institu-
tion leerer Signifikanten ein notwendiger Vorgang. Aber die Frage, welche konkreten Instanzen
diese Rolle ausüben, lässt sich nicht a priori beantworten, sondern hängt von den ergebnisof-
fenen Dynamiken politischer Artikulationen ab.
c) Das Primat des Politischen
Die Ausführungen zur Aneignung des gramscianischen Hegemoniebegriffes durch Laclau und
Mouffe zeigten, dass die Funktion der Hegemonie umfassender Natur ist. Hegemoniale Inter-
ventionen sind „Verfahrensweisen, die in einem Kontext von Kontingenz Ordnung herzustel-
len versuchen“ (Mouffe 2010: 25). Wenn Laclau und Mouffe davon ausgehen, dass alle sozia-
len Verhältnisse diskursive Verhältnisse sind, so beinhaltet diese diskursive Verfasstheit für
sie immer einen politischen Ursprung. Dass sich Diskursformationen (bzw. hegemoniale Pro-
jekte) in das „Fleisch des Sozialen“ einschreiben und ihren Einfluss entfalten, geschieht erst
durch umkämpfte Hegemonialwerdungen. Laclau und Mouffe plädieren auf diese Weise für
eine Primatstellung des Politischen. Ihre zentrale sozialtheoretische These ist, dass alle sozia-
len Verhältnisse einen konstitutiven politischen Ursprung aufweisen: Soziale Verhältnisse
werden durch Artikulation hervorgebracht, durch Antagonismen stabilisiert (und destabili-
siert) und durch Hegemonien universalisiert. Artikulation, Antagonismus, Hegemonie – das
sind die drei konzeptuellen Eckpunkte der Dimension des Politischen, die nur analytisch ge-
trennt sind und de facto stets verwoben auftreten. Diese Begriffstrias verleiht der hegemonie-
theoretischen These von der Primatstellung des Politischen ihre Durchschlagskraft und ent-
hüllt das Politische als Instituierungslogik sozialer Verhältnisse (vgl. Laclau 1994: 4). Auf
24
einen Satz verdichtet, ist die eigentliche Schlüsselthese Laclaus und Mouffes: Das Politische ist
das ursprüngliche Gründungsmoment aller sozialen Verhältnisse.
Das Politische als gründende Dimension des Sozialen beruht auf zwei Bewegungen, die
aufeinander verweisen und stets zusammen auftreten: die hegemoniale Entscheidung und der
konstitutive Antagonismus. Hegemoniale Entscheidungen sind nicht ohne antagonistische
Grenzziehungen zu haben, Antagonismen bilden sich nicht ohne hegemoniale Entscheidungen.
Erstens sind politische Instituierungsakte immer auch dezisionistische Schließungsakte.
Auf einem ontologisch kontingenten Terrain geben Schließungen diskursiven Strukturen eine
Form, sie sind für sie konstitutiv (vgl. Laclau 1996: 90). Entscheidungen bringen soziale Ver-
hältnisse auf der alleinigen Grundlage von Macht- und Herrschaftsverhältnissen hervor. Jede
Form von Objektivität, sei sie als Identität, Institution oder Gesellschaft bestimmt, ist nach
Laclau und Mouffe ein Produkt diskursiver Schließungen. Diese Schließungen werden ihrer-
seits von der Logik der Hegemonie angetrieben, dem Willen zur Durchsetzung und Universali-
sierung gewisser Positionen vor anderen: Jede Form von gesellschaftlicher Ordnung hat hege-
monialen Charakter. Der Antagonismus als zweite Facette des Politischen zeigt, dass Entschei-
dungen niemals vollkommen das verbannen können, was sie eigentlich (gewaltsam) aus dem
Diskurs ausschließen. Verbannte antagonistische Alternativen durchziehen jede instituierte Ob-
jektivität, sie sind „Spuren der Akte der Ausschließung“ (Laclau/Mouffe 2006: 26). So etwa die
diskursinterne Blockade, die die antagonistische Figur des „Ausländers“ in einem populisti-
schen Diskurs verursacht. Das Politische zeigt sich dort, wo diese unterdrückten Alternativen
wieder zutage treten und die antagonistische Verfasstheit des Sozialen offenlegen: „Die Mög-
lichkeit der Entstehung eines Antagonismus [kann] niemals ausgeschlossen werden“ (Mouffe
2010: 24). Kurz: Der Antagonismus ist das Symbol für den politischen Kern jeder Identität.
Derart durch hegemoniale Entscheidungen und konstitutive Antagonismen charakteri-
siert, verdeutlicht die Logik des Politischen auf einer ontologischen Ebene, dass soziale Ver-
hältnisse sowohl eine grundlegende Kontingenz als auch eine politische Ordnung aufweisen.
Einerseits legt die Logik des Politischen dar, dass das Soziale von Grund auf nichtfixierbar ist
und jeder bestimmten Ordnung ein kontingenter Charakter zukommt. Andererseits kann die
Logik des Politischen diese Kontingenz nur dadurch aufdecken, dass sie immer wieder aufs
Neue die unmögliche Fixierungsbewegung in Angriff nimmt und versucht, dem Sozialen eine
Ordnung zu verleihen. In der Pendelbewegung zwischen Kontingentwerdung und Ordnungs-
stiftung tritt die gründende Kraft des Politischen zutage: Das Politische ist der unaufhörliche
und letztlich stets scheiternde Versuch, das Grundlose mit einem Grund auszustatten.
25
III. Politische Ontologie und die Verdrängung des Sozialen
1) Eine postfundamentalistische politische Ontologie
Die Grundthese vom Primat des Politischen macht die übergreifende Stoßrichtung des Ansatzes
von Laclau und Mouffe deutlich: die Konstitution sozialer Objektivitäten durch politische
Gründungsakte. Die Dimension der politischen Gründung versteht sich damit als flankierende
Bewegung zur „anti-foundationalist Stoßrichtung des Poststrukturalismus“ (Stäheli 2000: 40),
die in ihrer derridaschen Ausprägung bereits behandelt wurde. Wenn die Hegemonietheorie für
die Verwobenheit von Kontingenz und Ordnung plädiert und damit die „unwiderrufliche und
konstitutive Spannung“ zwischen Unentscheidbarkeit (= Dekonstruktion) und Entscheidung
(= Hegemonie) betont (vgl. Laclau 1999: 137), dann tut sie das auf ontologischer Ebene.
Die Spannung zwischen Kontingenz und Ordnung ist deshalb ontologischer Natur,
weil sie eine quasi-transzendentale Dimension einnimmt, die jede Identität von Grund auf
durchzieht. Nach Laclau und Mouffe liegt nämlich die Möglichkeitsbedingung von Identität
gerade in ihrer konstitutiven Zerrissenheit zwischen ihrer Anwesenheit und ihrer Abwesenheit.
Diskurstheoretisch gewendet, ist die Abwesenheit mit der vollständigen Offenheit einer Dis-
kursstruktur und die Anwesenheit mit ihrer vollständigen Schließung gleichzusetzen (vgl. Mar-
chart 2004: 65). Diskursstrukturen bewegen sich aber in der Spannung zwischen beiden Mo-
menten. So wenig eine letzte, ultimative Schließung der Struktur möglich ist, so wenig ist es
auch ihre völlige Offenheit (vgl. Laclau/Mouffe 2001: 111). Beide Momente bedingen sich ge-
genseitig: Die Offenheit der Struktur befördert kontingente Schließungen, während die Schlie-
ßungen als kontingente stets wieder auf die letzte Offenheit der Struktur verweisen. Die Abwe-
senheit eines letzten Grundes forciert politische Gründungsversuche, vorübergehende Momente
der Institution. Die Hegemonietheorie unterstreicht eben nicht antifundamentalistisch das Ver-
schwinden letzter Fundamente, sondern postfundamentalistisch den strittigen, umkämpften
Charakter eines jeden Fundaments (vgl. Marchart 2010: 21). In genau diesem Sinne ist die He-
gemonietheorie Laclaus und Mouffes eine postfundamentalistische politische Ontologie.
Wenn aber das soziale Terrain in letzter Instanz „grundlos“ ist und jeder Grund ein kon-
tingent eingesetzter ist, dann fragt sich: Auf welche Weise bringen politische Instituierungsakte
soziale Objektivitäten – Identitäten, Institutionen oder Gesellschaften – hervor? Wie stabilisie-
ren sich derartige Objektivitäten? Und wie erklärt sich ihr immer partieller und oftmals träger
geschichtlicher Wandel? Das rückt eine wichtige, von der Hegemonietheorie aber unzu-
reichend behandelte, ja gleichsam verdrängte Kategorie in den Fokus: „The sedimented forms
of ‘objectivity’ [that] make up the field of what we will call the social“ (Laclau 1990: 35).
26
2) Das Soziale als Gegenbegriff des Politischen
Nachdem der Status der Hegemonietheorie als einer politischen Ontologie bestimmt wurde,
die postfundamentalistisch den umkämpften Charakter jedes sozialen Fundaments unter-
streicht, gilt es nun, die Kategorie des Sozialen in den Fokus zu rücken. Diese Kategorie ope-
riert wie die des Politischen auf einer ontologischen Ebene und fokussiert die „entpolitisierte“
Sedimentierung sozialer Verhältnisse, die ihre ursprüngliche politische Gründungsdimension
tendenziell vergessen macht. Das politische Ethos von Laclau und Mouffe darf nämlich nicht
dazu verleiten, den Autoren ein naiv voluntaristisches Politikverständnis zu unterstellen. Die
These von der Primatstellung des Politischen besagt nicht, dass jede spezifische politische Arti-
kulation, Antagonismenbildung oder Hegemonialwerdung gewissermaßen „im Handstreich“
alle sozialen Verhältnisse formt (vgl. Mouffe 2010: 26). Die These ist nicht, dass soziale Ver-
hältnisse immer politische Verhältnisse sind, sondern, dass alle sozialen Verhältnisse politische
Ursprünge haben. Die Kategorie der Hegemonie muss hierbei als Moment des „wechselseitigen
Zusammenbruchs“ von Objektivität und Macht ernstgenommen werden (Laclau/Mouffe 2006:
27). Vor dem Hintergrund grundlegender Kontingenz ist es nur die Kraft der Hegemonie, die
das Soziale instituiert, es in feste Formen gießt und ihm Bedeutung verleiht.
Indem Laclau und Mouffe soziale Verhältnisse als Ergebnisse der Hegemonie lesen, be-
kräftigen sie nicht nur die konflikthafte Instabilität sozialer Verhältnisse, sondern auch deren
Stabilisierung. Denn hegemoniale Artikulationen zielen gerade darauf, partikulare Horizonte zu
universalen und natürlichen Bedeutungsordnungen zu machen. Sind hegemoniale Operationen
erfolgreich, dann wird das Kontingente zum Objektiven:
„Insofar as an act of [hegemonic] institution has been successful, a ‘forgetting’ of possible alterna-
tives tends to occur; the system of possible alternatives tends to vanish and the traces of the origi-
nal contingency to fade. In this way, the instituted tends to assume the form of a mere objective
presence. This is the moment of sedimentation“ (Laclau 1990: 34)
Hegemoniale Institutierungsakte zeitigen, so Laclau, „Sedimentierungseffekte“, die den kontin-
genten und umkämpften Charakter der sozialen Realität tendenziell vergessen machen und eine
objektivierte Ordnung einrichten. Laclau und Mouffe rechnen die derart sedimentierten, objek-
tivierten und „entpolitisierten“ Bereiche der Kategorie des Sozialen zu. Das Soziale ist die
„Sphäre sedimentierter Verfahrensweisen, d.h. von Verfahrensweisen, die die ursprünglichen
Akte ihrer kontingenten politischen Instituierung verhüllen und als selbstverständlich angesehen
werden, als wären sie in sich selbst begründet. Sedimentierte gesellschaftliche Verfahrenswei-
sen sind ein konstitutiver Bestandteil jeder möglichen Gesellschaft“ (Mouffe 2010: 26).
27
Auf diese Weise avanciert die Kategorie des Sozialen zum ontologischen Gegenbegriff
des Politischen.17
Wie das Zitat von Mouffe hervorhebt, gehorchen soziale Verfahrensweisen
einem entpolitisierten Movens, der den politischen Ursprung sozialer Verhältnisse verschleiert
und so tut, als ob diesen Verhältnissen ein in sich selbst begründetes Wesen innewohnen würde.
Gleichzeitig ist das Soziale aber ein „konstitutiver Bestandteil“ jeder Gesellschaft. Trotz der
„derivativen“ Natur des Sozialen ist die Spannung zwischen politischer und sozialer Dimension
ontologischer Wesensart, denn sie durchzieht alle sozialen Beziehungen (vgl. Laclau 1990: 35).
Im Folgenden nehme ich die Kategorie des Sozialen in drei Schritten in den Blick. Ers-
tens stelle ich dar, wie in der Hegemonietheorie orthodoxerweise die Kategorien des Sozialen
und des Politischen verhandelt werden, nämlich als ontologisches Gegensatzpaar. Zweitens
zeichne ich nach, wie diese vorherrschende Lesart, explizit oder implizit, in einer ontischen
Grenzziehung zwischen dem sozialen und dem politischen Bereich mündet: Wird die Dimen-
sion des Politischen mit der Politik kurzgeschlossen, so wird das Soziale an Gesellschaft ge-
koppelt. Demgegenüber mache ich mich drittens (IV. Überleitung: das Soziale und die Tradi-
tion) für eine heterodoxe Lesart von Laclau und Mouffe stark, mit der ich diese strikte, onto-
logisch-ontische Gegenüberstellung des Politischen und des Sozialen aufbreche.
a) Politisches und Soziales – ein ontologisches Gegensatzpaar
Für die orthodoxe Deutung des Sozialen und des Politischen als ontologisches Gegensatzpaar
lege ich die Monographie Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory von
Jason Glynos und David Howarth zugrunde, zwei Vertreter der Essex School of Discourse Ana-
lysis.18
Die Autoren überführen die Grundkategorien Laclaus und Mouffes in eine Methodo-
logie, die sie als schulbildende Anleitung hegemonietheoretischer Diskursanalysen konzipieren.
Zunächst betonen Glynos und Howarth, dass das Soziale und das Politische als ontolo-
gische Kategorien zu verstehen sind. Beide Dimensionen lassen sich in der sozialen Wirklich-
keit nicht einfach wiederfinden, sondern sind in konkreten Verhältnissen stets verwoben. Sie
stehen in einem „relationalen“ und „dialektischen“ Zusammenhang und zeitigen in „allen“
sozialen Bereiche Effekte (Glynos/Howarth 2007: 117). Doch wie gelingt es Glynos und Ho-
warth, das Soziale und das Politische auseinanderzuhalten und ihre jeweiligen Grundbewe-
17
Die Gegenüberstellung zwischen dem Sozialen und dem Politischen hat in der politischen Theorie eine lange
Tradition. Prominent zeigt sie sich in Hannah Arendts Vita Activa: Das Gesellschaftliche wird hier als (moderne)
soziale Sphäre konzipiert, die sich nur um die materielle Reproduktion dreht und die politisch gesehen wertlos ist. 18
So die Bezeichnung für die an Laclau und Mouffe orientierte und mittlerweile etablierte Schule von Diskursfor-
schung und -analyse, die mit dem Master- und Doktorandenprogramm Ideology and Discourse Analysis (IDA) an
der University of Essex ihren institutionellen Ankerpunkt hat. Zu den Vertretern der Essex-Schule im engeren Sin-
ne gehören neben Howarth und Glynos Autoren wie Aletta Norval, Yannis Stavrakakis oder Jacob Torfing.
28
gungen – einmal politische Gründung, ein andermal soziale Reproduktion – voneinander ab-
zuheben und gegeneinander zu profilieren?
Obwohl die Autoren auf den ersten Blick eine dynamische Lektüre des Sozialen und des
Politischen nahezulegen scheinen, ziehen sie doch eine scharfe konzeptuelle Grenze zwischen
beiden Dimensionen. Analog zu den formalisierten Äquivalenz- und Differenzlogiken bei
Laclau und Mouffe bezeichnen Glynos und Howarth das Politische und das Soziale als Logiken.
Logiken definieren sie im Anschluss an Laclau als „the rules or grammars of the practice, as
well as the conditions which make the practice both possible and vulnerable“ (ebd.: 136).19
Derart als Grammatiken von Praktiken definiert, unterscheiden Howarth und Glynos poli-
tische und soziale Logiken folgendermaßen: Einerseits beschreibt die politische Logik, wie so-
ziale Verhältnisse auf umkämpfte Weise instituiert oder in Frage gestellt werden (vgl. ebd.: 142).
Wenn sich eine Protestbewegung gegen gewisse Regierungsmaßnahmen formiert, dann erhebt
sie eine Reihe von (äquivalent gesetzten) Forderungen und mobilisiert in der Gesellschaft Zu-
spruch für ihre Anliegen. Gegebenenfalls setzt die Bewegung einen gerafften politischen Wand-
lungsprozess in Gang, der nicht nur die Koordinaten des politischen Feldes im engen Sinne ver-
schiebt, sondern die Gesellschaft als Ganzes verändert. Wie Glynos und Howarth an anderer
Stelle festhalten: „[Political logics] speak to those processes of collective mobilization that are
precipitated by the dislocation of social relations, and which involve the construction, defence,
and naturalization of new social divisions or political frontiers” (Glynos et. al. 2009: 11).
Andererseits fokussiert die soziale Logik, welche Regelmäßigkeiten („patternings“) sozia-
le Verhältnisse annehmen (vgl. Glynos/Howarth 2007: 140). Auch hier folgen die Autoren dem
Plädoyer Laclaus, dass soziale Regelmäßigkeiten einhergehen mit einem „rarefied system of
statements, that is, a system of rules drawing a horizon within which some objects are represen-
table while others are excluded“ (Laclau 2005: 139). Wenn etwa eine soziale Logik des Marktes
instituiert ist, die die Funktionsweisen und Regelmäßigkeiten von Märkten grundiert, dann
verweist diese Logik nach Howarth und Glynos auf ein übergeordnetes Regelsystem, auf eine
übergreifende hegemoniale Ordnung. Sie fundiert „stillschweigend“ spezifische Praktiken und
ihre Regelmäßigkeiten: Einerseits instituierte sie diese Praktiken ursprünglich, während sie
andererseits ihren umkämpften Charakter verschleiert und sie zu quasi natürlichen Bestandtei-
len der sozialen Wirklichkeit macht. Zum Beispiel richteten während der 1980er Jahre hege-
moniale Regimes in den USA und Großbritannien weitgehend deregulierte Finanzmärkte ein.
19
Eine Logik ist also eine Regelhaftigkeit oder Grammatik, die eine Praxis als bestimmte Praxis performativ
hervorbringt und regulierend auf sie einwirkt. Logiken kommt ein quasi-transzendentaler oder eben ontologi-
scher Charakter zu, der sie auf je unterschiedliche sozio-historische Kontexte anwendbar macht (vgl. ebd.: 153f).
29
Diese wurden dann zu weitgehend „natürlichen“ und „entpolitisierten“ sozialen Bereichen mit
je eigenen Regelmäßigkeiten (vgl. Wullweber 2012: 35-38).
Weit davon entfernt, die Dialektik und Verwebung zwischen der Gründungs- und der Re-
produktionsdimension sozialer Verhältnisse zu akzentuieren, legen die Autoren mit ihrer Rede
von einer sozialen und einer politischen Logik nahe, dass das Soziale und das Politische diamet-
ral unterschiedliche Prozesse in den Fokus nehmen. Während die politische Logik für die um-
kämpfte Instituierung oder Infragestellung sozialer Verhältnisse steht, weist die soziale Logik
auf ihre befriedete Reproduktion. Zumal sich Howarth und Glynos (vgl. 2007: 116) mit Laclau
(vgl. 1990: 34f) dem phänomenologischen Begriffspaar der Sedimentierung und Reaktivierung
bedienen, um soziale und politische Prozesse ontisch voneinander abzusondern.
Einmal beschreibt die Sedimentierung den erfolgreichen Instituierungsprozess eines
sozialen Phänomens: Das Instituierte erlangt eine objektivierte Präsenz, die seine kontingen-
ten Ursprünge vergessen macht. Soziale Sedimentbildungen zeichnen sich dadurch aus, dass
schrittweise eine Vergegenständlichung gewisser Wissensbereiche geschieht und diese eine
objektivierte Präsenz annehmen. Wichtig ist, dass Sedimentierung für Glynos und Howarth
(und Laclau) mehr ist als eine bloße Verhärtung, sondern auch verdinglichende Züge besitzt
(vgl. Glynos/Howarth 2007: 139). Sedimentierungsprozesse gehen mit einer Verschleierung
(„concealment“) antagonistischer Grenzziehungen einher. In Sedimentierungsprozessen ver-
schüttet die politische Natur sozialer Verhältnisse. Sie nehmen eine fraglose Präsenz an. Sedi-
mentierung steht buchstäblich für soziale Verfestigungen und Verstetigungen: „Der ursprüng-
lich kontingente Charakter [sozialer] Bereiche und Handlungen gerät über die Zeit in Verges-
senheit und damit auch das Wissen um Alternativen“ (Wullweber 2012: 36).
Zum anderen steht das Moment der Reaktivierung für den Prozess des Kontingentwerdens
sedimentierter Phänomene. Politisierende Äquivalenzen und Antagonismen „reißen“ den politi-
schen Kern sozialer Verhältnisse wieder auf. Reaktivierungsprozesse – so das obige Beispiel
der Protestbewegung – stehen für die Wiederentdeckung des politischen Charakters sozialer
Entitäten: „Stagnant forms that were simply considered as objectivity and taken for granted are
now [in processes of reactivation] revealed as contingent and project that contingency to the
‚origins‘ themselves“ (Laclau 1990: 35). Waren soziale Verhältnisse im sedimentierten Zustand
erstarrt und „passiviert“, so werden sie durch Reaktivierungen wiederbelebt, verflüssigt und
dynamisiert. Fixierte Sedimentschichten werden erneut zu politischen Möglichkeitsräumen.
So suggerieren Howarth und Glynos, dass das Politische und das Soziale vollkommen un-
terschiedliche soziale Prozesse beschreiben: Während das Soziale für sedimentierte soziale Re-
30
gelhaftigkeiten steht, erscheint das Politische als Moment der instituierenden Ereignishaftigkeit
und Unterbrechung geronnener sozialer Verhältnisse (vgl. Howarth/Glynos 2007: 144). So
koppeln denn auch die Autoren das Soziale und das Politische an die beiden Bewegungen, für
die Laclau und Mouffe „ursprünglich“ den Logikbegriff reservierten (vgl. Glynos et al. 2009:
11). Das Soziale wird an die Differenzlogik, an entpolitisierende Diskurszersetzungen ge-
knüpft, während das Politische mit der Äquivalenzlogik, an politisierende Diskurverknüpfun-
gen, kurzgeschlossen wird. Soziale Logik = Differenzlogik = Sedimentierung; politische Lo-
gik = Äquivalenzlogik = Reaktivierung, so lautet Glynos’ und Howarths Gleichung.
Es ist die polar entgegengesetzte Ausrichtung des Sozialen und des Politischen, auf die
es in dieser orthodoxen Lesart zentral ankommt. Die soziale Logik schafft sedimentierte Re-
gelmäßigkeiten, die die politische Logik disruptiv aufbricht und reaktiviert. Das Soziale er-
scheint gleichsam als feste Sedimentschicht, gegen die das Politische immer wieder antritt
und die es mühevoll reaktiviert. Wollte man das Soziale und das Politische in Metaphern fas-
sen, so stünden sich beide Logiken diametral gegenüber: Das Soziale als Beständigkeit, Immo-
bilität und Erstarrung, und das Politische als Wandel, Transformation und Dynamik. Diese Kon-
frontation zwischen dem Sozialen und dem Politischen als bloß ontologisch-analytische Diffe-
renz zu verharmlosen, die in konkreten Verhältnissen immer verwoben sind, ist ein erkenntnis-
theoretischer Trugschluss: Das Begriffspaar Sedimentierung vs. Reaktivierung macht nur dann
Sinn, wenn es als konkrete – also ontische – Beschreibung und Differenzierung sozialer Prozesse
gehandhabt wird. Die radikale Konfrontation zwischen dem Sozialen und dem Politischen
nimmt dadurch als eine ontologisch-ontische Gegenüberstellung im starken Sinne Gestalt an.
Sie mündet quasi zwangsläufig in der ontischen Trennung, mehr noch, in der ontischen Pola-
risierung von Gesellschaft auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite.
b) Die ontische Polarisierung von Politik und Gesellschaft
Glynos’ und Howarths orthodoxe Lesart des Sozialen und des Politischen bei Laclau und Mouf-
fe läuft darauf zu, Gesellschaft und Politik als ontische Äußerungsformen des Sozialen und des
Politischen zu lesen und beide Bereiche scharf voneinander abzusondern. Paradigmatisch für
die übliche Argumentationslinie hegemonietheoretischer Autor/innen definiert Astrid Sigglow
Gesellschaft und Politik als jeweilige ontische „Stabilisierungsversuche“ der ontologischen
sozialen und politischen Dimension. Während das Soziale und das Politische ein allgemeiner
Horizont des Intelligiblen sind, realisieren „Gesellschaft und Politik ontische, positive Fixierun-
gen von Bedeutungen, Identitäten, Gruppen und politischen Projekten“ (Sigglow 2010: 42).
31
Die ontische Stabilisierung des Sozialen in Gesellschaft und des Politischen in Politik
vertieft nur die Gräben zwischen beiden Dimensionen – und denkt somit die orthodoxe Lektüre
von Glynos und Howarth konsequent zu Ende. Was heißt es zunächst, wenn sich das Politische
in Politik niederschlägt? Das Politische im ontologischen Sinne steht für die Allgegenwärtigkeit
des Antagonismus. Antagonistische Grenzziehungen durchziehen soziale Verhältnisse von
Grund auf und geben geradezu ihre Möglichkeitsbedingung ab. Die Pointe der Gleichsetzung
des Politischen mit dem Antagonismus ist: Der Antagonismus ist der Ausgangspunkt für die he-
gemoniale Errichtung gegebener Identitäten, er ist aber zugleich die Gewähr dafür, dass jede
Identität durch Ausschlussspuren gekennzeichnet bleibt – und das Aufkommen antagonistischer
Alternativen niemals ausgeschlossen werden kann. Das Politische als Antagonismus realisiert
sich als ontische Politik nicht etwa dadurch, dass man sie als ein klar eingrenzbares Funktions-
system begreift, sondern indem man ihr eine handlungs- und konfliktzentrierte Definition gibt:
„Politik [bezeichnet] das Ensemble von Praktiken, Diskursen und Institutionen, die eine bestimmte
Ordnung zu etablieren versuchen und menschliche Koexistenz unter Bedingungen organisiert, die
immer potentiell konfliktorisch sind, da sie von der Dimension ‚des Politischen’ affiziert werden“
(Mouffe 2008: 103)
Mouffe definiert also Politik als die Menge der politischen Artikulationen, die eine bestimmte
Ordnung entweder einrichten (hegemoniale Artikulationen) oder sie in Frage stellen (gegenhe-
gemoniale Artikulationen). Anders gesagt: Politik lässt sich definieren als die Menge der Orte in
einer Gesellschaft, in der „Kämpfe um Hegemonie, also um die Verfügung der Deutungsfähig-
keit […], stattfinden“ (Cazorla Rodríguez 2006: 12). Folglich ist Politik die Summe der zu ei-
nem gegeben Zeitpunkt ausgeführten politischen Artikulationen. Über diskursive Äquivalent-
setzungen, antagonistische Grenzziehungen und hegemoniale Universalisierungen streben Arti-
kulationen danach, der Gesellschaft eine spezifische Form zu geben. Politik ist dieser antagonis-
tische Streit über die Beschaffenheit der gesellschaftlichen Ordnung.
Dieses hochdynamische Politikverständnis, das gleich einem Kreuzfeuer überall auftre-
ten kann und buchstäblich strukturlos ist, hat sein Gegenstück in der Gesellschaft. Zwar ist Ge-
sellschaft nach dem poststrukturalistischen Tenor Laclaus und Mouffes niemals schlicht gege-
ben, sie ist keine apriorische Ordnung. Und doch ist Gesellschaft ein Derivat, sie ist ein Ergeb-
nis politischer Artikulationen. Gesellschaft bildet sich dort heraus, wo politische Artikulationen
erfolgreich sind und in der Hegemonialwerdung spezifischer Bedeutungshorizonte kulminie-
ren. Ist Politik die Summe politischer Artikulationen, so ist Gesellschaft die Summe sedimen-
tierter sozialer Regelmäßigkeiten. Überall dort, wo sich die sedimentierte Reproduktion sozia-
ler Verhältnisse in ontisch stabilisierten Identitäten, Handlungsmustern und sozialen Feldern
32
niederschlägt, kristallisiert sich Gesellschaft. Sie ist die soziale Totalität, die aus der Aufsum-
mierung aller sozialen Fixierungen hervorgeht. Zwar betonen Laclau und Mouffe, dass Gesell-
schaft ein stets „temporäres und widerrufliches“ Artikulationsergebnis sei (Mouffe 2010: 26)
und einem „unmöglichen Objekt“ gleichkomme (Laclau 1990: 91). Aber, und darauf kommt
es bei dieser orthodoxen Lektüre an: Die Dynamiken, die Gesellschaft immer wieder dezent-
rieren und neu formieren, wohnen nicht der Gesellschaft inne, sondern der Politik. Politische
Artikulationen schreiben sich fortwährend in die Gesellschaft ein und gestalten sie um. Ge-
sellschaft an und für sich ist nichts weiter als ein sedimentiertes Feld. Die Gesellschaft ist ein
fixiertes Terrain, gegen das politische Prozesse fortwährend antreten, um es zu reaktivieren,
umzugestalten und neu zu formen. Für Laclau und Mouffe sind Gesellschaft und Politik nicht
nur Gegenbegriffe, vielmehr ist Gesellschaft das Produkt von Politik. Zugespitzt formuliert:
Gesellschaft ist ein zwar notwendiges, aber für sich genommen interesseloses Derivat von
Politik. Die Strukturen, Tiefendimensionen und Brüche, die der Gesellschaft immanent aneig-
nen, rücken so gar nicht erst in den Fokus. Aber entgeht Laclau und Mouffe dadurch nicht,
dass politische Artikulationen nicht nur gesellschaftliche Strukturen hervorbringen, sondern
auch aus ihnen hervorgehen? Dass Artikulationen nicht in einem luftleeren Raum stattfinden,
sondern in einem hegemonial strukturierten Gesellschaftsterrain geschehen? Dass also Politik
ohne Gesellschaft nur unzureichend und immer nur selektiv begriffen ist?
IV. Überleitung: Das Soziale und die Tradition
Die Ausführungen zu den ontologisch-ontischen Begriffspaaren Politisches/Politik und Soziales/
Gesellschaft zeigten, wie die Hegemonietheorie „orthodoxerweise“ das Verhältnis zwischen
beiden Komplexen fasst. Auf der einen Seite stehen Politisches und Politik als fundierende und
gleichsam strukturlose Gründung und Reaktivierung sozialer Verhältnisse, auf der anderen Seite
stehen Soziales und Gesellschaft als deren regelgeleitete Reproduktion und Sedimentierung. De
facto haben hegemonietheoretische Arbeiten – auf theoretischem Terrain genauso wie in kon-
kreten Diskursanalysen – eine ausgeprägte Tendenz, das Verhältnis zwischen der politischen
und der sozialen Dimension einer Zwei-Welten-Lehre anzugleichen: Die primäre Unterbrechung
und Dynamisierung (Politisches/Politik) steht der sekundären Starre und Regelhaftigkeit (Sozia-
les/Gesellschaft) diametral gegenüber (vgl. Stäheli 2007: 137) – wobei hegemonietheoretisch
eigentlich nur das Politische und seine ontische Äußerung als Politik interessieren.
Im Folgenden setze ich mich von der Gegenüberstellung Politisches/Politik vs. Soziales/
Gesellschaft ab: Über den ontischen Begriff der Tradition lanciere ich – noch in immanenter
33
Orientierung an Laclau und Mouffe – eine „heterodoxe“ Lektüre des Verhältnisses von Politik
und Gesellschaft, die ihre Verschränkung betont: Zum einen geschehen Artikulationsprozesse
nicht in einem Vakuum, sondern in einem vorstrukturierten Terrain. Soziale Sedimente durch-
dringen politische Artikulationen. Zum anderen ist aber dieser strukturierte Artikulationsraum
weit dynamischer, als die obige Darstellung einer sedimentierten Gesellschaft nahelegt. Traditi-
onen sind nicht begrenzende Sedimentschichten, sondern politische Möglichkeitsräume. Diese
Doppelbewegung lässt über den ontischen Traditionsbegriff Soziales und Politisches zusam-
menlaufen und ineinander übergehen. So fungieren die vorliegenden Ausführungen denn auch
als Ausgangspunkt meines eigenen Argumentationsganges, der in den nächsten Kapiteln die
Hegemonietheorie um ein diskurstheoretisches Konzept von Zivilgesellschaft erweitern wird.
Den Traditionsbegriff setzen Laclau und Mouffe ein, um die geschichtliche Veranke-
rung politischer Artikulation zu unterstreichen. Indes kommt die Geschichtlichkeit der Tradi-
tion keiner objektivierten und regelhaften Sedimentierung gleich, sondern ist konstitutiv of-
fen, heterogen und umkämpft. Die Kategorie der Geschichtlichkeit („historicity“) betont, so
Laclau, eben nicht die regelhafte Sedimentierung sozialer Strukturen, sondern ihre letztliche
Kontingenz: „to understand something historically is to refer it back to its contingent conditi-
ons of emergence“ (Laclau 1990: 36). Die unausgeschöpften Potentiale einer dezidiert ge-
schichtlichen Lesart sozialer und politischer Prozesse lege ich nun frei, indem ich drei exemp-
larische Lektüren des Traditionsbegriffes bei Laclau und Mouffe durchführe.
Zunächst gebraucht Laclau in Politics and the Limits of Modernity (1988) das Konzept
der Tradition bezeichnenderweise dafür, um sich von der klassischen Anschuldigung abzu-
grenzen, dass die Wende von der Moderne zur Postmoderne mit einer nihilistischen Grund-
haltung einhergehe. Auch nachdem der ontologisch privilegierte Charakter des Cogito brüchig
geworden ist, sind nach Laclau argumentative Praktiken möglich. Argumentative Praktiken
nehmen aber in der postmodernen conditio nicht mehr den Charakter unangefochtener Wahr-
heitsurteile an, sondern sind grundsätzlich heterogen und umstritten: „The argument would
have the tendency to prove the verisimilitude of an argument rather than its truth, thus beco-
ming pragmatic and open-ended“ (Laclau 1988: 79). Die Glaubwürdigkeit eines Arguments –
die gewissermaßen seinen Wahrheitsanspruch ersetzt – hängt nun nach Laclau mit den Tradi-
tionen zusammen, die in einer gegebenen Gemeinschaft wirksam sind. Eine Gemeinschaft
wird sich eher gegenüber solchen Argumenten offen zeigen, die ihr bereits aus der Vergan-
genheit bekannt sind, nach vertrauten Regeln formuliert sind und an etablierte Normen an-
schließen. Dagegen wird sie eher solche Regeln ablehnen, die ihr fremd sind.
34
Laclau definiert den Begriff der Tradition als das Ensemble argumentativer Praktiken
einer Gemeinschaft, die über gewisse Zeiträume fortdauern (vgl. ebd.). Traditionen als derar-
tige argumentative Sets zeichnen sich aber per definitionem dadurch aus, dass sie eine offene
und veränderbare Textur aufweisen: Jede Aneignung eines neuen und noch so bekannt schei-
nenden Arguments verrückt die Traditionsstrukturen der Gemeinschaft. In Laclaus Aufsatz
erfüllt der Traditionsbegriff eine Doppelfunktion: Einerseits ist er ein sedimentiertes Bedeu-
tungsfeld, das a priori die Wahrheit oder Falschheit oder, genauer, die Glaubwürdigkeit oder
Nichtglaubwürdigkeit argumentativer Praktiken reguliert. Ob ein Argument glaubwürdig ist
oder nicht, ist demzufolge nicht beliebig, sondern hängt mit den jeweils wirksamen Traditio-
nen zusammen. Andererseits unterliegt aber auch das Bedeutungsfeld der Traditionen einem
ständigen Wandlungsprozess. Durch jede neue argumentative Praxis verschiebt sich die Textur
historischer Narrative. Jede Argumentation hinterlässt in der Tradition ihre Spuren.
Im Aufsatz Radical Democracy: Modern or Postmodern? (1993) spricht sich Mouffe
ebenfalls für den Traditionsbegriff aus und legt seine Potentiale für ihre radikale Demokra-
tietheorie frei. Ähnlich wie Laclau setzt Mouffes Traditionsverständnis an der postmodernen
Zurückweisung des modernen Universalismus an. Werden denn mit der Infragestellung des
„abstract Enlightenment universalism“ (Mouffe 1993: 13) nicht auch die grundsätzlichen Werte
der Freiheit und Gleichheit fragwürdig, auf denen die demokratische Ordnung beruht? Mouffes
Traditionsbegriff möchte genau diese Frage verneinen. Demokratische Werte sind eben nicht
privilegierte und transzendentale Prinzipien, sondern historisch vermittelte und damit kontin-
gente Narrative. Demokratische Werte sind Traditionen, die Mouffe folgendermaßen definiert:
„Tradition allows us to think our own insertion into historicity, the fact that we are constructed as
subjects through a series of already existing discourses, and that it is through this tradition that the
world is given to us and that all political action is made possible“ (ebd.: 16)
Wie das Zitat verdeutlicht, schließt Mouffes Traditionsbegriff unmittelbar an den des Diskur-
ses an, er verleiht ihm aber eine historische Wendung. Traditionen sind nach Mouffe Diskurse
mit einer langen historischen Dauer, sie haben sich förmlich in das Gemeinschaftsleben ein-
geschrieben und prägen es quasi von innen heraus. Diese prägende und sich dem Verhalten ein-
schreibende Dimension der Tradition fokussiert Mouffe einerseits über den konservativen Den-
ker Michael Oakshott und andererseits über Wittgenstein. Zum einen greift sie auf Oakshotts
Begriff der „tradition of behavior“ zurück, um zu plausibilisieren, dass die liberal-
demokratischen Werte in modernen Gesellschaften als tradierte Verhaltenskodizes fungieren.
Erst wenn man die Werte Freiheit und Gleichheit als organische Kodizes begreift, versteht
man, wie diese Werte durch soziale Kämpfe in immer mehr soziale Bereiche getragen werden
35
und diese reorganisieren (vgl. ebd.: 16). Zum anderen legt Mouffe mit Wittgensteins Begriff
des Sprachspiels dar, dass Traditionen nicht ein ideeller und dem Gemeinschaftsleben enthobener
Charakter zukommt, sondern sie stets mit gewissen Lebensformen verbunden sind, die sich in
Praktiken, Anschauungen und Institutionen verkörpern (dazu S. 72f). Mouffe pointiert dies wie
folgt: „Tradition is the set of discourses and practices that form us as subjects“ (ebd.: 17).
Nun ist für Mouffe die liberal-demokratische Tradition (genauso wie jede andere Tradi-
tion) in keiner Weise ein festes, unumstößliches und ahistorisches Faktum, sondern ein genuin
politisches Konstrukt. Indem sich politische Projekte auf spezifische Art und Weise auf die libe-
ral-demokratische Tradition berufen und sich in dieser Tradition andere oder neue Bedeu-
tungsgehalte geben, verändern sich ihre Konturen – und damit die mit der Tradition einherge-
henden „traditions of behavior“ (Oakshott) sowie Lebensformen (Wittgenstein). Insofern be-
tont Mouffe die unauslöschliche politische Dimension der Tradition und ihre transformative
Wirkung. Dabei hängt die historische Beständigkeit der demokratischen Traditionen, ihre
longue durée, damit zusammen, dass politische Projekte sie sich immer wieder aneignen, ihre
Gehalte umbesetzen und sie als ein lebendiges Narratives in die Gegenwart einschreiben.
Die beiden Lektüren von Laclau und Mouffe betonten jeweils, dass mit dem Traditions-
begriff sowohl die historische Beständigkeit als auch die Prozesshaftigkeit sozialer Phänome-
ne ins Zentrum rückt: Einerseits reichen sie zwar bis in die Verhaltenskodizes und Lebens-
formen der Gemeinschaft hinein, andererseits sind aber auch diskursive Konstruktionen, die
laufend durch politische Interventionen verändert und aktualisiert werden. Laclau und Mouffe
unterstreichen so, dass sich ein konstruktivistisches Verständnis von Traditionen als veränder-
baren Narrativen durchaus mit ihrer historischen Tiefenwirkung verträgt. Nimmt man diese
Tiefenwirkung ernst, dann avancieren Traditionen zu umfassenden Archiven im foucaultschen
Sinne (vgl. Foucault 1973: 186f): Traditionen sind historische Aprioris, die das Auftauchen
der Diskurse regulieren und ihre generellen Formationsgesetze definieren.
Die Rolle der Tradition als ein Archiv taucht bei Laclau und Mouffe – dies ist meine
dritte Lektüre – auch auf gleichsam metatheoretischer Ebene auf. Sie zeigt sich in Hegemony
and Socialist Strategy dort, wo Laclau und Mouffe den fundamentalen Charakter der demokra-
tischen Revolution hervorheben. Für die Autoren sind die amerikanische und besonders die
französische Revolution die „Möglichkeitsbedingung“ kollektiven politischen Handelns, „direc-
ted towards struggling inequalities and challenging relations of subordination“ (Laclau/Mouffe
2001: 153). Es bedarf der demokratischen Revolutionen, um naturalisierte Unterordnungsver-
hältnisse („relations of subordination“) in politisierbare Unterdrückungsverhältnisse („relations
36
of oppression“) zu verwandeln. Erst nachdem die Revolutionen das Gleichheitsaxiom zu ei-
nem universellen Menschenrecht erklären, werden die Unterordnungsverhältnisse der Leibei-
genen, Sklaven oder Knechte aufgebrochen und in politisch umkehrbare Unterdrückungsver-
hältnisse verwandelt (vgl. ebd.: 154). Die demokratische Revolution beendet so einen Gesell-
schaftstyp, der sich durch eine stratifizierte, trifunktionale Ordnung auszeichnete und inaugu-
riert eine neue Gesellschaftsmatrix: Die demokratische Revolution schafft eine Gesellschafts-
ordnung, in der machtgeladene Konflikte eine wahrlich instituierende Funktion übernehmen
und das Gemeinwesen in seiner spezifischen Beschaffenheit hervorbringen.
Die demokratische Revolution wird somit zur quasi-transzendentalen Bedingung der
postfundamentalistischen politischen Ontologie von Laclau und Mouffe. Die hegemonietheore-
tischen Grundbegrifflichkeiten und die Primatstellung des Politischen greifen in einem sozialen
Terrain, das von der demokratischen Revolution vorbereitet wurde: Laclau und Mouffe könnten
die Zentralität von Artikulation, Antagonismus und Hegemonie gar nicht erst affirmieren (bzw.
als solche denken), wenn sie nicht innerhalb des Horizontes der demokratischen Revolution
stünden. Die Kategorien von Laclau und Mouffe sind selber historische Kategorien, die ihre
Wirksamkeit in und durch die Tradition der demokratischen Revolution entfalten: Erst diese
Tradition fördert die „unvernähte“ und konflikthafte Natur soziale Verhältnisse zutage, erst
sie rückt die gründende Dimension der Hegemonie ins Zentrum.
Resümierend erlaubt das Traditionsverständnis Laclaus und Mouffes eine Neulektüre von
Gesellschaft und Politik, die sich ihrer Polarisierung widersetzt und ihre Verwobenheit betont.
Erstens weisen Traditionen zwar sedimentierte Bedeutungsgehalte auf. Deren Dynamik und
Veränderbarkeit verbietet es aber, sie als durchweg starre und regelhafte Gesellschaftsgebilde
zu lesen – wie noch die orthodoxe Deutung nahelegte. Zweitens sind Traditionen stets politisch
aufgeladen. Traditionen stellen die Aufteilung von sozialen und politischen „Logiken“ in Frage
und legen offen, dass sedimentierte Diskurse auch politisierend und reaktivierend wirken. Ver-
steht Laclau die Argumentationspraktiken einer Gemeinschaft als Tradition oder liest Mouffe
demokratische Werte als kontingente Traditionen, so deuten sie damit historische Diskurse
nicht nur als Sedimentierungspunkte, sondern auch als Ausgangspunkte neuer Artikulationsbe-
wegungen. Damit bekommen Artikulationen geschichtlich strukturierte „Fundamente“. Drittens
unterzieht der Traditionsbegriff den ontologischen Begriff des Politischen einer grundsätzlichen
Historisierung. Laclaus und Mouffes These von der Primatstellung des Politischen ist eine his-
torische These. Erst die demokratische Revolution macht die Gesellschaft zu einem politischen
Raum, den politische Beziehungen von allen Seiten durchkreuzen und umgestalten.
37
B) Dreh- und Angelpunkt des Politischen: die Zivilgesellschaft
Nachdem das erste Kapitel die Konzepte und Grundaxiome der Hegemonietheorie von Laclau
und Mouffe vorstellte, führt das zweite Kapitel den Begriff der Zivilgesellschaft ein. Meine
Leitintuition ist, dass ein Zivilgesellschaftsverständnis, wie es in der Demokratietheorie Leforts
und besonders im unorthodoxen Marxismus Gramscis auftaucht, Laclau und Mouffe an ent-
scheidender Stelle ergänzt. Gegen die Dichotomie einer politischen und einer sozialen Logik
und ihrer binären Zuordnung zu den ontischen Sphären der Politik und Gesellschaft betont der
Zivilgesellschaftsbegriff, dass beide Dimensionen in einem engeren ontologischen und onti-
schen Verhältnis stehen als von der Hegemonietheorie unterstellt: Politische Bewegungen
durchdringen den sozialen Raum, soziale Sedimente durchsetzen politische Artikulationen.
In diesem Sinne geht es im Folgenden nicht darum, die postfundamentalistische politi-
sche Ontologie von Laclau und Mouffe „soziologisch“ zu dezentrieren und die Vorrangigkeit
einer Logik des Sozialen vor politischen Gründungsakten zu postulieren. Ich strebe nicht eine
sozial- bzw. kulturtheoretische Infragestellung der politischen Primatstellung an, sondern viel-
mehr ihre Vertiefung. Das Politische zeitigt auch noch in jenen sozialen und kulturellen Sphären
Effekte, die sich a priori als unpolitisch gebärden. Ich folge hierbei Gramscis Leitidee, dass he-
gemoniale Prozesse in alle Verästelungen der Gesellschaft hineinwirken. Nach Gramsci bringen
hegemoniale Kollektivwillen übergreifende Weltauffassungen hervor, sie schaffen gewisserma-
ßen ein „kulturelles Klima“, das die Gesellschaft durchdringt (vgl. Gramsci 2012: 1051). Kurz
gesagt: Ich beabsichtige, die These Laclaus und Mouffes von der Primatstellung des Politischen
kritisch weiterzuentwickeln und offenzulegen, dass hegemoniale Instituierungsakte eine fluide
Machttopographie hervorbringen, die sich als Zivilgesellschaft bezeichnen lässt. Diese Topo-
graphie ist weit weniger fixiert, als es die Kategorien des Sozialen und der Gesellschaft bei
Laclau und Mouffe nahelegen. Hegemoniale Gründungsakte kreieren einen instabilen und ver-
änderbaren politischen Raum. Er ist nicht nur ein geronnener sozialer Effekt hegemonialer Be-
deutungsfixierungen, sondern fungiert überdies als Ausgangspunkt politischer Artikulationen.
Das vorhergehende Kapitel wies im immanenten Rückgriff auf den Traditionsbegriff
von Laclau und Mouffe den Weg zu einem dynamischeren Verhältnis von Politik und Gesell-
schaft. Ihr Traditionsverständnis fungiert als der – allerdings heterodoxe – theorieimmanente
Ausgangspunkt, von dem aus ich meine Argumentation lanciere und mein Konzept von Zivil-
gesellschaft einführe. Es ist insbesondere eine konkrete ontische Tradition, die sowohl explizit
für Laclau und Mouffe als auch implizit auf einer metatheoretischen Ebene im Zentrum steht:
die demokratische Revolution. Zum einen ist die demokratische Revolution nach Mouffe eine
38
– wenn nicht die – gewichtige Tradition, an die gegenwärtige politische Projekte anschließen:
Sie aktualisieren die demokratischen Axiome von Freiheit und Gleichheit für ihre eigenen Ziel-
setzungen. Zum anderen ist die demokratische Revolution metatheoretisch die historische
Möglichkeitsbedingung für das von Laclau und Mouffe vorgebrachte Primat des Politischen.
Erst die demokratische Revolution gestattet, die ontologische Vorrangstellung politischer
Instituierungsakte zu behaupten und die konfliktgeladene Artikulation hegemonialer Projekte
als Schlüsselmoment sozialer Ordnungsstiftung zu profilieren. So zentral die demokratische
Revolution für Laclau und Mouffe ist, so entgeht ihnen dabei doch die Kategorie der Zivilge-
sellschaft, die ihr diesbezüglicher Referenzautor in den Vordergrund stellt. Claude Lefort be-
tont, dass die moderne Demokratie mit einer autonomisierten und politisch aufgeladenen Zivil-
gesellschaft einhergeht. Nach Lefort ist sie die politische Drehachse des nachrevolutionären
Gemeinwesens. Erst durch sie wird das demokratische „Abenteuer“ auf Dauer gestellt.
Im Folgenden werde ich die Kategorie der Zivilgesellschaft schrittweise einführen und
plausibilisieren, dass mit ihr die Gegenüberstellung von Politik und Gesellschaft bei Laclau und
Mouffe transzendiert werden kann. Zunächst werde ich die Bezüge zu Leforts Demokratietheo-
rie klarstellen und selektiv darlegen, welche sozialtheoretischen Konsequenzen seine Konzepti-
on des Sozialen zeitigt: Ursprüngliche Spaltung, radikale Konflikthaftigkeit und politische
Aufladung – dies sind die drei Hauptcharakteristika, die mir bei Leforts Zivilgesellschaftsver-
ständnis besonders wichtig sind (I). Nach der Behandlung dieses republikanischen Gesell-
schaftsverständnisses schlage ich im zweiten Schritt den Bogen zu Gramsci, dem zentralen
Bezugsautor Laclaus und Mouffes: Gramscis Konzeption ergänzt den lefortschen Ansatz in
dem Maße, als er die Zivilgesellschaft zum Ursprungsort einer umfassenden, kulturellen und
politischen Hegemonie macht. Gramsci liest die Zivilgesellschaft als ein vermachtetes und
stratifiziertes Kräftefeld, das durch kollektive Deutungs- und Gestaltungskämpfe geformt wird.
Bewegt sich der Anschluss an Leforts Zivilgesellschaftsbegriff noch auf einer allgemeinen
Grundlagenebene, so orientiert sich meine Auseinandersetzung mit Gramsci bereits an den ana-
lytischen Hauptsträngen, die dann das dritte Kapitel systematisch ausbaut: Ich präsentiere
Gramscis Begriffe der organischen Ideologie, des Alltagsverstandes und der kulturellen Organi-
sation und lese sie als eine Begriffstrias, an die ich diskurstheoretisch anknüpfe (II). Das Kapitel
schließt mit einem Exkurs, der eine Übersicht über die aktuellen sozial- und politiktheoretischen
Debatten rund um das Konzept der Zivilgesellschaft gibt (III). Dieser Exkurs gibt die Kontrast-
folie meines eigenen Zivilgesellschaftskonzepts ab, das ich im dritten Kapitel in einer syntheti-
schen Verdichtung gramscianischer und poststrukturalistischer Gedanken entfalte.
39
I. Lefort: Gespalten, konflikthaft, politisch – die Zivilgesellschaft
Die Auseinandersetzung mit der Demokratietheorie Leforts verfolgt die Zielsetzung, die le-
fortsche Konzeption von Zivilgesellschaft als einem politischen Raum zu unterstreichen und sie
als Dreh- und Angelpunkt des Politischen zu lesen. Die Verselbständigung eines autonomen
Gesellschaftsbereichs, den Lefort explizit als Zivilgesellschaft20
bezeichnet, ist für ihn ein zent-
rales Signum der demokratischen Revolution. Indem der lefortsche Ansatz betont, dass sich die
Zivilgesellschaft durch Spaltung, Konflikthaftigkeit und politische Aufladung auszeichnet, eb-
net er einem dynamischen Gesellschaftsverständnis den Weg. Auch wenn ich Lefort sehr selek-
tiv lese und mir bei weitem nicht alle seine Prämissen und Kategorien aneigne, verteidige ich
gleichwohl, dass seine Beschreibung der Zivilgesellschaft als dem zentralem Bezugspunkt des
Politischen der Ausgangspunkt jedes schlagkräftigen Zivilgesellschaftskonzepts sein sollte.
Bevor ich die drei für mich zentralen Facetten des lefortschen Zivilgesellschaftsbegrif-
fes – ursprüngliche Spaltung, radikale Konflikthaftigkeit und politische Aufladung – vorstelle,
erinnere ich in nuce an den historischen Startpunkt, durch den nach Lefort ein autonomer Be-
reich der Zivilgesellschaft entsteht. Es ist insbesondere die französische Revolution, mit der
sich eine neue symbolische Repräsentation der Gesellschaftsmatrix herausbildet und durch die
die instituierende Macht des Politischen zutage tritt (vgl. Lefort 1988: 104f). Mit Kantorowicz
stellt Lefort fest, dass die vorrevolutionäre, absolutistische Gesellschaft durch die doppelte,
gleichzeitig weltliche und transzendentale Stellung des Monarchen geprägt ist. Der doppelte
Körper des Monarchen schafft eine substantielle, „organische“ Einheit von Macht und Gesell-
schaft. Die Gesellschaft sieht sich vollständig in die Macht inkorporiert, sie ist ein Teil der
„mystischen Gemeinschaft“ des gesamten Königreichs (Marchart 2009: 229).
Die französische Revolution als Geburtsstunde der modernen Demokratie stellt diese
vollständige Inkorporierung der Gesellschaft in die monarchische Macht- und Herrschaftsord-
nung grundsätzlich in Frage. Lefort folgt hier François Furets These, dass die französische
Revolution den Ort der Macht radikal dezentriert und das Politische als Gründungsdimension
aller sozialen Verhältnisse freisetzt (vgl. Furet 1983: 81, Lefort 1988: 105). Die Enthauptung
Ludwigs XVI. markiert symbolisch das Ereignis, in dem sowohl die Dekorporierung der
Macht als auch der Gesellschaft stattfindet (vgl. Rödel et al. 1989: 89). Zum einen geschieht
mit der Enthauptung Ludwigs XVI. eine Dekorporierung des Ortes der Macht, der zur buch-
stäblichen Leerstelle wird. Die Macht verliert somit ihre außerweltlich-transzendentale Aufla-
dung. Jede dauerhafte Aneignung und Einverleibung der Macht ist von nun an unmöglich.
20
In den Ausführungen zu Lefort gebrauche ich den Begriff der Gesellschaft synonym zu dem der Zivilgesellschaft.
40
Wie Lefort betont, wird die Macht zu einem leeren und letztlich unbesetzbaren Ort, „so dass
kein Individuum, keine Gruppe ihm konsubstantiell zu sein vermag“ (Lefort 1990: 293). Zum
anderen zerbricht im Zuge der französischen Revolution die organische Einheit der Gesellschaft
mit der Macht. Hiermit setzt eine Autonomisierung der Sphäre des Sozialen ein, die die vom
Ancien Régime symbolisierte organische Totalität des Gemeinwesens außer Kraft setzt (vgl.
ebd.: 294f). Die nachrevolutionäre Gesellschaft ist körperlos. Transzendentaler Ordnungsprin-
zipien beraubt, muss das Gesellschaftliche immer wieder aufs Neue die Stiftung und Instituie-
rung seiner selbst in Angriff nehmen (vgl. Lefort/Gauchet 1990: 96). Es beginnt das ungewisse
„Abenteuer“21
der modernen Demokratie und einer auf sich gestellten Zivilgesellschaft.
1) Ursprüngliche Spaltung
Mit der These von der doppelten Dekorporierung von Macht und Gesellschaft durch die fran-
zösische Revolution tritt die erste Facette des lefortschen Zivilgesellschaftsverständnisses
zutage: die ursprüngliche Spaltung. Lefort macht das Axiom der Spaltung auf zwei Ebenen
stark. Zum einen gibt es eine Spaltung zwischen Staat und Zivilgesellschaft, zum anderen
durchläuft die Spaltung auch die Zivilgesellschaft selbst. Pointiert formuliert, weist die Zivil-
gesellschaft nach Lefort sowohl eine äußere als auch eine innere Spaltung auf.
Zunächst ist die Zivilgesellschaft nach außen von der Sphäre des Staates getrennt. Im
Zuge der demokratischen Revolutionen bildet sich ein eigenständiger Raum des Gesellschaftli-
chen heraus, der nicht mehr durch die Sphäre des Staates verkörpert wird. Lefort deutet indes
die Teilung der Zivilgesellschaft von der Sphäre des Staates auf heterodoxe Art und Weise. Er
begreift sie nicht als eine absolute Trennung, sondern als spannungsgeladene Beziehung. An-
ders als herkömmliche Politiktheorien grenzt er sich von der Vorstellung ab, dass die Zivilge-
sellschaft eine entpolitisierte Sphäre des privaten Verkehrs sei. Dagegen liest er sie als zutiefst
politischen Bereich (s.u.). Die Zivilgesellschaft ist stets auf die Sphäre des Staates oder, in der
Diktion Leforts, auf den leeren Ort der Macht bezogen. Das Verhältnis zwischen Zivilgesell-
schaft und Staat gleicht einer dynamischen Relation, die die Grenze zwischen dem gesellschaft-
lichen Innen und dem politischen Außen (der Ort der Macht) ständig unterläuft und neu be-
stimmt. Der Spaltung zwischen beiden Sphären nimmt also die Form eines fluiden und kon-
fliktgeladenen „In-Beziehung-Setzens“ an (Lefort 1999: 49), das sich der klaren Grenzzie-
hung zwischen zwei „äußerlich“ sich gegenüber stehenden Bereichen widersetzt.
21
Den Begriff des Abenteuers gebraucht Lefort nicht im alltagssprachlichen Sinne, sondern orientiert sich an
Merleau-Pontys Verwendung in Die Abenteuer der Dialektik. Das Abenteuer steht für eine „dem Ereignis, der
Kontingenz und der historischen Prüfung ausgesetzten Erfahrungsdimension“ (Scheulen/Szánkay 1999: 98).
41
Dass die äußere Spaltung der Zivilgesellschaft gegenüber dem Staat fluide ist, wird
gleichzeitig dadurch bedingt, dass sich die Spaltung auch durch das Innere der Zivilgesell-
schaft zieht. Eine demokratische Gesellschaft ist dekorporiert, sie ist eine buchstäblich körper-
lose Gesellschaft, die jeder positiven Determination entbehrt (vgl. ebd.: 50). Die Zivilgesell-
schaft weist konflikthafte Spaltungen auf, die sie von innen dezentrieren. Wie Marcel Gau-
chet, Leforts wohl bekanntester Schüler, betont, ist die Teilung der Gesellschaft ursprünglicher
Natur: „Die Teilung ist weder ableitbar noch auflösbar“ (Gauchet 1990: 224). Die im Zuge
der demokratischen Revolution autonomisierte Zivilgesellschaft kommt nicht einem homoge-
nen Kollektivakteur gleich, der als neue Souveränitätsfigur die Geschicke des Gemeinwesens
in die Hand nehmen könnte.22
Die zivilgesellschaftliche Sphäre bildet keine organische Ein-
heit, sie ist ein gespaltenes Kräftefeld. In einem demokratischen Gemeinwesen bildet die Zi-
vilgesellschaft insofern den Bezugspunkt des Politischen, als sich in ihr die Kräfte konstituie-
ren, die temporär den leeren Ort der souveränen Macht besetzen.
2) Radikale Konflikthaftigkeit
Mit Lefort ist der Konflikt als unauflösbares Phänomen anzusehen, das „mitten in das Zent-
rum des Rätsels des Politischen“ führt (Lefort/Gauchet 1990: 92). Lefort unterstreicht die ra-
dikale, unüberwindbare Konflikthaftigkeit sozialer Verhältnisse. Der Konflikt wird zum Dreh-
und Angelpunkt der Vergesellschaftung erhoben und seine produktive, gesellschaftsinstituie-
rende Kraft herausgestellt (vgl. Brodocz 2008: 232f). Für Lefort durchziehen soziale Konflik-
te die Zivilgesellschaft. Im Anschluss an das marxsche Axiom des Klassenkampfes bekräftigt
er, dass in der Gesellschaft unterschiedliche soziale Klassen oder, allgemeiner, soziale Kol-
lektive bestehen, die einander konflikthaft infrage stellen. Diese konflikthafte „Zerrissenheit
der Gesellschaft“ (Gauchet 1990: 208) gilt es ins Zentrum zu rücken.
Nach Lefort tritt die instituierende – und deinstituierende – Kraft des Konflikts dann
vollständig zutage, wenn dieser aus der Gesellschaft „heraustritt“ und auf der politischen
Bühne, auf der Ebene der Macht, erscheint. Dieser Austritt des Konflikts aus der Gesellschaft
und seine Einschreibung auf der politischen Bühne beinhaltet zwei zentrale Momente: Erstens
erlebt der Konflikt eine symbolische Aufladung.23
Er wird mit gewissen Bedeutungen versehen,
die ihm seine scheinbare gesellschaftliche Faktizität und Unmittelbarkeit nehmen. Mittels
22
Hier distanziere ich mich von der Lefort-Rezeption Rödels et al., die in Die demokratische Frage die Zivilgesell-
schaft tatsächlich als ein „autonomes und handlungsfähiges“ Kollektivsubjekt lesen (vgl. Rödel et al. 1989: 89). 23
Den Begriff des Symbolischen verwendet Lefort im Anschluss an Lacan und meint damit – im Unterschied
zum Realen und Imaginären – in klassisch (post-)strukturalistischer Manier die durch eine spezifische Signifi-
kantenordnung strukturierte zwischenmenschliche Realität (vgl. Laplanche/Pontalis 1972: 487f).
42
dieser symbolischen Aufladung transponiert der Konflikt die gesellschaftsimmanenten Kämp-
fe in ein anderes „Wirklichkeitsregister“, das performative Wirkungen entfaltet: Durch seine
symbolische Aufladung bildet er nicht nur reale, gesellschaftsinnere Auseinandersetzungen
ab, sondern verschiebt sie zugleich und verleiht ihnen eine andere Bedeutung. Mit der symbo-
lischen Aufladung des Konflikts geschieht seine politische Zähmung, was das soziale Band
vor dem Zerbrechen bewahrt und die offene Identität der Gesellschaft garantiert (vgl. Le-
fort/Gauchet 1990: 116f). Zweitens geschieht die Einschreibung des Konflikts auf der politi-
schen Bühne als eine partielle Veräußerlichung. Der Konflikt verliert seine gesellschaftliche
Immanenz und steht der Zivilgesellschaft als partiell äußerlicher Konflikt gegenüber. Aller-
dings liest Lefort die Absetzbewegung des Konflikts von der Zivilgesellschaft in die Politik
stets als Einschreibungsbewegung antagonistischer Kräfte in die politische Sphäre (vgl. Lefort
1990: 294). Diese Bewegung lädt die sozialen Kämpfe mit einem primär politischen Sinn auf.
3) Politische Aufladung
Vergleichbar zu Laclau und Mouffe geht Lefort davon aus, dass die soziale Ordnung moder-
ner und demokratischer Gemeinwesen grundsätzlich unbestimmt ist. Die demokratischen Re-
volutionen fördern die letztliche Unbestimmtheit der Zivilgesellschaft zutage. So vertritt auch
Lefort eine postfundamentalistische Position (vgl. Marchart 2010: 126f, Lefort 2007: 465f),
die wie Laclau und Mouffe die gesellschaftliche Unbestimmtheit mit dem Moment der politi-
schen Ordnungsbildung verbindet. Der Begriff des Politischen bei Lefort fokussiert zwar ana-
log zu Laclau und Mouffe die hervorbringenden Prinzipien des Gemeinwesens, er betont aber
stärker als die Hegemonietheorie, dass die politische Gründungsdimension eine spezifische
Strukturgebung sozialer Verhältnisse beinhaltet. Diese Strukturgebung kennzeichnet Lefort mit
der dreifachen Bestimmung des Politischen als Formgebung (mise en forme), Sinngebung (mise
en sens) und Inszenierung (mise en scène) (vgl. Lefort 1990: 284).24
Meint das Politische als
Formgebung (mis en forme) die primäre instituierende Dimension als solche, so fokussiert es
als Sinngebung (mise en sens) die Errichtung einer spezifischen Bedeutungswelt, die mit der
politischen Formung der Gesellschaft einhergeht. Für meine Zwecke besonders interessant ist
das Moment der Inszenierung (mise en scène). Lefort plädiert hier dafür, dass das Politische als
Inszenierungsweise ein quasi theatralisches Moment beinhaltet. Das Politische als Strukturge-
bung geht stets mit einem gewissen In-Szene-Setzen der Gesellschaft einher, durch das diese die
Dimension ihrer politischen Gründung nochmals repräsentiert.
24
Bei der Übersetzung dieser Begriffstrias entscheiden sich Scheulen, Cuvelier und Szánkay (vgl. 1999: 95) für die
emphatischeren, phänomenologisch besetzten Kategorien In-Form-Setzen, In-Sinn-Setzen und In-Szene-Setzen.
43
Die Selbstrepräsentation der Gesellschaft erfolgt dadurch, dass die hervorbringenden
Prinzipien des Politischen in bestimmten Institutionen und Bereichen eine feste Form anneh-
men. Es ist für Lefort vornehmlich – aber nicht ausschließlich – die „Politik“ als ein ein-
grenzbares soziales Feld,25
in dem die Selbst-Inszenierung der Gesellschaft geschieht. Indem
eine Verfassung in Kraft tritt, ein plurales Parteiensystem entsteht und periodisch Wahlen statt-
finden, die die gewählten Parlamentarier zur Responsivität zwingen, tritt etwa die politische
Inszenierung eines liberal-demokratischen Gemeinwesens zutage. Indem sich auf diese Weise
die Gesellschaft auf ein Set „geronnener“ Institutionen bezieht und sich durch diese gleichsam
selbst repräsentiert, hält sie ihre politische Gründungsdimension wach. Wesentlich ist folgen-
des: Das Moment der Inszenierung legt offen, dass die ontologische Kategorie des Politischen
stets mit einem Ensemble ontischer Institutionen einhergeht. Nach Lefort sind Institutionen
nicht nur das „sedimentierte“ Ergebnis der Formgebung der Gesellschaft, sondern auch die
Ausgangspunkte, durch die die politische Gründungsdimension immer wieder angestoßen
wird. Der gesellschaftliche Raum ist stets ein politischer Raum. Diese ontische Färbung des
Politischen erweitert seine rein ontologische Beschreibung bei Laclau und Mouffe: Das Mo-
ment der Inszenierung bei Lefort macht darauf aufmerksam, dass die politische Gründungs-
dimension institutionelle Ankerpunkte im gesellschaftlichen Raum aufweist. Doch diese An-
kerpunkte sind alles andere als unumstößlich: Laufend verändern sich die Wege, mittels derer
die Gesellschaft ihre Spaltungen und Konflikte „theatralisch“ zutage fördert.
Durch die Bestimmung des Politischen als Inszenierungsweise bindet Lefort die ontologi-
sche Gründungsdimension des Politischen also an ontische Institutionen zurück. Während, ge-
mäß der orthodoxen Lesart bei Laclau und Mouffe, die instituierten Formen des Sozialen nur
sedimentierte Effekte von Hegemonialwerdungen sind, können sie bei Lefort potentiell auch
zum Ausgangspunkt neuer politischer Gründungsversuche avancieren. Leforts Interesse gilt
daher in besonderem Maße den demokratischen Institutionen, da sie quasi in Reinform die insti-
tutionellen Repräsentationsinstanzen der letztlichen Körperlosigkeit und Spaltung des Gemein-
wesens sind. Mit diesen Institutionen entsteht eine politische Bühne: Durch sie stellt sich der
Konflikt „als notwendig, unreduzierbar und legitim“ dar, durch sie wird die „Gesellschaft an die
Erfahrung ihrer Instituierung“ zurückgebunden (Lefort 1999: 52f). Die Selbst-Repräsentation
der Zivilgesellschaft auf der politischen Bühne ist jedoch ein zweischneidiger Vorgang: Diese
Bühne versinnbildlicht einerseits die ontologische Unbestimmtheit und fungiert anderseits als
fester Rahmen, der diese Unbestimmtheit symbolisch überwindet und sie institutionell fixiert.
25
Gegen diese Einschränkung politischer Prozesse gegen ein strukturell eingrenzbares soziales Feld widersetzt
sich allerdings mein Ansatz, der die Zivilgesellschaft in ihrer Gänze als politischen Raum bestimmt (S. 101f).
44
II. Gramsci: Die Zivilgesellschaft als hegemoniales Kräftefeld
Im Vorhergehenden wurde eine selektive Lektüre einiger lefortscher Kategorien unternommen.
Obwohl sich Leforts republikanisches Zivilgesellschaftsverständnis in einem anderen Denkho-
rizont bewegt als mein diskurstheoretisches Konzept, so markieren gleichwohl seine Einsich-
ten bezüglich der Spaltung, Konflikthaftigkeit und politischen Aufladung der Zivilgesellschaft
zentrale Eckpunkte, die auch in meiner Umarbeitung des Zivilgesellschaftsbegriffes wirksam
bleiben. Ähnlich wie zuvor beim Traditionsbegriff Laclaus und Mouffes schließe ich überdies
in einigen Punkten eng an Lefort an: Seine ontische Erweiterung des Begriffes des Politischen
durch das Konzept der Inszenierung (mise en scène) und seine Rückbeziehung politischer Pro-
zesse an zivilgesellschaftliche Spaltungen und Konflikte bilden maßgebliche Anknüpfungs-
punkte für meine Konzeption von Zivilgesellschaft als politischem Raum (S. 100-104).
Anders als bei Lefort ist mein Anschluss an Gramscis Zivilgesellschaftskonzept weniger
selektiv und stärker systematisch ausgerichtet. Ich lanciere eine vergleichsweise enge Gramsci-
Lektüre, mit der ich die inhaltlichen Weichenstellungen meiner eigenen Analysestränge lege.
Im Folgenden orientiere ich mich an einer kulturalistischen Lesart Gramscis, wie sie seit
den 1970er Jahren im Geiste der Erneuerung marxistischer Theorie und Praxis vorgebracht
worden ist.26
Wenn ich Gramsci als Denker deute, der das kulturelle und ideologische Moment
ins Zentrum stellt, dann möchte ich damit nicht seine klassenreduktionischen und ökonomisti-
schen Züge leugnen, sondern sie in den Hintergrund stellen.27
Im Anschluss an die mittlerweile
etablierte Gramsci-Lektüre Stuart Halls, der Cultural Studies und der Hegemonietheorie Laclaus
und Mouffes möchte ich Gramsci als einen Denker betrachten, der die Zivilgesellschaft als eine
kulturelle Sphäre in den Fokus rückt, „die die gesellschaftlichen Verhaltens- und Lebensweisen
der Menschen reguliert“ (Gosewinkel/Reichardt 2004: 5). Der sittliche und normative Zusam-
menhalt, der sich in dieser Sphäre bildet, resultiert aus der kulturellen Vorrangstellung bestimm-
ter gesellschaftlicher Kollektive. Die kulturellen Gehalte der Zivilgesellschaft sind stets poli-
tisch aufgeladen. Sie bilden nach Gramsci ein politisches Regime, eine subtile Form der hege-
monialen „Regierung“ (Gramsci 2012: 1853). Denn das „kulturelle Klima“ und der „spontane
Konsens“ (ebd.: 1335), die sich in der Zivilgesellschaft bilden und für ihren Zusammenhalt sor-
gen, sind nicht schlicht gegeben, sondern ein Ausdruck hegemonialer Herrschaft.
26
Wobei dazu bemerkt werden muss, dass Gramscis Schriften alles andere als ein geschlossenes Theoriegebäude
darstellen: Gramscianische Konzepte lassen sich auf vielfache und oft widersprüchliche Weise für die ver-
schiedensten theoretischen und politischen Ziele instrumentalisieren (vgl. Davidson 2008, Borstel 2008: 24f). 27
Es versteht sich, dass eine kulturalistische Lesart Gramscis aus marxistischer Warte frontal in Frage gestellt wird.
Dazu exemplarisch die materialistische Gramsci-Lektüre Andersons (1976) oder die Kritik Theborns (2007: 81).
45
1) Die Zivilgesellschaft als kulturelle Sphäre
Bevor ich näher erläutere, wie die politische Aufladung der Zivilgesellschaft bei Gramsci zu
verstehen ist, plausibilisiere ich auf einer generellen Ebene die Behauptung, dass er die Zivilge-
sellschaft als eine kulturelle Sphäre liest. Wenn Gramsci über die Zivilgesellschaft als einem
Bereich spricht, der methodisch von der Ökonomie und dem Staat unterschieden werden muss
(vgl. Gramsci 2012: 499), dann scheint dies erst einmal ein sozialstrukturelles Verständnis der
Zivilgesellschaftskategorie nahezulegen. Die Zivilgesellschaft könnte dann bei Gramsci ange-
lehnt an Hegels Begriff der bürgerlichen Gesellschaft als vorstaatliche Sphäre gedeutet wer-
den, die sich durch private Institutionen wie Vereinen, Schulen, Korporationen, der Kirche,
usw. auszeichnet (vgl. etwa Rangeon 1986). Die Zivilgesellschaft würde dadurch zu einem
sozialstrukturell klar abgrenzbaren Bereich, der sich vom Staat einerseits und von der Öko-
nomie andererseits abheben würde: Weder fiele sie mit materiellen Reproduktionsabläufen
(Ökonomie) noch mit politischen Steuerungsaufgaben (Staat) zusammen.
Zwar hat diese Deutungslinie des Zivilgesellschaftsbegriffes augenscheinlich durchaus
Anhaltspunkte in Gramscis Gefängnisheften, etwa wenn er die Zivilgesellschaft als Ensemble
der „gemeinhin als privat genannten Organismen“ begreift (Gramsci 2012: 1502) oder er den
hegelschen Einfluss auf seine Zivilgesellschaftskonzeption bekräftigt (vgl. ebd.: 118, 729).
Was diese sozialstrukturelle Lektüre jedoch grundsätzlich verkennt, ist das grundlegende Ver-
ständnis dafür, dass Gramsci gerade der marxistische Denker ist, der die Kraft und Autonomie
der kulturellen und ideologischen Superstrukturen ins Zentrum stellt.28
Nach Bobbios klassi-
scher Interpretation (vgl. Bobbio 1988: 88-93) führt Gramscis Zivilgesellschaftsverständnis
zwei Umkehrungen der klassischen marxistischen Axiome aus. Erstens grenzt er sich vom star-
ren Ökonomismus des Marxismus ab, der das Verhältnis von ökonomischer Basis zu kulturel-
lem Überbau kausaldeterministisch konzipiert: Jede Schwankung der ökonomischen Struktur
verursacht hier unmittelbar superstrukturelle Veränderungen.29
Zweitens weist Gramsci inner-
halb der Superstruktur dem ideologischen Faktor die Vorrangstellung gegenüber dem institutio-
nellen zu. Gibt die erste Umkehrung dem Überbau das Primat vor der ökonomischen Basis, so
verschiebt die zweite innerhalb des Überbaus den Schwerpunkt vom Staatsapparat hin zum ide-
ologischen Moment. Mit diesen Dezentrierungen schafft sich Gramsci den konzeptuellen Frei-
raum, um der Zivilgesellschaft eine gesellschaftstheoretische Schlüsselstellung zuzuweisen:
28
Mit der Umkehrung des Verhältnisses von Struktur und Superstruktur leitet Gramsci in gewissem Sinne einen
cultural turn in der marxistischen Theoriebildung ein (vgl. Stäheli 2010). 29
Etwa wenn die bürgerliche Produktionsweise eine ihr entsprechende Philosophie wie den Utilitarismus „kreiert“.
46
„between necessity and freedom, which corresponds to the dichotomy between base and super-
structure; and between force and consent, which corresponds to the dichotomy between institutions
and ideologies“ (Bobbio 1988: 89)
Wie Bobbio darstellt, herrschen in der Zivilgesellschaft Freiheit und Konsens vor, womit sie
sich einerseits von der bedürfnisgebundenen Ökonomie und andererseits von dem durch Zwang
geprägten Staat abhebt. Diese beiden Umkehrungen, die Gramsci gegenüber Marx vornimmt
(Basis Superstruktur; institutionelle Superstruktur ideologische Superstruktur) sind in
ihrer Bedeutung kaum zu überschätzen. Sie ebnen den Weg für eine starke Lektüre des kulturel-
len Moments bei Gramsci. Ist die Zivilgesellschaft eine „freie“ Sphäre, die keine institutionelle,
sondern eine ideologische Verfasstheit aufweist, dann folgt daraus, dass der zivilgesellschaftli-
che Raum keine a priori vorgegebene Struktur hat. Stattdessen ist die Zivilgesellschaft ein
„ethisch-politischer Raum“ (vgl. Laclau 2000a: 50). Ethisch-politisch deshalb, weil die einzige
Substanz der Zivilgesellschaft aus ethischen oder, mit Hegel, „sittlichen“ Gehalten besteht.
Dieser ethische bzw. sittliche Inhalt resultiert aber nicht aus einem mit sich versöhnten Ge-
meinwesen, sondern drückt die partikulare und machtgeladene Hegemonie eines bestimmten
Kollektivs aus (vgl. Golding 1992: 78ff). Gramsci pointiert dies wie folgt: „die Ethik bezieht
sich auf die Aktivität der Zivilgesellschaft, auf die Hegemonie“ (Gramsci 2012: 1310).30
Die Konzeption der Zivilgesellschaft als einer Superstruktur, die „nur“ durch Ideologie
strukturiert wird, könnte dazu verleiten, dem zivilgesellschaftlichen Raum eine grundsätzliche
Fluidität oder gar Strukturlosigkeit zu unterstellen. Dieser Annahme hält Gramsci seine be-
rühmte militärische Metapher von der Zivilgesellschaft als einem ausgedehnten Verteidigungs-
system entgegen, womit er die Komplexität und Widerstandsfähigkeit dieser kulturellen Sphäre
unterstreicht. Analog zu den Verteidigungslinien des ersten Weltkrieges an den westlichen
Kriegsschauplätzen – man denke an die französische Maginotlinie – vergleicht Gramsci die
Zivilgesellschaft mit einer widerständigen „Kette von Festungen und Kasematten“ (Gramsci
2012: 874).31
Dieses ausgedehnte System von Schützengräben hält auch dann noch stand,
wenn es schwere Wirtschafts- oder Staatskrisen erschüttern: „beim Wanken des Staates ge-
wahrte man sogleich eine robuste Struktur der Zivilgesellschaft (ebd., auch 868). Doch woher
rührt die Komplexität und Widerstandsfähigkeit der Zivilgesellschaft? Welche Kraft macht
diese „freie“, „nichtinstitutionelle“ und bloß ideologische Superstruktur zu einem robusten
System der Schützengräben, das ökonomischen und politischen Krisen widersteht?
30
Nach Gramsci gibt es zwischen der in der Zivilgesellschaft angesiedelten, „ethisch-politischen“ Praxis und der in
der ökonomischen Basis verhafteten Tätigkeit einen „kathartischen“ Bruch: Die ethisch-politische Tätigkeit hat ge-
genüber der ökonomischen weit höhere Grade an Selbstständigkeit und Eigeninitiative (vgl. Gramsci 2012: 1259). 31
Siehe die Ausführungen von Anderson (1976: 8f) zur historischen Einbettung der Schützengräbenmetapher
und ihrer Verbindung mit dem berühmten Begriffspaar „Bewegungskrieg“ und „Stellungskrieg“.
47
2) Organische Ideologie
Die Kraft, die nach Gramsci für die Vielschichtigkeit und Robustheit der Zivilgesellschaft
sorgt, ist keine andere als die des ideologischen und kulturellen Moments selbst. Kultur und
Ideologie, die bisher lose synonym verwendet wurden, stehen bei Gramsci tatsächlich für ein
und dasselbe Phänomen. Er verbindet gezielt die Ideologie- und die Kulturkonzeption und lässt
ihre jeweiligen Bedeutungen ineinander übergehen: Einerseits bezeichnet der Ideologiebegriff
in der marxistischen Tradition ja herkömmlicherweise ein „falsches“ Bewusstsein, das die ge-
samtgesellschaftliche Vormachtstellung einer partikularen Gruppe ausdrückt (vgl. etwa Tell-
mann 2008: 111). Andererseits steht der Kulturbegriff in der tradierten alltagssprachlichen und
theoretischen Verwendung für unpolitische Lebensformen, Weltanschauungen und inkorporier-
te Praktiken, die das Gesellschaftsleben friedlich durchziehen, es von „innen“ prägen und als
Traditionen von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden (vgl. etwa Hall 1980: 63).
Gramsci bemüht sich nun darum, diese beiden idealtypischen Bedeutungslinien von Ideo-
logie und Kultur zusammenzudenken und sie als Teile ein und desselben Phänomens zu deuten.
Nach Gramsci kann eine Ideologie nur bestehen, wenn sie gesellschaftlich angeeignet wird und
zu einer gelebten Kultur avanciert. Und auch Kultur ist nicht nur ein Ensemble gegebener Prak-
tiken, Rituale oder Traditionen, sondern beinhaltet stets ideologische Gehalte. Diese sorgen für
die soziale Ausbreitung kultureller Formen. Die Verklammerung des Kulturellen und des Ideo-
logischen bringt der Begriff der „organischen Ideologie“ auf den Punkt (Gramsci 2012: 876,
auch Mouffe 1979: 186f). Ideologie wird in dieser Verwendung zu einer umfassenden Welt-
auffassung, „die sich implizit in der Kunst, im Recht, in der ökonomischen Aktivität, in allen
individuellen und kollektiven Lebensäußerungen manifestiert“ (Gramsci 2012: 1380). Spricht
Gramsci über Ideologie, dann stets in diesem organischen Sinn. Ihr Organisch-Werden be-
schreibt, wie sich eine partikulare Ideologie im Gesellschaftsleben ausbreitet. Die Ideologie
avanciert zur allgemeinen Welt- und Lebensauffassung, zum „Volksglauben“ (ebd.: 876). Die
organische Ideologie wird zum „innersten Zement“ der Zivilgesellschaft (ebd.: 1313). Sie ist die
Kraft, die die Zivilgesellschaft zusammenhält und ihre kulturelle Robustheit sicherstellt.
Um den Schlüsselbegriff der organischen Ideologie präziser zu lesen und seine Dyna-
miken zu entschlüsseln, tätige ich im Folgenden einen konzeptuellen Dreischritt. Zunächst
fokussiere ich unter dem Stichwort des senso comune (Alltagsverstand) die Diffusion und
Verhärtung organischer Ideologien in der Gesellschaft, dann betrachte ich die kulturellen In-
stitutionen (Presse, Kirche, Schule, etc.), die als „ideologische Struktur“ fungieren, schließlich
gehe ich auf die entpolitisierte Artikulationsfunktion der Intellektuellen ein.
48
a) Kultureller Ausdruck: Alltagsverstand (senso comune)
Der Begriff des Alltagsverstandes (senso comune) gehört wohl deshalb zu den berühmtesten
Kategorien Gramscis, weil er die Verbindungslinien zwischen dem Kulturellen und dem Ideo-
logisch-Politischen besonders deutlich zutage fördert (vgl. Kebir 1986: 74f, Marchart 2008:
80). Der Alltagsverstand steht dabei für die kulturelle Schlagseite organischer Ideologien. Er
beschreibt, wie sich Ideologien in inkorporierte Praktiken und Anschauungsweisen verkör-
pern. Die Fragen darüber, welche Belletristik vorherrscht, welche Brauchtümer den populären
Klassen aneignen oder welche Märchen besonders verbreitet sind (vgl. Gramsci 2012: 823),
führen ins Herz der organischen Wirkungsweise der Ideologie. Allerdings versteht Gramsci
die Diffusion und „Verhärtung“ der Ideologie zum Alltagsverstand, d.h. zu kulturellen Le-
bensformen und Anschauungsweisen nicht als monolithische Einschreibung, sondern als kom-
plexen und widersprüchlichen Ablagerungsprozess. Wie Gramsci festhält, kommt der All-
tagsverstand keineswegs einer homogenen und ausbuchstabierten Ideologie gleich:
„Der Alltagverstand ist keine einheitliche, in Raum und Zeit identische Auffassung: er ist die
„Folklore“ der Philosophie, und wie die Folklore bietet er sich in unzähligen Formen dar: sein
grundlegender Charakter ist es, eine auseinanderfallende, inkohärente, inkonsequente Weltauffas-
sung zu sein“ (Gramsci 2012: 1039)32
Folgt man dem Zitat, dann macht der Alltagsverstand die Stabilität und Dauerhaftigkeit der
Ideologie deutlich (vgl. Leggett 2013: 308). Er zeigt aber auch auf, dass sich Ideologien dis-
kontinuierlich und graduell in das soziale Terrain einschreiben. Wie Gramscis Zitat betont, ist
der Alltagsverstand eine „auseinanderfallende, inkohärente und inkonsequente Weltauffas-
sung“. Im Alltagsverstand lassen sich verschiedene historische Schichten unterscheiden, die
Gramsci – klar normativ33
– als „fossilisierte“ und „reaktionäre“ oder „schöpferische“ und
„fortschrittliche“ ideologische Ablagerungen deutet (Gramsci 2012: 2216f). Sein prominentes
Beispiel für die historische Gerinnung einer Ideologie ist die Religion, und insbesondere der
Katholizismus. Aus Gramscis Sicht zeichnet sich das Italien seiner Zeit durch tiefe sozio-
politische Spannungen und kulturelle Ungleichzeitigkeiten aus. Während in Norditalien In-
dustrialisierung und gesellschaftliche Modernisierung um sich greifen, lebt der ländliche Sü-
32
Kebirs Interpretation zufolge (1986: 77f), zieht Gramsci eine bloß graduelle Unterscheidung zwischen der
Hochkultur und der Populärkultur. Ist die Philosophie am hochkulturellen Pol, so steht der Alltagsverstand am
populärkulturellen Ende („die Folklore der Philosophie“). Diese Unterscheidung zwischen dem Hoch- und dem
Populärkulturellen muss ihrerseits in ihrer ideologisch-politischen Dimension gelesen werden: Die Philosophie
steht für die ausformulierte und homogene Seite der Ideologie, der Alltagsverstand weist auf ihre Ablagerung
und Verbreitung in der Gesellschaft (vgl. Gramsci 2012: 528). In Abwandlung der marxschen Begriffe: Die
Philosophie fungiert als „ideeller“ Überbau der Ideologie, der Alltagsverstand gibt ihre „organische“ Basis ab. 33
Derartige Unterscheidungen offenbaren, dass Gramsci ein dezidiert politischer Denker war, der soziale Ver-
hältnisse strategisch im Hinblick auf sozialistisch-kommunistische Transformationsmöglichkeiten analysierte.
49
den, der sogenannte Mezzogiorno, weiter in einer fast feudalen Welt. Die Vormachtstellung
der katholischen Kirche spielt buchstäblich die Rolle einer „Volksreligion“ (ebd.: 2216), die
jedem ökonomischen und politischen Transformationsversuch widersteht. Kraft des täglichen
Kirchgangs, der regelmäßigen Beichte, religiös imprägnierten Aberglauben oder Märchener-
zählungen wird der Katholizismus zum „zähen“ Alltagsverstand (ebd.: 2216). Die gramsciani-
sche Pointe dieser ideologischen „Versteinerung“ lautet, dass der zum Alltagsverstand gewor-
dene religiöse Glaube auch nach dem Niedergang der katholischen Ideologie wirksam bleibt –
als politische Überzeugung, kulturelles Ritual oder tradierter Aberglaube (vgl. ebd.: 1408).
Trotz der kulturellen Verhärtung und Ablagerung von Ideologien wohnt dem senso
comune eine grundsätzliche Dynamik inne: „Der Alltagsverstand ist nichts Erstarrtes und Un-
bewegliches, sondern verändert sich fortwährend“ (ebd.: 2180). Beispielhaft hierfür ist
Gramscis Beschreibung der Entwicklung der fordistischen Produktionsweise in den Vereinigten
Staaten. Begünstigt durch das Fehlen traditionell-ständischer Ideologien entsteht hier ein spezi-
fisch moderner Alltagsverstand (vgl. ebd.: 133). Das Konzept des Alltagsverstandes ist folglich
bei Gramsci deskriptiv offen angelegt. Der senso comune kann sich aus den verschiedensten
ideologischen Formen zusammensetzen: traditionell und modern, konservativ und progressiv.
Ein letztes Moment, das beim Begriff des Alltagsverstandes wichtig ist, ist seine grund-
sätzliche Pluralität. Nach Gramsci ist der Alltagsverstand grundsätzlich vielfältig. Er ist inso-
fern stets widersprüchlich und fragmentarisch, als einerseits die Gesellschaft unterschiedlich
zusammengesetzte kulturelle Schichtungen aufweist (vgl. ebd.: 701) und andererseits jede
soziale Klasse ihren Alltagsverstand besitzt (vgl. Gramsci 2012: 2180). Der senso comune
eines Bauern oder eines Proletariers unterscheidet sich grundsätzlich von dem eines Priesters
oder eines Industriebourgeois. Es gibt nicht den einen Alltagsverstand, der sich gleichförmig
über die Gesellschaft ausbreiten würde. Unterscheiden sich die Schichten des Alltagsverstandes
somit kulturell nach ihrem Maß an Tradition (= Beharrung) oder Progressivität (= Dynamik), so
differieren sie überdies auch dadurch, unter welcher sozialen Klasse sie sich festsetzen. Ein und
dieselbe Ideologie kann vielleicht zum unumstößlichen Alltagsverstand einer Klasse werden,
während sie von einer anderen schnell wieder abgeworfen wird oder gar nicht erst fruchtet. Auf
diese Weise muss die grundsätzliche Pluralität und Geschichtlichkeit des Alltagsverstand (vgl.
ebd.: 1041) auch als ein entscheidender methodischer Leitsatz gelesen werden. Das Konzept des
senso comune fordert zur konkreten Analyse davon auf, wie „Ideen in bestimmten historischen
Situationen die Menschenmassen organisieren und das Terrain formen, auf dem die Menschen
in Bewegung geraten“ (Hall 1984: 116).
50
b) Materielle Struktur: kulturelle Institutionen
Der Begriff des Alltagsverstandes fokussierte die gesellschaftlichen Wirkungsweisen organi-
scher Ideologien und ihre kulturelle Verhärtung in eingespielten Praktiken, Anschauungswei-
sen und Weltauffassungen. Indes blieb die Frage offen, warum der Alltagsverstand eine derar-
tige Stabilität aufweisen kann. Was stellt den senso comune in seinen verschiedenen Ausfor-
mungen auf Dauer? Organische Ideologien schlagen sich im Alltagsverstand nieder (und
bringen ihn hervor), sie äußern sich aber auch über eine solide institutionelle Struktur. Letzte-
re wird von Gramsci definiert als „die materielle Organisation, die darauf gerichtet ist, die
theoretische oder ideologische ‚Front‘ zu bewahren, zu verteidigen und zu entfalten“
(Gramsci 2012: 373). Diese materielle Organisation muss im weitesten Sinne als ein Gefüge
kultureller Institutionen verstanden werden, das von der Presse über Bibliotheken, Schulen,
Vereine, Debattierzirkel, Klubs und Salons bis hin zum Kirchwesen reicht (vgl. ebd.: 374).34
Die derart konkrete, institutionelle Organisation der Ideologie macht kenntlich, warum
Gramscis Zivilgesellschaftskonzept zuweilen sozialstrukturell missverstanden wird (s.o.). Die
„privaten“ zivilgesellschaftlichen Institutionen stehen in dem Maße in Gramscis Fokus, als sie
das materiell-institutionalisierte Gefüge bilden, durch welches Ideologien auf Dauer gestellt
werden. Wenn man so will, geben die Presse, Schule, Kirche, etc. das institutionelle Skelett
der Ideologie ab. Diese Institutionen sind insofern buchstäblich „kulturelle Organisationen“
(Gramsci 2012: 1392), als sie als Stabilisatoren und Reproduktionsvehikel der Ideologie fun-
gieren. Dass etwa im Italien des frühen 20. Jahrhunderts die Ideologie des Katholizismus eine
derartige Verbreitung findet, hängt nach Gramsci eben auch damit zusammen, dass sie ein
enormes Ensemble von Organisationen geschaffen oder okkupiert hat, durch das sie sich be-
sonders wirksam in den Alltagsverstand der populären Klassen einschreibt. Die katholische
Erziehung in der Volkshochschule, die Existenz einer Kirche in jedem Dorf oder die religiöse
Prägung der Spitäler (vgl. ebd.: 854) sind allesamt institutionelle Apparate, die der hegemoni-
alen Führungsfunktion des Katholizismus dienen und sie auf Dauer stellen. Kulturelle Institu-
tionen fungieren als Gradmesser des Verbreitungsgrades spezifischer Ideologien. Sie geben
das institutionelle „Terrain“ ab, auf dem sich die kulturell-ideologische Tätigkeit entfaltet
(vgl. ebd.: 897).
Begreift man im gramscianischen Sinne Institutionen als ideologisches Terrain, dann
wird deutlich, dass die Hervorbringung und Entwicklung von Organisationen immer im Kon-
34
Zudem rechnet Gramsci dieser materiellen Organisation der Ideologie auch die Gestaltung des urbanen Rau-
mes zu: „die städtische Architektur, die Anlage der Straßen und die Namen derselben“ (vgl. ebd.: 374).
51
text spezifischer Ideologien geschieht. Sind Institutionen allerdings einmal ins Leben ge-
bracht, dann werden sie zu einem Kampffeld, um deren Besetzung verschiedenste Ideologien
ringen. So zeichnet Gramsci nach, wie im Bildungswesen innerhalb der verschiedenen Schul-
und Universitätstypen zwei Weltanschauungen rivalisieren: die bürgerlich-moderne einerseits
und der Katholizismus andererseits (vgl. ebd.: 535). Dem gleichen Zweck dienen die Typolo-
gien, die er von Zeitschriften nach ihren jeweiligen inhaltlichen Ausrichtungen erstellt (vgl.
ebd.: 86, 162f, 2172) oder sein Plädoyer, die institutionellen Formen zu studieren, die durch
neue ideologische Konstellationen entstehen – etwa die jakobinischen Klubs der französischen
Revolution (vgl. ebd.: 118). Die Beispiele zeigen auf, dass für Gramsci die Analyse der Ideolo-
gie stets eine wichtige institutionelle Dimension beinhaltet (vgl. Buttigieg 2002: 444). Um zu
verstehen, wie Ideologien zu gelebten und breitenwirksamen Kulturen werden, bedarf es der
Auseinandersetzung mit den ihnen zugehörigen Organisationen und Institutionen.
Der organische Status der Ideologie erklärt sich gerade durch das Zusammenwirken
zwischen ihrer kultureller Ausdrucksweise im Alltagsverstand und ihrer materiellen Verhär-
tung in Institutionen. Einerseits werden die unter dem Begriff des senso comune subsumierten
Praktiken, popularen Anschauungsweisen und unsystematischen Weltanschauungen durch das
Wirken von Organisationen wie Schulen, Zeitungen, Bibliotheken, dem Kirchwesen, etc. her-
vorgebracht. Der institutionelle Apparat der Ideologie gewährleistet, dass sich Ideologien wirk-
mächtig in den Alltag einschreiben. Durch den langjährigen Schulbesuch, den regelmäßigen
Kirchgang oder die geflissentliche Zeitungslektüre entfaltet sich die, poststrukturalistisch gespro-
chen, subjektivierende Kraft der Ideologie.35
Anderseits lehnt sich die Ideologieproduktion von
Institutionen an die etablierten kulturellen Formen an, die die Ideologie als Alltagsverstand ange-
nommen hat. So orientieren sich Zeitungen, Zeitschriften oder Fortsetzungsromane an den Ge-
schmäckern ihres Publikums und verstärken dadurch gewisse Ausformungen des Alltagsverstan-
des vor anderen (vgl. Gramsci 2012: 136). Die reproduzierende und stabilisierende Funktion der
Organisationen äußert sich mithin dadurch, dass sie sich an den Gemeinplätzen des senso co-
mune anlehnt und diese kontinuierlich hervorbringt. Das Zusammenwirken zwischen Alltags-
verstand und kulturellen Institutionen ist ein dynamischer Prozess. Wenn Journalisten Artikel
verfassen, Priester in ihren Dorfgemeinden regelmäßig Messen abhalten, Lehrer ihre Schüler
erziehen oder Parteikader ihre politisierende Tätigkeit entfalten, dann sind sie nicht nur Sinnbil-
der für die Anpassungsfähigkeit der Ideologie, sondern auch für ihre artikulierende Kraft.
35
Mouffe hebt hervor, dass Gramsci bereits eine „protostrukturalistische“ Position einnimmt, die Althusser dann
entfaltet (vgl. ebd.: 199). Gramsci liest das Bewusstsein des Einzelnen als Effekt eines „system of ideological
relations into which the individual is inserted. Thus it is ideology which creates subjects” (Mouffe 1979: 187).
52
c) Artikulierende Kraft: die Intellektuellen
Gramsci bedient sich eines weiten Verständnisses von Intellektuellen. Er definiert sie als jene
spezifische Schicht, „die auf die begriffliche und philosophische Ausarbeitung spezialisiert
[ist]“ (Gramsci 2012: 1385). Der Kategorie der Intellektuellen wird damit eine strikt politisch-
strategische Deutung verliehen. All jene Menschen, die organisierende Funktionen ausüben,
müssen als Intellektuelle gelten (vgl. ebd.: 1975). Mit diesem weiten Intellektuellenbegriff – der
neben Lehrern, Geistlichen oder Universitätsprofessoren auch Techniker, Ökonomen, Beamte,
Partei- und Gewerkschaftskader oder gehobene Militärränge umfasst – betont Gramsci, dass die
organisierende Kraft der Ideologie bis in die kleinsten Verästelungen der Gesellschaft hinein-
reicht. Die intellektuelle Tätigkeit fungiert als aktive Ideologieproduktion. Zum einen arbeitet
die intellektuelle Tätigkeit durch die organisationale Struktur von Presse, Schulen, Kirchen, etc.
Die kulturellen Organisationen bilden die Plattform, von der aus die intellektuelle Tätigkeit ide-
ologische Gehalte ausformuliert, homogenisiert und verbreitet. Zum anderen ist es gerade die
intellektuelle Tätigkeit, die sich aktiv an den Alltagsverstand anpasst, auf ihn einwirkt und ihn
auf spezifische Weise entfaltet. Die intellektuelle Tätigkeit ist die artikulierende Kraft der
Ideologie (vgl. Anderson 1976: 20, Laclau 2000a: 50).
Es sind die Intellektuellen, die die konsensuale Herrschaft bestimmter Ideologien gegen
andere sicherstellen und sie gesellschaftlich verbreiten. An Gramscis Beschreibung der hege-
monialen Führungsfunktion der Intellektuellen ist für meine Zwecke besonders interessant, dass
sie sich auf gleichsam entpolitisierte Art und Weise vollzieht.36
Die Einbindung oder, pointiert,
die subalterne Entmündigung der Bauernschaft geschieht mittels eines integralen Assimilati-
onsprozesses, in dem die „berufliche“ Vermittlung (des Notars, Rechtsanwaltes, Arztes, etc.)
nicht von seiner politisch-ideologischen Einwirkung zu trennen ist (vgl. Gramsci 2012: 516,
bereits Gramsci 1986: 205). In diesem Sinne sind wirksame traditionelle Intellektuelle immer
auch organische Intellektuelle.37
Sie erfüllen (so der Priester, der Lehrer oder der Polizist) eine
organische Funktion insofern, als sie die populären Klassen kontinuierlich in spezifische Ideo-
logien einbinden, organisch auf ihren Alltagsverstand einwirken und Institutionen kreieren, in
denen sich diese ideologischen Systeme institutionalisieren und reproduzieren (vgl. ebd.: 1390,
auch Holz 1982: 22). Nach Gramsci gleicht die intellektuelle Führungsfunktion einer „Politik
des Kulturellen“ (ebd.: 1391). Sie wirkt auf scheinbar vorpolitische Sinnhorizonte und Lebens-
welten ein und bringt in ihrem Ergebnis „kompakte“ historische Blöcke hervor (ebd.: 1084).
36
Mein Konzept der „befriedeten“ Artikulationsweise von Diskursen setzt genau an dieser Stelle an (S. 63-67). 37
Zur Unterscheidung von traditionellen und organischen Intellektuellen vgl. besonders Gramsci 2012: 513-524.
53
3) Historische Blöcke
Die Kategorie des historischen Blockes gehört zu den prominentesten Begriffen Gramscis. Es
wurde bereits dargestellt, wie Laclau und Mouffe diesen Begriff lesen und ihn einer diskurs-
theoretischen Überarbeitung unterziehen, die den Begriff des historischen Blockes als hegemo-
niale Formation bzw. hegemoniales Projekt neu konzipiert (S. 20-23). An dieser Stelle sei nur
daran erinnert, dass für Gramsci historische Blöcke der Kulminationspunkt hegemonialer Ver-
hältnisse sind. Gelingt es politischen Kräften, einen übergreifenden Kollektivwillen zu bilden,
der eine Vielzahl verschiedener Einzelinteressen verschweißt, dann formieren sich historische
Blöcke, die das soziale Terrain tiefgreifend umgestalten. Auf den vorherigen Seiten wurde „im
Schritt zurück“ zu Gramsci der Dreh- und Angelpunkt hegemonialer Prozesse in der Zivilge-
sellschaft angesiedelt, die der italienische Marxist als eine kulturell-ideologische Superstruktur
liest. In ihrem Rahmen formieren sich organische Ideologien, in ihr lokalisiert sich der Alltags-
verstand (der kulturelle „Ausdruck“ der Ideologie), in ihr kristallisiert sich ein Gefüge kultu-
reller Organisationen (die ideologische „Struktur“). Die Begriffstrias organische Ideologie,
Alltagsverstand und kulturelle Organisation bildet die grundlegende Struktur hegemonialer
Prozesse, deren Movens in der artikulierenden Kraft der Intellektuellen besteht.
Wenn es Ideologien gelingt, sich durch die artikulierende Kraft der Intellektuelle im
populären Alltagsverstand immer weiter festzusetzen und eine Vielzahl von kulturellen Orga-
nisationen besetzt zu halten, dann avancieren sie zu einer gelebten Kultur oder, wie Gramsci
bekräftigt, zu einem „gemeinsamen Leben“ (Gramsci 2012: 490). Im Zuge des „Organisch-
Werdens“ der Ideologie bildet sich dann, gewissermaßen als Kulmination, der historische
Block. Die Konzeption des historischen Blockes, die Gramsci Sorel entnimmt,38
erweitert den
Begriff der organischen Ideologie, indem sie beschreibt, wie eine kulturell-ideologische Forma-
tion zu einer umfassenden sozialen Totalität wird (vgl. Golding 1992: 120). Zwar ist die He-
gemonie, d.h. Herrschaft durch Konsens, eine kulturelle Machtform, die ihren zentralen Dreh-
und Angelpunkt in der Zivilgesellschaft hat. Die kulturelle Vormachtstellung einer Ideologie
zeitigt jedoch Effekte, die über die zivilgesellschaftliche Sphäre im engen Sinne hinausrei-
chen und sich über das gesamte soziale Terrain ausdehnen.
Hat also die Bewegung der Hegemonie ihren Dreh- und Angelpunkt in der ideologischen
Superstruktur der Zivilgesellschaft, so gehen ihre Effekte über sie hinaus und schreiben sich in
38
Sorel gebraucht noch nicht den Begriff des historischen Blockes, sondern den des Mythos als einem „System von
Bildern“, das in „Großereignissen“ (Revolution, Generalstreik, etc.) auftaucht. Nach Sorel darf man diese Mythen
nicht in Einzelteile zerlegen, sondern sie als „historische Kräfte im Block nehmen“ (Sorel 2012: A 224).
54
die beiden anderen sozialen Bereiche ein, die für Gramsci wichtig sind, die ökonomische Struk-
tur und der staatliche Zwangsapparat (vgl. Bobbio 1988: 94). Gerade in Bezug auf die ökono-
mische Basis betont Gramsci wiederholt, dass durch einen historischen Block ideologische Su-
perstruktur und ökonomische Struktur zur Einheit werden (vgl. Gramsci 2012: 1045, 1547). Im
historischen Block werden „sozio-ökonomischer Inhalt“ und „ethisch-politische Form“ mitei-
nander „konkret identisch“ (ebd.: 1251). Ich möchte nur diesen einen Gedankenstrang ins Zent-
rum stellen, ohne auf seine immanenten Verästelungen, Widersprüche und Aporien einzuge-
hen:39
Historische Blöcke sind Machtkonfigurationen, die verschiedenste soziale Sphären struk-
turieren und soziale Totalitäten hervorbringen. Indem Ideologien organisch werden und sich zu
Blöcken ausweiten, werden sie zu Gesellschaftsformationen.40
Die Kategorie des historischen
Blockes deutet damit auf eine radikalisierte Konzeption von sozialer Totalität, die in der kultu-
rellen Machtform der Hegemonie ihre grundlegende Achse findet.
Mit dem Begriff des historischen Blockes ist die immanente Darstellung jener Konzepte
Gramscis komplettiert, an die meine Argumentationslinien im nächsten Kapitel anschließen
werden. Die Ausführungen zu den gramscianischen Begrifflichkeiten gipfeln bewusst im Be-
griff des historischen Blockes. Laclau und Mouffe greifen dieses Konzept auf und deuten es
als hegemoniale Formation bzw. hegemoniales Projekt um. Auch ich werde an die Kategorie
des historischen Blockes anschließen, ihr aber gegenüber Laclau und Mouffe eine umfassen-
dere Akzentuierung geben. Ich möchte den Begriff des historischen Blockes nicht nur als ein
spezifisches hegemoniales Projekt definieren, sondern als umfassende Machtkonfiguration,
die als Effekt von Hegemonialwerdungen entsteht. Die derart als Ergebnis hegemonialer Arti-
kulationen hervorgegangene soziale Totalität konzipiere ich in Abgrenzung zur Hegemoniethe-
orie nicht als fixierte, träge und sedimentierte Gesellschaft (S. 31f), sondern als einen historisch
konstituierten und dynamischen politischen Raum. Zielt der Rekurs auf Lefort entlang der Mo-
tive Spaltung, Konflikthaftigkeit und politische Aufladung darauf, die politische Verfasstheit
dieses Raumes hervorzuheben, so legt Gramscis Zivilgesellschaftsverständnis die Weichen-
stellung für seine Grundkategorien: Die gramscianischen Begriffe organische Ideologie, All-
tagsverstand und kulturelle Institution dienen mir als Leitlinien, von denen ausgehend ich im
folgenden dritten Kapitel meine eigenen Konzepte entwerfe.
39
Siehe zum ökonomistischen Reduktionismus, zu dem Gramscis Begriff des historischen Blocks letztlich ten-
diert, die Ausführungen von Golding 1992: 102-122. 40
Im Aufsatz Zur Frage des Südens präsentiert Gramsci eine frühe Konzeption historischer Blöcke, die bereits
zentrale Facetten seiner Ausarbeitung enthält. Nach Gramsci gelingt es dem süditalienischen Agrarblock, im
Mezzogiorno quasi mittelalterliche Zustände zu stabilisieren (vgl. Gramsci 1986: 209) und jeden ideologisch-
politischen, staatlichen oder ökonomischen Transformationsversuch wirksam abzuwehren.
55
Exkurs: Zwischen normativer Aufladung und peripherer Stellung –
zum Stand der Debatte um den Begriff der Zivilgesellschaft
Der folgende Überblick über den aktuellen Debattenstand um den Begriff der Zivilgesell-
schaft fungiert als negative Kontrastfolie, vor deren Hintergrund ich im nächsten Kapitel mei-
ne Zivilgesellschaftskonzeption entwickle. In den derzeitigen sozialtheoretischen Diskussio-
nen nimmt diese Kategorie eine Randstellung ein. Die wichtigsten Theoriestränge, bei denen in
der Vergangenheit diese Kategorie eine Rolle spielte, haben inzwischen die Bemühungen, das
Konzept der Zivilgesellschaft als gesellschaftstheoretischen Schlüsselbegriff zu profilieren –
sei es explizit, sei es implizit – aufgegeben. Wenn heute die Zivilgesellschaftskategorie einge-
setzt wird, dann als normativer Kampfbegriff ohne tiefergehenden deskriptiven Gehalt.
Diese grundlegende Diagnose, die ich gleich ausführen werde, manifestiert sich auf ana-
loge Weise in der öffentlichen Debatte. Auch 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhanges
wohnt der Rede von Zivilgesellschaft noch jener Impetus von Demokratisierung, Rechtsstaat-
lichkeit und sozio-ökonomischer Liberalisierung inne, der ihr in den Transformationsprozessen
der ehemaligen Ostblockstaaten aneignete. Die einstige Civil-Society-Debatte mag weitestge-
hend abgeflaut sein (vgl. als Überblick Klein 2001: 2ff), sie hat aber dennoch dem zurzeit
dominierenden Zivilgesellschaftsverständnis seine Grundbedeutung eingeprägt: Die Zivilge-
sellschaft steht für den Bereich des sowohl macht- und herrschaftsfreien als auch sittlich inte-
grierten Verkehrs aller Gesellschaftsmitglieder, sie erscheint als wahrlich zivile Gesellschaft.
So avanciert die Zivilgesellschaft zur „weichen“ Ergänzung von liberaler Repräsentativdemo-
kratie, Rechtsstaatlichkeit und freiem Markt. Die Zivilgesellschaft wird zum Bereich jenseits
von Staatlichkeit und Ökonomie, die gleich einem „unsichtbaren Kitt“ die Entwicklung der an-
deren Sphären von selbst befördern soll. Denn anders als die „festen“ politischen und ökonomi-
schen Institutionen lässt sich das polyzentrische Netz von Vereinen, Nichtregierungsorganisati-
onen, Stiftungen, sozialen Bewegungen und sonstigen zivilen Akteuren nicht einfach herstellen,
sondern nur hoffen oder höchstens gemahnen, dass es entstehe oder sich entwickle.41
In den gegenwärtigen Debatten wird damit die Zivilgesellschaft zu einem höchst flexibel
einsetzbaren Begriff. In Abwandlung von Anthony Giddens (2000: 336) kann man festhalten,
41
So etwa, wenn der Bundespräsident eine „mutige“ Zivilgesellschaft „aktiver und eigenverantwortlicher Bür-
ger“ fordert, um dem Rechtsradikalismus Paroli zu bieten (Gauck 2012), die Kanzlerin gegenüber Putin betont,
dass Russland eine „aktive Zivilgesellschaft“ brauche (Merkel 2013) oder – und parallel zur Position von Gid-
dens (s.u.) – die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton neben einer kompetenten „governance“ und
einem ausgeprägten „private sector“ die Zivilgesellschaft als dritten Angelpunkt einer fortschrittlichen und zu-
kunftsfähigen Demokratien konturiert („they work like three legs of a stool“) (Clinton 2010).
56
dass in gegenwärtigen Öffentlichkeitsdebatten die Zivilgesellschaft das schwächste und am
schwersten fassbare Glied der drei Säulen einer „guten Gesellschaft“ ist: Eine „starke“ – aller-
dings nicht zu starke – Zivilgesellschaft ist wenig mehr als das soziale Bindemittel, das das
reibungslose Funktionieren einer „guten aktiven Regierung“ und einer „anständigen Markt-
wirtschaft“ sicherstellt. In foucaultschen Termini wird die Zivilgesellschaft zur unsichtbaren
dritten Säule moderner Gouvernementalität. Sie grenzt die Expansion von Staat und Markt-
wirtschaft ein und sorgt dadurch für ein ausbalanciertes, wohlgeordnetes Gemeinwesen (vgl.
Bröckling 2004: 61). In diesem Sinne kann man den öffentlichen Gebrauch des Zivilgesell-
schaftsbegriffes diagnostisch wie folgt zusammenzufassen: Wenn liberal-demokratische Insti-
tutionen und marktwirtschaftliche Mechanismen „funktionieren“, dann taucht er höchstens in
feierlichen Sonntagsreden auf. Stehen sie aber in Frage,42
dann wird wohlfeil an die Bedeu-
tung der Zivilgesellschaft für ein demokratisches Gemeinwesen appelliert.
Das Schwanken des Zivilgesellschaftsbegriffes zwischen normativer Aufladung und peri-
pherer Stellung wiederholt sich nun auf vergleichbare Weise in der wissenschaftlichen Diskus-
sion. Die Theorielinien,43
die sich einst im Hoch der Zivilgesellschaftsdebatten der 1980er und
frühen 1990er dieser Kategorie eine konzeptuelle Schlüsselposition zuwiesen, haben sie heute
entweder fallengelassen oder aber ihre Ausarbeitung weitgehend aufgegeben.44
Erstens hat, vielleicht am offensichtlichsten, die deliberative Demokratietheorie den Zi-
vilgesellschaftsbegriff verabschiedet. Markierte paradoxerweise die umfangreiche Studie Civil
Society and Political Theory (1994) der Habermas-Schüler Andrew Arato und Jean L. Cohen
den Hochpunkt der civil-society-Debatte, so taucht in der jüngsten Theoriebildung des delibera-
tiven Ansatzes der Zivilgesellschaftsbegriff höchstens am Rande auf.45
Wie Axel Honneth kon-
statiert, ist das „theoretische Augenmerk weg von den zivilen Assoziationen und politischen
Bewegungen hin auf die rechtlichen Verfassungen und prozeduralen Vorkehrungen von demo-
kratischen Staaten verlagert“ (Honneth 2013: 291). Wenn aber die Habermas-Schule im weiten
Sinne noch die zivile Sphäre in den Blick nimmt, die rechtsstaatlichen Prozeduren vorgelagert
ist, dann tut sie das in erster Linie über den klassischen Begriff der Öffentlichkeit. Diese fun-
giert, mit Habermas gesprochen, als wichtige legitimationsstiftende Grundlage des politischen
42 Dies gerade in Kontexten, in denen entweder durch demokratische Transitionsperioden oder durch sozio-
ökonomische Krisen liberal-demokratische Institutionen einen unsicheren Stand haben. So bedürfe es einer star-
ken und aktiven Zivilgesellschaft sowohl im nachrevolutionären Kontext des Nahen Ostens (vgl. Auswärtiges
Amt 2013) als auch in den krisengeschüttelten südeuropäischen Ländern (vgl. Subirats 2013, VVAA 2013) 43
Diese Einteilung ähnelt der Kneers (1997) und Honneths (1994), fügt ihr aber die gramscianische und kultursozi-
ologische Theorielinien hinzu und klammert die Diskussionen um eine global civil society aus (vgl. Keane 2003). 44
Meine Übersicht geht nicht auf die unüberschaubare Zahl empirischer Arbeit zur Zivilgesellschaftskategorie ein. 45
Das gilt auch für Arato und Cohen selbst: Als Teilnehmer an der „deliberativen Wende“ sprechen sie mittlerweile
von Zivilgesellschaft nur noch in Verbindung mit verfassungsrechtlichen Fragen (vgl. Peruzzotti/Plot 2013: 13ff).
57
Systems. Die Öffentlichkeit ist das vorstaatliche, „politisch-kulturelle“ Integrationsmedium, das
eine „gemeinsame politische Willensbildung“ und die „kommunikative Erzeugung“ demokra-
tisch legitimierter Macht und Herrschaft gewährleistet (Habermas 2011: 56f). Honneth als jener
Autor, der sich derzeit in der habermas’schen Tradition am intensivsten mit den sozialkulturel-
len Räumen vor dem Regelwerk demokratischer Deliberationen beschäftigt, hegt selbst offene
Skepsis am Nutzen des Zivilgesellschaftsbegriffes (vgl. Honneth 2011: 549ff, bereits 1994).
Dagegen macht sich seine neohegelianische Gerechtigkeitstheorie für die normative Kategorie
der „demokratischen Sittlichkeit“ stark. Als Sammelbegriff für die sozialen Bereiche (Öffent-
lichkeit, Markt und Familie), in denen Anerkennungsverhältnisse auf Dauer gestellt sind, ist sie
die schutzbedürftige und nicht zur Disposition stehende Grundlage eines demokratischen Ge-
meinwesens (vgl. ebd.: 115). Dadurch hat Honneth zwar ein Konzept für den übergreifenden
sozio-kulturellen Bereich, der gesellschaftliche Verhaltens- und Lebensweisen reguliert. Dem
normativen Begriff der demokratischen Sittlichkeit entgeht indes die konflikthafte Aufladung
und hegemoniale Verfassung dieser kulturellen Sphäre, für die Gramsci sensibilisierte.
Zweitens ist die republikanische Zivilgesellschaftskonzeption Leforts soweit in den Hin-
tergrund getreten, dass sich von einem langsamen „Verschwinden“ dieser Tradition sprechen
lässt. Zwar fand Leforts Zivilgesellschaftsverständnis im deutschsprachigen Raum, auf den ich
mich bei dieser Linie konzentriere,46
durchaus Gehör. Vor allem Ulrich Rödel, Günter Franken-
berg und Helmut Dubiel rezipierten die lefortschen Thesen und entwickelten daraus ihr eigenes,
radikaldemokratisches Zivilgesellschaftskonzept. Die als autonome Sphäre in Szene gesetzte
Zivilgesellschaft ist für sie der neue Dreh- und Angelpunkt demokratischer Selbstregierung und
immer weitergehender Demokratisierung (vgl. Rödel et al. 1989, als Überblick Brodocz 2008).
Jedoch fragt sich, ob dieses hochdynamische Zivilgesellschaftsverständnis nicht das demokrati-
sierende Potential dieser Sphäre überschätzt. Aus der politischen Hochphase der neuen sozialen
Bewegungen und der osteuropäischen Transformationsprozesse hervorgegangen, lässt sich mit
dieser Konzeption die weitgehende Stilllegung sozialen Wandels oder die Existenz undemokra-
tischer, „unziviler“ Strömungen in der Zivilgesellschaft nicht recht erklären. Zwar arbeiteten
Rödel, Frankenberg und Dubiel ihr Konzept während der 1990er in Einzelstudien weiter aus,
stellten aber dann seit der Jahrtausendwende ihre diesbezügliche Produktion weitgehend ein47
–
ohne seither durch jüngere Autorengenerationen aufgegriffen und fortgedacht zu werden.
46
Die deutsche Entwicklung scheint aber durchaus repräsentativ für die internationale und insbesondere franzö-
sische Lefort-Rezeption. Symptomatisch ist etwa, dass Gauchet, Leforts renommierter Schüler, sich weitgehend
aus der Sozialtheorie zurückgezogen und sich mit der großangelegten Triologie L’avènement de la démocratie
(2007-2010) in das Feld der politischen Ideengeschichte im engeren Sinne vertieft hat. 47
Siehe als exemplarischer Überblick: Rödel 1994, Dubiel 1994: 67-118, 2001, Frankenberg 1997, 2003.
58
Drittens hat die gramscianische Theorielinie zwar keinen gar so abrupten Abbruch er-
lebt, sie befindet sich aber gleichwohl in einer Phase weitgehender Stagnation. Gramscis Zi-
vilgesellschaftsverständnis erweist sich zwar mit seiner dreifachen deskriptiven, kulturalisti-
schen und konfliktorientierten Schwerpunktsetzung als durchaus fruchtbar und anschlussfähig
für empirische Studien, die sich von idealisierenden und utopistischen Verständnissen des
„dritten Sektors“ der Gesellschaft absetzen und dessen konstitutive Vermachtung in den Blick
rücken: Die kulturellen Hegemonien, die sich in der Zivilgesellschaft ausbilden, müssen nicht
progressiv sein, ihr können genauso konservative oder faschistische Züge aneignen.48
Indes ist
auffallend, dass sich, bedingt durch ihr marxistisches Selbstverständnis, diese Theorietradition
gegen konzeptuell-theoretische Erweiterungsunternehmen weitgehend abgeschirmt hat. Die
theoretische Öffnung und Weiterentwicklung von Gramscis Konzepten wird pauschal als Preis-
gabe seiner ursprünglichen marxistischen Leitsätze verworfen. Wenn dennoch poststrukturalis-
tische Ansätze, allen voran Laclau und Mouffe, verhandelt werden, dann unter dem Vorzei-
chen eines „back to the origins“, das die poststrukturalistischen Devisen von Diskursivität und
Kontingenz verwirft und an ihrer statt die materialistischen von Klasse und Ökonomie setzt.49
Viertens ist das kultursoziologische Zivilgesellschaftskonzept Jeffrey C. Alexanders das
gegenwärtig wohl einzige sozialtheoretisch ambitionierte Vorhaben, „der Kategorie der Zivilge-
sellschaft neue Substanz und Aktualität zu verleihen“ (Honneth 2013: 293). Sein Opus Magnum
The Civil Sphere (2006) entwirft aus der empirischen Gesellschaftsanalyse immanent eine nor-
mative Gesellschaftstheorie und konturiert so die Zivilgesellschaft als Sphäre der Solidarität.
In ihr sei ein Reservoir an Werten und Normen enthalten, „that generates the capacity for so-
cial criticism and democratic integration at the same time“ (ebd.: 5). Aus hiesiger Sicht ei-
gentlich beachtenswert ist aber die Tatsache, dass Alexander die Zivilgesellschaft als eine
kulturelle Struktur liest, die semiotisch verfasst ist: Sie besteht aus symbolischen Homologien,
die sich antagonistisch gegenüberstehen (etwa: deliberative ↔ conspirational, friendly ↔ anta-
gonistic) (vgl. ebd.: 56f). Alexanders kulturalistisches Zivilgesellschaftsverständnis bildet der-
zeit jedoch ein Unikum im Feld zeitgenössischer Sozial- und Kulturtheorien – mit bisher ver-
halten gebliebener Rezeption. Sieht man von den systematischen Schwierigkeiten der Studie
einmal ab,50
so scheint es als scheitere Alexanders Zivilgesellschaftskonzept bereits am schieren
Unglauben der (post-)modernen Theoriebildung, dass die „veraltete“ Kategorie der Zivilgesell-
schaft gerade auf kulturtheoretischem Wege zu aktualisieren und zu reaktivieren sei.
48
Dazu exemplarisch die Arbeiten von Borstel 2008, Bundschuh 2012 und Riley 2010. 49
Vgl. Leggett 2013: 311, Riley 2011, Thoburn 2007: 81, Demirovic 2007, Wood 1990, als Ausnahme Opratko 2012. 50
Vgl. Sciortino 2006: 568 zum Problem des doppelten analytischen und normativen Anspruches von Alexander.
59
C) Ein diskurstheoretisches Zivilgesellschaftskonzept
Nachdem das erste Kapitel die grundlegenden Begriffe und Axiome der Diskurstheorie von
Laclau und Mouffe vorstellte und das zweite „im Schritt zurück“ zu Lefort und Gramsci die
Grundlinien des Zivilgesellschaftsverständnisses beider Autoren konturierte, arbeitet das dritte
Kapitel diese beiden Leitstränge synthetisch auf. Sein Hauptgedanke ist, dass ein durch Lefort
und insbesondere durch Gramsci inspiriertes Zivilgesellschaftskonzept die Hegemonietheorie
Laclaus und Mouffes an zentralen konzeptuellen Schaltstellen ergänzt. Ich lanciere eine dis-
kurstheoretische Radikalisierung Leforts und Gramscis, mit der ich betone, dass Artikulationen
ein sedimentiertes Diskursfeld hervorbringen, das dann auf Artikulationsprozesse zurückwirkt
und diese strukturiert. Ich lese die Zivilgesellschaft als politischen Raum, der gleichzeitig das Er-
gebnis hegemonialer Fixierungen und der Ausgangspunkt neuer politischer Prozesse ist. Dem
aktuellen Trend widersprechend (s.o.), verleihe ich so der Zivilgesellschaftskategorie über den
Weg ihrer diskurstheoretischen Neufassung eine theoretische und politische Schlüsselstellung.
Mein Zivilgesellschaftskonzept orientiert sich maßgeblich an der gramscianischen Be-
griffstrias von organischer Ideologie, Alltagsverstand und kultureller Organisation und unter-
zieht sie einer diskurstheoretischen Überarbeitung. Im ersten und ausführlichsten Schritt be-
schreibe ich den Begriff der organischen Ideologie als sedimentierte Diskursformation und
definiere sie als politische Kultur (I). Zweitens markiert die gramscianische Konzeption des
Alltagsverstandes – die kulturelle Äußerungsform der Ideologie in Praktiken, Anschauungen
und Lebensformen – den Ausgangspunkt meines Begriffs von kollektiven Serien (II). Drittens
fasse ich die kulturellen Institutionen, d.h. die institutionelle Struktur der Ideologie, als Netze
von Diskursproduzenten: Sie bilden übergreifende öffentliche Sphären, die Diskurse in einen
Raum der allgemeinen Sichtbarkeit rücken (III). Nachdem die ersten drei Schritte die Katego-
rien politische Kultur, kollektive Serie und öffentliche Sphäre jeweils für sich genommen ein-
führten, lege ich viertens dar, in welchem Zusammenhang diese Konzepte stehen (IV). Die
drei Kategorien bilden eine nur analytisch differenzierbare Trias, die in der Kategorie der po-
litischen Kultur ihre übergeordnete Klammer findet. Politische Kulturen sind die umfassenden
Diskursstrukturen, in die kollektive Serien und öffentliche Sphären eingelagert sind. Die Zi-
vilgesellschaft wird von einer Pluralität politischer Kulturen strukturiert, wobei sich hegemo-
niale von untergeordneten Positionen unterscheiden lassen. Wichtig ist, dass die zivilgesell-
schaftliche Struktur – auch wenn sie befriedet und stabilisiert scheint – ständig in Bewegung
ist und politischen Verschiebungen unterliegt.
60
I. Von der organischen Ideologie zur politischen Kultur
Mit dem Konzept der politischen Kultur nehme ich eine diskurstheoretische Überarbeitung
von Gramscis Kategorie der organischen Ideologie in Angriff. Wie bereit deutlich gemacht
betont die gramscianische Kategorie der organischen Ideologie den Punkt des wechselseitigen
Zusammenfallens von Ideologie und Kultur. Pointiert gesagt, bezeichnen organische Ideolo-
gien die kulturelle Inkorporierung und das Wirksamwerden partikularer Anschauungen als
weitgehend entpolitisierte Lebensformen, Wissensformen und Praktiken. Der konzeptuelle
Mehrwert von Gramscis Begriff der organischen Ideologie gegenüber Laclaus und Mouffes
Konzept von hegemonialen Projekten (S. 20-23) liegt darin, dass er hervorhebt, dass die He-
gemonialwerdung gewisser partikularer Formationen im Medium der Kultur geschieht. Ich ver-
deutliche dies am diskurstheoretischen „Schulbeispiel“: dem hegemonialen Projekt des That-
cherismus. Eine klassische Hegemonieanalyse nach Laclau und Mouffe würde fokussieren, wie
der Thatcherdiskurs auf einer eminent politischen und makrologischen Ebene operiert. Er
würde dann etwa „die britische Nation“ als leeren Signifikanten konturieren, der eine weite
Äquivalenzkette diskursiver Momente zusammenhält, in dem sowohl konservative Momente
des tradierten Torydiskurses (Nation, Familie, Autorität, Traditionalismus) als auch neolibera-
le Themenfelder (Eigeninteresse, Konkurrenzindividualismus, Anti-Etatismus) eingebunden
sind (vgl. Hall 1983: 29, auch Hall 1989b: 181).
Die spezifische Perspektivierung, die demgegenüber Gramscis Begriff der organischen
Ideologie nahelegt, ist der stärkere Fokus auf die sozialkulturelle Etablierung des Thatcheris-
mus, seine schrittweise Einschreibung in den verschiedensten sozialen Sphären (vom Bank-
wesen bis hin zur Hochschullandschaft) und seine gesellschaftliche Durchsetzung als ein neo-
liberaler Commonsense, der die britische Gesellschaft seit den 1980er Jahren prägt. Dort also,
wo die Hegemonietheorie oftmals allzu generell von der Durchsetzung eines hegemonialen
Imaginären51
oder der Sedimentierung einer dominanten Bedeutungsordnung spricht und hier-
mit die Analyse für abgeschlossen erklärt (vgl. etwa Smith 1998: 171f), regt die organische Ide-
ologiekonzeption Gramscis zum Weiterdenken an. Der Begriff der organischen Ideologie lenkt
die Aufmerksamkeit auf den schrittweisen Prozess der Fixierung, Entpolitisierung, Befriedung
und kulturellen Einschreibung eines hegemonialen Projekts. Dieser Vorgang ist nun deswegen
hochinteressant, weil er ein präziseres Hegemonieverständnis entfaltet: Eine Diskursformation,
51
Zur Definition eines hegemonialen Imaginären Smith (1998: 117): ,,As it becomes an imaginary, the hege-
monic discourse becomes embodied in a number of different key institutions, thereby ensuring the incitement of
identifications within its framework in as many different sites in the social as possible“.
61
die in diesem organischen Sinne vorherrschend geworden ist, stößt umfassende sozialkulturelle
Reorganisationsprozesse an, sie gestaltet das soziale Terrain von Grund auf um.52
Meine Konzeption von politischer Kultur „übersetzt“ nun die Kategorie der organischen
Ideologie in diskurstheoretische Termini und erweitert dadurch grundbegrifflich den Ansatz
von Laclau und Mouffe. Ich definiere politische Kulturen als sedimentierte Diskursformatio-
nen und schreibe ihnen vier zentrale Charakteristika zu, auf die ich der Reihe nach genauer
eingehe: Erstens verwende ich den Begriff der politischen Kultur um den Prozess der schein-
bar „befriedeten“ Sedimentierung von Diskursformationen zu betrachten – in Abgrenzung zu
ihrer offenen politischen Durchsetzung, die der Begriff des hegemonialen Projekts fokussiert.
Zweitens, und damit zusammenhängend, charakterisiere ich politische Kulturen mit stärker ent-
politisierten Begriffen als hegemoniale Projekte. Ich setze mich von Laclaus und Mouffes Beto-
nung von Äquivalentsetzungen, antagonistischen Grenzziehungen und universalisierenden He-
gemonialisierungen ab und präsentiere dagegen ein offeneres und weniger antagonistisch aufge-
ladenes Verständnis von Artikulationsprozessen. Drittens betone ich, dass die Sedimentierung
von politischen Kulturen in Schichten vonstattengeht, die sich analytisch aufschlüsseln lassen:
Weniger stark sedimentierte und stärker politisierte Schichten heben sich von stärker sedi-
mentierten und entpolitisierten Schichten ab. Viertens unterstreiche ich, politische Kulturen
veränderte Kollektivitätsformen aufweisen. Ich widersetze mich hierbei dem monistischen
Verständnis von leeren Signifikanten bei hegemonialen Projekten und plädiere stattdessen für
eine plurales und stärker an Praktiken gebundenes Verständnis von Kollektivität.
1) Politische Kulturen als sedimentierte Diskursformationen
Legt die Konzeption von politischen Kulturen als sedimentierte Diskursformationen nicht
eine kategoriale, ontologische und ontische, Trennung zwischen den Bereichen des Politischen
und des Sozialen nahe, die eigentlich bereits der Kritik unterzogen wurde? Nein, denn es verhält
sich genau umgekehrt: Mit dem Begriff der politischen Kultur relativiere ich die ontologisch-
ontische Gegenüberstellung zwischen dem Sozialen (der Gesellschaft) und dem Politischen (der
Politik). Denn der Begriff der politischen Kultur betont die ontische Durchdringung der sozialen
und der politischen Dimension: De facto bewegen sich politisierte hegemoniale Projekte und
sedimentierte politische Kulturen in einem sozialen Raum, dem der Zivilgesellschaft. Sowohl
52
Und genau dies gelang dem Thatcherismus, indem er den sozialdemokratischen Konsens der Nachkriegszeit
(„the political settlement“) von Grund auf dezentrierte (vgl. Hall 2002b: 229) und in den letzten Jahrzehnten zur vor-
herrschenden politischen Kultur geworden ist, zum selbstverständlichen Denk- und Handlungsrahmen von konservati-
ven, aber auch von sozialdemokratischen Positionen (Stichwort: der Dritte Weg von New Labour unter Tony Blair).
62
die umkämpfte Durchsetzung einer Diskursformation als auch ihr Sedimentierungsprozess bil-
den ein ontisches Kontinuum, das ständig zwischen einem politischen und einem sozialen Pol
oszilliert. Diskursformationen (etwa der Thatcherismus) können in zivilgesellschaftlichen Kon-
texten zwischen hegemonialen Projekten und politischen Kulturen fluktuieren. Die umkämpfte
Durchsetzung einer Formation macht nicht dort halt, wo Äquivalenzketten geschmiedet, starke
antagonistische Grenzen gezogen und integrative leere Signifikanten eingerichtet werden, son-
dern erstreckt sich auf soziale Prozesse, die Metaphern wie Gerinnung, Fixierung oder Sedi-
mentierung auf dieser generellen Ebene nur unzureichend und schematisch fassen.53
Die Her-
ausbildung gefestigter Bedeutungsordnungen, Lebensformen und Institutionen sind hegemoniale
Sedimentierungseffekte, die bisher von Laclau und Mouffe kaum thematisiert worden sind.
Tatsächlich lanciere ich mit der Konzeption von politischen Kulturen als sedimentierten
Diskursformationen den Versuch, die Funktionsweise von Diskursen in der, hegemonietheo-
retisch gesprochen, Logik des Sozialen präziser aufzuschlüsseln. Wenn ich Gramscis Sensibi-
lisierung dafür folge, dass die Hegemonialwerdung gewisser Kollektive als ein verästelter und
umfassender kultureller Prozess beschrieben werden muss, dann heißt dies übersetzt in
Laclaus und Mouffes Termini: Hegemoniale Prozesse sind erst dann zu Ende gedacht, wenn sie
in der umkämpften Logik des Politischen und in der „befriedeten“ Logik des Sozialen nachge-
zeichnet werden. Wie ich am Ende der Ausführungen plausibilisieren werde, folgt aus einem
derart ausgebauten Hegemoniebegriff, dass ich mich letztlich gegen die binäre Gegenüberstel-
lung einer politischen und einer sozialen Logik wende und stattdessen das Soziale und Politi-
sche als unterschiedliche Grade der Politisierung begreife: Während soziale Verhältnisse am
sozialen Pol weitgehend entpolitisiert und „befriedet“ sind, sind sie am politischen Pol relativ
leicht hinterfragbar und haben eine starke antagonistische Aufladung. Indes müssen die Politi-
sierung und die Entpolitisierung sozialer Verhältnisse nicht nur mit der politischen Konflikthaf-
tigkeit einerseits oder der sozialen Sedimentierung andererseits korrelieren. Politisierung und
Entpolitisierung können auch für verschiedene hegemoniale Strategien stehen: Einerseits die
eher von der Hegemonietheorie fokussierte makrologische und umkämpfte Durchsetzung, ande-
rerseits der von Gramsci betonte – und von Laclau und Mouffe vernachlässigte – molekulare
Prozess einer kulturellen und entpolitisierten Sedimentierung. Die Primatstellung des Politi-
schen erstreckt sich also auf politisierte genauso wie auf vordergründig entpolitisierte Artikula-
tionen und macht daher ein grundbegrifflich erweitertes Hegemonieverständnis notwendig. 54
53
Wenn ich dennoch von politischen Kulturen als sedimentierten Diskursformationen spreche, so unter dem Vor-
behalt der grundlegenden konzeptuellen Schärfung und Ausdifferenzierung des Sedimentierungsbegriffes (S. 68-75). 54
So ergänze ich Laclaus und Mouffes aktiven Hegemoniebegriff mit einer passiven Hegemoniekonzeption (S. 105).
63
2) Eine „befriedete“ Artikulationsweise
Nachdem ich auf einer generellen Ebene politische Kulturen als sedimentierte Diskursforma-
tionen definiert habe und sie auf diese Weise der Logik des Sozialen oder, in meinen Termini,
einer Logik der kulturellen Entpolitisierung zugeordnet habe, entfalte ich nun mein eigenstän-
diges Verständnis der „befriedeten“ Artikulationsweise von politischen Kulturen. Meine Les-
art hebt sich stark vom Operieren politisierter hegemonialer Projekte ab und zeichnet sich
durch drei Facetten aus, die ich schrittweise einführe: Erstens die Expansion von Differenzbe-
ziehungen (vs. Äquivalentsetzungen bei hegemonialen Projekten), zweitens die entpolitisierten
Diskursgrenzen (befriedete borders vs. antagonistische frontiers) und drittens die iterative
Diskursstabilisierung (vs. expansive Diskursausdehnungen).
a) Differenzlogik
Politische Kulturen operieren primär über die Expansion von Differenzbeziehungen und nicht
wie hegemoniale Projekte über Äquivalentsetzungen. Wie gezeigt (S. 15f), sind nach Laclau
und Mouffe die Logiken von Äquivalenz und Differenz notwendig in jeder artikulatorischen
Praxis angesiedelt. Es kann nur eine graduelle Vorherrschaft der einen über die andere Logik
geben. Während die Äquivalenzlogik die Gemeinsamkeit von Diskursmomenten unterstreicht,
hebt die Differenzlogik ihre Unterschiede hervor und stellt die differenzielle Identität der ein-
zelnen Diskursmomente heraus. Weil die Äquivalenzlogik einer Formation Diskursmomente
hinzufügt, wirkt sie diskursexpansiv und politisierend. Hingegen wohnt der Differenzlogik ein
entpolitisierendes Moment inne: Sie zersetzt Äquivalenzketten, stellt diskursive Gemeinsam-
keiten in Frage und stabilisiert auf diese Weise gegebene Ist-Zustände. Die Diskurstypen, in
denen es zur graduellen Vorherrschaft der Logik der Differenz kommt, stehen folglich im
Dienste der Stabilisierung bereits instituierter Bedeutungsordnungen und verhindern die Arti-
kulation neuer Formationen (vgl. Laclau 2005: 154f).55
Es kommt bei der Differenzlogik darauf an, dass sie die Momente einer Diskursformati-
on fixiert und stabilisiert. Mit Foucault gesprochen, stellt die Logik der Differenz nicht die
formierende (= ereignishafte), sondern die formierte (= strukturelle) Dimension von Diskurs-
formationen in den Vordergrund (S. 19f). Indem die Logik der Differenz die Identität der ein-
zelnen diskursiven Glieder hervorhebt, sorgt sie für eine rekursive Stabilisierung von Diskurs-
55
Laclau geht gar so weit, dass er die entpolitisierende Differenzlogik an einen spezifischen Diskurstyp koppelt,
den er als institutionalistisch definiert und dem er jede politische Relevanz abspricht: „[this type of discourse]
involves the death of politics and its reabsorption by the sedimented forms of the social (Laclau 2005: 154f).
64
strukturen, wodurch deren konstitutive Brüchigkeit tendenziell überwunden wird. Die Stabili-
sierungs- und Fixierungsfunktion der Differenzlogik umfasst drei Bereiche: Begriffe, Subjekt-
positionen und Strategien.56
Die Differenzlogik sorgt dafür, dass in Diskursen spezifische
Begriffe auf Dauer gestellt werden und stabilisierte Formen der Koexistenz annehmen. Dies
ist etwa der Fall, wenn in einem wohlfahrtsstaatlichen Regime die Begriffe soziale Gerechtig-
keit, Gleichheit, Sozialstaat und Umverteilung regelmäßig (und in gewissen Abfolgen) er-
scheinen, ohne aber durch starke Äquivalenzen verbunden zu werden und sich gegenüber Anta-
gonisten abzugrenzen. Sodann stabilisiert die Differenzlogik Subjektpositionen. Spezifische
„Ensemble[s] von Orten, die als Positionen regulierter Redeweisen den Subjekten erst ermög-
lichen zu sprechen“ (Stäheli 2000: 48), erhalten somit einen naturalisierten und scheinbar un-
verrückbaren Status. Auf diese Weise werden gegebene Subjektivierungsweisen57
vor anderen
begünstigt. Im wohlfahrtsstaatlichen Regime etwa steht dem Subjekt bloß eine begrenzte und
nicht beliebig besetzbare Zahl von Subjektpositionen (u.a. als Arbeitnehmer oder Sozialhilfe-
empfänger) zur Verfügung. Letztlich festigt die Differenzlogik spezifische Strategien. Das
Verhältnis, die Abfolge und die Gruppierungsweisen von bestimmten Diskursmomenten, Be-
griffen und Subjektpositionen werden stabilisiert und zu festen Gefügen vernäht. Es entstehen
nunmehr schwer verrückbare Diskursordnungen, die das politisierende Potential von neu auf-
kommenden Äquivalentsetzungen hemmen und ihre Momente auf entpolitisierende Weise
gewissermaßen „absorbieren“.58
b) Entpolitisierte Grenzen („borders“)
Die Vorherrschaft der Differenz- vor der Äquivalenzlogik leitet zum entpolitisierten Status der
Grenzziehung über. Gegenüber hegemonialen Projekten zeichnen sich politische Kulturen nicht
durch antagonistische Grenzziehungen (frontiers) als vielmehr durch nur schwach politisierte
und antagonistisch aufgeladene Diskursgrenzen (borders) aus. Die Dominanz der Differenz-
gegenüber der Äquivalenzlogik führt damit zu einer grundsätzlichen Abschwächung des An-
tagonismuskonzepts. Lange Äquivalenzketten bzw. starke Kollektividentitäten werden nach
Laclau und Mouffe gerade dadurch zusammengehalten, dass sie sich von einem rein negativen
56
Diese Einteilung orientiert sich an der Unterscheidung von Begriffen, Äußerungsmodalitäten und Strategien in
der Archäologie des Wissens (vgl. Foucault 1973: 75-102). 57
Subjektivierung mit Bröckling (2012: 131) verstanden „als das Ensemble der Kräfte, die auf die Einzelnen
einwirken und ihnen nahelegen, sich in einer spezifischen Weise selbst zu begreifen, ein spezifisches Verhältnis
zu sich selbst zu pflegen und sich in spezifischer Weise selbst zu modellieren und zu optimieren“ 58
Diese differenzielle Absorption exemplifiziert Laclau (vgl. 2005: 77) an der Weise, wie ein wohlfahrtsstaatli-
ches Regime auf die Forderungen von Protestbewegungen respondiert: Sie werden als differenzielle und isolierte
Momente behandelt, die untereinander keine Gemeinsamkeiten teilen und je für sich befriedigt werden können.
65
und gefährdenden Außen abgrenzen. Der Antagonismus symbolisiert damit das „konstitutive
Außen“ (S. 17f), auf das jeder Diskurs angewiesen ist, um sich negativ zu stabilisieren. Indes
sind Antagonismenbildungen nicht notwendigerweise der einzige Weg, um die konstitutive
Brüchigkeit von Diskursen zu bewältigen und sie zu stabilisieren (vgl. Stäheli 2004: 236f, Nor-
val 2000: 223). Die Vorherrschaft der Differenzlogik wirkt auf zweierlei Weise auf Diskurse
ein und trägt zu ihrer Festigung bei: Zum einen stabilisiert die Differenzlogik Diskursmomen-
te. Wie oben gezeigt, forciert sie die formierte Dimension von Diskursformationen, indem sie
gegebene Begriffe, Subjektpositionen und Strategien festigt. Zum anderen befördert die Diffe-
renzlogik eine diskursinterne Komplexitätszunahme. Da die vereinheitlichende Äquivalenz-
bewegung fehlt und die „für sich stehende“ Identität der Einzelmomente in den Vordergrund
rückt, besteht keine Notwendigkeit mehr für einen gemeinsamen Symbolisierungsraum des
Diskurses. Die Selbstbezeichnung des Diskurses – bei hegemonialen Projekten durch leere
Signifikanten übernommen – entfällt bei politischen Kulturen weitgehend. Sie bilden diffe-
renzielle Totalitäten (vgl. Laclau 2005: 77), die sich nicht mehr als ein Ganzes signifizieren.
Die Doppelbewegung „differenzielle Festigung“ und „Komplexitätszunahme“ wertet
die Stabilisierungs- und Schließungsfunktion des Antagonismus grundsätzlich ab. Politische
Kulturen müssen ihre Grenzen nicht antagonistisch aufladen, um ihren Bedeutungsstrukturen
ex negativo Stabilität zu verleihen. Vielmehr grenzt sich der differenzielle Diskursraum von
politischen Kulturen dadurch von seinem konstitutiven Außen ab, dass er es gar nicht erst signi-
fiziert. Mit Stäheli gesagt, lassen diese Diskurstypen ihr Außen unmarkiert: Sie stehen dem,
was sich jenseits ihrer bewegt, „indifferent“ gegenüber (Stäheli 2004: 237f).
Das nichtmarkierte Außen von politischen Kulturen lässt sich mit dem Begriff der Hete-
rogenität bezeichnen. Nach Laclau steht die Heterogenitätskategorie nämlich für die prinzipi-
elle Abwesenheit eines symbolischen Raumes. Anders als der Antagonismus schreibt sich die
Heterogenität nicht wieder im Diskursinnen ein, wie dies etwa die Figur des „parasitären Aus-
länders“ in einem rechtspopulistischen Diskurs tut. „[Heterogeneity] presupposes exteriority
not just to something within a space of representation, but to the space of representation as
such“ (Laclau 2005: 140). Der Heterogenitätsbegriff ist ein Exzess, der sich der innerdiskursi-
ven Kategorisierung und Aneignung entzieht und gewissermaßen zum „unsichtbaren“ Symbol
der konstitutiven Brüchigkeit jedes Diskurses wird. Das radikale Außen des Diskurses wird
dadurch nicht mehr antagonistisch überdeterminiert (vgl. Thomassen 2006: 301). An einer onti-
schen Äußerungsform der Heterogenität verdeutlicht, ist die Kategorie des „Lumpenproletari-
ats“ der im marxschen Theorierahmen a priori nicht eingeplante Exzess, der die Grunddicho-
66
tomie Proletariat gegen Bourgeoisie durchkreuzt. Die Kategorie des Lumpenproletariats zeigt,
dass sich prinzipiell auch andere Antagonismen als der Gegensatz von Kapital vs. Arbeit bil-
den und andere Identitäten konstituieren können (vgl. Laclau 2005: 142).
Auf diese Weise enthalten die entpolitisierten Grenzen (borders) von politischen Kultu-
ren zwar an sich keine starke antagonistische Aufladung mehr, sie bleiben aber weiterhin ein
Signum für das konstitutive Diskursaußen – das immer wieder antagonistisch besetzt werden
kann. Die Unterscheidung zwischen umkämpften, antagonistisch symbolisierten frontiers und
entpolitisierten, nichtmarkierten borders ist nur gradueller Natur und kann jederzeit in beide
Richtungen (Politisierung ↔ Entpolitisierung) aufgeladen werden. Bewegt sich etwa ein ka-
tholischer Diskurs im sedimentierten Modus einer politischen Kultur, dann spielt das Moment
der Homosexualität für den Diskurs die Rolle eines „nichtmarkierten Außen“. Homosexuelle
Praktiken tauchen dann im katholischen Diskursraum gar nicht erst auf, sie werden weder po-
sitiv noch negativ signifiziert. Indes wird in stärker politisierten Kontexten, man denke an die
Legalisierung der Homosexuellenehe in Frankreich, das ursprünglich heterogene Moment der
„Homosexualität“ antagonistisch aufgeladen. Der katholische Diskurs verwandelt dann die
entpolitisierte border gegenüber einem vordem nichtsignifizierten Außen in eine politisierte
frontier, die nun das konstitutive Diskursaußen symbolisch besetzt: Der katholische Diskurs
„antagonisiert“ die Homosexualität und erklärt sie zu einem grundsätzlichen moralischen Ver-
derbnis, die es dementsprechend mit aller Macht zu bekämpfen und niederzuringen gilt.
c) Iterative Stabilisierung
Die diskursive Stabilisierung von politischen Kulturen geschieht durch iterative Bewegungen.
Wie bereits aus der Vorherrschaft der Differenzlogik und dem entpolitisierten Status der Dis-
kursgrenze hervorging, zielt die Logik politischer Kulturen nicht darauf, ihre Bedeutungshori-
zonte expansiv zu erweitern. Hegemoniale Projekte tendieren dazu, durch Äquivalenzketten und
antagonistische Grenzziehungen ihre partikularen Gehalte zu universalisieren (S. 22f). Dieses
Streben nach Expansion, das in der Logik des Politischen grundsätzlich jeder Diskursformation
innewohnt, entfällt bei politischen Kulturen weitgehend. Sie gehorchen eher einer nach innen
gekehrten Stabilisierung ihres Diskursraumes. Der Logik einer hegemonialen Expansion setzen
politische Kulturen, mit Derrida, eine Logik der iterativen Stabilisierung entgegen. Indem in
politischen Kulturen ständig ähnliche Differenzbewegungen geschehen, entstehen dominante
Spuren (vgl. Derrida 1999: 51). Diese Spuren schränken das Spiel der Differenzen ein, lenken
es in gewisse Bahnen und erlauben, die Stabilität und Trägheit von Diskursen auch unter der
67
Bedingung ihrer deontologischen Dekonstruktion zu denken. Allerdings darf die iterative Stabi-
lisierungslogik politischer Kulturen nicht als mechanische und unbewegliche Reproduktions-
praxis missdeutet werden. Die Bewegung der Iterabilität geht stets mit Verschiebungen einher,
die verräumlichend und zeitaufspreizend wirken (vgl. Derrida 1999: 36).
Die iterative Stabilisierungslogik lässt sich dann genauer beschreiben, wenn die Rolle
kulturell inkorporierter Praktiken gegenüber klaren sprachlich-semiotischen Symbolen aufge-
wertet wird. Wie ich beim Serienbegriff genauer ausführe, operieren politische Kulturen stärker
über die praxeologische als über die semiotische Dimension von Diskursen. Die Reproduktion
und mikrologische Verschiebung von politischen Kulturen geschieht vorwiegend durch Prak-
tiken und nicht durch voll ausformulierte Zeichenordnungen. Zwar werden Praktiken weiter-
hin implizit durch Wissenscodes strukturiert und sind in übergreifenden Diskursformationen
verankert, sie sind aber bislang in ihrer Eigendimension vom textualistischen Ansatz Laclaus
und Mouffes nur unzureichend dechiffriert worden. Gegenüber der hegemonietheoretischen
Perspektive von „Diskurs als Text“ (Reckwitz 2008: 43) erlaubt eine stärker praxeologisch
argumentierende Diskurstheorie die Einschreibung von Bedeutungsordnungen in kulturelle
Verhaltensmuster präziser zu konzeptualisieren. Gegenüber der formalistischen Erklärungs-
strategie der Hegemonietheorie führt dies zu einem stärker kontextualistischen Zugang,59
der
Artikulationsprozesse in ihrer geschichtlichen Einbettung begreift.
Wie die Tabelle resümiert, wurde bisher die generelle diskursive Artikulationsweise poli-
tischer Kulturen nachgezeichnet und gegenüber Laclaus und Mouffes Begriff von hegemonialen
Projekten dargestellt. Nun gilt es, die Sedimentierungsdimensionen von Bedeutungsordnungen
und damit die kulturellen Tiefenwirkungen hegemonialer Prozesse zu fokussieren.
Hegemoniales Projekt
Logik des Politischen
„Politisierung“
Politische Kultur
Logik des Sozialen
„Entpolitisierung“
Artikulationsweise
Äquivalenzlogik
Im Diskursinnen: Destabilisierung
und Vereinfachung
Differenzlogik
Im Diskursinnen: Stabilisierung
und Komplexitätszunahme
Grenzziehung
antagonistische Grenze (frontier)
konstitutives Außen: Antagonismus
entpolitisierte Grenze (border)
konstitutives Außen: Heterogenität
Diskursstabilisierung
„expansive“
Diskursausdehnung
Semiotischer Schwerpunkt
„iterative“
Diskursstabilisierung
Praxeologischer Schwerpunkt
59
Zur Differenz zwischen formalistischen und kontextualistischen Zugängen vgl. generell White 1999: 43-54.
graduelle
Unterscheidung
68
3) Sedimentierungsdimensionen: Zeichen, Praktiken, Institutionen
Sedimentierung ist der erfolgreiche hegemoniale Instituierungs- und Fixierungsprozess sozia-
ler Verhältnisse, der ihre kontingenten und antagonistischen Ursprünge vergessen macht und
ihnen eine tendenziell objektivierte Präsenz verleiht. Durch Sedimentierungen erhalten Bedeu-
tungsordnungen eine stabilisierte Präsenz und werden somit zu den objektivierten Bestandteilen
der Zivilgesellschaft (S. 95ff). Allerdings sind Sedimentierungsprozesse in hegemonietheore-
tischen Arbeiten und Analysen weitgehend unterkonzeptualisiert geblieben. Die generalisierte
Rede von der Sedimentierung einer hegemonialen Ordnung verdeckt, dass Sedimentierungs-
prozesse im Sinne einer Schichtung geschehen, in der sich leicht politisierbare Gehalte von
tief eingeschriebenen und nur schwer politisch reaktivierbaren Schichten abheben (etwa:
Schicht A = leichte Sedimentierung, hohe Politisierung, Schicht B = tiefe Sedimentierung,
hohe Entpolitisierung, etc.). Sedimentierungsprozesse versteht man am besten, wenn sie im
Anschluss an Gramsci als kulturelle Inkorporierungen und Materialisierungen begriffen werden.
Sedimentierung beschreibt dann, wie Hegemonie ihre Macht als Kultur ausübt, die sich
selbstverständlich in Wissensformen, Anschauungen und Praktiken festsetzt und soziale Ver-
haltens- und Lebensweisen immanent reguliert. Im Folgenden kombiniere ich die Schich-
tungsperspektive auf Sedimentierungsprozesse – bei der ich mich an Wullweber (vgl. 2012:
35-38) orientiere – mit der bereits vorgestellten „entpolitisierten“ Artikulationsweise von poli-
tischen Kulturen: Oberflächliche Sedimentierungen liegen dann vor, wenn instituierte Wis-
sensordnungen noch auf einer weithin semiotisch ausbuchstabierten Ebene fassbar sind. Da-
gegen geschehen tiefergehende Sedimentierungen, wenn Wissensordnungen auch in Praktiken
inkorporiert werden und sich in Institutionen materialisieren.60
Ich lege einen schrittweisen Einschreibungsprozess von Diskursformationen zugrunde, der
bei Zeichenordnungen beginnt, über Praktiken führt und in Institutionen gipfelt. Auf einer kon-
zeptuell-analytischen Ebene müssen drei generelle Sedimentierungsdimensionen unterschieden
werden: eine semiotische Dimension (Zeichenordnungen), eine praxeologische Dimension
(Praktiken) und eine institutionelle Dimension (Institutionen). Diese Dimensionen präzisieren
den pauschalen Sedimentierungsbegriff von Laclau und Mouffe: Sie entschlüsseln auf theore-
tischem Terrain die verschiedenen Verfestigungsgrade von Diskursen und dienen als Leitlinien,
die sich in empirischen Diskursanalysen als heuristische Analyseraster einsetzen lassen.
60
In konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen sind alle drei Sedimentierungsdimensionen zugleich präsent und
werden durch – politisch gestiftete – strukturelle Korrespondenzen (Homologien) miteinander verbunden (S. 95f).
69
a) Semiotische Dimension
Die semiotische Sedimentierungsdimension bewegt sich auf der Ebene expliziter symbolischer
Ordnungen. Sie schließt an die Vorstellung der entpolitisierten Artikulationsweise politischer
Kulturen an, weshalb ich mich hier kurz halte. Aus der Vorherrschaft der Differenzlogik, dem
entpolitisierten Status der Grenze und der iterativen Diskursstabilisierung folgt eine spezifische
Diskursstruktur. Sie orientiert sich an der Verfasstheit hegemonialer Projekte, die mir als der
Idealtypus semiotischer Wissensordnungen gelten. Gegenüber Laclau und Mouffe plädiere ich
aber für ein offeneres und weniger stark homogenisiertes Diskursverständnis. Politische Kultu-
ren sind ein verschwommenes Abbild hegemonialer Projekte: Leere Signifikanten werden zu
pluralen diskursiven Knotenpunkten, Äquivalenzketten zu lockeren Beziehungen der Nähe,
Antagonismen verschwinden oder gehen in diskursinterne Oppositionsbeziehungen über.
Als erstes wird in sedimentierten Diskursen die Universalisierungsfunktion leerer Signi-
fikanten brüchig. An ihre Stelle treten plurale diskursive Knotenpunkte,61
die einzelne Dis-
kursstränge je verschiedentlich artikulieren und den Diskurs nicht mehr als ein Ganzes bezeich-
nen. Anstelle einer zentralen Repräsentationsinstanz gibt es nun mehrere entleerte Signifikan-
ten, die den Diskurs je eigentümlich verdichten. Hatte ein nationalistischer Diskurs etwa in
einer politisierten Phase einen zentralen Signifikanten (wie Nation), so tauchen im Zuge sei-
ner Instituierung unterschiedliche diskursive Knotenpunkte (wie Volk, Verfassungspatriotis-
mus, nationale Folklore, etc.) auf, die unterschiedliche Stränge des Diskurses bündeln und von
keiner übergeordneten Repräsentationsinstanz zusammengehalten werden. Im Zuge der entpoli-
tisierten Verfestigung eines Diskurses kommt es zur – allerdings reversiblen – internen Kom-
plexitätszunahme. Sie untergräbt schrittweise die monistische Universalisierungsfunktion eines
leeren Signifikanten und setzt an ihre Stelle verschiedene diskursive Verdichtungspunkte.
So löst sich auch die starke Kopplung und Gleichsetzung der Diskursmomente auf und
geht über in gelockerte Beziehungen der Nähe. Wo früher starke Äquivalenzen den Diskurs
strukturierten, kommt es bei politischen Kulturen zu abgeschwächten Familienähnlichkeiten.
Die interne Relation der Diskursmomente differenziert sich zusehends aus. Mit ihrer Sedimentie-
rung löst sich etwa die nationalistische Äquivalenzkette von Patriotismus, politischer Tugendhaf-
tigkeit und institutioneller Stabilität auf und wird zu einem Ensemble nur noch locker miteinan-
der verwandter Momente, die ihre differenziellen Identitäten stärker zutage fördern.
61
Indem ich politische Kulturen durch verschiedene Artikulationsinstanzen strukturiert sehe, spiele ich hier die
Position Mouffes, die stets von pluralen Diskursknotenpunkten spricht (vgl. jüngst Mouffe 2013: 30), gegen das
monistische Diskursverständnis Laclaus aus, der die universalisierende Funktion einzelner Signifikanten betont.
Damit unterstreiche ich nicht die Universalisierungs-, sondern die Artikulationsfunktion politischer Kulturen.
70
Letztlich schwächt sich das Moment des Antagonismus ab. Die Entgegenstellung von
antagonistisch-politisierten und befriedet-entpolitisierten Grenzen (frontier vs. border) und
den zwei den Äußerungsformen des konstitutiven Außen, Antagonismus und Heterogenität,
ist idealtypischer Natur. Zwischen beiden Polen gibt es aber ontische Zwischenstadien: Durch
die Sedimentierung politisierter Diskurse werden Antagonismen in abgeschwächte Oppositio-
nen verwandelt. Der frühere Feind verliert schrittweise seine bedrohliche und rein negative Ge-
stalt und wird zu einem diskursinternen Moment, der nicht mehr die Rolle eines konstituieren-
den Diskursaußen spielt – aber erneut zu einem solchen werden kann. Oppositionen bewegen
sich im Diskurs, sie behalten jedoch eine grundsätzliche antagonistische Markierung. Diese
Markierung begünstigt, dass in reaktivierenden Politisierungsphasen diskursinterne Oppositio-
nen erneut zu konstitutiven – und damit diskursexternen – Antagonismen aufgeladen werden.
b) Praxeologische Dimension
Mit der praxeologischen Sedimentierungsdimension verfolge ich ein doppeltes Ziel: Einerseits
zeichne ich nach, wie Bedeutungsordnungen zu Praktiken sedimentieren. Andererseits ergänze
ich den textualistischen Ansatz von Laclau und Mouffe um ein poststrukturalistisches Verständ-
nis von Praktiken, das die Verschachtelung von Diskursen in pragmatische Handlungskontexte
hervorhebt. Praktiken definiere ich mit Reckwitz als „körperlich verankerte Komplexe von im-
plizit sinnhaft organisierten, routinisierten Verhaltensweisen“ (Reckwitz 2008: 44). Im Unter-
schied zu anderen Zugängen liest eine poststrukturalistische Konzeption von Praktiken diese
nicht – sei es über die Begriffe von Erfahrung, Intentionalität oder Kreativität62
– als Gegenbe-
griff intersubjektiver Wissensordnungen, sondern macht sich für ihre Verschränkung stark: Zei-
chenordnungen werden durch Praktiken aktualisiert und verschoben, Praktiken werden durch
Zeichenordnungen strukturiert und in gewisse Bahnen gelenkt. Die bisherige Vorstellung politi-
scher Kulturen zielte mitunter gerade darauf ab, die Diskursordnungen zu beschreiben, die auf
Praktiken einwirken und sie strukturieren. Der Fokus auf Praktiken eröffnet nun seinerseits ein
Verständnis von Diskursformationen, das diese (gegen Laclau und Mouffe) weniger als kohä-
rente Zeichenordnungen mit klaren Strukturen deutet, sondern sie als praxeologisch verankerte
Regelsets liest. Politische Kulturen werden erst dann vollends verständlich, wenn man sie
„entintellektualisiert“ und als „ontologische Narrative“ (Somers 1994: 618) versteht, die sich in
Praktiken festsetzen und zu selbstverständlichen, ja vernatürlichten Deutungsrahmen werden.
62
Poststrukturalistische Handlungstheorien grenzen sich so ab von den Handlungstheorien, die im deutschen Raum
dominieren – von der dokumentarischen Methode (Bohnsack) über die Phänomenologie (Berger/Luckmann) bis hin
zum Pragmatismus und Interaktionismus (Joas). Vgl. die kondensierte Gegenüberstellung von Reckwitz 1999: 29ff.
71
Mein Verständnis der praxeologischen Sedimentierungsdimension stelle ich hier entlang
der Begriffe Iterabilität, Performanz und Lebensform allgemein vor – ihre konkrete Wirkungs-
weise und ihren Zusammenhang erläutere ich mit der Kategorie der kollektiven Serie (S. 78ff).
Zunächst unterstreicht die Iterabilität, dass Diskurse ihre konstitutive und subjektivie-
rende Kraft durch ständige Wiederholungspraktiken entfalten. Bedeutung stabilisiert und re-
produziert sich nämlich, indem sie sich in „gleichförmigen, repetitiven und routinisierten Hand-
lungsmustern“ festsetzt (Moebius 2008: 61). Die Stabilisierung von Diskursen in Praktiken ist
mit Judith Butler als fortwährende Zitationspraxis zu verstehen (vgl. Butler 1998: 75). Jeder
Sinngehalt muss durch Körperpraktiken, Identifizierungen und habitualisierten Verhaltens-
schemata ständig re-zitiert und wiederholt werden (vgl. Moebius 2003: 237). Diskurse sind in
Verhaltensweisen eingefasst und fungieren als deren immanente Regulierungspunkte. Indem in
verschiedenen Handlungssituationen immer wieder bestimmte Normen eingesetzt werden, er-
halten diese rekursiv ihre Wirksamkeit und machen soziales Verhalten grundsätzlich erwartbar
und vorhersehbar. Man denke an die Norm der Zivilität, die dadurch, dass sie in verschiedens-
ten Zusammenhängen eingesetzt wird (nicht bei Rot über die Ampel gehen, seinen Sitzplatz für
alte Menschen freigeben, etc.), dafür sorgt, dass im Alltag bestimmte und grundsätzlich erwart-
bare Verhaltensweisen auftreten. Durch Praktiken avancieren Bedeutungsgehalte ihrerseits zu
selbstverständlichen Orientierungsrahmen, die in routinehafte Praktikenmuster inkorporiert und
habitualisiert sind. Mittels iterativer Wiederholungen avancieren Diskursstrukturen zu vernatür-
lichten Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata,63
die jede soziale Praxis mit Sinn ver-
sehen und sie grundsätzlich stabilisieren. Derart in Praktiken eingefasst, erscheinen Diskurs-
strukturen weniger als abstrakte Codes, sondern vielmehr als prozedurale „Know-How-
Wissensbestände“ (Reckwitz 2000: 578), die den Akteuren oft implizit bleiben. Diese „pragma-
tischen“ Wissensbestände schweben nicht über iterative Zitierungspraktiken, sondern sind in sie
eingebettet und werden ständig durch sie reaktualisiert und verschoben.
Dies führt zum Moment der Performanz. Denn die iterativen Zitierungspraktiken äußern
nicht einfach Bedeutungsgehalte, die in einem anderen Wirklichkeitsregister lokalisiert sind.
Vielmehr sind sie immer auch Hervorbringungsformen von Diskursen. Wie Butler insbesondere
in Bezug auf das heteronormative Geschlechterverhältnis dargestellt hat, wird diese Ordnung in
ihrer mannigfachen praktischen Re-Zitierung immer wieder hervorgebracht und der Möglich-
keit nach auch verschoben (vgl. Butler 1998: 112). Wenn aber die autoritative Kraft von Dis-
kursen von Praktiken abhängt, dann hat jede Praxis das Potential, diskursverschiebend zu wir-
63
Hier eröffnen sich Konvergenzpunkte zwischen poststrukturalen Diskurstheorien und der Distinktionstheorie und
Lebensstilanalyse Pierre Bourdieus, auf die ich nicht eingehen kann (vgl. dazu aber den Ansatz Diaz-Bones 2010).
72
ken. Zwar können diskursive Codierungen durch Praktiken nicht von Grund auf neu geschaffen
werden. Doch ironische Parodien, „falsche“ Aneignungen oder bewusste Verzerrungen können
durchaus auf Diskursordnungen einwirken (vgl. Moebius 2008: 70). Man denke an den Fall,
dass sich eine Hebamme oder eine Ärztin weigern würde, bei der Geburt eines Kindes die ein-
deutige Zuordnung zu treffen: „Es ist ein Mädchen, es ist ein Junge“. Aus poststrukturaler War-
te müssen die Momente von Iterabilität und Performanz stets zusammengedacht werden: Repeti-
tive Wiederholungen gehen notwendig mit Verschiebungen einher. Letztere schützen davor, die
Reproduktion von sedimentierten Bedeutungsgehalten in einer allzu repetitiven, mechanischen
und erstarrten Weise zu deuten. Ihrem Potential nach führt die Performativität von Praktiken zu
Verzerrungen, Brüchen und Dislozierungen in stabilisierten Diskursordnungen (vgl. Butler 2000:
14), die dann politisch reaktivierende Artikulationsbewegungen aufgreifen können.
Die Sedimentierung von Bedeutung in Praktiken äußert sich letztlich über die Entstehung
von Lebensformen. Dieser wittgensteinsche Begriff verweist darauf, dass sowohl iterative als
auch performative Praktiken in Gemeinschaften eingebunden sind. Diese Gemeinschaften sind
aber nicht ein Apriori von diskursiven Prozessen, sondern werden gerade durch Artikulationen
hervorgebracht. Wie in Bezug auf den Traditionsbegriff betont (S. 32-36), schreiben sich stabili-
sierte diskursive Prozesse förmlich in das soziale Leben ein und prägen es gleichsam von innen
heraus. Diskurse werden zu tradierten Verhaltenskodizes, zu persistenten Traditionen, die als
intergenerationale Narrative ständig aufgegriffen und reaktualisiert werden. Wie Mouffe in Be-
zug auf demokratische Werte betont, sind diese nicht ein Set formaler Prozeduren, sondern kon-
stitutive Bestandteile moderne Gemeinschafts- oder eben Lebensformen (vgl. Mouffe 2008:
74). So äußert sich etwa der Wert der Gleichheit nicht nur in der politischen Sphäre, sondern
auch in der Sphäre des Privaten, in Freundschafts- und Intimbeziehungen.64
Lebensformen sind deshalb wichtig, weil sie als sozialer Rahmen fungieren, durch den
diskursive Gehalte auf Dauer gestellt werden. Erst durch Lebensformen bilden sich stabilisierte
und aufeinander verweisende Muster von Praktiken. Die Regelhaftigkeit, aber oft auch die Per-
formativität von Praktiken erklärt sich durch die Eigenheiten und Ausprägungen spezifischer
Lebensformen: An sich zwar ein Produkt artikulatorischer Prozesse, wirken sie in konkreten
geschichtlichen Zusammenhängen auf diskursive Prozesse als Kontexte ein und drücken ihnen
ihren Stempel auf. So wie einerseits die Etablierung gewisser Bedeutungsgehalte nicht ohne
64
Um die Verwobenheit von Lebensformen und Bedeutungsstrukturen zu pointieren, ließen sich Lebensformen in
Abwandlung von Stanley Fishs Konzept der „interpretive communities“ (vgl. Fish 1980) auch als Deutungsgemein-
schaften bezeichnen. Wo Fish relativ eng auf Rezeptionspraktiken von Texten fokussiert, setzt der Begriff der Deu-
tungsgemeinschaft genereller an: Mit ihm könnte man die Gesamtheit der diskursiven Praktiken und Deutungsrah-
men bezeichnen, die ein Kollektiv auszeichnen und ihn als spezifische Lebensform hervorbringen.
73
gemeinschaftliche Einstimmung geschieht, so kommt es andererseits bei politischen Artikula-
tionen maßgeblich darauf an, Lebensformen hervorzubringen, die „ihre“ Diskurse reproduzie-
ren und in Praktiken verankern. Wittgenstein paraphrasierend (vgl. 2006: 356), werden in hege-
monialen Deutungs- und Gestaltungskämpfen jene Lebensformen kreiert, stabilisiert oder hin-
terfragt, in denen man zur scheinbar selbstverständlichen Übereinstimmung findet.
c) Institutionelle Dimension
Die Sedimentierung von Diskursen und ihre praxeologische Verstetigung in gewissen Lebens-
formen leiten über zur institutionellen Sedimentierungsdimension. Wie in der Kritik an
Laclau und Mouffe wiederholt moniert worden ist, mangelt es ihrer Diskurstheorie an einer
schlagkräftigen Konzeption von Institutionen (vgl. Geras 1987: 79, Simons 2011). Einerseits ist
dieser Kritik entgegenzuhalten, dass zwischen (neo-)institutionalistischen und poststrukturalen
Ansätzen derart divergente sozialontologische Ausgangspunkte und Forschungsinteressen herr-
schen, dass eine Synthese beider Ansätze kaum denkbar scheint. Es ist insofern nicht nur folge-
richtig, dass Laclau und Mouffe an der prinzipiellen Nichtreduzierbarkeit von Diskursen auf
Institutionen festhalten, sondern auch die Vorrangigkeit von Diskursen gegenüber Institutio-
nen betonen. Hegemonietheoretisch zugespitzt, entstehen Institutionen als Effekt breiterer
Diskursformationen. Die sozialen Verhältnisse und Konfliktlinien etwa, die in einem privatwirt-
schaftlichen Betrieb herrschen, werden erst dann verständlich, wenn man sie in übergeordnete
Diskurskontexte einbettet (hier: das hegemoniale Projekt der freien Markwirtschaft).65
Andererseits zeigt jedoch die Kritik am institutionellen Defizit von Laclau und Mouffe
richtigerweise auf, dass die Autoren das Feld der Institutionen bisher weitgehend unthematisiert
gelassen haben. Zwar betonen sie prinzipiell im Anschluss an Althussers Ideologietheorie, dass
Diskurse in Institutionen verkörpert („embodied“) sind (vgl. Laclau/Mouffe 2001: 109), sie
führen dies jedoch (anders als Althusser) nicht auf systematische Weise aus. Mein Fokus auf
die institutionelle Dimension von Sedimentierung versteht sich folglich als ein Schritt in die
Richtung einer präziseren Ausbuchstabierung des „Moments der Institution“ innerhalb der
Hegemonietheorie. Meine Lefort- und Gramsci-Rezeptionen machten bereits geltend, dass
Institutionen aus zwei verbundenen Gründen interessant sind: Erstens sind Institutionen als
Sedimentierungseffekte hegemonialer Fixierungen präziser zu fokussieren. Gramsci zeigte, dass
institutionelle Strukturen (von der Schule über die Presse bis hin zur Kirche) eine entscheidende
65
Die prinzipielle hegemonietheoretische Vorrangigkeit von Diskursformationen vor Institutionen habe ich ge-
meinsam mit Hildebrand gegen die Machttheorie von Giddens ins Feld geführt (Hildebrand/Lluis 2012: 202ff).
74
Rolle bei der Stabilisierung und Reproduktion von Ideologien spielen. Zweitens verdeutlichte
Lefort, dass Institutionen nicht per se ordnungsstabilisierend wirken, sondern auch Ausgangs-
punkte politischer Instituierungsakte sein können. Mit dem Moment der Inszenierung (mise en
scène) machte Lefort darauf aufmerksam, dass das Politische als ontologischer Gründungsmo-
ment sozialer Verhältnisse immer auch bestimmter ontischer Institutionen bedarf. Die demokra-
tische Selbstregierung eines Gemeinwesens etwa ist nicht ohne eine instituierte Verfassung und
funktionierende demokratische Institutionen denkbar. Möchte beispielsweise eine neue politi-
sche Kraft die Gesellschaft verändern, dann muss sie sich stets auf institutionelle Kanäle stüt-
zen. Sie kann etwa zu einem parlamentarischen Akteur (einer Partei) werden; oder sie kann ein
Netz von zivilen Vereinen, Organisationen, Medien, etc. einrichten, die ihre kulturelle Hege-
monie forcieren. Wie oben pointiert, besitzt das Politische institutionelle Ankerpunkte im ge-
sellschaftlichen Raum. Es ist diese Doppelperspektivierung von Institutionen über Gramsci und
Lefort, die ich verfechte: Institutionen können stabilisierende Depolitisierungseffekte mit sich
bringen, sie können aber auch reaktivierende Politisierungswirkungen zeitigen.
An dieser Stelle tätige ich nur eine Reihe grundlegender Vorbemerkungen zu meinem
Institutionsverständnis, die das Unterkapitel III. Öffentliche Sphären ausbaut und in mein Zi-
vilgesellschaftskonzept einbettet (S. 85ff). Ich orientiere mich prinzipiell an der gramsciani-
schen Lektüre von kulturellen Organisationen und nehme das gesellschaftlich instituierte Netz
von Kommunikationsstrukturen in den Blick. Kommunikationsstrukturen bestehen aus einem
materiellen Konglomerat von Organisationen, die Diskurse stabilisieren, reproduzieren und
hervorbringen, weshalb ich diesbezüglich auch von institutionalisierten Diskursproduzenten
spreche. Diskursproduzenten reichen von Kommunikationsmedien (Radiosender, Internetsei-
ten, Zeitungen, etc.) über etablierte politische Organisationen (Parteien, Gewerkschaften, poli-
tische Stiftungen, etc.) bis hin zum Vereinswesen. Meine Lesart von institutionalisierten Akt-
euren als Produzenten diskursiver Themen, Deutungsmuster und Subjektpositionen orientiert
sich zwar konzeptuell an der wissenssoziologischen Diskursanalyse, verleiht ihr jedoch eine
hegemonietheoretische Wendung: Diskursproduzenten artikulieren niemals uneingebettet und
„souverän“ bestimmte Diskurse bzw. Diskursstränge, sondern sind in übergreifende diskursi-
ve Horizonte eingebunden. Diskursproduzenten begreife ich auf diese Weise als „signifying
institutions“ (Hall 1982: 86), denen eine aktive Rolle bei der Herstellung kultureller Hegemo-
nien zukommt. Ihre Signifikationspolitiken haben einerseits den Charakter offen ausgetrage-
ner kollektiver Deutungskämpfe, die sich um die „legitime“ Rahmung, Perspektivierung und
Gestaltung sozialer Sachverhalte drehen. Andererseits nehmen Diskursproduzenten ihre Rolle
75
als „Hegemonieapparate“ (Marchart 2008: 160) aber auch auf subtilere Weise ein, nämlich
indem sie Wahrnehmungsmacht ausüben: Werden gewisse Subjektpositionen, Forderungen
oder kollektive Identitäten in einen Raum der öffentlichen Sicht- und Wahrnehmbarkeit ge-
rückt, so werden andere, schwächere Positionen a priori von ihm ausgeschlossen und in eine
weitgehende Unsichtbarkeit gestoßen. Diskursproduzenten schaffen eine symbolische Karto-
graphie der sozialen Wirklichkeit, sie strukturieren Bedeutungsordnungen.
Wenn freilich alle Kommunikationsformen umkämpften Signifikationspolitiken gleich-
kommen, so gilt ebenfalls: Auch die übergeordneten diskursiven Arenen, in denen diese Kom-
munikation zusammengefasst ist, weisen eine politische Verfassung auf. Es wird sich zeigen,
dass sich Diskursproduzenten zu übergreifenden öffentlichen Sphären aggregieren. Meine for-
male, entsubstantialisierte und streng deskriptive Öffentlichkeitskonzeption geht davon aus,
dass die Zivilgesellschaft durch verschiedene öffentliche Sphären strukturiert wird, die sich in
Über- und Unterordnungsverhältnissen gegenüberstehen und sich antagonistisch in Frage stel-
len. Die Bildung, (Um-)Besetzung oder Auslöschung öffentlicher Sphären ist ein Schlüsselin-
dikator für den Stand hegemonialer Kämpfe. Gelingt es politischen Kulturen, sich in Diskurs-
produzenten einzuschreiben und öffentliche Sphären zu besetzen, dann stabilisiert und entfaltet
sich ihre organische Vorherrschaft oder, in meinem Duktus, ihre passive Hegemonie.
Zeichen, Praktiken und Institutionen oder, genauer, institutionelle Diskursproduzenten bilden
die drei übergeordneten Leitachsen von Sedimentierungsprozessen. Damit präzisiere ich das
schematische Sedimentierungsverständnis Laclaus und Mouffes. Diese drei Sedimentierungs-
dimensionen bilden in ihrem konkreten Zusammenspiel das voll heraus, was ich inspiriert durch
Gramscis Konzept der organischen Ideologie als politische Kultur bezeichne. Die semiotische,
die praxeologische und die institutionelle Sedimentierungsdimension sind verschiedene Aus-
prägungen von politischen Kulturen. Jedoch habe ich bisher lediglich die befriedete diskursive
Artikulationsweise politischer Kulturen und damit ihre semiotische Dimension ausbuchstabiert.
Dagegen wurden Praktiken und Institutionen bisher nur allgemein vorgestellt – ihre präzise
Ausprägung und ihre Verwobenheit in politischen Kulturen wurde noch nicht geklärt. Die
nächsten Schritte gehen nun auf diese beiden Ebenen ein und arbeiten sie zu den Konzepten
kollektive Serie (praxeologische Dimension) und öffentliche Sphäre (institutionelle Dimension)
aus. Indem ich zudem kollektive Serien und öffentliche Sphären als Bestandteile politischer Kul-
turen konturiere, verbinde ich die drei Begriffe zu einer konzeptuellen Trias: Sie dechiffriert die
zivilgesellschaftliche Struktur und plausibilisiert ihren Status als politischen Raum.
76
II. Vom Alltagsverstand zur kollektiven Serie
Die gramscianische Kategorie des Alltagsverstandes legte offen, wie sich ideologische Gehalte
im kulturellen Leben niederschlagen. Wie Gramsci eindrücklich anhand des Katholizismus
zeigte, nahm dieser im italienischen Mezzogiorno den Status einer Volksreligion an, die alle
Bereiche des Gesellschaftslebens durchdrang – von religiös geprägten Traditionen bis hin zu
wertekonservativen politischen Verhaltensweisen. Es ist diese kulturelle Verfestigung, diese
„Versteinerung“ der Ideologie in unpolitischen und alltäglichen Anschauungen, Praktiken und
Lebensformen, die Gramscis Konzeption des senso comune prägnant auf den Begriff bringt.
Die Kategorie der kollektiven Serie schließt insofern an Gramscis Verständnis des All-
tagsverstandes an, als auch sie nachzeichnet, wie sich Wissensformationen in Praktiken nie-
derschlagen, festsetzen und zu selbstverständlichen Lebensformen im Sinne Wittgensteins
avancieren. Die relativ engere Fokussierung des Serienbegriffes auf Formen der Kollektivität,
die in Praktiken auf Dauer gestellt werden,66
ist dabei auch darauf gerichtet, das hegemoniethe-
oretische Verständnis für die hegemoniale Sedimentierung, kulturelle Verstetigung und politi-
sche Reaktivierung kollektiver Identitäten zu schärfen. Der Begriff der kollektiven Serie ent-
wirft auf diese Weise ein praxeologisch informiertes Verständnis von Kollektivität. Er legt dar,
wie kollektive Identitäten in Praktiken und Lebensformen auf Dauer gestellt werden.
Der Serienbegriff stellt sich der zentralen Frage, die von Laclau und Mouffe im Grunde
unbehandelt bleibt: Warum gelingt es gewissen Kollektivitätsformen, sich in politischen Arti-
kulationen als einflussreiche leere Signifikanten zu behaupten? Wie erklärt sich die Aktualität
von Signifikanten wie Geschlecht oder Ethnizität, der Niedergang von Kategorien wie Prole-
tariat oder Bauernschaft oder das schillernde Wiederauftauchen des Nationen- und Volksbe-
griffes? Um zu veranschaulichen, dass der Begriff der kollektiven Serie hierauf eine Antwort
bieten könnte, führe ich ihn im systematischen Rückgriff auf die oben dargelegten Kategorien
von Lebensform, Iterabilität und Performativität ein und lehne mich an Iris M. Young an. Ich
mache kollektive Serien in ihrem Doppelstatus als Sedimentierungs- und Entstehungsform von
Kollektivität stark: Sie sind unstrukturierte Kollektivitäten, „unities in flight“ (Young 1994:
726). Kollektive Serien gehen der verästelten Sedimentierung und dem Aufkommen von Kol-
lektivität nach und umreißen dadurch ihre politischen Möglichkeitsräume.
66
Genau genommen, geht mit der Kategorie der kollektiven Serie gegenüber der des Alltagsverstandes eine zu-
gleich engere und weitere Perspektive einher. Der Serienbegriff setzt einerseits enger an, weil er nicht prinzipiell
alle Formen von Praktiken und Lebensformen in den Blick nimmt, sondern nur das relativ enge Set derer, die mit
Kollektivitätserscheinungen zusammenhängen. Andererseits ist aber die Kategorie der kollektiven Serie auch
breiter als die des senso comune angelegt: Gegenüber der relativ starren Konzeption Gramscis liest der Serien-
begriff „sedimentierte Praktiken“ als dynamische und grundsätzlich politisch reaktivierbare Handlungsflüsse.
77
1) Kollektive Serien – gestaltlose Kollektivitäten
In Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective (1994) führt Young
inspiriert durch Sartres Konzept der serialité den Begriff der Serialität ein, um in der feministi-
schen Theoriebildung für ein alternatives Kollektivitätsverständnis zu sensibilisieren. Gegen-
über der essentialistischen Konzeption von Geschlecht als faktisch gegebener, starrer Gruppe
und ihrer radikalkonstruktivistischen Infragestellung schlägt der Serialitätsbegriff einen drit-
ten Weg vor. Nach Young offenbaren Serialitäten, die ich im Folgenden als kollektive Serien67
bezeichne, dass sich Kollektive bereits dort abzeichnen, wo es (noch) keine diskursiven Iden-
titätszuschreibungen, antagonistische Wir/Sie-Grenzen oder explizite Gruppenzugehörigkeiten
gibt. „The series is a blurry, shifting unity, an amorphous collective“ (Young 1994: 728). Um
an einem einfachen Beispiel zu illustrieren, was Young mit derartigen amorphen oder gestaltlo-
sen Kollektiven meint: Man denke an die Wartenden einer Bushaltestelle, die bis auf ihr ge-
meinsames Warten auf den Bus nichts vereint, sie besitzen keine gemeinsamen Ziele oder
Identitätsmerkmale. Allerdings kommt das Warten auf den Bus einer serienhaften Praktik
gleich, die aus den Passanten eine passive Einheit macht (ebd.: 733). Käme der Bus nicht,
dann würden sich die Wartenden gegebenenfalls organisieren, Sammeltaxis rufen oder
schlimmstenfalls eine gemeinsame Klage beim Transportunternehmen einreichen. Aus der pas-
siven Einheit der Wartenden ginge ein homogenes, handlungsfähiges Kollektiv hervor.
Serien sind nicht nur – wie das Passantenbeispiel nahelegen könnte – als potentielle
Gruppen auf der Mikro-Ebene angesiedelt, sondern ebenso der gleichsam unauffällige Unter-
bau makrologischer Identitäten wie Klasse, Ethnie, Nation oder eben Geschlecht (vgl. ebd.:
731f). Nach Young erklärt sich die Kraft dieser Kollektivitätsformen dadurch, dass sich bei
ihnen parallel zu expliziten Identitätszugehörigkeiten repetitiv wiederholte Muster von Prakti-
ken zu stabilen Bündeln verdichten (ebd.: 725). Pointiert formuliert, steht hinter jeder kol-
lektiven Identität ein Ensemble von Praktiken, eine kollektive Serie.
Arbeitet man den Serienbegriff vom phänomenologischen Ansatz Youngs in einen post-
strukturalen Theorierahmen ein und erweitert man ihn grundbegrifflich, dann enthüllt sich sein
Potential als analytischer Ergänzungsbegriff zum semiotisch und antagonistisch ansetzenden
Verständnis von kollektiver Identität, das die Hegemonietheorie verficht. Ich zeichne nun
zunächst anhand meiner praxeologischen Leitbegriffe nach, wie Kollektivitätsformen sedi-
mentieren, um im darauffolgenden Schritt ihre politische Entstehungsform zu verfolgen.
67
Ich habe mich der konzeptuellen Griffigkeit halber gegen die in den deutschen Übersetzungen gebräuchlichen
Konzepte von Serialität, serielle Kollektivität oder kollektive Serialität entschieden.
78
2) Stabilisierungsfaktoren: Kontext, Regel, Wiederholung
Kontexte sind für die Sedimentierung von Kollektivität zentral. Kontexte stehen im Zusammen-
hang mit dem oben ausgeführten Begriff der Lebensform: Kontexte sind eine Ausprägung von
Lebensformen. Lebensformen sind der soziale Rahmen, der ursprünglich durch Artikulationen
hervorgebracht wurde, in konkreten ontischen Zusammenhängen aber auf Artikulationen zu-
rückwirkt. Kontexte als sedimentierte Artikulationsprodukte strukturieren dann ihrerseits Arti-
kulationsprozesse. Man denke daran, wie durch die demokratische Revolution gewisse Lebens-
formen ins Leben gerufen werden, die von einem Set politischer Institutionen (Parlament, Wah-
len, Justiz, etc.) bis hin zu privaten Vergemeinschaftungsformen (Freundschafts- und Intimbe-
ziehungen) reichen. Lebensformen sind so die Kontexte von Artikulationen. Als Kontexte wir-
ken sie auf Artikulationen ein und wirken regulierend und eingrenzend auf sie (vgl. Grossberg
2006: 5). Kontexte sind hier in ihrer mikrologischen und praxeologischen Dimension zu fokus-
sieren. Praktiken als körperlich verankerte Verhaltensweisen, die in Raum und Zeit stark einge-
schränkt sind, sind in situative Kontexte eingebunden. Diese sind die objektivierten oder eben
sedimentierten Strukturen,68
die Praktiken stabilisieren. Kontexte stehen Praktiken als faktische,
nur schwer veränderbare Realitäten gegenüber, sie sind ihre übergeordneten Formierungsfakto-
ren. Praktiken sind in Kontexte eingebettet und werden durch sie in gewisse Bahnen gelenkt.
Die formierende Kraft von Kontexten tritt noch deutlicher hervor, wenn sie mit dem
Moment der Iterabilität verbunden wird. Iterabilität meint die sequentielle Gleichförmigkeit
von Praktiken über verschiedene Situationen hinweg (vgl. Reckwitz 2006b: 712). Mit Butler
betonte ich, dass sich Praktiken dadurch stabilisieren, indem in verschiedenen Handlungssitu-
ationen gewisse diskursive Gehalte immer wieder zitiert werden (S. 71f). Der Kontextbegriff
erlaubt nun, die iterative Zitierung von Bedeutung selbst zu kontextualisieren. Bedeutungszi-
tierung ist immer in Gebrauchszusammenhänge eingeflochten. So wie Handlungskontexte mit
semantischen Gehalten aufgeladen sind, so ist Bedeutung in pragmatische Kontexte eingebet-
tet (S. 12f). Mit Wittgenstein (vgl. 2006: 262) gesprochen, sind semantische Gehalte immer
mit ihrem pragmatischen Gebrauch verbunden. Die Geltung einer übergeordneten Norm wie
jener der Zivilität ist nicht schlicht gegeben, sondern muss in mannigfachen Situationen (ge-
sittetes Verhalten in der Arbeit, Befolgung der Verkehrsregeln, ehrenamtliches Engagement)
gebraucht werden, um überhaupt Geltung und Bedeutung zu erlangen.
68
Auf diese Weise erfüllen Kontexte eine grundsätzlich vergleichbare Funktion wie der Begriff der „praktisch-
inerten Realität“ bei Young (vgl. 1994: 725f), mit dem die Autorin auf phänomenologischem Wege zeigt, wie
sich Praktiken zu gesellschaftlichen Zusammenhängen verfestigen und „verobjektivierten“, um dann ihrerseits
als geronnene soziale Strukturen Praktiken einzuschränken und sie zu regulieren.
79
Die Frage, in welchen Situationen welche Zitationspraktiken zum Einsatz gebracht wer-
den, führt sodann zum Begriff der Regel. Regeln oder genauer Gebrauchsregeln definieren,
wann und wie gewisse Zitationen eingesetzt werden. Gebrauchsregeln legen fest, zu welchen
Zeitpunkten welche Know-how-Wissensbestände und welche Handlungsskripts angewendet
werden müssen. Der Einsatz spezifischer Zitationspraktiken in spezifischen Situationen ist alles
andere als zufällig, sondern folgt gewissen Vorgaben. Zugleich darf man sich Gebrauchsregeln
nicht in strukturalistischer Manier als übergeordnete semiotische Codes vorstellen, die Prakti-
ken äußerlich dirigieren. Gebrauchsregeln sind Praktiken immanent, sie sind Effekte der stän-
digen Wiederholung gewisser Muster von Praktiken.69
Iterativen Re-Zitationspraktiken wohnt insofern eine selbststrukturierende Tendenz inne.
Kraft der ständigen Wiederholung gewisser Bedeutungsgehalte in gegebenen Kontexten formie-
ren sich immanent Gebrauchsregeln, die dann ihrerseits eine objektivierende Wirkung entfal-
ten: Sie stellen gewisse Zitationspraktiken auf Dauer und verbinden sie mit spezifischen Kon-
texten. Die Iterabilität von Praktiken und ihre Strukturierung durch Gebrauchsregeln verwei-
sen zirkulär aufeinander und bringen sich gegenseitig hervor: Wiederholungen kristallisieren
sich zu Regeln, und Regeln stabilisieren wiederum Wiederholungen.
Die praxeologische Begriffstrias Kontext, Iterabilität und Regel erlaubt, die Sedimentie-
rung von Kollektivität in drei Schritten genauer auszubuchstabieren: Zunächst geschieht die he-
gemoniale Stabilisierung von Kollektivformen als Festsetzung von Identitäten in Kontexten. Diese
Sedimentierung also ist nicht primär auf einer rhetorischen Signifikationsebene angesiedelt (als
Signifikant „Frau“, „Arbeiter“, etc.), sondern vornehmlich ein konkreter Vorgang. Die Versteti-
gung der Identität „Frau“ etwa geschieht dadurch, dass sie sich in verschiedenen Kontexten (am
Arbeitsplatz, an der Schule, in der Privatsphäre, etc.) einschreibt und zu ihrem selbstverständli-
chen Bestandteil wird. Wie Young betont, folgt aus dieser kontextuellen Verfestigung auch eine
tendenzielle Unsichtbarmachung von Identität. Die Einschreibung der Identität „Frau“ in gewis-
se Kontexte geht mit einer Veralltäglichung einher, die schrittweise vergessen macht, dass die-
se Identität als Identität überhaupt in diesem Kontext wirksam ist. Ein Arbeitskontext, in dem
Männer die Führungspositionen innehaben und Frauen nur als Sekretärinnen arbeiten dürfen,
enthält zwar gewisse weibliche und männliche Identitätsformen. Aber diese sind derart mit
Kontexten verschmolzen, dass sie zu den vernatürlichten Bestandteilen gewisser Handlungssi-
tuationen werden und ihr „konstruierter“ Charakter verschleiert wird: „A series is not a mutual-
ly acknowledging identity with any common project or shared experience“ (Young 1994: 735).
69
Wittgenstein versteht die Regelbefolgung und -anwendung als „Gepflogenheit“. Sie ist eine natürliche Routine,
die Praktiken nicht äußerlich dirigiert, sondern mit ihnen unauflösbar verbunden ist (Wittgenstein 2006: 344).
80
Sodann geschieht die Verfestigung von Kollektivität als ein interkontextueller Vorgang.
Wenn ein hegemoniales Projekt seine Bedeutungsordnung fixiert (etwa die heteronormative
Ordnung), dann muss man sich diese Fixierung auf der Mikro-Ebene von Praktiken so vorstel-
len, dass in einer Vielzahl von Kontexten ähnliche Zitationspraktiken von Bedeutung (hier:
die binäre Geschlechterordnung) angetrieben werden. Dass es allerdings zu derartigen Ver-
vielfältigungen von Zitationen kommt, geschieht nicht als mechanischer Ausdruck einer Be-
deutungsordnung, sondern als schrittweise und langsame Ausbreitung ähnlicher Gebrauchsre-
geln über verschiedene Kontexte.70
Die Regeln des einen Kontextes (etwa dem Arbeitsplatz)
werden stets – schwächer oder stärker – von den Regeln des anderen Kontextes (etwa der
Kleinfamilie) abweichen: Regeln gehen immanent aus situativen Praktiken hervor. Die Re-
geln, die Zitationspraktiken regulieren, sind unauflösbar an Kontexte gebunden. Hegemoniale
Bedeutungsfixierungen schweben nicht über Kontexten, sondern entfalten sich in ihnen.
Letztlich erfolgt die Sedimentierung kollektiver Identitäten als ein Vervielfältigungspro-
zess. Damit widerspreche ich der (impliziten) Annahme Laclaus und Mouffes, dass kollektive
Identitäten als fixierte Signifikanten über verschiedene Situationen hinweg gleich bleiben
(vgl. Schatzki 1996: 196f). Wenn sich eine Identität in verschiedenen Kontexten festsetzt und
dort auf Dauer gestellt wird, fächert sich ihre Bedeutung auf. Aus einer übergeordneten kol-
lektiven Identität entsteht eine Vielzahl kollektiver Serien, die sich je unterschiedlichen Kontex-
ten zuordnen. Aber die Praktiken und Regeln, die die Serien stabilisieren und reproduzieren,
unterscheiden sich je nach Kontext grundsätzlich voneinander. Der Serienbegriff nimmt damit
ins Visier, wie sich kollektive Identitäten in unterschiedlichen Kontexten niederlassen und
dadurch eine Zersplitterung erleben. Hinter einer scheinbar homogenen Zeichenordnung bewe-
gen sich verschiedenste Praktikenkonstellationen, denen allen eigene Regelhaftigkeiten inne-
wohnen. Hinter einer kollektiven Identität steht eine Pluralität kollektiver Serien, die verschie-
dene Subjektivierungsweisen entfalten. Allerdings teilt trotz dieser Zersplitterung eine Familie
kollektiver Serien (hier: die kollektive Identität „Frau“) strukturelle Korrespondenzen miteinan-
der, die auf einen zwar abgeschwächten, aber weiter anwesenden Diskurshorizont verweisen.
Die diskursiven Gemeinsamkeiten kollektiver Serien werden durch politische Kulturen
garantiert. Sie verhindern, dass die Zersplitterung von Serien je restlos ist. Analog zu politischen
Kulturen (S. 64f), verschüttet bei Serien denn auch die antagonistische Aufladung. Die Präsenz
des Antagonismus schwächt sie bei ihnen ab – tauchen jedoch konflikthafte Wir/Sie-Grenzen
auf, dann ist das ein Indiz dafür, dass sich Serien erneut zu politischen Kollektiven formieren.
70
Die Gebrauchsregel des „Frau-Seins“ in der Kleinfamilie wird sich unterscheiden vom „Frau-Sein“ am Arbeits-
platz, an der Universität oder im öffentlichen Leben.
81
3) Entstehungsformen: von der Performanz zur Lebensform
Die bisherigen Ausführungen zeichneten nach, wie kollektive Identitäten zu kollektiven Serien
sedimentieren. Dieser Sedimentierungsprozess gleicht einem Auffächerungsprozess: Einzelne
kollektive Identitäten zerfallen zu einer Pluralität kollektiver Serien. Die Vervielfältigung
eines leeren Signifikanten zu einer Vielzahl von Serien geschieht im Rahmen von Kontexten:
Sie strukturieren Praktiken. Wie am Beispiel der Geschlechtsidentität erläutert, bilden sich in
Kontexten spezifische Muster von Praktiken heraus, denen jeweils eigene Regelhaftigkeiten
innewohnen. Je nach Kontext unterscheiden sich die Zitationsregeln für Bedeutungsgehalte (der
Identität „Frau“) grundlegend voneinander. Die Kategorie der kollektiven Serie fokussiert ge-
nau diese Einbettung oder, stärker, diese Einflechtung kollektiver Identitäten in Kontexte.
Jedoch wohnt der Sedimentierung von Identitäten zu Serien auch eine inhärente Instabi-
lität, Brüchigkeit und Dynamik inne. Identitäten stabilisieren sich nicht nur in Serien, sondern
entstehen auch aus Serien heraus. Es sind zwei Momente, die für die Nicht-Fixierbarkeit von
Serien sorgen und sie zu potentiellen Identitäten machen. Erstens ist dies die Überschneidung
verschiedener kollektiver Serien in Kontexten. Die Sedimentierung von Identitäten in Kontex-
ten wurde bisher nur aus heuristischen Gründen als unidimensionaler Prozess gelesen: Serien
setzen sich in unterschiedlichsten situativen Kontexten fest und überschneiden, durchkreuzen
und destabilisieren sich dort gegenseitig. Am Beispiel der Manageridentität verdeutlicht: Inner-
halb des konkreten Kontextes einer Firma sind möglicherweise verschiedene Bedeutungen da-
von festgesetzt, wie die Manageridentität auszuführen ist. Sie kann dem Modell eines auf work-
life-balance bedachten Managers entsprechen, sie kann aber auch eher als nachhaltige Identität
auftreten (Stichwort: corporate responsibility) oder sie kann gar als neoliberale Identität er-
scheinen, die nur auf Profitmaximierung gerichtet ist. Aufgrund dieser stets gegebenen Über-
schneidung gegenläufiger Serien in Kontexten stellt sich den Akteuren fortwährend „das Prob-
lem der Kontingenz und der Handlungsunsicherheit“ (Reckwitz 2000: 627).
Die Überschneidung von Serien in Kontexten sensibilisiert dafür, dass die Sedimentie-
rung von Identität nicht einer homogenen und hyperstabilen Verfestigung gleicht – zumal wenn
sie, zweitens, in Verbindung mit der Performanz von Praktiken gelesen wird. Nach Butler meint
Performanz das verschiebende und dynamisierende Potential von Zitierungspraktiken. Gerade
in relativ mehrdeutigen Kontexten werden verschiebende Re-Zitierungspraktiken begünstigt.
Im Kontext einer neu gegründeten Organisation (z.B. einer Partei), in der Rollenerwartungen
noch nicht klar fixiert sind, könnten parodische, „falsche“ oder verzerrende Zitationen von Be-
82
deutung begünstigt, toleriert oder gar gefördert werden. Mehr noch, jeder iterativen Zitierungs-
praktik wohnt potentiell ein Verschiebungspotential inne. Wie das derridasche Konzept der dif-
férance darlegte, ist die endgültige Stabilisierung von Bedeutungsstrukturen unmöglich. Iterati-
ve Praktiken sind stets performativ aufgeladen. Sie kopieren nicht ein Original, sondern zitieren
es zu neuen Zeitpunkten und in anderen Zusammenhängen: Jedes Zitat verschiebt die Identität
des Wiederholten und schreibt ihm Dezentrierungen ein (vgl. Moebius 2003: 232).
Überschneidungen und Performanzen verhindern, dass die Sedimentierung kollektiver
Identitäten zu kollektiven Serien jemals vollständig ist. Immanente Überschneidungen und per-
formative Praktiken dezentrieren kollektive Serien – und lassen aus ihnen konstitutiv dezentrier-
te Identitäten hervorgehen. Die letzte Instabilität von Bedeutungsstrukturen setzt sich in jedem
Kontext fest. Sie dient als Ausgangspunkt für politische Reartikulationen, die kollektive Serien
erneut zu übergeordneten kollektiven Identitäten verweben. Der politische Formierungsprozess
von kollektiven Serien hin zu kollektiven Identitäten beinhaltet vier analytische Momente.
Erstens, und als Vorbedingung, verweisen kollektive Serien auf übergeordnete kollektive
Identitäten. Trotz ihrer kontextuellen Einbettung verweisen Zitationspraktiken weiter auf über-
geordnete Zeichen. Die Verschiebung und Dezentrierung von Identitäten durch Kontexte ist nie
vollständig. Kollektive Serien erfahren nie eine völlige Pluralisierung und Zersplitterung, son-
dern sind weiter mit Diskursen verbunden. Die pragmatische Sedimentierungsdimension (kol-
lektive Serie) ist stets flankiert durch die semiotische Dimension (politische Kultur). Ge-
schlechtsidentitäten etwa sind zwar in verschiedenen Kontexten seriell unterschiedlich ausge-
prägt, sie verweisen aber weiter auf übergeordnete diskursive Knotenpunkte des „Frau-Seins“.
Die Spannung zwischen kontextueller Partikularität (kollektive Serien) und semiotischer Uni-
versalisierung (kollektive Identitäten) ist für Identifikationsprozesse konstitutiv und nur graduell
auflösbar. In politischen Formierungsprozessen kommt es nun zur Dominanz der semiotischen
Dimension von Identitäten. Sie unterhöhlt die Unterschiede zwischen kollektiven Serien, stellt
ihre Gemeinsamkeiten heraus und macht sie zu Teilgliedern eines homogenisierten Diskurses:
So vergeht die latente Einbindung von kollektiven Serien in politische Kulturen. Serien avancie-
ren erneut zu kollektiven Identitäten, die sich in hegemonialen Projekten ansiedeln.
Dies führt zweitens zur Vorherrschaft der Äquivalenz- vor der Differenzlogik. Die impli-
zite Bedingung für die Sedimentierung und Pluralisierung von kollektiven Identitäten zu kol-
lektiven Serien ist die Vorherrschaft einer differenzierenden Artikulationslogik, welche die
Gemeinsamkeiten zwischen den Serien in den Hintergrund stellt und ihre Eigenidentität be-
tont (S. 15f). Diese Logik kehrt sich in der politischen Reaktivierung von Serien zu Identitäten
83
um. Nicht mehr der Unterschied, sondern die Gemeinsamkeit der Serien rückt ins Zentrum.
Die Äquivalentsetzung der Serien geschieht aber nicht nur auf einer semiotischen, „textuel-
len“ Ebene, sondern auch auf der Ebene von Praktiken. Die kontextuell gebundenen Regeln
von Praktiken werden in den Hintergrund gedrängt und die Zitationsgehalte erhalten eine zent-
rale Stellung. Wo zuvor die je verschiedenen Regeln spezifischer Serien standen (etwa Frausein
am Arbeitsplatz, in der Privatsphäre, etc.), setzen sich jetzt politisierende Äquivalentsetzungen
durch: Sie forcieren die Vereinigung der Serien unter breitere Identifikationspunkte.
Drittens geschieht die Äquivalentsetzung kollektiver Serien als eine progressive Bindung.
Mit dem Bindungsbegriff, den ich Anderson (vgl. 1998: 43f) entlehne, lässt sich das Schwanken
von Identität zwischen Differenz und Äquivalenz, zwischen Sedimentierung und Politisierung,
präzisieren. Die Diffusion kollektiver Identitäten zu kollektiven Serien führt einen ungebunde-
nen Zustand herbei. Als ungebundene Serien nehmen Identitäten eine kontextuelle und „hybri-
de“ Ausprägung an, die ihre Zuordnung zu spezifischen Makro-Identitäten erschwert (vgl. Liu
1999: 153). Dagegen befördert die politische Reaktivierung von Serien einen Bindungsprozess.
Serien durchlaufen eine Homogenisierung, die ihre kontextuellen Unterschiede unterwandert
und sie unter übergeordnete Identitäten vereint. Aus dieser Bindung folgt eine tendenzielle Ho-
mogenisierung, Formalisierung und Totalisierung von Kollektivität. Wo sich zuvor Kollektivi-
tätsformen in mikrologischen Praktikenkontexten quasi gesondert reproduzierten, stehen nun
klar gebundene Makro-Identitäten – wie sie sich exemplarisch in Kategorien wie Ethnie, Ge-
schlecht oder Klasse kundtun. Mit der Bindung wird auch die die antagonistische Dimension
von Kollektiven reaktiviert. Homogenität nach innen heißt im Umkehrschluss: antagonistische
Grenzziehung nach außen. Gebundene Kollektivitäten grenzen sich konflikthaft gegenüber ei-
nem Außen ab, um sich selbst als einheitliche und handlungsfähige Akteure zu signifizieren.
Viertens folgt aus dem politischen Formierungsprozess kollektiver Identitäten, dass sich
gefestigte Lebensformen bilden. Einerseits spielen Lebensformen auf der mikrologisch seriel-
len Ebene die Rolle fester Kontexte. Sie umschließen Praktiken, formen sie und lenken sie in
spezifische Bahnen. Anderseits erhellt die Formierung übergeordneter kollektiver Identitäten,
wie Lebensformen überhaupt entstehen. Lebensformen bilden ein ausgedehntes Ensemble
verbundener Kontexte, die sich durch gemeinsame Identitätsformen auszeichnen. Lebensfor-
men spielen die Rolle von sozialen Rahmungen, die spezifische Sets von Praktiken und Dis-
kursen enthalten. Die bindende Äquivalentsetzung von Serien bewirkt damit nicht nur eine
destabilisierende und Kontext zersetzende Rolle, sie schafft auch neue Kontexte, die ihrerseits
gewisse Identitätsformen stabilisieren und auf Dauer stellen. Pointiert gesagt, folgt aus der
84
Infragestellung alter Rahmungen notwendig die Bildung neuer Rahmungen, die nicht minder
handlungsregulierend wirken. Die kollektive Identität „Arbeiterklasse“ etwa ging aus der
Bindung einer Vielzahl spezifischer Serien und der damit einhergehenden Lebensformen ein-
her, die von Handwerkern über Bauern bis hin zur Kleinbourgeoisie reichte. Hand in Hand mit
der Formierung und Stabilisierung der Arbeiteridentität entstand eine umfassende Arbeiterkul-
tur, die verschiedenste soziale Bereiche umspann und als ein riesiges Ensemble von Handlungs-
kontexten (Vereine, Gewerkschaften, Parteien, etc.) den „praxeologischen Unterbau“ bildete,
auf dem die kollektive Identität der Arbeiterklasse gründete. So wie also auf der einen Seite
die politische Formierung kollektiver Identitäten tradierte Lebensformen in Frage stellt und
zersetzt, so schafft sie auf der anderen Seite auch neuartige Lebensformen. Durch sie stabili-
sieren und reproduzieren sich aufs Neue kollektive Serien – die dann ihrerseits in reaktivie-
renden Politisierungsprozessen zu kollektiven Identitäten verbunden werden.
Die Entstehung, Infragestellung und Neubildung von Lebensformen durch die Artikula-
tion kollektiver Identitäten ist ein ständig sich vollziehender Kreislauf. Die befriedete Repro-
duktion kollektiver Serien und die politisierende Artikulation kollektiver Identitäten gehen
permanent ineinander über. So wie in jeder Serie durch Überschneidungen und Performanzen
konstitutive Dezentrierungen eingeschrieben sind, so bringt jede Identität sedimentierte Le-
bensformen hervor, die immer wieder aufs Neue kontextualisierend wirken. Kollektive Serien
und kollektive Identitäten verweisen aufeinander: Die mikrologische und pragmatische Serie
ist nicht denkbar ohne die makrologische und semiotische Identität, und vice versa. Kollektive
Serie und kollektive Identität sind die zwei idealtypischen Achsen, um die sich die Formie-
rung, Stabilisierung und Neubildung von Kollektivität dreht. Das Schaubild synthetisiert diesen
kontinuierlichen Sedimentierungs- und Formierungskreislauf von Kollektivität:
Zersplitterung
kollektive Identität
leerer Signifikant
Serie 1
kollektive Serien
Kollektivitätsformen in Kontexten
Stabilisierung: iterative Praktiken und
kontextspezifische Regeln
Serie 2
(inhärente)
Destabilisierung:
Überschneidung
von Serien und
Performanz Serie 3
Soziale Sedimentierung
(von Identität zu Serie)
1. (Bedingung) Angewiesenheit
von Serie auf Identität
2. Äquivalenzlogik
3. Bindung (& damit: erneute
antagonistische Aufladung)
4. Entstehung von Lebensformen,
in denen sich Identität stabilisiert
und reproduziert
Politische Formierung
(von Serie zu Identität)
85
III. Von kulturellen Institutionen zu öffentlichen Sphären
Nach der Vorstellung der Konzepte politischer Kultur und kollektiver Serie gilt es, auf das
letzte Glied meines Zivilgesellschaftsbegriffes, die öffentliche Sphäre, einzugehen. Der Be-
griff der öffentlichen Sphäre folgt Gramscis Verständnis von kulturellen Institutionen als Re-
produktionsinstrumenten, Stabilisierungsfaktoren und Ausbreitungsvehikel der Ideologie. Insti-
tutionen wie die Schule, die Presse oder die Kirche sind die materiellen Apparate, mittels derer
es organischen Ideologien gelingt, verschiedenste soziale Feldern zu strukturieren, auf den All-
tagsverstand einzuwirken und ihre hegemoniale Deutungsmacht durchzusetzen.
Antwortete das Konzept der kollektiven Serie auf die ungenügende Theoretisierung von
Kollektivität seitens der Hegemonietheorie und betonte, dass sich kollektive Identitäten in situa-
tiven Kontexten als Serien festsetzen, so begegnet das Konzept der öffentlichen Sphäre dem
institutionellen Defizit bei Laclau und Mouffe. Zwar erkennen die Autoren prinzipiell an, dass
Institutionen als Effekt von Artikulationen entstehen, sie buchstabieren aber nicht aus, wie diese
Institutionen geartet sind und welche Zusammenhänge sich zwischen ihnen bilden. Diese Fra-
gen sind aber insofern wichtig, als Artikulationen stets in einem geschichtlich vorstrukturierten
Terrain geschehen, dem institutionelle Ausformungen innewohnen. Lässt man Institutionen un-
theoretisiert, dann entgehen nicht nur die Sedimentierungseffekte hegemonialer Prozesse, son-
dern auch die institutionellen Ankerpunkte politischer Gründungsversuche. Institutionen sind
als soziale Sedimentierungseffekte und politische Ausgangspunkte von maßgeblicher Relevanz.
Mein Hauptgedanke ist, dass öffentliche Sphären stabilisierte Kommunikationsstruktu-
ren sind, die sich aus einem Ensemble von institutionellen Diskursproduzenten (Kommunika-
tionsmedien, Vereine, Parteien, etc.) zusammensetzen. Öffentliche Sphären sind damit nichts
anderes als die Bezeichnung für den Zusammenschluss institutioneller Akteure. Wichtig ist,
dass öffentliche Sphären – und damit Diskursproduzenten – von Artikulationsprozessen durch-
drungen werden: Die Bildung, (Um-)Besetzung oder Auslöschung öffentlicher Sphären ist einer
der zentralen Gradmesser für den Stand hegemonialer Auseinandersetzungen. Sie legen offen,
wie sich die Kämpfe um die hegemoniale Deutungshoheit entwickeln. Demgemäß sind öffentli-
che Sphären nur im Plural zu haben: In der Zivilgesellschaft siedelt sich eine Vielzahl über- und
untergeordneter öffentlicher Sphären an und stellt sich wechselseitig in Frage. Es wird sich zei-
gen, dass sich in gegenwärtigen westlichen Gesellschaften einzelne dominante liberal-
demokratische öffentliche Sphären von einer Vielzahl subalterner Gegenöffentlichkeiten abhe-
ben. Die Pluralität von öffentlichen Sphären erklärt sich dadurch, dass sie durch übergreifende
Diskurshorizonte gerahmt werden. Genauso wie kollektive Serien sind auch öffentliche Sphären
86
Bestandteile von politischen Kulturen: Dominante öffentliche Sphären sind ein Teil hegemonia-
ler politischer Kulturen, gegenhegemoniale Sphären sind in subalterne politische Kulturen ein-
gebunden. Wie schon bei den kollektiven Serien betont, ist die Differenzierung der drei Sedi-
mentierungsdimensionen – Zeichen, Praktiken und Institutionen – analytischer Natur: De facto
stehen politische Kulturen (semiotische Dimension), kollektive Serien (praxeologische Dimen-
sion) und öffentliche Sphären (institutionelle Dimension) in einem politischen Zusammenhang,
dessen überwölbende Klammer politische Kulturen sind.
Im Folgenden entwickle ich mein Verständnis von öffentlichen Sphären als Ensembles
von Diskursproduzenten in drei Schritten. Erstens konturiere ich im Rückgriff auf die wissens-
soziologische Diskursanalyse institutionalisierte Akteure als Diskursproduzenten. Sie bilden die
Grundelemente von öffentlichen Sphären und sind konstitutiv mit diskursiven Logiken verbun-
den. Zweitens gebe ich mit den Cultural Studies dem Begriff der Diskursproduzenten eine poli-
tische Fassung: Diskursproduzenten entfalten spezifische Signifikationspolitiken, die im Zei-
chen hegemonialer Deutungskämpfe stehen. Drittens betrachte ich den Zusammenschluss von
Diskursproduzenten unter öffentlichen Sphären und lese sie als diskursive Arenen. Sie forcieren
einerseits den Allgemeinheitsbezug und die Strukturierung politischer Artikulationen. Ande-
rerseits bilden sich zwischen diskursiven Öffentlichkeitsarenen umkämpfte (und umkehrbare)
Über- und Unterordnungsverhältnisse heraus.
1) Institutionelle Akteure als Diskursproduzenten
Hatte ich in den vorherigen Schritten die Strukturierungsleistung politischer Artikulationen
auf der semiotischen und praxeologischen Ebene unter den Rubriken politische Kultur und
kollektive Serie betrachtet, so fokussiere ich nun den institutionellen Niederschlag von Arti-
kulationsprozessen. Institutionen sind zwar ein Effekt von Artikulationen, sie entfalten aber eine
Eigendynamik, die auf diskursive Prozesse zurückwirkt. Um diese Strukturierungsleistung ana-
lytisch in den Blick zu bekommen, lege ich einen engen Institutionenbegriff zugrunde. Er liest
Institutionen als sowohl formale als auch assoziative Organisationsgebilde mit gewissen Mit-
gliedschaftsregelungen, Strukturen und Zielen.71
Dafür bediene ich mich Reiner Kellers empha-
tischem Verständnis von Institutionen als „handlungsfähigen“ Gebilden, das von Parteien und
Verbänden über Protestbewegungen bis hin zu Massenmedien reicht. Keller rückt damit die
„institutionell-organisatorische“ Rahmung von Diskursen in den Fokus (Keller 2011a: 147).
71
Siehe zum grundsätzlichen soziologischen Organisationsbegriff anstelle vieler Tacke 2008: 211ff, zum allge-
meinen Verständnis von Organisation als Ordnungs-, Gebilde- und Vergemeinschaftungsform: Türk et al. 2006.
87
Diskursproduzenten sind die Medien,72
durch die hindurch diskursive Prozesse operie-
ren und ihren Einfluss entfalten. Keller definiert institutionelle Akteure wie folgt: Sie sind
„kollektive Produzenten von Aussagen, die unter Rückgriff auf spezifische Regeln und Res-
sourcen durch ihre Interpretationen und Praktiken einen Diskurs (re-)produzieren und trans-
formieren“ (Keller 2011b: 234). Diese Definition institutioneller Akteure als kollektive Dis-
kursproduzenten unterstreicht ihre eigenständige Rolle in diskursiven Prozessen. Durch Dis-
kursproduzenten werden Diskurse interessebezogen, strategisch und taktisch mobilisiert und
verbreitet (vgl. Keller 2011a: 147). Institutionen strukturieren und verstärken Artikulations-
prozesse.73
Zudem stellen institutionelle Akteure Praktiken der Produktion, Zirkulation und
Fixierung von Bedeutung auf Dauer und machen sie zu verstetigten Kommunikationsflüssen
(vgl. Hall 1989a: 134). Dieses grundsätzliche Verständnis von Diskursproduzenten kann nun
mit Annie Waldherr analytisch nuanciert werden. Ihre Unterscheidung fächert die Aktivitäts-
grade von sozialen Akteuren auf: Diskursproduzenten können passiv Themen filtern (Ga-
tekeeper), sie können aber auch Bedeutung zielorientiert stabilisieren (Themenunternehmer)
oder scheinbar selbstständig Diskurse produzieren (Diskursproduzenten im engen Sinne).
Als Gatekeeper übernehmen institutionelle Akteure die Rolle der Selektion und Aus-
wahl von Diskursgehalten, die in bestimmte Diskurshorizonte gehören – oder von ihnen aus-
geschlossen sind. Die Filterfunktion von Diskursproduzenten stabilisiert so die entpolitisierten
Grenzen politischer Kulturen. Zur Erinnerung: Letztere grenzen sich nicht konflikthaft gegen-
über ihrem konstitutiven Außen ab, sondern signifizieren schlechterdings nicht mehr das, was
jenseits ihres Horizontes liegt. An die Stelle des bedrohlichen Antagonismus tritt die nicht-
markierte Heterogenität. Die Gatekeeperrolle institutioneller Akteure macht kenntlich, wie
entpolitisierte Grenzziehungen institutionalisiert und verstetigt werden. Der Selektionsprozess
von Gatekeepern gleicht einem subtilen Entscheidungsprozess darüber, welche diskursiven
Gehalte (Themen, Diskursstränge, Subjektpositionen, etc.) in gewissen Horizonten auftauchen
dürfen und welche a priori davon ausgeschlossen sind. Wenn etwa ein linkspositioniertes
Nachrichtenportal ausführlich über die Aktivitäten einer sozialen Bewegung berichtet, hinge-
gen aber das aktuelle Finanzmarktgeschehen vollkommen ausblendet, dann trifft es eine Se-
72
Meine Ausführungen verstehen sich aber nicht ausschließlich als ein „medialer“ Unterbau der Hegemoniethe-
orie, sondern als genereller Bezugsrahmen, der ein Verständnis für die Institutionalisierung von Artikulations-
prozessen entwickelt. Diese Rahmen fungiert als ein genereller Ausgangspunkt. Von ihm ausgehend könnte man
zum einen eine medientheoretische Ergänzung der Hegemonietheorie vornehmen. Zum anderen lässt sich mit
ihm aber auch eine organisationstheoretische Komplementierung von Laclaus und Mouffes Ansatz erwägen. 73
Diese diskursive Verstärkungs- und Strukturierungsleistung von Diskursproduzenten erstreckt sich sowohl auf
die von Laclau und Mouffe betonten Äquivalenzen, antagonistische Grenzziehungen und Universalisierungen (=
Politisierungsdynamiken) als auch die von mir hervorgehobenen Differenzen, entpolitisierte Grenzen und diskursi-
ve Pluralisierungen (= Entpolitisierungsdynamiken).
88
lektion darüber, welche Phänomene mit „Bedeutung“ ausgestattet werden und welche gar
nicht erst als solche auftauchen. Institutionelle Gatekeeper schirmen den Diskurs nach außen
ab, indem sie das verwerfen, was nicht zu ihm gehören darf.
Als Themenunternehmer tragen institutionelle Akteure dazu bei, die Begriffe, Subjekt-
positionen und Strategien von politischen Kulturen gesellschaftlich zu stabilisieren und zu
verbreiten. Akteure bedienen nämlich Deutungsrahmen („frames“), in denen spezifische Ver-
hältnisse, Abfolgen und Gruppierungen von Begriffen, Subjektpositionen und Strategien fi-
xiert sind. Mit Gamson und Modigliani kann man institutionelle Akteure als Frame-Sponsoren
oder eben Themenunternehmer verstehen. Über Berufspolitiker, Journalisten, Vereinsvorsitzen-
de, Aktivisten etc. verbreiten sie auf eine professionalisierte Weise Deutungsrahmen. „Frame-
Sponsorship involves such tangible activities as speech making, interviews with journalists,
advertising, article and pamphlet writing“ (Gamson/Modigliani 1989: 6). Einerseits ist die Insti-
tutionalisierung von Themenunternehmern – über bestimmte Parteien, Vereine, sympathisieren-
de Massenmedien, etc. – ein Hinweis dafür, dass es einer Diskursformation gelungen ist, ihre
Bedeutungsgehalte hegemonial zu fixieren und gesellschaftlich zu verankern. Andererseits zei-
gen die Veränderungen, Destabilisierungen oder Auslöschungen von Themenunternehmern auf,
dass umkämpfte De-/Reartikulationen von Diskursen im Gange sind. Wenn sich eine politi-
sche Partei auflöst oder abrupt eine andere politische Position einnimmt, dann zeigt dies: Eine
Bedeutungsordnung ist „ins Hintertreffen“ geraten und wird zusehends von anderen Projekten
verdrängt. Die Existenz, Proliferation oder Auslöschung von Themenunternehmen enthüllt
folglich, ob und wie die hegemoniale Stabilisierung von Diskursformationen und der zu ihnen
gehörenden Begriffe, Subjektpositionen und Strategien gelingt.
Letztlich erscheinen institutionelle Akteure als Diskursproduzenten im engen Sinne,
wenn Diskursordnungen politisch disloziert oder neu artikuliert werden. Diskursproduzenten
werden dann zum „Anzeichen“ für die Initialzündung politisierender Artikulation. Akteure er-
heben in solchen Situationen eine angeblich eigene Stimme, beziehen Position und greifen pro-
aktiv gewisse Themen auf. So beispielsweise, wenn eine Zeitung über Kommentare und Leitar-
tikel plötzlich einen neuen Standpunkt vertritt, der von ihrer bisherigen politischen Linie ab-
weicht, oder wenn sie sich für neue Inhalte interessiert und recherchiert, die bisher nicht auf
ihrer Agenda standen (vgl. Waldherr 2008: 178). Das veranschaulicht: Die Rolle institutioneller
Akteure als aktive Diskursproduzenten ist dort angesiedelt, wo sie scheinbar selbstständig und
nicht von externen Akteuren, Deutungsmustern oder Konjunkturen vorgegeben eine eigene Po-
sition einnehmen – und damit zum Vehikel reaktivierender politischer Artikulationen werden.
89
2) Umkämpfte Signifikationspolitiken
Die Beschreibung von Institutionen griffe zu kurz, wenn sie diese nur als Apparate von Artiku-
lationen lesen würde. Institutionen dienen nicht nur als Gatekeeper (= Stabilisatoren diskursiver
Grenzen) und Themenunternehmer (= Stabilisatoren diskursiver Konstellationen) der entpoliti-
sierten entpolitisierten Reproduktion von politischen Kulturen. Ihre Rolle erschöpft sich auch
nicht darin, als Diskursproduzenten im engen Sinne ein Anzeichen von Politisierungen zu sein.
Außerdem verarbeiten institutionelle Akteure Bedeutung. Sie entfalten im Zeichen hegemonia-
ler Deutungskämpfe spezifische Signifikationspolitiken: Diskursproduzenten kartographieren
Bedeutungsordnungen, objektivieren sie und organisieren den gesellschaftlichen Konsens.
Im Anschluss an Hall definiere ich institutionelle Diskursproduzenten als „signifying
institutions“ (Hall 1982: 86), die soziales Wissen selektiv konstruieren und bereitstellen. Dis-
kursproduzenten stellen Bedeutungsartikulationen nicht nur auf Dauer, sie strukturieren auch
Kommunikationsflüsse. Institutionelle Akteure greifen bestimmte Ereignisse auf, versehen sie
mit Bedeutung und beurteilen sie. Diese Codierung von Ereignissen spitzt sich auf eine mediale
Kartographierungsleistung der sozialen Wirklichkeit zu (vgl. Hall 1979: 341). Diskursprodu-
zenten konstruieren „Landkarten der Bedeutungen“, sie „entwerfen ein ganzes Inventar an Bil-
dern, Lebensstilen und Klassifikationen, welches es den Leuten erlaubt, die soziale Realität zu
kartographieren, zu regeln, sie in eine bestimmte Ordnung und imaginäre Kohärenz zu brin-
gen und sich selbst darin zurechtzufinden“ (Hall, zit. nach Marchart 2008: 166).
Die von institutionellen Akteuren geleistete symbolische Kartographierung der Wirk-
lichkeit schafft eine Ordnung und Inventarisierung der Bilder, Symbole und Bedeutungen, die
in einer Gesellschaft kursieren. So üben Institutionen eine subtile Wahrnehmungsmacht aus
(vgl. zum Begriff Imbusch 1998: 16). Sie rücken gewisse Ereignisse in einen Raum der Sicht-
barkeit und schließen andere davon aus. Es entstehen mediale Inklusionen und Exklusionen,
die eine Grenze ziehen „between preferred and excluded explanations and rationales, between
permitted and deviant behaviours, between the meaningless and the meaningful“ (Hall 1979:
341). Die Bedeutungscodierung von Diskursproduzenten ist immer selektiv: Schon die reine
Auswahl einer Nachrichtensendung über die bedeutsamen (und damit auch die unbedeuten-
den) Ereignisse gibt Aufschluss über die ideologisch-politische Positionierung des Senders.
Als Effekt medialer Kartographierungen entstehen um Diskursformationen räumlich-
historische Perimeter im Sinne Michael Freedens (1996: 78ff). Historische Ereignisse (etwa
nationale Gründungsmythen) und geographische Gegebenheiten (etwa die Flüsse, Berge und
Meere einer Nation) werden zu scheinbar unumstößlichen Fixpunkten von Bedeutungsordnun-
90
gen gemacht. Indes sind diese Perimeter keineswegs objektive Fakten. Vielmehr sind sie selbst
symbolische Konstrukte und imaginäre Codierungen. Mediale Repräsentationen suggerieren,
dass eine natürliche, fraglose Verwobenheit von Bedeutungsordnungen mit historischen Ereig-
nissen und räumlichen Gegebenheiten herrscht (vgl. Werlen 2008: 386). Die durch Diskurspro-
duzenten geleistete Codierung ist also immer auch eine zeitliche und räumliche Codierung.
Die mediale Kartographierung der sozialen Wirklichkeit durch Diskursproduzenten lei-
tet über zu ihrer Rolle als hegemoniale „Konsensmanufakturen“ (Marchart 2005: 25). Diskur-
sproduzenten tragen auf zwei komplementäre Weisen zur Formung des hegemonialen Konsen-
ses bei: Erstens befördern institutionelle Akteure die Strukturierung und Stabilisierung von
Diskursformationen. Wie unter den Rubriken Gatekeeper, Themenunternehmer und Bedeu-
tungskartographen ausgeführt, befördern institutionelle Akteure diskursive Typisierungen und
Strukturierungen. Institutionen regulieren und definieren Bedeutungsstrukturen. Als Gatekeeper
verarbeiten institutionelle Akteure diskursive Ereignisse und schließen andere aus. Als The-
menunternehmer werden sie zu den aktiven Sponsoren spezifischer Deutungsrahmen und stellen
somit Konstellationen von Begriffen, Subjektpositionen und Strategien sicher. Als Bedeutungs-
kartographen verwandeln sie politische Kulturen in imaginäre Raum/Zeit-Konfigurationen.
Kurz: Diskursproduzenten bauen Diskurse zu umfassenden Diskursuniversen aus.
Zweitens dehnen Diskursproduzenten die Kontexte aus, innerhalb derer sich Diskurse
bewegen und entfalten. Unter Kontexten sind die Handlungsrahmen zu verstehen, die Muster
von Praktiken – und damit kollektive Serien – umfassen und eingrenzen (S. 78). Diskursprodu-
zenten befördern nun die schrittweise Ausweitung dieser Kontexte. Sie transformieren unmit-
telbare und eingegrenzte Handlungsrahmen in umfassende gesellschaftliche Kontexte (vgl. zum
Begriff Bohnsack 1995: 83). Sind ohne institutionelle Akteure nur unmittelbare Face-to-Face-
Interaktionen und stark begrenzte Praktiken möglich, so entstehen durch mediale Repräsentati-
onsleistungen ausgedehnte diskursive Räume, die ein weites Repertoire an Kollektivsymboli-
ken, Praktikenmustern und Institutionen enthalten. Bezüglich der Herausbildung von kol-
lektiven Identitäten aus kollektiven Serien folgt daraus: Die Bindung, d.h. die Ausweitung und
Homogenisierung, kollektiver Serien ist auf die kontexterweiternde Funktion von Diskurspro-
duzenten konstitutiv angewiesen.74
Zwar resultieren aus der „Bindungsleistung“ von institutio-
nellen Akteuren nicht automatisch ausgedehnte Kollektive (d.h. kollektive Identitäten). Aber
Diskursproduzenten sind die notwendige Bedingung jedes politischen Bindungsprozesses.
74
Wie Anderson (1991) gezeigt hat, konnte sich beispielsweise in der Moderne das Kollektivbewusstsein einer
„nationalen Identität“ nur unter Bedingung des vereinheitlichenden Mediums der Presse durchsetzen. Er sie
erlaubte es allen Mitgliedern eines Staates, sich (simultan) als Bürger einer nationalen Identität zu imaginieren.
91
3) Öffentliche Sphären
Der in Abgrenzung zur habermas’schen Kategorie der Öffentlichkeit75
gewählte Begriff der
öffentlichen Sphäre bezeichnet den Zusammenschluss von institutionellen Diskursproduzenten
zu übergreifenden diskursiven Arenen. Diskursproduzenten stehen nicht isoliert nebeneinander,
sondern werden durch politische Kulturen zu spezifischen Gruppierungen zusammengefasst.
Öffentliche Sphären bringen diese Gruppierungen auf den Begriff – und zeitigen ihrerseits ei-
gentümliche diskursive Effekte. Dabei vertrete ich nicht ein substantiell oder normativ aufgela-
denes, sondern ein streng deskriptives Verständnis öffentlicher Sphären.76
Spricht man von
konkreten öffentlichen Sphären, die etwa liberal-demokratisch, plebejisch oder gar faschistoid
verfasst sind, so ist immer zu beachten: Öffentliche Sphären sind ausschließlich institutionelle
Ausformungen zugrunde liegender politischer Kulturen. Meine Konzeption von öffentlichen
Sphären beinhaltet drei zentrale Charakteristika, auf die ich der Reihe nach eingehe: Allge-
meinheitsbezug, Strukturgebung und (konflikthafte) Pluralität.
Wie bereits der Begriff des Öffentlichen verdeutlicht – und beim englischen und franzö-
sischen public noch prononcierter zutage tritt –, besitzen öffentliche Sphären einen Allge-
meinheitsbezug. Öffentliche Sphären sind Zusammenschlüsse vieler Diskursproduzenten. Und
als solche machen sie diskursive Prozesse für eine breite Allgemeinheit zugänglich. An dieser
Stelle lässt sich Leforts Begriff der Inszenierung (mise en scène) wiederaufgreifen: Er be-
schreibt, wie sich die politische Gründung des Gemeinwesens durch ein Set an Institutionen
selbst repräsentiert oder inszeniert. Öffentliche Sphären sind ein solches „politisches Theater“
(Rebentisch 2011: 366). Sie sind im buchstäblichen Sinne diskursive Arenen. Öffentliche Sphä-
ren können politische Ausschlüsse und Setzungen als Ausschlüsse und Setzungen markieren.
Zwei aufeinander verweisende Begriffe pointieren diese theatralische Funktion. Zum
einen stoßen öffentliche Sphären eine Sichtbarmachung hegemonialer Auseinandersetzungen
an: Zusammenschlüsse von Diskursproduzenten machen Artikulationsbewegungen transpa-
rent. Mit Lefort gesprochen, transponieren öffentliche Sphären sozialimmanente Spaltungen
und Konflikte in ein anderes, in ein symbolisches Wirklichkeitsregister. Sie gewährleisten, dass
Artikulationsprozesse in Repräsentationsräumen stattfinden und in einem gewissen Sinne
75
Habermas liest die „Öffentlichkeit“ als offenen, symmetrischen und machtfreien Raum, in dem sich Bürger ver-
nünftig über die Anliegen des Gemeinwesens verständigen. Die Öffentlichkeit wird so zur legitimationsstiftenden
Grundlage des politischen Systems. Dagegen gelten mir mit Mouffe (2006: 11) öffentliche Sphären (im Plural) als
symbolische Rahmen politischer Artikulationen. Ihr normatives Potential liegt darin, Dissensräume zu sein, die
Macht- und Ausschlussakte ans Licht bringen können, „that hegemonic forces attempt to keep concealed“ (ebd.). 76
Öffentlichkeit lese ich als einen Sachverhalt (eine Situationsbeschreibung): Er betont die allgemeine Zugänglich-
keit eines Raumes und entspricht dem republikanischen Gedanken der res publica (vgl. Kleinsteuber (2011: 412).
92
„transparent“ werden. Wenn aus einer sozialen Bewegung heraus Medien (Zeitungen, Radios,
Internetseiten, etc.) und politische Akteure (Parteien, Vereine) entstehen, dann gewährleistet
dieses Netz von Diskursproduzenten eine allgemeine Zugänglichkeit der Forderungen und
Kollektivitätsformen der Bewegung. Zum anderen sorgen öffentliche Sphären als diskursive
Arenen für eine Ereignishaftmachung, um einen foucaultschen Begriff aufzugreifen (vgl.
Foucault 1992: 31). Demzufolge können die in politischen Artikulationen getroffenen Macht-
und Ausschlussakte auch als solche symbolisiert werden. Diese allgemeine Sichtbarkeit führt
damit zu einer generellen Transparenz der Grenzziehungen, die Diskurse für ihre Konstitution
bedürfen. Diskursive Arenen wie Parlamente, Parteien oder Kommunikationsmedien machen
potentiell die antagonistischen Grenzziehungen politischer Artikulationen offenkundig, die da-
mit in ihrer Partikularität und Grundlosigkeit entschleiert werden können.
Des Weiteren befördern öffentliche Sphären Strukturgebungen. Diese haben eine dop-
pelte Ausrichtung. Strukturgebungen richten sich nach innen und stabilisieren die Ordnung von
Diskursformationen, sie richten sich aber auch nach außen und forcieren die Strukturierung der
Gesellschaft als Ganzes. An dieser Stelle ist daran zu erinnern, wie Diskursproduzenten in ihrer
Rolle als Gatekeeper (= Stabilisatoren diskursiver Grenzen) und Themenunternehmer (= Stabi-
lisatoren diskursiver Konstellationen) auf diskursive Prozesse zurückwirken und diese stabili-
sieren. Diese nach innen gerichtete Strukturgebung geschieht als schrittweiser Organisations-
prozess77
von Diskursen. Die institutionelle Äußerungsform von Diskursformationen, etwa als
parlamentarische Fraktionen – und damit als Teil der liberal-demokratischen öffentlichen Sphä-
re (s.u.) – wirkt ihrerseits auf Diskursformationen zurück und verleiht ihnen ein spezifisches
Gepräge. Die Summe der parlamentarischen Stellungnahmen und Positionspapiere, Wahlpro-
gramme, Pressemitteilungen, Regierungsentscheidungen, etc. strukturiert Bedeutungsordnun-
gen und treibt ihre progressive Stabilisierung und Ausbuchstabierung an.
Zudem verstärken öffentliche Sphären äußere Strukturgebungen. Der Allgemeinheits-
bezug öffentlicher Sphären setzt nämlich Diskurse unter erhöhten Legitimationsdruck: Sie müs-
sen zusehends als öffentliche Diskurse auftreten, die die Interessen des Gemeinwesens legitim
vertreten. Der öffentliche Legitimationsdruck verstärkt die hegemoniale Ausrichtung von Dis-
kursformationen. Durch die Einbettung in öffentliche Sphären sind Diskursordnungen gezwun-
gen, ihre partikularen Positionen glaubwürdig als Allgemeininteressen darzustellen. Damit wird
die die Verbreitung und Produktion hegemonial ausgerichteter Diskurse angetrieben. Zwar ma-
chen öffentliche Sphären Macht- und Ausschlussakte transparent und entschleiern potentiell
77
Organisation nicht als spezifisch-empirische Organisiertheit, sondern als genuin symbolische Organisation von
Diskursstrukturen zu übergreifenden und weithin kohärenten Formationen.
93
ihre Partikularität und Grundlosigkeit. Zugleich dynamisieren sie aber die Verwandlung von
partikularen Interessen in gesellschaftsübergreifende, allgemein akzeptierte Weltauffassungen.
In dieser Lesart dienen öffentliche Sphären der hegemonialen Konsensstiftung – sie sind keines-
wegs jene utopischen Ideale, als die sie die deliberative Demokratietheorie begreifen möchte.
Letztlich stehen sich in der Zivilgesellschaft plurale öffentliche Sphären konflikthaft
gegenüber. Innerhalb eines politischen Raumes gibt es eine Vielzahl von über- und unterge-
ordneten öffentlichen Sphären. Mit Mouffe gehe ich davon aus, dass in westlichen Gesell-
schaften die vorherrschende öffentliche Sphäre liberal-demokratisch verfasst ist. Sie dreht
sich um die Werte von Freiheit und Gleichheit: Sie hält liberal die individuellen Freiheits- und
Menschenrechte hoch, behauptet aber auch demokratisch soziale Rechte und Volkssouveräni-
tät (vgl. Mouffe 2008: 52f). Die liberal-demokratische Sphäre wird nicht von einer einzelnen
politischen Kultur getragen, sondern von einer lockeren Koalition verschiedener politischer
Kulturen. Diese reichen von neoliberalen zu rechtspopulistischen, von konservativen zu sozi-
aldemokratischen, von traditionalistischen zu sozialistischen Formationen. Sie zeichnen sich
alle durch ihre gemeinsame – aber verschieden gewichtete – Verpflichtung auf die Freiheits-
und Gleichheitswerte der demokratischen Revolution aus. Die liberal-demokratische Sphäre
ist eine Metasphäre. Sie fungiert als breiter symbolischer Rahmen, in dem Konflikte gezähmt
ausgetragen werden. Die Formationen, die sich in dieser Sphäre verorten, erkennen sich als
legitime Gegner an (vgl. Mouffe 2005: 30). Sie sind nicht Antagonisten, sondern Agonisten,
die ihre jeweiligen Machtansprüche grundsätzlich respektieren und die Pluralität eines symbo-
lischen Raumes verteidigen, der durch ihre politische Kompromissbildung getragen wird.
Dieser Pluralismus78
zeichnet die liberal-demokratische Sphäre normativ aus. Sie ist der insti-
tutionelle Ausdruck davon, dass es einem demokratischen Gemeinwesen gelingen kann, Kon-
flikte symbolisch zu entschärfen, antagonistische Macht- und Ausschlussakte in ihrer „Ereig-
nishaftigkeit“ zu problematisieren und Hegemonialwerdungen umkehrbar zu halten.
In der liberal-demokratischen öffentlichen Sphäre entsteht ein verdichtetes Beziehungsge-
füge von Artikulationen, die tendenziell aufeinander verweisen. Die Gegner de- und reartikulie-
ren ihre jeweiligen Bedeutungsgehalte, Deutungsrahmen und kollektiven Identitäten und zertifi-
zieren sich damit ihre gegenseitige Legitimität – als Ideologeme, Parteien, Bewegungen, Verei-
ne etc. Jedoch ist die Kehrseite dieser Verdichtung von Artikulationsprozessen nach „innen“ die
weitgehende Nichtanerkennung von Formationen, die außerhalb der liberal-demokratischen
78
Jedoch vertritt Mouffe nicht einen klassischen, sondern einen antagonistischen Pluralismus. Die Kompromiss-
bildung zwischen liberal-demokratischen Akteuren ist prekärer Natur und lässt sich politisch aufkündigen: Agonis-
tische Gegnerschaften können jederzeit wieder in antagonistische Feindschaften umschlagen (vgl. Mouffe 1993: 4).
94
Sphäre stehen. So etwa religiös-fundamentalistische Positionen, rechts- und linksextreme Kräfte,
außerparlamentarische Oppositionen oder radikale soziale Bewegungen: Diese Kräfte bekennen
sich entweder nicht zum liberal-demokratischen Kompromiss und/oder sie werden seitens der
demokratischen Positionen von ihm vollständig oder teilweise ausgeschlossen.
Diese ausgeschlossenen Formationen gruppieren sich nun ihrerseits in subalternen Gege-
nöffentlichkeiten („subaltern counterpublics“) im Sinne Nancy Frasers. Sie sind „parallel exis-
tierende diskursive Arenen, in denen Mitglieder untergeordneter sozialer Gruppen Gegendis-
kurse erfinden und verbreiten, die ihnen erlauben, oppositionelle Interpretationen ihrer Identitä-
ten, Interessen und Bedürfnisse zu formulieren“ (Fraser 2001: 129). Gegenöffentliche Sphären
weisen gegenüber der liberal-demokratischen Sphäre eine stärkere diskursive Einheitlichkeit
auf. Im Einklang mit den obigen Bestimmungen zeichnen sich gegenöffentliche Sphären durch
ihre instrumentelle Doppelfunktion für Artikulationen aus: Sie fungieren nach innen als Räume
der Stabilisierung und Gruppierung von Bedeutungsordnungen. Sie sind institutionelle Fixpunk-
te, in denen sich die Forderungen, Diskurskonstellationen und Kollektivitätsformen stabilisie-
ren. Möchte sich etwa eine neu formierte Protestbewegung im politischen Raum verankern und
zu einem bedeutenden Akteur werden, dann muss sie erst ein Netz von Diskursproduzenten
schaffen (Kommunikationsmedien, Vereine, Parteien, etc.), das ihre Bedeutungsgehalte repro-
duziert. Durch gegenöffentliche Sphären gelingt es folglich subalternen politischen Kulturen,
sich über lange Zeiträume zu reproduzieren und in der Zivilgesellschaft zu sedimentieren.
Allerdings sind gegenöffentliche Sphären immer auch nach außen gerichtet, sie sind
politische Ausgangspunkte. Sie sind die Bedingung dafür, dass minoritäre Positionen politische
Artikulationsprozesse lancieren, die darauf zielen, die Gesellschaft als Ganze umzugestalten.
Auch bei gegenöffentlichen Sphären gibt es einen Allgemeinheitsbezug und eine hegemonial
ausgerichtete Strukturgebung. Gegenöffentliche Sphären sind die Enklaven (mit Fraser: „the
bases and training grounds“), von denen ausgehend minoritäre Lager versuchen, majoritär zu
werden. Demgemäß ist die Unterscheidung zwischen einer überlegenen liberal-demokratischen
öffentlichen Sphäre und einer Vielzahl subalterner Gegenöffentlichkeiten nicht prinzipieller und
ahistorischer Natur, sondern geschichtlich kontingent. Sie trifft in dieser Fassung nur für zeitge-
nössische westliche Zivilgesellschaften zu. Denkt man an andere historische Konjunkturen (et-
wa der Aufstieg der Faschismen in den 30er Jahren) oder andere geographische Kontexte (etwa
die sozialistisch regierten Staaten Südamerikas), dann wird ersichtlich: Erst wenn öffentliche
Sphären in die geschichtlichen Dynamiken von politischen Artikulationsprozessen eingebettet
werden, lässt sich ihre Verfasstheit und ihr Verhältnis bestimmen.
95
IV. Die Struktur der Zivilgesellschaft
Die vorherigen Unterkapitel haben über die Begriffstrias politische Kultur, kollektive Serie und
öffentliche Sphäre die konzeptuelle Landkarte meines Zivilgesellschaftsverständnisses entwor-
fen. Mit der diskurstheoretischen Überarbeitung der gramscianischen Begriffe organische Ideo-
logie (politische Kultur), Alltagsverstand (kollektive Serie) und kulturelle Institution (öffentli-
che Sphäre) wurde die Hegemonietheorie Laclaus und Mouffes an zentralen Schaltstellen er-
gänzt und die geschichtliche Dimension politischer Artikulationen in den Vordergrund gerückt.
Doch handelt es sich dabei um eine „bloße“ Nuancierung der Kategorie des Sozialen – oder, auf
ontischer Ebene, der Gesellschaft – bei Laclau und Mouffe? Erschöpfen sich die vorgestellten
Überlegungen darin, die Sedimentierung hegemonialer Bedeutungsfixierungen präziser aufzu-
schlüsseln? Auch wenn es mir tatsächlich darum geht, soziale Sedimentierungsprozesse nuan-
cierter zu lesen und in ihrer Vielgestaltigkeit zu fassen, gehorchen meine Ausführungen doch
einer grundsätzlich anderen Zielsetzung. Der klassischen Dichotomie einer fixierten, starren und
befriedeten Gesellschaft und einer strukturlosen, ereignishaften und antagonistischen Politik
halte ich entgegen, dass politische Artikulationen in einem strukturierten und strukturierenden
Raum geschehen, den ich als Zivilgesellschaft bestimme. Die Zivilgesellschaft ist weder nur
gesellschaftlich oder nur politisch, sondern beides zugleich: Sie wird durch hegemoniale Aus-
einandersetzungen strukturiert und ist ihr gesellschaftliches Ergebnis, sie ist aber gleichzeitig
der strukturierende politische Ausgangspunkt von politischen Artikulationen.
Die gesellschaftlich-politische Doppelstellung der Zivilgesellschaft äußert sich in jedem
der Bestandteile, die ihre Struktur bilden. Auf diese Struktur gehe ich in einer zusammenfüh-
renden Erläuterung nochmals ein. Dabei konzentriere ich mich auf die Kategorie der politischen
Kultur, in die die anderen Grundbegriffe (kollektive Serie und öffentliche Sphäre) als Teilglie-
der eingeklammert sind. Politische Kulturen sind die maßgeblichen Strukturierungsinstanzen
der Zivilgesellschaft. Sie sind de facto der Schlüsselbegriff meines Begriffsapparats. Ganz wie
bei Gramscis organischen Ideologien liegt die Kraft politischer Kulturen darin, zu den festen
Bestandteilen und nahezu unverrückbaren Essenzen der Gesellschaftsordnung zu werden.
Politische Kulturen sind sedimentierte Diskursformationen, die sich durch eine entpoli-
tisierte Artikulationsweise auszeichnen: Bei ihnen überwiegt die Differenz- vor der Äquiva-
lenzlogik, ihre diskursiven Grenzen erfahren eine Entpolitisierung (borders vs. frontiers) und
ihre Diskurselemente werden iterativ stabilisiert. Diese Beschreibung offeriert ein idealtypi-
sches Verständnis von politischen Kulturen. Sie legt den entpolitisierten und sedimentierten
Pol von Diskursformationen dar, der in politisierten hegemonialen Projekten (mit klaren
96
Äquivalenzketten, antagonistischen Grenzen und expansiven Diskurserweiterungen) sein Ge-
genstück findet. Diese polare Gegenüberstellung zwischen politischen Kulturen und hegemo-
nialen Projekten ist freilich aus heuristischen Gründen überzeichnet. Im Raum der Zivilgesell-
schaft oszillieren Diskursformationen graduell zwischen ihrem politisierten Status als hege-
moniale Projekte und ihrem entpolitisierten Status als politische Kulturen.
Auf was das Konzept der politischen Kultur abzielt, ist die präzisere Ausbuchstabierung
von scheinbar befriedeten und geronnenen sozialen Prozessen. Auch dort, wo Antagonismen
beseitigt, Signifikantenordnungen universalisiert und soziale Verhältnisse fixiert scheinen,
setzt sich die hegemoniale Strukturgebung der Gesellschaft fort. Ein hegemoniales Projekt wie
den Thatcherismus begreift man erst in seiner vollen Relevanz, wenn man nicht nur seine um-
kämpfte Durchsetzung in der institutionellen Politik oder in öffentlichen Diskursen nachzeich-
net, sondern auch seine Verbreitung zu einem unbestrittenem Commonsense in verschiedensten
gesellschaftlichen Bereichen – dessen Auswirkungen sich noch heute äußern.79
Das Konzept
der politischen Kultur dechiffriert die scheinbar unpolitische Umgestaltung sozialer Verhältnis-
se, ohne die hegemoniale Prozesse nur unzureichend begriffen wären. Inspiriert durch Gramsci
sichtet es in allen kollektiven Äußerungsformen hegemoniale Strukturgebungen.
Der Begriff der politischen Kultur ergänzt das politisierte Verständnis, das Laclau und
Mouffe von hegemonialen Projekten haben: Politische Prozesse setzen sich in der Logik des
Sozialen fort und forcieren einen veränderten, gesellschaftstheoretisch fortgeschriebenen He-
gemoniebegriff (S. 105f). Neben hegemonialen Projekten sind politische Kulturen die zentralen
Ordnungsinstanzen der Gesellschaftsstruktur. Die hegemoniale Kraft politischer Kulturen bringt
maßgeblich die Gesellschaft in ihrer spezifischen – politischen, kulturellen, ökonomischen, etc.
– Verfasstheit hervor. So wie sich im Politischen eine Vielzahl an Diskursformationen vonei-
nander abgrenzt und sich gegenseitig in Frage stellt, so steht sich auch im Sozialen eine Plura-
lität politischer Kulturen in Über- und Unterordnungsverhältnissen gegenüber. Was auf der po-
litischen Ebene als umkämpftes Verhältnis zwischen hegemonialen und gegenhegemonialen
Projekten Gestalt annimmt, wird auf der sozialen Ebene zur Gegenüberstellung zwischen ein-
zelnen hegemonialen politischen Kulturen und einer Vielzahl subalterner politischer Kulturen.
Zwar lässt sich die Ausformung und der Einfluss spezifischer politischer Kulturen immer
erst in konkreten Diskursanalysen aufschlüsseln. Auf theoretischem Terrain gibt es gleichwohl
zwei Indikatoren, um den hegemonialen oder subalternen Status politischer Kulturen analytisch
zu differenzieren: Erstens ist dies die Breitenwirkung von Sedimentierungsprozessen. Hegemo-
79
Die im Fall des Thatcherismus von der Privatisierung der Hochschulen über die Umgestaltung der Volkswirt-
schaft bis hin zur intellektuellen Zurückdrängung kritischer Strömungen (an erster Stelle der New Left) reichten.
97
niale politische Kulturen entfalten ihre gesellschaftsstrukturierende Kraft dann, wenn sie mög-
lichst viele soziale Felder durchdringen und ihnen ihre Gesetzmäßigkeiten aufoktroyieren.
Wenn verschiedene soziale Felder wie jene der Politik, der Ökonomie, der Wissenschaft, etc.
auf befriedete und entpolitisierte Art und Weise gegebene diskursive Logiken reproduzieren,
dann werden politische Kulturen hegemonial. Die Pointe ihrer entpolitisierten Artikulationswei-
se liegt mithin darin, dass sie sich verschleiert und als vernatürlichter Bestandteil sozialer Zu-
sammenhänge auftritt. Werden aber die diskursiven Gesetzmäßigkeiten sozialer Felder durch
politisierende Artikulationen hinterfragt, dann folgt daraus eine politische Reaktivierung politi-
scher Kulturen zu hegemonialen Projekten – ihre passive Hegemonie schlägt dann erneut in
eine aktive Hegemonie um: Plurale Knotenpunkte werden zu einzelnen leeren Signifikanten,
entpolitisierte borders verwandeln sich in antagonistische frontiers, und expansive Diskurser-
weiterungen (durch Äquivalenzen) treten an die Stelle iterativer Diskusstabilisierungen.
Der zweite Gradmesser für die Vorherrschaft bestimmter politischer Kulturen ist ihre
Tiefenwirkung. Hegemoniale Bedeutungsfixierungen geschehen gleichsam in Schichten. Rela-
tiv politisierte und locker sedimentierte Schichten heben sich von entpolitisierten und stark
sedimentierten Schichten ab. Idealtypisch herrschen starke Sedimentierungen dort vor, wo
politische Kulturen nicht nur als Sets von Zeichen stabilisiert sind, sondern sich auch als Prak-
tiken und Institutionen festsetzen. Im Falle starker Sedimentierungen kristallisieren sich feste
Zusammenhänge zwischen politischen Kulturen auf der einen Seite und kollektiven Serien und
öffentlichen Sphären auf der anderen. Die sozialen Kontexte, in denen Serien angesiedelt sind,
werden dann zum festen Element bestimmter politischer Kulturen. Die Kontexte der kollektiven
Serie „Geschlechtsidentität“ etwa sind eine sedimentierte Konsequenz der heteronormativen
Bedeutungsordnung. Die vergeschlechtlichten Strukturen am Arbeitsplatz, im Privaten, im öf-
fentlichen Leben, etc. werden durch umfassende Diskurse erzeugt und sind in sie eingeflochten.
Gegenüber Laclau und Mouffe betone ich hierbei, dass der subjektivierende Effekt von Diskur-
sen nicht nur über Identitäten qua rhetorischen Signifikationspraktiken geschieht (z.B. hetero-
normativer Diskurs schafft weibliche und männliche Subjektpositionen), sondern ebenfalls über
die Erzeugung stabilisierter Praktikenkontexte. Die sedimentierte Tiefenwirkung politischer
Kulturen schafft die Lebensformen, in denen kollektiven Identitäten zu kollektiven Serien „ge-
rinnen“ – und von denen aus sie immer wieder politisch ausbuchstabiert werden.
Neben Serien sind auch öffentliche Sphären in politische Kulturen eingebunden und
verweisen konstitutiv auf sie. Öffentliche Sphären schweben als Zusammenschlüsse von Dis-
kursproduzenten nicht in einem Vakuum. Vielmehr zeitigt die hegemoniale Fixierung von Be-
98
deutung institutionelle Folgen: Sie schafft ein Netz institutioneller Agenten, die dann Diskurse
reproduzieren und auf Dauer stellen. Die Hervorbringung von Institutionen und deren eigene
diskursstabilisierende Wirkung gleicht einer Zirkelbewegung, die sich reziprok verstärkt: Die
Stabilisierung von Bedeutung (semiotische Ebene) kreiert Diskursproduzenten (institutionelle
Ebene), die dann die Produktion diskursiver Gehalte verstärken und in neue soziale Bereiche
tragen. An sich ein Diskurseffekt, sind Institutionen in konkreten Situationen stets vorhanden
und wirken als feste Strukturen auf Artikulationen zurück. Zusammenhänge von Diskursprodu-
zenten organisieren Bedeutungsordnungen, geben ihnen einen Aufbau, tragen sie proaktiv nach
außen und schließen jene Gehalte aus, die nicht zu ihnen gehören dürfen.
In diesem Sinne sind dominante öffentliche Sphären institutionelle Äußerungsformen
von hegemonialen politischen Kulturen. Die „soziale Marktwirtschaft“ in der Bundesrepublik
zeigt, wie die Etablierung eines hegemonialen Projekts einhergeht mit der Stabilisierung einer
dominanten Öffentlichkeitssphäre. Im Zuge der Durchsetzung dieses Projekts entstand ein insti-
tutioneller Apparat von Massenmedien und politischen Parteien, die diesen Diskurs verfochten
und als seine Träger auftraten. Dieses Ensemble von Diskursproduzenten reproduzierte und
verbreitete den Diskurs der sozialen Marktwirtschaft so, dass er in den letzten 40 Jahren zum
selbstverständlichen gesunden Menschenverstand avancierte und zur Materialisierung der natür-
lichen und gerechten Ordnung Deutschlands wurde (vgl. Nonhoff 2005). Die seither geschehe-
nen Veränderungen in der liberal-demokratischen Medien- und Parteienlandschaft geben Auf-
schluss darüber, wie sich diese politische Kultur mit der Zeit ausgebreitet und verändert hat.
Die Erläuterung von Sedimentierungsprozessen in ihrer Breiten- und Tiefenwirkung
könnte zum Trugschluss verleiten, dass die zivilgesellschaftliche Struktur nur durch einzelne,
gesellschaftsübergreifende politische Kulturen geformt wird. Tatsächlich aber fällt der Zusam-
menhang von sedimentierten Formationen, praxeologischen Serien und institutionellen Diskur-
sproduzenten in den seltensten Fällen vollends stabil, umfassend und harmonisch aus.
Der interne Zusammenhang zwischen politischen Kulturen, kollektiven Serien und öf-
fentlichen Sphären ist in sich gebrochen und diskontinuierlich. Gewisse Kollektivitätsformen
können sich in Praktikenkontexten festsetzen und sich über lange Zeiträume als Serien repro-
duzieren. Auch nachdem ihre übergreifenden Diskurshorizonte verdrängt wurden, können Se-
rien in Kontexten weiterbestehen. Serien werden dann zu „Bruchstücken“ von Kollektivität, die
über iterativ wiederholte Praktiken- und Regelsets auf Dauer gestellt sind. Facetten der klassi-
schen Arbeiteridentität haben etwa in Hooliganvereinen englischer Fußballklubs überlebt und
ihren ursprünglichen Horizont, die politische Kultur der Arbeiterbewegung, überdauert (vgl.
99
Readhead 2009). Dasselbe gilt für die Einflechtung öffentlicher Sphären in Diskurse. Durch
umkämpfte De- und Reartikulationen von Bedeutungen können sich Diskursproduzenten aus
politischen Kulturen herauslösen und zu Trägern einzelner Diskusstränge oder -fragmente wer-
den. Die Rolle von Diskursproduzenten als Träger von Diskursen vergeht damit nicht, sie rela-
tiviert sich aber. Die Zusammenhänge zwischen politischen Kulturen, Diskursproduzenten und
öffentlichen Sphären werden immer wieder brüchig – politische Artikulationen besetzen Dis-
kursproduzenten, löschen sie aus oder flechten sie in andere öffentliche Sphären ein.
Die Einbindung öffentlicher Sphären und kollektiver Serien in politische Kulturen ist
nicht gegeben, sie wird politisch erzeugt. Anders als die geologische Sedimentierungsmetapher
nahelegt, ist die schrittweise Sedimentierung von Diskursen bereits an sich ein hegemonialer
Erfolg. Diese Sedimentierung wird von Laclau und Mouffe unterbewertet. Sie begnügen sich
mit einem pauschalen Sedimentierungsbegriff und halten der Stabilisierung hegemonialer Pro-
jekte poststrukturalistisch entgegen: In der Gesellschaft dominiert grundsätzlich nicht Ordnung,
sondern Kontingenz, Konflikthaftigkeit und Wandel. Dagegen schärfe ich mit Gramsci den Blick
für die gesellschaftliche Durchsetzung und Verankerung von Diskursformationen. Etabliert sich
eine Formation als politische Kultur, verankert sie ihre Kollektivitätsformen in kollektiven Se-
rien und besetzt – oder kreiert – sie Diskursproduzenten und vereint diese zu öffentlichen Sphä-
ren, dann hat sie sich in die zivilgesellschaftliche Struktur eingeschrieben: Sie wird dann zum
Bestandteil des strukturierenden Rahmens, in dem politische Artikulationen geschehen.
Der Zusammenhang zwischen politischen Kulturen, kollektiven Serien und öffentlichen
Sphären ist auch deshalb instabil, weil er extern umkämpft ist. In der Zivilgesellschaft steht sich
immer eine Vielzahl politischer Kulturen gegenüber. Einzelne hegemoniale politische Kulturen
bilden stabilisierte und breitenwirksame Ketten von Zeichenkomplexen, kollektiven Serien und
öffentlichen Sphären. Dagegen sind andere politische Kulturen eher an den gesellschaftlichen
Rand gedrängt und/oder weisen weniger starke Sedimentierungsgrade auf. Durch ihre geringere
Breiten- und Tiefenwirkung kommt diesen politischen Kulturen nur ein subalterner Status zu.
Sie besitzen nur geringen politischen Einfluss und bilden regelrecht subkulturelle Enklaven.
Dennoch fungieren subalterne politische Kulturen als sedimentierte Ankerpunkte minori-
tärer Positionen. Gewisse hegemoniale Projekte mögen in der Breite (gesamtgesellschaftlich)
erfolglos geblieben oder verdrängt worden sein, und doch in gewissen sozialen Feldern oder
Sedimentierungsschichten ihre Spuren hinterlassen haben. Man denke an das Überleben kriti-
scher Strömungen (die Ausläufer der New Left) in der englischen und amerikanischen Hoch-
schullandschaft auch nach der Durchsetzung des Thatcherismus und Reaganismus in den 1990er
100
und 2000er Jahren. Oder man halte sich vor Augen, wie in der Bundesrepublik trotz ihrer politi-
schen und gesellschaftlichen Marginalisierung rechtsradikale Strömungen fortdauern. Ihnen ist
es gelungen, sich in gewissen sozialen Feldern, Milieus und Gemeinden festzusetzen und sich
damit politische Einflussgrade zu sichern. Die Beispiele veranschaulichen, dass subalterne poli-
tische Kulturen quasi in der Defensive stehen und über lange Zeitperioden bedeutungslos blei-
ben. Zugleich sensibilisieren sie aber auch dafür, dass subalterne politische Kulturen weiterhin
politische Möglichkeitsräume darstellen. Ungeachtet ihres majoritären oder minoritären Status
sind politische Kulturen immer Ausgangspunkte für reaktivierende politische Artikulationen,
die bestehende Hegemonien ausweiten oder in Frage stellen.
Die konzeptuelle Landkarte der zivilgesellschaftlichen Struktur stellt das beigefügte
Schaubild synthetisch dar. Die Einfassung von kollektiven Serien und öffentlichen Sphären in
politische Kulturen fällt genauso schematisch aus wie die Konfrontation einer hegemonialen
und einer subalternen politischen Kultur. Weder sind kollektive Serien und öffentliche Sphären
gänzlich homogen in diskursive Horizonte eingefasst, noch stehen sich in der Zivilgesellschaft
nur zwei, sondern eine Vielzahl über- und untergeordneter politischer Kulturen gegenüber.
kollektive Serien: Reproduktion in Kontexten
über iterative Praktiken und Regeln
Schicht 1
semiotische
Dimension
Schicht 2
praxeologische
Dimension
subalterne
politische Kultur
Schicht 3
institutionelle
Dimension
Diskursproduzenten
Entpolitisierte Grenzen („border“)
Verschleierung antagonistischer Grenzziehungen
Sch
ich
tmod
ell
vo
n
Sed
imen
tier
un
g
hegemoniale öffentliche Sphäre
= Ensemble von Diskursproduzenten
gegenhegemoniale
öffentliche Sphäre
plurale diskursive Knotenpunkte
hegemoniale politische Kultur
Stabilisierung
Stabilisierung: Begriffe, Subjektpositionen, Strategien
Reproduktion und Organisation von Artikula-
tionsprozessen durch öffentliche Sphären
(„Bedeutungskartographie“)
101
D) Die Zivilgesellschaft als politischer Raum
“Any democratic struggle emerges within an ensemble
of positions, within a relatively sutured political space
formed by a multiplicity of practices“
(Laclau/Mouffe 2001: 132)
Die Bezeichnung von Zivilgesellschaft als politischem Raum bringt meine Grundthese auf den
Begriff. Die Zivilgesellschaft ist der Dreh- und Angelpunkt hegemonialer Kämpfe. Der Begriff
des politischen Raumes geht dabei mit einer doppelten Schwerpunktsetzung einher, die meinem
Plädoyer entspricht: In der Zivilgesellschaft laufen soziale Sedimentierungen (Gesellschaft), und
politische Artikulationen (Politik) zusammen und wirken aufeinander ein. Der politische Raum
ist ein strukturierter und strukturierender Raum. Er ist ein politischer Möglichkeitsraum.
Die Kategorie des Raumes legt dar, dass die Zivilgesellschaft immer eine spezifische
Strukturalität aufweist. Hegemoniale Artikulationen hinterlassen Spuren, sie schlagen sich in
Sedimentierungen nieder, in relativ stabilisierten Ordnungen von Zeichen, Praktiken und In-
stitutionen. So entsteht ein geschichtlich strukturiertes Diskursfeld, in dem sich Traditionen,
Lebensformen, Kollektivitäten und Institutionen festsetzen. Gleichwohl ist die zivilgesell-
schaftliche Struktur plural verfasst und diskontinuierlich. Weder ist der politische Raum ein
homogener und „nahtloser“ Raum: Stets stehen sich hegemoniale und subalterne Positionen
gegenüber. Noch sind die Sedimente dieses Raumes in sich starr und hyperstabil: Stets wer-
den sedimentierte Momente durch inhärente Brüche und Dezentrierungen verschoben.80
Zugleich ist der zivilgesellschaftliche Raum politisch verfasst. Das relativ strukturierte
Diskursfeld der Zivilgesellschaft ist kein nebensächlicher Effekt hegemonialer Kämpfe, son-
dern ihr Schlüsselbestandteil. Indem gewisse Positionen den Diskursraum in ihrem Sinne for-
men, strukturieren sie das Feld, in dem sich politische Artikulationen entfalten. Die Strukturie-
rung des Artikulationsraumes ist immer umkämpft und kontingent. Der politische Raum macht
gewisse Artikulationen wahrscheinlicher als andere – ohne sie aber kausal zu determinieren.
Weichen Artikulationen zu sehr von den Diskursen, Praktiken und Institutionen des politi-
schen Raumes ab, dann haben sie geringere Chancen, sich durchzusetzen und eine hegemoni-
ale Stellung zu erlangen. Schließen dagegen Artikulationen eng an die verfassten Strukturen
an, dann rückt ihre Aussicht auf Vorherrschaft in größere Nähe. So kommt der politische
Raum einer „diskursiven Gelegenheitsstruktur“ gleich. Diese Struktur ist der hegemonial ver-
fasste Grund, auf dem sich Artikulationen entfalten und um dessen Gestaltung sie ringen.
80
In jeder Sedimentschicht tauchen konstitutive Dezentrierungen auf. Man denke an die Heterogenität (Zeichen),
die Überschneidung/Performanz (Praktiken) oder die hegemoniale Struktur öffentlicher Sphären (Institutionen).
102
In diesem Schlusskapitel ziehe ich die übergeordneten sozialtheoretischen Folgerungen,
die sich aus meinem Gesamtargument ergeben: Erstens erläutere ich an den unterschiedlichen
Bestandteilen der zivilgesellschaftlichen Struktur jeweils ihre doppelte, soziale und politische
Verfasstheit. Zweitens komme ich auf das Hegemoniekonzept zurück und stelle mein gegen-
über Laclau und Mouffe grundbegrifflich erweitertes Hegemonieverständnis dar. Drittens
benenne ich die generellen Dynamiken, welche die Zivilgesellschaft durchziehen und sie zu
einem sowohl konstitutiv geordneten als auch kontingenten Diskursfeld machen. Viertens
betone ich, dass die Konzeption von Zivilgesellschaft als politischem Raum Laclaus und
Mouffes ontologische Gegenüberstellung des Sozialen und Politischen relativiert.
1) Die soziale und politische Verfasstheit der Zivilgesellschaft
In der Zivilgesellschaft durchdringen sich soziale (sedimentierte) und politische (reaktivieren-
de/neugründende) Prozesse wechselseitig, überlagern sich und gehen ineinander über. Das vor-
hergehende Kapitel betonte immer wieder die soziale und politische Beschaffenheit der zivilge-
sellschaftlichen Struktur. Öffentliche Sphären, kollektive Serien und politische Kulturen sind
sowohl Sinnbilder sozialer Sedimentierungen als auch politischer Reaktivierungen.
Öffentliche Sphären sind Zusammenschlüsse von Diskursproduzenten (= institutionelle
Akteure). Mit diesem Konzept lässt sich zunächst eine Antwort auf das institutionelle Defizit
bei Laclau und Mouffe formulieren. Diskursproduzenten, und damit auch öffentliche Sphären
als ihr Oberbegriff, sind ein institutioneller Effekt diskursiver Artikulationen. Doch Institutio-
nen sind nicht nur ein passiver Apparat, sie verarbeiten auch aktiv Bedeutung und verändern
ihre Textur. Im Dienste spezifischer Artikulationslogiken erzeugen Diskursproduzenten Be-
deutungskartographien. Öffentliche Sphären verleihen diesen Kartographien eine spezifische
Form und tragen sie in einen Raum allgemeiner Sicht- und Wahrnehmbarkeit. Nimmt man die
Rolle von Institutionen als „Konsensmanufakturen“ ernst, dann folgt daraus: Institutionen
sind ein Kampffeld, um dessen (Um-)Besetzung, Auslöschung oder Einrichtung gerungen wird.
Schon meine Konzeption von Diskursproduzenten betont ihr fortwährendes Changieren
zwischen Dynamiken der Politisierung und der Entpolitisierung. Einerseits „panzern“ Diskurs-
produzenten die befriedete Artikulationsweise politischer Kulturen, indem sie als Gatekeeper
und Themenunternehmer entweder subtile diskursive Filterungsfunktionen erfüllen oder aktiv
gewisse Deutungsrahmen und Diskurskonstellationen stabilisieren. Andererseits verweisen Dis-
kursproduzenten im engen Sinne auf die Initialzündung neuer Artikulationen. Damit machen sie
kenntlich, dass sedimentierte Ordnungen immer wieder politisch aufgebrochen werden.
103
Bei öffentlichen Sphären verstärkt sich diese soziale und politische Doppelausrichtung
noch. Zunächst zeigt das hierarchische Verhältnis zwischen vorherrschenden und subalternen
öffentlichen Sphären auf, dass die „institutionellen Fixpunkte“ der Zivilgesellschaft eine he-
gemoniale Beschaffenheit aufweisen, die sich nicht leicht durchbrechen lässt. Rückt eine vor-
herrschende öffentliche Sphäre – etwa die liberal-demokratische Sphäre – gewisse Positionen
in einen allgemeinen Wahrnehmungsraum, so schließt sie andere a priori davon aus. Indem
sich jedoch die – sei es vollständig, sei es partiell – ausgeschlossenen Akteure in subalternen
Gegenöffentlichkeiten gruppieren, sichern sie sich gewisse Einflussgrade und setzen sich als
minoritäre Positionen in der Zivilgesellschaft fest. Gleichwohl stabilisieren öffentliche Sphären
nicht per se geronnene Über- und Unterordnungsverhältnisse. Sie können Ordnungen auch (re-)
dynamisieren und ihre Umkehrbarkeit forcieren: Öffentliche Sphären sind diskursive Arenen,
die potentiell die Ereignishaftigkeit politischer Prozesse entschleiern – und damit deren anta-
gonistische Grenzziehungen und partikulare Standpunkte offen zur Schau tragen.
Kollektive Serien sind Kollektivitätsformen, die sich in Kontexten festsetzen und über
Praktiken reproduzieren. Dieses Konzept fungiert als analytischer Ergänzungsbegriff zu Laclaus
und Mouffes semiotischem und antagonistischem Begriff von kollektiver Identität (Kollektiv =
leerer Signifikant). Der Serienbegriff erhellt den sozialen Sedimentierungs- und politischen
Formierungskreislauf von Kollektivität: Serien legen dar, dass sich Kollektivitäten in einer Pen-
delbewegung zwischen sozial-sedimentierten und politisch-reaktivierten „Polen“ befinden.
Zunächst zur sozialen Sedimentierung von kollektiven Identitäten zu kollektiven Serien:
Als Effekt hegemonialer Fixierungen entstehen nicht nur stabilisierte Institutionen, sondern
auch verstetigte Muster von Praktiken. Wie Wittgensteins Begriff der Lebensform darlegt, ver-
läuft die Stabilisierung von Praktiken in gewissen Bahnen. Bedeutungsgehalte stabilisieren sich
in Kontexten: Die regelgeleitete Re-Zitierung gewisser Identitätsformen erfolgt stets innerhalb
gegebener Handlungsrahmen. Im sedimentierten Zustand „schweben“ etwa die kollektiven
Identitäten „Frau“ oder „Proletarier“ nicht über Kontexten, sondern sind in diese eingebunden
und quasi mit ihnen verwoben. In der Fabrik steht das Proletariat für etwas anderes als im sozi-
aldemokratischen Verein. Aber bereits die praxeologische Stabilisierung und Fixierung von
Kollektivitätsformen in Kontexten ist nicht unverrückbar, sondern in sich diskontinuierlich und
gebrochen. Auf mikrologische Weise destabilisieren sich in Kontexten kollektive Serien gegen-
seitig und werden durch unvorhergesehene performative Praktiken verschoben.
Die politische Formierung von kollektiven Serien zu kollektiven Identitäten beginnt mit
dieser nie vollendeten Fixierung. Die Entstehung politischer Kollektivitäten hat verschiedene
104
Facetten. Der nie verschüttete Verweis kollektiver Serien auf übergeordnete Signifikanten und
die interkontextuelle Äquivalentsetzung von Serien sowie ihr damit angestoßener Bindungs-
prozess wirken zusammen. Diese Faktoren befördern die erneute Schaffung „gebundener“
und antagonistischer kollektiver Identitäten im Sinne Laclaus und Mouffes. In diesem politi-
schen Formierungsprozess sind leere Signifikanten wie „Volk“, „Nation“, „Proletariat“ oder
„Geschlecht“ der politische Kulminationspunkt von Kollektivität. Indes bedürfen diese leeren
Signifikanten eines weit gestreuten Unterbaus – von weit weniger offensichtlichen – kollektiven
Serien, um ihre Wirkmächtigkeit zu entfalten. Folglich ist die politische Artikulation von Kol-
lektivitäten konstitutiv auf ihre soziale Sedimentierung angewiesen. Mehr noch, der politische
Pol von Kollektivität bedarf nicht nur seines sozialen Pols, er bringt diesen auch immer wie-
der hervor. Mit der Formierung übergeordneter kollektiver Identitäten entstehen ständig neue
Lebensformen, die dann als stabile Kontexte auf Kollektivitäten einwirken – und dadurch
kollektive Identitäten erneut in kollektive Serien verwandeln.
Politische Kulturen nehmen in der Zivilgesellschaft eine Schlüsselstellung ein, sie ver-
leihen ihr ihre Struktur. Zur Erinnerung: Politische Kulturen sind sedimentierte Diskursforma-
tionen, in denen die Differenz- vor der Äquivalenzlogik vorherrscht, deren Momente iterativ
stabilisiert werden und die entpolitisierte Grenzen (borders) besitzen (S. 63-67). Politische
Kulturen sind eng in die Gesellschaftsstruktur eingeflochten. Sie haben sich als Traditionen,
Lebensformen und Institutionen in die soziale Ordnung eingeschrieben und sind ein Teil von ihr
geworden. Politische Kulturen entfalten strukturelle Breiten- und Tiefenwirkungen. Besonders
ausgeprägt tun dies hegemoniale politische Kulturen – so der Thatcherismus in Großbritannien
oder die soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik.81
Zum einen strukturieren sie ver-
schiedenste soziale Felder, zum anderen sind sie in allen (semiotischen, praxeologischen und
institutionellen) Sedimentierungsdimensionen verankert. Dagegen bilden subalterne politische
Kulturen buchstäblich subkulturelle Enklaven: Sie stabilisieren sich institutionell über subalterne
gegenöffentliche Sphären und schlagen sich schwächer in Mustern von Praktiken nieder.
Aber haben politische Kulturen als derart sedimentierte und entpolitisierte Diskursfor-
mationen überhaupt eine genuin politische oder hegemoniale Kraft? Firmieren sie nicht gera-
de als „befriedeter“ Gegenbegriff zum „politisierten“ Konzept des hegemonialen Projekts, wie
es Laclau und Mouffe vertreten?
81
Die deutsche Sozialdemokratie Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ist ein anderes exemplarisches
Beispiel für eine hegemoniale politische Kultur: Sie stabilisierte ihren Diskurs über ein weites Netz von Instituti-
onen (Parteien, Vereinen, Gewerkschaften, Medien, etc.), brachte gewisse Kollektivitätsformen in verschiedenen
Ausprägungen hervor – die Identität des „Arbeiters“ bzw. „Proletariers“ – und verbreitete sich breitenwirksam in
den verschiedensten sozialen Feldern (von der Politik über die Wirtschaft bis hin zur Kunst).
105
2) Hegemonie revisited: die passive Hegemonie politischer Kulturen
Hegemonie meint eine Herrschaftsform, die nicht vornehmlich über Zwang, sondern über
Konsens ausgeübt wird. Nach Gramsci ist Hegemonie eine Führung, die über das Einverständ-
nis aller Eingebundenen operiert, der Führenden wie der Geführten. Laclaus und Mouffes He-
gemonietheorie fokussiert, wie Hegemonie aktiv ausgeübt und hinterfragt wird. Es ist die Stär-
ke ihres Ansatzes, ein diskurstheoretisches Vokabular für den hegemonialen Universalisie-
rungsprozess partikularer Positionen zu liefern: von leeren Signifikanten, über Äquivalentset-
zungen bis hin zum Schlüsselkonzept des Antagonismus. Ist aber Hegemonie einmal errungen,
dann setzt ein Sedimentierungsprozess ein. Kontingente Artikulationen gerinnen zu festen Ob-
jektivitäten. Doch Laclau und Mouffe buchstabieren diese Sedimentierungsprozesse nicht aus,
sondern geben sich mit der poststrukturalistischen Beteuerung zufrieden, dass jede soziale Se-
dimentierung erneut durch politische Artikulationen aufgebrochen wird – und hierin liegt eine
der zentralen Schwachstellen ihrer als Gesellschaftstheorie angetretenen Diskurstheorie.
Dagegen legt Gramscis Hegemonieverständnis nicht so sehr den Akzent auf die relativ
seltenen Fälle der umkämpften Infragestellung und Umbildung der gesellschaftlichen Ordnung,
als vielmehr auf ihre befriedete Reproduktion und Verstetigung. Nach Gramsci wird nur gele-
gentlich aktiv um Hegemonie gerungen, sie entfaltet sich allermeist passiv.82
Wie das zweite
Kapitel zeigte, ist Gramscis ganzes Begriffsrepertoire – von der organischen Ideologie über den
Alltagsverstand und die kulturellen Institutionen bis hin zur artikulierenden Kraft der Intellek-
tuellen – darauf angelegt, Hegemonie als eine vordergründig „entpolitisierte“ Herrschaftsform
zu lesen. Asymmetrische Herrschaftsverhältnisse nisten sich in inkorporierten Praktiken, tra-
dierten Lebensformen und natürlichen Weltanschauungen ein und verleihen ihnen ihr Gepräge.
Diese passive Hegemonie, die bei Laclau und Mouffe prinzipiell fehlt oder verkannt
wird,83
gilt es in den Fokus zu rücken. Das ist einer der Grundimpulse meiner diskurstheoreti-
schen Weiterentwicklung der gramscianischen Kategorien. Die Ausarbeitung des Sedimentie-
rungsbegriffes versucht, der „entpolitisierten“ Reproduktion von Institutionen (öffentliche
Sphären), Kollektivitäten (kollektive Serien) und Diskursen (politische Kulturen) gerecht zu
werden. Auch dort, wo diese Kategorien stärker sozial als politisch aufgeladen sind, ist ihre
Herrschaftsfunktion keineswegs verschwunden, sondern hat andere Formen angenommen.
82
Mit Kategorien wie Transformismus (Gramsci 2012: 1947f) oder passive Revolution (ebd.: 1243) geht der italie-
nische Marxist der grundlegenden Frage nach: Wie gelingt es den konservativen Eliten, die italienische Gesell-
schaft zu führen und zu strukturieren, ohne die populären Klassen in ihre Herrschaft aktiv einzubinden? Wie lässt
sich die Arbeiter- und Bauernschaft friedlich beherrschen und zugleich ihre politische Entmachtung sicherstellen? 83
So tauchte der Begriff einer passiven Hegemonie zwar bei der frühen Mouffe (1979) auf. Er wird aber weder
von ihr noch von Laclau weiterentwickelt – und stattdessen (implizit) durch die Kategorie des Sozialen ersetzt.
106
Die sedimentierten Strukturen der Zivilgesellschaft sind verfestigte kulturelle Formen,
die das Gesellschaftsleben „von innen“ prägen. Die subtile Wahrnehmungsmacht von Diskurs-
produzenten, die diskursive Strukturierungsleistung von öffentlichen Sphären oder die Produk-
tion von Kontexten durch Lebensformen machen sichtbar: Auch an den Stellen, wo entpoliti-
sierte Tendenzen vorherrschen, setzt sich die strukturierende Kraft der Hegemonie fort und ent-
faltet sich weiter. Ganz im Sinne Gramscis schreiben sich hegemoniale Verhältnisse als fraglose
Konsense in der Gesellschaft fest. Es ist die Pointe der Hegemonie als einer kulturellen Herr-
schaftsform, dass sie eine vernatürlichte Form annimmt. Bestimmte hegemoniale Verhältnisse
werden zu den scheinbar unverrückbaren Pfeilern sozialer Ordnung. In dieser latenten, ja gera-
dezu passiven Ausprägung stellt sich Hegemonie als unstrittige Verkörperung von Ordnung dar.
Politische Kulturen sind Sinnbilder einer passiven Hegemonie. Politische Kulturen wirken
auf das Gesellschaftsleben „organisch“ ein. Scheinbar selbstverständliche Ordnungswerte wie
Ordnungssicherheit (Handlungs- und Erwartungssicherheit im Alltag), Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben oder kulturelle Zugehörigkeit (vgl. Trotha 1994: 75) sind nicht objektiv ge-
geben, sondern werden diskursiv erzeugt und strukturiert. Auf welche Weise die Sicherheit des
öffentliches Raumes garantiert wird, welche biographischen Pfade (etwa von der Ausbildung in
die Arbeit zur Rente) in einer Gesellschaft vorherrschen, oder wie Fremde kulturell inkludiert
oder exkludiert werden, ist stets ein Ergebnis bestimmter latenter Hegemonien. Politische Kul-
turen üben solch eine passive Vorherrschaft aus. Sie liegt eine Ebene tiefer als die aktive Vor-
herrschaft hegemonialer Projekte. Während aktive Hegemonie fokussiert, wie sich Bedeutungs-
gehalte antagonistisch durchsetzen und zu hegemonialen Imaginären werden, zeigt sie in ihrer
passiven Dimension: Bedeutungen setzen sich als selbstverständliche kulturelle Formen fest
und steigen zu weithin fraglosen und als notwendig erscheinenden Ordnungswerten auf.
Politische Kulturen mobilisieren Zustimmung nicht primär über symbolisch ausformulier-
te und kohärente Weltanschauungen. Bei ihnen ist die stabilisierte Reproduktion von kultureller
Ordnung die eigentlich zentrale Legitimitätsquelle. Schienen anfangs politische Kulturen ein
schwaches Abbild hegemonialer Projekte, so zeigt sich nun: Ihre nicht expansive und antagonisti-
sche, sondern iterative und entpolitisierte Artikulationsweise erfüllt ebenfalls hegemoniale Zwe-
cke. Dies ist eine subtilere und „befriedete“ Herrschaftsform. Passive Hegemonien wirken als
unfragliche kulturelle Ordnungen auf soziale Verhältnisse ein und machen sich damit für das
Gesellschaftsleben „unverzichtbar“. Indem politische Kulturen das Alltagshandeln strukturie-
ren, sich in Anschauungen festsetzen, Lebensformen hervorbringen oder Institutionen schaf-
fen, entfalten sie eine grundlegende Basislegitimität (vgl. zum Begriff Popitz 1992: 221f).
107
3) Die Dynamiken der Zivilgesellschaft
Indem politische Kulturen eine passive Hegemonie ausüben, verleihen sie der Zivilgesellschaft
gleichsam organisch ihr Gepräge. Die von politischen Kulturen verkörperte Basislegitimität führt
damit zurück zur Beschreibung der zivilgesellschaftlichen Struktur. Die obigen Ausführungen
könnten zum Missverständnis verleiten, die Zivilgesellschaft sei ein durchweg starrer, sedi-
mentierter Raum, der bis hinein in seine Tiefendimensionen durch politische Kulturen, kollek-
tive Serien und öffentliche Sphären strukturiert sei. Zwar ist es durchaus ein gramscianisches
Leitmotiv der vorliegenden Arbeit, für die weitreichenden und prägenden Effekte hegemonia-
ler Prozesse zu sensibilisieren. Auch vordergründig unpolitische Ordnungen, Lebensformen
oder Institutionen sind von Grund auf hegemonial verfasst. In diesem Sinne: Es gilt, „entpoli-
tisierte“ und befriedete Tendenzen nicht gegen „politisierte“ und antagonistische Dynamiken
auszuspielen, sondern beide Dimensionen ineinander zu blenden.
Die präzise „hegemoniale Landkarte“ der zivilgesellschaftlichen Struktur lässt sich zwar
erst in der konkreten, kontextuell eingebetteten Auseinandersetzung erstellen. Gleichwohl kann
man auf einer übergeordneten Ebene drei Grundtendenzen ausmachen, die die Zivilgesellschaft
durchziehen: Die Unterscheidung von hegemonialen, residualen und emergenten Dynamiken84
hilft, die Verhärtungen und Brüche des politischen Raumes analytisch aufzuschlüsseln.
Hegemoniale Dynamiken werden durch hegemoniale politische Kulturen verkörpert. Sie
entfalten starke Breiten- und Tiefenwirkungen in der zivilgesellschaftlichen Struktur, sie struk-
turieren eine Vielzahl unterschiedlicher sozialer Felder und schreiben sich tief in Praktiken
und Institutionen ein. Aber die Hegemonie derartiger politischer Kulturen – wie der That-
cherismus oder die soziale Markwirtschaft – besteht gerade darin, dass sie ihre Bedeutungsge-
halte je nach Konjunktur schnell wieder politisch reaktivieren. Sie werden dann erneut zu he-
gemonialen Projekten, die klare antagonistische Grenzen ziehen und starke Äquivalenzketten
schmieden. Etwa wurde jeder Infragestellung Thatchers seitens des linkssozialistischen Lagers
mit der Reaktivierung eines Diskurses begegnet, der die linken „Sozialparasiten“ als grundsätz-
liche Last für das Wohlergehen der britischen Nation geißelte (vgl. Howarth/Glynos 2007: 150).
Die hegemoniale Kraft bestimmter Formationen gründet folglich darin, dass sie fluide zwischen
ihrem sedimentierten und befriedeten Status als politische Kulturen und ihrem politisierten und
antagonistischen Status als hegemoniale Projekte oszillieren. Diese Formationen verkörpern
zugleich beide Facetten der Hegemonie: sowohl die aktive Hegemonie universalisierter Bedeu-
tungsordnungen als auch die passive Hegemonie latenter Basislegitimitäten.
84
Hier orientiere ich mich an der Typologie kultureller Phänomene von Raymond Williams (vgl. 1977: 121-127).
108
Dagegen zeichnen sich residuale Dynamiken durch ein Überhandnehmen sedimentierter
und entpolitisierter Tendenzen aus. Das Residuale liegt in politischen Kulturen, die nur eine
subalterne Position einnehmen – man denke nur an die politische Kultur der Arbeiterklasse in
gegenwärtigen westlichen Gesellschaften. Grundsätzlich sind subalterne politische Kulturen
an den zivilgesellschaftlichen Rand gedrängt und bilden subkulturelle Enklaven. Indes darf der
residuale Charakter bestimmter Diskurse, Kollektivitäten oder Institutionen nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass sie weiter zu zivilgesellschaftlichen Struktur gehören. Sie halten weiterhin
bestimmte gegenöffentliche Sphären besetzt und setzen sich in gewissen, schwächer verbreite-
ten kollektiven Serien fest. Residuale Positionen mögen verdrängt sein, aber sie bleiben, mit
Williams (1977: 122) gesprochen, „still active in the cultural process, not only and often not at
all as an element of the past, but as an effective element of the present“. Residuale Formen zei-
gen, dass keine Hegemonie vollkommen ist und scheinbar ausmanövrierte Positionen doch fort-
bestehen können. Zurückgedrängte politische Kulturen, kollektive Serien und öffentliche Sphä-
ren überleben als potentielle Ausgangspunkte gegenhegemonialer Artikulationsversuche.
Emergente Dynamiken stehen für das Aufkommen grundsätzlich neuer Artikulationen,
Formationen und Kollektivitäten. Sei es, dass sich neuartige „Hybridkombinationen“ aus tra-
dierten Bedeutungsgehalten bilden, sei es, dass neue Diskursmomente artikuliert werden: Im-
mer wieder wird die zivilgesellschaftliche Struktur durch das Heraufziehen neuer politischer
Prozesse dynamisiert und umgestaltet. Emergente Dynamiken sind das Signum für die grundle-
gende Kontingenz sozialer Verhältnisse. Die emergente Dimension neuer politischer Artikulati-
onen ist nicht etwa, dass sie aus dem „Nichts“ auftauchen würden. Vielmehr verortet sie sich in
den disruptiven und „neuordnenden“ politischen Wirkungen, die sie verursacht. Die Formierung
neuer hegemonialer Projekte, die tradierte Hegemonien antagonistisch in Frage stellen und
sich anschicken, die gesellschaftliche Ordnung neu zu begründen, verschiebt fortwährend das
Gefüge der Zivilgesellschaft. Die Artikulationen von Protestbewegungen sind ein paradigmati-
sches Beispiel für emergente Dynamiken. Zum einen greifen sie hegemoniale politische Kultu-
ren an und legen deren partikulare Gehalte offen. Zum anderen reaktivieren sie oftmals residua-
le Diskurse, Kollektivitäten und Institutionen. Auch wenn das Aufkommen einer Protestbewe-
gung nicht in einer hegemonialen Position mündet, ist ihre Dynamisierungsleistung erheblich.
Möglicherweise macht sie die Vorherrschaft hegemonialer Positionen brüchig, reaktiviert ver-
drängte Formen und versieht diese mit neuer politischer Brisanz. Emergente Dynamiken ver-
hindern folglich, dass die Ordnung der zivilgesellschaftlichen Struktur je vollkommen ist. Sie
fördern immer wieder ihre grundsätzliche Kontingenz und ihre Konflikthaftigkeit zutage.
109
4) Die Relativierung der Dichotomie Soziales vs. Politisches
Als politischer Raum bringt die Zivilgesellschaft soziale und politische Prozesse zusammen.
Auch wenn soziale Gegebenheiten befriedet und sedimentiert scheinen, werden sie durch politi-
sche Brechungen dynamisiert. Aber auch wenn politische Prozesse angeblich strukturlos und
kreuzfeuerartig Gesellschaft neubegründen, ist Vorsicht geboten: Politische Instituierungen ver-
ändern die zivilgesellschaftliche Struktur und schaffen sie zu Teilen neu, sie können sich aber
nicht über diese Struktur einfach hinwegsetzen. Damit transzendiert mein Verständnis von Zi-
vilgesellschaft Laclaus und Mouffes Gegenüberstellung von Politik und Gesellschaft. Demge-
genüber lenke ich im gramscianischen Sinne den Fokus auf das geschichtliche und hegemonial
verfasste Diskursfeld, in dem soziale Sedimente und politische Dynamiken zusammentreffen.
Aber wie wirkt sich die Konzeption von Zivilgesellschaft als Verdichtungspunkt von Ge-
sellschaft und Politik auf die ontologische Gegenüberstellung zwischen dem Sozialen und dem
Politischen aus? Bei Laclau und Mouffe erscheinen diese Dimensionen ja als Gegenbegriffe, die
sich zueinander spiegelbildlich verhalten: Das Soziale ist die sedimentierte Starre, die das Poli-
tische als antagonistische und hegemoniale Dynamik ständig aufbricht und neu stiftet.85
Die vorliegende Arbeit stellt die grundsätzliche Gegenüberstellung des Politischen und
des Sozialen nicht in Frage, aber sie relativiert sie. Zunächst folgt aus meiner Beschreibung der
Zivilgesellschaft, dass das Politische in seiner antagonistischen Dimension abgeschwächt wird.
Wie die sozial-politische Doppelstellung der Bestandteile von Zivilgesellschaft zeigte, ist der
Antagonismus nicht immer unmittelbar präsent, sondern ist zuweilen verschüttet. Politische
Kulturen ziehen nicht mehr antagonistische frontiers, sondern stabilisieren sich über entpoliti-
sierte borders. Kollektive Serien grenzen sich nicht mehr von einem bedrohlichen und konstitu-
tiven Außen ab. Diskursproduzenten und öffentliche Sphären müssen nicht per se konflikthafte
Artikulationen forcieren, sie können genauso „entpolitisierten“ Reproduktionslogiken dienen.
Die Zivilgesellschaft ist nicht immer und überall konflikthaft aufgeladen. Geschehen freilich
politisierende Artikulationen, dann tritt der Antagonismus wieder hervor und sorgt für eine Re-
aktivierung der Zivilgesellschaft: Politische Kulturen werden zu hegemonialen Projekten, kol-
lektive Serien zu kollektiven Identitäten, öffentliche Sphären stehen im Zeichen hegemonialer
Deutungskämpfe. So bleibt der Antagonismus für die Stiftung sozialer Verhältnisse zentral. Der
85
Zur Erinnerung: Einerseits setzen sie das Politische mit der virtuellen Allgegenwärtigkeit des Antagonismus
gleich. Der Antagonismus durchzieht jede soziale Objektivität von Grund auf. Er steht für die Allgegenwärtig-
keit der antagonistischen Neugründung (und Infragestellung) von Objektivität (S. 23f). Dagegen lesen die Auto-
ren das Soziale als derivativen Begriff des Politischen: Das Soziale sind für sie die sedimentierten Objektivitäts-
formen, die als Produkt des Politischen entstehen (S. 26-32).
110
politische Raum bleibt ohne das Politische als Gründungsdimension unverständlich. Antago-
nismen und Hegemonien bringen soziale Objektivitäten hervor, die sich niemals vollständig
stabilisieren, sondern konstitutiv dezentriert und hinterfragbar bleiben.
Nimmt man aber die irreduzible Natur und die stete Latenz des Politischen ernst, dann
fragt sich, ob nicht ein anderes Verständnis des Sozialen angebracht wäre, um diese politische
Latenz in den Fokus zu rücken. Warum sollte man das Soziale nur als Passivität, Beharrung
und Objektivierung verstehen? Warum spricht man dem Sozialen nicht auch eine „schwache“
strukturierende Kraft zu, die gleichsam als Resonanz des Politischen – und insbesondere sei-
ner hegemonialen Ordnungskraft – alle sozialen Verhältnisse durchzieht?
Die vorliegende Arbeit hat ja nicht nur den politisch-sozialen Doppelstatus der Zivilge-
sellschaft ins Zentrum gerückt, sondern überdies betont: Auch dort, wo die soziale gegenüber
der politischen Dimension vorherrscht, sind latente Strukturgebungen im Gange. Die passive
Hegemonie politischer Kulturen versinnbildlicht diese „entpolitisierte“ und latent bleibende
Strukturierung des politischen Raumes. Mittels basaler Ordnungswerte (Handlungssicherheit,
kulturelle Zugehörigkeit, etc.) verkörpern politische Kulturen eine vernatürlichte „Basislegitimi-
tät“ – und geben damit dem politischen Raum subtil seine Form. Auch das Soziale belässt die
Verhältnisse nicht in ihrem Ist-Zustand, sondern gestaltet sie um. Zwar ist die formende Kraft
des Sozialen beschränkter als das Politische in seiner antagonistischen Gründungsdimension.
Gleichwohl legt sie offen, dass die scheinbar sedimentierte Reproduktion sozialer Verhältnisse
nicht einfach gegeben ist, sondern aktiv und hegemonial erzeugt wird. Auch in ihrem sozialen
und „entpolitisierten“ Modus werden die Bestandteile und Dynamiken der Zivilgesellschaft von
hegemonialen Dynamiken durchzogen und angetrieben. Die antagonistische Aufladung sedimen-
tierter sozialer Verhältnisse ist zwar abgeschwächt, hegemoniale Bewegungen bleiben aber als
aktive Strukturierungsleistungen durchaus präsent. Nur werden sie unauffälliger und erscheinen
weniger als politische Gründungen, sondern eher als entpolitisierte und kulturelle Äußerungs-
formen. Steht das Politische für die virtuelle Allgegenwärtigkeit des fundierenden Antagonis-
mus, so ist das Soziale als latente Strukturgebung eine subtilere Äußerungsform hegemonialer
Dynamiken. Weit davon entfernt, eine starre Sedimentierung zu sein, ergänzt das Soziale viel-
mehr die politische Gründungsdimension und buchstabiert ihre Wirkungen aus. Der Antago-
nismus mag im Sozialen verschüttet sein, aber die Hegemonie äußert sich in ihm weiterhin, nur
auf andere Art und Weise: nicht als offener Deutungskampf, sondern als ordnende Kultur.
111
Fazit: Perspektiven einer politischen Gesellschaftstheorie
Erschienen Gesellschaft und Politik am Anfang der Untersuchung als Gegenbegriffe, so hat sich
in ihrem Verlauf herausgestellt, dass beide Kategorien konstitutiv verzahnt sind. Meine Konzep-
tion von Zivilgesellschaft blendet politische und gesellschaftliche Prozesse ineinander und liest
sie als ein Kontinuum. Die Zivilgesellschaft als politischer Raum überwindet die Gegenüberstel-
lung von Gesellschaft und Politik und offeriert einen erweiterten Analysefokus. Politische Arti-
kulationen und gesellschaftliche Sedimentierungen bedingen einander und bringen sich gegen-
seitig hervor. Politik als Summe der Konflikte um die hegemoniale Deutungshoheit geschieht auf
der Grundlage von Gesellschaft als Summe der sedimentierten Strukturen. Aber zugleich ver-
weist Gesellschaft in ihren politischen Ursprüngen und in ihren vordergründig „entpolitisierten“
Dynamiken stets auf Politik: Gesellschaft ist die entpolitisierte Seite von Politik. Keine Politik
ohne Gesellschaft, keine Gesellschaft ohne Politik!, so lautet der – theoretische und methodolo-
gische – Leitsatz, den die Kategorie der Zivilgesellschaft verdichtet auf den Begriff bringt.
Der Vernachlässigung von Gesellschaft zugunsten von Politik bei Laclau und Mouffe habe
ich angesichts meines systematischen Anschlusses an ihren Ansatz eine starke Aufmerksamkeit
geschenkt. Ich bin dem Leitgedanken gefolgt, dass die Autoren aufgrund ihrer These von der
Primatstellung des Politischen die Dimension des Sozialen – und der Gesellschaft als ihrer onti-
schen Manifestation – vernachlässigen und ihr eine bloß derivative Stellung zuschreiben. Über-
spitzt gesagt, versprechen Laclau und Mouffe, Diskurstheorie als Gesellschaftstheorie zu entwi-
ckeln, ihr konzeptueller Apparat schränkt sie aber de facto auf eine Politiktheorie ein. Mit den
Schlüsselkonzepten Antagonismus, Äquivalenzkette und leerer Signifikant entschlüsseln sie, wie
fortwährend Kämpfe um Hegemonie ausgetragen werden. Dadurch sehen sie soziale Verhältnis-
se stets durch die Brille ihrer letztlichen Kontingenz, Konflikthaftigkeit und Dynamik. Dem habe
ich weniger grundsätzlich als vielmehr analytisch widersprochen: Die Sedimentierungseffekte
politischer Kämpfe sind nicht aus dem Blick zu verlieren. Um Hegemonie wird nicht nur ge-
rungen, sie wird auch ausgeübt – und oft über lange Zeiträume hinweg, mit relativ wenig Ge-
genspruch und nicht nur über ausbuchstabierte Diskursordnungen. Prinzipiell sind zwar alle so-
zialen Verhältnisse kontingent, faktisch aber weisen sie oft eine feste Ordnung auf. So schwächt
sich auch das Moment ab, das für Laclau und Mouffe die Politik auszeichnet, der Antagonis-
mus. Er ist eine latente, aber nicht immer präsente Dimension von Gesellschaft. Indes führt die
Relativierung disruptiver politischer Dynamiken nicht dazu, Gesellschaft für politikfrei zu hal-
ten. Im Gegenteil: Die ordnende Kraft der Hegemonie durchdringt geradezu die Gesellschaft.
112
Die Vernachlässigung von Politik zugunsten von Gesellschaft steht in einem spiegelbild-
lichen Verhältnis zu Laclaus und Mouffes politischer Einseitigkeit. In weiten Teilen der Sozio-
logie erscheinen soziale Verhältnisse als weitgehend politikfreie Verhältnisse. Sozialtheorien im
engen Sinne „verbannen“ Politik auf einen rein institutionellen Apparat, auf ein autonomes und
selbstreferentielles Teilsystem oder auf ein soziales Feld unter anderen. Eine solche soziologis-
tische Sicht kann gar so weit gehen, Politik zur abhängigen Variable von Gesellschaft zu degra-
dieren. Entweder fungiert Politik dann als rationales Instrument, das der Behandlung und Lö-
sung sozialer (bzw. kultureller oder sozialstruktureller) Problemstellungen dient. Oder Politik
erscheint als Folgeerscheinung gesellschaftlicher Gegebenheiten: Politische Kräfte drücken
dann nur noch die Interessen von vermeintlich objektiven sozialen Kategorien wie Klassen,
Milieus oder Einzelakteuren aus. Damit wird ausgeblendet, dass erst hegemoniale Deutungsho-
heiten gesellschaftliche Beziehungen stiften und stabilisieren. Der Deklassierung von Politik zur
abhängigen Variable von Gesellschaft setzt die hiesige Perspektive entgegen, dass letztlich „alles
von der Politik abhängig [ist]“ (Greven 1999: 13). Mit Lefort und Gramsci begreife ich den
sozialen Raum eben nicht als politikfrei, sondern als durchweg politisch – weshalb ich auch nicht
den Begriff der Gesellschaft, sondern den der Zivilgesellschaft in den Vordergrund stelle.
Die Zivilgesellschaftskategorie verschränkt also Politik und Gesellschaft keineswegs
symmetrisch und quasi „gleichrangig“ miteinander. Vielmehr gebe ich mit dem Begriff der
Zivilgesellschaft der politischen Gründungsdimension den Vorrang und buchstabiere die he-
gemoniale Instituierung des Sozialen aus. Mit meinem Zivilgesellschaftsverständnis mache
ich sichtbar, dass politische Prozesse ein strukturiertes Diskursfeld hervorbringen, das dann auf
diese Prozesse einwirkt und sie ihrerseits formt. Einen substantiell politikfreien Gesellschaftsbe-
reich gibt es nicht. Jede soziale Objektivität ist in letzter Instanz ein politisches Erzeugnis. Jede
gesellschaftliche Sedimentierung ist in ihren Wurzeln politisch verfasst und kann durch Anta-
gonismen und Gegenhegemonien zu ihren politischen Möglichkeiten zurückgelangen: Subal-
terne politische Kulturen lassen sich reaktivieren, minoritäre kollektive Serien zu politischen
Kollektivitäten formieren, öffentliche Sphären für gegenhegemoniale Zwecke umbesetzen.
Es darf nicht darum gehen, hier die politischen „Gründungsdynamiken“ von Antago-
nismus und Hegemonie hochzuhalten und dort „befriedete“ gesellschaftliche Prozesse zu er-
forschen, sondern beides zugleich zu betreiben. Meine Schwerpunktsetzung stellt die disziplinä-
re Trennung zwischen politischer Theorie und Sozialtheorie in Frage. Und zwar mit folgendem
Grundgedanken: Die politische Gründungsdimension ist erst dann vollständig begriffen, wenn
deutlich wird, wie sie ihren scheinbaren Gegenspieler – den Bereich des Gesellschaftlichen –
113
hervorbringt und in ihm wirksam bleibt. Folglich plädiere ich mit dem Zivilgesellschaftsbegriff
für eine politische Gesellschaftstheorie. Mit Laclau und Mouffe behaupte ich die Primatstellung
des Politischen und ihrer beiden treibenden Kräfte, dem Antagonismus und der Hegemonie. Um
jedoch das Politische in seinen Wirkungen und Ausformungen zu dechiffrieren, gilt es im Sinne
Gramscis das Augenmerk auf die geschichtlichen und kulturellen Dynamiken der Hegemonie
zu richten. Denn Hegemonien verhärten sich zu Kulturen, Lebensformen und Institutionen.
Im Geiste einer solchen politischen Gesellschaftstheorie nimmt die Zivilgesellschaft als
politischer Raum eine Schlüsselstellung ein: Sie ist der Dreh- und Angelpunkt politischer Ar-
tikulationen, sie ist der Möglichkeitsraum des Politischen. Das zentrale Anliegen dieser Arbeit
war, die sozial- und politiktheoretischen Potentiale der Zivilgesellschaftskategorie freizule-
gen. Über die Verschränkung von gramscianischen und poststrukturalistischen Gedanken habe
ich ein streng deskriptives und politisch aufgeladenes Verständnis von Zivilgesellschaft ent-
worfen. Mit dieser konzeptuellen Neufassung stelle ich nicht nur die übliche normative Auf-
ladung der Zivilgesellschaftskategorie in Frage, sondern rücke sie zudem von der Peripherie
ins Zentrum der – theoretischen und politischen – Aufmerksamkeit. Dafür markierte ich die
grundlegenden Anschluss- und Erweiterungslinien gegenüber der Diskurstheorie Laclaus und
Mouffes, stellte meine Inspiration durch Lefort und Gramsci heraus und präsentierte die
Grundkategorien meiner diskurstheoretischen Konzeption von Zivilgesellschaft. Es versteht
sich, dass auf einer konzeptuellen Ebene meine Hauptbegriffe (politische Kulturen, kollektive
Serien, öffentliche Sphären) weiter nuanciert werden müssen. Auch das präzise Verhältnis der
umfassenden Konzeption des politischen Raumes zu gesellschaftstheoretischen Grundkatego-
rien (Staat, politisches Feld, etc.) ist noch unterbestimmt. Gleichzeitig halte ich gemäß dem
gramscianischen Antrieb dieser Arbeit die empirische Erprobung meines Zivilgesellschafts-
konzeptes für entscheidend. Die Strukturen, Verhärtungen und Dynamiken des politischen
Raumes bilden eine geschichtliche Landkarte. Sie lässt sich nicht auf bloß formalem Wege
ergründen, sondern führt in die konkrete Auseinandersetzung.
114
Literatur
Akerstrom, Nils Michael (2003): Discursive Analytical Strategies. Understanding Foucault, Koselleck, Laclau,
Luhmann. Bristol: Policy Press.
Alexander, Jeffrey C. (2006): The Civil Sphere. Oxford: Oxford University Press.
Anderson, Benedict (1991): Imagined Communities. London: Verso.
Anderson, Benedict (1998): Nationalism, Identity and the Logic of Seriality, in: The Spectre of Comparisons.
Nationalism, Southeast Asia, and the World. London: Verso.
Anderson, Perry (1976): The Antinomies of Antonio Gramsci, in: New Left Review, No. 100 (November 1976-
January 1977), S. 5-78.
Auswärtiges Amt (2013): Transformationspartnerschaft in Tunesien zur Stärkung von demokratischer Rechts-
staatlichkeit und Zivilgesellschaft, Url.: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/ (Zugriff: 2.8.2013)
Bachmann-Medick, Doris (2010): Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbeck:
Rowohlt.
Barrett, Michèle (1991): The Politics of Truth. From Marx to Foucault. Cambridge: Cambridge University Press.
Bobbio, Norberto (1988): Gramsci and the Concept of Civil Society, in: John Keane (Hg.): Civil Society and the
State: New European Perspectives. London: Verso.
Borstel, Dierk (2008): Engagement als Strategie – Was will der nette Nazi von nebenan?, in: Forschungsjournal
Neue Soziale Bewegungen. Rechtsradikale Zivilgesellschaft? Neonazis besetzen das Ehrenamt. Heft 4 – Dez.
2008, S. 23-30.
Bröckling, Ulrich (2004): Balance of Power. Zivilgesellschaft und die Gouvernementalität der Gegenwart, in:
Dieter Gosewinkel, Sven Reichardt (Hg.): Ambivalenzen der Zivilgesellschaft. Gegenbegriffe, Gewalt und
Macht. Discussion Paper Nr. SP IV 2004-501. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin, S. 60-68.
Bröckling, Ulrich (2012): Der Ruf des Polizisten. Die Regierung des Selbst und ihre Widerstände, in: Reiner
Keller et al. (Hg.): Diskurs – Macht – Subjekt. Wiesbaden: VS, S. 131-144.
Brodocz, André (2008) [2003]: Die Konflikttheorie des zivilgesellschaftlichen Republikanismus, in: Thorsten
Bonacker (Hg.): Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien. Wiesbaden: VS, S. 231-248.
Bundschuh, Stephan (2012): Die braune Seite der Zivilgesellschaft: rechtsextreme Sozialraumstrategien, in:
ApuZ, 18-19/2012, S. 28-32.
Butler, Judith (1998): Hass spricht. Zur Politik des Performativen. Berlin: Berlin Verlag.
Butler, Judith (2000): Restaging the Universal: Hegemony and the Limits of Formalism, in: Judith Butler et al.
(Hg.): Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on the Left. London: Verso, S. 11-43.
Buttigieg, Joseph A. (2002): Gramsci on Civil Society, in: James Martin (Hg.): Antonio Gramsci. Critical As-
sessments of Leading Political Philosophers. Volume II. Marxism, Philosophy and Politics. London: Routledge,
S. 422-449.
Cazorla, Bertrán Rodríguez (2006): Die Kultur hinter der Politik, in: Zugzwang – Studentische Zeitschrift für
Soziologie, 1, S. 7-14.
Clinton, Hilary (2010): Civil Society: Supporting Democracy in the 21st Century. Speech held at the Community
of Democracies. Url.: http://www.state.gov/secretary/ (Zugriff: 3.8.2013)
Critchley, Simon; Marchart, Oliver (2004): Introduction, in: Ebd. (Hg.): Laclau. A Critical Reader. New York:
Routledge, S. 1-14.
Davidson, Alastair (2008): The Uses and Abuses of Gramsci, in: Thesis Eleven, 2008: 95, S. 68-92.
Demirovic, Alex (2007): Politische Gesellschaft – zivile Gesellschaft. Zur Theorie des integralen Staates bei
Antonio Gramsci, in: Sonja Buckel, Andreas Fischer-Lescano (Hg.): Hegemonie gepanzert mit Zwang. Zivilge-
sellschaft und Politik im Staatsverständnis Antonio Gramscis. Baden-Baden: Nomos, S. 21-41.
115
Derrida, Jacques (1972): Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaft vom Menschen,
in: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Derrida, Jacques (1986): Positionen. Gespräche mit Henri Ronse, Julia Kristeva, Jean-Louis Houdebine, Guy
Scarpetta. Wien: Passagen.
Derrida, Jacques (1990) [1969]: Grammatologie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Derrida, Jacques (1999) [1972]: Randgänge der Philosophie. Wien: Passagen.
Diaz-Bone, Rainer (2010): Kulturwelt, Diskurs und Lebenswelt. Eine diskurstheoretische Erweiterung der Bour-
dieuschen Distinktionstheorie. Wiesbaden: VS.
Dubiel, Helmut (1994): Ungewißheit und Politik. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Dubiel, Helmut (2001): Unzivile Gesellschaften, in: Soziale Welt: Zeitschrift für sozialwissenschaftliche For-
schung und Praxis. 52, 2, S. 133-150.
Edwards, Michael (Hg.) (2011): The Oxford Handbook of Civil Society. Oxford: Oxford University Press.
Fish, Stanley (1980): Is There a Text in This Class? The authority of interpretive communities. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press.
Foucault, Michel (1973): Archäologie des Wissens. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Foucault, Michel (1992): Was ist Kritik? Berlin: Merve.
Frank, Manfred (1984): Was ist Neostrukturalismus? Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Frankenberg, Günter (1997): Die Verfassung der Republik: Autorität und Solidarität in der Zivilgesellschaft.
Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Frankenberg, Günter (2003): Zivilgesellschaft im transnationalen Kontext, in: Maecenata Actuell : Journal des
Maecenata-Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin, 43, 2003, S.
3-21.
Fraser, Nancy (2001): Neue Überlegungen zur Öffentlichkeit. Ein Beitrag zur Kritik der real existierenden De-
mokratie, in: Die halbierte Gerechtigkeit. Schlüsselbegriffe des postindustriellen Sozialstaats. Frankfurt a.M.:
Suhrkamp.
Freeden, Michael (1996): Ideology and Political Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
Furet, François (1983) [1978]: Penser la Révolution Française. Gallimard: Paris.
Gamson, William A.; Modigliani, Andre (1989): Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A
Constructionist Approach, in: American Journal of Sociology, 95.1, S. 1-37.
Gauchet, Marcel (1990): Die totalitäre Erfahrung und das Denken des Politischen, in: Ulrich Rödel (Hg.): Auto-
nome Gesellschaft und libertäre Demokratie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 207-238.
Gauck, Joachim (2012): Ansprache bei der Gedenkfeier „Lichtenhagen bewegt sich“ Url:
http://www.bundespraesident.de (Zugriff: 03.09.2012).
Geras, Norman (1987): Post-Marxism?, in: New Left Review, 1:163, S. 40-82.
Giddens, Anthony (2000): „Es wird ziemlich schwer, öffentlichen Raum zurück zu gewinnen“. Gespräch mit
Anthony Giddens, in: Die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, 47.6, S. 335-340.
Glynos, Jason; Howarth, David (2007): Logics of critical explanation in social and political theory. London:
Routledge.
Glynos, Jason, et al. (2009): Discourse Analysis: Varieties and Methods. ESRC National Centre for Research
Methods Review paper. August 2009. National Centre for Research Methods. NCRM/014.
Golding, Sue (1992): Gramsci’s Democratic Theory. Contributions to a Post-Liberal Democracy. Toronto: Uni-
versity of Toronto Press.
Gosewinkel, Dieter; Reichardt, Sven (2004): Ambivalenzen der Zivilgesellschaft: Einleitende Bemerkungen, in:
Dies. (Hg.): Ambivalenzen der Zivilgesellschaft. Gegenbegriffe, Gewalt und Macht. Discussion Paper Nr. SP IV
2004-501. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin, S. 1-6.
116
Gramsci, Antonio (2012): Gefängnishefte. Kritische Gesamtausgabe. Herausgegeben von Klaus Bochmann und
Wolfgang Fritz Haug. Neuauflage der Erstausgabe 1991. Hamburg: Argument.
Greven, Michael Th. (1999): Die politische Gesellschaft. Kontingenz und Dezision als Probleme des Regierens
und der Demokratie. Opladen: Leske + Budrich.
Grossberg, Lawrence (2006): Does Cultural Studies have Futures? Should it? (Or What’s the Matter with New
York?), in: Cultural Studies, 20. 1, S. 1-32.
Habermas, Jürgen (2011): Zur Verfassung Europas. Berlin: Suhrkamp.
Hall, Stuart (1979): Culture, the Media and the ‚Ideological Effect‘, in: James Curran et al. (Hg.): Mass Commu-
nication and Society. London: Edward Arnold & The Open University Press, S. 315-348.
Hall, Stuart (1980): Cultural Studies – two paradigms, in: Media, Culture and Society, 2, S. 57-72.
Hall, Stuart (1982): The Rediscovery of Ideology: Return of the Repressed in Media Studies, in: Michael
Gurevitch et al. (Hg.): Culture, Society, and the Media. London, Methuen, S. 354-364.
Hall, Stuart (1983): The Great Moving Right Show, in: Stuart Hall, Martin Jacques (Hg.): The Politics of
Thatcherism. London: Lawrence and Wishart, S. 24-35.
Hall, Stuart (1984): Ideologie und Ökonomie – Marxismus ohne Gewähr, in: Fritz Haug (Hg.): Die Camera
obscura der Ideologie. Philosophie – Ökonomie – Wissenschaft. Hamburg: Argument, S. 97-121.
Hall, Stuart (1989a): Die strukturierte Vermittlung von Ereignissen, in: Ideologie, Kultur, Rassismus. Ausge-
wählte Schriften 1. Hamburg: Argument, S. 129-149.
Hall, Stuart (1989b): Der Thatcherismus und seine Theoretiker, in: Ideologie, Kultur, Rassismus. Ausgewählte
Schriften 1. Hamburg: Argument, S. 172-206.
Hall, Stuart (2000): Postmoderne und Artikulation. Ein Interview mit Stuart Hall, in: Cultural Studies. Ein politi-
sches Theorieprojekt. Ausgewählte Schriften 3. Hamburg: Argument, S. 52-77.
Hall, Stuart (2002a): Gramsci’s Relevance for Race and Ethnicity, in: James Martin (Hg.): Antonio Gramsci.
Critical Assessments of Leading Political Philosophers. Volume IV Contemporary Applications. London:
Routledge. London: Routledge, S. 281-309.
Hall, Stuart (2002b): Gramsci and Us, in: James Martin (Hg.): Antonio Gramsci. Critical Assessments of Leading
Political Philosophers. Volume IV Contemporary Applications. London: Routledge, S. 227-238.
Hildebrand, Marius (2010): Demokratie als hegemoniales Projekt. Über den normativen Gehalt der Hegemo-
nietheorie von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe. Unveröffentlichte Magisterarbeit. Freiburg i.Br.
Hildebrand, Marius; Lluis, Conrad (2012): The Negation of Power: from structuration theory to the politics of
the Third Way, in: Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, 13:2, S. 187-207.
Holz, Hans H. (1982): Philosophische Reflexion und politische Strategie bei Antonio Gramsci, in: Hans Heinz
Holz, Guiseppe Prestipino (Hg.): Antonio Gramsci heute. Aktuelle Perspektiven seiner Philosophie. Bonn: Pahl
Ruggenstein, S. 18-35.
Honneth, Axel (1994): Fragen der Zivilgesellschaft, in: Desintegration. Bruchstücke einer soziologischen Zeitdi-
agnose. Frankfurt a.M.: Fischer, S. 80-90.
Honneth, Axel (2011): Das Recht der Freiheit. Berlin: Suhrkamp.
Honneth, Axel (2013): Idee und Realität der Zivilgesellschaft. Jeffrey Alexanders Versuch, die Gerechtigkeits-
theorie vom Kopf auf die Füße zu stellen, in: Leviathan, 41. Jg., 2/2013, S. 291-308.
Howarth, David (2000): Discourse. Manchester: Manchester University Press.
Howarth, David (2005): Applying Discourse Theory: the Method of Articulation, in: David Howarth, Jacob
Torfing (Hg.): Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance. Hampshire: Palgrave
Macmillan, S. 316-350.
Imbusch, Peter (1998): Einleitung, in: Ebd. (Hg.): Macht und Herrschaft. Sozialwissenschaftliche Konzeptionen
und Theorien. Opladen: Leske + Budrich, S. 9-36.
Joas, Hans; Knöbl, Wolfgang (2004): Sozialtheorie. Zwanzig einführende Vorlesungen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Keane, John (2003): Global Civil Society? Cambridge: Cambridge University Press.
117
Kebir, Sabine (1986): Zum Begriff des Alltagsverstandes (“senso comune”) bei Antonio Gramsci, in: Helmut
Dubiel (Hg.): Populismus und Aufklärung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 74-83.
Keller, Reiner (2011a): Wissenssoziologische Diskursanalyse: Grundlegung eines Forschungsprogrammes. 3.
Auflage. Wiesbaden: VS.
Keller, Reiner (2011b): Wissenssoziologie Diskursanalyse, in: Reiner Keller et al. (Hg.): Handbuch sozialwissen-
schaftliche Diskursanalyse. Band 1: Theorien und Methoden. 3., erweiterte Auflage. Wiesbaden: VS, S. 115-146.
Klein, Ansgar (2001): Der Diskurs der Zivilgesellschaft. Münster: Dampfboot.
Kleinsteuber, Hans. J. (2011): Öffentlichkeit, in: Dieter Nohlen, Florian Grotz (Hg.): Kleines Lexikon der Politik.
München: Beck, S. 412-413.
Kneer, Georg (1997): Zivilgesellschaft, in: Georg Kneer et al. (Hg.): Konzepte moderner Zeitdiagnosen. Mün-
chen: Wilhelm Fink, S. 228-251.
Knoblauch, Hubert (1995): Kommunikationskultur. Die kommunikative Konstruktion kultureller Kontexte. Ber-
lin: Walter de Gruyter.
Kocka, Jürgen (2007): Civil Society in Historical Perspective, in: John Keane (Hg.): Civil Society. Berlin Per-
spectives. Oxford: Berghahn, S. 37-50.
Laclau, Ernesto (1988): Politics and the Limits of Modernity, in: Andrew Ross (Hg.): Universal Abandon? The
Politics of Postmodernism. Minneapolis: University of Minnesota Press, S. 63-82.
Laclau, Ernesto (1990): New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso.
Laclau, Ernesto (1993): Discourse, in: R.A. Goodin, Philipp Petit (Hg.): A Companion to Contemporary Politi-
cal Philosophy. Oxford: Blackwell Publishers, S. 431-437.
Laclau, Ernesto (1994): Introduction, in: Ebd. (Hg.): The Making of Political Identities. London: Verso, S. 3-9.
Laclau, Ernesto (1996): Emancipation(s). London: Verso.
Laclau, Ernesto (1999): Dekonstruktion, Pragmatismus, Hegemonie. In: Chantal Mouffe (Hg.) Dekonstruktion
und Pragmatismus. Demokratie, Wahrheit und Vernunft. Wien: Passagen, S. 111-154.
Laclau, Ernesto (2000a): Identity and Hegemony; The Role of Universality in the Constitution of Political
Logics, in: Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek: Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary
Dialogues on the Left. London: Verso, S. 44-89.
Laclau, Ernesto (2000b): Structure, History and the Political, in: Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek:
Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on the Left. London: Verso, S. 182-212.
Laclau, Ernesto (2000c): Constructing Universality, in: Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek: Contingen-
cy, Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on the Left. London: Verso, S. 281-307.
Laclau, Ernesto (2001): Can Immanence Explain Social Struggles?, in: Diacritics, Vol. 31, N. 4, S. 3-10.
Laclau, Ernesto (2004): Glimpsing the future, in: Simon Critchley, Oliver Marchart (Hg.): Laclau. A critical
reader. London: Routledge, S. 279-327.
Laclau, Ernesto (2005): On Populist Reason. London: Verso.
Laclau, Ernesto; Mouffe, Chantal (1981): Socialist Strategy. Where Next?, in: Marxism Today, January 1981, S.
18-22.
Laclau, Ernesto; Mouffe, Chantal (1990): Post-Marxism without Apologies, in: Ernesto Laclau: New Reflections
on the Revolution of Our Time. London: Verso, S. 97-134.
Laclau, Ernesto; Mouffe, Chantal (2001) [1985]: Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical De-
mocratic Politics. London: Verso.
Laclau, Ernesto; Mouffe, Chantal (2006): Vorwort zur deutschen Ausgabe, in: Ebd.: Hegemonie und radikale
Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus. Wien: Passagen.
Laplanche, Jean; Pontalis, Jean-Bertrand (1972): Das Vokabular der Psychoanalyse. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Lefort, Claude (1986): The Political Forms of Modern Society. Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism. Cam-
bridge, Oxford: Polity Press.
118
Lefort, Claude (1988): Democracy and Political Theory. Cambridge: Polity Press.
Lefort, Claude; Gauchet, Marcel (1990): Über die Demokratie: Das Politische und die Instituierung des Gesell-
schaftlichen. In: Ulrich Rödel (Hg.): Autonome Gesellschaft und libertäre Demokratie. Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp, S. 89-121.
Lefort, Claude (1990): Die Frage der Demokratie. In: Ulrich Rödel (Hg.): Autonome Gesellschaft und libertäre
Demokratie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 281-297.
Lefort, Claude (1999): Fortdauer des Theologisch-Politischen? Wien: Passagen.
Lefort, Claude (2007): Le temps présent. Écrits 1945-2005. Paris: Belin.
Legget, Will (2013): Restoring society to post-structuralist politics: Mouffe, Gramsci and radical democracy, in:
Philosophy Social Criticism. 39: 3, S. 299-315.
Liu, Lydia H. (1999): The Desire for the Sovereign and the Logic of Reciprocity in the Family of Nations, in:
Diacritics. 29: 4, S. 150-177.
Marchart, Oliver (2004): Politics and Ontological Difference, in: Simon Critchley, Oliver Marchart (Hg.):
Laclau. A Critical Reader. London: Routledge, S. 54-72.
Marchart, Oliver (2005): Der Apparat und die Öffentlichkeit. Zur medialen Differenz von ‚Politik‘ und ‚dem
Politischen‘, in: Daniel Gethmann, Markus Stauff (Hg.): Politik der Medien. Berlin: diaphanes, S. 19-37.
Marchart, Oliver (2008): Cultural Studies. Konstanz: UTB.
Marchart, Oliver (2009): Die politische Theorie des zivilgesellschaftlichen Republikanismus: Claude Lefort und
Marcel Gauchet, in: André Brodocz, Gary S. Schaal (Hg.): Politische Theorien der Gegenwart II. Eine Einfüh-
rung. 3., erweiterte und aktualisierte Auflage. Opladen: Budrich, S. 221-251.
Marchart, Oliver (2010): Die Politische Differenz. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Marchart, Oliver (2013): Das unmögliche Objekt. Eine postfundamentalistische Theorie der Gesellschaft. Berlin:
Suhrkamp.
Merkel, Angela (2013): Rede zur Eröffnung der Zukunftsmesse Hannover, 7. April 2013. Url.:
http://www.bundeskanzlerin.de (Zugriff: 3.8.2013).
Moebius, Stephan (2003): Die soziale Konstituierung des Anderen. Grundrisse einer poststrukturalistischen
Sozialwissenschaft nach Lévinas und Derrida. Frankfurt a.M.: Campus.
Moebius, Stephan (2008): Handlung und Praxis: Konturen einer poststrukturalistischen Handlungstheorie, in:
Stephan Moebius, Andreas Reckwitz (Hg.): Poststrukturalistische Sozialwissenschaften. Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp, S. 58-74.
Moebius, Stephan (2009a): Kultur. Bielefeld: transcript.
Moebius, Stephan (2009b): Strukturalismus/Poststrukturalismus, in: Georg Kneer, Markus Schroer (Hg.): Hand-
buch Soziologische Theorien. Wiesbaden: VS, S. 419-444.
Mouffe, Chantal (1979): Hegemony and Ideology in Gramsci, in: Chantal Mouffe (Hg.): Gramsci and Marxist
Theory. London: Routledge and Kegan Paul, S. 168-204.
Mouffe, Chantal (1993): The Return of the Political. London: Verso.
Mouffe, Chantal (2006): Hegemony, democracy, agonism and journalism: an interview with Chantal Mouffe by
Nico Carpentier and Bart Cammaerts, in: Journalism Studies, 7 (6), S. 964-975.
Mouffe, Chantal (2008) [2000]: Das Demokratische Paradox. Aus dem Englischen übersetzt und eingeleitet von
Oliver Marchart. Wien: Turia + Kant.
Mouffe, Chantal (2010) [2005]: Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion. Bonn: Bundeszentrale
für politische Bildung.
Mouffe, Chantal (2011): Civil society, democratic values and human rights, in: Terell Carver, Jens Bartelson
(Hg.): Globality, Democracy and Civil Society. London: Routledge, S. 95-111.
Mouffe, Chantal (2013): Space, Hegemony and Radical Critique, in: David Featherstone, Joe Painter (Hg.):
Spatial Politics: Essays for Doreen Massey. London: John Wiley & Sons, S. 21-31.
119
Nonhoff, Martin (2004): Diskurs, in: Gerhard Göhler, Matthias Iser, Ina Kerner (Hg.): Politische Theorie. 22
umkämpfte Begriffe zur Einführung. Wiesbaden: VS, S. 65-82.
Nonhoff, Martin (2005): Soziale Marktwirtschaft als hegemoniales Projekt. Eine Übung in funktionalistischer
Diskursanalyse. Vortrag am 1. Juli 2005, Paris XII, Créteil, Url.: http://www.johannes-
angermueller.de/deutsch/ADFA/nonhoff.pdf (Zugriff: 19.9.2013)
Nonhoff, Martin (2006): Politischer Diskurs und Hegemonie. Das Projekt „Soziale Markwirtschaft“. Bielefeld:
transcript.
Nonhoff, Martin (2008): Politik und Regierung. Wie das sozial Stabile dynamisch wird und vice versa, in: An-
dreas Reckwitz, Stephan Moebius (Hg.): Poststrukturalistische Sozialwissenschaften. Frankfurt a.M.: Suhrkamp,
S. 277-293.
Norval, Aletta (2000): Trajectories of future research in discourse theory, in: David Howarth et al. (Hg.): Dis-
course theory and political analysis. Identities, hegemonies and social change. Manchester: Manchester Univer-
sity Press, S. 219-235.
Opratko, Benjamin (2012): Ein theoretischer Universalschlüssel? Zur Ontologisierung des Hegemoniebegriffes
bei Laclau und Mouffe, in: Iris Dzudzek, Caren Kunze, Joscha Wullweber (Hg.): Diskurs und Hegemonie. Ge-
sellschaftskritische Perspektiven. Bielefeld: transcript, S. 59-83.
Peruzzotti, Enrique; Plot, Martín (2013): Introduction: the political and social thought of Andrew Arato, in: Dies.
(Hg.): Critical Theory and Democracy. Civil Society, dictatorship, and constitutionalism in Andrew Arato’s
democratic theory. London: Routledge, S. 1-26.
Popitz, Heinrich (1992): Phänomene der Macht. 2., stark erweiterte Auflage. Tübingen: Mohr.
Quadflieg, Dirk (2008): Sprache und Diskurs: Von der Struktur zur différance, in: Andreas Reckwitz, Stephan
Moebius (Hg.): Poststrukturalistische Sozialwissenschaften. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 93-107.
Rangeon, François (1986): Société civile: histoire d’un mot, in: CURAPP (Hg.): La société civile. Paris: PUF, S.
9-33.
Rebentisch, Julianne (2011): Die Kunst der Freiheit: Zur Dialektik demokratischer Existenz. Frankfurt a.M.:
Suhrkamp.
Reckwitz, Andreas (1999): Aber irgendwann wechselt die Farbe…“ Einführende Anmerkungen zum gegenwär-
tig stattfindenden Paradigmenwechsel in den Sozialwissenschaften, in: Andreas Reckwitz, Holger Sievert (Hg.):
Interpretation, Konstruktion, Kultur. Ein Paradigmenwechsel in den Sozialwissenschaften. Opladen: Westdeut-
scher Verlag, S. 19-49.
Reckwitz, Andreas (2000): Die Transformationen der Kulturtheorie. Zur Entwicklung eines Theorieprogramms.
Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
Reckwitz, Andreas (2004): Die Politik der Moderne aus kulturtheoretischer Perspektive: Vorpolitische Sinnhori-
zonte des Politischen, symbolische Antagonismen und das Regime der Gouvernementalität, in: Birgit Schwelling
(Hg.): Politikwissenschaft als Kulturwissenschaft. Theorien – Methoden – Forschungsperspektiven. Wiesbaden:
VS, S. 33-56.
Reckwitz, Andreas (2006a): Nachwort zur Neuauflage der Studienausgabe, in: Die Transformation der Kultur-
theorien. Zur Entwicklung eines Theorieprogramms. Weilerswirst: Velbrück Wissenschaft.
Reckwitz, Andreas (2006b): Ernesto Laclau: Diskurse, Hegemonien, Antagonismen. In: Stephan Moebius, Dirk
Quadflieg (Hg.): Kultur. Theorien der Gegenwart. Wiesbaden: VS, S. 340-349.
Reckwitz, Andreas (2008): Unscharfe Grenzen. Perspektiven der Kultursoziologie. Bielefeld: transcript.
Redhead, Steve (2009): Hooligan Writing and the Study of Football Fan Culture: Problems and Possibilities,
Url.: http://www.nobleworld.biz/images/Redhead2.pdf (Zugriff: 17.9.2013).
Riley, Dylan (2010): The Civic Foundations of Fascism in Europe. Italy, Spain, and Romania, 1870-1945. Bal-
timore: Johns Hopkins University Press.
Riley, Dylan (2011): Hegemony, Democracy, and Passive Revolution in Gramsci’s Prison Notebooks, in: Cali-
fornia Italian Studies, 2: 2: S. 3-23.
Rödel, Ulrich; Dubiel, Helmut; Frankenberg, Günter (1989): Die demokratische Frage. Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp.
120
Rödel, Ulrich (1994): Zivilgesellschaft und selbstorganisierte Öffentlichkeiten, in: Neue Soziale Bewegungen.
Forschungsjournal. 1, 1994, S. 34-45.
Rüdiger, Anja (1996): Dekonstruktion und Demokratisierung. Emanzipatorische Politiktheorie im Kontext der
Postmoderne. Opladen: Leske + Budrich.
Saar, Martin (2008): Klasse/Ungleichheit: Von den Schichten der Einheit zu den Achsen der Differenz, in: Ste-
phan Moebius, Andreas Reckwitz (Hg.) (2008): Poststrukturalistische Sozialwissenschaften. Frankfurt a.M.:
Suhrkamp, S. 194-207.
Saussure, Ferdinand de (1967) [1914]: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Berlin: de Gruyter.
Schatzki, Theodore R. (1996): Social Practices. A Wittgensteinian Approach to Human Activity and the Social.
Cambridge: Cambridge University Press.
Scheulen, Hans; Szánkay, Zoltán (1999): Anmerkungen, in: Claude Lefort: Fortdauer des Theologisch-
Politischen? Wien: Passagen, S. 80-100.
Sciortino, Giuseppe (2007): Bringing Solidarity Back In, in: European Journal of Social Theory 10: 4, S. 561-570.
Sigglow, Astrid (2010): Emanzipation und Kontingenz. Poststrukturalistische Demokratietheorie bei Chantal
Mouffe, Ernesto Laclau und Jacques Derrida. Unveröffentlichte Magisterarbeit. Freiburg i.Br.
Simons, Jon (2011): Mediated Construction of the People: Laclau’s Political Theory and Media Politics, in:
Lincoln Dahlberg, Sean Phelan (Hg.): Discourse Theory and Critical Media Politics. Basingstoke: Palgrave-
Macmillan, S. 201-219.
Smith, Anna-Marie (1998): Laclau and Mouffe. The radical democratic imaginary. London: Routledge.
Somers, Margaret R. (1994): The narrative constitution of identity: A relational and network approach, in:
Theory and Society 23: S. 605-649.
Sorel, Georges (2012): Über die Gewalt, zit. nach Anmerkungen zu Heft – § 15, in: Gramsci, Antonio (2012):
Gefängnishefte. Kritische Gesamtausgabe. Herausgegeben von Klaus Bochmann und Wolfgang Fritz Haug.
Neuauflage der Erstausgabe 1991. Hamburg: Argument.
Stäheli, Urs (2000): Poststrukturalistische Soziologien. Bielefeld: transcript.
Stäheli, Urs (2004): Competing Figures of the Limit. Dispersion, Transgression, and Indifference, in: Simon
Critchley, Oliver Marchart (Hg.): Ernesto Laclau. A Critical Reader. London: Verso, S. 226-240.
Stäheli, Urs (2007): Von der Herde zur Horde? Zum Verhältnis von Hegemonie- und Affektpolitik, in: Martin
Nonhoff (Hg.): Diskurs – radikale Demokratie – Hegemonie. Zum politischen Denken von Ernesto Laclau und
Chantal Mouffe. Bielefeld: transcript, S. 123-138.
Stäheli, Urs (2009): Kapitel VII. Die Politische Theorie der Hegemonie: Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, in:
André Brodocz, Gary S. Schaal (Hg.): Politische Theorien der Gegenwart II. Eine Einführung. 3., erweiterte und
aktualisierte Auflage. Opladen: Budrich, S. 250-284.
Stäheli, Urs (2010): Macht, Hegemonie, Posthegemonie. Vortrag im Rahmen der interdisziplinären Vorlesungs-
reihe „Schlüsselkonzepte der Geistes- und Sozialwissenschaften“. Institute of Adanced Studies in the Humanities
and the Social Sciences. Universität Bern.
Subirats, Joan (2013): Cómo está lo mío? En España, la democracia es estable, pero el equilibrio entre sociedad
civil, Estado y partidos no se ha dado. El País, 9.2.2013.
Tacke, Veronika (2008): Organisation, in: Sina Farzin, Stefan Jordan (Hg.): Lexikon Soziologie und Sozialtheo-
rie. Hundert Grundbegriffe. Stuttgart: Reclam, S. 212-215.
Tellmann, Ute (2008): Ideologie, in: Sina Farzin, Stefan Jordan (Hg.): Lexikon Soziologie und Sozialtheorie.
Hundert Grundbegriffe. Stuttgart: Reclam, S. 110-113.
Thoburn, Nicholas (2007): Patterns of Production: Cultural Studies after Hegemony, in: Theory, Culture and
Society, 24: 3, S. 79-94.
Thomassen, Lasse (2006): Antagonism, Hegemony and Ideology after Heterogeneity, in: Journal of Political
Ideologies, 10:3, S. 289-309.
121
Torfing, Jacob (2005): Discourse Theory: Achievements, Arguments, and Challenges, in: David Howarth, Jacob
Torfing (Hg.): Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance. Hampshire: Macmillan,
S. 1-31.
Trotha, Trutz von (1994): Streng aber gerecht. Hart, aber tüchtig. Über Formen von Basislegitimität und ihre
Ausprägungen am Beginn staatlicher Herrschaft, in: Wilhelm Möhlig, Trutz von Trotha (Hg.): Legitimation von
Herrschaft und Recht, 3. Kolloquium der deutsch-französischen Rechtsanthropologen. Köln: Rüdiger Köppe
Verlag, S. 69-90.
Türk, Klaus; Lemke Thomas; Bruch, Michael (2006) [2002]: Organisation in der modernen Gesellschaft. Eine
historische Einführung. Wiesbaden: VS.
Votsos, Theo (2001): Der Begriff der Zivilgesellschaft bei Antonio Gramsci. Ein Beitrag zur Geschichte und
Gegenwart politischer Theorie. Hamburg: Argument.
VVAA (2012): Más sociedad civil. La sociedad civil tiene que mobilizarse en estos momentos tan críticos. Ma-
nifesto. Url.: http://www.levante-emv.com/ (Zugriff: 28.7.2013).
Waldherr, Annie (2008): Gatekeeper, Diskursproduzenten und Agenda-Setter – Akteursrollen von Massenmedi-
en in Innovationsprozessen, in: Pfetsch, Barbara; Adam, Sylke (2008): Massenmedien als politische Akteure.
Konzepte und Analysen. Wiesbaden: VS, S. 171-195.
Wenman, Mark (2003): Laclau or Mouffe? Splitting the Difference, in: Philosophy & Social Criticism 29: 5, S.
581-606.
Werlen, Benno (2008): Körper, Raum und mediale Repräsentation, in: Jörg Dörning, Tristan Thielmann (Hg.):
Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Bielefeld: transcript, S. 365-392.
White, Hayden (1999): Figural Realism: Studies in the Mimesis Effect. Baltimore: John Hopkins University
Press.
Williams, Raymond (1977): Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press.
Wittgenstein, Ludwig (1986) [1946]: Tractatus Logico-Philosophicus, Tagebücher 1914-1916, Philosophische
Untersuchungen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Wood, Ellen Meiksins (1990): The Uses and Abuses of ‘Civil Society’, in: Socialist Register, 26: S. 60-84.
Wullweber, Joscha (2012): Konturen eines politischen Analyserahmens – Hegemonie, Diskurs und Antagonis-
mus, in: Iris Dzudzek, Caren Kunze, Joscha Wullweber (Hg.): Diskurs und Hegemonie. Gesellschaftskritische
Perspektiven. Bielefeld: transcript, S. 29-58.
Žižek, Slavoj (1990): Beyond Discourse-Analysis. In: Ernesto Laclau: New Reflections on The Revolution of
Our Time. London: Verso, S. 249-260.