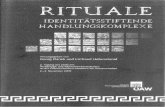Staat, Legitimität und Praktiken der Wasserversorgung im Mekong Delta: Zur Konzeptualisierung von...
Transcript of Staat, Legitimität und Praktiken der Wasserversorgung im Mekong Delta: Zur Konzeptualisierung von...
Geographische Zeitschrift, Band 103 · 2015 · Heft 2 · Seite xx–xx© Franz Steiner Verlag, Stuttgart
1 Einleitung
Der vorliegende Beitrag verfolgt zwei Ziele. Erstes und vorrangiges Ziel des Beitrags ist eine theoretische Konzeptualisierung von politischer Kultur für die geographische Forschung. Es soll
dargelegt werden, welchen Beitrag Philosophie und (darauf aufbauend) Methodologie des Kri-tischen Realismus – einer Wissenschaftstheorie, die vor allem auf den engl. Philosophen Roy Baskhar zurückgeht – zur Theoretisierung von politischer Kultur beitragen können, und warum
Staat, Legitimität und Praktiken der Wasserversorgung im Mekong-Delta: Zur Konzeptualisierung von politischer
Kultur aus kritisch-realistischer Perspektive
NADINE REIS, Bonn
Ziel des Beitrags ist eine theoretische Konzeptualisierung von politischer Kultur für die geographische Forschung. Dem kritischen Realismus folgend wird Kultur als „wirkliches“ Bedeutungssystem konzeptu-alisiert, ist jedoch weder epiphänomenal noch Hauptbestimmungsfaktor für Gesellschaft. Eine Analyse von Entscheidungsprozessen in der vietnamesischen Wasserbürokratie zeigt, dass Kultur ein elementarer Be-standteil des gegebenen politisch-ökonomischen Systems ist, und dass dies mithilfe einer kritisch-realis-tischen Analyseperspektive auch systematisch dargelegt werden kann. Ausgehend von der Fallstudie wird vorgeschlagen, zwei Kriterien für die Definition eines politisch-kulturellen Systems anzulegen. Es handelt sich erstens um ein Bedeutungssystem, in dem es um das Verhältnis des Individuums zu seiner sozialen Welt und Fragen von Macht und Autorität geht. Zweitens zeichnet sich politische Kultur durch den Zusam-menhang mit politisch-ökonomischen Strukturen aus. Im Ausblick werden Ansatzpunkte und Forschungs-fragen skizziert, die sich aus einer solchen Konzeption von (politischer) Kultur für die geographische Forschung ergeben.
Schlüsselwörter: Kritischer Realismus, Politische Kultur, Staatstheorie, Vietnam
State, Legitimacy, and Practices of Water Supply in the Mekong Delta: Conceptualising Political Culture from a Critical Realist Perspective
The article deals with a theoretical conceptualisation of political culture for geographical research. Based on critical realist philosophy, culture is conceptualised as ‘real’ system of meaning, which is neither epi-phenomenal nor the principal determinant of society. Research on decision-making processes in the Viet-namese water bureaucracy has shown that culture is an essential element of the given political economic system, and that the critical realist perspective is useful for a systematic analysis of the functioning of this relationship. Based on the case study I suggest two criteria for defining a political-cultural system. Firstly, it is a system of meaning concerned with the relationship of the individual to his/her social world and issues of power and authority. Secondly, political culture is characterised by its linkage to political-economic structures. The article ends with some suggestions as regards starting points and research questions emerg-ing from the presented conceptualisation of (political) culture for future geographical research.
Keywords: Critical Realism, political culture, state theory, Vietnam
2 Nadine Reis
diese Perspektive relevant für die Erforschung von Staatlichkeit ist. Wie ich darlegen möchte, bietet eine kritisch-realistische Perspektive auf politische Kultur insbesondere Potenzial für die Erforschung von multiskalarer Politik und For-men der „Glokalisierung“ (Swyngedouw 2000).
Zweitens verfolgt der Beitrag das Ziel, ein Verständnis von Kultur vorzustellen, mit dessen Übernahme der/die GeographIn nicht auf rein konstruktivistische Gesellschaftstheorien be-schränkt bleibt, sondern mit der die Erforschung von Kultur theoretisch sinnvoll mit der Analyse von politischen Ökonomien in Einklang werden kann. Die Philosophie des Kritischen Realismus ist seit den 1980er Jahren in der englischspra-chigen Geographie populär (vgl. z. B. Massey/Meegan 1985; Sayer 1992) und erfährt dort in jüngster Vergangenheit neue Aufmerksamkeit (vgl. Cox 2013; Pratt 2013). Im vorliegenden Beitrag wird die Auffassung vertreten, dass der Kritische Realismus für die geographische For-schung besonders fruchtbar ist, da Kultur prin-zipiell der Status von Wirklichkeit zugestanden wird, sie jedoch weder als epiphänomenal (klas-sisch-marxistische politische Ökonomie)1, noch als Hauptbestimmungsfaktor für Gesellschaft (radikal konstruktivistische Ansätze innerhalb der „Neuen Kulturgeographie“)2 verstanden wird. Der Beitrag will somit eine Alternative sowohl zum essentialistischen Kulturverständnis der traditionellen Länderkunde als auch zu re-lativistischen Kulturauffassungen, die in der Hu-mangeographie der vergangenen zwei Jahrzehn-te dominant waren (vgl. Boeckler 2005, 36f.), aufzeigen.
Der Beitrag gliedert sich in vier Teile. In Teil eins sollen zunächst die wissenschaftstheoreti-schen Ausgangspunkte der kritisch-realistischen Perspektive auf Kultur beleuchtet werden, die in einer formell-theoretischen Arbeitsdefinition von „Kultur“ mündet. Im zweiten Teil wird eine empirische Fallstudie präsentiert, in der Ent-scheidungsprozesse in der vietnameschen Was-serbürokratie untersucht wurden. Die Studie zeigt, dass die kulturelle Dimension elementar für das Verständnis von politischen Prozessen und Staatlichkeit ist, und dass dies mithilfe einer
kritisch-realistischen Analyseperspektive auch systematisch dargelegt werden kann. Ausgehend von der Fallstudie wird im dritten Teil die Frage behandelt, was spezifisch unter „politischer Kultur“ verstanden werden kann oder sollte. Im Ausblick werden schließlich einige Forschungs-perspektiven skizziert, die sich daraus für die Geographie ergeben.
2 Politische Kultur aus kritisch-realistischer Perspektive
Ausgangspunkt des Versuchs, politische Kultur theoretisch zu fassen, ist zunächst das „Gefühl“, dass Kultur Einfluss auf Untersuchungsgegen-stände hat, die für die geographische Forschung von Interesse sind, beispielsweise für die gover-nance von natürlichen Ressourcen. Damit einher geht die Annahme, dass Kultur nicht nur Ergeb-nis von anderen sozialen, ökonomischen oder politischen Strukturen ist, sondern selbst etwas „macht“, also ursächlich für bestimmte soziale, politische oder ökonomische Zusammenhänge sein kann. Aus diesem „Gefühl“ heraus präsen-tierten die „Urväter“ einer Theorie der politi-schen Kultur, Gabriel Almond und Sidney Verba, bereits im Jahr 1963 ein theoretisches Konzept, basierend auf empirischen Studien zu politischer Kultur in fünf Ländern (Almond/Verba 1963). Die breite Rezeption ihres Ansatzes fiel jedoch vor allem der Kritik des Kulturalis-mus zum Opfer (Almond 1989, 28ff.). Darüber hinaus erscheint ein verengter Kulturbegriff, der sich in der quantitativen Methodik der Almond/Verba-Studie spiegelt, nur begrenzt brauchbar für die Beantwortung komplexerer sozialwis-senschaftlicher Fragestellungen. So moniert etwa Rohe (1990, 331), „daß die Survey-For-schung den harten Kern einer jeden politischen Kultur, der aus kaum reflektierten Selbstver-ständlichkeiten besteht, geradezu systematisch verfehlen muß, weil den Befragten kulturelle Selbstverständlichkeiten gar nicht bewußt oder bestenfalls halb bewußt sind“ (Rohe 1990, 331). Die Schwierigkeit, politische Kultur als wissen-schaftliches Konzept zu begreifen ist demnach
Staat, Legitimität und Praktiken der Wasserversorgung im Mekong-Delta 3
sowohl ontologischer wie auch epistemolo-gischer und methodischer Art. Es stellt sich also die Frage, wie die höchst alltagsweltlich vorbe-lastete, diffuse und schwer zu greifende Idee von „politischer Kultur“ so systematisch theoretisiert werden kann, dass sie für eine wissenschaftliche Erklärung der sozialen Welt herhalten kann.
Zunächst ist eine Klärung der wissenschafts-theoretischen Ausgangspunkte notwendig, auf der eine Theoretisierung von politischer Kultur stattfindet bzw. überhaupt stattfinden kann. Denn ob Kultur ein legitimes Objekt für die sozialwissenschaftliche Forschung darstellt, hängt zuallererst von der ontologischen Grund-position des Betrachters ab. Wer beispielsweise, aus der klassisch-marxistischen Denkweise kommend, Kultur lediglich als epiphänomenalen Überbau begreift, erkennt kulturelle Strukturen nicht als ursächlich für gesellschaftliche Mecha-nismen, den Wandel oder die Reproduktion von gesellschaftlichen Strukturen an. Positivis-tisch-individualistische Positionen wiederum, wie sie vor allem in der (neo-)klassischen Wirt-schaftswissenschaft und vergleichenden Politik-wissenschaft vorzufinden sind, erkennen den Faktor „Kultur“ nicht als relevantes Forschungs-objekt an, da die Wirklichkeit und potenzielle Erforschbarkeit von wirkungsmächtigen Struk-turen von vornherein negiert werden. Die Welt besteht hiernach aus Einzelereignissen, und nur die empirische Regelmäßigkeit von Einzelereig-nissen wird als wissenschaftliche Erklärung anerkannt. Auf der anderen Seite solcher Pers-pektiven, die die Wirkmächtigkeit von Kultur ablehnen, stehen idealistische und relativistische Perspektiven, in denen Kultur zur Hauptdeter-minante sozialer Ordnung gemacht wird.
Demgegenüber wird im Kritischen Realismus eine Ontologie vertreten, in der sowohl mensch-liche als auch nicht-menschliche Strukturen un-abhängig von menschlicher Wahrnehmung oder Erkenntnis existieren und von kausaler Bedeu-tung für die soziale Welt sind. Gesellschaftliche Strukturen sind dabei selbst immer Folgen von vorhergegangenen menschlichen Praktiken, wer-den also nur durch menschliche Praktiken (re-)produziert. Handelnde Akteure müssen sich der
wirkmächtigen Strukturen nicht bewusst sein. Die Identifikation kausaler Wirkbeziehungen, die gerade nicht durch direkte Beobachtung/Abfrage erkennbar sind, ist just die wissenschaftliche Leistung (vgl. auch Endnote 6).
Strukturen verfügen über Kräfte und Dispo-sitionen, die je nach Kontext als Mechanismen (in Praktiken) wirksam werden können oder nicht. Ob Mechanismen konkrete Ereignisse hervorrufen oder nicht ist wiederum kontextab-hängig, d. h. abhängig vom möglichen Vorhan-densein anderer, entgegenwirkender, Mechanis-men (Bhaskar/Lawson 1998, 9). Bei der Identi-fikation von Kausalität geht es somit nicht um das regelmäßige Auftreten von Einzelereignis-sen, sondern darum, die Eigenschaften und Wirkmächtigkeit von Forschungsobjekten zu bestimmen. Kausale Ursächlichkeit kann Ob-jekten daher prinzipiell auch unabhängig von bestimmten Ereignismustern zugeschrieben werden (Sayer 1992, 105).
Bei der Bestimmung von kausaler Ursäch-lichkeit geht es jedoch nicht lediglich darum, diese bloß festzustellen. Ein typisches Beispiel hierfür ist eine Politikfeldanalyse, an deren Ende „mangelnder politischer Wille“ oder „fehlende Kommunikation“ für die Diskrepanz zwischen den Zielen und Ergebnissen von Politik verant-wortlich gemacht werden. Vielmehr ist von In-teresse, wie bestimmte Kausalitäten funktionie-ren. Die Logik der Schlussfolgerung über das, was wirklich ist, basiert daher weder auf Deduk-tion noch auf Induktion, sondern auf Retroduk-tion: Ziel des sozialwissenschaftlichen Unter-fangens ist die Identifikation von Mechanismen, die bestimmte Ereignisse produzieren (ebd., 106). Retroduktion beinhaltet also die Isolierung der für die Existenz eines Ereignisses notwen-digen Bedingungen. Wirklich ist demnach nicht nur das empirisch erfahrbare, sondern auch das, was wirkliche Effekte hat, denn „what does not exist cannot exert force“ (Peet 2002, 331). Einer solchen wissenschaftstheoretischen Grundlage folgend ist Kultur prinzipiell wirklich – und von besonderem Interesse dann, wenn sie eine not-wendige Bedingung für die Erklärung eines Phänomens ist.
4 Nadine Reis
Wie kann das „chaotische“ Objekt „Kultur“ sinnvoll abstrahiert werden, so dass wir von einer bestimmten Kultur als einer kausalen Ursache für soziale Ereignisse sprechen können? Kri-tisch-realistische Ansätze schlagen vor, Kultur nicht als einheitliches, abgrenzbares und festste-hendes Objekt zu fassen, sondern als Struktur zu begreifen, die, wie auch politisch-ökonomische Strukturen, Praxis konditioniert (vgl. Bukovans-ky 2002, 30). Hierfür ist es hilfreich, zunächst eine Definition des Begriffs „Struktur“ vorzu-nehmen: Als „Struktur“ wird im Kritischen Re-alismus ein Set von Elementen (Praktiken oder Objekten) bezeichnet, deren Beziehungen unter-einander intern und notwendig sind (Sayer 1992, 92). Strukturen können demnach identifiziert werden, in dem Fragen nach der Art von Bezie-hungen zwischen Elementen in einer komplexen Realität gestellt werden. Solche Fragen sind beispielsweise: Was sind die Bedingungen für die Existenz dieses Objektes? Kann es als solches unabhängig von anderen Elementen bestehen? Wenn nicht, von was ist es abhängig (ebd., 91)? Die Beziehung zwischen Hauseigentümer und Mieter setzt beispielsweise die Existenz von Privateigentum, Miete, ökonomischem Mehr-wert etc. voraus (ebd., 92). Dabei existieren Strukturen auch auf verschiedenen Ebenen: „Contrary to a common assumption, structures include not only big social objects such as the international division of labour but small ones at the interpersonal and personal levels (e. g. con-ceptual structures) and still smaller non-social ones at the neurological level and beyond“ (ebd.). Die Identifikation von Strukturen ist zentral, denn diese konditionieren (nicht: determinieren!) soziale Interaktion durch das ihnen eigene Wir-kungsvermögen, die hier als emergente Eigen-schaften (emergent properties) bezeichnet wer-den. Emergente Eigenschaften entstehen aus der Struktur des Objekts, d. h. sie sind nicht redu-zierbar auf die Wirkungskräfte der einzelnen Elemente der Struktur. Einfach ausgedrückt bezeichnet Emergenz die Einsicht, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist.3
Wie Archer dargelegt hat, können auch kul-turelle Strukturen auf diese Art und Weise abs-
trahiert werden, indem sie als Bedeutungsstruk-turen begriffen werden, die emergent sind, d. h. aus sozialer Interaktion der Akteure hervorgehen, und gleichzeitig in diesen operativ sind (Archer 2005, 24). „Kultur“ wird hierbei definiert als alle intelligibilia, d. h. Elemente, die potenziell von Menschen verstanden werden können. Kultur kann theoretisch abstrahiert werden und Teil der Erklärung von sozialen Gegebenheiten sein, indem kulturelle Systeme, also Bedeutungsstruk-turen, identifiziert werden. Ein kulturelles Sys-tem (C. S.) wird verstanden als ein Korpus von Ideen oder „Aussagenregister“, der oder das in einer Gesellschaft zu einem bestimmten Zeit-punkt vorhanden ist (ebd.). Wie alle Strukturen besitzen kulturelle Systeme emergente Eigen-schaften: „At any moment, the C. S. is the prod-uct of historical S-C [socio-cultural, Anm. N.R.] interaction, but having emerged (cultural emer-gence being a continuos process) then qua prod-uct, it has properties but also powers of its own kind. Like structure, some of its most important causal powers are those of constraints and en-ablements” (ebd., 25; Herv. i. Orig.).
Im Folgenden wird ein Fallbeispiel darge-stellt, bei der die Bedeutung von kulturellen Systemen für die Analyse von politischen Pro-zessen deutlich wird. Hiermit wird anschließend ein Verständnis von politischer Kultur entwi-ckelt.
3 Politische Kultur und Entscheidungs prozesse in der Wasserbürokratie in Vietnam
Die Forschung wurde als Teil des BMBF-Pro-jekts WISDOM (Water-related information system for the sustainable development of the Mekong Delta) im Rahmen einer Dissertation in den Jahren 2007-2010 durchgeführt. Gegen-stand der Untersuchung war der Sektor der ländlichen Trinkwasserversorgung im vietname-sischen Mekong-Delta. Ausgangspunkt der Forschung war die Frage nach den Faktoren, die Entscheidungsprozesse in der Wasserbürokratie beeinflussen: Was wird von wem warum ent-
Staat, Legitimität und Praktiken der Wasserversorgung im Mekong-Delta 5
schieden, und wie werden politische Entschei-dungen umgesetzt? Welche Strukturen sind also wirksam bei der Art und Weise, wie Politik in der ländlichen Wasserversorgung gemacht und umgesetzt wird? Für die Beantwortung dieser Fragen kamen vornehmlich qualitative Metho-den zur Anwendung, welche mithilfe von Ab-straktion und Retroduktion als zentrale Metho-den der Theoriebildung (Yeung 1997, 58ff.; Blaikie 2010, 87ff.; Bygstad/Munkvold 2011) analysiert wurden. Bei der Retroduktion werden aus dem Datenmaterial mithilfe von Abstraktion Kategorien gebildet, um zwischen kontingenten und notwendigen Wirkbeziehungen zu unter-scheiden. Abstraktion ist laut Sayer (1992, 88) notwendig, denn: „Neither objects nor their re-lations are given to us transparently; their iden-tification is an achievement and must be worked for“. Mit der Abstraktion wird so lange fortge-fahren, bis eine theoretische Sättigung erreicht ist, d. h. wenn weitere Abstraktion keine weitere, signifikante theoretische Präzision mehr hervor-bringt und wenn die empirische Basis stark genug ist, um die praktische Adäquanz des po-stulierten Mechanismus zu unterstützen (Yeung 1997, 59). Insgesamt wurden 167 halbstruktu-rierte Interviews mit Behördenvertretern auf vier administativen Ebenen (95), ländlichen Haus-halten (55), Vertretern von internationalen Or-ganisationen (14) und Forschungsinstituten (3) durchgeführt, auch unter Anwendung der parti-zipativen Methode des „Influence Network Mapping“ (Schiffer/Waale 2008). Zudem wur-den ein Jahr lang Sekundärdaten gesammelt, wie offizielle Statistiken, Berichte und Pläne, sowie lokale Zeitungsartikel. Räumliche Daten wurden mit Hilfe von GIS erhoben.
Das Untersuchungsgebiet Can Tho City ist eine Provinz im vietnamesischen Mekong-Del-ta, die seit den 1990er Jahren stark durch mas-sive Intensivierung der Landwirtschaft, Indust-rialisierung (insbes. Fischzucht und -verarbei-tung für den Export) und davon begleitet, hohem Bevölkerungswachstum und Urbanisierung ge-prägt wird. Trotz des offiziellen „City“-Status sind viele Gemeinden noch ländlich geprägt. Das schnelle Wirtschaftswachstum führte jedoch zur
massiven Degradierung von natürlichen Res-sourcen. Für die ländliche Bevölkerung ist dies besonders problematisch im Hinblick auf die Verschmutzung von Flüssen und Kanälen, wel-che das Mekong-Delta netzwerkartig durchzie-hen und welche die Bevölkerung traditioneller-weise für die häusliche Wasserversorgung nutzt.
Die häusliche Wasserversorgung in den länd-lichen Gemeinden basiert heute auf der Nutzung verschiedener Wasserquellen. Von großer Be-deutung ist Oberflächenwasser (d. h. Fluss- bzw. Kanalwasser), welches aufgrund der Siedlungs-struktur, die sich an den Wasserwegen orientiert, leicht zugänglich ist. Weiterhin speichern die Haushalte Regenwasser, welches jedoch in der Trockenzeit (Dezember bis April) nicht verfüg-bar ist. Seit der zunehmenden Verschmutzung des Oberflächenwassers in den 1980er Jahren wurden außerdem verstärkt Tiefbrunnen ge-bohrt. Da sauberes Grundwasser jedoch erst in Tiefen von 60-100m zu finden ist, ist dies relativ teuer und daher nur für wohlhabendere Haus-halte möglich.
Die Strategie der Provinzregierung bzw. der zuständigen Behörde CERWASS (Centre for Rural Water Supply and Environmental Sanita-tion) besteht seit Ende der 1990er Jahre darin, Wasserversorgungsstationen mit Trinkwasser-netzwerken zu bauen, die ebenfalls Grundwasser nutzen und ca. 50-100 Haushalte versorgen. Das Versorgungsnetz deckt jedoch bei weitem nicht den gesamten ländlichen Raum ab, und die ganzjährige Versorgung mit sauberem Trinkwas-ser bleibt problematisch für ca. 30-50 % der Bevölkerung. Dies ist vor allem auf die man-gelnde Wirtschaftlichkeit des Systems zurück-zuführen, die eine flächendeckende Versorgung und die Anbindung aller Haushalte an das Netz-werk derzeit verhindert und auch für die Zukunft unwahrscheinlich erscheinen lässt (Reis 2012, 90ff.). Darüber hinaus ist das System ökologisch nicht nachhaltig, da das Grundwasser aus einem antiken Grundwasserspeicher gewonnen wird. Der politische Ansatz zur Lösung des Problems erscheint daher zunächst nicht rational.
Die Untersuchung des politischen Entschei-dungsprozesse im Trinkwassersektor ergab eine
6 Nadine Reis
scheinbare „Schizophrenie“ der politischen Praktiken: Der formelle Politikprozess weicht signifikant von den eigentlich entscheidenden Praktiken ab, welche in der „informellen Sphä-re“ stattfinden. Die Planung für ländliche Was-serversorgung findet im traditionell-sozialisti-schen Staatsapparat im Rahmen von Jahresplä-nen und einem System von „bottom-up“-Be-richterstattungen und „top-down“-Entscheidun-gen statt. Lokale Beamte sammeln allerlei Daten über die Situation und Bedürfnisse der Bevöl-kerung und leiten diese nach Oben weiter, wo sie dann als Entscheidungsgrundlage herange-zogen werden. All das geschieht laute Aussagen zahlreicher interviewter Beamter „to serve the needs of the people“. Die Wasserbürokratie ist tagtäglich damit beschäftigt, die Planungsma-schinerie durch das Erheben von Daten, das Verfassen von Berichten und Statistiken, das Festlegen von Planzielen und das Abhalten von Besprechungen am Leben zu erhalten. Vasavakul (2006) identifiziert die Betonung der „Service-orientierung“ als eine neue Art von „governance culture“ in Vietnam, die aus einer Reform der öffentlichen Verwaltung (Public Administration Reform) im Jahr 2001 resultiert. Infolge dieser sollen Beamte den Bürgern als „Kunden“ Dienstleistungen bereitstellen (ebd., 150).
Die Auswertung der Daten ergab jedoch, dass der tatsächliche Entscheidungsprozess nicht dem vorgegebenen Ansatz (demand-orientation) folgt. Es konnte gezeigt werden, dass weder der politische Ansatz (Wasserversorgungsstationen bauen) noch wie dieser ausgeführt wird (wo die neuen Stationen gebaut werden) noch die Bud-getzuordnung auf nationaler Ebene an die Pro-vinzen durch die formelle staatliche „Planungs-maschinerie“ – d. h. auf Basis von Daten und Berichten über die Situation und Bedürfnisse der Bevölkerung – entschieden wird. Entschei-dend sind vielmehr Praktiken, die in einer infor-mellen Staatssphäre stattfinden. Diese informel-le Sphäre wird von den materiellen Interessen einer politischen Elite genährt, die Geschäfte für Wasserversorgungsunternehmen macht, die sie bzw. nahe Verwandte besitzen oder in die sie investiert haben.
Die Ko-existenz der beiden Sphären wurde in der Literatur als Existenz von zwei gegenei-nander arbeitenden Kräften im Kommunisti-schen Einparteienstaat verstanden, die um die Kontrolle von Politik konkurrieren. Während ein Teil des Staatsapparats für eine neue „öffent-liche Servicekultur“, für mehr Effizienz und die Bekämpfung von Korruption stehe, streben dem Veränderungsprozess Kräfte entgegen, die hier-durch materielle Verluste hätten (Painter 2003, 260; Vasavakul 2006). Im Gegensatz dazu wird im Folgenden argumentiert, dass die Ko-existenz der beiden Sphären eine inhärente Logik auf-weist. Diese Logik steht im Zusammenhang mit dem kulturellen System, auf dem der vietname-sische Staat fußt.
Staatlichkeit beruht auf sozial produzierter und reproduzierter Legitimität, die in unter-schiedlichen Kontexten unterschiedlich herge-stellt und institutionalisiert wird. „Staat“ und „Gesellschaft“ sind keine analytisch zu trennen-den Konzepte, da die Existenz des Staats u. a. auf einer sozial kontingenten Idee basiert (Ab-rams 1988/1977, 68; Englebert 2000, 74). In Vietnam wird der Staat von einer Idee zusam-mengehalten, die in der Doktrin des „demokra-tischen Zentralismus“ Ausdruck findet. Diese Kerndoktrin des sozialistischen politisch-juris-tischen Kanons (Gillespie 2005, 47) geht auf den Glauben Lenins zurück, die demokratischen Rechte der Arbeiterklasse könnten nur durch die „Diktatur des Proletariats“ sichergestellt werden (ebd., 48; Duong 2004, 5) und mündet schlus-sendlich in der Idee, dass eine politische Elite im Interesse der Allgemeinheit handelt. Der Fortbestand dieser Idee zeigt sich auf Bannern in lokalen Volkskomitees mit Slogans wie „Die Partei ist das Volk und das Volk ist die Partei“, oder dem populären Slogan „The party leads, the people rule, the government manages“ (Han-nah 2005, 103).
Während der Anspruch auf einen allgemeinen Willen oder ein Allgemeininteresse eine gene-relle Eigenschaft des Systems „Staat“ darstellt (Jessop 2008, 9), stellt sich die Frage, durch welche Mechanismen der Glaube an diesen konkret produziert wird. Auf Basis der empiri-
Staat, Legitimität und Praktiken der Wasserversorgung im Mekong-Delta 7
schen Untersuchung von Entscheidungsprozes-sen in der Wasserbürokratie wird im Folgenden argumentiert, dass in Vietnam das Bild eines Staatsapparats, in dem die Bedürfnisse der Be-völkerung systematisch aufgenommen werden und die Basis für die politische Entscheidungs-findung bilden, das Kernprinzip für die Erzeu-gung dieses Glaubens ist. Es ist die Darbietung von Zweckrationalität im Politikprozess, welche für politische Legitimität mobilisiert wird.
Unter Rückgriff auf die Gesellschaftstheorie Margaret Archers (1995) zeigt Abbildung 1 schematisch auf, wie sowohl formelle als auch informelle politische Praktiken funktional für die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung in Vi-etnam sind. Gesellschaft beinhaltet laut Archer die Bedingtheit durch politisch-ökonomische und kulturelle Strukturen4 (als emergente Konsequen-zen vorhergegangenen Handelns), soziale Inter-aktion, und strukturelle Elaboration oder Repro-
duktion, wobei ersteres als „Morphogenese“, letzteres als „Morphostase“5 bezeichnet wird.
Das Funktionieren des vietnamesischen Staats kann hiermit als Zusammenfallen von politisch-ökonomischer und kultureller Morpho-stase erklärt werden, d. h. einer Situation, die einerseits eine monolithische soziale Ordnung mit der Überlagerung der gesamten Gesellschaft durch Eliten sowie starker Konzentration mate-rieller Ressourcen aufweist (rechte Seite), und andererseits „the hegemony of systematization or syncretism“ auf der kulturellen Ebene (linke Seite) (Archer 1995, 309). „Turning […] to the mutual influences of the two domains upon one another, these display complete reciprocity. The force of hegemonic ideas imposes itself on stable social groups and the fortune of the dominant groups reinforces the stability of ideas, the two thus working together for maintenance of the status quo“. (ebd., 310)
produce
Idea of the state (Cultural Emergent Property)
One-party rule (Structural Emergent
Property)
Formal policy practices (Socio-Cultural interaction)
What policy does
Informal policy practices (Social Interaction)
Cultural reproduction: “Government caring for
the people”
Structural reproduction: concentration of resources
with political/economic elite
activated in activated in
Creating legitimacy Maintaining and increasing resources
Stability of idea
Force of hegemonic idea
Abb. 1: Die Wirkungsweise von Politikprozessen in der Trinkwasserversorgung für Morphostasis in Vietnam (Reis 2012, 216)
8 Nadine Reis
Konkret wird hier die Idee des vietnamesischen Staats als „serving the needs of the people“ in formellen politischen Praktiken (linke Seite) aktiviert, nämlich in den täglichen Interaktionen von Beamten, die Statistiken, Pläne und Berichte produzieren. Abbildung 1 zeigt auch, dass diese Praktiken keine materiellen Ergebnisse (Was-serversorgungsstation, Mitte des Schemas) er-zeugen. Was sie jedoch „tun“, ist die performa-tive Reproduktion der Idee einer Elite, die legi-timerweise im Interesse der Gesellschaft handelt.
Nicht formelle, sondern informelle Praktiken (rechte Seite) produzieren materielle „policy outcomes“ in Form der Wasserversorgungssta-tionen in der Mitte. Die Einparteienherrschaft als strukturell-emergentes Vermögen wird akti-viert, um das „Projekt“ der politischen Elite zu hegen: in informellen Praktiken wird das Inter-esse vorangetrieben, die Vormachtstellung und Kontrolle über politische und ökonomische Ressourcen beizubehalten. Seit dem ökonomi-schem Reformprozess der 1980er Jahre (doi moi) bietet politische Macht in Vietnam Zugang zu ergiebigen finanziellen Ressourcen. Diese wer-den im parallelen Dasein von Staatsvertretern als Unternehmer fruchtbar gemacht. Die politi-sche Elite verhinderte das Aufkommen einer parteiunabhängigen ökonomischen Elite, die das vorherrschende kulturelle System infrage stellen könnte, durch die Strategie des „Marktleninis-mus“ (London 2009). Informelle politische Praktiken sind also wesentlich für die Repro-duktion der strukturell bedingten Verteilung von materiellen Ressourcen in der Gesellschaft.
Die durch die ökonomische Liberalisierung wachsenden verfügbaren Ressourcen (im Sinne von Geld, aber auch anderen Ressourcen wie Wissen durch Bildung) erhöhten dabei zwar die Anzahl der Individuen, die Zugang zu diesen haben. Zentral für die Stabilität des gesamtge-sellschaftlichen Systems ist jedoch die Verein-nahmung dieser durch die Kommunistische Partei Vietnams (KPV). So ist zu erklären, dass die Anzahl an Staatsbediensteten zur Zeit der Abschaffung der Planwirtschaft stark angestie-gen ist (vgl. Gainsborough 2005, 374; Gainsbo-rough 2009; Benedikter 2009, 7). In den Worten
Archers haben sich die wirtschaftlich neu Em-porgekommenen der dominanten Gruppe von „corporate agents“, welche den Kontext für alle Akteure ausbildet, angeschlossen (Archer 1995, 260). Hierin liegt begründet, warum Wirtschafts-wachstum, entgegen weitverbreiteter Theorie6, bisher keine (wirkungsmächtigen) Demokratie-bewegungen hervorgebracht hat.
Wesentlich ist außerdem, dass die materiellen Ergebnisse der informellen Politikpraktiken auch an die kulturelle Sphäre (linke Seite) ge-koppelt sind, indem sie auch auf dieser Seite zur Reproduktion beitragen. Die Notwendigkeit eines bestimmten Niveaus an sichtbaren Ergeb-nissen des Politikprozesses für die Stabilität des Systems begründet sich in der Spezifizität des kulturellen Systems, das die KPV nicht mit willkürlicher Macht ausstattet.
Trotz anhaltender politischer Repressionen basierte die Einparteienherrschaft nie auf phy-sischer Gewaltausübung. Die Macht der KPV beruhte seit jeher auf ihrer Erscheinung als le-gitime Inhaberin der politischen Führung. Seit der Unabhängigkeit Vietnams im Jahr 1954 und über die Wiedervereinigung und Gründung der Sozialistischen Republik Vietnams im Jahr 1976 hinaus bestand die Hauptlegitimitätsquelle der KPV und ihrer autoritären Herrschaft in der Vereinigung des Volkes gegen externe Interven-tion und Unterdrückung. Die zunehmend kriti-sche wirtschaftliche Situation Mitte der 1980er Jahre, gefolgt vom Zusammenbruch der Sowje-tunion und der sozialistischen Parteien Osteuro-pas in den frühen 1990er Jahren, stellte die KPV vor ernsthafte Herausforderungen. Innerpartei-liche Kritiker konstatierten die marxistisch-le-ninistische Ideologie sei überholt und die nati-onale Einheit verloren (Thayer 2010, 428), und forderten das Ende des Sozialismus, Liberalisie-rung und Demokratisierung. Für die politische Elite war deutlich, dass das System Anpassungen erforderte, wenn die KPV dem Schicksal ande-rer sozialistischer Parteien entgehen wollte. Der Glaube an die marxistisch-leninistische Idee war zutiefst erschüttert und die KPV konnte ihre Legitimität nicht mehr alleine aus der Kraft zur Vereinigung gegen Außen schöpfen (Womack
Staat, Legitimität und Praktiken der Wasserversorgung im Mekong-Delta 9
2006, 75). Infolgedessen wurde die marxis-tisch-leninistische Ideologie zum großen Teil durch „Ho Chi Minh thought“ ersetzt. Dies symbolisierte den Übergang zu einer eigenen, vietnamesischen Interpretation des Sozialismus, welche die alten Sowjetischen und Chinesischen Paradigmen hinter sich ließ.
Der wesentliche Umbruch fand jedoch an anderer Stelle statt. Thayer (2009; 2010) be-schreibt den Wandel als einen von „regime le-gitimacy“ zu „performance legitimacy“, d. h. einer stärkeren Rolle von Wirtschaftswachstum, Armutsbekämpfung, der Wahrung politischer Stabilität und internationaler Anerkennung für politische Legitimität. Woodside (2006, 84) beobachtete einen Trend zur „Remandarinisie-rung“ seit den 1990ern – die Durchsetzung eines starken Glaubens an Wissenschaft und Techno-logie sowie die „manageability“ der Gesell-schaft: „Remandarinization’s function would be to simulate something like a higher moral au-thority of the democratic kind without all the risks of political democracy“ (ebd.). Dies stützt die hier aufgeworfene These vom Bild eines zweckrationalen, effektiven administrativen Systems, das für die Erfüllung der Bedürfnisse der Bevölkerung steht, als zentrale Quelle poli-tischer Legitimität für die KPV.
Zusammenfassend wurde gezeigt, dass der untersuchte Politikprozess konkret-materielle Ergebnisse zeitigt. Diese sind jedoch nicht ur-sächlich auf formelle, sondern auf informelle Strukturen zurückzuführen. Es wurde infolge-dessen argumentiert, dass die Hauptfunktiona-lität der formell-administrativen Struktur in der vietnamesischen Wasserbürokratie kultureller Art ist. Die Reproduktion eines kulturellen Sys-tems ist zentral für die Analyse von staatlichen Entscheidungsprozessen in der ländlichen Was-serversorgung. Dieses kulturelle System steht jedoch in einem notwendigen Zusammenhang mit der politisch-ökonomischen Struktur des vietnamesischen Staats, da es sowohl ihrer Auf-rechterhaltung dient als auch umgekehrt durch die Reproduktion politisch-ökonomischer Machtverhältnisse am Leben erhalten wird. Um Missverständnissen vorzubeugen muss hier
nochmals hervorgehoben werden, dass die Re-produktion dieser strukturellen Kräfte von ihrer Aktivierung in menschlichen Praktiken abhängt, d. h. kulturelle Systeme sind strukturelle Bedin-gungen und nicht Determinanten menschlichen Handelns. Das Soziale ist grundsätzlich offen (Archer 2005, 25). Tatsächlich existieren in Vietnam zivilgesellschaftliche Kräfte, welche die hegemoniale Idee in Frage stellen. Die Fra-ge ist, in welchem Maß dies das System desta-bilisiert. Derzeit besteht Grund zur Annahme, dass zivilgesellschaftliche Praktiken eher auf die Reproduktion des Systems hinwirken als auf einen demokratischen Wandel (Reis 2014).
Im Folgenden soll auf Basis des kritisch-re-alistischen Ansatzes und der vorgestellten Fall-studie eine Konzeptualisierung von politischer Kultur vorgenommen werden, die als Ausgangs-punkt für die Untersuchung von multiskalarer Politik dienen kann.
4 Zur Konzeptualisierung von politischer Kultur
Die Fallstudie der vietnamesischen Wasserbü-rokratie verdeutlicht, dass Kultur von zentraler Bedeutung für die Erklärung politischer Phäno-mene sowie für die Analyse von Staat und Staatlichkeit sein kann. Mit der Konzeptualisie-rung von Kultur als kulturelles System wird es möglich, Kultur auch abstrakt theoretisch zu fassen und für die Analyse brauchbar zu machen. Nach der Definition von Kultur als kulturelles System stellt sich nun die Frage, was unter po-litischer Kultur verstanden werden kann bzw. sollte. Hierbei ist zunächst klarzustellen, dass politische Kultur nicht als Objekt zu verstehen ist, in dem Sinne, dass es die politische Kultur eines Staats, einer Region o. ä. gäbe – und so wieder einem essentialistischen Kulturverständ-nis zu verfallen. Vielmehr soll hier betont wer-den, dass Untersuchungsobjekte wie „Staat“, „Politik“, und „Bürokratie“ und die damit ein-hergehenden Praktiken, anhand derer raumwirk-same Politikprozesse und Phänomene untersucht werden, eine kulturelle Dimension besitzen, die
10 Nadine Reis
mithilfe einer kritisch-realistischen Perspektive greifbar gemacht werden kann. Soll „politische Kultur“ als ein Gegenstandsbereich der geogra-phischen Forschung enger umrissen werden, so bieten sich zwei Anschlusspunkte an: Erstens bezüglich des substantiellen Inhalts politisch-kultureller Systeme und zweitens bezüglich ihres Zusammenhangs mit der politisch-ökono-mischen Dimension von Staatlichkeit.
Der erste Anschlusspunkt bezieht sich auf den substantiellen Inhalt eines politisch-kulturellen Systems. Unter Bezugnahme auf Almond (1956) versteht Pye unter politischer Kultur Einstellun-gen (attitudes) in Bezug auf Macht (1985, 18). Dieser Gegenstandsbereich erscheint zunächst auch im Kontext der vorgestellten Fallstudie sinnvoll. Wie Rohe (1990) hervorhebt, birgt der Begriff „Einstellungen“ jedoch die Fallstrecke einer Reduktion von politischer Kultur auf das durch quantitative Methoden empirisch beob-achtbare, wohingegen „politische Kultur auf einer grundsätzlicheren Ebene anzusiedeln ist als sie die auf Umfragedaten basierende Einstel-lungsforschung in der Regel verortet“ (1990, 334). Will man diesem Umstand Rechnung tragen, muss politische Kultur als menschliche Praxis konditionierendes Bedeutungssystem verstanden werden, in dem es um das Verhältnis des Individuums zu seiner sozialen Welt und Fragen von Autorität und Macht geht.
Welche Eigenschaften oder Elemente können politisch-kulturelle Systeme aufweisen? Wenn-gleich die dem klassischen Ansatz von Almond/Verba zugrundeliegende Methodik nicht ausrei-chend ist, um politisch-kulturelle Strukturen in einem kritisch-realistischen Sinn zu identifizie-ren, schlägt Almond (1989) eine Klassifikation vor, die dennoch mit der vorgestellten Ontologie vereinbar und hilfreich für die Identifikation von politisch-kulturellen Bedeutungssystemen ist. In Anlehnung an Almond (1989, 28) könnten sich Fragen nach politischer Kultur an den fol-genden Dimensionen orientieren:1. „Systemkultur“: Hierunter fallen allgemeine
Vorstellungen bzgl. der nationalen Gemein-schaft, des Regimes und der Autoritäten; die Bedeutung von nationaler Identität, Einstel-
lungen im Hinblick auf die Legitimität eines Regimes und seiner Institutionen, die Rollen-verteilung im Politikprozess. Das poli-tisch-kulturelle Bedeutungssystem des viet-namesischen Staats, das hier vorgestellt wurde, würde in diese Kategorie fallen. Die „Systemkultur“ bezieht sich auf das von Charles Taylor (2004) als „social imaginary“ beschriebene kulturelle System, welches je-doch meist eine unreflektierte Selbstver-ständlichkeit ist: „the ways people imagine their social existence, how they fit together with others, how things go on between them and their fellows, the expectations that are normally met, and the deeper normative no-tions and images that underlie these expecta-tions“ (ebd., 23).
2. „Prozesskultur“: hiermit sind Einstellungen bzgl. des Selbst und gegenüber anderen Ak-teuren im politischen Feld gemeint. Es könn-te hier z. B. um die eigene Rolle im politi-schen System gehen, aber auch um kulturel-le Ideen im Zusammenhang mit Korruption und Nepotismus, Vorstellungen von Politi-kern oder die Personalisierung von politischer Macht.
3. „Policykultur“: Dieser Aspekt betrifft kultu-relle Präferenzen bzgl. der Ergebnisse von Politik (policy output); hierunter fallen z. B. politische Werte wie Wohlfahrt, Sicherheit, Privatsphäre, Freiheit.
Die verschiedenen Dimensionen können als Orientierungshilfe angesehen werden; die ein-zelnen Elemente stehen im Zusammenhang miteinander, und es geht bei der Untersuchung u. a. darum, die Beziehungen der Elemente un-tereinander zu identifizieren. Von zentraler Bedeutung ist hierbei, dass kulturelle Systeme nicht logisch konsistent sein müssen. Ein poli-tisch-kulturelles System besteht (wie jedes kulturelle System) aus Ideen, Aussagen, Regeln und Normen, die in verschiedener Art und Wei-se miteinander in Beziehung stehen (Bukovans-ky 2002, 30). Einzelne Elemente können kom-plementär zueinander sein, jedoch auch im Widerspruch zueinander stehen. Beide Fälle
Staat, Legitimität und Praktiken der Wasserversorgung im Mekong-Delta 11
können für soziale Akteure prinzipiell Ein-schränkungen ihrer Handlungsmöglichkeiten darstellen oder ihnen Gelegenheit zu strate-gischem Handeln bieten (Archer 2005, 26ff.). Widersprüchlichkeiten und Komplementaritäten eines politisch-kulturellen Systems stellen für politische Akteure sowohl Möglichkeiten als auch Grenzen dar, und wirken sich somit auf deren Interaktionen oder Konflikte aus (Buko-vansky 2002, 31). Archer (1995, 230ff.) syste-matisiert die Konditionierung kultureller Syste-me durch die Identifikation von vier möglichen situativen Logiken, die aus solchen Komplemen-taritäten (complementarities) und Widersprüch-lichkeiten (contradictions) entstehen.7
Der zweite Anschlusspunkt für die Untersu-chung politisch-kultureller Systeme begründet sich in deren Zusammenhang mit den poli-tisch-ökonomischen Strukturen eines Staatsap-parats. Kulturelle Systeme besitzen eine auto-nome Existenz gegenüber politisch-ökonomi-schen Strukturen, d. h. sie haben ein „Eigenle-ben“ und sind nicht lediglich als epiphänomen-al zu diesen zu betrachten (vgl. Bukovansky 2002, 29ff.). Dennoch kann argumentiert wer-den, dass politische Kultur sich dadurch aus-zeichnet, dass sie durch ihre Effekte, wie auch durch ihre Stabilisierung oder De-Stabilisierung durch Prozesse, die in der politisch-ökonomi-schen Dimension von Gesellschaft ablaufen, in einem engen Zusammenhang mit diesen steht. Die vorgestellte Fallstudie verdeutlicht dies.
Ein kritisch-realistischer theoretischer Rah-men, der den wechselseitigen Einfluss von Kul-tur und Politischer Ökonomie zum Gegenstand des Forschungsinteresses macht, ist der Ansatz der kulturellen politischen Ökonomie (KPÖ) (Jessop/Oosterlynck 2008). KPÖ anerkennt die Bedeutung von Kultur für die Analyse politischer Ökonomien und befasst sich mit der Co-Evolu-tion von semiotischen und nicht-semiotischen Strukturen sowie deren Einfluss auf die Konsti-tution und Dynamik kapitalistischer Formationen (Jessop/Oosterlynck 2008, 1157; Jessop 2008, 236). Der Begriff „Co-Evaluation“ signalisiert dabei, dass kulturelle und politisch-ökonomische Strukturen zwar ontologisch zu unterscheiden
sind, gemeinsam jedoch historisch-spezifische Formationen bilden. Die KPÖ zielt insbesonde-re auf die Herausarbeitung der Co-Konstitution der kulturellen und politisch-ökonomischen Dimensionen kapitalistischer Gesellschaften. „It is the continuing interaction between the semi-otic and extra-semiotic in a complex co-evolu-tionary process of variation, selection, and re-tention that gives relatively successful econom-ic and political imaginaries their performative, constitutive force in the material world“ (Jessop/Oosterlynck 2008, 1157). Es geht bei der Unter-suchung von politischer Kultur also um die Identifikation von notwendigen Beziehungen zwischen politisch-kulturellen und politisch-öko-nomischen Strukturen.
Im folgenden Ausblick sollen einige Ansatz-punkte für ein Forschungsprogramm skizziert werden, in denen das erarbeitete Konzept von politischer Kultur zum Tragen kommt.
5 Ausblick: Zur Relevanz von politischer Kultur in der geographischen Forschung
Politische Kultur ist nicht nur von zentraler Bedeutung für die Analyse von Politik innerhalb von Nationalstaaten. Wie Cochrane und Ward (2012, 5) hervorheben, kann die Analyse von Politik nicht mehr alleine auf den nationalstaat-lichen Rahmen beschränkt bleiben. Im Fokus geographischer Arbeiten steht derzeit vor allem die Analyse von Formen von „policy mobilities“, „travelling ideas“ und „multiskalarer“ Politik (vgl. z. B. Weisser et al. 2014; Barrett 2013; McCann/Ward 2012; Swyngedouw et al. 2002). Politische Prozesse, die bestimmte „Ergebnisse“ produzieren, spielen sich meist auf mehreren Ebenen ab, insbesondere in Bezug auf die go-vernance von Umweltveränderungen (Cash et al. 2006). Die Akteure auf verschiedenen räum-lichen, juridischen, anderweitig institutionellen Ebenen („scales“) (ebd.) unterliegen dabei verschiedenen Legitimationsanforderungen. Besonders relevant sind diese verschiedenen Legitimationsanforderungen bei der Überset-zung von globalen politischen Ideen in den na-
12 Nadine Reis
tionalstaatlichen Kontext (vgl. Meyer 2014). Politische Kultur fungiert hierbei als „Filter“ für die Übersetzung von globalen Politikideen in den nationalen politischen Rahmen und deren „Umsetzung“ in reale Ergebnisse. Ideen oder Politikmodelle erzeugen so verschiedene Ergeb-nisse, je nachdem, wie sie in das lokal vorherr-schende politisch-kulturelle System „einge-passt“ werden können. An anderer Stelle habe ich z. B. dargelegt, wie die im Okzident behei-matete Idee von „Zivilgesellschaft“ in das poli-tisch-kulturelle System Vietnams übersetzt wurde (Reis 2014a). Die westliche Idee von „Zivilgesellschaft“ als Gegenpol zu „Staat“ besitzt nur sehr eingeschränkte Komplementa-ritäten mit dem politisch-kulturellen System des vietnamesischen Staates, und stellt auch eine Gefahr für dasselbe dar, weshalb die Idee nur begrenzt anschlussfähig ist. Im Gegensatz dazu ist die Idee von „Management“ für Entwicklung höchst anschlussfähig an die vietnamesische Staatsidee, wo, wie oben gezeigt wurde, büro-kratisch-administrative Prozesse eine zentrale Rolle für die Legitimation staatlicher Macht spielen. Der internationale Status von Vietnam als „donor darling“ ist somit kein Zufall, son-dern geht auf die (zufällige) Komplementarität der gegenwärtigen Managementmodelle von Entwicklungsorganisationen mit der politischen Kultur Vietnams zurück (Reis 2014b).
Nicht nur in Bezug auf Systemkultur, sondern auch auf Prozesskultur ergeben sich hier neue Perspektiven. So hat Jasanoff (1986) gezeigt, wie in verschiedenen (westlichen) Kulturen verschiedene Kulturen des Risikomanagements vorherrschen. Gerade in der geographischen Entwicklungsforschung wäre es gewinnbrin-gend, den Einfluss der spezifischen poli-tisch-kulturellen Systeme auf den Umgang von nicht-westlichen Gesellschaften mit Umweltri-siken zu untersuchen, sowie den Einfluss von globalen Leitideen – die etwa von internationa-len Experten eingebracht werden – auf die Ver-änderung dieser Strategien. Politische Kultur ist demnach ein „Filter“ dafür, wie Prozesse auf globaler und nationalstaatlicher Ebene mitein-ander interagieren. Globale und lokale Prozesse
beeinflussen sich dabei jedoch gegenseitig. Nationalstaaten müssen sich zu einem gewissen Grad auch nach außen hin legitimieren, und interne Legitimationsmechanismen wirken so auf globale politische Kultur zurück, d. h. auf das was international „geht“ oder „nicht geht“ (vgl. Bukovansky 2002).
Besonders interessante Forschungsperspekti-ven ergeben sich in diesem Kontext auch aus Fragen nach dem Zusammenhang zwischen politisch-kulturellen und politisch-ökonomi-schen Prozessen, wie sie die Kulturelle Politische Ökonomie aufwirft. Aus geographischer Pers-pektive erscheint vor allem die Frage relevant, wie sich politische Kulturen, d. h. Legitimations-weisen von Staatlichkeit, aber auch Verlust von und Kampf um Legitimation, mit dem „resca-ling“ (Swyngedouw 2000) von Kapital-Ar-beit-Verhältnissen, Regulationsweisen, und der Verteilung öffentlicher Ressourcen verändern. Ziel wäre demnach nicht nur die Erforschung der Globalisierung von politischer Kultur, sondern auch deren „Glokalisierung“ (ebd.).
Die vorgestellte Konzeption von politischer Kultur bietet sich somit als Ansatzpunkt bzw. Analysekategorie für eine Reihe an aktuellen Fragestellungen der geographischen Forschung an. Der Kritische Realismus bietet eine wissen-schaftstheoretische Herangehensweise, welche die Schwächen von rein konstruktivistischen Perspektiven überwindet (vgl. Sayer 1993), dabei aber die Bedeutung von Kultur für gesell-schaftlichen Wandel noch stets ernst nimmt. Ein derartiger Ansatz ist vor allem für die Geogra-phie mit ihrem Vermögen, auf intensiver empi-rischer Forschung basierendes, kontextspezifi-sches Wissen über Mensch-Umwelt Verhältnis-se bereitzustellen, von Nutzen.
Literatur
Abrams, P. (1988/1977): Notes on the Difficulty of Studying the State. In: Journal of Historical Sociology 1(1), 58-89.
Almond, G. A. (1956): Comparative Political Sys-tems. In: The Journal of Politics 18(3), 391-409.
Staat, Legitimität und Praktiken der Wasserversorgung im Mekong-Delta 13
Almond, G. A. (1989): The intellectual history of the Civic Culture concept. In: Almond, G. A. (Hrsg.): The Civic Culture revisited. London: Sage, 1-36.
Almond, G. A. und Verba, S. (1963): The Civic Cul-ture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press.
Archer, M. (1995): Realist Social Theory: The Mor-phogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Archer, M. (2005): Structure, Culture and Agency. In: Jacobs, M. D. und Weiss Hanrahan, N. (Hrsg.): The Blackwell Companion to the Sociology of Culture. Oxford: Blackwell, 17-34.
Barrett, S. (2013): The necessity of a multiscalar analysis of climate justice. In: Progress in Human Geography 37(2), 215-233.
Benedikter, S. (2009): Capturing Bureaucratic Evo-lution in Contemporary Vietnam: Case Studies from the Mekong Delta. Paper prepared for the ZEF Master Class in framework of WISDOM, September 14-15, 2009, Bonn (www.wisdom.caf.dlr.de/). Unpublished.
Bhaskar, R. und Lawson, T. (1998): Transcendental Realism and Science. Introduction: Basic Texts and Developments. In: Archer, M. et al. (Hrsg.): Critical Realism. Essential Readings. New York: Routledge, 3-15.
Blaikie, N. (2010): Designing Social Research. Malden: Polity.
Boeckler, M. (2005): Geographien kultureller Praxis. Syrische Unternehmer und die globale Moderne. Bielefeld: transcript.
Bueno de Mesquita, B. und Downs, G. W. (2005): Development and Democracy. In: Foreign Affairs 84(5), 77-86.
Bukovansky, M. (2002): Legitimacy and Power Politics: The American and French Revolutions in International Political Culture. Princeton: Princeton University Press.
Bygstad, B. und Munkvold, B. E. (2011): In search of mechanisms. Conducting a critical realist data analysis. Completed Research Paper. Thirty Second International Conference on Information Systems, December 4-7, 2011, Shanghai. http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1073&context=icis2011 (Januar 2015).
Cash, D. W. et al. (2006): Scale and Cross-Scale Dynamics: Governance and Information in a Multilevel World. In: Ecology and Society 11(2).
Cochrane, A. und Ward, K. (2012): Researching the geographies of policy mobilities: confronting the
methodological challenges. In: Environment and Planning A 44, 5-12.
Cosgrove, D. und Jackson, P. (2004): New directions in cultural geography. In: Thrift, N. und What-more, S. (Hrsg.): Cultural Geography: Critical Concepts in the Social Sciences. London: Rou-tledge, 33-41.
Cox, K. R. (2013): Notes on a brief encounter: Crit-ical realism, historical materialism and human geography. In: Dialogues in Human Geography 3(1), 3-21.
Duong, M. N. (2004): Grassroots democracy in Vietnamese communes. Australian National University, Centre for Democratic Institu-tions. Research Paper. www.cdi.anu.edu.au/CDIwebsite_1998-2004/vietnam/veitnam_ downloads/Doung_Grassrootsdemocracypaper.pdf (1.7.2010).
Englebert, P. (2000): State legitimacy and develop-ment in Africa. Boulder: Lynne Rienner.
Gainsborough, M. (2005): Between Exception and Rule: Ho Chi Minh City’s Political Economy under Reform. In: Critical Asian Studies 37(3), 363-390.
Gainsborough, M. (2009): Privatisation as State Ad-vance: Private Indirect Government in Vietnam. In: New Political Economy 14(2), 257-274.
Gillespie, J. (2005): Changing Concepts of Socialist Law in Vietnam. In: Gillespie, J. und Nicholson, P. (Hrsg.): The Diversity of Legal Change in So-cialist China and Vietnam. Canberra: Asia Pacific Press, 45-75.
Hannah, J. (2005): Civil-Society Actors and Action in Vietnam: Preliminary Empirical Results and Sketches from an Evolving Debate. In: Heinrich-Böll-Foundation (Hrsg.): Towards good society. Civil Society Actors, the State and the Business Class in Southeast Asia. Facilitators of or Impedi-ments to a Strong, Democratic, and Fair Society? Documentation of a workshop of the Heinrich Böll Foundation, October 26-27, 2004, Berlin. Berlin: Heinrich-Böll-Foundation, 101-110. www.giga-hamburg.de/dl/download.php?d=/content/staff/wischermann/publications/final_ towards_good_society.pdf (1.8.2009).
Jasanoff, S. (1986): Risk Management and Political Culture. Social Research perspectives. Occasion-al reports on current topics 12. New York: Russel Sage Foundation.
Jessop, B. (2008): State power: A Strategic-Relation-al Approach. Cambridge: Polity.
14 Nadine Reis
Jessop, B. und Oosterlynck, S. (2008): Cultural political economy: on making the cultural turn without falling into soft economic sociology. In: Geoforum 39, 1155-1169.
London, J. (2009) Vietnam and the Making of Market-Leninism. In: The Pacific Review 22(3), 375-399.
Marx, K. und Engels, F. (1965): Theorien über den Mehrwert. MEW Band 26, 1. Teil. Berlin: Dietz Verlag.
Massey, D. und Meegan, R. (1985): Politics and Method: Contrasting Studies in Industrial Geog-raphy. London: Methuen & Co.
McCann, E. und Ward, K. (2012): Assembling ur-banism: following policies and ‘studying through’ the sites and situations of policy making. In: Environment and Planning A 44, 42-51.
Meyer, R. E. (2014): ‘Re-localization’ as Micro-mo-bilization of Consent and Legitimacy. In: Drori, G. S. et al. (Hrsg.): Global Themes and Local Variations in Organization and Management. New York: Routledge, 79-89.
Painter, M. (2003): Public Administration Reform in Vietnam: Problems and Prospects. In: Public Administration and Development 23(3), 259-271.
Peet, R. (2002): There is such a thing as Culture. In: Antipode 34(2), 330-333.
Pratt, A. C. (2013): ’…The point is to change it’: Crit-ical realism and human geography. In: Dialogues in Human Geography 3(1), 26-29.
Pye, L. W. (1985): Asian power and politics. The cultural dimensions of authority. Cambridge: Belknap Harvard.
Reis, N. (2012): Tracing and making the state. Policy practices and domestic water supply in the Me-kong Delta, Vietnam. Berlin: LIT Verlag.
Reis, N. (2014a): Civil society and political culture in Vietnam. In: Waibel, G. et al. (Hrsg.): South-east Asia and the Civil Society Gaze. Scoping a contested concept in Vietnam and Cambodia. New York: Routledge, 77-92.
Reis, N. (2014b): Good Governance and Cultures of Rationalization in International Aid: The Case of Vietnam’s Water Supply and Sanitation Sector. Paper presented at the 14th EADI Conference, June 23-26, 2014, Bonn.
Rohe, K. (1990): Politische Kultur und ihre Analyse: Probleme und Perspektiven der politischen Kul-turforschung. In: Historische Zeitschrift 250(2), 321-346.
Sayer, A. (1992): Method in Social Science. A
realist approach. Revised 2nd Edition. London: Routledge.
Sayer, A. (1993): Postmodernist thought in geogra-phy: A realist view. In: Antipode 25(4), 320-344.
Schiffer, E. und Waale, D. (2008): Tracing Power and Influence in Networks: Net-Map as a Tool for Research and Strategic Network Planning. Project “Integrating Governance and Modelling”. IFPRI Discussion Paper 00772. http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp00772.pdf (April 2015).
Swyngedouw, E. (2000): Authoritarian governance, power, and the politics of rescaling. In: Envi-ronment and Planning D. Society and Space 18, 63-76.
Swyngedouw, E., Page, B. und Kaika, M. (2002): Sus-tainability and Policy Innovation in a Multi-Level Context: Crosscutting Issues in the Water Sector. In: Heinelt, H. et al. (Hrsg.): Participatory Gov-ernance in Multi-Level Context. Concepts and Experience. Wiesbaden: Springer, 107-131.
Taylor, C. (2004): Modern social imaginaries. Dur-ham: Duke.
Thayer, C. A. (2009): Political Legitimacy of Viet-nam’s One Party-State: Challenges and Respons-es. In: Journal of Current Southeast Asian Affairs 28(4), 47-70.
Thayer, C. A. (2010): Political Legitimacy in Vi-etnam: Challenge and Response. In: Politics & Policy 38(3), 423-444.
Van Heur, B. (2010): Beyond Regulation: Towards a Cultural Political Economy of Complexity and Emergence. In: New Political Economy 15(3), 421-444.
Vasavakul, T. (2006): Public Administration Reform and Practices of Co-Governance: Towards a Change in Governance and Governance Cul-tures in Vietnam. In: Heinrich Böll Foundation (Hrsg.): Active Citizens under Political Wraps. Experiences from Myanmar/Burma and Viet-nam. Chiang Mai: Heinrich Böll Foundation, 143-165. http://www.boell.de/sites/default/files/uploads/2008/11/hbs_myanmar_vietnam2006.pdf (April 2015).
Weisser, F. et al. (2014): Translating the ‘adaptation to climate change’ paradigm: the politics of a travelling idea in Africa. In: The Geographical Journal 180(2), 111-119.
Womack, B. (2006): China and Vietnam – the politics of asymmetry. New York: Cambridge University Press.
Staat, Legitimität und Praktiken der Wasserversorgung im Mekong-Delta 15
Woodside, A. (2006): Lost modernities. China, Viet-nam, Korea, and the hazards of world history. Cambridge: Harvard University Press.
Yeung, H. W. (1997): Critical realism and realist research in human geography: a method or a philosophy in search of a method? In: Progress in Human Geography 21(1), 51-74.
Autorin: Dr. Nadine Reis, Universität Bonn, Geographi-sches Institut, Meckenheimer Allee 166, 53115 Bonn, E-Mail: [email protected]
Endnoten
1 Epiphenomenal = ein in der Kausalität sekundäres Phänomen ohne eigene kausale Wirkkraft. So sind nach Marx die Bewusstseinsformen und das Staatssystem einer Gesellschaft von ihrer realen Basis, d. h. der ökonomischen Struktur, bestimmt (vgl. z. B. Marx/Engels 1965, 257).
2 Vgl. z. B. Cosgrove/Jackson 2004, 33f. Kultur ist hiernach nicht die bloße „Oberfläche” einer ökonomischen Basis, sondern „the very medium through which social change is experienced, contested and constituted“.
3 Das Emergenzkonzept war bereits in der antiken Philosophie vorhanden und wird in verschiedenen Systemtheorien der Natur- und Sozialwissenschaften theoretisiert. Zum Emergenzkonzept im kritischen Realismus vgl. van Heur 2010, 424f.
4 Archer selbst verwendet, wie in Abb. 1, die Be zeichnungen „Cultural Emergent Property“ und „Structural Emergent Property“, um auf die analytischen Unterschiede zwischen politisch-ökonomischen und kulturellen Strukturen zu verweisen. M. E. sind diese Begrifflichkeiten ungünstig gewählt, da Kulturen ebenfalls als Strukturen zu verstehen sind, wie sie selbst ausführlich dargelegt hat. Im weiteren Verlauf wird hier daher von „politisch-ökonomischen“ und „kulturellen“ Strukturen gesprochen.
5 Aus dem Altgriechischen morpho = Gestalt, Form; genesis = Geburt, Entstehung, Ursprung; stasis = stehen, fest-stehen; d. h. Morphostase = Zustand, in dem strukturelle Bedingungen fortwährend reproduziert werden; Morpho-genese = Weiterentwicklung, Veränderung struktureller Bedingungen, also z. B. Veränderung von Wertsystemen.
6 Für eine Diskussion des Zusammenhangs von Wirtschaftswachstum und Demokratisierung, siehe Bueno de Mesquita und Downs 2005.
7 Diese sind: constraining contradictions (necessary incompatibilities), concomitant complementarities (necessary complementarities), competetive contradictions (contingent incompatibilities), und contingent complementarities.