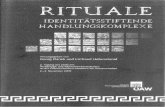'Tag that Wall'. Augmented-Reality-Apps am Beispiel der Street Art zwischen Skripten und Praktiken...
Transcript of 'Tag that Wall'. Augmented-Reality-Apps am Beispiel der Street Art zwischen Skripten und Praktiken...
1 1 1
THEMENHEFT: APP-KULTUR
ULRICH SCHMITZ Apps - Barockes Zeichenspiel für technisierte Alltagskommunikation
ISABELL OTIO/MATHIAS DENECKE WhatsApp und das prozessuale Interface. Zur Neugestaltung von Smartphone-Kol lektiven
KATJA GLASER/JENS SCHRÖTER ,Tag that wall '. Augmented Reality-Apps am Beispiel der Street Art zwischen Skripten und Praktiken
PABLO ABEND Apps als Kunst? Zum Verhältnis von Medienkunst und Technologie
MATHIAS FUCHS/NIKLAS SCHRAPE Bewegte Spiele. Zur Verschiebung des Verhältnisses von Spiel und Alltagswelt durch mobile Games
Supplement:
PETER KRAPP Alles so schön mobil . Apps zwischen Werbung und Mobilisierung
111-2013
Herausgeber
Dr. Erika Linz Prof. Dr. Natal ie Binczek Ruhr-Universität Bochum Germanistisches Institut Universitätsstr. 150 44801 Bochum [email protected]
Prof Dr. Ludwig Jäger Internationales Kolleg Morphomata Universität zu Köln Weyertal 59
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn Institut IX, Abt. für Interkulturelle Kommunikation und Mehrsprachigkeitsforschung
50937 Köln [email protected]
Wissenschaftlicher Beirat
G. Brandstetter - P. Gendolla - J. Gessinger H. J. Heringer - R. Hüser -1. von der Lühe G . Stötzel - R. Wimmer - U. Wirth G . Wunberg
Inhalt
Themenheft: App-Kultur
Ul rich Schmitz
Lennestraße 6/ 5 31 1 3 Bonn [email protected]
Redaktion
Dr. Stephanie Heimgartner Ruhr-Universität Bochum / Germanistisches Institut Universitätsstr. 150 / 44801 Bochum stephanie. [email protected]
Apps - Barockes Zeichenspiel für technisierte Al ltagskommunikation
lsabell Otto/Mathias Denecke WhatsApp und das prozessuale Interface. Zur Neugestaltung von Smartphone-Kollektiven
Katja Glaser/Jens Schröter ,Tag tha t wall'. Augmented Reality-Apps am Beispiel der Street Art zwischen Skripten und Praktiken .
Pablo Abend Apps a ls Kunst? Zum Verhältnis von Medienkunst und Technologie . . ..... .
Mathias Fuchs/Niklas Schrape Bewegte Spiele. Zur Verschiebung des Verhältn isses von Spiel und Alltagswelt durch mobile Games.
Supplement: Peter Krapp Alles so schön mobil. Apps zwischen Werbung und Mobi lisierung ... . . . . .. , . .
Einsendung von Manuskripten Für unverlangt eingesandte Manuskripte w ird keine Gewähr übernommen. Nachdrucke innerhalb der gesetzlichen Frist nur mit ausdrückl icher Genehmigung der Verlage.
3
14
30
49
69
84
Mit der Annahme Ihres Manuskripts zur Veröffentlichung in der Zeitschrift „Sprache und Literatur" räumen Sie dem Wilhelm Fink
Verlag für die Dauer von 12 Monaten nach Erscheinen das ausschließliche Verlagsrecht an Ihrem Originalbeitrag örtlich und
zeitlich unbeschränkt ein, ebenso im gleichen Umfang das Recht zur unkörperlichen Übermittlung und Wiedergabe, und zwar für a lle Druck- und Datenträgerausgaben sowie zur Online-Nutzung in und aus Speichermedien, insbesondere Datenbanken .
Das schließt zugehörige Bildvorlagen, Pläne, Karten, Skizzen und Tabellen mit ein. Weiterhin kann der Verlag Ihren Aufsatz für Nachdrucke, Abstracts und als Sonderdruck oder im Rahmen von Sammelwerken nutzen. Die Nutzung erfolgt unentgeltlich.
Sind 12 Monate seit dem Erscheinen Ihres Beitrags vergangen, verbleiben im Anschluss die eingeräumten Rechte dem Verlag
als einfache Rechte . Soweit Sie dann selbst Rechte an Dritte vergeben, bitten wir um einen genauen Quellennachweis.
Erscheinungsweise Zweimal jährlich Uuni & Dezember)
Verantwortlich für Anzeigen Ute Schnückel ([email protected])
Satz Ruhrstadt Medien AG
ISSN 0724-971 3
Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags KG · Jühenplatz 1-3 · 33098 Paderborn
Editorial: App-Kultur
Was bis in die Mitte der 2000er Jahre hinein noch als Zukunftsszenarium galt, ist in kürzester Zeit zu einem festen Bestandteil der Alltagskultur geworden. Mit der Verbreitung von Smartphones und Tablets als Standardmedien hat sich in nur wenigen Jahren eine Kultur von mobilen webbasierten Anwendungen etabliert, die inzwischen auf ein breit zugängliches Angebot von mehr als zwei Millionen unterschiedlichen, häufig sogar kostenlos zur Verfügung gestellten App-Programmen zurückgreifen kann. Weltweit stieg die Anzahl der Downloads in nur einem Jahr von 64 Milliarden in 2012 um 60% auf über hundert Milliarden heruntergeladene Apps bis Ende 2013 (laut statista.de). Trotz dieser rasanten ubiquitären Verbreitung fehlt es bislang an einer breiteren wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den kulturellen und medientheoretischen Konsequenzen dieser Revolution.
Spätestens seit der Durchsetzung der Smartphone-Technologie fungiert das Mobiltelefon nicht mehr nur als Erweiterung des Festnetzes, sondern dient zunehmend als Technologieträger für alle übrigen Medien. Neben den daraus entstehenden neuen Distributions- und Vernetzungsformen ändern sich auch die Formate und Produktionsformen digitaler Medienangebote. Bezogen auf die mediale Infrastruktur bedeutet die Entwicklung eine zunehmende Ablösung der offenen Webnutzung hin zu mehr oder weniger geschlossenen, unternehmerisch kontrollierten Plattformen, in denen das Internet nur noch als Übertragungs- und Distributionsmedium fungiert, wie Chris Anderson bereits 2010 hervorgehoben hat: ,Genutzt wird das Netz, aber nicht mehr das Web.' 1 (vgl. die Beiträge von Abend und Krapp) . Bezogen auf die medialen Artefakte treten neben neue Formen der Remediation traditioneller medialer Formate (vgl. den Beitrag von Schmitz) zunehmend mobile Anwendungen, die im Sinne von „Augmented Reality"-Konzepten die gängige Trennung zwischen „virtual space" und sog. „real space" aufheben und damit Wahrnehmung und Aneignung der physischen Umgebung grundlegend verändern. Lokative Anwendungen und mobile Social-Web-Dienste schaffen eine kontinuierliche ortsunabhängige Einbindung in das Netz privater Sozialbeziehungen (vgl. den Beitrag von Otto/ Denecke), ermöglichen die Historisierung ortsbezogener Präsenzerfahrungen, erlauben die lokale Situierung und Rezeption kultureller Artefakte (vgl. den Beitrag von Glaser/ Schröter) oder verwandeln die physische Umgebung in die Szenerie einer virtuellen Spielwelt (vgl. den Beitrag von Fuchs/Schrape).
Das Themen-Heft will dazu beitragen, die wissenschaftliche Diskussion um die Folgen der entstehenden App-Kultur aus medien-, literatur- und sprachwissenschaftlicher Perspektive anzustoßen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach den Transformationen kultureller Praktiken sowohl durch die Etablierung und den Gebrauch App-spezifischer Medienformate als auch durch die damit einhergehenden Distributions- und Vemetzungsformen. Welche Restriktionen und Standardisierungen erwachsen aus den weitreichenden monopolistischen Kontrollmechanismen der Apple- und Android-Anbieterplattformen (vgl. Abend und Krapp)? Wie verändern sich sprachlich-kommunikative und semiotische Verfahren (vgl. Schmitz), diskursive (vgl. Otto/Denecke), alltagskulturelle (Fuchs/Schrape) und künstlerische Praktiken (vgl. Abend und Glaser/Schröter) und wie werden dabei
Vgl. den Beitrag von Chris Anderson (2010): „The Web ls Dead. Long Live the Internet" unter: http:// www.wired.com/magazine/2010/08/ff _ webrip/ (05 .07.2013 ).
Katja Glaser/Jens Schröter
,Tag that wall': Augmented Reality-Apps am Beispiel der Street Art zwischen Skripten und Praktiken
„Augmented Reality (AR) is a technology which allows computer generated virtual imagery to exactly overlay physical objects in real time." 1 Oder: „This paper surveys the field of Augmented Reality, in which 3-D virtual objects are integrated into a 3-D real environment in real time. "2 Diese Definitionen zeigen an, was der Kern der sogenannten ,Augmented Reality' (=AR) ist. Durch geeignete Displays wird grafische (2D oder 3D), textuelle oder akustische Information in Echtzeit dem Bild der realen Umgebung überlagert.
Apps schließen in gewisser Weise an die Tradition der Augmented Reality an. Spezifische Augmented Reality-Apps integrieren die Technologie sogar explizit in ihre Software, wobei das portable Smartphone-Device dieser Technologie noch eine zusätzliche Dimension verleiht: Mobilität sowie den Zugriff auf standortbezogene, navigatorische Dienste (also Location-based Services, LBS).
In diesem Artikel wird das Phänomen der Augmented Reality-Apps am Beispiel der Street Art diskutiert, einem noch recht neuen Einsatzgebiet dieser Smartphone-Technologie. Da die ,Street Art' 3
, wie ihr Name schon sagt, per definitionem auf spezifische Orte und Situationen bezogen ist, bietet sie sich besonders für die orts- und situationsbezogene Medienpraxis der Augmented Reality an. Street Art-Augmented Reality-Apps können also verstanden werden als mediale Form, in der sich zwei verschiedene Genealogien überschneiden: Eine technische Interface-Entwicklung und eine spezifische medienästhetische Tradition. Diese Überschneidung und Verbindung verändert beide, es kommt zu einer Ko-Konstruktion von Technologien und Nutzungsweisen.4 Weder determiniert allein die neue Technologie eine Veränderung der künstlerischen Praxis, vielmehr wird sie selbst verändert - noch bleibt die medienästhetische Praxis dieselbe. Dieser Ko-Konstruktion und der Frage, ob sie wirklich symmetrisch ist, soll an ausgewählten Beispielen nachgegangen werden.
Dazu wird in Abschnitt 1) die Augmented Reality historisch von der ,Virtual Reality' (= VR) abgegrenzt. Es soll deutlich werden, woher diese Verfahren kommen und welche ,Skripte' 5 in sie eingegangen sind, also zu welchem Zweck sie entwickelt wurden. Unter 2) wird nach einem kurzen Abriss der Geschichte der Street Art die Verwendung von Augmented Reality-Apps auf Smartphones in Bezug auf die Street Art anhand zwei verschiedener Nutzungsweisen diskutiert. In Abschnitt 3) folgt ein knappes Fazit.
http:/ /ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/2345/J II 2613246 _ 2008-Trend-inA ugmentedReal ityTracking lnteractionandDisplayAReviewoffen YearsofISMAR.pdf, (Stand: 13.9.2013).
2 Azuma (1997), S. 355 . Vgl. dazu u.a. Klitzke/Schmidt (Hg.) (2009) und Reinecke (2007). Vgl. Oudshoorn/Pinch (2005). Im Sinne von Akrich (2006).
, Tag that wall': Augmented Reality-Apps 31
1. Augmented Reality und Virtual Reality
Am besten ist die Augmented Reality6 zu konturieren, indem der Unterschied zur Virtual Reality herausgestellt wird.7 Der Grundgedanke der unter dem Titel „Virtual Reality" versammelten Techniken und Praktiken war, eine immersive, ggf. durch entsprechende Display- und Interaktionstechniken den Benutzer mehr oder weniger umschließende, simulierte Umgebung zu schaffen, in der der Benutzer nichts mehr von der ihn eigentlich umgebenden Außenwelt wahrnimmt.8 Demgegenüber ist die Idee der Augmented Reality, Elemente simulierter mit Elementen realer Umgebung zu verbinden. Dadurch soll die Realitätswahrnehmung ,verbessert' (augmented) werden, z.B. indem bestimmte Arten von bildlicher, schriftlicher oder akustischer Information dem Bild des Realraums überlagert werden - eine Überlagerung, die sich idealiter an die sich je verändernde Wahl des Wahrnehmungsausschnitts anpasst.
Einer der Namen, die immer wieder genannt werden, wenn es um die Geschichte von Virtual Reality geht, ist Ivan Sutherland.9 Das liegt erstens daran, dass er 1966 seinen Aufsatz „The Ultimate Display" veröffentlichte, in dem er eine ultimative Visualisierungstechnologie visionierte, deren Bilder ununterscheidbar von der Realität sein sollten - man sieht mithin, woher die Szenarien z. B. von „The Matrix" kommen. 10 Aber Sutherland war nicht nur der erste , Visionär' der Virtual Reality. Zweitens und wichtiger hat er wirkliche technische Entwicklungen zur Genealogie von Augmented Reality wie Virtual Reality beigesteuert - insbesondere das am Anfang der 1990er Jahre als ,Datenbrille' geradezu zur Ikone der Virtual Reality aufgestiegene „Head Mounted Display"(= HMD). Abb. 1 zeigt ein typisches Bild der Zeit.
Abb. 1: ,Datenbrille' als typische Darstellung von Virtual Reality, um 1994
6 Vgl. zu einigen der informatischen Hintergründe: Bimber, Raskar (2005) und Haller et al. (Hg.) (2007). Die kultur- und medienwissenschaftliche Debatte zu Augmented Reality ist klein, vgl. Fahle (2006). Fahle bezieht sich wesentlich auf ein spezielles Augmented Reality-Projekt an der Bauhaus Universität Weimar und dessen bildtheoretische Implikationen. Vgl. auch Manovich (2006). Manovich wiederum behandelt Augmented Reality nur als Untermenge seiner Beschäftigung mit dem ,augmented space' und erwähnt die hier diskutierte Nutzung von Smartphones eher am Rande (Fahle erwähnt sie gar nicht).
7 Vgl. Milgram et al. (1994), zur Einordnung von Augmented Reality und Virtual Reality auf einem Konti-nuum verschiedener ,Mixed Realities'.
• Vgl. zum folgenden detaillierter Schröter (2004), S. 152-276. ' Vgl. Schröter (2007).
10 Vgl. Sutherland (2007).
32 Katja Glaser/Jens Schröter
Das erste HMD entwickelten Sutherland und seine Mitarbeiter bis 1968. Ihre Arbeit wurde 1969 in einem Aufsatz mit dem Titel „A Head-Mounted Three Dimensional Display" publiziert. Die ersten Abschnitte umreißen die Grundidee:
„The fundamental idea behind the three-dimensional display is to present the user with a perspective image which changes as he moves. [ ... ] The image presented by the three-dimensional display must change in exactly the way that the image of a real object would change for similar motions of the user's head . [ ... ] Our objective in this project has been to surround the user with displayed three-dimensional information." 11
Zunächst klingt das alles nach Virtual Reality: Der Benutzer wird von Information , umgeben'; und die ständige Neuberechnung des Bildes, abhängig von der Bewegung des Nutzers, führt dazu, dass sich die virtuelle Umgebung für die Wahrnehmung auf dieselbe Weise verändert wie es beim Anblick realer Objekte der Fall wäre (natürlich ging es zu der Zeit dieses Artikels um einfache Wireframe-Grafiken) . Doch was bei der Einordnung dieses ersten Textes in die Genealogie der Virtual Reality manchmal übersehen wird, ist, dass Sutherlands HMD halbdurchlässig war und so die Überlagerung der Computer-Bilder mit den Bildern des Realraums erlaubte:
„Half-silvered mirrors in the prisms through which the user looks allow him to see both the images from the cathode ray tubes and objects in the room simultaneously. Thus displayed material can be made either to bang disembodied in space or to coincide with maps, desk tops, walls, or the keys of a typewriter." 12
D. h. , Sutherland hatte bei der Entwicklung des HMD gar nicht das Ziel, einen (den Betrachter abschottenden) immersiven Raum zu schaffen. Das HMD war als ein Interface konzipiert, welches die sinnfällige und komplexitätsreduzierte Präsentation von Information ermöglichen sollte (z. B. für die wissenschaftliche Visualisierung oder für militärische Zwecke - siehe die „maps", die Sutherland nennt). HMDs sollten also eher zur Effizienzsteigerung dienen. 13 In diesem Sinne ist Sutherlands Konzept gerade kein Vorläufer der illusionistisch-eskapistisch gedachten Virtual Reality der frühen neunziger Jahre. Für diese waren etwa die Einlassungen von Jaron Lanier besonders typisch. 14 Dass die schon bei Sutherland angelegte Möglichkeit der Augmented Reality, also einer Überlagerung des virtuellen mit dem realen Raum, heute viel wichtiger ist, verwundert nicht. Während die Virtual Reality (zumindest in ihrer phantasmatischen Form) die Flucht aus dieser Welt erlauben soll, dient die Augmented Reality dazu, sie mit Informationen anzureichern. Das Skript der Augmented Reality ist eben, die Realitätswahrnehmung zu , verbessern' - d. h., zu fanktionalisieren und zu optimieren. So gesehen steht Augmented Reality in der Tradition der von Foucault thematisierten Disziplinartechnologien. 15 Daher ist sie für den globalen Kapitalismus heute viel wichtiger - und ihre Durchsetzung letztlich ein Zeichen dafür, dass neue Medien in der Regel nicht die Welt fundamental verändern, sondern in die dominanten Strukturen integriert werden, etwa mit dem Ziel, sie zu beschleunigen und dadurch z. B. Produktivitätsvorteile in der kapitalistischen Konkurrenz zu erzeugen (was nicht heißt, dass die neuen technischen Verfahren nicht auch zu Verschiebungen, Störungen und Konflikten führen). Die Einsatzgebiete der Augmented
11 Sutherland (1968), S. 757. 12 Ebd., S. 759. 13 Vgl. z.B. HMDs als spezielle Displays für Kampfpiloten: Furness (1986). 14 Vgl. Lanier (1990). 15 Vgl. Foucault (1976).
,Tag that wall': Augmented Reality-Apps 33
Reality sind vielfältig. Primär denkt man vielleicht an den Bereich der Transport- und Navigationsindustrie. Aber auch in anderen Branchen verspricht der Einsatz von Augmented Reality grundlegende Produktivitätsvorteile: so zum Beispiel im Militär, in der Medizin, aber auch in Architektur- und Designbüros erweist sich die Augmented Reality als konstruktives Hilfsmittel bei der Planung und Durchführung gemeinschaftlicher, kollaborativer (Groß)Projekte. 16 Auch die Unterhaltungs- und Kulturindustrie profitiert vom Einsatz der Augmented Reality.
Mit Augmented Reality kann man nicht, wie mit Laniers phantasmatischer Virtual Reality, aus dieser Welt flüchten - in der Überlagerung der Welt mit Information und Grafik ist aber vielleicht deren ästhetische Veränderung möglich. Und zwar, indem z. B. realräumliche Architektursituationen mit ,erweiterndem' und gleichzeitig ästhetisierendem Bildmaterial vor Ort und in situ überlagert werden. Vielerorts bekommen so ganze Häuserfassaden und Gebäudekomplexe einen ,neuen (digitalen) Anstrich ' . Ein Feld, an dem diese Entwicklung veranschaulicht werden kann, ist die Street Art - jene originär urbane Kunstform, die sich (aus der Subkultur kommend) diverser Praktiken der urbanen Raumaneignung und -generierung bedient und dabei, spätestens seit dem britischen Sprayer Banksy, auch keinen Halt mehr vor renommierten Galerien, Museen und Auktionshäusern macht. 17
Während in eben jenen Museen bereits vielerorts mit Augmented Reality als künstlerisch-ästhetischer/-kuratorischer Ausstellungspraktik gearbeitet wird, soll in diesem Artikel eine neue und gleichzeitig urbane, mobil(er)e Form der Augmented Reality herausgestellt werden: Es geht um sogenannte Augmented Reality-Street Art-Apps, d. h., um die Diskussion von Street Art - und zwar genau jener, die noch nicht Einzug ins Museum gehalten hat18 -und deren Kombination mit mobiler Smartphone-Technologie. Die Frage ist: Was passiert, wenn die ursprünglich für die Effizienzsteigerung von Subjekten entwickelte Augmented Reality nun, mobilisiert durch Smartphones, mit einer künstlerischen Praxis zusammentrifft, die sich ursprünglich durchaus nicht nur als ästhetisch, sondern auch als kritisch verstanden hat? 19
2. Augmented Reality-Street Art-Apps
Im Folgenden werden zwei Felder von Apps umrissen: einmal solche zur (Geo)Lokalisierung von Street Art im Realraum und dann solche, die selber der Produktion virtueller Street Art dienen.
(Geo)Lokalisierung von Street Art in Realraum: „All City"
Ein Beispiel einer solchen ,augmented' Street Art-App ist die sogenannte „All City"Street Art-App20 der beiden US-Amerikaner Marcus White und Kayce Thompson-Russ aus Brooklyn. Motivation für deren Entwicklung war ihre eigene Begeisterung und Leidenschaft für StreetArt sowie die Graffiti-Kultur im Allgemeinen, so die beiden selbst.2 1
Konzipiert ist die App sowohl für Street Art-Enthusiasten als auch für Künstler. Sie bietet
1• Vgl. Schröter (2012). 17 Zur Geschichte der Street Art, die hier nicht ausführlich dargestellt werden kann, vgl. u.a. Blanche (2010),
Reinecke (2007) und Metze-Prou/Van Treek (2000). 18 sondern die (noch) in ihrem ursprünglichen Territorium, der Straße, anzutreffen und lokalisierbar ist. 19 Vgl. dazuAutonomeAfrika-Gruppe/Blissett/Brünzels (Hg.) (2001), sowie Baudrillard (1987). 20 Vgl. https://itunes.apple.com/us/app/all-city-street-art-graffiti/id359211420?mt=8, (Stand: 1.1.2013). 21 Vgl. http://allcitystreetart.com/the-app/, (Stand: 31.12.2012).
34 Katja Glaser/Jens Schröter
Abb. 2: Smartphone-Screenshot der „All City"-Street Art-App, hier: Suchoptionen
ihren Usern dabei sowohl die Möglichkeit nach Street Art in ihrer unmittelbaren Umgebung zu suchen als auch ,globale' Street Art-Touren - ,händisch' und in digitaler Form - auf dem Smartphone-Display zu unternehmen.22 Nach einer Lokalisierung des eigenen Standorts (mit Hilfe einer integrierten GPS-Technologie) kann die eigentliche, ,erweiterte'23 Street Art-Tour bzw. -Suche losgehen - wobei zuallererst bestimmt werden muss, welche Filterkategorien zum Zug kommen. Prinzipiell steht der App-Nutzer dabei vor folgenden Möglichkeiten:
(a) er sucht nach Künstlern, woraufhin ihm eine alphabetische Liste mit mehreren hundert Künstlernamen erscheint;
(b) er sucht nach „recent uploads", also kürzlich hinzugefügten Bildern; oder aber, (c) er sucht nach StreetArt-Erscheinungen mit höchster User-Bewertung (Abb. 2).
Über diese drei Kategorien hinaus besteht jeweils die Wahl zwischen einem scheinbar ,willkürlichen', globalen Browsen im digitalen Netz oder aber einer konkreten Suche und Lokalisierung von Street Art-,Pieces' 24 in unmittelbarer Umgebung, was im Falle einer Augmented Reality-App wohl das Hauptziel darstellt: die geomediale Lokalisierung von Street Art im Stadtraum mit Hilfe einer Smartphone-App, die gleichzeitig, den Realraum überlagernde und ,erweiternde', digitale Zusatzinformationen zum konkreten Kontext des ,Pieces' liefert. Die App ist somit nicht nur darauf ausgelegt die Kunst als digitales (Ab)Bild zum Betrachter kommen zu lassen, sondern zielt vielmehr darauf ab, auch den Betrachter bzw. User zur Kunst zu führen. Denn dieser wird, mit Hilfe der in die App integrierten GPS-Technologie, dabei unterstützt das jeweilige Street Art-,Piece'
22 Wobei an dieser Stelle anzumerken ist, dass die ,händische' Navigation und das dabei zwangsläufig resultierende Berühren die Kunstwerkes (via Touchscreen) keinesfalls mit einer realräumlichen, haptischen Erfahrung gleichzusetzen ist. Die Erfahrung des Materialcharakters sowie Spezifika realräumlicher Architektursituationen weichen einem zweidimensionalen, planen (Ab)Bild.
23 Vgl. dazu Manovich (2005), S. 338. Auch im Beispiel der Street Art-App geht es hierbei primär darum, die Erweiterung des Raumes als Idee und kulturelle/ästhetische Praxis herauszustellen; auf die spezifisch elektronischen Netzwerktechnologien, die zur eigentlichen Hervorbringung jener Erfahrung beitragen, wird nicht umfassender eingegangen.
24 Im Street Art- und Graffiti-Jargon spricht man anstelle von Bildern oder Werken von sogenannten ,Pieces'.
,Tag that wall ': Augmented Reality-Apps 35
(auch) im Realraum ausfindig zu machen. Folgen somit mehrere User gleichzeitig den navigatorischen Instruktionen der StreetArt-App, kommt es vor Ort und in situ zu einem realräumlichen Aufeinandertreffen (und möglichem Austausch) der beteiligten Akteure. Demnach sind in jener Form der geomedialen, kartografischen Street Art-Navigation Praktiken der realräumlichen Vergemeinschaftung angelegt, die letztlich sogar Einfluss darauf nehmen, wie wir mit anderen Menschen oder Usern (die jene Technologien ebenfalls nutzen, oder eben auch nicht) sowie der uns umgebenden Welt kommunizieren.
Im Falle von „All City" funktioniert das so: Dem App-User wird auf seinem Smartphone-Display eine Bandbreite an digitalen Street Art- und Graffiti-Fotos angezeigt, die sich allesamt in dessen Umgebung befinden. Neben der Angabe der Künstlernamen ist deren genaue Position in Form einer (möglichst vollständigen, postalischen) Adressangabe bestimmt: Straße und Hausnummer sowie Stadt und Land. Entgegen der in der Diskussion zu mobilen Endgeräten oftmals behaupteten ,placelessness' wird dadurch der lokale Ortsbezug noch verstärkt.25 So verliert der App-User gerade nicht seinen ,kartografischen Boden unter den Füßen' , sondern es entsteht - mit Hilfe eines Sets geomedialer Koordinaten - eine konkrete Verbindung und gleichzeitige Nähe zu bestimmten realräumlichen Spots und Örtlichkeiten. Denn: Diese Orte bzw. die konkreten ,Pieces' sind mit ortsspezifischen und von anderen App-Usem (oder eigens) generierten Informationen angereichert bzw. überlagert. Für die User werden diese Informationen damit ,augmentierter' Teil des ,Pieces' und Ortes, welcher gleichzeitig digital markiert scheint. Dadurch entstehen letztlich gänzlich neue, teilweise emotional besetzte, personalisierte Orte,26 die nicht nur Lokative Gesichtspunkte hervorheben, sondern einzelne ,Pieces' -auch an (scheinbar) ästhetischer - Relevanz gewinnen lassen. Sind in der Gegend mehrere Street Art-Erscheinungsformen zu finden, ist solch ein ,Hotspot' 27 in der App mit einem kleinen Feuersymbol am rechten Displayrand gekennzeichnet. Auch ist die UserBewertung - die Vergabe von 0 bis höchstmöglichen 5 Sternchen ist möglich - auf den ersten Blick sichtbar (Abb. 3).
Abb. 3: Screenshot der „All City"-Street Art-App, hier:
User-Bewertungen
25 Vgl. dazu De Souza e Silva/Frith (2012) . 26 Vgl. ebd., S. 7, 168. 27 Als Street Art-,Hotspot' bezeichnet man einen Ort bzw. eine Örtlichkeit, an welchem eine Vielzahl von
Street Art- ,Pieces ' zu finden sind. Solche hochfrequentierten Orte entstehen dabei keineswegs willkürlich: Sie sind entweder besonders leicht oder schwer zugänglich, werden von einem großen Publikum gesehen oder aber wurden bereits von renommierten Artists bespraytlbeklebt, mit welchen man sich (vor allem aus Prestigegründen) gerne umgibt.
36 Katja Glaser/Jens Schröter
Klickt man nur auf ein einzelnes Bild, so erscheint es in Vollgröße auf dem SmartphoneDisplay. Hier besteht die Möglichkeit, es in der ,Map', also der digitalen Karte bzw. dem Stadtplan anzeigen zu lassen. Via Google Maps ist nun ein ,händisches' Browsen im digitalen Raum möglich, ohne vor Ort körperlich präsent zu sein. So kann man einerseits, mü Hilfe der Smartphone-Technologie, auf den (digitalen) Spuren der eingespeisten Street Art wandeln, während man sich jedoch gleichzeitig in seinem persönlichen, realräumlichen Umraum befindet - welcher vom anvisierten ,Piece' unter Umständen mehrere hundert Kilometer entfernt sein kann. In gewissem Sinn scheint man somit an zwei Orten gleichzeitig präsent: Formen hybrider Präsenzerfahrung entstehen.28 Doch prinzipiell stellt diese Praxis des (ausschließlich) ,händischen' Navigierens auf dem als Interface operierenden Smartphone-Display nur eine sekundäre Motivation dar, lebt eine solche App doch gerade von der Mobilität und Portabilität des ihr zugrundeliegenden technischen Devices, dem Smartphone. Haupteinsatzgebiet ist mithin der Stadtraum.
Street Art-Addicts, -Enthusiasten, -Touristen und Hobby-Fotografen kennen das Problem der Street Art-Lokalisierung nur zu gut, denn: ein konkretes Auffinden (bzw. die Anvisierung) von spezifischen Erscheinungsformen ist nicht immer ganz einfach - gerade in eher unbekannten Gegenden oder Stadtteilen. Auch wenn manche Stadtbewohner und Passanten einwenden, die knallbunten Schriftzüge und vermeintlichen Schmierereien seien (zu ihrem Leidwesen) mittlerweile an jeder Straßenecke zu finden, so gestaltet sich die Lokalisierung von ,ästhetisch' konnotierten Werken nicht immer ,als Spaziergang'. Dafür gibt es mehrere Gründe: Erstens ist Street Art von jeher eine relativ kurzlebige Kunst. Sie kann von anderen Künstlern übermalt/übersprayt, von städtischen Reinigungstrupps entfernt oder aber vom Wetter abgetragen werden. Die besondere Signifikanz von Augmented Reality-Apps tritt somit bereits an dieser Stelle zu Tage: Denn auch wenn die Kurzlebigkeit der Street Art mit Hilfe von Augmented Reality-Apps keinesfalls aufgehalten werden kann, so scheint die neue Technologie dennoch im Begriff, ihr in gewisser Weise ein Stück weit entgegenzuwirken. Mit der Möglichkeit einer ,erweiterten', geomedialen und (beinah)echtzeitlichen Navigation im Realraum werden Street Art-Hotspots nämlich nicht nur deutlich einfacher, sondern auch wesentlich schneller lokalisier- und ansteuerbar. So scheint die Wahrscheinlichkeit, die Spots noch vor ihrem möglichen ,Ableben' realräumlich aufsuchen zu können, deutlich höher. Die Vergänglichkeit der Street Art wird dadurch zwar nicht aufgehoben (und das sollte auch nicht die Intention sein, schließlich ist diese ja gerade ein wesentliches Charakteristikum ihrer Eigendynamik), dennoch besteht die Möglichkeit, konkrete ,Pieces' - in Form von digitalen, fotografischen Abbildern - zu archivieren und folglich der Nachwelt zugänglich zu machen.29 Die spezifischen Eigenschaften des Smartphones - wie Mobilität, die Benutzung von Apps bzw. der Rückgriff auf echtzeitliches Kartenmaterial sowie die integrierte Kamera - tragen somit wesentlich zur (schnelleren) Lokalisierung von Street Art bei, wobei gleichzeitig Praktiken der medialen Partizipation, Distribution und Archivierung angestoßen werden. Diese finden im Laufe des Artikels noch genauere Erwähnung.
28 Vgl. dazu Abend/Haupts/Müller (Hg.) (2012) . 29
Gleichzeitig jedoch begünstigen die auf Lokalisierung ausgelegten Augmented Reality-Apps im Gegenzug aber auch das ,Ableben ' konkreter StreetArt-,Pieces ' und beschleunigen deren Kurzlebigkeit. Denn: Street Art wird zunehmend beliebter. Es ist keine Seltenheit mehr, dass Street Art-Fans und -Passanten ihre Lieblingswerke gezielt von den Wänden der Städte abreißen undfiir den Eigengebrauch in die private Kollektion überführen. Unlängst sorgten zudem anonyme Street Art-Verkäufer, die gestohlene Originalwerke von den Straßen -über die Onlineplattform eBay oder via Facebook - anboten, für Aufsehen und Empörung unter Künstlern und Fans.
,Tag that wall': Augmented Reality-Apps 37
Ein zweiter Grund für mögliche Lokalisierungsprobleme ist, dass Street Art durchaus (auch) klein, sublim, teilweise sogar verspielt, auftritt - ohne dabei jedoch ihre Wirkungskraft einzubüßen.30 So scheint sie vielmehr stets eine Möglichkeit zu finden, der gegebenen (Stadt)Ordnung mit einer gewissen Widerspenstigkeit entgegenzutreten. Der französische Soziologe Michel de Certeau bezeichnet dabei genau jene alltäglichen Aneignungspraktiken und kreativen Umdeutungen des Stadtraums, derer sich ganz offensichtlich auch die Street Art bedient, als „gelungene Streiche, schöne Kunstgriffe, Jagdlisten, vielfältige Simulationen, Funde, glückliche Einfälle sowohl poetischer wie kriegerischer Natur."3 1 Und seine Formulierung vereint dabei genau die zwei essentiellen Aspekte, die auch die Street Art zu dem macht, was sie ist: ,subversiv(-rebellisch)', aber gleichzeitig keinesfalls ausschließlich destruktiv, plump, willkürlich oder unüberlegt (zumeist zumindest). Vielmehr wird sie von den jeweiligen Künstlern mit Konzept und Überlegung vorbereitet, bewusst platziert und tritt letztlich in einen konstruktiven Dialog mit ihrem architektonischen Trägermedium. Codes, Zeichen, Ordnungen und als naturalisiert vorgeführte, camouflierte Herrschaftsverhältnisse werden invertiert statt destruiert. Street Art ist somit per se orts- und situationsgebunden. Dem Street Art-Fan wird dabei im Gegenzug eine gewisse Umsicht und Konzentration abverlangt, um das ,bunte Geschehen' am Wegesrand nicht zu übersehen. Noch scheint nicht absehbar, ob die ,erweiternden' Smartphone-App(lication)s dem User auch hier, lokativ und endetail, unterstützend zur Seite stehen können (oder sollten), oder ob der Street Art dabei nicht gerade ihr eigentlicher Reiz - das urbane Flanieren und zufällige Entdecken - genommen wird.
Street Art-Apps wie „All City" erlauben es aber nicht nur, die Stadt auf Street Art,Pieces' und -Hotspots hin zu ,scannen' und stellen mögliche Wegbeschreibungen für einen realräumlichen Besuch bereit, sondern überlagern den physikalischen Raum zudem mit ,erweiternden' Informationen (Abb. 4).
Abb. 4: Screenshot der „All City"-Street Art-App, hier: Street Art-Hotspot in New York
30 Vgl. dazu auch De Certeau (1988), S. 110. 31 Vgl. ebd„ S. 56.
38 Katja Glaser/Jens Schröter
Abb. 5: Screenshot der „All City"-Street Art-App, hier: Verl inkung mit und Distributionsmöglichkeiten über andere Onlinedienste und Plattformen
Realräumliche Spots und ,Pieces' sind somit vor Ort und in situ, mit ortsspezifischem, situiertem Zusatzinformationen überlagert. Der reale Raum wird damit nach Manovich zu einem „Datenraum".32 So können mittels solcher Apps, durch spezifische Verlinkungen, konkrete Informationen zu den Künstlern abgerufen werden, und das in Echtzeit, ohne zeitliche Verzögerung. Die Street Art tritt also in ein komplexes Netzwerk heterogener Akteure ein: Menschen, Devices, Räume und Technologien sind über mobile Schnittstellen miteinander verbunden und operieren als Praktiken kultureller Produktion und sozialer Interaktion in einem wechselseitigen Verhältnis.33
Gleichzeitig kannjeder User dabei zum ,Produser' avancieren, indem er Details des unlängst gesichteten ,Pieces' editieren kann: So kann er das ,Piece' bewerten, kommentieren, zu seinen Favoriten hinzufügen, teilen, mit Flickr oder Twitter verknüpfen oder aber bereits vorhandene Informationen bearbeiten und gegebenenfalls berichtigen (Abb. 5).
Auch können eigene Street Art-Funde, in Form von fotografischen (Ab-)Bildern, ins digitale Straßennetz geladen und eingespeist werden. Somit kann also auch auf die städtische Navigation anderer User Einfluss genommen werden, beispielsweise durch den Upload eines besonders interessanten ,Pieces'. Ganze Routen können dadurch vorgefertigt werden: „Users are not only able to read spaces - they , write' spaces as weil." 34 Die App ist damit grundsätzlich auf Partizipation und gegenseitige Kollaboration angelegt; eine mediale Teilhabe ist sogar ausdrücklich erwünscht, lebt sie doch gerade von der steten Aktualisierung und Erweiterung durch ihre (Prod)User.
Aktualisiert wird jedoch nicht nur mittels neuer Street Art-Uploads, sondern auch mittels des Archivierungs-Buttons, der es ermöglicht, den Status einzelner ,Pieces' zu
32 Manovich (2005), S. 341. Manovichs Aus führungen zum „erweiterten Raum" beziehen sich dabei vor allen Dingen auf städtische Räume (wie Einkaufszentren, Unterhaltungsgegenden, Messehallen etc.), die von dynamischen, vielfältigen Multimedia-Informationen drahtlos überlagert werden. Dabei fragt er, wie jene überlagerten Schichten (Realschicht und digitale Informationsschicht) unsere Erfahrungen verändern und welchen Stellenwert den jeweiligen ,Layern' zugesprochen werden kann: Operieren sie gleichberechtigt, kommt es zur gegenseitigen Subsumption oder letztlich gar zu einem neuen, multidimensionalen Raumerlebnis mit neuer Qualität, vgl. dazu ebd.
33 Vgl. dazu auch Fannan (2012), S. 120: „ [ .. ] the mobile interface is [„.] a practice and not a set ofprede
termined fixtures." 34 De Souza e Silva/Frith (2012), S. 163.
,Tag that wall ': Augmented Reality-Apps 39
verändern, wenn ursprünglich ,anvisierte ' (d. h. via App lokalisierte) Street Art im urbanen Stadtraum nicht mehr auffindbar ist - verschwunden, beseitigt, entfernt. Die App operiert hierbei mit einem weiteren Zeichen, welches das Verschwundensein der Street Art kennzeichnet: ein kleiner Geist am rechten Displayrand. Somit nimmt die App spezifische Charakteristika der Street Art auf und reagiert, in Form von technischen Anpas-sungen und Zurichtungen, auf deren Eigendynamik(en). .
Doch die aktive, mediale Teilhabe der Nutzer zur Aufrechterhaltung und stetigen Aktualisierung der App hat auch seine problematischen Seiten. Derzeit gibt es eine Vielzahl an Street Art-Apps, die auf ihre je spezifische Weise zur Überlagerung und Erweiterung des physikalischen Realraums beitragen. Abgesehen von technisch-konzeptionellen Gesichtspunkten (für die mehrheitlich Auftraggeber, Hersteller und Programmierer verantwortlich sind), sind Augmented Reality-Street Art-Apps tendenziell nur so gut wie ihre (Prod)User fleißig. Dazu kommt, dass derzeit ein ,Kanal' fehlt, der alle Erscheinungsformen bündelt und in der Entwicklung solcher Street Art-Apps eine gewisse ,Monopolstellung' einnehmen könnte. Eine systematische Einspeisung bzw. Erstellung realitätsnaher echtzeitlicher Street Art-Maps steht damit aus. So sind viele Apps derzeit (noch?) recht 'spärlich aufbereitet; nur ein kleiner Bruchteil der im Stadtraum auffindbaren ,Pieces' und ,Tags ' 35 ist ins digitale Straßennetz der jeweiligen App-Software eingespeist. Oftmals fehlen zusätzliche Verlinkungen oder Informationen, sodass die (vom Hersteller proklamierten) Augmented Reality-Effekte bislang sehr selektiv bleiben - auch wenn „All City" hierbei bereits eine vergleichsweise recht breite Funktionalität (wie auch geografische Verbreitung) aufweist.
Statt das Phänomen global fassen zu wollen, wie dies die Konzeption von „All City" nahelegt, wählen andere StreetArt-Apps, wie beispielsweise „StreetArt NYC"36, „Street Art London"37 oder „Street Art Berlin"38 einen begrenzten lokalen Fokus und konzentrieren sich allein auf die Street Art-Erscheinungen einer Stadt. Auch hier wird die geomediale Lokalisierung (des eigenen Smartphones, und somit seiner Selbst, via GPS) mit der informativen Überlagerung des jeweiligen Realraumes konzeptionell verbunden - nur eben in kleinerem Rahmen. D. h., nach Lokalisierung der eigenen geografischen Position wird diese mit den Koordinaten konkreter StreetArt-,Pieces', in Form von Wegbeschreibungen, Richtungs- und Entfernungsangaben, verknüpft. Bei einem realräumlichen A~fsuchen können die ,Pieces' dann mittels digital-überlagerter, auf dem Smartphone-D1splay abrufbarer Zusatzinformationen zu Künstler, Kontext oder Umgebung ,erweiternd' erfahren werden: „As a result, finding a location no longer means only finding its geographic coordinates, but also accessing an abundance of digital information that now belongs to that location. This information is always dynamic, because it is constantly being created, deleted, and edited,"39 konstatieren auch De Souza e Silva und Frith.
Dass die App-Technologie nicht nur einen Zugewinn für seine User darstellt, sondern gleichzeitig einen Verlust (in diesem Fall: der Privatheit seiner persönlichen Daten) nach
" Ein , Tag' ist die gesprayte Signatur eines Sprayers. Diese sind vor all em in der Graffiti-Kultur beheimatet und folglich weniger auf den ganzen, übergeordneten Komplex der Street Art übertragbar. Neben der ,klassi schen ' Raumaneignung geht es beim ,Taggen' mehrheitlich um das Postulieren der eigenen Präsenz im urbanen s.tadtraum. Einer, der jene Praktik wohl am obsessivsten betrieb, war „Taki 183", der in den 1970er Jahren mit semem Pseudonym ganz New York ,invadierte'. „Taki" rekurriert dabei auf die griechische Kurzform seines Geburtsnamens „Demetrius"; „183" war die Hausnummer seiner New Yorker Adresse, vgl. dazu http://www.takil83.net/#
(Stand: 31.12.2012). 36 Vgl. https://itunes.apple.com/us/app/street-art-nyc-geo-street-art/id501l94903?mt=8 (Stand: 1.1.201 3). " Vgl. https://itunes.apple.com/gb/app/street-art-london-geo-street/id47 l 746725?mt=8 (Stand: 1. 1 .2013).
Vgl. https://itunes.apple.com/de/app/street-art-berlin/id56661l1l7?mt=8 (Stand: 1.1.2013). 39 Vgl. De Souza e Silva/Frith (201 2), S. 9.
40 Katja Glaser/Jens Schröter
sich ziehen kann, scheint nicht überraschend. Räumliche Erweiterung und gleichzeitige Überwachung bzw. Kontrolle durch permanentes, teils unwissentliches ,tracking' von Seiten der ,mapping App(lication)s' (und deren teils unkontrollierte Datenweitergabe an Dritte, wie beispielsweise an lokal operierende Werbeanbieter) scheinen somit, allein schon in technologischer Hinsicht, eine symbiotische Einheit zu bilden40 und greifen auch im Falle der Augmented Reality-Street Art-Apps. Von Seiten des Stadtmarketings jedoch sind diese Apps wiederum eine gern gesehene Entwicklung als Marketingstrategien und touristische ,Eyecatcher'. Darin werden die Skripte der Augmented Reality offenkundig fortgesetzt. Der Stadtraum wird durch ihren Einsatz gleichsam selber musealisiert: Mit dem Slogan „Banksy Street Art removed, now visible with augmented reality ,Circa App"'41 wirbt zusätzlich ein momentanes Kickstarter-Projekt um die Gunst unterstützender Fans und zahlender Sponsoren. Mit ihrem Projekt wollen die Initiatoren verschwundene StreetArt-,Pieces' ihres Idols wieder an die Wände der Stadt zurückholen. „To ghost photos" nennen sie dabei ihre Praxis der digitalen Re-Vitalisierung vergangener Kunstobjekte. 42 Reale Räume werden dabei mit der Smartphone-Kamera abgescannt. Mit dem sogenannten „augmented reality viewer" können, über das von Apple bereitgestellte iOS Device, vorherrschende Architektursituationen (wieder)erkannt und piktural ,komplettiert' werden. Diese Expansion des Museums-Dispositivs auf die ganze Stadt erlaubt es, im Prinzip jede Hauswand als ,kulturell wertvoll' auszuflaggen - und also an die Tourismus-Industrie (sowie durch die Datenweitergabe an die Werbeindustrie) anzuschließen.
Das Smartphone als Spraydose, oder , Tagging' im Hybridraum: „ Street Tag"
An dieser Stelle wird bereits eine (mögliche) Tendenz der Augmented Reality-StreetArtApp-Entwicklung deutlich: Während einige durchaus auf alltagspraktische Funktionalität angelegt sind (das Auffinden der Street Art im Realraum), so scheint bei einer Vielzahl dennoch ihr unterhaltender, spielerisch-performativer Charakter im Vordergrund zu stehen. So zum Beispiel bei „Street Tag"43 - einer App, die das Smartphone quasi zur Sprühdose umfunktioniert. Entstanden ist sie im Jahr 2011, im Rahmen von „Channel 4's Street Summer", einem Event, welches zu Ehren von britischer Street Art Graffiti Hip Hop und urbaner Kultur abgehalten wurde. 44 ' '
„Shake to spray", lautet die initiale Aufforderung zum Start der mobilen iPhone-Applikation.45 Begleitet von Schüttelgeräuschen - wie dies bei einer echten Spraydose auch der Fall ist-kommt die Kamerafunktion des Handys zum Einsatz.46 Im Display erscheint das digitale Abbild des realen Umraums, welches zur virtuellen ,Leinwand' avanciert (Abb. 6).
40 Vgl. Manovich (2005), S. 341. 41
http://circaapp.com/news/banksy-street-art-restored-now-visible-with-augmented-reality-circa-app/ (Stand: l.l.2013).
42 Vgl. ebd. 43 Vgl. https://itunes.apple.com/us/app/street-tag/id45 l 000359?mt=8 (Stand: 1.1.2013). 44 Vgl. ebd. 45
Eine performativ, spielerische Körperpraktik bildet somit den Ausgangspunkt jener ,Tagging' -Praxis (,embodiment'), vgl. dazu Farman (2012), S. 22: „[„.] we create space as we create our bodies across digital media."
46 Die Kamerafunktion als ,alte', ins Smartphone integrierte Medientechnik erweist sich dabei bei fast allen
Street Art-Apps als essentielles Hilfsmittel bei der Erzeugung von Augmented Reality.
,Tag that wall': Augmented Reality-Apps
Abb. 6: Screenshot der „Street Tag"- App, hier: ,digitales' Sprayen
41
Abb. 7: Screenshot der „Street Tag"- App, hier: Geotagging und weitere Distributionsoptionen
Auch verschiedene Spray-Optionen können gewählt werden: die Größe bzw. Dicke des Sprühkopfes, die Konsistenz bzw. Materialbeschaffenheit der Farbe (trocken oder nass )47, sowie die Farbe selbst. Außerdem kann ein bereits bestehendes , Tag' aus der Galerie ausgewählt werden (einige vorgefertigte ,Tags' werden von der App bereitgestellt; jedoch kann auch auf eigene, zuvor gespeicherte Kreationen zurückgegriffen werden).
Sind alle Voreinstellungen gewählt, kann mit dem Sprayen begonnen werden: Bis auf die Kadrierung des Displays, also den Bildausschnitt, sowie das darin vorgegebene Raster, sind der Sprayer-Phantasie keine Grenzen gesetzt. Keinerlei Gesetzesvorgaben oder -auflagen limitieren die Invasion der grellbunten ,Tags' in den öffentlichen Raum. So können sie beliebig auf jede realräurnliche Architektursituation oder Umgebung platziert werden, und dies in Echtzeit. Denn gesprayt wird letztlich nur auf einen digitalen Layer, der den Realraum überlagert. Der reale Raum wird somit weder verschmutzt noch , beschmiert' , von Vandalismus oder Sachbeschädigung kann also nicht die Rede sein. Damit wird der Street Art freilich ein Teil ihres subversiven Potentials genommen - ist die NeuAneignung des öffentlichen Raums durch die buchstäbliche Besetzung öffentlichen Eigentums doch eigentlich einer ihrer wesentlichen Aspekte.48
Zusätzlich besteht die Option, die bunt besprayten ,Wände' mit Freunden und Bekannten zu teilen; per Email, via Facebook oder Twitter werden sie dadurch für eine breite Öffentlichkeit zugänglich (Abb. 7).
Augmented Reality-Street Art-Apps ermöglichen somit nicht nur die Generierung personalisierter, ästhetisierend-gelayerter Orte, sondern tragen ebenfalls zu deren Zirkulation und Sichtbarkeit - auch für Nicht-User jener Technologien - bei. Darüber hinaus ist deren App-interne Einspeisung bzw. Markierung innerhalb von digitalen Stadtplänen und Karten möglich, wodurch die ,getagten' Spots mit Hilfe von Google Maps selbst
41 bzw. matt oder glänzend. 48 Vgl. dazu erneut Autonome Afrika-Gruppe/Blissett/Brünzels (Hg.) (2001), Reinecke (2007) sowie
Baudrillard ( 1987).
42 Katja Glaser/Jens Schröter
lokalisier- und ansteuerbar werden. Markiert sind sie von kleinen Pins, die an Stecknadeln erinnern. Zoomt man an sie heran, wird die Karte um einige Hintergrundinformationen ergänzt: Neben dem geografischen Standort des anvisierten ,Tags' erhält der AppUser Informationen über den genauen Tag und die Uhrzeit der ,Tagging'-Praxis seines Mit-Users. Zumeist geben die (Prod)User und Smartphone-Sprayer dabei ebenfalls ihren Namen an. Um anonym zu bleiben, wird-wie beim ,richtigen Taggen' auch-mit Pseudonymen gearbeitet. Auch hieran zeigt sich eine Verschiebung: Sind Pseudonyme beim wirklichen ,Taggen' u.U. notwendig, um der Strafverfolgung zu entgehen, wird das Pseudonym beim digitalen ,Taggen ' zu einer ästhetischen Form, die ,street credibility' zitiert. Aus einer potentiell subversiven und strafbaren Handlung wird Akkumulation von kulturellem Kapital.
Dynamisierung von Street Art im Hybridraum: „LZRTAG"
Dynamisiert werden die zuvor beschriebenen Vorgänge durch „LZRTAG"49, eine spezifische Android-Augmented Reality-App, die Street Art nicht nur mobil macht (unter Zuhilfenahme des portablen Devices), sondern sie sich selbst bewegen lässt. StreetArt wird animiert bzw. Animationen werden zur Street Art: Dabei operiert die App mit sogenannten „paired marker tags", einer Modifikation von 3D-Barcodes (Abb. 8).
!iH~j
r Abb. 8: Screenshot der „LZRTAG"- App, hier: „paired marker tags"
Abb. 9: Screenshot der „LZRTAG"- App, hier: digitales Layering einer (Pinn)Wand
App-User kreieren ihre eigene, digitale Animation bzw. laden ihr Wunschbild auf die „LZRTAG"-Website. Im Gegenzug erhalten sie einen digitalen Barcode, den sie auf einer willkürlichen, realräumlichen Oberfläche bzw. Umgebung platzieren können. Solche „rnarker tags" erinnern dabei an Fotoecken; jene kleinen Klebeecken, die (früher) dazu verwendet wurden, um Fotos in (analogen) Fotoalben zu platzieren. Sind die „marker tags" im gelayerten Hybridraum exakt gesetzt, bilden sie einen Rahmen, der das StreetArt-,Piece' - beim Abscannen mit der Smartphone-App - erscheinen lässt (Abb. 9).
Die ,Tags' funktionieren sowohl für unbewegte Bilder als auch für Animationen, sofern sie eine Größe von 250kb nicht überschreiten. Jeder hochgeladene ,Tag' hat dabei eine ursprüngliche Lebensdauer von sechs Monaten, die sich jedoch verlängert, wenn er häufig abgescannt bzw. eingelesen wird. Wird ein , Tag' nach Ablauf der sechs Monate nicht mehr eingelesen, wird er recycled.50 Infolgedessen wird er also seiner vorherigen, pikturalen ,Aufladung' entledigt und steht, als eine Art digitales, transformiertes Kondensat, für andere Bilder zur Verfügung.
49 Vgl. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LZRTAG.reader (Stand: 1.1.2013). 50 Vgl. http://www.gizmag.com/lzrtag-augmented-reali ty-graffiti/23294/ (Stand: 1.1.2013).
,Tag that wall': Augmented Reality-Apps 43
„LZRTAG" ist eine relativ simple Augmented Reality-Technologie, die es erlaubt, animierten Augmented Reality-Content sowohl realräumlich ,erfahrbar' als auch speicherbar zu machen: Fotos vom momentanen, überlagerten Hybridraum können unter Zuhilfenahme der Smartphone-Kamera gemacht und, auch in diesem Falle, auf Social Networks wie Facebook geteilt werden. Hier wird also abermals deutlich, wie durch mobile Augmented Reality-Street Art-Apps deren (Prod)User zu kollaborativen Praktiken aufgerufen werden.
Auch PR- und Werbeleute können sich die Technologie zu Nutze machen, um interaktive Elemente zu ihrer Werbebotschaft hinzuzufügen, so die Hersteller. 51 Dies funktioniert sowohl bei traditionellen Medien, wie beispielsweise Zeitschriften, Zeitungen oder Werbeplakaten, als auch bei neuen, digitalen Medien: „A newspaper might include the marker tags in a story to provide some simple video or additional irnages. An advertiser can run an animated image of its logo or product"52, heißt es auf der Website. Ähnlich also wie bereits StreetArt, in Folge von ,Re-Appropriation'53 und ,Guerilla Marketing'54, durch die Werbeindustrie angeeignet wurde, um Marken eine modische, subkulturelle Konnotation zu verleihen (,branding the cool'), scheint auch bereits die im Street Art-Kontext verwendete Augmented Reality-Technologie auf Vermarktung zugeschnitten.
Dies könnte man, zusammen mit den erwähnten Verschiebungen, die die potentiell strafbaren Aspekte an der Street Art (Sachbeschädigung) neutralisieren, erneut als Auswirkung der Skripte der Augmented Reality auf die Street Art beschreiben. Potentiell subversive Praktiken, die mit bürgerlichen Eigentumsvorstellungen in Konflikt geraten, werden entschärft und zugleich mit Werbe- und Kommerzialisierungspraktiken verbunden. Gerade letztere können an die User-Produktivität anschließen, bzw. diese ausbeuten.55 Wenn User Städte mit virtuellen Street Art-Kunstwerken überziehen und diese publizieren, kann das wiederum als Steigerung der Attraktivität vermarktet werden. Zugleich kann diese Aufforderung zur - gefahrlosen - Produktivität (in Analogie zu ähnlichen Debatten in Bezug auf Facebook56
) eben selbst als eine Weise der Einübung in ständige Produktivität, also als Subjekt-Technologie des neoliberalen Kapitalismus, verstanden werden.
51 Vgl. http://www.gizmag.com/lzrtag-augmented-reality-graffiti/23294/ (Stand: 1.1.2013). 52 Ebd.; siehe dazu auch http://lzrtag.com/ (Stand: 1.1.2013). 53 Im Zuge der ,Re-Appropriation ' werden dabei einst in der Subkultur verortbare Haltungen, Lifestyles und
Modeerscheinungen vom Mainstream aufgenommen und gewinnbringend vermarktet. Die Subkultur wird, als Warenform, somit wiederum zur Ware des Mainstream. Voraussetzung dafür ist, dass die subkulturelle, rebellisch aufsässige Anti-Haltung den aktuellen Zeitgeist triffi, vgl. dazu Reinecke (2007), S. 161 , sowie auch Sturken/ Cartwright (2001).
54 Bei ,Guerilla Marketing' handelt es sich um zielgruppenspezifische Werbekampagnen, die mittels Flyer, gesprayten Stencil oder großflächig bemalten, urbanen Schauplätzen versuchen die Gunst bzw. Kaufkraft des (vermehrt jugendlichen) Publikums zu gewinnen. Auftraggeber sind Werbeagenturen bekannter Plattenfinnen oder Firmen wie Puma, Calvin Klein, o2 und PlayStation, vgl. Reinecke (2007), S. 82.
55 So wie etwa die Informations-Produktion durch die User bei Facebook zu gezielter Werbung und dadurch Gewinnen für Facebook genutzt werden kann, ohne dass die User davon etwas hätten - ihre Arbeit wird ausgebeutet, vgl. Andrejevic (2011). Ähnliches lässt sich auch im Bereich der Computerspiele beobachten, wo das ,Modding' (also die Weiterentwicklung von Spieleinhalt durch die Nutzer) wiederum von der Spieleindustrie abgeschöpft wird, siehe Kücklich (2005).
56 Vgl. Cote/Pybus (201 l) und generell Thrift (2006).
44 Katja Glaser/Jens Schröter
3. Zusammenfassung und Ausblick
Wir lieferten einen ersten Einblick in die Funktionsweise von sogenannten Augmented Reality-Street Art-Apps. Im ersten Beispiel stand der Aspekt der navigatorischen Optimierung und funktionalen Lokalisierung von Street Art im Vordergrund: realräumliche Spots und ,Pieces' sind in digitale Stadtpläne eingebunden, geomedial lokalisierbar und mittels ,erweiternder' Zusatzinformationen im physikalischen Stadtraum ,überlagert' erfahrbar. Hierbei geht es somit vor allem um die informative, sich gegenseitig ,anreichernde' Überlagerung zweier differenter Schichten (real-virtuell). Beispiel zwei steht exemplarisch für einen (eher) spielerischen Umgang mit dem Smartphone im Kontext von Street Art und Augmented Reality. Die Überlagerung von echtzeitlichem Realraum mit digital gelayerten Bildern steht jedoch auch hier im Mittelpunkt. Durch Potenzierung und Dynamisierung der Street Art mit Hilfe der Augmented Reality-App(lication)s rücken letztlich gestalterisch-experimentelle sowie künstlerische Praktiken in den Fokus, die deren vielfältige Spielräume einer (ästhetischen, sowie etwaig auch kommerziellen) Gestaltung offenlegen. Der von Manovich proklamierte „augmented space"57 wird hier zum „artistic augmented space".
Um nun auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: Es zeigte sich in beiden untersuchten Fällen, dass man die Praktiken sehr wohl als Transformation der Street Art durch die auf Effizienz und Funktionalisierung gerichteten Skripte der Augmented Reality lesen kann. Das Verhältnis zwischen den medienästhetischen Praktiken und den technologischen Skripten scheint nicht symmetrisch zu sein. Dies widerspricht der heute, v.a. in medienethnographischen Studien, manchmal anzutreffenden Naivität, die implizit unterstellt, Technologien seien quasi neutral - und könnten ,situiert' so oder so genutzt werden. Die hier diskutierten Beispiele legen vielmehr nahe, dass die Funktionalisierung und Effizienzsteigerung als ,Programm' der Augmented Reality auch auf die Praktiken mit ihr durchschlägt, selbst wenn die Street Art-Apps die Augmented Reality in dem Sinne verändert haben, dass sie jetzt mit anderen (künstlerischen) Praktiken und folglich anderen Orten und Situationen verbunden werden kann.
Theoretisch folgt daraus, die Skripte von Technologien, die sich archäologisch und technikanalytisch ablesen lassen58, ernst zu nehmen. Einen doppelten Fokus auf die Skripte und die Praktiken hat z. B. Madeleine Akrich59 auch immer empfohlen - doch in medienethnographischen bzw. bezeichnend schon so genannten ,praxeologischen' Forschungen wird dies oft vergessen, und die ,nicht-menschlichen Akteure' bzw. Technologien werden in ihrer historisch formierten und daher kontingenten Eigenlogik in der Regel einfach ausgeblendet. Nicht nur verletzt dies das oft in solchen Studien, zumindest rhetorisch, zugrunde gelegte Prinzip der „Symmetrie zwischen Menschen und nichtmenschlichen Wesen"60 - und zwar genau in der Hinsicht, die menschlichen Akteure wieder in die zentrale Rolle zu rücken. Schlimmer noch: Die Ausblendung der Eigendynamik der technischen (und anderer nicht-menschlicher) Akteure passt allzu gut zum heute alles durchdringenden, neoliberalen Menschenbild einer souveränen, sich selbst völlig transparenten Markt-Monade.61
" Manovich (2006). 58 Und hier ist immer noch und immer wieder auf das Werk von Friedrich Kittler zu verweisen - exempla-
risch Kittler (1998). 59 Vgl. Akrich (2006). 60 Latour ( 1996, 60) . " Tatsächlich gibt es wie Sangren ( 1988, 417 und 423) nahelegt, eine gewisse und bedenkliche Nähe der
Zentrierung um das Individuum und seine Praktiken in Uedenfalls bestimmten Formen von) ethnographischen
, Tag that wall': Augmented Reality-Apps 45
Praktisch ist es aber nicht undenkbar, künstlerische Anwendungen von Augmented Reality-Apps - und speziell solche, die sich auf Street Art beziehen - zu entwickeln, die versuchen, die Skripte zu verfremden, zu verformen oder alternative, kritische Praktiken zu entwickeln. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, dass Produzenten und Hersteller die (v.a. von Blast Theory und dem Mixed Reality Lab62
) bereits geleistete Pionierarbeit im Bereich , locative media art' aufgreifen und deren Bemühungen in der Entwicklung von Apps für GPS-fähige Mobiltelefone weiterführen. Eine solche Medienkunst auf der Basis von Augmented Reality-Apps wäre eine Möglichkeit, sich der alles durchdringenden Funktionalisierung und Optimierung, wie sie in der Archäologie der Augmented Reality angelegt ist, verfremdend und spielerisch entgegenzustemmen.
Literaturverzeichnis
Abend, Pablo/Haupts, Tobias/Müller, Claudia (Hg.) (2012): Medialität der Nähe. Situationen-Praktiken-Diskurse. Bielefeld: transcript.
Akrich, Madeleine (2006): „Die De-Skription technischer Objekte", in: Andrea Belliger/ David J. Krieger (Hg.): ANThology: ein einfahrendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld: transcript, S. 407-428.
Andrejevic, Mark (2011): „Facebook als neue Produktionsweise", in: Oliver Leistert/ Theo Röhle (Hg.): Generation Facebook. Über das Leben im Social Net. Bielefeld: transcript, S. 31 -49.
Autonome Afrika-Gruppe/Blissett, Luther/Brünzels, Sonja (Hg.) (2001): Handbuch der Kommunikationsguerilla. Berlin, Hamburg, Göttingen: Assoziation A.
Azuma, Ronald T. (1997): „A Survey of Augmented Reality", in: Presence: Teleoperators and Virtual Environments 6(4), S. 355-385.
Baudrillard, Jean (1987): Kool Killer oder der Aufstand der Zeichen. Berlin: Merve. Benford, Steve/Giannachi, Gabriella (2011): Performing Mixed Reality. Cambridge
(u.a.): MIT Press. Bimber, Oliver/Raskar, Ramesh (2005): Spatial Augmented Reality. Merging Real and
Virtual Worlds. Wellesley, MA: Peters. Blanche, Ulrich (2010): Something to s(pr)ay: Der Street Artivist Banksy. Eine kunstwis
senschaflliche Untersuchung. Marburg: Tectum. Cote, Mark/Pybus, Jennifer (2011): „Social Networks: Erziehung zur imm~~eriellen Ar
beit 2.0", in: Oliver Leistert/Theo Röhle (Hg.): Generation Facebook. Uber das Leben im Social Net. Bielefeld: transcript, S. 51-73.
De Certeau, Michel (1988): Kunst des Handelns. Berlin: Merve. De Souza e Silva, Adriana/Frith, Jordan (2012): Mobile Interfaces in Public Spaces. Lo
cational Privacy, Contra/, and Urban Sociability. New York (u.a.): Routledge. Fahle, Oliver (2006): „Augmented Reality - Das partizipierende Auge", in: Britta Neit
zel/Rolf F. Nohr (Hg.): Das Spiel mit dem Medium. Partizipation - Immersion - Interaktion. Zur Teilhabe an den Medien von Kunst bis Computerspiel. Marburg: Schüren, S. 91-103 .
Farman, Jason (2012): Mobile Interface Theory. Embodied Space and Locative Media. New York: Routledge.
Foucault, Michel (1976): Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Studien (siehe auch Meyer 2009) und dem ,methodologischen Individualismus' neoklassischer Ökonomie. Etwas anders ist die Position von Knorr (1981).
•2 Vgl. dazu De Souza e Silva/Frith (2012), S. 95, sowie Benford/Giannachi (2011).
46 Katja Glaser/Jens Schröter
Furness, Thomas (1986): „The Supercockpit and its Human Factors Challenges", in: Proceedings of the 30th Annual Meeting of the Human Factors Society, S. 48-52.
Haller, Michael et al. (Hg.) (2007): Emerging Technologies of Augmented Reality. Interfaces and Design. Hershey, PA: Idea Group.
Kittler, Friedrich (1998): „Hardware, das unbekannte Wesen", in: Sybille Krämer (Hg.): Medien - Computer - Realität, Frankfurt a.M., S. 119-132.
Klitzke, Katrin/Schmidt, Christian (Hg.) (2009): Street Art. Legenden zur Straße. Archiv der Jugendkulturen: Berlin.
Kücklich, Julian (2005): „Precarious Playbour: Modders and the Digital Games Industry", in: The Fibreculture Journal 5, http://five.fibreculturejournal.org/fcj -025-precariousplaybour-modders-and-the-digital-games-industry/, Stand: 31.12.2012.
Knorr, Karin (1981 ): „Anthropologie und Ethnomethodologie. Eine theoretische und methodische Herausforderung", in: Wolfdietrich Schmied-Kowarzik (Hg.): Grundfragen der Ethnologie: Beiträge zur gegenwärtigen Theorie-Diskussion. Berlin: Reimer, S. 107-123.
Lanier, Jaron (1990): „Der Ritt zum Saturn auf dem Riesenwurm. Post-symbolische Kommunikation". Auszüge aus einem Interview mit Jaron Lanier, geführt von Morgan Russe!, in: Gottfried Hattinger et al. (Hg.): Ars Electronica 1990. Bd. II: Virtuelle Welten. Linz: Linzer Veranstaltungsgesellschaft, S. 186-188.
Latour, Bruno (1996): Der Berliner Schlüssel. Erkundungen eines Liebhabers der Wissenschaften. Berlin: Akademie Verlag.
Manovich, Lev (2006): „The Poetics of Augmented Space", in: Visual Communication, 5(2), S. 219-240.
- (2005): „Die Poetik des erweiterten Raumes", in: Angelika Lamrnert/Michael Diers/ Robert Kudielka/Gert Mattenklott (Hg.): Topos Raum. Die Aktualität des Raumes in den Künsten der Gegenwart. Berlin: Verlag für moderne Kunst Nürnberg, S. 337-349.
Metze-Prou, Sybille/Van Treek, Bernhard (2000): Pochoir. Die Kunst des SchablonenGraffiti. Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf.
Meyer, Christian (2009): „Ereignisethnographie und methodologischer Situationalismus. Auswege aus der Krise der ethnographischen Repräsentation", in: Peter Berger et al. (Hg.): Feldforschung. Ethnologische Zugänge zu sozialen Wirklichkeiten. Berlin: Weißensee Verlag, S. 401-436.
Milgram, Paul et al. (1994): „Augmented Reality: A Class ofDisplays on the RealityVirtuality Continuum", in: SPIE Vol. 2351-34, Proceedings of Telemanipulator and Telepresence Technologies, S. 282-292.
Oudshoorn, Nelly/Pinch, Trevor (2005): How Users Matter. The Co-Construction of Users and Technology. Cambridge, MA: MIT Press .
Reinecke, Julia (2007): Street-Art. Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript.
Sangren, P. Steven (1988): „Rhetoric and the Authority of Ethnography: ,Postmodernism' and the Social Reproduction of Texts", in: Current Anthropology 29(3), June 1988, S. 405-435.
Schröter, Jens (2012): „Echtzeit und Echtraum. Zur Medialität und Ästhetik von Augmented Reality-Applikationen", in: Isabell Otto/Tobias Haupts (Hg.): Bilder in Echtzeit. Medialität und Asthetik des digitalen Bewegtbildes (= AugenBlick. Marburger Hefte zur Medienwissenschaft 51). Marburg: Schüren, S. 104-120.
- (2007): „Von grafischen, multimedialen, ultimativen und operativen Displays. Zur Arbeit Ivan E. Sutherlands", in: Tristan Thielmann, Jens Schröter (Hg.): Display II:
,Tag that wall': Augmented Reality-Apps 47
Digital(= Navigationen. Zeitschriftfiir Medien- und Kulturwissenschaften 7). Marburg: Schüren, S. 33-48.
- (2004): Das Netz und die virtuelle Realität. Zur Selbstprogrammierung der Gesellschaft durch die universelle Maschine. Bielefeld: transcript.
Sturken, Marita/Cartwright, Lisa (2001 ): Practices of Looking. An Introduction of Visual Culture. New York: Oxford University Press.
Sutherland, Ivan (2007): „Das ultimative Display", in: Tristan Thielmann/Jens Schröter (Hg.): Display 11: Digital (=Navigationen. Zeitschriftfiir Medien- und Kulturwissenschaften 7). Marburg: Schüren, S. 29-32 (übersetzt von Nicola Glaubitz und Jens Schröter).
- (1968): „A Head-Mounted Three Dimensional Display", in: AFIPS Conference Proceedings 33(1), S. 757-764.
Thrift, Nigel (2006): „Re-inventing Invention: New Tendencies in Capitalist Commodification", in: Economy and Society 35(2), S. 279-306. http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/2345/1/12613246_2008-Trend-in AugmentedRealityTrackinglnteractionandDisplayAReviewofTenYearsoflSMAR. pdf, Stand: 13.9.2013.
Zu denApps:
„All City"-StreetArt-App: https://itunes.apple.com/us/app/all-city-art/id3592l1420?mt=8, 31.12.2012. http://allcitystreetart.com/the-app/, Stand: 31.12.2012. http://www.taki183.net/#, Stand: 31.12.2012.
„Street Art NYC"-App:
https://itunes.apple.com/us/app/street-art-nyc-geo-street-art/id501194903 ?mt=8, Stand: 1.1.2013.
„Street Art London"-App: https://itunes.apple.com/gb/app/street-art-london-geo-street/id4 717 46725?mt=8, Stand:
1.1.2013. „Street Art Berlin"-App: bttps://itunes.apple.com/de/app/street-art-berlin/id56661ll17?mt=8, Stand: 1.1.2013.
„ Circa "-App:
http://circaapp.com/news/banksy-street-art-restored-now-visible-with-augmented-reality-circa-app/, Stand: l.1.2013.
„Street Tag"-App:
https://itunes.apple.com/us/app/street-tag/id45 l 000359?mt=8, Stand: 1.1.2013.
„LZRTA G "-App:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LZRTAG.reader, Stand: 1.1.2013. http://lzrtag.com/, Stand: 1.1.2013. http://www.gizmag.com/lzrtag-augmented-reality-graffiti/23294/, Stand: 1.1.2013.
48 Katja Glaser/Jens Schröter
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Sven Bormann (1994): Virtuelle Realität. Genese und Evaluation. Bonn (u.a.): Addison Wesley, S. 80.
Abb. 2-5: Smartphone-Screenshots der All-City-App (Stand: 28.12.2013). Abb. 6-7: https://itunes.apple.com/us/app/street-tag/id45 l 000359?mt=8 (Stand: 1.1.2013). Abb. 8: http://lzrtag.com/design.php (Stand: 1.1.2013). Abb. 9: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LZRTAG.reader (Stand: 1.1 .2013).
Pablo Abend
Apps als Kunst? Zum Verhältnis von Medienkunst und Technologie
Den Zahlen von Industrieanalysten zufolge wurden im Jahr 2011 erstmals mehr Smartphones als PCs ausgeliefert. Im Medienverbund mit den Smartphones konnten sich mobile Programme, gemeinhin als Apps bezeichnet, weiter massenhaft verbreiten, sodass im selben Jahr die Nutzungsdauer von Online-Apps erstmals die des Internet-Browsers übertraf. 1 Zur selben Zeit entdeckten Medienkünstler Apps für sich, sofern die Vergabe eines Preises als Indikator für eine solche Präferenz herangezogen werden kann: Am 8. Juli 2011 wurde erstmals ein Preis für App Art vergeben, ausgelobt vom Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe, finanziell unterstützt von Sponsoren aus dem Bereich der IT-Technologie.2 In drei Kategorien gab es Preise für künstlerische Apps, die für die Endgeräte von Apples oder Googles Betriebssystem programmiert wurden. Um dem schnellen technologischen Wandel auf diesem Gebiet folgen zu können, gibt es jedes Jahr, neben der Hauptkategorie ,künstlerischer Innovationspreis', zwei weitere Preise in wechselnden Kategorien. 2012 entschieden sich die Organisatoren für eine Sonderkategorie mit dem Titel ,Game Art', für die Einreichungen akzeptiert wurden, die eine Form des Gameplays in ihre gestalterische Umsetzung integrieren, und eine Kategorie namens ,Cloud Art', die Kunstwerken vorbehalten war, die sich nach der Client-ServerArchitektur auf viele Rechner und Server verteilen. Das Feld der App-Kunst ist, nimmt man den unternehmensgeförderten App-Art-Award als Ausgangspunkt, gerade mal zwei Jahre alt.
Die Ausrufung eines Awards für App-Kunst oder aber für Apps als Kunst provoziert gleich mehrere Fragen: nach dem Verhältnis und den Wechselwirkungen von Kunst und Technologie, nach den Motiven der Künstler für die Nutzung eines solchen Formats und, mit beidem verbunden, nach der Spezifik einer Kunst, die in ihrer kunsthistorischen Einbettung als Abkömmling der Computerkunst eher als Genre denn als Gattung verstanden werden muss. Gleichwohl nähert sieb dieser Artikel der App-Kunst als Medienkunst nicht primär aus Richtung der Kunstgeschichte, sondern macht von einem technologieund objektzentrierten Zugang Gebrauch, bei dem Apps nicht isoliert betrachtet werden, sondern als Teil eines heterogenen Netzwerks, in dem sie mit ihrer Trägertechnologie, dem Smartphone, im Medienverbund existieren, von ihren Produzenten, denApp-Künstlern, ins Werk gesetzt werden und über neuartige Vertriebswege, die spezialisierten AppStores von Google und Apple, Verbreitung finden . Diese multiperspektivische Betrachtung folgt der Prämisse, dass es sich bei Apps um vernetzte Medienassemblagen handelt, die sich nicht mehr in Hardware und Software sowie On- und Ofilineanwendungen trennen lassen. Zudem ist damit die Erwartung verbunden, dass durch die Analyse von AppKunst allgemeinere Entwicklungen der digitalen Kultur sichtbar werden, allen voran einige Mechanismen der Rezeption und Verbreitung von kulturellen Objekten. Einzelne
http: //www.canalys.com/newsroom/smart-phones-overtake-client-pcs-2011 (04.02.2013). 2 http://www.app-art-award.org/ (18.02.2013).