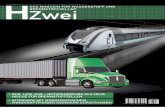Zeugnisse bürgerlicher Repräsentation: reich dekorierte Keramik wohlhabender Patrizier aus...
-
Upload
museum-goerlitz -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Zeugnisse bürgerlicher Repräsentation: reich dekorierte Keramik wohlhabender Patrizier aus...
79
Die Görlitzer Altstadt wird bis heute durch eine nahezu lückenlos erhaltene histo-rische Bausubstanz geprägt. Zahlreiche prächtige Bürgerhäuser vermitteln den Eindruck einstmals blühenden wirtschaft-lichen Lebens in der Neißestadt. Vor allem der Handel mit Tuch, Färberwaid und Bier hatte den Bürgern erheblichen Reichtum beschert. Enge Kontakte entwickelten sich damals unter anderem nach Schlesien, Sachsen und Böhmen. Aufgrund der ein-zigartigen Geschlossenheit der Altstadtbe-bauung kam es hier in der Vergangenheit nur selten zu größeren Tiefbauarbeiten, so dass damit heute gesetzlich verknüpfte stadtarchäologische Untersuchungen bislang die Ausnahme bilden. Viele Fragen besonders an die frühe Stadtgeschichte lassen sich vor diesem Hintergrund nach wie vor nur spekulativ beantworten.
Ein regelrechter Glücksfund gelang jedoch im Oktober 1981, als am nordwest-lichen Rand des mittelalterlichen Stadtge-bietes auf der Parzelle Hugo-Keller-Straße 9 ein aus Feldsteinen gesetzter Brunnen bei Tiefbauarbeiten angeschnitten wurde. Her-bert Köppert (†) von den Görlitzer Heimat-forschern alarmierte umgehend die Archä-ologen der Städtischen Kunstsammlungen. Heiner Mitschke, Lutz Oberhofer (†) und Frank Schulze konnten das an der Straßen-seite der Parzelle gelegene Bauwerk bis in eine Tiefe von 6 m ausräumen (Abb. 1). Auf-grund des Wintereinbruchs erreichten die Ausgräber die Brunnensohle jedoch nicht. Die voranschreitenden Arbeiten an den Neubauhäusern Hugo-Keller-Straße 8–10 verhinderten eine Fortsetzung der Aus-grabungsarbeiten im folgenden Frühjahr, so dass die tieferen Bereiche des Brunnens
nach wie vor unversehrt im Boden ruhen. Dennoch konnten tausende Funde gebor-gen werden. Sie befi nden sich heute in der umfangreichen archäologischen Sammlung des Kulturhistorischen Museums.
Der überwiegende Teil der Objekte um-fasst Haushaltskeramik: Ausgesprochen repräsentative Trink- und Schenkgefäße sind ebenso vertreten wie eine bemerkens-werte Vielfalt von verschiedenartigem Kü-chengeschirr. Daneben fi ndet sich jedoch auch technische Keramik wie Schmelztie-gel mit dreieckiger Mündung unterschied-licher Größe und sogar Destillierhelme. Die vornehmlich aus grünlichem Waldglas und cristallo produzierte Gläser decken das Spektrum der Tafel- und Vorratsgläser ebenso ab wie Objekte medizinischer Verwendung (Urinale) oder Flachgläser ehemaliger Fenster. Knochen und Mu-scheln gelangten wohl als Schlacht- und Küchenabfall in die Verfüllung. Aus dem Umfeld von Handwerkern liegen Produk-tionsabfälle der Knopfherstellung vor. Schmiedetätigkeit wird durch kalotten-
Stefan Krabath und Jasper von Richthofen
Zeugnisse bürgerlicher Repräsentation:reich dekorierte Keramik wohlhabender Patrizier aus Görlitz1
Abb. 1Die Ausgrabung in der Hugo-Keller-Straße 1981
80
förmige Schlacken indiziert. Allerdings wurden die Gegenstände offensichtlich nicht willkürlich in dem Brunnen entsorgt, wie wir es aus zahlreichen entsprechenden Befunden kennen. Metallfunde, d.h. wieder verwendbare Rohstoffe, traten ausneh-mend selten zu Tage. Aus Kupferlegierung bestehen nur wenige Stücke: darunter der verlorene Zunftring eines Schmiedes mit Handwerkinsignien und dem Monogramm CVL und das Fragment eines Kerzenleuch-ters. Holz jeglicher Art fehlt, da es verfeuert oder wieder verwendet werden konnte. Brandschutt wurde bei der Ausgrabung nicht beobachtet. Ebenso wenig zeigen die Fundstücke eindeutige Brandspuren. Das Spektrum deutet auf eine Herkunft der Brunnenfunde aus einem Patrizier-haushalt sowie aus dem Umfeld eines Grobschmiedes, eines Knochenschnitzers und eines Alchemisten hin.
Im Mittelpunkt der vorliegenden Be-trachtung soll das repräsentative Tafelge-schirr stehen. Bei einer Gegenüberstellung des Görlitzer Komplexes und anderer reicher Fundensembles aus Dresden, Frei-berg, Leipzig oder Zwickau wird deutlich, dass in Görlitz in besonderem Maße qua-litätvolle Funde in den Boden gelangten, die andernorts bestenfalls als Einzelstücke überliefert wurden. Dies gilt sowohl für die Keramik als auch für die Glasfunde. Unter letzteren sind emailbemalte und diamant-gerissene Gläser überdurchschnittlich vertreten. Die Qualität sowie die überein-stimmende Datierung der Fundstücke in die Zeit um 1600 lassen als Hintergrund an eine Katastrophe denken, von der mehrere Bürgerhaushalte betroffen waren und in de-
ren Folge man den entstandenen Bruch in einem Zuge im Brunnen am einstigen Jü-denring, der heutigen Hugo-Keller-Straße, entsorgte. Im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges belagerten am 30. Oktober 1633 kaiserliche Truppen die Stadt. Dabei wurde durch Kanonenbeschuss im Bereich der nordwestlichen Stadtmauer eine Bresche geschlagen. Viele Häuser sollen verwüstet worden sein. Erneut wurde dieser offenbar besonders gefährdete Abschnitt der Stadt-befestigung im Zuge der Belagerung des Sommers 1641 niedergelegt. Spätestens jetzt wurden die unmittelbar hinter dem Durchbruch stehenden Bürgerhäuser zwischen Jüdenring und Langenstraße erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Belagerungsplan aus dem Jahre 1641 zeigt anschaulich das Ausmaß der damit einher gehenden Zerstörung (Abb. 2). Vielleicht steht also jene Katastrophe, in deren Folge die Bewohner verschiedener Parzellen ihre durch den Beschuss zu Bruch gegangenen Haushaltsgegenstände in den vermutlich unbrauchbaren Brunnen schütteten, mit den Kriegsereignissen in direktem Zu-sammenhang.
Im Haus Langenstraße 32, in unmit-telbarer Nähe des Fundorts lebte die Patrizierfamilie Hagedorn. Sie käme un-ter den Hausbesitzern des Quartiers am wahrscheinlichsten als Eigentümer der geborgenen Luxusartikel in Frage. Durch Kriegseinwirkung zerbrochenes Geschirr sowie beschädigte Kachelöfen konnten Ha-gedorns ohne aufwändige Transportwege in dem unweit des nachweislich ausge-dehnten Gartens der Familie gelegenen, vermutlich öffentlichen Brunnen entsorgen.
Abb. 2Beschießung der Stadt Görlitz 1641, Detail aus „Delineatio oder Abriß der Fürnehmen Stad Görlitz“ von Melchior Schlomachen und Sa-muel Weishun (1641).
81
Dieser befand sich straßenseitig am Haus Jüdenstraße 9 der Handwerkerfamilie Patke, gleich hinter der Stadtbefestigung. Nach den Geschossakten des Görlitzer Ratsarchivs scheint das Haus am Brunnen allerdings bereits bald nach 1630 „wüst gefallen“ zu sein. Zumindest verzeichnen die Akten letztmalig im Jahre 1630 den Eingang von Steuerzahlungen durch Hans Patke. Das Brunnen-Grundstück wurde erst 200 Jahre später wiederbebaut.
Malhorndekorierte Irdenware
Mit dem Begriff „malhorndekorierter Ir-denware“ wird eine Keramik beschrieben, die auf der Schauseite mit einem Malhorn aufgebrachte Dekore aus Tonschlicker trägt. Abschließend brachte man eine klare in Passagen auch grünliche Bleiglasur auf. Über hellbraunen bis gelblichen Engoben wurde die vornehmlich in konzentrischen Kreisen zonierten Malhorndekorationen in Braun-, Rotbraun und Grüntönen in Form von bräunlichen Strichen, Punkten, Kreu-zen, Halbkreisausschnitten oder anderen einfachen geometrischen meist linearen Dekoren aufgebracht (Abb. 3–4). Nur ver-einzelt sind dunkle Engoben mit gleicher Ornamentik zu beobachten.
Den überwiegenden Teil unter der mal-hornverzierten Keramik stellen fl ache For-men wie Teller von Miniaturausführungen
bis annähernd 40 cm Durchmesser dar. Ebenso stark vertreten sind unterschied-lich große Schalen. Seltener kommen hohe Formen wie Tassen mit Bandhenkeln vor. Um regelrechte Unikate handelt es sich demgegenüber bei einer Kanne oder Krug (Abb. 5) und einer kleine Fußschale und einer tierfömigen Aquamanile (Gießge-fäß) vielleicht in der Gestalt eines Löwen
Abb. 3Teller, malhorndeko-rierte Irdenware (EK 243-1984).
Abb. 4Teller, malhorndeko-rierte Irdenware (EK 246-1984).
Abb. 5Kanne/Krug, malhorn-dekorierte Irdenware (EK 85-1981).
82
(Abb. 6). Ersteres Gefäß zeigt zwischen ei-ner horizontalen Zonierung aus parallelen Linien alternierend rot- bzw. dunkelbraune stilisierte Pflanzen, die im komposito-rischen Gesamteindruck überwiegen,1 während das löwenförmige Aquamanile durch horizontale Linien bzw. Punkte und Striche geziert wird.
Die gesamte Gruppe der Görlitzer mal-horndekorierten Irdenware besitzt einen stilistisch einheitlichen, geschlossenen Charakter. Eine regionale Produktion in der Oberlausitz oder in Niederschlesien er-scheint daher am wahrscheinlichsten. Für eine lokale Zuweisung fehlen allerdings eindeutige Funde wie beispielsweise hier-für charakteristische Fehlbrände aus dem Pro duktionsmilieu. Der unzureichende For schungsstand der sächsischen, schle-sischen und böhmischen Töpfereien2 er-schwert darüber hinaus eine nähere lokale Auseinandersetzung mit dem Fundstoff.
Das Malhorndekor kommt in Mitteleu-ropa während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Mode und hält sich bis
in das erste Drittel des 17. Jahrhunderts, womit eine Datierung des Komplexes in die Zeit um 1600 gegeben ist.3
Glasierte Irdenware
Zu den glasierten Irdenwaren zählen all-gemein das Haushaltsgeschirr sowie die ebenfalls reich im Brunnenfund überliefer-te Ofenkeramik. Erwähnt werden soll die große Varietät des Gesamtspektrums, das sich mit folgenden Gefäßformen darstellt: Teller, Schüssel, Schalen, Waschbecken, Wandbrunnen, Krüge, Becher mit kegel-stumpfförmige Fuß und glockenförmiger Kuppa, Vexiergefäße, Tassen, Kannen, Koch- und Vorratstöpfe, Dreibeintöpfe, Pfannen, Kerzenleuchter, Öllampen, Dosen, Wärmeschalen und sogar Sparschweine, um nur die wichtigsten Formen zu nen-nen. Die Glasuren kommen in den Farben grün, gelb, braun, violett und blau vor. Ge-fäße mit gemodelten Applikationen können einfarbig glasiert sein, teilweise wurden die Applikationen durch eine dunklere Engo-be farblich vom Umfeld abgesetzt. Seltener sind polychrome Glasuren. Die Gefäße aus Irdenware machen bezüglich Qualität der Ausführung, Farbe des Scherbens und Spuren der Nutzung einen uneinheitlichen Gesamteindruck. Neben einer lokalen Pro-duktion lassen sich somit auch regionale und überregionale Provenienzen wahr-scheinlich machen. Der überwiegende Teil der Keramik dürfte allerdings in Görlitz her-gestellt worden sein. Demgegenüber sind aufwändigere Gefäße wohl durch Handel
1 Vgl. im Gegensatz dazu Funde aus Dresden mit deutlich abweichendem Dekor auf dunklem Grund, 16. Jh: Harald W. Mechelk, Waldenburger Hafner-ware aus dem Stadtkern Dresden. In: Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte [Festschrift für Werner Coblenz], Teil 2. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpfl ege, Beiheft 17, Berlin 1982, 347–359, hier: 351, Abb. 4.
2 Vgl. die wenigen Stücke bei Vladimir Scheufl er: Lidové hrnčířství v českých zemích [Volkstümliche Töpferei in den Böhmischen Ländern], Prag 1972, und bei Hedvika Sedláčková: Renesanční Olomouc v archeologických nálezech. Sklo, slavnostní kera-
mika a kachle. Archeologické výzkumy Památko-vého ústavu v Olomouci 1973–1996 [Renaissance Olomouc in Archaelogical Finds. Glass, Festive Ceramics and Tiles. Archaeological Research of the Institute of Landmark Conservation in Olomouc 1973–1996], Olmütz 1998.
3 Hans-Georg Stephan: Die bemalte Irdenware der Renaissance in Mitteleuropa. Ausstrahlungen und Verbindungen der Produktionszentren im gesamteuropäischen Rahmen. Forschungshefte des Bayerischen Nationalmuseums München 12, 1987.
Abb. 6Aquamanile mit Mal-horndekoration (EK 70/80-1981).
83
an die Neiße gelangt. Einige der glasierten Irdenwaren zeigen deutliche Affi nitäten zu Bodenfunden aus Schlesien, Böhmen und Franken. Eine Gruppe applikationsbesetz-ter Irdenware-Gefäße weist Josef Horschik der Waldenburger Glasurtöpferei zu.4 Ähn-lichkeiten dieser Produkte sind auch in der Görlitzer Brunnenverfüllung auszumachen. Erst eine Detailuntersuchung wird hier al-lerdings nähere Einzelheiten klären. Ähn-lichkeiten zu Modelapplikationen auf Stein-zeugen aus Triebel/Trzebiel bei Sorau/Żary bzw. Bad Muskau, lassen mutmaßlich auf eine Entstehung in den dortigen Töpfereien schließen. Ein Krug (EK 88-1981) mit schrä-gen Linien in grüner violetter Verlaufsglasur könnte mutmaßlich aus dem mittelschle-sischen Brieg/Brzeg stammen.5
Krug mit zylinderförmigem Hals, Band-henkel und abgesetztem Fuß (Abb. 7), Höhe: 19,4 cm, rötlicher Scherben, blei-glasiert, auf der Schulter drei runde Me-daillons mit Blattkranz: Maskaron einzeln
und Lamm Gottes mit antikisierendem Herrscherporträt direkt neben einander. Auf der Schauseite gegenüber dem Henkel ein Mann in vornehmer spanischer Tracht mit Mantel, kurzen Hosen, Gamsbauch und Halskrause. In der linken Hand trägt er eine Fahne, die auf seiner Schulter aufl iegt. Als Vorbild für das Model diente ein Stich des Niederländers Hendrik Goltzius (* 1558, † 1616) aus dem Jahre 1587.6 Goltzius gehört zu den bedeutendsten niederländischen Graphikern der Zeit um 1600, dessen druckgraphisches Œuvre in weiten Teilen Europas Verbreitung fand. Das gleiche Model wurde auch für Steinzeug-Applika-tionen des Görlitzer Fundes genutzt (vgl. Gefäß EK 219-1984).
Krug in Bärenform (Vexiergefäß?), (Abb. 8), erhaltene Höhe: 12 cm, über einem pla-nen Boden erbebt sich die vollplastische Hohlform eines sitzenden Bären, Hinterläufe im Fußbereich angedeutet, Vorderläufe halten ein Wappenschild (abgebrochen), außen Bewurf aus scharfkantigen Quarz(?)
4 Josef Horschik: Die Waldenburger Glasurtöpferei des 16. und 17. Jahrhunderts. Keramos 79, 1978, 31–56.
5 Vergleichbare Funde werden bei Konrad Strauss: Schlesische Keramik. Studien zur deutschen
Kunstgeschichte 254, Straßburg 1928, 20 f. be-schrieben.
6 Gundula Wolter: Die Verpackung des männlichen Geschlechts. Eine illustrierte Kulturgeschichte der Hose, Marburg 1991, 104, Abb. 132.
Abb. 7Krug, glasierte Irden-ware (EK 64-1981)
Abb. 8Gesandelter bären-förmiger Krug (EK 90-1981)
84
stücken, fl ächig grün glasiert, innen gelbe Bleiglasur. Bärenförmige Gefäße gehören unter den Gefäßen der Renaissance zu den großen Seltenheiten.7 Am ähnlichsten er-scheint das Exemplar in einer ehemaligen Schlesischen Privatsammlung.8 Die Sande-lung der Gefäßoberfl äche erfreute sich ho-her Wertschätzung. Dieser Umstand wird dadurch deutlich, dass gesandelte Gefäße mit edlen Tafelgläsern, wertvollem Besteck und Steinzeug zusammen in Stillleben der Zeit um 1600 bei Georg Flegel (* 1566, † 1638) wiedergegeben werden.9 Die Her-kunft des Görlitzer Einzelstücks erscheint aufgrund der schlechten Forschungslage unbestimmt. Glasurüberzogene Sandan-würfe fi nden sich auch bei Stücken aus der Straubinger Renaissance-Töpferei und bei Wiener Bodenfunden,10 ohne dass ein
direkter Bezug zu Görlitz hergestellt werden kann. Vielleicht kommen Schlesien oder auch Franken (Nürnberg?) als Herkunft in Betracht.
Wandbrunnen
Wandbrunnen sind zumeist quaderför-mige Wasserkästen, die in speziell dafür gefertigten, hohen schmalen Schränken bürgerlicher Haushalte ihren Platz fanden. Zwei seitlich angebrachte Haken dienten zur Befestigung. Über einen kleinen Zapf-hahn konnte Wasser zum Waschen der Hände in eine darunter stehende Schale fl ießen. Dieses Waschgeschirr löste im aus-gehenden Mittelalter die Lavabogefäße ab. Ausführungen aus Bronze und Zinn sind ebenso bekannt wie keramische Arbeiten. Besondere Beliebtheit besaßen diese Waschgarnituren während der Renais-sance und dem Frühbarock. Spätformen des Rokoko wurden in Norddeutschland aus Fayence gefertigt. In den Alpenländern benutzte man Zinnausführungen noch bis in das 19. Jahrhundert. Zwei solcher Wandbrunnen treten im Görlitzer Fundma-terial auf (Abb. 9). Die rechteckigen Kästen besaßen ursprünglich ein zum Befüllen ab-nehmbares Walmdach. Alle bleiglasierten Schauseiten zeigen plastisch gemodelte Darstellungen aus dem Alten und Neuen Testament in einer architektonischen Rahmung: Kreuzigung bzw. Auferstehung Christi, eherne Schlange am Kreuz, Judith in Renaissancetracht. Ihre große Affi nität zu den Ofenkacheln lässt an eine Verwen-dung von Kachelmodeln für die Dekoration der Kastenseiten denken. In einem Fall fi ndet sich das Motiv der Schmalseite eines
7 Töpfereikomplex Straubing in Niederbayern, zwei-te Hälfte 16. Jahrhundert (Werner Endres: Strau-binger Renaissancekeramik. Sonderausstellung Gäubodenmuseum Straubing 17. November 2005 bis 19. März 2006. Katalog des Gäubodenmuseums Straubing 30, Straubing 2005, 113, Abb. 74–75); Rastal-Sammlung, Höhr-Grenzhausen, Wester-waldkreis (Uwe Chr. FINKE: Rastal-Sammlung histo-rischer Trinkgefäße. „Drinck mich avs vnd schenck mich ein“ … Trinkgefäße aus fünf Jahrhunderten
[Ausstellungskatalog Höhr-Grenzhausen 1991], Höhr-Grenzhausen 1991, 81, Kat.-Nr. 125).
8 Strauss (Anm. 6), Taf. L.266 [Datierung 18. Jahr-hundert bedarf der Korrektur].
9 Kurt Wettengl: Georg Flegel 1566–1638. Stilleben, Stuttgart 1999, 95 f., Kat.-Nr. 15–16.
10 Endres (Anm. 8), 80, Abb. 31; Alfred Walcher von Molthein: Hafnergeschirr der Renaissance. Die Gruppe der Gefäße mit Sandanwurf. Belvedere 7, 1925, 71–79.
Abb. 9Wandbrunnen, glasierte Irdenware (EK 63-1981).
85
der Wandbrunnen modelgleich auf einer Ofenkachel aus demselben Fundkomplex (EK 251-1984).
Wandbrunnen (Abb. 9), Höhe: 27,5 cm, hochrechteckiger Quader, Schauseiten grün bleiglasiert, innen vollständig gelb bleiglasiert, Deckel fehlt. In der Ebene der Rückwand zwei seitlich hervorstehen-de Wandhaken (abgebrochen). Oberer Abschluss der Vorderseite gewellt mit Ritz- und triangulärem Einstichdekor. Auf der breiten Vorderseite unter einer architektonischen Rahmung im Zentrum eine Kreuzigungsszene mit krönender In-schrift „JNRI“, Lendenschurz Christi nach rechts wehend, im Zentrum unter dem Kreuz ein Loch für einen Konushahn zur Entnahme von Wasser, links des Kreuzes die Darstellung von Abraham in reichem Renaissance-Gewand, der den vor ihm knienden Isaak opfern will, ein Engel verhindert die Ausführung der Tat, indem er das erhobene Schwert Abrahams mit beiden Händen festhält. Gegenüber auf der anderen Seite des Kreuzes die Darstellung der Ehernen Schlange, die sich um den waagerechten Balken eines Taukreuzes schlängelt, der bärtige Moses – frontal dem Betrachter zugewandt – weist mit seiner erhobenen Rechten auf die Schlange. Auf der anderen Seite des Kreuzes kniet eine weibliche Person, die die Schlange anblickt und überlebt, während am Boden ein Ungläubiger in reicher Schlitztracht der ersten Hälfte bis Mitte des 16. Jahrhun-derts im Vordergrund stirbt. Eine weitere weibliche Person in Zeittracht blickt die Schlange an. Die beiden alttestamentlichen Szenen galten seit dem späten Mittelalter
als Sinnbilder für die Kreuzigung Christi. Auf den modelgleichen Seitenflächen des Wandbrunnens in architektonischer Rahmung ein Karyatide. Die Darstellung der Kreuzigung mit den Präfi gurationen von Eherner Schlage und Opfer Abrahams gehört zu den populären Darstellungen der späten Gotik und der Renaissance und fi ndet sich ebenfalls an der Fassade des so genannten Biblischen Hauses in der Görlitzer Neißstraße 29 wieder. Eine Datierung des Wandbrunnens in die erste Hälfte bis Mitte des 16. Jahrhunderts wird insbesondere durch trachtgeschichtliche Details der Figuren gestützt. Abrahams Opfer wird in gleicher Ikonographie noch um 1600 als Gefäßapplikation genutzt.11 Darstellungen an Kachelöfen, den soge-nannten Reformationsöfen, sind relativ häufi g. Die annähernd gleiche Darstellung der Frontseite fi ndet sich an einem im niederösterreichischen Schloss Grafeneck bei Krems befi ndlichen Kachelofen und als polychrom glasierte Kachel im Museum für Kunsthandwerk, Dresden.12 Alfred Walcher von Molthein gelang es überzeugend, ein Model mit annähernd identischer Darstel-lung dem Töpfermeister Hans Vinck aus Wels in Oberösterreich zuzuweisen, der nachweislich im Jahre 1552 verstarb.13
Polychrom glasierte Irdenware
Die wohl prächtigste Fundgruppe aus der Hugo-Keller-Straße bildet ein stilistisch ein-heitliches Ensemble polychrom glasierter und mit Modeln reich geschmückter Irden-ware. Zum überlieferten Formenvorrat ge-
11 Vgl. Bodenfund aus Olmütz (Sedláčková (Anm. 3), 92, Kat.-Nr. 17.1-1 [spätes 16. bis frühes 17. Jh.]).
12 Klaus-Peter Arnold: Deutsche Keramik aus fünf Jahrhunderten. Museum für Kunsthandwerk im Schloß Pillnitz [Ausstellungskatalog], Dresden 1984, 14–16, Kat.-Nr. 15; Rosemarie Franz: Der Kachelofen. Entstehung und kunstgeschichtliche Entwicklung vom Mittelalter bis zum Ausgang des Klassizismus, Forschungen und Berichte des Kunsthistorischen Instituts der Universität Graz 1, Graz 1969, 84, Abb. 209 [dort falsche Standortangabe].
13 Alfred Walcher von Molthein: Bunte Hafnerkeramik der Renaissance in den österreichischen Ländern ob der Enns und Salzburg bei besonderer Berück-sichtigung ihrer Beziehungen zu den gleichzeiti-gen Arbeiten der Nürnberger Hafner, Wien 1906, 71–74, Abb. 119, vgl. auch ein ähnliches Motiv in der ehemaligen Sammlung Adalbert von Lanna, Prag (Julius Leisching: Sammlung Lanna, Prag. Band 1. Auktionskatalog Rudolph Lepke, Nr. 1559, Leipzig 1909, 33 f., Kat.-Nr., 542, XIX f., Abb. 8).
86
hören eine Fußschale (Abb. 10), ein Pokal, ein Bienenkorbhumpen, ein kugelförmiger Ofenaufsatz sowie ein bauchiger Krug (Abb. 11). Alle Stücke stehen hinsichtlich des Scherbens und der handwerklichen Ausführung stilistisch sehr eng nebenei-nander. Charakteristisch erscheinen die
leicht ineinander verlaufenden Glasuren. Die gleichen Glasurfarben grün, violett, weiß und gelb, annähernd identische Zierbänder und wohl auch annähernd glei-che Modeln sprechen für die Entstehung in einer Werkstatt. Die Model stammen sowohl aus sakralem als auch aus dem profanem Kontext. Im Jahre 1904 wurde in Glogau/Głogów ein umfangreicher Fund von Modeln zusammen mit Töpfereiabfall geborgen. Mit Hilfe der Modelabdrücke ge-lang es Konrad Strauss einige überlieferte polychrom glasierte Gefäße der Glogauer Werkstatt zuzuweisen. Dazu gehört ein Krug in der Sammlung des Grafen Johann Nepomuk Wilczek (* 1835, † 1922) auf Burg Kreuzenstein bei Korneuburg (Nie-derösterreich).14 Dieses Gefäß entspricht in vielen Einzelheiten dem Görlitzer Fund. Die zentrale Sündenfallapplikation sowie die blütenförmigen Medaillons sind offen-bar identisch, so dass auch die Görlitzer Gefäße einer Glogauer Produktion zuge-wiesen werden können. In der New Yorker Sammlung von Ruth Blumka befi ndet sich ein weiterer Krug mit identischer Sünden-fallszene.15 Als Datierung kommt die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts in Betracht.
Die bichromen Zierzonen aus geome-trischen Elementen, wie sie an den Görlit-zer Gefäßen beobachtet werden können, fi nden sich in leicht abgewandelter Form auch an einem Schlesien zugeschriebenen Teller aus der ehemaligen Sammlung des Freiherrn Adalbert v. Lanna (* 1836, † 1909) in Prag.16 Die fl ächigen Blattranken der Taz-za (Fußschale) mit der charakteristischen Ausführung kleiner Blätter stehen einem inschriftlich in das Jahr 1554 datierten Teller im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe nahe, der ebenfalls nach Glogau gewiesen wird.17 Beide angeführten
14 Walcher von Molthein (ebd.), 7, Abb. 12, Taf. III; Konrad Strauss: Glogauer Hafnerkeramiken der Renaissance. Mitteilungsblatt der Keramikfreunde der Schweiz 76, 1968, 5–11. hier: Abb. 25.
15 Konrad Strauss: Neue Beiträge zur Hafnerkeramik der Renaissance in Schlesien. Keramos 50, 1970, 147–154. hier: 152, Abb. 6.
16 Leisching (Anm. 14), 34, Nr. 552, XVII, Abb. 4; Erich Meyer-Heisig: Deutsche Bauerntöpferei. Geschich-te und landschaftliche Gliederung, München 1955, Farbtafel II.
17 Hermann Jedding: Volkstümliche Keramik aus deutschsprachigen Ländern. Bilderhefte des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg 13, Hamburg 1976, 109, Kat.-Nr. 54 mit 70, Abb. 54.
Abb. 10Polychrom glasierte Fußschale (EK 84-1985)
87
Exemplare zeichnen sich jedoch durch eine wesentlich sauberere Ausführung der Gla-suren aus. Unter den seltenen Bodenfunden ist ein Krug aus Brünn/Brno (Tschechien) zu erwähnen:18 Auf dem Bauchumbruch verläuft ein geritztes, breites Band aus grün bzw. violett glasierten Dreiecken, das neben den applizierten Blättern stilistische Parallelen zu den Görlitzer Funden auf-weist. Die kannelierte Fußbildung und die plastischen Aufl agen der Sündenfallszene weichen allerdings deutlich ab, trotzdem könnte das Gefäß aber zu der Glogauer Gruppe gehören.
In der Oberlausitz liegen bislang nur aus dem Töpfereibezirk von Bischofs-werda polychrom glasierte und geritzte Scherben vor, jedoch handelt es sich bei den wenigen überlieferten Stücken nicht um eindeutige Fehlbrände, so dass eine Produktion in Bischofswerda nicht nach-zuweisen ist.
Fußschale (Tazza) (Abb. 10), Durchmesser der Schale: 27 cm. Der fl ach-kegelstumpf-förmigen Fuß mit Dekor aus geritzten weiß bzw. violett glasierten Parallelogrammen geht in einen Nodus mit gleichem Dekor über, bevor sich darüber ein nach oben leicht verjüngter, grün glasierter Schaft erhebt, der in eine fl ache auf der Unterseite vollständig plastisch gemodelte Schale über-geht. Die polychrom glasierte Schale trägt beidseitig plastische aufgelegte Dekore. Auf ihrer Unterseite fi nden sich ausschließlich Blattranken und Voluten, während die Innenseite mit verschiedenen Medaillons besetzt wurde. Um einen schlecht gemo-delten Spiegel mit fünfteiligem Wappen reihen sich auf den erhaltenen Randpartien die Darstellung von Adam (?) aus einer Sündenfallszene, eine stilisierte Sonne, eine Putte, die zwei Wappenschilde stützt sowie eine weibliche Darstellung mit Gefäß in der rechten Hand. Vereinzelt fi nden sich blütenförmige Applikationen und Blätter. Der Buchstabe L könnte Teil von Initialen des Töpfers darstellen, wie sie an dieser Keramikgruppe häufi ger belegt sind.
Steinzeug
Der Fundkomplex aus dem Görlitzer Brun-nen wird gekennzeichnet durch eine Viel-zahl hochwertiger und reich mit Reliefzier versehener Steinzeuggefäße. Kannen mit runder Tülle, Krüge und verschiedenartige Humpen, durchweg Trink- und Schenk-gefäße für alkoholische Getränke, stellen darunter die häufi gsten Gefäßformen dar. Seltener treten so genannte Butterdosen mit zugehörigen Deckeln auf. Eine der Tüllenkannen wurde möglicherweise als Kinderspielzeug als Miniaturform gefertigt und trägt deutlich für größere Gefäße be-stimmte Reliefapplikationen (Abb. 12).
Abb. 11Polychrom glasierter Krug (EK 100-1984)
88
Das geborgene Steinzeug besitzt unter-schiedliche Farben: Zu beobachten sind glänzende und matte Farben. Braun- und Grautöne sind zu beobachten. Die Her-kunft einiger Tüllenkannen aus Triebel/Trzebiel kann durch charakteristische Applikationen wahrscheinlich gemacht werden (Abb. 13), die identisch auf dort ge-borgenen Bodenfunden auftreten. Solche Verzierungen fi nden sich durchweg auf grauem und dunkelbraunem Steinzeug, so dass diese Provenienz wohl auch für beide Warenarten ohne entsprechende Applikationen zu vermuten ist. Eine genaue Unterscheidung der bekannten Töpferzentren von Triebel und Muskau im Hinblick auf die hergestellten Waren-arten erscheint aufgrund des derzeitigen Forschungsstandes leider noch nicht gegeben. Aus der Hand Muskauer Töp-fer werden hingegen Gefäße etwa mit
Kieselzier, kanneliertem Fuß, flächiger kobaltblauer Glasur oder Kerbschnittro-setten stammen. Höchstwahrscheinlich wird sogar der überwiegende Teil des im Brunnen geborgenen Steinzeugs dort hergestellt worden sein.
Zwei Butterdosen (Abb. 14), eine Verkantfl asche mit dunkelbraunen Bee-rennuppen und Ritzdekor sowie ein Krug gelangten wohl aus dem westsächsischen Waldenburg an die Neiße. Steinzeug ohne Reliefverzierungen weist häufi g schräge Streifen in blauer Pinselbemalung auf. Für diese sind graue und braune Farbtöne der Gefäßaußenseiten kennzeichnend.
Der überwiegende Teil aller Steinzeu-ge trägt Ascheanfl ug- oder Salzglasuren. Die Henkel der Gefäße sind ausnahmslos
Abb. 12Miniaturkrug aus Steinzeug (EK 194-1984)
Abb. 13Charakteristische Reliefapplikation aus Triebel/Trzebiel (EK 204-1984)
Abb. 14Steinzeug-Butterdose aus Waldenburg (EK 71-1981)
Abb. 15Steinzeug mit kur-sächsischem Wappen, Detail (EK 299-1984)
89
zerbrochen, was darauf schließen lässt, dass ursprünglich zweifellos vorhandene, wertvolle Zinnmontierungen wie beispiels-weise Deckel vor der Entsorgung entfernt wurden.
Das häufi g zu beobachtende kursäch-sische Wappen als Reliefapplikation stellt kein Indiz für eine Produktion der Keramik in Sachsen dar (Abb. 15), da auch in an-deren wichtigen Herstellungszentren für Steinzeug und Irdenware gleiche Wappen aufgebracht wurden: Hier zu nennen sind Gefäße aus dem Rheinland (Siegburg),19 Duingen, Ldkr. Hildesheim,20 und Großal-merode, Werra-Meißner-Kreis21 sowie Ir-denware aus Hannoversch Münden, Ldkr. Göttingen.22 Vielmehr orientiert sich das durch den Töpfer verwendete Dekor offen-bar am Geschmack potentieller Abnehmer. Leider erlaubt der Vergleich verschiedener Wappenapplikationen unterschiedlicher Töpferzentren auch keine Rückschlüsse auf die Verwendung und Verbreitung identischer Model, die vielleicht von ein und demselben Formschneider bezogen wurden. Die außerdem gelegentlich an den Applikationen auftauchenden Jah-
reszahlen gestatten bedauerlicherweise ebenfalls keine exakte Datierung der Pro-duktionszeit. An den Görlitzer Steinzeug-gefäßen beobachtete Zeitangaben streuen über rund ein halbes Jahrhundert von 1561 (Abb. 16) über 1599 (EK 78-1981) bis 1607 (Abb. 17). Ein Krug aus dem Auktionshaus Vogt mit der Modeldatierung 1545 und der geritzten Datierung 1626 führt deutlich vor Augen wie lange die Model einer Werkstatt in Verwendung blieben.23 In synoptischer Zusammenschau aller Funde kann jedoch konstatiert werden, dass die Herstellung der Funde aus dem Brunnen in der Gö-rlitzer Hugo-Keller-Straße wohl in den Zeitraum von der Mitte des 16. bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts datiert.
Offenbar wurden die Steinzeuge und die Irdenwaren wenigstens teilweise von identischen Töpfern bzw. Werkstätten
18 Čižmář, Miloš, Kateřina Geislerová (Hrsg.): Ústav Archeologické památkové péče Brno. Výzkumy 1999–2004, Brünn 2006, 74, Abb. o. Nr.
19 Ekkart Klinge: Siegburger Steinzeug. Kataloge des Hetjens-Museum Düsseldorf,Düsseldorf 1972, Kat.-Nr. 278.
20 Horst Löbert: Das verzierte Steinzeug aus Duingen, Kreis Alfeld. Studien zu seiner Entwicklung seit dem 16. Jahrhundert und zu seinen Beziehungen zu den deutschen Steinzeugzentren, insbesondere zu den rheinischen Herstellungsorten. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 5, 1977, 7–95, hier: Abb. 17.148, 17.150 und 17.154.
21 Hans Georg Stephan: Großalmerode. Ein Zentrum der Herstellung von technischer Keramik, Stein-
zeug und Irdenware in Hessen. Die Geschichte der keramischen Gewerbe in Großalmerode und die Entwicklung ihrer Produktion vom 12 bis zum 19. Jahrhundert. Teil I, 1986, 185, Abb. 135.4.
22 Hans Georg Stephan: Archäologische Unter-suchungen im Töpferviertel von Hannoversch Münden. Neue Entdeckungen und Erkenntnisse zur frühneuzeitlichen Keramik. Ein Vorbericht über die Ergebnisse der Grabung im Jahre 1979. Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 16, 1983, 363–386, hier: Taf. 116.2–3.
23 Kat. Vogt: 25. Spezialauktion Historische Trinkgefä-ße. Johannes Vogt Auktionen, München, München 2006, Kat.-Nr. 92.
Abb. 17Steinzeugkanne (Detail) mit Schriftfeld „Jacob Scholtz 1607“ (EK 197-1984).
Abb. 16Steinzeugkanne, modeldatiert 1561 (EK 220-1984)
90
24 Andreas Becke: Auf der Suche nach den Töpfern des „Freiberger“ und „Annaberger“ Steinzeugs. Nearchos 1. In: Beiträge vom 25. Internationalen Hafnerei-Symposium in Lienz/Osttirol 1992, hrsg. von Werner Endres, Konrad Spindler, Innsbruck 1993, 99–123; Josef Horschik: Steinzeug 15. bis 19.
Jahrhundert. Von Bürgel bis Muskau, 3. Aufl age, Dresden 1990.
25 Erki Russow: Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.–17. Sajansdil [Imported pottery in West Estonian towns between the 13th and 17th centuries], Tallinn 2006.
hergestellt, da an beiden Warenarten Reli-efapplikationen übereinstimmender Model auftreten. Somit lässt sich das Spektrum der in Triebel oder Muskau um 1600 her-gestellte Keramiken anhand der Görlitzer Funde mit Tüllenkannen und Krügen evtl. auch Humpen gut umreißen, wobei die Krüge sowohl aus Irdenware als auch aus Steinzeug gefertigt wurden.
Steinzeug mit gemodeltem Reliefdekor wird seit der zweiten Hälfte des 16. Jahr-hunderts in mehreren Orten Sachsens und Schlesiens hergestellt. Weit geschätzt wurden die Erzeugnisse aus Waldenburg und anderer westsächsischer Produkti-onszentren, die auch mit einigen Gefäßen in Görlitz vertreten sind.24 Waldenburger Steinzeug fand seine Abnehmer bis in die baltischen Länder.25 Der überwiegende Teil des Görlitzer Steinzeugs hebt sich jedoch in der Ausführung der Applikationen und
ihrer gelegentlich unregelmäßigen An-bringung auf der Gefäßwandung deutlich vom Waldenburger Material ab. Die annä-hernd fl ächig aufgesetzten Darstellungen (Abb. 18) reichen von antikisierenden Herr-scherdarstellungen, Maskarons, Personen in Renaissance-Tracht z. B. ein Liebespaar, Heiligengestalten, teilweise mit Legende (z. B. St. Nikolaus), alttestamentlichen (Adam und Eva am Baum der Erkenntnis), neutestamentlichen Themen (Leben Chri-sti), Falken mit Schellenband und Wap-pendarstellungen bis hin zu Bouquets aus Gemüse, Blumen sowie Blumensträußen in Vasen. Die bildlichen Darstellungen gehen wohl in der Regel auf druckgraphische Vorlagen oberdeutscher Kleinmeister und niederländischer Künstler zurück. Die auf der Keramik applizierten Reliefs gehörten während der Renaissance zu einer weit verbreiteten Bilderwelt, die häufi g etwa
Abb. 18Krug mit fl ächig aufge-setzter Reliefapplika-tionen (EK 196-1984)
Abb. 19Steinzeug-Kanne mit Applikation „Jacob Scholtz“ (EK 197-1984).
91
26 Freundliche Mitteilung durch Christiane Thiele. 27 Strauss (Anm. 15); ders. (Anm. 16).
in der Architektur auftaucht. Kostümge-schichtliche Betrachtungen zeigen, dass Kleidung – insbesondere die spanisch beeinfl usste Mode – der zweiten Hälfte des 16. und des beginnenden 17. Jahrhunderts dominiert. Ausnahmen repräsentieren deutsche Renaissancetrachten der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Eine Kanne trägt den Namen Jacob Scholtz mit der Da-tierung „1607“ (Abb. 17, 19). Scholtz könnte sowohl der Auftraggeber als auch der Töp-fer des Gefäßes gewesen sein. In den Gö-rlitzer Geschossbüchern lässt sich ein aus Hennersdorf/Jędrzychowice stammender Mälzer namens Jakob Scholtz nachweisen, der von 1592 bis mindestens 1642 im Haus Krebsgasse 5 gelebt hat.26 Ob dieser aber als Auftraggeber des Kruges in Frage kommt, erscheint im Hinblick auf dessen gesell-schaftliche Stellung eher unwahrscheinlich. Der ja keineswegs ungewöhnliche Name Scholtz tritt unter anderem auch unter den Glogauer Töpfern auf.27
Tüllenkanne (Abb. 19), Höhe: 19,5 cm, braunes Steinzeug, durch zwei Wülste be-tonte konische Mündung, römisches Zah-lenmuster auf der Schulter, Bandhenkel, reiche Medaillonzier: unter der Tülle eine rechteckige Tafel, teilweise abgeplatzt mit dem Schriftzug „Jacob Scholtz / Bu[…]rm / 16 [anno do] m[in]i 07“ („domini“ als Ab-breviatur), Blumemotiv, Halbportrait eines Königs mit Krone und Szepter in Zeittracht, Adam und Eva am Baum der Erkenntnis, Löwe frontal, Atlas mit Fruchtkorb, Vase mit Blumenstrauß, Christus am Kreuz (weniger sorgfältig ausgeführtes Model), männliches Halbportrait, langhaariger Mann in langem Mantel (Jünger Jesu?), schreitender Vogel im Profi l, sechsblättrige Blüte. Grundform und Scherben weisen auf Bad Muskau oder Triebel als Produktionsort hin.
Zusammenfassung
Für die Herkunft der keramischen Erzeug-nisse kommen verschiedene Regionen in Betracht. Ein Großteil der Töpferwaren – insbesondere die einfach glasierten Ir-denwaren – dürften wohl in Görlitz selbst produziert worden sein. Der Töpferberg in der Neißevorstadt auf dem Ostufer der Neiße wird als Sitz der Töpfer erstmalig 1328 erwähnt. Leider konnten bislang dort keinerlei Fehlbrände als Produktionsabfall ansässiger Handwerksbetriebe nachge-wiesen werden, die die Vermutung einer regionalen Provenienz stützen. Jüngste Ausgrabungsfunde sind bislang noch unpubliziert. Stilistische Vergleiche lassen eine Entstehung der übrigen Irdenwaren und Steinzeuge in Triebel und Muskau sowie in einem Fall vielleicht in Brieg/Brzeg wahrscheinlich werden. Wenige Stücke wurden aus Waldenburg in Westsachsen importiert. Aufwändigere Irdenwaren stam-men hingegen wohl aus Glogau/Głogów.
Stilgeschichtliche und inschriftliche Datierungen legen eine Entstehung des reichen bürgerlichen Hausrats in der zwei-ten Hälfte des 16. und dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts nahe. Formen des fortgeschrittenen 17. Jahrhunderts fehlen. Somit wird die anfangs geäußerte Hypothe-se einer Verfüllung des Brunnens während des Dreißigjährigen Krieges gestützt, wenn auch nicht zweifelsfrei bewiesen.
Die hinsichtlich ihres Dekors hohe Qualität der Keramik und der Reichtum an verschiedenartigen Gefäßen lassen den Görlitzer Fundkomplex als eines der wohl bedeutendsten Fundensembles der Renaissance zwischen Elbe und Neiße er-scheinen. Eine Aufarbeitung und adäquate Publikation des Komplexes erscheint sehr wünschenswert.