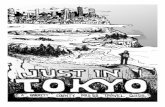Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück? Eine Replik auf Nicole Deitelhoff und Lisbeth Zimmermann
Urbanes Gehen: Berlin/Tokyo – Erste Schritte zu einer Bewegungsanalyse des Einkaufen-Gehens
Transcript of Urbanes Gehen: Berlin/Tokyo – Erste Schritte zu einer Bewegungsanalyse des Einkaufen-Gehens
Kai van Eikels
Urbanes Gehen: Berlin/Tokyo - Erste Schritte zu
einer Bewegungsanalyse des Einkaufen-Gehens
Es gibt, wie mir scheint, zwei Aufmerksamkeitsniveaus in unserer Weise, das Gehen zu kennen. Das
eine impliziert eine ästhetische Rahmung, eine Bühne oder Szene, auf der jemand geht: die Szene des
Tanzes, des Theaters, der Performance. Diese Beobachtung erfasst das Gehen vom Schrirf aus,
Sie vermag sich eigens auf das Gehen zu konzentrieren dank der besonderen Prägnanz des Schrei-
tens. Das schreitende Gehen ist immer schon mehr als blosses Gehen - es ist ein sich äusserndes
Gehen, nicht allein der Fortbewegung dienend, sondern darüber hinaus (oder: zu allererst) dazu
bestimmt, ais so/ches hervorzutreten. ln der Form des Schrittes hat das Gehen ein dramaturgisches
Profil, einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Es beginnt mit einem Auftritt, einem Einsatzzur Erwek-
kung der Achtsamkeit; es unterhält eine Dauer, ein gespanntes lntervall, und beherbergt am Scheitel-
punkt jeder Schrittkurve einen Moment der lnstabilität, in dem die Möglichkeit des Schwebens sich
ebenso andeutet wie die des Fallens; und es endet mit einem Abrollen, einem Auslaufen oder Anhal-
ten, jedenfalls mit etwas, was aus der Schrittfolge einen Gang macht.l Das Wo (Woher, Wohin) und
das Wie des Gehens verweisen auf Entscheidungen, die das Gehen gestalten. Wenngleich ein Gang
auf einer ästhetischen Szene improvisiert sein mag, rekonstruieren die Zuschauer unablässig die
künstlerischen Entscheidungen, die dieser Spontaneität zugrunde liegen, und der Gehende selbst
kann nicht umhin, sich im Nachhinein an dieser Rekonstruktion zu beteiligen, wenn er sich fragt, was
er da getan hat. Es ist dies eine Eigentümlichkeit unserer Vorstellung des Entscheidens: Man kann
während des Gehens reden, plaudern, etwas erörtern, über etwas verhandeln - doch um eine Ent-
scheidung zu treffen, bleibt man stehen.2 Diese Vorstellung betrifft auch das Gehen selbst: Sofern wir
davon ausgehen, dass die Bewegung des Gehens durch eine bewusste Entscheidung bestimmt ist,
lokalisieren wir diese Entscheidung in der Unterbrechung des Gehens, in der tatsächlichen oder ima-
ginären Zäsur zwischen den Schritten. Tanz, Theater und Performance sind auch deshalb die Domä-
ne der bewussten, gestalteten Bewegung, weil Bewegung hier sozusagen aus ihrer Unterbrechung
hervorgeht.
Demgegenüber möchte ich mich mit dem zweiten, wie man allgemein annimmt, niedrigeren Aufmerk-
samkeitsniveau beschäftigen: dem alltäglichen Gehen. Auch das alltägliche Gehen lässt sich ästhe-
tisch betrachten. Ein solcher Blick reisst es jedoch aus seiner Alltäglichkeit heraus und versetzt es auf
die Szene einer hypothetischen Performance. Dort wo das Gehen wirklich alltäglich ist, wird es weder
durch einen Anfang noch durch ein Ende dramaturgisch gegliedert - und auch nicht durch ein Unter-
wegs-Sein, dessen Temporalität sich aus der Verschränkung von Retentionen und Protentionen,
Bewegungserinnerung und Bewegungserwartung ergäbe. Das alltägliche Gehen ist auf ganzer Strek-
ke ein Weiter-Gehen. Das gilt besonders für den urbanen Alltag: Wer in der Stadt geht, ist nicht in
einem emphatischen Sinne unterwegs, sondern in einem lakonischen Zustand on the move. Anders als
die freie Gegend, die sich zwischen Dörfern auftut, bietet die städtische lnfrastruktur kaum lllustratio-
nen oder Symbole für ein lntervall zwischen Aufbruch und Ankunft. Städtisches Gehen ist in ein durch-
van Eikels 31
gängiges Währenddessen eingelassen, das sich vom Zwischen (dem Zeit-Raum des Schrittes) unter-
scheidet. Die Stadt schreitet man nicht ab, man läuft in ihr herum.
Das Einkaufen-Gehen verdeutlicht das eigentümlich dichte und zugleich unscheinbare, im Selbstver-
ständlichen komprimierte Währenddessen des urbanen Gehens besonders gut. Einkaufen-Gehen ist
etwas, was allein in der Stadt wirklich geht. lm Dorf kann man nur Besorgungen machen, und in der
Kleinstadt kann man darüber hinaus höchstens zum Einkaufen fahren. lch gehe Einkaufen meint im
urbanen Kontext etwas anderes als /ch mache Besorgungen Gehen und Kaufen sind beim Einkaufen-
Gehen in dieselbe flache, in sich selbst ein wenig verschobene Gegenwart verfügt, und diese Gegen-
wart lässt kaum Ansatzpunkte für eine Zäsurierung des Gehens erkennbar werden, an denen man eine
Kauf-Handlung von der Geh-Berazegung abtrennen könnte.
Der Augenblick des Kaufes ist daher in der Zeit des Einkaufen-Gehens eigentlich kein ausgezeich-
neter, hervorstechender Augenblick. Falls der Kauf nicht sehr spektakulär ausfällt, beherrscht das
Kaufereignis in meiner Wahrnehmung bzw. Erinnerung keinesfalls das Gehen: Auch nachdem ich
zuhause jene Dinge ausgepackt habe, die mir bald die einzige Dokumentation meiner Shopping-Exkur-
sion sein werden, bleibt das Gehen rückblickend ein Gehen. Das Gegangen-Sein verschwindet nicht
im Gekauft-Haben. Dies schon wegen der Erschöpfung, die sich in den Gliedern breit macht und dem
Gehen eine materielle Realität bescheinigt. Das Fehlen von Zäsuren, die einzelne Schritte isolieren,
bedeutet nicht, dass das Gehen sich beim Einkaufen in ein Fliessen verwandelt' Die urbane Bewegung
gerät keineswegs leichter als das Wandern über Land. lm Gegenteil hat das Durchqueren von städti-
schen Shopping-Zonen etwas Mühsames. Die Stadt als Medium ist von einer gewissen Zähigkeit, die
mehr mit Fülle als mit Distanz zu tun hat. Obgleich die zahlreichen Menschen, die sich durch die Ein-
kaufsviertel bewegen, mir nur selten wirklich in die Ouere kommen, scheint ihre Anwesenheit auf den
Strassen und in den Geschäften die Permeabilität der städtischen Luft herabzusetzen. lch arbeite mich
durch ein Labyrinth aus möglichen Kollisionen, und das kostet Kraft'
Gerade deshalb fällt es schwer, die folgende Frage zu beantworten:Wann und wie genau ist es beim
Gehen zum Kaufen gekommen? .Als ich noch eben zu XY rein gegangen bin, nur mal so, und da hatte
ich plötzlich diesen Pulli in der Hand..." Wann, wo und wie hat er stattgefunden, dieser Wechsel vom
Fuss in die Hand? lm Marketing-Diskurs spricht man mit einer gewissen Selbstverständlichkeit von der
*Kaufentscheidung". Lässt sich aber der Begriff der Entscheidung, der in unseren abendländischen
Konzepten des Handelns eine so grosse Bedeutung hat, auf eine Tätigkeit wie das Kaufen anwenden,
wenn es sich so nachhaltig dem Gehen anvertraut? Verdient es diese Tätigkeit überhaupt, ein Handeln
genannt zu werden?
ln unserer europäischen Begriffstradition gibt es einen klaren Status-Unterschied von Bewegung und
Handlung. Zwar ist jede Handlung auch eine Bewegung, aber es gilt keineswegs jede Bewegung als
Handlung. Man hat diese Unterscheidung mit wechselnden Akzenten behauptet und begründet:
Zunächst, exemplarisch in der griechischen Polis, durch die Abgrenzung eines öffentlichen Raumes,
der dem politischen Handeln, das eine Entscheidung trifft, der praxis, vorbehalten ist, vom privaten
olkos, dem Haushalt. Hannah Arendt hat beschrieben, wie die neuzeitliche Gesellschaft genau diese
32 van Eike s
Grenze auflöst: Privates wird öffentlich, Öffentliches privat. Das moderne Stadtleben stellt von Anfangan das Zentrum dieser ökonomischen Redetermrnierung der Öffentlichkeit dar, und die Bereiche, indenen sie zuerst und am vehementesten auftritt, sind die kommerziellen Zonen des Marktes und derEin kauf sviertel.
Ein zweites, für die Neuzeit bestimmendes Moment, das die besondere Würde der Handlung gegen-über der anspruchslosen Motorik der Bewegung sichern sollte, war die Bindung des Handelns an einstarkes Subjekt des Willens und der Verantwortung: Nur Bewegungen, die einem solchen Subjektzurechenbar sind, zählen; nur Bewegungen, die auf eine bewusste und im juridischen Sinne verant-wortbare Entscheidung verweisen, gebührt die Anerkennung als Handlung. Auch diesbezüglicherweist sich das Kaufen als prekär, denn der Akt des Kaufens führt das Subjekt offenbar im Augenblickeiner Schrazächevor: Als Käufer bin ich jemand, der Einflüssen ausgeliefert ist, auf Reize re-agiert, imKräftefeld von un- oder vorbewussten Manipulationen hin und her taumelt, zumal wenn ich nicht ziel-gerichtet etwas einhole, sondern in meinem Kaufverhalten der Eigendynamik des Ernkaufen-Gehensfolge. Obgleich der Kaufvertrag, der mit dem Wechsel von Geld und Ware zustande kommt, Käufer undVerkäufer als zwei gleichrangige, einander symmetrisch gegenüberstehende personen aufführt, mas-kiert oder kompensiert diese rechtliche Form eigentlich eine existenzielle Falle, in die eine lnstitution(der Verkäufer hat institutionellen Status) eine Privatperson (der Käufer ist nur dieser schutzlose, zuFuss ins Haus des anderen gekommene Körper) hineinlockt. Kaufen erscheint als die ohnmächtigsteoder depravierteste aller Aktivitäten: Entweder beugt der Käufer, der etwas braucht, sich der blossenNotwendigkeit des Lebens; oder er gehorcht dort, wo er etwas kauft, was er nicht braucht, dem lmpe-rativ des Kapitalismus, der sich selner in Gestalt gedankenvernebelnder Werbung oder durch die sub-tilen Bindungszwänge des custorner Relation Managemenf bemächtigt.
Wenn Kaufen für den mehr oder weniger begüterten modernen Stadtmenschen zu den Optionen sei-ner Bewegungsfreiheit gehört, so fällt es heute nichtsdestoweniger schwer, das als Gewinn an Frei-heit und nicht als Erhöhung von Fremdbestimmtheit aufzufassen. Unsere ex- und impliziten Theoriendes Handelns schliessen die Kaufhandlung durch eine Geringachtung, eine generelle Abwertung desKommerziellen aus. Nachdem der Mensch in unserer Gesellschaft weitgehend aufgehört hat zu tau-schen, beschränkt sich seine Teilnahme an der Transaktion, die innerhalb des ökonomrschen denBereich des Kommerziellen definiert, offenbar auf ein Ausführen, das sich an der Untergrenze dessenbewegt, was überhaupt noch als "handlungsförmig" wahrnehmbar ist. Trotz des weiter steigendenKonsumvolumens in den meisten der sog. uentwickelten" Länder ist die Emanzipation des Kaufaktesals handlungstheoretischer lmpuls erfolglos geblieben.3 Die geläufigen Wertvorstellungen in unsererGesellschaft verehren den Reichtum als Zeichen des Erfolgs; doch die Bilder, die Souveränität insze-nieren, indem sie Macht mit Luxus gleichsetzen, blenden gerade das Kaufen strukturell aus: Die Hal-tung des Gewinners besteht darin, sich etwas /ersfen zu können. Es kaufen zu müssen, impliziert da-gegen immer eine Niederlage, auch für die Erfolgreichen.
Souveränität' Zugang zu Handlungsfähigkeit, verheisst heute allein das Unternehmertum, der ent-schiedene Wechsel auf die Seite des Verkäufers.a Allenfalls zeichnet sich das Gegen-profil eines kriti-schen Verbrauchers ab, der Widerstand leistet gegen die Einflüsse und sich selbst beim Kaufen einMinimum an Entscheidungsfreiheit erkämpft. Von einem solchen kritischen Konsumenten darf man
van Eikels 33
indes am wenigsten erwarten, dass er Einkaufen gehr. Das kritische Bewusstsein erfordert hier (wie
auch anderswo) ein lnnehalten. Wer sich dem urbanen Gehen überlässt, wird früher oder später einem
unkritischen Kaufen verfallen - es sei denn, er sucht vor den kommerziellen Kompromittierungen des
Umherschweifens Zuflucht in eine die Bewegung gleichsam von innen her reinigende Passivität wie
der Benjaminsche Flaneur, der nichts kaufi, alles aufnimmt (und schriftlich wiedergibt)' aber nichts
konsumiert ausser den etherischen Substanzen Tabak, Kaffee und Alkohol'
Man versteht, dass die Betonung der Verbindung von Kaufen und Gehen angesichts dieses niedrigen
und prekären status, den das kaufende Subjekt handlungstheoretisch hat, auch eine apologetische
Funktion erfüllt: lch entschuldige mich für meine Schwäche, meine Unfähigkeit zu entschiedenem Vor-
gehen in der sache des Kaufens, meine Leichtgläubigkeit und die zu erwartenden Verluste schon im
Vorhinein damit, dass ich lediglich die Stadt als abwechslungsreiches Milieu des Gehens in Anspruch
nehmen wollte. Der Rest, bezeugt durch das sündhaft teure und wahrscheinlich sein Geld nicht werte
Zeug, das jetzt auf meinem Küchentisch liegt, ist unterdessen so passiert.
Einkaufen-Gehen scheint sich also in einer sphäre zwischen Bewegung und Handlung abzuspielen'
Wie genau es sich vollzieht, wird durch etwas bestimmt, das zwischen dem liegt, was wir üblicherwei-
se eine Entscheidung nennen, und dem, was wir üblicherweise als Einflüsse, Reaktionen auf Reize,
lnterferenzen oder Übertragungen aus dem Bereich der Entscheidung ausschliessen. Gerade deswe-
gen halte ich diese Tätigkeit für einen bemerkenswerten Untersuchungsgegenstand,denn ihre genaue-
re Analyse kann vielleicht dazu beitragen, die Tradition unserer begrifflichen Trennung und Hierarchi-
sierung von Bewegung und Handlung neu zu befragen'
lch möchte das an zwer Beispielen erproben, an den beiden Grossstädten, die ich selbst am besten
kenne: Tokyo und Berlin. Aktuell scheinen beide Städte zwei verschiedene Gesichter des metropolitanen
Kapitalismus zu präsentieren: während Tokyo selbst in den Jahren der Depression in den 1990ern
schauplatz eines exzessiven shoppings war und dies nach der konjunkturellen Erholung in Japan mehr
denn je ist, erkennt man in Berlin eher die Probleme und Stolpersteine der Kommerzialisierung' Aus die-
ser Stadt ein internationales Shoppingzentrum zu machen, hat an vielen Orten nicht oder nur sehr schlep-
pend funktioniert. Die Gründe, die dafür angegeben werden, verweisen auf volkswirtschaftliche Proble-
me: die hohe Arbeitslosigkeit, die entsprechend schlechte finanzielle Lage vieler Berliner, die unsichere
Stimmung, die die "Kauflust, der Menschen gebremst habe und die notorische Sparsamkeit in dieser nie-
mals reich gewesenen Stadt noch verstärke. lch will die Bedeutung dieser Faktoren nicht bestreiten,
ihnen aber einige Beobachtungen hinzufügen, die zeigen' dass eine stadt wie Tokyo der Performativität
des Einkaufen-Gehens durchaus anders korrespondiert als Berlin. Dabei geht es nicht um Wertungen
(schon gar nicht um eine unreflektiert positive Bewertung des Kommerziellen), sondern um ein paar erste
Schritte zu etwas, was man eine Bewegungsanalyse des Einkaufen-Gehens nennen könnte'
Etwas schematisch könnte man sagen: Das generative Prinzip Tokyos ist der verwinkelte Anbau oder
Einbau, das Einpassen ständig neuer Strukturen in die offenen Gelegenheiten der aktuell bestehen-
den, was zu einer ungeheuren Verdichtung führt, den Akzent aber immer auf Passierbarkeit' auf
Zugänglichkeit und Durchgängigkeit legt. Das Prinzip Berlins ist dagegen eher die Umnutzung und
34 van E kels
Uberbauung des Gescheiterten, das Sich-neu-Einrichten in abgebrochenen oder steckengebliebenenBewegungen' Das hat eine in historischer Perspektive vergleichsweise kurze, aber in beiden Fällenintensrve Vorgeschichte: Edo, die Stadt der Händler und eines relativ .liberalen, Bürgertums, wurde im19' Jahrhundert unter dem Namen Tokyo Regierungssitz des Meiji-Kaisers, und dieser Ortswechselverband sich mrt radikalen politischen und kulturellen Veränderungen. An die Stelle der Samurai-Mili-tärdiktatur trat eine Verquickung von wiedererstarktem Kaiserium und parlamentarismus nach europä-ischem Vorbild. Die japanische Lebensweise wandelte sich durch den lmport und eigenwillige über-setzungen westlicher Kultur. Bauten in einer japanischen lnterpretation des ueuropäischen Stils"schalteten srch in das Stadtbild ein. 1923 zerstörte ein schweres Erdbeben yokohama und grosseTerle des alten Tokyo. Die neu aufgebaute Hauptstadt fiel ihrerseits im Zweiten weltkrieg zu grossenTeilen den Bomben der Alliierten zum opfer, und seither gibt es in beinahe allen Terlen der Metropoleein Abreissen und Neubauen in immer schnellerem Tempo. Der europäische Traditionalismus im Um-gang mit Bauwerken und städtischen Strukturen ist den Japanern wertgehend fremd geblieben. DieBezirke von Central Tokyo befinden sich daher in einer ständigen Umgestaltung: Geschäfte entstehenund verschwinden; neue Viertel treten in kurzerZeir als Shopping-Zentren hervor, andere, vor allemsolche, in denen ein eher traditioneller Einzelhandel präsent war, verfallen.Berlin, auf der anderen Seite, katapultierten die m jlitärischen Erfolge der Hohenzollern und die Reichs-gründung in die Rolle einer Hauptstadt, deren Bevölkerung eine rigorose Zuwanderungspolrtik von1680 bis 1784 auf das Fünfzehnfache steigerte. Der Urbanisierung im Eiltempo folgten zwei Weltkrie-ge, die Teilung nach dem Zweiten, die lnselexistenz Westberlins und die sozialistrsche Neu-Gestaltungdes alten Zentrums im Osten, dre Wiedervereinigung und der Bauboom der frühen Neunziger, dieErnüchterung zum Ende des Jahrtausends mit ca. 1,5 Millionen Ouadratmetern leer stehender Büro-fläche, zahlreichen Firmenpleiten besonders in den zentralen Bezirken und mit einem daraus resultie-renden Stadtbild, in dem die neuesten kommerziellen Anstrengungen nicht selten direkt neben denRuinen der letzten Generation zu sehen sind.
Die Paarung von Tokyo und Berlin ist auch insofern aufschlussreich, als in keiner der beiden Städtejemals ein umfassender städtebaulicher Erneuerungsplan verwirklicht wurde, so dass sich beide sehrdirekt ais Spuren von Bewegungen zu lesen geben.5 Anders als das nach chinesjschem Musterschachbrettartig angelegte Kyoto hat sich Tokyo um die grosse zentrale Leere des Kaiserpalastesherum in einer lokalen, auf die einzelnen Viertel bezogenen Dynamik entwickelt. Kreuzungen von Land-strassen aus der Edo-Zeit und die Linienführung der privaten Eisenbahngesellschaften in den Vorortensteuerten das Wachstum im 19. und frühen 20. Jahrhundert, und bis auf einige Hauptverkehrsadernund Stadtautobahnen, die anlässlich der Olympischen Spiele 1964 gebaut wurden, ist Tokyo voneinem ebenso dichten wie chaotischen Geflecht enger und engster sich schlängelnder Wegebestimmt' Die Bevölkerungsexplosion in den 1940er Jahren, dre aus Tokyo die stadt mit der welt-grössten Einwohnerzahl machte, schuf eine neue Unübersichtlichkeit und erschwerte die Regulierung,was u'a' dazu führte, dass man das Stadtgebietlg4T in 23 Bezirke (ku lw)aufteilte, die seithereinenquasi autonomen Status haben. Heute spielen Nachbarschaftskulturen und Bürgerprojekteo für dieStadtentwicklung ebenso eine Rolle wie von lnvestoren kontrollierte Megaprojekte, die ein ganzesouartier in ein Lebens-Arbeits-Entertainment-Terminal verwandeln.Z
van Eikels 35
Auch Konzepte für Berlin blieben stets fragmentarisch, teilweise durch die historischen Brüche, teil-
weise einfach durch die Grösse der Stadt, teilweise durch eine Fülle von *unbewußten lrrtümern, be-
wußt bösen Tendenzenu, wie Joseph Roth schon 1930 schrieb.B Seit der deutschen Wiedervereini-
gung bezeichnet die Metapher von der Grossbausfelle Berlin einen sysiphusartigen Kampf um die
verwaltungstechnische Kontrolle über das Werden und Verfallen, der an vielen Fronten zugleich ge-
führt wird.e ln Tokyo wie in Berlin kam es in keiner Epoche zu einer systematischen Rationalisierung von
Architektur und Strassenführung wie etwa in Paris, und die chaotischen Übergangsphasen überwie-
gen deutlich die Kontinuitäten, so dass sich kein "organisches Wachstum" ergeben hat, sondern stets
nur relativ schnelle Entsprechungen, Reaktionen auf eine aktuelle urbane Lebenssituatjon und deren
Selbstentwürfe, oder eine ebenso rasante Eigendynamik. Beides sind also Städte in einer relativ freien
Bewegung, die im Verhältnis zu den Bewegungsoptionen zu sehen wäre, die sie ihren Bewohnern und
Besuchern jeweils bieten.10 lch will versuchen, das an vier Aspekten näher zu beleuchten:
1. Korridore
ln Tokyo vollzieht sich die kommerzielle Durchdringung der städtischen Architektur in Form von Korri-
doren. Ausser dem grossen vermauerten Areal des Kaiserpalastes gibt es fast nirgends massive Ge-
bäudeblöcke, die nicht auf einer Vielzahl von Bewegungsachsen zu passieren wären. Es sind zumeist
eher schmale, auf Fussgängerströme zugeschnittene Gänge, die sich in allen Richtungen durch die
Umgebung ziehen - wobei es sich bei dieser Umgebung sowohl um ein Haus als auch um eine Stras-
se, um einen Durchgang zwischen Strassen, um den Raum unterhalb einer Hochbahntrasse oder um
einen Bahnhof handeln kann. Die Korridore scheinen das primäre Element der urbanen Architektur von
Central Tokyo zu bilden, während die einzelnen Territorien, Grundstücke und Gebäudekomplexe als
Einteilung demgegenüber zurücktreten.11 Das Gehen fächert dementsprechend eher aul als dass es
eine Distanz überwindet.
Der Bahnhof spielt für dieses Geflecht eine besondere Rolle. Die Bahnhofsgegenden (das japanische
Wort dafür laulet ekimae /EREü wörtlich:vor dem Bahnhof) sind auch die kommerziellen Zentren der für
sich genommen relativ kleinen Stadtviertel - bzw., genauer: die Bewegungsknoten, aus denen sich
viele kommerzielle Transaktionen ergeben. Die kommerzielle Aktivität in Tokyo versteht sich in einem
ganz direkten Sinne yom Personenverkehr her: Tokyoter gelten keineswegs als begeisterte Fussgän-
ger; die Stadt, in der Pkw als Transportmittel kaum eine Option darstellen, verlangt den meisten aber
neben langen Bahnfahrten täglich auch ein erhebliches Laufpensum ab. Einkaufen-Gehen bedeutet
hier nicht, sich eigens zu einem Spaziergang zu entschliessen; es findet vor allem auch dort statt, wo
man sich den Bewegungen überlässt, die zum Bahnhof hin oder von ihm wegführen und einem dabei
zahlreiche Gelegenheiten zum Kaufen unterbreiten.
Auch die depaato, die grossen Warenhäuser, heben sich erst ab der zweiten oder dritten Etage als
getrennte Blöcke aus der Umgebung heraus. lm Erdgeschoss (meist gibt es zwei oder drei Etagen, von
denen man nicht weiss, ob es sich um ein Untergeschoss, das Parterre oder einen ersten Stock han-
delt) sind sie in das System von Korridoren eingebunden, das die Bahnhöfe umgibt und durchzieht, und
setzen es innerhalb ihrer Verkaufsfläche in etwas verdichteter, engmaschigerer Form fort. Oft informiert
lediglich das Logo den Passanten darüber, dass er sich jetzt in einem Seibu-, lsetan- oder Tobu-
36 van E kels
Department Store befindet. Diese mehrstöckigen Unterbauten beherbergen dabei in der Regel dieLebensmittel-, Bento- und Pätisserie-Abteilungen, nicht, wie häufig in deutschen warenhäusern, par-fums, Schmuck und Ledertaschen.l2 Ein Grossteil der kommerziellen Strategien läuft in japan über dasEssen, insbesondere über die Süssigkeiten, die leichte, der Arbeit des Verdauens enthobene, nur demraschen Genuss zugedachte Nahrung (wobei man interessanter Weise nicht im Gehen isst).Die Netze des Essens in den depaafo setzen sich aus einer grossen Zahl kleiner marktstandähnlicherCounter zusammen. Die Strukturen des japanischen Wirtschaftssystems, das durch keiretsu / *rt)sowohl vertikal als auch horizontal so eng verflochten ist, dass es kaum gelingt, zwischen Konzernen,Einzelfirmen, Töchtern, Partnern, Abteilungen, Zulieferern, Mitgliedern einer Kette, Franchise-Nehmernusw' zu unterscheiden, unterstützt diese Passagen: Dem Passanten wird kaum jemals klar, bei wel-chem Unternehmen er kauft' Die Abgrenzung von Firmenidentitäten dominiert fast nirgends das Stadt-bild (die Logos sind entweder diskret und leicht zu übersehen oder einander so ähnlich, dass sie ehereine durchgehende Schrift ergeben). Man trifft daher Kaufentscheidungen weniger in Bezug auf Unter-nehmensprofile, sondern wählt entlang der Route, die man sowieso verfolgt, aus dem Warenangebot.Der Blick springt nicht von Geschäft zu Geschäft, sondern trippelt über die feine, eher kontrastarmeund mit viel Gespür für den Rhythmus von Farbschattierungen und die wiederholung von Formen auf-gefächerte Unterteilung von Warengruppen. D.h., das Sehen befördert das Gehen, unterstützt undbeschleunigt die Passage, statt den Kunden zum rnneharten zu bringen.Das Prinzip des Nicht-widerstands gegen das Gehen bestimmt auch die konkrete Dramaturgie desVerkaufens So schön und originell in ihren Details die japanischen Geschäfte teilwejse sind, so scheintihre Ausstattung kaum dazu gedacht, den Blick des Kunden zu fesseln und ihn durch spektakuläreDinge oder Botschaften zu einem Aufenthalt über die kurzfristige Synchronisierung der passage mitdem Rhythmus des Wählens, Verpackens, Zahlens und Aushändigens hinaus zu bewegen. Wenn einKunde wiederkommt, so deshalb, weil man ihn von seinem Auftauchen bis zu seinem Verschwinden rei-bungslos durch das Verkaufsereignis führt, ihm das Gefühl gibt, mit seinem Verweilen im Geschäft kei-nerlei Zeit zu verlieren. Dabei geht es um eine imaginäre Komponente, die aber durchaus zur Erfahrungdes Gehens gehört: Sicher vergeht Zeit, während ich in einem japanischen Geschäft etwas kaufe,nicht anders als überall auf der welt; aber die Gestaltung des gesamten kommerziellen Ablaufs ver-mittelt mir den Eindruck, nicht aufgehalten sondern durch den Kaufakt selbst dem ursprünglichen Zielmeines Weges weiter entgegen getragen zu werden, auch wenn ich .eigentlich" nur ins Büro odernach Hause will' Die Abwicklung des Kaufvorgangs verbündet sich mit der Selbstverständlichkeit desGehens: ich kann mich auf die Bewegungen des Verkäufers genauso verlassen wie auf die meinerBeine; d.h., ich brauche ihn nicht weiter zu beachten.i3
Diese kommerzielle Architektur hängt in vielfacher Weise von der Bewegungsdisposition der StadtTokyo ab, in der geologische, architektonische, politisch-adminrstrative, wirtschaftliche und gesell-schaftliche Faktoren zusammenwirken. Wie sehr, zeigt sich in den noch vergleichsweise jungen Be-strebungen, in Berlin ähnliche kommerzielle Transit-Zonen zu etablieren, etwa in den grossen Bahnhö-fen der Deutschen Bahn oder ansatzweise in der S-Bahn-Station potsdamer platz. Während derBahnhof Shinjuku, von der zahl der Züge und Passagiere her der grösste der welt, aus der Luftansichtpraktisch nicht zu erkennen ist, da die Gebäudesegmente nahtlos in der Umgebung aufgehen und
van E kels 37
grosse Teile unterirdisch liegen, haben in den 1880er Jahren gebaute Berliner Bahnhöfe wie Fried-
richstrasse oder Alexanderplatz die Form von Hallen. Und trotz des Versuchs, innerhalb dieser Gross-
form über mehrere Etagen hinweg Gänge zu schaffen, zieht die Weite der Halle die Geschäfte von den
Rändern der Wege, die Passanten nehmen, in eine seltsame Semipräsenz zurück. Die .Spur der
Weine, im Bahnhof Alexanderplatz bspw, lag nie wirklich an meinem Weg, obwohl ich dort mehrmals
in der Woche vorbei gegangen bin und durchaus ein potenzieller Kunde für gute und nicht zu teure
Weine gewesen wäre. Der leere Kühlschrank am Sonntag, der mich und offenbar viele andere gele-
gentlich in den Edeka-Supermarkt im Bahnhof Friedrichstrasse treibt, ist kein Argument dafür, die
anderen Läden nebenan zu betreten, so dass diese, wenn ich dort entlanggehe, regelmässig men-
schenleer sind.
Wenn ich in Berlin etwas kaufe, bedeutet das vor allem Warten - nicht nur weil der Service wegen Per-
sonaleinsparungen, schlechter Bezahlung und folglich meist geringer Motivation der Angestellten tat-
sächlich viel schleppender ist und ich häufig lange Zeit gar nicht beachtet werde, bis ein Verkäufer sich
zuständig fühlt, um mich zu bedienen, sondern weil das Geschäft selbst als ein Ort des Stehenblei-
bens und Wartens angelegt ist. lm Marketing und Sales Management in Deutschland, das ich ein wenig
aus eigener Erfahrung kenne, taucht der Einkaufen-Gehende insofern als Subjekt einer Entscheidung
auf , als er sich dagegen entscheiden kan n, ein Prod u kt des U nterne h mens zu kauf en, u nd d ieses Dage-
gen-Entscheiden hat die bedrohliche Form des Weitergehens. Die Marketing-Strategien waren und
sind bislang weitgehend darauf ausgerichtet, das zu rasche und zu geläufige Weitergehen zu verhin-
dern oder zumindest zu bremsen. Die Aufmerksamkeit des Kunden erregen bedeutet, ihn mittels uHaltl,
rufender greller Signale, die eine Gebäudefassade bestücken (und sie dadurch desto mehr zur massi-
ven Fassade machen) auf eine günstige Weise aus dem Tritt zu bringen, ihn zu einem Umweg zu nöti-
gen und die verlangsamende Abirrung dieses Umwegs dazu zu nutzen, eine Kommunikation mit ihm
anzuknüpfen, die ihn, im Erfolgsfall, schliesslich zum Stehenbleiben verleitet.la
Auch auf stadtplanerischer Ebene fand die Dramaturgie des Gehens bislang bei der Schaffung kom-
merzieller Zonen in Berlin offenbar keine Beachtung. ln entsprechenden Planungspapieren kommen
die verschiedenen städtischen Zonen lediglich unter dem Aspekt der Eigenschaften von Standorten
und ihrer Zuordnung zu bestimmten Firmentypen in Betracht, die sich für die lmmobilien interessieren
könnten. Die ästhetische Aufmerksamkeit für die Gestaltung von Gebäuden, Strassen und Plätzen ori-
entiert sich vornehmlich am Bild: es geht um hübsche, visuell geschlossene Häuserfronten, nicht um
Bewegungen. Bekanntlich ist die Geschichte der Urbanisierung des kleinen Doppelstädtchens Berlin-
Cölln eine Geschichte der Errichtung von Fassaden. Die Hohenzollern verpassten den eher schäbigen
Handwerkerhäuschen, aus denen ein Grossteil des Ortes bestand, pompöse Barockfassaden, hinter
denen die eigentlichen Gebäude verrotteten. Dieselbe Fassadenfixiertheit findet sich in Albert Speers
Plänen, der seine Fassaden-Modelle bei den Experten für illusronäre Fronten, in den Ufa-Studios
Babelsberg bauen liess, in der stalinistischen Prachtarchitektur in der heutigen Frankfurter Allee, wo
sich hinter gewaltigen Fassaden einfache Sozialwohnungen verbergen, in der DDR-Praxis, nur die zum
Westen zeigenden Fassaden der Häuser an der Mauer zu renovieren, und in der Bauverordnung für die
Neugestaltung nach der Wiedervereinigung. Der 2OO2 gefasste Beschluss zur Wiedererrichtung nur
der Stadtschlossfassade am Ort des Palastes der Republik blickt also auf eine lange Tradition zurück.1s
38 van Eike s
Dabei hat man nicht nur das Grosse in der Logik der Fassade gedacht, sondern konzipiert so nunmehr
auch das Kleinteilige, das mit den Schritten der Fussgänger kompatibel sein und die Stadt "den Men-
schen nahe bringen, soll. Es gibt bspw, Versuche, monumentale Blöcke durch dünne Verkleidungen
mit kleinen Natursteinplatten in si6sn "passierbaren" Rhythmus aufzulösen. *Man bewegt sich daher
auf der Friedrichstrasse und in der ,Daimler City, am Potsdamer Platz wie auf einer Baufachmesse mit
überdimensionierten Ausstellungsmustern von Fassadenherstellern.,l 6
2. lnnen/Aussen
Ein anderes Problem, das die kommerzielle Konditionierung der städtischen Transportwege hierzulan-
de kompliziert, ist die geforderte Nähe zum Draussen. Abgesehen von der mangelnden Frische des
Fisches würde ich das Sushi-Restaurant im Durchgang vom Sony-Center zur S-Bahn Potsdamer Platz
schon deshalb nicht wieder betreten, weil ich mir dort unten eingekerkert, von Licht und Leben abge-
schnitten vorkomme. ln einer Kultur, wo der optimale Platz sich in einem Zimmer aufzuhalten am Fen-
ster liegt, sind der kommerziellen Nutzung des Bewegungsraums enge Schranken gesetzt: Die Gren-
ze zwischen lnnen und Aussen ist für uns der Erlebnisort schlechthin, dessen Liminalität auch der Art
und Weise unseres Begehrens/Geniessens korrespondiert. Aber diese Grenze lässt sich innerhalb
einer Massenarchitektur nicht beliebig vervielfältigen. Die Bevölkerung einer Metropole wird sich tag-
täglich durch dunkle Hallen, Flure und Treppenschächte wälzen, und solange erst die Berührung mit
der lichten Umgebung das zum Genuss erforderliche Wohlbehagen verschafft, dürften diese Durch-
gänge kommerzielle Un-Orte bleiben und die Geschäfte dort bestenfalls den Status eines Bahnsteig-
kiosks erlangen, bei dem selbst die aktuellen Ausgaben der Zeitschriften aussehen, als wären sie
schon viele Jahre alt.17
Architekten versuchen daher seit längerem, ganze Gebäude in einen einzigen Ort am Fenster zu ver-
wandeln, indem sie mit Glas und spiegelndem Metall arbeiten. Aber gerade für den Verkauf scheint
sich diese transparente Architektur nur bedingt zu eignen, bzw., es gibt bislang kaum entsprechende
Verkaufs- und Präsentationskonzepte, die sich der Transparenz von Glas- und Stahlpalästen für die
lnteraktion mit den Hindurchgehenden glücklich bedienen. Es wirkt oft geradezu rührend lächerlich,
wie die Firmen, die in diesen Gebäuden Verkaufsfilialen eröffnen, sich bemühen, mithilfe von messe-
standähnlichen Schirmen und Pappwänden in der lichtdurchfluteten, reflektierenden Offenheit des
Gebäudedesigns ihre eigene, proprietäre Zone zu schaffen. Die Konzepte der "Positionierung von Mar-
ken" durch Schaffung eines gegen andere abgegrenzten Terrains kollidieren mit den Raumdefinitionen
der architektonischen Visionäre, was den Bewegungssinn der Passanten zusätzlich irritiert: lch müss-
te dort hingehen, um eins jener Produkte in Augenschein zu nehmen, welche die herumstehendenVer-
käufer eher zu bewachen als darzubieten scheinen. Und ich habe das höchst unangenehme Gefühl,
wenn ich dort wäre, ebenso für andere sichtbar im Abseits herumzustehen.
Die japanische Architektur kennt die dramatische Konfrontation und Durchdringung von lnnen- und
Aussenraum, Tageslicht und Zimmerdunkel so nicht und verwendet sie auch heute eher zitathaft, als
einzelnen, auf eine konkrete Situation begrenzten Effekt. Das .traditionelle" japanische Haus (wenn ich
mich zurAbkürzung dieses etwas problematischen Begriffs bedienen darf) hat shöji lW+ aus Papier,
keine Glasfenster. Auch im modernen Tokyo ist der Grossterl der kommerziellen Bereiche vom Aus-
van Eikels 39
senraum abgeschlossen, ohne dass das Fehlen des freien Himmels klaustrophobische Reaktionen
auslöst. Sogar in höheren Etagen verschliessen die Läden ihre Fenster oft mit Platten. Ein lnnenraum
ist so häufig nichts, was man erst eigens von aussen betreten müsste, keine private Domäne eines ein-
zelnen Geschäfts, sondern der allgemein zugängliche Raum, durch den alle sich ständig bewegen,
befindet sich gleichermassen innen wie aussen.
Es ist viel über die Themenparks in Japan und anderen ostasiatischen Ländern geschrieben worden,
deren künstliche Welten Entertainment-Angebote mit der Unterbringung von Geschäften kombinieren.
Das prominenteste Beispiel in Tokyo ist das Venus Fort in Odaiba, das im Design eines italienischen
Renaissance-Städtchens über hundert Läden, überwiegend für Damenmode, integriert (ein Vorbild für
das 2OO6 eröffnete Sch/oss in Berlin-Steglitz). Diese Themenpark-Shopping-Areas forcieren jedoch
nur die allgemeinen Prinzipien bei der Gestaltung von kommerziellen Orten in Japan - denn ohne sicht-
bare Verbindung zu einer Welt jenseits des Fensters ist das Geschäft ohnehin ein quasi autonomer, als
solches erst zu gestaltender Bereich. Lediglich der Ouadratmeterpreis begrenzt die Gestaltungsmög-
lichkeiten; doch auch diese erzwungene Kleinheit oder Kleinteiligkeit der japanischen Geschäfte unter-
stützt die kommerzielle Bewegung, denn sie führt dazu, dass sich die einzelnen Ladenräume auf den
Zentimeter genau in die Passantenströme passen und von sich aus über ihre Auslagen in die benach-
barten Läden übergehen. Das ähnelt mitunter jenen orientalischen Geschäften, die einen Grossteil
ihrer Waren an den äusseren Rändern des Ladenraums präsentieren und sich überall zu einem Bazar
organisieren;doch ist dieser Randbezirk hier kein kommunaler Raum der Versammlung, den man auf-
sucht, um Bekannte zu treffen, Tee zu trinken, einen Teil des täglichen Lebens zu verbringen, sondern
Durchgangsstadium des glatten, zugleich anonymen und euphorischen Verkehrs, eines Weitergehens,
das sich niemals, auch und gerade nicht zum Kaufen, unterbricht.
3. Diagonalen
Der wichtigste Vektor, auf dem sich in Tokyo Kaufen und Gehen gemeinsam organisieren, ist die Dia-
gonale: die Treppe oder Rolltreppe, aber mehr noch die unmerkliche Diagonale, die einen, ohne dass
man es recht bemerkt, von der einen auf eine andere Ebene bringt. Schon Roland Barthes hat sich in
den 1960er Jahren darüber begeistert, dass das Geflecht von Geschäften, das in Tokyo die Verkehrs-
knotenpunkte der Bahnhöfe einhüllt, oft mehrere Stockwerke in die Tiefe führt.l8 Dabei sind Waage-
rechte und Senkrechte nicht in systematischer Strenge entwickelte, gleichförmig miteinander verbun-
dene Richtungen, sondern unregelmässig in einen Raum eingezeichnet, von dem man nie weiss, wo
und wie er sich ausdehnt. Treppen und Rolltreppen stellen sich nicht einfach als die notwendigen Ver-
bindungslinien zwischen gestapelten Ebenen dar; es ist eher so, als ob die Verteilung von horizontalen
und vertikalen Strukturen sich aus dem Vorhandensein solcher Diagonalen jeweils ergeben würde:
Jede Diagonale läuft vor allem auf eine Gelegenheit hinaus Breiten- und Tiefendimension neu zu ver-
teilen.Man kommt daherfast niemals zurückwenn man den natürlich erscheinenden Pfaden folgt. Es
herrschen weder Symmetrie noch Reversibilität.1e
Ahnliches gilt für die Ecken: Eine Ecke gleicht stets ein wenig einer Treppe (oft tritt beides ohnehin
zusammen auf). Als Bewegungsgelenk hat diese Ecke eine grössere Komplexität als ein einfacher
Knick. Um eine Ecke zu biegen bedeutet fast immer, in einen neuen Abschnitt einzutreten; es gestattet
II
I
I
40 van Eikels
der Bewegung, sich irgendwie in sich zu drehen, einen Schwenk zu vollführen, der zugleich eine neuePerspektive des möglichen Konsumierens eröffnet: Hier bin ich offenbar in eine Zone mit Backwerkgeraten - Blätterteigpasteten, Miniaturkunstwerke von Kuchenstückchen, mit Bohnenpaste gefülltejapanische süssigkeiten -, hier, eine Ecke weiter, in eine Restaurantlandschaft, die von den starkenAromen der Yakitori- und unagi-stände bestimmt wird. Die verlockung derjapanischen Kaufarchitek-turen hängt mit einer verdrehung der Bewegung durch rreppen und Ecken zusammen, die sich mitun-ter ganz den spiralenförmigen Bahnen von Duftschwaden anzupassen scheint. Das verlockende istdas' was hinter der Ecke oder im durch die Treppenflucht geöffneten Ausschnitt des nächst höherenoder niedrigeren Ganges sichtbar, hörbar, riechbar wird. Das profitiert davon, dass Tokyo eine bergigestadt mit zum Teil extremen Höhenunterschieden ist. Durch rokyo zu gehen heisst immer auch, dasNiveau zu wechseln, ohne dass aufgrund der Enge und Gedrängtheit ein ländlicher Eindruck entstün-de' Die Einkaufswelten nutzen diese wechsel für Effekte, die das Erscheinen bestimmter waren mitdieser Erhebung oder Vertiefung synchronisieren.Die Ausbreitung der Stadt in der Vertikalen, vor allem aber auch die diagonale (überhaupt eine andereals rechtwinklige) Verknüpfung von Gebäuden und wegen wird im wiedervereinigten Berlin weitge-hend durch das Planwerk lnnenstadt von 1997 blockiert, das die Aufteilungen und proportionen des19' Jahrhunderts als standards festschreibt, an denen sich auch neue Architekturprojekte zu orientie-ren haben' Die gedankliche Einheit dieses Planwerks ist der Block. Die Verfasser denken das Gesche-hen "stadt" von einer festen unterteilung in Gebäudeblöcke her. .Der Grundriss [...] ist das Gedächt-nis einer Stadt.,20
strassen wirken somit als Trennlinien. wer sie entlanggeht, kommt nicht umhin, sich mit dieser Tren-nung auseinanderzusetzen. .Die Auflösung einer ganzheitlichen Struktur weist dem stadtbenutzer eineaktive Rolle zu: Der Zusammenhang zwischen den mannigfaltigen Elementen ist immer wieder neu her-zustellen"' heisst es in "Berlin - stadt ohne Form,, der studie eines Kollektivs von Architektur- undstadttheoretikern um Philipp oswalt'2' Genau das wird beim Gehen durch Berlin zur überbrückunggrosser Distanzen und Diskrepanzen, d.h. zu einer gleichermassen imaginären wie motoris chen Arbeit.lndem ich die Zonen ablaufe, muss ich tatsächlich selber das, was von sich aus nicht zusammengehö-ren will (und soll), in das geläufige Milieu eines gelungenen Einkauftrips verwandeln, und die Verant-wortung für das Gelingen liegt ausschliesslich bei mir.Berlin bietet dabei durchaus eine Vielzahl hoch interessanter, sowohl räumlich als auch zeitlich diago-naler Blicke' Das kommt indes einer ständigen Aufforderung zum stehenbleiben gleich: Die Koexistenzdes Widersprüchlichen fasziniert. Es liegt in der Tat viel näher, aus der Bahn seines Einkaufsbummelsdurch Mitte oder Prenzlauer Berg herauszutreten, um das merkwürdige Aufeinandertreffen verschie-dener Epochen und stile, verschiedener historischer Fährten, verschiedener stadien von Zerfall,Restauration oder innovativer Umgestaltung, verschiedener Kräfteverhältnisse zwischen Kontrolle undDesorganisation zu studieren, als weiterzugehen und das nächste Geschäft zu betreten. BerlinsGeschäfte konkurrieren mit der stadt um die lnteressantheit: strategisch geschickt eignen sie sich dasraue' gebrochene Flair der stadt an und geben es in ihren warenauslagen in Form kruder Kontrastewieder - oder in der Form direkter Zitate: Berlin-Schriftzüge, Fernsehturm-Bilder oder Ampelmänn-chen auf Kleidung, Taschen, Gebrauchsgegenständen.
van Eikels 41
Berlin hält den Übergang von der Bewegung des Gehens zu einer Handlung wie dem Kaufen auf, weil
es den Zwischenraum zwischen Bewegung und Handlung gewissermassen mit sich selbst
ausfüllt: mit der Stadt als einem Archiv bemerkenswert gewordener Dysfunktionalitäten, einer durch-
weg ironischen (nur durch lronie auszuhaltenden) Selbstreferenz, die das Kaufen-Gehen in mehr als
einem Sinne durchkreuzt. Das Diagonale ist hier das Durchkreuzende. Die Stadt drängt sich schräg
von der Seite her in den Freiraum, den die Bewegung des Gehens lässt. Der Gehende watet durch
eine historisch-kulturelle Masse, und in dieser zähen indirekten Selbsterfülltheit gibt es weder Gele-
genheit zur Erhebung noch zur Vertiefung und damit kaum dramatisches Potenzial für die selbst flache
Gegenwart des Einkaufen-Gehens.
4. Zugänglichkeit
Ein grosser Teil der aufregendsten und Berlin-typischsten kommerziellen Aktivitäten hat sich abseits
der prominenten Shopping-Adressen angesiedelt. Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Teile von
Kreuzberg stecken voller neuer Geschäfte, die zu Fuss oft anstrengend erreichbar sind und sich tief im
lnneren von Wohnblocks oder ehemaligen Manufakturgebäuden mit drei oder vier Hinterhöfen verber-
gen.
Diese neuen Geschäfte antworten darüber hinaus noch in einem anderen, nachhaltigeren Sinne auf die
Bewegung des Durch-die-Stadt-Gehens nicht mehr: Das Gehen nimmt die Stadt einschliess/ich ihrer
Geschäfte als einen selbstverständlich zugänglichen Raum in Anspruch. Das scheint heute gefährdet.
Die Präsenz von Sicherheitskräften in Einkaufszentren, das Aushängen von Hausordnungen, die einen
erheblichen Teil der öffentlich eingeräumten Aktivitäten verbieten, und die schwer zu ignorierenden
Objektive von Überwachungskameras machen deutlich, dass der Status der urbanen Öffentlichkeit auf
dem Spiel steht. Es darf längst nicht mehr jeder sich überall aufhalten. Aber wer durch die Stadt geht,
bewegt sich weiterhin in der Selbstverständlichkeit von Zugänglichkeit - und ein der modernen Stadt
entsprechender Begriff des kollektiven Raums wäre vielleicht aus dieser Selbstverständlichkeit des
Gehens zu verstehen und nicht so sehr von der expliziten Auszeichnung der Versammlungs- und
Begegnungsorte,
Die neuen, dezentralen kommerziellen Spots irritieren jedoch gerade diese Selbstverständlichkeit: Sie
bedrohen mich nicht mit uniformierten Türstehern oder Kameras, geben mir aber, sofern ich in der Rolle
des Fussgängers nur eben vorbeikommel den Eindruck, eine Zone zu betreten, von der keineswegs
ausgemacht ist, ob sie der Öffentlichkeit zugänglich sein soll, in der sich vielmehr Zeichen einer Pri-
vatsphäre mit Zeichen paaren, die der kommerziellen (aber auch der künstlerischen) Präsentation
zugehören. ln den Schaufenstern eines Ladens an der Ecke zwischen Pappelallee und Buchholzer
Strasse in Prenzlauer Berg befinden sich bspw. Lampen, Stühle, ausserdem eine Pyramide von Pak-
kungen, die alle die gleiche Backform enthalten. Also offenbar ein Geschäft für Design. Aber ist es
wirklich ein Geschäft? Oder nicht eher nur ein Büro? Die Mitte des grossen Raumes nehmen zwei ein-
ander zugewandte Schreibtische ein. An ihnen sitzen zwei junge Männer, ihrem Aussehen nach mögli-
cherweise die Designer selbst, vielleicht aber auch eine Art von Agenten, die sich mit dem Vertrieb der
Design-Oblekte befassen (das Wort .Verkäufer" will jedenfalls nicht passen). Einer von ihnen unterhält
sich mit einer Frau, die auf der Ecke seines Schreibtisches sitzt und in ihrem Macchiato-Glas rührt. Der
42 van E kels
Macchiato stammt offensichtlich aus dem Cafö nebenan, aber woher kommt die Frau? Gehört sieebenfalls zu dem Geschäft? Oder arbeitet sie im Cafe? lst sie nur eine Freundin und zu Besuch odereine Kollegin, vielleicht ebenfalls einer der vertretenen Designer? ln jedem Fall ist sie auf eine andereArt vorbeigekommen, als ich, der Passant und mögliche Käufer, hier vorbeikomme. lhre Anwesenheitzusammen mit der der beiden Männer trägt massgeblich dazu bei, den Laden hinsichtlich seiner Zu-gänglichkeit umzudefinieren: Sie entzieht ihn der Passage eines Fussgängers, der sich gewiss seindarf, dort, wo er seinen Fuss hinsetzt, allgemein zugängliches Terrain vorzufinden. Sie entzieht ihn abergleichermassen der Privatheit eines Geschäftsraums, der auf seinen Eigentümer verweist und eine
'persönliche' Atmosphäre hat. Dieses hybride Zwischending aus Showroom, Verkaufsraum, Büro,Treffpunkt und Lebensraum präsentiert sich als ein sozialer Ort, eine Domäne des Kommunizierens, dieFremde nicht durch sichtbare Schranken abweist, aber gleichwohl nur über andere Bewegungen alsdie anonyme, laienhafte, unprofessionelle Bewegung des Gehens zugänglich wäre.
lch könnte durchaus versuchen, das kommunikative Netzwerk, dessen Knoten sich im lnneren desLadens befindet, zu betreten. Aber ich müsste dazu persönliche soziale und womöglich professionelleKompetenzen aktivieren. Zufällig kenne ich den Designer, der eine der Lampen und die Backform ent-worfen hat. lch könnte also hinerngehen und zu den Anwesenden sagen:.Hi, ich bin ein BekanntervonSebastian. Das da sind doch seine Sachen..." - und würde mich mitten in einem Gepräch wiederfin-den, von dem zu entscheiden bliebe, ob ein Verkaufgespräch daraus wird. Aber was würde passieren,wenn ich nur einfach so einträte, als Einkaufen-Gehender, ohne mich als Teil des sozialen Netzwerkszu erkennen zu geben, das die Kreativen in Prenzlauer Berg miteinander verbindet? Wenn ich dort in
Erscheinung träte, ohne etwas zu sagen? Würden diese Drei, in ihrem Gespräch gestört, mich nichtirritiert und erwartungsvoll schweigend anstarren wie etwas sehr Unzeitgemässes?Die neuen kommerziellen Aktivitätszentren Berlins unterscheiden ihre Erreichbarkeit von der Leutselig-keit des Gehens. Die Disposition ihrer Zugänglichkeit ist sozio-professionell - was in Tokyo, wo nochdas abgelegenste Etablissement im fünften Kellergeschoss ein "lrasshaimase!, zur Begrüssung insTreppenhaus hinausschickt, kaum denkbar wäre. lch möchte das Einkaufen-Gehen, mit der Betonungder unqualif izierten Alltäglichkeit des Gehens, daher auch als eine Figur der Zugänglichkeit hervorhe-ben. Jeremy Rifkin hat in seinem bekannten Buch *Access" die Behauptung aufgestellt, dass derZugang zu Ressourcen und Prozessen heute wichtiger sei als der Besitz.22 Bewegung erscheint damitnicht nur unter dem Aspekt der Fort- oder der Selbstbewegung. Es geht auch darum, zu welchenBewegungen man Zugang erhält, wie man sich an dynamischen Prozessen zu beteiligen, sich mit ihnenzu synchronisieren, mit ihnen Schritt zu halten vermag.
Die Sphäre des Kommerziellen ist für diese Problemstellung insofern besonders interessant, als alleökonomischen Theorien des Kapitalismus bislang davon ausgehen, dass es hier Anbieter gibt, denendaran gelegen sein muss, die Zugangsbarrieren f ür die Kunde n ihrerZielgruppe so niedrig wie möglichzu halten. Mir scheint, dass diese Voraussetzung, die das Kommerzielle als einen rein ökonomischdeterminierten Bereich beschreibt, heute von einem Ort wie Berlin her in Frage zu stellen wäre - unddass es gerade die ambivalente Erfahrung des Einkaufen-Gehens dort ist, von der her eine solchelnfragestellung beginnen kann: Wir kennen die (vielfach berechtigten) Klagen über die ökonomisie-rung des Sozialen' Umgekehrt gilt es aber auch eine soziale Redeterminierung des ökonomischen
van Eikels 43
festzustellen, deren Wirkungen nicht so eindeutig und deren mögliche Konsequenzen umso beden-
kenswerter sind.
Dieses Beispiel deutet an, worum es einer Bewegungsanalyse des Einkaufens gehen kann: Die Frage'
der sie nachgeht, ist auch die, mittels welcher Oualität von Bewegung ein kommerzieller Ort erreichbar
ist. Das betrifft nicht nur die Aspekte der physischen Fortbewegung und die geographische Verteilung
der Verkaufsstätten, sondern auch das Wie des Sichbewegens und die sozialen lmplikationen der
Bewegungsweise. Der kommerzielle Raum einer Stadt gilt unserer Vorstellung weitgehend als eine
Zone, in der alle umhergehen dürfen, denen man zutraut, dass sie kaufen können. Doch so eindeutig ist
dre kommerzielle Bestimmung des öffentlichen Raumes in Berlin nicht, schon gar nicht an jenen Orten,
wo dem Vernehmen nach die grössten Potenziale der Stadt stecken. Die von Rem Koolhaas propa-
gierte Entgegensetzung von durchgeplanten und kontrollierten Kommerzräumen vom Typ Shopping-
Mall oder Flughafen einerseits und den verwildernden aufgegebenen Resten andererseits trifft so für
Berlin nicht zu. Etwas zugespitzt könnte man vielmehr sagen, dass die Bewegung des Gehens als
Motiv des kommerziellen Verkehrs, der Kunden zu Produzenten oder Verkäufern befördert, hier von
einem System des Bei-einander-Bleibens von Produzierenden überspannt und zumindest teilweise
neutralisiert wird. Bei der beobachteten Kaffeepause handelt es sich um mehr als nur ein zufälliges Bei-
sammensein und um etwas anderes als eine Pause. Sie ist das Symbol für eine lnteraktion, in der kom-
merzielle Aktivität und soziales Leben keinen Unterschied mehr machen wollen - bzw. darin ein Aus-
kommen finden, dass die Routine des Kommunizierens die Möglichkeit einer solchen Unterscheidung
sozusagen strukturell vergisst.
Das heisst auch: das Konsumieren geht hier auf eine unmittelbarere Weise in die Aktivitäten des
Produzierens ein als in den traditionellen Szenarien des Verkaufs. ln einer klassisch-modernen
urbanen Verkaufsdramaturgie bildet das Gehen den Ausgangspunkt für die kommerzielle Aktivität, weil
es als leere, verschwenderische Entäusserung von Zeit und Energie die Basis für den Luxus des Kau-
fes darstellt. lch mag in meinem Beruf selber Produzent sein, doch als Spaziergänger trete ich aus die-
ser Rolle heraus, und wenn ich kaufe, tue ich dies als Laie, als Privatmensch, als Subjekt der
anspruchslosesten und zugleich bereitwilligsten aller Tätigkeiten. Wo die Szene für das Einkaufen-
Gehen dagegen verschwindet und einer sozialen Szene des Bei-einander-Bleibens von Produzieren-
den weicht, entfällt diese Rolle des Gehenden. Das tendiert nicht nur dazu, die körperliche Erfah-
rungsrealität der Kräfteverausgabung, als die sich Einkaufen-Gehen in unser Leben einschreibt, zu
neutralisieren (man verbringt Arbeitszeit und Freizeit gleichermassen halb entspannt auf einer
Schreibtischkante sitzend). Es modifiziert auch die Freiheiten, die damit verbunden sind, dass man nur
geht und die eigene Bewegung offen hält für alle erdenklichen Einflüsse - modifiziert sie oder lenkt sie
um:Vielleicht sind es bald nicht mehr nur die Konzerne, die mit ihren privaten Sicherheitsdiensten den
öffentlichen Raum einschränken, sondern, auf eine andere Weise, die Netzwerke der alternativen Pro-
duzierenden, die ihn mit ihren sozio-professionellen Beziehungen überspannen und den bindungslos
umherschweifenden Konsumenten als sozialen Verlierer ermitteln. Dann würde wieder gelten, was
schon Rousseau in seinen Confessions notierte: dass es nichts nütze, Geld zu haben, um Zugang zur
Welt der Produkte zu erlangen, wenn man nicht mit dem Händler verwandt, befreundet oder wenig-
stens bekannt sei.23 Und was hiesse das für den Kapitalismus?
Kai von Eikels ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sonderforschungsbereich "Kulturen des Performativen" an der Freien
Universität Berlin.
44 van Elke s
1 "Die Bewegung überhaupt, ihre Flüchtigkeit - alsGehen, als Ver-Gehen - sammelt sich in jenememphatischen Moment, der Gehen als ,Gang, srchtbarmacht. [...] Das Gehen im Tanz präsentiert sich alsFigur und als Kon-Figuration.,, aus: Gabriele Brand-stetter. ".Stück mit Flügel,. über Gehen schreiben,, in:Literatur als Philsophte - Phtlsophte als Literatur, hrsg.von Eva Horn, Bettina Menke und Christoph Menke,München, 2006, S. 31 9-330, S. 322f.
2 Die Orte des Entscheidens in unserer Kultur sind stetssolche, an denen man sich einfindet, sich versammelt,sitzt oder steht: die Bewegtheit der agoralen Rede ent-faltet sich im Bruch mit der körperlichen Fortbewe_gung. Ludger Schwarte hat zusammen mit den Künst_lern Nanni Grau und Frank Schönert alternativeArchitekturen der Agora für die politische Versamm_lung im 2l. iahrhundert konzipiert. Der zentraleVersammlungsort weicht dabei Möbiusband-artigenKonstruktionen, die den geschlossenen Zirkel der klas-sischen Parlamente auseinanderfalten und so ver-schiedene Zonen schaffen, in denen Begegnungenmöglich sind, dabei den übergängen einen besonde-ren Wert für eine differenzierte, in sich selbst heteroge_ne und polyzentrische politische Auseinandersetzungzumessen. Siehe: Ludger Schwarte, "parliamentaryPublic", in: Making Things public. Atmospheres ofDemocracy, hrsg. von Bruno Latour und peter Weibel,Karlsruhe und Cambridge, 2005, S. Z86-294. Es liegtnahe, von solchen Entwürfen her auch die Frage nacheiner Politik im Gehen zu stellen: Wie würden sich poli-tische Entscheidungen verändern, wenn man sie inBewegung träfe? Wie würden Menschen entscheiden,die sich durch ein dynamisches parlament bewegenund ihre Bewegungen dabei in wechselnden Konstel-lationen synchronisieren? Eine solche Fragestellungführt die repräsentative parlamentarische polittk viel-leicht mit jenen performativen politiken zusammen,die man in jüngerer Zeit unter den Begriffen des"Schwarms, oder "Smart Mobs, diskutiert hat. Vgl. Kaivan Eikels, "Schwärme, Smart Mobs, verteilte öffent-lichkeiten - Bewegungsmuster als soziale und politi-sche Organisation?,, in: Tanz als Anthropologie, hrsg.von Gabriele Brandstetter und Christoph Wulf, Mün-chen,2007.
3 Andy Warhol versuchte in den 197Oer Jahren, dieEmanzipation des Konsumenten vom Händler alsBefreiung zu feiern, dem Kaufakt eine neue Souveräni-tät zuzusprechen. Vgl. Andy Warhol, Die philosophiedes Andy Warhol. Von A nach B und zurück, München1 991, S. 235.
4 Vielleicht erklärt sich so die Beliebtheit von Online-Börsen, wo dre Menschen von heute zumrndest zwi-schendurch in die alte Figur des Händlers schlüpfenkönnen. lch würde das weniger als Rückwendung zuvormodernen Tauschbeziehungen verstehen, eher alsOption, in einer Gesellschaft, wo der Käufer eine infe-riore und der Verkäufer die superiore Figur ist, diesoziale Normalität, in der wir alle vor allem als Käuferauftreten, zu kompensieren. Etwas über eBay (wieder)zu verkaufen, verschafft uns für den Augenblick dieerlösende Gewissheit, dadurch, dass wir es gekaufthaben, nicht endgültig reingefallen zu sein.
5 Hidenobu Jinnar stellte beim Vergleich von aktuellenStadtplänen mit Karten aus der Meiji-Zeit überraschtfest, dass die wichtigsten Bewegungslinien und -gren-zen des modernen Tokyo immer noch denen der Edo_Zeit entsprechen: "To my surprise, I found that not only
the old Edo streets but also the patterns of district divi_sions and even the lot boundaries corresponded, inalmost every instance, to the contemporary map.,, aus:Hidenobu Jinnai, Tokyo - A Spatial Anthropotogy, Ber-keley/Los Angeles/London 1 99S, S. 9. Zur Stadtstruk_tur des gegenwärtigen Tokyo vgl. ausserdem BrianBoigon, Speed Reading lokyo (Exhibition September'I 8-October 20, 1990, P3 Alternative Museum), Tokyo1 990.
6 Zur Rolle von Bürgerprojekten vgl. Silke Vogt, li/eueWege der Stadtplanung in Japan. partizipationsansätze auf der Mikroebene, dargestellt anhand ausgewähl-ter machizukuri-Projekte in Tokyo, Monographien desDeutschen lnstitutes für Japanstudien, Band 30, Mün-chen 2001.
7 Zum Konzept der "Stadt als Terminal" vgl. VolkerGrassmuck, .Tokyo Sim-City. Stadt als Terminal undTerminal als Stadt,, 199b, in: http://waste.informatik.hu-berlrn.de/-grassmuck/texts.html (1 7.0 1 .2007). Diebesondere Version von Kapitalismus, die in Japan nachdem Zweiten Weltkrieg entstand und die man nichtganz zu Unrecht als eine Art von "Staatskapitalismus,bezeichnet hat, brachte eine äusserst enge Verflech_tung von Wtrtschaft und Politik - was auch dazu ge_führt hat, dass Unternehmenskomplexe bei der Gestal-tung grosser Flächen des städtischen Raumes quasimit politischer Souveränität agieren. Ein konzisesPorträt der japanischen Wirtschaft findet sich ber:Manuel Castells, End of Millenium. The lnformationAge: Economy, Society, and Culture Vol. til, Oxford/Malden 1 998, S. 214-248.
8 Joseph Roth in Berlin. Ein Lesebuch f ür Spaziergän-ger, hrsg. von Michael Bienert, Köln 1996, S. 163.
9 Vgl. Eva Schweitzer, Grossbaustelle Berlin. Wie dieHauptstadt verplant wird, Berlin 1998 (3. Aufl.).
10 Zwischen Berlin und Tokyo besteht ausserdem seit Mar1994 eine offizielle Städtepartnerschaft, die nichtzuletzt auch zu einem lnformationsaustausch in SachenStadtentwicklung geführt hat. Die hier untersuchtenUnterschiede werden durch den verstärkten Wissens-transfer umso interessanter.
1 1 Trotz des Platzmangels sind durchgehende Gebäude-fronten in Tokyo eher dre Ausnahme als die Regel. Zwi-schen den Häusern verbleibt ein Abstand - der eben-so wie das Haus selbst oft schmal ist und den einGewirr von Leitungen, Rohren, Klimaanlagen-Geblä-sen usw. ausfüllt, was den Häuserzeilen etwas voneinem provisorrschen Arrangement verleiht. Wo derAbstand doch etwas grösser ausfällt, entsteht irgend-wann ein weiteres, winziges Gebäude (das aber sei_nerseits einen winzigen Abstand zu den Nachbarbau-ten bewahrt). Die Künstlergruppe Atelier Bow-wowund das Tsukamoto Architectural Laboratory des Tokyolnstitute of Technology haben in ganz Tokyo solcheKleinstgeschäfte aufgespürt und dokumentiert, die sie"pet architecture, nennen. Breite und Tiefe dieserLäden betragen teilweise weniger als zwei Meter, unddie Grundrisse, die sich exakt an der Form der Lückeorientieren, erinnern an Tortenstücke oder Regale. Vgl.Atelier Bow-wow, Tokyo lnstitute of Technology, pefArchitecture Guide Book, Living Spheres Bd. 2, Tokyo2002. Einige dieser Gebäudefotos wurden ausserdem20O6 in der Ausstellung Berlin Tokyo - Tokyo Berlin inder Neuen Nationalgalerie Berlin präsentiert (vgl. denKatalog, Ostfildern 2006).
1 2 Das 2006 renovierte und neu gestaltete Kaufhof-Warenhaus am Berliner Alexanderplatz macht den
van Eikels 45
1C
Unterschied besonders deutlich: Die Lebensmittelab-teilung liegt hier ebenfalls im Erdgeschoss, aber um zu
ihr zu gelangen, muss man sich vom Hauptportal her
durch Parfum- und Schmuckauslagen bis in den hinter-sten Teil hindurcharbeiten. Direkte Verbindungen zu
dem daneben liegenden Bahnhof Alexanderplatz,einem der grossen Verkehrsknotenpunkte Berlins, gibtes keine. Offenbar einzige Ausnahme ist diesbezüglichnach wie vor das ursprünglich 1927128 von PhilippSchäfer errichtete Karstadt-Gebäude am Hermann-plalz. Zur Architekturgeschichte der Berliner Kaufhäu-ser vgl. Jürgen fieZ, Berliner Verwandlungen. Haupt-stadt / Architektur / Denkmal, Berlin 2000, S.41-44.lch habe die Dramaturgie der Kaufhandlung und dasVerhältnis zwischen Verkäufer und Kunde in Japan skiz-
ziert in: Kai van Eikels, "Das Denken der Hand. Japan-Affirmationen als Entwürfe einer nichtperformativenPragmatik", in: Zeitschrift für Germanistik 3/2OO2,
hrsg. von Inge Stephan, Bern 2002, S, 488-497; Kai
von Eikels, Das Denken der Hand. Japanische Techni-ken, Bern 2004, S. 167-176.Man hätte schon von den Wochenmarkthändlern ler-nen können, dass diese Unterbrechung nicht als Stö-rung, d.h. überhaupt nicht als solche empfunden wer-den darf. Das Rufen des Marktverkäufers zergt sehr gut
die Anforderungen an den Rhythmus erner merkantilenlntervention in das Gehen: Der laute Anruf zupft sozu-sagen am Kunden, bringt ihn dazu, den Blick zur Seitezu wenden; aber der Verkäufer achtet darauf, diesesRufen kontinuierlich zu wiederholen, und seine Melodieentspricht nicht einer plötzlichen persönlichen Anrede,die den Einzelnen überfällt, sondern ergibt einen gleich
bleibenden Singsang, eine Schwingung, die sich zur
Atmosphäre des Ortes rechnet und mit dem Tempo
eines gemächlichen Schlenderns harmoniert. Der Vor-beigehende fühlt sich so zugleich angehalten und wei-terbefördert, und diese Situation vermittelt ihm dasGefühl, kaufen zu können, aber nicht zu müssen oderzu sollen.Die im August 2005 in Auszügen vorgestellte Mach-barkeitsstudie zur Fassaden-Version blieb als Gesamt-dokument (mit einem Umfang von 1000 Seiten)geheim. Eine Analyse findet sich unter http://www,urb-ancatalyst. net/d own loads/Mach barkeitsstud ie. pdf(17 .O1 .2OO7). Das Nutzungskonzept der Stadt-schloss-lnitiative, die "Schloss pur, wollte, findet sichu nter http ://www.stadtschloss-berl in.de/konzepte.htm I
(1 7.01.2O07). Aus den angekündigten .rauschenden
Feiern" und Gelegenheiten zum "Übernachten wie derKaiser in einem luxuriösen Ambiente' dürfte jedoch
nrchts werden.Philipp Oswalt, Berlin - Stadt ohne Form. Strategieneiner anderen Architektur, München 2000, S. 94.Symptomatisch für diese Einschätzung ist ein Berichtdes Architekturkritikers Jürgen Tietz von seinem erstenBesuch im .l 999 eröffneten Nike Town an der Tauent-
zienstrasse: "Alles wird sich im lnneren abspielen,, lau-
tet der zweifelnde, schon leicht polemische Einstieg.Die Polemik setzt sich fort durch ein gequält ironischesSpiel mit den Sportworten "indoor, und .outdoor":.Hier bekommt der Besucher absolut ,indoor, (innen
drin), was die Grossen und die Kids (KindeD für den
Sport auch ,outdoor, (vor der Türe) benötigen> - um
schliesslich, beim Verlassen des Geschäfts, mit dem
Stossseufzer zu enden: .Vor der Tür sind wir zurÜck: in
Berlin,, aus: Tietz 2000, wie Anm. 1 2, S. 15Sff. Positi-ve Anmerkung dagegen: "Mit seinem betont nüchter-nen technischen Ambiente fügt sich das Gebäude gut
in seine Umgebung ein., (Ebd., S. 157)18 "Die Stadt durchqueren (oder in ihre Tiefen eindringen,
denn es gibt ein unterirdisches Netz von Bars und
Geschäften, zu denen man manchmal durch den Ein-
gang irgendeines Gebäudes gelangt, so daß sichlhnen hinter dieser engen Pforte das dunkle lndien desHandels und der Freuden auftut) heißt Japan von obennach unten durchqueren, heißt der Topographie dieSchrift der Gesichter überstülpen.", aus: Roland Bar-thes, Das Reich der Zeichen, Frankfurt a. M. 1981,s. 59f.
19 Das durchweg Gelegentltche der Verteilung lässt kei-
nen Gedanken an ein Labyrinth aufkommen (was dieVorstellung einer bösen lntelligenz impliziert, die dasalles so geplant hat). Man hört sofort auf, an der Mög-lichkeit der Rückkehr festzuhalten - und findet auch
auf unbekannten Wegen doch ohnedies dorthin, wohinman ursprünglich wollte. ln vielen Jahren habe ich michin Tokyo nicht ein einziges Mal verlaufen.
20 Barbara Jakubeit, "Zwischen Tradition und Moderne.Plädoyer für eine Architektur der Großstadt,,, in: Deut-
scher Architektentag 1997. Die Zukunft der Baukultur
- Exempel Berlin: offene Stadt im Wandel, Berlin1 997, S. 44-48, hier S. 44.
21 Oswalt 2000, wie Anm. 16, S. 42.22 Jeremy Rifkin, Access. Das Verschwinden des Eigen-
furns, Frankfurt a. M. 2002.23 "lch möchte einen Gegenstand, aber nur von vortreffli-
cher Güte: für mein Geld bin ich sicher, ihn in geringer
zu erhalten. lch kaufe mit teuerem Geld ein frisches Ei
- es ist faul, eine schöne Frucht - sie ist unreif, ein
Mädchen - es ist verdorben. lch liebe guten Wein,
aber woher ihn nehmen? Vom Weinhändler? Wie ich
es auch immer anstellen wollte - er vergiftet ihn. Willich aber unter allen Umständen gut bedient werden,welche Mühen und Anstrengungen wollte mir das wohlkostenl Es heißt dann, Freunde und briefliche Bezie-hungen haben, Aufträge erteilen, schreiben, hin und
her laufen, warten, und zu guter Letzt wird man dochbetrogenl Welche Plage macht mir dann also mein
Geld: ich fürchte sie weit mehr, als ich guten Weinliebe.", aus: Jean-Jacques Rousseau, Bekenntnisse,übers. von Ernst Hardt, Frankfurt a. M. 1 985, S. 78.
14
15
16
17
46 van E kels