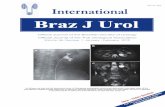Autologous dental pulp stem cells in regeneration of defect created in canine periodontal tissue
Tissue engineering and stem cell research in urology
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Tissue engineering and stem cell research in urology
Urologe 2007 · 46:1224–1230
DOI 10.1007/s00120-007-1486-3
Online publiziert: 16. August 2007
© Springer Medizin Verlag 2007
K.-D. Sievert1 · G. Feil1 · M. Renninger1 · C. Selent1 · S. Maurer1 · S. Conrad2 · J. Hennenlotter1 · U. Nagele1 · R. Schäfer4 · R. Möhle3 · T. Skutella2 · H. Northoff4 · J. Seibold1 · A. Stenzl1
1 Klinik für Urologie, Universitätsklinikum, Tübingen2 Sektion Tissue Engineering, Anatomisches Institut am Österberg, Universitätsklinikum, Tübingen3 Medizinische Klinik II, Universitätsklinikum, Tübingen4 Institut für klinische und experimentelle Transfusionsmedizin, Universitätsklinikum, Tübingen
„Tissue engineering“ und Stammzellforschung in der Urologie für den rekonstruktiven bzw. regenerativen Therapieansatz
Operationsverfahren/Technische Entwicklungen – Originalien
Die Innovationen der rekonstruktiven Urologie auf dem Gebiet des „tissue en-gineering“ und der Stammzellforschung entwickeln sich am Universitätsklinikum Tübingen im Schnittpunkt zwischen den klinischen Erfordernissen und der Basis-forschung der Klinik für Urologie. Dieser Bereich schafft durch seine enge Koope-ration des Urologischen Labors für Tis-sue Engineering mit dem Institut für Anatomie, der Klink für Innere Medizin und der Transfusionsmedizin frühzeitig Möglichkeiten der Integration in die Kli-nik. Diese Kooperation ist eine der man-nigfaltigen Facetten des universitätseige-nen Forschungsbereichs „Regenerative Medizin“ (http://www.regmed.uni-tueb-ingen.de).
Um die klinische Integration kompli-kationslos zu ermöglichen, bedarf es der Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbe-dingungen und das Schaffen geeigneter Vorraussetzungen. Hierzu gehören bei-spielsweise die Optimierung der Nährme-dien und der Zellkulturtechniken, worun-ter neben der Vermehrung auch die Diffe-renzierung fällt, und die gleichzeitige Vor-bereitung für die klinische Anwendung durch maximal optimierte Versorgungs-wege für die komplikationslose Anwen-dung von Zellprodukten.
Der Bereich „tissue engineering“ hat die Bereitstellung kompatibler und funk-tioneller Zellen und Gewebe zur Rekons-truktion und zum vollständigen Ersatz
erkrankter oder funktionsunfähiger Or-gane zum Ziel. „Tissue engineering“ ist eine etablierte, allerdings noch in weiten Bereichen experimentelle Forschungs-richtung, mit dem Potenzial, die chirur-gisch-rekonstruktiven Möglichkeiten der Urologie zu erweitern. Autologes Gewe-be, mit den Methoden des „tissue engi-neering“ expandiert und modifiziert, bietet den großen Vorteil der physiolo-gischen und immunologischen Kompa-tibilität [1].
Schwerpunktmäßig werden in der Uro-logie gegenwärtig die Generierung eines mehrschichtigen Urothels für die rekons-truktive Urologie und die Stammzellfor-schung zur Regeneration der Sphinkter-funktion beforscht.
Urothel (Gewinnung, Nährmedien, Stratifizierung, Einsatz)
Mit dem Ziel der Konstruktion urothelia-ler Ersatzgewebe werden isolierte humane Urothelzellen (HUZ) nach erfolgreicher Primärkultur in vitro stratifiziert. Da-durch werden flächige, mehrlagige Uro-thelkonstrukte gewonnen. Nach Ablösen dieser mehrlagigen Konstrukte von den Kulturgefäßen, stellen diese eine Option beispielsweise für Rekonstruktionen im Bereich der Urethra dar.
Die routinemäßige Primärkultur hu-maner urothelialer Zellen erfolgt bisher nach Isolierung der Zellen aus nativem Biopsiematerial [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Hierbei besteht jedoch die Notwendigkeit
Abb. 1 7 Enzymatisch abgelöstes, in vitro
stratifiziertes Urothel-häutchen
1224 | Der Urologe 9 · 2007
endoskopischer oder offen chirurgischer Eingriffe.
In vitro stratifiziertes Urothelium aus Spülflüssigkeiten
Zur Vermeidung dieser invasiven Eingriffe wurden Studien zur Isolierung von HUZ aus Spülflüssigkeiten der Harnblase initi-iert [12]. Hierzu wurden Spülflüssigkeiten gemäß vorliegendem Ethikvotum von Pa-tienten gewonnen, bei denen eine Zysto-skopie durchgeführt wurde. Patienten mit Anzeichen für einen urologischen Tumor oder mit persistierendem Harnweginfekt wurden aus dieser Studie ausgeschlossen. Die Isolierung zellulären Materials aus den Spülflüssigkeiten erfolgte durch wiederhol-te Zentrifugationsschritte. Isolierte HUZ wurden bis zur Konfluenz in komplettem serumfreien Keratinozytenmedium kulti-viert. Die Stratifizierung der konfluenten primären Urothelkulturen wurde durch Erhöhung des Calciumgehalts im Kultur-medium induziert. Mehrlagige Urothel-häutchen wurden enzymatisch vom Kul-turgefäß abgelöst (. Abb. 1).
Das histologische Bild wies mehrere Lagen von Zellen auf, vergleichbar zum nativen Urothel. Die erhaltene Vitalität abgelöster Urothelhäutchen konnte durch erfolgreiche Etablierung von Explantkul-
turen gezeigt werden: so konnte aus klei-nen Teilen der abgelösten Häutchen ein rasches Auswachsen von Urothelzellen beobachtet werden.
Charakterisierung urothelialer Konstrukte
In den stratifizierten Zellkulturen sowie in den abgelösten Konstrukten konnte immunhistochemisch einwandfrei die epitheliale Herkunft der beteiligten Zel-len demonstriert (Anti-Panzytokeratin-Antikörper, AE1/AE3) und die Beteili-gung unerwünschter mesenchymaler Zellen ausgeschlossen werden (Antikör-per gegen Fibroblastenantigen und gegen glattmuskuläres α-Aktin). Zytokera-tin 20, ein Marker für die superfiziellen Zellen des Urothels, konnte punktuell nachgewiesen werden. Dies deutet auf ei-ne urotheliale Differenzierung der Kons-trukte hin (. Abb. 2).
Als weiteren interessanten Marker zur Charakterisierung der Urothelhäutchen wurde die Expression von p63 in strati-fizierten Kulturen und abgelösten Kons-trukten im Vergleich zu Urothelgewebe herangezogen [13]. p63 gehört zur Gen-familie p53 und spielt eine wichtige Rol-len bei der initialen Entwicklung von Epi-thelien sowie bei Proliferation, terminaler
Differenzierung und Aufrechterhaltung bestehender Epithelgewebe.
Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass die Isolierung von HUZ aus Spülflüssigkeiten der Harnblase eine alter-native, wenig invasive Technik zur Etab-lierung primärer Urothelzellkulturen dar-stellt, aus denen nachfolgend mehrlagige Urothelkonstrukte gewonnen werden können. Eine zwingende Voraussetzung für den klinischen Einsatz dieser Kons-trukte ist die mit nativem Urothelgewe-be vergleichbare Expression wichtiger Markerproteine als Hinweis auf funktio-nelle Eigenschaften. Diese Vergleichbar-keit wurde für die Marker Panzytokera-tin AE1/AE3, Zytokeratin 20 und p63 bei gleichzeitigem Ausschluss unerwünschter mesenchymaler Zellen nachgewiesen.
Verwendung von Histidin-Trypto-phan-Ketoglutarat-Lösung als Blasenspülflüssigkeit
Blasenspülungen werden gewöhnlich mit Aqua dest., isotoner Salzlösung oder mit elektrolytfreier Spüllösung (EFS) durch-geführt. Um die Erfolgsrate bei der Etab-lierung primärer Urothelkulturen aus Bla-senspülungen zu optimieren, wurden in einer nachfolgenden Studie [14] eine elek-trolytfreie Spüllösung und eine Histidin-
Abb. 2 8 Immunozytochemische Darstellung von Urothelzellkulturen vor Stratifizierung (a, b), am Tag 14 nach Indukti-on der Stratifizierung (c, d) und immunohistologische Darstellung abgelöster, mehrlagiger Urothelhäutchen. Obere Reihe Markierung mit Anti-Zytokeratin-Antikörpern AE1/AE3, untere Reihe Markierung mit Anti-Zytokeratin-20-Antikörper. Die für den jeweiligen Antikörper positiven Zellen zeigen eine Braunfärbung; Vergr. 10:1 (a–d) und 40:1 (e, f)
1226 | Der Urologe 9 · 2007
Operationsverfahren/Technische Entwicklungen – Originalien
Tryptophan-Ketoglutarat-Lösung (HTK) als Blasenspülflüssigkeit hinsichtlich des Primärkulturerfolgs getestet. HTK wird in der Transplantationschirurgie zur Perfusi-on und Spülung von Organen vor Trans-plantation und zur schonenden hypother-men Lagerung bereits entnommener Transplantate weltweit erfolgreich einge-setzt. HTK-Lösungen sind kommerziell als Produkte mit FDA-Zulassung erhält-lich.
Nach Einverständniserklärung wurden Harnblasen von Erwachsenen ohne Anzei-chen für einen Tumor oder eine Infektion mit EFS oder HTK gespült. Es konnte ge-zeigt werden, dass durch die Verwendung von HTK als Spülflüssigkeit die Erfolgsra-te bei der Etablierung primärer Urothelzel-lkulturen aus Blasenspülflüssigkeiten deut-lich erhöht und die Zeit bis zur ersten Zell-passage verkürzt werden kann [14].
Die Möglichkeit der Isolierung uro-thelialer Zellen aus Blasenspülflüssig-keiten stellt eine wichtige Alternative zu deren Isolierung aus Biopsiematerial dar. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Stei-gerung des Primärkulturerfolgs durch die Verwendung von HTK-Lösung als Bla-senspülflüssigkeit und die Tatsache, dass eine FDA zugelassene HTK-Lösung kom-merziell erhältlich ist. Im Hinblick auf die klinische Applikation autologer, urotheli-aler Ersatzgewebe sollen in weiteren Stu-dien die mechanische Stabilität der Kons-trukte weiter verbessert und ihre Funkti-onalität überprüft werden.
GMP-konformes Medium für auto-loge humane Urothelzellen
Neben der Anzüchtung und Stratifizierung zu mehrschichtigem Urothel wird der An-satz verfolgt, Urothelzellen zu vermehren, zu stratifizieren und zur endoskopischen Verabreichung mit entsprechenden Träger-substanzen für den autologen Einsatz zu optimieren. In der Vergangenheit konnte gezeigt werden, dass kommerziell erhält-liche azelluläre „small intestinal submuco-sa“ (SIS) sich dafür nicht eignen [10].
Durch den Einsatz autologer Zellen kann das Risiko der Immunreaktion na-hezu ausgeschlossen werden. Im Zuge der Harnröhrenrekonstruktion kann während der Diagnostik eine Blasenspülung durch-geführt werden und die gewonnenen Uro-
Zusammenfassung · Abstract
Urologe 2007 · 46:1224–1230 DOI 10.1007/s00120-007-1486-3© Springer Medizin Verlag 2007
K.-D. Sievert · G. Feil · M. Renninger · C. Selent · S. Maurer · S. Conrad · J. Hennenlotter · U. Na-gele · R. Schäfer · R. Möhle · T. Skutella · H. Northoff · J. Seibold · A. Stenzl
„Tissue engineering“ und Stammzellforschung in der Urologie für den rekonstruktiven bzw. regenerativen Therapieansatz
ZusammenfassungNachdem sich die rekonstruktive Urologie in den letzten Jahren neuen Gebieten gewid-met hat, konnten im Bereich „tissue enginee-ring“, nach herausragenden Ergebnissen in der Grundlagenforschung, erste Erfolge in kli-nischen Bereichen verzeichnet werden. Auch die Stammzellenforschung eröffnet weitere Bereiche bezüglich regenerativer Ansatz-punkte.
Durch die enge Kooperation der Urologie mit verschiedensten Disziplinen der Universi-tät Tübingen werden Fragestellungen mit en-gem klinischem Bezug bearbeitet. Die Rege-neration des äußeren Sphinkters bedarf funk-tionell integrierter Muskelzellen. Darüber hin-aus wird zur Rekonstruktion der Harnröhre Urothel benötigt, um nicht nur die Invasivität, sondern auch die Möglichkeit der Restriktur weiter zu verringern.
Nachdem mesenchymale Stammzellen (MSC) erfolgreich zu Muskelzellen differen-ziert und appliziert werden konnten, müssen für den klinischen Einsatz, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, die Vorraussetzungen geschaffen werden. Neben der Entwicklung entsprechender Nährmedien und Verifizie-rung im Tiermodell, wurden aus humanem
Hodengewebe omnipotente Stammzellen gewonnen und in Zellen aller drei Keimblät-ter differenziert.
Zur Herstellung eines mehrlagigen Uro-thels wurde zur Gewinnung autologer Uro-thelzellen durch die „Blasenwaschung“ die In-vasivität weiter vermindert. Entsprechende Spül- und Nährmedien verbessern die Aus-beute, die mit der entsprechenden Stratifi-zierung das mehrlagige Urothel entstehen lässt. Darüber hinaus wird im Großtiermo-dell die Applikation von Urothelzellen endo-skopisch mit entsprechenden Trägersubstan-zen zur Minimierung der Invasivität erfolg-reich untersucht.
In der Urologie werden im Bereich „tissue engineering“ und in der Stammzellforschung durch die enge Kooperation mit anderen Dis-ziplinen in kürzerer Zeit und mit nahem kli-nischem Bezug neue therapeutische Ansatz-möglichkeiten für die rekonstruktive und re-generative Urologie eröffnet.
Schlüsselwörter„Tissue engineering“ · Stammzellen · Unterer Harntrakt · Sphinkter · Urothel
Tissue engineering and stem cell research in urology for a reconstructive or rengenerative treatment approach
AbstractWith the involvement of clinical reconstruc-tive urology in the field of tissue engineering, outstanding results have been achieved in basic research as well as in some clinics. Stem cell research has even opened up possibilities for regenerative aspects.
In close cooperation with various disci-plines, the Department of Urology at the Uni-versity of Tübingen investigates different clin-ical aspects with regard to reconstructive and regenerative urology. The regeneration of the external urethral sphincter requires function-ally integrated muscle cells. In addition stric-ture reconstruction with multilayer urotheli-um should become less invasive and the re-stricture rate reduced.
After the application of differentiating stem cells was proven, the clinical setting needed to be set for legal issues. In addition to the specification of culture media and ver-ification in the animal model, the possibility
to harvest omnipotent stem cells out of hu-man testis and to differentiate those into the three germ layers was demonstrated.
With the reduced invasiveness of harvest-ing the urothelium cells by a bladder wash using specific culture fluids, the cell culture was significantly improved enabling success-ful creation of urothelium by stratification. In addition urothelial cells in a matrix are further improved for endoscopic application.
The close cooperation of different disci-plines shortens the time to develop thera-peutic approaches with a close clinical rela-tionship in reconstructive and regenerative urology.
KeywordsTissue engineering · Stem cells · Lower urina-ry tract · Sphincteram Universitätsklinikum Tübingen · Urothelium
1227Der Urologe 9 · 2007 |
thelzellen unter optimalen Bedingungen kultiviert und vermehrt werden. In einem weiteren Forschungsansatz werden ande-re (z. T. kommerziell erhältliche) Nährme-dien neben bisher erfolgreich genutzten, aber nicht GMP-konformen Medien eva-luiert und für die Kultivierung von Uro-thelzellen weiter optimiert.
Therapeutische Zell- bzw. Gewebe-transplantate inklusive der Kulturmedi-en sind Rezepturarzneimittel, die phar-mazeutische Qualität aufweisen müssen. Die derzeitigen Zellkulturmedien für die Kultivierung von humanen Urothelzel-len enthalten entweder fötales Kälberse-rum (FKS) oder Rinderhypophysenex-trakt (BPE). Supplemente tierischer Her-kunft sind für GMP-konforme Medien nicht zugelassen.
Das Ziel ist die Entwicklung eines für die Herstellung von urothelialen Ersatz-geweben geeigneten Komplettmediums pharmazeutischer Qualität. Die Anzucht und die Vermehrung der Zellen wurde in komplettem Keratinozytenmedium (KS-FM mit BPE, epidermalem Wachstums-faktor und Choleratoxin) durchgeführt. Für das GMP-konforme Medium wurden ver-schiedene Ansätze untersucht. Zum einen wurde das BPE durch eine Mischung aus verschiedenen human rekombinaten Fak-toren ersetzt. Zum anderen wurde der Ein-fluss eines durch humane mesenchymale Stammzellen (MSC) konditionierten Me-diums als BPE-Ersatz auf humane Urothel-zellen analysiert. Die Kultur der MSC er-folgte in einem GMP-konformen Medium. Anschließend wurde die Vitalität und die Proliferation der Urothelzellen bestimmt. Im GMP-Medium, das mit der Ersatzmi-schung aus human rekombinaten Faktoren ergänzt wurde, waren die Vitalität und die Proliferation der Urothelzellen signifikant verringert. In dem MSC-konditionierten Medium konnte bei den Urothelzellen eine annähernd gleiche Vitalität und Proliferati-on im Vergleich zur Kontrolle nachgewie-sen werden. Das durch MSC konditionierte Medium hat einen positiven Effekt auf die Vitalität und die Proliferation und bietet ei-nen vielversprechenden Ansatz für die Kul-tivierung nach GMP-Bedingungen.
In einem weiteren Ansatz wird evalu-iert, in welcher Weise Trägersubstanzen dazu beitragen können, für einen endosko-pischen Ansatz die generierten Urothelzel-
Abb. 3 8 a Setzung der Striktur mittels Ligatur. b Radiologische Aufnahme von der Harnröhrenstrik-tur, Kennzeichnung des verengten Lumens durch Pfeilmarkierung
Abb. 4 8 a Aufnahme eines Gewebeschnittes einer Urethra, dargestellter Ausschnitt: Lumen mit Uro-thel im resezierten Strikturbereich (PKH26-Färbung, Vergr. 200:1, rot PKH26-markierte, implantierte, autologe Urothelzellen). b Aufnahme eines Gewebeschnittes einer Urethra, dargestellter Ausschnitt: Lumen mit Urothel im resezierten Strikturbereich (rot PKH26-markierte, implantierte, autologe Uro-thelzellen, blau Kernfärbung mit DAPI, Vergr. 200:1)
Harnblase
Blasenhals/prox. Harnröhre
Abb. 5 9 Applikation PKH26-markierter, dif-ferenzierter MSC in die proximale Harnröhre
Abb. 6 8 Nachweis der applizierten Zellen 7 Tage nach Injektion in die proximale Harnröhre. a Häma-toxylin-Färbung. b Fluoreszenz der PKH26-markierten Zellen
1228 | Der Urologe 9 · 2007
Operationsverfahren/Technische Entwicklungen – Originalien
len im Rahmen des rekonstruktiven An-satzes zu verbessern. Nach dem aktuellen Entwurf der EMEA 2007 müssen bereits in vitro die Zellen mit der Trägersubstanz zu-sammengeführt werden, um deren Zusam-menwirken evaluieren zu können.
Um den Einsatz der konzipierten Uro-thelien mit Trägersubstanzen bzw. mehr-schichtigem Urothel in seiner Verwend-barkeit zu überprüfen, bedurfte es der Entwicklung eines Tiermodells.
Großtiermodell zur Etablierung der Therapie von komplizierten Harnröhrenstrikturen
Derzeit existieren keine etablierten expe-rimentellen oder klinischen Verfahren zur Therapie von Harnröhrendefekten mittels „tissue engineering“. Ziele waren die Etab-lierung eines Großtiermodells für die Therapie von komplizierten Harnröhren-strikturen und die Entwicklung einer ge-eigneten Therapie durch Implantation von autologen Urothelzellen in den rese-zierten Strikturbereich.
Für das Großtiermodell wurden Mi-nipigs verwendet. In der ersten Operati-on erfolgte eine Verengung durch Liga-tursetzung. Das Ergebnis wurde radiolo-gisch überprüft und dokumentiert. Um einen guten Urinabfluss trotz Harnröh-renverengung zu gewährleisten, wurde ein künstlicher Harnblasenausgang angelegt. Für die Isolierung autologer Urothelzellen wurde ein Gewebestück aus der Harnbla-se gewonnen.
Die gesetzten Harnröhrenstrikturen wurden nach der Methode von Sachse mit einem Kinderurethrotom endosko-pisch unter Sicht aufgeschlitzt. Anschlie-ßend erfolgte die Applikation der autolo-gen Urothelzellen, die vor der Implantati-on mit dem Fluoreszenzfarbstoff PKH26 markiert und mit stabilisierter Hyaluron-säure vermischt worden waren, über ei-nen Katheter in den Strikturbereich. Um eine erfolgreiche Integration der implan-tierten Zellsuspension zu erreichen, wurde der Schlitzungsbereich durch Ballonkathe-ter begrenzt. Die Gewebeintegrität wurde histologisch untersucht. Die Detektion der implantierten Urothelzellen erfolgte durch den Nachweis der PKH26-Fluoreszenz.
Die Einengung der Urethra durch Li-gatursetzung war eine effektive und ein-
fache Methode für die Etablierung einer Harnröhrenstriktur. (. Abb. 3) Im Ver-gleich zur nativen Urethra konnte im Strik-turbereich bei den Kontrollschweinen eine deutliche Einengung des Lumens nachge-wiesen werden. Im resezierten Bereich war die lokale Integration der transplantierten, autologen Urothelzellen mittels PKH26-Fluoreszenz nachweisbar. (. Abb. 4).
Derzeit werden Untersuchungen zur biologischen Funktion der transplan-tierten Urothelzellen durchgeführt. Die erfolgreiche Etablierung eines Großtier-modells am Minipig zur Untersuchung der endoskopischen Therapie kompli-zierter Harnröhrenstrikturen mit autolo-gen Urothelzellen erlaubt weitere Studien mit dem Ziel der klinischen Anwendung.
Stammzellen (differenziert, undifferenziert)
Adulte Stammzellen werden mittels geeig-neter Verfahren aus dem entsprechenden Gewebe separiert und in speziellen Kul-turen expandiert und unter entsprechenden Bedingungen zu den entsprechenden Zell-typen differenziert. Die differenzierten Zel-len werden im Rahmen des „tissue engi-neering“ auf geeignete formgebende Struk-turen oder Trägermaterialien aufgebracht oder als Zellsuspension (je nach Anwen-dung) xenogen (artfremd), allogen (gene-tisch differente Individuen, gleiche Spezies) oder autolog eingesetzt. Sie werden dabei direkt oder mit Trägersubstanzen an den gewünschten Ort appliziert. Gegenwärtig werden in der Regel autologe Zellen, die mittels einer Biopsie aus entsprechendem Gewebe gewonnen wurden, in Kultur ex-pandiert und letztendlich in den Spender zurück implantiert [15].
Der Forschungsschwerpunkt der Sphinkterregeneration beinhaltet die Eva-
luation von Stammzellen aus unterschied-lichen Ursprüngen. Anstelle der bekannten Differenzierung myogener Stammzellen werden die Möglichkeiten der Verwen-dung mesenchymaler und adulter sperma-togonaler Stammzellen untersucht.
In einem ersten Forschungsansatz in Kooperation mit der Transfusionsme-dizin und der Klinik für Innere Medizin werden die Möglichkeiten der MSC-The-rapie für die Urologie im Bereich der my-ogenen Regeneration evaluiert. Im tier-experimentellen Ansatz wurden Stamm-zellen aus dem Knochenmark gewonnen. Für den späteren klinischen Einsatz wird bereits die Möglichkeit der Gewinnung und Differenzierung von MSC aus peri-pherem Blut geprüft.
Myogen differenzierte mesenchy-male Stammzellen (MSC) zum Ein-satz bei der Belastungsinkontinenz
Die Belastungsinkontinenz wird mit der Verletzung der Sphinkters bzw. der alters-bedingten Apoptose von muskulären und neurogenen Strukturen in Zusammen-hang gebracht. Daher scheint die Regene-ration unter Einsatz von MSC eine mög-liche Therapieoption zu sein. Ziel eines laufenden Projektes ist es, myogen diffe-renzierte MSC in den Harnröhrensphink-ter zu integrieren und in der zeitlichen Achse zu verfolgen. Die Stammzelldiffe-renzierung wurde durch 5-Acacytidin ein-geleitet und immunzytochemisch mit mo-noklonalen Antikörkern für die glatte bzw. quergestreifte Muskulatur unter-sucht. Unter der gegenwärtigen Differen-zierung wurden in 50–90% aller Zellen glattmuskuläres α-Aktin und in ca. 20% glattmuskuläres α- und γ-Aktin nachge-wiesen, während nur vereinzelt Zellen MyoD-positiv waren.
Abb. 7 8 44 Tage nach Injektion PKH26-markierter Zellen. a Hämatoxylin-Färbung, b PKH26-Fluores-zenz
1229Der Urologe 9 · 2007 |
Im Rattenmodell werden mit dem Flu-oreszenzfarbstoff PKH26 markierte Zel-len in den Blasenhals injiziert (. Abb. 5). Ziel ist die Integration und das Überleben der applizierten Zellen in den bestehen-den Zellverband zu belegen.
Histologische Untersuchungen zeigten am Applikationsort nach 2, 4 und 7 Tagen (. Abb. 6) den direkten Nachwies appli-zierter Zellen. Nach 44 Tagen (. Abb. 7) bzw. 18 Wochen findet sich eine homo-gene Verteilung PKH26-markierter Zel-len in der kompletten Zirkumferenz.
Die ersten Ergebnisse lassen darauf schließen, dass durch Injektion von diffe-renzierten MSC eine autologe funktionelle Regeneration des Kontinenzmechanismus als Therapieansatz möglich ist [16].
Der Nachweis, dass durch den Einsatz von MSC in differenzierter Form die Re-generation der Sphinkterfunktion erzielt werden könnte, ließ die Überlegung auf-kommen, ob und welche adulten omni-potenten Stammzellen auf eine einfache Weise in hoher Konzentration gewonnen werden können, um die gesehenen Ergeb-nisse zu optimieren.
Mit Ethikvotum der Universität Tü-bingen wurden aus humanen testikulären Proben bereits spermatogonale Stamm-zellen isoliert. Im Projekt „Isolierung und Differenzierung von humanen adulten spermatogonalen Stammzellen zum Ein-satz in der zellbasierten Schließmuskeler-satztherapie“ konnte darüber hinaus die Differenzierung in Richtung aller drei Keimblätter bei entsprechenden Kultur-bedingungen erzielt werden.
Dieser recht junge Bereich der adulten omnipotenten Stammzellforschung, der die ethischen Bedenken der embryonalen Stammzellforschung nicht berührt, bedarf einer neuen konzeptionellen Vorgehens-weise, die in der Kooperation mit dem Ana-tomischen Institut mit der entsprechenden Zielsetzungen Rechnung getragen wird:F Isolierung der adulten spermatogona-
len Stammzellen,F Entwicklung geeigneter Kulturbedin-
gungen/Wachstumsfaktoren zur Dif-ferenzierung der spermatogonalen Stammzellen in die entsprechenden Gewebetypen,
F Etablierung von geeignetem Trans-port und Lagerung.
Die ersten viel versprechenden Ergebnisse zeigen die Bildung stammzellhaltiger Cluster und nach Aufreinigung der Zell-kultur durch das „magnetic activated cell sorting“ die Differenzierung in neurale, pankreatische, osteogene und myogene Zellen. Die Omnipotenz der so gene-rierten Vorläuferzellen und die Gewebe-spezifität der sich daraus entwickelnden Zellen wurde durch Transplantation in Nacktmäuse und mittels PCR, ELISA und Immunhistochemie belegt [17].
Der genannte urologische Schwer-punkt im Bereich der Universität Tübin-gen konnte durch die Kooperation mit verschieden Bereichen der Klinik und der Grundlagenforschung erste entscheidende Schritte zur Entwicklung neuer Therapie-ansätze in der rekonstruktiven und rege-nerativen Urologie schaffen.
Durch die enge Verknüpfung der Ba-sisforschung und der klinischen Gegeben-heiten können nicht nur die GMP-Bedin-gungen für die Züchtung untersucht wer-den, sondern im gleichen Zuge die Urothel-zellen in einem minimal-invasiven Eingriff gewonnen und optimierte Transportmedi-en etabliert werden. Dieses Ineinandergrei-fen der Abläufe ist die Grundlage für die er-folgreiche Durchführung. Die parallel und erfolgreich durchgeführten Tierversuche prüfen die Machbarkeit für den Einsatz in der Klinik. In ähnlicher Weise sind die Er-gebnisse bezüglich der Regeneration mus-kulärer Strukturen zu sehen. Durch den im Tierversuch erfolgreich durchgeführten Einsatz mesenchymaler und kürzlich auch spermatogener Stammzellen sind Wege zu neuen Therapieoptionen eröffnet worden.
Durch die Integration und Differenzie-rung applizierter Stammzellen kann deren Funktionalität verbessert bzw. wieder her-gestellt werden. Es bedarf der zukünftigen weiterführenden Forschung, um nicht nur muskuläre sondern auch nervale Struktu-ren zu generieren und beide für eine opti-male Funktionsregeneration zu vereinen. Darüber hinaus lässt die Differenzierung der adulten spermatogenen Stammzellen in Zelltypen aller Keimblätter die Hoffnung zu, dass weiter Therapieoptionen auch in nicht-urologischen Bereichen eröffnet werden.
Diese zukunftsträchtigen Ziele können nur in gemeinsamen Anstrengungen und Kooperationen erreicht werden, wie sich solche bereits an der medizinischen Fa-
kultät der Universität Tübingen etabliert haben.
KorrespondenzadresseProf. Dr. K.D. SievertKlinik für Urologie, UniversitätsklinikumHoppe-Seyler-Straße 3, 72076 Tü[email protected]
Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Literatur
1. Corvin S, Feil G, Stenzl A (2004) Tissue engineering of the urethra and ureter. Urologe A 43: 1213–1216
2. Southgate J, Masters JRW, Trejdosiewicz LK (2002) Cul-ture of epithelial cells. In: Freshney I, MG Freshney (eds) Culture of epithelial cells. 2nd edn. Wiley-Liss Inc, New York, pp 381–399
3. Atala A, Freeman MR, Vacanti JP et al. (1993) Implan-tation in vivo and retrieval of artificial structures con-sisting of rabbit and human urothelium and human bladder muscle. J Urol 150: 608–612
4. Hutton KAR, Trejdosiewicz LK, Thomas DFM, South-gate J (1993) Urothelial tissue culture for bladder re-construction: an experimental study. J Urol 150: 721–725
5. Cilento BG, Freeman MR, Schneck FX et al. (1994) Phe-notypic and cytogenetic characterization of human bladder urothelia expanded in vitro. J Urol 152: 655–670
6. Petzoldt JL, Leigh IM, Duffy PG, Masters JRW (1994) Culture and characterisation of human urothelium in vivo and in vitro. Urol Res 22: 67–74
7. Southgate J, Hutton KAR, Thomas DFM, Trejdosiewicz LK (1994) Normal human urothelial cells in vitro: pro-liferation and induction of stratification. Lab Invest 71: 583–594
8. Sugasi S, Lesbros Y, Bisson I et al. (2000) In vitro engi-neering of human stratified urothelium: analysis of its morphology and function. J Urol 164: 951–957
9. Feil G, Maurer S, Christ-Adler M et al. (2003) Cell cul-ture technique and characterisation of urothelial cells obtained from ureteral specimens. Tissue Eng 4: 839
10. Feil G, Christ-Adler M, Maurer S et al. (2006) Inves-tigations of urothelial cells seeded on commercial-ly available small intestine submucosa. Eur Urol 50: 1330–1337
11. Maurer S, Feil G, Stenzl A (2005) In vitro stratifiziertes Urothelium und seine Bedeutung für die rekonstrukti-ve Urologie. Urologe A 44: 738–742
12. Nagele U, Maurer S, Feil G et al. (2006) A new opti-on for urethral reconstruction with multilayered uro-thelium established from bladder washings. Eur Urol 5(Suppl 2): 47
13. Feil G, Maurer S, Krug J et al. (2007) Expression of p63 in human urothelial cell cultures and tissue-engi-neered urothelium: a new marker for the functionality of in vitro stratified urothelium. Eur Urol 6(Suppl 2): 97
14. Nagele U, Maurer S, Feil G et al. (2007) Primary urothe-lial cell cultures established from bladder washings: optimising cellular retrieval using HTK solution as irri-gation fluid. Eur Urol 2(Suppl 6): 138
15. Sievert KD, Amend B, Renninger M et al. (2007) Value of stem cell therapy for the treatment of stress incont-inence: Current status and perspectives. Urologe A 46: 264–267
16. Feil G, Boehmler AM, Maurer S et al. (2006) A new ap-proach for functional treatment of urinary inconti-nence with mesenchymal stem cells in a rat model. Eur Urol 5(Suppl 2): 78
17. Renninger M, Conrad S, Hennenlotter J et al. (2007) Isolation of human spermatogonial cells from testi-cular parenchyma and differentiation towards diffe-rent tissues of the three human germ layers. Eur Urol 6(Suppl 2): 138
1230 | Der Urologe 9 · 2007
Operationsverfahren/Technische Entwicklungen – Originalien