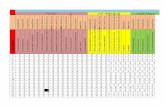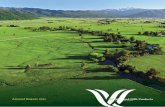Tätigkeitsbericht 2011
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Tätigkeitsbericht 2011
Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.
Tätigkeitsbericht 2010 / 2011Die DGM vertritt die Interessen ihrerMitglieder – als Garant für eine kontinuierlichinhaltliche, strukturelle und personelleWeiterentwicklung des Fachgebiets derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik.
www.DGM.de
TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011
Editorial
ED
ITO
RIA
L
2009 und 2010 waren für unsere Gesellschaftüberaus ereignisreiche und – vor allem –auch erfolgreiche Jahre. Nicht zuletzt wurdenin diesem Zeitraum wichtige Reformenbeschlossen, die bereits jetzt erste Erfolge zei-gen. Trotz Weltwirtschaftskrise ist es uns sogelungen, die DGM gestärkt und für dieZukunft gut gerüstet aufzustellen.Besonders in der Nachwuchsförderung ist indiesem Rahmen viel Positives passiert. Her-
ausragend war unter anderem die vomBMBF-finanzierte Wanderausstellung „For-schungsexpedition ins Land der Materialwis-senschaft und Werkstofftechnik“, die von denMitgliedern – etwa für einen Tag der Offenen
Tür – gemietet werden kann, ansonsten aberfester Bestandteil vom Schülerlabor inBochum ist, welches jährlich von mehr als7.000 Schülerinnen und Schüler besuchtwird. Dank der exzellenten Vernetzung derDGM wird ab 2011 auch die erste Lehrerfort-bildung zu unserem Fachgebiet im Schüler -labor in Bochum vom Lehrstuhl für Didaktikder Chemie angebotenAber auch im Bereich der Öffentlichkeitsar-
beit hat die Geschäftsstelle der DGM in denletzten beiden Jahren viel erreicht: Der neueDGM-Newsletter wird dabei ebenso gutangenommen wie die MitgliedszeitschriftAEM als Online-Version und der ersten
3
Editorial
www.DGM.de
DGM-Geschäftsstelle: Senckenberganlage 1060325 FrankfurtT 069-75306 [email protected], www.dgm.de
Schülerinnen und Schüler erproben die „Expedition ins Land der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik“
Internationaler Nachwuchs auf der MSE2010 in Darmstadt.
EditorialSeite 3
Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit Seite 8
Fachausschüsse und Technologie transferSeite 16
Fortbildungen und NachwuchsförderungSeite 24
Beratung von Wissenschaft und WirtschaftSeite 41
Tagungen und sonstige VeranstaltungenSeite 45
Nationale und internationale VernetzungSeite 55
DGM-Gremien und DGM-GeschäftsstelleSeite 63
DGM-Jahresabschluss 2010Seite 70
Editorial
Editorial
4 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
DGM-Tätigkeitsbericht: ein Trend, den wir2011 mit einer DGM-Imagebroschüre für diebreite Öffentlichkeit, dem DGM-Studien -führer „Checkpoint Zukunft“ für Abiturien-tinnen und Abiturienten sowie einer Werk-stoff-Wikipedia als Wissensdatenbankweiterzuführen gedenken.
Zuverlässig und verständlichBei den Mitgliedern genießt die DGMohnehin bereits ein sehr hohes Maß an Zuver-lässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Anse-hen. Das zeigen die Ergebnisse der erstenOnline-Mitgliederbefragung, die vom Mar-keting-Lehrstuhl in Freiberg unabhängigdurchgeführt wurde. Hieraus lassen sich vie-le Handlungsempfehlungen für die nächstenJahre ableiten, die der DGM helfen, sich alsführende Fachgesellschaft im Zentrum derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnikin Deutschland weiter zu etablieren. Nichtzuletzt das Ansehen der DGM in der Wissen-schaft wurde als ausgezeichnet beurteilt unddie Kommunikation mit der DGM-Geschäfts-stelle als überaus positiv eingeschätzt, vorallem hinsichtlich der Verlässlichkeit undVerständlichkeit von Informationen sowieder Freundlichkeit und Höflichkeit der Mit-arbeiter: Beste Voraussetzungen also zur Wei-terentwicklung unserer Fachgesellschaft.Zur Weiterentwicklung trug auch die Breit-bandtagung „MSE2010“ an der TU Darm-stadt bei, die erstmals nach neuem Konzeptausgerichtet wurde. Mit über 300 Doktoran -
dinnen und Doktoranden aus aller Welt undinsgesamt 1.000 Besuchern (inklusive SideEvents) konnte die MSE2010 ihrem Motto„Young Researchers meet Professionals“ voll-auf gerecht werden. Die nächste MSE2012wird deshalb nach ähnlichen Vorgaben vom25. bis 27. September 2012 ebenfalls an derTU-Darmstadt durchgeführt.
Neue Mitglieder von der BasisIn diesem Zusammenhang können wir aucheine erfreuliche Zwischenbilanz der auf derMitgliederversammlung 2009 beschlossenenDGM-Basismitgliedschaft ziehen, die über550 Nicht-Mitglieder über einen in der Teil-nahmegebühr zur MSE2010 enthaltenen För-derbeitrag erhielten. Die Basismitgliedschaftläuft ein Jahr und endet danach automatisch.
Dabei erhält das Basismitglied ein dreimona-tiges Probeabo der AEM sowie Zugriff aufdie Online-Vorjahresausgabe der Zeitschrift.Die Reaktionen der Basismitglieder aus allerWelt fiel überraschend positiv aus. Bereits vorAblauf der Basismitgliedschaft wechseltenviele in die Vollmitgliedschaft. Der Vorstandbeschloss daraufhin eine Ausweitung derTestphase des Modells für weitere zwei Jahreauf alle Tagungen der DGM. Einen neuen Weg weisen auch die von derMitgliederversammlung 2010 beschlossenenDGM-Regionalforen, die die DGM durchortsgebundene Aktivitäten noch besser sicht-bar machen und so neue Mitglieder gewin-nen, bestehende Mitglieder binden und ins-besondere den Nachwuchs frühzeitigansprechen sollen. Das erste Regionalforum
Klausur der Fachausschuss- und Arbeitskreisleiter zum DGM-Tag 2010 in Darmstadt.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Nachwuchskarriereworkshop von BVMatWerk und DFG im Rahmen derMSE2010 in Darmstadt.
Spezielle DGM-Fortbildungen für Doktorandinnen und Doktoranden aus Wissenschaft und Industrie.
5TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Editorial
Editorial
soll am 15. Juni 2011 in Dresden im Rahmendes DGM-Tages gegründet werden. WeitereAngebote zur Gründung von DGM-Regio-nalforen liegen bereits vor.Besonders erfreulich sind auch die Fortschrit-te bei den Fachausschüssen. Auf Vorschlagder Fachausschuss- und Arbeitskreisleiterwurde im Vorstand für die jährlich über 2.000Nicht-Mitglieder der DGM die Zahlung einesFörderbeitrags in Höhe von 50 Euro nachdem zweiten Besuch einer Sitzung ab 2011beschlossen. Dieser Förderbeitrag geht aufein Gemeinschaftskonto aller Fachausschüsseund Arbeitskreise. Über die Vergabe der Mit-tel entscheiden die Leiter im Rahmen ihrerjährlichen Klausur. Ausgenommen vom För-derbeitrag sind Doktorandinnen und Dokto-randen sowie Mitarbeiter von DGM-Mit-gliedsfirmen, eingeladene Gäste undVertreter der Förderorganisationen. Die Mit-tel sollen zielgerichtet und effizient eingesetztwerden und ausschließlich der Entwicklungder Zusammenarbeit von Wissenschaft undIndustrie bzw. der Nachwuchsförderung die-nen. Zusätzlich wurde beschlossen, dass Dokto-randinnen und Doktoranden für ihre Teilnah-me an den Sitzungen die Basismitgliedschaftder DGM für ein Jahr erhalten. Durch dieseMaßnahme versprechen sich die Leiter derFachausschüsse und Arbeitskreise und derVorstand der DGM eine gerechtere Vertei-lung anfallender Kosten: Bislang trugen circa400 DGM-Mitglieder, die regelmäßig dieFachausschüsse und Arbeitskreise der DGMbesuchen, durch ihren Mitgliedsbeitrag auchdie Kosten für die etwa 2.000 Nicht-DGM-Mitglieder. Der Mehrwert durch den Besucheiner Fachausschuss- und Arbeitskreis -sitzung ist um ein Vielfaches höher einzustu-fen und muss unserer Meinung nach auchhonoriert werden.
Im Dienst des NachwuchsesAuch im Bereich der Nachwuchsförderungkann sich die Bilanz der DGM sehen lassen.So haben wir für die BVMatWerk und dieDFG bereits im dritten Jahr den Nachwuchs-karriereworkshop mit über 340 Teilnehmernausgerichtet. Insgesamt hatten sich über 1.400Doktorandinnen und Doktoranden um einenPlatz beworben. Dies verdeutlicht den enor-men Bedarf an Informationen für die nächs -ten Karriereschritte in Wissenschaft undIndustrie, sowohl in Deutschland als auchinternational.In den letzten zwei Jahren initiierte die DGM-Geschäftsstelle zudem spezielle Fortbildun-gen für den Nachwuchs. Diese greifen The-
Nachwuchskonzept der DGM mit Nachwuchskarriereworkshop, MatWerk-Akademie und Workshop zumErfahrungsaustausch.
Rege Diskussion auf dem DGM-Strategieworkshop „Modern Metals“ am 3. März 2010 in Bonn.
Neu initiierte Tagungen der DGM im Berichtsjahr 2009/10.
Editorial
6 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
men wie Projektmanagement oder Soft-Skills,aber auch das Einwerben von Drittmittelnauf.
Erfolg braucht kluge StrategiekonzepteDurch die immer wieder neue Ausrichtungder DGM-Strategieworkshops entwickeltsich die DGM zum zentralen Ratgeber rundum unser Fachgebiet. So zielte der ersteWorkshop im Oktober 2009 zum Thema„Intelligente Werkstoffe“ auf eine Förderbe-kanntmachung vom BMBF, die tatsächlich imAugust 2010 veröffentlicht wurde. Der„Modern Metals“ überschriebene zweiteWorkshop im März 2010 hatte das for-schungspolitische Ziel, die langsam aber ste-
tig sinkende Kompetenz der Metallphysik alswissenschaftliches Fundament für dengesamten Bereich der Werkstofftechnik andeutschen Hochschulen aufzuhalten. Derdritte Workshop am 22. November 2010 inAachen sollte die Frage beantworten, wo undwie Deutschland zum Thema „Modellierungund Simulation“ positioniert ist und ob neueAnsätze bestehen, die in den nächsten Jahrenelementare Veränderungen bringen. Einhelligbetonten alle Redner aus Wissenschaft undIndustrie die Notwendigkeit einer skalen -übergreifenden Modellierung. Die Botschaft kam bei den Teilnehmerinnenund Teilnehmern, aber auch bei den anwe-senden Vertretern von VDI-TZ, PtJ und DFG
deutlich an. Einhellig wurde einmal mehrklar, wie ernst die DGM ihren Auftrag füreine kontinuierlich inhaltliche, strukturelleund personelle Weiterentwicklung des Fach-gebiets der Materialwissenschaft und Werk-stofftechnik mit dem Instrument der Strate-gieworkshops nimmt.
Erkenntnistransfer befördernNeben den Tagungen zum Austausch undDiskussion von Erkenntnissen sind aber auchdie Fortbildungen der DGM von unschätzba-rem Wert zur Entwicklung unseres Fachge-bietes. Deren Leiter leisten damit einen über-aus wichtigen Beitrag, um den Erkenntnis-und Technologietransfer zwischen Wissen-schaft und Wirtschaft zu fördern. Damit lei-stet die DGM als Fachgesellschaft einen wert-vollen Beitrag zur Sicherung derWettbewerbsfähigkeit unseresTechnologiestand ortes in Deutschland. Insge-samt hat die DGM-Geschäftsführung in denletzten zwei Jahren 15 neue Fortbildungeninitiiert, weitere sind für die nächsten Jahre inVorbereitung. Ebenfalls erfreulich ist die breite Zustim-mung der Mitgliederversammlung 2010 inDarmstadt hinsichtlich der Einrichtung einesneuen DGM-Preises, der für herausragendeLeistungen im Bereich der Materialwissen-schaft und Werkstofftechnik im mittlerenLebensabschnitt verliehen werden soll.Damit kann die DGM endlich auch auf exzel-lente Leistungen in dieser Lebensphase auf-merksam machen. Erstmalig wird der Preisam 15. Juni 2011 im Rahmen des DGM-Tagesin Dresden verleihen.Aber auch die breite Zustimmung der Mit-glieder zur Umstellung auf das neue Bei-tragsmodell der DGM ist überaus erfreulich.Eigentlich war das alte Modell, welches sicham Jahresbruttoeinkommen orientierte,bereits sehr gut. Allerdings hat sich in derVergangenheit gezeigt, dass nur selten eineSteigerung des Einkommens und damit einhöher Beitrag gegenüber der Geschäftsstelleangezeigt worden ist. Seit diesem Jahr ent-scheidet nun das Alter über die Beitragshöhe.Für den Nachwuchs, Rentner, Erwerbslose,Teilzeitbeschäftigte und Technische Ange-stellte gelten allerdings besondere Tarife, sodass durch die Umstellung keine Benachteili-gung entsteht: ein gerechtes und nachvoll-ziehbares Beitragsmodell.
Skulptur „Durchbruch“ zum DGM-Preis für herausra-gende Leistungen im Bereich der Materialwissenschaftund Werkstofftechnik im mittleren Lebensabschnitt.
Der neue DGM-Vorsitzende Dr. Ulrich Hartmann (Wieland-Werke) dankt seinem Vorgänger Prof. Wolfgang Kaysserfür dessen erfolgreiche Amtszeit.
Editorial
Skulptur zur Ernennung von DGM-Regionalforen
7TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Editorial
PersonellesZum 1. Januar 2011 wurde Professor Wolf-gang Kaysser von Dr. Ulrich Hartmann alsVorsitzender abgelöst. Damit wird die guteTradition eines permanenten „Führungs-wechsels“ zwischen Wissenschaft und Wirt-schaft fortgesetzt. Professor Kaysser bleibtder DGM aber noch weitere zwei Jahre alsStellvertretender Vorstandsvorsitzendererhalten. Ebenfalls zum 31. Dezember 2010 endet dievierjährige Amtszeit von Herrn Dr. ThomasGrandke (Siemens). Herr Kaysser dankteHerrn Grandke im Namen des Vorstandesfür die offene und konstruktive Zusammen-arbeit, durch die die DGM wichtige Impulseerhalten habe. Herr Grandke seinerseits stell-te die wichtige Rolle der DGM als Netzwerkfür die Industrie heraus, von der auch erstark habe profitieren können. Er wünschteder DGM auch weiterhin gutes Gelingen. Nach sechs Jahren ist auch Dr. Frank Hein-richt (Heraeus) aus dem Vorstand der DGMausgeschieden. Professor Kaysser hob vorallem Heinrichts Leistungen in seiner Amts-zeit als Vorsitzender (2007-2008) und Stellver-tretender Vorsitzender (2009-2010) und dabeiinsbesondere seine Verdienste beim Wechselin der Geschäftsführung der DGM-Geschäftsstelle hervor. Dr. Heinricht habedurch seine sachliche, kompetente und ver-bildliche Vorgehensweise den Grundstein füreinen Neuanfang der DGM gelegt.
Zum Abschluss möchte ich Herrn Kaysserund allen Vorstandsmitgliedern für die kon-struktive Zusammenarbeit in den letztenzwei Jahren danken – und wünsche seinemNachfolger, Dr. Ulrich Hartmann, für seineAmtszeit viel Erfolg. Ich bin sicher, dass auchder nächste Tätigkeitsbericht illustrierenwird, wie stark sich die DGM im Diensteihrer Mitgliederinnen und Mitglieder und fürunser Fachgebiet hat engagieren können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine an -regende Lektüre.
Ihr
Dr.-Ing. Frank O.R. Fischer
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Dr. Thomas Grandke (Siemens) scheidet nach vier Jahren aus dem DGM-Vorstand aus.
Dr. Heinricht (Heraeus) erhielt aus den Händen von Prof. Wolfgang Kaysser einen Bildband seiner Amtszeit alsAbschiedsgeschenk.
Editorial
Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
8 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Hand auf’s Herz,liebe DGM-Mit-glieder: Wannhaben Sie zumletzten Mal einNeumitglied fürunsere Gesell-schaft geworben?Ich höre Ihre Ant-worten: „Die jun-
gen Leute wollen sich heute nicht mehr lang-fristig binden.“ „Die konkurrierendenAngebote sind so zahlreich.“ „Die tauschensich in Facebook aus, aber nicht in einer fürsie altmodischen Vereinigung von Personen.“Aufgrund solcher Gedanken ist man schnellversucht, zu resignieren. Dann muss manaber auch akzeptieren, dass die Tage unsererGesellschaft gezählt sind, so wie ein Adelsge-schlecht ohne Nachkommen ausstirbt, einVolk ohne Kinder von der Erde verschwindetoder ein Gesangverein ohne neue Sängerin-nen und Sänger eines Tages verstummt.Für unsere DGM gibt es zweifellos eine bes-sere Strategie als die Resignation. Dazu ladeich Sie ein, kurz einmal darüber nachzuden-ken, in wie vielfältiger Art und Weise undwie lange schon Sie von der DGM-Mitglied-schaft profitieren. Denken Sie an Ihren Startin der DGM, denken Sie wie oft Sie persön-
lich die DGM-Brückenfunktion zwischenWissenschaft und Praxis, zwischen Univer-sität und Industrie erlebt und genutzt haben!Denken Sie an die eine oder andere beruflicheund vielleicht sogar persönliche Freund-schaft, die sich für Sie innerhalb der DGM-Familie entwickelt hat! Denken Sie auch dar-an, dass es immer wieder Momente gegebenhat, in denen Sie stolz waren, ein DGM-Mit-glied zu sein, z. B. wenn ganz junge Werk-stofftechniker oder höchst arrivierte Material-wissenschaftler von unserer Gesellschaftgeehrt wurden.Wenn Sie all dies bedenken, wird Ihr Vertrau-en in den Wert unserer Gesellschaft aufge-frischt und gestärkt. Ich fordere Sie auf undbitte Sie, aus dieser Haltung heraus auf diejungen Vertreterinnen und Vertreter derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnikin Ihrem Umfeld zuzugehen und sie zueinem intensiven Gespräch einzuladen.Erklären Sie, wie das persönliche Netzwerkder DGM (im Kontrast zu allen virtuellenNetzwerken) die langjährige Zusammenar-beit fördert, wie dadurch gegenseitiges Ver-trauen entsteht! Ich ermuntere Sie: Laden Siedie jungen Kolleginnen und Kollegen zuunseren Veranstaltungen ein, begleiten Sie siedabei und lassen Sie sie dabei den Wert despersönlichen Austauschs, des Gesprächs von
Angesicht zu Angesicht erleben! Lassen Siedie jungen Menschen hautnah erfahren, dassSie selbst stolz sind, DGM-Mitglied zu sein!Noch ein warnendes Wort an all jene, die jetztsagen: Das ist alles recht schön und gut, aberdazu haben wir ja eine Geschäftsstelle undeinen gewählten Vorstand. Diese Personenmüssen kreativ sein und jene Aktionendurchführen, die unserer Gesellschaft neueMitglieder zuführen. Wir Mitglieder habenfür die Mitgliederwerbung keine Zeit, wirmüssen uns in dem immer stärker werden-den Druck unserer Berufswelt mit unseremganzen Engagement um unsere eigenenBelange kümmern. Falls Sie, liebe Leserin, lie-ber Leser dieser Zeilen, so denken, berück-sichtigen Sie, dass Geschäftsstelle und Vor-stand für unsere potentiellen Neumitgliederweit, weit weg sind. Dagegen sind Sie, liebeMitglieder, vor Ort. Gerade durch Ihr hohesberufliches Engagement machen Sie unsereGesellschaft für die jungen Menschen persön-lich erlebbar. Mit Ihrem persönlichen Einsatzund Ihrer persönlichen Ausstrahlung werdenSie zum attraktivsten Werbeträger unsererGesellschaft. Sie sind die DGM! Wir sind dieDGM!
Winfried J. Huppmann
aus: DGM aktuell, 4/2011
Im Jahr 2010 sind 162 Persönliche Mitgliederder DGM beigetreten. Das sind mehr als dop-pelt so viele wie noch vor 2 Jahren. DasDurchschnittsalter lag bei 32 Jahren. Im Jahr2010 haben 2094 Persönliche Mitglieder ihrenMitgliedsbeitrag entrichtet. Beitragsfrei sind40 Ehrenmitglieder und 15 Verbandskolle-gen. Insgesamt kommt die DGM damit zum31.12.2010 auf 2149 Persönliche Mitglieder.Des Weiteren hat die DGM 1011 Basismitglie-der. Die Basismitgliedschaft erhalten Nicht-DGM-Mitglieder mit dem Besuch einerDGM-Tagung für ein Jahr.Es konnten in 2010 aber auch neue Firmenund Institute von den Leistungen der DGMüberzeugt werden. 9 Institute und Firmensind 2010 der DGM beigetreten. Insgesamtgehören damit 175 Firmen und Institute demDGM-Netzwerk an.Aber diese Zuwächse an Neumitgliederndürfen uns noch nicht zufrieden stimmen.Um signifikante Steigerungen bei den Neu-
mitgliedern zu erreichen, bedarf es derUnterstützung aller DGM-Mitglieder. Profes-
sor Huppmann hat die Situation in seinemEditorial sehr trefflich zusammengefasst:
Mitgliederentwicklung 2010
Hand auf’s Herz
Neueintritte in die DGM (Stand 31.12.2010)
9TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
Mitgliederbetreuung und Ö
ffentlichkeitsarbeit
Vor einiger Zeiterhielt ich von derDGM einG ru ß s c h re i b e nanläßlich meiner40-jährigen Mit-g l i e d s c h a f t .Dadurch wurdemir erst wiederrichtig bewusst,
was ich ein Berufsleben lang von dieser „mei-ner“ Gesellschaft hatte und heute noch habe.Kurz vor meiner Promotion „warb“ michmein Doktorvater mit den Argumenten: Teil-nahme an den Hauptversammlungen undSpezialtagungen, Mitarbeit in Fachausschüs-sen und Arbeitskreisen; alles Foren, die dazudienen, eigene Ergebnisse zu präsentieren
und aktuelle Erkenntnisse der Fachkollegenzu erfahren und zu diskutieren. Später konn-ten im Verbund mit den Kollegen aus Wissen-schaft und Industrie erfolgreich Forschungs-anträge gestellt und bearbeitet werden sowieFort bildungsseminare durchgeführt werden.Über die Hauptversammlung und Gesell-schaftsnachrichten bekommt man einenÜberblick – manchmal vielleicht auch nureine Ahnung – über aktuelle Entwicklungenauf dem weiten Gebiet der Forschung undAnwendungen der Materialkunde.„Man war einfach in der DGM“, sie ist diewissenschaftlich-technische „Heimat“ fürInformation, Diskussion und Organisationdes eigenen Fachgebiets. Nicht zuletzt istman einem großen Kollegenkreis verbunden,in dem sich viele fachliche Kontakte zu
freundschaftlichen Beziehungen und anhal-tenden Freundschaften entwickelten. Auchjetzt im Ruhestand interessiere ich mich fürneue Entwicklungen in der Materialkundeund den Werkstoffwissenschaften und freuemich über aktuelle Meldungen und die per-sönliche Nachrichten.
DGM-Mitgliedschaft – lebenslang einGewinn. Ja, natürlich! Nutzen Sie es – auchals junge Wissenschaftlerinnen und Wissen-schaftler!
Dr. Hermann Jehn
aus: DGM aktuell 05/2011
Mit der DGM durchs Berufsleben
German President Christian Wulff visits Kiel University
During his inaugural visit to Schleswig-Hol-stein German president Christian Wulff,accompanied by Minister President HarryCarstensen, came to the nanolaboratory ofthe Christian-Albrechts-Universität zu Kiel(CAU). “Schleswig-Holstein is known notonly for its tourism; it also has an excellentstate university. It provides outstandingscientific achievements, as this example innanotechnology shows.” emphasized Presi-dent Christian Wulff.
“The Christian Albrecht University in Kiel isproud to welcome President Wulff to one ofour most modern establishments, the clean-room laboratory at the Faculty of Enginee-ring. As part of the planned Cluster of Excel-lence “Materials for Life,” the CAU canpresent here an additional research focus thatdemonstrates the highly interdisciplinarynature of scientists’ work today” said univer-sity president Fouquet.
Professor Quandt presented the nanolabora-tory: “It is the experimental heart of researchon “Materials for Life”. For instance, we areworking on developing intelligent materialsfor implants and probes. One example is theproduction of stents for neural application. Aproduction process for this has been patentedat Kiel University and a spinoff is in the finalphase.”In the current round of the Federal ExcellenceInitiative the Kiel University has applied for aCluster of Excellence, “Materials for Life”.Here scientists from various disciplines suchas materials science, physics, electricalengineering and medicine are investigatingintelligent materials for the medical sector.What makes this work so special is the uni-que combination of fundamental and appliedresearch, for example for the development ofmonitoring systems to increase the mobilityand the independence of patients. The nano-laboratory and the excellence cluster, which isstill in competition, should thus strengthenthe research and promotion focus of Schles-wig-Holstein in the area of health care.
aus: DGM newsletter 04/2011
From left to right: Minister-President H. Carstensen, President of the Federal Republic of Germany C. Wulff, Prof. E. Quandt, and Dr. R. Lima de Miranda in the Kiel nanolaboratory.
Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
10 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
„Leuchtturm werkstoffwissenschaftlicher Forschung“DGM begrüßt Gründung des IAM in Karlsruhe
Den Zusammenschluss von sechs Institutendes Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)zu einem Institut für Angewandte Materiali-en (IAM) ist für die DGM ein wichtigerSchritt in die richtige Richtung. Das hobDGM-Vorstandsmitglied Professor Hans-Jür-gen Christ in seinem Grußwort der DGM aufder IAM-Gründungsfeier am 18.05.2011 inKarlsruhe hervor. „Ich bin der Überzeugung, dass dadurch einLeuchtturm der werkstoffwissenschaftlichenForschung entstehen wird, der seine interna-tionale Sichtbarkeit zu einer Führungspositi-on ausbauen wird“, fasste Christ die Sicht derDGM zusammen. Keineswegs sei das neueIAM ein künstliches Konstrukt: „Alle sechsInstitute verstehen unter Werkstoff das, wasman im ersten Semester als Studierenderlernt: ein fester Stoff zur Realisierung einer
technischen Idee.“In seinem Grußwort hob Christ vor allemauch die ebenso zahlreichen wie engen Ver-bindungen zwischen den Mitgliedern desIAM und der DGM hervor. Viele Fachaus-schussleiter, aber auch Vertreter der DGM-Fachausschüsse seien am Standort angesie-delt. Auch bei den Preisen und Ehrungen, diedie DGM zu vergeben habe, seien „die IAM-Mitglieder gut dabei“.Tatsächlich hat die Zusammenarbeit zwi-schen DGM und den IAM-Mitgliedern einelange und erfolgreiche Tradition, die sichauch in koordinierten Forschungsverbündenwiderspiegelt. Christ verwies dem entspre-chend auf die seit dem Jahr 2000 DFG-geför-derten Sonderforschungsbereiche "Hochbe-anspruchte Gleit- und Funktionswerkstoffeauf Basis ingenieurkeramischer Werkstoffe“und "Entwicklung, Produktion und Qua-litätssicherung von urgeformten Mikrobau-teilen aus metallischen und keramischenWerkstoffen sowie auf das 2008 bewilligteGraduiertenkolleg "Prozessketten in der Fer-tigung: Wechselwirkung, Modellbildung undBewertung von Prozesszonen".Wie ausgezeichnet die Zusammenarbeit zwi-schen DGM und den IAM-Mitgliedern auchklimatisch funktioniert, machte Christ ineiner humorvollen und weithin beschmun-zelten Pointe seines Grußworts deutlich, inder er darauf verwies, dass rund die Hälftealler IAM-Professoren im Jahr 1962 geborenseien. „So ist 2028 eine Wiederberufungswel-le zu erwarten. Aber bis dahin ist ja noch vielZeit, die Weichen richtig zu stellen.“
Dr.-Ing. Frank O.R. FischerGeschäftsführendes Vorstandsmitglied
Karlsruher IAM-Leiter
Vier auf einen Streich - Neuer Professor imMaschinenwesen punktet bei der DFGEinstand mit vier Treffern: Die DeutscheForschungsge meinschaft (DFG) hat Prof.Christoph Leyens vom Institut für Werkstoff-wissenschaft, Fakultät Maschinenwesen derTU Dresden, gleich vier Anträge bewilligt.
Prof. Leyens ist seit Ende 2009 an der TUD.Der Wiederaufbau der Professur Werkstoff-technik erhält dadurch starke Unterstützung.Das Fördervolumen beträgt über alle vierAntragsthemen rund 1 Million Euro.Dadurch werden außerdem Stellen für dreiJungwissenschaftler und eine Reihe von stu-
dentischen Hilfskräften neu geschaffen.Im Zusammenhang mit dem von Prof. Ley-ens initiierten und koordinierten Schwer-punktprogramm 1299 „Adaptive Ober-flächen für Hochtemperaturanwendungen -Das Haut-Konzept“ (www.spp-haut.de) wer-den das Koordinatorprojekt des in der zwei-
Mitglied des DGM-Beraterkreises, Professor Christoph Leyens, punktet bei der DFG!
Prof. Dr. Hans-Jürgen Christ
11TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
Mitgliederbetreuung und Ö
ffentlichkeitsarbeit
ten Förderphasebefindlichen Pro-gramms sowiezwei wissen-schaftliche Projek-te über jeweils dreiJahre gefördert.Gemeinsam mitder RWTHAachen werdenMetall-Keramik-Nanolaminate auf
der Basis von MAX-Phasen Dünnschichtenerforscht, die als Schleifkontakte für Elektro-motoren oder als Erosionsschutzschichtenauf Triebwerkschaufeln Verwendung findenkönnten.Um Triebwerke geht es auch im zweiten For-schungsprojekt, bei dem in Kooperation mitdem Deutschen Zentrum für Luft- undRaumfahrt, der DECHEMA und der TU Ber-lin haifischhautähnliche Strukturen auf Tur-binenschaufeln zur Reduzierung desStrömungs widerstandes und zur Selbstreini-gung im Fokus der Forschungsarbeiten ste-
hen.Außerhalb des Schwerpunktprogramms,aber ebenfalls mit Bezug zur Entwicklunginnovativer Werkstoffsysteme, steht das vier-te Gemeinschaftsvorhaben mit dem Deut-schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt undder DECHEMA zur Erforschung von kerami-schen Wärmedämmschichten auf intermetal-lischen Titan aluminiden.Quelle: Informationsdienst Wissenschaft – IDW
aus: DGM aktuell, 5/2010
Prof.-Dr.-Ing. ChristophLeyens
Zum nunmehr dreizehnten Mal fand amInstitut für Werkstoffwissenschaft und Werk-stofftechnik der TU Chemnitz das traditionel-le Werkstofftechnische Kolloquium miteinem Grußwort vom GeschäftsführendenVorstandsmitglied der DGM, Dr.-Ing. FrankO.R. Fischer statt. Bei der werkstoffwissen-schaftlichen Tagung am 30. September und 1.Oktober 2010 wurde in über 80 wissenschaft-lichen Vorträgen und Posterbeiträgen überneueste Forschungsergebnisse, innovativeAnwendungen und prozesstechnische Ent-wicklungen berichtet. Die erfreulich hoheTeilnehmerzahl von 240 Gästen aus dem In-und Ausland bestätigt erneut die Akzeptanzdieser Tagung im steten Wissensaustauschmit anderen Fachkollegen.Zu den thematischen Schwerpunkten derdiesjährigen Tagung zählten das thermischeSpritzen, das galvanische Beschichten, dasAuftragsschweißen, das Veredeln von hoch-festen Aluminium- und Composite-Werkstof-
fen sowie spezielle Fragen der Oberflächen-behandlung von Werkstoffen.Zudem wurden aktuelle Forschungsergeb-nisse aus zwei Sonderforschungsbereichen inChemnitz und Freiberg präsentiert: a) SFB692 der TU Chemnitz "Hochfeste aluminium-basierte Leichtbauwerkstoffe für Sicherheits-bauteile" und b) SFB 799 "TRIP-Matrix Com-posite" der TU Bergakademie Freiberg. HerrProf. Bernhard Wielage und Herr Prof. Bier-mann als Sprecher der beiden SFBs betonenin diesem Zusammenhang ausdrücklich diegute wissenschaftliche Zusammenarbeit zwi-schen den beiden Universitäten. Einerseitsgeht es um die Verbesserung der Festigkeits-kennwerte von Aluminiumlegierungen undandererseits um das Design von Verbund-werkstoffen auf der Basis von Fe-ZrO2. Auchkonnten erste Ergebnisse eines Forschungs-verbundes (PAK 437) „Herstellung, Eigen-schaftsanalyse und Verschleißverhalten vontechnischen Oberflächen aus mikrostruktu-
rierten, metallischen Werkstoffen undBeschichtungen“ vorgestellt werden.Zu den weiteren Höhepunkten zähltensowohl der eindrucksvoll gestaltete Festvor-trag von Herrn J. Ramisch über das ProjektASCONA als auch die Verleihung der Preisefür die besten Tagungsbeiträge. Diese wur-den verliehen an: 1) Frau A. Yania (TUBAFreiberg), 2) Herrn Th. Lindner (TU Chem-nitz), 3) Herrn K. Kerber (LU Hannover) und4) Frau Dr. Kieselstein (Kieselstein GmbHChemnitz).Die wissenschaftlichen Beiträge wurden ineinem referierten Tagungsband zusammen-gefasst (www.wtk.tu-chemnitz.de).Das Institut für Werkstoffwissenschaft undWerkstofftechnik lädt am 22. und 23. Novem-ber 2010 wieder nach Chemnitz zum jährlichstattfindenden Weiterbildungskurs "Elektro-chemische Schichten - Herstellung und Cha-rakterisierung" ein. Interessenten aus derIndustrie, beruflichen Ausbildungsstättenund Forschungseinrichtungen wird mit demzweitätigen Fortbildungsprogramm ein theo-retischer und praktischer Einblick in elektro-chemische Prozesse und Verfahren sowie inWerkstoff- und Oberflächencharakterisie-rungsmethoden gegeben. Informationen zurAnmeldung und dem Kursprogramm erhal-ten Sie unter www.elch.tu-chemnitz.de. Wirfreuen uns auf Ihr Kommen.
Chemnitz, 25. Oktober 2010 Prof. B. Wielage / Prof. T. Lampke / Dipl.-Ing. D. Meyer
aus: DGM aktuell 10/2010
13. Werkstofftechnisches Kolloquium der TU Chemnitzam 30. September und 01. Oktober 2010 in Chemnitz
Strahlende Gesichter über die guten Ergebnisse aus den SFBs (v.l.n.r. Prof. Thomas Lampke, Prof. Horst Biermann,Prof. Bernhard Wielage, Dr.-Ing. Frank O.R. Fischer)
Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
12 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Die DGM-Preisträger 2010Heyn-Denkmünze 2010 Prof. Dr. Robert SingerTammann-Gedenkmünze 2010keine Verleihung Masing-Gedächtnispreis 2009Dr. –Ing. Karsten Durst
Georg-Sachs-Preis 2009 Dr. Jens Freudenberger
Werner-Köster-Preis 2009Dr.-Ing. Alexandra Hatton (geb. Velichko)Prof. Dr.-Ing. Frank Mücklich
Roland-Mitsche-Preis 2010Dr. Marianne KurzDGM-Nachwuchspreis 2010Dr. Ing. Michael Bäurer, Karlsruhe Dipl.-Ing. Manja Krüger, MagdeburgDr. Robert Maaß, Zürich
Die Deutsche Gesellschaft für Materialkundeverleiht Herrn Univ.-Professor Dr. rer. nat. Dr.h. c. Günter Gottstein die Ehrenmitgliedschaftin Würdigung seiner bahnbrechenden experi-mentellen und theoretischen Arbeiten zurKorngrenzenkinetik und Gefügeentwicklung.In der DGM widmete sich Herr Gottstein vieleJahre auch als Vorstand der Weiterentwicklungder Gesellschaft sowie der bundesweiten Ver-einheitlichung des Faches Materialwissen-schaft und Werkstofftechnik. Insbesondere dieFörderung des Nachwuchses in der DGM undin der Materialwissenschaft liegt ihm am Her-zen.
Günter Gottstein hat seine Laufbahn an der THAachen mit einem Physikstudium begonnenund blieb in Aachen bis zu seiner Habilitation1979. Daraufhin folgte ein mehrjähriger For-schungsaufenthalt in den USA, wo er zumSchluss die Position eines Full Professors ander Michigan State University inne hatte. Vondort folgte er 1989 dem Ruf zur Nachfolge sei-nes früheren Mentors, Prof. Lücke. Seitdem istGünter Gottstein erfolgreich in Aachen tätig.In der Materialwissenschaft gelten die Interes-sen von Günter Gottstein insbesondere demZusammenhang zwischen Gefüge und Eigen-schaften, also einem klassischen Gebiet derMaterialwissenschaft. Sein Ziel war es hierbei,basierend auf grundlegenden Experimenten zueinem quantitativen Verständnis der Gefüge-entwicklung zu kommen. Durch den rechtzeitigen Aufbau einer Gruppe,die moderne materialwissenschaftliche Vorstel-lungen in Algorithmen für die Computersimu-lation umsetzte, gelang es der Gruppe umHerrn Gottstein, Gefüge und Eigenschaften imModell so zu verknüpfen, dass man in die Lageversetzt wurde, Werkstoffe und ihre Eigen-schaften gezielt zu optimieren bis hin zur indu-striellen Anwendung. Diese Vision hatte Herr Gottstein schon bei derEinrichtung der Gruppe und er hat sie bis heu-te konsequent weiterentwickelt. Dies führte zu
zwei Sonderfor-schungsbereichen,die die Computer-simulation zumInhalt hatten.Einer davon "Inte-gral MaterialModelling, SFB370" wurde vonihm gegründetund erfolgreichgegen viele Zwei-
fel, ob man Eigenschaften von Werkstoffen imComputer simulieren kann, über zwölf Jahredurchgeführt. Der zweite "Stahl - ab initio, SFB761", bei dem die Gruppe von Herrn Gottsteinund die Gruppen ehemaliger Schüler tragendeMitglieder sind, beschäftigt sich mit der Frage,ob man nicht heute quantenmechanische Methoden zum Verständ-nis und zur Weiterentwicklung neuer Werk-stoffe heranziehen kann. Gerade dieses Themazeigt besonders deutlich die treibende Kraft inder Forschung von Günter Gottstein, sorgfälti-ge manchmal auch schwierige und zeitaufwen-dige Experimente durchzuführen, die es erlau-ben, quantitative Schlüsse zu ziehen. Diesedann zu modellieren bis hin zur Quantenme-chanik, um Gleichgewichte und Diffusionspro-zesse besser zu verstehen. Dabei bleibt er nicht stehen, als gelungene Per-sonalunion zwischen Physiker und Ingenieurmöchte er seine Erkenntnisse in die Anwen-dung übertragen, um der Gesellschaft denMehrwert der Forschung zu verdeutlichen.Sein Institut beschäftigt sich mit einer Reihevon Forschungsthemen, seine besondere Liebegalt immer den Korngrenzen. In eleganten Ver-suchen an Bikristallen mit wohlüberlegtenGeometrien (Bikristalle in Form eines Kuchen-stücks, um eine definierte geometriebedingtetreibende Kraft zu erhalten) oder in in-situExperimenten im Temperaturgradienten unter-suchte er die Bewegung der Korngrenze alsFunktion der Orientierung, des Grenzflächen-
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Günter GottsteinRWTH Aachen
typs und der Segregation. Hierbei konnte erzusammen mit seinen Doktoranden zeigen,welche Rolle innere Spannungen bei der Bewe-gung von Korngrenzen spielen. Auch im aktu-ellen Gebiet der nanokristallinen und ultrafein-körnigen Werkstoffen galt sein Interesse derStabilität des Gefüges. In intelligenten Experi-menten konnte er zeigen, dass mit abnehmen-der Korngröße die Bewegung der Tripelliniendas Kornwachstum bestimmt. Diesen Über-gang des Wachstumsverhalten konnte er dannin einem sehr schönen Modell quantitativbeschreiben. Solche interessanten und einmali-gen Experimente bleiben nicht ohne Folgen, sodass Günter Gottstein neben anderen Ehrun-gen 1982 den Masing-Preis, 2003 die Heyn-Denkmünze und 2005 den Werner Köster Preiserhielt.Aber auch als Organisator von Forschung warGünter Gottstein sehr aktiv, wobei ihm insbe-sondere die gute Ausbildung und die Chancendes heimatlichen Nachwuchses am Herzen lie-gen. Hier engagierte er sich in vielen Gesell-schaften und an der Universität. Er übernahmsogar den Vorsitz der DGM von 2005 bis 2006und diente als Dekan von 1996-1998 an derFakultät für Bergbau, Hüttenwesen und Geo-wissenschaften. Eines seiner Ziele war, dass dieWerkstoffwissenschaft in Deutschland alsFachgebiet sichtbar wird. Deshalb engagierte ersich sehr für die Einführung eines einheitlichenNamens an allen Universitäten was schließlichzur Bezeichnung "Materialwissenschaft undWerkstofftechnik" führte.Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft anGünter Gottstein, der sowohl als Wissenschaft-ler als auch als aktives Mitglied bis hin zumVorsitz der DGM viel für die DGM und dieWerkstoffwissenschaft getan hat, ist deshalbnur die logische Konsequenz einer erfolgrei-chen Karriere.
Horst Vehoff, Saarbrücken
DGM-Ehrenmitgliedschaft 2010
13TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
Mitgliederbetreuung und Ö
ffentlichkeitsarbeit
Die Deutsche Gesellschaft für Materialkundeverleiht Herrn Professor Dr. phil., Dr. techn.mult. Hellmut Fischmeister die Ehrenmitglied-schaft in Würdigung seiner außerordentlichenVerdienste um die Materialwissenschaft alsWissenschaftler, Institutsleiter, und Wissen-schaftsmanager. Sein wissenschaftliches Wir-ken steht für die erfolgreiche Verbindung vongrundlegender und angewandter Forschungan modernen Werkstoffen; seine inspirierendePersönlichkeit hat eine Vielzahl junger Kolle-gen – in mehreren europäischen Ländern - aufihrem Berufsweg beflügelt. Als Gründungsdi-rektor eines Max-Planck-Instituts in Halle/Saa-le hat er sich außerdem maßgebend für denwissenschaftlichen Aufbau Ost engagiert.
Professor Hellmut Fischmeister (Jahrgang1927) ist einer der herausragenden Werkstoff-wissenschaftler, die das interdisziplinäreGebiet auf europäischer und internationalerEbene, wissenschaftlich wie wissenschaftspoli-tisch, vertreten und vorangetrieben haben. SeinWerdegang führt ihn in mehrere europäischeLänder, in denen er nachhaltig seine Spurenhinterlässt. Nach der Promotion in Physikali-scher Chemie an der Universität Graz im Jahr1951 wird er Forschungsassistent an der Uni-versität Uppsala (Schweden), dann in FolgeLeiter der Entwicklungsabteilung bei der LMEricson Telefongesellschaft in Stockholm undLeiter des neu gegründeten Laboratoriums fürPulvermetallurgie bei Jernkontoret, dem Inter-essenverband der schwedischen Stahlindustriein Stockholm. 1961 wird er zum Forschungsdi-rektor des Edelstahlwerks der Firma StoraKopparberg in Söderfors bestellt. Im Jahr 1965folgt er einem Ruf als Ordinarius und Vorstanddes neu gegründeten Instituts für Konstrukti-onswerkstoffe an die Chalmers TechnischeHochschule in Göteborg. 1975 wird er zumOrdinarius und Vorstand des Instituts fürMetallkunde und Werkstoffprüfung an dieMontanuniversität Leoben berufen. Schließlicherreicht ihn 1981 das Angebot der Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftliches Mitglied undDirektor des Instituts für Werkstoffwissen-schaft am Max-Planck-Institut für Metallfor-schung in Stuttgart zu werden. Im Jahr 1993wird er zum Honorarprofessor an der TU Grazbestellt, später bekleidet er dieselbe Funktionan der TU Graz und an der MontanuniversitätLeoben. 1995 wird er aus dem MPI für Metall-forschung emeritiert.Hellmut Fischmeister war in seiner aktivenZeit Pionier auf zahlreichen zukunftsweisen-den Gebieten der Werkstoffwissenschaft. Früherkannte er, dass die „Nahtstelle“ – er selbstvermeidet den irreführenden Begriff „Schnitt-stelle“ - zwischen Grundlagen und Anwen-dung ein intellektuell höchst anspruchsvollesArbeitsgebiet abgibt. „Die komplexen Werk-stoffe der Technik sind zu einer Herausforde-
rung für dieGrundlagenfor-schung gewor-den“, so drückte erseine Überzeu-gung einst ineinem Interviewaus. Zuallererst istdabei die Pulver-metallurgie zunennen; er gehörtzu den herausra-
genden Wissenschaftlern weltweit, die sicherfolgreich um die Fundierung dieses technolo-gisch höchst anspruchsvollen Gebiets verdientgemacht haben. Beispiele sind die Mechanis-men des Schmiedens, des Sinterns und dermechanischen Verdichtung von Metallpulvern,die alle wesentlich die Eigenschaften des Pro-dukts bestimmen, aber bis dahin meist empi-risch optimiert wurden. Diese Arbeiten warenvon großem Interesse für die Plansee AG inReutte, mit der er viele Jahre eng verbundenwar. Darüber hinaus befasste er sich in Schwe-den mit der Mechanik von Mehrphasenwerk-stoffen, der Oberflächenanalytik und der quan-titativen Gefügecharakterisierung. In seinerLeobener Zeit widmete sich Hellmut Fischmei-ster u.a. den Mechanismen der Erstarrung, dieer mit Mitarbeitern sowohl unter terrestrischenals auch unter Weltraumbedingungen erforsch-te; daraus konnten wesentliche Erkenntnissefür die Optimierung von Hochleistungslegie-rungen gewonnen werden. Außerdem fallen indiese Zeit aufsehenerregende Arbeiten über dieAusscheidungskinetik in Schnellarbeitsstählen.Auch in Stuttgart konnte er trotz großer admi-nistrativer Belastung international herausra-gende, inzwischen hoch zitierte Arbeiten veröf-fentlichen. Besonders hervorzuheben ist diemit Mitarbeitern umgesetzte Idee, Rissausbrei-tung in kubisch-raumzentrierten Metallen mit-hilfe von Computersimulationen zu untersu-chen; er war maßgeblich an der Realisierungeiner Methode beteiligt, die es erlaubte, die ato-mistische Simulation der Rissspitze mit einemFinite-Element-Modell für das Fernfeld zukombinieren. Diese Arbeit, 1991 in Philosophi-cal Magazine publiziert, ist richtungsweisendund zählt heute zu den Klassikern der Werk-stoffsimulation; sie hat eine Vielzahl weiter-führender Arbeiten in verschiedensten Laborsu.a. der Fraunhofer-Gesellschaft inspiriert.Weitere fruchtbare Arbeitsgebiete von HellmutFischmeister betreffen Korrosions- und Oxida-tionsschutzschichten, Mechanik zweiphasigerMaterialien, Elektronenspektroskopie, Zähig-keit und Bruchverhalten, Verbundwerkstoffe,hochauflösende Elektronenmikroskopie undinnere Grenzflächen von Materialien.Durch sein persönliches Beispiel und Vorbildhat Hellmut Fischmeister sein Wissenschafts-gebiet wesentlich gestaltet und geprägt. Das
Prof. Dr. phil., Dr. techn. mult. Hellmut FischmeisterGraz, Österreich
vertrauensvolle Heranführen neuer Forscher-generationen an die Wissenschaft war ihmdabei stets ein Herzensanliegen. Der Erfolg sei-ner Tätigkeit zeigt sich daher auch darin, dassviele seiner ehemaligen Schüler und Mitarbei-ter heute Professorenstellen an Universitäten,leitende Stellen in der außeruniversitären For-schung, sowie führende Industriepositioneneinnehmen. Sein konstruktiver Rat war in Bera-tungsgremien zahlreicher Forschungsorganisa-tionen gefragt und hatte wesentlichen Anteil ander Gestaltung der Förderprogramme derdeutschen Bundesregierung und der Europäi-schen Kommission. Seiner großen Erfahrungund seinem unermüdlichen Einsatz verdanktdas MPI für Metallforschung die erfolgreicheNeuorientierung in einer schwierigen Phase,aus der es als eine der führenden und meistzi-tierten Institutionen der Materialforschunghervorging. Hervorzuheben ist insbesondereauch sein außergewöhnliches Engagement inHalle/Saale bei der Überführung des ehemali-gen Instituts für Elektronenmikroskopie derAkademie der Wissenschaften der DDR in einMax-Planck-Institut, dessen Gründungsdirek-tor er einige Jahre war. Diese Aufgabe fordertenicht nur den Wissenschaftler, sondern vorallem sein auf großer Menschenkenntnis und –achtung beruhendes Urteilsvermögen. Dassdas heutige Max-Planck-Institut für Mikro-strukturphysik zu den führenden Institutionenauf seinem Gebiet gehört, ist in nicht geringemMaße seiner anfänglichen Aufbauarbeit zuzu-schreiben. Seit seiner Emeritierung hat sichHerr Fischmeister von der Welt der Wissen-schaft keinesfalls zurückgezogen: Er hat sichseither vor allem in seiner Heimat Österreich inwissenschaftspolitischen Zusammenhängenverdient gemacht. Er war von 1995 bis 2003Mitglied des Österreichischen Universitäten-kuratoriums und von 2003 bis 2009 Mitglieddes Österreichischen Wissenschaftsrats. In bei-den Funktionen wirkte er wesentlich an zentra-len Empfehlungen, insbesondere zur Entwick-lung der Naturwissenschaften in denösterreichischen Universitäten und außeruni-versitären Forschungseinrichtungen, mit.Bereits 1997 wurde ihm das Deutsche Bundes-verdienstkreuz 1. Kl. Verliehen; im Juni 2010zeichnet ihn seine Heimat mit dem Österreichi-schen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst1. Kl. aus. Der DGM stellte Herr Fischmeisterseinen Rat als Vorstandsmitglied, als Vorsitzen-der des Beraterkreises und als Sprecher desFachausschusses Materialien der Mikroelektro-nik zur Verfügung.Von seinen zahlreichen Auszeichnungen seieneinige beispielhaft erwähnt: Ritterkreuz desKöniglichen Schwedischen Nordsternordens,Fellow of the American Society for Metals,Ehrenmitglied der Société Francaise de Métall-urgie et de Matériaux, Auswärtiges Mitgliedder Schwedischen Akademie der Ingenieur-
Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
14 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Die DGM gedenkt der verstorbenen Mitglieder
Prof. Dr.-Ing. Hans Ahlborn, HamburgDr. rer. nat. Franz Braumann, WolfenbüttelProf. Dr. Günter Dlubek, LieskauDr.-Ing. Knut Escher, Völklingen
Dr.-Ing. Ulrich Feldmann, WolfenbüttelProf. Dr. Hans Jürgen Grabke, DüsseldorfProf. Dr.-Ing. Peter Klimanek, FreibergHeidemarie Knoblich, Wien, Österreich
Dipl.-Ing. Jürgen Lange, BochumDr. Jürgen Paul, WetzlarProf. Dr. Roger Thull, WürzburgHeinrich Winkelmann, Ahlen
Jubilare (Juni 2010 - Juni 2011)
50 Jahre persönliche DGM-Mitgliedschaft
Dr.-Ing. Peter C. Borbe, GarbsenDr. Wolfgang Dürrschnabel, BellenbergDr. Peter Fischer, AlbstadtDr. Hermann R. Franz, HamburgProf. Dr. Manfred von Heimendahl, GrassauProf. Dr. Günther Heimke, AlbstadtDr. Hans Hillmann, DarmstadtProf. Dr. Friedrich Klein Aalen
Dipl.-Ing. Gerhard Köhlert, Bad KrozingenDr. Hans Leo Lukas, WaldenbuchDr. Wilhelm Normann, KoblenzProf. Dr. Günter Petzow, StuttgartDr.-Ing. Horst Alfried Schulze, DürenProf. Dr.Ferdinand Stangler, Mödling,ÖsterreichDr.-Ing. Franz Strier, Schwerte
Prof. Dr. Hans Warlimont, FreigerichtDr. Jörg Wegst, HemmingenDr.-Ing. Günter Wirth, RoesrathDr.-Ing. Günther Ogiermann, Rodenbach
40 Jahre persönliche DGM-Mitgliedschaft
Josef Adels, DürenDr.-Ing. Herbert Haas, Gelnhausen
Dr.-Ing. Dieter Sauer, MeinerzhagenDr.-Ing. Manfred Schrader, Tübingen
Prof. Dr.-Ing. Hans Maria Tensi, RiemerlingDr.-Ing. Horst Wittig, Pilsach
25 Jahre persönliche DGM-Mitgliedschaft
Dipl.-Ing. Peter Baumgart, NeuenradeDr.-Ing. Manfred Bayerlein, MünchenProf. Dr.-Ing. Hans Berns, BochumDr. Ulrich Bischofberger, StuttgartDipl.-Ing. Peter Daamen, Bad Berleburg Dr. Petra Donner, BochumDr.-Ing. Werner Droste, BonnProf. Dr.-Ing. Jürgen Eckert, DresdenDr. Bernd Grieb, TübingenProf. Dr. Joachim Hammer, RegensburgProf. Dr.-Ing. Dierk Hartmann, KemptenProf. Dr.-Ing. Manfred Heiser, WolfenbüttelDr. Hans Rainer Hilzinger, Langenselbold
Dr. Rune Hoel, Oslo, NorwegenDr. Michael Hörmann, RatingenDr. Wolfgang Hoffelner, Villigen, CHDr.-Ing. Bruno Kaiser, DarmstadtDipl.-Ing. Hermine Ketteler, BottropDr.-Ing. Manfred Koschlig, BurghausenDr. Helmut Krauth, HanauDipl.-Ing. Willi Meiers, Hanau-WolfgangDipl.-Ing. Roland Müller, Reichshof-HespertDr. Jürgen Neuhaus, GarchingDr.-Ing. Ludger Ohm, Olpe-FriedrichsthalDr.-Ing. Dirk Ponge, DüsseldorfDr.-Ing. Wiebke Sanders, Düsseldorf
Dipl.-Ing. Katharina Scheler, Remseck-PattonvilleProf. Dr. Siegfried Schmauder, StuttgartDr.-Ing. Jens Schröder, Mülheim/RuhrDr. Bernd Schuhmacher, DortmundProf. Dr.-Ing. Karl Schulte, HamburgDipl.-Ing. Gerhard Stäbler, HerrenbergDr. Alfred Umgeher, Marktl, ÖsterreichProf. Dr. Knut Urban, JülichProf. Dr. Alexander Wanner, KarlsruheDr. Joachim Wecker, ErlangenProf. Dr. Gerhard K. Wolf, Heidelberg
wissenschaften, Wirkliches Mitglied der Öster-reichischen Akademie der Wissenschaften, Mit-glied der Academia Europaea (London) undder Acad. Scientiarum et Artium Europaea
(Salzburg), Sir Charles Hatchett Award, Plan-see Plakette der Plansee AG, Roland MitschePreis, Emil Heyn Denkmünze, und die Ehren-doktorate der Könglichen Technischen Hoch-
schule Stockholm, der Technischen UniversitätGraz und der Montanuniversität Leoben.
Eduard Arzt, Saarbrücken
15TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
Mitgliederbetreuung und Ö
ffentlichkeitsarbeit
Das neue Online-Portal der DGM bietet absofort den kostenfreien Zugriff auf alle Aus-gaben der DGM-aktuell und des DGM-news-letters. Darüber hinaus besteht für DGM-Mit-
glieder die Möglichkeit, sich mit ihrer DGM-Mitgliedsnummer (121912) und IhremGeburtsdatum auf die Online-Ausgaben derFachzeitschrift Advanced Engineering Mate-
rials (AEM) zuzugreifen. Einzelne Artikelkönnen mit Bookmarks versehen und ausge-druckt werden, und mit einem Knopfdruckspeichern Sie eine gesamte Ausgabe als PDFfür Ihr persönliches Archiv auf Ihrer Festplat-te ab.
Sie finden die einzelnen Bereiche des Online-Portals unter folgenden Adressen:
DGM-aktuell: http://dgm.de/dgm-info/dgm-aktuell (kostenfrei)DGM-newsletter:http://dgm.de/dgm-info/newsletter(kostenfrei)AEM:http://dgm.de/dgm-info/aem(kostenfrei für DGM-Mitglieder)
aus DGM-newsletter 05/2010
Das neue Online-Portal der DGM:DGM-aktuell, Advanced Engineering Materials (AEM) und DGM-newsletter ab sofort auf Knopfdruck
Neuer DGM-Preis ab 2011
Auf der Mitgliederversammlung 2010 inDarmstadt wurde über die Einrichtung einesneuen DGM-Preises, der für herausragendeLeistungen im Bereich der Materialwissen-schaft und Werkstofftechnik im mittlerenLebensabschnitt verliehen werden soll, ent-schieden. Damit kann die DGM auch aufexzellente Leistungen in dieser Lebensphaseaufmerksam machen. Erstmalig wird derPreis am 15. Juni 2011 im Rahmen des DGM-Tages in Dresden verleihen.
Skulptur „Durchbruch“ zum DGM-Preis für herausragende Leistungen im Bereichder Materialwissenschaft und Werkstofftechnik im mittleren Lebensabschnitt.
16 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fachausschüsse und Technologietransfer
Fachausschüsse und Technologietransfer
Wir führen die Menschen zusammen undbieten für Begegnungen den passenden Rah-men. Wir überblicken die unterschiedlichenDisziplinen und Kulturen und bauenBrücken, um Menschen privat und beruflichzu vernetzen. Darin sehen wir als DGM-Geschäftsstelle unseren Auftrag. Neben den
Tagungen und Fortbildungen spielen dabeidie über 84 Fachausschüsse und Arbeitskrei-se der DGM eine herausragende Rolle. ProJahr kommen zu den Sitzungen mehr als 2000Experten aus Wissenschaft und Industrie.Nicht zuletzt trifft sich hier auch der Nach-wuchs zum Austausch mit den etablierten
Kollegen. Neben dem Erkenntnistransfer ausder Grundlagenforschung in die Anwendungist das Netzwerk der Fachausschüsse undArbeitskreise der DGM für die Karriere vonüberragender Bedeutung.
Fachausschüsse und Technologietransfer
Liebe Mitglieder und Freunde der DGM,
die Fachausschüsse und Arbeitskreise derDGM bilden seit vielen Jahren das Rückgratder DGM. Derzeit gibt es mehr als 60 Arbeits-kreise, die in 24 Fachausschüssen organisiert
sind. Darüber hin-aus ist die DGMmaßgeblich an zahl-reichen Gemein-schaftsausschüssenmit anderen Fachge-sellschaften beteiligt.An den regelmäßigstattfindenden Fach-ausschuss- und
Arbeitskreissitzungen nehmen mehr als 2000Materialwissenschaftler und Werkstofftech-niker teil, um sich über neuste Entwicklun-gen und Trends in ihrem Fachgebiet auszu-tauschen. Bisher gibt es allerdings nur einegeringe Wechselwirkung zwischen den ein-zelnen Fachausschüssen. Um diesem Defizitentgegenzuwirken, fand beim DGM-Tag inSaarbrücken erstmals eine Klausursitzungder Fachausschuss- und Arbeitskreis leiterstatt. Zusätzlich wählten die Fach ausschuss-
und Arbeitskreisleiter einen Sprecher undStellvertretenden Sprecher, der die Anliegender Fachausschüsse im DGM-Vorstand ver-tritt.Zur aktiven Unterstützung der Vernetzungder Fachausschüsse sollen diese neu organi-siert werden. Die Einteilung kann entspre-chend der fachlichen Ausrichtung in (i) mate-rialorientierte, (ii) prozesstechnikorientierte,(iii) erkenntnisorientierte und (iv) anwen-dungsorientierte Fachausschüsse erfolgen.Materialorientierte Fachausschüsse sind bei-spielsweise Magnesium, Titan oder Polymer-werkstoffe, während prozesstechnik -orientierte Fachausschüsse sich mitFormgebungsverfahren wie Strangpressen,Stranggießen, Ziehen oder Walzen beschäfti-gen. Die erkenntnisorientierten Fachaus-schüsse behandeln eher grundlagenwissen-schaftliche Themen, wie die Simulation, dieThermodynamik, Kinetik und Konstitutionvon Werkstoffen oder beispielsweise dasWerkstoffverhalten unter mechanischerBeanspruchung. Darüber hinaus gibt es Fach-ausschüsse bei denen bestimmte Anwendun-gen das verbindende Element darstellen, wiebeispielsweise Materialien für elektronische
Anwendungen oder die Hochtemperatur-Sensorik. Die Neuorganisation der Fachaus-schüsse erleichtert auch die Identifikationvon relevanten Bereichen der Materialwis-senschaft und Werkstofftechnik in denen dieDGM bisher noch nicht aktiv ist. Daraus kön-nen dann Handlungsempfehlungen zur Ein-richtung neuer Arbeitskreise abgeleitet wer-den. Um künftig größere Synergieeffekte zwi-schen den einzelnen Fachausschüssen zuerzielen, werden gemeinsame Fachaus -schusssitzungen zwischen den einzelnenThemenfeldern angestrebt. Bei der nächstenKlausursitzung im Rahmen des DGM-Tagesin Dresden (14.06.2011) soll zunächst disku-tiert werden, wie ein Fachausschuss dasgenerierte Wissen und die Methoden dererkenntnis orientierten Fachausschüsse nut-zen kann. Wo besteht beispielsweise einBedarf für Simulationen oder welchen Bei-trag können thermodynamische Rechnungenbei der Legierungsentwicklung leisten? Wasgibt es für neue materialographische Metho-den, die zu einem besseren Verständnis derGefüge-Eigenschaftskorrelation führen?Andererseits sollen material- und prozess-
Bericht aus den Fachauschüssen der DGM
Klausur der Fachausschuss- und Arbeitskreisleiter zum DGM-Tag 2010 in Darmstadt.
17TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fachausschüsse und Technologietransfer
Fachausschüsse und Technologietransfer
technikorientierte Fachausschüsse denBedarf an neuen Methoden und Technikendefinieren.
Die Neuorganisation der Fachausschüssedient auch zur übersichtlichen Außendarstel-lung der vielfältigen Aktivitäten der DGM.
So soll gezeigt werden, in welchem Bezug dieAktivitäten der einzelnen Fachausschüsse zugesellschaftlich relevanten Themenstellun-gen, wie Energie, Mobilität, Gesundheit,Information- und Kommunikation, oderUmwelt, Rohstoffe und Recycling stehen.Interessenten aus Wirtschaft, Wissenschaftund Politik sollen damit einen schnellenÜberblick über das DGM Kompetenzportfo-lio und die entsprechenden Ansprechpartnererhalten.
Ihr Michael J. Hoffmann
Sprecher der Fachausschüsse
Prof. Hoffmann (Sprecher der FA) und Prof. Hirsch (Stellv. Sprecher der FA)
18 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fachausschüsse und Technologietransfer
Fachausschüsse und Technologietransfer
Liebe Leserin, lieber Leser,
eigentlich ist es ja allen klar: In Zeiten, woFlugzeuge immer größer und leichter, Autosimmer sicherer und sparsamer oder Handys
immer kleiner undfunkt ionsre i cherwerden, sind neueMaterialien undWerkstoffe wichtigerdenn je. Der Erfolgder deutschen Indu-strie – und der Wohl-stand der ganzenGesellschaft – hängtim zunehmenden
Maße von der innovativen Forschung in die-sen Bereichen ab.Warum aber gehen so viele hoch spannendeErgebnisse aus den Laboren der ingenieur-wissenschaftlichen Universitätsinstitute inFachzeitschriften und Publikationen unter,die kein Techniker liest? Weshalb sind Wis-senschaftlerinnen und Wissenschaftler eben-so wie Unternehmerinnen und Unternehmersowie Ingenieurinnen und Ingenieure aufihren jeweiligen Kongressen unter sich? Warum also gibt es keinen Screening-Prozess,der die Grundlagenforschung an Hochschu-len und außeruniversitären Einrichtungensystematisch auf wirtschaftlich verwertbareErkenntnisse hin untersucht? Und: Warumexistiert keine Schnittstelle zwischen Indus -
trie und Wissenschaft, die in beide Richtun-gen relevante Aufgaben formuliert und imSinn eines beidseitigen Erkenntnistransferseffektive Lösungen findet, oder eine Innova-tion bis zu ihrer Patentierung und Massen-produktion begleitet?Während meiner Tätigkeit als Programm -direktor für Materialwissenschaft und Werk-stofftechnik bei der Deutschen Forschungs-gemeinschaft (DFG) habe ich mir dieseFragen über Jahre immer wieder gestellt,ohne eine befriedigende Antwort darauf zuerhalten. Als Geschäftsführer der DeutschenGesellschaft für Materialkunde kann ich michjetzt zumindest über die Fortbildungen derDGM freuen, deren Hauptaufgabe ja darinbesteht, den geeigneten Rahmen zur Vernet-zung der Community bereitzustellen undTechniker mit Unterstützung der Hochschu-len mit den neuesten Erkenntnissen derGrundlagenforschung vertraut zu machen.Nicht weniger wichtig sind hierbei auch diezahlreichen Fachausschüsse und Arbeitskrei-se der DGM, in denen sich nicht nur Expertenaus Wissenschaft und Industrie austauschenkönnen, sondern auch der Nachwuchs „lau-fen“ und Prioritäten setzen lernt. Aber reichtdas wirklich aus? Oder gibt es Möglichkeiten,den Erkenntnistransfer noch weiter zubeschleunigen und voranzutreiben?Um diese Fragen zu klären, entstand imGespräch mit Kolleginnen und Kollegen desProjektträgers in Jülich die Idee eines
Forschungsprojektes, das die komplexenBeziehungen, Erfolgsfaktoren aber auch Hin-dernisse des Erkenntnis- und Technologie-transfers im Bereich Material- und Werkstoff-technik explorativ untersucht. Dasvorliegende Buch dokumentiert diese Ergeb-nisse. Neben spannenden Einblicken in dieRealität des Erkenntnistransfers liefern dieAutoren auch die Idee eines „Technology-Translators“, der als eine Art Dolmetscherzwischen den Welten der wissenschaftlichenErgebnisse und der industriellen Anwen-dung fungiert: ein Pate, der beide Sprachenspricht, Synergien erkennt und zum Nutzenaller fruchtbar macht. Wie dies vonstattengehen könnte, wird in der Ausgabe „Techno-logie- und Erkenntnistransfer aus der Wis-senschaft in die Industrie - Eine explorativeUntersuchung in der deutschen Material-und Werkstoffforschung“ der SchriftenreiheProjektträger Jülich erläutert, die sie sich alsPDF herunterladen können:
http://www.dgm.de/dgm-info/ newsletter/2010/10/images/PTJ_Schriftenreihe_01.pdf
Dr.-Ing Frank O. R. Fischer Geschäftsführendes Vorstandsmitglied derDeutschen Gesellschaft für Materialkunde
aus: DGM aktuell 10/2010
Technologie- und Erkenntnistransfer aus der Wissenschaft in die Industrie - Eine explorative Untersuchung in der deutschen Material- und Werkstoff forschung
Dr.-Ing. Frank O.R.Fischer
Der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnissein anwenderbezogene Technologien stelltWissenschaft und Praxis gleichermaßen vorgroße Herausforderungen. Wie gelingt esHochschulen, Forschungsergebnisse in indu-strielle Technologien zu transferieren? Wel-che Voraussetzungen müssen Hochschulenauf der einen Seite und Unternehmen auf deranderen Seite für einen erfolgreichen Transfer
erfüllen? Diese und andere Fragen werdenim Rahmen eines Forschungsprojekts amLehrstuhl für Marketing und InternationalenHandel der TU Bergakademie Freiberg unter-sucht.Gegenstand des Projekts ist die Erforschungvon Technologie-Transfers im Bereich derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik.Technologie-Transfers beziehen sich auf Pro-zesse, durch die Informationen und Erkennt-nisse, aber auch Technologien aus der wis-senschaftlichen Forschung an Unternehmenübertragen werden.Mit der Beantwortung der Fragen helfen Sie,
Einflussfaktoren zu identifizieren, die denErfolg eines Technologie-Transfers im Bereichder Materialwissenschaft und Werkstofftech-nik ermöglichen und fördern. Darüber hin-aus tragen Sie mit der Teilnahme an der Stu-die maßgeblich zum Gelingen einerForschungsarbeit eines angehenden Nach-wuchswissenschaftlers bei. Die Beantwor-tung der einzelnen Fragen dauert ca. 17Minuten. Selbstverständlich werden alleAngaben streng vertraulich und nur für wis-senschaftliche Zwecke verwendet.
aus: DGM-newsletter 05/2011
Umfrage zum Technologie-Transfer in der Materialwissenschaftund Werkstofftechnik
19TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fachausschüsse und Technologietransfer
Fachausschüsse und Technologietransfer
Mit der Gründung eines neuen Fachaus-schusses „Feuerfestwerkstoffe“ erweitert dieDGM ihr Expertennetzwerk auf dem Gebietder Werkstoffe und Technologien fürHochtemperaturanwendungen. Wissen-schaft, Forschungseinrichtungen und dieIndustrie sind eingeladen, sich aktiv in dieArbeit des Fachausschusses einzubringen.Feuerfeste Werkstoffe und Bauteile sicherndie Funktionsfähigkeit von Hochtemperatur-prozessen, wie z.B. bei der großtechnischenErschmelzung von Metallen und Glas, derHerstellung von Eisen und Stahl, Zementund Keramik oder bei der Energieerzeugung.Allein die Herstellung eines Pkw und der
dafür notwendigen Stahl-, Aluminium-,Glas-, und Keramikbauteile verbraucht beieinem Gesamtgewicht von 1,3 t insgesamt ca.10 kg Feuerfestmaterial. Bei einem Airbus 380sind es bereits ca. 1.100 kg Feuerfestmaterial.Zudem entscheidet das Design feuerfesterWerkstoffe und Bauteile über Energieeffizi-enz und Schadstoffemissionen solcher Pro-zesse. Der Weg zu höheren Wirkungsgradenbei klimafreundlicheren Technologien führtdaher unmittelbar über die Entwicklunginnovativer Feuerfestwerkstoffe und –tech-nologien.Diesen Entwicklungsprozess konstruktiv zubegleiten und zu unterstützen, ist Anliegendes neu gegründeten Fachausschusses “Feuerfestwerkstoffe“ der DGM. „Wir wollen
wissenschaftliche und industrielle Fragestel-lungen auf dem Gebiet der Feuerfestwerk-stoffe und –technologien aufgreifen undgemeinsame Forschungs- und Entwicklungs-vorhaben von Universitäten, Forschungsein-richtungen und der Industrie initiieren“, soder Leiter des neuen Fachauschusses Prof.Dr.-Ing. habil. Christos G. Aneziris (TU Berg -akademie Freiberg).Im Fokus stehen mechanische, thermische,chemische und funktionstechnische Eigen-schaften von Feuerfestwerkstoffen mit einerbreiten Korngrößenverteilung vom Nanome-ter- bis zu Millimeter-Korn sowie die Werk-stoffkompatibilität in Hochtemperaturan-
wendungen mit Blick auf Korrosion, Erosion,Thermoschock, Kriechen und Clogging.Dabei versteht sich der Fachausschuss alsPlattform für eine Vernetzung und Zusammenarbeit sowohl mit weiteren Fach-ausschüssen auf dem Gebiet der Hochtempe-raturwerkstoffe bzw. Hochtemperaturan-wendungen als auch mit Industrieverbändenwie beispielsweise dem VDEh.Die Gründung des Fachausschusses „Feuer-festwerkstoffe“ fand anlässlich des „Freiber-ger Feuerfestforums“ an der TU Bergakade-mie Freiberg statt. Etwa 100 Gäste nahmen ander Veranstaltung teil, davon ca. 60 Industrie-vertreter von Rohstoffunternehmen, Herstel-lerunternehmen feuerfester Werkstoffe undKomponenten sowie Vertreter von Anwen-
derindustrien, vor allem der Stahlindustrie.Außerdem präsentierte das „Feuerfest -forum“ Forschungsergebnisse des Schwer-punktprogramms 1418 der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG „Feuerfest –Initiative zur Reduzierung von Emissionen –FIRE“. Wissenschaftler von elf deutschenUniversitäten und Forschungseinrichtungenforschen gemeinsam an einer neuen Genera-tion feuerfester Materialien. Ihr Ziel ist es,thermoschockbeständige, kohlenstoffarmebzw. –freie Keramiken für „saubere und intel-ligente“ Feuerfestbauteile zu erzeugen. Siesollen nicht nur den Schadstoffausstoß sen-ken, sondern auch die Qualität und die Ener-gieeffizienz von Herstellprozessen verbes-sern helfen. Vor allem in der Stahlindustriebesteht ein großer Forschungsbedarf nachkohlenstofffreien „Clean-Steel-Technologi-en“. Forschungsergebnisse des Schwerpunkt-programms werden daher interessanteImpulse für die Arbeit des neuen DGM-Fach-ausschusses darstellen.
Ansprechpartner: Prof. Dr.-Ing. habil. Christos G. Aneziris, Institut für Keramik, Glas- und Baustofftech-nik, TU Bergakademie Freiberg
Autorin: Dr. Anja GeigenmüllerTU Bergakademie Freiberg
aus: DGM aktuell 11/2010
DGM initiiert neuen Fachausschuss für Feuerfestwerkstoffe
Etwa 100 Gäste nahmen an der Gründungsveranstaltung teil
20 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fachausschüsse und Technologietransfer
Fachausschüsse und Technologietransfer
Auf dem DGM-Tag am 23.08.2010 in Darm-stadt wurde der neue DGM-FachausschussZellulare Werkstoffe vorgestellt. Die Leitungdieses DGM-FA wird Prof. Dr. MichaelScheffler, Otto-von-Guericke-Univerität Mag-deburg übernehmen. Am 26. Oktober 2010,
im Vorfeld der CellMat 2010, Dresden, wirddie konstituierende Sitzung des DGM-FAstattfinden, auf der die Ziele diskutiert unddie Arbeitskreise vorgestellt werden. Einesder Hauptziele wird sein, die Strukturen zel-lularer Werkstoffe und die daraus resultieren-
den Anwendungen in den Vordergrund zustellen und eine Brücke zwischen den Werk-stoffklassen zu schlagen. Interessenten sindherzlich eingeladen.
aus: DGM-newsletter 09/2010
Gründung des neuen Fachausschusses der DGM „Zellulare Werk-stoffe“ am 26. Oktober 2010 in Dresden
Zu seiner 50. Sitzung traf sich der Fachaus-schuss Mechanische Oberflächenbehandlun-gen am 12. und 13.4.2011 in Karlsruhe. DieVeranstaltung wurde gemeinsam mit einemSymposium des DFG-geförderten Graduier-tenkollegs 1483 „Prozessketten in der Ferti-gung“ durchgeführt, das von V. Schulzegemeinsam mit B. Nestler geleitet wird. AusAnlass dieses Jubiläums gab H. Wohlfahrt,der 1984 der erste Leiter des Fachausschus-ses war, einen Rückblick auf die Einrichtungund thematische Entwicklung des Fachaus-schusses sowie die durch den Fachausschussermöglichten Konferenzveranstaltungen.Hierzu zählen 3 Internationale Kugelstrahl-konferenzen (ICSP-Serie) und 2 deutsch-französische Treffen der entsprechendenArbeitsgruppen.
aus: DGM newsletter 06/2011
50. Sitzung des Fachausschusses „Metallische Oberflächenbehand-lung“ in Karlsruhe
Die bisherigen Leiter des Fachausschusses Mechanische Oberflächenbehandlungen (von links nach rechts: V.Schulze, B. Scholtes, H. Wohlfahrt (es fehlt L. Wagner)
21TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fachausschüsse und Technologietransfer
Fachausschüsse und Technologietransfer
• Bioinspirierte und interaktive MaterialienProf. Dr. Thomas ScheibelProf. Dr. Carsten Werner
Arbeitskreise:
Grenzflächen: Statisch und dynamischProf. Dr. Andreas FeryDr. Tobias KrausInteraktive und adaptive MaterialienDr. Richard WeinkamerDr. Cordt ZollfrankVom Gen zum MaterialProf. Dr. Joachim BillProf. Dr. Carsten Werner
• BiomaterialienProf. Dr. Klaus D. Jandt
Arbeitskreise:
Antimikrobielle BiomaterialienDr.-Ing. Jörg BossertBiomimetische BiomaterialienPriv.-Doz. Dr. Günter TovarDr. Kirsten BorchersDauerimplantateDr. Thomas EbelDentalwerkstoffeProf. Dr.-Ing. Detlef BehrendGrenzflächenDr. Thomas F. KellerModellierung und SimulationDipl.-Ing. Andreas BurbliesResorbierbare / DegradierbareBiomaterialienDipl.-Ing. Peter AlbrechtDr. Torsten ScheuermannTissue EngineeringDr. Petra KlugerProf. Dr. Heike WallesZertifizierung, Zulassung, Normierung und RechtDr.-Ing. Jürgen Dieter Schnapp
• ComputersimulationDr. Franz Roters
Arbeitskreis:
MikrostrukturmechanikProf. Dr. rer.nat. Siegfried Schmauder
• Materialien für elektronische AnwendungenProf. Dr. Oliver Kraft
Arbeitskreise:
Kohlenstoff-basierte MaterialienProf. Dr. Ehrenfried ZschechMaterialien für Interconnect-SystemeProf. Dr. Ralph SpolenakMaterialien für logische DevicesProf. Dr. rer. nat. Dieter SchmeißerMechanische Charakterisierung in kleinen DimensionenDr. Erica Lilleodden
• MaterialographieProf. Dr. habil.rer.nat. Markus Retten-mayr
Arbeitskreise:
AusbildungGundula Jeschke BauteilmetallographieDr.-Ing. Andreas Neidel FIB-Anwendungen in der Materialo-graphieDr. Hans-Jürgen Engelmann KoordinierungProf. Dr. habil.rer.nat. Markus Retten-mayr Materialographie im Internet Dipl.-Ing. Michael Engstler Prof. Dr. Günter Petzow Mikroskopie der Kunststoffe und Kunststoffverbunde Dr.-Ing. Jörg Trempler ProbenpräparationDr.-Ing. Holger Schnarr Quantitative 3-D Mikroskopie von OberflächenDipl.-Ing. Edeltraud Materna-Morris Quantitative GefügeanalyseN.N. RasterkraftmikroskopieProf. Dr. Mathias Göken Regionale ArbeitskreiseKatrin Kuhnke Tomographie in der MaterialforschungProf. Dr.-Ing. Frank MücklichUnterausschuss für Metallographie der ASMET Ing. Gerald Frank
• Dünne SchichtenProf. Dr.-Ing. Alfred Ludwig
Arbeitskreise:
Dünne Schichten in der Mikrosystem -technikProf. Dr.-Ing. Alfred LudwigMagnetische Schichten für technische AnwendungenN.N.Optische Dünne SchichtenDr. Harald MändlStruktur Dünner SchichtenN.N.
• FeuerfestwerkstoffeProf. Dr.-Ing. Christos Aneziris
• Gefüge und Eigenschaften von PolymerwerkstoffenProf. Dr. Volker Abetz
• Hochtemperatur-SensorikProf. Dr. Holger Fritze
Arbeitskreise:
Resonate WandlerstrukturenProf. Dr. Holger FritzeTransiente SensorenDr. rer. nat. Jens ZoselProf. Dr. Ulrich GuthZustandssensorikProf. Dr.-Ing. Ralf Moos
• Intermetallische PhasenDr. Martin Palm
• MagnesiumDr.-Ing. Norbert Hort
Arbeitskreise:
KonstruktionswerkstoffeDr.-Ing. Norbert HortMagnesium-Bio-WerkstoffeDr. Frank Witte
Derzeit aktive Fachausschüsse und deren Arbeitskreise
22 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fachausschüsse und Technologietransfer
Fachausschüsse und Technologietransfer
VDEh-Unterausschuß für MetallographieDr. Ulrich Etzold
• Mechanische Oberflächen -behandlungProf. Dr.-Ing. Volker Schulze
• Metallische Verbundwerkstoffe Prof. Dr. Alexander Wanner
Arbeitskreise:
MMC-FunktionswerkstoffeDr. Ludger WeberMMC-KonstruktionswerkstoffeDr. rer. nat. Achim Neubrand
• Optische FunktionsmaterialienProf. Dr. Lothar Wondraczek
• StranggießenDr.-Ing. Hilmar R. Müller Dr.-Ing. Dirk Rode
Arbeitskreise:
Ofenabhängige KokilleProf. Dr.-Ing. Jürgen R. BöhmerDipl.-Ing. Robert GrossOfenunabhängige Kokille - AluminiumDr. Dietmar Bramhoff Philip MeslageOfenunabhängige Kokille - KupferDr.-Ing. Dirk RodeDr.-Ing. Alexander KhourySprühkompaktieren / Spray Forming Dipl.-Ing. Bernhard CommandeurDipl.-Ing. Gero Sinha
• Werkstoffcharakterisierung mit StrahllinienDr.phil. Wolfgang Hoffelner
• Werkstoffverhalten unter mecha nischer BeanspruchungProf. Dr.-Ing. Eberhard Kerscher
Arbeitskreise:
Materialermüdung (DGM, DVM)Prof. Dr.-Ing. Ulrich KruppProf. Dr.-Ing. Gerhard BiallasMaterialkundliche Aspekte der Tribolo-gie und der EndbearbeitungProf. Dr.- Ing. habil. Matthias SchergeMechanisches Werkstoffverhalten bei hoher TemperaturPriv. Doz. Dr.-Ing. Birgit SkrotzkiVerformung und BruchProf. Dr. Eberhard Kerscher
• Zellulare WerkstoffeProf. Dr. Michael Scheffler
• ZiehenProf. Dr. Heinz Palkowski
Arbeitskreise:
Draht und StangenDipl.-Ing. Fred WissenbachRohre und ProfileDipl.-Wirt.-Ing. Martin Fritz
• StrangpressenDipl.-Ing. Horst Gers
Arbeitskreise:
ForschungProf. Dr.-Ing Dirk RinghandLeichtmetallDipl.-Ing. Erich HochSchwermetall - StrangpresserzeugnisseDipl.-Ing. Hans-Gerd Klingen
• TexturenProf. Dr. Werner Skrotzki
• Thermodynamik, Kinetik und Konstitution der WerkstoffeProf. Dr. Hans Jürgen Seifert
• TitanProf. Dr.-Ing. Lothar WagnerDr.-Ing. Manfred Peters
• WalzenDipl.-Ing. Heinrich G. Bauer
Arbeitskreise:
ForschungProf. Dr.-Ing. Jürgen HirschLeichtmetallDr.-Ing. Stefan KästnerPlanheitsmessung und -regelungDr. Kai Friedrich KarhausenThermoprozesstechnikDipl.-Ing. (FH) Christoph RösgenWalzplattierenDipl.-Ing. Peter Münzner
• HochleistungskeramikDr. Bärbel Voigtsberger
Trägergesellschaften: DGM, DKG
Arbeitskreise:
BiokeramikProf. Dr. Horst FischerKeramische Membranen Dr. Ingolf Voigt
Verarbeitungseigenschaften syntheti-scher keramischer RohstoffeDr. Manfred FriesDr.-Ing. Ulrich EiseleVerstärkung keramischer WerkstoffeDr.-Ing. Dietmar Koch
KoordinierungDr. Bärbel Voigtsberger Dr. Wolfgang RossnerLebensdauer und Zuverlässigkeit struk-tur- und elektrokeramische BauteileN.N.Prozessbegleitende PrüfungDr. Torsten RabeSysteme und Basis FunktionskeramikProf. Dr. Alexander Michaelis
Derzeit aktive Gemeinschaftsausschüsse und deren Arbeitskreise
23TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fachausschüsse und Technologietransfer
Fachausschüsse und Technologietransfer
• Metallkundliche Probleme des GießereiwesensN.N.
Trägergesellschaften: DGM, VDG
• PLASMA GermanyDr. Christian Oehr
Trägergesellschaften: AWT, DGO, DGM, DGPT, DVG, DVS, EFDS, INPLAS, VDI-W
Arbeitskreise:
KoordinierungDr. Heinz Hilgers Dr. Johannes StrümpfelNormung/StandardisierungProf. Dr. Georg ReinersPlasmabehandlung von PolymerenProf. Dr. Jörg Friedrich
• Rasterelektronenmikroskopie in der MaterialprüfungProf. Dr.-Ing. Pedro D. Portella
Trägergesellschaften: DVM, DGM
Arbeitskreise:
Fraktographie (DGM, DVM)Dr.-Ing. Dirk BettgeIn situ PrüfungProf. Dr.-Ing. Martin Franz-Xaver WagnerMikrostrukturcharakterisierung im REMDr. Gert Nolze
• VerbundwerkstoffeProf. Dr.-Ing. Bernhard Wielage
Trägergesellschaften: DGM, DKG, DGG, DGO, DVS, VDI-W
• PulvermetallurgieUniv. Prof. Dr. Herbert DanningerDr. Klaus Dollmeier
Trägergesellschaften: DGM, FPM, VDEh, VDI, DKG
Arbeitskreise:
Expertenkreis MetallpulvererzeugungDr. Jürgen Cornelius Dr. Volker UhlenwinkelExpertenkreis Metallpulverspritzguss (MIM)Dr.-Ing. Frank PetzoldtExpertenkreis Sinter-AluminiumDr.-Ing. Thomas WeißgärberExpertenkreis SinternDr. rer. nat. Jürgen SchmidtExpertenkreis SinterstähleProf. Dr.-Ing. Paul Beiss
24 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
Im Bereich der Nachwuchsförderung habenwir in den letzten zwei Jahren einmal mehrgute Fortschritte gemacht. Zu den herausra-genden Leistungen gehört, dass die DGM2010 bereits im dritten Jahr für die BVMat-Werk und die DFG den Nachwuchskarrier-eworkshop ausrichten könnte, der von über340 Teilnehmerinnen und Teilnehmernbesucht werden konnte. Insgesamt hattensich über 1.400 Doktorandinnen und Dokto-randen darum beworben: ein Beleg für denenormen Bedarf an Informationen über dienächsten Karriereschritte junger Wissen-schaftlerinnen und Wissenschaftler in Wis-senschaft, Industrie und Ausland.
In den letzten zwei Jahren initiierte die DGM-Geschäftsstelle zudem wieder spezielle Fort-bildungen für den Nachwuchs im interdiszi-
plinären Bereich der Materialwissenschaftund Werkstofftechnik. Dabei wurden The-men wie Projektmanagement, Soft-Skills aberauch das Einwerben von Drittmitteln aufge-griffen.
Zu einem wichtigen Modul der DGM-Nach-wuchsförderung könnten sich in Zukunft dieMatWerk-Akademien entwickeln, die modu-lar auf den DGM-Karriereworkshop aufbau-en. Die erste fand im Mai 2011 auf BurgSchnellenberg im Sauerland statt: Sie wurdegemeinsam von DGM und DFG ausgerichtet.Die mehrtägigen MatWerk-Akademien rich-ten sich an besonders motivierte und lei-stungsstarke junge Doktoranden und Post-Docs der Materialwissenschaft undWerkstofftechnik. Ziel ist, den Nachwuchsunseres Fachgebiets bereits in einer frühen
Phase seiner beruflichen Laufbahn für dieunterschiedlichen Instrumente einer erfolg-reichen Karriereplanung in Wissenschaft undIndustrie zu sensibilisieren.
Wir möchten allen Mitstreitern, besonderesdem damaligen Ausbildungsausschussleiter,Professor Martin Heilmaier ganz herzlich fürseine Unterstützung danken und würden unswünschen, dass noch mehr etablierte Profes-sorinnen und Professoren im Kreis ihrer Stu-dentinnen und Studenten, der StudentischenHilfskräfte und ihrer Doktorandinnen undDoktoranden für das Karrierenetzwerk derDGM werben und so unseren Auftrag derVernetzung unterstützen.
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
Doktorandinnen und Doktoranden beim Nachwuchskarriereworkshop der BVMatWerk und DFG im Rahmen der MSE2010 in Darmstadt.
Neue DGM-Fortbildungen für Doktorandinnen und Doktoranden aus Wissenschaft und Industrie.
25TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
Nachwuchskonzept der DGM mit Nachwuchskarriereworkshop, MatWerk-Akademie und Workshop zum Erfahrungsaustausch.
Im Mai 2011 richtete die DGM die ersteMatWerk-Akademie zur Nachwuchsförde-rung und frühen interdisziplinären Vernet-zung aus: mit durchschlagendem Erfolg.
Im Frühjahr 2011 traf auf Burg Schnellenbergim Sauerland das ritterliche Mittelalter aufdie ingenieurwissenschaftliche Zukunft.Dort, wo einst Baumeister und Kunsthand-werker im Dienste Freiherrn Caspar von Für-stenberg wirkten, versammelte sich vom 2.bis 6. Mai 2011 der Nachwuchs aus demBereich der Materialwissenschaft und Werk-
stofftechnik auf Einladung der DeutschenGesellschaft für Materialkunde (DGM) zumErfahrungsaustausch mit Experten des Fach-gebiets.In dem abgelegenen, ländlich schönenAmbiente einer der größten erhaltenen Burg-anlagen Westfalens führte die DGM zumersten Mal die MatWerk-Akademie „Mate-rialwissenschaft und Werkstofftechnik“durch. Gefördert wurde sie von der Deut-schen Forschungsgemeinschaft (DFG). AmEnde waren sich die 23 Teilnehmerinnen undTeilnehmer einig, ein Netzwerk viel verspre-
chender neuer Kontakte geknüpft und wich-tige Erkenntnisse zur eigenen Karrierepla-nung gewonnen zu haben.Die mehrtägige Veranstaltung richtete sich anbesonders motivierte und leistungsstarkejunge Doktoranden und PostDocs aus deminterdisziplinären Fachgebiet der Material-wissenschaft und Werkstofftechnik. Auf BurgSchnellenberg erhielten sie die Möglichkeit,vor einem renommierten Expertenkreis eige-ne Projektvorschläge zu präsentieren. Dabeibekamen sie durch die anwesenden DFG-Vertreter aus erster Hand konkrete Tipps, wie
Effizienter Wegweiser zur Karriereplanung
26 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
Vorstellung der eigenen Projektidee
Gruppenarbeit zur Ausarbeitung interdisziplinärer Projekte
Dr. Xenia Molodova, DFG und Prof. Hans-Jürgen Christ Prof. Martin Heilmaier, TU Darmstadt und Prof. Martin Wagner, TU Chemnitz
27TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
Impulsvortrag durch Prof. Gunther Gottstein, RWTH Aachen zur Karriere in derWissenschaft
Impulsvortrag von Dr. Ulrich Bast, Siemens zur Karriere in der Industrie
Teilnehmer der Gruppe I der MatWerk-Akademie
Teilnehmer der Gruppe II der MatWerk-Akademie
28 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
ein erfolgversprechender Antrag bei der DFGaufgebaut sein muss.Mit diesem Wissen im Rücken arbeiteten dieTeilnehmenden in kleinen, fachlich interdiszi-plinären Gruppen auf eine exzellente Art undWeise ihre innovativen Projektskizzen aus,die sie präsentieren und anschließend vor derGutachtergruppe verteidigen mussten.Von der Effizienz der interdisziplinärenZusammenarbeit waren dabei nicht nur dieGutachterinnen und Gutachter, sondern auchdie Nachwuchswissenschaftlerinnen undNachwuchswissenschaftler überaus positivüberrascht.Eine sehr breite Aufmerksamkeit erhieltenauch die Impulsvorträge des ehemaligen Vor-sitzenden der BV MatWerk, Professor GünterGottstein von der RWTH Aachen, und vonDr. Ulrich Bast von der Siemens AG, die die
unterschiedlichen Karrierewege in Industrieund Wissenschaft beleuchteten. Beide beton-ten, dass es bei der Karriereplanung keineKönigswege gebe, sondern vor allem dieindividuelle Ausrichtung und Lebensphilo-sophie von zentraler Bedeutung sei. Geradefür diejenigen Teilnehmerinnen und Teilneh-mer, die ihre Wahl zwischen Industrie undWissenschaft noch nicht getroffen hatten,bedeuteten die Anregungen der Impulsvor-träge einen wichtigen Wegweiser für ihreZukunft.Nach dem durchschlagenden Erfolg derersten Veranstaltung ihrer Art könnten sichdie MatWerk-Akademien, die modular aufden DGM-Karriereworkshop aufbauen, zueinem weiteren wichtigen Modul der DGM-Nachwuchsförderung entwickeln. Ihr Ziel,den Nachwuchs bereits in einer frühen Phase
seiner beruflichen Laufbahn mit entsprechen-den Instrumenten der Drittmittelwerbungvertraut zu machen sowie mit Erfahrungenim Bereich von Wissenschaftsmanagementund kommunikativer Strategientwicklungfür Wissenschaft und Industrie auszustatten,wurde auf Burg Schnellenberg nach Ansichtaller Beteiligten jedenfalls vollends erreicht.Allen Teilnehmern, Referenten und Gutach-tern sei nochmals herzlich gedankt. Derbesondere Dank gilt auch der DFG für dieFörderung und die Unterstützung vor Ort.
Dr.-Ing. Frank O.R. FischerGeschäftsführendes Vorstandsmitglied derDGM
aus: DGM aktuell 06/2011
Drei Minuten für die Zukunft.Die JUNIOR EUROMAT 2010
Für die Karriereplanung wird die Präsenta -tion wissenschaftlicher Erkenntnisse voreinem größeren professionellen Publikumimmer wichtiger. Jedenfalls ist sie viel zuwichtig, um dabei etwas dem Zufall zu über-lassen. Im Bereich der Materialwissenschaft undWerkstofftechnik gibt es die JUNIOR EURO-MAT, die von der Deutschen Gesellschaft fürMaterialkunde (DGM) für den EuropäischenDachverband Federation of European Mate-rials Societies (FEMS) ausgerichtet wird. Hierhaben Bachelor-Studenten und Doktorandenaus ganz Europa die Gelegenheit, im Rahmeneiner Sommerschule mit informellem Flair,erste Erfahrungen bei der Präsentation ihrerForschungsthemen zu gewinnen: im mündli-chen Vortrag, unterstützt von Postern – undmit nur drei Minuten Zeit. Lampenfieberinklusive.So war es auch vom 26. bis 30. Juli 2010 beider diesjährigen JUNIOR EUROMAT in Lau-sanne. Nachdem FEMS-Präsident ProfessorDr.-Ing Pedro D. Portella die Veranstaltungeröffnet hatte, konnten die rund 320 Teilneh-merinnen und Teilnehmer aus 33 Nationen inder angenehmen Atmosphäre der direkt amGenfer See gelegenen Universität, teils erst-mals vor einem größeren – und internationa-len – Publikum ihre Forschungen anschaulichwerden lassen, wobei Deutschland mit mehr
als 80 Nachwuchswissenschaftlerinnen undNachwuchswissenschaftlern am stärkstenvertreten war.In den Posterpräsentationen kam denn auchdas ganze Spektrum der Materialwissen-schaft und Werkstofftechnik zur Sprache.Dabei reichte das Angebot von der „Mira-culous World of Superconductors“ über die„Multilayered Transparent Material with Sili-con Interlayer“ bis zur „Cold Rolling ofFerro manganese Steel TWIP“ – wobei alleVorträge auf Englisch gehalten werden mussten; für die Teilnehmerinnen und Teil-nehmer in den seltensten Fällen die Mutter-sprache – und so eine profunde Möglichkeit,ihre Themen unter „internationalen Real -bedingungen“ zu erproben.Seit 1992 wird die JUNIOR EUROMAT nunschon alle zwei Jahre in Lausanne ausgerich-tet – und konnte so in diesem Jahr ihren„zehnten Geburtstag“ feiern. Dabei zeigtesich, wie stark sie inzwischen als feste Größezum internationalen Tagungskalender dazu-gehört. Tatsächlich ist die Veranstaltunglängst zu einer etablierten Übungswiese fürjunge Wissenschaftlerinnen und Wissen-schaftler geworden, was sich nicht zuletztauch im Engagement auf der Bühne wieder-spiegelte. Wie gut das Format ankommt, beweist unteranderem die Tatsache, dass der Hörsaal in
Lausanne bei den jeweiligen Präsentationenauch in diesem Jahr wieder voll besetzt war.Zur Motivation trugen dabei sicher einmalmehr die zahlreichen Preise bei, die verliehenwurden. Bestimmt wurden die Sieger überStimmzettel, die nach den Sitzungen auszu-füllen waren. Dass dies mit viel Spaß verbunden war, warden Teilnehmer auch nach vier mit viel Pro-gramm gefüllten Tagen noch anzusehen.Besondere Begeisterung löste Professor Lud-wig Schultz aus Dresden aus, als er seineextra aus Dresden eingeflogene Supra-Leiter-Schwebebahn vorstellte.Dazu passte auch, dass die Veranstaltung miteinem Barbecue an der Universität mit an -schließendem Get Together, direkt am Uferdes Genfer Sees gelegen, endete. Die Teilneh-merinnen und Teilnehmer haben bei Wurstund einem Glas Bier die JUNIOR EUROMAT2010 und ihre eigenen Leistungen noch ein-mal Revue passieren lassen – oder einfach inlockerer Atmosphäre ein erstes Netzwerk anKontakten knüpfen können, das sich in ihremweiteren Karriereweg noch als nützlicherweisen könnte.
Dr.-Ing. Frank O. R. FischerGeschäftsführendes Vorstandsmitglied
29TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
Großes Lob vom FEMS-Präsidenten an das Tagungsteam der DGM (v.l.n.r.: MarcoRoßnagel, Susanne Grimm, Projektleiter Niels Parusel und Professor Portella)
Die 3-Minuten-Postervorträge der jungen Wissenschaftler lockten durchgehendviele Zuhörer an.
Professor Ludwig Schultz stellte in einem Plenarvortrag seine Supra-Leiter-Schwebebahn vor.
Bei der Barbeque-Party konnten Freundschaften und Netzwerke geknüpft werden.
FEMS-Präsident Professor Pedro Portella (rechts im Bild) von der BAM in Berlinbegrüßte Dr.-Ing. Frank O.R. Fischer zur Eröffnung der JUNIOR EUROMAT 2010in Lausanne.
Angeregte Diskussionen an den Posterwänden
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
Is this ano-ther articleabout the lackof women inmanagementp o s i t i o n s ?Maybe this isan engagedc o m p l a i n tabout mis-sing childcareplaces andemployer fle-
xibility? Will it result in continued requestsfor quotas? Well, most readers already knowthe approximate content of such a contributi-
on. This gives me an opportunity to insteadexpress some thoughts originating from myown, personal expe rience. And as this articleis clearly an „opinion piece“ let me start witha fundamental, yet controversial statement:Women ARE different!It is needless to determine where those diffe-rences come from. Whether a female humanis dominantly influenced by her geneticimprint, by differences in her early childhoodeducation or environmental insinuation; it isa fact that average girls behave differentlythan boys, even today, in the „time of equalopportunities“. Consequently, our societymust address these differences to provide fairconditions for both genders.
Recently, DW-TV reported as a headline thatthe Telecom Company wants to fill a third oftheir management positions with womenwith in the next five years. While the storyunfolded on TV I couldn’t help wonderinghow that company would try to accomplishthis goal and find enough qualified womenwhen they were clearly unsuccessful in thisarea in the past. Unfortunately, no detailswere given with regard to the company’schange in future appointment procedures. Itis widely recog nized nowadays that womenare needed in all professions. However, howto get them into leading positions remains anopen question.Political initiatives to provide better „back -
WOMEN in SCIENCE - The Difficulty of Finding Female Talents
Eins der wichtigstenZiele der DeutschenForschungsgemein-
schaft (DFG) ist die Förderung junger Wis-senschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hier-für bittet die DFG unterschiedlicheProgramme an, die die jeweilige Phase derQualifizierung angemessen berücksichtigenund unterstützen. Ein relativ neues Förder-modul in diesem Zusammenhang stellen dieNachwuchsakademien dar, in denen hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wis-senschaftler in einem frühen Stadium ihrerKarriere auf die eigenständige Durchführungvon Forschungsprojekten vorbereitet werdensollen.Nachwuchsakademien bestehen in der Regelaus zwei aufeinander aufbauenden Einhei-ten. An einen Workshop, in dem die Teilneh-menden ihre Forschungsideen vorstellen undmit Expertinnen und Experten diskutieren,schließt sich die Möglichkeit an, einen erstenAntrag auf Projektförderung bei der DFG ein-zureichen. Dieses Jahr fand bereits die dritte Veranstal-tung dieser Art auf dem Gebiet Materialwis-senschaft und Werkstofftechnik unter demMotto „Interdisziplinäre Fragestellungen derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik“statt, die von Professor Martin Heilmaier vonder TU Darmstadt koordiniert wurde. Zielwar es dabei einmal mehr, jungen Wissen-schaftlerinnen und Wissenschaftlern den
Weg zur frühen wissenschaftlichen Selbst-ständigkeit zu eröffnen. Schon früh werdensie hier für interdisziplinäre Forschungs-ansätze sensibilisiert und auf eigenständigeForschungsprojekte und die Einwerbung vonDrittmitteln vorbereitet. Im dreitägigenWorkshop, das im Frühjahr ausgerichtet wur-de, hatten die Teilnehmenden die Möglich-keit, im Austausch mit international renom-mierten Expertinnen und Experten sowieGesprächen untereinander, ihre methodi-schen und fachlichen Kompetenzen auszu-bauen, und wurden bei der Ausarbeitungeigener Forschungsfragen unterstützt. Alsnächster Schritt fand vor kurzem einAntragskolloquium statt, bei dem die Teil-nehmenden ihre bei der DFG eingereichtenProjektanträge vorstellten und anschließenddie besten Vorhaben von einem Gutachter-gremium ausgewählt wurden. Im Herbst
2011 wird für die hier erfolgreichen Antrag-stellenden ein Nachtreffen organisiert, beidem sie ihre Erfahrungen austauschen undweitere Hilfestellungen erhalten können.Bis dahin wünschen wir den Teilnehmendenviel Erfolg bei der Bearbeitung ihrer For-schungsprojekte und freuen uns auf span-nende Ergebnisse!
Dr.-Ing. Xenia Molodova
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)-Ingenieurwissenschaften--Werkstofftechnik-Dr.-Ing. Burkhard Jahnen
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)-Ingenieurwissenschaften--Materialwissenschaft-
aus: DGM aktuell 06/2010
DFG-Nachwuchsakademie „Interdisziplinäre Fragestellungen derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik“
DFG-Nachwuchsakademie „Interdisziplinäre Fragestellungen der Materialwissenschaft undWerkstofftechnik“
30 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
31TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
ground conditions“ for working womenthrough improved daycare systems and moreflexible shopping hours are certainly helpful.In some countries an employment quota forwomen proved to be successful, too. Havingthis „framework“ in place does facilitate awoman’s choice to pursue her career into aleading position. Yet, the main obstacleremains: women simply do not advertisetheir own talents as aggressively as men do,and, con sequently, they are not as often aspassionately supported as their male counter-parts. Female talents have to be discoveredand coached to learn management skills aswell as „to sell themselves“. However, fin-
ding that particular talented young womanand actively assist her in the development ofher potentially outstanding career is not oftendominant in the minds of parents, partners,teachers, professors, supervisors and mana-gers. If we want to permanently increase thenumber of women in top busi ness positionswe all have to change our attitude towardsthose female talents and be come personallyinvolved.I would like to end with a variation to MartinWagenscheins words: „If we step out of oureveryday’s hectic life and provide our girlswith time and trust we will see them performin astonishing ways!“ It is up to all of us to
pave the way for more future female businesscareers.
With greetings from Berkeley,
Petra Specht, Dr.rer.nat. Department of Materials Science and Engineering, University of California, Berkeley, USA
aus: DGM aktuell 05/2010
Den Fingerabdruck von Materialien perSpektroskopie identifizieren und eine span-nende Reise ins Land der Materialwissen-schaft und Werkstofftechnik unternehmenkönnen Schülerinnen und Schüler im AlfriedKrupp-Schülerlabor der RUB. Zu Beginn desSchuljahrs 2010/11 starten zwei neue fachü-bergreifende Projekte, die Physik, Material-wissenschaft und Werkstofftechnik sowie dieChemie verbinden: "Fingerprints of Materi-als" und "Prüfstelle Schülerlabor". Schulklas-sen und Oberstufenkurse können die ganztä-gigen Projekte ab sofort buchen.
Grundlagen der Spektroskopie lernen Lichtist nicht gleich Licht - und es ist vor allemmehr als die für uns sichtbaren Farben Rot bisLila. Was passiert zum Beispiel mit "Licht",wenn es auf einen Stoff - ein Gas, eine Flüs-sigkeit - trifft? Jeder Stoff reagiert mit einfal-lenden elektromagnetischen Wellen undzeigt als Reaktion ein charakteristischesSpektrum, vergleichbar mit dem individuel-len Fingerabdruck eines Menschen. In die-sem neuen Projekt untersuchen Schüler dieSpektren verschiedener Stoffe und lernen
dabei die Grundlagen der Spektroskopie ken-nen. Es entstand in einer Kooperation desLehrstuhls für Physikalische Chemie II (Prof.Dr. Martina Havenith-Newen) mit demSchülerlabor.
Bilinguale Projekte Als bilinguales Projektwird "Fingerprints of Materials" auch aufEnglisch angeboten, um die weltweit führen-de Wissenschafts- und Laborsprache mitSpaß und ohne Berührungsängste anzuwen-den. Es ist das vierte bilinguale Angebot imSchülerlabor – in den Projekten "MightyMinerals", "Discover Plasma Physics" und"Vanilla or Vanillin" können Schüler bereitsauf Englisch experimentieren. "Fingerprintsof Materials" startet im Oktober 2010 undrichtet sich an Schülerinnen und Schüler derOberstufe.
Prüfstelle Schülerlabor "Marmor, Stein undEisen bricht" – oder etwa nicht? Und welcheMöglichkeiten gibt es, die Eigenschaften vonMaterialien zu untersuchen? Im neuen Pro-jekt "Prüfstelle Schülerlabor" beschäftigensich Schüler ab Klasse 10 mit ausgewähltenMethoden der Werkstoffprüfung und aktuel-len Entwicklungen von Materialien. Sie expe-rimentieren an verschiedenen Stationen,"programmieren ihr eigenes Formgedächt-nismetall, erfahren etwas über den Einsatzmagnetischer Flüssigkeiten in der Krebsthe-rapie, machen Zugversuche und Ultraschall-untersuchungen, arbeiten mit Wärmebildka-
meras und Mikroskopen. Die insgesamt neunmobilen Versuchsstände für dieses Projektsind eine Dauerleihgabe der DeutschenGesellschaft für Materialkunde (DGM) inFrankfurt am Main. Das Projekt verknüpftMaterialwissenschaften und Methoden derChemie.
Projekte im Internet Das Schülerlabor ist einzentraler Teil der Initiative "Junge Uni –Schulprojekte an der Ruhr-UniversitätBochum". Ausführliche Informationen überdie neuen Projekte – zum Beispiel auch über"Soap Opera(tions)" aus den vergangenenSommerferien, das jetzt dauerhaft im BereichChemie angeboten wird – stehen auf denInternetseiten des Schülerlabors unterhttp://www.rub.de/schuelerlabor
Weitere InformationenAlfried Krupp-Schülerlabor, Ruhr-Univer-sität Bochum, Tel. 0234/32-27081, E-Mail:schuelerlabor[at]rub.de
aus: DGM-newsletter 09/2010
DGM-Forschungsexpedition ins Land der Materialwissenschaft undWerkstofftechnik startet offiziell im Alfried Krupp-Schülerlabor inBochum
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
32 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Wie kann man die Jugend erreichen? Undwie können wir ihr Interesse für das Fachge-biet der Materialwissenschaft und Werkstoff-technik wecken?Interessante Antworten auf diese und andereFragen ergeben sich im Zuge der Wanderaus-stellung „Forschungsexpedition ins Land derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik“der DGM. Im März 2009 vom BMBF bewil-ligt, reist sie mit ihren Exponaten seitdemdurchs Land: Vom Science-Center-Museumin Flensburg über Aachen bis nach Freiberg.In der „Forschungsexpedition ins Land derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik“können Schülerinnen und Schüler per Licht-mikroskopie Oberflächenstrukturen betrach-ten oder das „Formgedächtnis“ eines Metall-gefüges bestaunen; ein Zugversuch illustriertanhand einer gleichmäßig, stoßfrei und lang-sam ausgeführten Dehnung, ob ein Werkstoffden an ihn gestellten Anforderungen genügt.Ziel der Wanderausstellung ist, die Öffent-lichkeit über die Materialwissenschaft undWerkstofftechnik zu informieren und denpotenziellen Nachwuchs schon frühzeitigdafür zu begeistern. Im Fokus der Wander-ausstellung stehen demnach junge Menschenund deren Potenzial. Die interaktiven Expo-nate sollen ihren Entdeckergeist wecken undsie spielerisch für die vielfältigen Möglichkei-ten des Fachgebiets sensibilisieren.Was aber ist der ideale Standort, um mög-lichst viele junge Menschen über die Mate-rialwissenschaft und Werkstofftechnik zuinformieren, wenn die Wanderausstellungeinmal nicht auf Reisen ist? Die „Forschungsexpedition ins Land derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik“machte Halt in der Arbeitsgruppe „Didaktikder Chemie“ der Ruhr-Universität Bochumunter der Leitung von Prof. Dr. Katrin Som-mer und fand dort optimale Unterstützungund Betreuung. Es wurde die Idee geboren,die „Forschungsexpedition“ in ein Schülerla-borprojekt zu integrieren. Für die Durch-führung bot sich das Alfried Krupp-Schüler-labor der Ruhr-Universität Bochum aufgrundseines interdisziplinären Charakters gerade-
zu an. Konzipiert und ausgearbeitet wurdedas Projekt mit dem Titel „Prüfstelle Schüler-labor“ von Prof. Dr. Katrin Sommer und denMitarbeitern Lena Gehle und Hennig Steff ingemeinschaftlicher Arbeit mit der DGM. Diefachliche Begleitung erfolgte durch Prof. Dr.Michael Pohl (Werkstoffprüfung, RUB) undProf. Dr. Alexander Hartmaier (ICAMS,RUB), die zudem vor Schülerinnen undSchülern den Einführungsvortrag zur Bedeu-tung der Materialforschung in verschiedenenZeitepochen hielten. Natürlich werden dabeiauch die Zukunftsperspektiven hervorgeho-ben, die neue Werkstoffe und Materialen für
die gesellschaftliche Entwicklung haben.Premiere hatte das Schülerlaborprojekt„Prüfstelle Schülerlabor“ am 2. Juli 2010 mitSchülerinnen und Schülern aus den Chemie-und Physikkursen des elften Jahrgangs derWilly-Brandt-Gesamtschule Bochum. Ineinem kurzen Einführungsvortrag stellteProf. Dr. Alexander Hartmaier die verschie-denen Werkstoffklassen vor. Begleitet wur-den die äußerst motivierten Jugendlichenvon ihren Lehrern Hans-Jürgen Swenne undNorbert Ermeling, die beide Fachlehrer fürChemie (und Englisch bzw. Erdkunde) sindund bereits seit vielen Jahren einen Koopera-
Planen für die Zukunft - DGM-Nachwuchsförderung fängt in derSchule an!
Schülerinnen und Schüler der Klasse 11 der Willy-Brandt-Gesamtschule Bochum an den Stationen der
DGM-„Forschungsexpedition ins Land der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik“
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
33TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
tionsvertrag mit der Fakultät für Chemie &Biochemie der RUB mit Leben füllen. DieLehrer konnten entspannt und gelassenbeobachten, wie ihre 11er Schülerinnen undSchüler an den verschiedenen Stationen diegestellten Aufgaben erfüllten. Dabei war esbemerkenswert, mit welcher Leichtigkeit dieJugendlichen ihr gelerntes Wissen an denExponaten einsetzen konnten.Erfreulicherweise plant Frau Prof. Dr. KatrinSommer für das Jahr 2011 auch eine Lehrer-fortbildung zum Thema Materialwissen-schaft und Werkstofftechnik. Damit bestehtdie Chance, dass unser Fachgebiet zu einemElement in einem zeitgemäßen Chemie- undPhysik-Unterricht wird. Somit leistet die„Forschungsexpedition ins Land der Mate-rialwissenschaft und Werkstofftechnik“ auchdurch die mit ihr verbundenen Aktivitäteneinen wichtigen Beitrag, den potentiellenNachwuchs und seine „Ausbilder“ frühzeitigfür unser Fachgebiet zu begeistern.Nun sind Sponsoren gefragt, die zum Bei-spiel Exkursionen zur „Prüfstelle Schülerla-bor“ im Alfried Krupp-Schülerlabor derRuhr-Universität Bochum ermöglichen oder
unsere Exponate für ihre Veranstaltungen –etwa im Zuge eines „Tages der offenen Tür“ –anfordern.
Weitere Informationen zur Wanderausstel-lung „Forschungsexpedition ins Land derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik“
und zum Schülerlaborprojekt „PrüfstelleSchülerlabor“ im Alfried Krupp-Schülerlaborfinden Sie hier: www.dgm.de/dgm/forschungsexpeditionwww.aks.rub.de/index.php
Dipl.-Ing. Fahima Fischer
(v.l.n.r.) Henning Steff , Prof. Dr. Katrin Sommer, Prof. Dr. Alexander Hartmaier, Lena Enste, OStR
Norbert Ermeling, Dr.-Ing. Frank O.R. Fischer, OStR Hans-Jürgen Swenne (Foto: Fahima Fischer)
Die interaktiveWanderausstel-lung der Deut-schen Gesell-
schaft für Materialkunde (DGM)„Forschungsexpedition ins Land der Mate-rialwissenschaft und Werkstofftechnik“ warvom 29. März bis zum 8. April 2011 an derTechnischen Universität Chemnitz zu Gastund wurde von dem Institut für Werkstoff-wissenschaft und Werkstofftechnik (IWW)betreut. Schülergruppen und Klassen voninsgesamt 7 verschiedenen Schulen nutztendas Angebot durch Experimente, wie Härte-messung, Lichtmikroskopie und Ultraschall-prüfung, verschiedenen Werkstoffen eigen-ständig auf die Spur zu gehen. Die 8Laborstationen sind selbsterklärend undladen zum ausgiebigen Experimentieren ein.Die Schüler erfuhren spielerisch, dass dieMaterialwissenschaft und Werkstofftechnikalle Bereiche unseres täglichen Lebens beein-flusst. Ein besonderes Highlight waren dieDrähte aus Formgedächtnismetall, die sicheine bestimmte Form merken und diese beiErwärmung immer wieder annehmen, egal
wie stark man sie vorher verformt. Mit selbst-gebastelten Formen aus diesem zauberhaftenDraht konnten sich die Schüler eine Erinne-rung schaffen, die sowohl der Draht als auch
die Schüler nicht so schnell vergessen wer-den.
Prof. Dr. Bernhard Wielage, Chemnitz
Werkstofftechnik spielerisch erleben
34 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
35TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
Verbindlich und sys -tematisch oder ver-schult und praxis-fern? Die Meinungenzur strukturiertenPromotion in denIngenieurwissen-schaften gehen weitauseinander. Moti-viert durch dieExzellenzinitiativehaben deutsche Uni-versitäten in den ver-gangenen JahrenGraduiertenschulen
und Doktorandenkollegs eingerichtet, indenen eine strukturierte Promotion mit inte-grierten Ausbildungsabschnitten gefördertwird. Doch nicht nur seitens der Industriebesteht eine gewisse Skepsis, inwiefern sichstrukturierte Programme für eine Promotionin den Ingenieurwissenschaften eignen. Vordiesem Hintergrund widmete sich ein eige-nes, durch den Studientag Materialwissen-schaft und Werkstofftechnik organisiertesSide Event der MSE 2010 in DarmstadtErwartungen, Optionen und Rahmenbedin-gungen für die Zukunft der Promotion in derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik.Unter dem Titel „Wege zur Promotion inMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik“diskutierten unter Moderation von Prof. Dr.Horst Biermann Vertreter von Universitäten,der Deutschen Forschungsgemeinschaft, derIndustrie sowie von acatech – Deutsche Aka-demie der Technikwissenschaften und
VDMA Perspektiven der Ingenieurpromo -tion. Im Mittelpunkt standen die Förderungdes wissenschaftlichen Nachwuchses undentsprechende Zielstellungen strukturierterProgramme. Weiterhin verdeutlichte die Ver-anstaltung Anforderungen des Arbeitsmark-tes und Erwartungen an Qualifikationen undKompetenzen promovierter Ingenieure.Schließlich gab das Side Event einenÜberblick über Konzepte und Strukturen, dieUniversitäten aktuell in der Qualifizierungund Betreuung von Doktoranden speziell inder Materialwissenschaft und Werkstofftech-nik verfolgen.Ausgangspunkt der Diskussionen war dieunbestritten hohe Reputation, die der deut-sche Titel „Dr.-Ing.“ nach wie vor genießt.Gleichzeitig führen ein internationaler Wett-bewerb um die besten Köpfe, die rasanteZunahme von Wissen und die Differenzie-rung und Spezialisierung von Wissens- undForschungsgebieten zu der Notwendigkeit,die Qualifikation des wissenschaftlichenNachwuchses an diese Veränderungen anzu-passen. Ein wesentlicher Aspekt dieserAnpassung sind Maßnahmen zur Strukturie-rung und Institutionalisierung der Doktoran-denqualifizierung. Die Definition relevanterQualifizierungskonzepte und eine Festle-gung von Verantwortlichkeiten auch seitensder Universitäten sollen die Qualität derDoktorandenbetreuung und damit die Qua-lität von Promotionen in den Ingenieurwis-senschaften sichern helfen. Darüber hinausbesteht das allgemein angestrebte Ziel derVerkürzung der Promotionsdauern.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft(DFG) fördert dazu seit nunmehr 20 Jahrendie Einrichtung von Graduiertenkollegs andeutschen Universitäten [1]. Wie die Vertrete-rin der DFG, Frau Dr. Annette Schmidtmann,betonte, bieten Graduiertenkollegs ein defi-niertes und auf den Nachwuchs individuellzugeschnittenes Forschungs- und Studien-programm mit fachlichen und fachübergrei-fenden Qualifizierungsangeboten. Umfang-reiche Mittel in Form von Stellen, Stipendienund finanziellen Hilfen z.B. für junge Elterntragen dazu bei, den Weg einer Promotionsicherer, planbarer und damit attraktiver zugestalten. Außerdem werden durch die Ein-richtung von Graduiertenkollegs Tagungen,Workshops, Auslandsaufenthalte sowie Gast-wissenschaftlerprogramme realisiert, diedem Promovierenden zusätzliche attraktiveMöglichkeiten für eine Qualifizierung bieten.Denn auch wenn die individuelle For-schungsleistung des Doktoranden im Mittel-punkt stehe, so Frau Dr. Schmidtmann, seidie Promotion kein drittes Studium. „EinePromotion ist die erste forschende Berufs -tätigkeit eines Wissenschaftlers bzw. einerWissenschaftlerin, die diese auf eine Lauf-bahn sowohl in der Wissenschaft als auch inder Industrie vorbereitet“, so ihre, von allenTeilnehmern einhellig geteilte, Aussage.Daher ist der Erwerb von Kompetenzen jen-seits der wissenschaftlichen Arbeit unbedingtnotwendig. Insgesamt lege die DFG Wertdarauf, die Vielfalt der Promotionswege zuerhalten, gleichzeitig aber Individualpromo-tionen besser zu strukturieren.
Wege zur Promotion in Materialwissenschaft und WerkstofftechnikVertreter aus Wissenschaft und Industrie diskutieren auf der MSE 2010 zur Zukunft der Ingenieurpromotion
Dr. Anja Geigenmüller,Lehrstuhl für Marketingund internationalenHandel, TechnischeUniversität BergakademieFreiberg
36 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
Das Verständnis der Promotion als ersteberufliche Tätigkeit wurde auch seitens derDeutschen Akademie für Technikwissen-schaften (acatech) hervorgehoben. Entspre-chend wichtig sei es, die Selbständigkeit vonDoktoranden in der Forschung, aber auch inder Lehre und der Projektarbeit zu fördern.Dies erfordere u. a. eine optimale Betreuungder Doktoranden durch verbindliche Betreu-ungskonzepte und die Vermittlung außer-fachlicher Qualifikationen. Folglich, so dieVertreterin der acatech, Vera Lohel, sei dieKoexistenz von Individualpromotion undstrukturierter Doktorandenqualifizierung fürdie Leistungsfähigkeit der Ingenieurpromoti-on überaus wichtig. Anregungen aus struktu-rierten Programmen sollten konstruktiv auf-gegriffen und zur Stärkung derIndividualpromotion genutzt werden. Eingegenseitiger Lernprozess sei ausgesprochenvorteilhaft angesichts der Rolle der Inge -nieur promotion als Bindeglied zwischen wis-senschaftlichen Fragestellungen und ihrerRelevanz für die industrielle Praxis. Eine aus-führliche Darstellung der Empfehlungen gibt
eine acatech-Studie aus dem Jahr 2008 [2].Anforderungen der Industrie an promovierteIngenieure erläuterte Frau Judith Herzog-Kuballa vom Kompetenzzentrum Bildungdes Verbandes des Deutschen Maschinen-und Anlagenbaus VDMA. Im Maschinenbaubestehe vor allem für Forschungs- undFührungspositionen weiterhin eine hoheNachfrage nach promovierten Ingenieuren.Doch das Anforderungsprofil habe sich starkverändert, so Frau Herzog-Kuballa. Es zähleinsbesondere die Fähigkeit, komplexe Pro-blemlösungsstrategien zu entwickeln undumzusetzen, eigenverantwortlich zu arbeitenund dabei Schnittstellen zwischen verschie-denen Funktionen im Unternehmen einzu-binden.Diese Sichtweise wurde auch durch den Ver-treter der Industrie, Dr. Ulrich Bast von derSiemens AG, nachdrücklich betont. Dr. Bastverwies auf den Umstand, dass in der Indus -trie Forschung dem Zweck der Gewinnorien-tierung folgt. Anders als in der Wissenschaftstehen in der Praxis marktfähige Leistungenmit wettbewerbsfähigen Alleinstellungs-
merkmalen im Mittelpunkt. Wichtig seidaher, dass Ingenieure ihre Arbeit als ent-scheidenden Baustein zur Realisierung kom-plexer Systeme begreifen. Sie müssen in derLage sein, nicht nur technische Systemanfor-derungen zu verstehen, sondern auch dasgeschäftliche und gesellschaftliche Umfeld.Neben Fachkenntnissen und ausgeprägtensozialen und kommunikativen Fähigkeitensei daher das Verständnis für den Markt unddas Unternehmen eine wesentliche Grundla-ge für die Laufbahn eines promovierten Inge-nieurs in der Industrie. In einer solchen Posi-tion sei die Übernahme von „Leadership“entscheidend, d. h. die Fähigkeit, Innovatio-nen voranzutreiben und entsprechendeTeams zu führen. Dazu gehöre auch, in mult-idisziplinären bzw. internationalen unddamit interkulturellen Netzwerken erfolgrei-che Teamarbeit zu leisten.Aus Sicht der Industrie sowie des VDMA las-sen sich solche Fähigkeiten durch zu starkverschulte Programme nur schwer vermit-teln. Vielmehr sei es notwendig, im Rahmenvon promotionsbegleitenden Industriepro-
Abbildung 1: Positionen zur Zukunft der Ingenieurpromotion
37TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
jekten praxisnah auszubilden und „arbeit-sprozessintegriertes Lernen“ zu ermöglichen.Auf Basis einer Promotionsstudie [3] siehtder VDMA daher das größere Potenzial inder Individualpromotion („Assistenzpromo-tion“), die durch Elemente einer strukturier-ten Ausbildung unterstützt werden sollte.Dies betreffe vor allem die Vermittlungaußerfachlicher Qualifikationen, wie z. B.Managementtechniken bzw. Fähigkeiten derMitarbeiterführung. Eine solche Personalent-wicklung gehe deutlich über reguläre Weiter-bildungsangebote hinaus. Zudem verweistder Verband auf die Verantwortung derbetreuenden Hochschullehrer, als Führungs-kräfte die Persönlichkeitsentwicklung ihrerDoktoranden zu fördern.Angesichts eines solch breiten Spektrumsvon Erwartungen an Qualifikationen undFähigkeiten von Promovierenden (vgl. Abbil-dung 1) stehen Universitäten vor der Heraus-forderung, geeignete und für Doktorandenattraktive Konzepte und Strukturen für einePromotion zu etablieren. Einen Einblick inderzeit existierende Qualifizierungskonzepte
in der Materialwissenschaft und Werkstoff-technik vermittelten die Präsentationen meh-rerer deutscher Universitäten. Vorgestelltwurden Graduiertenkollegs der Universitä-ten Bayreuth und Erlangen-Nürnberg (GRK1229, Prof. Dr. Mathias Göken), der Univer-sität Bremen (GRK 1375, Dr. Michaela Wil-helm) und des Karlsruher Institut für Techno-logie (KIT) (GRK 1483, Prof. Dr. AlexanderWanner). Außerdem präsentierten sich dieIntegrierten Graduiertenkollegs zweier Son-derforschungsbereiche, des SFB 799 „TRIP-Matrix-Composite“ der TU BergakademieFreiberg (Dr. Anja Geigenmüller) sowie desSFB 855 „Magnetoelektrische Verbundwerk-stoffe“ der Universität Kiel (Prof. Dr. EckhardQuandt).Die Erfahrungen der verschiedenen Kollegszeigen, dass strukturierte Programme für dieQualifikation von Doktoranden der Material-wissenschaft und Werkstofftechnik sowohl infachlicher als auch persönlicher und organi-satorischer Hinsicht Vorteile bieten. In fachli-cher Hinsicht eignen sich Graduiertenkollegsals Plattform für einen interdisziplinären
Austausch, für Vernetzung und gemeinsa-mes Lernen über Disziplingrenzen hinweg.Gerade für stark interdisziplinäre Gebietewie die Materialwissenschaft und Werkstoff-technik ist das Verständnis für Nachbardiszi-plinen und eine Kommunikation zwischenverschiedenen Fachgebieten von unschätzba-rem Wert. Zudem profitieren Doktorandenvon der Möglichkeit, sowohl von Professorenals auch von Kollegiaten Feedback zu ihrenProjekten und Forschungsvorhaben zu erhal-ten. Die Einbindung von Vertretern der In -dus trie, z. B. in Form von Industriebeiräten,stellt eine Möglichkeit dar, die geforderte Ver-bindung zur industriellen Praxis herzustel-len.In persönlicher Hinsicht bieten Graduierten-kollegs einen geeigneten Rahmen, Eigenstän-digkeit und Selbstorganisation der Kollegia-ten zu fördern. Doktoranden erhalten denFreiraum, sich in die Konzeption und Organi-sation von Lehrveranstaltungen, Projekten,Tagungen und Workshops einzubringen undso „ihr Graduiertenkolleg“ aktiv mitzugestal-ten. Großzügige Möglichkeiten für Auslands -
Abbildung 2: Zufriedenheit von Doktoranden der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik mit ihrem Promotionsverlauf [4]
38 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
aufenthalte fördern zudem internationaleund interkulturelle Erfahrungen der Kolle-giaten und tragen so zur Persönlichkeitsent-wicklung des Nachwuchses bei. Schließlicherfolgt im Rahmen von Graduiertenkollegseine klare Strukturierung des Promotions -prozesses. Betreuungsvereinbarungen sowieregelmäßige Statusgespräche und Eigenbe-richte erhöhen die Transparenz des Promo-tionsprozesses sowohl für Doktoranden alsauch für betreuende Hochschullehrer. Eineempirische Untersuchung zu Einstellungenund Bedürfnissen von Doktoranden derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnikim Rahmen der Promotion und der nachfol-genden Karriereplanung im Jahr 2008 unter-stützt diese Sichtweise. Wie aus der Abbil-dung 2 hervorgeht, bewerteten Doktorandenaus strukturierten Programmen ihre Betreu-ung, den Fortschritt in der Promotion und dieAustauschmöglichkeiten mit anderen Wis-senschaftlern signifikant positiver als Befrag-te, die eine Individualpromotion ohne struk-turierte Elemente absolvieren.Generell zeigt sich, dass strukturierte Pro-gramme die Promotionskultur an Universitä-ten deutlich verändern können. Mehrere Uni-versitäten reagieren darauf mit derEtablierung fachübergreifender Dachorgani-sationen. Ein Beispiel dafür stellte Prof. Dr.Martin Heilmaier, Vizepräsident für For-schung und wissenschaftlichen Nachwuchsder TU Darmstadt vor. Mit „Ingenium –Young Researchers at TU Darmstadt“ grün-dete die Universität jüngst eine zentrale Ein-richtung, die u. a. Qualitätsstandards für Pro-motionen festlegt, Weiterbildungs- undBeratungsangebote bündelt, die Vernetzung
innerhalb und außerhalb der Universitätsteuert und als Ansprechpartner vor allemfür internationale Doktoranden dient.Als Fazit der Veranstaltung lässt sich festhal-ten, dass die Promotion im Bereich der Mate-rialwissenschaft und Werkstofftechnik vonstrukturierten Programmen durchaus profi-tieren kann. Das Angebot zusätzlicher, außer-fachlicher Qualifikationen, umfassende Mög-lichkeiten für eine internationale Vernetzungsowie ein interdisziplinärer Dialog zwischenDoktoranden unterstützt nicht nur das Ziel,Promovierende in den Ingenieurwissenschaf-ten nachhaltig zu fördern. Strukturierte Pro-gramme können auch dazu beitragen, talen-tierte Nachwuchskräfte für den Weg einerPromotion zu gewinnen.Offen bleibt die Frage, welche Abschlüssezukünftig den Zugang zu einer Promotioneröffnen. Die Einführung von Bachelor- undMasterabschlüssen an Hochschulen und Uni-versitäten hat Ausbildungswege bis hin zurPromotion deutlich verändert. Daher wirdunter anderem zu klären sein, unter welchenVoraussetzungen Bachelorabsolventen zurPromotion zugelassen und wie sie leistungs-gerecht in entsprechende Strukturen für einePromotion integriert werden können. Dashierfür verwendete Stichwort des „FastTrack“ für herausragende Studenten ist eineHerausforderung für die Universitäten, neueWege unter Beibehaltung der bisherigenQualitätsstandards zu erwägen. Das SideEvent war somit ein erster Schritt, einen Dia-log zwischen allen Beteiligten zu initiierenund gemeinsam geeignete Strategien zur Pro-motion in der Materialwissenschaft undWerkstofftechnik zu erarbeiten.
[1] Fremmer, A.; Brüggemann, N. (2010): 20Jahre Graduiertenkollegs. Deutsche For-schungsgemeinschaft DFG (Hrsg.), Bonn.www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_pro-fil/geschaeftsstelle/publikationen/20_jah-re_graduiertenkollegs.pdf [2] Zäh, M. F. (2008): Empfehlungen zurZukunft der Ingenieurpromotion. Wege zurweiteren Verbesserung und Stärkung derPromotion in den Ingenieurwissenschaftenan Universitäten in Deutschland. acatechberichtet und empfiehlt Nr. 3, acatech - Deut-sche Akademie der Technikwissenschaften(Hrsg.), Stuttgart. www.acatech.de/filead-min/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/Pro-jektberichte/Acatech_Ingenieurpromotion_FINAL.pdf [3] Feller, C.; Kottkamp, E.; Rauen, H. (2006):Wir kümmern uns um die Elite, VDMA Posi-tionen zur Promotion, Verband DeutscherMaschinen- und Anlagenbau e.V. (Hrsg.),Frankfurt/M. [4] Schöpe, T.; Enke, M.: Empi-rische Studie zu Einstellungen und Bedürf-nissen von Doktoranden der Materialwissen-schaft und Werkstofftechnik im Rahmen derPromotion und der nachfolgenden Karriere-planung. TU Bergakademie Freiberg, 2008.
Autoren: Dr. Anja Geigenmüller, Lehrstuhl für Marke-ting und internationalen Handel und Prof.Dr.-Ing. Horst Biermann, Institut für Werk-stofftechnik, Technische Universität Bergaka-demie Freiberg
aus: DGM aktuell 10/2010
39TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
02.03.-05.03.2010Einführung in die Metallkundefür Ingenieure und TechnikerDarmstadt
17.03.-18.03.2010Titan und TitanlegierungenKöln
21.03.-26.03.2010Systematische Beurteilung techni-scher SchadensfälleErmatingen
22.03.-24.03.2010Entstehung, Ermittlung undBewertung von EigenspannungenKarlsruhe
26.05.-27.05.2010PulvermetallurgieAachen
21.06.-23.06.2010Computer-Aided Thermodyna-micsMaria Laach
15.09.-17.09.2010Bruchmechanik: Grundlagen,Prüfmethoden und Anwendungs-beispieleFreiberg
25.10.-26.10.2010Mechanische Oberflächenbehand-lung zur Verbesserung derBauteil eigenschaftenKarlsruhe
26.10.-28.10.2010HochtemperaturkorrosionJülich
09.11.-11.11.2010Moderne BeschichtungsverfahrenDortmund
09.11.-10.11.2010Faserverbundwerkstoffe - Ferti-gung, Prüfung und Anwendung(Teil 1)Stuttgart
10.11.-11.11.2010Faserverbundwerkstoffe - Lami-natberechnung (Teil 2)Stuttgart
24.11.-26.11.2010BauteilmetallographieBerlin
01.12.-02.12.2010Schicht- und OberflächenanalytikKaiserslautern
06.12.-07.12.2010Direktes und Indirektes Strang-pressenBerlin
21.09.-24.09.2010Einführung in die Metallkunde fürIngenieure und TechnikerDarmstadt
22.09.-24.09.2010Zerstörende Werkstoffprüfung fürFortgeschrittenePaderborn
03.10.-08.10.2010Systematische Beurteilung techni-scher SchadensfälleErmatingen
06.10.-07.10.2010Schweißtechnische Problemfälle:Metallkundlich-technologischeAnalyseBraunschweig
11.10.-13.10.2010Gefüge und Schädigung: Ionen-und elektronenmikroskopischePräparation und 3D-AnalyseSaarbrücken
25.10.-26.10.2010Löten - Grundlagen und Anwen-dungenAachen
Fortbildungen und Workshops im Jahr 2010
23.03.-23.03.2010Multimaterialsysteme - Zukünfti-ge Leichtbauweisen für ressour-censparende Mobilität - im Pro-gramm WING des BMBF -Frankfurt
07.06.-07.06.2010Fördermittel effizient nutzen •Nanotechnologie • Materialfor-schung • ProduktionstechnikFrankfurt
26.10.-27.10.2010Zuverlässigkeit Feuerfester Pro-dukte für die GießereiRheinbach
26.10.-27.10.2010Arbeitstechniken - Werkzeugeund Methoden für den Vorsprungim ArbeitsalltagFrankfurt
30.06.-30.06.2010Energieeffizienter Leichtbau: Rah-menkonzept "Forschung für dieProduktion von morgen" - BMBF-Bekanntmachung vom April/Mai2010Frankfurt
07.10.-07.10.2010Intelligente Werkstoffe für innova-tive Produkte - im ProgrammWING des BMBF -Frankfurt
Neue Fortbildungen und Workshops im Jahr 2010
40 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Fortbildungen und Nachw
uchsförderung
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
15.11.-16.11.2010Soft Skills: Schlüsselqualifikationfür die KarriereFrankfurt
18.11.-19.11.2010Einführung in die Grundlagen desTiefziehensDortmund
01.12.-02.12.2010Bauteilschädigung durch Korrosi-onKöln
08.12.-09.12.2010Produktentwicklung mit kerami-schen WerkstoffenRheinbach
29.11.-30.11.2010NanoanalytikDresden
29.11.-30.11.2010Projektmanagement - Der richtigeWeg zum Erfolg von ProjektenFrankfurt
30.11.-01.12.2010Metallurgie und Technologie derAluminium-WerkstoffeBonn
41TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Beratung von Wissenschaft und Wirtschaft
Beratung von Wissenschaft und W
irtschaft
Im Berichtszeitraum war die Beratung vonWissenschaft und Industrie zum Einwerbenvon Drittmitteln ein weiterer Schwerpunktder DGM-Arbeit. So fand im Oktober 2009 der erste Workshopzum Thema „Intelligente Werkstoffe“ inAachen statt. Dort stellten Expertinnen undExperten aus Wissenschaft und Industrie denForschungsförderorganisationen wie DFG,VDI-TZ oder PtJ in Impulsvorträgen denzukünftigen Förderungsbedarf vor, um amForschungs- und WirtschaftsstandortDeutschland neue Forschungs- und Techno-logiefelder zu erschließen und zu sichern.Am Ende der Workshops wurde mit Unter-stützung von Frau Professor Marion A. Weis-senberger-Eibl vom Lehrstuhl für Innovati-ons- und Technologie-Management derUniversität Kassel eine Roadmap mit denErgebnissen erstellt und der interessiertenÖffentlichkeit bereitgestellt.Der DGM-Strategieworkshop „IntelligenteWerkstoffe“ führte Mitte 2010 zu einer gleich-
lautenden BMBF-Bekanntmachung. So leiste-te die DGM nachweisbar einen wichtigenBeitrag zum Generieren von Fördermitteln, -zum Vorteil ihrer Mitglieder und des gesam-ten Fachgebiets.Im November 2010 veranstaltete die DGM inAachen einen weiteren Strategieworkshop,diesmal zum Thema „Wo steht Deutschlandmit seiner Modellierung und Simulation?“.Auch er hatte zum Ziel, Forschungsbedarf inWissenschaft und Industrie aufzuzeigen undals Roadmap den Forschungsförderorganisa-tionen zur Verfügung zu stellen. Die Ergeb-nismatrix kann im Netz unterwww.dgm.de/past/2010/strategieworks-hop_nov/php/ergebnismatrix.pdf als pdfabgerufen werden.Zudem hat die DGM 2009 einen Fachaus-schuss zum Thema „Bioinspirierte Materiali-en“ gegründet, um eine Brücke zwischen denNaturforschern auf der einen sowie denMaterialwissenschaftlern und Werkstofftech-nikern auf der anderen Seite zu schlagen –
und so den Dialog zwischen den Disziplinenzu unterstützen. In diesem Rahmen ist fürHerbst 2011 mit der Unterstützung der DFGauch ein DGM-Strategieworkshop zum The-ma „Was bietet die Natur an Lösungen derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik“in Planung, der mit der DGM-Tagung „Bio-Inspired Materials, International School andConference on Biological Materials Science“im März 2012 in Potsdam konform geht. ImZentrum soll dabei die Frage stehen, ob der-zeit eine ausreichende Vernetzung zwischenden Naturforschern sowie den Materialwis-senschaftlern und Werkstofftechnikernbesteht.
Weitere Informationen zu allen DGM-Strate-gieworkshops sind im Netz unterwww.dgm.de/strategieworkshop abrufbar.
Beratung von Wissenschaft und Wirtschaft
In der Bundes-r e p u b l i kDeutschlandwird dasGebiet derMaterialwis-senschaft undWerkstofftech-nik schon seitMitte der1980er Jahrevon der Bun-
desregierung engagiert gefördert. Hintergrundist u.a. die Erkenntnis, dass für internationalwettbewerbsfähige technologische Innovatio-nen häufig die Verfügbarkeit leistungsfähigerund kostengünstiger Werkstoffe die Vorausset-zung ist. Schon damals wurde fest gestellt:Material for schung muss lang fristig angelegtwer den, soll sie erfolgreich sein. Dies giltunverändert auch heute noch.Aufbauend auf einer schon in den 1990er Jah-ren guten Position im internationalen Vergleich
wird dem Gebiet in Deutschland auch aktuelleine in vielen Feldern führende Positionbescheinigt. Einer der Gründe hierfür ist nichtzuletzt, dass die öffentliche Förderung derMaterialforschung und Werkstofftechnik inDeutschland durch den Bund, die Länder unddie EU derzeit mit insgesamt jährlich gut 1 Mrd. Euro* ausgestattet ist. Das ist eine guteBasis.Die gute Position gilt es zu halten und weiterauszubauen, will Deutschland seinen führen-den Platz als Technologie- und Innovations-standort in einer globalisierten Welt erhalten.Dazu bedarf es der Weiterentwicklung von(Förder-) Konzepten, der Fokussierung auf diezentralen Themenfelder - in den Instituten undHochschulen ebenso wie in der Industrie. Diesschließt besonderes Augenmerk auf qualifizier-te Ausbildung und Nachwuchsförderung mitein.Eine noch engere und effizientere Zusammen-arbeit von institutioneller Forschung und indu-strieller Entwicklung, die Bearbeitung der
gesamten Wertschöpfungskette vom Materialbis zur Anwendung in Systemen – die nochzügigere Umsetzung von Inventionen in markt-fähige Innovationen – hat hier strategischeBedeutung.Klima/Energie, Gesundheit/Ernährung, Mobi-lität, Sicherheit und Kommunikation sind diezentralen Handlungsfelder der Hightech-Stra-tegie 2020 der Bundesregierung. Es liegt auf der Hand, dass zur Lösung vonHerausforderungen in diesen Feldern – insbe-sondere bei Klima/Energie, Mobilität undKommunikation – moderne Werkstoffe zentra-le Beiträge leisten können und werden. Aberman kann es nicht oft genug wiederholen: Ent-wicklungszeiten von der Idee bis zur Anwen-dung - „Time to Market“ und Kosten werdenzu den erfolgskritischen Faktoren gehören.Nicht nur eine strategische Forschungs -planung, die Entwicklung von zukunftsfähigenKonzepten der Zusammenarbeit und die Defi-nition von prioritären Themen sind erforder-lich. Der europäische Forschungsraum spielt
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik in Deutschland: Unsereführende Position halten und ausbauen
42 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Beratung von W
issenschaft u
nd W
irtschaft
Beratung von Wissenschaft und Wirtschaft
hier eine zunehmend wichtige Rolle. MancheProblemlösungen werden nur im Rahmen einerinternationalen Bündelung der Kräfte zu lösensein. Dazu gehört letztlich auch das verstärkteEngagement von Experten aus Deutschland inden Gremien der Europäischen Union.Die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde
DGM mit der breit gefächerten Expertise ihrerMitglieder aus Forschung und Industrie istgeradezu prädestiniert, sich wirkungsvoll indiesen Prozess einzubringen und mitzuwirken.Einfach ist das nicht. Die Prozesse müssen ent-wickelt, organisiert und umgesetzt, in politi-sche Entscheidungen implementiert werden.
Aber es ist eine lohnende Aufgabe!
Wolfgang Faul, Jülich* Quelle: F.J. Bremer, Projektträger Jülich
aus: DGM aktuell 08/2010
Das Bundesministerium für Bildung undForschung (BMBF) hat die Förderung vonForschungs- und Entwicklungsvorhabenzum Thema "Energieeffizienter Leichtbau"im Rahmenkonzept "Forschung für die Pro-duktion von morgen" bekanntgemacht, u. A.mit den Schwerpunkten: • Entwicklung ressourceneffizienter undwirtschaftlicher Herstellungs- und Bearbei-tungstechnologien und entsprechender Anla-gen und Werkzeuge • Technologien zum Material- und Halb-zeughandling
• Optimierte Herstellungsprozesse durchSimulation und prozessintegrierte Qualitäts-sicherungsverfahren für eine automatisierteFertigung.
Förderkonzept ist die Verbundforschung vonIndustrie und Instituten. Antragstellungerfolgt in einem zweistufigen Verfahren.
Deadline der ersten Stufe mit der Einrei-chung von Projektskizzen ist der 31.7.2010.
• Die DGM bietet hierzu am 30.6.2010 inFrankfurt für Interessenten einen spezifi-schen Workshop zur Gestaltung von erfolg-versprechenden Projektskizzen an. • Anschließend besteht (nach Voranmel-dung) die Möglichkeit der vertraulichen indi-viduellen Einzelberatung. • Der Workshop richtet sich an Vertreter aus
Industrie und Forschung. Die Teilnehmer-zahl ist auf 24 begrenzt. • Teilnehmer sollten sich zuvor mit derBekanntmachung vertraut gemacht haben(http://www.produktionsforschung.de/national/bekanntmachungen/index.htm). • Vor Einreichung der Projektskizzen könnendiese zudem in einem individuellen vertrau-lichen Check bezüglich Vollständigkeit, Plau-sibilität, Konformität zu dieser Ausschrei-bung und zu den allgemeinenFörderbedingungen unterzogen werden (hiergesonderte Kosten).
Der Workshop wird geleitet von Dipl.-Ing.Wolfgang Faul, ProjektEntwicklung Werk-stofftechnik.
aus: DGM news 06/2010
Workshop Energieeffizienter Leichtbau
43TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Beratung von Wissenschaft und W
irtschaft
Beratung von Wissenschaft und Wirtschaft
Die BMBF-Bekanntmachung zum Themen-feld „Intelligente Werkstoffe für innovativeProdukte“ im Rahmen des Förderprogramms„WING - Werkstoffinnovationen für Indu-strie und Gesellschaft“ hatte ihren Ursprungim DGM-Strategieworkshop „IntelligenteWerkstoffe“ vom 15. Oktober 2009 in Aachen.Damit wird deutlich, dass das Expertennetz-werk der DGM ein idealer Impulsgeber fürneue Förderinitiativen ist.Die BMBF-Bekanntmachung finden Sie hier:www.bmbf.de/foerderungen/ 15112.phpIn der ersten Stufe sind zunächst dem Pro-jektträger bis spätestens 15. November 2010Projektskizzen vorzulegen.
Zur Antragsvorbereitung bietet die DGM am7. Oktober 2010 in Frankfurt einen Antrags-workshop unter Leitung von Herrn Dipl.-Ing.Wolfgang Faul an. Hier erfahren Sie wertvol-le Hinweise und Details zur Antragsausarbei-tung. Eine Einzelberatung ist ebenfalls mög-lich. Anmeldungen richten Sie bitte direkt anHerrn Niels Parusel ([email protected], Tel.: 069-75306-757).Der nächste DGM-Strategieworkshop zumThema „Wo steht Deutschland mit seinerModellierung und Simulation?“ findet am22.11.2010 in Aachen unter Schirmherrschaftvon Herrn Professor Günter Gottstein statt.Neben Impulsvorträgen aus Wissenschaftund Industrie werden auch wieder die Ver-treter von DFG und den Projektträgern einenÜberblick liefern. Das Programm und dieMöglichkeit zur Anmeldung stehen Ihnen abEnde September unter
www.dgm.de/dgm/strategieworkshop_novzur Verfügung. Vorabanfragen richten Sie bit-te direkt an Dr.-Ing. Frank O.R. Fischer([email protected], Tel.: 069-75306-756).
Wir wünschen Ihnen bei der Antragstellungviel Erfolg und würden uns freuen, Sie beimnächsten DGM-Strategieworkshop zum The-ma „Wo steht Deutschland mit seiner Model-lierung und Simulation?“ am 22. November2010 in Aachen begrüßen zu dürfen.
Dr.-Ing. Frank O.R. FischerGeschäftsführendes Vorstandsmitglied
aus: DGM aktuell 08/2010
Bekanntmachung des BMBF über die Förderung zum Themenfeld„Intelligente Werkstoffe für innovative Produkte“
44 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Beratung von W
issenschaft u
nd W
irtschaft
Beratung von Wissenschaft und Wirtschaft
Das Bundesministerium für Bildung undForschung (BMBF) hat die Förderung vonForschungs- und Entwicklungsvorhabenzum Thema "Materialien für eine ressource-neffiziente Industrie und Gesellschaft -MatRessource" im Rahmen des Förderpro-gramms "WING - Werkstoffinnovationen für
Industrie und Gesellschaft" bekanntgemacht.
Deadline zur Einreichung von Projektskizzenwar der 28. Februar 2011.
Die DGM bot hierzu am 12. Januar 2011 inFrankfurt für Interessenten einen spezifi-schen Workshop zur Gestaltung von erfolg-versprechenden Projektskizzen an.Der Workshop richtete sich an Interessentenaus Industrie und Wissenschaft. Ziel war dieGestaltung von erfolgversprechenden Pro-jektvorschlägen zu der o.g. BMBF-Bekannt-machung.
Empfohlen wurde, dass Teilnehmer sichmöglichst zuvor mit den Grundzügen derBekanntmachung vertraut gemacht habensollen.
Anschließend bestand - nach Voranmeldung- die Möglichkeit der vertraulichen individu-ellen Einzelberatung.
Vor endgültiger Einreichung der Projektskiz-zen konnten diese auf Wunsch - individuellund vertraulich - bis 18. 2. 2011 zusätzlicheinem Check auf Vollständigkeit, Konfor-mität und Plausibilität unterzogen werden.
Der Workshop wurde geleitet von Dipl.-Ing.Wolfgang Faul, Projekt Entwicklung Werk-stofftechnik.
aus: DGM-newsletter 11/2010
DGM-Beratungsworkshop zur BMBF-Bekanntmachung am Mittwoch, 12.01.2011 in Frankfurt „Materialien für eine ressourceneffiziente Industrie und Gesellschaft - MatRessource“
Der DGM‐Strategieworkshop zum Thema„Wo steht Deutschland mit seiner Modellie-rung und Simulation?“ fand am 22.11.2010 inAachen unter Schirmherrschaft von Herrn
Professor Gottstein statt. Neben Impulsvor-trägen aus Wissenschaft und Industrie liefer-ten auch wieder die Vertreter von DFG undden Projektträgern einen Überblick.
Website des Strategieworkshops:http://www.dgm.de/past/2010/strategieworkshop_nov/
DGM-Strategieworkshop "Wo steht Deutschland mit seiner Modellierung und Simulation?"
45TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Aber auch in den klassischen Aufgabenfel-dern der DGM, den Tagungen und Fortbil-dungen zeigten sich im Berichtszeitraumüberaus erfreuliche Impulse. Sowohl 2009 alsauch 2010 wurden wichtige neue Tagungeninitiiert, die das Profil der DGM weiterschärften. Dazu gehört zweifellos die EURO-Superalloys, die im Mai 2010 erstmalig unterLeitung von Professor Martin Heilmaier inWildbad-Kreuth stattfand. Der Zuspruch mitüber 230 Teilnehmern aus der ganzen Weltunterstrich die Notwendigkeit, dieses Themaim Rahmen einer DGM-Tagung aufzugreifen. Im August desselben Jahres folgte dann dieMSE2010 und im Oktober erstmalig die Cell-Mat zum Thema „Zellulare Werkstoffe“ inDresden. Letztere soll zukünftig alle zweiJahre die Entwicklungen im Bereich der zel-lularen Werkstoffe aus Glas, Keramik undMetallen diskutieren und so die interdiszi-plinäre Vernetzung und den Austausch überdie Materialklassen hinweg ermöglichen. AufHochtouren laufen die Vorbereitungen fürdie neuen Tagungen der DGM zum Thema„Aluminium“ (ECAA2011) sowie „Reibungund Verschleiß“ (Friktion2011). Mit über 260Teilnehmerinnen und Teilnehmern übertrafdie erste Biomaterial-Tagung der DGM(EURO-BioMat) im April 2011 in Jena alle
Erwartungen. An dieser Stelle sei Herrn Pro-fessor Klaus D. Jandt und Herrn Dr. ThomasF. Keller ganz herzlich für die ehrenamtlicheUnterstützung gedankt.
Tagungen und Fortbildungen der DGM2010 - 2012Für März 2012 plant die DGM eine neueTagung zum Thema „Bio-Inspired Materials,International School and Conference on Bio-logical Materials Science“ die von Herrn Pro-fessor Peter Fratzl in Potsdam geleitet wer-den wird. Sie widmet sich jenen natürlichenMaterialien, die durch ihre in Jahrmillionenoptimierten Eigenschaften die Einsatzmög-lichkeiten von künstlich hergestellten Pro-dukten weit übertreffen. Die Tagung trägtdem Umstand Rechnung, dass sich in denletzten Jahren eine immer größer werdendeZahl von Wissenschaftlerinnen und Wissen-schaftlern, aber auch immer mehr Firmen mitdiesen Materialien beschäftigen, um, inspi-riert durch die Natur, neue Materialien fürWissenschaft und Forschung zu entwickeln.Neben all ihren neuen Aktivitäten ist dieDGM stets bemüht, auch die Qualität derbestehenden Tagungen weiter zu verbessern.Dabei können wir uns vor allem auch auf dieExpertise und Motivation der jeweiligen Lei-
terinnen und Leiter verlassen. Im November2010 fand in Neu-Ulm die Tagung „Strang-gießen“ unter Leitung von Dr. Hilmar R.Müller statt. Im Dezember 2010 folgte eben-falls in Neu-Ulm die Gemeinschaftstagung„Werkstoffprüfung“ unter Leitung von Pro-fessor Michael Pohl. Ebenfalls sehr erfolg-reich folgte im März 2011 die Tagung „Ver-bundwerkstoffe“ unter Leitung vonProfessor Bernhard Wielage in Chemnitz. Fürdie Traditionstagung „Materialographie“ imSeptember 2011 in Karlsruhe laufen die Vor-bereitungen bereits auf Hochtouren.
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
46 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Tagungen der DGM 2010-2012
Jahresvergleich der DGM-Veranstaltungsbesucher (Tagungen und Fortbildungen)
47TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Was sich bewährt hat, das soll man wiederho-len. Nach dem großen Debüterfolg der Kon-ferenz „Materials Science and Engineering“(MSE) in Nürnberg vor zwei Jahren, fanddeshalb vom 24. bis zum 26. August 2010 diezweite MSE-Konferenz im Anschluss an denDGM-Tag an der TU Darmstadt statt. Diesmal stand die internationale Veranstal-tung unter dem Motto „Young Researchersmeet Professionals“ – ein Grundsatz, deroffenbar viele Besucher, vor allem aber auchNachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-wuchswissenschaftler aus dem Bereich derMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik,in die Universitätsräume locken konnte. Inseiner Eröffnungsrede begrüßte der DGM-Vorsitzende Prof. Kaysser die Gäste aus allerWelt und wünschte ihnen eine erfolgreicheTagung in Darmstadt.Insgesamt konnte die von der DGM organi-sierte Veranstaltung, mitsamt ihren imUmfeld stattfindenden Side Events, mehr als1.000 Besucher aus 43 Ländern begrüßen. Über 300 Doktorandinnen und Doktorandennahmen an der Tagung teil und präsentiertenihre Ergebnisse in Form von Vorträgen undPostern. Dabei lag das Durchschnittsalter bei
34 Jahre, sodass die MSE 2010 ihrem Motto„Young Researchers meet Professionals“mehr als gerecht werden konnte.Neben spannenden Plenarvorträgen gab esgleich am Abend des ersten Tages eine Party,auf der man sich kennenlernen und ersteKontakte knüpfen konnte. Highlight wardabei sicherlich der Auftritt der beiden„Kings of Soul“ Waymond Harding und Smi-ley Garfield, die dem vorwiegend jungenPublikum kräftig einheizten. So konnte es gut gelaunt, aber auch hochmotiviert in die professionell aufbereitetePostersession am zweiten Tag gehen. Inintensiven Gesprächen auf hohem Niveaufand hier ein reger Austausch der Teilnehme-rinnen und Teilnehmer statt.Am letzten Tag der MSE 2010 stellte das Bun-desministerium für Bildung und Forschung(BMBF) gemeinsam mit der Deutschen Aka-demie der Technikwissenschaften (acatech)in einem Pressegespräch das neue 10-Punkte-Programm zur Förderung der Materialwis-senschaft und Werkstofftechnik vor, die als„Schlus̈sel fur̈ die Gestaltung der Zukunft“,etwa im Bereich von Klima- und Umwelt-schutz, Gesundheitsforschung oder Informa-
tions- und Kommunikationstechnik, verstan-den werden. Parallel zur MSE-Konferenz fanden auch2010 wieder verschiedene Side Events zuaktuellen Fragestellungen rund um das Fach-gebiet der Materialwissenschaft und Werk-stofftechnik statt, die von den Teilnehmerngebührenfrei besucht werden konnten. DieDeutsche Akademie der Technikwissenschaf-ten (acatech) und die Deutsche Forschungs-gemeinschaft (DFG) diskutierten etwa überdie Chancen von Materialwissenschaft undWerkstofftechnik im europäischen For-schungsraum. Der Studientag wiederum thematisierte dieFrage nach Sinn und Unsinn strukturierterPromotionsprogramme und stellte dazu dieAusbildungskonzepte von Graduiertenkol-legs und Sonderforschungsbereichen mitintegriertem Graduiertenkolleg im Fachge-biet vor.Ein Side Event gab anhand laufender For-schungsprojekte einen profunden Einblick indas Spannungsfeld von Material, Innovationund Gesellschaft, ein anderes beleuchteteunter Federführung vom VDI-TZ konkretdas Innovationspotenzial der MetallischenGläser und der Funktionellen Oxide für dieElektronik. Die Frage, wie die Wahrnehmung
Eröffnung der MSE 2010 durch den DGM-Vorsitzenden Prof. Kaysser.
Was sich bewährt hat, das soll man wiederholen - MSE 2010 am neuen Tagungsort Darmstadt verlief sehr erfolgreich
48 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
von Materialwissenschaft und Werkstofftech-nik in der Öffentlichkeit gesteigert werdenkann, stand beim Themennetzwerk von aca-tech und der Bundesvereinigung Material-wissenschaft und Werkstofftechnik (BVMat-Werk) auf der Agenda. Gemeinsam mit denTeilnehmern wurden hier Ziele, Zielgruppen,neue Kommunikationsformate und konkreteAktivitäten diskutiert. So konnte sich derNachwuchs, wie bei der MSE 2010 auch,engagiert selbst mit einbringen – was er auchrege tat.Die DGM-Geschäftsstelle möchte sich beiallen Beteiligten – insbesondere der DGM-Ortsgruppe Darmstadt und dem DGM-Bera-terkreis – für die exzellente Unterstützungdanken, ohne die die MSE 2010 so nicht ver-laufen wäre. Wir würden uns freuen, wennwir Sie auch 2012 zur nächsten MSEbegrüßen können (25. bis 29.09.2012 in Darm-stadt).
Dr.-Ing. Frank O. R. FischerGeschäftsführendes Vorstandsmitglied
aus: DGM aktuell 09/20
Nächste MSE 2012 am 25.-27. Sept. 2012
Prof. Lupascu und Prof. Faupel im Gespräch
Prof. Kaysser und Prof. Riedel
Internationaler Nachwuchs auf der MSE
49TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Über 30% der Teilnehmer waren Frauen
Prof. Rödel, TU-Darmstadt hielt den ersten Plenarvortrag zur MSE 2010 Highlight der MSE-Party war der Auftritt der beiden „Kings of Soul“ WaymondHarding und Smiley Garfield
Prof. Quandt, Prof. Faupel, eine Doktorandin und Prof. Kaysser Dr. Fischer, Frau Naddaf aus Kaiserslautern und Prof. Kaysser
50 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Vom 25. bis 28. Mai 2010 fand zum ersten Maldas European Symposium on Superalloysand their Applications (EuroSuperalloys)unter der federführenden Organisation derDGM in Wildbad Kreuth nahe dem maleri-schen Tegernsee statt. Die Idee, diese Veran-staltung ins Leben zu rufen, kam einigen Wis-senschaftlern des Programmausschusses
(derzeitiger Leiter: Prof. Martin Heilmaier,TU Darmstadt) aufgrund ihrer sehr positivenErfahrungen mit dem US-amerikanischenPendant dieser Tagung. So wurde ein Formatgewählt, das nicht nur den Austausch wis-senschaftlicher Erkenntnisse, sondern auchdas persönliche Miteinander maximal för-dern sollte. Dies bedeutete einerseits viel Zeit
für die „poster sessions“ vorzusehen, inderen Rahmen auch drei junge Wissenschaft-ler(innen) mit Geldpreisen, dank der finanzi-ellen Unterstützung der Firma Alstom,geehrt werden konnten, andererseits aberauch die Zahl der Parallelsitzungen klein zuhalten und den Fokus auf „Plenary sessions“mit hochrangigen nationalen und internatio-nalen Vortragenden zu legen. Das einhelligpositive Feedback der über 230 Tagungsteil-nehmer aus 30 Ländern motiviert den Pro-grammausschuss daher zusätzlich, dieseTagung in dem dafür spezifisch erfolgreichenFormat in 4 Jahren zu wiederholen. Die DGMfreut sich auf eine erfolgreiche Fortsetzung in2014, vielleicht dann im Sinne der europäi-schen Zusammenarbeit in einem (westlichliegenden) Nachbarland!
aus: DGM aktuell 07/2010
EuroSuperalloys, 25.-28.05.2010 in Wildbad Kreuth mit mehr als230 Teilnehmern erfolgreich ins Leben gerufen!
Prof. Fleck, Prof. Jandt, Dr. Fischer und Dr. Keller Prof. Lukas bei der Präsentation des 10-Punkte-Programms vom BMBF
51TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Die internatio-nale Fachtagung„Verbundwerk-stoffe und Werk-stoffverbunde“wird „volljäh-rig“. Mit Stolzkann ich sagen,dass die 1992erstmals nachder Wiederver-
einigung auf ost-deutschem Boden stattfinden-de Veranstaltung ein echtes „Chemnitzer Kind“ist. Über die vielen Jahre des Wachstums hat dieTagung durch bedeutende wissenschaftliche,anwendungsbezogene und technologischeBeiträge einen international bedeutenden Stel-lenwert erlangt. Mit dem 18. Symposium kehrtnun diese traditionsreiche Tagung zum drittenMal zurück nach Chemnitz. Moderne maßgeschneiderte Werkstoffe warenam Anfang der Tagungsgeschichte noch eineferne Vision vieler Wissenschaftler, die heutezum Selbstverständnis ingenieurtechnischerEntwicklung geworden sind. Die Verbund-werkstoffe und Werkstoffverbunde bereichernalle wichtigen technologischen Bereiche underweitern stetig die Einsatzgrenzen unsererProdukte. Die Vielfalt der Anwendungen istriesig – von hybriden Werkstoffen in der Luft-und Raumfahrt, Multi-Material-Design in derAutomobilindustrie, partikel- und faserver-stärkten hochfesten Leichtbauanwendungen
im Maschinenbau bis hin zu medizinischenAnwendungen von adaptiven, biokompatiblenWerkstoffen. Trotz dieser bisher positiven Entwicklung ver-birgt sich in diesen Materialien noch immer einenormes Forschungs- und Entwicklungspoten-zial. Der Beitrag für eine „grüne“ Zukunft fin-det sich sowohl in der nachhaltigen Nutzungund im Recycling dieser Werkstoffe als auch inder bedarfsgerechten Konstruktion und in einerserientauglichen und kostengünstigen Herstel-lung wieder. Die Tagung liefert damit einenweiten Raum für neue wissenschaftliche Arbei-ten. Dazu zählt die Forschung an multifunktio-nalen und intelligenten Verbundwerkstoffen,die über sensorische oder aktorische Kompo-nenten ein ganz neues Feld von Anwendungs-möglichkeiten aufspannen. In diesem For-schungsgebiet können Ansätze, wieSelbstheilungseffekte und Lebensdauerdiagno-stik von Werkstoffen, die die Sicherheit techni-scher Produkte nachhaltig verbessern, gefun-den werden.Zahlreiche von diesen spannenden Themen ste-hen zum 18. Symposium „Verbundwerkstoffeund Werkstoffverbunde“ auf dem Programm.In den drei Tagen wird es zukunftsweisendeVorträge in einer Mischung aus Forschung, Ent-wicklung und Industrieeinsatz geben. In über100 Fachbeiträgen können sich die Besucherneben Entwicklungen in den traditionellenBereichen der Metallmatrix-, Keramikmatrix-und Polymermatrix-Verbundwerkstoffen auch
über innovative Forschungen auf den Gebietender zellularen und porösen Werkstoffe sowieauf dem Sektor neuartiger Werkstoffverbundeinformieren. Vielschichtige Akzente werdenunter dem Fokus „Structural Health Monito-ring“ gesetzt. Funktionelle Beschichtungen vonWerkstoffkomponenten sind inzwischen beizahlreichen Anwendungen Notwendigkeit füreine maßgebliche Eigenschaftsverbesserung.Die Gebiete „Modellierung und Simulation“tangieren alle Forschungsschwerpunkte inbedeutendem Maße.Die Tagung lädt zum intensiven Gedankenaus-tausch ein und soll zur Nutzung von Synergienzwischen den einzelnen Disziplinen und ihrenWissenschaftlern anregen. Denn wie Aristotelesbereist vor 2000 Jahren feststellte: „Das Ganzeist mehr als die Summe seiner Teile.“ In diesem Sinne freue ich mich sehr, Sie vom30.03.2011 bis 01.04.2011 in Chemnitz begrüßenzu dürfen.
Herzlichst Ihr Bernhard Wielage
Technische Universität Chemnitz
aus: DGM aktuell 10/2010
Verbundwerkstoff-Tagung in Chemnitz
52 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Wahre Vielfaltswunder: CellMat 2010 und neuer DGM-Fachausschuss widmen sich zellularen Werkstoffen
Produkte aus zellularen Werkstoffen sindwahre Vielfaltswunder. Denn die Eigenschaf-ten der Leichtbaumaterialien lassen sich,ihrem Einsatz gemäß, kostengünstig undumweltschonend variieren: Zur Schall- undWärmedämmung oder zur mechanischenDämpfung etwa, aber auch zum Energie-transport oder für katalytische Effekte.In zahlreichen Vorträgen illustrierte die vonder DGM organisierte Tagung Cellular Mate-rials (CellMat) vom 27. bis zum 29. Oktober2010 die ganze Bandbreite der wissenschaftli-chen sowie industriellen Forschungs- undEntwicklungsaktivitäten rund um zellulareWerkstoffe aus Glas, Keramik, Polymerenund Metall.
Dabei beschritt die 2010 erstmals ausgerichte-te Tagung neue Wege. Denn bisher wurdendie verschiedenen Materialklassen getrenntvoneinander diskutiert: Infolgedessen konn-ten in Expertengesprächen kaum Bezüge ver-deutlicht oder Synergien genutzt werden. DieTagung konnte hier erste Brücken bauen.
Der rege Zuspruch bestätigte den Bedarf aneinem Austausch: Insgesamt nahmen mehrals 150 Teilnehmer aus 32 Ländern an derCellMat 2010 teil. Der wachsenden Bedeutung zellularer Werk-stoffe innerhalb der Materialwissenschaftund Werkstofftechnik trug die DGM imOktober aber gleich doppelt Rechnung:
Bereits einen Tag vor Beginn der CellMat2010 konstituierte sich in Dresden der neueDGM-Fachausschuss „Zellulare Werkstoffe“,der in regen Diskussionen seine inhaltlicheZielsetzung definierte und Professor Dr.Michael Scheffler von der Otto-von-Gue-ricke-Universität Magdeburg zu seinem Lei-ter wählte. Neben der interdisziplinären Vernetzung derverschiedenen Disziplinen wurde vor allemüber die Funktionalisierung der zellularenWerkstoffe beraten. Hierdurch sollen in dennächsten Jahren ganz neue Forschungs- undAnwendungsfelder erschlossen – und damitdie Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten nochmehr erweitert – werden.
Dr.-Ing. Frank O. R. Fischer
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
aus: DGM aktuell 12/2010
v.l.n.r.: Programmausschuss der CellMat: Dr. Fischer (DGM), Dr. Falk (Saarbrücken), Dr. Stephani (IFAM-Dresden), Dr. Adler (IKTS Dresden), Dr. Hipke (IWU-Chemnitz)
53TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Wenn es um Biomaterialien geht, denken diemeisten Menschen wohl an künstliche Hüft-gelenke oder Zahnimplantate. Doch aucheine von Muscheln überwucherte Schiffs-wand gehört dazu. „Alle von Menschen her-gestellten Materialien, die Grenzflächen mitKontakt zu einem biologischen Systemhaben, werden als Biomaterialien bezeich-net“, sagt Prof. Dr. Klaus Jandt von der Fried -rich-Schiller-Universität Jena. Für Biomaterialien gibt es eine Fülle von Ein-satzmöglichkeiten und deshalb wächst diesesFeld sehr stark, konstatiert der Jenaer Materialwissenschaftler Jandt. Über denaktuellen Stand und die Entwicklungen derZukunft tauschten sich über 270 Materialwis-senschaftler aus 30 Ländern am 13. und 14.April bei der ersten Euro BioMat 2011 in Jenaaus. Das zweitägige Symposium der DGMvereint Wissenschaftler aus Europa undÜbersee und dürfte damit die bislang größteinternationale Veranstaltung zu diesem The-ma in Deutschland gewesen sein. Ausgerich-tet wurde das „European Symposium on Bio-materials and Related Areas“ von derDeutschen Gesellschaft für Materialkunde(DGM) mit Sitz in Frankfurt. Prof. KlausJandt, bei der BioMat aktuell Tagungspräsi-dent, leitet zusätzlich den Fachausschuss Bio-materialien der DGM. „Weltweit führend bei der Entwicklung von
Biomaterialien sind die USA, China, Japanund Großbritannien“, schätzt Jandt ein undfährt fort: „Jena ist einer der führendenStand orte für Biomaterialien in Deutsch-land“. Es dürfe deshalb als Erfolg gewertetwerden, dass Experten aus diesen Ländernzur Jenaer Tagung gekommen sind, obwohlderen Fokus auf Europa gerichtet ist. Zu den Höhepunkten rechnet Prof. Jandt denVortrag von Prof. Thomas Webster von derBrown University aus Providence, USA.Webster sprach über den Einsatz von Nano-technologie in der regenerativen Medizinund künftige Entwicklungen.Die Wissenschaftler von der Universität Jenapräsentieren neuartige Beschichtungen fürImplantate, mit denen durch Nanostrukturendas Zell- und Bakterienwachstum beeinflusstwerden kann. „Bei Dauerimplantaten sollensich die Zellen möglichst rasch an der Ober-fläche ansiedeln“, sagt Prof. Jandt. Der gegen-teilige Effekt sei hingegen bei Schraubverbin-dungen erwünscht, wie sie nachKnochenbrüchen für eine Zeitlang im Körperverbleiben. Die zweite Jenaer Innovation ist eine Nanofa-ser aus körpereigenem Eiweiß, die geradeeinmal einen Nanometer dick ist – also einMillionstel Millimeter stark. Aus dieser Faserentwickeln die Materialwissenschaftler vonder Uni Jena Schwamm-Strukturen, die als
Knochen-Ersatz zum Einsatz kommen sollen.„Wir stehen an der Schwelle zur klinischenErprobung des neuen Materials“, sagt KlausJandt. Abgeschaut werden dabei die Bauprin-zipien der Natur. Ziel ist es, künstlich Kno-chen und Knorpel herzustellen. Angesichtseiner zunehmend älter werdenden Bevölke-rung in den Industrieländern ein Wachstums-markt mit enormem Potenzial.
Die DGM dankt Professor Jandt und Dr. Kel-ler für die exzellente Unterstützung im Vor-feld der Tagung. Die 2. Euro BioMat wird imFrühjahr 2013 ebenfalls in Jena ausgerichtet.
Kontakt: Prof. Dr. Klaus D. JandtInstitut für Materialwissenschaft und Werk-stofftechnologie der Friedrich-Schiller- Universität JenaLöbdergraben 32, 07743 Jena, Tel.: 03641 /947730, E-Mail: K.Jandt[at]uni-jena.de
aus: DGM aktuell 05/2011
Materialwissenschaftler trafen sich am 13./14. April 2011 zur ersten „Euro BioMat 2011“ der DGM in Jena
v.l.n.r.: Herr Joachim, DGM-Vorstandsreferent, Prof. Jandt, Jena, Tagungsleiter der Euro BioMat, Dr. Fischer, Geschäftsführendes Vorstandsmitglieder der DGM
05.10.-07.10.2011
05.10.-07.10.2011EURO ECAA - European Conferenceon Aluminium AlloysBremen
20.03.-23.03.2012EURO Bio-inspired Materials 2012International School and Conference onBiological Materials SciencePotsdam
24.09.-24.09.2012DGM-Tag 2012Darmstadt
25.10.-26.10.2011HLKSymposium Hochleistungs-keramik 2011Karlsruhe
23.07-27.07.1012Junior EUROMAT 2012Lausanne, CH
Herbst 2012Materialographie46. Metallographie-Tagung
54 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Tagungen und sonstige Veranstaltungen
14.09.-16.09.2011Materialographie45. Metallographie-TagungKarlsruhe
26.-10.-28.10.2011EURO Friction Wear and WearProtectionEuropean Symposium on FrictionWear, Wear Protection and RelatedAreasKarlsruhe
25.09.-27.09.2012MSE 2012 - Materials Science andEngineeringDarmstadt
Vorschau Tagungen 2011/2012
55TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Nationale und internationale Vernetzung
Nationale und internationale Vernetzung
Es gibt in der DGM keinen Zwang zur Mitar-beit, sondern viele engagierte Menschen, diedieses komplexe Netzwerk pflegen und wei-ter ausbauen. Das ist das eigentliche Kapitalder DGM! Diese Vernetzung findet beispiels-weise auf nationaler Ebene zwischen denExperten aus Wissenschaft und Industrie inden Fachausschüssen der DGM statt, im Stu-dientag „Materialwissenschaft und Werk-stofftechnik“ zwischen den Hochschulen undUniversitäten, die unseren Nachwuchs aus-bilden, in der Bundesvereinigung „Material-wissenschaft und Werkstofftechnik“ zwi-schen den vielen Fachgesellschaften rund umunser Fachgebiet und auch im Themennetz-
werk „Materialwissenschaft und Werkstoff-technik“ der Akademie der Technikwissen-schaften, um bei der Politik und den Ent-scheidungsträger Gehör zu finden. Die DGMist in allen Ebenen sehr gut vertreten undbringt die Interessen ihrer Mitglieder ein.Aber auch international spielt die DGM einesehr wichtige Rolle. Die DGM ist auch Grün-dungsmitglied vom europäischen Dachver-band der Materialwissenschaft und Werk-stofftechnik der Federation of EuropeanMaterials Societies (FEMS) und sorgt so fürdie Interessensvertretung auf europäischerEbene. Aber auch die Deutsche Forschungs-gemeinschaft unterstützt DGM-Mitglieder
bei der weltweiten Vernetzung unserer Mate-rialwissenschaftler und Werkstofftechniker.Professor Jürgen Rödel wurde beispielsweiseals Leibniz-Preisträger nach Indien zu denersten Leibniz-Lectures eingeladen undkonnte dort die von der DGM finanzierteKeramik-Roadmap vorstellen.
Die Pflege des nationalen und internationa-len Netzwerkes ist eine Kernaufgabe derDGM-Geschäftsstelle. Nur so können wirGestalten und die Interessen unserer Mitglie-der einbringen und angemessen vertreten.
Nationale und internationale Vernetzung
DGM und DECHEMA unterzeichnen Koope-rationsvereinbarung; „International Confe-rence on Materials for Energy“ 2013 in Karls-ruhe
Die Chemie muss stimmen – auch in der Mate-rialwissenschaft und Werkstofftechnik. Deshalbhaben die Deutsche Gesellschaft für Material-kunde (DGM) und die Gesellschaft für Chemi-sche Technik und Biotechnologie (DECHEMA)eine engere Zusammenarbeit auf dem Gebietder Energietechnik vereinbart. Am 19. Mai 2011unterzeichneten die Geschäftsführer der DGMund der DECHEMA, Dr. Frank O.R. Fischer
und Prof. Dr. Kurt Wagemann einen entspre-chenden Kooperationsvertrag. Er ist zunächstauf zweieinhalb Jahre angelegt.In erster Linie zielt die Vereinbarung auf dieOrganisation einer gemeinsamen Veranstal-tungsreihe International Conference on Materi-als for Energy. Die Tagungen sollen in wech-selndem Turnus von der DGM und derDECHEMA ausgerichtet werden. Letztere istfür die kommende Veranstaltung, die vom 12.-16. Mai 2013 in Karlsruhe stattfinden wird, ver-antwortlich sein. "Die fachliche Weiterentwicklung auf demGebiet der Materialforschung und -entwick-
lung für die Energietechnik ist von elementarerBedeutung", begründet DGM-GeschäftsführerFrank O.R. Fischer die Zusammenarbeit. "Des-halb kommt die Kooperation für DGM undDECHEMA – und für unser Fachgebiet – genauzum richtigen Zeitpunkt." Ich freue mich, dassdie DGM und die DECHEMA gemeinsam ihreKompetenz in der Materialtechnologie, derChemischen Technik und der Verfahrenstech-nik nutzen werden. So können wir neue Wegezu noch besseren Lösungen mit internationalenFachleuten aus unterschiedlichen Disziplinendiskutieren“, ergänzt Prof. Wagemann bei derUnterzeichnung.
Am 19. Mai 2011 unterzeichneten die Geschäftsführer der DGM und der DECHEMA Frank O.R. Fischer und Kurt Wagemann einen Kooperationsvertrag(Mitte). Links und rechts im Bild: Klemens Joachim, Vorstandsreferent der DGM und Andreas Förster, Leiter der DECHEMA-Forschungsförderung
Die Energietechnik beflügeln
56 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Nationale und internationale Vernetzung
Nationale und internationale Vernetzung
Nachrichten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG):
Energieforschung: Expertenworkshop "Thermische Speicher"
"Energieeffizienz" und "Ausbau der erneuer-baren Energien" ziehen sich als Schlüsselbe-griffe durch die aktuelle politische undgesellschaftliche Diskussion zum ThemaEnergie. Zur Steigerung der Energieeffizienzkönnen in bestimmten Anwendungsberei-chen thermische Energiespeicher beitragen.Diese stehen im Mittelpunkt eines Experten-workshops, den die Deutsche Forschungsge-meinschaft (DFG) und der ProjektträgerJülich (PtJ; für das Bundesministerium fürWirtschaft und Technologie) Ende Juni inBerlin gemeinsam veranstalten. Auf demzweitägigen Treffen wollen Experten aus ver-schiedenen Wissenschaftsgebieten und derIndustrie vor allem über die Entwicklungs-potenziale der Materialsysteme diskutieren,die für thermische Energiespeicher verwen-det werden. Neben den eingeladenen Exper-ten steht die Veranstaltung auch allen interes-sierten Wissenschaftlerinnen undWissenschaftlern offen. Sie wird von der DFGim Rahmen der Arbeit der Projektgruppe"Energieforschung" mitorganisiert.
Die Vorträge und Diskussionen des Works-hops sollen deutlich machen, dass auf demGebiet der thermischen EnergiespeicherungGrundlagenforschung und Angewandte For-schung gleichermaßen gefragt sind, umneuartige Speichermaterialien (Latentspei-
cher und thermochemische Speicher) kosten-günstig herstellen und einsetzen zu können.Während anwendungsorientierte Speicher-forschung in der Maßnahme Forschung fürenergieoptimiertes Bauen (EnOB) des Bun-desministeriums für Wirtschaft und Techno-logie (BMWi) vom PtJ betreut wird, erfolgtbei der DFG eine Förderung von grundla-genorientierten Arbeiten in verschiedenenProgrammen. Der gemeinsame Workshopbietet die Chance eines Austausches derunterschiedlichen Experten.
Künftige Leitlinien und Ziele der Forschungund Entwicklung sollen benannt und hin-sichtlich ihrer Realisierbarkeit in physikali-scher und wirtschaftlicher Hinsicht bewertetwerden. Dabei soll explizit eine Einordnungin grundlagen- sowie anwendungsorientierteFragestellungen vorgenommen werden.Damit können die Ergebnisse des Workshopseine wichtige Grundlage für die Ausrichtungkünftiger Speicherforschung darstellen undhelfen, Synergien zwischen anwendungs-und grundlagenorientierter Forschung opti-mal zu nutzen.
Weiterführende Informationen Der Expertenworkshop "Thermische Spei-cher – Potenziale und Grenzen für die Steige-rung der Energiespeicherdichten" findet am
28. und 29. Juni 2010 im Audiovisuellen Zen-trum (AVZ) der Technischen Universität (TU)Berlin, Sitzungssaal H3005, Straße des 17.Juni 135, 10623 Berlin, statt.
Anmeldungen interessierter Wissenschaftle-rinnen und Wissenschaftler sind ab sofortmöglich.
Ausführliche Informationen zur Veranstal-tung sowie zur Anmeldung finden sich unter:www.fz-juelich.de/ptj/rationelle-energiever-wendung
Ansprechpartner in der DFG-Geschäftsstellezum Expertenworkshop und zur DFG-Pro-jektgruppe "Energieforschung": Dr.-Ing. Burkhard JahnenGruppe IngenieurwissenschaftenTel. +49 228 885-24 87burkhard.jahnen[at]dfg.de
Informationen zur Projektgruppe "Energie-forschung" finden sich auch unter: www.dfg.de/gefoerderte_projekte/projekt-gruppen/energie/index.html
aus: DGM-newsletter 05/2010
Die Bundesvereinigung Materialwissenschaftund Werkstofftechnik e.V. (BV MatWerk –www.matwerk.de) etablierte sich am 22.Oktober 2007 in Berlin – zu den 25 Grün-dungsmitgliedern gehört die DGM, die vonAnfang an diese Initiative unterstützte. Mitt-lerweile gehören mehr als 35 Institutionender Bundesvereinigung an, der erste Wechselim Vorstand wurde vollzogen, die ersten Pro-jekte sind voll im Gang.Generelles Ziel der BV MatWerk ist eineIntensivierung der Zusammenarbeit und eineBündelung der Interessen der Organisatio-nen, die auf diesem Gebiet tätig sind. Sie sollsubsidiär da tätig sein, wo eine konzentrierte
Aktion auf mehreren Ebenen vonnöten ist.Ein konkretes Beispiel ist die Aktualisierungder Ausbildung von Werkstoffprüfern: Inunserem Fachgebiet nehmen Werkstoffprü-fer/-innen in technischer und in wirtschaftli-cher Hinsicht eine sehr wichtige Rolle ein.Vor dem Hintergrund der gegenwärtigenAnforderungen werden Anpassungs- oderAktualisierungsvorschläge formuliert und andie zuständige Stelle weitergeleitet. Eine Auf-wertung des Berufsbildes wäre ein wesentli-cher Beitrag zu unserer Gemeinschaft, der indieser Form nicht von einzelnen Verbändenerbracht werden könnte. Sie sind herzlicheingeladen, Ihre Eindrücke und Vorschläge
Neuer Vorstand der BV MatWerk wurde gewählt
zu diesem Thema einzubringen.Zusammen mit dem Studientag Materialwis-senschaft und Werkstofftechnik(www.stmw.de) und mit dem Themennetz-werk Materialwissenschaft und Werkstoff-technik von acatech:www.acatech.de/de/themennetzwerke/materialwissenschaft-undwerkstoff technik.html) will die BV Mat-Werk als Kontaktstelle zu Wissenschaft, Wirt-schaft und Politik fungieren, dieÖffentlichkeitsarbeit auf diesem Gebiet för-dern und Aktivitäten zur Nachwuchsförde-rung unterstützen. Gemeinsam bereiten dieseInitiativen eine Internet-Plattform vor, dieanwenderorientiert gestaltet wird. Der Nut-
57TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Nationale und internationale Vernetzung
Nationale und internationale Vernetzung
zer soll mit einer klaren Präsentation die Aus-kunft erhalten, für die er sich interessiert: ObWirtschaftsindikatoren oder fach liche Aus-künfte zu einem bestimmten Werkstoff, Bild-material zu einem gegebenem Herstellungs-verfahren, Informationen zum Studium oderzur beruflichen Ausbildung auf dem Gebietder Materialwissenschaft und Werkstofftech-nik, auf dieser Plattform soll der Nutzer deneinfachen Zugang finden.Die Rezeption der Werkstoffe in der Öffent-lichkeit ist ein weiteres, wichtiges Betäti-gungsfeld für die BV MatWerk. Welchen Bei-trag leistet die Materialwissenschaft undWerkstofftechnik für unsere Gesellschaft?Gerade durch seine Breite – über verschiede-ne Werkstoffklassen – und Produktionstiefe –von der Metallgewinnung über die Verarbei-tung bis hin zur Fügetechnik – wird leichtersichtlich, dass dieses Gebiet einen bedeu-tenden Anteil am Bruttosozialprodukt unse-
res Landes hat. Auf der anderen Seite wirddurch ebendiese Vielfalt die zuverlässige
Quantifizierung dieses Beitrages (Produkti-on, Beschäftigung) erschwert. In diesemBereich sind wir erst am Anfang, die vorhan-denen Beiträge der Mitgliedsorganisationenwerden gesichtet und abgeglichen.Zusammenfassend möchte ich feststellen,dass die BV MatWerk in ihrem kurzen Lebenerste Akzente setzen konnte und auf demguten Weg ist, sich in der deutschen Land-schaft der Materialwissenschaft und Werk-stofftechnik zu positionieren. Für Vorschlägeund Anregungen aus den Mitgliedsorganisa-tionen ist sie stets offen.
Dr.-Ing. Pedro Dolabella Portella
Generalsekretär der Bundesvereinigung Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, BAM – Bundesanstalt für Materialforschungund -prüfung, Berlin
aus: DGM aktuell 04/2010
Alter und neuer Vorstand der BVMatWerkVlnr.: Prof. Dr. J. Janek, Justus-Liebig-UniversitätGießen; Prof. Dr. D. Herlach, Deutsches Zentrumfür Luft- und Raumfahrt e.V., Köln; Dr. P. Portella,Bundesanstalt für Materialforschung und -prü-fung, Berlin; Prof. Dr. G. Gottstein, RWTHAachen; Dr. C.-D. Wuppermann, StahlinstitutVDEh im Stahl-Zentrum Düsseldorf
Die diesjährige Verbandsversammlung desDVT fand am 5. Mai im Stahlinstitut VDEh inDüsseldorf statt. Neben den Vorstandswah-len standen auch die Schwerpunkte derArbeiten des DVT für das Jahr 2010 auf derAgenda. Hierzu zählen die weitere Beteili-gung an der Debatte zum Klimaschutz, dieinternationale Vertretung der deutschenIngenieurinteressen und die Bemühung umAnerkennung akademischer und beruflicherQualifikationen im Ausland. Der DVT willsich darüber hinaus um die Harmonisierung
der Abschlüsse im Zuge der Bologna-Reformsowie die Verhinderung der Schlechterstel-lung von FH-Absolventen in der laufendenTarifrunde des Öffentlichen Dientesbemühen (Beibehaltung der Einstufung inEntgeltgruppe 10!). Auch sind ein Geschäfts-führerseminar und ein ParlamentarischerAbend im zweiten Halbjahr 2010 zu aktuel-len Themen geplant.Ein wichtiges Anliegen wird in diesem Jahrdie deutschlandweite Einführung der auf derHannover-Messe durch den Verein Deut-scher Ingenieure (VDI) und den Zentralver-band der Ingenieurvereine (ZBI) vorgestell-ten „engineerING card“ sein. Hierbei handeltes sich um einen Berufsausweis für Ingenieu-re. Der DVT wird in der ideellen Trägerge-meinschaft der engineerING card des VDImitarbeiten. Diese Karte kann von Ingenieu-ren mit einem abgeschlossenen ingenieurwis-
senschaftlichen Studium an einer anerkann-ten Hochschule erworben werden. DieKosten für die Karte betragen 95 € für Bewer-ber, die einem Trägerverein der engineerINGcard angehören, ansonsten werden 225 € ver-langt.Erworbene Studienabschlüsse, Berufserfah-rung und absolvierte Weiterbildungen wer-den auf dieser Karte gespeichert und könnendadurch problemlos nachgewiesen werdenund erleichtern somit künftige Bewerbungen,insbesondere im Ausland. Geplant ist eineAusweitung des Konzepts auf weitereeuropäische Länder. Die Niederlande, dieSchweiz und Österreich stehen bereits in denStartlöchern.In den Vorstand des DVT wählte die Ver-bandsversammlung folgende Persönlichkei-ten: Prof. Dr.-Ing. habil. Bruno O. BraunPräsident des VDIProf. Dr. rer. nat. Günter GottsteinDeutsche Gesellschaft für MaterialkundeDipl.-Ing. Klaus RollenhagenHauptgeschäftsführer des Verbandes Bera-tender Ingenieure (VBI).
Quelle: http://www.dvt-net.de/aktuell.html
aus: DGM aktuell 06/2010
Prof. Günter Gottstein in den DVT Vorstand gewählt!
Die Teilnehmer an der DVT-Verbandsversammlung 2010
Nationale und internationale Vernetzung
Nationale und internationale Vernetzung
58 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Liebe Mitglieder und Freunde der DGM,
acatech, die Deut-sche Akademie derTechnikwissenschaf-ten, vertritt die Inter-essen der deutschenTechnikwissenschaf-ten im In- und Aus-land in selbstbe-s t i m m t e r ,unabhängiger undgemeinwohlorien-tierter Weise. AlsArbei tsakademie
berät acatech Politik und Gesellschaft in tech-nikwissenschaftlichen und technologiepoliti-schen Zukunftsfragen auf dem besten Standdes Wissens. Darüber hinaus hat es sich aca-tech zum Ziel gesetzt, den Wissenstransferzwischen Wissenschaft und Wirtschaft zuunterstützen und den technikwissenschaftli-chen Nachwuchs zu fördern.Diese Ziele werden themenspezifisch in elfsogenannten Themennetzwerken verfolgt.Das Themennetzwerk „Materialwissenschaftund Werkstofftechnik“ diskutiert Aspekteder öffentlichen Wahrnehmung, der Ausbil-dung und Forschung in diesem Feld. Welchessind die Defizite in diesem Bereich? WelcheWege zu deren Überwindung können aufge-zeigt werden? Das acatech Themennetzwerkfusionierte im Sommer 2009 mit dem Impuls-kreis Werkstoffinnovation und konnte soKräfte bündeln. Das Themennetzwerk bietet
heute der Politik eine ebenso unabhängigewie kompetente Ansprechstelle.Im vergangenen Jahr hat acatech angesichtsder enormen wirtschaftlichen Relevanz, aberviel zu geringen Sichtbarkeit der Werkstoffein der Öffentlichkeit Empfehlungen zurMaterialwissenschaft und Werkstofftechnikin Deutschland veröffentlicht, die vor kurz-em übrigens auch in englischer Übersetzungerschienen sind. Die acatech Empfehlungenbetreffen Forschung, Forschungsförderung,Lehre, Studium sowie die öffentliche Wahr-nehmung der Bedeutung von Werkstoffen.Ein eigenes Kapitel betrifft den Wissenstrans-fer entlang der gesamten Kette „Vom Materi-al zum Produkt“.Angesichts der enormen Bedeutung der The-matik - rund 70 Prozent aller neuen Produktebasieren auf neuen Werkstoffen – hat dieAkademie im vergangenen Jahr einen Jour-nalistenworkshop durchgeführt, bei demWissenschaftsjournalisten einen Einblick indieses Feld des Technikjournalismus anhandkonkreter Beispiele und vor dem Hinter-grund der acatech Stellungnahme erhielten:http://www.acatech.de/journalistenworks-hop.Gegenwärtig erarbeitet acatech eine themen -fokussierte Stellungnahme zur Situation derOrganischen Elektronik in Deutschland, dieeine Bestandsaufnahme, Bewertung undEmpfehlungen umfassen soll und Anfang2011 veröffentlicht werden soll.Auf der MSE-Tagung im August ist acatechmit Side Events präsent. Mit der Fragestel-
Side Event der MSE 2010: „Unsichtbar, aber unverzichtbar: Wie stei-gern wir die Wahrnehmung von Materialwissenschaft und Werk-stofftechnik in der Öffentlichkeit?“
lung „Neue Chancen für Materialwissen-schaft und Werkstofftechnik im EuropäischenForschungsraum?“ möchten acatech undDFG den oft als abstrakt und schwer durch-schaubar erscheinenden Europäischen For-schungsraum besser greifbar machen. Vertre-ter aus Wissenschaft, Wirtschaft undAdministration werden aktuelle Herausfor-derungen diskutieren.Das Side Event „Unsichtbar, aber unverzicht-bar: Wie steigern wir die Wahrnehmung vonMaterialwissenschaft und Werkstofftechnikin der Öffentlichkeit?“ wird gemeinsam vonacatech und der BV MatWerk ausgerichtet.Die Veranstaltung soll einen Überblick zuVermittlungsformaten in Vergangenheit undGegenwart geben. Gemeinsam mit den Teil-nehmern werden Perspektiven der Werk-stoff-Kommunikation (Ziele, Zielgruppen,neue Kommunikationsformate) und konkre-te Aktivitäten diskutiert. Beide Side Eventssind öffentlich und kostenfrei zugänglich.
Der Besuch der Side Events ist gebührenfrei.Hier können Sie sich anmelden: http://www.dgm.de/dgm/mse-congress/php/events.php
Prof. Dr.-Ing. Christina Berger
Sprecherin acatech Themennetzwerk „Materialwissenschaft und Werkstofftech-nik“
aus: DGM aktuell 07/2010
Ob in der Medizin, dem Automobilbau oderin der Umwelttechnik – kaum eine Branchekommt ohne innovative Werkstoffe aus. DasBundesministerium für Bildung und For-schung (BMBF) plant deshalb, die Förderungbei der Werkstoff- und Materialforschung inden nächsten Jahren auszubauen. Die
Schwerpunkte sind in einem 10-Punktepro-gramm zur Werkstoff- und Materialfor-schung skizziert, das vom BMBF und von derDeutschen Akademie der Technikwissen-schaften (acatech) am Donnerstag in Darm-stadt vorgestellt wurde.„Die meisten Innovationen wären ohne neue
Im Rahmen der MSE2010 fand das Pressegespräch von acatech undBMBF zur Förderung der Materialwissenschaft und Werkstofftechnikstatt
Werkstoffe nicht möglich gewesen“, sagteBMBF-Staatssekretär Dr. Georg Schütte anläs-slich der Vorstellung des Programms. Werk-stoffe und Materialien erzielen in Deutsch-land einen jährlichen Umsatz von knappeiner Billion Euro, rund 5 Millionen Arbeits-plätze hängen direkt oder indirekt von der
Materialbranche ab. „Das 10-Punktepro-gramm zeigt, worauf wir die Forschungsför-derung bei den Werkstoffen konzentrierenwollen“, sagte Schütte weiter. „In manchenBereichen sind wir Weltspitze, auf anderenGebieten müssen wir noch aufholen. Dabeisoll das Programm den Forschern helfen.“Die Schwerpunkte sind nach den Worten desStaatssekretärs eng angelehnt an die Hight-ech-Strategie, die sich in dieser Legislaturpe-riode auf die GebieteGesundheit/Ernährung, Klima/Energie,Mobilität, Kommunikation sowie Sicherheitkonzentriert. „In allen diesen Bereichen spie-len Werkstoffe eine zentrale Rolle“, sagteSchütte. „Der leistungsstarke Computer, derbrillante LCD-Fernseher und das neue Auto –dies alles ist erst durch neue Werkstoffe mög-lich geworden.“
„Wir denken Innovationen oft zu sehr vonden Endprodukten her. Ohne moderne Werk-stoffe im Verborgenen haben viele neue Tech-nologien keine Chance“, sagte Prof. HenningKagermann, Präsident der Deutschen Akade-mie der Technikwissenschaften und Vorsit-zender der Nationalen Plattform Elektromo-bilität. „Um Elektroautos billiger zu machenund gleichzeitig Reichweiten zu erhöhen,brauchen wir optimale Materialien in derBatterie, bessere Dämmstoffe und auch Werk-stoffe, die das Auto leichter machen. Auchdeshalb ist es gut, dass die Materialwissen-schaft und Werkstofftechnik in den Koaliti-onsvertrag und in die Fortschreibung derHightech-Strategie des BMBF aufgenommenwurden.“
Dr. Thomas Geelhar, Chief Technology Offi-cer des Unternehmensbereichs Chemie beider Merck KGaA, demonstrierte bei demPressegespräch das Potenzial der Material-wissenschaft und Werkstofftechnik in derorganischen Elektronik anhand eines 3D-Flachbildfernsehers der neuesten Generation.Prof. Thomas Schmitz-Rode, Direktor amHelmholtz-Institut für Biomedizinische Tech-nik und Inhaber des Lehrstuhls für Ange-wandte Medizintechnik an der RWTHAachen, skizzierte die Anwendungsmöglich-keiten neuer Werkstoffe in der Medizintech-nik.
Mehr Informationen über acatech finden Sieim Internet unter www.acatech.de.
Weitere Informationen:Acatech:Jann Gerrit OhlendorfLeiter der Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: [email protected]:Christian Herbst Stellvertretender PressesprecherE-Mail: christian.herbst[at]bmbf.bund.de
aus: DGM newsletter 10/2010
Nationale und internationale Vernetzung
59TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Nationale und internationale Vernetzung
v.l.n.r.: Dr. Frank O.R. Fischer (DGM), MinDir Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas (BMBF), Prof. Dr.-Ing.Christina Berger (acatech); Foto: M. Roßnagel, DGM
v.l.n.r.: MinDir Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas (BMBF), Prof. Dr. Henning Kagermann (Präsident acatech); Foto: M. Roßnagel, DGM
Nationale und internationale Vernetzung
Nationale und internationale Vernetzung
60 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
MSE news, der internationale Newsletter der DGM startet im Früh-jahr 2011
Zusätzlich zum deutschsprachigen News -letter, der sich seit nun fast 2 Jahren großerBeliebtheit erfreut, startete die DGM mit demneuen internationelen Newsletter ‘MSEnews, Materials Science and Engineering’ insJahr. Der internationale Newsletter erreichtderzeit eine Leserschaft von ca. 25000 Interes-senten aus aller Welt und wird 4 Mal im Jahrerscheinen.
Wie auch das deutschsprachige Informati-onsangebot, ist der MSE-Newsletter kosten-frei und im Online-Portal der DGM für dieÖffentlichkeit zugänglich:
http://www.dgm.de/dgm-info/mse-news/
Nachrichten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG):
DFG-Rundgespräch „Perspektiven und fachliche Einordnung von Bio-materialforschung“Am 2. und 3. November 2010 fand auf Einla-dung der DFG ein Rundgespräch „Perspekti-ven und fachliche Einordnung von Biomate-rialforschung“ in Waldenbuch bei Stuttgartstatt. Ziel des Rundgesprächs war es zuklären, wo die Grenzen zwischen biologi-schem bzw. biophysikalischem Aspekteneinerseits und materialwissenschaftlichenbzw. ingenieurwissenschaftlichen Aspektenvon Biomaterialforschung andererseits liegt.Der Blick sollte dabei nicht nur auf dieFächerstruktur der DFG-Fachkollegien, son-
dern gerade auch auf das Forschungsfeld ansich gelenkt werden.Als Resümee kann festgehalten werden, dassder Weg des Fachgebiets konsequenter inRichtung der Biologie beschritten werdensollte und dass die Grenzverschiebung zwi-schen „lebender Materie“ und artifiziellenMaterialien neue fachliche Zusammenarbeitbedingt. So wird sich Biomaterialforschungzukünftig deutlich stärker durch Themen wiez.B. Nervenregeneration oder Hämokompati-bilität auf Felder außerhalb des Hartgewebe-
ersatzes bewegen. Eine Öffnung in Richtungder Pharmazie, der Zellbiologie und derMikrosystemtechnik wird in diesem Zusam-menhang bedeutsam sein. Die frühzeitig aufInterdisziplinarität ausgerichtete Förderungdes wissenschaftlichen Nachwuchses istdabei eine zentrale Herausforderung undAufgabe.
aus: DGM-newsletter 11/2010
(v.l.n.r) Carsten Werner (Dresden), Michael Gelinsky (Dresden), Kurosch Rezwan (Bremen), Michael Scheffler (Magdeburg), Burkhard Jahnen (Bonn), Aldo R. Boccaccini(Erlangen), Matthias Epple (Duisburg-Essen), Frank O.R. Fischer (Frankfurt), Thomas Scheibel (Bayreuth), Peter Fratzl (Golm)
Nationale und internationale Vernetzung
61TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Nationale und internationale Vernetzung
Nationale und internationale Vernetzung
62 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Nationale und internationale Vernetzung
Personalwechsel im FEMS-Sekretariat
Auf der General Ver-sammlung der Federati-on of European Materi-
als Societies (FEMS) in Lausanne, die imRahmen der von der DGM für die FEMSorganisierten Junior Euromat 2010 stattfand,
wurde der neue FEMS Sekretär vorgestellt.Dr. Hugh M. Dunlop folgt Herrn Dr. PaulMcIntyre, der aus Gesundheitsgründen dasAmt des Sekretärs Mitte 2010 niedergelegthatte.
63TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
DGM-Grem
ien und DGM-Geschäftsstelle
Vorsitzender
Dr. Ulrich Hartmann,Wieland-Werke AG, Ulm
Stellvertretende Vorsitzende
Prof. Dr. Wolfgang Kaysser,GKSS-Forschungszentrum GeesthachtGmbH
Beisitzer
Dr. Jörg EsslingerMTU Aero Engines GmbH, München
Prof. Dr.-Ing. Frank Mücklich,Universität des Saarlandes, Saarbrücken
Priv. Doz. Dr.-Ing. Birgit Skrotzki,Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Frank O. R. FischerDeutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.
Prof. Dr. Hans-Jürgen Christ,Universität Siegen
Annette LukasW.C. Heraeus GmbH, Hanau
Prof. Dr. Jürgen Rödel,Technische Universität Darmstadt
DGM-Vorstand
DGM-Gremien und DGM-Geschäftsstelle
DGM-Gremien und DGM-Geschäftsstelle
DGM-Gremien und DGM-Geschäftsstelle
64 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Vertreter der DGM-Fachausschüsse:
Prof. Dr. Michael Hoffmann,Universität Karlsruhe
Schriftleiter Zeitschrift für Metallkunde:
Prof. Dr. Manfred Rühle,Max-Planck-Institut für Metallforschung,Stuttgart
Beraterkreis:
Prof. Dr. Eckard QuandtChristian-Albrechts-Universität zu Kiel
Preiskuratorium II:
Prof. Dr. Martin HeilmaierTechnische Universität Darmstadt
Vertreter Deutsche Forschungsgemeinschaft:
Dr.-Ing. Xenia MolodovaDeutsche Forschungs-gemeinschaft, Bonn- Werkstofftechnik
Prof. Dr.-Ing. Jürgen HirschHydro Aluminium Deutschland GmbH,Bonn
Ausbildung:
Prof. Dr. Alexander HartmaierRuhr-Universität Bochum
Vertreter Projektträger Jülich:
Dr. Franz-Josef Bremer
Dr. Burkhard JahnenDeutsche Forschungs-gemeinschaft, Bonn- Materialwissenschaft
Kooptierte Vorstandsmitglieder
Vertreter des Schweizerischen Verband für die Materialtechnik (SVMT):
Marcel Menet Me-Network GmbHZürich, Schweiz
65TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
DGM-Grem
ien und DGM-Geschäftsstelle
DGM-Gremien und DGM-Geschäftsstelle
DGM-Vertreter in Federation of European Materials Societies (FEMS):
Prof. Dr. Ehrenfried ZschechFraunhofer-Institut für zerstörungsfreie Prüfverfahren Dresden
Vertreter der Société Française de Métallurgie et de Matériaux (SF2M):
Dr. Jean-Marie WelterLuxemburg
DGM-Gremien und DGM-Geschäftsstelle
DGM-Gremien und DGM-Geschäftsstelle
66 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Prof. Dr. Eckard QuandtChristian-Albrechts-Universität zu Kiel(Vorsitzender)
Prof. Dr-Ing. Horst BiermannTU Bergakademie Freiberg
Dr.-Ing. Tanja EckardtHeraeus Holding GmbH, Hanau
Prof. Dr. Peter FratzlMax-Planck-Institut für Kolloid- undGrenzflächenforschung, Potsdam
Prof. Dr. Klaus D. JandtFriedrich-Schiller-Universität Jena
Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen MaierUniversität Paderporn
Prof.-Dr.-Ing. Aldo R. BoccacciniFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-Nürnberg
Prof. Dr. Franz FaupelChristian-Albrechts-Universität zu Kiel
Burkhard HeineHochschule Aalen
Prof. Dr.-Ing. Christoph LeyensBrandenburgische Technische Universität Cottbus
Prof. Dr. Sanjay MathurUniversität zu Köln
DGM-Beraterkreis
DGM-Grem
ien und DGM-Geschäftsstelle
DGM-Gremien und DGM-Geschäftsstelle
67TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-PyzallaHelmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Berlin
Prof. Dr. Ralf RiedelTechnische Universität Darmstadt
Dr. Joachim WeckerSiemens AG, Erlangen
Prof. Dr. Dierk RaabeMax-Planck-Institut für Eisenfor-schung GmbH, Düsseldorf
Dr. Jörn RitterbuschWILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, Weinheim
DGM-Gremien und DGM-Geschäftsstelle
DGM-Gremien und DGM-Geschäftsstelle
68 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Die DGM-Geschäftsstelle
DGM-Geschäftsstelle
Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
Fachausschüsse und Technologietransfer
Fortbildungen und Nachwuchsförderung
Beratung von Wissenschaft und Wirtschaft
Tagungs- und Veranstaltungsorganisation
Nationale und internationale Vernetzung
Dr.-Ing. Frank O. R. FischerGeschäftsführendes VorstandsmitgliedTel.: 069-75306 756
Hans Joachim Banck-BaaderFinanzen und PersonalTel.: 069-75306 753
Arnold Börsch, Ing. (grad.)Network AdministratorEDV TechnikTel.: 069-75306 750
Dipl.-Kfm. Klemens Joachim DGM-VorstandsreferentTel.: 069-75306 752
Beate Tölle-KortmannAssistentin der GeschäftsführungMitgliederbetreuungTagungenTel.: 069-75306 751
Vera HausenTagungenAusstellungenTel.: 069-75306 758
DGM-Grem
ien und DGM-Geschäftsstelle
DGM-Gremien und DGM-Geschäftsstelle
69TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
Uwe BöttcherEDV TechnikTel.: 069-75306 750
Yvonne KoallTagungenTel.: 069-75306 743
Miriam LeonardyÖffentlichkeits- und PressearbeitTel.: 069-75306 759
Anja MangoldTagungenTel.: 069-75306 744
Niels ParuselFortbildungenTagungenTel.: 069-75306 757
Marina RathsMarketing und KommunikationTel.: 069-75306 745
Ute RiedelTagungenTel.: 069-75306 747
Marco RoßnagelOrganisation Tel.: 069-75306 750
Jackson TakamEDV TechnikTel.: 069-75306 750
Susanne GrimmOrganisation Tel.: 069-75306 750
Petra von der BeyFachausschüsseÖffentlichkeits- und PressearbeitTagungenTel.: 069-75306 741
70 TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
DGM-Jahresabschluss 2010
DGM-Jahresabschluss 2010
DGM-Jahresabschluss 2010
Die DGM ist ein als gemeinnützig anerkann-ter, die Wissenschaft und die Allgemeinheitfördernder eingetragener Verein und gehörtsomit zu den Nonprofit-Organisationen. Mitdem untenstehenden Auszug aus dem DGM-Jahresabschluss 2010 der SteuerberaterinFrau Marianne Sturm, Mainz, erbringt dieDGM den Nachweis, dass die tatsächlicheGeschäftsführung mit dem Satzungszweckübereinstimmt. Die Übersicht ist in vierbewährten und für gemeinnützige Organisa-tionen üblichen Tätigkeitsbereiche unterglie-dert: in den steuerfreien ideellen Bereich, diesteuerfreie Vermögensverwaltung sowie diesteuerbegünstigten Zweckbetriebe und diesteuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-betriebe.Im steuerlichen ideellen Bereich werden aufder Ertragsseite vor allem Mitgliedsbeiträge,Spenden, Zuschüsse und Zuwendungenerfasst. Hier verwirklicht die DGM ihreeigentlichen satzungsgemäßen Ziele. In dersteuerfreien Vermögensverwaltung setzt dieDGM ihr Vermögen ein, um Einkünfte zuerzielen. Die Erträge aus diesem Bereichumfassen in der Regel vor allem Zinsen undDividenden aus diversen Finanzanlagen. Inden steuerbegünstigten Zweckbetrieben wer-den die wirtschaftlichen Aktivitäten abgebil-det, die für die Zweckverwirklichung unent-behrlich sind. Bei der DGM sind dies vorallem die Aktivitäten in den Bereichen
Tagungen und Fortbildungen.Von untergeordneter Bedeutung bei derDGM sind die Erträge aus den steuerpflichti-gen wirtschaftlichen Geschäftsbereichen.Diese unterliegen der normalen Besteuerungund bilden sämtliche Aktivitäten der DGMab, die den drei vorgenannten Bereichennicht zuzuordnen sind.
Nach dem schwierigen Jahr 2009 konnte imGeschäftsjahr 2010 ein Vereinsergebnis von84.847,68 Euro erzielt werden. Damit steigendie Rücklagen auf insgesamt 804.868,06Euro (Stand 31.12.2010).
71TÄTIGKEITSBERICHT 2010/2011 www.DGM.de
DGM-Jahresabschluss 2010
DGM-Jahresabschluss 2010
Quelle: Auszug aus dem Bericht über die Prüfung der Rechnungslegung des Jahres 2010. Original liegt in der DGM Geschäftsstelle zur Ein-sicht aus.
Ausführliche Informationen gibt es auf der Mitgliederversammlung am 15. Juni 2011 in Dresden im Rahmen des DGM-Tages. Dort kanngesondert auf einzelne Ertrags- und Aufwandspositionen des abgelaufenen Geschäftsjahrs eingegangen werden. Für Rückfragen stehenIhnen Herr Banck-Baader (Finanzen und Personal) und ich gerne jederzeit zur Verfügung.
Dr.-Ing. Frank O. R. Fischer
Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.Senckenberganlage 10D-60325 Frankfurt
Telefon: +49-69-75306 750Telefax: +49-69-75306 733E-Mail: [email protected]
Vorsitzender: Dr. Ulrich Hartmann, Ulm
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied:Dr.-Ing. Frank O. R. Fischer
Registergericht: Frankfurt, VR 11655