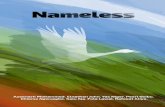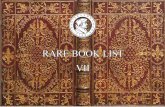Tätigkeitsbericht 2007–2008 - Stiftung Haus der Geschichte ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Tätigkeitsbericht 2007–2008 - Stiftung Haus der Geschichte ...
StiftungHaus der Geschichteder Bundesrepublik Deutschland
Tätigkeitsbericht2007–2008
Geschichteerleben®
Stiftung
Haus der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland
StiftungHaus der Geschichteder Bundesrepublik Deutschland
Tätigkeitsbericht 2007–2008
Geschichteerleben®
Stiftung
Haus der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland
Geleitwort
4
Die Stiftung Haus der Geschich -te der Bundesrepublik Deutschlandgehört heute in Deutschland zu den führenden und in Europa zu den viel beachteten Institutionen zur Vermittlung von Zeitgeschichte.Besucherfreundlichkeit und Erleb-nisorientierung zeichnen ihre Aus-stellungen und Veranstaltungen aus. Auch in den Jahren 2007 und
2008 lud eine Vielzahl von Wechsel-ausstellungen zum „Geschichte erleben®“ ein. Besondere Publi-kums magneten waren die Ausstel-lungen „Das Boot – Geschichte.Mythos. Film“ und „Melodien fürMillionen. Das Jahrhundert desSchlagers“. Zum Doppeljubiläumder Bundesrepublik Deutschland2009/2010 – 60 Jahre Grundgesetz,20 Jahre friedliche Revolution undWiedervereinigung – leistet die Aus-stellung „Flagge zeigen? Die Deut-schen und ihre Nationalsymbole“seit Ende 2008 einen wichtigen undviel beachteten Beitrag.Die bemerkenswerten Erfolge
der Stiftung spiegeln sich in den un-gebrochen hohen Besuchszahlenebenso wider wie in den Auszeich-nungen für ihre Arbeit, zum Bei-spiel dem hochrangigen „Master of Excellence“ für die Internetausstel-lung „Beobachtungen – Der Parla-mentarische Rat 1948/49“.Für ihren tatkräftigen Einsatz
danke ich allen Mitarbeiterinnen undMitarbeitern der Stiftung in Bonn,Leipzig und Berlin, namentlich dem
seit Februar 2006 kommissarischamtierenden und im Sommer 2007berufenen Präsidenten Herrn Prof.Dr. Hans Walter Hütter. Ich freuemich darauf, unsere vertrauensvolleund konstruktive Zusammenarbeitauch in Zukunft zum Wohle der Stif-tung fortzuführen. Danken möchteich ebenso den Vertretern von Deut-schem Bundestag, Bundesrat undBundesregierung im Kuratoriumsowie den Mitgliedern des Wis -senschaftlichen Beirates und des Arbeitskreises gesellschaftlicherGruppen für sachkundige Bera-tung und engagierte Unterstützung.Ein besonderer Dank richtet sichschließ lich an meinen Vorgänger alsKuratoriumsvorsitzender, Herrn Prof.Dr. Hermann Schäfer.Auf die Stiftung kommen auch
in den nächsten Jahren vielfältigeAufgaben und zahlreiche neue He-rausforderungen zu. Als Kuratori-umsvorsitzende werde ich auchzukünftig alles tun, damit die Stif-tung ihre erfolgreiche und zugleichwegweisende Arbeit fortsetzenkann.
MinisterialdirektorinDr. Ingeborg Berggreen-MerkelVorsitzende des Kuratoriums derStiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
5
Vorwort
Mit ihrem neunten Tätigkeits -bericht zieht die Stiftung Haus derGeschichte der BundesrepublikDeutschland erneut Bilanz. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten
im Berichtszeitraum gehört die Neu-gestaltung unserer Dauerausstel-lung in Leipzig, die am 9. Oktober2007 von Staatsminister Bernd Neu-mann MdB wiedereröffnet wurdeund sich seither zunehmender Re-sonanz erfreut. Auch zahlreicheWechsel- und Wanderausstellungenzu zeitgeschichtlichen Themen – er-gänzt durch eine Vielzahl vertiefen-der Angebote wie etwa Publika- tionen oder Veranstaltungen – be-geistern unser Publikum. Darüberhinaus hat die Stiftung ihre interna-tionalen Kontakte ausgebaut undmit ihrer Arbeit für vergleichbareEinrichtungen in Europa – etwa fürdas geplante „Haus der Europäi-schen Geschichte“ in Brüssel – Vor-bildwirkung entfaltet. In Berlin hat sich der Aufgaben-
bereich der Stiftung erweitert: Inder KulturBrauerei am PrenzlauerBerg wird – in Verbindung mit wei-teren Angeboten – eine Daueraus-stellung zur Geschichte der All- tagskultur in der DDR entstehen. Im„Tränenpalast“ am Bahnhof Fried-richstraße in Berlin wird die Stiftungeine Dauerausstellung zum Thema„Teilung und Grenze im Alltag derDeutschen“ einrichten.Das außergewöhnliche Engage-
ment und der hohe Leistungsstan-
dard unserer Mitarbeiterinnen undMitarbeiter bilden den Grundsteinfür das hohe Ansehen der Stiftungim In- und Ausland. Allen Kollegin-nen und Kollegen danke ich für diegeleistete Arbeit und den gemein-samen Einsatz für die Ziele der Stif-tung. Darüber hinaus gilt meinherzlicher Dank dem Kuratorium,dem Wissenschaftlichen Beirat unddem Arbeitskreis gesellschaftlicherGruppen. Künftig wird die Stiftung ihr
Augenmerk noch intensiver als inder Vergangenheit auf die veränder-ten Interessen der Besucherinnenund Besucher sowie die rasanteEntwicklung der Informationstech-nologie mit ihren Folgen für dasWahrnehmungsverhalten richten.Auch auf den demografischen Wan-del und den steigenden Anteil vonMenschen mit Migrationshinter-grund in der deutschen Bevölkerungwird sie sich verstärkt einstellen. Ichfreue mich darauf, diese Schritte ge-meinsam mit allen Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern sowie den Gre-mien der Stiftung zu gestalten.
Dr. Hans Walter HütterPräsident und ProfessorStiftung Haus der Geschichteder Bundesrepublik Deutschland
6
Geleitwort 4Vorwort 5
6
Titelthema
Ausstellung „Flagge zeigen? Die Deutschen und ihre Nationalsymbole“ 10Eröffnungsrede des Bundespräsidenten 15
Die Stiftung 18Gremien 20
Ausstellungen
Dauerausstellungen
Bonn 24Leipzig 26
Wechselausstellungen
man spricht Deutsch 30 Melodien für Millionen. Das Jahrhundert des Schlagers 34Skandale in Deutschland nach 1945 38Das Boot – Geschichte. Mythos. Film 42 Heimat und Exil. Emigration der deutschen Juden nach 1933 46drüben. Deutsche Blickwechsel 50
Flucht, Vertreibung, Integration 54Beobachtungen – Der Parlamentarische Rat 1948/49 55
Deutschlandreise. Fotografien von Pia Malmus 56Roger Melis – In einem stillen Land. Fotografien aus der DDR 56Inhaftiert. Fotografien und Berichte von Franziska Vu 56Antisemitismus? Antizionismus? Israelkritik? 56Fortgesetzte Einmischung. Bilder zur Zeitgeschichte 57Der Stoff aus dem die Träume sind. Das Hawaiihemd 57
Ausstellungen in der U-Bahn-Galerie
Wilde Zeiten. Fotografien von Günter Zint 58 Auf die Bilder kommt es an! Wahlkampf und politischer 59Alltag in Deutschland
7
Inhalt
Veranstaltungen
Ausstellungen
Bonn
Begleitprogramme 76Museumsfeste 78Literatur und Kultur 80Themenreihen 81Symposien 82Politik und Gesellschaft 83Stiftungstag 85
Veranstaltungen in historischen Gebäuden in Bonn
Palais Schaumburg 86Bundesrat 87
Leipzig
Begleitprogramme 88Literatur und Film 91Diskussionen 93Highlights 95
Berlin
Auftakt zur Veranstaltungsreihe „Alltag in der DDR“ 96
Wanderausstellungen 60Bilder, die lügen 66
Karikaturengalerie
Geschichte Deutschlands nach 1945 im Spiegel der Karikatur 68
Ausstellung im Bundeskanzleramt Berlin
Staatsgeschenke 70
Gastausstellungen
Die Kunst des SPIEGEL: Die Originale der SPIEGEL-Titelbilder 71Rückblende 2006 und 2007 72
Sammlungen
Öffentlichkeitsarbeit
Bonn
Sammeln zur Zeitgeschichte 100Objektmanagement 105Dokumentation 106Restaurierungswerkstatt 106Fotostudio 107Projekte 108
Leipzig
Sammeln zur Zeitgeschichte 110Objekt- und Ausstellungsmanagement 113
Berlin
Sammlung Industrielle Gestaltung 114
Bonn
Medien 118Marketing 120Publikationen 122
Leipzig
Medien 126Publikationen 127Werbung 128
8
9
Inhalt
Besucherservice
Bonn
Museumspädagogik 132Besucherdienst 135 Besucherstatistik 136Besucherforschung 138Informationszentrum 143Mediathek 145
Leipzig
Museumspädagogik 146Besucherdienst und -statistik 148
Gebäude, Personal, Haushalt
Bonn
Gebäude 152Personal 154Haushalt 155Informationstechnologie 156Internet 159
Leipzig
Gebäude 160
Berlin
Gebäude 161
Anhang
Veranstaltungen 164Veröffentlichungen 172Gremienmitglieder 174Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 178Chronik 182Gesetz 186Impressum 188
11
Titelthema
Ausstellung „Flagge zeigen?
Die Deutschen und ihre
Nationalsymbole“
Friedliche Revolution und Mau-erfall standen im Zeichen vonSchwarz-Rot-Gold, bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 tauchteganz Deutschland in ein schwarz-rot-goldenes „Sommermärchen“ein. „Ich liebe nicht den Staat, ichliebe meine Frau“, antwortete nochim Frühjahr 1969 der spätere Bun-despräsident Gustav Heinemannauf die Frage eines Journalisten. Ercharakterisierte damit das ambiva-lente Verhältnis vieler Bundesbürgerzu ihrer Nation und zu nationalenSymbolen wie Flagge, Hymne undAdler. Was sind die Gründe für diesen offensichtlichen Wandel im Umgang mit den Nationalsym-bolen? Die Ausstellung „Flagge zeigen?
Die Deutschen und ihre National-symbole“ nahm diese wechselvolleGeschichte zum Anlass für eine kri-tische Darstellung von Herkunft,Verwendung und Rezeption natio-naler Symbole in Deutschland nach1945. Zum Auftakt des Jubiläums-jahres 2009 „60 Jahre Bundesrepu-blik Deutschland“ und „20 JahreFriedliche Revolution“ fragte sienach der Herkunft von Fahne,Hymne und Wappen und beleuch-tete ihre Verwendung in verschie-denen historischen Epochen.Besonders die Einrichtung von na-
tionalen Gedenk- und Feiertagensowie der Umgang mit Denkmälernund Gedenkstätten in demokra -tischen Gesellschaften und Diktatu-ren warfen ein Schlaglicht auf die unterschiedlichen Motive undAbsichten. Bundespräsident HorstKöhler eröffnete die Ausstellung inBonn.Rund 600 Exponate waren in
der Ausstellung zu sehen, daruntereine Fahne des ReichsbannersSchwarz-Rot-Gold, das Gemälde„Café Deutschland“ von Jörg Im-mendorff sowie Entwurfsskizzender Kollektion „Mutter, Erde, Vater,Land“ der Modedesignerin EvaGronbach.
Foto Seite 10:Nach dem Rundgangdurch die Wechsel -ausstellung trägt sichBundespräsident Horst Köhler in das Gästebuch ein.
Foto Seite 11:Bundespräsident Horst Köhler eröffnetdie Ausstellung „Flagge zeigen? Die Deutschen und ihre Nationalsymbole“am 4. Dezember 2008.
12
Besondere Aussagekraft ge-wann die Ausstellung durch die vergleichende Perspektive auf de -mo kratische und diktatorischeStaatsformen. Den Besucher für die „Sprache“ der Symbole zu sen-sibilisieren, die Bindung von Sym-bolen an übergeordnete Werte wieFreiheit, Demokratie und Men-schenrechte ins Bewusstsein desBesuchers zu rufen, war ein wichti-ges Ziel von „Flagge zeigen?“. Die Wechselausstellung beleuch -
tete die Entstehung nationaler Sym-bole im 19. Jahrhundert, ihre Rolleim Kaiserreich, in der Weimarer Re-publik und im Nationalsozialismus
exemplarisch und konzentrierte sichauf die Zeit nach 1945. Die ersteAusstellungseinheit war der Wei-marer Republik gewidmet. „DieReichsfarben sind schwarz-rot-gold“, legte Artikel 3 der Verfassungdes Deutschen Reichs von 1919fest. Doch die Anhänger der Repu-blik blieben zunächst eine Minder-heit. Viele Deutsche trauerten dem1918 untergegangenen Kaiserreichund seinen Farben nach. Mit demAufruf „Wählt schwarz-weiß-rot.Das ist deutsch-national“ griff dieDeutschnationale Volkspartei dieseStimmung auf. Nationalistische undvölkische Kreise waren sich einig imKampf gegen die parlamentarisch-demokratische Staatsform, für dieSchwarz-Rot-Gold stand. Als Kampf-bund gegen links- und rechtsextre-mistische Gruppierungen gründetesich auf Initiative der SPD 1924 dasReichsbanner Schwarz-Rot-Gold.Eine seltene Original-Standarte desReichsbanners mit dem Reichsadlerund der dritten Strophe desDeutschlandliedes stand exempla-risch am Beginn der Ausstellung.„Ein Volk, ein Reich, ein Führer“:
Mit einem in der deutschen Ge-schichte bis dahin beispiellosenSymbolkult setzte der nationalsozia-listische Staat seinen Machtan-spruch in Szene, unterdrückte seineGegner und wollte die „Volksge-nossen“ für sein weltanschaulichesProgramm gewinnen. In der Aus-stellung visualisierte die große
Horst Köhler signiert im Anschluss an die Eröffnung Exemplaredes Begleitbuchs zurAusstellung.
13
Titelthema
Skulptur des Reichsadlers, geschaf-fen von Kurt Schmidt-Ehmen für dieNeue Reichskanzlei in Berlin, diesenaggressiven Herrschaftswillen. Film- ausschnitte vom Reichsparteitag in Nürnberg 1937 demonstriertendem Besucher die verführerischeSuggestivkraft von Symbolen imRahmen einer diktatorischen Staats-form. „Die Befreiung musste vonaußen kommen.“ Die überdimen-sional auf eine Wand geworfenenWorte Thomas Manns vom 11. Mai1945, gesprochen im DeutschenDienst der BBC, leiteten über in die Nachkriegszeit und damit zumSchwerpunkt der Ausstellung.In der Nachkriegszeit war
Schwarz-Rot-Gold das einzige vonKrieg und Terror unbelastete ge-samtdeutsche Symbol für die Deut-schen in allen Besatzungszonen.Bei der doppelten Staatsgründung1949 beschworen beide deutschenTeilstaaten mit diesen Farben dienationale Einheit in der Tradition desPaulskirchenparlaments 1848 undder ersten deutschen Republik vonWeimar. Zugleich setzten sie unterschied -
liche Akzente in ihrer Erinnerungs-kultur und grenzten sich im KaltenKrieg zunehmend voneinander ab.Die DDR orientierte sich an den Tra-ditionen der Arbeiterbewegung undbetonte das revolutionäre Elementder Barrikadenkämpfe vom März1848. Die Symbole der DDR wur-den bewusst und gezielt verordnet,
ohne öffentliche Debatten und demokratische Entscheidungspro-zesse. Zentral symbolisierte dies inder Ausstellung das Bild des Hän-dedrucks zwischen Wilhelm Pieckund Otto Grotewohl auf dem SED-Gründungsparteitag 1946, überragtvon einem überdimensionalen Por-trät Stalins, des „Paten“ der Partei-und Staatsgründung. In der Bundes -republik Deutschland nahm manverstärkt Bezug auf die parlamenta-rischen Traditionen von 1848/49.Der Briefwechsel von TheodorHeuss und Konrad Adenauer überdie zukünftige Nationalhymne so -wie die verschiedenen Vorschlägezur deutschen Nationalflagge, die
Unterschiedliche Akzente: Die DDRknüpft an die Traditionender Arbeiterbewegungan, die Bundesrepublikbesinnt sich auf dasPaulskirchenparlament1848/49.
14
im Parlamentarischen Rat und in derÖffentlichkeit diskutiert wurden, be-legen eine breite Auseinanderset-zung über diese Nationalsymbole inder westdeutschen Demokratie.Die SED begriff die DDR seit den
1970er Jahren als sozialistische Na-tion und betrieb die Abgrenzung vonder Bundesrepublik. Diese hielt –trotz der scheinbar in weiter Fer-ne liegenden WiedervereinigungDeutschlands – am Ziel der nationa-len Einheit fest und gab dieser Poli-tik symbolhafte Zeichen: Der 17.Juni, der Tag des Volksaufstands inder DDR, wurde nationaler Feiertag,das Brandenburger Tor Sinnbild derTeilung Deutschlands und des Wil-lens zu ihrer Überwindung. Ein indie Ausstellung integriertes Modelldes Brandenburger Tores durch-schritten die Besucher beim Rund-gang durch die Ausstellung mehr-fach. Es eröffnete Blickachsen vom17. Juni 1953 bis zur friedlichen Re-volution 1989 und zeigte, wie sichpolitische Programme auch in Sym-bolen verdichten. Die DDR setzteweiter auf die Traditionen der Arbei-terbewegung und der Kommunisti-schen Internationalen: Sie feiertevor allem den 1. Mai als internatio-nalen Kampftag der Arbeiterklasse,den 8. Mai als Tag der Befreiungvom Faschismus und die Staats-gründung am 7. Oktober.Friedliche Revolution und deut-
sche Einheit standen 1989/90 imZeichen von Schwarz-Rot-Gold. Die
Staatssymbole der DDR wurdennach der deutschen Wiedervereini-gung aus der Öffentlichkeit entfernt,während in den Medien erste Dis-kussionen um den Erhalt „sozialisti-scher“ Denkmäler begannen. Vorallem in der Hauptstadt Berlin setztedas vereinigte Deutschland – be-gleitet von regen öffentlichen Dis-kussionen – bauliche Signale für dasSelbstverständnis der Republik:Nach dem Umbau gibt das Reichs-tagsgebäude als Sitz des DeutschenBundestages mit einer begehbarengläsernen Kuppel dem politischenBerlin ein populäres Erkennungs-merkmal. Das wiedervereinigteDeutschland bekennt sich zu seinerhistorischen Verantwortung undsetzt mit der Erinnerung an die nationalsozialistische Gewaltherr-schaft mit der Neukonzeption derGedenkstätte „Neue Wache“ unddem „Denkmal für die ermordetenJuden Europas“ Zeichen.Künstlerische Arbeiten, entstan-
den 1998 bei einem Wettbewerbzur Erinnerung an die Revolutionvon 1848, zeigten am Ende der Aus-stellung, wie ambivalent nationaleSymbole je nach Gebrauch wirken:Sie sind Zeichen für bürgerschaftli-che Identität und Teilhabe. Zugleichbergen sie das Potenzial zur politi-schen Verblendung. Besucher hat-ten die Gelegenheit, sich zumaktuellen Umgang mit den National-symbolen in einem elektronischenBesucherbuch zu äußern.
Foto oben:Ingeborg Berggreen-Merkel,Vorsitzende des Kuratoriumsder Stiftung Haus der Ge-schichte (l.), und Hans WalterHütter (r.), Präsident der Stif-tung, im Gespräch mit Bun-despräsident Horst Köhler.
Foto unten:Ausstellungsdirektor JürgenReiche, Projektleiterin AngelaStirken und Hans Walter Hüt-ter (v.l.n.r.) beim Rundgangdurch die Ausstellung mitBundespräsident Horst Köhler.
15
Titelthema
Bei Fontane weht über dem Herrenhaus des altenDubslav von Stechlin eine schon etwas verschlissenepreußische Fahne. Eines Tages will ihr sein Kammer-diener einen roten Streifen annähen, wo doch Preußenjetzt zum Deutschen Reich von 1871 gehöre und des-sen Farben nun einmal Schwarz-Weiß-Rot seien. AberStechlin wehrt ab: „Lass. Ich bin nicht dafür. Das alteSchwarz und Weiß hält gerade noch; aber wenn duwas Rotes dran nähst, dann reißt es gewiss.“ An diese kleine Geschichte lassen sich einige Ge-
danken knüpfen – über die Belastbarkeit von National-symbolen in den Stürmen der Zeit; über den Eigensinndieser Zeichen und über den Eigensinn derer, die zuihnen halten. Sie zeigt auch, wie im Lauf des 19. Jahr-hunderts mit dem modernen Nationalstaat neue Staats-symbole entstanden, und wie schwer sie es inDeutschland mitunter hatten, sich neben den altenLoyalitäten ihren Platz zu sichern. – Der Preuße bliebeben auch im neuen Reich zunächst einmal vor allemPreuße; der Bayer ein Bayer, der Sachse ein Sachse …und der Rheinländer ein Rheinländer – auch wenn Letz-teres den Preußen nicht gefiel. Ich freue mich darüber, dass ab heute das Haus der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonneine Ausstellung über „Die Deutschen und ihre Natio-nalsymbole“ zeigt. Im kommenden Jahr be gehen wirDeutsche ein Doppeljubiläum: den 60. Geburtstag derBun desrepublik und den 20. Jahrestag des Mauerfalls.Es ist gut, die Ge schichte des geteilten und wieder-vereinigten Deutschlands auch im Spiegel seiner Nationalsymbole zu erzählen. Symbole sind Zeichen, die komplexe Sachverhalte,
Ideen und Gefühle verdichten und sinnlich erfahrbarmachen. Symbole – das können Bilder sein, Rituale,Handlungen, Erzählungen. So wie ein Ge dicht mehr istals eine Verkettung sprachlicher Zeichen, die auf einenbestimmten Gegenstand verweisen, so ist auch einSymbol mehr als ein bloßer Stellvertreter für das, wases bezeichnet. Politische Symbole stehen für Ideen,Werte und Ziele, sie sind Erkennungszeichen und Bekenntnis, sie geben Orientierung und Rückhalt, siestiften Gemein schaft. Sie können integrieren, aberauch provozieren. Sie machen Mut – und werdenmanchmal auch als Zumutung empfunden.
Symbol ist, was als Symbol wirkt. Deshalb gehörenzu den Zei chen, die für unser Land stehen, nicht nurFlaggen, Hymnen, Orden und Gedenktage, sondernauch Menschen, Orte, Schlüsselworte, Ges ten. Ichdenke zum Beispiel an den Kniefall von BundeskanzlerWilly Brandt am Ehrenmal für das Warschauer Ghetto(heute fast auf den Tag genau vor 38 Jahren). Oder anPräsident Gorbatschow und Bun deskanzler Kohl inStrickjacke im Kaukasus. Oder an die Bilder der fried -lichen Revolution vom Herbst 1989: an Tausende, diebei den Montagsdemonstrationen durch Leipzig zogen;an die Menschen, die von beiden Seiten auf die Mauerkletterten; an den Ruf „Wir sind das Volk“, aus demschon bald „Wir sind ein Volk“ werden sollte. Symbole wecken Erinnerungen, Erwartungen und
Gefühle. Das macht ihre Kraft aus – und zugleich liegtdarin auch eine Gefahr. Die Gefahr, dass Menschendurch sie verblendet und verführt werden; dass ihre Be-geisterung für falsche Zwecke ausgenutzt wird. In derjüngeren deutschen Geschichte gibt es schlimme Bei-spiele für den Missbrauch von Symbolen, der immerauch ein Missbrauch von Loyalitäten ist. Es ist gut, dassdie Ausstellung, die wir heute eröffnen, sich auch demThema „Symbole in der Diktatur“ widmet. Die Verbrechen des Dritten Reiches haben den
Deutschen in der Nachkriegszeit das Bekenntnis zumStaat sehr schwer gemacht. Die Nationalsozialistenhaben auch mit den Symbolen der Deutschen Schind-luder getrieben. Manche hielten sie danach für unrett-bar be schmutzt und zerstört. Der Schriftsteller ReinholdSchneider etwa – gewiss kein Umstürzler – schrieb1953: „Das Wort ‚Nation‘ ist für mich jedes Sinnes bar:eine deutsche Fahne sagt mir nichts.“ Statt zum „his-torisch belasteten“ Nationalstaat und seinen Zeichenbekannte Schneider sich zu seiner badischen Heimat.Andere wollten Deutsch land in Europa aufgehen lassen. Im Westen Deutschlands hingen zudem viele der
Vorstellung an, ein guter Inhalt könne sich mit einemMinimum an äußerer Form be gnügen. Sachlichkeit undFunktionalität – das waren Schlüsselbegriffe für das äs-thetische Selbstverständnis der jungen Bundesrepu-blik. Eher noch als Flagge und Hymne waren es dennauch das „Wirtschaftswun der“ und die D -Mark, mit
„Symbole der Demokratie: Unser Vorrat wächst“
Ansprache von Bundespräsident Horst Köhler anlässlich der
Eröffnung der Ausstellung „Flagge zeigen? Die Deutschen und
ihre Nationalsymbole“ am 4. Dezember 2008 in Bonn
16
denen sich viele Westdeutsche identifizierten und diezu einem wichtigen „Markenzeichen“ ihres Staatesnach außen wurden. Die junge Bundesrepublik übte also eine gewisse
Zurückhaltung, wo es um staatliche Symbole oder garum staatliches Gepränge ging, und dieses Understate-ment stand ihr gut zu Gesicht. Aber im Lauf der Jahrezeigte sich auch: Gemeinschaft muss sich selber mit-teilen. Unser sozialer Rechtsstaat kam voran und hatteErfolg, aber es fehlte ihm an Farbe, an Klang, an ver-trauter Gestalt, die Zuneigung weckt. Mit For mularenund Bilanzen allein kann man sich nicht identifizieren,damit lässt sich nicht gemeinsam jubeln und trauern.Der zweiten deutschen Demokratie gelang sehr vielGutes, aber die Symbole dafür, die ja auch Symbole derSelbstachtung und der Wertschätzung des Erreich tensind, diese Symbole blieben im öffentlichen Bewusst-sein eigentüm lich schwach. Das machte es unsererDemokratie übrigens nicht leich ter, zu verdeutlichen,wie konsequent der Neuanfang von 1949, die Abkehrvom Staat der Nazis war. In Ostdeutschland dagegen wurde wenig so sehr in-
szeniert wie diese Abkehr. Die DDR reklamierte alles,was sie für die „fortschrittli chen Traditionen“ der deut-schen Geschichte hielt, für sich allein. Und sie tat dasmit lautstarkem „antifaschistischem“ Pathos. Im Wes-ten löste der Gedanke an staatliche Symbole Unbeha-gen aus – im Osten wurden sie verordnet. Und wenndie Parteilinie wechselte, wurde neu verordnet: DieDDR -Hymne zum Beispiel wurde ab 1970 nicht mehrgesungen, nur gespielt, weil die SED die Zeile„Deutschland einig Va terland” nicht mehr hören wollte.Aber Symbole sind zählebig und kön nen neu aufgela-den werden: 1989 war „Deutschland einig Vaterland“mit einem Mal in aller Munde … Das hat auch im Westen manche überrascht, viel-
leicht sogar be schämt, denn im Lauf der Jahrzehntewollten auch hier manche nichts mehr von der deut-schen Einheit hören. Die Aufforderung dazu in der Prä-ambel des Grundgesetzes schien vielen illusionär, dieMahnung dar an am 17. Juni wurde immer öfter zumBundesausflugstag umfunktio niert, und viele fandensich sehr leicht damit ab, dass in Ostdeutsch land Un-freiheit und Mangel herrschten. Ob das auch daran lag,
dass der Appell zu Einigkeit und Recht und Freiheit alsdem alten Sinn von Schwarz -Rot -Gold in der Bundes-republik zu selten und zu leise ertön te? Der lange Schatten des Dritten Reiches – er beein-
flusst auch heute im wiedervereinten Deutschlandnoch unseren Umgang mit staatlichen Symbolen undunser Verhältnis zur eigenen Nation. Wir werden nieganz aus diesem Schatten heraustreten – das ist wedermöglich noch wünschenswert. Aber wir sollten lernen,über die Ränder dieses Schattens hinauszublicken:nach vorne in die Zukunft; nach rechts und links zu un-seren Nachbarn – und auch zurück in unsere eigene Geschichte. Und die beginnt nicht erst mit der so ge-nannten „Stunde Null“. Die deutsche Geschichte der vergangenen 200
Jahre wird durch zwei Grundströmungen bestimmt:durch das Streben nach nationaler Einheit und durchdas Ringen um politische Freiheit. Der erste Versuch,die Deutschen zur Einheit in Freiheit zu führen, war dieRevolution von 1848. Sie scheiterte. Erreicht wurdenihre Ziele erst mit der Weimarer Republik. Doch die warnur von kurzer Dauer. Für ihren Untergang gab es vieleGründe: die überschwere Bürde der Lasten aus Krieg,Nieder lage und Weltwirtschaftskrise, die Übermachtihrer innenpolitischen Feinde, die fehlende demokrati-sche Gesinnung der Eliten, die man gelnde Identifika-tion der Bürger mit einem Staat, der es nicht verstand,die Menschen für sich und seine Ziele zu begeistern.Die Weimarer Republik scheiterte an alledem, und siescheiterte – wie Ernst Toller 1933 schrieb – auch an den„Realpolitiker[n], die taub wa ren für die Magie des Wor-tes, blind für die Macht der Idee, stumm vor der Kraftdes Geistes.“ Es ist bezeichnend für die Schwäche der Weimarer
Demokraten und ihre Unterschätzung der Bedeutungpolitischer Symbole, dass sie nicht in der Lage waren,dem Land eine einzige Flagge zu geben. Stattdessenführte die Republik ab 1926 deren zwei, die sich imGrun de gegenseitig ausschlossen: das Schwarz -Rot -Gold der Demokraten und das Schwarz -Weiß -Rot desuntergegangenen Kaiserreichs. Die Fahne, die dochEinheit stiften soll, wurde so zum amtlichen Symboleiner gespaltenen Nation. 1832 beim Hambacher Fest und 1848 in der Natio-
17
Titelthema
nalversamm lung in der Frankfurter Paulskirche warenSchwarz -Rot -Gold die Farben der deutschen Einheit. Inder Weimarer Republik standen sie beson ders für dieDemokratie. Und in den ersten Jahren nach dem Zwei-ten Weltkrieg verbanden sie die Menschen im geteil-ten Deutschland. Heute symbolisieren sie das inFreiheit vereinte Deutschland. Die lange und gute Ge-schichte unserer Flagge zeigt uns, dass die freiheitlicheOrd nung des Grundgesetzes weit mehr ist als eine Re-aktion auf die Verbrechen des Dritten Reiches. Sieknüpft an eine lange Freiheitsge schichte an, auf die wirstolz sein können. Mehr als jede andere Regierungsform ist die De-
mokratie darauf angewiesen, dass ihre Bürger sie be-jahen und mit Leben erfüllen. Ob diese Zustimmungnur vom Kopf oder auch vom Herzen ausgehen soll te,darüber wurde und wird bei uns in Deutschland kon-trovers disku tiert. Kann man – darf man – sein Land lie-ben? Bertolt Brecht fand: Ja. Und ich finde: Da hat erRecht. Das heißt nicht, dass wir andere Länder weniger
achten oder dass wir die Schwächen und Fehler unse-res eigenen beschönigen. Im Ge genteil: Weil wir unserLand lieben, wollen wir, dass es aus seinen Feh lernlernt; dass es danach strebt, besser zu werden – undein guter und verlässlicher Partner zu sein für die an-deren Völker unserer Einen Welt. Kann Patriotismus ohne Gefühle auskommen und
ohne Symbole, die diese Gefühle ausdrücken und an-sprechen? Ich habe meine Zwei fel. Denn selbst ein intellektueller Verfassungspatriotismus wird letzt lichvon Emotionen getragen. Verfassungen sind nicht nur Texte. Ihre Schlüsselbegriffe und Grundwerte – „liberté“, „égalité“, „fraternité“, „the pursuit of hap-piness“, „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“– verdanken ihre Wirkungskraft gerade auch ihrememotionalen Ge halt. Die Demokratie braucht Symbole. Sie braucht Zei-
chen der Erin nerung und Zeiten des gemeinsamenNachdenkens über ihre Grundla gen und Ziele. Mit denWorten des amerikanischen Philosophen RichardRorty: „Nationalstolz ist für ein Land dasselbe wieSelbstachtung für den Einzelnen: eine notwendige Be-dingung der Selbstvervollkom mnung.“
Ich denke, diese Einsicht wächst auch bei uns. Ichhabe mich ge freut, dass im Fußballsommer 2006 vieleBürger die deutsche Flagge gezeigt haben. UnsereFahne ist zwar ein Staatssymbol, aber sie ge hört nichtallein dem Staat, sondern den Bürgern. Und besondersschön fand ich, dass damals auch viele Menschen mitWurzeln außer halb von Deutschland ganz selbstver-ständlich die schwarz rot goldene Fahne geschwenktund sich gemeinsam gefreut haben. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir Deutsche in den
letzten Jahren viel unbefangener und fröhlicher unsereFarben zeigen. Es ist ein gutes Zeichen, dass unsereNationalhymne viel öfter gesungen wird. An mir selbsthabe ich übrigens beobachtet: Ich singe sie irgendwieviel unbe schwerter und fröhlicher, seit unsere Einheit inFreiheit wiedergewon nen ist. Es ist ein gutes Zeichen,dass der Tag der Deutschen Einheit landauf, landab mitso viel Kreativität und Eintracht gefeiert wird. Und esist ein gutes Zeichen, dass unser Vorrat sogar nochwächst an Sym bolen für Gemeinsamkeit und Leistungund Verantwortung; an Symbo len, die alle verstehenund die allen wichtig sind, an Symbolen wie der Reichs-tagskuppel und dem Holocaust- Mahnmal und derDresdner Frau enkirche. Und auch wenn wir an unsereFahne keinen blauen Streifen nähen, haben wir dochmit Freude und aus Überzeugung einen Fah nenmastaufgerichtet, an dem Europas Sternenbanner weht. Meine Damen und Herren, sagen wir aus ganzem
Herzen Ja zu Deutschland.
18
Die Stiftung
„In einem Ausstellungs-, Doku-mentations- und Informationszen-trum die Geschichte der Bundes-republik Deutschland einschließlichder Geschichte der Deutschen De-mokratischen Republik unter Einbe-ziehung der Vor- und Entstehungs-geschichte darzustellen und Kennt-nisse hierüber zu vermitteln“, lautetder Auftrag im Gesetz zur Er -richtung einer Stiftung Haus der
Geschichte der BundesrepublikDeutschland.Tätigkeitsschwerpunkte sind,
Kenntnisse zur Zeitgeschichte zuvermitteln und Bewusstsein für his-torische Zusammenhänge zu för-dern. Die Erarbeitung und Präsen-tation von Ausstellungen zu zeitge-schichtlichen Themen ist die Haupt-aufgabe in den derzeit beidenMuseen der Stiftung, dem Haus derGeschichte in Bonn und dem Zeit-geschichtlichen Forum Leipzig. Die
Blick auf das Museums-gebäude an der Willy-Brandt-Allee in Bonn
19
Die Stiftung
dortigen Dauerausstellungen zeigenattraktive Museumsobjekte, diegroßteils aus den umfangreichenSammlungen der Stiftung stam-men. Die Dauer- und Wechselaus-stellungen werden durch einvielfältiges Wanderausstellungspro-gramm im In- und Ausland abgerun-det. In den Jahren 2007 und 2008präsentierte die Stiftung insgesamtzwölf verschiedene Wanderausstel-lungen an 38 Stationen.Mit einemumfassenden Webauftritt sowie vir-tuellen Ausstellungen ist die Stif-tung auch im Internet präsent,wobei das „Lebendige virtuelle Mu-seum Online“ (LeMO) im Zentrumsteht. Zahlreiche Publikationen, Veran-
staltungen, museumspädago gischeAngebote sowie weitere Vertie-fungsmöglichkeiten ergänzen dasAusstellungsangebot. Ferner er-möglicht die Stiftung auf dem „Wegder Demokratie“ durch das ehema-lige Regierungsviertel in Bonn anauthentischen Orten der Zeitge-schichte – dem Palais Schaumburgmit Park und Teehaus sowie demehemaligen Plenarsaal des Bundes-rats – einen Blick hinter die Kulis-sen der Politik. Der Kanzlerbunga-low, der große Kabinettssaal unddas Kanzlerbüro im ehemaligenBonner Kanzleramt folgten im Früh-jahr 2009.Die Stiftung hat ihren Sitz in
Bonn. Ihre Arbeit erstreckt sich pri-mär auf die Standorte Bonn, Leipzig
und Berlin. Hinzu kommen Orte imIn- und Ausland, an denen ihre Wan-derausstellungen gezeigt werden.Darüber hinaus ist die Stiftungdurch Ausstellungsko operationen,Austauschprogramme für Nach-wuchswissenschaftler und muse-umspädagogische Projekte nationalund international vielfältig vernetzt. Aus der Fortschreibung der
Gedenkstättenkonzeption der Bun-desregierung ergibt sich eine Auf-gabenerweiterung der Stiftung inBerlin: In der KulturBrauerei amPrenzlauer Berg entsteht dem-nächst eine Dauerausstellung zurGeschichte der Alltagskultur in derDDR, die durch Wechselausstellun-gen ergänzt wird. Auf diese Weisewerden Teile der „Sammlung In-dustrielle Gestaltung“, die der Stif-tung 2005 übertragen wurde, einerbreiten Öffentlichkeit zugänglich.Neben Veranstaltungen und muse-umspädagogischen Angeboten sindin der Kulturbrauerei ergänzendeAktivitäten zum Thema „Oppositionund Widerstand“ vorgesehen. Zu dem wird die Stiftung im
„Tränenpalast“ am Bahnhof Fried-richstraße in Berlin – der ehemali-gen Grenzübergangsstelle der DDR– eine Dauerausstellung zumThema „Teilung und Grenze im All-tag der Deutschen“ einrichten. Siewird auch den Vereinigungsprozess1989/90 umfassend darstellen undwürdigen.
Foto oben:Auf dem Gelände derKulturBrauerei amPrenzlauer Berg befin-det sich die SammlungIndustrielle Gestaltung.
Foto unten:Das ZeitgeschichtlicheForum Leipzig im Zen-trum der Stadt
20
Gremien
Die Organisation der StiftungHaus der Geschichte der Bundesre-publik Deutschland ist auf Transpa-renz und Kooperation ausgerichtet.Dabei gewährt die reibungslose undvertrauensvolle Zusammenarbeitder Stiftungsorgane im Rahmeneiner unabhängigen Stiftung öffent-lichen Rechts größtmögliche wis-senschaftliche Unabhängigkeit undist ein wichtiges Fundament für denfortgesetzten Erfolg der Stiftungs -tätigkeit. Stiftungsorgane sind das
Kuratorium, der WissenschaftlicheBeirat, der Arbeitskreis gesell-schaftlicher Gruppen sowie der Prä-sident. Sie garantieren den hohenwissenschaftlichen Standard derStiftungsarbeit sowie eine mög-lichst objektive Darstellung der Zeit-geschichte, die stets den aktuellenForschungsstand widerspiegelt. Zu-gleich unterstützen sie die Stiftungdabei, historische Zusammenhängeund Entwicklungen visuell attraktivund anschaulich zu präsentieren.Der Präsident führt die Geschäf -
te der Stiftung und entscheidet inallen Angelegenheiten, soweit nichtdas Kuratorium zuständig ist. Am 5. Juni 2007 berief das Kuratoriumin dieses Amt Prof. Dr. Hans WalterHütter, der die Stiftung bereits seitdem 1. Februar 2006 kommissa-risch geleitet hat.Das Kuratorium ist aufsichtfüh-
rendes Organ der Stiftung. Es ent-scheidet über den Haushalt und dieGrundzüge der Programmgestal-tung sowie über Personalentschei-dungen von wesentlicher Bedeu-tung. Das Gremium setzt sich drit-telparitätisch aus Vertretern derFraktionen des Deutschen Bundes-tags, der Bundesregierung und Re-präsentanten aller Bundesländerzusammen. Dabei trägt die Beteili-gung der Länder ihrer KulturhoheitRechnung. Am 10. Juni 2008 wurdeDr. Ingeborg Berggreen-Merkel, Mi-nisterialdirektorin beim Beauftrag-ten der Bundesregierung für Kultur
Im Juni 2007 berief dasKuratorium der StiftungHaus der Geschichte Hans Walter Hütter zum Präsidenten, im Frühsommer 2008 wurdeIngeborg Berggreen-Merkel zur Kuratoriums-Vorsitzenden gewählt.
21
Gremien
und Medien, als Nachfolgerin vonProf. Dr. Hermann Schäfer vom Ku-ratorium einstimmig zur Vorsitzen-den dieses Gremiums gewählt. Dem Wissenschaftlichen Beirat
gehören Historiker, Politikwissen-schaftler und Museumsfachleutean. Er berät das Kuratorium und denPräsidenten der Stiftung im Rah-men des gesetzlichen Auftrags, insbesondere bei der konzeptionel-len Vorbereitung der Wechselaus-stellungen und bei der inhaltlichenArbeit an der Dauerausstellung.
Zudem ist er ein wichtiger Garant fürdie Unabhängigkeit der Stiftung vonäußerer Einflussnahme. Vorsitzenderdes Wissenschaftlichen Beirats warim Berichtszeitraum Prof. Dr. LotharGall. Im Januar 2009 berief das Ku-ratorium nach Ablauf der letztenWahlperiode den Wissenschaftli-chen Beirat für vier Jahre neu.Der Arbeitskreis gesellschaft -
licher Gruppen versteht sich als kri-tische Interessenvertretung derBesucher. Zahlreiche gesellschaft -liche Kräfte, darunter die großen Re-
Präsident:
Prof. Dr. Hans Walter Hütter
Wissenschaftlicher Beirat
Vorsitzender: Prof. Dr. Lothar Gall
Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen
Vorsitzender:Prälat Dr. Karl Jüsten
ligionsgemeinschaften, Arbeitgeber-und Arbeitnehmerverbände, Vertre-ter des Bundesausländerbeirates,des Deutschen Frauenrates, desDeutschen Sportbundes, des Bun-des der Vertriebenen, des Deut-schen Bundesjugendringes und derkommunalen Spitzenverbände, bün-deln ihre Interessen innerhalb desArbeitskreises, der sowohl das Ku-ratorium als auch den Stiftungsprä-sidenten berät. Der Vorsitzende desArbeitskreises gesellschaftlicherGruppen ist Prälat Dr. Karl Jüsten.
Kuratorium
Vorsitzende:
Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel
Drittelparitätisch:
Vertreter des Deutschen BundestagsVertreter der BundesregierungVertreter der Bundesländer
beschließt die Grundzüge der Programmgestaltung, den Haushaltsplan und wichtige
Personalentscheidungen
beruft
berät
beruft
berät
berät berät
24
Dauerausstellung im
Haus der Geschichte Bonn
Die Dauerausstellung der Stif-tung Haus der Geschichte der Bun-desrepublik Deutschland in Bonnbleibt ein Besuchermagnet. Um eingleichbleibend hohes Niveau derAusstellungspräsentation zu ge-währleisten, sind umfangreicheund kontinuierliche Wartungs- undReparaturmaßnahmen notwendig.Laufende Optimierungen und Ak-tualisierungen werden in Zusam-menarbeit mit den Wissenschaft-lern und den Museumspädagogin-
nen geplant und in der Regel durchdie hauseigenen Werkstätten re-alisiert. Die Aktualisierung undOptimierung der Dauerausstellungist ein wesentlicher Beitrag, die At-traktivität des Museums für Besu-cher aus dem In- und Ausland zuerhalten.Im Berichtszeitraum konnten
durch attraktive Objekte und inter-aktive Elemente weitere Themen indie Dauerausstellung einbezogenbzw. vertieft werden: Die Zerstö-rung deutscher Städte im ZweitenWeltkrieg und – in der Gegenüber-stellung – der Wiederaufbau bis in
die 1950er Jahre sind jetzt in einerBildanimation visualisiert: „10 JahreWiederaufbau 1945–1955“ zeigt ne-beneinander auf zwei großen Moni-toren Ansichten vom Ende desKrieges und vomWiederaufbau vonDresden, Düsseldorf, Hamburg,Kiel, Köln, Magdeburg oder Mün-chen. Hinzu kommt eine Multime-diastation, welche Stadtplanung undWohnungsbau der Nachkriegszeitveranschaulicht. Filmbeispiele zumHansaviertel und der Gedächtniskir-che in Berlin, zur Neuen Vahr in Bre-men, zur Bauausstellung in Essen,dem Architekten Ernst May oderauch dem Wohnungsbau für Berg-arbeiter bieten ein anschaulichesBild der Anstrengungen und neuenWege im Bauwesen im WestenDeutschlands der 1950er Jahre.Auch die Ausstellungseinheit
zum Thema „Raumfahrt“ wurde er-weitert. Die Besucherinnen und Be-sucher können sich an einem Com-puterterminal zur Mondlandung jetztauch über die Frage „Inszenierungoder Realität?“ informieren. Positio-nen zu einer möglichen vorge-täuschten Mondlandung und ent-kräftende Gegenargumente werdenexemplarisch anhand der BeispieleRaumanzug, Fußspur, Landekrater,Fahne und Mondrover gegenüber-gestellt.Im Ausstellungsbereich „Ju-
gendkultur“ und speziell zu den„Roaring Sixties“ hat der Besucherjetzt die Möglichkeit, an einer Hör-
25
Dauerausstellung
Bonn
bar 20 Beispielen der Musikge-schichte der 1960er Jahre von Grup-pen wie den Beatles, Rolling Stonesoder The Doors zu lauschen.Neben den nahezu 7.000 Expo-
naten bietet die Dauerausstellung inunterschiedlichsten Präsentations-formen eine große Anzahl an Me-dienstationen. Eine Vielzahl voninteraktiven mechanischen Syste-
men wie Schubladen-, Klapp- undDrehelemente laden die Besucherzum Mitmachen ein.
Im Berichtszeitraum haben auchdie Planungen für eine umfangrei-che Überarbeitung und Aktualisie-rung der Dauerausstellung begon-nen. Diese werden zeitgleich zurSanierung des Glasdaches 2010stattfinden.
Foto Seite 24:Geschichte erleben:Die Dauerausstellungpräsentiert auchAspekte der Medien-und Wirtschaftsge-schichte.
Fotos Seite 25:Medienstationen undinteraktive Elemente inder Dauerausstellungladen zum Ausprobierenein.
26
Dauerausstellung im
Zeitgeschichtlichen Forum
Leipzig
Die Dauerausstellung des Zeit-geschichtlichen Forums „Teilungund Einheit, Diktatur und Wider-stand“ zeigt die Geschichte von Dik-tatur, Widerstand und Opposition inder Sowjetischen Besatzungszoneund in der DDR vor dem Hinter-grund der deutschen Teilung, einge-bettet in die alltägliche Lebenswelt.Widerständler und Oppositionellewerden als selbstbewusst han-delnde Akteure gezeigt, die sichgegen die totalitäre Staatsmachtauflehnen. Ein weiteres wichtigesThema ist die deutsche Wiederver-einigung, besonders die Darstellungdes inneren Vereinigungsprozesses.Die Ausstellung richtet sich grund-sätzlich gegen alle Tendenzen zurVerharmlosung und Rechtfertigungder SED-Diktatur, deren Machtaus-übung zwischen Verführung undGewalt, Zustimmung und Unterdrü-ckung gezeigt wird.Da das Konzept der Ausstellung
seit ihrer Eröffnung 1999 von derÖffentlichkeit hervorragend ange-nommen worden war, wurde beider Überarbeitung an ihren Grund-aussagen festgehalten. In einerSituation, in der die sozialen und po-litisch-kulturellen Dimensionen derdeutschen Teilung deutlicher zuTage traten, hatte die Neugestal-tung zuerst das Ziel, neue wissen-
27
Dauerausstellung
Leipzig
schaftliche Erkenntnisse und aktu-elle zeitgeschichtliche Diskussionenzu berücksichtigen. Solche Ergeb-nisse lagen etwa zum instrumenta-lisierten „Antifaschismus“ der SED,zu den Opfern des Stalinismus, zumAufstand am 17. Juni 1953, zum frü-hen Widerstand in der SBZ/DDRund zur Militarisierung in der Spät-phase der DDR vor. Zu berücksichti-gen waren auch die breite Dis-kussion um Flucht und Vertreibungals Folge des Zweiten Weltkriegesund die Auseinandersetzungen umdie Bedeutung des KSZE-Prozes-ses, der Stellenwert der Flucht ausder DDR für ihre Destabilisierungund die Ziele der Bürgerbewegungin der Spätphase der kommunisti-schen deutschen Diktatur.Weite Teile der Ausstellung soll-
ten auch gestalterisch optimiertbzw. lebendiger präsentiert werden,und neu recherchierte ausdrucks-starke Objekte waren zu integrie-ren. Eine biografische Leitlinieermöglichte einen interaktiven Zu-griff in Wort und Bild auf lebensge-schichtliche Aspekte der Befragten.Neue Gestaltungsideen konnten be-sonders im Eingangsbereich wieauch in den Bereichen Kollektivie-rung der Landwirtschaft, Mauerbauund Grenzausbau, Kirchenspren-gungen, Niederschlagung des Pra-ger Frühlings 1968, Militarisierungder DDR, Bürgerbewegung undStaatssicherheit in den 1980erJahren umgesetzt werden. Dazu
Foto Seite 26:Drakonische Strafen:Ein sowjetisches Militär-tribunal verurteilte imHerbst 1950 Jugendli-che zum Tod, weil siemit einem selbst gebau-ten Sender eine Rededes StaatspräsidentenWilhelm Pieck gestörthatten.
Foto oben:Eine neue Eingangssi-tuation informiert überdie Anzahl der Toten desZweiten Weltkriegs.
Foto links:Fernsehausschnitteund Zeitzeugenberichteinformieren über den17. Juni 1953.
28
kamen die Darstellung des wirt-schaftlichen Niedergangs der Dikta-tur und des Falls der Berliner Mauer.Es blieb auch in der neu konzi-
pierten Ausstellung wichtig, denGegensatz zwischen Anspruch undRealität in der Diktatur sowie die all-täglichen Spannungen zwischen Le-benswirklichkeit und Herrschafts-anspruch im SED-Regime aufzuzei-gen. Deshalb war die Überarbeitung
des Alltagsbereichs von grundsätz-licher Bedeutung. Hier konnte die-ses Spannungsverhältnis weiterverdeutlicht werden. Auch die Dif-ferenzen zwischen den Forderun-gen der Staatspartei bzw. derenUmsetzung im Alltag und demLeben der Oppositionellen waren zuberücksichtigen. Dabei konnte derlebensweltliche Charakter der Aus-stellungseinheit verstärkt werden,
Foto Seite 28:Der Beauftragte derBundesregierung fürKultur und Medien,Staatsminister BerndNeumann MdB, beimRundgang durch dieüberarbeitete Daueraus-stellung mit HansWalter Hütter, Ausstel-lungsdirektor JürgenReiche, MarianneBirthler und dem Direk-tor des Zeitgeschicht-lichen Forums Leipzig,Rainer Eckert (v.l.n.r.)
Foto Seite 29:AlltagsgeschichtlicheElemente in der Dauer-ausstellung lassen dieSpannungen zwischenHerrschaftsanspruchdes SED-Regimes undder Lebenswirklichkeitdeutlich werden.
29
Dauerausstellung
Leipzig
und Regierung von Bonn nachBerlin, die erste Bundeskanzlerinostdeutscher Herkunft oder die So-lidarität mit den neuen Bundeslän-dern stehen ebenso im Mittelpunktdes Interesses wie Arbeitslosigkeit,neue Industriekerne und der Wie-deraufbau von Stadtzentren. Dazukommen die Rolle Deutschlands inder Welt und die europäische Eini-gung. Ein besonders spannenderAspekt ist auch die Betrachtung derWerte von Ost- und Westdeut-schen, ihrer Haltung zur Nation bis
hin zur Auseinandersetzung mitder DDR-Vergangenheit und der„Ostalgie“.Mit der Überarbeitung der Dau-
erausstellung, von Foyer und Trep-penhaus war die Berliner Firma„Coordination Ausstellung GmbH“beauftragt. Die Überarbeitung derLeipziger Dauerausstellung erfolgtebei laufendem Ausstellungsbetrieb.Nach ihrer Eröffnung am 9. Oktober2007 durch KulturstaatsministerBernd Neumann MdB haben sichdie Besuchszahlen deutlich erhöht.
und es wurde möglich, Alltagsat-mosphäre zu vermitteln. Die Umge-staltung dieses Bereiches begannmit den 1960er Jahren, die deutsch-landpolitisch und für die Umorien-tierung des Widerstandes Schlüs-seljahre waren. Bei einer Kategori-sierung der zweiten deutschenDiktatur in die Phasen der Herr-schaftsübernahme, der Herrschafts-sicherung, der voll funktionierendenHerrschaft und des Niedergangsgeht es in den Jahrzehnten nachdem Bau der Berliner Mauer umden Ausbau und die Funktion derDiktatur. Mit 1961 ist das Datum der„inneren Staatsgründung“ gege-ben, und am Ende dieses Zeitraumsgeht die DDR ihrem Zusammen-bruch in einer friedlichen Revolutionentgegen. All dies konnte in alltags-geschichtliche Zusammenhängezwischen Wohnen im Plattenbauund individueller Lebensgestaltung,zwischen Arbeitsalltag und Freizeit,eingebettet werden.Eine weitere Herausforderung
waren Erweiterung, Aktualisierungund inhaltliche Neugestaltung derAusstellungseinheit „Wege in dieGegenwart“. Dieser Bereich öffnetdie Ausstellung über die Wiederver-einigung hinaus bis in die Gegen-wart. Räumlich wurde dies durchdie Verlegung von Museums-Shopund Informations-Counter und derdamit erreichten grundsätzlichenVeränderung der Eingangssituationerreicht. Der Umzug von Parlament
30
man spricht Deutsch
Standort:
Bonn
12.12.2008–3.5.2009Besuche:
108.869Projektleitung:
Dr. Jürgen ReicheGestaltung:
Michael Hoffer
Die deutsche Band „Tokio Ho-tel“ gewann 2008 nicht nur einenMTV-Europe-Award, sie sorgte auchfür einen Ansturm auf Deutsch-kurse in Frankreich und Japan.Gleichzeitig diskutierten deutschePolitiker und die Öffentlichkeit, obdie deutsche Sprache ins Grundge-setz aufgenommen werden sollte.Die Stiftung Haus der Geschichteder Bundesrepublik Deutschlandging in einer Ausstellung über diedeutsche Gegenwartssprache denwidersprüchlichen Meinungen überdie deutsche Sprache und ihren ver-schiedenen Funktionen nach. In Zu-sammenarbeit mit dem DeutschenHistorischen Museum Berlin ent-standen zwei sich konzeptionell er-gänzende Ausstellungen. Währendsich „man spricht Deutsch“ in Bonnauf Phänomene der deutschen Ge-genwartssprache konzentrierte, botdie Ausstellung in Berlin unter demTitel „die Sprache Deutsch“ einenbreiten Überblick über die Ge-schichte der deutschen Spracheseit ihren Anfängen.Rund 500 Exponate luden in
Bonn zum Flanieren durch die deut-sche Gegenwartssprache ein – vomGrimmschen Wörterbuch und einerOriginal-Ausgabe des „Werther“ biszu kunstvoll im Unterricht verziertenReclam-Heften, von Videobotschaf-ten jugendlicher Musiker bis zumSMS-Kurztext. Medieninstallationenund interaktive Elemente machtenLust auf Deutsch und wurden be-
sonders von jungen Besuchern neu-gierig ausprobiert: Die Schönheitvon Sprache konnten sie in einemWald von Klangröhren erleben, amLiteraturautomaten gab es Lyrikfür einen geringen Preis und einSchreib-Roboter der freien Künstler-gruppe „robotlab“ verfasste Texteüber Sprache, deren Wortfolge dieMaschine aus einem Fundus vonBegriffen eigenständig und nacheinem Zufallsprogramm zusam-mensetzte.Szenen aus dem Spielfilm „Der
Pate“ waren in Sächsisch und an-deren deutschen Dialekten zuhören, weitere Film- und Tondoku-mente ließen Werbe-, Politik- undJugendsprache lebendig werden.Woher kommt die deutsche
Sprache? Was zeichnet sie aus?Wie verändert sich die Bedeutungvon Worten? Die Ausstellung „manspricht Deutsch“ gab Antworten aufdiese Fragen.Sprache ist „das“ Kommunikati-
onsmittel des Menschen. Sie ist zu-gleich Trägerin von Wissen undKultur, wie eine Bibliothek in derAusstellung verdeutlichte.„Was geht, Alter?“ – Sprache
verbindet, Sprache trennt, Spracheschafft Heimat und Integration:Jugendliche grenzen sich mit ihrereigenen Sprache immer neu vonder Erwachsenenwelt ab. Daranerinnerte ein „Kapitel“ über die„Jugendsprache“ und die Sprachejunger Migranten.
31
Wechselausstellungen
man spricht Deutsch
Sprache verändert sich – Der Ein-fluss von Anglizismen auf die deut-sche Sprache ist unüberhörbar.Stirbt die deutsche Sprache alsoaus? Augenscheinlich nicht: Über120 Millionen Menschen in allerWelt sprechen Deutsch, 17 Millio-nen Ausländer lernen derzeit unsereSprache, Deutsch ist innerhalb derEuropäischen Union die am häufigs-ten gesprochene Muttersprache.Und sie entwickelt sich weiter: LautDuden kommen jedes Jahr etwa1.000 Worte hinzu.
Sprache ist Klang – „Meinschönstes deutsches Wort ist Li-belle, weil ich Wörter mit demBuchstaben „L“ liebe und diesesWort sogar drei davon hat … Dasflutscht so auf der Zunge.“ Mitdieser Begründung gewann der9-jährige Sylwan Wiese den Kinder-wettbewerb für das schönste deut-sche Wort, den der deutscheSprachrat und das Goethe-Institut2004 ausgeschrieben hatten. Auchweitere „Lieblingswörter“ der Deut-schen wurden den Besuchern teils
Der Schreib-Roboterder Künstlergruppe„robotlab“ verfasste„Manifeste“ aus einemFundus von Begriffen,die er nach einemZufallsprogrammzusammensetzte.
32
großformatig gedruckt, teils akus-tisch präsentiert und regten zumNachdenken über das eigene„schönste Wort“ der Mutterspra-che an.Die Wahrnehmung der deut-
schen Sprache im Ausland war einweiterer Aspekt der Ausstellungund bot einen interessanten Einblickin die Wirkung des Deutschen aufandere Sprachen: So „wanderte“das deutsche Wort „Kaffeepause“
nach Finnland aus, wo es als „Kaf-feepaussi“ die Ruhezeiten einesBusfahrers an seinem Bus verkün-det. Ein Kompositum wie „Zeit-geist“ schaffte es sogar bis in dieWeltsprache Englisch. Gleichzeitigbereichern „eingewanderte“ Wör-ter die deutsche Sprache; die Her-kunft der mittlerweile in den all-täglichen Sprachgebrauch der meis-ten Deutschen übergegangenenWörter konnte der Besucher in derAusstellung ebenfalls erkunden.Eine Umfrage zum Lieblingsbuchder Deutschen, Rätsel zu verschie-denen Romananfängen und eine„Tausch-Bibliothek“ rundeten dieAusstellung ab. Ab Januar 2010 ist„man spricht Deutsch“ als Wander-ausstellung in vielen Goethe-Institu-ten im In- und Ausland zu sehen.Die ersten Stationen sind in Paris,Brüssel und Lissabon geplant. Esfolgen Barcelona, Madrid und Lyon.Der Schriftsteller Axel Hacke, der
sich in Büchern und Kolumnen viel-fältig mit der deutschen Spracheund ihrem Gebrauch beschäftigthat, eröffnete vor rund 700 Besu-chern die Ausstellung in Bonn. Inseiner Eröffnungsrede ging er hu-morvoll auf zahlreiche Wortbildun-gen im Deutschen ein, in derSprache von Kindern ebenso wie inder Sprache der Bürokratie. Gleich-zeitig machte er deutlich, welcherFormenreichtum in der deutschenSprache existiert und welche spie-lerischen Möglichkeiten sie bietet.
Sprache zum „Anfassen“:Die Wechselausstellung„man spricht Deutsch“präsentierte die SpracheDeutsch auf unterhaltsameWeise.
33
Wechselausstellungen
man spricht Deutsch
„(…) Ich spreche jetzt seit etwa 50 Jahren deutsch.Das ist eine ziemlich dauerhafte Beziehung, finde ich.Wie jede gute, interessante Beziehung ist sie span-nungsreich.
Mir geht es auf die Nerven, dass mein Sohn alles geilfindet, was ihm gefällt, aber dann denke ich an dasFeuilleton, das Kurt Tucholsky mal über das Wortknorke geschrieben hat, das vor dem Krieg in Berlinungefähr das war, was geil heute ist. Eines Tages,schrieb Tucholsky, sei es mit knorke zu Ende gegan-gen, ganz plötzlich. Auf einmal taumelte knorke,schrieb er, „durch die Wochen, die Rinnsteine schrienes sich noch mitunter zu, dann verfiel es sichtlich,wankte traurig umher, senkte das Haupt und war sogut wie verschieden“.
Niemand sagte mehr knorke, die Leute hatten knorkeplötzlich satt – und genau so wird es eines Tages mitgeil sein. Es wird die Sonne aufgehen, es wird einMorgen sein, und es wird kein geil mehr sein – unddas werde ich dann geil finden!
Ich finde es auch lächerlich, dass ich mich bei derBahn am Service Point nach dem nächsten Zug er-kundigen muss und bei der Telekom eine Hotline an-rufen darf, damit mir dann doch nicht geholfen wird.Aber dann denke ich an den Fernsehsender SAT1, dermal den Werbeslogan Powered by emotion hatte –und ihn abschaffte, als er merkte, dass die Leutedachten, das heiße Kraft durch Freude. (…) Ich ärgeremich jedes Mal aufs Neue über die unglaublicheSpracharmut, die Journalisten dazu bringt, zum hun-
dertmillionsten Mal einen Satz zu schreiben, wie„Wimbledon ist das Mekka der Tennisfreunde“ – aberdann denke ich an den schönen Text eines Kollegen,den das genauso störte. Und der deshalb im Streif-licht der Süddeutschen Zeitung behauptete, Mekkasei das Wimbledon der Moslems.
Man sieht: Wir sind wehrhaft. Wir können lachen.Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe deutsch ge-sprochen.
Viel Vergnügen in der Ausstellung. Sie ist super!,knorke!, geil! – na ja, also: hochinteressant.“
Auszug aus der Eröffnungsrede von Axel Hacke
Melodien für Millionen.
Das Jahrhundert des Schlagers
Standorte:
Bonn
9.5.–5.10.2008Besuche:
144.949Leipzig
22.11.2008–19.4.2009Besuche:
39.419Projektleitung:
Prof. Dr. Hanno SowadeGestaltung:
id3d-Berlin
Seit über hundert Jahren begeis-tert er Millionen von Menschen,er wird geliebt oder belächelt: derSchlager. Als Spiegel des Zeitgeis-tes zeigt er den Wandel von Gesell-schaft und Mentalität, reagiert aufpolitische und gesellschaftlicheStrömungen. Als kommerziellesMassenprodukt ist er mit seinenUmsätzen ein bedeutender Faktorin der Musik- und Unterhaltungs-branche. Die Wechselausstellung„Melodien für Millionen. Das Jahr-hundert des Schlagers“ ging demkomplexen Phänomen Schlager vonden Anfängen im 19. Jahrhundertbis in die Gegenwart nach.
Die Ausstellung zeigte über1.500 Exponate und gab den Besu-chern an großen Plattentischen Ge-legenheit, aus über 1.000 Schlagernihre Favoriten per Touchscreen aus-zuwählen und anzuhören. Unter denHighlights der Ausstellung befan-den sich neben dem gläsernen Flü-gel von Udo Jürgens und CaterinaValentes perlenbesetztem Kostümaus der Perry-Como-Show auchHandschuhe und Schmuck von Li-lian Harvey und der Motorroller vonCornelia Froboess. Ausschnitte vonSchlagerfilmen, die in einem Kino zusehen waren, ergänzten die multi-mediale Präsentation.
34
Wechselausstellungen
Melodien für Millionen.
Das Jahrhundert des Schlagers
Götz Alsmann eröffnete die Aus-stellung am 8. Mai 2008 in Bonn inAnwesenheit vieler Prominenteraus dem Showgeschäft: Unter denGästen waren Schlagerstars wieHeino, Stefanie Hertel, FlorianSilbereisen, Tom Astor und DieterThomas Kuhn sowie „ZDF-Hitpara-de“-Moderator Dieter Thomas Heckund Produzent Hans Beierlein.Die unterschiedlichen Schwer-
punkte der Ausstellung wurden aufBühnen präsentiert, die sich auf ein-zelne Zeitabschnitte konzentrierten.Die Außenseiten der Bühnen warenals Kulissen gestaltet und beleuch-teten politische, gesellschaftliche
und wirtschaftliche Aspekte sowiedie jeweiligen technischen Beson-derheiten der Zeitabschnitte. DerEinfluss von Fernsehen, digitalenDatenträgern und des Internets aufdie Entwicklung des Schlagers undseiner Stars standen dabei ebensoim Mittelpunkt des Interesses wiedie Anfänge der Verbreitung überdie Schallplatte und im Rundfunk.Der innere Bühnenraum präsen-
tierte die musikalische und emotio-nale Seite des Schlagers, wichtigeStars und Themen wie Heimat,Fernweh, Sozialkritik, Frieden undLiebe, die weitgehend zeitübergrei-fend sind.
Prominente Gästekamen zur Eröffnungvon „Melodien fürMillionen“: darunterHannelore Krammund ihr Mann Heino,Stefanie Hertel, HansBeierlein, Götz Als-mann, Jürgen Drews,Dieter Thomas Heckund Florian Silbereisen(v.l.n.r.).
35
36
Die einzelnen Bühnen boten eineZeitreise durch das Jahrhundert desSchlagers: Nach den Anfängengegen Ende des 19. Jahrhundertserlebte die Schlagermusik in derWeimarer Republik ihren ersten Hö-hepunkt und erfuhr durch die Me-dien Schallplatte, Rundfunk undFilm eine weite Verbreitung. Die be-sondere Rolle des Schlagerstarswurde am Beispiel Lilian Harveysdeutlich: Die Interpreten der Schla-ger nehmen seit Anfang der 1920erJahre eine herausragende Stellungals Idole des Publikums ein. Texterund Komponist treten hinter denSchlagerstar zurück.Die nationalsozialistische Pro-
paganda versuchte, den Schlagersystemstabilisierend einzusetzen.Neben der bunten, fröhlichen Seitedes Schlagers blickte die Ausstel-lung in diesem Kontext auch aufAusgrenzung, Vertreibung und Er-mordung jüdischer Schlagerkompo-nisten und das Verbot ihrer Werke.Fünf weitere Bühnen präsentier-
ten die Geschichte des Schlagersvom Ende des Zweiten Weltkriegsbis in die Gegenwart: In der unmit-telbaren Nachkriegszeit griffenSchlager und Heimatfilm die Sehn-sucht nach der „heilen Welt“ auf. Inden 1960er Jahren verdrängte dasFernsehen zunehmend das Kinound die Musikboxen in den Gast-stätten, der Schlager zog sich in denprivaten Raum zurück. Die „weicheWelle“ setzte ein Gegengewicht zu
den politischen Umwälzungen derZeit.Dieter Thomas Heck, der mit der
ZDF-Hitparade Fernsehgeschichteschrieb, entführte die Besucherauf einer großen Showtribüne indie schillernde Schlager-Welt der1970er Jahre. An mehreren audiovi-suellen Stationen hatten BesucherGelegenheit, sich Ausschnitte ausder Hitparade anzusehen und anzu-hören. Das SED-Regime versuchtein den Nachkriegsjahren vergeblich,einen eigenen „sozialistischenSchlager“ zu schaffen. In der Aus-stellung wurde der Einfluss westli-cher Schlagermusik deutlich. Mitpopulären Sendungen wie „Ein Kes-sel Buntes“ gelang es dem DDR-Fernsehen, den Schlagersendungenvon ARD und ZDF Konkurrenz zumachen. Schlagerstars wie FrankSchöbel wurden in den 1970er Jah-ren auch in der Bundesrepublik be-kannt.Mit der zunehmenden Verbrei-
tung englischsprachiger (Rock)-Musik seit Ende der 1960er Jahregeriet der Schlager in die Krise. Ergalt zunehmend als Musik eines al-ternden Publikums.Blödelschlager und „Neue Deut-
sche Welle“ zeugten in den 1980erJahren von einer Krise des Schla-gers, der sich neu orientierenmusste. Unterschiedliche Entwick-lungen charakterisieren den Schla-ger seit den 1990er Jahren: DieterThomas Kuhn und Guildo Horn sorg-
Foto oben:Ein Publikumsrenner:die Plattentische, andenen Besucher ihrepersönlichen Favoritenselbst auswählen undanhören konnten.
Foto unten:Eine Showbühne mitMultimediastationenlud zum Anschauen derZDF-Hitparade und zumMitsingen ein.
37
Wechselausstellungen
Melodien für Millionen.
Das Jahrhundert des Schlagers
ten für ein Revival des Schlagers,der durch Wettbewerbe wie denEurovision Song Contest gefördertwird. Deutschsprachige Texte sindwieder verstärkt im Rundfunkzu hören. Volkstümliche Schlager,Volksmusiksendungen und -showserreichen seit Jahren ein Millionen-publikum.
Leipzig
Nach ihrer erfolgreichen Präsen-tation in Bonn wurde die Wechsel-ausstellung vom 22. November2008 bis zum 19. April 2009 auch imZeitgeschichtlichen Forum Leipzigmit großer Resonanz gezeigt.Frank Schöbel, der in besonderer
Weise für die Entwicklung desSchlagers in der DDR steht, sangfür die Gäste des Eröffnungs-abends, darunter Julia Axen undKomponist Walter Eichenberg. JuliaAxen und Frank Schöbel warenauch mit Exponaten in der Ausstel-lung vertreten.Neu in Leipzig präsentiert wurde
eine Vitrine, die sich dem LeipzigerSchlagerstar Hans-Jürgen Beyerwidmete. Darin zu sehen warenu. a. die beiden 1976 und 1978 beimWorld Popular Festival in Tokyo er-rungenen Hauptpreise sowie derAnzug, mit dem der ehemaligeChorknabe des Leipziger ThomanerChores in Dieter Thomas HecksZDF-Show „Musik liegt in der Luft“
aufgetreten war. Ebenfalls neu ein-gefügt in die DDR-Ausstellungsein-heit war eine mit Fotos, Plakatenund Programmheften gestalteteWand zu zentralen Orten des Schla-gers im Osten Deutschlands: dem(alten wie neuen) Friedrichstadtpa-last in Ost-Berlin, dem Haus der Hei-teren Muse in Leipzig und demDresdner Kulturpalast, in dem von1971 bis 1988 das InternationaleSchlagerfestival der DDR stattfand.
DDR-Schlagerstar FrankSchöbel eröffnete dieAusstellung in Leipzig.
38
Skandale
in Deutschland nach 1945
Standorte:
Bonn
12.12.2007–24.3.2008Besuche:
105.166Leipzig
7.5.–12.10.2008Besuche:
25.179Projektleitung:
Dr. Andrea MorkGestaltung:
Büro Manfred SchulzArchitektur und Design Hamburg
Affären und Skandale beschäfti-gen die Menschen weltweit. KeinTag vergeht, ohne dass vermeintli-che oder wirkliche Skandale – meistüber die Medien – aufgedeckt wer-den und für allgemeine Erregungund Gesprächsstoff sorgen. Mit Er-scheinungsformen und Wirkungs-mechanismen von Skandalen inDeutschland setzte sich die Stiftungin ihrer Ausstellung „Skandale inDeutschland nach 1945“ auseinan-der. Sie gab exemplarisch Auf-schluss über Wandlungsprozesseder politischen Kultur in der Bun-desrepublik Deutschland und be-leuchtete die Reaktionsweisen derÖffentlichkeit, das gesellschaftlicheWertesystem und die Rolle der Me-dien. Ein besonderes Augenmerk
galt den öffentlichkeitswirksamenFolgen dieser Ereignisse.Der Ausstellung zugrunde lag ein
Skandalbegriff, der sich vom um-gangssprachlichen Gebrauch desWortes löste: Als Skandal im Sinnder Ausstellung waren Verfehlun-gen definiert, die im Zuge ihrer Ent-hüllung eine weithin empfundene,öffentliche Empörung auslösen.Erst sie macht den Missstand zumSkandal.Die Medien spielen dabei eine
wichtige Rolle. Sie sorgen für hoheAufmerksamkeit, profitieren aberauch ökonomisch von der Bericht-erstattung. Als Mittel im politischenMachtkampf dienen Skandale oftder Diskreditierung politischer Geg-ner. Die Wirkung des Skandals istumstritten: Zum einen lernen Ge-sellschaften mit Hilfe von Skandalenihr Normsystem weiter zu entwi-ckeln und Handlungsrichtlinien zuüberprüfen; zum anderen könnensie das Vertrauen in Eliten und Insti-tutionen untergraben, sind oft ober-flächlich und kurzatmig.In einer Gesellschaft ohne un-
abhängige Öffentlichkeit kann esdaher keine Skandale in diesemSinn geben. Deshalb berücksich-tigte die Ausstellung für die DDRlediglich die Fälschung der Kommu-nalwahlen 1989, um den Skandalals Krisenphänomen in einer Dikta-tur zu beschreiben, deren Machtge-füge schon sichtbare Risse aufwies.Diese wurden durch die öffentliche
39
Wechselausstellungen
Skandale in Deutschland nach 1945
Kritik der Gegner des SED-Regimesweiter vertieft.An 20 ausgewählten Einzelfällen
zeigte die Stiftung die Ereignisse inihrem jeweiligen historischen Kon-text und verdeutlichte die Eigenar-ten dessen, was den Skandal alsgesellschaftliches Phänomen aus-macht. Der Gang durch die Ausstel-lung ging dem Wandel moralischerund ethischer Werte nach, wobeidie Skandale als Kristallisations-punkte gesellschaftlicher Verände-rungsprozesse erschienen.Die Skala der anhand dieser
Kriterien ausgewählten Beispielereichte vom Protest gegen den Film„Die Sünderin“ 1951, in dem die ka-tholische Kirche eine „Verletzungdes sittlichen Empfindens“ sah, biszum Fall Mannesmann/Vodafone,bei dem im Jahr 2000 im Zuge derFirmenübernahme gezahlte Sonder-prämien zum Stein des Anstoßeswurden. Der Fall der Skandalisie-rung der „Sünderin“ beleuchteteexemplarisch das gesellschaftlicheWertesystem der Nachkriegszeit.Sterbehilfe, Selbstmord, Prostitu-tion und wilde Ehe: Jedes derMotive war ein hochgradiges Reiz-thema, deren Summe die tabubre-chende Wirkung noch verstärkte.Der Film wollte mit konventionellenDenkmustern seiner Zeit brechenund traf auf eine Öffentlichkeit, dieAngst vor einer Erschütterung dergerade erst wiedergewonnenen all-gemeinen Übereinkunft über „Sitte
und Moral“ hatte. Die Empörungüber die Nacktszene spielte zu-nächst eine untergeordnete Rolle.Ein weiteres Augenmerk der
Ausstellung richtete sich darauf,welche nachhaltige Wirkung Skan-dale durch die Reaktionsweisen derÖffentlichkeit auf gesellschaftliche
Foto Seite 38:Filmplakat von 1958
Foto Seite 39:Dem „GladbeckerGeiseldrama“ war einSkandalfall gewidmet,der die Rolle derMedien kritischbeleuchtete.
40
Handlungsrichtlinien haben. AmBeispiel der Übernahme von Man-nesmann durch Vodafone wurdendie weitreichenden Konsequenzeneines Skandals exemplarisch für
den Besucher aufgearbeitet. So wares sicherlich kein Zufall, dass derDeutsche Bundestag 2005 in un-mittelbarer zeitlicher Folge desMannesmann/Vodafone-Skandalsein Gesetz zur Offenlegung der Be-züge von Vorstandsmitgliedern bör-sennotierter Aktiengesellschaftenverabschiedete. In diesen Kontextdes Wechselspiels zwischen Fakto-ren und Konsequenzen eines Skan-dals stellte die Ausstellung auch dieimmer bedeutender werdendeRolle der Medien. Der Vergleich derbeiden herausragenden Politikskan-dale, der „Spiegel“-Affäre und desFlick-Skandals, ließ wie in einemBrennglas die gesellschaftlichenVeränderungen in der Bundesrepu-blik Deutschland sichtbar werden.Die „Spiegel“-Affäre veränderte daspolitische Klima: Sie gilt als Ge-burtsstunde einer durchsetzungsfä-
Skandale in der Wechselausstellung:
„Die Sünderin" Flick-AffäreTheodor Oberländer Neue HeimatRosemarie Nitribitt Hitler-TagebücherContergan Barschel-Pfeiffer-Affäre„Spiegel“-Affäre Philipp Jenningers Gedenkrede„Der Stellvertreter“ Gladbecker GeiseldramaStarfighter/Lockheed Memminger AbtreibungsprozessKlarsfeld-Ohrfeige Kommunalwahlen in der DDRBundesligaskandal Amigo-AffäreHormonskandale Mannesmann/Vodafone
Projektleiterin AndreaMork (l.) erläutert Eröff-nungsredner WolframWeimer, Chefredakteurdes Magazins Cicero(2.v.l.), und den Bundes-ministern a. D. NorbertBlüm (4.v.l.) und HansFriedrichs (6.v.l.) Einzel-heiten zum Skandal umRosemarie Nitribitt.
41
Wechselausstellungen
Skandale in Deutschland nach 1945
Leipzig
Nach der Präsentation im Hausder Geschichte war die Ausstellungim Zeitgeschichtlichen Forum Leip-zig zu sehen. Der Präsident derStiftung Haus der Geschichte, HansWalter Hütter, sprach zur Eröffnungmit dem Journalisten Stefan Wel-teke von der Wochenzeitung DIEZEIT über das Thema „Skandale“.Das Gespräch konzentrierte sich vorallem auf die Rolle der verschiede-nen Medien bei der Enthüllung von
Skandalen. Nur wenige Presse-organe hätten die erforderlicheMacht, Infrastruktur sowie perso-nelle und finanzielle Ausstattung,um im Zuge von zum Teil sehr auf-wändigen Recherchen Skandaleaufzudecken und das Thema überlängere Zeit weiter zu verfolgen.Von besonderem Interesse war dasThema Skandalisierung der ge-fälschten Kommunalwahlen in derDDR am 7. Mai 1989. DIE ZEIT zumBeispiel berichtete in ihrer Ausgabevom 12. Mai 1989 auf Seite 1 überdie Aufdeckung des Wahlbetrugs,danach aber rückte das Thema zu-nächst wieder in den Hintergrund.
higen liberalen Öffentlichkeit und alsSchlüsselereignis für das Wächter-amt der Presse als vierter Gewalt.Wie sehr dies die Rolle der Medienals „Skandalisierer“ prägte, de-monstrierte die Ausstellung am Bei-spiel der Flick-Affäre, in der diePresse diese Rolle ganz selbstver-ständlich einnahm. Welche zweifel-hafte Rolle viele Medien im„Gladbecker Geiseldrama“ spielten,wurde bei der Darstellung diesesSkandals deutlich. Hier agiertenJournalisten auf der Jagd nachExklusivinformationen und -bildernnicht als Aufklärer, sondern mach-ten sich zu (Mit)-Agierenden und be-hinderten die Polizeiarbeit.Die Wechselausstellung lud an-
hand der ausgewählten 20 Einzel-fälle den Besucher dazu ein, sichselbst ein Urteil über die Wirkungvon Skandalen zu machen.
Die Titelgeschichte desSPIEGEL beschäftigtesich 1971 mit demBundesligaskandal.
Das Boot
Geschichte. Mythos. Film
Standort:
Bonn
16.11.2007–24.2.2008Besuche:
108.118Projektleitung:
Dr. Jürgen ReicheGestaltung:
„Das Boot Revisited“
„Das Boot“ war einer der erfolg-reichsten und umstrittensten deut-schen Filme. Die Produktion nacheiner Romanvorlage von Lothar-Günther Buchheim wurde für sechsOscars nominiert. Die strapaziösenDreharbeiten, der technische Auf-wand und die hohen Produktions-kosten von 25 Millionen D-Mark(1981) haben den Film zur Legendegemacht. Gelobt wurden besondersdie schauspielerischen Leistungen,die Filmmusik und die Kamerafüh-rung. Mit 5,8 Millionen Besucherngehört „Das Boot“ bis heute zu denzehn erfolgreichsten deutschen Fil-men. Der Spielfilm, von dem eseine Kinofassung und eine umfang-reichere Fernsehversion gibt, zeigt
in packenden Bildern eine Gruppevon Menschen unter extremen Be-dingungen in einem Wechsel ausbeklemmender Ruhe und dramati-schen GefahrensituationenIn Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Filmmuseum Frankfurt/Main, dem Autorenteam „Das BootRevisited“ und der Bavaria FilmGmbH ermöglichte das Haus derGeschichte seinen Besuchern einenfaszinierenden Blick hinter die Kulis-sen des erfolgreichen und zugleichumstrittenen deutschen Films.Unter den rund 300 Exponatenwaren der imposante U-Boot-Turm,Kostüme und Requisiten sowieein 2,5 Meter langes Gesamtmodellder „U 96“ zu sehen.
42
43
Wechselausstellungen
Das Boot
Geschichte. Mythos. Film
Für die Ausstellung wählte dasAutorenteam „Das Boot Revisited“Material aus über 130 StundenInterviews mit Schauspielern unddem Filmteam aus. Aus derMontage von Statements, Filmaus-schnitten und vielen unveröffent-lichten Film- und Fotodokumentenentstand ein Stück erzählter Filmge-schichte.Die Ausstellung konzentrierte
sich jedoch nicht allein auf den Film,sie lenkte den Blick auch auf dieRomanvorlage von Lothar-GüntherBuchheim und den historischenKontext. Der 1973 erschieneneRoman schildert das wechselhafteGeschick von „U 96“ und seinerBesatzung unter KapitänleutnantHeinrich Lehmann-Willenbrock aufihrer „7. Feindfahrt“ im Herbst1941. Die authentische Schilderungdes Lebens an Bord des U-Bootes,die auf Buchheims persönlichenErfahrungen basiert, zeichnet dasBild eines aussichtslosen Kampfes,in dem die „einfachen“ SoldatenOpfer einer rücksichtslosen, fanati-schen Führung werden. Den inter-nationalen Erfolg des in vieleSprachen übersetzten Romans do-kumentierte die Ausstellung ebensowie das kontroverse Medienechoauf die Premiere des Films vonWolfgang Petersen.Ergänzt wurde die Ausstellung
im Haus der Geschichte durch einefundierte Dokumentation des U-Boot-Kriegs, welche die Lücken zwi-
schen medialer Darstellung und dentatsächlichen Ereignissen schloss.Zu Beginn des Zweiten Weltkriegsknüpfte die deutsche Seekriegslei-tung militärisch und ideologischan die Vorbilder der kaiserlichen Ma-rine an. Porträtdarstellungen aufPostkarten, Plaketten oder Gedenk-tellern dokumentieren die Helden-verehrung hochdekorierter U-Boot-Kommandanten des Ersten Welt-kriegs. Viele Offiziere der kaiserli-chen Marine wirkten in den 1930erJahren am Neuaufbau der Flotteunter ihrem Befehlshaber Karl Dö-nitz mit. Eine strategische Denk-schrift der Seekriegsleitung vom15. Oktober 1939 bezeichnete Eng-
Foto Seite 42:Eine fundierteDokumentation des„realen“ U-Boot-Kriegsergänzte die medialeDarstellung im Film.
Foto Seite 43:Eingang zur Foyeraus-stellung „Das Boot –Geschichte. Mythos.Film“: Die Ausstellungs-gestaltung lehnte sichan die Form einesU-Bootes an.
44
land als Hauptkriegsgegner, der anseiner verwundbarsten Stelle, demSeehandel, zu bekämpfen sei. Ne-ben der Luftwaffe sollten vor allemauch U-Boote „mit der zur Erzielungdes Erfolges erforderlichen Schärfe“eingesetzt werden. In der Nachtvom 13. zum 14. Oktober 1939 ge-lang es „U 47“ unter dem Kom-mando von Günther Prien, in den
stark gesicherten Hauptstützpunktder britischen Flotte Scapa Flow imNorden Schottlands einzudringenund dort das Schlachtschiff RoyalOak zu versenken.Die nationalsozialistische Propa-
ganda überhöhte die Leistungen derBesatzungen, die sich als militäri-sche Elite fühlten, und inszenierte inWochenschaubeiträgen und Zeit-
Originalrequisiten ausdem Film wurden durchKommentare vonSchauspielern und Mit-gliedern der Filmcrewan zahlreichen Multime-diastationen ergänzt.
45
Wechselausstellungen
Das Boot
Geschichte. Mythos. Film
schriften einen Heldenkult um viel-fach ausgezeichnete „U-Boot-Asse“wie Günther Prien, Erich Topp oderJoachim Schepke mit dem Ziel, Frei-willige für die U-Bootwaffe zugewinnen. Spiele wie „Mit Priengegen England“ sollten die Begeis-terung Jugendlicher für das ver-meintlich abenteuerliche Leben derU-Bootfahrer wecken.Regimekritisches Verhalten wur-
de hingegen mit unerbittlicher Härteverfolgt, wie zahlreiche biografischeZeugnisse zum Fall des OffiziersOskar Kusch, Kommandant vonU 154, belegen. Er hatte den deut-schen Sieg in Zweifel gezogen undin der Offiziersmesse ein Hitlerpor-trät gegen eine selbst gefertigteZeichnung ausgetauscht. Kuschwurde von seinem Ersten Offizierverraten, im Januar 1944 verhaftetund wegen „Zersetzung der Wehr-kraft“ verurteilt. Das Oberkomman-do der Kriegsmarine verweigertedie Begnadigung des mit demEisernen Kreuz ausgezeichnetenOffiziers. Oskar Kusch wurde am12. Mai 1944 in Kiel hingerichtet.Das in Auszügen präsentierte
„Kriegstagebuch des Befehlshabersder Unterseeboote“ verzeichnet Ver-senkungen gegnerischer Schiffeund Verluste eigener Boote. „Ton-nagewimpel“, die nach erfolgreicher„Jagd“ beim Einlaufen in den Hafengeflaggt wurden, verkündeten An-zahl und die jeweiligen Bruttore-gistertonnenzahlen der zerstörten
Schiffe. Tabellen und Kurvendia-gramme fassten die längerfristigenEntwicklungen – Erfolge und Miss-erfolge – des U-Boot-Kriegs über-sichtlich zusammen.
Demgegenüber vermitteltenFotografien, Augenzeugenberichteund biografische Dokumente ausenglischen und deutschen Archiveneinen Eindruck von der bedrücken-den Enge an Bord eines U-Boots,der ohnmächtigen, stummen Angstder Mannschaften bei Wasserbom-benangriffen und den schrecklichenFolgen der Torpedierungen.Die genauen Zahlen der getöte-
ten alliierten Soldaten, Seeleute undPassagiere bei deutschen U-Boot-Angriffen lassen sich nicht mehr
ermitteln. Allein die britische Han-delsmarine verlor während desZweitenWeltkriegs mehr als 32.000Seeleute.Auf Grund der technischen Über-
legenheit und verbesserten Abwehrder Alliierten nahmen ab 1943 dieVerluste auf deutscher Seite massivzu. Sie waren prozentual so hochwie bei keiner anderen Waffengat-tung. Mindestens 28.000 von ins-gesamt etwa 45.000 U-Bootfahrernkamen ums Leben.Begleitet von den Durchhaltepa-
rolen der Seekriegsleitung kämpftendie Besatzungen, die sich bis zumSchluss mehrheitlich aus Freiwilli-gen rekrutierten, bis zur Kapitulationweiter.
Zur Eröffnung spielteKlaus Doldinger mitseiner Band „Passport“noch einmal die von ihmkomponierte Filmmusik.
46
Heimat und Exil.
Emigration der deutschen Juden
nach 1933
Standorte:
Bonn
17.3.–7.10.2007Besuche:
94.036Leipzig
14.12.2007–30.3.2008Besuche:
19.104Projektleitung:
Dr. Christian PetersGestaltung:
Architekturbüro Schaal, AttenweilerHans-Dieter Schaal, Armin Teufel,Janet Görner
Der erzwungene Exodus derdeutschen Juden nach 1933 wardas Thema einer großen Aus-stellung der Stiftung Haus derGeschichte der BundesrepublikDeutschland und des JüdischenMuseums Berlin. Erstmals wurdedie Emigration von rund 280.000deutschen Juden in über neunzigLänder auf fünf Kontinenten in einerGesamtschau gezeigt. Die Ausstel-lung zeichnete anhand einzelnerSchicksale die Phasen der Flucht-vorbereitung, bürokratische Hürden,die ersten Jahre in den Aufnahme-ländern und vor allem das ambiva-lente Gefühl der „Heimat“ nach. Sieberichtete von Kindertransportennach Großbritannien, von der zu-nächst nur schleppend anlaufendenEmigration nach Palästina und vonungewöhnlichen Emigrationsortenwie der chinesischen HafenstadtShanghai. Mit reichem biografi-schen Material und vielen Film- undHörstationen fragte die Ausstellungnach der emotionalen und geografi-schen Heimat zwischen Alltag, An-passung und Integration.
Mit über 1.000 Exponaten er-zählte „Heimat und Exil“ von Ver-folgung und systematischer Aus-plünderung durch die Nationalsozia-listen, von Reisewegen in eineungewisse Zukunft, von denSchwierigkeiten, sich eine neue ma-terielle Grundlage zu schaffen undsich an eine fremde Umgebung zugewöhnen. Karteikarten des Briti-schen Hilfskomitees dokumentier-ten die Angaben der gut 10.000jüdischen Kinder, die im Rahmender Kindertransporte 1938–1939nach Großbritannien kamen. Er-gänzt wurden diese durch sehrpersönliche Briefe und Gedichte,die Eltern in letzter Minute ihrenKindern mitgaben. Sie ließen denBesucher erahnen, welche Unge-wissheit die jungen Emigranten aufihrer Reise begleitete.Die antisemitische Vertreibungs-
politik der Nationalsozialisten undder bürokratische Hürdenlauf, andem jede Emigration ihren Aus-gangspunkt hatte, standen am Be-ginn der Ausstellung. Dann richtetesich der Blick auf die ersten Flucht-
47
Wechselausstellungen
Heimat und Exil.
Emigration der deutschen Juden nach 1933
und Transitländer wie die Tschecho-slowakei, die Niederlande undFrankreich. In der Hoffnung, baldwieder nach Deutschland zurück-kehren zu können, fühlten sich dieEmigranten in der Anfangszeit dernationalsozialistischen Herrschaft indiesen Ländern sicher. Die erneuteFlucht begann, als auch diese Län-der von der Wehrmacht besetzt
wurden. So standen im Mittelpunktder Ausstellung die Länder, indenen die meisten deutschenJuden letztlich Zuflucht fanden:Großbritannien, USA, Palästina undeinige lateinamerikanische Staaten.Palästina als damals britisches Man-datsgebiet unterschied sich vonallen anderen Aufnahmeländern da-durch, dass zionistische Organisa-
Foto Seite 46:Glücksfall: Schrank-koffer von Herbert undUrsula Lebram – 1941in Berlin bei einer Spedi-tion vor der Flucht ein-gelagert, bekam ihn dasEhepaar nach dem Kriegunversehrt zurück.
Foto Seite 47:Ankunft in der Fremde:Zwei Kinder vor der Türihrer zukünftigen Gast-eltern in New York City,Juli 1943
48
tionen die jüdische Einwanderungins Land förderten. Die Juden ausDeutschland, „Jekkes“ genannt,wurden ausdrücklich nicht als Exi-lanten, sondern als zukünftige Bür-ger eines angestrebten jüdischenNationalstaates betrachtet. So auchAndreas Meyer, dessen Lebens-und Reiseweg die Besucher in der
Ausstellung nachvollziehen konn-ten: Er floh mit seiner Familie 1937nach Palästina und eröffnete in Na-hariya mit seinem Bruder eineSchlosserei und einen Fahrradver-leih.Mit 120.000 bis 130.000 jüdi-
schen Immigranten aus Deutsch-land waren die USA das beliebteste
49
Wechselausstellungen
Heimat und Exil.
Emigration der deutschen Juden nach 1933
Auswanderungsland; wie unter-schiedlich die Reisewege in das„Land der unbegrenzten Möglich-keiten“ waren, dokumentierte dieAusstellung anhand einzelner Bio-grafien bekannter wie unbekannterFlüchtlinge. Ein Beispiel war Prof.W. Michael Blumenthal, der heutigeDirektor des Jüdischen MuseumsBerlin, der mit seinen Eltern nachShanghai floh und später zumUS-Finanzminister aufstieg. KurtRoberg aus Celle, der 1938 überRotterdam in die USA gelangte, tratwie viele junge Flüchtlinge in dieamerikanische Armee ein, umgegen Hitler-Deutschland zu kämp-fen. Nach dem Krieg beteiligte ersich am Foto-Unternehmen einesBekannten aus Celle und wurde Ge-schäftsführer.Auch die chinesische Metropole
Shanghai fand in der AusstellungBeachtung. Sie wurde nach 1938zur letzten Zuflucht für jüdischeEmigranten aus Deutschland, danoch bis 1941 eine Einreise ohneVisum möglich war.Die Ausstellung thematisierte
die zwiespältigen Gefühle, welchedie Flüchtinge begleiteten: Erleich-terung über das Entkommen, aberauch Trauer über den Verlust derHeimat und Angst vor einer unge-wissen Zukunft. Der vergleichs-weise kleinen Zahl jüdischerEmigranten, die nach 1945 nachDeutschland zurückkehrten, wid-mete die Ausstellung einen eigenen
Teil. Es waren nur wenige, dieDeutschland noch als „Heimat“sahen. Das Leitmotiv der Ausstel-lung, die Frage nach der Heimat,bekam für diese „Rückkehrer“ einebesondere Bedeutung.
Leipzig
Mit einer beeindruckenden Redeeröffnete der Historiker und Publi-zist Dr. Rafael Seligmann am 13. De-zember 2007 in Leipzig die Aus-stellung. Seine nachdenklichen,aber auch kritisch an die deutscheÖffentlichkeit gerichteten Ausfüh-rungen standen im Zentrum dergut besuchten Eröffnungsveranstal-tung, die musikalisch vom LeipzigerSynagogalchor umrahmt wurde.
Foto Seite 48:Projektleiter ChristianPeters (M.) beim Rund-gang mit Journalisten
Foto Seite 49:Der LeipzigerSynagogalchor sangzur Eröffnung derAusstellung in Leipzig.
50
drüben. Deutsche Blickwechsel
Standorte:
Bonn
8.12.2006–9.4.2007Besuche:
68.335Leipzig
31.5.–9.10.2007Besuche:
32.249Projektleitung:
Dr. Anne MartinGestaltung:
Prof. Jan Fiebelkorn-Drasen,Potsdam
Zwei Chronisten deutsch-deut-scher Stimmungslagen, der Fern-sehjournalist und SchriftstellerDieter Zimmer sowie der Dreh-buchautor und Regisseur WolfgangMenge („Ein Herz und eine Seele“),eröffneten gemeinsam am 30. Mai2007 im Zeitgeschichtlichen ForumLeipzig die Wechselausstellung„drüben. Deutsche Blickwechsel“.Mit einer ebenso nachdenklichenwie amüsanten Bestandsaufnahmeder Befindlichkeiten zwischen„Ossis“ und „Wessis“ in Vergan-genheit und Gegenwart unterhiel-ten sie fast 300 Gäste.Mit mehr als 1.300 Objekten, für
die Präsentation im Zeitgeschichtli-chen Forum noch einmal ergänzt,erinnerte „drüben. Deutsche Blick-wechsel“ an Verbindendes undTrennendes im vielschichtigen Ver-hältnis von West- und Ostdeut-schen in den Jahrzehnten derTeilung und ging auch auf Erfahrun-gen und Vorurteile ein, die auf dasinnerdeutsche Klima seit der Wie-dervereinigung einwirken. Im Mit-telpunkt der stark alltags- undmentalitätsgeschichtlich ausgerich-teten Schau standen private, indivi-duelle oder halboffizielle Verbindun-gen und Sichtweisen, veranschau-licht an prägnanten, vor allem bio-grafischen Beispielen.Die inhaltlichen Schwerpunkte
der Ausstellung folgten den Fragen,welche Begegnungsmöglichkeitendie Deutschen aus DDR und Bun-
desrepublik hatten, welche Bildersie vom jeweiligen „drüben“ entwi-ckelten und wie sich innerer Zu-sammenhalt und Entfremdungäußerten. Hatte in der Bundesrepu-blik in den 1950er Jahren noch dasGedenken an die „Brüder undSchwestern im Osten“ im öffentli-chen Raum eine große Rolle ge-spielt, so richtete sich seit Mitte der1960er Jahre eine wachsendeMehrheit im westdeutschen Provi-sorium ein. Das Interesse für denanderen deutschen Teilstaat – seineMenschen, Städte, Landschaften,historischen Orte – nahm ab. DasThemaWiedervereinigung verlor zu-sehends an Bedeutung, der Kreisderer, die in der Hoffnung auf die
51
Wechselausstellungen
drüben. Deutsche Blickwechsel
Einheit etwas Rückständiges, wennnicht gar Anrüchiges sahen, wurdegrößer. Gleichzeitig veränderte sichdie Wahrnehmung der politischenVerhältnisse „drüben“. Für dieWestdeutschen verbanden sich mitdem SED-Staat zwar nach wie vorUnfreiheit und Mangelwirtschaft.Bei Umfragen fand aber auch ver-stärkt die These Zustimmung, dieDDR böte interessante Alternativen– etwa im Hinblick auf die sozialeAbsicherung der Bevölkerung, beiFragen der Gleichberechtigung, inder Erziehung oder auch der Sport-förderung. Die Begeisterung man-cher für ein vermeintlich fort-schrittlicheres System führte aberso gut wie nie zu dem Wunsch,
„nach drüben zu gehen“, oder zueiner besonderen Zuneigung für dieOstdeutschen. Viele Westdeutscheohne familiäre Bindungen in dieDDR hatten mit der ostdeutschenGesellschaft kaum noch Berüh-rungspunkte.Ganz anders blickte die Mehrheit
der Ostdeutschen nach „drüben“.In vielerlei Hinsicht bezogen sich dieMenschen in der DDR auf den fürsie anderen Teil Deutschlands undwussten auch weit mehr über dasLeben im Westen, als dies umge-kehrt der Fall war. Die Pakete ausdem Westen prägten ihr Bild vom„Wirtschaftswunderland“ Bundes-republik entscheidend mit. Besuchevon „drüben“ – jede zweite Familie
Foto Seite 50:Drehbuchautor undRegisseur WolfgangMenge eröffnete dieAusstellung in Leipzig.
Foto Seite 51:Originalexponat:Warnschild an der inner-deutschen Grenze
52
in der DDR hatte Westverwandte –und von 1964 an die jährlich eineMillion Rentnerreisen in die Bun-desrepublik bewirkten, dass die vonder SED verbreiteten Zerrbilder vomWesten bei der breiten Bevölkerungauf wenig Zustimmung stießen. ImGegenteil: Die antiwestliche Propa-ganda ihrer politischen Führungführte bei vielen Ostdeutschen eherzu einer Idealisierung der Verhält-nisse in der Bundesrepublik. Derseit den späten 1960er Jahren vorallem durch den Empfang des„Westfernsehens“ ermöglichteständige Blick nach „drüben“ ließdie Ostdeutschen nicht nur die poli-tischen Systeme vergleichen, son-dern beeinflusste sie stark in ihrenVorlieben und Alltagsgewohnheiten.Sie orientierten sich an westdeut-scher Mode, Kunst, Popmusiksowie Konsum- und Reiseverhalten.Gleichsam als „Zaungäste desWes-tens“ unternahmen sie mittelsdes Fernsehens allabendlich eine„kollektive Ausreise“.Neben einer breit gefächerten
Auswahl persönlicher Erinnerungs-gegenstände spielten daher Film-quellen eine besonders wichtigeRolle in der Ausstellung. Ausschnit-te aus in Ost und West gleicherma-ßen beliebten Unterhaltungssen-dungen des bundesdeutschen Fern-sehens rückten deutsch-deutscheGemeinsamkeiten ins Blickfeld. Re-portagen westdeutscher Korres-pondenten aus dem „Arbeiter- und
Foto oben:Großes Besucher-interesse bei der Aus-stellungseröffnung
Foto unten:Westpakete: Hilfsorga-nisationen mahnen diewestdeutsche Bevölke-rung, die Brücken zuden Landsleuten„drüben“ nichtabzubrechen.
53
Wechselausstellungen
drüben. Deutsche Blickwechsel
Bauernstaat“ erinnerten an das Be-mühen, das Interesse der Bundes-bürger an der DDR wach zu haltenund den Ostdeutschen ein realisti-scheres Bild von den Verhältnissen„vor Ort“ zu vermitteln, als dies imBestreben der von der SED gelenk-ten DDR-Medien lag. Objekte ausdem Büro Karl Eduard von Schnitz-lers und Ausschnitte aus seinerSendung „Der schwarze Kanal“ lie-ßen gegen die Bundesrepublik ge-richtete Diffamierungskampagnender SED anschaulich werden. EinRadio mit markierten DDR-Sendernund Tafeln, mit denen Zuschauerdes Westfernsehens öffentlich an-geprangert wurden, erzählten vondem vergeblichen Versuch der kom-munistischen Machthaber, denEmpfang des Westfernsehens und-rundfunks in der DDR zu unter-binden.Die besondere Aufmerksamkeit
der Besucher zog in der Ausstellungeine Inszenierung aus dem Alltags-leben auf sich: Eine westdeutscheGartenlaube und eine ostdeutscheDatsche versinnbildlichten gemein-same Freizeitvorlieben der Deut-schen diesseits und jenseits derGrenze. Auf Sprachunterschiedezwischen Ost undWest verwies einZettelkasten, in dem ein westdeut-scher Sprachforscher seine beiFahrten zur Leipziger Messe ge-sammelten Beobachtungen fest-hielt. An den „Fußballblick nachdrüben“ erinnerten Fanartikel, die
ein Ost-Berliner von bundesdeut-schen Fußballvereinen unter schwie-rigen Bedingungen sammelte undnachbastelte.
Bonn
Die Präsentation der Ausstellungin Bonn eröffnete der ostdeutscheSchriftsteller Thomas Brussig. Er lasaus seinem Roman „Helden wiewir“, der die Geschichte des Mau-erfalls aus der Perspektive seines„Helden“ Klaus Uhltzscht be-schreibt. Wissenschaftliche Ge-schichtsschreibung wird im Kontexteiner privaten Lebensgeschichte iro-nisch gebrochen: Der Stasi-SpitzelUhltzscht bringt in diesem moder-nen Schelmenroman durch einespektakuläre Aktion die Mauer ganzallein zu Fall.
Pressekonferenzzur Eröffnungmit ProjektleiterinAnne Martin
54
Flucht, Vertreibung, Integration
Flucht, Vertreibung, Integration
Standorte:
Leipzig
1.12.2006–22.4.2007Besuche:
33.358Berlin
18.5.–27.8.2006Besuche:
47.369Bonn
3.12.2005–17.4.2006Besuche:
140.414Projektleitung:
Achim WestholtGestaltung:
Petra Winderoll und Klaus Würth
Nach den erfolgreichen Präsen-tationen der Wechselausstellung„Flucht, Vertreibung, Integration“im Haus der Geschichte in Bonnund im Deutschen Historischen Mu-seum in Berlin wurde die Schau am30. November 2006 im Zeitge-schichtlichen Forum Leipzig eröff-net. In enger Zusammenarbeit derMitarbeiter in Leipzig und Bonn mitdem Gestalterteam konnte die Aus-stellung gut in die etwas kleinerenRäumlichkeiten des Zeitgeschichtli-chen Forums eingepasst werden.Inhalt und Umfang blieben unverän-dert, sodass auch in Leipzig mehrals 1.200 Objekte – Gegenstände,Fotografien, Dokumente und audio-visuelle Medien – in Szene gesetztwaren.Die Ausstellung bettete das Ge-
schehen von Flucht und Vertreibungin den historischen Kontext des„Jahrhunderts der Vertreibungen“und des nationalsozialistischen Ver-nichtungskrieges ein. Sie zeigte dieleidvollen Umstände der Flucht undder sogenannten wilden bezie-hungsweise organisierten Vertrei-bungen von Deutschen am Endedes Zweiten Weltkriegs. Die Prä-sentation veranschaulichte nicht nurdas unmittelbare Geschehen von
Flucht und Vertreibung, sondernstellte auch die vielfältigen Einglie-derungsprozesse der Menschen inihrer neuen Heimat dar. Zeitzeugenschilderten in Interviews ihre Erin-nerungen und Erfahrungen bis in dieGegenwart. Die Besucher konntenwährend ihres Rundgangs Einzel-heiten zum Schicksal der Betroffe-nen erfahren. Das Datenmaterialwurde während der Präsentations-zeit der Ausstellung ständig erwei-tert, sodass in Leipzig rund 350„Lebenswege“ abrufbar waren.Weitere Themen der Schau warendie Wahrnehmung und Rezeptionvon Flucht und Vertreibung in Lite-ratur, Film und Wissenschaft, die inzahlreichen Medienstationen prä-sentiert wurden.Rund 300 Gäste erlebten im Zeit-
geschichtlichen Forum Leipzigeinen berührenden Eröffnungs-abend. Der tschechische Schrift-steller Pavel Kohout würdigte dieAusstellung aus dem Blickwinkeldes östlichen Nachbarlandes. Erhielt auch – trotz zu erwartenderEinwände in seiner Heimat – einePräsentation dort für wünschens-wert. Die Publizistin Helga Hirschplädierte in bewegendenWorten füreine angemessene Würdigung desLeides deutscher Opfer von Fluchtund Vertreibung. Eine musikalischeImprovisation des in Polen gebore-nen Leipziger Pianisten JanuszWozniak griff die angesprochenenThemen kunstvoll auf.
Eingangsbereich zurAusstellung
55
Wechselausstellungen
Beobachtungen –
Der Parlamentarische Rat 1948/49
Fotografien von Erna Wagner-Hemke
Beobachtungen –
Der Parlamentarische Rat 1948/49
Fotografien von
Erna Wagner-Hehmke
Standort:
Bonn
2.9.–5.10.2008Projektleitung:
Dr. Dietmar Preißler, Wiebke SieverGestaltung des Internetauftritts:
Rabea Hashagen,„kommunikationslösungenvon langzeitwirkung“
Faszination Demokratie: Neugie-rig blickten Journalisten am 23. Mai1949 durch die Fenster der Pädago-gischen Akademie in Bonn. Der Par-lamentarische Rat, der das Grund-gesetz für die Bundesrepublik erar-beitet hatte, trat zu seiner letztenSitzung zusammen. Die FotografinErna Wagner-Hehmke hielt auchdiese Szene im Bild fest. Mit rund1.200 Fotos entstand die umfas-sendste fotografische Dokumenta-tion zur Arbeit der „Mütter undVäter des Grundgesetzes“. Die Stif-tung Haus der Geschichte der Bun-desrepublik Deutschland übernahmdiesen einzigartigen Fotobestand inihre Sammlungen und präsentierteeine Auswahl von 60 Bildern in derAusstellung „Beobachtungen – DerParlamentarische Rat 1948/49“. DerMinisterpräsident des Landes Nord-rhein-Westfalen, Dr. Jürgen Rütt-gers, eröffnete am 1. September2008 die Ausstellung im Rahmeneiner Diskussion zum Thema „Ge-hört das Grundgesetz zum altenEisen?“.Parallel dazu startete eine Inter-
netausstellung mit demselben Titel,in der eine größere Auswahl von250 Motiven, erläuternde Texte, dieLebensläufe der Abgeordnetensowie Tondokumente der Öffent-lichkeit zur Verfügung stehen – er-weitert durch die Integration derLiteratur- und Objektdatenbank desMuseums. Verbunden war das Pro-jekt mit der informationstechni-
schen Aufbereitung für die digitaleLangzeitarchivierung. In Kooperationmit dem Deutschen Rundfunkarchivund der Bundeszentrale für politi-sche Bildung wurde das aufwändigeVorhaben zum 60. Jahrestag der Er-öffnung des ParlamentarischenRates realisiert.Nur rund 2.500 Fotografien sind
insgesamt über die Arbeit des Par-lamentarischen Rates dokumen-tiert, etwa die Hälfte stammt vonErna Wagner-Hehmke. Mit ihrerPartnerin Anne Winterer führte sieab 1925 in Düsseldorf ihre „Licht-bildwerkstatt“. Von Hermann Wan-dersleb, dem Leiter der Düs-seldorfer Landeskanzlei, erhielt sie1948 den Auftrag, die Arbeit desParlamentarischen Rates zu doku-mentieren. Die Ausstellung kon-zentrierte sich nicht nur auf die inder Öffentlichkeit bekannten BilderWagner-Hehmkes – beispielsweiseKonrad Adenauer bei der Unter-zeichnung des Grundgesetzes –,der Besucher konnte auch Blickeauf die Arbeit hinter den Kulissenwerfen.
Der Ministerpräsidentdes Landes Nordrhein-Westfalen, JürgenRüttgers, und HansWalter Hütter eröffne-ten die Ausstellung„Beobachtungen – DerParlamentarische Rat1948/49“.
56
Neben den großen Wechselaus-stellungen zeigte das Zeitgeschicht-liche Forum in den Jahren 2007 und2008 eine Reihe von Foyerausstel-lungen, zum Teil in Kooperation mitPartnern.
Deutschlandreise. Fotografien
von Pia Malmus
Auf der Suche nach Spuren ge-genwärtiger deutscher Identitätreiste die Fotografin Pia Malmuskreuz und quer durch Deutschlandund dokumentierte Städte, Denk-mäler, Landschaften und historischeOrte in ihrem persönlichen Stil. Mitihrem unverbrauchten Blick ent-deckte die Künstlerin historischeOrte wie das Hermannsdenkmaloder die Walhalla neu, indem sie be-kannte Bildmotive in ungewöhnli-chen Perspektiven zeigte. Rund 60Arbeiten – eine Quintessenz derfotografischen Ausbeute dieserRundreise – präsentierte das Zeit-geschichtliche Forum Leipzig vom11. Mai bis 17. Juni 2007. Zuvor wardie Ausstellung vom 9. Juni 2006bis 15. April 2007 in der U-Bahn-Galerie des Hauses der Geschichtezu sehen.
Roger Melis – In einem stillen
Land. Fotografien aus der DDR
In Kooperation mit dem Lehm-stedt Verlag Leipzig entstand dieAusstellung „Roger Melis – In einemstillen Land“, die vom 15. Februarbis 30. März 2008 im Foyer des Zeit-
geschichtlichen Forums zu sehenwar. Die Bilder des renommiertenBerliner Fotografen Roger Melisstammen aus den Jahren 1965 bis1989, zeigen atmosphärisch dichtMenschen und ihren Alltag im „realexistierenden Sozialismus“. Trotzder merkwürdigen Stille, die Landund Leute zu lähmen schien, zeu-gen die Aufnahmen gleichzeitigvomWiderspruchsgeist und Selbst-bewusstsein der Ostdeutschen.
Inhaftiert. Fotografien und Be-
richte aus der Untersuchungs-
haftanstalt der Staatssicherheit
von Franziska Vu
Machtlosigkeit, Angst und Ein-samkeit prägten den Alltag derGefangenen in der Untersuchungs-haftanstalt der Staatssicherheit inHohenschönhausen. In einer Kom-bination aus Lebensgeschichtenund visueller Annäherung setztesich die Berliner Fotografin Fran-ziska Vu mit dem Ort und den Er-lebnissen ehemaliger Stasi-Häftlin-ge auseinander. Eine Dokumenta-tion des Projektes zeigte das Zeit-geschichtliche Forum Leipzig unterdem Titel „Inhaftiert“ vom 11. Aprilbis 18. Mai 2008.
Antisemitismus? Antizionismus?
Israelkritik?
Vom 28. August bis 28. Septem-ber 2008 präsentierte das Zeit-geschichtliche Forum Leipzig eindeutsch-israelisches Gemeinschafts-
Auch die Ausstellungenim Foyer stießen aufgroßes Besucherinter-esse, oben „Deutsch-landreise. Fotografienvon Pia Malmus“, unten„Roger Melis – In einemstillen Land“.
57
Wechselausstellungen
Foyerausstellungen Leipzig
projekt des Zentrums für Antisemi-tismusforschung der TU Berlin undder Holocaust-Gedenkstätte Yad Va-schem in Jerusalem. Die Wander-ausstellung entstand 2004 aufInitiative des damaligen israelischenMinisters für Diaspora, Natan Sha-ransky, und wurde 2007 erstmalsder Öffentlichkeit vorgestellt. Fotos,Plakate und Karikaturen deckten dieAlltäglichkeit und Vielfalt der Facet-ten noch heute existierender Ju-denfeindlichkeit in Deutschland auf.
Fortgesetzte Einmischung.
Bilder zur Zeitgeschichte
Rund 60 Arbeiten des DresdnerMalers, Grafikers und Objektkünst-lers Jürgen Schieferdecker aus übervier Jahrzehnten waren unter die-sem Titel im ZeitgeschichtlichenForum Leipzig zu sehen. „Was demZeitgenossen nicht unter die (Kopf-)Haut geht, wird später wenig An-spruch auf Interesse machen kön-nen“, ist das Motto des Künstlers.Jürgen Schieferdecker ist diesemAnspruch an das eigene Schaffentreu geblieben. Er war in der DDRein unbequemer Künstler, dessenkritische Bilder und Collagen häufigaus staatlichen Ausstellungen ent-fernt worden sind. Zugleich reichtdie Spur seiner künstlerischen Ein-mischung in das Zeitgeschehen wieauch seiner Auseinandersetzungmit der Geschichte bis in die unmit-telbare Gegenwart. Alle gezeigtenArbeiten kamen durch Ankäufe
sowie eine umfangreiche Schen-kung des Künstlers in den Bestandder Stiftung.
Der Stoff aus dem die Träume
sind. Das Hawaiihemd
Mit der Losung „Visafrei bisHawaii“ demonstrierten mutigeMagdeburger im Herbst 1989 fürReisefreiheit in der DDR. Das far-benfrohe Hawaiihemd symbolisiertauch heute noch die Sehnsuchtnach Sommer, Sonne und Sorg-losigkeit. Antizyklisch zur dunklenJahreszeit präsentierte das Zeitge-schichtliche Forum Leipzig vom11. Dezember 2008 bis 1. Februar2009 diese Ausstellung im Infor-mationszentrum. Die Präsentationentstand in Kooperation mit derHochschule für Technik, Wirtschaftund Kultur Leipzig.
Plakat zurAusstellung
58
Wilde Zeiten.
Fotografien von Günter Zint
Wilde Zeiten.
Fotografien von Günter Zint
Standort:
Bonn (U-Bahn-Galerie)
8.5.2007–18.5.2008Projektleitung:
Dr. Jürgen Reiche
„Ich will Realität zeigen, meineBilder sind Gebrauchsfotografien“,sagt der Fotograf Günter Zint überseine Arbeiten. Wie greifbar dieRealität in seinen Bildern wird,konnten Besucher der Ausstellung„Wilde Zeiten“ in der U-Bahn-Galerie des Museums sehen. DasHaus der Geschichte der Bundesre-publik Deutschland zeigte eine Aus-wahl von rund 60 Schwarz-Weiß-Bildern des Fotografen und Samm-lers. ImMittelpunkt standen Motiveaus dem Hamburger „St.-Pauli-Kiez“ sowie Fotos der Studenten-,Friedens- und Anti-Kernkraft-Bewe-gung. Die Ausstellung in Bonn er-öffnete der Schriftsteller GünterWallraff. Viele von Zints Fotografienhaben sich ins kollektive Gedächtnis
eingebrannt, so fanden sich in derU-Bahn-Galerie unter anderem Bil-der der Beatles vor dem HamburgerStar-Club, Aufnahmen protestieren-der Studenten in Berlin und Parissowie das Foto der Vorsitzendender Bürgerinitiative Lüchow-Dan-nenberg, umringt von Polizisten.Zint gilt als Vorreiter eines sozial en-gagierten und aufklärerischen Bild-journalismus in der Bundesrepublik,er richtet seinen Blick auch aus derPerspektive der Agierenden, derGegenkulturen heraus auf die Reak-tionen der Gesellschaft. Deutlichwurde dies für den Besucher anZints Dokumentation der Euphorieund Ernüchterung der Ostdeut-schen beim Fall der Mauer.
Foto oben:Die Ausstellung „WildeZeiten“ mit Fotografienvon Günter Zint eröff-nete der SchriftstellerGünter Wallraff (l.).
Foto links:Demonstrant undPolizisten, Berlin 1968
59
Ausstellungen in der U-Bahn-Galerie
Auf die Bilder kommt es an!
Wahlkampf und politischer Alltag
in Deutschland
Auf die Bilder kommt es an!
Wahlkampf und politischer Alltag
in Deutschland
Standort:
Bonn (U-Bahn-Galerie)
13.6.2008–7.6.2009Projektleitung:
Dr. Jürgen Reiche, Dr. Tuya Roth
Ob Franz Josef Strauß ganz „pri-vat“ mit seiner Tochter „Mensch är-gere dich nicht“ spielt oder GerhardSchröder sich in Siegerpose aufdem Podium präsentiert – die Me-diendemokratie nutzt eindringlicheund emotionale Bilder als Mittel derpolitischen Kommunikation. Im Vor-feld des Wahljahres 2009 bot dieStiftung Haus der Geschichte derBundesrepublik Deutschland An-schauungsmaterial und Stoff fürDiskussionen: Welche politischeWerbung spricht den Wähler heutean? Kann sich der Wähler unabhän-gig von der medialen Politiker-In-szenierung eine Meinung bilden?Am 12. Juni 2008 eröffnete der
PR-Berater Prof. Coordt von Mann-stein, Wahlkampfstratege und Ge-
schäftsführer der von MannsteinWerbeagentur GmbH, die Ausstel-lung. Rund 60 Fotografien zeigten inder Bonner U-Bahn-Galerie, wie sichPolitiker in der Öffentlichkeit und impolitischen Alltag seit 1945 in Szenesetzten. Ein Hauptaugenmerk lagdabei auf den Wahlkämpfen, indenen politische Inszenierungen be-sonders augenfällig sind und be-wusst geplant werden. Die Aus-stellung präsentierte dazu Beispielealler Volksparteien: Fotos von Wahl-kampfplakaten und Parteitagen zeig-ten die zunehmende Konzentrationauf den jeweiligen Kanzlerkandida-ten und die geringer werdende Be-deutung von Sachaussagen. Bereits1961 warb die CDU mit einem Por-trät von Konrad Adenauer und demSlogan „Setzt Deutschland nichtaufs Spiel“, 1998 beschwor Ger-hard Schröder auf dem Leipzi-ger SPD-Parteitag „Die Kraft desNeuen“ vor einem riesigen farbigenDisplay. Beide Bilder dokumentier-ten trotz der unterschiedlichen Stil-mittel und der zeitlichen Distanz diealltägliche politische Inszenierungvon Politikern und Parteien.Die Darstellung des Privaten in
der Öffentlichkeit war ein weiteresThema der Ausstellung. MehrereFotos zeigten, wie Politiker aufdiese Weise Sympathien für sichgewinnen wollten: Beispiele warenu. a. Helmut Schmidt beim Schach-spiel mit seiner Frau oder HelmutKohl im Urlaub am Wolfgangsee.
Inszeniertes Privatleben:Franz Josef Strauß undseine Tochter beim„Mensch ärgere dichnicht“ sowie das Ehe-paar Schmidt beimSchachspiel
60
Wanderausstellungen
Durch das Wanderausstellungs-programm konnte die Stiftung einweit verzweigtes Netz von Partner-schaften knüpfen. Schon seit 1995ist die Stiftung mit ihren Ausstellun-gen nicht nur in der gesamtenBundesrepublik, sondern auch imAusland präsent. Ziel ist es, einmöglichst breites Publikum anzu-sprechen und auf die Ausstellungenund Veranstaltungen der Stiftung anden Standorten Bonn, Leipzig undBerlin neugierig zu machen. Durchintensive Kontaktpflege konnte das
Netzwerk an Kooperationspartnernstetig ausgebaut und gefestigt wer-den. Positive Reaktionen von denInstitutionen, die die Ausstellungender Stiftung präsentieren, sowievom Publikum unterstreichen denErfolg.Im Berichtszeitraum war die Stif-
tung an 38 Stationen mit ihren Aus-stellungen vertreten, darunter vierim benachbarten Ausland. Seit Be-ginn des Programms 1995 sind esinsgesamt bereits 342 Standorte, andenen Wanderausstellungen derStiftung gezeigt wurden. Es um-fasst zurzeit zehn Ausstellungen
„Wilde Zeiten“:Marianne Fritzen, dieehemalige Vorsitzendeder BürgerinitiativeLüchow-Dannenberg,bei einer Demonstrationgegen den Bohrbeginnfür das geplante Atom-müll-Endlager in Gorle-ben (Foto von GünterZint, 1979)
61
Wanderausstellungen
mittlerer Größe sowie „Bilder, dielügen“, die einschließlich Architek-tur an museale Institutionen weiter-gegeben wird. Die in Kooperationmit der Bundeszentrale für politi-sche Bildung entstandene Ausstel-lung ist seit Jahren die erfolg-reichste Wanderausstellung.Das Ausstellungsangebot wird
regelmäßig aktualisiert, um auchlangjährige Kooperationspartnerimmer wieder anzusprechen. Seit2007 ist „Deutschlandreise. Foto-grafien von Pia Malmus“ neu imProgramm. Die Ausstellung präsen-tiert eine Serie von Aufnahmen der
jungen Fotografin Pia Malmus, diesich mit ihrer Kamera auf eine Reisedurch Deutschland begeben hat. Inihren Bildern von Städten, Land-schaften, Denkmälern, historischenOrten und Bauten stellt die Künstle-rin die Frage, worin sich deutscheIdentität und deutsche Befindlich-keit manifestieren.2008 wurde mit „Wilde Zeiten.
Fotografien von Günter Zint“ eineweitere Fotoausstellung in dasWanderausstellungsprogramm auf-genommen. Wie „Deutschland-reise“ trifft auch sie auf großesInteresse. Der 1941 geborene Foto-
Seit 2007 zeigt dasHaus der Geschichtedie Fotografien von PiaMalmus’ Deutschland-reise in einer Wander-ausstellung.
62
graf Günter Zint gilt als wichtigerChronist des Jahres 1968. Seine po-litisch engagierten Aufnahmen do-kumentieren auch die Jugend- undProtestbewegungen der 1970erund 1980er Jahre. Sie sind ein be-merkenswertes Zeitzeugnis undführen den Betrachtern zentrale Er-eignisse der deutschen Nachkriegs-geschichte lebendig und engagiertvor Augen.Einer außerordentlich großen
Nachfrage erfreuen sich zwei Wan-derausstellungen zur Geschichteder DDR. „Unterm Strich. Karikaturund Zensur in der DDR“ und „Da-
mals in der DDR. 20 Geschichtenaus 40 Jahren“ waren 2007 und2008 kontinuierlich auf Tournee.Während erstere am Beispiel derKarikatur Einblicke in Wesen undWirklichkeit der SED-Diktatur er-möglicht, verfolgt letztere einen bio-grafischen Ansatz, indem sie daspersönliche Schicksal von 20 Zeit-zeugen thematisiert. Beide Aus-stellungen, die auch zunehmend In-teresse bei westdeutschen Institu-tionen finden, sind für 2009 bereitsausgebucht.Die Besuchszahlen sprechen für
sich: Von 1999 bis 2008 wurden in
Edward SerrottasFotografien zum Thema„Juden in Deutschlandheute“ waren imGäuboden Museumin Straubing zu sehen.
63
Wanderausstellungen
den Wanderausstellungen über 1,3Millionen Besuche gezählt, allein inden Jahren 2007 und 2008 warenes über 280.000 Gäste.Um an den Ausstellungsorten für
die Ausstellungen werben zu kön-nen, stellt das Haus der Geschichteseinen Partnern einheitlich gestal-tete Plakate, Flyer und Einladungs-karten im Corporate Design derjeweiligen Ausstellung zur Verfü-gung. Weitere Handreichungen füreine professionelle Öffentlichkeits-arbeit werden angeboten. Die Aus-lage von Flyern und des aktuellenMuseumsmagazins machen zusätz-
lich auf die Arbeit der Stiftung auf-merksam. Die Werbemaßnahmenund die Ausstattung der Ausstellun-gen werden kontinuierlich überar-beitet und optimiert. Seit 2008 wirbtdas Haus mit einem anspre-chend gestalteten Faltblatt für dasWanderausstellungsprogramm, dasKurzinformationen zu Ausstellungenund Konditionen für potentielle Leih-nehmer enthält. Zudem könneninteressierte Institutionen im Inter-net Informationen zu Inhalt und Um-fang der einzelnen Präsentationenabrufen.
Die Landrätin desKreises Soest,Eva Irrgang (2.v.r.),und Heike Baare (l.)vom Haus derGeschichte freuen sichüber die Präsentationder „Deutschlandbilder“im Kreishaus.
64
Bilder, die lügen
17.1.–15.4.2007BremenFocke-MuseumBremer Landesmuseumfür Kunst und Kulturgeschichte
28.4.–7.10.2007LübeckKulturforum Burgkloster Lübeck
Damals in der DDR.
20 Geschichten aus 40 Jahren
18.1.–25.3.2007RastattErinnerungsstätte für die Freiheitsbewe-gungen der deutschen Geschichte
19.4.–31.7.2007TöpenDeutsch-Deutsches MuseumMödlareuth
12.8.–15.11.2007BlankenhainDeutsches Landwirtschaftsmuseum
16.3.–26.5.2008Asbach SickenbergGrenzmuseum „Schifflersgrund“
23.6.–11.8.2008WeißenthurmVerbandsgemeindeverwaltung
4.9.2008–11.1.2009WolfenIndustrie- und Filmmuseum
Deutschlandbilder. Das vereinigte
Deutschland in der Karikatur des
Auslands
1.3.–24.6.2007MunsterDeutsches Panzermuseum
3.10.–18.11.2007GüterslohStadtmuseum
29.9.–21.11.2008SoestKreishaus
Wanderausstellungen in Deutschland
Deutschlandreise.
Fotografien von Pia Malmus
9.10.–9.12.2008ElsterheideLandesfeuerwehrschule Sachsen
frauenobjektiv
1.7.–16.3.2007GreizHeimatmuseum
Jeder ist ein Fremder
11.2.–29.4.2007ErlangenStadtmuseum
Juden in Deutschland heute.
Photographien von Edward Serotta
8.11.2007–3.2.2008StraubingGäuboden Museum
1.9.–5.10.2008Bad KreuznachKatholische Erwachsenenbildungim Bistum Trier
Klar-Sichten.
Fotos aus drei Generationen
1945 bis 1999.
Willi, Dieter und Reto Klar
2.3.–1.4.2007EriskirchBürgerhaus „Alte Schule“
4.7.–30.11.2007MunsterDeutsches Panzermuseum
18.12.2007–27.1.2008RasdorfGrenzmuseum Röhn „Point Alpha“
Lili Marleen.
Ein Schlager macht Geschichte
11.3.–10.6.2007MoersGrafschafter Museum im Schloss
12.8.–21.10.2007GrevenbroichMuseum Villa Erckens
20.1.–2.3.2008Hamm-NorddinkerOtmar-Alt-Stiftung
22.10.2008–22.3.2009StuttgartStiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus
Unterm Strich.
Karikatur und Zensur in der DDR
24.2.–15.4.2007WadgassenDeutsches Zeitungsmuseum
2.5.–31.5.2007MünsterAgentur Deutsche EinheitMünsterland
28.6.–12.8.2007RasdorfGrenzmuseum Röhn „Point Alpha“
1.9.–31.10.2007SchwerinAußenstelle der Bundesbeauftragtenfür die Unterlagen desStaatssicherheitsdienstes
5.11.–30.12.2007NeubrandenburgAußenstelle der Bundesbeauftragtenfür die Unterlagen desStaatssicherheitsdienstes
65
Wanderausstellungen
Bilder, die lügen
19.10.2007–6.7.2008Bern (Schweiz)Museum für Kommunikation
31.7.–19.10.2008Schiltigheim bei Straßburg(Frankreich)Hôtel de Ville de Schiltigheimin Zusammenarbeit mit demGoethe-Institut Straßburg
31.10.2008–22.3.2009Vaduz (Liechtenstein)Liechtensteinisches Landesmuseum
Deutschlandbilder. Das vereinigte
Deutschland in der Karikatur des
Auslands
11.10.–23.11.2007Oppeln (Polen)Sozial-Kulturelle Gesellschaft derDeutschen im Oppelner Schlesien
Wanderausstellungen im Ausland
8.1.–28.2.2008RostockAußenstelle der Bundesbeauftragtenfür die Unterlagen desStaatssicherheitsdienstes
7.4.–31.7.2008TöpenDeutsch-Deutsches MuseumMödlareuth
28.8.–15.11.2008Frankfurt (Oder)Städtische MuseenJunge Kunst und Viadrina
Unverschämtes Glück. Fotografien
aus Deutschland von Robert Lebeck
31.1.–30.3.2008BrackenheimTheodor Heuss Museum
5.6.–30.11.2008MunsterDeutsches Panzermuseum
Wilde Zeiten.
Fotografien von Günter Zint
30.9.2008–18.1.2009WolfsburgHoffmann-von-Fallersleben-Museum
• Erlangen
• Stuttgart
• Wadgassen
• Neuwied
• Borken
• Hamm• Bochum
• Nürnberg
• Rasdorf
• Bremen
• Neubrandenburg• Schwerin
• Grevenbroich
• Lübeck
• Rastatt
• Töpen
• Greiz
• Blankenhain• Asbach Sickenberg
• Weißenthurm
• Wolfen
• Munster
• Gütersloh
• Soest
• Elsterheide
• Straubing
• Bad Kreuznach
• Eriskirch
• Moers
• Münster
• Rostock
Frankfurt (Oder) •
• Brackenheim
• Wolfsburg
Ausstellungsstandortein Deutschland
66
Bilder, die lügen
Die Ausstellung „Bilder, dielügen“, eine Kooperation der Stif-tung mit der Bundeszentrale für po-litische Bildung, wird seit 2003 inDeutschland und benachbarten Län-dern erfolgreich präsentiert. DieWanderversion verzeichnete bisherfast 700.000 Besuche. Die Ausstel-lung fragt nach der Objektivität vonBildern und zeigt Grundmuster derManipulation von und mit Bildern.Den Besucher erwartet ein „Lügen-ABC“ von „A wie Aktuelles“ über„K wie Kalter Krieg“ bis hin zu „Zwie Zukunft“.
Ein Grund für die weiterhingroße Resonanz ist die ständigeÜberarbeitung und Anpassung derAusstellung an aktuelle Gescheh-nisse aus den Bereichen der Bild-manipulation.Zu Beginn des Jahres 2007 en-
dete die Präsentation von „Bilder,die lügen“ im KulturgeschichtlichenMuseum Osnabrück, anschließendwar sie im Focke-Museum Bremenzu sehen. Insgesamt notierte dieAusstellung dort über 14.000 Besu-che. In Kooperation mit der Landes-zentrale für politische Bildung botdas Focke-Museum im Rahmenpro-gramm zur Ausstellung eine Vor-tragsreihe an.Nach der Präsentation in Lübeck
von April bis Anfang Oktober 2007reiste die Ausstellung in dieSchweiz: Speziell für diese Stationwurden Unterrichtsmaterialien fürSchüler und eine grafische Lösungfür die Mehrsprachigkeit der Aus-stellung erarbeitet und die Medien-stationen mit französischen Unter-titeln versehen. Das Museum fürKommunikation in Bern entwickelteeinen begleitenden Workshop-Be-reich, in dem die Ausstellung umSchweizer Beispiele ergänzt wurde.Das große Engagement des BernerKooperationspartners und die über-zeugende Öffentlichkeitsarbeit, dieein großes Medienecho nach sichzog, trugen dazu bei, dass „Bilder,die lügen“ dort mit 52.000 Besu-
In Bern und Schiltig-heim/Elsaß konnte„Bilder, die lügen“zweisprachig präsentiertwerden.
67
Wanderausstellungen
Bilder, die lügen
chen zur erfolgreichsten Sonder-ausstellung überhaupt wurde. Diesbestätigten auch Besucherbefra-gungen vor Ort: Danach beurteilten94 Prozent der Befragten die Aus-stellung als „gut“ oder „sehr gut“.Im Anschluss an die Präsenta-
tion in Bern konnte „Bilder, dielügen“ dank einer Kooperation mitdem Goethe-Institut Straßburg abJuli 2008 im Rathaus von Schiltig-heim präsentiert werden – ebensowie in Bern zweisprachig. In Koope-ration mit dem Sender „arte“ wurdedie Ausstellung während der dorti-gen Präsentationszeit im Septem-ber zusätzlich auf den Internetseitendes Senders als „Ausstellung desMonats“ beworben.Seit Oktober 2008 war die Aus-
stellung im LiechtensteinischenLandesmuseum in Vaduz zu sehen.Im Anschluss wird die Ausstellung2009 im Tiroler Landesmuseum inInnsbruck und danach in Münchengezeigt. Foto oben:
Impression vom Aus-stellungseingang: DieBesucher erwartet ein„Lügen-ABC“ von„A wie Aktuelles“ über„K wie Kalter Krieg“ bishin zu „Z wie Zukunft“.
Foto links:Das Haus derGeschichte stellt denKooperationspartnerndas Corporate Designzur Ausstellung füreigene Werbung zurVerfügung.
Karikaturengalerie
Mit mehr als 75.000 Zeichnun-gen besitzt die Stiftung Haus derGeschichte eine der größten Karika-turensammlungen von Originalenzur deutschen Geschichte seit demEnde des Zweiten Weltkriegs. DieBestände sind jetzt in der Karikatu-rengalerie des Museums – gegen-über dem Haus der Geschichte ander Willy-Brandt-Allee – unterge-bracht. Eine Ausstellung zeigt rund100 ausgewählte Zeichnungen undExponate zu Themen der deutschenGeschichte. Zur Eröffnung am1. April 2007 kamen auch viele be-kannte Karikaturisten wie BurkhardMohr und Walter Hanel, die sich mitihren Werken in der Präsentationwiederfinden.
Die Ausstellung beleuchtetschlaglichtartig politische Ereignisseund Konflikte seit 1949. Schwer-punktthemen ergänzen das Pano-rama deutscher Zeitgeschichte:Eine „Adlergalerie“ bildet den Auf-takt. Das Wappentier ist ein weitverbreitetes Symbol für Deutsch-land. Vom Doppeladler als Metapherfür die deutsche Teilung biszum Bundesadler, der kraftvoll dieBerliner Mauer durchbricht – dieausgewählten Arbeiten belegenKontinuität, aber auch Wandlungs-fähigkeit des Motivs und die Kreati-vität der Karikaturisten.Interaktive Medienstationen la-
den die Besucher ein, sich mit demEntstehen von Karikaturen ausei-nanderzusetzen. Auch die Grenzenvon Karikatur und Satire werden
Foto Seite 68:Rund 100 ausgewählteZeichnungen, ergänzt uminteraktive Medienstatio-nen, beleuchten in derKarikaturengalerie schlag-lichtartig politische Ereig-nisse und Konflikte seit1945.
Foto Seite 69 oben:Zur Eröffnung der Karikatu-rengalerie kamen WalterHanel (2.v.l.) und BurkhardMohr (3.v.l.), die auch miteigenen Werken vertretensind. SammlungsdirektorDietmar Preißler, HansWalter Hütter und Projekt-leiter Ulrich Op de Hipt(v.l.n.r.) begrüßten dieGäste.
Foto Seite 69 unten:„Auf dem Bahnhof derGeschichte“,Josef Partykiewicz, 1998
68
69
Karikaturengalerie
Geschichte Deutschlands nach 1945
im Spiegel der Karikatur
an Fallbeispielen gezeigt, die öffent-liches Aufsehen erregten und bis zuGerichtsprozessen führten.In den Sammlungen sind origi-
nale Zeichnungen renommierter Ka-rikaturisten aus dem In- undAusland in Form von Einzelblätternoder Gesamtnachlässen zusam-mengetragen. Alle wichtigen The-men der deutschen Geschichte seitEnde des Zweiten Weltkriegs spie-geln sich wider.Als eines der ersten Konvolute
kam 1989 das Werk von MirkoSzewczuk (1919–1957) in das Mu-seum, den die Londoner Times inden 1950er Jahren als den „bestenZeichner der Bundesrepublik“ wür-digte.Neben Zeichnungen und gemal-
ten Karikaturen sind in der Ausstel-lung auch „Plastikaturen“ zu sehen:Der Karikaturist Burkhard Mohr ar-beitet nicht nur mit Papier undFeder. Als Bildhauer schmiedet er„Grotesken“, dabei handelt es sichum Portraits von bekannten Politi-kern.In der Karikaturengalerie können
Interessenten über ein Terminal inausgewählten Beständen recher-chieren. Darüber hinaus steht einRaum für Workshops zur Verfü-gung.
70
Ausstellung im Bundeskanzleramt Berlin
Staatsgeschenke
Bundeskanzler Konrad Adenauerunternahm zwischen 1949 und1963 allein 22 offizielle Reisen indas Nachbarland Frankreich. Seit-dem ist weltweit die Zahl derStaatsbesuche sprunghaft angestie-gen. Die in Kooperation mit demBundeskanzleramt entstandeneAusstellung zeigt im Foyer des Ge-bäudes Staatsgeschenke an dieKanzlerin und die Kanzler der Bun-desrepublik Deutschland. Der welt-weite Brauch des Austauschs vonGastgeschenken reicht bis in dieAntike zurück und ist heute nochfester Bestandteil internationaler Di-plomatie. Die Geschenke sind Zei-
Staatsgeschenke
Standort:
Berlin (Bundeskanzleramt)
23.5.2008–Juni 2010Besuche:
98.573Projektleitung:
Dr. Jürgen ReicheGestaltung:
Jochen GringmuthCoordination Ausstellungs GmbH
chen der Wertschätzung und Aus-druck der Sympathie für den Be-schenkten. In der Vielfalt derStaatsgeschenke spiegeln sichneben persönlichen Interessen derRegierungschefs auch außenpoliti-sche Schwerpunkte der Kanzler-schaften von Konrad Adenauer bisAngela Merkel. Die am Tag der of-fenen Tür am 23./24. August 2008eröffnete Ausstellung sahen alleinean diesen beiden Öffnungstagen35.000 Besucher. Wegen des gro-ßen Erfolges wurde die Präsenta-tion auf Wunsch des Kanzleramtesbis Juni 2010 verlängert.
Foto Seite 70:Ausgewählte Staats-geschenke imhistorischen Kontextzeigt die Ausstellungim Bundeskanzleramt.
Foto Seite 71:Alfons Kiefer war einerder Illustratoren, diezur Präsentation ihrerWerke nach Bonnkamen.
Gastausstellungen
Die Kunst des SPIEGEL
Die Kunst des SPIEGEL:
Die Originale der
SPIEGEL-Titelbilder
Standort:
Bonn
14.3.2007–2.4.2007Besuche:
12.677Projektleitung:
Dr. Judith Koppetsch
Ein gutes Titelbild bringt es aufden Punkt: Es weckt Interesse, pro-voziert, lädt zum Kauf und zumLesen ein. Seit über 50 Jahrengestalten weltweit renommierteGrafiker die Titelbilder des Nach-richtenmagazins DER SPIEGEL.Rund 100 dieser Titelbilder im Origi-nal zeigte das Haus der Geschichteder Bundesrepublik Deutschland inder Ausstellung „Die Kunst desSPIEGEL“. Teil der Ausstellung wardarüber hinaus der Schreibtisch vonRudolf Augstein aus den Sammlun-gen des Museums, der erstmals öf-fentlich präsentiert wurde.
Die Ausstellung offenbarteneben den erfolgreichen Titelbildernzugleich, welche Illustrationen esnicht auf die Titelseite schafften undwelche stattdessen ausgewähltwurden. Der Besucher erhielt Ein-blicke in die Stil-, Zeit- und Politikge-schichte der vergangenen 50 Jahresowie in die Arbeitsweise der Titel-bild-Redaktion des SPIEGEL. Auchdie verschiedenen Arbeitstechnikender Illustratoren – von der Ölmalereiüber die Federzeichnung bis zur di-gitalen Grafik – wurden anschaulich.
71
72
Rückblende 2006 und 2007
Standorte:
Bonn
25.5.2007–17.6.200712.3.2008–13.4.2008Besuche:
35.514Leipzig
27.6.2007–22.7.200718.6.2008–20.7.2008Besuche:
15.102
Rentz den ersten Preis mit einemFoto von Dr. Angela Merkel auf derFregatte „Sachsen“. Er hielt mit sei-nem Bild den Moment fest, alsJagdbomber über das Schiff hin-wegflogen und sich die Kanzlerin imGegensatz zu dem neben ihr ste-henden Marineinspekteur nicht dieOhren zuhielt. Das Siegerfoto zeigtAngela Merkel unverkrampft, leichterschrocken lächelnd.Der Preisträger in der Kategorie
„Karikatur“, Burkhard Mohr, eröff-nete gemeinsammit StaatssekretärDr. Karl-Heinz Klär, Bevollmächtigterdes Landes Rheinland-Pfalz beimBund und für Europa, und Prof. Dr.Hans Walter Hütter, Präsident derStiftung Haus der Geschichte der
Die „Rückblende“ ist der wich-tigste deutsche Preis für politischeFotografie und Karikatur. Ziel derAusstellung ist die Deutung des ver-gangenen „politischen“ Jahres. Seit1995 wird die „Rückblende“ alsWettbewerb ausgeschrieben, eineunabhängige Jury wählt die bestenFotografien und Karikaturen aus. Or-ganisiert wird die Ausstellung vonder Landesvertretung Rheinland-Pfalz gemeinsammit dem SPIEGEL,dem Bundesverband Deutscher Zei-tungsverleger und der Bundespres-sekonferenz.Für die „Rückblende 2006“ hat-
ten 174 Fotografen und 60 Karikatu-risten ihre Beiträge eingereicht. Beiden Fotografen gewann Andreas
Das Siegerfoto 2006von Andreas Rentz:Bundeskanzlerin AngelaMerkel auf der FregatteSachsen beim Überflugeines Jagdbombers
73
Gastausstellungen
Rückblende 2006 und 2007
Bundesrepublik Deutschland, diePräsentation in Bonn. Seine Karika-tur zeigte Angela Merkel und Vize-kanzler Franz Müntefering beim„Großen Tango“ anlässlich des ein-jährigen Bestehens der Großen Ko-alition.Fabian Bimmers Foto, das Poli-
zisten und als Clowns verkleideteDemonstranten beim G8-Gipfel inHeiligendamm zeigt, war das Sieger-foto der „Rückblende 2007“. Esfängt die Stimmung des jährlichenZusammentreffens der G8 auf be-sondereWeise ein, zeigt Gegner desGipfels und Polizisten friedlich ne-beneinander. Für die beste politischeKarikatur des Jahres 2007 wurdeKlaus Stuttmann ausgezeichnet,der Bundesinnenminister Dr. Wolf-gang Schäuble MdB und seine Pläne
zur Erhebung und Speicherung per-sonenbezogener Daten kritisch insBild setzte.183 Fotografen und 53 Karikatu-
risten reichten für das Jahr 2007 ins-gesamt über 1.300 Arbeiten ein. DieAusstellung im Haus der Ge-schichte zeigte eine Auswahl von100 Fotografien und 50 Karikaturen.Der Karikaturist und Rückblende-Preisträger 2007, Klaus Stuttmann,eröffnete die Präsentation in Bonn.
Leipzig
Das Zeitgeschichtliche ForumLeipzig der Stiftung übernahm imAnschluss an die Präsentation inBonn die Ausstellung und zeigte siemit großem Erfolg im Informations-zentrum des Museums.
Foto links:Siegerfoto 2007:Polizisten und alsClowns verkleideteDemonstrantenbeim G8-Gipfel inHeiligendamm
Foto unten:ÜberraschendeRückblicke auf dasJahr 2006
Veranstaltungen im
Haus der Geschichte Bonn
In den Jahren 2007 und 2008 be-gleiteten zahlreiche eigene, Koope-rations- und Fremdveranstaltungendie aktuellen Wechselausstellungenund vertieften einzelne Themen derDauerausstellung. Podiumsdiskus-sionen und Vorträge behandeltenaktuelle politische und gesellschaft-liche Themen. Darüber hinaus wardas Haus der Geschichte Veranstal-tungsort für zahlreiche Lesungen,Themenreihen und andere Kultur-veranstaltungen.
Begleitprogramme
Kulturelle und wissenschaftlicheVeranstaltungen sowie Museums-tage setzten eigene Akzente zu denWechselausstellungen des Hauses.Anlässlich der Ausstellung
„Zug um Zug. Schach – Gesell-schaft – Politik“ veranstaltete dasHaus der Geschichte im Januar2007 einen Schachsonntag, beidem der ehemalige Schachwelt-meister Boris Spasski zu Gast war.Der russische Großmeister spieltevor über 2.000 Besuchern 25Schachpartien simultan, wobei der„Schachschiedsrichter des Jahr-hunderts“, Lothar Schmid, die Ober-aufsicht führte.Deutsch-deutsche Themen stan-
den im Mittelpunkt einer siebentei-ligen Vortragsreihe im Rahmen derAusstellung „drüben. DeutscheBlickwechsel“, so zum Beispiel„1973 – Doppelter UN-Beitritt:Deutsch-deutsche Konkurrenz aufder internationalen Bühne“ oder„1974 – das Sparwasser-Tor: Diegesellschaftliche und politische Be-deutung des Sports für beide deut-schen Staaten“. Die Veranstal-tungen fanden in Kooperation mitdem Institut für Zeitgeschichte inMünchen statt.Am Familiensonntag zur Aus-
stellung im Februar 2007 sahen dieBesucher die Filme „Solo Sunny“und „Spur der Steine“. Ein Mit-mach-Programm führte die jungen
Der ehemalige Schach-weltmeister BorisSpasski spielt beimSchachsonntag zurAusstellung „Zug umZug. Schach – Gesell-schaft – Politik“ simul-tan gegen 25 Gegner.
76
77
Veranstaltungen
Bonn
Gäste an verschiedene Ausstel-lungsstationen, wo sie in zweiTeams – „Ost und West“ – Fragenzu Objekten, Film- oder Tondoku-menten beantworten konnten. Aufdiese Weise setzten sich viele Fa-milien intensiv mit dem Ausstel-lungsthema auseinander.Begleitend zur Ausstellung „Hei-
mat und Exil. Emigration der deut-schen Juden nach 1933“ lud dasHaus der Geschichte zu einer sie-benteiligen Veranstaltungsreihe, inder unter anderem die jüdische Zeit-zeugin Margot Barnard von ihremSchicksal, das sie von Deutschlandüber Palästina nach England führte,und ihren Erfahrungen auf derSuche nach einer neuen Heimat be-richtete. Rabbinerin Elisa Klapheckvon der Gemeinde Beit Ha’Chidushin Amsterdam diskutierte die Frage„Wie sieht sich das Judentum ineinem säkularen Europa?“. Am 19.Juni 2007 wurde der Film „Die Kis-singer-Saga: Henry und Walter –zwei Brüder aus Fürth“ gezeigt. An-schließend fand ein Gespräch mitZeitzeugen undWeggefährten statt.Freya Klier besuchte das Haus am25. September 2007, um aus ihremBuch „Gelobtes Neuseeland –Fluchten bis ans Ende der Welt“ zulesen, in dem sie das Schicksal jüdi-scher Emigranten beschreibt.Anlässlich der Wechselausstel-
lung „Skandale in Deutschland nach1945“ veranstaltete das Haus derGeschichte ein Podiumsgespräch
und eine Buchvorstellung mitDr. Michael Philipp. Die Publikation„Persönlich habe ich mir nichts vor-zuwerfen“ befasst sich mit politi-schen Rücktritten in Deutschlandvon 1950 bis heute.Im Rahmen der Ausstellung
„Melodien für Millionen. Das Jahr-hundert des Schlagers“ wurde imHaus der Geschichte die Schallplat-tenbar vonWDR 4 aufgezeichnet, inder als Stargast Roberto Blanco auf-trat.
Roberto Blanco trat imRahmenprogramm zurAusstellung „Melodienfür Millionen. Das Jahr-hundert des Schlagers“als Stargast bei der Auf-zeichnung der WDR 4-Schallplattenbar auf.
78
Museumsfeste
Die Internationalen Museums-tage und Bonner Museumsmeilen-feste 2007 und 2008 orientiertensich an den jeweiligen Wechselaus-stellungen sowie der Dauerausstel-lung und boten den Besuchern einspannendes und abwechslungsrei-ches Programm, das sie das Mu-seum auf andere Weise erlebenließ.Am Internationalen Museumstag
2007, unter dem Motto „Museenund universelles Erbe“, richtete sichdas Programm insbesondere an Kin-der und Jugendliche. Im Vorder-grund standen die Sammlungen mit
spannenden Objekten zur Zeitge-schichte. Die „Teen Group“, etwa20 Jugendliche zwischen 16 und 19Jahren, die sich regelmäßig im Hausder Geschichte treffen und die Ar-beit in einem Museum für Zeitge-schichte kennenlernen, begleitenund unterstützen, gestaltete ein at-traktives Programm. Die Jugendli-chen erwarteten die Besucher mitFrage-Stationen in der Ausstellung.Begleitungen durch die Dauer-ausstellung mit Informationen zuausgewählten Objekten und zurSammlungstätigkeit der Stiftungsowie durch das Palais Schaumburgund den Bundesrat standen aufdem Programm.„Museen und gesellschaftlicher
Wandel“ war das Thema des Inter-nationalen Museumstages 2008.Neben Theateraufführungen in derDauerausstellung wurden Beglei-tungen durch die Ausstellung„Melodien für Millionen. Das Jahr-hundert des Schlagers“ angeboten,bei denen Mitglieder der TeenGroup erklärten, wie die National-sozialisten den Volksempfängerals „Massenbeeinflussungsmittel“nutzten.Zum Museumsmeilenfest 2007
stellte das Haus der Geschichte einattraktives Familienprogramm zurAusstellung „Heimat und Exil. Emi-gration der deutschen Juden nach1933“ zusammen. Unter demMotto „...essen Sie nichts auf derStraße!“ wurde auf die Lebensbe-
Typische Speisen ausden Exilländern derjüdischen Emigrantennach 1933 konnten dieBesucher des Muse-umsmeilenfestes 2007mit Michael von derZypen kochen undprobieren, Restaurant-kritiker Helmut Gotemoderierte.
79
Veranstaltungen
Bonn
dingungen im Exil eingegangen. Ge-meinsam mit dem Koch Michaelvon der Zypen konnten die Besu-cher typische Speisen aus den Exil-ländern kochen und probieren.Erläuterungen zum historischenUmfeld ergänzten das Programm;der LILIPUZ-Chefkoch und Journa-list Helmut Gote (WDR) moderierte.Weitere Angebote für Besucherwaren Lesungen mit der Kinder-buchautorin Mirjam Pressler ausihrem Buch „Malka Mai“ über einFlüchtlingsschicksal sowie Swingund Yiddish Folk mit der Band„A Tickle in the Heart“.Das Programm des Museums-
meilenfestes 2008 stand ganz imZeichen des Schlagers. Das musi-kalische Highlight für die kleinen Be-sucher war Detlev Jöcker, einer dererfolgreichsten Komponisten undSänger von Kinderliedern. Die älte-ren Schlagerfans konnten im Mu-seum live bei der Übertragung desEurovision Song Contest in Belgradmitfiebern und für ihren Favo-riten abstimmen. Der Wettbewerbwurde auf einer Großleinwand über-tragen und von Conferencier HeppiHerrlich moderiert. Bekannte Schla-ger in jazzigen Arrangements zumZuhören und Mitswingen präsen-tierte die Gruppe „Sing bar sing“aus Köln. In den Schlager-Musik-workshops konnten die Besucherselbst Mikrofon und Instrumente indie Hand nehmen und herausfin-den, welche Starqualitäten in ihnen
stecken. Wer lieber tanzt, konntedies mit Anleitung in Tanzwork-shops ausprobieren. Tägliche Tur-nusbegleitungen durch die Aus-stellung „Melodien für Millionen.Das Jahrhundert des Schlagers“luden ein, den Schlager als musika-lischen Seismografen gesellschaft-licher und politischer Strömungenkennenzulernen.Einen besonders großen Publi-
kumsansturm erlebte das Hausanlässlich der Kulturnacht am27. September 2008. Klaus Doldin-gers Band „Passport“ begeistertemit Hits und Filmsongs die Jazz-Fans im Foyer des Museums.
Der LiedermacherDetlev Jöcker begeis-terte die kleinenBesucher des Muse-umsmeilenfestes 2008,das ganz im Zeichendes Schlagers stand.
80
Literatur und Kultur
Die erfolgreiche Zusammenar-beit zwischen dem Haus der Ge-schichte und dem Haus der Spracheund Literatur in Bonn, der Volks-hochschule Bonn und dem Robert-Schuman-Institut wurde auch 2007und 2008 mit zahlreichen hochkarä-tigen Veranstaltungen fortgesetzt.Am 23. April 2007 präsentierte
Marie Luise Marjan ihr neues Buch„Freundschaften“.Anfang März 2008 las Julia
Franck im voll besetzten Saal desMuseums aus ihrem erfolgreichenRoman „Die Mittagsfrau“. Nur we-nige Tage darauf fand die Lesung
„Sirenen aus Bagdad“ von YasminaKhadra in französischer Sprachestatt. Ein großer Publikumserfolgwar auch die Autorenlesung mitRaoul Schrott, der in seinem kon-trovers diskutierten Buch „HomersHeimat. Der Kampf um Troja undseine realen Hintergründe“ neueTheorien zum antiken Mythos vor-stellte.Anlässlich der Fußballweltmeis-
terschaft 2006 sowie der Europa-meisterschaft 2008 präsentiertenProf. Dr. Uwe Baumann und Prof.Dr. Dittmar Dahlmann im Sommer2008 ihr Buch „Kopfball, Einwurf,Nachspielzeit“, welches sich rundum die Faszination Fußball dreht. Zu
Foto links:Kooperation mit demHaus der Sprache undLiteratur: Die prominenteAutorin Julia Francklas aus ihrem Buch„Die Mittagsfrau“.
Foto rechts:Ihr neues Buch „Freund-schaften“ präsentierteSchauspielerin MarieLuise Marjan.
81
Veranstaltungen
Bonn
Gast waren unter anderen JensNowotny und Wolfgang Overath.Nach Asien wurden die Besu-
cher im August 2008 von Maria Blu-mencron entführt, die unter demTitel „Auf Wiedersehen Tibet – Aufder Flucht durch Eis und Schnee“multimedial über Kinder auf derFlucht von Tibet ins indische Exil las.Anlässlich des 100. Geburtstags
Simone de Beauvoirs erinnerteAlice Schwarzer am Abend des 28.August 2008 auf Einladung desMontag-Clubs an ihre Freundin undWeggefährtin.
Themenreihen
Im Berichtszeitraum veranstal-tete das Haus der Geschichteverschiedene Themenreihen zu he-rausgehobenen politischen und zeit-geschichtlichen Jahrestagen.Die dreiteilige Veranstaltungs-
reihe „Der ,Deutsche Herbst’ 1977“erinnerte 2007 an die terroristischeBedrohung durch die Rote ArmeeFraktion (RAF). Den Auftakt dieserReihe bildete der Vortrag „30 Jahredanach: Der Deutsche Herbst ausSicht eines Staatsanwalts“ von Ge-neralstaatsanwalt Klaus Pflieger, derin den 1970er Jahren als jungerBundesanwalt einer der Anklägerder RAF-Terroristen war. SPIEGEL-Chefredakteur Stefan Aust widmetesich am 15. Oktober 2007 im Ge-spräch mit dem Präsidenten der
Stiftung Haus der Geschichte,Hans Walter Hütter, der medialenAuseinandersetzung mit diesemThema. Zum Abschluss dieserReihe diskutierten Clais Baron vonMirbach, Dr. Wolfgang Kraushaar,Prof. Dr. Joachim Scholtyseck undMoritz Müller-Wirth den aktuellenForschungsstand und näherten sichdem Thema auch unter dem Ge-sichtspunkt „Täter und Opfer“.2008 beschäftigte sich die The-
menreihe „40 Jahre danach – wasbedeutet ’68 heute?“ mit einem bisin die Gegenwart heftig diskutiertenThema: Der Prager Frühling und dieStudentenbewegung der späten1960er Jahre. In der Veranstal-tungsreihe des Hauses der Ge-schichte kamen Zeitzeugen undExperten zu Wort, analysierten unddiskutierten internationale Bezüge,Hintergründe und Folgen der 68erBewegung. Den Anfang machteein Zeitzeugengespräch mit PavelKohout, einem der Wortführer desPrager Frühlings.Es folgte eine Diskussion über
„‘68 in globaler Perspektive“ mitProf. Dr. Ingrid Gilcher-Holtey, Prof.Dr. Gert Languth und Prof. Dr.Joachim Scholtyseck.Einen Vergleich des politischen
Engagements der Studenten da-mals und heute sowie eine Beurtei-lung der Studentenbewegungwagten der Historiker PD Dr. PhilippGassert und Gerd Appenzeller vomBerliner Tagesspiegel.
SPIEGEL-ChefredakteurStefan Aust sprach mitHans Walter Hütter überdie Verfilmung seinesBuches „Der Baader-Meinhof-Komplex“.
82
Im Rahmen des 60-jährigen Ju-biläums des Staates Israel fand imMuseum die Reihe „60 Jahre Israel“statt. Den Auftakt bildete eine Le-sung mit Olivier Guez, der die fran-zösische Sicht auf Israel schilderte.Aus einer anderen Perspektivebeleuchtete die jüdische Autorin Ye-hudit Kirstein Keshet den Nahost-konflikt.Höhepunkt war die Eröffnung
der israelischen Filmreihe in Koope-ration mit der Bonner Kinemathekdurch den Botschafter des StaatesIsrael in Deutschland, Yoram Ben-Zeev, am 19. November 2008.
Symposien
Im Jahr 2008 fanden im Hausder Geschichte zwei große Sympo-sien statt.Am 22. Februar 2008 war die
Forschungsgemeinschaft 20. Juli1944 mit dem Symposion „Der mi-litärische Widerstand gegen Hitlerim Lichte neuer Kontroversen“ zuGast. Mit Spannung verfolgten be-sonders die Nachfahren Stauffen-bergs und andere Mitglieder desWiderstands gegen Hitler, das Fach-publikum und die Presse die zahlrei-chen Vorträge zur historischenDebatte.Im Rahmen des Beethovenfes-
tes Bonn, welches 2008 unter demMotto „Macht und Musik“ stand,lud das Haus der Geschichte in Ko-
Zum Symposion „Dermilitärische Widerstandgegen Hitler im Lichteneuer Kontroversen“kamen prominenteHistoriker und Spezialis-ten nach Bonn, darunterPeter Hoffmann,Verfasser einer Biografieüber Claus Schenk Grafvon Stauffenberg.
83
Veranstaltungen
Bonn
operation mit dem BeethovenfestBonn und der Bundeszentrale fürpolitische Bildung zu dem Sympo-sion „Musik ist nicht mehr eineSache der Wenigen“ und einer Film-reihe ein. Das Symposion, bei demrenommierte Musikwissenschaftlerzugegen waren, behandelte exem-plarisch anhand der Beispiele Schla-ger, „Lagerlied“ und Musiktheaterdie Frage „Kann Musik (un)politischsein?“. Eine Filmdokumentation be-schäftigte sich mit der Situation derBerliner Philharmoniker währendder Zeit des Nationalsozialismus.
Politik und Gesellschaft
Einen Schwerpunkt im Veran-staltungsprogramm des Hauses derGeschichte bildeten Vorträge, Dis-kussionsrunden und Buchvorstel-lungen zu historischen, politischenund gesellschaftlichen Themen.Diese Veranstaltungen werden häu-fig mit langjährigen Kooperations-partnern durchgeführt. Zu diesenPartnern zählen zum Beispielpolitische Stiftungen wie die Kon-rad-Adenauer-Stiftung oder dieFriedrich-Ebert-Stiftung, die Deut-sche Gesellschaft für AuswärtigePolitik, die Deutsche AtlantischeGesellschaft oder die EuropäischeFöderalismusakademie Bonn.Zu Beginn des Jahres 2007 stell-
ten Hermann und Gerda Weber ihrBuch „Leben nach dem Prinzip
links“ im Informationzentrum desHauses vor. Es schildert ihr politischbewegtes Leben sowie persönlicheErfahrungen und Begegnungen ausfünf Jahrzehnten.In Zusammenarbeit mit der
Konrad-Adenauer-Stiftung präsen-tierten die Brüder Dr. Bernhard undDr. Hans-Jochen Vogel am 11. April2007 ihr erfolgreiches Buch„Deutschland aus der Vogel-Per-spektive“.
Die Brüder Hans-Jochenund Bernhard Vogelbei der Präsentationihres Buches„Deutschland aus derVogel-Perspektive“ imHaus der Geschichte
84
Im Rahmen der Vortragsveran-staltung „Stand der Föderalismus-reform II“ besuchte der Vorsitzendeder SPD-Bundestagsfraktion, PeterStruck MdB, am 27. Juni 2007 dasMuseum und hielt einen Vortragüber die Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen.Anlässlich des 50-jährigen Be-
stehens des Hilfswerks Misereorfand im Januar 2008 ein entwick-lungspolitischer Fachkongress imHaus der Geschichte statt. Unterdem Titel „Mit Zorn und Zärtlichkeitan der Seite der Armen“ begrüßteModerator Peter Frey unter ande-rem BundesentwicklungsministerinHeidemarie Wieczorek-Zeul undProf. Dr. Klaus Töpfer.
Foto oben:Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion PeterStruck MdB (l.) im Ge-spräch mit Joachim West-hoff (General-AnzeigerBonn) über die Reformder Bund-Länder-Finanz-beziehungen
Foto rechts:Staatsministerin MariaBöhmer (l.) war zu Gastbeim Forum „Integration –Schlüsselaufgabe für diechristlichen Demokraten“.
Foto Seite 85:„Helden: verehrt –verkannt – vergessen“:Unter diesem Motto fanddie Auftaktveranstaltungfür Nordrhein-Westfalenzum Geschichtswettbe-werb des Bundespräsiden-ten 2008 im Haus derGeschichte statt.
85
Veranstaltungen
Bonn
In Kooperation mit der Bundes-kanzler-Willy-Brandt-Stiftung prä-sentierte die Stiftung Haus derGeschichte am 28. Februar 2008das Buch „Willy Brandt. Verbrecherund andere Deutsche. Ein Berichtaus Deutschland 1946“.Zum 10-jährigen Bestehen des
Deutsch-Türkischen Forums veran-staltete die Konrad-Adenauer-Stif-tung am 29. Februar 2008 ein Forumzum Thema „Integration – Schlüs-selaufgabe für die christlichen De-mokraten“. Den Festvortrag hielt dieIntegrationsbeauftragte des Bundes,Staatsministerin Maria Böhmer.Besonders interessant für Ju-
gendliche waren die AktionstagePolitische Bildung der Bundeszen-trale für politische Bildung im Mai2008. WDR-Rundfunk-ModeratorManni Breuckmann moderierte dieQuizshow „Klima – Umwelt – Wis-sen“, bei der Olli Briesch, BarbaraElligmann, Ilka Eßmüller und IngoOschmann die Fragen beantwortenmussten.„Helden: verehrt – verkannt –
vergessen“ lautete der Titel des Ge-schichtswettbewerbs 2008 desBundespräsidenten, den die Körber-Stiftung organisiert. Die Auftaktver-anstaltung für Nordrhein-Westfalenmit Joachim Gauck fand am 3. Sep-tember 2008 im Haus der Ge-schichte statt.Viele Geschichtsinteressierte be-
suchten im Oktober 2008 eine Ko-operationsveranstaltung mit der
Stiftung Konrad-Adenauer-Haus, inder Prof. Dr. Arnulf Baring zumThema „Das Ende der Westbin-dung? Deutsche Außenpolitik vonBismarck bis Merkel“ referierte.
Stiftungstag
Der Verein für Bonner Stiftungene. V. veranstaltete am 1. Dezember2007 im Haus der Geschichte den1. Bonner Stiftungstag.Nach einer Studie des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungenliegt Bonn im Städteranking deut-scher Großstädte nach Stiftungs-dichte bundesweit auf Platz drei –
hinter Frankfurt/Main und Hamburg.Diese Studie bestätigte den Vereinfür Bonner Stiftungen in seiner Ab-sicht, das herausragende Wirkender vielen Stiftungen in der Regioneiner breiten Öffentlichkeit vorzu-stellen.Im Foyer des Hauses der Ge-
schichte präsentierte sich ein„Markt der Stiftungen“, auf dem an-schauliche Beispiele für Stiftungsar-beit in den unterschiedlichstenBereichen gezeigt wurden. Darüberhinaus hielten ausgewiesene Ex-perten zahlreiche Fachvorträge undinformierten rund um das Thema„Stiften“.
86
Veranstaltungen
im Palais Schaumburg
Im Jahr 2007 setzte das Hausder Geschichte in Kooperation mitdem Beethoven Orchester Bonn dieim Vorjahr begonnene Reihe „Pa-laiskonzerte“ fort. An drei Abendenwidmete sich das Ensemble operanova aus Zürich im historischenSpeisesaal des Palais Schaumburgder Musik nach 1945. Die in unter-schiedlicher Besetzung vorgetrage-nen Stücke – mal als Bläserquintettoder an zwei Klavieren – boten ein-drucksvolle Beispiele avantgardisti-scher Kompositionen.Anlässlich des Tages der offe-
nen Tür am 19. August 2007 nah-men über 7.000 Besucher dieGelegenheit wahr, die historischenRäume des Palais Schaumburg zubesichtigen. Im Mittelpunkt des au-ßerordentlich großen Interessesstand einmal mehr das ehemaligeKanzlerarbeitszimmer, in dem unter
anderem der Schreibtisch von Kon-rad Adenauer zu sehen ist. Beson-deren Anklang fand bei denzahlreichen Besuchern ein histori-sches Mercedes 300 Cabriolet.2008 startete das Haus der Ge-
schichte eine neue Veranstaltungs-reihe: Zeitzeugengespräche anhistorisch-politischen Orten in Bonn.Den Auftakt der Reihe, die das Hausin Zusammenarbeit mit der Volks-hochschule Bonn durchführte, bil-dete am 22. April 2008 eineGesprächsrunde im Palais Schaum-burg. Die ehemaligen Staatssekre-täre Hans Neusel und ManfredSchüler diskutierten mit Dr. KlausWiegrefe vom SPIEGEL über dasRegierungshandeln damals undheute. Sie gaben spannende Einbli-cke in ihre Arbeit mit den ehemali-gen Bundeskanzlern Kurt GeorgKiesinger und Helmut Schmidt.
Am 22. und 23. Oktober 2008fand im Palais Schaumburg einewissenschaftliche Tagung über „Die,alte’ Bundesrepublik in neuen Per-spektiven“ statt. Gemeinsam mitder Johannes Gutenberg-UniversitätMainz beschritt die Stiftung bei derDurchführung neue Wege. Auf dasübliche akademische Wechselspielvon Vortrag und Diskussion wurdeverzichtet, stattdessen debattiertennamhafte Zeithistoriker der jünge-ren Generation offen, spontan undungezwungen über die Geschichteder Bundesrepublik Deutschland biszur Wiedervereinigung.
Über 7.000 Besucherkamen zum Tag deroffenen Tür insPalais Schaumburg.
87
Veranstaltungen in historischen Gebäuden in Bonn
Palais Schaumburg
Bundesrat
Veranstaltungen
im Bundesrat
Auch der Bundesrat Bonnwar am Tag der offenen Tür 2007für Besucher geöffnet. So konntender Plenarsaal, das ehemalige Präsi-dentenzimmer und die Ausschuss-räume sowie das Informations-zentrum Föderalismus besichtigtwerden.Zum Auftakt der Kooperation des
Hauses der Geschichte mit der Her-tie-Stiftung fand am 28. November2007 eine Debatte der Bundessie-ger von „Jugend debattiert“ stattüber die Frage „Soll das Wahlalterauf 16 Jahre gesenkt werden?“.Zuvor hatte Joachim Gauck, ehe-maliger Bundesbeauftragter für die
Unterlagen des Staatssicherheits-dienstes der ehemaligen DDR, vorden rund 200 Schülerinnen undSchülern einen beeindruckendenVortrag über das Erinnern gehalten.Am 11. November 2008 setzte
das Haus der Geschichte im Plenar-saal des Bundesrats Bonn die Zeit-zeugengespräche an historisch-politischen Orten fort.Zahlreiche Zuhörer verfolgten die
Ausführungen von Dr. BernhardVogel, dem ehemaligen Minister-präsidenten von Rheinland-Pfalzund Thüringen, und Dr. HenningVoscherau, ehemaliger Erster Bür-germeister der Freien und Hanse-stadt Hamburg, über den Einflussdes Bundesrats auf die Bundes-politik.
„Jugend debattiert“im Bundesrat: EineKooperation der Hertie-Stiftung mit dem Hausder Geschichte
88
Veranstaltungen im
Zeitgeschichtlichen Forum
Leipzig
Mit seinem vielfältigen undanspruchsvollen Veranstaltungspro-gramm hat sich das Zeitgeschichtli-che Forum als anerkannter undbeliebter Veranstaltungsort in Leipzigetabliert. Mit über 200 Veranstaltun-gen und mehr als 16.000 Teilneh-mern war 2008 das besucher-stärkste Jahr im Veranstaltungsbe-reich seit der Eröffnung des Hauses1999. Positiv wirkte sich dabei dielangjährige gute Zusammenarbeitmit dem Deutschlandfunk, der Leip-ziger Volkszeitung, dem Mitteldeut-schen Rundfunk sowie mit ver-schiedenen Leipziger Institutionenwie dem Polnischen Institut und derUniversität aus.
Begleitprogramme
Ein wesentlicher Bestandteil desVeranstaltungsprogramms sind dieBegleitveranstaltungen zu denWechselausstellungen: Im Rahmender Ausstellung „Flucht, Vertrei-bung, Integration“, die vom Dezem-ber 2006 bis zum April 2007 inLeipzig zu sehen war, bot das Zeit-geschichtliche Forum in Koopera-tion mit der Bundeszentrale fürpolitische Bildung ein umfangrei-ches Rahmenprogramm aus Fil-men, Diskussionen und Lesungen.So spiegelte eine Filmreihe den Um-gang mit dem Thema Vertreibung inden verschiedenen Jahrzehnten seit1945 und machte gleichzeitig deut-lich, dass es sich um eine Proble-matik von europäischer Dimensionhandelt. Besonders bewegend wardie szenische Lesung aus Tagebü-chern, Briefen und Erinnerungenunter dem Titel „Wir waren keineMenschen mehr“, die in Zusam-menarbeit mit medica mondialee. V. stattfand und speziell auf dasSchicksal der Frauen aufmerksammachte.Anlässlich der Präsentation von
„drüben. Deutsche Blickwechsel“von Mai bis Oktober 2007 setztedas Zeitgeschichtliche Forum seineerfolgreiche Zusammenarbeit mitdem Deutschlandfunk und derLeipziger Volkszeitung fort. In einerGesprächsrunde beleuchteten Jour-nalisten den „anderen Blick“, den
Foto Seite 88:Schauspielerin MariaFurtwängler besuchtedie Wechselausstellung„Flucht, Vertreibung,Integration“ (v.l.n.r.:Rainer Eckert, Direktordes ZeitgeschichtlichenForums Leipzig, JürgenReiche, Ausstellungs-direktor, und MirjamJahr, Gruppenbegleiterinim ZeitgeschichtlichenForum Leipzig).
Foto Seite 89:Im Begleitprogrammzur Wechselausstellung„Heimat und Exil. Emi-gration der deutschenJuden nach 1933“ tratdie SchauspielerinKatrin Troendle in demMusical „Heute Abend:Lola Blau“ auf.
89
Veranstaltungen
Leipzig
sie als „Westkorrespondenten“ aufdie DDR hatten. Besonders faszi-nierte dabei ihre Rolle als Mittlerzwischen Ost und West. EinigeJournalisten nutzten trotz schwie-riger Arbeitsbedingungen ihre Mög-lichkeiten, um auch den Bürger-rechtlern ein Sprachrohr zu bieten,das über Westfernsehen und -rund-funk in die DDR zurückwirkte. Er-gänzt wurde dies durch eineVortragsreihe mit renommiertenHistorikern über Schlüsselereig-nisse der deutsch-deutschen Ge-schichte, Lesungen und Filme.Ein Höhepunkt des Begleitpro-
gramms zur Ausstellung „Heimatund Exil“ von Dezember 2007 bisMärz 2008 war die Aufführung desMusicals „Heute Abend: Lola Blau“.Der Autor Georg Kreisler, der selbst1938 vor den Nationalsozialisten indie USA fliehen musste, schildertdarin das Emigrantenschicksal einerjungen jüdischen Künstlerin – einernstes Thema, mit Witz und Ironieauf die Bühne gebracht. Tief bewegtwaren die Zuschauer auch vomLeben der jüdischen Pianistin AliceSommer-Herz, das der FilmemacherMichael Teutsch in seiner Doku-mentation „Von der Hölle ins Para-dies oder Chopin hat mich gerettet“nachgezeichnet hat, die er im Ja-nuar 2008 im ZeitgeschichtlichenForum vorstellte. Im Rahmen derBuchmesse präsentierte im Märzunter anderem die israelische Kom-ponistin Ella Milch-Sheriff ihre Auto-
biografie „Ein Lied für meinenVater“, in der sie eindrucksvoll dieschwere seelische Bürde schildert,die auf der zweiten Generation derHolocaust-Überlebenden lastet.
90
Den Auftakt des Begleitpro-gramms zur Wechselausstellung„Skandale in Deutschland nach1945“ von Mai bis Oktober 2008bildete eine ebenso unterhaltsamewie nachdenklich stimmende Dis-kussion zum Thema „Der politischeSkandal und die Rolle der Medien“.Auf Einladung des Zeitgeschichtli-chen Forums, des Deutschland-funks und der Leipziger Volks-zeitung diskutierten der PublizistGünter Wallraff, die ehemaligeschleswig-holsteinische Minister-präsidentin Heide Simonis, der lang-jährige Stern-Redakteur MichaelSeufert und Michael Haller, Profes-sor für Journalistik, unter der Lei-tung von Rainer Burchardt über dieMacht der Medien. Deren Miss-brauch dokumentierte auf beklem-mende Art der Film „Sebnitz – Dieperfekte Story“ – ein Lehrstück fürdie Rolle der Medien in unserer Ge-sellschaft.Den Abschluss bildete ein Ge-
spräch zwischen dem Kommuni-kationswissenschaftler Prof. Dr.Ansgar Zerfaß und Dr. MichaelPhilipp über sein Buch zur Ge-schichte der politischen Rücktrittein Deutschland seit 1950, das glei-chermaßen amüsante wie erhel-lende Details über die Mechanis-men unserer politischen Kulturlieferte.
Foto oben:Ehemalige Korrespon-denten aus Ost undWest diskutierten überihre Arbeit im jeweilsanderen Teil Deutsch-lands mit ModeratorHenning von Löwis:Peter Pragal, RalfBachmann, PeterJochen Winters, PeterWensierski (v.l.n.r.).
Foto rechts:Über politischeSkandale und die Rolleder Medien sprachenu. a. die ehemaligeMinisterpräsidentinSchleswig-HolsteinsHeide Simonis und derSchriftsteller GünterWallraff.
91
Veranstaltungen
Leipzig
Literatur und Film
Das Zeitgeschichtliche Forumpräsentierte sich auch 2007 und2008 als wichtiger Veranstaltungs-ort anlässlich des jährlich im Rah-men der Leipziger Buchmessestattfindenden Lesefestes „Leipzigliest“. In Kooperation mit zahlrei-chen Verlagen fanden in beidenJahren Lesungen, Buchvorstellun-gen und Gespräche zu aktuellenund historischen Themen statt. Sodiskutierte am 22. März 2007 ClaasDanielsen, Direktor des LeipzigerDOK-Filmfestivals, mit den beidenPreisträgern des Leipziger Buch-preises zur Europäischen Verständi-gung Gerd Koenen und MichailRyklin. Der Theologe FriedrichSchorlemmer stellte zwei Tage spä-ter im voll besetzten Saal sein Buch„Lass es gut sein. Ermutigung zueinem gelingenden Leben“ vor. ImRahmen der Podiumsdiskussion„Goodbye DDR – Vergessen wir un-sere Vergangenheit?“ am 13. März2008 stellte Hermann Vinke seinSachbuch über die DDR vor und dis-kutierte mit Joachim Gauck über dieNotwendigkeit, insbesondere jun-gen Menschen dieses jüngste Kapi-tel deutscher Zeitgeschichte zuvermitteln. Ein spannendes Ge-spräch entspann sich zwischen denAutoren Andrea Röpke und AndreasSpeit. Sie deckten in „Neonazis inNadelstreifen. Die NPD auf demWeg in die Mitte der Gesellschaft“
die verschiedenen Strategien derNPD auf, in Deutschland eine rechteAlltagskultur zu etablieren. Nicht zu-letzt widmeten sich viele Neuver-öffentlichungen dem historisch be-deutsamen Jahr 1968. So war der„Frühling in Prag 1968“ Themaeiner Podiumsdiskussion zwischendem ehemaligen tschechischenBotschafter František Cerný, demPolitikwissenschaftler Prof. Dr.Dieter Segert und dem HistorikerRainer Eckert, die in Kooperation mitder Bundeszentrale für politischeBildung stattfand. Der JournalistPetr Brod moderierte die Runde undfragte nach den Konzepten und demScheitern des Prager Frühlings.
Der Bürgerrechtlerund Theologe FriedrichSchorlemmer stelltezur Leipziger Buch-messe 2007 sein Buch„Lass es gut sein.Ermutigung zu einemgelingenden Leben“vor.
`́
92
Als ein weiterer Veranstaltungs-schwerpunkt haben sich Vorauffüh-rungen von Dokumentar- undSpielfilmproduktionen in Koopera-tion mit öffentlich-rechtlichen Sen-deanstalten etabliert. So behandeltedie ZDF-Spielfilmproduktion „An dieGrenze“ am 18. Oktober 2007 dasThema Schießbefehl aus der Sichteines DDR-Grenzsoldaten. DerMDR zeichnete im Februar 2008mit der Dokumentation „Ein Artikelzuviel. Anna Politkowskaja und dasSystem Putin“ den persönlichenund politischen Weg der 2006 er-mordeten Journalistin nach undzeigte zugleich ein kritisches BildRusslands in der „Ära Putin“. DieLiebesgeschichte eines Stasi-Offi-ziers zu einer DDR-Oppositionellenwährend ihrer Inhaftierung – verar-beitet im Spielfilm „Zwölf heißt: Ichliebe dich“ – verfolgten am 2. April2008 die Besucher im bis auf denletzten Platz besetzten Veranstal-tungssaal des ZeitgeschichtlichenForums. Anschließende Diskussio-nen boten dem Publikum Gelegen-
heit, auch kontrovers mit Filmema-chern, Redakteuren und Schauspie-lern ins Gespräch zu kommen.Eine neue und höchst erfolgrei-
che Veranstaltungsreihe startetedas Zeitgeschichtliche Forum An-fang 2008: Der „Film des Monats“widmet sich dem Schaffen von Fil-memachern im geteilten und ver-einten Deutschland. Dabei handeltes sich um Dokumentar- und Spiel-filme, die sich mit den jeweiligengesellschaftlichen Wirklichkeitenoffen, kritisch, aber auch humorvollauseinandersetzen. Eröffnet wurdedie Reihe im Januar mit einer Werk-schau des 2007 verstorbenen ge-sellschaftskritischen Schriftstellersund Dramatikers Ulrich Plenzdorf.Von April bis Juni 2008 waren unterdem Titel „zensiert – Regalfilme derDEFA“ jene politisch unbequemenFilme zu sehen, die auf dem 11. Ple-num des ZK der SED 1965 verbotenwurden und erst mit der Wiederver-einigung in die deutschen Kinos ge-langten. Meist junges Publikumströmte in die Dokumentarfilme, die
Anlässlich des 50. Inter-nationalen LeipzigerFestivals für Dokumen-tar- und Animationsfilmhielt der Berliner Autorund Dozent GünterJordan den Eröffnungs-beitrag zum Symposium„Identitäten einesFestivals“.
93
Veranstaltungen
Leipzig
sich mit den verschiedenen Ju-gendkulturen der 1980er Jahre inder DDR beschäftigten. So zeich-nete der Regisseur Nico Raschickein spannendes Porträt der DDR-Breakdanceszene, in dem die Be-geisterung der einstigen Akteureebenso spürbar wird wie der ratloseUmgang des Staates mit einer Sub-kultur, die ihre Wurzeln in den Ghet-tos amerikanischer Großstädte hat.Die Veranstaltungsreihe zählte bis-her über 1.000 Besucher.
Diskussionen
Etablierte Veranstaltungsreihenwie das Leipziger Europaforum unddie Podiumsdiskussionen in Zusam-menarbeit mit dem Deutschland-funk und der Leipziger Volkszeitungfanden im Berichtszeitraum ebensoein interessiertes Publikum wie diezahlreichen Tagungen, Kongresseund Diskussionsveranstaltungen zuEinzelthemen. Das Zeitgeschichtli-che Forum konnte damit seinePosition als Ort für kontroverse Aus-einandersetzungen mit der deut-schen und europäischen Geschich-te über die Grenzen Leipzigs hinausfestigen.Das zweimal jährlich stattfin-
dende Europaforum behandelteu. a. Fragen der europäischen Inte-gration, einer gemeinsamen EU-Au-ßenpolitik sowie der europäischenErinnerungskultur. So diskutierten
am 24. März 2007 die Publizistin Dr.Helga Hirsch, der tschechische His-toriker Matej Spurný, der Direktordes Zentrums für Historische For-schung Berlin der Polnischen Aka-demie der Wissenschaften, Prof.Dr. Robert Traba, und der LeipzigerHistoriker Dr. Stefan Troebst über„Flucht und Vertreibung europäischerinnern? Das ‚deutlich sichtbareZeichen’ gegen Vertreibungen“. Am15. März 2008 erörterten der Histo-riker und Publizist Gerd Koenen,Oleg Krasnickij, stellvertretenderDirektor der Europaabteilung fürInnen- und Außenpolitik im Ministe-rium für Auswärtige Angelegenhei-ten der Russischen Förderation, die
Das 14. LeipzigerEuropaforum widmetesich dem außenpoliti-schen Verhältnis zwi-schen Russland undder Europäischen Union(v.l.n.r.: Gerd Koenen,Oleg Krasnickij, EckartD. Stratenschulte,Gabriele Krone-Schmalz).
94
Fernsehjournalistin und Dr. Gabri-ele Krone-Schmalz und CzesławPorebski, Professor für europäischeStudien an der Jagiellonen-Universi-tät Krakau, unter der Leitung vonProf. Dr. Eckart D. Stratenschulte,Leiter der Europäischen AkademieBerlin, die Frage „Russland und dieEU: Bewährungsprobe einer euro-päischen Außenpolitik?“.Das „MDR Radiocafé“, eine Hör-
funkreihe des MitteldeutschenRundfunks, nahm die Veröffentli-chung der Studie „Das Deutsch-Deutsche Geheimnis“ zum Anlass,am 28. Oktober 2007 unter demTitel „Verostet der Westen? Deut-sche Gefühle im 18. Jahr“ die Jour-
nalisten Angela Elis und MichaelJürgs sowie den Autor der StudieAlexander Mackat einzuladen. Unterder Leitung des MDR-ModeratorsThomas Bille wurde die deutsch-deutsche Gefühlslage 17 Jahrenach der Wiedervereinigung bewer-tet.Kontrovers diskutierten am
12. November 2008 Historiker, Zeit-zeugen und engagierte Besucherdie Ereignisse in Berlin und Leipzigim Oktober 1989 und die Rolle derbeiden Städte in der friedlichen Re-volution – eine Gemeinschaftsver-anstaltung des ZeitgeschichtlichenForums und des Berliner Landesbe-auftragten für die Unterlagen desStaatssicherheitsdienstes der ehe-maligen DDR.Die Erinnerung an den 9. Okto-
ber 1989 – erster Höhepunkt derfriedlichen Revolution in der DDR –bot 2008 bereits zum achten MalAnlass für ein internationales wis-senschaftliches Symposion. Iminternationalen Vergleich gingennamhafte Historiker aus dem In-und Ausland, darunter Jörg Barbe-rowski, Professor für GeschichteOsteuropas an der Humboldt-Uni-versität Berlin, Alexander Vatlin, Pro-fessor für deutsche Geschichtean der Lomonossow-UniversitätMoskau, Prof. Dr. Horst Möller,Direktor des Instituts für Zeitge-schichte München/Berlin, undProf. Dr. Piotr Madajczyk von derPolnischen Akademie der Wissen-
Zum Livetalk „MDRRadiocafé“ spielte dieSteierisch-LeipzigerBläserformation „SmartMetal Hornets & DIX“im ZeitgeschichtlichenForum Leipzig.
,
95
Veranstaltungen
Leipzig
schaften Fragen zum Umgang mitFaschismus, Nationalsozialismus so-wie den kommunistischen Diktatu-ren Mittel- und Osteuropas nach.
Highlights
Die Museumsnächte gehörtenauch 2007 und 2008 zu den Höhe-punkten des Veranstaltungspro-gramms im ZeitgeschichtlichenForum. Am 21. April 2007 stand die8. Leipziger Museumsnacht unterdem Motto „Augen auf und durch-geblickt“. Eine besondere Attraktionwar die Spielshow „Samstagsma-ler“, bei der die erfolgreicheARD-Sendung „Montagsmaler“ fürdiesen Abend wiederbelebt wurde.Prominente Kandidaten bildeten dieTeams des Mitteldeutschen Rund-funks, der Leipziger Volkszeitung,der Deutschen Frauenhandball-meisterinnen des HCL sowie derModeratoren des RadiosendersPSR, die sich ein amüsantes undturbulentes Duell lieferten, aus demder MDR als Sieger hervorging.Auch der Schnellzeichner und Kari-katurist Achim Jordan, der die Be-sucher in Windeseile portraitierte,und eine Lesestunde für Kinderlockten zahlreiche Gäste an.2008 stand das Fest ganz im Zei-
chen des Themas „Privat“. Ein mu-sikalisch-literarisches Programm desLiedermachers Stephan Krawczyksowie Schmalfilmaufnahmen von
Ostseeurlaub, Tanzstunde oderHausbau zeigten die private Seiteder DDR. Im Foyer lud die Weima-rer Künstlerin Anke Heelemann dieBesucher ein, in die Welt vergesse-ner Fotos einzutauchen, die sie aufFlohmärkten oder bei Haushaltsauf-lösungen zusammengetragen hatte.Unterstützt wurde sie dabei vondem Schauspieler und Improvisati-onskünstler Thorsten Giese, der ge-meinsam mit dem Publikum denunbekannten Menschen auf denFotos ihre verlorene Geschichtewiedergab.
Aus der Spielshow „DieSamstagsmaler“ bei der8. Leipziger Museums-nacht ging das Teamdes MDR als Siegerhervor: Moderator PaulFröhlich mit „Brisant“-Chefredakteur HansMüller-Jahns, einemTeilnehmer aus demPublikum, TV-Modera-torin Anja Petzold undMarketing-ExpertinMaike Beilschmidt(v.l.n.r.).
96
Auftakt zur Veranstaltungsreihe
„Alltag in der DDR“
Ein Zeitzeugengespräch zumThema „Alltag in der DDR“ am 29.Oktober 2008 war die erste Veran-staltung der Stiftung Haus derGeschichte der BundesrepublikDeutschland an ihrem BerlinerStandort in der KulturBrauerei. DerPodiumsdiskussion werden weitereVeranstaltungen folgen, die durchihre Themen die künftigen Ausstel-lungen ergänzen.
Für die Zielsetzung der Samm-lung Industrielle Gestaltung – einekritische Auseinandersetzung mitdem gegenständlichen Erbe derDDR zu ermöglichen – bildete dieDiskussion „Alltag in der DDR“einen gelungenen Auftakt: Die heu-tige Wahrnehmung des Lebens inder DDR war der Schwerpunkt derPodiumsdiskussion, die von AlfredEichhorn (rbb/Rundfunk Berlin Bran-denburg) moderiert wurde. Wiewichtig die Auseinandersetzung mitder Geschichte der DDR fern vonjeglicher Ostalgie ist, unterstrichJoachim Gauck, erster Bundesbe-auftragter für die Unterlagen desStaatssicherheitsdienstes der ehe-maligen DDR. Er erzählte von seinerbewussten Entscheidung als Pfarrerin Rostock, das Land nicht zu ver-lassen, um vor Ort etwas bewirkenzu können. Die DDR sei ein Un-rechtsstaat gewesen: „Das Fehlendemokratischer Grundrechte unddie Verfolgung Andersdenkendersollten nicht beschönigt werden“,bekräftigte Gauck. Zugleich warnteer davor, sich an diese Epoche nurunter dem Gesichtspunkt derUnterdrückung durch die Staats-sicherheit zu erinnern: „Neben derwichtigen Aufgabe, die Gedenkstät-ten erfüllen, müssen bei der Aufar-beitung der DDR-Geschichte alleFacetten berücksichtigt werden. DieFormung der Menschen in der DDRgeschah oft unbemerkt und in vie-len Lebensbereichen“, so Gauck.
Auftakt mit Diskussion:Johanna Sänger, wiss.Mitarbeiterin der Samm-lung Industrielle Gestal-tung, Hans WalterHütter und dieDiskussionsteilnehmerRobert Ide, JoachimGauck sowie ModeratorAlfred Eichhorn (v.l.n.r.).
97
Veranstaltungen
Berlin
Das sei vor allem der jungen Gene-ration nicht bewusst.Das Thema bot einen hohen ak-
tuellen Bezug: In den gegenwärti-gen öffentlichen Debatten reicht dieBewertung der DDR von der aus-schließlichen Reduktion auf dieTätigkeit des Ministeriums fürStaatssicherheit bis zur Verklärungder SED-Diktatur. Während überHerrschaft und Repression in derDDRmittlerweile vieles bekannt ist,bleibt das Alltagsleben offen für un-terschiedlichste Deutungen undauch Rechtfertigungen. Diese De-batte nahmen die beiden Rednerzum Anlass, über mögliche Ursa-chen einer gespaltenen Erinnerung,vor allem unter den Ostdeutschen,und ihre Bedeutung für das heutigeDeutschlandbild zu diskutieren.Robert Ide, heute Sportjournalistdes Berliner „Tagesspiegel“ undAutor des Buches „Geteilte Träume.Meine Eltern, die Wende und ich“,sah eine unterschiedliche Erinne-rungskultur, vor allem zwischen denGenerationen. Dadurch, dass dasLeben vieler Ostdeutscher nach derWiedervereinigung so tiefgreifendumgestaltet worden sei, gebe esgenerationsbedingte Unterschiedein der Erinnerung. Zwischen ihm,der die DDR nur als Jugendlicher er-lebt habe, und seinen Eltern, dieden größten Teil ihres Lebens in derDDR verbracht hätten, herrscheheute aufgrund der unterschiedli-chen historischen Bewertungen
eine gewisse Sprachlosigkeit. Einelebhafte Diskussion der rund 100Gäste mit den Teilnehmern des Po-diumsgesprächs beendete die ersteVeranstaltung dieser Art in derSammlung Industrielle Gestaltungund dokumentierte den immer nochgroßen Gesprächs- und Erklärungs-bedarf über die verschiedenen Fa-cetten der Erinnerung an die DDR.
Der erste Bundesbeauf-tragte für die Unterlagendes Staatssicherheits-dienstes der ehemaligenDDR, Joachim Gauck(M.), sprach mit „Tages-spiegel“-JournalistRobert Ide (l.) über denAlltag in der DDR.
100
Basis einer Sammlungsstrategie mitdrei Schwerpunkten:„Systematisches Sammeln nachGattungen“, „Sammeln und Aus-stellen“, „Von der Straße ins Mu-seum“.
Beispielhaft werden in der Folgeausgewählte Objekte vorgestellt,die nach diesen Kriterien erworbenwurden.
Sammeln zur Zeitgeschichte
Systematisches Sammeln
nach Gattungen
Mit mehr als 75.000 Zeichnun-gen besitzt die Stiftung eine dergrößten Karikaturensammlungenvon Originalen zur deutschen Zeit-geschichte. Die Bestände wurden2007 in die Karikaturengalerie desMuseums eingelagert. Parallel hier-zu wird hier eine Ausstellung prä-sentiert.
Ein Schwerpunkt bei der Erwei-terung der Karikaturensammlunglag auf dem Erwerb von Arbeitendes Karikaturisten Sebastian Krügerund des Zeichnerduos Achim Gre-ser und Heribert Lenz.
Greser und Lenz gehören derjüngeren Karikaturistengenerationan. Sie knüpfen in ihrer Art zu zeich-nen bewusst an Comics an. DieKarikaturen sind Highlights in der„FAZ“, im „Stern“ und in der „Tita-nic“. 42 ausgewählte Blätter hat dasHaus der Geschichte übernommen.
Foto Seite 100:
Die Karikaturengalerie
des Hauses der
Geschichte ist seit 2007
neuer Aufbewahrungs-
und Präsentationsort
der Karikaturen-
sammlung.
Foto Seite 101:
Werke von
Greser & Lenz sowie
Marie Marcks erweiter-
ten die Karikaturen-
sammlung der Stiftung.
Sammlungen der Stiftung
Haus der Geschichte
Bonn
Rund 600.000 Objekte befindensich in den Sammlungen der Stif-tung in Bonn, Leipzig und Berlin;davon sind etwa 25.000 im Be-richtszeitraum hinzugekommen. DieWissenschaftlerinnen und Wissen-schaftler legen hohe Maßstäbe an,bevor neue Objekte in die Samm-lungen der Stiftung aufgenommenwerden: Objekte müssen aussage-kräftig sein, Anziehungskraft undAusstrahlung auf die Besucher ent-wickeln. Diese Auswahl erfolgt auf
101
Sammlungen
Bonn
Mit Zeichnungen von Marie Marckserwarb das Haus der Geschichte einKonvolut der bedeutendsten Karika-turistin Deutschlands. 16 Arbeitenironisieren das Thema Emanzipa-tion.
Unter dem Aspekt ihrer poli-tischen und gesellschaftlichen Aus-sagekraft erwarb das Haus fürden Sammlungsbereich „BildendeKunst“ eine Reihe von Exponaten.Dazu zählen die Collagen „Stasi-Akte I“ und „Stasi-Akte II“ des Mu-sikers und Malers Udo Lindenberg.Für diese Arbeiten verwendete erFragmente seiner Stasi-Akte. Dieumfangreichen Unterlagen zeugenvom Misstrauen der SED gegen-über dem Rocksänger aus demWesten. Die Collagen beinhaltenZeichnungen Lindenbergs, die diezumeist belanglosen Beobachtun-gen der Spitzel karikieren.
Für den Ankauf sozialistischerHerrschaftsbilder der DDR-Diktaturstehen exemplarisch eine Stalin-und Leninstatue sowie eine Bronze-büste von Ernst Thälmann. Beson-ders bei der Stalinstatue handelt essich um ein außergewöhnliches undseltenes Stück, da nach der Entsta-linisierung Kunstwerke mit Bezugzu seiner Person aus dem öffentli-chen Raum entfernt und zumeistvernichtet wurden.
Für die künstlerische Fotografieist exemplarisch der Erwerb von sie-ben Fotografien der Serie „Einge-brannte Bilder“ von Ernst Volland
aus den Jahren 1997 bis 2006.Neben „Twintower“ gehören da-zu „Junge in Warschau“, „Kniefallvon Willy Brandt“, „Hanns MartinSchleyer“, „Fahnen am Branden-burger Tor“, „Mauerspringer“ und„Benno Ohnesorg“. Volland ver-wendet als Vorlagen Foto-Ikonender Zeitgeschichte. Im Verlauf sei-nes Arbeitsprozesses entstehen un-scharfe Schattenbilder, die zurneuen Betrachtung dieser Bilder an-regen.
Die etwa 20.000 Objekte um-fassende Plakatsammlung mit Ex-ponaten vor allem zu Politik-, Kultur-,Wirtschafts- und Sozialgeschichtekonnte ebenfalls um aussagekräf-tige Konvolute erweitert werden.Beispielhaft zu nennen ist eine Neu-erwerbung aus den ehemaligen Be-ständen des Archivs der kommu-nistischen Partei Frankreichs inParis. Plakate der 1950er bis 1970erJahre dokumentieren Themen wiedie deutsche Wiederbewaffnung,die Europäische Verteidigungsge-meinschaft und die nationalsozialis-tische Vergangenheit Deutschlands.
Die Währungsreform 1948 indenWestzonen war eines der wich-tigsten wirtschaftspolitischen Ereig-nisse der deutschen Nachkriegs-geschichte. Eine Holzkiste, mit derdie ersten DM-Geldscheine für dieWährungsreform 1948 von denUSA nach Deutschland transportiertwurden, visualisiert dieses Ereignisund erzählt Geschichte.
Die Versorgung der Reichsbankmit den in den USA gedrucktenBanknoten verlief unter dem Code-namen „Operation Bird Dog“. DieHolzkisten wurden mit kryptischenNamen versehen, die Bezug zumCodenamen hatten. Die in denSammlungsbestand aufgenom-mene Kiste trägt den Namen „WildDog“.
102
Sammeln und Ausstellen
Diese zentralen Aufgaben einesMuseums sind eng aufeinander be-zogen. Die Themen der Ausstellun-gen bieten im Besonderen für einMuseum zur Zeitgeschichte eineinhaltliche Orientierung für den Ob-jekterwerb.
Im Kontext der Recherchen zurWechselausstellung „Flagge zei-gen? Die Deutschen und ihre Natio-nalsymbole“ erhielt die Stiftungeine umfangreiche Sammlung zumThema „Deutschlandlied“. Die vondem Musikhistoriker Dr. JürgenZeichner zusammengestellten Ob-jekte enthalten Tonträger mit unter-schiedlichen Einspielungen desDeutschlandlieds – von der Militär-musik über vokale Versionen bis hinzum Rap –, Feldpostkarten aus dem
Ersten Weltkrieg, die Erstveröffent-lichung des Deutschlandlieds von1841, Telefonkarten, Notenhefte,Fanschals etc. Die „SammlungZeichner“ macht den Zusammen-hang von Hymnen- und Mentalitäts-geschichte sichtbar.
Im gleichen Ausstellungskontextsteht ein Shirt der bekanntenbritischen Modedesignerin VivianWestwood. Mit provozierendenKleidungsstücken und Accessoiresprägte sie die internationale Mode-szene. 1977 verwendete sie das Ha-kenkreuz-Motiv auf einem T-Shirt.Die Bedeutung des Objekts liegt inder Verbindung von Jugendkultur,Provokation und Symbolsprache.
Über die Wechselausstellung„Flucht, Vertreibung, Integration“erhielt die Stiftung ein Tagebuch.Darin dokumentiert eine Frau dieGeschichte ihrer Flucht aus der ost-deutschen Heimat sowie die ge-waltsamen Übergriffe und Verge-waltigungen durch Soldaten derRoten Armee.
Ein ähnlich bewegendes Expo-nat gehört zum Konvolut von per-sönlichen Dokumenten aus demBesitz einer Familie, die vom Con-tergan-Skandal betroffen ist. ImRahmen der Ausstellung „Skandalein Deutschland nach 1945“ ge-langte ein Taschenkalender ausdem Geburtsjahr der Contergan ge-schädigten Tochter mit der Eintra-gung „Geburt/O Gott/warum?“ indie Sammlungen.
Dieses Tagebuch einer
Mutter, die eine
Contergan geschädigte
Tochter zur Welt
brachte, dokumentiert
auf bewegende Weise
den Skandal um
das umstrittene
Arzneimittel.
103
Sammlungen
Bonn
Zwei weitere bemerkenswerteObjekte ergänzten andere Themen-bereiche: Die Haftraumtür aus demUntersuchungsgefängnis Holsten-glacis in Hamburg, in dem RudolfAugstein im Zuge der „Spiegel-Af-färe“ einsaß, visualisiert einen wich-tigen Aspekt dieses Skandals. EinKonvolut von Unterlagen und Pro-testmaterial aus dem Besitz vonBeate Klarsfeld dokumentiert dieprovozierende Aktion vom 7. No-vember 1968, als sie auf dem CDU-Parteitag Bundeskanzler Kurt GeorgKiesinger wegen dessen national-sozialistischer Vergangenheit ohr-feigte. Dazu gehören u. a. ein Plakatmit einem Aufruf zur Protestde-monstration gegen den Klarsfeld-Prozess und der Strafantrag KurtGeorg Kiesingers gegen BeateKlarsfeld.
Als zentrale Exponate für die zu-künftige Ausstellung im Berliner„Tränenpalast“ sicherte die Stiftungdie vor dem Gebäude stehendenMauersegmente, die von denKünstlern Kiddy Citny und TierryNoir gestaltet wurden. Die ur-sprünglich vom Potsdamer Platzstammenden Teile wurden 1994von den beiden Künstlern bemaltund prägten das Entree des „Trä-nenpalastes“.
Für die Dauerausstellung in Bonnerwarb die Stiftung weitere Ob-jekte: Die Anfänge der Republik unddas Wiederentstehen der SPD do-kumentiert ein Konvolut zu Kurt
Schumacher. Hierzu gehört u. a.sein Schreibtisch aus dem Büro inHannover.
Über Erich und Margot Hone-ckers privates und öffentlichesLeben geben Koffer mit wichtigenDokumenten Auskunft. Die beidenKoffer waren lange Zeit in Berlin de-poniert. Sie enthalten u. a. einenHaftbefehl gegen Honecker, Manu-skripte von Rechtfertigungsschrif-ten aus seiner Moskauer Zeit undviele Fotografien mit privaten undhalboffiziellen Motiven.
Die letzten Jahre und den Abzugder Westgruppe der russischenTruppen in Deutschland dokumen-tiert ein etwa 300 Objekte umfas-sender Bestand. Unter anderemgehören dazu ein großes dekorati-ves Glasbild mit einemMotiv Lenins
Einen Haftbefehl gegen
Erich Honecker sowie
zahlreiche Fotografien
und Dokumente aus
dem persönlichen
Besitz des SED-General-
sekretärs enthalten zwei
Koffer, die der FOCUS
an das Haus der
Geschichte übergab.
104
aus einer russischen Kaserne(330 x 190 cm), ein Transparent zumAbzug der Westgruppe mit demSchriftmotiv „Leb wohl Rathenow“in kyrillischer und lateinischerSchrift, Gemälde mit dem Motivdes sowjetischen Ehrenmals inTreptow und das Rote Telefon deskommandierenden Generals.
Von der Straße ins Museum
Zeitgeschichte zu dokumentie-ren heißt auch, die aktuellen undzeithistorisch bedeutenden Ereig-nisse zu beobachten und Objekte di-rekt zu sichern, die sonst vomVerfall bedroht wären. Die gewan-delte Stellung der BundesrepublikDeutschland in der Welt verdeut-lichte der G8-Gipfel in Heiligen-
damm 2007. Die Stiftung hat dieseinternationale Konferenz begleitetund eine Fülle von Objekten gesi-chert: Ein Zaunsegment visualisiert,welcher Aufwand zum Schutz derKonferenzteilnehmer betrieben wer-den musste. Ein Strandkorb gingebenfalls in die Sammlungen ein, daer über die mediale Berichterstat-tung zu einem zentralen Bild derKonferenz wurde. Programme undMenükarten geben Auskunft überdie Verhandlungen und die protokol-larischen Gepflogenheiten. Transpa-rente wie z. B. das Spruchband mitdem Schriftmotiv „Zäune helfennicht! Gegen Abschottung, für einfaires Asylrecht“ zeugen von denvielfältigen Protesten, die im Um-feld der G8-Gipfel geäußert werden.
Materialien von Demonstratio-nen gegen die Schließung desNokia-Werkes in Bochum belegenwirtschaftspolitische Probleme inder globalisierten Welt: Ein Schildmit dem Slogan „Soziales Ausgegen 7,2 Milliarden Gewinn?“ unddas T-Shirt mit dem Schriftzug„Nokia – Nicht ohne Kampf insAus“ stehen beispielhaft für dieseObjektrecherche.
Die Einführung des Einbürge-rungstests führte in den letzten Jah-ren zu heftigen Diskussionen inDeutschland. Sechs Plakate derKünstlerin Amélie Guth greifen dieThemen Migration und Integrationauf. Die Plakate zeigen jeweils einePerson mit Migrationshintergrund,
„Bin ich deutsch
genug?“, fragen diese
Plakate der Künstlerin
Amélie Guth vor dem
Hintergrund der Diskus-
sion um die Einführung
des „Einbürgerungs-
tests“.
105
Sammlungen
Bonn
immer verbunden mit dem Schrift-motiv „Bin ich deutsch genug?“.Ein Formblatt des Tests zum glei-chen Thema fand Eingang in dieSammlungen.
Der sportliche Erfolg der deut-schen Handballnationalmannschaftbei der Weltmeisterschaft 2007 imeigenen Lande setzte die nationaleEuphorie der Fußballweltmeister-schaft fort. Dafür steht stellvertre-tend Handballbundestrainer HeinerBrand. Seine Goldmedaille, seinTrainingsanzug und weitere Objektevisualisieren den sportgeschichtlichwichtigen Erfolg der Handballnatio-nalmannschaft und die damit ver-bundene Debatte über nationaleIdentität.
Ein Schild „Rauchfreier Bahn-hof“ belegt sowohl diese weitrei-chende Maßnahme der Gesund-heitspolitik als auch die Problemeder Übertragung europäischenRechts auf die nationale Ebene.
Objektmanagement
Eine zentrale Rolle im Museumspielt der Arbeitsbereich der Regis-trars. Die Koordination von Objekt-bewegungen und von objektbe-zogenen Informationen steht imMittelpunkt ihrer Arbeit. Sie werdenhierbei von Dokumentaren, Depot-verwaltern, Restauratoren und demFotoarchiv unterstützt. Gleichzeitigsind sie die Schnittstelle zwischen
Sammlungen, Ausstellungsteamund -gestaltern. Die Registrars be-treuten im Berichtszeitraum über2.000 Leihgaben sowie 800 Foto-vorlagen und waren an der Erstel-lung von rund 700 Ausstel-lungsgrafiken beteiligt. Dabei pfleg-ten sie Kontakt zu rund 400 Leihge-bern, bereiteten entsprechendeLeihverträge vor und organisiertendie notwendigen Transporte. Anfra-gen zur Erstellung von reprofähigenAbbildungen – über 600 in den Jah-ren 2007/2008 – wurden von ihnenebenso koordiniert wie große Leih-anfragen von nationalen und inter-nationalen Museen. Hierzu ge-hörten unter anderem das DeutscheHistorische Museum, das DeutscheTechnikmuseum Berlin, die Deut-
Handballbundestrainer
Heiner Brand (M.) über-
gibt seine Goldmedaille
von der Weltmeister-
schaft 2007 und weitere
Objekte an Hans Walter
Hütter. Michael Vesper
(r.), der Generalsekretär
des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes,
kam ebenfalls nach
Bonn.
106
sche Kinemathek Berlin, die Funda-cion Caixa Catalunya, La Pedrera,das Norske Teknisk Museum,das City-Museum of Helsinki, dasZentrum Paul Klee Bern, das Tech-nische Museum Wien und DA2Domus Artium 2002, Salamanca.
Über die Depotverwalter veran-lassten die Registrars über 6.000Ausgaben von Objekten und dieEinlagerung von 37.000 Objekten.Die Neueinlagerungen waren be-dingt durch den Umzug der Karika-turen in das neue Depot und dieReorganisation der Grafiksamm-lung.
Dokumentation
Die Dokumentation beschreibt inder Datenbank der Stiftung Objektenach historischen Inhalten, visuellenMotiven, Herkunft, Beschaffenheit,Logistik, Rechtsstatus und Ausstel-lungskontext. Diese Daten bietendie Grundlage für das Recherchie-ren von Objekten durch Ausstel-lungsteams, externe Anfragen oderdas Objektmanagement. Im Be-richtszeitraum wurden über 11.000Objekte neu erfasst, 90 Prozent derim Integrierten Museumsmanage-ment System (IMS) vorhandenenObjekte sind über Abbildungen do-kumentiert. Zusätzlich bearbeitetendie Mitarbeiter der Dokumentationüber 2.000 Projektleihgaben.
Restaurierungswerkstatt
Die Verantwortlichkeit der Res-taurierungswerkstatt erstreckt sichvon der Pflege der Sammlungsob-jekte unter konservatorischen Ge-sichtspunkten bis hin zur Unter-stützung des Ausstellungsaufbausdurch Vorbereitung der Objekte fürdie Präsentation, deren Einbringungin Vitrinen und Unterstützung beider Hängung sowie die Erstellungder notwendigen Zustandsberichte.Für die auszuleihenden Objektewerden ebenfalls Zustandsberichteverfasst und konservatorische Vor-gaben formuliert.
Foto Seite 106:
Registrars und Depot-
verwalter unterstützen
Transport und Aufbau
wichtiger Exponate:
hier die Anlieferung des
„gläsernen Flügels“
von Udo Jürgens für die
Ausstellung „Melodien
für Millionen“.
Fotos Seite 107:
Die Fotografien aus
dem Bestand von Erna
Wagner-Hehmke liegen
jetzt auch in hochwerti-
ger digitaler Bildqualität
vor.
107
Sammlungen
Bonn
Das Restauratorenteam protokol-lierte im Berichtszeitraum 7.400 Ob-jekte, über 3.000 Exponate wurdenfür eigene Ausstellungen und rund650 für die Ausleihe vorbereitet. Über700 Objektemussten restauratorischbehandelt werden. Insgesamt betei-ligten sich die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter an 33 Ausstellungen. EinSchwerpunkt der Arbeit im Berichts-zeitraum war die Behandlung groß-formatiger Kinotransparente sowieder Umgang mit Lebensmitteln undVerpackungen mit biologischen In-haltsstoffen. Besonders hervorzuhe-ben ist die Restaurierung desfünfteiligen, großformatigen Glasbil-des „Lenin“. So mussten u. a. fürjede Scheibe des Bildes einzelneRahmen aus Winkeleisen und Holz-profilen angefertigt werden.
Fotostudio
Die technische Einrichtung desFotostudios konnte weiter verbes-sert werden. Für die vielfältigenAusstellungen und Publikationenbearbeiteten die Fotografen der Stif-tung über 2.500 Fotografien. Hierzugehört das Erstellen von hochwerti-gen Reproduktionsvorlagen und derAusdruck der Fotografien. Ein Bei-spiel sind die umfangreichen Arbei-ten für die Ausstellung „Beobach-tungen – Der Parlamentarische Rat1948/49. Fotografien von Erna Wag-ner-Hehmke“, die vom Fotostudio
in hervorragender Qualität erstelltwurden.
Zusammen mit den hausinter-nen objektbezogenen Fotoanfragenwurden insgesamt 1.200 Objektereproduktionstauglich digitalisiertund in die Cumulus-Bilddatenbankeingestellt, sodass Ende 2008 über20.000 hochwertige digitale Bildda-teien in dieser Datenbank abrufbarsind.
108
Projekte
Netzwerk Mediatheken
Vorrangiges Ziel des NetzwerksMediatheken ist es, audiovisuelleQuellen und Materialien als bedeu-tendes Kulturgut zu sichern, zu be-wahren und zu erschließen sowiedarüber hinaus für Bildung, Wissen-schaft, Forschung, Lehre und Kunst
bereitzustellen. Das zweisprachigeInternetportal www.netzwerk-media-theken.de soll der interessierten Öf-fentlichkeit den oftmals schwierigenZugang zu dezentralen Medien-sammlungen erleichtern. Mittler-weile gehören dem NetzwerkMediatheken 56 bedeutendeMediensammelnde Institutionen an. Seit2001 führt die Stiftung die Geschäfte
Die Stiftung Haus der
Geschichte führt seit
2001 die Geschäfte
des „Netzwerks
Mediatheken“.
109
Sammlungen
Bonn
dieses Verbundes, pflegt das Inter-netportal und organisiert die zweimalim Jahr stattfindenden Treffen.
Der Umgang mit AV-Medien isteng mit Fragen des Urheberrechtsverbunden. Dazu verabschiedetenim Oktober 2007 die beteiligten Ins-titutionen „Empfehlungen des Netz-werks Mediatheken für den Um-gang mit ,verwaisten Werken’“. Vordem Hintergrund des aktuellen Ur-heberrechts macht das NetzwerkMediatheken damit auf ein prakti-sches Problem aufmerksam. Mitdem erarbeiteten Papier beabsich-tigt das Netzwerk, im Dialog mitden beteiligten Interessengruppenund der Politik eine Lösung herbei-zuführen. Die im Oktober 2008 vor-gelegten Thesen „Regelungsbedarffür jugendeigene Medienproduktio-nen im Rahmen medienpädagogi-scher Maßnahmen“ thematisierendiese Probleme im Bildungsbereichund bieten auch hier Lösungsmög-lichkeiten an. Beide Stellungnah-men wurden dem Bundesjustiz-ministerium zugeleitet.
Forschungskooperation mit der
Fachhochschule Köln
Alle Objekte werden im Inte-grierten Museumsmanagementsys-tem (IMS) dokumentiert, d. h. siewerden nach vorgegebenen Merk-malen exakt beschrieben, um siebei der Recherche wieder auffind-bar zu machen. Neben einer Voll-textsuche bietet das System auch
einen Thesaurus, mit dessen Hilfedie Recherche verbessert wird:Ober- und Unterbegriffe sowie Sy-nonyme werden bei der Suche mitherangezogen. Zum Beispiel wer-den bei der Recherche nach„Baum“ sowohl „Eiche“ als auch„Bäume“ gefunden. Mit der wach-senden Zahl der Datensätze (zur-zeit 300.000) steigen auch die An-forderungen an die Suchfunktionender Datenbank. Diese müssen sogestaltet sein, dass sowohl Fach-leute als auch interessierte Laiendie gewünschten Ergebnisse er-halten.
Ziel ist es, „intelligente“ Such-möglichkeiten zu entwickeln. Eineim Januar 2008 begründete For-schungskooperation mit der Fach-hochschule Köln soll neue Ent-wicklungen von IT-Technologie, Lin-guistik und Informationswissen-schaften für die Museumspraxisnutzbar machen. Dabei werdenüber die „automatische Indexie-rung“ aller Objektbeschreibungenmit Hilfe einer speziellen Software(Lingo) normierte Begrifflichkeitenfür Suche und Dokumentation auf-gebaut. Diese sollen die Basis fürdie Erweiterung und Optimierungdes bestehenden Thesaurus bilden.
110
Sammlungen im
Zeitgeschichtlichen Forum
Leipzig
Die Sammlungsstrategie desZeitgeschichtlichen Forums ist engabgestimmt mit den Häusern inBonn und Berlin. InhaltlicherSchwerpunkt in Leipzig ist die Ge-schichte von Diktatur und Wider-stand in der sowjetischen Besat-zungszone und der DDR, auchmit Bezug zur Alltagsgeschichte.
87.000 Objekte befinden sich imZeitgeschichtlichen Forum. Knapp21.000 Objekte gelangten 2007/2008 in die Bestände.
Für die Überarbeitung der Dau-erausstellung recherchierten dieMitarbeiter in Leipzig eine Fülle mar-kanter und aussagekräftiger Ob-jekte. Das Schild der bundes-deutschen Botschaft am Palais Lob-kowitz in Prag führt den Beobachterin die Zeit des Untergangs der DDRzurück. 1989 suchten mehrere Tau-
Seltenheit: Fotografien
von der Sprengung der
Pauliner Kirche in Leip-
zig übergab Christiane
Sommerfeld (M.), die
Tochter des Fotografen,
dem Direktor des Zeit-
geschichtlichen Forums,
Rainer Eckert (r.), und
dem wissenschaftlichen
Mitarbeiter Bernd
Lindner (l.).
111
Sammlungen
Leipzig
send Menschen aus der DDR Zu-flucht in der bundesdeutschen Bot-schaft. Das Schild, das von 1974 bis2007 an der Botschaft angebrachtwar, hält diese Eindrücke von 1989wach.
Ein Fotoalbum mit 14 Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigt die PaulinerKirche in Leipzig 1968 kurz vor undnach der Sprengung durch die SED-Diktatur. Bilder von der Sprengungsind äußerst selten, da die Staatssi-cherheit das Fotografieren zu ver-hindern suchte. Diese Aufnahmenblieben erhalten, weil der FotografHans Bleier den belichteten Filmnoch am selben Tag Verwandten inden Westen senden konnte.
Objekte aus dem AtombunkerKossa der Nationalen Volksarmee,der von 1976 bis 1979 gebautwurde, geben einen Eindruck vomKalten Krieg auch in der Zeit der Ent-spannungspolitik. Zum Konvolutgehören unter anderem eine Ein-gangstür, ein Funkgerät und ein Gei-gerzähler.
Auf Probleme der Wiedervereini-gung geht ein Gehaltszettel ein, aufdem erstmals der Solidaritätszu-schlag ausgewiesen ist.
Die abgebaute Grenzschranke,die zwischen der BundesrepublikDeutschland und der TschechischenRepublik angebracht war, belegtden politischen Wandel in Europa.Im Zusammenhang mit der Auswei-tung des Schengener Abkommensauf neun weitere EU-Mitgliedsstaa-
ten, darunter Tschechien, wurdediese Grenzschranke zwischen demsächsischen Johanngeorgenstadtund dem böhmischen Jeleni ent-fernt.
Für die Ausstellung „Wir gegenuns. Sport im geteilten Deutsch-land“ konnte ein improvisierter Bas-ketballring der Betriebssportge-meinschaft SG KPV 69 Halle erwor-ben werden. Da Basketball in derDDR seit Ende der 1960er nichtmehr gefördert wurde, gab es auchkeine entsprechenden Sportgerätemehr. Die Betriebssportgemein-schaft stellte daher in Eigenproduk-tion die benötigten Stahlringe her.
Eine weitere spannende Ge-schichte verbindet sich mit einerSportjacke von Ralph Pöhland. Erflüchtete wenige Wochen vor denOlympischen Winterspielen in Gre-noble 1968 aus dem Trainingslagerder DDR-Nationalmannschaft. SeineHoffnung, für das westdeutscheTeam zu starten, erfüllte sich nicht.Allerdings gehörte er dennochder westdeutschen Olympiamann-schaft an. Die Olympiajacke, eineTeilnehmerurkunde und eine Teil-nehmermedaille weisen ihn alsMitglied der westdeutschen Mann-schaft aus.
Im Kontext der geplanten Wech-selausstellung „Humor und Politik“(Arbeitstitel) erwarb das Zeitge-schichtliche Forum Leipzig zweibedeutende Karikaturenbestände.8.000 Blätter aus dem Nachlass
„Beatabend“ von Ulrich
Hachulla (1973), einem
Schüler von Bernhard
Heisig und Werner
Tübke, thematisiert den
jugendlichen Aufbruch
in der DDR.
112
eines der bekanntesten Karikaturis-ten in der DDR, Luis Rauwolf, bele-gen die Funktion der satirischenZeichnungen in einem totalitärenRegime. Mit den etwa 300 Karika-turen von Fritz Behrend besitzt dasZeitgeschichtliche Forum Leipzigeinen eindrucksvollen Bestand, dersich kritisch mit den Diktaturen desOstblocks auseinandersetzt.
Das Kabarettkostüm „AngelaMerkel“ von Matthias Richling er-zählt ironisierend die Geschichtedes Abendkleides, das Bundeskanz-lerin Merkel bei einem Opernbe-
such in Oslo am 14. April 2008 trug,und beleuchtet die Rolle derMedien.
Hervorzuheben sind auch An-käufe zu den Sammlungsbereichen„Bildende Kunst“ und „Fotografie“.Das Gemälde „Beatabend“ (1973)von Ulrich Hachulla, einem Schülervon Bernhard Heisig und WernerTübke, dokumentiert den Aufbrucheiner neuen Jugendgeneration An-fang der 1970er Jahre in der DDR.
Das Künstlertagebuch „Log/LOCKbuch“ von Micha Brendel ausdem Jahr 1988 ist ein künstlerisch
Das Künstlertagebuch
„Log/LOCKbuch“ von
Micha Brendel aus dem
Jahre 1988
113
Sammlungen
Leipzig
hochwertiges Dokument der spek-takulärsten Kunstaktion in der Ge-schichte der Leipziger Galerie„Eigen-Art“, in der sich nonkon-forme Künstler trafen.
Eine 21 Arbeiten umfassendeFotoserie „Real-Mode“ von UweFraundorf hält Szenen der Jugend-kultur in der Endphase der DDRfest. Fraundorf fotografierte Besu-cher in der Disco „Eben“ 1988 inLeipzig. Die Fotografien dokumen-tieren auffallend „westliches“ Frei-zeit- und Kulturverhalten bereits vordem Ende der DDR.
Objekt- und
Ausstellungsmanagement
Das Team der Registrars, Res-tauratorinnen, Dokumentare undDepotverwalter ist für das Objekt-und Ausstellungsmanagement, dieDokumentation sowie für die kon-servatorische und restauratorischePflege der Objekte verantwortlich.Im Berichtszeitraum wurden rund12.000 Objektdatensätze neu ange-legt und die Objekte im Magazineingelagert. Damit stehen in der Ob-jektdatenbank der Stiftung jetzt60.000 Datensätze von Objektenaus dem Zeitgeschichtlichen Forumzur Verfügung. Die Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter betreuten acht Foy-erausstellungen mit 400 Objekten.Während des laufenden Ausstel-lungsbetriebs wurde die Daueraus-
Blick in die Leipziger
Depoträumestellung komplett überarbeitet unddurch weitere 800 Objekte und Aus-stellungsmittel ergänzt. Dazu kamdas Management für die rund 3.200Objekte in der Dauerausstellung.Dies umfasst sowohl die dokumen-tarische Erfassung, die Übermitt-lung der Objektdaten an denGestalter, den notwendigen Leih-verkehr und die Begleichung derLizenzkosten. Das Team übernahmzusätzlich die Bearbeitung von zahl-reichen Leihanfragen und organi-sierte die Leihnahmen für alleAusstellungsprojekte.
114
Sammlung
Industrielle Gestaltung Berlin
Der vielfältige und einmaligeBestand der Sammlung an Alltags-Design der DDR war bis 2007 zumgrößten Teil in zwei Außendepotseingelagert. Da die bestehendeSituation in den beiden Gebäudennicht den notwendigen konservato-rischen Bedingungen entsprach,war es zur Sicherung dieser Objektenotwendig, ein neues Depot zu be-ziehen, das in Berlin-Spandau ange-mietet werden konnte.
Nach der Sicherung des Bestan-des besteht die Hauptarbeit nundarin, den umfangreichen, etwa
160.000 Objekte umfassenden Be-stand mittels des Integrierten Mu-seumsmanagement Systems (IMS)der Stiftung zu dokumentieren undzu erschließen sowie die technisch-logistische Optimierung des neuenDepots weiter voranzutreiben. Fürdie noch in der KulturBrauerei gela-gerten dreidimensionalen Objektewerden weitere Findlisten erstellt.Parallel dazu sind in die Online-Da-tenbank SINT die ersten Objekteder Sammlung Industrielle Gestal-tung eingestellt worden und somitvirtuell zugänglich.
Die Fortschreibung der Gedenk-stättenkonzeption des Bundes stelltder Stiftung die Aufgabe, in derKulturBrauerei am Prenzlauer Bergeine Dauerausstellung zur Ge-schichte der Produkt- und Alltags-kultur in der DDR aufzubauen unddamit zur kritischen Auseinander-setzung mit dem gegenständlichenErbe der DDR anzuregen.
Nach der Sicherung des Objekt-bestands wird die Aufgabe derSammlung Industrielle Gestaltungin den nächsten Jahren darin beste-hen, Ausstellungen vorzubereiten,die auch Opposition und Wider-stand im Alltagsleben einbeziehen.Über dieses Vorhaben informierteHans Walter Hütter, Präsident derStiftung Haus der Geschichte, auchden Vorsitzenden des Stiftungs-rats Industrie- und Alltagskultur,Bundestagsvizepräsident WolfgangThierse MdB, und weitere Vertreter
Dietmar Preißler,
Sammlungsdirektor
der Stiftung Haus der
Geschichte, und Mitar-
beiterin Anja Schubert
informieren den Vorsit-
zenden des Stiftungs-
rats Industrie- und
Alltagskultur, Bundes-
tagsvizepräsident Wolf-
gang Thierse MdB,
über die Bestände der
Sammlung Industrielle
Gestaltung (v.l.n.r.).
115
Sammlungen
Berlin
der Stiftung, die am 26. August2008 die Sammlung besuchten.
Vor der Fertigstellung der Dauer-ausstellung bieten „Schaufenster“seit 2008 den Besuchern derKulturBrauerei am Prenzlauer Bergeinen kleinen Einblick in die Samm-lung zur Produkt- und Alltagskulturder DDR. Eine Zusammenstellungvon designhistorisch bedeutendenObjekten aus den wichtigsten Be-standsgruppen zeigt den PassantenStühle, Leuchten, Geschirr und Kü-
chentechnik sowie Werbung undVerpackungen, Spielzeug, Büro-technik, Plattenspieler und Stereo-anlagen sowie den ersten (undeinzigen) Heimcomputer der DDR.In drei Schaufenstern wurden bis-her anhand von Campingaus-stattung und Fahrzeugen zudemverschiedene Facetten des Alltagsvorgestellt. Dazu kam eine Auswahlaus dem großen Spielzeugbestandder Sammlung.
Foto oben:
„Schaufenster“ bieten
erste Einblicke in die
Sammlung zur Produkt-
und Alltagskultur.
Foto links:
Umzug in das neue
Depot in Berlin-Spandau
118
Öffentlichkeitsarbeit im Hausder Geschichte Bonn
Medien
Die Betreuung und Informationder Journalisten vor allem zu Aus-stellungseröffnungen und Veran-staltungen stand imMittelpunkt derMedienarbeit. Dreharbeiten undInterviews sind vorzubereiten undmit den Ansprechpartnern zu koor-dinieren.
Im Vorfeld der Eröffnungen wer-den die Redaktionen informiert, zuden Pressevorbesichtigungen und-konferenzen eingeladen. Besonde-res Medieninteresse wecken spek-takuläre Exponate, die in der Vorbe-reitungsphase der jeweiligen Wech-selausstellungen vorgestellt undanschließend in die Ausstellung ein-gebracht werden: Ein Beispiel istder gläserne Flügel von Udo Jür-gens, mit dem der Künstler 2007auf Tournee war. Die Anlieferungund der Transport an seinen Prä-sentationsort in der Ausstellung„Melodien für Millionen“ sorgtenfür ein großes Medienecho.
Zur Eröffnung der Ausstellunghatte das Museum prominenteGäste aus der Schlagerszene wieHeino, Jürgen Drews, Stefanie Her-tel, Götz Alsmann, Florian Silberei-sen, Dieter Thomas Heck undandere geladen, die auf dem rotenTeppich vor dem Eingang für Inter-views und Fotos zur Verfügungstanden. Die Medien berichtetenzahlreich, insgesamt erreichte alleindie Tagespresse über 30 MillionenLeserinnen und Leser in Deutsch-land. Dazu kamen vielfältige Be-richte in Hörfunk und Fernsehen:Der SWR nahm die Ausstellungzum Anlass, dort eine kompletteSendung aus der Reihe „FröhlicherFeierabend“ mit Chris Howland undChris Roberts aufzuzeichnen.
Ein überaus großes Medienecholöste auch die Eröffnung der Aus-
Bei den Pressekonferen-
zen haben die Medien-
vertreter Gelegenheit,
sich umfassend über
die neuen Ausstellun-
gen des Hauses zu
informieren.
119
Öffentlichkeitsarbeit
Bonn
stellung „Flagge zeigen? Die Deut-schen und ihre Nationalsymbole“aus. Bereits bei der Pressekonfe-renz am Tag zuvor kamen rund 80Journalisten. Von der Eröffnung undvom anschließenden Ausstellungs-rundgang mit dem Bundespräsiden-ten berichteten alle großen Fern-sehsender, Fotografen und die maß-geblichen Nachrichtenagenturender Bundesrepublik.
Die persönliche Kontaktpflege zueinzelnen Redaktionen und dieNachbereitung, zu der die Presse-dokumentation und der Versand derPublikationen gehört, haben darüberhinaus einen besonderen Stellen-wert.
Zahlreiche Fernsehsender wieder Westdeutsche Rundfunk, RTLund andere nutzten vielfach dieObjektensembles in der Daueraus-stellung für ihre Produktionen. Zeit-zeugen wie der ehemalige WDR-Intendant Friedrich Nowottny oderdie Bundesminister a. D. NorbertBlüm und Hans Dietrich Genscherwaren mehrfach für Fernsehauf-zeichnungen als Interviewpartnereingeladen. Gefragter Drehort istdas Haus auch in Bezug auf dieSammlungsbestände: Plakate undDokumente filmten zum Beispielder SWR für die Reihe „Deutsch-land im Kalten Krieg“ und das ZDFfür das Kulturmagazin „aspekte“.
Die Übergabe und Präsentationbesonders „medienwirksamer“ Ex-ponate waren mehrfach Anlass für
das Haus der Geschichte, gezieltJournalisten zu diesen Termineneinzuladen: Ein besonderes Ereigniswar die Präsentation des „Leh-mann-Zettels“ im Foyer des Muse-ums.
Im Viertelfinale der Fußball WM2006 gegen Argentinien hatte Tor-warttrainer Andreas Köpke dieNamen der argentinischen Elfme-terschützen sowie ihre bevorzugtenSchussgewohnheiten mit Bleistiftauf dem Zettel notiert. Anschlie-ßend übergab er ihn Jens Lehmann,dem Torwart der deutschen Natio-nalmannschaft. Lehmann hielt zweiElfmeter, Deutschland gewann dasSpiel mit 5:3 Toren. Jens Lehmannkam persönlich ins Haus der Ge-schichte, um den Zettel zu präsen-tieren. Viele Foto- und Fernseh-journalisten hielten die Übergabe inBildern fest, anschließend stand derNationaltorwart für zahlreiche Inter-views zur Verfügung.
Auf ähnlich große Resonanzstieß die Präsentation des „Hone-cker-Koffers“: Das Magazin FOCUS,in dessen Hände zwei Koffer mit pri-vaten Fotos, Briefen und Unterlagengelangten, übergab die Objekte imInformationszentrum desMuseums.
Die Mehrzahl der Dokumente inden Koffern, darunter auch der Haft-befehl des ehemaligen SED-Gene-ralsekretärs mit handschriftlichenAnmerkungen bezog sich auf Hone-ckers Zeit im Moskauer Exil.
Foto oben:
Spektakuläre Objekt-
transporte wie die
Anlieferung des gläser-
nen Flügels von Udo
Jürgens bieten Gelegen-
heit, schon im Vorfeld
der Ausstellungen Inte-
resse bei den Medien
zu wecken.
Foto unten:
Der SWR drehte zum
Thema „Melodien für
Millionen“ die Modera-
tionen der Sendung
„Fröhlicher Feierabend“
in der Ausstellung.
120
Marketing
Werbung und Marketing unter-stützten die Medienarbeit, um aufAusstellungen und Veranstaltungendes Museums hinzuweisen. Die Be-werbung der verschiedenen Wech-selausstellungen in Bonn und ananderen Orten stand im Vorder-grund der Arbeit: In Bonn machenGroßtransparente am Haus regel-mäßig auf die Wechselausstellun-gen aufmerksam, ebenso wieGroßflächen in der U-Bahn sowieFlyer und Plakate, die unter ande-rem auch gezielt an Multiplikatorenund Zielgruppen aus dem Bildungs-bereich versandt werden. Die Er-gebnisse einer Evaluation zur
Wechselausstellung „Skandale inDeutschland nach 1945“ belegendie Wirksamkeit dieser Maß-nahmen.
Zur Unterstützung der Pressear-beit werden auch Anzeigen in Print-medien geschaltet und weitereWerbemaßnahmen umgesetzt: DieAusstellung „Melodien für Millio-nen. Das Jahrhundert des Schla-gers“ bot 2008 eine hervorragendeMöglichkeit, speziell Zielgruppen imBereich dieser Musik anzuspre-chen.
Mit der vom WDR produziertenLive-Sendung „Schlagerbar“ konnteeine attraktive Kooperationsveran-staltung im Haus der Geschichtestattfinden.
Das Museumsmeilenfest 2008nahm das Haus der Geschichte zumAnlass, mit einer Anzeige im Pro-grammflyer der Kunst- und Ausstel-lungshalle (Auflage eine MillionExemplare) zusätzlich für die Schla-ger-Ausstellung zu werben. ImSommer 2008 fanden darüber hi-naus Konzerte von Annett Louisanund Dieter Thomas Kuhn auf demMuseumsplatz statt. Das Haus derGeschichte nutzte diese Gelegen-heit, um in einem redaktionellenBeitrag im Flyer des Musikveran-stalters zu werben, der in einer Auf-lage von 60.000 Exemplaren denKonzerttickets beigelegt wurde.„Melodien für Millionen“ war auchin einem Videospot für Konzertbe-sucher vertreten.
Auf der Internationalen
Tourismusbörse in
Berlin informierte
Pressereferent Peter
Hoffmann interessierte
Besucher über die
Dauerausstellung und
aktuelle Wechselaus-
stellungen.
121
Öffentlichkeitsarbeit
Bonn
Bei den längerfristigen Marke-tingaktivitäten steht die Informationtouristischer Zielgruppen weiterhinim Mittelpunkt: Die Tourismus &Congress GmbH Bonn, mit der dasHaus der Geschichte eng zusam-menarbeitet, setzte auch 2007 und2008 erfolgreich ihre Bemühungenfort, Reiseveranstalter, Tagungsor-ganisationen, Firmen und Verbändenach Bonn einzuladen und über dietouristischen Aktivitäten zu infor-mieren. Eine besondere Attraktionfür Besucher und Multiplikatorenaus dem touristischen Bereich istdas alljährliche Feuerwerk „Rhein inFlammen“. Zu diesem Großereigniswaren 2008 zahlreiche Schiffe rundum das Thema Musik gechartertworden, darunter auch ein „Schla-ger-Schiff“. Das Haus der Ge-schichte war mit Informations-materialien an Bord vertreten.
Zusammen mit der Kunst- undAusstellungshalle, dem Kunstmu-seum Bonn, dem Deutschen Mu-seum und dem Museum AlexanderKoenig präsentierte sich das Hausder Geschichte auf der Internationa-len Tourismus Börse (ITB) in Berlinin den Jahren 2007 und 2008.Neben der Museumsmeile Bonn in-formierten auch die Museen derStadt Köln und die DüsseldorferKunstmuseen über aktuelle undkünftige Ausstellungen. ZahlreicheGespräche mit Reiseveranstalternschaffen Kontakte und vermittelndie Angebote der Häuser.
Die Museen und Ausstellungs-häuser haben sich als kulturellesSchwergewicht des rund 250 qmgroßen Gemeinschaftsstandes derStädte Düsseldorf, Köln und Bonnetabliert. Die Standgestaltung trägtdem kontinuierlichen Auftritt derKulturinstitutionen Rechnung. Diezusammenhängende Ausstellungs-fläche, die ohne Trennung durchAusstellungscounter auskommt, er-laubt auch die Präsentation von Ex-ponaten während der Messe. DasHaus der Geschichte stellte denMessebesuchern – passend zu denThemen der Wechselausstellungen– eine Musikbox und Originalge-stühl aus dem Bundestag in Bonnvor.
Mit rund 130.000 Besuchen,80.000 qm Ausstellungsfläche und10.000 Ausstellern bleibt die Inter-nationale Tourismus Börse das zen-trale Kommunikations- und Mar-ketingforum der Reisebranche fürFachbesucher und Privatpublikum.
Großformatige Plakate
werben in Köln
und Bonn für die
Ausstellungen.
122
nisse aus dem ehemaligen Regie-rungsviertel in Bonn aufgreift. ImMittelpunkt steht ein gut erhaltenerKellerraum eines Hauses im Bonnervicus, der an seinem Fundort imHaus der Geschichte präsentiertwird.
„Deutscher Bundestag – Die Sit-zung ist eröffnet“ liegt überarbeitetund ergänzt in zweiter Auflage vor.Im Mittelpunkt dieser „Zeitge-schichte“ steht das Original-Gestühlaus dem ersten Deutschen Bun-destag, das im Haus der Geschichteausgestellt ist.
Zur Wechselausstellung „Skan-dale in Deutschland nach 1945“ er-schien im Kerber Verlag, Bielefeld,eine Begleitpublikation. Im Fokusstehen die 20 in der Ausstellungpräsentierten Skandale – vom Pro-test gegen den Film „Die Sünderin“1951, in dem die katholische Kircheeine „Verletzung des sittlichenEmpfindens“ sah, bis zum Fall Man-nesmann/Vodafone, bei dem imJahr 2000 im Zuge der Firmenüber-nahme gezahlte Sonderprämienzum Stein des Anstoßes wurden.Auch die Rolle der Medien wird be-leuchtet: Sie spielen eine wichtigeRolle, indem sie für hohe Aufmerk-samkeit sorgen und zugleich ökono-misch von der Berichterstattungprofitieren.
Im Mai 2008 veröffentlichte dieStiftung mit „Melodien für Millio-nen. Das Jahrhundert des Schla-gers“ einen reich illustrierten und
Publikationen
Die Stiftung Haus der Ge-schichte der BundesrepublikDeutschland legt ihrem Publikati-onskonzept gemäß Informationenzur Dauerausstellung, zu Wechsel-ausstellungen und zu Veranstaltun-gen sowie zur allgemeinenInformation der Öffentlichkeit vor.
In der Reihe „Zeitgeschichte(n)“veröffentlichte das Haus derGeschichte im Berichtszeitraum vierNeuerscheinungen beziehungs-weise -auflagen. „Schwerter zuPflugscharen. Geschichte einesSymbols“ erschien anlässlich derWiedereröffnung der Dauerausstel-lung im Zeitgeschichtlichen ForumLeipzig. Der Band beschreibt ein-drücklich den Kampf der Friedens-bewegung in der DDR gegen dieHochrüstung in Ost und West.
Das Buch zum „Salonwagen 10205“ erfreut sich nach wie vor gro-ßer Beliebtheit – es erschien imJahr 2007 in der vierten Auflage. Indiesem Eisenbahnwagen reistendie Bundeskanzler Adenauer, Er-hard, Kiesinger und Brandt durchDeutschland und das europäischeAusland: Er war komfortabler Salon,Arbeitszimmer und Schlafraum zu-gleich.
„Römerkeller. Zeitreise im Hausder Geschichte“ lautet der Titel derzweiten, umfassend überarbeitetenund aktualisierten Ausgabe, dieauch neueste Ausgrabungsergeb-
„Schwerter zu Pflug-
scharen“ – ein neuer
Titel in der Reihe
„Zeitgeschichte(n)“
123
Öffentlichkeitsarbeit
Bonn
attraktiv gestalteten Ausstellungs-begleitband im Format einer Schel-lackplatte. Die beiden Hauptsträngeder Ausstellung bilden die Schwer-punkte der Publikation: „Medien,Gesellschaft und Kommerzialität“sowie „Schlager und Zeitgeist“.Weitere Themenbereiche sind „ImDienst der NS-Propaganda“ und„Schlager in der DDR“. Eine wis-senschaftlich-analytische Betrach-tungsweise des Themas wirdergänzt durch Interviews mit denMusik-„Machern“ und Lebensläufeausgewählter Interpreten. Auf dieseWeise verknüpft das Buch die Emo-tionalität des Schlagers mit den viel-schichtigen Hintergründen desPhänomens – ein Novum auf demBuchmarkt. Ergänzend zum Begleit-band legte das Museum zusammenmit Meisel Music eine Doppel-CDmit vierzig Hits aus hundert Jahrensamt informativem Booklet vor. DieErstauflage von 3.000 Exemplarenwar binnen kurzer Zeit vergriffen, sodass noch während der ersten Aus-stellungsstation eine zweite Auflageproduziert wurde.
Die Wechselausstellung „Flaggezeigen? Die Deutschen und ihre Na-tionalsymbole“ vertieft der gleich-namige Begleitband. Die reichbebilderte Publikation bietet einenumfassenden Einblick in die histori-sche Herkunft, Verwendung undRezeption nationaler Symbole inDeutschland. Sie beleuchtet dieEntstehung der deutschen Nation
Zu den Wechselaus-
stellungen legte die
Stiftung jeweils umfang-
reich illustrierte Begleit-
bände vor.
124
im 19. Jahrhundert, die Rolle derBurschenschaften und den propa-gandistischen Einsatz von National-symbolen im „Dritten Reich“. Diemeisten Beiträge konzentrieren sichauf die Zeit nach 1945 mit einervergleichenden Perspektive auf de-mokratische und diktatorische Staats-formen in Deutschland. Als 1989/90die Symbole der DDR aus der Öf-fentlichkeit verschwanden, machtedies den Untergang dieser Diktatursinnfällig. Meinungsumfragen, das„Sommermärchen“ 2006 und ak-tuelle Marketingmaßnahmen fürDeutschland runden das Thema ab.
Das Begleitbuch zu der erfolgrei-chen Wechselausstellung „Flucht,Vertreibung, Integration“ erschiendank finanzieller Unterstützung desBundesbeauftragten für Kultur undMedien auch in polnischer Sprache.„Ucieczka, wypedzenie, integracja“erschien ebenso wie die deutscheFassung im Bielefelder KerberVerlag.
Die Stiftung unterstützte die Pu-blikation des großformatigen Werks„Der Regierungsbunker“ des Bun-desamts für Bauwesen und Raum-ordnung und lüftete offiziell das Ge-heimnis um die Festung im Ahrtal.Das 19 Kilometer lange Röhrensys-tem unter einem Weinberg sollteim Falle eines Atomkrieges die Ar-beitsfähigkeit der Regierung ge-währleisten und ist neben denResten der Berliner Mauer daswichtigste bauliche Dokument des
Kalten Krieges. Seit März 2008 istein 200 Meter langes Teilstück derÖffentlichkeit zugänglich.
Für das Museumsmagazin, dasviermal im Jahr erscheint, war 2008ein besonderes Jahr: Ab Ausgabe03/2008 präsentierte es sich miteinem aktualisierten redaktionellenKonzept und in modifiziertem Er-scheinungsbild. Das neue Layoutunterstützt Lesefreundlichkeit undOrientierung, ohne auf bewährteElemente zu verzichten. Insbeson-dere wurden die Informationen zuden drei Standorten der Stiftung –Bonn, Leipzig und Berlin – über-sichtlicher gestaltet und deren Profilals Veranstaltungsorte geschärft.
Zudem erschien im November2008 eine Sonderausgabe des Mu-seumsmagazins als Begleitpublika-tion zur Ausstellung „man sprichtDeutsch“. In dieser Ausgabe schrie-ben prominente Sprachwissen-schaftler, Künstler und Politiker inunkonventioneller Weise über zeit-geschichtliche Phänomene der All-tagssprache Deutsch.
Der Begleitband
zur Ausstellung
„Flucht, Vertreibung,
Integration“ konnte
mit Unterstützung des
Bundesbeauftragten für
Kultur und Medien auch
in Polnisch vorgelegt
werden.
125
Öffentlichkeitsarbeit
Bonn
Das Museumsmagazin
der Stiftung: Zur Aus-
stellung „man spricht
Deutsch“ erschien eine
Sonderausgabe, die
schnell vergriffen war.
126
Öffentlichkeitsarbeit imZeitgeschichtlichen ForumLeipzig
Medien
Im Zentrum des Interesses amZeitgeschichtlichen Forum Leipzigstand in den Jahren 2007 und 2008die neu gestaltete Dauerausstel-lung. Zum Pressetermin anlässlichder Wiedereröffnung dieser Aus-stellung konnte das Haus am 9. Ok-tober 2007 zahlreiche Journalistenbegrüßen, darunter Vertreter wich-tiger Nachrichtenagenturen sowieRundfunk- und Fernsehanstalten.Das beachtliche überregionale Pres-seecho belebte das Interesse der
Medien dauerhaft, wie zahlreicheAnfragen in- und ausländischerJournalisten im Berichtszeitraumzeigten. Im Jahr 2008 wurde dasMuseum im Umfeld der Feierlich-keiten zum Jahrestag der entschei-denden Leipziger Montagsdemons-tration am 9. Oktober 1989 erneutzur gefragten Anlaufstelle für Re-portagen, Filmberichte und Inter-views.
Erfreulich entwickelte sich auchdie Berichterstattung über dieWechselausstellungen. Besonde-res Interesse weckte 2007 die imZeitgeschichtlichen Forum Leipzigerarbeitete Präsentation „drüben.Deutsche Blickwechsel“, die mitder Darstellung unterschiedlicherPerspektiven auf die deutsche Ge-schichte und Gegenwart besondersim ostdeutschen Raum auf bemer-kenswerte Resonanz stieß. Ein gro-ßes Medienecho hatte darüberhinaus im November 2008 die ausdem Haus der Geschichte in BonnübernommeneWechselausstellung„Melodien für Millionen. Das Jahr-hundert des Schlagers“. Auch zurEröffnung in Leipzig, dem zweitenPräsentationsort, fand diese Aus-stellung große Beachtung. DasFernsehen des MitteldeutschenRundfunks nahm die gelungene Prä-sentation zum Anlass, die Schau amEröffnungstag als Hintergrund fürdie „Live-Aufzeichnung“ einer Mu-siksendung zu nutzen. Auch klei-nere Ausstellungen und Objekt-
Foto Seite 126:
Die „Honecker-Koffer“
zogen auch in Leipzig
das Interesse der
Medien auf sich.
Fotos Seite 127:
Neue Begleitbücher
erschienen in Leipzig
zur Dauerausstellung
und zur Wechselaus-
stellung „drüben“.
127
Öffentlichkeitsarbeit
Leipzig
präsentationen, die das Museumzwischen den Wechselausstellun-gen zeigte, fanden das Interesseder Medien. Dies galt etwa für diejährliche Präsentation der „Rück-blende“, einer von der Landesver-tretung Rheinland-Pfalz federfüh-rend betreuten Foto- und Karikatu-renausstellung zum politischenGeschehen des jeweiligen Vorjah-res. Große Aufmerksamkeit erregteim Oktober 2007, wie bei der Prä-sentation in Bonn, der „Lehmann-Zettel“, mit dem der deutscheNationaltorhüter Jens Lehmann2006 im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft über die Schuss-gewohnheiten der argentinischenElfmeterschützen informiert wor-den war. Besondere Resonanz hat-ten schließlich auch die im Frühjahr2008 im Zeitgeschichtlichen Forumausgestellten Koffer und Privatun-terlagen von Margot und Erich Ho-necker, die das Ehepaar 1991während der Flucht nach Moskau inBerlin zurückließ.
Zusätzliche Höhepunkte der Me-dienarbeit waren die in jedem Jahrstattfindende Leipziger Museums-nacht „Nachtschicht“ sowie die Po-diumsgespräche, die das Hausunter dem Titel „Geschichte im Ost-West-Dialog“ gemeinsam mit demDeutschlandfunk und der LeipzigerVolkszeitung bzw. unter dem Titel„Leipziger Europaforum“ gemein-sam mit internationalen Einrichtun-gen in der Stadt veranstaltete. Als
Partner des Mitteldeutschen Rund-funks war das ZeitgeschichtlicheForum Leipzig zudem regelmäßigSchauplatz der Aufzeichnung desFernseh-Geschichtsmagazins „Bar-barossa“.
Publikationen
Im Oktober 2008 konnte dasneue Begleitbuch zur Dauerausstel-lung im Zeitgeschichtlichen Forumder Öffentlichkeit vorgestellt wer-den. Die Publikation „Demokratiejetzt oder nie! Diktatur – Widerstand– Alltag“ schildert mit gesamtdeut-scher Blickrichtung die GeschichteOstdeutschlands von 1945 bis in dieGegenwart. 16 reich illustrierte Ka-pitel folgen dem Weg durch die imJahr 2007 überarbeitete Ausstel-lung, vertiefen und ergänzen derenInhalte. Zentrale Themen der vonden wissenschaftlichen Mitarbei-tern der Stiftung verfassten Bei-träge sind die Anfänge derkommunistischen Diktatur in dersowjetischen Besatzungszone (SBZ),die Gründung der beiden deutschenTeilstaaten 1949, der Aufstand vom17. Juni 1953, der Mauerbau 1961,die Zäsur 1968 mit dem Scheiterndes „Prager Frühlings“ und die Ge-schichte der Opposition in der DDRseit Mitte der 1970er Jahre bis zumHerbst 1989.
Die erste Auflage des Begleit-buchs erschien 2001 unter dem
128
Titel „Einsichten. Diktatur und Wi-derstand in der DDR“. Die umfas-send überarbeitete Neuausgabenimmt neue Erkenntnisse der zeit-geschichtlichen Forschung ebensoauf wie die zusätzlichen Akzenteund veränderten Schwerpunkte derAusstellung. Sie gibt dem Wider-stand in der DDR noch größerenRaum und erinnert dabei an vieleEinzelschicksale. Außerdem be-leuchtet sie intensiv das Alltagsle-ben in der zweiten deutschenDiktatur und zeigt in diesem Zu-sammenhang die Mechanismen derUnterdrückung, den Gegensatz zwi-schen dem propagandistischen An-spruch der SED und der Wirk-lichkeit. Das aktualisierte Schluss-kapitel zur Entwicklung nach 1990beschreibt den Aufbau in den neuenBundesländern nach dem Zusam-menbruch des SED-Regimes undgeht der Frage nach, wie stark sich
noch immer die Folgen von Diktaturund Teilung auf die Gegenwart aus-wirken.
Das neue Begleitbuch zur Dau-erausstellung des Zeitgeschichtli-chen Forums erschien in einerGesamtauflage von 3.000 Exempla-ren im renommierten Verlag EditionLeipzig. Der Einbandgestaltung liegtein Fries des Cartoonisten RainerSchade zugrunde, das während derfriedlichen Revolution im Herbst1989 Teil der „Säule der Demokra-tie“ auf dem damaligen Karl-Marx-Platz vor dem Gewandhaus inLeipzig war.
Werbung
Auch die Werbemaßnahmen desZeitgeschichtlichen Forums Leipzigkonzentrierten sich besonders aufdie Wiedereröffnung der Daueraus-stellung im Oktober 2007. Für diegeplanten Maßnahmen wurde ineinem begrenzten Wettbewerbunter Grafikern und Agenturen eineigenes Corporate Design entwi-ckelt und anschließend auf sämtli-che Werbemittel übertragen. DasMotiv wurde in Leipzig und den an-grenzenden Regionen als Plakat ge-schaltet. In Leipzig konnte dasZeitgeschichtliche Forum die vonder Stadt zur Verfügung gestelltenSonderflächen zur Werbung mit hin-terleuchteten Plakaten belegen undauch die an den wichtigsten Aus-
Foto Seite 128:
Zur Wiedereröffnung
der Dauerausstellung
warb das Zeitgeschicht-
liche Forum mit dem
Werbeslogan auf einem
Bus der örtlichen Stadt-
werke.
Foto Seite 129:
City-Light-Poster
machen in Leipzig
auf die Ausstellungen
aufmerksam.
129
Öffentlichkeitsarbeit
Leipzig
fallstraßen positionierten Groß-Pos-ter nutzen. Mit Unterstützung derLeipziger Verkehrsbetriebe erreichtedas Museum darüber hinaus aufrund 700 Werbestellen in Bussenund Straßenbahnen die Aufmerk-samkeit von täglich mehreren zehn-tausend Fahrgästen. Eine besonde-re Wirkung erzielte ferner ein imCorporate Design gestalteter Stadt-bus, der auf einer Innenstadtlinie inunmittelbarer Nähe des MuseumsHalt macht. Wegen der zahlreichenAnfragen von Besuchern und aus-wärtigen Interessenten wurde dasMotiv auch als Postkarte produziert.
Zur Bewerbung der Wechselaus-stellungen belegte das Zeitge-schichtliche Forum – wie bei derDauerausstellung – die genanntenPlakatflächen der Stadt Leipzig. In-formationsfaltblätter wiesen in aus-gewählten Städten der östlichenBundesländer auf die Präsentatio-nen hin, wobei die Verteilung ziel-gruppenorientiert in Kultur-, Bil-dungs- und Gastronomieeinrichtun-gen erfolgte. Große Aufmerksam-keit erzielte auch das hinter-leuchtete Großtransparent, das seitder Neugestaltung der Daueraus-stellung im Eingangsbereich desMuseums zur Außenwerbung zurVerfügung steht. Es wurde durchein elektronisches Schriftband er-gänzt, das am Eingang laufend überdie aktuellen Angebote des Hausesinformiert. Auf diese Weise nutztedas Haus den Vorteil des zentralen
innerstädtischen Standorts in derGrimmaischen Straße, die zu denmeistfrequentierten EinkaufsmeilenDeutschlands gehört.
Das Zeitgeschichtliche ForumLeipzig bewarb seine Angebote fer-ner mit effektiv platzierten Anzeigenin verschiedenen Publikationen. Fürdie Wechselausstellungen wurden
Anzeigen in Kultur- und Stadtmaga-zinen geschaltet. Das Museum wardarüber hinaus mit Anzeigen und re-daktionellen Beiträgen im Regional-magazin „Regjo“ vertreten, dasdurch Verteilung in der ICE-Flotteder Deutschen Bahn auch überre-gionale Wirkung entfaltet.
132
Besucherservice im
Haus der Geschichte Bonn
Museumspädagogik
Aus Anlass des 50. Jahrestagsder Unterzeichnung der RömischenVerträge veranstaltete die Stiftungam 25. März 2007 den Familien-Sonntag „Europa spielend entde-cken“. In der Talkrunde „Schülerfragen Politiker“ diskutierten in derDauerausstellung die Europaabge-ordnete Ruth Hieronymi MdEP unddie Leiterin der Regionalen Vertre-tung der Europäischen Kommissionin Bonn, Barbara Gessler, mit Schü-lerinnen und Schülern der Europa-
Ein Angebot der „Teen
Group“ des Hauses der
Geschichte: Jugendliche
informieren ihre Alters-
genossen zu besonderen
Anlässen wie dem Interna-
tionalen Museumstag in
den Ausstellungen.
schule Bornheim. Anlässlich des Ju-biläums erschien das neue Mit-mach-Programm „Eine Reise durchEuropa“.
Für das Informationszentrum Fö-deralismus im Bundesrat Bonn ent-wickelte das Haus der Geschichteein museumspädagogisches Ange-bot, mit dem dieser authentischeOrt der deutschen Zeitgeschichtespeziell für Jugendliche erlebbarwird. Hierbei ging die Stiftung eineKooperation mit der Gemeinnützi-gen Hertie-Stiftung als Trägerin desBundeswettbewerbs „Jugend de-battiert“ ein. Die Kooperationspart-ner entwickelten einen Projekttagfür Schulklassen mit dem Titel „DieSitzung ist eröffnet! Schülerinnenund Schüler debattieren im Bundes-rat Bonn“. Die Auftaktveranstaltungfand im November 2007 im Plenar-saal mit Joachim Gauck und einerSchaudebatte der „Jugend debat-tiert“-Bundessieger vor über 200Jugendlichen statt. Nach mehrtägi-gen intensiven Trainingsseminarenfür die Moderatoren und zwei Pilot-workshops gehört das Programmseit Herbst 2008 zum ständigenmuseumspädagogischen Angebotder Stiftung.
Das Haus der Geschichte ist seit2008 Kooperationspartner der Kör-ber-Stiftung für den Geschichts-wettbewerb des Bundespräsiden-ten in Nordrhein-Westfalen. 140Lehrerinnen und Lehrer kamen am3. September 2008 zur Auftaktver-
133
Besucherservice
Bonn
anstaltung ins Museum, informier-ten sich über das aktuelle Wettbe-werbsthema „Helden: verehrt –verkannt – vergessen“ und disku-tierten mit Joachim Gauck. Im Som-mer 2009 werden die Landespreiseim Rahmen eines Geschichtsfestesim Haus der Geschichte vergeben.
Die 2005 gegründete „TeenGroup“ setzte ihre Arbeit mit Ju-gendlichen aus fünf verschiedenenSchulen fort. Alle zwei Wochenwerfen die Teens einen Blick hinterdie Kulissen des Museums und ler-nen verschiedene Arbeitsbereicheim Haus der Geschichte kennen.Sie gestalteten mehrere Familien-Sonntage mit eigenen Beiträgen. Anden Internationalen Museumstagenam 20. Mai 2007 und 18. Mai 2008standen sie Besuchern im Rahmendes Projekts „Ask me...“ in denAusstellungen Frage und Antwortzu ausgewählten Objekten. Überihre Projekte und den internationa-len Austausch mit Jugendlichenin den USA informiert auch dieHomepage der Teen Group unterwww.hdg.de.
Zu den Wechselausstellungender Jahre 2007 und 2008 fanden un-terschiedliche museumspädagogi-sche Veranstaltungen statt: ImBegleitprogramm der Ausstellung„Heimat und Exil. Emigration derdeutschen Juden nach 1933“ nah-men über 250 Schülerinnen undSchüler an Workshops teil, in denensie sich mit den Fluchtwegen deut-
scher Juden nach 1933 und der Si-tuation in den Emigrationsländernbeschäftigten. Zu den Ausstellun-gen „drüben. Deutsche Blickwech-sel“ und „Skandale in Deutschlandnach 1945“ organisierte die Muse-umspädagogik am 11. Februar 2007und am 27. Januar 2008 Familien-Sonntage. Im Sommer 2008 be-suchten über 40 Kinder halbtätigeFerienworkshops, in denen sie dieAusstellung „Melodien für Millio-nen. Das Jahrhundert des Schla-gers“ entdecken und unter pro-fessioneller Anleitung selbst Schla-ger singen und musizieren konnten.
An jeweils sechs Veranstal-tungstagen in den Jahren 2007 und2008 trat das Theater Taktil im Hausder Geschichte auf und bot den Be-
Im Original-Gestühl
des ersten deutschen
Bundestages können
Besucherinnen und
Besucher Ausschnitte
aus Bundestagsdebatten
der 1950er und 1960er
Jahre selbst auswählen
und anschauen.
134
suchern einen emotionalen Einstiegin ausgewählte Themen der Dauer-ausstellung.
Die bestehenden Kooperationenmit Schulen und Bildungsinstitutio-nen führte die Museumspädagoginim Berichtszeitraum fort: Sie unter-stützte und leitete Projekttage imRahmen des jährlichen ost-west-deutschen Schüleraustauschs so-wie zu den Themen „Migrations-geschichten in Deutschland“ und„Musik im Spiegel der Geschichte“.Mit Studienseminaren und Lehrer-kollegien sowie Kolleginnen undKollegen aus anderen Museenführte sie intensive Beratungs- undAustauschgespräche und betreutederen Studientage im Haus der Ge-schichte. Zudem konnte die lang-
jährige Kooperation mit dem Duits-land Instituut Amsterdam für dieniederländische Lehrerausbildungerfolgreich weitergeführt werden.Die Jahrestagung des Geschichts-lehrerverbands Nordrhein-Westfa-len fand 2007 im Haus derGeschichte statt. Mit dem Verbandder Geschichtsdidaktikerinnen undGeschichtsdidaktiker Deutschlandse.V. ging die Stiftung eine enge Ko-operation ein, ebenso konnte dieZusammenarbeit mit den Universi-täten Bonn, Köln und Mainz inten-siviert werden. Gemeinsam mitanderen Bonner Museen entwi-ckelte die Stiftung die Homepage„Museen machen Schule“. Dortkönnen Lehrerinnen und Lehrerzielgruppen- und themenorientiertgeeignete museumspädagogischeAngebote in Bonn recherchieren.
Im Berichtszeitraum entstandenin Kooperation mit dem Stark VerlagUnterrichtsmaterialien für Lehrerin-nen und Lehrer zur Vorbereitungeines Besuchs in der Karikaturenga-lerie. Für das InformationszentrumFöderalismus entwickelte das Hausder Geschichte Mitmach-Materia-lien zur Entdeckung des Plenarsaalsund für die Präsentation im Foyer.Für das Rollenspiel „Die Sitzung isteröffnet“ im Bundesrat erarbeitetedas Projektteam gemeinsam mit„Jugend debattiert“ umfangreicheLehrermaterialien, auch zur Vorbe-reitung und Nachbereitung des Pro-jekttags im Unterricht.
Neue Mitmach-Programme
zu den zahlreichen Aus-
stellungen des Museums
finden großes Interesse.
135
Besucherservice
Bonn
Besucherdienst
Zu den Hauptaufgaben des Besu-cherdienstes gehören Auswahl,Schulung, Fortbildung sowie Evalua-tion der Gruppenbegleiterinnen und-begleiter. Diese vermitteln die Aus-stellungsinhalte und geben Anregun-gen zum Nachdenken über die deut-sche Geschichte seit dem Ende desZweiten Weltkriegs. Ein Pool vonrund 60 Honorarkräften steht für diejährlich nahezu 5.500 gebuchten Be-gleitungen zur Verfügung.
Von den Gruppenbegleiterinnenund -begleitern des Hauses werdennicht nur gute Kenntnisse der deut-schen Zeitgeschichte erwartet, son-dern auch die Fähigkeit, sowohlkomplexe zeitgeschichtliche Ent-wicklungen zielgruppengerecht zupräsentieren als auch historische In-halte und Zusammenhänge durchObjekte zu vermitteln. Ein vom Be-sucherdienst konzipiertes umfang-reiches Fortbildungsangebot unter-stützte die Qualitätssicherung derBesucherbetreuung. Im Berichts-zeitraum standen Fortbildungsver-anstaltungen zusammen mit denwissenschaftlichen Mitarbeitern so-wie der Erfahrungsaustausch zumUmgang mit Zielgruppen oder me-thodisch-didaktische Fragen aufdem Programm. Expertengesprä-che zu verschiedenen Themen so-wie zwei ganztägige Workshops mitprofessionellen Kommunikations-trainern ergänzten das Angebot.
Mit Ausstellungen außerhalbdes Museums – Ensemble PalaisSchaumburg und Kanzlerbungalowmit Park, das InformationszentrumFöderalismus im Bundesratsge-bäude sowie die Karikaturengalerie– erweitert sich auch das Spektrumder Angebote des Besucherdiens-tes. Bisher hat sich etwa die Hälfteder Begleiterinnen und Begleiter fürdiese historischen Standorte zu-sätzlich qualifiziert.
Besucherbetreuung beginnt be-reits mit der Anmeldung von Grup-pen im Büro des Besucherdienstes:Die Mitarbeiterinnen beraten Inte-ressenten im Vorfeld des Besuchsund bearbeiten die schriftlichen, te-
Die Koordinatorin des
Besucherdienstes,
Helena von Wersebe,
bei einem Rundgang
für Mitglieder der Teen
Group
136
lefonischen und elektronischen An-fragen. Im Berichtszeitraum war eindeutlicher Anstieg an elektroni-schen Anfragen zu beobachten:Während 2007 elf Prozent der Grup-pen per E-Mail angemeldet wurden,waren es 2008 bereits 23 Prozent.
Am Informationsschalter imFoyer des Museums findet die Be-treuung der Gruppen- und Einzelbe-sucher unmittelbar und persönlichstatt. Die Steuerung von Kommuni-kations- und Serviceangebotenbeinhaltet: tägliche Aktualisierungder Informationsmonitore, Emp-fang von angemeldeten Gruppen,Organisation der entsprechendenBegleitungen, Verkauf von ausge-wählten Publikationen des Muse-ums und Unterstützung bei Ver-anstaltungen.
Besucherstatistik
Die Besuchszahlen in der Dauer-ausstellung und den Wechselaus-stellungen in Bonn befinden sichweiterhin auf hohem Niveau: Über8,6 Millionen Besuche wurden seitder Eröffnung 1994 bis Ende 2008allein in der Dauerausstellung ge-zählt − 2007 waren es mehr als520.000, 2008 knapp unter 500.000Besuche.
In den verschiedenen Wechsel-ausstellungen konnten seit 1994über 3,1 Millionen Besuche gezähltwerden. 2007 zählte das Museum330.000, 2008 mit 350.000 Ausstel-lungsbesuchen die dritthöchstenZahlen in den Wechselausstellun-gen seit Eröffnung. Die erfolg-reichste Wechselausstellung imBerichtszeitraum war „Melodien fürMillionen. Das Jahrhundert desSchlagers“ mit 144.949 Besuchen.Die Ausstellung liegt damit nach Be-suchszahlen insgesamt an dritterStelle bei den Wechselausstellun-gen nach „SpielZeitGeist“ (1995)und „Rock. Jugend und Musik inDeutschland“ (2006). Nach wie vorzogen die Wechselausstellungenam Wochenende besonders Klein-gruppen und Mehrfachbesucher an.
Die besucherstärksten Monatewaren 2007 der Mai mit über58.000 Besuchen und 2008 derJuni mit knapp 50.000 Besuchen inder Dauerausstellung. Das Besuchs-aufkommen verteilte sich wie in den
Foto Seite 136.
Elektronische Führungs-
systeme ermöglichen
die drahtlose Kommu-
nikation zwischen
Gruppenbegleiter und
Gruppe.
Foto Seite 137:
Die interaktiven Medien-
stationen bieten Besu-
chern die Möglichkeit,
Themen individuell zu
vertiefen.
137
Besucherservice
Bonn
Vorjahren relativ gleichmäßig überdie Wochentage. Der Sonntag warim Berichtszeitraum erneut der be-sucherstärkste Tag. Durchschnittlichkamen 2007 und 2008 jeweils über1.600 Besucher täglich in die Dau-erausstellung.
Die hohen Besuchszahlen 2007und 2008 machten sich auch in derZahl der „Supertage“ mit je über4.000 Besuchen bemerkbar: 2007waren drei solcher Spitzentage zuverzeichnen: Der letzte Öffnungstagdes Jahres, Sonntag, der 30. De-zember, war mit 4.750 Besuchenin der Dauer- und 7.784 Besuchenin den Wechselausstellungen derbesucherstärkste Tag des Jahres2007. 2008 war dies der 3. Oktobermit 3.942 Besuchen in der Dauer-und 5.974 Besuchen in den Wech-selausstellungen.
Die Zahl der Begleitungen in derDauer- und den Wechselausstellun-gen bewegt sich weiterhin aufhohem Niveau: 2007 gab es 5.462Begleitungen mit 102.125 Teilneh-mern, 2008 5.234 Begleitungen mit97.805 Teilnehmern. Somit wurdenim Berichtszeitraum rund 19 Pro-zent aller Besucher in der Dauer-ausstellung im Rahmen einerGruppenbegleitung betreut. Davonstellen die Schulen den größten An-teil mit zirka 40 Prozent der Beglei-tungen. Der Anteil aller fremd-sprachigen Begleitungen in Eng-lisch, Französisch, Niederländisch,Polnisch, Russisch, Italienisch und
Spanisch betrug rund 19 Prozent.An den regelmäßig samstags undsonntags angebotenen Turnusbe-gleitungen in der Dauer- unddenWechselausstellungen nahmen2007/2008 jeweils über 4.000 Be-sucher teil.
Auch das Interesse an Beglei-tungen durch das Ensemble PalaisSchaumburg und Park war weiter-hin hoch: 2007 fanden über 600 Be-gleitungen für 7.347 Personen statt,2008 über 400 Begleitungen für
knapp 5.500 Personen. Der Besuchdes ehemaligen Plenarsaals im Bun-desratsgebäude sowie der Ausstel-lung im Vorraum ist für angemel-dete Gruppen täglich möglich.Knapp 3.000 Personen haben vondiesem Angebot in den Berichtsjah-ren Gebrauch gemacht. Seit April2007 ist auch die Karikaturengaleriesonntags geöffnet. Im Jahr 2007haben sich über 3.600 und 2008über 3.200 Personen die dortigeDauerausstellung angesehen.
138
Besucherforschung
Die Stiftung Haus der Ge-schichte befragt in regelmäßigenAbständen ihre Besucherinnen undBesucher, um Aufschluss zu gewin-nen über demografische Daten der„Nutzer“, die Resonanz auf Dauer-ausstellung undWechselausstellun-gen sowie die Korrelation vonGestaltung und Ausstellungsinhal-ten. Diese langfristig angelegtenUntersuchungen und die kontinuier-liche Arbeit der Stiftung in der Be-sucherforschung ermöglichen über
die jeweilige „Momentaufnahme“hinaus, langfristige Trends und Än-derungen im Besucherverhalten zuerkennen.
Auch in den Jahren 2007 und2008 führte die Stiftung ihre besu-cherorientierte Arbeit mit einerReihe von Projekten weiter. Im Vor-dergrund stand die Befragung vonNutzern des Hauses der Geschichtein Bonn, die nicht mit einer vorabangemeldeten Gruppenbegleitungdas Museum besuchten. Außerdemwidmete sich die Stiftung anlässlichder Wechselausstellung „Skandalein Deutschland nach 1945“ derFrage, wie die Besucher des Muse-ums von Ausstellungen erfahrenund welche Informationswege sienutzen.
Für die geplante Umgestaltungverschiedener Bereiche und Abtei-lungen des Museums wurden dieBesucher detailliert zu Inhalten undGestaltung interviewt und ihreWege durch die Ausstellung evalu-iert.
Standardbefragung
Seit 1995 befragt das Haus derGeschichte immer wieder in größe-rer Zahl die Besucher, die allein odermit Partner/Partnerin bzw. in kleinenGruppen das Haus besuchen. Die-ser Personenkreis umfasst etwa 80Prozent der Gesamtbesucher desMuseums und ermöglicht durchseine Aussagen, die Resonanz derAusstellung insgesamt, ihre einzel-
Häufigkeit des Besuchs im Haus der Geschichte
1997-1999 2002/2003 2006 2007/2008
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
1 Besuch2 bis 3 malöfter als 3 mal
61
24
15
56
50
45
2629
26 2425
19
139
Besucherservice
Bonn
nen Vermittlungskomponenten so-wie das sonstige Angebot des Mu-seums genauer zu erfassen.
Die Besucher schätzen Ausstel-lungen und Programm des Hausesund kommen gern wieder. Diesspiegelt sich zum einen in dergleichbleibend hohen Zustimmung:Fast allen Besuchern gefiel dasHaus der Geschichte sehr gut (69Prozent) oder gut (30 Prozent);diese Gruppe äußert darüber hinauszu einem sehr großen Teil (87 Pro-zent), einen Besuch uneinge-schränkt weiter zu empfehlen.
Zum anderen zeigt die Häufigkeitdes Besuchs, dass mehr als dieHälfte der Befragten schon mehr-mals im Museum gewesen ist: EinViertel der Besucher kam bereitszum zweiten oder dritten Mal in dasHaus der Geschichte, fast ein Drit-tel ist sogar schon öfter als dreimalzu Besuch gewesen. Etwa 45 Pro-zent waren zum ersten Mal im Hausder Geschichte.
Insbesondere durch die persönli-che Empfehlung durch Verwandteoder Freunde – 45 Prozent der Be-fragten gaben dies an – werden dieBesucher auf das Haus der Ge-schichte aufmerksam gemacht,zirka 30 Prozent nennen die Be-richterstattung in Printmedien, Funkund Fernsehen. In den letzten Jah-ren ist zudem ein deutlicher Anstiegdes Internets als Informationsme-dium zu verzeichnen.
Ein attraktives Wechselausstel-lungsprogramm brachte mehr alsdie Hälfte der Besucher dazu, sichneben der Dauerausstellung auch„Skandale in Deutschland nach1945“ und „Das Boot – Geschichte.Mythos. Film“ anzusehen. Sie setz-ten sich intensiv mit dem Angebotauseinander: Jeder dritte Besucherverweilte zwei bis drei Stunden,mehr als jeder zehnte sogar bis zuvier Stunden im Haus. Wie in denVorjahren bleibt das Haus Ziel priva-ter Unternehmung – über 60 Pro-zent der Befragten kamen mitPartnern, Familie oder Freunden.Die große Akzeptanz des Hauseswird durch die detaillierte Beurtei-
Altersgruppen Bundesrepublik – Besucher Haus der Geschichte
< 19 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-59 Jahre > 60 Jahre
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
Bundesrepublik gesamtBesucher Haus der Geschichte
20
16
12
23
14 1416
15
13
17
25
15
lung der Ausstellungspräsentationund -inhalte sowie verschiedenereinzelner Angebote des Hauses un-termauert. Die Vermittlung von Zu-satzinformationen durch allgemeineund detailliertere Ausstellungstextesowie interaktive Ausstellungsele-mente – Medienstationen, Schubla-den und Klappelemente – bewertetein erfreulich großer Teil der Besu-cher als sehr zufrieden stellend undabwechslungsreich (zwischen 80und 90 Prozent). Dabei sind es be-sonders die jüngeren Besucher imAlter zwischen 15 und 19 Jahren,die diese Stationen sehr positiv an-nehmen.
140
Ist die Darstellung von Themen der Bundesrepublik
einerseits und der DDR andererseits ausgewogen?
1997-1999
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
AusgewogenMeistens ausgewogenUnausgewogenHabe keine Meinung
38
43
118
2002/2003
47
36
9 8
2006
50
36
5
9
2007/2008
53
37
5 5
Von großer Bedeutung ist auchder Besucherservice. Er wird vonden Besuchern gern genutzt. Über85 Prozent der Besucher nehmenbei ihrem Besuch Angebote des Be-sucherdienstes wahr, seien es Be-
Die Darstellung von Themen ausder Zeit des geteilten Deutschlandwird zunehmend besser beurteilt.Für fast 90 Prozent der Besuchersind Inhalte der Geschichte der Bun-desrepublik Deutschland und derDDR-Geschichte sehr oder größten-teils ausgewogen dargestellt und insinnvollen Vergleichen präsentiert.
ratungen am Informationsschalterim Foyer oder Begleitungen durchdie Ausstellungen.
Bei den demografischen Datenzeigen sich einige positive Verände-rungen: Im Vergleich zur letzten Er-hebung hat sich die Altersgruppeder „Twens“ von 20 bis 29 Jahrenwieder deutlich vergrößert auf23 Prozent, damit sind Besucherdieses Alters am zahlreichsten imHaus vertreten und folgen zudemsehr häufig einer persönlichen Emp-fehlung, das Haus der Geschichtekennenzulernen. Der langfristigeVergleich zeigt, dass sich auch derAnteil der über 60-Jährigen auf ak-tuell über 15 Prozent vergrößert hat.
Umgestaltung der
Dauerausstellung
Auch für die geplante Neugestal-tung der Dauerausstellung werdendie Methoden der Besucherfor-schung genutzt. So wird der zu-künftige Ausstellungsbereich, dersich mit den deutsch-deutschen Be-ziehungen von Mitte der 1950er bisMitte der 1960er Jahre beschäftigt,stärker mit der Fluchtbewegungund dem menschlichen Schicksalder Flüchtlinge aus der DDR befas-sen. Untersuchungen zeigten, dassnicht einmal jeder fünfte Besucherdie Erwartung hatte, von diesemThema etwas zu sehen bzw. dasThema „Flucht aus der DDR“ über-haupt kannte und erwartete. Die-sem Informationsmangel wird das
141
Besucherservice
Bonn
Haus der Geschichte bei der Neu-strukturierung der DauerausstellungRechnung tragen. Die Ergebnissevon Besucherbefragungen und -be-obachtungen fließen auch in die Zu-sammenarbeit mit den Mitgliederndes Wissenschaftlichen Beiratesein, die die Umgestaltung der Dau-erausstellung als Experten beglei-ten. Sie zeigten sich in intensivenBesprechungen sehr interessiert anden Reaktionen und Kenntnissender zum größten Teil nicht fachwis-senschaftlich vorgebildeten Nutzerdes Hauses.
In die Umgestaltung der Dauer-ausstellung wird auch das Informa-tionszentrum einbezogen. Die Be-
sucherforschung stellt hier Erkennt-nisse über Interessen undWünscheder Nutzer zur Verfügung, die in diePlanungen für die Raumstruktursowie die technische Ausrüstungdes Informationszentrums einflie-ßen.
Skandale in Deutschland
nach 1945
Für diese Wechselausstellungwurde untersucht, welche Informati-onsquellen undMedien die Besuchergenutzt haben und welche Wirkungdiese auf den Entschluss hatten, sichdie Ausstellung anzusehen.
Die Befragungen ergaben, dassfast 25 Prozent der Besucher durch
Publikationen wie den Ausstellungs-flyer, 35 Prozent durch die Transpa-rente amMuseumsgebäude von derPräsentation erfahren haben. Auchan Plakate zur Ausstellung, die inBonn und Köln ausgehängt waren,erinnerten sich über die Hälfte derBesucher.
Darüber hinaus hatte die Be-richterstattung in Tageszeitungensowie die persönliche Empfehlunggroße Bedeutung: 46 Prozent derBesucher hatten in der Zeitungdavon gelesen, 43 Prozent einenHinweis durch ihr privates Umfeldbekommen.
Fast ein Drittel der Besucher gaban, auch im Internet über „Skandale
Wie sind Sie auf die Ausstellungen aufmerksam geworden?*
vor Ort(im Haus)
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
Wechselausstellung SkandaleDauerausstellung
24
keineAng
abe
vor Ort(Transparent)
35
5
Plakat
51
12
Zeitung,Zeitschrift
46
16
Hinweise,Empfehlung
4345
Internet
31
8
Publik.zur WA
24
4
Info-ScreenU-Bahn
20
keineAng
abe
Fernsehen
14
7
Radio
9
5
*Mehrfachnennungen möglich
142
in Deutschland“ erfahren zu haben.Die Nennung des Mediums „Inter-net“ zur Information über eine aktu-elle Wechselausstellung ist damithöher als für die Dauerausstellungdes Hauses. Dagegen spielten Fern-seh- und Radioberichte eine gerin-gere Rolle.
Die wichtigsten Auslöser, dieWechselausstellung zu besuchen,sind die persönliche Empfehlungoder Berichte in der Presse. Die Be-richterstattung in den Printmedienveranlasste zu jeweils 20 Prozentdie Besucher dazu, noch am selben
Tag oder innerhalb einer Woche dieAusstellung zu besuchen.
Das Transparent am Museums-gebäude oder die Plakate spieltenfür jeweils zirka 12 Prozent der Be-sucher eine Rolle. Mit über 10 Pro-zent der Nennungen ist auch dasInternet eine relevante Größe. Be-richte im Fernsehen, Rundfunk oderder Ausstellungsprospekt waren fürdie Entscheidung, die Wechselaus-stellung zu besuchen, von geringe-rer Bedeutung.
Über die Hälfte der Befragten be-suchte gezielt nur die Wechselaus-stellung, die anderen Besucherkombinierten ihren Aufenthalt nochmit einem Besuch der Daueraus-stellung oder weiteren kulturellenUnternehmungen.
Inhaltlich zeigte sich, dass die ander Sache orientierte Präsentations-form der „Skandale in Deutschland“den Besuchervorstellungen entge-genkam: Der überwiegende Teil desPublikums wollte die Hintergründeder einzelnen Skandale kennenler-nen und war weniger an „pikantenEnthüllungen“ interessiert.
Darüber hinaus ändert sich mitdem Ausstellungsbesuch die per-sönliche Bewertung einzelner Skan-dale. So wurde der emotionalberührende Contergan-Skandal beider Befragung nach dem Besuchwesentlich häufiger als für die Be-fragten wichtig benannt als vor demBesuch der Ausstellung.
Rund ein Fünftel der
befragten Besucher ent-
schloss sich aufgrund
der Presseberichterstat-
tung kurzfristig zum
Besuch der Ausstellung.
143
Besucherservice
Bonn
Informationszentrum
Das Informationszentrum bietetden Besucherinnen und Besucherndes Hauses ein vielfältiges Angebotan Büchern, Zeitschriften und Zei-tungen sowie audiovisuellen Me-dien. Zeitgeschichtliche Themenkönnen dort in Bezug zu den Inhal-ten der Ausstellungen des Muse-ums vertieft werden.
Drei Sammlungsschwerpunktehaben einen einmaligen Bestandentstehen lassen:
Bibliotheksgut, das biografischesErleben von Geschichte vermittelt,Medien und Berichte, die die bildli-che Darstellung historischer Ereig-nisse festhalten und Materialien, diesich mit der dinglichen Kultur derZeitgeschichte auseinandersetzen.
Im Berichtszeitraum haben über50.000 Besucherinnen und Besu-cher das Informationszentrum ge-nutzt, 14.000 Anfragen wurdenbeantwortet.
Der Gesamtbestand von rund63.000 Büchern wurde im Berichts-zeitraum um 4.000 Erwerbungen er-gänzt, die umfassende Sammlungvon Zeitschriften, bestehend aus2.500 Titeln, davon 150 zur Fortset-zung, konnte um 3.250 Einzelhefteund 85 Bände erweitert werden.Der Bestand an öffentlich zugängli-chen audiovisuellen Medien wuchsum 756 auf nun insgesamt 4.067Einheiten. Um die Lagerkapazitätendem Bestandswachstum anzupas-
sen, wird in den Depots der Einbaueiner neuen Kompaktanlage vorbe-reitet.
Neben seiner Bedeutung als Stu-dien- und Leseort erfüllt das Infor-mationszentrum auch eine wichtigekommunikative Funktion, die sichnicht zuletzt an den vielfältigen Ver-anstaltungen ablesen lässt. Dazuzählen Buchvorstellungen wiedie Präsentation des biografischenLexikons „Kanzler und Minister1998–2005“ mit dem ehemaligenBundesarbeitsminister Norbert Blümoder die Präsentation von WillyBrandts Bericht über die NürnbergerProzesse mit der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung.
Gemeinsam mit dem
früheren Bundesarbeits-
minister Norbert Blüm
(2.v.r.) stellte Herausge-
ber Udo Kempf (2.v.l.)
den Band „Kanzler und
Minister 1998-2005“ vor.
144
HermannWeber stellte die Erin-nerungen aus seiner Zeit an derSED-Parteihochschule und der Ab-kehr vom Kommunismus mit demTitel „Leben nach dem Prinzip links“vor. Auch für Podiumsdiskussionenwird das Informationszentrum gerngenutzt: Im Anschluss an die Über-gabe von Exponaten zur HandballWM 2008 fand dort eine Diskussion
mit Handball Bundestrainer HeinerBrand und Marketingexperten statt.
Die räumliche Atmosphäre fürderartige Veranstaltungen wirdebenfalls für wichtige Objektüber-gaben wie die sogenannten„Honecker-Koffer“ genutzt, diedanach über mehrere Wochen imInformationszentrum präsentiertwurden.
Einen besonderen Sammlungs-schwerpunkt bildet die „Bibliothekzur Geschichte der DDR“ mit insge-samt rund 185.000 Bänden, davon1.100 Neuerwerbungen im Be-richtszeitraum. Aus über 50 JahrenSammlungstätigkeit werden sowohlseltene Primär- und Sekundärlitera-tur als auch die aktuellsten wissen-schaftlichen Publikationen zur DDR-und Deutschlandforschung angebo-ten. Komplettiert wird dieser Be-stand durch die reichhaltigeSammlung von 2.000 Zeitschriften-titeln und 380 Zeitungen, der Wis-senschaftler aus dem In- undAusland anzieht. Basierend auf die-sen Beständen sind in den letztenJahren neben zahlreichen Seminar-und Abschlussarbeiten auch eineReihe wissenschaftlicher Monogra-fien entstanden. Zu den Arbeits-schwerpunkten der nächsten Zeitgehören neben der weiteren Digita-lisierung der bibliografischen Nach-weise des Altbestandes eine nochengere inhaltliche und organisatori-sche Verzahnung mit dem Informa-tionszentrum.
Fußballnationalspieler
Wolfgang Overath und
WDR-Rundfunkreporter
Dietmar Schott im
Gespräch bei der Buch-
vorstellung „Kopfball,
Einwurf, Nachspielzeit“
der Bonner Professoren
Uwe Baumann und
Dittmar Dahlmann
145
Besucherservice
Bonn
Mediathek
In der Mediathek werden der Ein-satz von audiovisuellen Medien fürdie Dauer- und Wechselausstellun-gen der Stiftung dokumentiert sowieumfassende Informationen über zeit-geschichtlich relevante audiovisuelleProduktionen aufbereitet. Im Be-richtszeitraum konnten über 5.000neue Datensätze angelegt werden.Mehr als 35.000 Einheiten stehenzur Verfügung. Einen besonderen Ar-beitsschwerpunkt bildeten die zahl-reichen Bestände an Filmen undTonträgern zum Thema Schlager, dieim Rahmen der Wechselausstellung
„Melodien für Millionen. Das Jahr-hundert des Schlagers“ für dieSammlung erworben und erschlos-sen wurden. Darüber hinaus unter-stützte das Team der Mediathek imBerichtszeitraum mit über 700 Re-cherchen die verschiedenen Aus-stellungsteams des Museums.
Eine neue Aufgabe stellt dieLangzeitarchivierung von digitalenMedieneinheiten dar, die einenimmer größeren Stellenwert imSammlungsbestand einnehmen.Hier werden langfristige Konzeptefür die Erschließung dieser Mediensowie deren dauerhafte Verfügbar-keit entwickelt.
Zahlreiche Bild- und Ton-
träger zur Ausstellung
„Melodien für Millionen“
konnten für die Samm-
lungen erworben und
erschlossen werden.
146
Besucherservice im
Zeitgeschichtlichen Forum
Leipzig
Museumspädagogik
Mit der Eröffnung der neuenDauerausstellung im Oktober 2007mussten auch die museumspäda-gogischen Angebote überarbeitetwerden: vordringlich Materialien,die es Schülerinnen und Schülernermöglichen, sich vertiefend mit derDauerausstellung zu beschäftigen.Die Museumspädagogin erarbeitetein enger Zusammenarbeit mit Leh-rerinnen und Lehrern Arbeitsbögenmit thematischen Schwerpunktenfür die selbstständige Erkundungder Ausstellung durch Kleingruppen,u.a. zu den Themen „Kirche in derDDR“, „Frauen in der DDR“, „Poli-tikgeschichte“, „Jugend in derDDR“ und „Opposition und Wider-
stand“. Die Arbeitsbögen findennicht nur bei den Pädagogen großeZustimmung, sondern auch bei denSchülerinnen und Schülern.
Ebenfalls seit 2008 steht der Pro-jekttag „Die Berliner Mauer“ für dieKlassenstufen 9 (Mittelschule) und10 (Gymnasium) mit zehn metho-disch unterschiedlichen Aufgaben-stellungen zur Verfügung. Nebentheoretischem Lernen bleibt auchGelegenheit für eigenes kreativesHandeln. Die Museumspädagoginentwickelte zudem das Mitmach-programm „Entdeckungen“ in denSprachen Deutsch, Englisch, Fran-zösisch und Spanisch für die Welt-jugendkonferenz der Baptisten, dieim August 2008 in Leipzig tagte.
Besucher mit eingeschränkterMobilität können jetzt das in Koope-ration mit dem BehindertenverbandLeipzig e.V. aktualisierte Begleitheftdurch die Ausstellung nutzen.
Für die Übernahme der Wech-selausstellungen „Heimat und Exil.Emigration der deutschen Judennach 1933“, „Skandale in Deutsch-land nach 1945“ und „Melodien fürMillionen. Das Jahrhundert desSchlagers“ wurden die museums-pädagogischen Angebote in Leipzigerweitert. Die Museumspädagoginbot zur Wechselausstellung „Hei-mat und Exil“ einen thematisch pas-senden Dokumentarfilm als Film-werkstatt an, für „Skandale inDeutschland “ Schülerprojekte zurRolle der Presse. Um Lehrerinnen
Foto Seite 146:
Archive und Museen
stellten sich zum Auftakt
des Geschichtswett-
bewerbs 2008 des
Bundespräsidenten
in Sachsen im Zeitge-
schichtlichen Forum vor.
Foto Seite 147 oben:
Zur Weltjugendkonfe-
renz der Baptisten
entwickelte die Muse-
umspädagogik ein
mehrsprachiges Mit-
machprogramm für
die Dauerausstellung.
Foto Seite 147 unten:
Der sächsische Minister-
präsident Georg
Milbradt diskutierte
während eines Besuchs
im Zeitgeschichtlichen
Forum mit Schülerinnen
und Schülern.
147
Besucherservice
Leipzig
und Lehrern in Ostdeutschland dieganze Bandbreite der Angebote be-kannt zu machen, führte die Muse-umspädagogin im Berichtszeitraumüber 20 Lehrerfortbildungen durchund leitete über 60 Schülerprojektezu Themen der Dauerausstellungund den Wechselausstellungen.
Darüber hinaus beteiligte sie sichan der Organisation und Gestaltungbesonderer Veranstaltungen: Im Ja-nuar 2008 begleitete sie im Rahmendes „Dialogs zwischen den Genera-tionen“ den sächsischen Minister-präsidenten Prof. Dr. Georg Milbradtund Schülerinnen und Schüler durchdie Dauerausstellung.
Als neuen Kooperationspartnerkonnte das ZeitgeschichtlicheForum Leipzig die Körber-StiftungHamburg begrüßen, die mit derAusrichtung des Geschichtswettbe-werbs des Bundespräsidenten be-traut ist. Erstmals organisierte dieMuseumspädagogik gemeinsammit dieser Stiftung und dem sächsi-schen Staatsministerium für Kultusdie Auftaktveranstaltung des Wett-bewerbs in Sachsen, bei der Kultus-minister Prof. Dr. Roland Wöller dasThema des Wettbewerbs bekanntgab. Dank der guten Erfahrungenaller Beteiligten soll die Kooperationauch in Zukunft fortgesetzt werden.
Außerhalb des Zeitgeschichtli-chen Forums Leipzig war die Muse-umspädagogin als „Museumsbot-schafterin“ gefragt: In der LeipzigerGrundschule am Floßplatz führte sie
im Mai 2008 im Rahmen der „Kin-der-Uni“ Grundschüler an die Auf-gaben eines Museums heran.
Auf zwei Fachkonferenzen zurMuseumspädagogik und zur Ver-mittlung von DDR-Geschichte imSeptember und Oktober 2008 inBerlin und auf Veranstaltungen an-derer Institutionen konnte die Mu-seumspädagogin neue Impulse fürdie Museumspädagogik gewinnenund gleichzeitig für das Zeitge-schichtliche Forum Leipzig werben.
148
Besucherdienst und -statistik
Der Umbau der Dauerausstel-lung bei gleichzeitigem Besucher-verkehr stellte den Besucherdienstvor besondere Herausforderungen.Die Besucher wurden stets über dieaktuellen Baumaßnahmen infor-miert und reagierten positiv trotzteilweise geschlossener Ausstel-lungsbereiche. Ein Besucherrück-
gang war während der Bauphasenicht zu verzeichnen, die Besuchs-zahlen konnten im Vergleich zumVorjahr sogar gesteigert werden. Inmehreren Fortbildungen wurden dieGruppenbegleiterinnen und -beglei-ter intensiv in die neuen Ausstel-lungsbereiche eingeführt. Nach derWiedereröffnung am 9. Oktober2007 entwickelte sich die Dauer-ausstellung zu einem Besucher-
Gruppenführungs-
systeme unterstützen
die Besucherbegleiterin-
nen und -begleiter bei
ihrer Arbeit.
149
Besucherservice
Leipzig
magneten: Am Ende des Jahres2007 konnten fast 92.000 Besuchegezählt werden. 2008 wurde das er-folgreichste Jahr seit der Eröffnungdes Zeitgeschichtlichen Forums1999: Über 96.000 Besuche wurdenin der neuen Dauerausstellung ver-merkt.
Zahlreiche Wechselausstellun-gen stießen auf großes Besucher-interesse: Die Ausstellung „Flucht,Vertreibung, Integration“, die imApril 2007 endete, verzeichnete fast33.400 Besuche. „drüben. Deut-sche Blickwechsel“ war mit 32.200Besuchen bei geringer Laufzeitebenfalls erfolgreich. „Heimat undExil. Die Emigration deutscherJuden nach 1933“, eine Kooperati-onsausstellung mit dem JüdischenMuseum in Berlin, sahen in Leipzigfast 20.000 Besucher. In derWechselausstellung „Skandale inDeutschland nach 1945“ wurdenmehr als 25.000 Besuche gezählt.
Zahlreiche Fortbildungen für dieGruppenbegleiterinnen und -beglei-ter des Besucherdienstes zu denWechselausstellungen und zu Foto-grafien als historische Quelle unter-stützten die Qualifizierung. Dazugehören auch regelmäßige Evalua-tionen und Begleitertreffen.
Die Kooperation mit dem „Mu-seum in der Runden Ecke“ konntedurch zwei Führungen zur Todes-strafe in der DDR und zur Rolle derStaatssicherheit im Bezirk Leipzig inden Räumen der ehemaligen Be-
zirksverwaltung der Staatssicherheitvertieft werden.
Zur Museumsnacht am 26. April2008 und zum City-Tag der 15. Bap-tistischen Weltjugendkonferenz am2. August 2008 organisierte der Be-sucherdienst spezielle Programme.Die erfolgreiche Arbeit mit denGruppenbegleiterinnen und –beglei-tern spiegelt sich in der steigendenAnzahl von Begleitungen vor allemdurch die Dauerausstellung wider.Mit rund 1.200 Begleitungen warauch hier das Jahr 2008 das erfolg-reichste seit der Eröffnung.
Rekord: Rund 96.000
Besuche wurden 2008
in der neuen Daueraus-
stellung gezählt.
152
Gebäude, Personal, Haushalt
Haus der Geschichte Bonn
Gebäude
Die Betreuung eines technischanspruchsvoll ausgestatteten Mu-seumsgebäudes und seiner zusätz-lichen Liegenschaften erfordert einereibungslose Zusammenarbeit zwi-schen allen Mitarbeitern aus denWerkstattbereichen und der Be-triebstechnik.
Bauunterhalt
Zur dringend erforderlichen Sa-nierung des Glasdaches im Ausstel-lungsbereich wurde 2006 ein euro-paweiter Wettbewerb ausgeschrie-ben. Im Vorfeld musste hierzu eindetailliertes Anforderungsprofil er-stellt werden einschließlich der Be-urteilungskriterien zur Tragwerk-planung, der Tageslichtplanung, derBauphysik und des Brandschutzes.Auf Empfehlung des Preisgerichteswurde der Wettbewerb Ende 2006abgeschlossen. Das zuständigeBundesamt für Bauwesen undRaumordnung (BBR) fasste ineinem förmlichen Prozess schließ-lich alle Anforderungen und Er-kenntnisse sowie die Ergebnisseder aufwändigen, doch dringend er-forderlichen Prüfverfahren in einer„Haushaltsunterlage Bau“ zusam-men. Nach der haushaltsrechtlichenAnerkennung durch den Bundesmi-nister der Finanzen kann nach demjetzigen Sachstand im Jahr 2010 mitder Sanierung des Glasdachs be-gonnen werden.
Neben zahlreichen vorbeugen-den und akuten Instandhaltungs-maßnahmen führte die Stiftung inEigenregie über 100 kleinere Bau-maßnahmen durch: Die Büroräumedes Verwaltungstraktes können nundank neuer Konvektortechnik in denSommermonaten gekühlt werden.Die Abluftanlage des Museums-cafés wurde optimiert, das Sprink-lerrohrnetz nach zwölfeinhalbjäh-
Foto Seite 152:
Verwaltungsdirektor
Wilhelm Braam im
Gespräch mit Ausstel-
lungsdirektor Jürgen
Reiche und Heinz Denk,
Mitglied des Arbeitskrei-
ses gesellschaftlicher
Gruppen
Foto Seite 153:
Die Dauerausstellung
wird ständig verbessert
und aktualisiert. Bei der
Umsetzung unterstüt-
zen die Werkstätten die
wissenschaftlichen Mit-
arbeiter des Hauses
(v.l.n.r.) Werkstattleiter
Dagobert Warndorf,
Schreiner Herbert Groß,
Hanno Sowade, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter,
und Ausstellungsdirek-
tor Jürgen Reiche.
Gebäude, Personal, Haushalt
Bonn
riger Betriebszeit einer komplettenÜberprüfung unterzogen.
Gebäude- und
Gefahrenmanagement
Im Rahmen des Gebäude- undGefahrenmanagements haben dieFunktionssicherheit, die Verfügbar-keit und der wirtschaftliche Betriebder haustechnischen Anlagen sowiedie Bedarfsermittlung und Optimie-rung der Gebäudeausrüstung mitden umfangreichen überwachungs-bedürftigen Anlagen einen hohenStellenwert. Zu den wichtigsten Sa-nierungsmaßnahmen in diesem Be-reich gehörte der notwendig ge-wordene Austausch der Einbruch-meldeanlage sowie die Erneuerungder elektro-akustischen Anlage.
Energiemanagement
Zur Kontrolle u. a. der durch dieVollklimatisierung des Museumsge-bäudes erforderlichen Energiever-bräuche werden wöchentlich rundvierzig Messstellen erfasst, ausge-wertet und laufend Verbesserungs-maßnahmen durchgeführt. Dadurchkonnten die erheblichen Energie-kostensteigerungen der letztenJahre durch Optimierung derAbläufe in der Anlagesteuerungweitgehend kompensiert werden.Außerdem werden in jährlich statt-findenden Verhandlungen mit denörtlichen Energieversorgern die Lie-ferkonditionen neu vereinbart.
Betreuung von Dauerausstellung
und Veranstaltungen
Pflege und Optimierung allerAusstellungen sind weitere Schwer-punkte im Aufgabenbereich dertechnischen Dienste. Hier wurdenvorbeugende Instandhaltungen anObjekten und technischen Ausstel-lungsmitteln, wie z. B. dem Indus-trieroboter und den Mess- und Prüf-einrichtungen im Ökolabor durchge-führt. Um weitere finanzielle Mitteleinzusparen, fertigen die Werkstät-ten inzwischen qualitativ hochwer-tige Plakate, Folien, Eingangs-,Themen- und Objekttexte sowieLeihgeberlisten im Hause an.
Die Planung für die Wechselaus-stellungen beginnt in der Regel zweiJahre vor ihrer Eröffnung. Auch hierist die Mitarbeit der Betriebstechnikund der Werkstätten von großer Be-
deutung, z. B. bei der Festlegungvon organisatorischen und bauli-chen Maßnahmen zum Brand-schutz, zur Fluchtwegeregelungsowie zu Abstimmungen mit dengebäudetechnischen Versorgungs-und Alarmierungsanlagen. Bei klei-neren Ausstellungen wird der Auf-und Abbau von den Werkstätten inAbstimmung mit der Ausstellungs-gestaltung selbst realisiert. Diehauseigene Schreinerei fertigt dabeizum Teil aufwändige Konstruktionenmaßgerechter Einzelbauteile an, da-rüber hinaus auch Sonderanferti-gungen von Möbeln und Aus-stellungsmitteln. Im Rahmen dertäglichen größeren und kleinerenVeranstaltungen ist das Wissen unddie Unterstützung der Mitarbeiterin-nen und Mitarbeiter der techni-schen Dienste ebenfalls nötig.
153
154
Personal
Durch einen Beschluss des Ku-ratoriums am 5. Juni 2007 wurdeDr. Hans Walter Hütter zum Präsi-denten und Professor der Stiftungernannt. Kommissarisch nahm erdiese Aufgabe bereits seit dem1. Februar 2006 wahr.
Die Stiftung beschäftigt insge-samt 167 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter in (Plan-)Stellen: 132 inBonn, 31 im ZeitgeschichtlichenForum Leipzig sowie vier in derSammlung Industrielle GestaltungBerlin. Hinzu kommen studentischeHilfskräfte sowie Schülerpraktikan-ten und studentische Praktikanten.
Ein besonderes Anliegen derStiftung ist die Ausbildung. Nebenvier wissenschaftlichen Volontaria-ten, die permanent besetzt sind, bil-det die Stiftung kontinuierlich infolgenden Berufen aus: Fachkraftfür Bürokommunikation (Bonn),Fachangestellte/r für Medien und In-formationsdienste (Bonn und Leip-zig), Fachkraft für Schutz undSicherheit (Bonn), Energieelektroni-ker/in (Bonn), Holzmechaniker/in(Bonn) und Fachlagerist/in (Leipzig).Zusätzlich werden jährlich dreiPlätze für das freiwillige soziale Jahrin der Kultur angeboten, die in derMuseumspädagogik, der Veranstal-tungskoordination und den Werk-stätten angesiedelt sind.
Im Berichtszeitraum wurdenrund 6.000 Bewerbungen bearbei-
tet, davon etwa 1.000 Initiativbe-werbungen. Überwiegend befristeteingestellt wurden in dieser Zeit 30Personen – ohne Berücksichtigungder studentischen Hilfskräfte undPraktikanten.
International engagiert sich dieStiftung seit 1996 in einem Aus-tauschprogramm, das wissen-schaftlichen Museumsmitarbeiterndie Chance gibt, die Museumsarbeitin Frankreich oder Belgien aus eige-ner Anschauung näher kennen zulernen. Nach einem dreiwöchigenSprachkurs absolvieren die Teilneh-mer einen zweimonatigen Arbeits-aufenthalt, der abschließend inten-siv mit den Programmverantwortli-chen evaluiert wird.
Das Programm wird sowohldurch die EU als auch durch Stipen-dien des deutsch-französischen Ju-gendwerkes finanziert und von derStiftung inhaltlich und organisato-risch betreut. Hierdurch wird derwissenschaftliche Nachwuchs nichtnur fortgebildet, sondern auch derinternationale Austausch intensi-viert.
Foto Seite 154:
Zum Gedankenaus-
tausch in Bonn trafen
sich im Mai 2008 die
Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des
trinationalen wissen-
schaftlichen Austausch-
programms in Bonn.
Foto Seite 155:
Pachteinnahmen aus
Museumscafé und
-shop tragen zum
Stiftungshaushalt bei.
155
Gebäude, Personal, Haushalt
Bonn
Haushalt
Die Stiftung Haus der Geschichteder Bundesrepublik Deutschlandhat als selbstständige öffentlich-rechtliche Stiftung des Bundesihren Sitz in Bonn und unterhältStandorte in Bonn, Leipzig und Ber-lin. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben er-hält die Stiftung einen jährlichenZuschuss nach Maßgabe des jewei-ligen Bundeshaushalts.
Der Bundeszuschuss betrug fürdas Haushaltsjahr 2007 rund 19,7Millionen Euro, davon ca. 14,4 Mil-lionen Euro für den Standort Bonn,4,8 Millionen Euro für den StandortLeipzig und rund 0,5 Millionen Eurofür den Standort Berlin. Für dasHaushaltsjahr 2008 stand der Stif-tung ein Bundeszuschuss in Höhevon rund 18,8 Millionen Euro zurVerfügung, davon rund 13,7 Millio-nen Euro für den Standort Bonn, 4,6Millionen Euro für den StandortLeipzig und rund 0,5 Millionen Eurofür den Standort Berlin.
Gebäude, technische Anlagen,Ausstellungseinbauten und darinenthaltene Medienhardware derStiftung werden aufgrund der au-ßerordentlich hohen Besucherzah-len und des intensiven Veranstal-tungsbetriebs stark beanspruchtund erfordern stetig hohe Instand-setzungs- und Reparaturaufwen-dungen.
Zusätzlich fallen Aufwendungenfür die Anmietung von Liegenschaf-ten und Geräten sowie für die Be-wirtschaftung der eigenen undangemieteten Liegenschaften in be-trächtlicher Höhe an.
In den Jahren 2007 und 2008mussten allein für die Aufrechter-haltung des laufenden Betriebs, ins-besondere für Instandsetzungs- undBewirtschaftungsmaßnahmen überzwölf Millionen Euro aufgewandtwerden. Gegenüber dem vorange-gangenen Berichtszeitraum habensich die Ausgaben im Bereich derlaufenden Betriebsführung damitum rund 20 Prozent erhöht.
Das zunehmende Alter vonGebäuden und Einrichtungen sowieder damit einhergehende Ver-schleiß, steigende Energiekostenund Steuerbelastungen werdenauch in Zukunft zu deutlich steigen-den Betriebsaufwendungen führen.Dazu tragen auch die aufgrund derfortschreitenden Entwicklung tech-nischer und rechtlicher Rahmenbe-dingungen notwendigen Moderni-sierungsmaßnahmen bei.
Die bei der laufenden Betriebs-führung und im Personalbereichentstehenden Kostensteigerungengehen zu Lasten der operativenMöglichkeiten der Stiftung. Mittel,die dort zusätzlich aufgewandt wer-den müssen, stehen nicht mehr fürAusstellungen, Veranstaltungen undden Erwerb von Sammlungsgegen-ständen zur Verfügung.
Zur Realisierung ihrer Projekteversucht die Stiftung regelmäßigSponsoren und an der Projektfinan-zierung beteiligte Kooperationspart-ner zu gewinnen. Weitere Einnah-men erzielt die Stiftung durch dieVermietung von Veranstaltungsräu-men und die Vergabe von Lizenz-rechten.
Auch die Pachteinnahmen ausMuseumsshop und Museumscafésowie die Überschüsse aus demVerkauf von Publikationen tragenzur Unterstützung des Stiftungs-haushalts bei.
156
Informationstechnologie
Die IT-Systeme der StiftungHaus der Geschichte unterstützendie musealen Tätigkeiten in allenFachbereichen und schaffen dieBasis für die Optimierung von Ar-beitsabläufen und Entscheidungs-prozessen.
Nach Stabilisierungsmaßnahmenin den Jahren 2005/2006 standenfür den Berichtszeitraum Erweite-rungen der IT-Systeme sowie dieWeiterentwicklung der Programmeund Projekte im Vordergrund: Dabeibildeten die Erstellung eines IT-Rah-menkonzepts und dessen Fort-schreibung, die Einführung einesneuen Haushaltsmanagementsys-tems zur Bearbeitung zentralerVerwaltungsprozesse wie das Be-
stell-, Rechnungs- und Kassenwe-sen sowie die Installation einesneuen E-Mail-Systems zur Unter-stützung der internen und externenKommunikation Schwerpunkte. DieWeiterentwicklung des Content-Management-Systems, die Vernet-zung mit der Liegenschaft in Berlin,der Ausbau der Servertechnologienund des Integrierten ManagementSystems (IMS) standen ebenfallsauf dem Programm. Kontinuierlichwaren Ersatzbeschaffungen vorzu-nehmen, die technischen Entwick-lungen im Hard- und Software-bereich erforderten entsprechendeAusstattungen an den Arbeitsplät-zen wie auch im Serverbereich.
Die Planungen und Maßnahmenzielten weiterhin darauf, Anwen-dungen wie Datenbanken zu zentra-
Foto links:
Bei der Kontrolle im
Serverraum: der Leiter
der IT-Koordination
Thomas Schneemelcher
Foto rechts:
Arnd Eßer kümmert sich
um das Internet.
157
Gebäude, Personal, Haushalt
Bonn
lisieren und Hardware zu standardi-sieren. Neue Entwicklungen wie diezukunftsträchtige Technologie derServervirtualisierung weisen einenWeg, den bislang hohen Adminis-trationsaufwand bei Servern zu min-dern, die Datensicherung zuerleichtern und Hardware-Kosten zusenken.
Die intensiv betriebene Integra-tion der Adress- und Bilddatenbankin das IMS stellt nun zentral denNutzern je nach Anforderungsprofil– Presse, Internet, Fotografen, Do-kumentation u.a. – einen Bild- undInformationspool in unterschiedli-chen Datenformaten zur Verfügung.
In der Verwaltung wurde ein äl-teres Haushaltsüberwachungs-Sys-tem von einem auf den ÖffentlichenDienst ausgerichteten komplexenHaushaltsprogramm abgelöst.
Auch der Schutz der Datenvor Computerviren hat weiterhinhöchste Priorität. Permanent sinddie Virenschutzprogramme zu ak-tualisieren oder durch effektivereProgramme abzulösen. Die Abwehrder enorm gestiegenen Viren-attacken und der unbefugten exter-nen Zugriffsversuche erforderneinen erheblichen Arbeits- und Zeit-aufwand. Mit ständig aktualisierterFiltersoftware wird der Kampfgegen die Überflutung des Mail-Ser-vers durch Spams geführt. Daskomplexe Antiviren-Serversystemund mehrere Firewalls, die alle Zu-griffe auf die Server kontrollieren
und bewerten, werden weiterhinständig auf dem neuesten techni-schen Stand gehalten. Im Zugedieser Maßnahmen wurde auch dasE-Mail-System ersetzt: In einem län-gerfristigen Projekt wurden dieMicrosoft Anwendungs-SystemeOutlook/Exchange installiert, mitdem der E-Mail-Verkehr im Hausverwaltet und gefiltert, Zeitpläneerstellt und Termine koordiniertwerden.
Programme wie das Bibliotheks-verwaltungssystem oder Anwen-dungen für den Besucherservice
IT-Koordinator Klaus
Tiefensee prüft die
Statusmeldung der
Serveranzeige.
158
wurden weiterentwickelt. Sie sindein unverzichtbares Arbeitsmittel inden Ablaufprozessen des Muse-ums. Im Streben nach partieller Un-abhängigkeit vom Softwaremarktentwickelte der IT-Bereich weiterhinProgramme, die die Fachbereicheunterstützen.
Das IT-Rahmenkonzept, das imBerichtszeitraum in Zusammenar-beit mit einer Beratungsfirma er-stellt und von der IT-Koordinationfortgeschrieben wurde, enthält diezusammenfassende Darstellung derin der Stiftung derzeit eingesetztenInformationstechnik und der für dieFolgejahre geplanten IT-Vorhaben.Das Dokument soll als wesentlichePlanungs- und Entscheidungsgrund-lage für die kurz- und mittelfristig imIT-Bereich umzusetzenden Maß-nahmen dienen.
Nur eine schnelle und leistungs-starke Netzstruktur ermöglicht eineproblemlose Datenkommunikation,die bei komplexer Vernetzung meh-rerer Arbeits- und Ausstellungs-standorte unverzichtbar ist. WeitereLiegenschaften wurden in das IT-Gesamtsystem integriert: Nebender Erweiterung des Netzes in derKarikaturengalerie war es vor allemdie Liegenschaft in Berlin.
Der vollständige Zugriff auf dieDatenbestände ist für die Arbeitsfä-higkeit der Stiftung zwingend erfor-derlich. Deshalb wurden dieSicherungsverfahren ausgebaut,hochwertige Sicherungs-Software
Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der
IT-Koordination sorgen
für eine problemfreie
Datenkommunikation
(oben Thomas Schnee-
melcher, unten
Friederike Kürschner).
159
Gebäude, Personal, Haushalt
Bonn
implementiert und die Backup-Ser-ver-Systeme für die zentrale Daten-sicherung erweitert.
Ausgewählte Datenbestände giltes aber auch für zukünftige Genera-tionen zu sichern und zu archivieren.Die IT-Koordination hat erste Pro-jekte der Langzeitarchivierung in An-griff genommen.
Internet
Das neue Content-Management-System zur Erstellung von Websei-ten hat sich bewährt und bietet dieBasis für die Weiterentwicklung desgeplanten Internetauftritts. Grundle-gend für die Überarbeitung sind dieBeschlüsse des Kuratoriums überdie Struktur der Stiftung mit denStandorten in Bonn, Leipzig undBerlin. Daraus ergeben sich Konse-quenzen für die Internetseiten, dieentsprechend angepasst werden
Beim Wettbewerb
„Corporate Media
2008“ erhielt das Haus
der Geschichte zwei
Auszeichnungen für
die Internetausstellung
„Beobachtungen – Der
Parlamentarische Rat
1948/49. Fotografien
von Erna Wagner-
Hehmke“ (v.l.n.r.):
Rolf G. Lehmann,
Corporate Media,
Projektleiter Dietmar
Preißler, Manfred Ernst,
Bundesverband
deutscher Film- und
AV-Produzenten,
sowie Wiebke Siever,
Projektmitarbeiterin.
müssen. TechnischeWeiterentwick-lungen des Internets und die stän-dige Zunahme vielfältiger medialerAngebote für die Nutzer sind wei-tere Gründe für eine umfassendeNeugestaltung.
In die Überarbeitung fließen auchdie Ergebnisse der monatlichenAuswertungen der Seiten-Zugriffeein. Damit können Schwerpunktset-zungen im Angebot fundiert bewer-tet und entsprechend geändertwerden. Zudem findet eine perma-nente Erfolgskontrolle statt.
Im Berichtszeitraum wurde nacheinem umfassenden Ausschrei-bungsverfahren eine externe Agen-tur beauftragt, erste Vorschläge füreine Neugestaltung zu unterbreiten.Diese Überlegungen wurden inten-siv im Haus diskutiert. Die Vorberei-tungen für den neuen Internet-Auftritt stehen unmittelbar vor demAbschluss.
160
Gebäude Zeitgeschichtliches
Forum Leipzig
Die technischen Dienste schaf-fen die Voraussetzungen für dieRealisierung der verschiedenenAusstellungen, die zahlreichen Ver-anstaltungen und den störungs-freien Museumsbetrieb. Sie sindebenfalls für die wirtschaftliche Füh-rung der Ausstellungs- und Arbeits-räume im Zentral-Messepalastsowie der Außendepots zuständig.Bedingt durch den kontinuierlichenAusbau der Sammlung und dieAnforderungen an die fachgerechteLagerung und Präsentation der Ex-ponate waren weitere Investitionenerforderlich: Beispiel ist eine Um-
luftanlage, die zur Verbesserung derkonservatorischen Bedingungen indie Wechselausstellungshalle ein-gebaut wurde.
Im Depot Rackwitzer Straßewurde nach einer eingehenden Be-standsaufnahme die vorhandeneLagerfläche so umgestaltet, dassdort Kapazität für mehr Exponatebereitsteht. Damit wird eine kos-tenintensive Zumietung weitererLagerflächen vermieden.
In den Haushaltsjahren 2007 und2008 wandte die Stiftung insgesamtjeweils rund 1,5 Mio. Euro Mietkos-ten für den Zentral-Messepalastsowie das Außendepot auf. Die ge-nutzte Mietfläche betrug insgesamt7.350 qm.
Das Zeitgeschichtliche
Forum Leipzig der
Stiftung in der
Grimmaischen Straße
161
Gebäude, Personal, Haushalt
Leipzig
Berlin
Gebäude Sammlung Industrielle
Gestaltung Berlin
Die geplante Ausstellung zurProdukt- und Alltagskultur der DDRsoll in den Ausstellungsräumen inder KulturBrauerei ihren Platz fin-den. Die Sammlung ist seit 1993 indiesem historischen Gebäudekom-plex beheimatet. 2005 wurde dieSammlung Industrielle Gestaltungder Stiftung Haus der Geschichteder Bundesrepublik Deutschlandübertragen. Auf dem Areal amPrenzlauer Berg präsentieren sichauch vielfältige kulturelle Dienstleis-ter, darunter ein Kino und mehrereTheater, Klubs, eine Literaturwerk-statt und mehrere Verlage.
Der künftigen Dauerausstellungin der KulturBrauerei kommt nachder Gedenkstättenkonzeption derBundesregierung 2008 die Aufgabezu, „zur kritischen Auseinanderset-zung mit dem gegenständlichenErbe der DDR anzuregen.“ Für Aus-stellungen, Besucherbetreuung undVeranstaltungen stehen im Nordflü-gel der KulturBrauerei Räume zurVerfügung, die ursprünglich von derSchultheiß-Brauerei genutzt wur-den. Das Unternehmen wurde be-reits Mitte des 19. Jahrhundertsgegründet und entwickelte sichrasch zur zeitweise größten BerlinerBrauerei. Nach Einstellung desBrauereibetriebs in der DDR verfie-len viele Gebäude. Diese histori-schen Räume sind nun in
Kooperation mit der Eigentümerin,der Berliner ImmobiliengesellschaftTLG, und dem Hauptnutzer, demBerliner Senat, baulich so herzurich-ten, dass sie in Zukunft für Ausstel-lungsbesucher zugänglich sind.
Foto oben:
Diskussion um den
weiteren Aufbau der
Dauerausstellung in den
Räumen der Sammlung
Industrielle Gestaltung
Foto unten:
Sammlungsmitarbeiterin
Anja Schubert bei der
Inventarisierung von
Objekten
164
Veranstaltungen im Haus der Geschichte Bonn (Auswahl)
2007
Januar17. Januar„Leben nach dem Prinzip links.Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten“,Buchvorstellung mit Hermann Weber
21. JanuarSchachsonntag mit Boris Spasski
22. Januar„Das deutsch-französische Geschichts-buch – ein Novum in der Geschichtsver-mittlung in Deutschland und Frankreich“,Podiumsdiskussion zum „Deutsch-Fran-zösischen Tag“
Februar11. FebruarFamiliensonntag zur Wechselausstellung„drüben. Deutsche Blickwechsel“
22. Februar„1949/1955 – Thomas Mann in Frank-furt, Stuttgart und Weimar: Kampf umdas kulturelle Erbe“, Vortragsreihe zurAusstellung „drüben. Deutsche Blickwin-kel“ in Zusammenarbeit mit dem Institutfür Zeitgeschichte, München
27. Februar„Die Grünen und die DDR – Die Doppel-strategien zweier ungleicher Partner“,Vortragsreihe zur Ausstellung „drüben.Deutsche Blickwechsel“ in Zusammen-arbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte,München
März1. März„1969 – Der Rücktritt von Bundes-präsident Lübke: Zweierlei Vergangen-heitsbewältigung im Systemkonflikt“,Vortragsreihe zur Ausstellung „drüben.Deutsche Blickwechsel“ in Zusammen-arbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte,München
8. März„1973 – Doppelter UN-Beitritt:Deutsch-deutsche Konkurrenz auf derinternationalen Bühne“, Vortragsreihezur Ausstellung „drüben. DeutscheBlickwechsel“ in Zusammenarbeit mitdem Institut für Zeitgeschichte, München
13. MärzEröffnung der Wechselausstellung„Die Kunst des SPIEGEL.Titel-Illustrationen aus fünf Jahrzehnten“mit dem stellv. SPIEGEL-ChefredakteurMartin Doerry
13. März„Störfall Honecker aus ‚Zeitgeschichtenaus dem Leben eines Taugenichts’“,Vortragsreihe zur Ausstellung „drüben.Deutsche Blickwechsel“ in Zusammen-arbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte,München
15. März„1974 – das Sparwasser-Tor: Die gesell-schaftliche und politische Bedeutung desSports für beide deutschen Staaten“,Vortragsreihe zur Ausstellung „drüben.Deutsche Blickwechsel“ in Zusammen-arbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte,München
22. März„1987 – Honecker in Bonn: Deutsch-deutsche Spitzentreffen 1947-1990“,Vortragsreihe zur Ausstellung „drüben.Deutsche Blickwechsel“ in Zusammen-arbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte,München
25. März„Europa wird 50!“:Familiensonntag zum Europa-Tag
27. MärzEröffnung der Karikaturengalerie
April23. April„Freundschaften“, Buchvorstellung undLesung mit Marie-Luise Marjan
Mai2. Mai„Schönheit – Exzess“, Kammerkonzertdes Beethoven Orchesters Bonnim Palais Schaumburg
8. MaiEröffnung der Wechselausstellung„Wilde Zeiten. Fotografien von GünterZint“ in der U-Bahn-Galerie mit GünterZint und Günter Wallraff
10. MaiBuchvorstellung Kai-Uwe von Hassel
20. MaiInternationaler Museumstag unter demMotto „Museen und universelles Erbe“
24. MaiEröffnung der Wechselausstellung„Heimat und Exil. Emigration derdeutschen Juden nach 1933“
25. MaiEröffnung der Ausstellung„Rückblende 2006 –Politische Fotografien und Karikaturen“
30. Mai„Luftschlösser“, Kammerkonzert imPalais Schaumburg mit demZürcher Bläserquintett
165
Anhang
Juni7./10. JuniMuseumsmeilenfest 2007
19. JuniPräsentation des WM-Zettelsmit Jens Lehmann
19. Juni„Die Kissinger-Saga: Henry und Walter –zwei Brüder aus Fürth“, Filmvorführungund Zeitzeugengespräch in Zusammen-arbeit mit der Deutschen AtlantischenGesellschaft
23. Juni„Das Ausmaß einer fehlgeschlagenen In-tegration – Phänomen Zwangsehe“, Ver-anstaltung des DeutschenJuristinnenbundes
27. Juni„Entwicklung der Föderalismusreform“,Diskussion mit Peter Struck
Juli14. JuliJugendparlament im Bundesrat
August19. AugustTag der offenen Türim ehemaligen Regierungsviertel
23. August„Bonn-Palästina-England: Eine Zeitzeuginerinnert sich“, Zeitzeugengespräch imBegleitprogramm zur Wechselausstel-lung „Heimat und Exil. Emigration derdeutschen Juden nach 1933“
September4. SeptemberAmtseinführung des neuen PräsidentenProf. Dr. Hans Walter Hütter
5. September„Kultur im Gespräch“ mit WDR Inten-dantin Monika Piel
8. September30 Jahre Verein für Gefährdetenhilfe,Festveranstaltung
12. September„Kindertransport – in eine fremde Welt“,Filmreihe zur Wechselausstellung„Heimat und Exil. Emigration derdeutschen Juden nach 1933“
14. SeptemberMitglieder des Präsidiums des Europäi-schen Parlaments besuchen die Dauer-ausstellung
14. September„Jazzin’ History“, Vortrag und Konzertin Zusammenarbeit mit jazzin’ Bonn
19. September„30 Jahre danach: Der Deutsche Herbstaus Sicht eines Staatsanwalts“, Vortragvon Klaus Pflieger
19. September„Die Ritchie Boys“, Filmreihe zur Wech-selausstellung „Heimat und Exil. Emigra-tion der deutschen Juden nach 1933“
21. SeptemberÜbergabe der Handball-WM-Exponateund Gespräch mit Heiner Brand, MichaelVesper und Sport-Marketing-Experten
25. September„Der Regierungsbunker“,Buchvorstellung
26. September„Zuflucht in Shanghai“, Filmreihe zurWechselausstellung „Heimat und Exil.Emigration der deutschen Juden nach1933“
Oktober15. Oktober„Der Baader-Meinhof-Komplex“,Gesprächsabend mit Stefan Austund Hans Walter Hütter
23. Oktober„Dreißig Jahre Deutscher Herbst“,Diskussionsveranstaltung mit ClaisBaron von Mirbach, Wolfgang Kraushaar,Joachim Scholtyseck und Moritz MüllerWirth (Die ZEIT)
30. Oktober„Literatur Europa: Haus der Sprache undLiteratur“, Lesung mit Péter Esterházyaus Budapest
November15. NovemberEröffnung der Wechselausstellung„Das Boot – Geschichte. Mythos. Film.“
22. November„Vielfalt ist Zukunft – Vielfalt erlesenund erleben“, 6. Bonner BuchmesseMigration, Veranstaltung des BonnerInstituts für Migrationsforschung undInterkulturelles Lernen
28. November„Sollen Jugendliche ab 16 Jahren beiallgemeinen Wahlen wählen dürfen?“,Bundessieger des Bundeswettbewerbs„Jugend debattiert“ diskutieren imPlenarsaal Bundesrat Bonn
30. November/1. Dezember1. Bonner Stiftungstag
Dezember7. Dezember19. MeisterwettbewerbCorporate Media 2007
11. DezemberEröffnung der Wechselausstellung„Skandale in Deutschland nach 1945“
166
Veranstaltungen im Haus der Geschichte Bonn (Auswahl)
2008
Januar21. Januar„Humanitäre Hilfe aus deutscher undfranzösischer Sicht“, Diskussion zumDeutsch-Französischen Tag
24. Januar„Persönlich habe ich mir nichts vorzu-werfen“, Buchvorstellung und anschlie-ßende Podiumsdiskussion mit AutorMichael Philipp im Begleitprogrammzur Wechselausstellung „Skandale inDeutschland nach 1945“
25. Januar„Mit Zorn und Zärtlichkeit an der Seiteder Armen“, EntwicklungspolitischerFachkongress anlässlich des 50-jährigenBestehens von MISEREOR
27. JanuarFamilien-Sonntag zur Wechselausstel-lung „Skandale in Deutschland nach1945“
Februar22. bis 24. FebruarXXI. Königswinterer Tagung der For-schungsgemeinschaft 20. Juli 1944gemeinsam mit der Stiftung„20. Juli 1944, Berlin“
28. Februar„Verbrecher und andere Deutsche“,Willy Brandts Bericht über die Nürnber-ger Prozesse, Buchpräsentation derBundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung,u.a. mit Dieter Dowe, Brigitte Seebacher
29. Februar„Integration – Schlüsselaufgabe fürdie christlichen Demokraten“, Forumund Podiumsdiskussion der Konrad-Adenauer-Stiftung, u.a. mit Staats-ministerin Maria Böhmer
März4. März„Die Mittagsfrau“, Lesung mit AutorinJulia Franck, in Zusammenarbeit mitdem „Haus der Sprache und Literatur,Bonn“
11. MärzEröffnung der Ausstellung„Rückblende 2007“
April22. April„In der Schaltzentrale der Macht“, Zeit-zeugengespräch im Palais Schaumburg
Mai8. MaiEröffnung der Wechselausstellung„Melodien für Millionen.Das Jahrhundert des Schlagers“,u. a. mit Götz Alsmann
16. MaiQuizshow „Klima – Umwelt – Wissen“,Veranstaltung im Rahmen der Aktions-tage Politische Bildung 2008
18. MaiInternationaler Museumstag
22. bis 25. MaiMuseumsmeilenfest 2008
29. MaiVortrag von Hans-Gert Pöttering MdEP,Präsident des Europäischen Parlaments,Veranstaltung der Europa Union
Juni3. Juni„Kanzler und Minister 1998-2005“Buchpräsentation mit Norbert Blüm,Veranstaltung in Kooperation mit demVS Verlag für Sozialwissenschaften,Wiesbaden
12. JuniEröffnung der Wechselausstellung„Auf die Bilder kommt es an! Wahl-kampf und politischer Alltag in Deutsch-land nach 1945“ in der U-Bahn-Galeriemit Coordt von Mannstein
24. Juni„Kopfball, Einwurf, Nachspielzeit“,Buchpräsentation mit den HerausgebernUwe Baumann und Dittmar Dahlmannsowie Jens Nowotny und Dietmar Schott
August30. AugustWDR 4-Schlagerbar im Haus derGeschichte mit Roberto Blanco, Begleit-programm zur Wechselausstellung„Melodien für Millionen.Das Jahrhundert des Schlagers“
September1. SeptemberDer Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Jürgen Rüttgers, eröffnetdie Ausstellung „Beobachtungen –Der parlamentarische Rat 1948/49.Fotografien von Erna Wagner-Hehmke“
3. September„Helden: verehrt – verkannt – vergessen:Geschichtswettbewerb des Bundesprä-sidenten 2008“, Auftaktveranstaltungmit Joachim Gauck
8. September„Solidaritätslied. Hanns Eisler – eineGeschichte“, Filmvorführung im Rahmendes Beethovenfestes 2008 in Koopera-tion mit der Bundeszentrale für politischeBildung
9. September1968 – Rückblicke: „Prager Frühling `68“mit Pavel Kohout
167
Anhang
15. September„Taking Sides – Der Fall Furtwängler“,Filmvorführung im Rahmen des Beetho-venfestes 2008 in Kooperation mit derBundeszentrale für politische Bildung
16. September1968 – Rückblicke: „‘68 in globalerPerspektive“ – Experten im Gespräch:Ingrid Gilcher-Holtey, Gerd Langguthund Joachim Scholtyseck
17. September„Musik ist nicht mehr eine Sache derWenigen“, Symposion im Rahmen desBeethovenfestes 2008 in Kooperationmit der Bundeszentrale für politischeBildung
18. September„Das Reichsorchester“, Filmvorführungim Rahmen des Beethovenfestes 2008in Kooperation mit der Bundeszentralefür politische Bildung
27. SeptemberLange Nacht der Museumsmeile mit„Klaus Doldinger’s Passport“
30. September1968 – Rückblicke: „Die Rezeption von´68: eine Festkultur?“ mit PrivatdozentPhilipp Gassert und Gerd Appenzeller
Oktober3. OktoberFestakt zum Tag der Deutschen Einheitund zum 20-jährigen Bestehen der Städ-tepartnerschaft Bonn-Potsdam durchden Potsdam Club
5. Oktober„La Paloma. Das Lied. Sehnsucht.Weltweit“, Filmvorführung im Begleit-programm zu „Melodien für Millionen –Das Jahrhundert des Schlagers“
22. Oktober„Die Reise nach Jerusalem“,Kabarett mit Matthias Deutschmann
22. und 23. Oktober„Die ‚alte’ Bundesrepublik in neuenPerspektiven“, Tagung junger Zeithistori-ker im Palais Schaumburg, Veranstaltungmit der Johannes-Gutenberg-UniversitätMainz
November9. NovemberPremiere des Films„König der Spione – John le Carré“
11. November„Bundesrat –die andere Gewaltenteilung“,Gesprächsrunde mit Bernhard Vogelund Henning Voscherau
12. November„Der Baader Meinhof Komplex“,Gesprächsabend mit Stefan Austüber Buch und Film
19. November„Die Beziehungen zwischen Deutsch-land und Israel“, Vortrag des Botschaf-ters des Staates Israel in Deutschland,S.E. Yoram Ben-Zeev, anschließendEröffnung der Filmretrospektive„Im Aufbau. Israelisches Kino“ mitzehn israelischen Filmproduktionenvon 1950-1970
20. NovemberEröffnung der 5. Bonner Wocheder Kulturen
Dezember4. DezemberEröffnung der Wechselausstellung„Flagge zeigen? Die Deutschen und ihreNationalsymbole“ mit BundespräsidentHorst Köhler
11. DezemberEröffnung der Wechselausstellung„man spricht Deutsch“ mit Axel Hacke
Veranstaltungen Bonnständige Kooperationspartner:Beethoven Orchester BonnBundeszentrale für politische BildungDeutsche Atlantische Gesellschaft
Deutsche Gesellschaftfür Auswärtige Politik
Europa UnionFriedrich-Ebert-StiftungGeneral-Anzeiger BonnHaus der Sprache und LiteraturKonrad-Adenauer-StiftungMontag-ClubUniversität Bonn
Verband Entwicklungspolitik DeutscherNichtregierungsorganisationen (VENRO)
Volkshochschule BonnWestdeutscher Rundfunk
168
Veranstaltungen im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig (Auswahl)
2007
Januar10. Januar„Journalistisches Handeln unter ethischenMaximen“, öffentliche Vorlesungsreihedes Lehrstuhls für Journalistik der Uni-versität Leipzig mit Michael Ebert (Neon)
11. Januar„Der Präsident im Exil“, Filmvorführungund Publikumsgespräch
24. Januar„Journalistisches Handeln unter ethischenMaximen“, öffentliche Vorlesungsreihedes Lehrstuhls für Journalistik der Uni-versität Leipzig mit Kuno Haberbusch(NDR)
25. Januar„Wir sind keine Menschen mehr“,Szenische Lesung
28. Januar„Alles auf Anfang. Von der Sehnsuchtsich neu zu er-finden …“, MDR Radio-Café mit Johannes Czwalina, HolmFriebe, Anna Maria Scholz
Februar1. Februar„Das feldgraue Erbe. Die Wehrmachtein-flüsse im Militär der SBZ/DDR“, Buch-präsentation und Podiumsdiskussion
8. Februar„Schlesiens Wilder Westen“, Filmvor-führung und Publikumsgespräch
15. Februar„BergersDorf“, Lesung mit der AutorinHerma Kennel
20. Februar„Krev Zmizelého“, Filmvorführung
März1. März„Das ewige Tabu? – SexualisierteGewalt als Kriegserfahrung von Frauendamals und heute“, Podiumsdiskussionmit K. Erik Franzen, Monika Hauser,Rainer Kaps
8. März„Geschichte verstehen – Zukunft gestal-ten“, Deutsch-polnisches Symposium
13. März„Vertreibungsdiskurs und europäischeErinnerungskultur. Deutsch-polnischeInitiativen zur Institutionalisierung“,Buchvorstellung und Podiumsdiskussionmit Claudia Kraft, Michal Maliszewski,Stefan Troebst
21. MärzPolitik und Zeitgeschichte im Gespräch:„Flucht und Vertreibung“, Podiumsdis-kussion mit Micha Brumlik, ManfredKittel, Erika Steinbach, Thomas Urban
24. März12. Leipziger Europaforum: „Flucht undVertreibung europäisch erinnern? Das‚deutlich sichtbare Zeichen’ gegen Ver-treibung in der Diskussion“, Podiumsdis-kussion mit Helga Hirsch, Matej Spurný,Robert Traba, Stefan Troebst
April17. April„Esmas Geheimnis“, Filmvorführung
19. April„Auf dem Weg nach Kopenhagen? Min-derheiten in Südosteuropa im Beitritts-prozess der EU“, Podiumsdiskussion mitKlaus Bochmann, Ewa Chilinsky, JessicaHeun, Johannes Ries
21. AprilNachtschicht – 8. Leipziger Museums-nacht: „Augen auf und durchgeblickt!“
Mai15. Mai„Architektur auf Zeit. Baracken, Pavil-lons, Container“, Buchvorstellung undPodiumsdiskussion
19. Mai„Markus Wolf – ‚Kundschafter des Frie-dens’ oder Täter?“, Vortrag und Diskus-sion
23. Mai„Leipzig – Sex and the City. Das Nacht-leben der DDR-Messestadt“, Filmvor-aufführung und Gespräch
Juni5. Juni„Die Krise der Demokratie“, Buchvor-stellung und Podiumsdiskussion mitWerner Bramke, Friedrich Schorlemmer,Werner Schulz
12. Juni„Das Sichere war nicht sicher. Die erwar-tete Wiedervereinigung“, Buchvorstel-lung und Publikumsgespräch
169
Anhang
13. Juni„Ohne Tradition? Ohne Zukunft? Die Ar-beiterbewegung in Ostdeutschland“,Buchvorstellung und Podiumsdiskussion
19. Juni„Bosnien und Herzegowina unddie EU – Annäherung mit Hindernissen“,Podiumsdiskussion mit Joachim Bleicker,Katrin Hett, Christina Catherine Krause,Mitar Kujundži
21. Juni„Von der Atlantischen Gemeinschaftzum Transatlantischen Raum?“, Podi-umsdiskussion mit Beverly Crawford,Milos Calda, Frank Trommler
27. Juni„Der andere Blick. Korrespondenten-arbeit im geteilten Deutschland“,Podiumsdiskussion mit Ralf Bachmann,Peter Pragal, Peter Wensierski,Peter Jochen Winters
Juli3., 5. und 10. JuliFilmwerkstatt mit dem Film „Lilly unterden Linden“
5. Juli„1954 – Kirchentag in Leipzig: Kontakteund wechselseitige Wahrnehmungender evangelischen Kirchen“, Vortrag
21. Juli„Amerikabilder im Wandel“, Podiumsdis-kussion mit Rik DeLisle, Thomas Nehls
August9. August„Der geteilte Himmel“, Filmvorführung
September2. September„Ein Objekt und seine Geschichte“, Vor-trag von Ruairí O’Brien
13. September„1989 – Die Mauer fällt: das Ende desdoppelten Deutschlands“, Vortrag undPublikumsgespräch
27. September„Rückwärts immer“, Lesung mitChristoph Dieckmann
Oktober10. Oktober„Die eigene Geschichte! Lebensberichteaus der DDR“, Podiumsgespräch undPräsentation mit Laurence McFalls,Bernd Lindner, Zeitzeugen
16. Oktober„Farbenspiele. Die Ukraine nach derRevolution in Orange“, Buchpräsentationund Podiumsgespräch mit WolfgangTemplin
18. Oktober„An die Grenze“, Filmvoraufführung undPublikumsgespräch
24. Oktober„Euthanasieverbrechen im Dritten Reich.Verantwortung und Rezeption inDeutschland“, Fachtagung
28. Oktober„Verostet der Westen?Deutsche Lebensgefühle im 18. Jahr“,MDR Radio-Café
November1. November„Identitäten eines Festivals. Symposionzum 50. Jubiläum des LeipzigerFestivals“, in Kooperation mit denLeipziger DOK-Filmwochen
8. NovemberPolitik und Zeitgeschichte im Gespräch,13. Leipziger Europaforum: „Gemein-same Ziele, getrennte Wege? EuropasKurs in die Zukunft“, Podiumsdiskussionmit Karl Lamers, Petra Pinzler, RainderSteenblock, Janusz Tycner
15. und 16. November„Hungersnot in der Ukraine“,Fachtagung
18. November„Einmal Hans mit scharfer Soße …Hatice Akyün über das Leben in zweiWelten“, MDR Radio-Café mit HaticeAkyün
22. November„Freiheit als Denkmal? – Einheit alsMonument?“, Podiumsdiskussion mitRainer Eckert, Burkhard Jung , GünterNooke
Dezember5. Dezember„Westbesuch. Die geheime DDR-Reisevon Helmut Kohl“, Buchpräsentation mitJan Schönfelder und Rainer Erices
10. Dezember„Der Konflikt in Darfur – Hintergründe,Menschenrechtssituation, Auswirkun-gen“, Podiumsdiskussion mit GarangAkok, Melha Rout Biel, Alfred Buss
16. Dezember„Wissen, was gut ist. Über Konsum undQualität“, MDR Radio-Café
170
Veranstaltungen im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig (Auswahl)
2008
Januar9. Januar„Journalismus zwischen Print und Web2.0. Bildblog und Mediawatch: WennMedien am Pranger stehen!“, Öffentli-che Vorlesungsreihe des Lehrstuhls fürJournalistik der Universität Leipzig, mitStefan Niggemeier
10. Januar„Die Universitätskirche St. Pauli –Gotteshaus und Politikum. Ort des Be-kennens“, Diskussionsforum mit FranzHäuser, Christoph Michael Haufe, TobiasHollitzer, Bernd-Lutz Lange, Rüdiger Lux,Wolfgang Schmidt, Rainer Eckert, UlrichStötzner, Christian Wolff
30. Januar„Wandel durch Annäherung – ein erfolg-versprechendes Politikkonzept?“, Podi-umsdiskussion mit Egon Bahr, RebeccaHarms, Adam Krzeminski, Friedhelm Ost
Februar12. Februar„Die Welt war so heil. Die Familie derElse Ury – Chronik eines jüdischenSchicksals“, Lesung mit AngelikaGrunenberg
20. Februar„Ein Artikel zuviel. Anna Politkowskajaund das System Putin“, Filmvorauffüh-rung und Gespräch
29. Februar bis 2. März„Frieden mit dem Unfrieden? Wissens-bestände im Wandel“, Kongress derArbeitsgemeinschaft für Friedens- undKonfliktforschung e.V.
März4. März„Heute Abend: Lola Blau“, Musical vonGeorg Kreisler, mit Katrin Troendle,Helge Nitzschke
7. März„Zurück in die Zukunft – Russland nachder Ära Putin?“, Podiumsdiskussion mitArnold Vaatz, Lev Gudkov, Michail Ryklin,Angelika Nußberger
10. März„Insel der Schwäne“, Filmvorführung
15. März14. Leipziger Europaforum: „Russlandund die EU: Bewährungsprobe einereuropäischen Außenpolitik?“,Podiumsdiskussion mit Gerd Koenen,Oleg Krasnitzkij, Gabriele Krone-Schmalz,Eckart Stratenschulte
27. März„Gelobtes Neuseeland“, Lesung mitFreya Klier
April2. April„Zwölf heißt: Ich liebe dich“,Filmvoraufführung
3. April„Für Gott, Zar und Vaterland“,Filmvoraufführung und Gespräch
12. April„Gesicht zur Wand – 15 Jahre politischeHaft in der SBZ und DDR“, Filmvorfüh-rung und Gespräch mit Melanie Kol-latzsch, Christiane Gumpert, ReinhardDobrinski, Sascha Möbius
15. April„Reporter des Alltags. Leipzig in denFotografien von Karl Heinz Mai 1945 bis1964“, Buchvorstellung und Gesprächmit Andreas Mai, Karl-Detlef Mai,Thomas Nabert
17. April„Schwarze Pyramiden, rote Sklaven“,Buchvorstellung und Podiumsdiskussionmit Wladislaw Hedeler, Horst Hennig,Gerald Diesener
22. April„Barbarossa“, Live-Screening des MDR-Geschichtsmagazins und Gespräch
26. April9. Leipziger Museumsnacht: „Privat“
29. April„Die Toten der Paulinerkirche.Spurensuche vierzig Jahre danach“,Filmvoraufführung und Gespräch
Mai19. Mai„Das Kaninchen bin ich“, Filmvorführung
21. Mai„Antisemitismus und Antizionismus inder DDR: Die unbekannte Seite des in-strumentalisierten Antifaschismus?“,Podiumsdiskussion mit Wolfgang Benz,Anette Leo, Kurt Pätzold, Konrad Weiß
28. MaiStreitfragen Ost-West: „Der politischeSkandal und die Rolle der Medien“,Podiumsdiskussion mit Michael Haller,Michael Seufert, Heide Simonis,Günter Wallraff
Juni2. Juni„Kunst am Bau als Erbe des geteiltenDeutschlands. Zum Umgang mit archi-tekturbezogener Kunst der DDR“,Vortrag und Podiumsdiskussion mitThomas Topfstedt, Silke Wagler, BerndSikora, Sigrid Hofer, Rainer Eckert
9. Juni„Wenn du groß bist, lieber Adam“,Filmvorführung
171
Anhang
26. Juni„Schicksalstage: Sebnitz – Die perfekteStory“, Filmvorführung
Juli9. Juli„Uni + Kirche = Aula? Was war? Wasist? Was soll sein? Ein Informations-abend“, Informationsveranstaltung mitFranz Häuser, Hans-Albrecht Koch,Martin Petzoldt
14. Juli„Auf der Sonnenseite“, Filmvorführung
24. Juli„Der Sohn des Staatsfeindes.Die gestohlene Kindheit des ChristianDertinger“, Filmvorführung
August11. August„Heißer Sommer“, Filmvorführung
September1. SeptemberGeschichtswettbewerb des Bundes-präsidenten, Auftaktveranstaltung
18. September„Persönlich habe ich mir nichts vorzu-werfen. Politische Rücktritte in Deutsch-land von 1950 bis heute“,Podiumsgespräch mit Michael Philipp,Ansgar Zerfaß
24. September„Frieden schaffen ohne Waffen? DieFriedensbewegungen in Ost und West“,Podiumsdiskussion mit Lukas Beck-mann, Rainer Eppelmann, FriedrichSchorlemmer, Willy Wimmer
25. September„Der Tag, der Deutschland veränderte –9. Oktober 1989“, Lesung und Gesprächmit Martin Jankowski, Ingo Schulze,Christian Führer, Rainer Eckert
Oktober8. und 9. OktoberSymposion: „Diktaturen erinnern. DieAuseinandersetzung mit den europäi-schen Diktaturen im 20. Jahrhundert“,mit Helmut Altrichter, Jörg Baberowski,Bernd Faulenbach, Günther Heydemann,Piotr Madajczyk, Horst Möller, Jiri Per-nes, Wolfgang Schieder, AndreasSchmidt-Schweizer, Joachim Scholty-seck, Krisztián Ungváry, Alexander Vatlin,Dorothee Wierling
12. bis 17. Oktober„1939-1949 – Dekade der Gewalt.Internationales Forum 2008 der Ge-schichtswerkstatt Europa“, Tagung
13. Oktober„flüstern und SCHREIEN“,Filmvorführung
15. Oktober„Die Umerziehung der Vögel. Der Malerund Autor Hans-Hendrik Grimmlingund sein Leipzig der 1980er Jahre“,Podiumsgespräch mit Hans-HendrikGrimmling, Doris Liebermann, BerndLindner
29. Oktober„Schlesien. Das Land und seine Ge-schichte“, Buchvorstellung und Podi-umsgespräch mit Arno Herzig, MichaelParak, Krzysztof Ruchniewicz
November4. November„Service Made in Germany – Ein Reise-führer“, Buchpräsentation mit ThomasHofmann, Marcus Kölling, Kathrin Mös-lein, Ralf Reichwald
5. November„Pazifismus um jeden Preis? Friedens-ethik 20 Jahre nach der FriedlichenRevolution“, Vortrag von Anja Siebert
10. November„here we come“, Filmvorführung
12. November„Tage im Oktober. Berlin, Leipzig und diefriedliche Revolution in der DDR“, Podi-umsdiskussion mit Katrin Hattenhauer,Tobias Hollitzer, Ilko-Sascha Kowalczuk,Ehrhart Neubert, Uwe Schwabe, TomSello
17. November„60 Jahre Israel. Gefahren und Heraus-forderungen für den Staat der Juden“,Vortrag von Gil Yaron
27. November15. Leipziger Europaforum:„Der Blickvon außen – wie ausländische Korres-pondenten das Jahr 1989 erlebten“,mit Lucas Delattre, Michał Jaranowski,Peter Wensierski
Dezember1. Dezember„Nun auch der Kapitalismus am Ende?Die Finanzkrise: Der zweite Fall derMauer“, MDR Radio-Café
11. Dezember„Lili Marleen“, Filmvorführung
Veranstaltungen ZeitgeschichtlichesForum Leipzigständige Kooperationspartner:Bundeszentrale für politische BildungDeutschlandfunkEuropa-Haus LeipzigFriedrich-Ebert-StiftungKonrad-Adenauer-StiftungMitteldeutscher RundfunkLeipziger Volkszeitung
Sächsische Landeszentralefür politische Bildung
Sächsischer Landesbeauftragter für dieUnterlagen der Staatssicherheitsdienstes
Stiftung zur Aufarbeitung der SED-DiktaturUniversität Leipzig
`́
172
Veröffentlichungen
Stiftung Haus der Geschichte derBundesrepublik Deutschland (Hrsg.),Museumsmagazin (vierteljährlich).Sonderausgabe zur Ausstellung „manspricht Deutsch“ im November 2008.
Dies. (Hrsg.), Tätigkeitsbericht2007/2008, Bonn 2009(erscheint seit 1992).
Dies. (Hrsg.), Skandale in Deutschlandnach 1945, Bielefeld/Leipzig 2007.
Dies. (Hrsg.), Ucieczka, wypedzenie,integracja, Bielefeld 2007.
Dies. (Hrsg.), Flagge zeigen?Die Deutschen und ihre Nationalsymbole,Bielefeld/Leipzig 2008.
Dies. (Hrsg.), Melodien für Millionen.Das Jahrhundert des Schlagers,Bielefeld/Leipzig 2008.
Dies. (Hrsg.), Melodien für Millionen.Das Jahrhundert des Schlagers(Compact-Disc), Berlin 2008.
Dies. (Hrsg.), Demokratie jetzt oder nie!Diktatur – Widerstand – Alltag.Begleitbuch zur Dauerausstellung desZeitgeschichtlichen Forums Leipzig,Leipzig 2008.
Dies. (Hrsg.), Deutscher Bundestag.Die Sitzung ist eröffnet,Bonn 2007, 2. Auflage.
Dies. (Hrsg.), Salonwagen 10205.Von der Schiene ins Museum,Bonn 2007, 4. Auflage.
Dies. (Hrsg.), Schwerter zu Pflugscharen.Geschichte eines Symbols,Bonn/Leipzig 2007.
Dies. (Hrsg.), Römerkeller. Zeitreiseim Haus der Geschichte, Bonn 2008,2. Auflage.
Dies./Bundesamt für Bauwesen undRaumordnung (Hrsg.),Der Regierungsbunker, Tübingen 2007.
Veröffentlichungen der Stiftung
,
174
Gremienmitglieder
BundestagFraktion der CDU/CSUElisabeth Winkelmeier-BeckerDr. Günter KringsDaniela RaabStellvertreter
Dr. Ralf GöbelPhilipp MissfelderRenate Blank
Fraktion der SPDDr. Angelica Schwall-DürenGunter WeißgerberStellvertreter
Stephan HilsbergDr. Wolfgang Thierse
Fraktion der FDPDetlef ParrStellvertreter
Gisela Piltz
Fraktion Die Linke/PDSJan KorteStellvertreter
Dr. Dagmar Enkelmann
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENKatrin Göring-EckartStellvertreter
Undine Kurth
KuratoriumVorsitzendeDr. Ingeborg Berggreen-Merkel
Stellvertretender VorsitzenderStaatssekretär Dr. Knut Nevermann
Baden-WürttembergStaatssekretär Dr. Dietrich BirkStellvertreter
Dr. Veit Steinle
BayernN.N.Stellvertreter
N.N.
BerlinVolker HellerStellvertreter
Rainer Klemke
BrandenburgStaatssekretär Dr. Johann KomusiewiczStellvertreter
Hans-Joachim Cornel
BremenBürgermeister Jens BöhrnsenStellvertreter
Staatsrätin Dr. Kerstin Kießler
HamburgStaatsrat Reinhard StuthStellvertreter
Marie-Luise Tolle
HessenN.N.Stellvertreter
Günter Schmitteckert
Mecklenburg-VorpommernIlka Lochner-Borst, MdLStellvertreter
Dr. Enoch Lemcke
NiedersachsenStaatssekretär Dr. Josef LangeStellvertreter
Dr. Annette Schwandner
Nordrhein-WestfalenStaatssekretärHans-Heinrich Grosse-BrockhoffStellvertreter
Peter Landmann
Rheinland-PfalzStaatssekretärProf. Dr. Joachim Hofmann-GöttigStellvertreter
Heidi Schumacher
SaarlandStaatssekretärinDr. Susanne ReichrathStellvertreter
Helga Knich-Walter
SachsenStaatssekretär Dr. Knut NevermannStellvertreter
Thomas Früh
Sachsen-AnhaltStaatssekretär Dr. Valentin GramlichStellvertreter
Dr. Gerold Letko
Schleswig-HolsteinSusanne Bieler-SeelhoffStellvertreter
Dr. Stephan Opitz
ThüringenStaatssekretärProf. Dr. Walter Bauer-WabneggStellvertreter
Dr. Werner von Trützschler
Bundesrat
175
Anhang
BundeskanzleramtDr. Ingeborg Berggreen-MerkelStellvertreter
Bundesministerium für Verkehr,Bau- und StadtentwicklungMichael Halstenberg
Bundesministerium des InnernDr. Markus KerberStellvertreter
Bundesministerium des InnernNorbert Seitz
Auswärtiges AmtN.N.Stellvertreter
Auswärtiges AmtN.N.
Bundesministerium der FinanzenN.N.Stellvertreter
Bundesministerium der FinanzenN.N.
Bundesministeriumfür Bildung und ForschungKornelia HauggStellvertreter
Bundesministeriumfür Bildung und ForschungDr. Gisela Steffens
BundeskanzleramtDr. Michael RoikStellvertreter
BundeskanzleramtN.N.
Bundesministeriumfür Wirtschaft und TechnologieDr. Melitta Büchner-SchöpfStellvertreter
Bundesministeriumfür Umwelt, Naturschutzund ReaktorsicherheitDr. Peter Müller
Bundesministerium für Familie,Senioren, Frauen und JugendN.N.Stellvertreter
Bundesministerium der VerteidigungOberst i. G. Klaus-Dieter Bermes
BundesregierungReinhard BuschDr. Rolf-Peter CarlSiegfried FrieseGabi Förder-HoffLandtagspräsident a.D. Jürgen GansäuerDr. Detlef GottschalckProf. Dr. Claus GrimmDr. Wilfried GroligPeter GuntermannDr. Michael HenkerJörg KastendiekProf. Markus KarpStaatssekretär Prof. Dr.Joachim-Felix LeonhardStaatssekretär Heinz MaurusDr. Erich PostProf. Dr. Hermann SchäferMichael ScheuringRolf Dieter SchnelleDr. Göttrik Wewer
Im Berichtszeitraum ausgeschieden
Stand: März 2009
176
Gremienmitglieder
Wissenschaftlicher Beirat*Vorsitzender:Prof. Dr. Lothar Gall
Stellvertretende Vorsitzende:Dr. Ulrich LöberProf. Dr. Marie-Luise Recker
Prof. Dr. Wlodzimierz BorodziejProf. Dr. Ulrich BorsdorfJoel J. CahenProf. Dr. Bernd FaulenbachDr. Andres FurgerProf. Dr. Helga GrebingProf. Dr. Antonia GrunenbergProf. Dr. Ulrich von HehlProf. Dr. Beatrice HeuserProf. Dr. Klaus HildebrandProf. Dr. Hans Günter HockertsProf. Dr. Hélène Miard-DelacroixProf. Dr. h.c. mult. Horst MöllerProf. Dr. Andreas RödderProf. Dr. Klaus SchönhovenProf. Dr. Günther SchulzProf. Dr. Hans-Peter SchwarzProf. Dr. Klaus TenfeldeProf. Dr. Hartmut WeberDr. Stefan Wolle
Wissenschaftlicher Beirat*
Prof. Dr. Wlodzimierz BorodziejProf. Dr. Ulrich BorsdorfJoel J. CahenProf. Dr. Otto DepenheuerProf. Dr. Bernd FaulenbachProf. Dr. Lothar GallProf. Dr. Ingrid Gilcher-HolteyProf. Dr. Antonia GrunenbergProf. Dr. Ulrich von HehlProf. Dr. Beatrice HeuserProf. Dr. Hans Günter HockertsProf. Dr. Hélène Miard-DelacroixProf. Dr. Gabriele MetzlerProf. Dr. Dr. h.c. mult. Horst MöllerProf. Dr. Werner PlumpeProf. Dr. Marie-Luise ReckerProf. Dr. Andreas RödderProf. Dr. Martin SabrowProf. Dr. Joachim ScholtyseckProf. Dr. Günther SchulzProf. Dr. Hans-Peter SchwarzProf. Dr. Klaus TenfeldeProf. Dr. Hartmut WeberProf. Dr. Andreas WirschingDr. Gabriele Zuna-Kratky
*bis Dezember 2008
Stand: März 2009
*nach Neubesetzung durch das Kuratoriumim Januar 2009
177
Anhang
Arbeitskreis gesellschaftlicher GruppenVorsitzenderPrälat Dr. Karl JüstenStellvertretende VorsitzendeDr. Inge von Bönninghausen
Evangelische KircheProf. Dr. Wolf-Dieter HauschildStellvertreter:
Oberkirchenrat Dr. h.c. Volker Faigle
Katholische KirchePrälat Dr. Karl JüstenStellvertreter:
Dr. Burkhard van Schewick
Zentralrat der Juden in DeutschlandDr. Alexander BrennerStellvertreter:
N.N.
BundesausländerbeiratGiuseppe SchillaciStellvertreter:
N.N.
Bundesvereinigung derdeutschen ArbeitgeberverbändeUlrich R. HüttenbachStellvertreter:
Dr. Barbara Dorn
Deutscher GewerkschaftsbundHans-Otto HemmerStellvertreter:
Dr. Hans-Joachim Schabedoth
Bund der VertriebenenDr. Herfried StinglStellvertreter:
Markus Leuschner M.A.
Deutscher FrauenratDr. Inge von BönninghausenStellvertreter:
Henny Engels
Deutscher KulturratDr. Georg RuppeltStellvertreter:
Prof. Dr. Max Fuchs
Deutscher SportbundProf. Dr. Heinz DenkStellvertreter:
Prof. Dr. Michael Krüger
Deutscher BundesjugendringAlexander SchwitanskiStellvertreter:
Antonia Kühn
Bundesvereinigung derkommunalen SpitzenverbändeProf. Dr. Hans-Günter HennekeStellvertreter:
Dr. Klaus Nutzenberger
Im Berichtszeitraum ausgeschieden:Dr. Claudia Schwalfenberg
Stand: März 2009
178
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dr. Hans Walter HütterPräsident und ProfessorDr. habil. Harald BiermannDirektor der AbteilungÖffentlichkeitsarbeitWilhelm BraamDirektor der Abteilung Zentrale DiensteProf. Dr. Rainer EckertDirektor ZeitgeschichtlichesForum LeipzigDr. Dietmar PreißlerDirektor der Abteilung SammlungenDr. Jürgen ReicheDirektor der Abteilung Ausstellungen
AHans-Jürgen Arnold;Hausmeister ZeitgeschichtlichesForum Leipzig
BHermann Barths; Fahrer (bis 31.12.08)Christel Baumgart; Inventar- undDokumentationssachbearbeiterin(bis 31.12.08)Ralf Beck; TechnikerSabine Behr; Dipl. BibliothekarinHardy Berg; Sachbearbeiter VerwaltungHeinrich Beschmann; ElektrikerConnie Bhattacharya;AuskunftsassistentinGerald Boch; DepotverwalterDorina Junia Bodenstein;AuszubildendeSvenja Boon; AuszubildendeHans-Dieter Brambach;VerwaltungsmitarbeiterAndrea Braun; DirektionssekretärinAnna Brüx; RestauratorinZeitgeschichtliches Forum LeipzigBirgit Bublitz; SachbearbeiterinAdressverwaltung
DDorothee Dennert;Museumspädagogin(bis 29.2.08)Frauke Dungs; DiplombibliothekarinMaren Dombrowski; SekretärinSascha Dreiser;MedientechnikerZeitgeschichtliches Forum LeipzigNadine Duderstädt; AuszubildendeZeitgeschichtliches Forum LeipzigStephan Dumon; Inventar- und Doku-mentationssachbearbeiter
EPhilipp Einer; AuszubildenderZeitgeschichtliches Forum LeipzigArnd Eßer; Sachbearbeiter InternetUrsula Evers; DepotverwalterinAdelheid Ewenz; AuskunftsassistentinInformationszentrum
FManfred Fiévet; BetriebsingenieurClaudia Freytag;Wiss. Mitarbeiterin
GCornelia Geißenhöner; SekretärinZeitgeschichtliches Forum LeipzigDr. Henrike Girmond;Wiss. Mitarbeite-rin Zeitgeschichtliches Forum LeipzigLilo Glomb; Dipl. Bibliothekarin(bis 31.10.07)Julia Götzl; Auszubildende (bis 24.6.08)Ramona Greis; Auszubildende(bis 16.7.08)Dr. Olivia Griese;Wiss. Leiterin desInformationszentrumsAndrea Grobien; Bibliotheksassistentin(beurlaubt)Herbert Groß; Schreiner
HHildegard Hanfland-Gödde;AuskunftsassistentinVanessa Hansen; Sekretärin (bis 30.9.07)Regina Haunhorst; SachbearbeiterinLeMOEike Kerstin Hemmerling;VeranstaltungsassistentinZeitgeschichtliches Forum LeipzigReinhard Henk; TechnikerDr. Detlef Herbner;Veranstaltungskoordinator (bis 31.1.09)Alexandra Hissen; Inventar- undDokumentationssachbearbeiterinGabriele Hodžić; Dipl. Bibliothekarin Zeit-geschichtliches Forum LeipzigGünter Höfer; DepotverwalterManuela Hoffmann; Bibliotheks-und InformationsassistentinZeitgeschichtliches Forum Leipzig
179
Anhang
Peter Hoffmann; PressereferentTobias Hoppe; Auszubildender(bis 19.1.09)
JDr. Stephanie Jacobs;Ausstellungsassistentin (bis 28.2.07)Edgar Jöbgen; Schlosser
KAlexandra Kaiser;Wiss. VolontärinBettina Kath; RestauratorinZeitgeschichtliches Forum LeipzigHeinz-Peter Kefferpütz; HausarbeiterPhilipp Kelcec; SicherheitsmitarbeiterGabriele Kellermann; RegistraturleiterinInge Keßler;Wiss. Leiterindes Informationszentrums (bis 30.11.07)Gundula Klein;MuseumspädagoginTim Kleinmann; technischer Angestellter(bis 31.3.08)Ruth Klippel;Malerin (beurlaubt)Torsten Kniest; SachgebietsleiterVerwaltungJudith Koberstein;SammlungsassistentinSven Kodlin; Auszubildender(bis 28.1.09)Bernd Köhler; IT-KoordinatorZeitgeschichtliches Forum LeipzigElke Köhler; SekretärinZeitgeschichtliches Forum LeipzigDr. Judith Koppetsch;VeranstaltungskoordinatorinDr. Daniel Kosthorst;Wiss. MitarbeiterZeitgeschichtliches Forum LeipzigUta Köstler;Bibliotheks- und InformationsassistentinZeitgeschichtliches Forum LeipzigDr. Dorothea Kraus;Wiss. MitarbeiterinTorsten Krause; Registrar SammlungIndustrielle Gestaltung BerlinKatrin Krell; Sammlungs- undDokumentationsmitarbeiterinSammlung Industrielle Gestaltung BerlinWolfgang Kreutzer; Registrar
Ulrike Krüsmann; Leiterin der MediathekFriederike Kürschner; IT-KoordinatorinBrigitte Kurth; Inventar- undDokumentationssachbearbeiterinVolker Küster; Depotverwalter
LBarbara Langer; Publikationsreferentin(bis 29.2.08)Kerstin Langwagen; ObjektdisponentinZeitgeschichtliches Forum LeipzigMandy Lochmann; SachbearbeiterinVerwaltung Zeitgeschichtliches ForumLeipzigDr. Antoinette Lepper-Binnewerg;Wiss. MitarbeiterinRalf Lieb;MedieningenieurManfred Lierz; Leitender RestauratorProf. Dr. Bernhard Lindner;Wiss. MitarbeiterZeitgeschichtliches Forum LeipzigErik Lindner;Meister der Veranstaltungs-technik Zeitgeschichtliches Forum LeipzigDr. Kornelia Lobmeier;Wiss. MitarbeiterinSascha Löhr;MalerAusonia Lotá; SekretärinCarmen Lutz; Dokumentationssach-bearbeiterin Zeitgeschichtliches ForumLeipzig
`́
180
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
MManfred Mardinskij; SachbearbeiterFotoarchivDr. Anne Martin,Wiss. MitarbeiterinZeitgeschichtliches Forum LeipzigDr. Simone Mergen;MuseumspädagoginChrista Meyer;Mitarbeiterin MediathekDr. Elke Mittmann;Wiss. MitarbeiterinZeitgeschichtliches Forum LeipzigUwe Morenz; SicherheitsmitarbeiterDr. Andreas Morgenstern;Wiss. Volontär (bis 31.1.09)Dr. Andrea Mork;Wiss. MitarbeiterinAndrea Müggenburg; Sachgebiets-leiterin Verwaltung ZeitgeschichtlichesForum Leipzig
NVolker Näkel; ElektrikerMaria Neumann; SekretärinZeitgeschichtliches Forum Leipzig(Freistellungsphase)Siegfried Neveling; TechnikerAlfred Niessen;Leitender BetriebsingenieurBrigitte Nowak; BibliotheksassistentinJan Nowinski; HausmeisterPetra Nüßgen; Inventar- und Dokumenta-tionssachbearbeiterin (beurlaubt)
OUlrich Op de Hipt;Wiss. MitarbeiterDr. Petra Oepen;Wiss. VolontärinThomas Otto; Lager- und Depotverwal-ter Zeitgeschichtliches Forum LeipzigUrsula Overath; Personalreferentin
PGudrun Pauli; IT-KoordinatorinGerda Paulussen; RestauratorinBettina Peterle;VeranstaltungsassistentinDr. Christian Peters;Wiss. MitarbeiterNorbert Pietz; TechnikerJana Piontek;DokumentationssachbearbeiterinZeitgeschichtliches Forum LeipzigSusanne Ponnwitz; SachbearbeiterinVerwaltung Zeitgeschichtliches ForumLeipzigChristiane Popella-Leicht;Auskunftsassistentin (beurlaubt)
RCarsten Reich; TechnikerJoschka Reich; Auszubildender(bis 14.2.08)Christina Reinsch;Wiss. MitarbeiterinZeitgeschichtliches Forum LeipzigFerdinand Retzmann;WerkstattmitarbeiterKatharina Ricke;VeranstaltungskoordinatorinDr. Schanett Riller;Wiss. Volontärin(bis 31.12.07)Annika Risse; AuskunftsassistentinMonika Rodenbach; Dipl. BibliothekarinDiana Roschka-Meinerding;Sachgebietsleiterin VerwaltungPetra Rösgen; PublikationsreferentinDr. Tuya Roth; AusstellungsassistentinDetlef Rother; HausmeisterZeitgeschichtliches Forum Leipzig
SDr. Johanna Sänger;Wiss. LeiterinSammlung Industrielle Gestaltung BerlinHelene Schaefer; SekretärinJosef Schäfer; Dipl. BibliothekarSabine Schebben; Direktionssekretärin
181
Anhang
Dorothee Schmidt;BibliotheksassistentinMiriam Schmidt; Dipl. BibliothekarinNorbert Schmitt; RestauratorDaniela Schmitz; SekretärinWalter Schmitz; HausmeisterThomas Schneemelcher;Leiter IT-KoordinationJens Scholten;Wiss. VolontärBirgit Schrandt; Dipl. BibliothekarinAnja Schubert; Sammlungs- undDokumentationssachbearbeiterinSammlung Industrielle Gestaltung BerlinUwe Schwabe; Sammlungssachbear-beiter Zeitgeschichtliches Forum LeipzigGabriele Schwalge; RestauratorinSandra Schwindtke;BibliotheksassistentinBerthold Seidel; SchreinerProf. Dr. Hanno Sowade;Wiss. MitarbeiterUwe Spieß; DepotverwalterMartina Stadler; Leiterin desInformationszentrumsGerhard Staudenmaier;Sachbearbeiter VerwaltungStefanie Steilberg;Sicherheitsmitarbeiterin (bis 14.3.07)Christina Steinbicker;Wiss. VolontärinMatthias Stenger;Wiss. VolontärDr. Angela Stirken;Wiss. MitarbeiterinTilla Stöckigt;MuseologinZeitgeschichtliches Forum LeipzigDorothea Straßberger; SekretärinChristina Strick;Wiss. Volontärin(bis 31.1.09)
THelmut Thelen; SachbearbeiterVerwaltungVolker Thiel; Leitender RegistrarCornelia Thiere; AuskunftsassistentinZeitgeschichtliches Forum LeipzigDr. Helene Thiesen;Wiss. Mitarbeiterin
Dr. Brigitta Thomas;Wiss. Volontärin (bis 31.1.07)Axel Thünker; FotografKlaus Tiefensee; IT-Koordinator
VAjith Vithanage;Mitarbeiter Verwaltung
WCathrin Wachter; AuszubildendeYvonne Walter, Besucherdienstkoordina-torin Zeitgeschichtliches Forum LeipzigDagobert Warndorf;WerkstattleiterMartina Weck; BibliotheksassistentinThomas Welle; InstallateurHelena von Wersebe;BesucherdienstkoordinatorinHans-Joachim Westholt;Wiss. MitarbeiterKai-Ingo Weule;Sachgebietsleiter VerwaltungTobias Wöhrle;Wiss. Volontär(bis 31.1.09)
ZErika Zander; Inventar- undDokumentationssachbearbeiterinStefan Ziegler;MedieningenieurThomas Zumbeck; Hausarbeiter
Nachruf
Zwei langjährige Mitarbeiter der Stiftungsind im Jahr 2008 für uns alle unerwartet verstorben.
Wolfgang Henkel undMichael Jenschhaben durch ihre engagierte Arbeit und ihre Kreativitätzum Erfolg unserer Arbeit beigetragen.
Wir werden Ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.
Stand: 31.3.2009
182
Chronik
15. JuliEröffnung der Ausstellung„Annäherungen. Deutsche und Polen“im Warschauer Unabhängigkeitsmuseum
13. NovemberEröffnung der Ausstellung„1936. Die Olympischen Spiele undder Nationalsozialismus“im Haus der Geschichte
6. DezemberEröffnung der Wanderausstellung „ AlsMickey Mouse nach Deutschland kam“im Haus der Geschichte, Foyer
199713. MärzEröffnung der Ausstellung„Markt oder Plan. Wirtschaftsordnungenin Deutschland 1945 bis 1961“im Haus der Geschichte
10. JuniEröffnung der Ausstellung„By the way – Fotografien amerikani-scher Soldaten“ im Haus der Geschichte
8. OktoberEröffnung der Ausstellung„Ungleiche Schwestern? Frauen inOst- und Westdeutschland“im Haus der Geschichte
11. DezemberEröffnung der Ausstellung „...allez hopp!Straßenkunst der Nachkriegszeit“im Haus der Geschichte, Foyer
199815. MaiEröffnung der Ausstellung„Ungleiche Schwestern?“ in Dresden
3. JuniEröffnung der Ausstellung„Vis-à-vis: Deutschland und Frankreich“im Haus der Geschichte
6. NovemberEröffnung der Ausstellung„Bilder, die lügen“im Haus der Geschichte
8. DezemberStart der Wanderausstellung „40+10Fünfzig Jahre deutsche Geschichte“ imHaus der Geschichte
17. DezemberEröffnung der Ausstellung„Vis-à-vis: Deutschland und Frankreich“im Maison de Radio France in Paris
199922. AprilEröffnung der Ausstellung„Künstliche Versuchung.Nylon – Perlon – Dederon“im Haus der Geschichte
9. OktoberEröffnung des ZeitgeschichtlichenForums Leipzig durch BundeskanzlerGerhard Schröder in Anwesenheit vonBundestagspräsident Wolfgang Thierseund Ministerpräsident Kurt Biedenkopf
18. NovemberEröffnung der Ausstellung„Krauts – Fritz – Piefkes...?Deutschland von außen“im Haus der Geschichte
20001. MärzEröffnung der Ausstellung„Bilder, die lügen“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
11. MaiEröffnung der Ausstellung„Spuren der Macht. Die Verwandlungdes Menschen durch das Amt. EineLangzeitstudie“,Fotografien von Herlinde Koelblim Haus der Geschichte
199414. JuniBundeskanzler Dr. Helmut Kohl eröffnetdas Haus der Geschichte in allen Funkti-onsbereichen. Parallel zur Dauerausstel-lung wird die Wechselausstellung„Deutschlandbilder – Das vereinigteDeutschland in der Karikatur des Aus-lands“ gezeigt.
8. DezemberEröffnung der Ausstellung„SpielZeitGeist. Spiel und Spielzeugim Wandel“ im Haus der Geschichte
199531. MaiEröffnung der Ausstellung„Kriegsgefangene – Wojennoplennyje.Sowjetische Kriegsgefangene inDeutschland – deutsche Kriegsgefan-gene in der Sowjetunion“ im Haus derGeschichte
14. NovemberEröffnung der Ausstellung„Blende auf! Jugendfotografie inDeutschland 1960 bis 1995“im Haus der Geschichte
1. DezemberEröffnung der Ausstellung„Kriegsgefangene“ im Zentralmuseumfür den Großen Vaterländischen Kriegin Moskau
19967. MärzEröffnung der Ausstellung„Annäherungen. Deutsche und Polen1945/1995“ im Haus der Geschichte
5. JuniEröffnung der Ausstellung „EndlichUrlaub! Die Deutschen reisen“im Haus der Geschichte
183
Anhang
14. SeptemberEröffnung der Ausstellung„Spuren der Macht. Die Verwandlungdurch das Amt. Eine Langzeitstudie“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
21. NovemberEröffnung der Ausstellung„Deutschland – Niederlande. Heiter biswolkig“ in Anwesenheit vonKönigin Beatrix der Niederlandeund Bundespräsident Johannes Rauim Haus der Geschichte
7. DezemberEröffnung der Ausstellung„Miss Germany –eine schöne Geschichte“im Haus der Geschichte, Foyer
15. DezemberEröffnung der Ausstellung„Gegen Unrecht – für Freiheit!Karikaturen von Fritz Behrendt“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
200119. AprilEröffnung der Ausstellung„Tore der Freiheit. Von der Solidarnoczzur Deutschen Einheit“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
17. MaiEröffnung der Ausstellung„frauenobjektiv.Fotografinnen 1940 bis 1950“durch Bundestagspräsidentina.D. Annemarie Rengerim Haus der Geschichte
25. MaiEröffnung der Ausstellung„Deutschland – Niederlande.Heiter bis wolkig“ / „Zimmer frei“im Rijksmuseum Amsterdam
9. JuliEröffnung der überarbeiteten Daueraus-stellung im Haus der Geschichte durchBundeskanzler Gerhard Schröder
12. JuliEröffnung der Ausstellung„Fotoanschlag. Vier Generationenostdeutscher Fotografen“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
26. SeptemberEröffnung der Ausstellung„Jugendjahre. Teens und Twenszwischen 1950 und 2000“in der U-Bahn-Galerie
15. NovemberEröffnung der Ausstellung„Geteilt – Vereint – Gefunden“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
22. NovemberEröffnung der Ausstellung„Prominente in der Werbung.Da weiß man, was man hat“im Haus der Geschichte
6. DezemberEröffnung der Ausstellung„Lili Marleen.Ein Schlager macht Geschichte“im Haus der Geschichte, Foyer
20024. FebruarEröffnung der Ausstellung„Miss Germany –Eine schöne Geschichte“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
14. MaiEröffnung der Ausstellung„Fotoanschlag. Vier Generationenostdeutscher Fotografen“im Haus der Geschichte
19. JuniEröffnung der Ausstellung„Die Meute.Macht und Ohnmacht der Medien“im Haus der Geschichte, U-Bahn-Galerie
2. AugustEröffnung der Ausstellung„Klopfzeichen. Kunst und Kulturder 80er Jahre in Deutschland“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
24. OktoberEröffnung der Ausstellung„Am siebten Tag.Geschichte des Sonntags“durch Karl Kardinal Lehmannim Haus der Geschichte
12. DezemberEröffnung der Ausstellung„Leni Riefenstahl“im Haus der Geschichte, Foyer
16. DezemberEröffnung der Ausstellung„Duell im Dunkel – Spionage imgeteilten Deutschland“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
200330. JanuarEröffnung der Ausstellung„Widerstand und Opposition in der DDR“in Hamburg
10. MärzEröffnung der Ausstellung„Nähe und Ferne.Deutsche, Tschechen und Slowaken“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
22. MaiEröffnung der Ausstellung„Duell im Dunkel – Spionage imgeteilten Deutschland“im Haus der Geschichte
1. JuniEröffnung der Ausstellung„Unverschämtes Glück.Fotos von Robert Lebeck“im Haus der Geschichte, U-Bahn Galerie
184
Chronik
19. JuniEröffnung der Ausstellung„Am siebten Tag.Geschichte des Sonntags“im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig
18. NovemberEröffnung der Ausstellung„Jeder ist ein Fremder – fast überall“im Haus der Geschichte
1. DezemberEröffnung der Ausstellung„Spuren-Sledy.Deutsche und Russen in der Geschichte“im Haus der Geschichte
20048. MärzEröffnung der Ausstellung„Rückblende 2003“im Haus der Geschichte, Foyer
17. MärzEröffnung der Ausstellung„Nähe und Ferne.Deutsche, Tschechen und Slowaken“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
21. MaiEröffnung „Weg der Demokratie“im Palais Schaumburg
27. MaiEröffnung der Ausstellung„Bilder und Macht im 20. Jahrhundert“im Haus der Geschichte
13. – 15. Juni10 Jahre Haus der Geschichte
30. AugustEröffnung der Ausstellung„Konsum im ,Konsum’“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
28. SeptemberEröffnung der Ausstellung„15 Jahre friedliche Revolution“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
29. OktoberEröffnung der Ausstellung„Damals in der DDR“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
20. NovemberEröffnung der Ausstellung„Elvis in Deutschland“im Haus der Geschichte
25. NovemberEröffnung der Ausstellung„Bilder und Macht im 20. Jahrhundert“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
2. DezemberEröffnung der Ausstellung„Nähe und Ferne.Deutsche, Tschechen und Slowaken“im Haus der Geschichte
200522. AprilEröffnung der Ausstellung„Unterm Strich.Karikatur und Zensur in der DDR“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
29. AprilEröffnung der Ausstellung„Keine Panik –Udo Lindenbergs bunte Republik“mit Udo Lindenbergim Haus der Geschichte, Foyer
19. MaiEröffnung der Ausstellung„Verfreundete Nachbarn:Deutschland – Österreich“im Haus der Geschichte
10. JuniEröffnung der Ausstellung„Elvis in Deutschland“im „Tränenpalast“ Berlin
8. SeptemberEröffnung der Ausstellung„HANELUJA. Karikaturen vonWalter Hanel 1965 – 2005“im Haus der Geschichte, Foyer
23. SeptemberEröffnung der Ausstellung„Ein Amerikaner in Deutschland –Leonard Freed“im Haus der Geschichte, U-Bahn-Galerie
14. OktoberEröffnung der Ausstellung„Leben vor dem Mauerfall“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
18. NovemberEröffnung der Ausstellung„Unterm Strich.Karikatur und Zensur in der DDR“im Haus der Geschichte, Foyer
3. DezemberEröffnung der Ausstellung„Flucht, Vertreibung, Integration“mit Bundespräsident Horst Köhlerim Haus der Geschichte
17. DezemberEröffnung der Ausstellung„Rock!Jugend und Musik in Deutschland“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
200628. AprilEröffnung der Ausstellung„Versuch dich zu erinnern“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
18. MaiEröffnung der Ausstellung„Flucht, Vertreibung, Integration“im Deutschen Historischen MuseumBerlin
185
Anhang
24. MaiEröffnung der Ausstellung„Rock!Jugend und Musik in Deutschland“im Haus der Geschichte
1. JuniEröffnung der Ausstellung„ Verfreundete Nachbarn:Deutschland – Österreich“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
9. JuniEröffnung der Ausstellung„Deutschlandreise.Fotografien von Pia Malmus“im Haus der Geschichte, U-Bahn-Galerie
14. JuniEröffnung der Ausstellung„Rückblende 2005“im Haus der Geschichte, Foyer
6. SeptemberEröffnung des InformationszentrumsFöderalismus im Bundesratsgebäudein Bonn
14. SeptemberEröffnung der Dauerausstellungim Palais Schaumburg
31. OktoberEröffnung der Ausstellung„Zug um Zug.Schach – Gesellschaft – Politik“im Haus der Geschichte, Foyer
30. NovemberEröffnung der Ausstellung„Flucht, Vertreibung, Integration“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
1. DezemberEröffnung der Ausstellung„Rock!Jugend und Musik in Deutschland“im Kronprinzenpalais Berlin
7. DezemberEröffnung der Ausstellung„drüben. Deutsche Blickwechsel“im Haus der Geschichte
200713. MärzEröffnung der Ausstellung„Die Kunst des SPIEGEL:Die Originale der SPIEGEL-Titelbilder“im Haus der Geschichte, Foyer
24. MärzEröffnung der Karikaturengalerie in Bonn
8. MaiEröffnung der Ausstellung„Wilde Zeiten.Fotografien von Günter Zint“im Haus der Geschichte, U-Bahn-Galerie
24. MaiEröffnung der Ausstellung„Heimat und Exil. Emigration derdeutschen Juden nach 1933“im Haus der Geschichte
30. MaiEröffnung der Ausstellung„drüben. Deutsche Blickwechsel“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
9. OktoberEröffnung der neuen Dauerausstellungim Zeitgeschichtlichen Forum Leipzigdurch KulturstaatsministerBernd Neumann
15. NovemberEröffnung der Ausstellung„Das Boot –Geschichte. Mythos. Film“im Haus der Geschichte
11. DezemberEröffnung der Ausstellung„Skandale in Deutschland nach 1945“im Haus der Geschichte, Foyer
13. DezemberEröffnung der Ausstellung„Heimat und Exil. Emigration derdeutschen Juden nach 1933“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
20086. MaiEröffnung der Ausstellung„Skandale in Deutschland nach 1945“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
8. MaiEröffnung der Ausstellung„Melodien für Millionen.Das Jahrhundert des Schlagers“im Haus der Geschichte
1. SeptemberEröffnung der Ausstellung„Beobachtungen –Der Parlamentarische Rat 1948/49.Fotografien von Erna Wagner-Hehmke“im Haus der Geschichte, Foyer
21. NovemberEröffnung der Ausstellung„Melodien für Millionen.Das Jahrhundert des Schlagers“im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
4. DezemberEröffnung der Ausstellung„Flagge zeigen? Die Deutschenund ihre Nationalsymbole“im Haus der Geschichtedurch Bundespräsident Horst Köhler
11. DezemberEröffnung der Ausstellung„man spricht Deutsch“im Haus der Geschichte, Foyer
186
Gesetz
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1
Gesetzzur Errichtung einer Stiftung
„Haus der Geschichteder Bundesrepublik Deutschland“
§ 1Errichtung und Rechtsform
Unter dem Namen „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“wird eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Bonnerrichtet. Die Stiftung entsteht mit Inkrafttreten dieses Gesetzes.
§ 2Stiftungszweck
(1) Zweck der Stiftung ist es, in einem Ausstellungs,- Dokumentations- und Infor-mationszentrum die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einschließlichder Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik unter Einbeziehungder Vor- und Entstehungsgeschichte darzustellen und Kenntnisse hierüber zuvermitteln.
(2) Der Erfüllung dieses Zwecks dienen insbesondere:
1. Aufbau, Unterhaltung und Weiterentwicklung einer ständigen Ausstellung,2. wechselnde Sonderausstellungen, Vorträge, Seminare, Filmvorführungen,3. Einrichtung und Unterhaltung eines Informationszentrums, einer Bibliothek
und einer Dokumentationsstelle,4. Veröffentlichungen,5. Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden und Einrichtungen der Stiftung.
§ 3Unterstützung durch das Bundesarchiv
Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wird die Stiftung durch das Bundesarchivunterstützt.
§ 4Stiftungsvermögen
(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gehen die von der BundesrepublikDeutschland für die unselbstständige Stiftung „Haus der Geschichte derBundesrepublik Deutschland“ erworbenen beweglichen und unbeweglichenVermögensgegenstände in das Eigentum der Stiftung über.
(2) Zur Erfüllung des Stiftungszwecks erhält die Stiftung einen jährlichenZuschuß des Bundes nach Maßgabe des jeweiligen Bundeshaushalts.
(3) Die Stiftung ist berechtigt, Zuwendungen von dritter Seite anzunehmen.
(4) Erträgnisse des Stiftungsvermögens und sonstige Einnahmen sind nur imSinne des Stiftungszwecks zu verwenden.
§ 5Satzung
Die Stiftung gibt sich eine Satzung, die vom Kuratorium beschlossen wird.
§ 6Organe der Stiftung
Organe der Stiftung sind
1. das Kuratorium,2. der Direktor,3. der wissenschaftliche Beirat4. der Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen.
§ 7Kuratorium
(1) Das Kuratorium besteht aus zweiunddreißig Mitgliedern.
(2) Je acht Mitglieder werden vom Deutschen Bundestag und von der Bundes-regierung, sechzehn Mitglieder vom Bundesrat entsandt. Die vom DeutschenBundestag entsandten Mitglieder müssen Abgeordnete sein; sie und die vonder Bundesregierung entsandten Mitglieder verfügen über je zwei Stimmen.Die vom Bundesrat entsandten Mitglieder verfügen über je eine Stimme. Fürjedes Mitglied ist für den Fall der Verhinderung ein Stellvertreter zu benennen.Ist auch dieser verhindert, kann das Stimmrecht auf ein anderes Mitglied desKuratoriums übertragen werden.
(3) Die entsendungsberechtigten Stellen können jedes von ihnen entsandteMitglied abberufen. Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter aus, so ist einneues Mitglied oder ein neuer Stellvertreter zu entsenden.
(4) Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden unddessen Vertreter.
(5) Das Kuratorium beschließt über alle grundsätzlichen Fragen, die zumAufgabenbereich der Stiftung gehören, insbesondere über die Grundzüge derProgrammgestaltung für das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-land, die Satzung, den Haushaltsplan sowie bedeutsame Personalentscheidun-gen. Es überwacht die Tätigkeit des Direktors; der Direktor hat hierzu imKuratorium zu berichten.
(6) Beschlüsse über die Satzung (§ 5) und deren Änderung bedürfen einer Mehr-heit von zwei Dritteln der Stimmen. In der Satzung können weitere qualifizierteMehrheiten festgelegt werden. Im übrigen werden Beschlüsse mit einfacherMehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden desKuratoriums den Ausschlag.
(7) An den Sitzungen des Kuratoriums nehmen der Direktor, der Vorsitzendedes wissenschaftlichen Beirates und der Vorsitzende des Arbeitskreises gesell-schaftlicher Gruppen mit beratender Stimme teil, soweit das Kuratorium imEinzelfall nichts anderes beschließt. Das Kuratorium kann Vertreter der StadtBonn zu den Sitzungen einladen.
(8) Das Nähere regelt die Satzung.
§ 8Wissenschaftlicher Beirat
(1) Dem wissenschaftlichen Beirat gehören bis zu fünfundzwanzig Sachverstän-dige an. Sie werden vom Kuratorium für vier Jahre berufen. Die Wiederberufungist zulässig. Der Generaldirektor des Deutschen Historischen Museums kann anden Sitzungen des wissenschaftlichen Beirates teilnehmen.
(2) Der wissenschaftliche Beirat berät das Kuratorium und den Direktor.
(3) Das Nähere regelt die Satzung.
Gesetzzur Errichtung einer Stiftung
„Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“
vom 28. Februar 1990in der Fassung vom 12.02.2009*
187
Anhang
§ 9Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen
(1) Der Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen besteht aus bis zu fünfzehn Ver-tretern gesellschaftlicher Gruppen, unter anderem aus Vertretern von Religions-gesellschaften sowie Vereinigungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
(2) Das Kuratorium stellt fest, welche gesellschaftlichen Gruppen zur Entsen-dung eines Vertreters in den Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen berechtigtsind. Es beruft die Mitglieder des Arbeitskreises gesellschaftlicher Gruppen undihre Stellvertreter auf Vorschlag der entsendungsberechtigten Stelle für dieDauer von vier Jahren. Die Wiederberufung ist zulässig. Die entsendungsberech-tigten Stellen können dem Kuratorium die Abberufung vorschlagen. Scheidet einMitglied oder ein Stellvertreter aus, so kann die entsendungsberechtigte Stelleein neues Mitglied oder einen neuen Stellvertreter benennen.
(3) Der Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen berät das Kuratorium undden Direktor.
(4) Das Nähere regelt die Satzung.
§ 10Direktor
(1) Der Direktor führt die Geschäfte der Stiftung. Er entscheidet in allenAngelegenheiten der Stiftung, soweit dafür nicht das Kuratorium zuständig ist.Er vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich.
(2) Der Direktor wird vom Kuratorium nach Anhörung des wissenschaftlichenBeirates und des Arbeitskreises gesellschaftlicher Gruppen berufen.
§ 11Ehrenamtliche Tätigkeit
Die Mitglieder des Kuratoriums, des wissenschaftlichen Beirates und desArbeitskreises gesellschaftlicher Gruppen üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.Die Erstattung von Reisekosten und sonstigen Auslagen richtet sich nach denfür die unmittelbare Bundesverwaltung geltenden Bestimmungen
§ 12Aufsicht, Haushalt, Rechnungsprüfung
(1) Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht des zuständigen Bundesministers.
(2) Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie für die Rechnungs-legung der Stiftung gelten die für die unmittelbare Bundesverwaltung geltendenBestimmungen. Die Haushalts- und die Wirtschaftsführung der Stiftung unter-liegen der Prüfung durch den Bundesrechnungshof.
§ 13Berichterstattung
Die Stiftung legt alle zwei Jahre einen öffentlich zugänglichen Bericht über ihrebisherige Tätigkeit und ihre Vorhaben vor.
§ 14Beschäftigte
(1) Die Stiftung besitzt Dienstherrenfähigkeit im Sinne des § 2 des Bundesbeam-tengesetzes. Die Beamten der Stiftung werden mit Ausnahme des Direktorsvom Vorsitzenden des Kuratoriums ernannt, soweit nicht die Befugnis zurErnennung durch die Satzung dem Direktor übertragen ist.
(2) Oberste Dienstbehörde für die Beamten der Stiftung ist das Kuratorium.§ 144 des Bundesbeamtengesetzes bleibt unberührt.
(3) Auf die Arbeitnehmer der Stiftung sind die für Arbeitnehmer des Bundesjeweils geltenden Tarifverträge und sonstigen Bestimmungen anzuwenden.
§ 15Freier Eintritt, Gebühren
(1) Der Eintritt in das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschlandist frei.
(2) Die Stiftung kann Gebühren für die Benutzung von Stiftungseinrichtungenund für besondere Veranstaltungen erheben.
(3) Das Nähere regelt die Satzung.
§ 16Dienstsiegel
Die Stiftung führt ein Dienstsiegel.
§ 17Übergang von Rechten und Pflichten
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gehen auf die Stiftung sämtliche Rechteund Pflichten über, welche die Bundesrepublik Deutschland für die unselbst-ständige Stiftung „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“übernommen hat. Dies gilt insbesondere für die Arbeitsverträge der bei derunselbständigen Stiftung beschäftigten Arbeitnehmer. Erster Direktor derStiftung wird der Direktor der unselbständigen Stiftung.
Artikel 2Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sindgewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt undwird im Bundesgesetzblatt verkündet.
Bonn, den 28. Februar 1990
Der BundespräsidentWeizsäcker
Der BundeskanzlerDr. Helmut Kohl
Der Bundesminister des InnernSchäuble
*„Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Haus der Geschichte der BundesrepublikDeutschland“ (Artikel 1 d. Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung „Haus derGeschichte der Bundesrepublik Deutschland“) vom 28. Februar 1990(BGBl I S. 294), zuletzt geändert durch Artikel 15 Abs. 60 des Gesetzesvom 5. Februar 2009 (BGBl I S. 160)“
188
Impressum
Herausgeber:Stiftung Haus der Geschichteder Bundesrepublik DeutschlandPräsident:Prof. Dr. Hans Walter Hütter
MuseumsmeileWilly-Brandt-Allee 1453113 BonnTelefon: 0228/91 65-0Telefax: 0228/91 65-302Internet: www.hdg.deE-Mail: [email protected]
Redaktion:Peter HoffmannDr. habil. Harald Biermann
Konzept und Realisation:kultur & kommunikationAgentur für Kulturmarketingund Kommunikation GmbH, Hürth
Copyright: Stiftung Haus der Geschichteder Bundesrepublik DeutschlandBonn 2009
gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier
Bildnachweis:Bimmer, Fabian: S. 73 o.Brendel, Micha: S. 112dpa/Sven Simon: S. 59 M.Frommann-Czernik, Barbara: S. 5, 31, 32,33, 150/151, 152, 156, 157, 158Greser, Achim und Lenz, Heribert:S. 101 o.Gringmuth, Jochen: S. 70Guth, Amélie: S.104Hachulla, Ulrich: S. 111Hoffmann, Peter: S. 121Krause, Thorsten und Schubert, Anja(SIG): S. 19 o., 190, 161 u., S. 161 o.,RückseiteKreishaus Soest: S. 63Lübeck, Kulturforum Burgkloster: S.67 u.Malmus, Pia: S. 61Marcks, Marie: S. 101 u.Maskus, Nicole: S. 96, 97, 114Museum für Kommunikation, Bern:S. 66, 67o.Piontek, Jana: S. 53PUNCTUM/Hoyer: S. 7 u., 7 M., 28, 37,49, 50, 52 o., 54, 56, 88, 89, 91, 92, 93,95, 103, 126, 147 u., 148, 168 l., 169 M.,169 r., 170 M., 171PUNCTUM/Kober: S. 19 u., 26, 27, 29,146, 147 o., 155, 170 r., RückseitePUNCTUM/Marchand: S. 90 o., 148, 149PUNCTUM/Reihhold: S. 90 u., 168 M.,169 l.PUNCTUM/Zeyen: S. 94, 110, 168 r.
Rentz, Andreas: S. 72Rühmekorf, Cynthia: Titel, S. 6 M., 6 o.,7 o., 7 u, 8 o., 8 M., 8 u., 9 o., 9 M., 10,11, 12, 13, 14, 17, 18, 22/23, 24, 25, 30,34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 48, 55, 58 r.,71, 73 u.r., 74/75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82 o., 82 u., 83, 84, 85, 86, 87, 100, 103,105, 106, 116/117, 118, 119 o., 120,130/131, 132, 134, 135, 143, 144, 145,164, 165, 166, 167, RückseiteStadtmuseum Gütersloh: S. 62Stiftung Haus der Geschichteder Bundesrepublik Deutschland/Michael Jensch, Axel Thünker: S. 4, 6 u.,9 u., 20, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 51,52 u., 59, 68, 69, 98/99, 102, 108, 122,123, 124, 125, 127, 133, 136, 137, 142,153, 154, 155, 162/163Stiftung Haus der Geschichteder Bundesrepublik Deutschland/Zeitgeschichtliches Forum Leipzig: S. 129STRÖER, Leipzig: S. 128Tino Pauli Fotografie&Mediendesign/Pauli: S. 159US Holocaust Memorial Museum,Courtesy of American Jewish JointDistribution Committee: S. 47Wagner-Hehmke, Erna (BestandStiftung Haus der Geschichte der Bun-desrepublik Deutschland, Bonn): S. 107Wöhrle, Tobias: S. 25 r., 113Zint, Günther: S. 58 u.l., 60