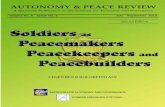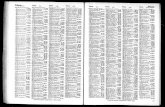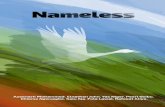Mitbestimmung - Hans-Böckler-Stiftung
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Mitbestimmung - Hans-Böckler-Stiftung
Im RampenlichtWarum Betriebsräte Medienkompetenz brauchen
Durchstarten nach der Wahl: Seminare für Einsteiger und „alte Hasen“
BEtriEBSratSqualifiziErung
Wir vermitteln HandlungskompetenzSystematisch. Praxisorientiert. Auf dem neuesten Stand.
I Einstieg in die Betriebsratsarbeit
I Betriebsverfassungsrecht und Arbeitsrecht
I Wirtschaft und Unternehmensentwicklung
I Gesundheit und Arbeit
I Sozialrecht und Sozialpolitik
I Methoden- und Sozialkompetenz
I EDV-Einsatz und web 2.0 in der Betriebsratsarbeit
I Ausbildungen
I Individuell zugeschnittene Gremienschulungen
Programmheft anfordern
Tel. 0211/4301-234 oder
Programm-Download
und Seminarinfos:
www.betriebsratsqualifizierung.de
DGB Bildungswerk BUND
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
www.dgb-bildungswerk.de
www.betriebsratsqualifizierung.de
DGB Bildungswerk BUND
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
www.dgb-bildungswerk.de
Seminare für Einsteiger und „alte Hasen“
www.betriebsratsqualifizierung.de
DGB Bildungswerk BUND
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
www.dgb-bildungswerk.de
MitbestimmungDAS MAGAZIN DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG · WWW.MAGAZIN-MITBESTIMMUNG.DE
Mit
best
imm
ung
11/2
014
5,00
€
56.
JAH
RG
AN
G
BU
ND
-VER
LAG
IM R
AM
pEN
LIC
HT
· War
um B
etri
ebsr
äte
Med
ienk
ompe
tenz
bra
uche
n5,
00€
60
. JA
HR
GA
NG
B
UN
D-V
ERLA
G
NoVEMBER 11/2014
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH · US-Arbeitsminister Perez trifft BetriebsräteFoToREpoRTAGE · Bei den Haus- und Landbesetzern von SevillaZEITZEUGEN · Ehemalige Spitzengewerkschafter reflektieren ihre Rolle
PostvertriebsstückD 8507Entgelt bezahlt
Postfach60424 Frankfurt am Main
Infotelefon:0 69 / 79 50 10-20
Fax:0 69 / 79 50 10-11
Internet: www.bund-verlag.de
E-Mail: [email protected] beziehen über den gut sortierten Fachbuchhandel oder direkt beim Verlag unter: [email protected]
Ganz nah dran. Bund-Verlag
Darf der Chef E-Mails der Mitarbeiter lesen? Darf er Videokameras installieren? Dürfen rechtswidrig erlangte Kenntnisse vor Gericht gegen die Beschäftigten verwendet werden? Wie verhalten sich Datenschutz und Compliance zueinander? Was ist beim Abschluss einer Betriebsverein-barung zu beachten?
Diese und viele andere Praxisfragen zum Datenschutz im Betrieb behandelt Wolfgang Däubler in seinem umfassenden Handbuch. Gerichtliche Entscheidungen aller Instanzen bis hin zum EuGH-Urteil gegen Google sind vollständig aus-gewertet, Rechtsprechung und Literatur bis September 2014 verarbeitet.
Die wichtigsten Themen: • Big Data und Cloud Services• Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung• Fragerecht gegenüber Bewerbern, Recherche im Internet• BEM und Pflicht zur ärztlichen Untersuchung• Ortungssysteme und Erstellung von Bewegungsprofilen• RFID im Betrieb• Benutzung biometrischer Merkmale• Einsatz von Privatdetektiven• Übermittlung von Daten in Drittstaaten (vor allem USA)• Kontrolle durch Datenschutzbeauftragten und die
Aufsichtsbehörde• Mitwirkung von Betriebsräten und Personalräten• Sicherheitsüberprüfung und AEO-Zertifikat
Der Autor:Dr. Wolfgang Däubler, Professor für Deutsches und Euro-päisches Arbeitsrecht, Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht an der Universität Bremen. Eines seiner Spezialgebiete ist der Arbeitnehmerdatenschutz.
Gegen Überwachung und Kontrolle im Betrieb
Wolfgang DäublerGläserne BelegschaftenDas Handbuch zum Arbeitnehmerdatenschutz6., überarbeitete Auflage2014. 730 Seiten, gebunden€ 59,90ISBN 978-3-7663-6086-1
Beachten Sie auch:
Däubler / Klebe / Wedde WeichertBundesdatenschutzgesetzKompaktkommentar zum BDSG4., überarbeitete Auflage2014. 902 Seiten, gebunden€ 89,90ISBN 978-3-7663-6097-7
MIT1114254_EAZ_6086_6097_1-1_U2_4c.indd 1 10.10.14 14:37
Ganz nah dran. Bund-Verlag
Zu beziehen über den gut sortierten Fachbuchhandel oder direkt beim Verlag unter: [email protected]
Fundiert und verständlich erläutert der Kommentar die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX). Die Autoren – anerkannte Experten mit umfassender Praxiserfahrung – geben einen vollständigen Überblick über die neueste Rechtsprechung des Bundessozial gerichts und der Instanzgerichte sowie über den Stand der Fachdiskuss ion. Für Fragen, die noch nicht gerichtlich entschieden sind, entwi-ckeln sie eigenständige Lösungen. Diese haben vor allem eine faire Beachtung der Rechte (schwer-)behinderter Menschen im Blick. Die Neuauflage berücksichtigt Gesetzgebung und Rechtsprechung bis einschließlich Juni 2014.
Die Schwerpunkte:• Rechtsprechung zur Gleichstellung behinderter Menschen,
zum Anspruch auf Zusatzurlaub, zum Betrieblichen Ein-gliederungsmanagement und zu Kündigungsfragen
• Die stufenweise Wiedereingliederung• Gesetz zur Änderung personenbeförderungsrechtlicher
Vorschriften
Die Herausgeber:Werner Feldes, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz der IG Metall-Vorstandsverwaltung, Frankfurt/M.Dr. Wolfhard Kohte, Professor für Bürgerliches Recht, Deutsches und Europäisches Arbeits-, Unternehmens- und Sozialrecht an der Universität Halle.Eckart Stevens-Bartol, Jurist, zuvor langjähriger Vorsitzender Richter am Landessozialgericht München.
Teilhabe durchsetzen
Die Autorinnen und
Autoren:
Postfach60424 Frankfurt am Main
Infotelefon: 069 / 79 50 10-20
Fax: 069 / 79 50 10-11
E-Mail: [email protected]
www.bund-verlag.de/6244
Werner Feldes / Wolfhard Kohte Eckart Stevens-Bartol (Hrsg.)SGB IX – Sozialgesetzbuch Neuntes BuchRehabilitation und Teilhabe behinderter MenschenKommentar für die Praxis3., überarbeitete Auflage2015. Ca. 1.250 Seiten, gebundenSubskriptionspreis bis drei Monate nach Erscheinen:ca. € 89,–Danach: ca. € 109,–ISBN 978-3-7663-6292-6Erscheint Dezember 2014Jetzt vorbestellen
Dr. Dörte Busch,Dr. Ulrich Faber, Bettina Fraunhoffer, Eberhard Kiesche, Daniele Kopp-Schönherr, Joachim Maaßen, Prof. Dr. Katja Nebe, Ingo Nürnberger, Peter Schmitz, Stefan Soost, Dr. Hans Günther Ritz
MIT1114255_EAZ_6292_1-1_U3_4c.indd 1 10.10.14 10:51
so beschrieb EU-Parlaments-präsident Martin Schulz kürzlich auf einer Konferenz des EGB die „höchst ex-plosive Lage in Europa“ (Seite 50). Diese wach-sende soziale Ungleichheit prägt nicht nur die Gesellschaf-ten der Mitgliedstaaten, sie zeigt sich vor allem auch in einem dramatischen Nord-Süd-Gefälle. Was Austeritätspolitik mit den Menschen in Südeuropa macht, hat die Böckler-Stipendiatin Jelca Kollatsch in Andalusien für eine Fotoausstellung eingefangen. Ihre
beeindruckenden Fotos (Seite 38) zeigen die Not der Menschen im spani-schen Armenhaus mit der höchsten Arbeitslosigkeit unter jungen Erwachse-nen in Europa, unglaub-lichen 65 Prozent. Ob-dachlosigkeit ist hier zum Massenphänomen gewor-den, obwohl es nicht an Wohnungen fehlt: Anda-
lusien hat die höchste Zwangsräumungsrate, weil die Menschen ihre Hypotheken und Mieten nicht bezahlen können.
Es ist deshalb nur konsequent, die 2013 auf den Weg gebrach-te, milliardenschwere Jobgarantie für Jugendliche zu verteidigen,
trotz der Umsetzungsprobleme. Das gilt genauso für die vom ehemaligen EU-Kommissar László Andor ins Ge-spräch gebrachte europäische Arbeitslosenversicherung, über deren konkrete Gestalt nachgedacht werden sollte (Seite 9). Bei allen Problemen: Es geht um ein Zeichen des politischen Willens, dem europäischen Projekt eine soziale Dimension zu geben.
Dass dies auch eine historische Verantwortung ist, argumentiert Professor Stefan Berger von der Ruhr-Uni-versität Bochum (Seite 58). Die Lehre aus den Katastro-phen des 20. Jahrhunderts ist die Stärkung der euro-päischen Integration in friedenspolitischer und sozialer Hinsicht. Darüber werden Gewerkschafter und Histori-ker auf der gemeinsamen historisch-politischen Konfe-renz von Hans-Böckler-Stiftung und DGB am 20. und 21. November in Düsseldorf diskutieren – auch mit Martin Schulz.
Angeregte Lektüre, auch zu vielen gelungenen Bei-spielen betriebsrätlicher Öffentlichkeitsarbeit, wünscht
„Bedrohung der Demo-kratie durch wachsende soziale Ungleichheit“,
Foto
: And
reas
Poh
lman
n
wolfgang jäger
3Mitbestimmung 11/2014
EDITORIAL
TITEL ÖffenTlICHKeITSarBeIT ARBEIT
10
RUBRIKEN
3 EDITORIAL 6 NAchRIchTEN 9 PRO & cONTRA 72 RäTsELhAfTEs fUNDsTücK 73 vORschAU, ImPREssUm 74 mEIN ARBEITsPLATZ Ulrich Fey, Clown
32
32 Ein Urknall für Arbeitnehmerrechte
Vor zehn Jahren ist das „Schwarz-buch Lidl“ erschienen. Von Martin Kempe
36 Im Parlament der Betriebsräte
Der Deutsche BetriebsräteTag 2014. Von C. Girndt und M. Hasel
37 „ mobilarbeit muss man im Betrieb regeln“
Interview mit BMW-Betriebsrat und Preisträger Peter Cammerer
10 Auf sendung Wie Betriebsräte das Internet für ihre Öffentlichkeitsarbeit nutzen.
Von Andreas Kraft
14 „Gute Bilder finden“ Fragen an Betriebsräteberater Michael Rasch über vermeidbare Fehler
16 „Blogs machen unsere Arbeit einfacher“ Interview mit Timm Boßmann, Betriebsrat und Blogger bei der Verlagsgruppe
Weltbild, über scharfe Schwerter in der gewerkschaftlichen Waffenkammer
19 Professionell und unbequem Betriebszeitungen sind eine spezielle Form des Journalismus. Von Susanne Kailitz
22 Den Wahnsinn steuern Medial erzeugter Druck kann auch hilfreich sein. Von Silke Ernst
25 Weil der Aufsichtsrat kein Geheimrat ist Vom klugen Umgang mit der Verschwiegenheitspflicht. Von Joachim F. Tornau
28 Wettlauf um Aufmerksamkeit Öffentlichkeitswirksame Aktionen brauchen gute Vorbereitung. Von Andreas Schulte
30 „Rampensau für das Gute“ Interview mit Porsche-Betriebsrat Uwe Hück über das nötige Rüstzeug für den
öffentlichen Auftritt
4 Mitbestimmung 11/2014
58 Zur sache Stefan Berger über die Lehren aus
zwei Weltkriegen
60 Böckler-Tagungen Arbeitszeitpolitische Tagungen Tarifpolitische Tagung
63 Tipps & Termine
64 Böckler-Nachrichten
66 Der furchtlose Altstipendiat Michael Hugo
engagiert sich in Rostock für die Integration von Ausländern. Von Susanne Kailitz
AUs DER sTIfTUNG
66
Klaus Franz, der ehemalige stellvertretende Opel-Aufsichtsratsvorsitzende, und Johann Rösch, Arbeitnehmervertreter im Karstadt-Aufsichtsrat, berich-ten über ihren Umgang mit der Verschwiegenheitspflicht: „Eine gut lancierte Pressekampagne ist oftmals erheblich wirkungsvoller als eine dreistündige Arbeitsniederlegung.“ seite 25
AUfsIchTsRAT
mEDIEN
68 Buch & mehr
70 Website-check
5338
POLITIK WIssEN
38 „In erster Linie kämpferisch“ Wie Menschen in Südspanien um
ihre Existenz und um ihre Würde kämpfen. Eine Fotoreportage von Jelca Kollatsch
50 Am scheideweg Europas Gewerkschaften formulieren
ihre Erwartungen an die neue EU-Kommission. Von Margarete Hasel und Andreas Schulte
53 Die Kraft der Erinnerung Ehemalige führende Gewerkschafter
geben in einem Forschungsprojekt Einblicke in ihre Erfolge und Nieder lagen. Von Ingo Zander
Vorsichtig und kreativ
Foto
: Jür
gen
Seid
el
5Mitbestimmung 11/2014
INhALT
Foto
s: R
olf
Sch
ulte
n
BIlD DeS MonaTS
Meeting über Mitbestimmung mit US-Arbeitsminister „Welchen Nutzen haben deutsche Unternehmen durch die Mitbe-stimmung und die betriebliche Ausbildung? Warum teilen Arbeit-geber die Macht mit Betriebs- und Arbeitnehmeraufsichtsräten?, diese Dinge wollte US-Arbeitsminister Thomas Perez von uns wis-sen“, berichtet Birgit Helten-Kindlein (Foto 4.v.l.). Die Betriebs- und Aufsichtsrätin der Henkel AG war eine von elf Spitzenbetriebsräten, die zu einem Informationsaustausch über das deutsche Modell der Mitbestimmung mit dem US-amerikanischen Arbeitsminister am 29. Oktober in Berlin zusammengekommen waren. Mit dabei waren Arbeitnehmervertreter von Conti, Henkel, BMW, BASF, Siemens, Nokia, VW, Telekom, Siemens und der Kannegießer GmbH.
Zu den Intentionen seines Besuchs sagte Perez, Präsident Oba-ma sei sehr interessiert am deutschen Modell und Jobwunder, man wolle verstehen, lernen, verändern. Hintergrund sei, dass der Wohl-stand in den USA sehr ungleich verteilt sei – auch weil viele Men-schen nicht ausreichend qualifziert sind. Es sei für ihn überraschend, habe Perez gesagt, dass in Deutschland Betriebsräte in diesem Maße in unternehmerische Entscheidungen involviert sind und mit-
gestalten können. Ebenso erstaunte es ihn, dass jeder der elf Be-triebsräte mehr als 20 Jahre im gleichen Unternehmen tätig ist. Das sei normal, klärten die Arbeitnehmervertreter den US-Arbeitsminis-
erST foToTerMIn, Dann InTenSIver auSTauSCH: US-Arbeitsminister Thomas Perez mit Kollegin Andrea Nahles und den elf Betriebsräten
BR-Vorsitzende Andreas Wendland, Siemens, Monika Brandl, Telekom mit US-Arbeitsminister Thomas Perez (v.l.)
6 Mitbestimmung 11/2014
DreI zaHlen, DreI MelDungen
TopQuoTe BeI ÜBernaHMen Anzahl der Auszubildenden, die 2013 nach der Prüfung übernommen wurden …
papa BleIBT zu HauSeAnteil der Väter*, die Elterngeld beziehen, in …
Sorgen verSCHIeBen SICHZu den dringlichsten Aufgaben gehören …
Quelle: IAB-Betriebspanel, Oktober 2014
33% der Deutschen zählen Arbeitslosigkeit zu den dringlichsten Problem in Deutschland – weniger als halb so viele wie 2002. Für
genauso wichtig halten die Befragten Preisentwicklung und Renten.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Oktober 2014
Quelle: GfK, Juni 2014 (Mehrfachnennungen möglich)
266 der 402 Landkreise und kreisfreien Städte kom-men beim Elterngeld auf eine Väterbeteiligung von mindestens 25 Prozent. Besonders häufig
nutzen Väter das Angebot in Bayern, Sachsen und Thüringen.
67% der Auszubildenden wurden im Jahr 2013 übernommen. Die Übernahmequote liegt damit auf dem höchsten Stand seit Beginn
der Erhebung 1996. Damals waren es 52 Prozent.
2002
Arbeits-losigkeit
Preisent-wicklung
Renten
* Die Kinder wurden 2012 geboren.
Spitzenreiter Jena 50%
Schlusslicht Gelsenkirchen 11%
67%Gesamt
63%Ost
68%West
14%
12%
33%
2014
24%26%
74%
ter auf, da Arbeitsplatzsicherheit eine der Grundlagen sei für das Engagement der Mitarbeiter für ihr Unter-nehmen. „Ich habe ihm gesagt, dass wir im Henkel-Konzern noch nie betriebsbedingte Kündigungen hat-ten, obwohl wir viel restrukturiert haben“, berichtet Birgit Helten-Kindlein. Stattdessen seien die Mitarbei-ter für andere Aufgaben qualifiziert worden, wofür auch eine gute betriebliche Erstausbildung die Grund-lagen lege.
Wie ist die deutsche Industrie so rasch und erfolg-reich aus der Krise gekommen, wollte Perez wissen. Die Betriebsräte führten die hohe Arbeitszeitflexibilität der Mitarbeiter ins Feld, erläuterten Arbeitszeitkorri-dore, die mit der Auftragslage schwanken können und Arbeitszeitkonten. Und erklärten, dass Kurzarbeit ei-nes der interessantesten Instrumente der Arbeits-marktpolitik sei. All dies Ideen, die mitbestimmt entwi-ckelt wurden.
veranTworTung ÜBerneHMen_ Auf die direkte Frage von Arbeitsminister Perez: „Was könnt ihr uns mit auf den Weg geben?“, verwiesen die Betriebsräte auf die Betriebsverfassung als rechtlichen Rahmen.
„Das ist das A und O, da waren wir uns alle einig“, sagt die Henkel-Betriebsrätin. Ein ähnliches Resümee zog Arbeitsministerin Nahles: „In dem Moment, wo man eigene Rechte hat, ist man bereit, Gesamtverantwor-tung für das Unternehmen zu übernehmen.“ Das sei die Botschaft der Betriebsräte an den US-Arbeitsminis-ter gewesen, sagte sie einen Tag später auf dem Be-triebsrätetag in Bonn.
US-Arbeitsminister Thomas Perez, ein linksliberaler Bürgerrechtsanwalt, der schon in der Clinton-Adminis-tration tätig war, hatte bei seinem Deutschlandbesuch auch VW, Siemens und die Charité in Berlin besucht. Am Abend fand zudem ein Gespräch mit dem DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann statt. Das Treffen mit den Betriebsräten aus verschiedenen Branchen hatte auf Bitten von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles die Hans-Böckler-Stiftung inhaltlich vorbereitet.
Bei den US-Politikern Verständnis zu wecken für das deutsche System der Mitbestimmung dürfte auch für die Tochterfirmen von VW und Mercedes im Süden der USA von Bedeutung sein, wo seit Jahren um Ge-werkschaftsrechte und die Installierung von Works Councils gestritten wird. ■
Von CornelIa gIrnDT, Redaktion Magazin Mitbestimmung
7Mitbestimmung 11/2014
NAchRIchTEN
Betriebsratskandidatur aus EigennutzIm Januar soll das Landesarbeitsgericht Hamm über einen Streit auf der Zeche Auguste Victoria in Marl entscheiden. Wegen eines Formfehlers hat die christliche Gewerkschaft DHV die Wiederholung der jüngsten Betriebsratswahl ge-
richtlich durchgesetzt. Dage-gen führt der amtierende Be-triebsrat eine Beschwerde. Der Grund: Die DHV hatte bei der letzten Wahl nur eines von 23 Mandaten errungen. 22 Plät-ze gingen an die Kandidaten der IG BCE. „Wir sehen keinen Grund, warum das Ergebnis bei einer Neuwahl anders aus-sehen sollte“, sagt Betriebsrat Thomas Prinz. „Aber wir ha-ben gerade jetzt wichtigere Aufgaben als die Neuorgani-sation einer solchen Abstim-mung.“ Das Werk des RAG-
Konzerns schließt 2015. Ältere Mitarbeiter sollen bis dahin in den vorgezogenen Ruhestand gehen. 14 der 15 DHV-Kan-didaten der letzten Wahl zählen nicht zu dieser Gruppe und können daher keine Vorruhestandsregelung in Anspruch nehmen. „Sie hoffen wohl, ihre Zeit im Konzern durch eine Wahl zum Betriebsrat irgendwie verlängern zu können, da-bei hat der Gesetzgeber hier Grenzen gesetzt“, sagt Be-triebsrat Prinz. „Die Kandidaten haben ausschließlich egois-tische Motive.“ ■
CHRISTLICHE GEWERKSCHAFT DHV
Die Geschäftsführung der Schuhfabrik Peter Kaiser in Pirmasens mutet ihrer Belegschaft eine ungewisse Zukunft zu. Die 270 Mitar-beiter haben keine Ahnung, wie viel Geld sie demnächst verdienen werden. „Die Leute sind verärgert, orientierungslos und zermürbt. Der Arbeitgeber hat bis heute kein Konzept entwickelt, wie er seine Mitarbeiter zukünftig entlohnen will“, sagte IG-BCE-Sekretär Ulrich Schacht nach einem Treffen mit der Geschäftsführung Ende Okto-ber. Dazu war es gekommen, weil Unternehmer Peter Kaiser im September die Tarifbindung gekündigt hatte – ohne Angabe von Gründen. Nun sollen die Mitarbeiter ein leistungsorientiertes Ent-
Die Mediengruppe DuMont Schauberg krempelt ihr Unternehmen zulasten der Beschäftigten um. Viele der mehr als 3000 Mitarbeiter sollen in neu gegründete Firmen überführt werden – allein zehn am Standort Köln. Nach dem Willen der Arbeitgeber werden zum Bei-spiel das Druckzentrum in Köln, aber auch Verwaltungsbereiche wie Finanzen oder redaktionelle Abteilungen wie die Blattplanung ei-genständige GmbHs. Das Kalkül: Personalkosten zu senken und Kündigungen zu ermöglichen. „Denn keine dieser Firmen ist tarif-gebunden“, sagt der DuMont-Betriebsratsvorsitzende Heinrich Plaßmann. Zwar dürfen die Beschäftigten bei einem Betriebsüber-gang zunächst nicht schlechter gestellt werden. Doch dieser Schutz läuft nach einem Jahr ab. „Niemand weiß, was danach passiert“, sagt Plaßmann. DuMont hatte im Oktober zum wiederholten Mal angekündigt, Stellen abzubauen – 40 davon in Köln. Wie viele Jobs an den Standorten in Berlin, Hamburg und Halle wegfallen, ist wei-terhin unklar. ■
MEDIEN
schuhfabrik Peter Kaiser schweigt über Lohnhöhe
Dumont umgeht Tarifbindung
Kölner Protestgruppe gegen die Abbaupläne des DuMont-Verlages
Foto
: ver
.di B
ezir
k K
öln
, FB
8
gelt erhalten. Doch wie das aussieht, will die Geschäftsführung erst vor Weihnachten mitteilen. „Wir befürchten Lohneinbußen“, sagt Schacht, dessen IG BCE auch die Beschäftigten der Lederbranche vertritt. „Der Arbeitgeber will offensichtlich seinen Sanierungskurs auf Kosten der Belegschaft fortführen.“ In den vergangenen drei Jahren hat Peter Kaiser 40 Prozent der Mitarbeiter abgebaut. Ein Großteil der Produktion ist nach Portugal verlagert worden, wo täg-lich 2400 Paar Schuhe produziert werden. In Pirmasens sind es nur noch 800. Mitte Oktober hatte die Geschäftsführung die Umstruk-turierung des Unternehmens für abgeschlossen erklärt. ■
NACH TARIFKüNDIGUNG
RAG-Betriebsrat Thomas Prinz
8 Mitbestimmung 11/2014
Foto
s: V
ivia
n H
ertz
; MPI
„Nein, das erscheint wenig sinnvoll und noch weniger durchsetzbar. Drei Einwände stehen der Idee einer europä-ischen Arbeitslosenversicherung entgegen. Erstens wäre sie ein Transfersystem, das allein von den Beitragszahlern finanziert würde. Schon das ist grotesk. Hinzu treten zweitens die transnationalen Verteilungswirkungen. Es ist nicht ausgemacht, dass diese von Reich nach Arm verlaufen. Warum sollen wir beispielsweise an das Steu-erparadies Irland zahlen? Oder ärmere Länder an Deutschland, wenn es mit seiner Strategie des Kostendumpings gegenüber seinen Handelspartnern Schiffbruch erleidet? Drittens wäre eine europäi-sche Arbeitslosenversicherung nicht ohne eine gewisse Mindestan-gleichung zu machen. Wer zahlt ein, wer ist leistungsberechtigt, wie lange werden Transfers gewährt, wie hoch liegt das Renteneintritts-alter, wer verwaltet die Kasse, wer schlichtet Streitfragen? Es ist schleierhaft, auf welcher Kompetenzgrundlage diese Mindesthar-monisierung bewerkstelligt werden könnte.
‚Hauptsache mehr Europa!‘, scheint der Impuls hinter dieser For-derung zu sein. Gut durchdacht erscheint das alles nicht. Man kann den DGB in seiner sich abzeichnenden ablehnenden Haltung nur bestärken.“ ■
„Ja, eine europäische Arbeitslosenversicherung ist eine Option, um die Konjunkturzyklen zu stabilisieren. Sie könn-te Finanzströme zu den Arbeitslosen lenken, wo auch immer sie in Europa sind, und jene Länder unterstützen, die von einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen sind. Ich halte einen zusätzli-chen fiskalischen Stabilitätsmechanismus für gerechtfertigt, da die Währungsunion während der Krise keine entsprechende Stützung bereitgestellt hat, sondern die Fiskalpolitik 2013 prozyklisch war. So mussten einige Länder ihre Budgetpolitik straffen, weil sie Zugang zu den Finanzmärkten verloren hatten. Allerdings reicht es nicht aus, diesen Vorschlag allein unter einem fiskalpolitischen Aspekt zu analysieren. Man muss auch die Arbeitsmärkte betrachten, die durch große Heterogenität gekennzeichnet sind. Die Schaffung einer eu-ropäischen Arbeitslosenversicherung wäre ein gute Gelegenheit, sie zu harmonisieren. Damit könnten auch Währungsunion und Bin-nenmarkt gestärkt und die Mobilität der Arbeitnehmer verbessert werden. Es wäre ein Zeichen des politischen Willens, damit dem europäischen Projekt eine soziale Dimension zu geben. Viele Bürger beklagen die allzu technokratische Ausrichtung der EU. Eine euro-päische Arbeitslosenversicherung könnte ein Mittel sein, eine neue, direkte Solidarität zwischen den Bürgern in Europa zu schaffen.“
grégory ClaeyS ist Volkswirt und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Brüsseler Thinktank Bruegel.
MarTIn HÖpner ist Politikwissenschaftler und Privatdozent am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln.
Brauchen wir eine europäische Arbeitslosenversicherung?
9
PRO & cONTRA
Mitbestimmung 11/2014 9
Foto
: Pet
er E
ndig
/dpa
ÖffenTlICHKeITSwIrKSaMe ver.DI-aKTIon auf DeM
aMazon-BeTrIeBSgelänDe In leIpzIg, 28. oKToBer
2014: Der Bestellzettel für den Tarifvertrag im Einzel- und Versandhandel, für den die Amazon-Beschäftigten seit über einem Jahr streiken, schwebt mit einer Drohne ein.
10 Mitbestimmung 11/2014
Von anDreaS KrafT, Journalist in Bamberg
Auf SendungonlIne Das Internet wird auch für die Öffentlichkeitsarbeit von Betriebsräten immer
wichtiger. Sie erreichen über das Netz nicht nur Beschäftigte, sondern auch Manager und Journalisten. Im Konfliktfall haben sie damit einen Kanal mit einer hohen Schlagkraft.
TITEL
Wenn bei Amazon Streik ist, so wie Ende Oktober, schnellen die Zugriffszahlen in die Höhe – auf 50 000 Klicks am Tag. Auf dem Amazon-Blog von ver.di disku-
tieren die Beschäftigten dann miteinander: wie viele sich an dem Streik beteiligen, ob Amazon die deutschen Nie-derlassungen ins Ausland verlagern könnte, ob der Tarif-vertrag für den Einzel- und Versandhandel für Amazon gelten sollte. In den Nutzerkommentaren auf dem Blog hagelt es viel Kritik – an der Gewerkschaft und an den ver.di-Betriebsräten. Aber es gibt auch viel Zustimmung für den Kampf um Tarifverhandlungen mit dem Online-Händler. Doch nicht nur die Beschäftigten verfolgen die Seite, auch Journalisten recherchieren dort. Die Arbeit-nehmervertreter bei Amazon haben so einen direkten Draht zu den Medien.
Doch auch Amazon verfolgt den Blog aufmerksam. „Manchmal stelle ich mir vor“, sagt Andreas Gangl, der seit ein paar Monaten am Blog mitarbeitet, „dass mein Gesicht in Seattle auf der Dartscheibe von Jeff Bezos hängt.“ Der Amazon-Chef ist dafür bekannt, dass ihm die Rechte der Arbeitnehmer nicht all zu wichtig sind. Im Mai wählte ihn der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) zum schlechtesten Chef der Welt. Doch sein Konzern ge-hört neben Google, Apple und Facebook zu den Größen im Onlinegeschäft. Amazon hat den Handel weltweit umgekrempelt. Immer wieder klagen Einzelhändler dar-über, dass Kunden sich in ihren Läden beraten lassen und
die Waren dann online bestellen. So ist der Internetriese weltweit zum schärfsten Konkurrenten von Buchläden, Boutiquen und Warenhäusern geworden.
Vielleicht erklärt das, warum Amazon den Konflikt mit ver.di und den Beschäftigten in Deutschland mit einer derartigen Vehemenz führt. Die Gewerkschaft fordert, dass das Unternehmen den Tarif für den Einzel- und Ver-sandhandel anwendet. Amazon blockt das öffentlich im-mer wieder ab, lässt den Versandhandel unter den Tisch
fallen und behauptet: Man sei Logistiker. So entsteht in der Öffentlichkeit der Eindruck, der Konflikt drehe sich nur darum, welcher Tarif jetzt am besten zu Amazon passt. Dass der Internetriese gar nicht bereit ist, überhaupt über Löhne und Arbeitsbedingungen zu verhandeln, geht meist unter. Mit ihrem Blog können die Beschäftigten das aber immer wieder in Erinnerung rufen.
Wer bei Google nach „Amazon Blog“ sucht, findet als zweiten Treffer die Seite der Beschäftigten. Besser schneidet nur das Blog des Unternehmens ab. „Die Seite hat das Unternehmen als Antwort auf unser Blog aufgesetzt“, sagt Stefan Najda, der bei der ver.di-Bundesverwaltung für den Versand- und On-linehandel zuständig ist. Amazon zeichnet sich dort in netten Imagefilmen als vorbildlichen Arbeitgeber. „Aber eine Kommentarfunktion gibt es nicht“, sagt Najda. Dabei gehöre das zu einem Blog doch dazu. „Wir lassen bei uns ja auch die Kritik stehen, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass die Beiträge nicht wirklich echt sind, sondern vom Social-Media-Team des Unternehmens kommen.“
ÖffenTlICHer DruCK alS waffe_ Ver.di-Sekretär Najda sammelt seit Jah-ren Erfahrungen in Sachen Öffentlichkeitsarbeit über das Internet. Er sagt aber bescheiden: „Wir stecken da noch in den Kinderschuhen.“ Angefangen hat bei ver.di alles mit dem Blog beim Weltbild-Verlag – vor gerade mal fünf Jahren. Dem Betriebsrat des Verlags reichte das Schwarze Brett nicht mehr aus. Er wünschte sich eine Plattform, auf der er die Beschäftigten informieren kann, die aber auch Raum für Diskussionen liefert. „Die Kollegen dort haben wirklich Pionierarbeit geleistet“, sagt Najda, „und weil alles von Anfang an öffentlich war, haben sie damit eine enorme Schlagkraft entfaltet.“ (Siehe Interview mit Weltbild-Betriebsrat Timm Boßmann, Seite 16.)
Das Internet hat die Öffentlichkeit auch für Arbeitnehmervertreter enorm verändert: Während früher Betriebsräte immer erst ein Medium finden muss-
ten, das ihre Botschaft in die Welt trägt, können sie heute über das Internet ganz einfach selbst auf Sen-dung gehen. Dabei wird jede ihrer Aussagen google-bar. Wer sich etwa als Kunde für die Arbeitsbedin-gungen bei Amazon oder Weltbild interessiert, kann Informationen im Internet finden – eben weil sich die Betriebsräte die Arbeit mit ihren Blogs gemacht haben. Für die Arbeitgeber wird es damit immer schwieriger, schlechte Arbeitsbedingungen, die dem
Image des Unternehmens schaden können, vor den Kunden zu verbergen. Gewerkschafter und Betriebsräte hoffen daher darauf, dass der öffentliche Druck letztlich dafür sorgt, dass die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten besser werden.
Kanal In DIe CHefeTage_ Dass das wirklich funktionieren kann, weiß etwa Norbert Lamm, Betriebsrat beim Automobilzulieferer Schaeffler. Die Zentra-le im fränkischen Herzogenaurach hat vor ein paar Monaten ein neues Ver-waltungsgebäude angemietet. Doch die Klimaanlage funktionierte nicht
„Manchmal stelle ich mir vor, dass mein Gesicht in Seattle auf der Dartscheibe von Jeff Bezos hängt.“
ANDREAs GANGL, AmAZON-BLOGGER
12 Mitbestimmung 11/2014
TITEL
Blog oder facebook?
Kann ich ein Team von mehreren Freiwilligen bilden, die regelmäßig schreiben?
Habe ich genug Material, um mehrmals die Woche Artikel zu veröffentlichen?
Will ich ganz viel Zeit in die Arbeit stecken und mich immer wieder offen mit
Kritikern und Nörglern auseinandersetzen?
Reicht mein Atem für mehrere Jahre? Und führt jemand das Blog fort, wenn ich aufhöre?
Ich will in einem aktuellen Konflikt mit dem Arbeitgeber die Beschäftigten vernetzen
und informieren.
Gründe eine facebook-Gruppe
Als Administrator entscheiden Sie darüber, wer Mitglied in
der Gruppe ist. Die Mitglieder können hier in einem geschütz-ten Bereich diskutieren; Bilder von Aktionen einstellen und
sich so gegenseitig motivieren; Links zu Zeitungsartikeln teilen
und sich so gegenseitig auf dem Laufenden halten; sich
kennenlernen, auch wenn sie sich am Arbeitsplatz nicht über den Weg laufen. Sie können
sie zudem mit den Infos des Betriebsrates schnell und
aktuell informieren.
Und los geht‘s: Bloggen, bloggen, bloggen, und nach viel Schweiß und
Arbeit kommt irgendwann der Lohn – vielleicht.
Informieren Sie sich darüber, was ver-öffentlicht werden
darf: Tabu sind Beleidigungen und
Geschäfts-geheimnisse.
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Nein
Nein
Nein
Gründe ein Blog
Sie können mit Ihrem Team eine Seite aufsetzen. Am besten lassen Sie sich von Ihrer Gewerkschaft
dabei helfen. Gut wäre, wenn die sich bereit erklärt, die presserechtliche Haftung zu übernehmen.
Zudem kann sie Ihnen wahrscheinlich beim Design helfen und Platz auf einem Server zur Verfügung
stellen. Wenn nicht, hilft das Internet weiter.
Ich will langfristig eine Plattform schaffen, auf der sich die Beschäftigten über die Arbeit des Betriebsrates informieren und auf der sie sich
austauschen können.
InTervIew
„Gute Bilder finden“
Herr raSCH, SIe BeraTen SeIT MeHr alS 20 jaHren BeTrIeBS-
räTe groSSer unTerneHMen wIe vw oDer aIrBuS. waS
zeICHneT eIne guTe ÖffenTlICHKeITSarBeIT von arBeITneH-
MerverTreTern auS? Es fängt mit dem Selbstvertrauen an. Be-triebsräte tun sich oft schwer, sich selbst vor anderen zu loben. Sie fürchten, die Kollegen könnten sie dann komisch anschauen. Es fällt ihnen daher auch schwer, zu vermitteln, was sie erreicht haben.
waS Kann Man Dagegen Tun? Die Arbeitnehmervertreter müs-sen sich ja nicht zwangsläufig selbst loben. Sie können etwa in ei-nem Video oder auf einem Aushang die Kollegen sprechen lassen. Dann können die Betriebsräte einfach darauf antworten und sagen: Das haben wir doch gerne gemacht.
unD welCHe feHler MaCHen BeTrIeBSräTe BeI Der forMu-
lIerung IHrer flugBläTTer? Sie schreiben oft Funktionärstexte.
michael Rasch, Geschäftsführer der Agentur Praxis für Öffent-lichkeitsarbeit, über selbstvertrauen und die schere im Kopf
richtig: Die Angestellten klagten darüber, dass mitten im Hochsommer die Temperatur in den Büros bei gefühl-ten 15 Grad lag. Der Betriebsrat sprach die Probleme beim Management an, wurde aber vertröstet. Man habe „Ab-stimmungsschwierigkeiten mit dem Vermieter“. Schließ-lich schrieb Lamm einen Beitrag für das Beschäftigten-Blog, die „Schaeffler-Nachrichten“, die im Monat auf gut 250 000 Klicks kommen. „Der Vorstandsvorsitzende hat den Artikel gelesen, und plötzlich kam Bewegung in die Sache“, sagt Lamm. Als Druck aus dem Vorstand kam, sei alles sehr schnell gegangen. „Es wurden noch mal meh-rere Zehntausend Euro in das sechsstöckige Gebäude investiert, und ein paar Wochen später waren die Proble-me größtenteils behoben.“ Jetzt müssen die Angestellten nicht mehr frieren, auch an der Akustik in den Großraum-büros wurde einiges verbessert.
Gegründet wurden die „Schaeffler-Nachrichten“ 2006, in einer Zeit, als der Automobilzulieferer durch die Zu-
käufe von FAG und Continental immer größer wurde. Inzwischen beschäftigt die Schaeffler-Gruppe weltweit rund 76 000 Menschen. Die Internetseite des Betriebsrates soll vor allem dafür sorgen, dass die Beschäftigten sich darüber informieren können, was an den anderen Standorten gerade passiert. Auch die Arbeitnehmervertreter finden hier nützliche Informationen – und sei es nur die Telefonnummer von Kollegen. Und anscheinend schätzt auch der Vorstand die Seite. „Die finden es wohl ganz gut, einen Ort zu haben, an dem sie unge-schminkt erfahren können, was die Beschäftigten denken“, vermutet Lamm.
DranBleIBen IST zenTral_ Dass Schaeffler da kein Einzelfall ist, zeigt auch der „Siemens-Dialog“. Die Internetseite – seit rund 15 Jahren online – ist inzwischen viel mehr als ein Blog. Sie ist ein Portal für die rund 360 000 Siemens-Beschäftigten weltweit, und dazu zählt auch der Vorstandsvorsitzen-de. So habe sich einmal der frühere Siemens-Chef Heinrich von Pierer nach einem Artikel gemeldet, erinnert sich Hagen Reimer, der als stellvertretender Pressesprecher der IG Metall Bayern die Seite betreut. Auch der heutige Vor-standsvorsitzende Joe Kaeser habe in seiner Zeit als Finanzvorstand ein Sch-reiben an den damaligen Bezirksleiter mit den Worten „Wie ich im Siemens-
Foto
: pri
vat
14 Mitbestimmung 11/2014
In einem Faltblatt wollen sie alles sagen und machen dafür zehn Punkte. Dabei reichen drei Punkte vollkommen aus. Besser wäre sogar einer. Wer mehr wissen will, wird nachfragen, und schon ist man im Gespräch mit den Kollegen. Grundsätzlich muss man eine gute Öffentlichkeitsarbeit immer von der Zielgruppe her denken.
waS HeISST DaS KonKreT? Betriebsvereinbarungen sind oft in einer juristischen, abstrakten Sprache abgefasst. Bei einer Vereinba-rung zu mehr Arbeitszeitflexibilität hängen dann 27 Seiten am Schwarzen Brett. Ein gutes Marketing hingegen übersetzt die Leis-tungen in einen konkreten Nutzen. Dazu fragt man einen Kollegen, was ihm die Vereinbarung bringt. Er antwortet dann etwa, dass er jetzt endlich mit seinem Enkel auch mal Eis essen gehen kann. Und schon habe ich ein Bild, mit dem jeder etwas anfangen kann.
waS MaCHT eIn guTeS BIlD auS? Es muss anschaulich sein und hängen bleiben. Bei einer Lohnerhöhung beispielsweise hält das Wissen, dass man jetzt drei Prozent mehr bekommt, oft nur 30 Tage. Deshalb ist es wichtig, zu zeigen, was die Beschäftigten mit dem Geld machen. Etwa in Urlaub fahren. Man muss auch fragen, wohin. Und kann dann schreiben: Mit dem Fahrrad in die Dolomi-ten. Das bleibt hängen.
wir dafür gar nicht die Kapazitäten.“ Auf direkte Gesprä-che, Versammlungen, Betriebszeitungen, Aushänge, Flug-blätter könne man einfach nicht verzichten. Die neuen Kommunikationswege dürfe man aber auch nicht igno-rieren, da sie durchaus Chancen zum Dialog mit der Be-legschaft bieten.
Bei Amazon sind sich die Kollegen sicher, dass sich die Arbeit lohnt. Schließlich erreiche man die Beschäftigten besser als über das Schwarze Brett. Die Beiträge können sie in Ruhe zu Hause lesen und dann ihre Meinung dazu sagen. Aber vor allem hilft der öffentliche Druck im Kampf um einen Tarifvertrag. „Bei Ikea haben wir 13 Jahre ge-braucht“, sagt ver.di-Sekretär Najda. „Ich bin optimis-tisch, dass es bei Amazon nicht ganz so lange dauert.“ Die Beschäftigten hätten in jedem Fall einen langen Atem. Die Planungen für den nächsten Streik laufen bereits – im Weihnachtsgeschäft werden dann vermutlich die Klick-zahlen auf dem Blog wieder in die Höhe schießen. ■
Dialog gelesen habe“ begonnen. Fast täglich erscheinen auf der Seite neue Artikel. „Indem wir die Seite die ganze Zeit am Laufen halten“, sagt Reimer, „haben wir im Konfliktfall, etwa bei einer Umstrukturierung, einen Kanal zu den Beschäftigten, ins Management und in die Öffentlichkeit.“
Ein Blog zu betreiben bedeutet also viel Arbeit. Eine Erfahrung, die auch der Daimler-Betriebsrat machen musste. Dort wurden vor gut vier Jahren an zwei großen Standorten interne Blogs geschaffen, auf die nur die Beschäftigten zugreifen können. Damit sollte eine neue Form der Beteiligung angeboten werden. „Wir erreichen darüber auch Beschäftigte, die nicht gewerkschafts-affin sind und so gut wie nie auf eine Betriebsversammlung kommen“, sagt Silke Ernst, die Pressesprecherin des Daimler-Gesamtbetriebsrates. „Und be-kommen von ihnen auch Rückmeldungen zu unserer Arbeit. Die Kommenta-re geben uns ein gutes Stimmungsbild zu den aktuellen Themen.“ Doch die Kommentarfunktion mache die Blogs mitunter pflegeintensiv. Angeheizt von wenigen sogenannten Trollen, also Nutzern, die mit aller Macht provozieren wollen, seien Diskussionen zu Artikeln vereinzelt auch entgleist. „Da müssen wir gelegentlich moderierend eingreifen und falsche Behauptungen richtigstel-len oder fachliche Informationen liefern“, sagt Ernst. „Aber eigentlich haben
waS SInD DIe groSSen HInDernISSe BeI eIner guTen ÖffenT-
lICHKeITSarBeIT fÜr BeTrIeBSräTe? Ein ganz konkretes Problem ist die Zeit. Betriebsräte sind hoch belastet, sie sitzen im Wirtschafts-ausschuss oder im Gleichstellungsausschuss. Das haben sie in den Seminaren zum Betriebsverfassungsgesetz gelernt. Was sie nicht gelernt haben, ist, sich zu präsentieren. Dazu reicht meist die die Zeit nicht. Und wenn sie Erfolge formulieren sollen, haben sie schon die Schere im Kopf: Was sagt wohl der Arbeitgeber dazu? Dabei hat der sie nicht gewählt, verpflichtet sind sie nur den Beschäftigten.
waS KÖnnTen BeTrIeBSräTe grunDlegenD änDern? Oft kommen sie nur dazu, Rechenschaftsberichte abzuliefern. Für eine gute Öffentlichkeitsarbeit in die Belegschaft hinein ist das fatal. Sie wirken so oft als Bremser. Sie sollten mehr versuchen, selbst etwas zu gestalten, und dann sagen: Das haben wir vor. Wer agiert und nicht nur reagiert, kann damit viel für sein Image tun. Und nimmt die Beschäftigten mit bei der Gestaltung der Zukunft.
Die Fragen stellte anDreaS KrafT.
www.gopraxisgo.de informiert über die Arbeit der Agentur Praxis für Öffentlichkeitsarbeit
MeHr InforMaTIonen
15Mitbestimmung 11/2014
TITEL
Warum ist es für Betriebsräte und aktive Gewerkschaf-ter sinnvoll, Öffentlichkeitsarbeit über das Internet zu betreiben?
Information und Öffentlichkeitsarbeit sind die Grundlage jeder In-teressenvertretung. Und das Medium mit der größten Reichweite ist das Internet. Deshalb ist es nur logisch, dort auch mit der be-trieblichen Interessenvertretung präsent zu sein. Dazu kommt, dass ein Blog leicht zu bedienen ist. Verglichen mit dem Aufwand, den man für eine Betriebszeitung braucht, nimmt ein Blog nur zehn Prozent der Zeit in Anspruch.
Ist das der einzige Vorteil? Nein. Das Internet funktioniert in zwei Richtungen: Man sendet nicht nur eine Botschaft – Leserinnen und Leser haben über die Kommentarfunktionen auch einen Kanal, um zu antworten. Eine Interessenvertretung bekommt also sofort das Feedback der Leute, die sie vertritt. Das ist transparent und macht unsere Arbeit einfacher, weil wir die Wünsche der Kolleginnen und Kollegen besser kennen.
Ein Blog ist praktisch der ganzen Welt zugänglich. Verletzt ein Betriebsrat damit nicht seine Geheimhaltungspflicht? Mit dem Anstellungsvertrag gibt man nicht sein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ab. Gleichwohl versucht der Arbeitgeber häufig, über § 79 des Betriebsverfassungsgesetzes – die Geheimhal-tungspflicht – einen Riegel vorzuschieben. Ich bin der Meinung:
TIMM BoSSMann, Jahrgang 1966, ist Betriebsrat bei der Augsburger Verlagsgruppe Weltbild. Nach einer Ausbildung zum Tageszeitungs-Redakteur bei der „Wolfsburger Allge-meinen Zeitung“ studierte er Germanistik, Philosophie und Psychologie, arbeitete als Werbetexter und Buchautor. Mit weltbild-verdi.blogspot.de startete er 2009 gemeinsam mit Kollegen eines der ersten gewerkschaftlichen Blogs. Seit-dem berät er auch Betriebsräte und Gewerkschaftsaktive in Sachen Öffentlichkeitsarbeit mit Internetmedien. www.textarbeiter.de
zur perSon
InTervIew Timm Boßmann, Betriebsrat bei der Verlagsgruppe Weltbild, über strategische Kommunikation im Internet und den Bedeutungs-zuwachs gewerkschaftlichen Bloggens
Das Gespräch führten joHanneS SCHulTen und jÖrn Boewe.
„Blogs machen unsere Arbeit einfacher“
Foto
: pri
vat
16 Mitbestimmung 11/2014
Schlechte Arbeitsbedingungen sind keine Geschäftsgeheimnisse, darüber sollte man also bloggen. Man muss es ja nicht in der Funk-tion als Betriebsrat tun.
Was schlagen Sie stattdessen vor? Ich empfehle, die Blogs unter der Gewerkschaftsflagge laufen zu lassen, wie wir es etwa bei weltbild-verdi.blogspot.com machen. Da kann zusätzlich zur Meinungsfreiheit auch der Artikel 9 des Grund-gesetzes, das Grundrecht auf Koalitionsfreiheit, gezogen werden. Gemeinsam mit der Gewerkschaft kann man so auch Angriffe auf Blogs, so sie denn stattfinden, verhindern. Der Betriebsrat diskutiert mit dem Arbeitgeber gar nicht über das Blog, sondern verweist an die Gewerkschaft, die allein für das Blog verantwortlich ist.
Darf ein Betriebsrat während seiner Arbeitszeit bloggen? Der Betriebsrat macht grundsätzlich in der Betriebsratsarbeit keine direkte Gewerkschaftsarbeit. Unsere Betriebszeitung, den „Ticker“, erstellen wir als Öffentlichkeitsausschuss des Betriebsrates während der Arbeitszeit. Das Blog dagegen wird von einer Redaktion aktiver Gewerkschaftskollegen ehrenamtlich in der Freizeit gemacht. Wir halten das getrennt.
Kann ein Blog eine Betriebszeitung oder das Schwarze Brett im Betrieb ersetzen? Auf keinen Fall. Das wichtigste Kommunikationsmittel ist das per-sönliche Gespräch. Auch eine Zeitung ist vor allem ein Anlass, auf Leute zuzugehen. Richtig spannend wird es, wenn wir miteinander reden. Wie das Internet wirken kann, hat natürlich viel mit der Betriebsstruktur zu tun. Unser Blog wird viel von den Angestellten ge-lesen, von den Kollegen im Lager- und Versandbe-reich weniger – auch weil sie nicht durchgehend online sind. In anderen Betrieben ist ein Blog eine sehr gute Möglichkeit, die Grenzen einer Zeitung zu überwinden. Etwa im Einzelhandel, da liegen die einzelnen Fili-alen weit auseinander. Ein gemeinsames Blog ist dann häufig die einzige umfassende Informationsquelle – besonders in Betriebsteilen ohne Betriebsräte. Die ver.di-Blogs bei OBI oder dem Gartencenter Dehner werden sehr gut angenommen.
Sie verwenden häufig den Begriff „strategische Kommunikation“. Was ist damit gemeint? Der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick hat mal for-muliert: „Man kann nicht nicht kommunizieren“, wir kommuni-zieren also immer. Jede Äußerung steht im Zusammenhang mit politischen Zielen. Ich will andere Gewerkschafter dafür sensibili-sieren, zielgerichteter zu kommunizieren und Kommunikation dazu zu nutzen, ihre Interessen durchzusetzen. Neben dem klassischen Streik ist gute, zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit mit das schärfste Schwert in der Waffenkammer einer Gewerkschaft.
Haben Sie ein Beispiel? Etwa indem wir schlechte Arbeitsbedingungen öffentlich machen. Das wirkt gleich auf die Marke des Arbeitgebers, da entsteht gleich Druck, die Missstände zu beheben. Mit einem Blog haben wir die Möglichkeit, uns direkt an die Medien zu wenden. Und das stößt auf Interesse. Meiner Erfahrung nach recherchieren Journalisten gerne in Blogs. Anders als die gestelzten Pressemitteilungen, die mitunter von Gewerkschaften rausgegeben werden, haben die In-formationen dort eine hohe Authentizität.
Von welchen Themen sollten Gewerkschaftsblogger lieber die Fin-ger lassen?Prinzipiell kann man über alles berichten. Die Grenze ziehe ich bei Persönlichkeitsrechten des Einzelnen, sowohl der Kollegen als auch der Vorgesetzten. Zu schreiben: „Der Vorgesetzte Meyer verdient 100.000 Euro im Jahr“ – das geht nicht. Sehr wohl darf aber ge-schrieben werden: „Im Schnitt verdienen die Führungskräfte bei der Firma X im Jahr Y Prozent mehr als der normale Arbeitnehmer.“ Gleiches gilt für Beleidigungen, etwa in Kommentarspalten: So etwas muss gelöscht werden.
Das klingt zeitaufwendig. Finden sich dafür genug Kollegen? Ich empfehle immer, eine Blog-Redaktion zu gründen. Mit drei, vier Leuten, die verlässlich mitarbeiten. Wir bei Weltbild treffen uns einmal im Monat für eine Dreiviertelstunde und überlegen, was die Themen im Betrieb sind. Wir haben zwei Beiträge pro Woche, das
reicht. Jeder und jede schreibt also ein bis zwei Artikel im Monat. Das kann man leicht mal abends machen.
Gibt es ausreichend Schulungsangebote für Kolleginnen und Kol-legen, die sich hier engagieren wollen? Die Bildungsträger trauen sich noch nicht richtig an das Thema heran. Ich glaube, weil sie die technischen Hürden überschätzen. Aber im Prinzip ist alles sehr einfach. Schulungsbedarf liegt vielmehr bei den Schreibfertigkeiten. Viele Leute tun sich mit dem Schreiben schwer. Wie baue ich einen Artikel sinnvoll auf? Wie bringe ich meine Anliegen in einer klaren und verständlichen Sprache rüber? Schreiben ist ein Handwerk, das kann jeder lernen. Es gibt ein paar Regeln, wenn man die beherzigt, kommt etwas raus, das gern gele-sen wird. Da, denke ich könnte, man mehr machen. ■
„Neben dem Streik ist gute Öffentlichkeits-arbeit das schärfste Schwert in der Waffen-kammer einer Gewerkschaft.“
17Mitbestimmung 11/2014
TITEL
MeDIenTraInIng
von der schreibwerkstatt zur Bloggerschulung Kollektiv betriebene Blogs oder facebook-Gruppen werden in der Interessenvertretung immer beliebter. Bildungsangebote der Gewerkschaften vermitteln Know-how. Die nächsten Termine – eine Auswahl:
„oHne DIe BelegSCHafT geHT nIx – KreaTIve ÖffenTlICHKeITSarBeIT
IM BeTrIeBSraTSallTag“
4.–6. Februar 2015 in Münsterhttp://bit.ly/13zo7M8
„wIr SInD DrIn! BlogS, faCeBooK & TwITTer fÜr DIe InTereSSen-
verTreTung“
30. September – 2. Oktober 2015 in Weselhttp://bit.ly/1tzq1pv
DgB-BIlDungSwerK arBeIT unD leBen
ver.DI
Ig MeTall
Ig BCe
Ig Bau
„von MeDIenprofIS lernen. BeTrIeBlICHe ÖffenTlICHKeITSarBeIT
eInfaCH unD wIrKungSvoll geSTalTen“
15.–17. Dezember 2014 im ver.di-Bildungszentrum Mosbachhttp://bit.ly/1oa6Hpb
„MeHr präSenz IM BeTrIeB SCHaffen! STraTegISCHe ÖffenTlICH-
KeITSarBeIT fÜr DIe geSeTzlICHe InTereSSenverTreTung“
15.–19. Dezember 2014 im ver.di-Bildungszentrum Brannenburghttp://bit.ly/1yQq3K2
„weB 2.0: SoCIal MeDIa fÜr DIe perSonalraTSarBeIT unD alS
BeTrIeBlICHer regelungSgegenSTanD“
27.–29. Mai 2015 im ver.di-Bildungszentrum Berlin-Wannseehttp://bit.ly/1pgQ8Bu
„ÖffenTlICHKeITSarBeIT 2.0: KoMMunIKaTIon polITISCHer unD
BeTrIeBlICHer THeMen MITHIlfe von vIDeoClIpS“
31. August – 4. September 2015 im ver.di-Bildungszentrum Walsrodehttp://bit.ly/1yQqa8o
„weB 2.0 unD SoCIal MeDIa fÜr DIe InTereSSenverTreTung“
25.–27. November 2015 im ver.di-Bildungszentrum Brannenburghttp://bit.ly/1a4Cuq1
„jav-SpezIal: faCeBooK & Co. In BeTrIeB unD DIenSTSTelle“
11.–13. Mai 2015 im ver.di-Bildungszentrum Naumburghttp://bit.ly/1ed2aQ2
„MeDIen, MeInungen, ManIpulaTIon“
10.–15. Mai sowie 25.–30. Oktober 2015 im IG-Metall-Bildungszentrum Sprockhövel
„lernen auS Der praxIS profeSSIoneller MeDIen fÜr DIe arBeIT
IM BeTrIeB“
18.–23. Januar 2015 im IG-Metall-Bildungszentrum Sprockhövel
„BeTrIeBlICHe ÖffenTlICHKeITSarBeIT“
1.–6. März sowie 14.–19. Juni 2015 im IG-Metall-Bildungszentrum Berlin
„SoCIal MeDIa, KoMMunIKaTIon unD polITIK“
27. September – 2. Oktober 2015 im IG-Metall-Bildungszentrum Sprockhövelhttp://bit.ly/10exujI
Wer schnell einen Tipp braucht, kann sich direkt an erfaHrene Blogger wenden, etwa an Norbert Lamm, der mit seinen Kolleginnen und Kollegen die Internetseite igmetall-schaeffler.de [email protected]. 0 91 32/82 43 74
Das Wilhelm-Gefeller-Bildungszentrum der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie bietet ein E-Learning-Seminar zum Thema „ÖffenTlICH-
KeITSarBeIT IM InTerneT – weBSeITen geSTalTen“ an. Hier kann man von zu Hause aus über das Internet die Erstellung attraktiver Webseiten erler-nenhttp://bit.ly/1DrSrmB
In Arbeit ist ein Leitfaden zum Umgang mit Internetmedien:http://bit.ly/1tTcyzx
Mit ihrer „BloggerSCHulung“ wendet sich die IG BAU an hauptamtliche sowie ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen, die sich auf dem Aktivenblog wir-bauen-fuers-leben.de beteiligen wollen. Aktuell finden zwar keine Schulungen statt, Interessierte können sich bei Bedarf jedoch an den stell-vertretenden Bundesvorsitzenden Alexander Reise wenden:[email protected]. 0 69/95 73 76 07
18 Mitbestimmung 11/2014
Professionell und unbequem
BeTrIeBSzeITungen Sie sind eine spezielle Form des Journalismus: Betriebszeitungen müssen den Spagat beherrschen zwischen der Loyalität zum Unternehmen und dem
Selbstverständnis, im Interesse der Beschäftigten Missstände aufzudecken.
Von SuSanne KaIlITz, Journalistin in Dresden
SCHICHTweCHSel uM 6 uHr, MerCeDeS-werK MeTTIngen, Tor 1: Betriebsrat Ralf Eibner (m.), André Kaufmann und Jordana Vogiatzi (IG Metall Stuttgart) verteilen den neuen „ScheibenWischer“.
Foto
: Cir
a M
oro
19Mitbestimmung 11/2014
TITEL
Im aktuellen „ScheibenWischer“ geht es um die großen wie die kleinen Sachen: Die Forderungen der IG Metall für die Tarif-verhandlungen 2015 werden in der Oktober-Ausgabe der Be-triebszeitschrift für die 23 000 Beschäftigten des Mercedes-
Benz-Werkes in Untertürkheim ebenso thematisiert wie die Tatsache, dass die Leute seit Wochen auf dem Anlieferstreifen vor dem Werks-tor Hedelfingen parken, weil der Parkplatz gesperrt ist. Das aber, so schreibt der Autor, führe zu lebensgefährlichen Situationen für alle, die das Werk betreten oder verlassen und sich dafür zwischen parkenden Lkw durchschlängeln müssen. Man möge also bitte die Ausweichparkplätze benutzen, damit nicht die Lauffaulheit einiger Mitarbeiter das Leben anderer gefährde.
Der „ScheibenWischer“ tut damit genau das, was eine gute Be-triebszeitung ausmacht: Er ist nah dran an der Belegschaft und greift auf, was die Leute bewegt – von Tarifverhandlungen bis Parkplatz-problemen.
DIe zeIT Der BleIwÜSTen IST vorBeI_ Bis zu 2000 Mitarbeiter-zeitungen mit einer Auflage von bis zu zehn Millionen Exemplaren gebe es in Deutschland, schätzt Christian Cauers. Der Medienwis-senschaftler hat sich mit dieser speziellen Form der Presseerzeug nisse befasst und dazu die Studie „Mitarbeiterzeitschriften heute“ vorge-legt, die inzwischen in der zweiten Auflage erschienen ist. Allerdings hat er in seiner Untersuchung nicht unterschieden zwischen den Mitarbeiterzeitungen, die vom Unternehmen herausgegeben werden, und denen, die von Betriebsrat oder Gewerkschaften gefüllt werden.
Gleichwohl ist er sich sicher: „Die unprofessionellen Zeiten sind vorbei.“ Habe man früher Bleiwüsten mit wildem, selbst gebasteltem Layout in den Unternehmen verteilt, kämen die Betriebszeitungen heute deutlich hochwertiger daher. Dabei würden sich die einzelnen Zeitschriften aber stark voneinander unterscheiden. „Die Bandbrei-te ist sehr, sehr groß. Im hochtechnologischen IT-Bereich sind die Publikationen tendenziell hochwertiger und magaziniger. Da geht es nicht um die schnelle tagtägliche Kommunikation, dafür werden Intranet und Newsletter genutzt. Wichtiger ist die Darstellung des Unternehmens und die Information über seine Produkte.“
Anders sei das etwa im produzierenden Gewerbe. „In Firmen, in denen 80 Prozent der Mitarbeiter in der Produktionshalle arbeiten, sind die Formate der Mitarbeiterzeitungen den Tageszeitungen ähn-licher und oft traditionsreicher. Auch erscheinen sie häufiger.“ Man sei dort inhaltlich näher dran an den Mitarbeitern. „Da geht es dann schon mal um den letzten Betriebsausflug.“
lange TraDITIon_ Unternehmenszeitungen existieren seit Ende des 19. Jahrhunderts, seit einzelne Arbeitgeber die Kluft zwischen sich und ihren Beschäftigten in den Betrieben überbrücken wollten. Die Mitarbeiterzeitschrift sei klar aus „patriarchalen Absichten“ entstanden, so Cauers. „Sie war der Versuch, so zu führen und zu
beeinflussen, wie man es in der Familie gewöhnt war.“ Dieses „au-toritäre Stigma“ seien die Publikationen in der Herausgeberschaft der Arbeitgeber lange nicht losgeworden.
Und so mancher Geschäftsführer würde sich diese Zeiten viel-leicht zurückwünschen, wenn er heutige Betriebszeitschriften auf-schlägt. Kai Bliesener, selbst Mediendesigner und von 2004 bis Mitte 2013 Pressesprecher der IG Metall Baden-Württemberg sowie von 1998 bis 2004 verantwortlicher Redakteur des „ScheibenWi-schers“, erinnert sich jedenfalls gut daran, dass an manchen Erschei-nungstagen „die Geschäftsleitung sichtbar aufgescheucht war“. Vor allem dann, wenn das Blatt sich Missständen wie etwa dem Arbeits-zeitverfall oder bestimmten Arbeitsbelastungen gewidmet habe: „Da gab es dann auch mal rasch einberufene Sondersitzungen auf Ar-beitgeberseite, die sich mit einzelnen Beiträgen im ScheibenWischer befassten“, erzählt er. „Das war für uns immer ein gutes Zeichen, denn wir konnten uns sehr sicher sein: Das wird gelesen. Und zwar im ganzen Unternehmen. Das hat der Redaktion sehr geholfen, die Bedeutung und die Akzeptanz des ScheibenWischers auf allen Seiten zu verbessern.“
Auch Timm Boßmann, gelernter Journalist und Betriebsrat bei Weltbild, wird immer mal wieder von den Chefs gefragt, „ob das nun wieder sein musste. Wir sagen dann: Ja, das musste sein. Und dann ist die Sache eigentlich durch.“ Boßmann ist Kopf der Weltbild-Betriebsratszeitung „Picker“. Schon deren Name ist Programm: Die Picker sind diejenigen, die die Produkte zusammensuchen, die dann versendet werden – ohne sie kann kein Paket das Lager verlassen. „Damit wollten wir die Geschäftsführung immer wieder daran er-innern, wer den Laden eigentlich am Laufen hält. Und natürlich geht es auch darum, zu piksen und dem Arbeitgeber immer wieder den einen oder anderen Nadelstich zu versetzen.“
Grund dafür gab es bei Weltbild in den vergangenen Jahren im-mer wieder: Lange war unklar, was aus dem insolventen Unterneh-men werden sollte. Seit diesem Sommer gibt es eine neue Geschäfts-leitung, viele Fragen dazu, wie es für die Mitarbeiter weitergehen soll, sind noch offen. Während es für die tagesaktuellen Informati-onen einen Blog gibt, liefert der „Picker“ in seinen gedruckten Aus-gaben Hintergrundinformationen.
Insgesamt sind die Macher der Betriebszeitungen im Lauf der Jahre immer professioneller geworden, auch dank leicht verfügbarer Layout-Programme und Kollegen, die in Sachen Computerbedie-nung immer versierter sind. Der „ScheibenWischer“ etwa ist inzwi-schen ein ziemlich umfangreiches Projekt: Er erscheint acht- bis zehnmal pro Jahr mit etwa zwölf Seiten und einer Auflage von 12 000 Exemplaren. Betreut wird er von Jordana Vogiatzi, IG-Metall- Pressesprecherin in Stuttgart und zuständig für die Öffentlichkeits-arbeit in den Betrieben in ihrem Bezirk. Die „ScheibenWischer“-Redaktion legt die Themen fest, Vogiatzi unterstützt beim Layout oder bei der Bildersuche und gibt das Ganze schließlich an Layouter
20 Mitbestimmung 11/2014
und Drucker weiter. Zehn Betriebszeitungen gebe die IG Metall in ihrem Verwaltungsbezirk heraus, sagt sie, „das ist schon eine Haus-nummer“.
Vogiatzi ist noch immer begeistert über diese besondere Form des Journalismus, die sie mit den Betriebszeitungen betreibt. „Das macht einfach großen Spaß. Man hat ganz eng mit den Leuten aus dem Betrieb zu tun und erfährt, welche Themen die Menschen dort gerade bewegen. Für diese Zeit-schriften engagieren sich Beschäftigte, die große Lust am Schreiben haben und sich dafür begeistern.“ Da sie aber dennoch Laien sind, tun sich gelegentlich Baustellen auf, die es in anderen Redaktionen so wohl nicht gibt. „Ich muss immer wieder auf das Problem der Bildrechte aufmerksam machen“, sagt die IG-Metallerin. „Man kann eben auch noch so schöne Fotos nicht als Titelbild verwenden, wenn unklar ist, wer die Quelle ist. Unsere Autoren haben in der Regel keine journalistische Ausbildung. Das ist auch der Grund, warum die IG Metall Stuttgart journalistische Seminare für Betriebsräte und Vertrauensleute anbietet.“
puBlIzISTISCHer zwITTer_ Rein formal gelten Betriebszeitungen als publizistische Sonderform, die sowohl dem Presserecht als auch dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegen, wonach die Mitglieder des Betriebsrats zum Wohle der Beschäftigten wie des Unternehmens zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung verpflichtet sind. Als Zwitter aus Betriebs- und Presseorgan haben sie deshalb eine spezielle Art zu arbeiten – im Spagat zwischen der Loyalität zum Unternehmen und der Aufgabe, auf Missstände auf-merksam zu machen. „Das lässt sich auch nicht auflösen“, sagt Medienwissenschaftler Cauers. „Die Redaktion einer Betriebszei-tung wird niemals investigativ arbeiten – egal, ob das Unternehmen oder die Gewerkschaft die Kosten dafür trägt.“
Dass man dennoch mutig sein müsse und sich nicht selbst einen Maulkorb anlegen dürfe, davon ist Timm Boßmann, dessen Zeitung vom Unternehmen bezahlt wird, überzeugt. „Auch wenn es unzäh-lige Urteile zu vermeintlichen Betriebsgeheimnissen gibt – nach dem Betriebsverfassungsgesetz hat eine Betriebszeitung die Aufgabe, die Belegschaft zu informieren; auch über Dinge, die die Geschäftslei-tung gern unter dem Teppich halten würde.“ Einfacher hätten es da die Zeitschriften, deren Kosten die Gewerkschaften tragen, die dann auch presserechtlich verantwortlich zeichnen, so Kai Bliesener, der auch Mitherausgeber eines „Handbuch Medien machen“ ist. „Da muss man nicht allzu viele Rücksichten nehmen, wenn es darum geht, Missstände anzusprechen.“
Auch muss Ärger wegen eines Artikels nicht in jedem Fall schlecht sein: So habe man vor einigen Jahren einmal eine Gegendarstellung drucken müssen, erzählt Jordana Vogiatzi. „Da ging es um den
geplanten Verkauf von Flächen an einem Standort, und es wurde über die Gründe spekuliert. Da war von mangelnder Kommunika-tion der Geschäftsleitung mit dem Betriebsrat die Rede. Mit der Gegendarstellung haben wir dann genau das erreicht, was wir woll-ten, nämlich eine deutliche Klarstellung. Für die Leute. Und das war richtig gut.“
Damit das gelingt, brauchen die Redaktionen einen guten Draht in die Belegschaften und ein Gefühl für eine ausgewogene Berichter-stattung. „Wenn wir einen Aufmacher haben, der vor allem unsere Angestellten betrifft“, so Boßmann über den „Picker“, „dann muss auf der nächsten Seite etwas kommen, das für die Leute aus dem Lager und dem Versand spannend ist.“ Für Menschen außerhalb des Betriebs wären das häufig Lappalien. „Aber wenn in Halle 3 die Hebebühne seit drei Wochen defekt ist und alle Rückenschmerzen haben, dann treibt das den Blutdruck intern hoch. Und das müssen wir berichten.“
Beim „ScheibenWischer“ in Untertürkheim setzt man auf das Prinzip der namentlichen Kennzeichnung der Artikel. Die Autoren, meist Betriebsräte, geben auch an, wie sie für die Mitarbeiter er-reichbar sind. „Dann wissen die Leute, an wen sie sich wenden können, wenn sie mehr über ein Thema wissen wollen“, sagt Blie-sener. Die Arbeitnehmervertreter werden dann direkt angesprochen, wenn sie die Zeitung verteilen. „Das machen die Kollegen persönlich am Tor, das bringt eine ganz starke Verbundenheit.“ ■
Kai Bliesener/Eli Eberhardt/Jochen Faber/Jordana Vogiatzi (Hrsg.): HanDBuCH MeDIen MaCHen. Für engagierte Leute in Gewerk-schaften, Betriebsräten, Non-Profit-Organisationen. Marburg, Schüren Verlag 2011
mehr informationen
„Für Betriebszeitungen engagieren sich Beschäftigte, meist Betriebsräte, die große Lust am Schreiben haben und sich dafür begeistern.“
JORDANA vOGIATZI, IG-mETALL-PREssEsPREchERIN, sTUTTGART
21Mitbestimmung 11/2014
TITEL
Den Wahnsinn steuernBeTrIeBSraTSKoMMunIKaTIon Weltkonzerne wie die Daimler AG stehen unter permanenter medialer Beobachtung. Wie können sich das der Betriebsrat und seine Öffentlichkeitsarbeiter strategisch zunutze machen?
Von SIlKe ernST, Pressesprecherin des Gesamtbetriebsrats der Daimler AG
Foto
s: C
hris
tina
So
lvei
g Sc
hmid
t; B
ahti
yar
Kar
atas
22 Mitbestimmung 11/2014
Eine sichere Quelle sagt mir, dass es ein neues Milliarden-Sparprogramm bei Daimler geben wird. Will der Gesamt-betriebsratsvorsitzende das kommentieren?“ Die Spreche-rin des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden hört die Frage
eines gewöhnlich gut informierten Wirtschaftsjournalisten im Auto über die Freisprechanlage und hasst es, morgens vor acht schon wie der Depp des Tages auszusehen. „Weiß ich nicht. Kenne ich nicht“, antworte ich. Den Rest der Fahrt ins Büro in Untertürkheim hänge ich am Telefon. Weder mein gewöhnlich gut informierter Chef Mi-chael Brecht noch der Daimler-Pressebereich kennen das Thema. Später heißt es offiziell: Das laufende Effizienzprogramm „Fit for Leadership“ wird fortgesetzt – kein neuer Name, keine Verkündung neuer Zielzahlen. Dass Unternehmen ihre Effizienz verbessern und Kosten senken, ist in etwa so überraschend wie Nebel im November. Das wird erst sexy, wenn es dazu fantasievolle Zahlen und Pro-grammtitel gibt.
Egal, die Meldung steht schnell im weltweiten Netz und am nächs-ten Tag in der Zeitung – andere Blätter legen nach: Sie verkünden andere Zahlen und behaupten, bei Daimler stünden Arbeitszeitver-längerung und Lohnkürzungen im Raum. Das hätte ihm jemand aus dem Management erzählt, sagt mir der Journalist. Im Namen von Michael Brecht dementiere ich in aller Klarheit: Warum sollte der Gesamtbetriebsrat über so etwas verhandeln? Zumal in einer Zeit, in der Daimler gerade eine Rekordmeldung nach der anderen versendet. Absurd. In der Zeitung und im Netz steht’s trotzdem. Es gibt Nachfragen besorgter Kollegen. Das Dementi wird dann auch breit gedruckt. Die Öffentlichkeitsarbeiter in der Daimler-Presse-stelle und ich haben erfüllte Tage. Auf Google News findet man am Ende der Woche mehrere Hundert Meldungen zum Thema. Die Aufregung legt sich. Daimler und die Medien – ein Wahnsinn.
Es ist meine Aufgabe, diesen Wahnsinn weitgehend abzufangen, bevor er die politischen Entscheider trifft. Im Idealfall gelingt es mir, ihn zu kanalisieren und in die aus Sicht des Gesamtbetriebsrats rich-tige Richtung zu steuern. So verstehe ich professionelle Pressearbeit.
MeDIal erzeugTer DruCK IST HIlfreICH_ Das war beim Daimler-Gesamtbetriebsrat früher einmal anders: Karl Feuerstein, der 1999 verstorbene, legendäre Gesamtbetriebsratsvorsitzende, hatte seine Pressekontakte noch selbst gepflegt. Sein Nachfolger Erich Klemm erkannte allerdings rasch, wie tief greifend sich die Presse- und Me-dienlandschaft verändert und wie stark Daimler samt seiner Mitbe-stimmungsgremien im Fokus des Medieninteresses steht. Er setzte durch, dass er offiziell eine Pressesprecherin und ich eine erweiterte Funktion bekam. Bis dahin hatte ich als Referentin für das Sindel-finger Gremium an Konzepten und Vereinbarungstexten gefeilt und die interne Kommunikation mit aufgebaut. Der Medien-Hype, den die Auseinandersetzung um die Zukunftssicherung für die Daimler-Belegschaften im Jahr 2004 auslöste, räumte letzte Zweifel an der Notwendigkeit dieser Stelle aus. Der Kampf gegen die Erpressungs-versuche des Vorstands und für eine langjährige Beschäftigungssi-cherung („Zukunftssicherung 2012“) wurde nicht nur am Verhand-lungstisch und vor den Werkstoren entschieden, sondern zu einem gewichtigen Teil auch durch den medial erzeugten Druck.
Über einen Mangel an Arbeit und neuen Impulsen kann ich bis heute nicht klagen. Externe und interne Kommunikation des Ge-samtbetriebsrats sind inzwischen integriert – ich bin jetzt für beides verantwortlich. Und der Medien-Wahnsinn riss auch in diesem Jahr nicht ab. Dabei war das vermeintliche neue Sparprogramm aus der eingangs erzählten Episode nur ein Aufreger am Rande des Gesche-hens. Die echten Probleme für die Belegschaften und ihre Interessen-vertreter ergeben sich vor allem aus der Umsetzung der strukturellen Maßnahmen, mit denen der Vorstand seine Effizienzziele erreichen will: In diesem Jahr stemmen sich die Beschäftigten und Betriebsräte der Niederlassungen gegen den Verkauf von Betrieben; die Be-
proTeSTaKTIon IM DaIMler-werK unTerTÜrK-
HeIM, aprIl 2014; gBr-vorSITzenDer MICHael
BreCHT MIT preSSeSpreCHerIn SIlKe ernST: „Die Kommunikation berät die Politik, sie macht sie nicht.“
23Mitbestimmung 11/2014
TITEL
legschaften der Werke stehen unter erheblichem Druck und ringen gemeinsam mit ihren Betriebsräten um Teilhabe an der Wachstums-strategie. Senkung der Fertigungstiefe, Fremdvergabe indirekter Tä-tigkeiten wie der Logistik, Verlagerung von Verwaltungstätigkeiten in Shared-Service-Center, Bau neuer Werke im Ausland, Milliarden-investitionen im Inland – die Daimler-Welt ist in Bewegung, und alles findet öffentlich statt, quasi vor laufender Kamera.
Beschäftigte und Medien fordern Information und Reaktion vom Betriebsrat. Ein großer Teil der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit findet vor Ort in den betroffenen Werken und Niederlassungen statt – meist in enger Zusammenarbeit mit der IG Metall. Überregionale Medien, Nachrichtenagenturen und alle Journalisten, die eine Ge-samteinschätzung der Lage aus Sicht der Arbeitnehmervertretung beim Daimler hören wollen, rufen aber in der Regel erst mal bei mir an. Ich organisiere und begleite Hintergrundgespräche und Inter-views mit dem GBR-Vorsitzenden, versende Presseinformationen, formuliere Sprachregelungen, spreche mit den Akteuren vor Ort und vermittle, erkläre, werbe ununterbrochen am Telefon und im persönlichen Gespräch mit Journalisten. Damit die Informationen und Positionen des Gesamtbetriebsrats bei der Belegschaft direkt und nicht nur über die externen Medien ankommen, sind zeitgleich Redetexte und Artikel für diverse Print- und Onlinemedien der In-teressenvertretung zu schreiben. Meine Kolleginnen und Kollegen in der Stabsabteilung des Gesamtbetriebsrats unterstützen mich dabei inhaltlich. Manchmal denke ich darüber nach, wie viele Be-schäftigte in der Presseabteilung des Unternehmens, im Bereich In-terne Kommunikation, beim Redenschreiber-Pool und in den Vor-standsbüros an Kommunikationsthemen arbeiten. Dazu habe ich aber nie lange Zeit. Glücklicherweise hat sich seit Anfang dieses Jahres eine neue Kollegin der Frage der Gestaltung unserer Medien angenommen und unter anderem ein tragfähiges „Corporate De-sign“ für den Gesamtbetriebsrat entwickelt.
TeIl Der unTerneHMenSKoMMunIKaTIon_ Durch den Dschun-gel der Fragen, Ansprüche, Aufträge, Einschätzungen und Meinun-gen, mit denen ich täglich konfrontiert bin, hilft ein enger Draht zum GBR-Vorsitzenden und eine klare strategische Ausrichtung der Kommunikation nach innen und außen. Diese orientiert sich natur-gemäß an den strategischen Zielen, die sich der Gesamtbetriebsrat gegeben hat. Unter anderem setzt der im April 2014 unter dem Vorsitz von Michael Brecht neu konstituierte Daimler-Gesamtbe-triebsrat explizit auf Transparenz, Präsenz, Dialog und Beteiligung. Daraus lassen sich nicht nur die Ausrichtung der Kommunikation, sondern auch konkrete Arbeitsaufträge ableiten. Mit der politischen Ziellinie des Gremiums vor Augen kann ich als GBR-Pressespreche-rin in Texten und im Gespräch Beschäftigten und Medien sicher Orientierung geben.
Eine klare strategische Ausrichtung vereinfacht auch die Zusam-menarbeit der Betriebsratskommunikation mit der Pressestelle und der Internen Kommunikation des Unternehmens – Reaktionen kön-
nen abgeschätzt, Konflikte zum Teil vermieden werden, auf andere ist man vorbereitet. Ob und wie diese Zusammenarbeit funktioniert, ist eine entscheidende Größe für die Qualität des öffentlichen Auf-tritts beider Seiten. Die Frage, ob die Betriebsratskommunikation Teil der Unternehmenskommunikation ist, kann nämlich schnell beantwortet werden: Natürlich ist sie das! Das Bild vom Unterneh-men in den Medien und in der Belegschaft zeichnen beide Seiten – das Bild vom Betriebsrat übrigens auch.
In der Pressestelle und der Internen Kommunikation des Unter-nehmens sitzen Kolleginnen und Kollegen, deren konkreter Arbeits-auftrag bisweilen anders aussieht als meiner. Es sind aber auch Arbeitnehmer, die gerne wissen, wann ihr Feierabend anfängt. Da-her begrüßen sie es, wenn ich ihnen sage, dass wir demnächst eine Presse- oder Mitarbeiterinformation rausschicken, die ihnen Arbeit machen wird. Das gilt andersherum natürlich genauso. Um unnö-tige Verwerfungen zu vermeiden, tauschen wir uns regelmäßig da-rüber aus, welche Themen gerade bewegt werden. Vereinbarungen, die Unternehmensleitung und Betriebsrat gemeinsam getroffen ha-ben, werden idealerweise auch gemeinsam kommuniziert – das schmückt beide Seiten gleichermaßen, und jede Seite kann ihre Be-wertung und Einschätzung abgeben. Gleichzeitig wird der Beleg-schaft und auch den Medien die Sicherheit vermittelt, dass es viel-leicht einen unterschiedlichen Blick auf die Regelung, aber keinen Interpretationsspielraum gibt. Schließlich wollen Beschäftigte und Journalisten wissen, was wirklich Sache ist.
waS guTe KoMMunIKaTIon leISTeT_ Das klingt nun alles nach guten Ratschlägen, und das ist auch genau das, was Kommunika-tion leisten kann. Die Kommunikation berät die Politik, sie macht sie nicht. Sie kann formulieren, wie Zielsetzungen und Entscheidun-gen des politischen Gremiums in der internen und externen Öffent-lichkeit ankommen werden. Sie kann Botschaften, Themen und gewählte politische Entscheider in internen und externen Medien positionieren, Kampagnen leiten, Beteiligungsprozesse und Veran-staltungen initiieren und organisieren. Aber: Sie setzt keine politi-schen Ziele, sie entscheidet nicht, sie wählt nicht und beschließt keine Aktionen – dafür hat sie kein Mandat. Beratung kann ange-nommen werden oder auch nicht. Wichtig ist, dass die Entscheider erkennen, dass ihre Politik durch die kommunikative Beratung bes-ser wird und so unmittelbar wie positiv bei den Menschen ankommt.
Damit sie diese Qualität hat, braucht Kommunikation eine eige-ne Expertise. Sie muss wissen, wann und wie die Medien – von Flugblatt und Betriebsratszeitung über die eigene Internet- und Fa-cebookseite bis hin zur Nachrichtenagentur – am besten bespielt werden. Vor allem aber braucht sie ein eigenes Netzwerk – von Medienvertretern, Öffentlichkeitsarbeitern in der Gewerkschaft und im Unternehmen, von Fachleuten innerhalb und außerhalb des Un-ternehmens, Betriebsräten, Gewerkschaftssekretären und möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen. Dann kann Kom-munikation gelingen – selbst die zu den Aufregern am Rande. ■
24 Mitbestimmung 11/2014
Weil der Aufsichtsrat kein Geheimrat ist
verSCHwIegenHeITSpflICHT Aufsichtsratsmitglieder unterliegen einer umfassenden Verschwiegenheitspflicht. Wenn sie sich trotzdem gegenüber Betriebsrat, Belegschaft oder gar
der breiten Öffentlichkeit äußern wollen, müssen sie vorsichtig sein – und kreativ.
Von joaCHIM f. Tornau, Journalist in Kassel
preSSeKonferenz von „Mr. opel“ KlauS franz, 2009: „Den Rest können sich die Kollegen dann selbst zusammenreimen.“
Foto
: Tor
sten
Silz
/ddp
25Mitbestimmung 11/2014
TITEL
Geht es nach den Buchstaben des Gesetzes, dann brauchen Aufsichtsratsmitglieder vor allem eine Stärke: Sie müs-sen schweigen können. Dürfen keine Betriebsgeheim-nisse ausplaudern, keine vertraulichen Informationen
preisgeben. Sonst droht nicht nur der Verlust von Mandat und Ar-beitsplatz, sondern auch Schadenersatzforderung oder gar Strafver-folgung. Geht es dagegen nach Klaus Franz, dann braucht, wer für die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat eines Unternehmens sitzt, ganz andere Qualitäten: „Eine der wichtigsten Kompetenzen ist die kommunikative“, sagt der 62-Jährige. Gewonnene Erkenntnisse müsse man für die Beschäftigtenvertretung nutzen – und auch wei-tergeben. „Wer das nicht tut, ist Geheimrat statt Aufsichtsrat.“
Klaus Franz weiß, wovon er spricht. Bis Ende 2011 war er der oberste Arbeitnehmervertreter bei Opel und General Motors Europe, führte den Gesamtbetriebsrat und die europäische Beschäftigtenver-tretung an und fungierte als stellvertretender Vorsitzender des Auf-sichtsrats. Und: Er schwieg nicht. Im Gegenteil: Als der Rüsselshei-mer Autobauer nach der Jahrtausendwende von Krise zu Krise stolperte und sich immer neue Manager die Klinke in die Hand gaben, war kein Opelaner so medienpräsent wie er. Er trommelte für die – letztlich gescheiterte – Trennung vom US-amerikanischen Mutterkonzern, warb bei der Bundesregierung um staatliche Beihil-fen und nahm auch in der Öffentlichkeit nie ein Blatt vor den Mund. Nicht zu Unrecht wurde ihm deshalb das Etikett „Mr. Opel“ ange-heftet.
verTraulICHKeIT MaCHT SInn_ Doch wie verträgt sich das mit der Verschwiegenheitspflicht, der Klaus Franz als Vize-Aufsichts-ratschef unterlag? Zunächst einmal: Es ist nicht pauschal alles ge-heim, was bei einer Aufsichtsratssitzung besprochen wird. „Was
vertraulich ist und was nicht, ist immer eine Einzelfallentscheidung“, erklärt Lasse Pütz, Wirtschaftsrechtler der Hans-Böckler-Stiftung. Und diese Entscheidung treffe nicht der Vorstand oder der Aufsichts-ratsvorsitzende nach eigenem Gutdünken. Vielmehr müsse das Un-ternehmen ein objektives und überprüfbares Interesse an der Ge-heimhaltung haben. Das heißt: Es muss um Informationen gehen, deren Weitergabe dem Unternehmen schaden könnte und die bis dato nur einem kleinen Kreis von Eingeweihten bekannt sind. Oder es muss sich – bei börsennotierten Unternehmen – um Insiderinfor-
mationen handeln. „Was schon in der Zeitung stand, kann aber nicht mehr als vertraulich gelten“, sagt Pütz.
Konkret heißt das: Über technische Entwicklungen, Kundenlis-ten, bevorstehende Akquisitionen, geplante feindliche Übernahmen oder Personalentscheidungen zu reden ist in der Regel tabu. Und auch beim Berichten über eine Aufsichtsratssitzung ist Vorsicht ge-boten: Weil die Beratungen vertraulich sind, dürfen Diskussionen nicht im Detail wiedergegeben werden. Das eigene Abstimmungs-verhalten – oder das der Arbeitnehmerbank insgesamt – zu offen-baren und zu begründen ist okay. Über die Haltung anderer Auf-sichtsratsmitglieder zu sprechen nicht.
Ein Maulkorb? Nein, sinnvoll, meint Pütz. „Die Vertraulichkeit ist ein enorm wichtiges Gut.“ Ohne sie würden Aufsichtsräte nicht mehr so gut informiert und eine offene Aussprache verhindert. „Des-halb halte ich auch nichts von öffentlichen Aufsichtsratssitzungen, wie das für kommunale Unternehmen mal vorgeschlagen war“, sagt der Experte der Hans-Böckler-Stiftung. „Dann gäbe es nur noch Schaukämpfe.“ Der Haken: Die Verschwiegenheitspflicht ist sehr umfassend. Nicht nur gegenüber Presse, Funk und Fernsehen gilt sie, sondern auch gegenüber der Belegschaft. Und selbst Betriebsrat und Wirtschaftsausschuss darf Vertrauliches nicht verraten werden – obwohl gerade die betriebliche Arbeitnehmervertretung auf früh-zeitige Information angewiesen ist, um rechtzeitig eigene Strategien oder Gegenmaßnahmen entwickeln zu können.
wIrTSCHafTSauSSCHuSS alS pfunD_ Was tun? „Man muss sich Wege suchen“, erklärt Pütz. „Der Wirtschaftsausschuss spielt da eine wichtige Rolle.“ Denn diesem Gremium, das in Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten der Unterrichtung des Betriebsrats über wirtschaftliche Fragen dient, muss der Vorstand Auskunft ge-
ben – und Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Hat nun beispielsweise ein Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat unter dem Siegel der Verschwiegen-heit erfahren, dass ein Standort des Unternehmens vor dem Aus steht, kann er als Mitglied des Wirt-schaftsausschusses in aller Unschuld fragen: „Sagen Sie mal, sind eigentlich gerade Werksschließungen geplant?“ Und was die Unternehmensführung dann berichtet, kann fortan nicht mehr unter die Ver-
schwiegenheitspflicht gegenüber dem Betriebsrat fallen. „Auch aus diesem Grund“, sagt der Wirtschaftsrechtler, „ist es sinnvoll, dass Betriebsräte im Aufsichtsrat sitzen.“
Klaus Franz sieht das ähnlich. Er habe seine Tätigkeit in den verschiedenen Mitbestimmungsorganen immer „cross-funktional“ verstanden, betont der ehemalige „Mr. Opel“. „Ich habe keinen Unterschied gemacht, welchen Hut ich gerade aufhatte.“ Auch nicht, wenn er sich an die Beschäftigten oder an die Öffentlichkeit wand-te: „Die hat es nie interessiert, ob ich gerade als Aufsichtsrat, als
„Eine gut lancierte Pressekampagne ist oftmals erheblich wirkungsvoller als eine dreistündige Arbeitsniederlegung.“
KLAUs fRANZ
26 Mitbestimmung 11/2014
Betriebsrat oder als europäischer Arbeitnehmervertreter spreche.“ Das Unternehmen allerdings interessierte das sehr wohl: Ganze De-tektivbüros, erzählt Franz, habe ihm General Motors auf den Hals gehetzt, um die verbotene Weitergabe brisanter Informationen nach-zuweisen. Vergeblich. Wie sich erwies, waren so viele Leute im Un-ternehmen an der Vorbereitung einer Aufsichtsratssitzung beteiligt, dass man die Indiskretion nicht einfach der Arbeitnehmerseite in die Schuhe schieben konnte.
Wenn Klaus Franz von seinen langjährigen Erfahrungen berichtet, erschließt sich schnell, warum er Kommunikationsfähigkeit für eine der wesentlichen Kompetenzen eines Aufsichtsrats hält: Es braucht Kreativität und Fantasie, wenn man Informationen weitergeben will, ohne die Grenzen des Erlaubten zu überschreiten. Als Beispiel bemüht auch Franz die geplante Werksschließung: „Im Betriebsrat rede ich dann nur von Veränderungen des Markts, von Überkapazitäten und von einer drohenden Reaktion des Managements.“ Den Rest könn-ten sich die Kollegen dann selbst zusammenreimen.
TruMpfKarTe ÖffenTlICHKeIT_ Und auch die Trumpfkarte der medialen Öffentlichkeit lasse sich, aller Verschwiegenheitspflicht zum Trotz, durchaus spielen: „General Motors hat einmal einen möglichen Vorstandsvorsitzenden ins Gespräch gebracht, den wir nicht akzeptiert haben“, erzählt Franz. Also habe man der Gegen-seite klargemacht: Ihr könnt uns überstimmen, aber dann dreht der Streit eine dreiwöchige Ehrenrunde durch den Vermittlungsaus-schuss – und es ist nie auszuschließen, dass währenddessen etwas an die Presse durchsickert. Damit sei das Thema vom Tisch gewesen. „Alternativ hätten wir aber auch ganz in die Offensive gehen und öffentlich einen eigenen Personalvorschlag machen können“, sagt das IG-Metall-Mitglied. „Es gibt vielfältigste Mittel.“
Böckler-Experte Lasse Pütz rät zur Vorsicht: Die Rechtsprechung in puncto Verschwiegenheitspflicht sei sehr streng, warnt er. „Sich als Aufsichtsratsmitglied an die Presse zu wenden, kann ich ehrli-
cherweise nur bei vorheriger rechtlicher Beratung empfehlen.“ Klaus Franz indes beherrschte das Spiel mit der Öffentlichkeit wie kaum ein Zweiter in seiner Funktion – und hat deshalb keine Bedenken, es weiterzuempfehlen: „Eine gut lancierte Pressekampagne“, findet er, „ist oftmals erheblich wirkungsvoller als eine dreistündige Ar-beitsniederlegung.“
pflICHT Der InTereSSenverTreTung_ Zu den Aufsichtsräten, die vor öffentlichen Stellungnahmen nicht zurückscheuen, gehört auch Johann Rösch. Der ver.di-Einzelhandelsexperte sitzt seit 2011 als Gewerkschaftsvertreter im Aufsichtsrat der angeschlagenen Wa-renhauskette Karstadt – und hat die halbherzigen Sanierungsversu-che von Investor Nicolas Berggruen, der im Sommer nach vier Jah-ren aufgab, stets kritisch begleitet. Auch in Interviews.
Für den 61-Jährigen war und ist der Gang an die Öffentlichkeit jedoch weniger strategisches Instrument als „Notwendigkeit“, wie er sagt. „Wenn Planungen oder Entscheidungen Auswirkungen auf die Arbeitsplätze oder das Einkommen der Kolleginnen und Kolle-gen haben, dann halte ich eine öffentliche Positionierung für ange-zeigt.“ Denn den lapidaren Pressemitteilungen, mit denen Unter-nehmen Aufsichtsratsbeschlüsse mitzuteilen pflegen, lasse sich zumeist nicht entnehmen, dass eine Entscheidung gegen die Stimmen der Arbeitnehmerbank zustande gekommen ist. „Dann halte ich eine Bewertung aus unserer Sicht für notwendig“, sagt Rösch.
Sich gegenüber Belegschaft oder Betriebsrat in Schweigen zu hül-len kommt für den Gewerkschafter erst recht nicht infrage. „Im Gegensatz zu den Kapitalvertretern werden die Vertreter der Arbeit-nehmer im Aufsichtsrat von den Beschäftigten gewählt“, erklärt er. „Daraus ergibt sich aus meiner Sicht eine besondere Verpflichtung der Interessenvertretung.“ Natürlich verrate er auch hier nichts über interne Diskussionen und Beratungen des Aufsichtsrats. Sondern spreche nur über Tatsachen, die die Interessen der Beschäftigten unmittelbar betreffen. Doch davon gebe es genug – etwa wenn es um die strategische Ausrichtung geht, um geplant Ausgliederungen oder zu geringe Investitionen. „Für Fehlleistungen des Managements haben nach meiner Erfahrung immer die Beschäftigten die Zeche gezahlt, nicht selten durch den Verlust ihres Arbeitsplatzes“, sagt der Karstadt-Aufsichtsrat. Daher sei es unerlässlich, die Kollegen über drohende Fehlentwicklungen zu informieren. Und sich gemein-sam dagegen zu wehren. ■
Roland Köstler: verSCHwIegenHeITSpflICHT. Hinweise zum praktischen Umgang. Arbeitshilfen für Aufsichtsräte, Heft 5. Düsseldorf, Hans-Böckler-Stiftung, 3. überarbeitete Auflage 2010. 35 Seiten. Download unter: www.boeckler.de/pdf/p_ah_ar_05.pdf
MeHr InforMaTIonen
Foto
: Pet
er F
risc
hmut
h
KarSTaDT-aufSICHTSraT joHann rÖSCH: Unerlässlich, die Kollegen über drohende Fehlentwicklungen zu informieren
27Mitbestimmung 11/2014
TITEL
Markus Rademacher war auf dem Weg vor die Fern-sehkameras. Aber das wusste er nicht. Eigentlich hatte er sich nur zu seiner Arbeit auf dem Flugha-fen Zweibrücken aufgemacht. Doch plötzlich hieß
es dort: Insolvenz! Reporter tauchten auf: „Wie geht es weiter mit dem Flughafen? Wie fühlt sich die Belegschaft? Welche rechtlichen Schritte plant die Arbeitnehmerseite?“ Solche Fragen setzten dem 24-Jährigen mächtig zu. „Ich wusste nicht, wo mir der Kopf stand, ich wurde überrannt“, sagt er. Erst zwei Monate zuvor war er zum Betriebsrat gewählt worden. Ohne Erfahrung musste er sich an vor-derster Kommunikationsfront behaupten.
Doch im Spiel mit der Öffentlichkeit lernte er schnell dazu. Heu-te, fast 100 Interviews später, klingelt sein Telefon noch immer re-gelmäßig. Journalisten wollen auf dem jüngsten Stand der Dinge gehalten werden. Betriebrat Rademacher geht gelassener damit um als früher. „Anfangs war ich im Gespräch zu ängstlich. Ich bin jetzt viel selbstsicherer. Das habe ich mir durch die ständige Praxis an-trainiert“, sagt er.
SKanDalISIeren HIlfT_ Rademacher ist nicht der einzige Arbeit-nehmervertreter, der die geballte Wucht der Medien spürt. Betriebs-
Wettlauf um AufmerksamkeitÖffenTlICHKeIT Arbeitnehmervertreter stehen zu-nehmend im Fokus der Medien – und stoßen auf viel Verständnis. Doch der Schritt ins Scheinwerferlicht will gut vorbereitet sein.
Von anDreaS SCHulTe, Journalist in Köln
räte und Gewerkschafter stehen in Interviews, bei Streiks oder im Tarifstreit immer häufiger im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Denn die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auf. „Wegen der sozialen Schieflage stoßen Arbeitnehmervertreter in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend auf Verständnis“, sagt Hans-Jürgen Arlt, Kommunikationswissenschaftler und bis 2003 Leiter der Öffent-lichkeitsarbeit beim DGB. Betriebsräte und Gewerkschaften nutzen das aus.
So wirbelte die Kampagne „Schwer für mehr“ der IG BCE wäh-rend der Tarifrunde 2014 mächtig Staub auf. Dazu stiegen Arbeit-nehmer an verschiedenen Orten in Deutschland in ihren Betrieben auf die Waage. Das Ziel: symbolisch die Verhandlungsmasse der Gewerkschaft zu steigern und an einer Stelle zu bündeln. Dazu rich-tete die Gewerkschaft eine Internetpräsenz ein. Dort ließ sich die Gewichtszunahme der Verhandlungsmasse jederzeit ablesen. Am Ende standen vier Millionen Kilo und ein großes Medienecho.
Derart kreative Aktionen sind für Gewerkschaften kein Neuland mehr. Die Zeiten des bloßen Protests sind vorbei. „Seit rund einem Jahrzehnt kommunizieren Gewerkschaften deutlich professionel-ler“, sagt Juri Maier, Geschäftsführer von Wegewerk. Die Berliner Agentur konzipiert und begleitet Kampagnen für den DGB und
28 Mitbestimmung 11/2014
KreaTIvITäT STaTT TrIllerpfeIfe_ Doch auch das geschlossene Auftreten einer Belegschaft garantiert öffentliches Interesse nicht. Laut Wohland bleiben betriebliche Konflikte oft unberücksichtigt, weil im Arbeitnehmerlager die Ressourcen für eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit fehlen. Zwar springen regionale Medien schnell auf einen Streit zwischen Chefs und Beschäftigten an, sagt Wohland. Um den Sprung in nationale Leitmedien wie etwa die „Süddeutsche Zeitung“ zu finden, müsse ein Konflikt aber rund ein halbes Jahr schwelen. Nur wenige Auseinandersetzungen dauern so lange. „Schon deshalb haben es betriebliche Konflikte schwer, überregional Beachtung zu finden“, sagt Wohland.
Experte Arlt empfiehlt Arbeitnehmervertretern daher, sich nicht nur auf Journalisten zu verlassen, sondern zusätzlich eigene Kanäle zu bedienen. Im Internet lässt sich über Blogs, Twitter und Facebook die Öffentlichkeit ungefiltert erreichen. Betriebsräte nutzen diese Medien zunehmend. Wie wichtig ein eigener Kanal sein kann, zeigt das Beispiel der Kölner Verlagsgruppe DuMont. Gewerkschaft und Betriebsräte betreiben dort einen gemeinsamen Blog. Das Thema: Die Entwicklung des Verlags, der bereits seit Jahren Arbeitnehmer-rechte zu beschneiden versucht und massiv Personal abbaut. Für die Arbeitnehmer ist dieser Blog die einzige Möglichkeit, die Kölner
ver.DI-aKTIon; KaMpagnen-BeraTer woHlanD; DgB-KaMpagne: „Wer mit der Presse spricht, sollte in Bildern sprechen.“
einige seiner Gewerkschaften. Das Ziel: „Kampagnen müssen für Verständnis sorgen“, sagt Maier. Dafür sucht seine Agentur einfache, bildhafte Vergleiche. So seilten sich bei einem Event des DGB zum Mindestlohn Aktivisten an Fassaden ab. Darunter war ein Sicher-heitsnetz gespannt, sinnbildlich für die soziale Funktion des Min-destlohns. Der Erfolg einer solchen Veranstaltung lässt sich leicht messen. „Je häufiger wir unseren Vergleich anschließend in der Presse wiederfinden, desto gelungener ist er“, sagt Maier.
Spektakuläre Kampagnen sind freilich nicht das tägliche Brot von Gewerkschaften. Nachrichten aus dem betrieblichen Alltag rei-chen in der Regel nicht aus, um von Redaktionen berücksichtigt zu werden. „Für viele Sender und Zeitungen steht die Produktion von Aufmerksamkeit im Vordergrund, Inhalte sind ihnen weniger wich-tig“, sagt Arlt. Arbeitnehmervertreter müssen daher skandalisieren.
Dabei hilft Ulrich Wohland, der unter anderem ver.di bei der Organisation von Kampagnen berät. „Die Skandalisierung beginnt im Betrieb – mit Plakatierungen, Buttons und Flugblättern“, sagt er. „Erst wenn dort eine stabile Meinung über den Konflikt herrscht, kann man den Schritt in die Öffentlichkeit wagen.“ Die Gefahr: Neue Aspekte der öffentlichen Diskussion können intern neuen Streit entfachen. „Das kann die Belegschaft spalten“, sagt Wohland.
Foto
s: F
lori
an S
chuh
/dpa
; Wo
lfga
ng R
olo
ff; S
imon
e M
. Neu
man
n
29Mitbestimmung 11/2014
TITEL
InTervIew
„Rampensau für das Gute“
Herr HÜCK, SInD SIe eIne raMpenSau? Ja, und das aus gutem Grund. Wenn man Interessen durchsetzen will, braucht man die Öffentlichkeit. Die erreicht man besser, wenn man, wie ich, mit Ecken und Kanten ausgestattet ist. Im Gegenzug kann man sich allerdings auch mal blaue Flecken holen.
HIlfT IHnen IHre erSCHeInung, In verHanDlungen unD Me-
DIengeSpräCHen parolI BIeTen zu KÖnnen? Enorm. Da kommt mir meine Statur sehr zugute. Es beeindruckt Gesprächspartner, wenn mit mir austrainierte 100 Kilo Thaiboxer im schönen Anzug in den Raum kommen. Ich kann Menschen wortwörtlich in den Schat-ten stellen. Dazu kann ich auch noch schwätzen. Diese Kombination ist selten.
nICHT jeDer Kollege HaT SolCHe vorauSSeTzungen. wel-
CHe fäHIgKeITen BrauCHT eIn BeTrIeBSraT, wenn er erST-
MalS InS MeDIale raMpenlICHT TrITT? Er darf keine Angst haben. Er darf nicht erschrocken sein. Und ihm muss klar sein: In dem Moment, in dem er im Rampenlicht steht, kann es auch sein, dass es zum Schlechten kommt. Ein Vergleich: Ich steige für meine Lernstiftung Hück wöchentlich mit Jugendlichen in den Boxring. Viele von ihnen unterschätzen den Kämpfer Hück mit seinen 52
Jahren und meinen, sie könnten mit Gewalt alles erreichen. Nach wenigen Runden sind sie ganz friedlich. Damit will ich sagen: Wer in den Ring reingeht, darf sich nicht wundern, wenn der andere zuschlägt. In dem Moment, in dem einer aber Angst vor dem Ram-penlicht hat, muss er es lassen.
wIe Kann SICH eIn BeTrIeBSraT DIe nÖTIgen neHMerQualI-
TäTen anTraInIeren? Junge Betriebsräte müssen in den Sport rein – und damit meine ich den Sport. Denn dort lernt man, zu siegen und zu verlieren. Eine Niederlage im Sport ist nicht schlimm, schlimm ist nur, wenn du nicht alles gegeben hast. Betriebsräte müs-sen sich dazu gesellschaftlich engagieren und auch ein Ehrenamt ausüben. Gerade dort lernt man auch, Streitgespräche zu führen und Konflikte zu lösen.
MIT welCHen BeTrIeBlICHen KonflIKTen KoMMT Man Dann
InS raMpenlICHT? In einer Tarifrunde kann es gelingen. Aber auch bei anderen Themen. Zum Streit zwischen der Lokführergesellschaft GDL und der Eisenbahnergewerkschaft EVG habe ich mich geäu-ßert, weil ich diesen Gewerkschaften egoistische Motive unterstelle. Damit bin ich in die Öffentlichkeit gegangen. Das ist sofort aufge-nommen worden. Bei solchen aktuellen Themen muss man aus dem
uwe HÜCK, 52, ist seit 2002 Gesamtbetriebs-ratsvorsitzender und seit 2010 stellvertreten-der Aufsichtsratsvorsitzender beim Autobauer Porsche. Er wuchs elternlos in Heimen auf und trat später in die SPD und in die IG Metall ein. Der ehemalige Thaibox-Profi spielt die gesam-te mediale Klaviatur: Er pflegt einen eigenen Facebook-Auftritt, als Betriebsrat erreicht der gelernte Lackierer fünfstellige Klickzahlen bei YouTube, außerdem gastiert er regelmäßig in TV-Talkshows.
zur perSon
Uwe hück über seine Rolle als Porsche-Betriebsrat, über Angst und über das nötige Rüstzeug für den öffentlichen Auftritt
Foto
: Dan
iel M
aure
r/da
pd
30 Mitbestimmung 11/2014
Bauch heraus handeln. Dann wirkt es glaubhaft. Wenn du der Auffassung bist, du kämpfst für eine gerechte Sache, dann geh raus. Dann funktioniert das auch. Da gebe ich ger-ne die Rampensau für das Gute.
KoMMT DIe vorBereITung auf eIn MeDIengeSpräCH
nICHT zu Kurz, wenn Man So eMoTIonal vorgeHT? Es gibt Betriebsräte, die nur in ihrer Arbeitszeit Betriebsräte sind. Die könnten ein Gespräch so nicht angehen. Wer aber 24 Stunden am Tag Betriebsrat ist, der kann das. Das ist wie mit dem Wettkampf beim Boxen. Ich bereite mich auf meinen Kampf am Freitag gut vor. Ich trainiere dafür fünfmal die Woche. Genauso ist es, wenn ich als Betriebsrat in die Öf-fentlichkeit gehe. Ich bin sehr emotional, aber ich bin gut vorbereitet.
wIe läSST SICH gewonnene aufMerKSaMKeIT IM SIn-
ne Der arBeITneHMer eInSeTzen? Ein Beispiel: 2012 ha-ben wir in Baden-Württemberg ein Förderjahr im Tarifvertrag festgeschrieben. Benachteiligte Jugendliche sollen im Betrieb auf den Start in eine Berufsausbildung vorbereitet werden. Da habe ich bei Porsche gefragt, ob wir zwölf dieser Jugend-lichen einstellen. Der Vorstand hat aber nie eine Antwort gegeben. Um ihn endlich in die Pflicht zu nehmen, habe ich unabgestimmt eine Presseerklärung rausgegeben: „Arbeit-geber und Betriebsrat haben eine gemeinsame Verantwor-tung für eine gute Zukunft unserer Kinder“. Am Ende haben wir zwölf Jugendliche eingestellt, von denen jetzt neun eine Ausbildung bei Porsche machen. Das hat nur geklappt, weil die Rampensau mal wieder am Werk war. So etwas kann man aber nur machen, wenn die eigene Position im Unter-nehmen gefestigt ist.
SIe SInD BeI porSCHe auCH STellverTreTenDer auf-
SICHTSraTSvorSITzenDer. BeHInDerT DIe verSCHwIe-
genHeITSpflICHT IHre BeTrIeBSraTSTäTIgKeIT? Ich ver-schweige nur, was nicht zum Nachteil unserer Kollegen ist. Wenn ich feststelle, dass diese Gefahr droht, muss ich wort-gewandt sein. Diese Fähigkeit sollte jeder Betriebsrat haben. Allerdings halte ich mich immer an gesetzliche Regeln wie zum Beispiel das Aktiengesetz. Aber man kann auch Dinge verständlich zum Ausdruck bringen, ohne dass man sie aus-spricht. Verschwiegenheit heißt nicht, zuschauen wie die Menschen darunter leiden. ■
Das Gespräch führte anDreaS SCHulTe.
Öffentlichkeit ungefiltert zu erreichen. Denn ausgerech-net der eigene Arbeitgeber kontrolliert alle entscheidenden Medien der Stadt.
Hat es ein Konflikt einmal nach draußen geschafft, empfiehlt Wohland Arbeitnehmervertretern möglichst originelle Aktionen. So legten sich Mitte des Jahres in Berlin Beschäftigte im Gesundheitswesen einige Minuten lang aufs Straßenpflaster. Ihr Motto: „Pflege am Boden“. Das Kalkül: Statt mit einer Trillerpfeife nur Aufmerksam-keit zu erregen, wecken sie durch Kreativität Sympathien. „Früher haben Arbeitnehmer in Aktionen eher den Kon-flikt innerbetrieblich ausgelebt, heute wollen sie zusätzlich die Öffentlichkeit für sich gewinnen“, sagt Wohland. Auch das habe zu mehr allgemeinem Verständnis für ihre Inte-ressen geführt.
DIe MaCHT Der BIlDer_ Stößt ein Konflikt aber auf Un-verständnis, droht ein Imageschaden. Prominentes Bei-spiel: die Lokführergewerkschaft GDL. Für ihre Streiks im Oktober und November hagelte es Kritik. Auch GDL-Boss Claus Weselsky geriet ins Trommelfeuer der Medien. So bezeichnete etwa das Magazin „Wirtschaftswoche“ den Streik als „Amoklauf eines komplexbeladenen Au-ßenseiters“.
Wohland rät daher zu Vorsicht: „Arbeitnehmervertre-ter irren, wenn sie meinen, dass es per se gut ist, mit be-trieblichen Konflikten an die Öffentlichkeit zu gehen.“ Das Mediendebüt von Gewerkschaftssekretären und Be-triebsräten sollte daher gut vorbereitet sein. „Wer mit der Presse spricht, sollte in Bildern sprechen und sich kurz und knapp fassen“, rät Wohland, der dies in Kommuni-kationstrainings und Rollenspielen mit Arbeitnehmerver-tretern einübt.
Betriebsrat Rademacher am Flughafen Zweibrücken hätte sich so eine Schulung gewünscht. „Damals war kei-ne Zeit“, sagt er. Die richtigen Worte hat er offensichtlich dennoch gefunden. Facebook-Gruppen und ein Internet-forum unterstützen Rademacher beim Kampf gegen die Insolvenz. Gute Kontakte habe er zu drei regionalen Me-dien aufgebaut, auch der TV-Sender Sat1 höre regelmäßig nach, ob es etwas zu berichten gebe. Rademacher will das nutzen. „Durch sie kann ich unsere Interessen in der Öf-fentlichkeit mit mehr Nachdruck vertreten“, sagt er. „Wir spüren in der Bevölkerung eine gewisse Solidarität.“ ■
31Mitbestimmung 11/2014
TITEL
Ein Urknall für ArbeitnehmerrechteKaMpagnen Vor zehn Jahren machte die Gewerkschaft ver.di mit dem „Schwarzbuch Lidl“ die systematische Verletzung elementarer Arbeitnehmerrechte bei Deutschlands zweitgrößtem Discounter publik. Die breite Medienresonanz hat einen kritischen Blick auf die Arbeitswelt befördert.
Von MarTIn KeMpe, Journalist in Hamburg und bis 2007 Chefredakteur von ver.di-publik
Foto
: Wer
ner
Bac
hmei
er
Mitbestimmung 11/201432
Es ist der 10. Dezember 2004: Über 70 Journalistinnen und Journa-listen sitzen und stehen eng gedrängt im Konferenzraum im achten Stock der Berliner ver.di-Zentrale. Sie wollen hören, was das „Schwarzbuch Lidl“ enthüllen wird. ver.di-Vorstandsmitglied Fran-
ziska Wiethold spricht von „skandalösen Zuständen“, mit auf dem Podium sitzen der Journalist Andreas Hamann, der gemeinsam mit seiner Kollegin Gudrun Giese das Buch recherchiert und verfasst hat, und Agnes Schreieder. Sie war eigens in den USA, um zu lernen, wie man Kampagnen macht und hat die Lidl-Kampagne konzipiert.
Das Datum für die Präsentation der materialreichen brisanten Publikation war bewusst gewählt: Der 10. Dezember ist der Tag, an dem die UN 1948 die „Erklärung der allgemeinen Menschenrechte“ verabschiedete. Er wird seither weltweit als „Tag der Menschenrechte“ begangen. Und dieser Tag schien besonders geeignet für die Botschaft des knapp 100-seitigen, schwarz einge-bundenen Buchs mit dem verfremdeten Lidl-Logo auf dem Umschlag: Auch in Deutschland gibt es eine systematische Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten.
Die Pressekonferenz wurde zu einem ersten Höhepunkt der ver.di-Kampa-gne gegen die Arbeitsbedingungen beim damals zweitgrößten deutschen Dis-counter, gegen die Missachtung elementarer Arbeitsrechte, gegen Lohndrü-ckerei, Einschüchterung und Willkür. Wenige Tage vorher, am 7. Dezember, hatte das ZDF in der Magazinsendung „Frontal 21“ auf Basis des von Hamann und Giese recherchierten Materials einen ersten Fernsehbericht über die Zu-stände bei Lidl gesendet. Und nach der Pressekonferenz folgte eine Flut von Veröffentlichungen in nahezu allen Tages- und Wochenzeitungen. Mehrere Fernsehsender, darunter ARD und ZDF, berichteten in den Hauptnachrich-tensendungen, der Lidl-Konzern verhindere mit Druck und Drohungen, dass Beschäftigte ihr Recht auf die Wahl von Betriebsräten wahrnehmen. Die deut-sche Öffentlichkeit erfuhr, dass den Beschäftigten von Lidl systematisch un-bezahlte Mehrarbeit abgepresst werde.
groSSeS MeDIeneCHo_ Die Reaktion der Medien war überwältigend. Ganz überwiegend folgten die Berichte dem Schwarzbuch und verbreiteten die Anklagen gegen den Lidl-Konzern flächendeckend in der deutschen Öf-fentlichkeit. „Endlich ist die Mauer des Schweigens ge-brochen“, hieß es im Onlinedienst „heise“ am 12. Dezem-ber 2004, zwei Tage nach der Pressekonferenz. „Ein Buch wie eine Dynamitstange“, kommentierte das „manager magazin“ (2004). Einen „Aufruf zum Kassenkampf“ sah „Die Zeit“ zwei Monate später (3.2.2005) in einem durch-aus anerkennend und freundlich gehaltenen Artikel. Im November (17.11.2005) legte sie nach und schrieb, der „mehr als hundert Seiten starke Pranger war ein Prototyp für die moderne Gewerkschaftsarbeit“. Sogar ein Tatort-Krimi wurde später nach den Vorlagen des Buchs gedreht (Sendung ARD, 1.2.2009), und im Grundrechte-Report 2006 gab es ein extra Kapitel unter der Überschrift „Zum Schwarzärgern“ (Frankfurt 2007).
Der Lidl-Konzern geriet in die Defensive. Die Verun-sicherung der Kunden schlug auf die Umsätze durch.
33Mitbestimmung 11/2014
ARBEIT
Deutschland. So deutlich sich die Lidl-Kampagne positiv auf das mediale Umfeld gewerkschaftlicher Arbeit auswirkte – im gewerkschaftlichen Orga-nisationsinteresse war der Erfolg durchaus messbar, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Trotz vielfältiger Aktivitäten in und vor den Filialen von Lidl ist es nicht gelungen, eine relevante Zahl von Betriebsräten zu installieren, die – wie Jahre zuvor bei der Drogeriekette Schlecker – als Organisationsker-ne der Mitgliederentwicklung hätten fungieren können. Zwischen November 2004, also dem Monat vor Veröffentlichung des Schwarzbuchs, bis Ende 2006 hat sich die Zahl der ver.di-Mitglieder bei Lidl um knapp über 200 (bei damals rund 25 000 Beschäftigten in Deutschland) erhöht. In den ebenfalls zur Schwarz-Gruppe gehörenden Kaufland-Häusern war der positive Mitglieder-saldo allerdings deutlich höher.
gegenMaCHT nICHT gelungen_ Ulrich Dalibor, Bundesfachgruppenleiter für den Einzelhandel in der Berliner ver.di-Zentrale, meint im Rückblick auf die Kampagne, es sei zwar gelungen, in der Öffentlichkeit klarzumachen, „was der Billigwahn der Discounter anrichtet“. Aber es sei ver.di nicht gelungen, „im Unternehmen selbst Gegenmacht aufzubauen“. Angesichts der massiven Vorwürfe hätten sich viele Beschäftigte persönlich in ihrer beruflichen Identi-tät angegriffen gefühlt. Dies sei einer der Gründe, weshalb die Lidl-Beschäf-tigten – anders als die Schlecker-Frauen – ihre Interessen im Unternehmen nicht selbst in die Hand genommen hätten.
Agnes Schreieder, heute stellvertretende Landesleiterin von ver.di Hamburg, hebt, anders als Dalibor, hervor: „Den Konflikt zwischen Loyalität zum Ar-beitgeber und dem eigenen Wunsch nach Verbesserungen gibt es bei solchen Kampagnen immer. Aber ohne den Druck auf den Konzern, der nur durch die Medien und die soziale Bewegung möglich war, hätten wir es nie geschafft, eine spürbare Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei Lidl zu erreichen.“
Ein weiterer Grund für den begrenzten Organisationserfolg der Kampagne ist zu vermuten: Viele Beschäftigte wurden von der überwältigenden negativen Publizität ihres Arbeitgebers eher verschreckt und hatten berechtigte Angst, sich innerhalb der repressiven Lidl-Unternehmenskultur offen für ihre gewerk-schaftlichen Interessen einzusetzen. Es ist ihnen nicht entgangen, dass die Lidl-Filiale in Calw im Oktober 2005 trotz öffentlicher Proteste kurzerhand geschlossen wurde, als die Beschäftigten sich anschickten, einen Betriebsrat zu wählen.
Tatsächlich hat sich die Kampagne positiv für die Beschäftigten ausgewirkt. Das Management bemühte sich in der Folge darum, die schlimmsten Aus-wüchse im Umgang mit den Mitarbeiterinnen zu unterbinden. In einer Stel-lungnahme auf Anfrage der „Mitbestimmung“ verweist Stefan Krückel von der mittlerweile bestehenden Lidl-Pressestelle auf die jetzt im Unternehmen geltenden „Verhaltensgrundsätze im Umgang mit den Mitarbeitern“. Darin heißt es unter anderem: „Wir verhalten uns so, dass wir als attraktiver Ar-beitgeber bekannt und geschätzt sind.“ 2010 erhöhte Lidl für alle Mitarbei-
Beschäftigte und aktive Gewerkschafterinnen wurden vor den Lidl-Filialen ans Mikrofon geholt. Klaus Gehrig, Chef der Handelsgruppe Lidl, musste sich erstmals in dem ZDF-Filmbeitrag den kritischen Fragen des Journalisten Christian Esser stellen. Wenige Tage später, nach der Presse konferenz vom 10. Dezember, musste Gehrig dem „Handelsblatt“ und anderen durchaus wirtschaftsnahen Zeitschriften Rede und Antwort stehen – ein Signal, dass das Lidl-Management seine jahrelang geübte Abschot-tungspolitik gegenüber der Medienöffentlichkeit unter dem Druck der ver.di-Kampagne aufgeben musste. Zuvor hatte es über Jahrzehnte nicht einmal einen Pressesprecher im Konzern gegeben.
Das von den beiden Autoren Hamann und Giese sau-ber recherchierte „Schwarzbuch Lidl“ war also ein gran-dioser Medienerfolg. Die erste Auflage von 8000 Exem-plaren war in wenigen Tagen vergriffen, es musste nachgedruckt werden. Insgesamt wurden über 20 000 Exemplare verkauft. Das Buch wurde zur erfolgreichsten Publikation aus der Arbeitswelt seit den 1970 erschiene-nen Industriereportagen von Günter Wallraff.
Schwarzbücher waren ein eingeführtes publizistisches Format zur Skandalisierung kritikwürdiger Zustände. Doch diesmal war es eine doppelbödige Kritik, die auf den Konzernchef Dieter Schwarz zielte als Eigentümer und Hauptverantwortlichen für die repressive Unternehmens-kultur in der Schwarz-Gruppe. Zur ihr gehören die Kauf-land-Häuser und die damals rund 2500 Lidl-Filialen mit mehr als 25 000 Verkäuferinnen.
Der Titelslogan des „Schwarzbuchs Lidl“ lautete: „Bil-lig auf Kosten der Beschäftigten“. Er stand auch Pate bei dem Fernsehfilm „Die Billigheimer“ des Fernsehjourna-listen Mirko Tomic, der ab 2005 in nahezu in allen Regi-onalprogrammen der ARD ausgestrahlt wurde. Das Schwarzbuch wie der Fernsehfilm zielten nicht nur auf Lidl, sondern darüber hinaus auf das Discount-Geschäfts-modell und den wachsenden Sektor prekärer, ungesicher-ter und unterbezahlter Arbeit in Deutschland. Mitten in einer Phase neoliberaler Dominanz im medienvermittelten politischen Diskurs stießen das „Schwarzbuch Lidl“ und die nachfolgenden Publikationen (wie das „Schwarzbuch Lidl Europa“) einen gesellschaftlichen Aufklärungsprozess an über die Probleme von Beschäftigten, insbesondere von Frauen, in den sozialen Schattenbereichen des Modells
Mitbestimmung 11/201434
terinnen und Mitarbeiter in den Filialen und Lagerbetrieben den Stundenlohn auf zehn Euro. Inzwischen liegt er bei elf Euro und damit bei den meisten Einstiegsgehältern über dem tariflichen Niveau. Beschäftigte bestätigen, das Arbeitsklima habe sich in den letzten Jahren verbessert.
Die Schwarzbücher Lidl haben die öffentliche Aufmerksamkeit auf ein Geschäftsmodell gelenkt, das nicht nur im Discountbereich des Lebensmittel-handels besteht. Zahlreiche Nachfolgerecherchen (wie etwa die ARD-Repor-tagen zum Textildiscounter KIK 2007, Bewachungsgewerbe 2007, Amazon ab 2012) deckten Missstände auf: Missachtung gesetzlicher Arbeitsrechtsstan-dards, Be- und Verhinderung von Betriebsratswahlen, Qualitätsmängel bei den Produkten, Preisdruck auf deutsche und ausländische Zulieferer, men-schenunwürdige Arbeitsbedingungen in Zulieferunternehmen der Billiglohn-länder Asiens. Die Schwarzbücher haben ganz wesentlich dazu beigetragen, die Kehrseite eines Marktliberalismus in Deutschland und Europa für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen.
Nachfolgerecherchen gab es auch zu Lidl. Im März 2008 veröffentlichte der „Stern“, gestützt auf Dokumente einer von Lidl beauftragten Detektei, dass die Beschäftigten in über 200 Filialen überwacht und bespitzelt wurden. Lidl-Chef Klaus Gehrig erklärte, davon habe die Geschäftsführung des Kon-zerns nichts gewusst. Aber schon in den beiden Schwarzbüchern war nachzu-lesen, dass Lidl-Mitarbeiterinnen durch Video, Testkäufer und weitere rigide Kontrollen überwacht wurden. Wie das Magazin „Focus“ im Mai 2008 mel-dete, wurde gegen den Lidl-Konzern wegen der Bespitzelung der Mitarbeite-
rinnen und der Missachtung des Datenschutzes ein Buß-geld von 1,462 Millionen Euro verhängt. Im April 2009 enthüllte dann der „Spiegel“ die systematische – und ille-gale – Erfassung der Krankheitsdaten der Beschäftigten.
Die Schwarzbücher Lidl haben im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wesentlich dazu beigetragen, den öffent-lichen Raum für kritische Medienberichterstattung aus der Arbeitswelt zu erweitern. Anderen gewerkschaftlichen und außergewerkschaftlichen Kampagnen, etwa zum ge-setzlichen Mindestlohn oder zum Datenschutz am Arbeits-platz, wurde eine durch Fakten und Erfahrungen gestütz-te Plausibilität gegeben. Insofern liegt die Bedeutung des „Schwarzbuchs Lidl“ und des „Schwarzbuchs Lidl Euro-pa“ nicht nur in der Aufklärung über die mit dem Dis-countmodell einhergehenden Arbeitsbedingungen. Erst-mals nach Jahren marktliberaler Dominanz wurde der anwachsende Sektor prekärer Arbeit in Deutschland und anderswo zu einem breiten, allgemein wahrgenommenen Medienthema. Damit verbunden war ein schwer messba-rer, aber auf lange Sicht spürbarer Legitimitätsgewinn für gewerkschaftliches Handeln sowohl in den Medien wie auch in der Bevölkerung. ■
„Ohne den Druck auf den Konzern, der nur durch die Medien und die soziale Bewegung möglich war, hätten wir es nie geschafft, eine spürbare Verbesserung der Arbeits bedingungen bei Lidl zu erreichen.“
AGNEs schREIEDER
ver.DI-KaMpagnen-MaCHer agneS SCHreIeDer, ulrICH DalIBor, auTor anDreaS HaMann (v.l.): Auswüchse unterbunden
Foto
s: M
ario
n M
. Dit
tmer
; Alc
iro
The
odo
ro d
a Si
lva;
pri
vat
35Mitbestimmung 11/2014
ARBEIT
Im Parlament der BetriebsräteDeuTSCHer BeTrIeBSräTeTag 2014 Vor rund 400 Arbeitnehmervertretern rief der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann auf zur „Offensive gegen den mitbestimmungspolitischen Stillstand in diesem Land“. Die Hans-Böckler-Stiftung war Mitveranstalter.
Von CornelIa gIrnDT und MargareTe HaSel
Im Bonner Plenarsaal am Rhein, dort, wo bis 1999 die Bundes-tagsabgeordneten über die Geschicke der Republik stritten und entschieden, tagte nun zum elften Mal das „Parlament der Betriebsräte“ vom 28. bis 30. Oktober. Als „Rückgrat und
Stabilitätsanker der sozialen Demokratie“ adressierte Reiner Hoff-mann in seiner Eröffnungsrede die betrieblichen Akteure – und schlug den Bogen zur großen demokratischen Erzählung dieser Re-publik, wo genau vor 45 Jahren, am 28. Oktober 1969, Willy Brandt just an diesem Ort seine erste Regierungserklärung unter das be-rühmte Motto „Mehr Demokratie wagen“ gestellt hatte. „Und Brandt hat Wort gehalten.“ Nicht zuletzt das Betriebsverfassungs-gesetz 1972 sei ein Beleg dafür, dass der erste Kanzler der SPD die Mitbestimmung als Motor der Demokratisierung der Wirtschaft gesehen habe.
Die aktuelle Große Koalition hingegen habe den „mitbestim-mungspolitischen Stillstand“ sogar im Koalitionsvertrag festge-schrieben, kritisierte der DGB-Vorsitzende, der auch Vorstandsvor-sitzender der Hans-Böckler-Stiftung ist. Hoffmann skizzierte eine
Arbeitswelt im Umbruch. Die 14 für den Betriebsräte-Preis nomi-nierten Betriebsräte, zeigten wie sie sich kreativ und machtvoll damit auseinandersetzen: wie sie Standorte, die die Arbeitgeber schon aufgegeben haben, sichern; wie sie Mittel und Wege finden, um psychische Belastungen der Mitarbeiter zu reduzieren, und die Ver-einbarkeit von Beruf und Pflege voranbringen – zum Beispiel. Ihre Projektschilderungen im großen Kreis erhielten hier eine emotiona-le Bühne – durch den Zuspruch, den Applaus und die gezielten Nachfragen der Betriebsratskollegen. Am Ende wurden eine Menge Preise verliehen, wobei nach Art einer Gewinnshow auch über einen Publikumspreis abgestimmt wurde, den Tahir Sogukkan erhielt für einen zähen, erfolgreichen Kampf gegen Outsourcing (siehe Maga-zin Mitbestimmung 10/2014).
golD geHT an BMw_ Den Betriebsräte-Preis 2014 in Gold hat das Betriebsratsgremium der BMW AG München erhalten für seine Arbeitszeitregelung zur Mobilarbeit unter dem Motto: „Flexibel arbeiten – bewusst abschalten“. Die Anfang 2014 mit dem Arbeit-
Foto
s: D
euts
cher
Bet
rieb
srät
etag
/Dir
k B
aum
bach
36 Mitbestimmung 11/2014
InTervIew
„mobilarbeit muss man im Betrieb regeln“
HerzlICHen glÜCKwunSCH zuM BeTrIeBSräTepreIS In golD!
eure BeTrIeBSvereInBarung zur MoBIlarBeIT HaT nur vIer
SeITen. wIe HaBT IHr DaS geSCHaffT? Wir wollten einfache Regeln zu vereinbaren, die präzise und leicht verständlich sind. Dass dies bei einem so komplexen Thema möglich ist, hat mich selbst erstaunt, aber wir haben auch lange daran gefeilt. Wir mussten grundlegende Dinge klären: dass etwa die Möglichkeit der Mobilarbeit grundsätzlich für alle Arbeitnehmer der BMW AG gilt. Und dass alle Arbeiten, die außerhalb der BMW-Betriebe gemacht werden, als Mobilarbeit zählen – nicht nur die an mobilen Computern, sondern auch ein auf Papier erstelltes Kon-zept. Nach fast einem Jahr Praxis zeigt sich auch, dass wir nichts über-sehen haben, was noch geregelt hätte werden müssen.
waS waren DIe grÖSSTen HÜrDen In Den verHanDlungen MIT
Der arBeITgeBerSeITe? Ob und wie wir die Zeit erfassen. Von Arbeits-geberseite bestand sehr wohl die überlegung, die Mobilarbeit mit Ver-trauensarbeitszeit ohne Erfassung zu kombinieren. Wir suchten lange eine Lösung, wie man Arbeitszeit erfasst, etwa indem die Beschäftigten das selbst notieren. Bei BMW werden üblicherweise Arbeitszeiten als Komm- und Gehzeiten definiert, bei der Mobilarbeit wird nun die Dauer der Arbeitszeit erfasst – täglich und wöchentlich. Wann genau am Tag mobil gearbeitet wird, wird bei uns nicht erfasst, der Mitarbeiter erfasst jedoch selbstständig im System insgesamt seine Wochenarbeitszeit, die nicht überschritten werden darf – das zu regeln war nicht einfach.
Kann Man MoBIlarBeIT guT In eIner BeTrIeBSvereInBarung
regeln? oDer IST Da nICHT auCH Der geSeTzgeBer gefragT? Die meisten Aspekte der Mobilarbeit müssen vom konkreten Betrieb aus betrachtet und geregelt werden. Uns fiel aber auch auf, dass das Ar-beitszeitgesetz sozusagen noch zu stark an den Hochöfen ausgerichtet ist mit Festlegungen wie: Nach zehn Stunden Arbeit „am Stück“ wird elf Stunden geruht. Aber wenn ein Vollzeit-Beschäftigter – im Sinne von Work-Life-Balance – bis Mittag im Unternehmen arbeitet, nach-mittags mit den Kinder zusammen ist und am Abend freiwillig noch berufliche Arbeiten erledigt, dann ist das genau genommen nicht kom-patibel mit den vorgesehenen gesetzlichen Ruhezeiten.
Die Fragen stellte CornelIa gIrnDT.
Peter cammerer, Bereichsbetriebsrat der BmW AG in münchen, über die preisgekrönte Betriebsvereinbarung.
Die Betriebsvereinbarung zur Mobilarbeit bei der BMW AG München kann bei [email protected] angefragt werden.
reCHT auf aBSCHalTen, 4/2014, www.magazin-mitbestimmung.de
MeHr InforMaTIonen
geber abgeschlossene Betriebsvereinbarung legt die Grundlagen für mehr Selbstbestimmung über Arbeitszeit und Arbeitsort für alle BMW-Beschäftigten. Dabei stellt sie klar: Unterwegs oder zu Hause erledigte Arbeit zählt genauso als Arbeitszeit. Und: Es gibt ein Recht auf Nichterreichbarkeit. Der Betriebsrat der BMW Group hatte die Initiative ergriffen, weil immer mehr mobile Endgeräte genutzt wer-den, die Mitarbeiter immer länger erreichbar sind und sich auch gesundheitliche Probleme in der Belegschaft gehäuft hatten, berich-tete BMW-Betriebsrat Peter Cammerer.
Den Betriebsräte-Preis 2014 in Silber nahm Betriebsratsvorsit-zende Beate Heinert für den AWO Kreisverband Nürnberg e.V. entgegen. Die Arbeitnehmervertreter hatten eine drohende Insolvenz verhindert, die Arbeitsplätze von rund 50 Mitarbeitern gesichert – und das in einem Tendenzbetrieb. Üblicherweise sind dort die Mit-bestimmungsrechte der Betriebsräte massiv eingeschränkt. Davon ließen sich die Betriebsräte der AWO Nürnberg nicht abschrecken, sie installierten einen Wirtschaftsausschuss, wirkten darauf hin, dass die Geschäftsführung ausgetauscht wird, Gehälter überhaupt wieder und dann noch nach Tarifvertrag gezahlt werden. Womit ihnen ge-lang, den gewerkschaftlichen Organisationsgrad zu verdreifachen. „Unser Beispiel soll andere Arbeitnehmervertreter in sozialen und kirchlichen Einrichtungen ermutigen, über die Grenzen hinauszu-gehen, die der §118 BetrVG mit dem Tendenzschutz setzt“, sagte Beate Heinert dem Magazin Mitbestimmung nach der Preisverlei-hung.
Die Auszeichnung in Bronze ging an Betriebsräte der Deutschen Bahn für ihr Projekt „Sicher unterwegs“, das Lösungen erarbeitet hatte, wie man die Beschäftigten gegen die zunehmende Belästigung und Gewalt in Bahnen und Bussen schützt. Den Preis nahm Jürgen Knörzer, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der DB Regio AG Schie-ne und Bus aus Frankfurt/Main, entgegen. ■
BeTrIeBSräTepreISTräger peTer CaMMerer, BwM (M.);
BeaTe HeInerT, awo; jÜrgen KnÖrzer, DB: über Grenzen hinaus
37Mitbestimmung 11/2014
ARBEIT
SpanIen Was macht eine Wirtschaftskrise mit horrender Arbeits-losigkeit mit den Menschen? Wie sieht der Widerstand aus, den sie gegen Zwangsräumung, soziales Elend und Entwürdigung leisten? Die angehende Fotojournalistin Jelca Kollatsch reiste 2013/14 viermal nach Andalusien. Dort lebte die Stipendiatin der Hans-Böckler-Stif-tung mit Haus besetzern in Sevilla und auf einem Landwirtschaftsgut. Sie dokumentierte den Widerstand von Menschen im Südspanien, die seit dem Verlust ihrer Arbeit und mit marginalen Sozialleistungen oft nicht einmal mehr das Nötigste zum Leben haben, um Miete oder Hypotheken zu bezahlen.
„In erster Linie kämpferisch“
SevIlla, Der BeSeTzTe woHnBloCK „Corrala uTopÍa“: Fran, der hier seit 20 Monaten lebt, trägt nach dem Räumungsbeschluss Anfang 2014 die Betten seiner Familie aus dem Haus. Laut dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist es nicht zulässig, Menschen in einer sozialen Notlage zwangsweise zu räumen (l.).
proTeST gegen DIe anKlage von MITlIeDern Der lanDarBeITergewerKSCHafT SaT: 54 Mitglieder des Sindicato Anadaluz de Trabajadores (SAT) sollen 88 Monate ins Gefängnis, weil sie brachliegendes halbstaatliches Land besetzt und bewirtschaftet haben. In Solidarität mit den Besetzern gingen im November 2013 Tausende Menschen in Granada auf die Straße (o.).
39Mitbestimmung 11/2014
POLITIK
BewoHner DeS BeSeTzTen
woHnBloCKS In SevIlla
CaMpIeren IM STaDTzenTruM
vor Der BanK IBerCaja, Der
DaS geBäuDe geHÖrT: Sie fordern eine soziale Miete; jeden Abend finden Diskussionen statt.
vIele alleInerzIeHenDe frauen geHÖren zu Den HauSBeSeTzern: Mit einem Gartenschlauch holen die Bewohnerinnen Wasser vom nahegelegenen Brunnen, der angelegt worden war, weil es ein Recht auf Wasser gibt. Nach der Hausbesetzung im Mai 2012 hat die Stadtverwaltung dem Gebäude das Wasser und den Strom abgestellt. Sevilla ist mit Spitzenwerten um die 48°C die heißeste Stadt Spaniens.
DIe KInDer Der arBeITSloSen unD preKär BeSCHäfTIgTen: Immer helfen auch die Kinder ihren Eltern, den Wochenvorrat an Wasser vom Brunnen in die Wohnung zu bringen. 150 Liter pro Woche braucht eine Familie. „Es ist traurig, dass die Kinder so leben müssen. Aber sie lernen, sparsam mit Ressourcen zu sein“, sagt ihre Mutter Inma.
42 Mitbestimmung 11/2014
KrISenTreffen IM laDenloKal DeS BeSeTzTen woHnBloCKS: Eine ehrenamtliche Rechtsanwältin erklärt den Bewohnerinnen der Corrala Utopía ihre Rechtslage, nachdem bekannt wurde, dass das Gericht in Sevilla den Räumungsbescheid an die Polizei weitergegeben hat.
verzweIflung angeSICHTS DeS räuMungSBeSCHluSSeS: Der Vermittler zwischen dem Hauseigentümer, der Bank Ibercaja, und der Stadtverwaltung Sevilla hat schlechte Nachrichten. Aguasanta, die als Alleinerziehende mit ihren drei Söhnen zu den Besetzerinnen der ersten Stunde gehört, kann den Druck nicht mehr aushalten. Sie droht mit Selbstmord, um die Politik zum Handeln zu zwingen.
43Mitbestimmung 11/2014
POLITIK
wInTer IM BeSeTzen HauS oHne STroM: Unter einer Tischdecke versuchen Álvaro und María Angeles, sich mit einer Glutschale warm zu halten. Die konser-vative spanische Regierung hatte im Dezember 2013 einen Gesetzentwurf der Opposition abgelehnt, der es verboten hätte, Menschen im Winter die Strom-versorgung abzustellen. Ein solches Gesetz gibt es bereits in 14 EU-Ländern.
MITTageSSen IM SpeISerauM DeS SozIalzenTruMS „rey Her-
reDIa“ In CórDoBa: Jeden Tag werden bis 150 Menschen bekocht. Eltern können auch Essen für ihre Kinder einpacken lassen. Alle helfen mit. Wie Ignacio, der in der Küche der besetzten Schule beim Kochen hilft und das Tagesgericht serviert. Danach isst er gemeinsam mit der Kochgruppe. Sie alle sind arbeitslos oder leben von einer kargen Rente.
45Mitbestimmung 11/2014
POLITIK
leBen auf DeM lanDguT: Tato und Beatric leben nach langer Arbeitslosigkeit mit ihren Töchtern auf dem Landgut „Somonte“. „Es geht uns viel besser. Wir haben zu essen, und endlich können wir wieder etwas anpacken“, sagen sie. Die linke Gewerkschaft SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) hatte im März 2012 zusammen mit 500 Arbeiterinnen und Arbeitern die Finca besetzt. Unter der Landbevölke-rung Andalusiens ist seit der Wirtschaftskrise jeder Zweite arbeitslos. Viele Kinder bekommen nur noch in der Schule ausreichend zu essen. Laut Caritas sind 350 000 Menschen unter ernährt.
46 Mitbestimmung 11/2014
nICHT TagelÖHner SeIn, In freIHeIT leBen: „Das Leben auf dem Land-gut ist hart, aber es ist wieder ein würdiges Leben. Es gibt Arbeit, Essen, eine Perspektive und ein Recht auf Mitgestaltung“, sagt der Landarbeiter Raphael (oben rechts).
DIeSeS lanD geHÖrT DeM volK (l.) grunDBeSITz unD freIHeIT:
50 Kilometer vor Córdoba gelegen wurde im März 2012 die Farm „Somonte“ von 500 Gewerkschaftern der SAT besetzt. Sie sollte an einen Großgrund-besitzer verkauft werden. Die Finca hat 400 Hektar Land, sie bietet Arbeit und ernährt viele Menschen.
48 Mitbestimmung 11/2014
„So nah war Europa noch nie am Scheitern“, warnt Joschka Fischer und sagt auch warum: weil die Finanzkrise die innere Solidarität der Länder des Nordens und des Südens zerrissen hat. Während sehr viele Menschen in Spanien, Griechenland, Portugal nicht mehr wissen, wie sie ihre Kinder anständig ernähren sollen, und sich vor Obdachlosigkeit fürchten, brummt in Deutschland, dessen Regierung mit Spardiktaten daher-kommt, die Wirtschaft. In dieser dramatischen Situation ist die angehende Fotojournalistin Jelca Kollatsch nach Spanien gereist. Zu den Haus- und Land-besetzern. Das war im Frühjahr 2013, als in ihrem Studienfach der Kurs „Auslandsreportage“ anstand. „Da habe ich mich als Gewerkschafterin ge-fragt, was mit den Menschen passiert, wenn ihnen durch die Sparpolitik erst die Arbeit und dann auch die Sozialunterstützung weggenommen wird“, sagt die 30-Jährige anlässlich der Ausstellungseröffnung in der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf, wo seit Mitte Oktober in den Fluren der Studienför-derung ihre bewegenden Fotos zu sehen sind.
Sicher, sie hätte auch ein nostalgisches Porträt über den letzten Hutmacher von Valencia machen können. Aber das wollte sie nicht. Sie wollte „ein poli-tisch relevantes Projekt machen“, und da stand für sie, die Spanisch spricht, Andalusien an erster Stelle – eine Region mit der höchsten Zwangsräumungs-rate (weil die Menschen ihre Hypotheken und Mieten nicht bezahlen können) und der höchsten Arbeitslosigkeit in Europa mit unglaublichen 65 Prozent unter jungen Erwachsenen.
Sie flog nach Sevilla, lernte die Leute von der „Coralla Utopía“ kennen, 36 Familien, die in ihrer Wohnungsnot ein leer stehendes Gebäude besetzt hatten. Ein Gebäude, das einer jener Banken gehört, die in Spanien mit rund 100 Milliarden Euro aus Steuergeld gerettet wurden, während Hunderttau-sende ohne Arbeit sind und mit marginalen Sozialleistungen sich selbst über-lassen werden, darunter viele alleinerziehende Frauen. „Denn es fehlen in Spanien keine Wohnungen“, erklärt Jelca Kollatsch, im Gegenteil: Durch den Bauboom stehen ganze Siedlungen leer.
In der Finca „Somonte“ fand sie ihr nächstes Fotoprojekt: Als das teilstaat-liche Landgut zwischen Sevilla und Córdoba zu einem Schleuderpreis an einen Großgrundbesitzer verkauft werden sollte, besetzte die Gewerkschaft SAT das Gut, damit arbeitslose Menschen Landwirtschaft betreiben und davon leben können. Der Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ist eine linksanarchis-
Von CornelIa gIrnDT, Redakteurin der Mitbestimmung
tische Gewerkschaft, die land- und arbeitslose Bauern organisiert in einer Region mit extremer Armut, wo die Gewerkschaft „La tierra a quien la trabaja“ skandiert, dass denen die Erde gehört, die sie bearbeiten. Tatsächlich gehört in Andalusien die Hälfte an Grund und Boden gan-zen zwei Prozent der Bevölkerung. Auch das ist Europa!
All das können wir nachlesen in einem Fotobuch, das die junge Dokumentaristin sehr schön gestaltet hat. Die zweisprachigen Infos und Artikel hat sie mithilfe der spa-nischen Familien und Aktivisten, die ihr die Tür öffneten, übersetzt und getextet – während sie miteinander skypten. Die Hans-Böckler-Stiftung wiederum hat ihren Auslands-aufenthalt und das Fotobuch finanziell gefördert.
Mit dem Fotobuch unter dem Arm hat die Böckler-Stipendiatin inzwischen auch die Haus- und Grundbeset-zerfamilien besucht in Sevilla und auf der Finca „Somon-te“; sie konnten sehen, wie eine junge Deutsche ihren Widerstand und Alltag dokumentiert hat, was ihnen auch Wert und Würde zurückgibt. Und zeigt: In der inneren Zerissenheit Europas gibt es auch Solidarität und Mitge-fühl. ■
Jelca Kollatsch (Hrsg.): jenSeITS Der
KaSTagneTTen-Klänge. Vom Wider-stand gegen die Auswirkungen der Krise. Fotobuch. 99 Seiten, 25 Euro plus Versand und Solibeitrag. Zu beziehen über die Autorin, siehe Infos auf ihrer Homepage: www.kollatsch.com
mehr informationen
jelCa KollaTSCH: „Ein politisches Fotoprojekt machen“
Foto
: Fab
ian
Fiec
hter
49Mitbestimmung 11/2014
POLITIK
Am scheidewegeuropa Was ist zu tun, damit Europa unter der neuen EU-Kommission mit Jean-Claude Juncker an der Spitze den Elan des Neuanfangs zu einem Kurswechsel nutzt und den in der Wirtschaftskrise eingeschlagenen Pfad verlässt? Der Europäische Gewerkschaftsbund bündelte seine Antworten Ende September auf einer großen Konferenz in Brüssel.
Von MargareTe HaSel und anDreaS SCHulTe
Foto
s: E
TU
I 201
4, T
hier
ry R
oge,
Wit
ness
Im
ages
50 Mitbestimmung 11/2014
Für die hochkarätig besetzte Konferenz „Europa am Schei-deweg“ („Europe at a crossroads“) hatten der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) und sein Forschungsinstitut EGI kräftig getrommelt: Vertreter der europäischen Politik so-
wie Experten aus Gewerkschaften und Wissenschaft aus ganz Eu-ropa waren dem Ruf gefolgt. Drei Tage lang debattierten sie über mögliche Wege zu besseren Arbeitsbedingungen und mehr sozialer Gerechtigkeit.
Der Tenor in den Foren und Plenardebatten war kämpferisch – auch wenn keiner der Referenten und Diskutanten den einen Kö-nigsweg aus der Krise aufzeigen konnte. Lösungswege für einzelne Teilbereiche hingegen präsentierten sie in großer Vielfalt. Europas Sparkurs ist eben nicht alternativlos, wie viele Politiker behaupten, und Arbeitslosigkeit wie soziale Ungerechtigkeit lassen sich sehr wohl bekämpfen. Mit dieser These brachte EGB-Generalsekretärin Bernadette Ségol den Ball ins Spiel.
Diesen Ball griffen selbst die politischen Schwergewichte, die die Konferenz auf einem Podium eröffneten, gerne auf. Der scheidende EU-Sozialkommissar László Andor mahnte wortreich „eine Rekons-truktion des europäischen Sozialmodells“ an und forderte insbeson-dere eine „Regulierung der Finanzmärkte“. Andor verteidigte auch die 2013 auf den Weg gebrachte, milliardenschwere Jobgarantie für Jugendliche. „Sie ist kein Placebo.“ Er räumte allerdings Umset-zungsprobleme ein, weil viele EU-Länder bei der Entwicklung ent-sprechender Programme noch hinterherhinken.
„Die nächsten fünf Jahre sind entscheidend, um Vertrauen zu-rückzugewinnen“, unterstrich Pierre Moscovici. Der EU-Wirt-schafts- und Währungskommissar sieht Europa an einem histori-schen Wendepunkt: Viele Bürger würden mittlerweile die Integrität der EU infrage stellen. „Deshalb müssen wir schnell handeln.“ Und beispielsweise für mehr Wachstum sorgen, denn das brauche Euro-pa. Doch der ehemalige französische Finanzminister blieb die Ant-wort schuldig, wie die europäische Politik dies bewerkstelligen will. Eine Kehrtwende weg vom derzeitigen europäischen Sparkurs hin zu mehr öffentlichen Ausgaben kündigte er jedenfalls nicht an: „Bei der derzeitigen Staatsverschuldung ist Wachstum kaum möglich.“ Vorredner Claude Rolin dürfte das nicht gerne gehört haben. Der belgische Gewerkschafter und christdemokratische Europapar-
foruM zur weTTBewerBSfäHIgKeIT MIT ÖKonoM CollIgnon (l.), egI-DIreKTorIn jepSen unD egB-
SeKreTär nIeMIeC; egB-generalSeKreTärIn Segol unD BuSIneSSeurope-vorSTanD Beyrer; foruM
zur BeSCHäfTIgungSpolITIK MIT IMK-forSCHer waTT (2.v.l.); ep-präSIDenT SCHulz IM geSpräCH
MIT eu-wIrTSCHafTSKoMMISSar MoSCovIzI (IM uHrzeIgerSInn): Historischer Wendepunkt
foruM europa
Vom Sozialmodell zum Sozialdumping?
Zur Bekämpfung von Sozialdumping und Schwarzarbeit fehlt es den Staaten an grenzübergreifenden Kontrollmöglichkei-ten. Die EU-Erweiterung hat das Problem verschärft. Die im Frühjahr verabschiedete sogenannte Durchsetzungsrichtlinie zur Entsenderichtlinie verspricht keine Besserung. Mittlerwei-le sind Fälle bekannt, in denen Philippiner für 2,40 Euro pro Stunde Lkw fahren. „Wir müssen die Arbeitnehmerrechte EU-weit stärken und Sanktionen für Unternehmen entwi-ckeln“, fordert Veronica Nilsson, politische Sekretärin beim EGB. Volker Telljohann vom Institut für Sozialforschung (IRES) Emilia-Romagna: „Um Lohndumping durch Outsourcing in den Griff zu kriegen, müssen Gewerkschaften ihre Strategie nicht nur nach Betrieben und Branchen, sondern auch stärker an Wertschöpfungsketten ausrichten.“
foruM grÜne joBS
Mythos oder Wahrheit?
Die Investitionen in die regenerativen Energien gehen welt-weit seit 2011 zurück. Der Grund ist unter anderem eine starke Lobby für fossile Kraftstoffe. Ärgerlich, denn die Öko-energie in Europa könnte durchaus für neue Jobs sorgen. Gewerkschaften beäugen die grüne Energie misstrauisch, weil sie Arbeitsplätze in angestammten Branchen bedroht. „Die Klimadebatte ist die Achillesferse der Gewerkschaften, sie ver-treten keine eindeutige Position“, sagte Diskutant und ETUI-Sprecher Willy de Baecker. Neue Investitionen sollen neuen Schwung bringen. Zwei Prozent des europäischen Bruttoin-landsprodukts fordert die Industriegewerkschaft IndustriAll Europe für Investitionen in die Infrastruktur. „60 bis 70 Pro-zent davon sollen in die Energiewende fließen“, sagte Gene-ralsekretär Ulrich Eckelmann.
51Mitbestimmung 11/2014
POLITIK
Eine ausführliche multimediale Dokumentation der dreitägigen Konferenz „Europe at a crossroads“ unter: http://bit.ly/zu2lxg
MeHr InforMaTIonen
lamentarier forderte mehr Geld zur Bekämpfung der Arbeitslo-sigkeit. 50 Prozent weniger Arbeitslose solle sich Europa bis 2020 zum Ziel setzen.
Auch Martin Schulz wählte markige Worte. Der Präsident des Europäischen Parlaments sprach von einer „höchst explosiven Lage in Europa“ und von der „Bedrohung der Demokratie durch wach-sende soziale Ungleichheiten“. Er forderte alle EU-Staaten auf, ent-sprechend ihrer Leistungsfähigkeit Mindestlöhne einzuführen, um die Nachfrage anzukurbeln. Auch prangerte er die Steuerhinterzie-hung durch Unternehmen an.
Schulz’ Forderung nach mehr Nachfrage geht einigen Wissen-schaftlern aber nicht weit genug. Das wurde gleich in mehreren der insgesamt 16 Foren und vier Plenardebatten deutlich. So forderten Prakash Loungani vom Internationalen Währungsfonds, IWF und Andrew Watt vom Düsseldorfer Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK, Angebot und Nachfrage zugleich zu stärken. Beide zeigten sich überzeugt, dass sich Arbeitslosigkeit ver-meiden lasse. Als Indiz führte Watt die unterschiedlichen Arbeitslo-senquoten in Europa bei ähnlichen Voraussetzungen an. Nur einige Staaten hätten ihre Hausaufgaben gemacht, andere leider nicht, sagte er.
Häufig wurden in den Foren strukturelle Gründe für die Krise in der EU ausgemacht. Stellvertretend für viele vermisste beispielswei-se Stefan Collignon, Professor für Ökonomie an der Sant’Anna Hochschule in Pisa, in den politischen Institutionen Europas den dezidierten Willen zur Marktregulierung. Einigkeit herrschte vor allem auch beim Ruf nach einem umfassenden Investitionsprogramm zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum.
Kontrovers indes verlief der Abschluss der Konferenz. Bernadette Ségol hatte sich Markus Beyrer eingeladen. Der Vertreter von Busi-ness Europe, dem europäischen Dachverband der Arbeitgeber, kon-terte Ségols Forderung nach einem umfassenden Investitionspro-gramm zur Schaffung von Wachstum und Arbeitsplätzen. Er beharrte auf dem eingeschlagenen Weg der europäischen Sparpoli-tik und forderte ein unternehmerfreundliches Umfeld. Der Wettbe-werb werde für bessere Arbeitsbedingungen sorgen. Einig zeigten sich beide darin, dass die Krise nur gemeinsam von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bewältigt werden kann. „Wir brauchen den sozialen Dialog.“ ■
foruM alTernDe BelegSCHafTen
Welche Arbeitsbedingungen brauchen wir?
Deutschland verliert jedes Jahr altersbedingt 400 000 Arbeits-kräfte. Um das derzeitige Produktionsniveau zu halten, müs-sen die Menschen länger arbeiten. Das Gesundheitsmanage-ment der Arbeitgeber reicht nicht aus, um Arbeitnehmer länger im Job zu halten. Nur rund 20 Prozent aller Berufe gel-ten als nicht gesundheitsbelastend, dazu zählen Ingenieur und Manager. Andere hingegen, meist wenig qualifizierte Tätigkei-ten, machen krank. Und: Je länger die Menschen arbeiten, desto unterschiedlicher der Gesundheitszustand zwischen die-sen beiden Gruppen. Hans-Martin Hasselhorn, Wissenschaft-ler an der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA): „Der übergang in die Rente muss flexibler gestaltet werden.“
foruM loHnSCHere
Muss es weiterhin so sozial ungerecht zugehen?
Seit 1990 geht die Schere bei den Einkommen in den großen Industrienationen auseinander. Der Niedriglohnsektor wächst. „Reiche und Unternehmen müssen ihre Steuern endlich in dem Land zahlen, in dem sie Gewinne erwirtschaften“, fordert Anne Demelenne vom belgischen Gewerkschaftsbund FGTB. „Denkbar ist auch eine Abgabe der Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeitsplätzen.“ Und: „Eine Anhebung der Mindestlöhne und weniger Steuern für Geringverdiener können ein Gegen-gewicht bilden“, sagt Bea Cantillon, Leiterin des Zentrums für Sozialpolitik an der Uni Antwerpen.
foruM DIenSTleISTungSSeKTor
Ist Deregulierung unvermeidlich?
Niedrige Löhne sind der falsche Weg, um den Dienstleistungs-sektor anzukurbeln. Untersuchungen zeigen, dass selbst bei kürzeren Arbeitszeiten als bislang üblich mehr Nachfrage erzielt werden kann. Voraussetzung ist eine neue Aufteilung von Ar-beitszeiten innerhalb von Erwerbshaushalten. Auch sei ein we-niger gespreiztes Gehaltsgefüge innerhalb einer Volkswirtschaft gut für den Dienstleistungssektor. Aber: „Um Arbeitszeiten anzupassen, müssen wir Tarifabkommen stärken“, sagt Ar-beitsforscher Gerhard Bosch von der Uni Duisburg-Essen. Auch deshalb klaffen Gehälter weit auseinander: „Die EU behandelt den Mindestlohn stiefmütterlich“, sagt Wiemer Salverda, Pro-fessor am Institut für Arbeitsforschung (AIAS) in Amsterdam.
52 Mitbestimmung 11/2014
Die Kraft der Erinnerung
zeITgeSCHICHTe Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter hatten nach 1945 einen wesentlichen Anteil am Aufbau der sozialen Demokratie. Doch in der Geschichtsschreibung
und im kulturellen Gedächtnis der Bundesrepublik sind sie unterrepräsentiert. Das Oral- History-Projekt „Individuelle Erinnerung und gewerkschaftliche Identität“ will das ändern.
Von Ingo zanDer, Journalist in Kerpen bei Köln
DIe eHeMalIgen vorSITzenDen MonIKa
wulf-MaTHIeS, ÖTv (2.v.l.), unD gISBerT
SCHleMMer, gHK (r.), anfang aprIl 2014
auf eIneM feS-poDIuM In Bonn: Genauerer Blick auf die innere Demokratisierung Deutschlands nach 1945
Foto
: Jür
gen
Seid
el
WIssEN
Als Monika Wulf-Mathies 1982 zur ÖTV-Vorsitzenden gewählt wurde, kam das einer Sensation gleich. Niemand hatte damit ge-rechnet, dass es eine Frau in diesem Männer-
club an die Spitze schaffen würde. Bei der Wahl „stand eine Frau und Intellektuelle gegen einen gestandenen Ge-werkschafter von altem Schrot und Korn, das passte vie-len nicht“, erinnert sich die heute 72-Jährige. „Die gesam-te veröffentlichte Meinung war damals gegen mich.“ Sogar die linksliberale „Frankfurter Rundschau“ habe damals von „Bizeps“, „Stallgeruch“ und „Ochsentour“ schwadroniert, die einen „glaubwürdigen Gewerkschafts-führer“ ausmachen. In der ÖTV hingegen habe man er-staunlich differenziert diskutiert. „Um neue Mitglieder-schichten zu gewinnen, glaubten viele, sei auch ein neuer Typ Gewerkschafter erforderlich, also weniger Faust auf den Tisch, was Heinz Kluncker in seiner ganzen Breite, die jeden Bildschirm ausfüllte, gezeigt hatte“, so Wulf-Mathies.
Die ehemalige ÖTV-Vorsitzende – und spätere EU-Kommissarin – ist eine von 31 führenden Gewerkschaf-tern der Nachkriegszeit, die sich für das Projekt „Indivi-duelle Erinnerung und gewerkschaftliche Identität“ zur bio grafischen Spurensuche aufmachten und einem For-scherteam unter Federführung des Archivs der sozialen Demokratie in der Friedrich-Ebert-Stiftung Rede und Antwort standen. Ziel dieses von der Hans-Böckler-Stif-tung geförderten Projekts ist es, „Erinnerungen von Pro-tagonistinnen und Protagonisten der deutschen Zeitge-schichte nicht nur für die Geschichtswissenschaft, sondern auch für die historisch- politische Bildung zu sichern“, formuliert Projektkoordinator Stefan Müller. Zumal von diesem Personenkreis – anders als etwa von Spitzenpoli-tikern oder Unternehmern dieser Generation – bisher kaum Autobiografien oder andere Selbstzeugnisse vorlie-gen. Neun der Befragten waren Frauen, einer hatte einen Migrationshintergrund. Damit spiegeln die Führungspo-sitionen der westdeutschen Gewerkschaften in etwa die gesellschaftlichen Machtverhältnisse der alten Bundesre-publik wider.
TarIfverHanDlungen auf Der frauenToIleTTe_ Die promovierte Historikerin Monika Wulf-Mathies, Jahr-gang 1942, trat 1972 in die ÖTV ein. Mit Blick auf Her-
kunft und Beruf war das eher ungewöhnlich: Ihr Vater, den die Tochter als „Schöngeist“ beschreibt, hatte in der Finanzverwaltung gearbeitet, ihre Mut-ter hatte sich „durchbeißen müssen und es dann schließlich bis zur Abteilungs-leiterin in einer Krankenkasse gebracht“. Sie selbst arbeitete damals im Bun-deskanzleramt unter Willy Brandt.
Freimütig erzählt Monika Wulf-Mathies in ihrem Interview unter anderem darüber, wie sie sich in ihrer ersten Tarifrunde behauptete. „Für die Arbeit-geberseite führte damals die niedersächsische Finanzministerin Birgit Breuel (CDU) die Verhandlungen.“ Erstmals rückten also zwei Frauen in die bis dato in einer reinen Männerrunde geführten Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes ein. „Breuel und ich waren politisch so gegensätzlich, wie man sich das nur denken konnte.“ Die beiden Frauen waren sich aber auch stillschwei-gend einig, dass sie den Chauvinisten in ihren Reihen nicht das Vergnügen bereiten wollten, genüsslich zu beobachten, wie sich die beiden ehrgeizigen Frauen gegenseitig mit Schlamm bewerfen: „Als wir uns einmal zufällig auf der Damentoilette trafen, stellten wir überrascht fest, dass dies ein Ort für informelle Gespräche sein kann, der Frauen in einer männerdominierten Welt verschlossen war.“
54 Mitbestimmung 11/2014
MIT freMDSpraCHenKennTnISSen gepunKTeT_ Die gewerkschaftlichen Erfahrungen von Ruth Köhn, die von 1970 bis 1988 Mitglied im Hauptvor-stand der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten war, reichen in die unmittelbare Nachkriegszeit zurück. 1927 in Berlin geboren, ist sie die Ältes-te der befragten Zeitzeugen. Aus finanziellen Gründen konnte die Tochter eines Kraftfahrzeugmechanikers trotz Abitur nach dem Krieg nicht studieren. Sie lernte Steno-grafie und Schreibmaschine und absolvierte eine Ausbil-dung als Dolmetscherin. 1948 wurde sie NGG-Mitglied. Eine Tante, die schon vor 1933 Mitglied war, hatte sie mit gewerkschaftlichem Gedankengut vertraut gemacht. Seit 1949 war sie als hauptamtliche Gewerkschaftssekretärin für die Fach-gruppe Süßwaren und Tabak sowie Frauen, Jugend und Bildung tätig. Voller Stolz erinnert sie sich an den gewerkschaftlichen Kampf für das Betriebsver-fassungsgesetz und die Mitbestimmung Anfang der 50er Jahre: „Wir hatten eine Großveranstaltung in den Messe hallen am Funkturm in Berlin, wo sich die Gewerkschaften versammelten, um für die Mitbestimmung zu demonst-rieren. Ich durfte vor diesem großen Publikum für meine Gewerkschaft die
Stellungnahme vortragen. Das machte mich stolz.“ Köhn war wissbegierig und besuchte das Abendseminar der Hochschule für Politik in Berlin. „Ich fand es immer scha-de, dass nur ich Abitur hatte und die Kolleginnen und
Kollegen nur die Hauptschule besucht hatten.“ Sie enga-gierte sich deshalb auch in der gewerkschaftlichen Bil-dungsarbeit.
Gewerkschafter mit Fremdsprachenkenntnissen gab es damals kaum – deshalb lief es geradezu zwangsläufig da-rauf hinaus, dass Ruth Köhn immer zur Stelle sein muss-te, wenn ihre Gewerkschaft auf internationalem Par-
MonIKa wulf-MaTHIeS, 1992 vor IHrer wIeDerwaHl zur
vorSITzenDen auf DeM ÖTv-gewerKSCHafTSTag, unD 2014
BeI Der feS In Bonn: „Was ist der rote Faden in meinem Leben?“
Über 100 Interviewstunden warten jetzt im FES-Archiv darauf, zur Deutung der Zeitgeschichte herangezogen zu werden.
Foto
s: J
ürge
n Se
idel
55Mitbestimmung 11/2014
WIssEN
kett Präsenz zeigen musste. So überrascht es kaum, dass sie im NGG- Hauptvorstand, dem sie von 1970 bis 1988 angehörte, auch für Internatio-nales zuständig war. „Ich habe mich als Delegierte bei der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf dafür eingesetzt, dass Nachtarbeit – außer in lebensnotwendigen Bereichen wie im Krankenhaus – verboten bleibt“, er-innert sich Köhn an ein Politikfeld, das ihr wichtig war – und bis heute ist: „In diesem Punkt haben wir verloren, obwohl arbeitsmedizinisch klar belegt ist, dass Nachtarbeit gesundheitsgefährdend ist.“
QuellenSICHerung DanK oral HISTory_ Die jeweils mehrstündigen In-terviews liefen in zwei Phasen ab. In einem ersten Teil erzählten die Zeitzeugen über ihren Lebensweg, über prägende Erfahrungen in der Kindheit und Jugend, den Eintritt in die Gewerkschaft sowie über ihren beruflich-politischen Wer-degang. „Es kostet erst einmal eine gewisse Überwindung, über sein Leben nachzudenken, um es am Stück zu erzählen“, räumt Monika Wulf-Mathies ein. „Was ist der rote Faden in meinem Leben?“ Das erleichterten in einem zweiten Teil die Interviewer mit Leitfragen und Nachfragen, mit denen sie die Zeitzeugen anregten, ihre Erinnerungen vor dem Hintergrund der heutigen Probleme gewerkschaftlicher Arbeit zu vertiefen.
Dabei folgten die Interviewer einem weichen Verständnis der sogenannten Oral-History-Methode. Im strengen Sinne basiert dieses Verfahren auf dem freien Sprechenlassen von Zeitzeugen, ohne Steuerung durch den Interviewer, wie sie teilweise in der Ethnologie zur Anwendung kommt. In der deutschen Geschichtswissenschaft wurde mit Zeitzeugeninterviews bislang vor allem gearbeitet, um die Geschichte des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkrie-ges und des Holocaust zu erhellen. Mit ihrer Hilfe nun auch einen genaueren Blick auf die Geschichte der inneren Demokratisierung Deutschlands nach 1945 zu werfen ist ein Verdienst des Projekts von Hans-Böckler- und Friedrich-Ebert-Stiftung.
„wIr“ STaTT „ICH“_ Die meisten der befragten ehemaligen deutschen Spitzen-gewerkschafter wuchsen in Arbeiterhaushalten auf, kommen aus sogenannten „kleinen“ Verhältnissen. Die Ausnahme bildet Detlef Hensche, der ehemalige Vorsitzende der IG Medien, als Sohn eines wohlhabenden Unternehmers aus Wuppertal. Etwas aus der Reihe fällt auch Gisbert Schlemmer, von 1993 bis 1999 Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Holz und Kunststoff (GHK), des-sen Vater eine Drogerie leitete. „Von meinen Eltern hatte ich nichts über die Gewerkschaften erfahren“, sagt Gisbert Schlemmer den Interviewern.
Schlemmer, Jahrgang 1946, hatte das Gymnasium vorzeitig verlassen und vagabundierte in verschiedenen Hilfsarbeiterjobs, schließlich machte er eine Ausbildung als Speditionskaufmann. In einem Möbelunternehmen mit rund 650 Mitarbeitern im Rheingau war er danach für die Disposition der Fahrer zuständig, die die Möbel im Direktvertrieb in ganz Deutschland verkauften. „Der Besitzer führte sein Unternehmen nach Gutsherrenart“, so Schlemmer. Da er selbst zu den Fahrern ein Vertrauensverhältnis aufbauen konnte, klag-ten diese ihm bald ihr Leid „über Willkür jeder Art und Gehaltskürzungen“. Das habe ihn empört und politisiert. Als er feststellen musste, dass Gespräche mit dem Firmeninhaber fruchtlos blieben, nahm er Kontakt mit der Gewerk-schaft Holz und Kunststoff auf. Auf deren Anraten gründete er zusammen mit Kollegen den ersten Betriebsrat im Unternehmen. „Dann war ich plötzlich der jüngste freigestellte Betriebsrat in Hessen.“
ngg-vorSTanDSfrau ruTH KÖHn, auf eIner ngg-
Konferenz In Den 60er jaHren, unD 2014 BeI Der
feS In Bonn: „Das machte mich stolz.“
Foto
s: p
riva
t; J
ürge
n Se
idel
56 Mitbestimmung 11/2014
Auf der Webseite www.zeitzeugen.fes.de werden aus jedem der 31 Interviews mit ehemaligen Spitzen-gewerkschaftern – u.a. mit Hans Berger, Ilse Brusis, Hermann Rappe, Dieter Schulte, Klaus Zwickel – Video sequenzen präsentiert. Daneben gibt es Ab-schriften der Sequenzen sowie biografische Angaben zur Person. Die vollständigen Abschriften der Inter-views sind im Lesesaal des Archivs in Bonn einsehbar.
MeHr InforMaTIonen
BIografIen fÜr DIe BIlDungSarBeIT_ Insgesamt warten jetzt über 100 Stunden Interviews – gesichert auf Video und transkribiert – im Bonner Archiv der sozialen Demokratie darauf, zur Deutung der Zeitgeschichte herangezogen zu werden. Wer in den transkribierten Interviews liest, wird feststellen, dass die Interviewten lieber vom „Wir“ als vom „Ich“ reden. Dieses „Wir“-Nar-rativ bestätigt zunächst den englischen Sozial- und Wirtschaftshistoriker Eric Hobsbawm, der diese Erfahrung der Arbeiterbewegung in seinem Klassiker „Das Zeitalter der Extreme“ im Kapitel über die „goldenen Jahre 1945 bis 1990“ so auf den Punkt gebracht hat: „Alle Anstrengungen hatten ihre Kraft einst aus der gerechtfertigten Überzeugung der Arbeiter geschöpft, dass Men-schen wie sie Fortschritte nicht durch Einzelaktionen, sondern durch kollek-tive und vorzugsweise von Organisationen gesteuerte Aktionen erreichen konnten, ob in Gestalt gegenseitiger Hilfe, Streiks oder Wahlen.“ Der „Ich-Habitus“ galt in der gewerkschaftlichen Sozialisation lange Zeit als verpönt.
Doch in den über 100 Interviewstunden gewinnen die 31 befragten Ge-werkschafterinnen und Gewerkschafter, die bis in die 90er Jahre führende Positionen innehatten, auch als Individuen Konturen und nehmen über ihre Erinnerungen an Erfolge und Niederlagen als Persönlichkeiten Gestalt an.
Dass sie sich diesen Erinnerungen stellen und bereitwillig Auskunft über ihr Leben, ihr Wollen und Wirken geben, damit helfen sie, eine Leerstelle in der Bildungsarbeit zu füllen, denn „es gibt eine Sehnsucht nach Lebensge-schichte in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit – insbesondere bei den jun-gen Mitgliedern“, beobachtet Ulrike Obermayr, Leiterin Gewerkschaftliche Bildung beim Vorstand der IG Metall. Damit können die ehemaligen gewerk-schaftlichen Führungskräfte auch Reflexionen bei ihren Nachfolgern über die eigene Rolle auslösen. So gibt Gisbert Schlemmer zu verstehen, er habe stets darum gewusst, dass das gesellschaftliche Image eines Gewerkschaftsfunkti-
onärs keineswegs nur positiv besetzt sei: „Je höher die Position, desto größer die Gefahr, dass man selbst abhebt.“ Deswegen habe er sich, während er auf der Karriereleiter nach oben stieg, immer wieder die Frage gestellt: „Was würde jetzt mein Kollege, der als Betriebsrat in seiner Firma mit den alltäglichen Problemen konfrontiert wird, über mein Verhalten und meine Entscheidungen denken?“
Und – so formulieren es die wissenschaftlichen Pro-jektverantwortlichen – „sie ermöglichen das historische Ausmessen des gesellschaftlichen Wandels von politischem Selbstverständnis und gewerkschaftlicher Identität aus der Perspektive zentraler Akteure “. Das soll nun in einem – ebenfalls von der Stiftung geförderten – Projekt „Gewerk-schafterinnen und Gewerkschafter als Akteure der Zeit-geschichte“ in Angriff genommen werden. ■
gHK-vorSITzenDer gISBerT
SCHleMMer, 1995 BeIM gewerK-
SCHafTSTag Der gHK, unD 2014
BeI Der feS: „Was würde mein Kollege im Betriebsrat sagen?“
Foto
s: J
ürge
n Se
idel
57Mitbestimmung 11/2014
WIssEN
100 Jahre sind es her, seit in Europa „die Lichter ausgingen“, wie das Lord Grey, der britische Außenminister, bei Ausbruch des Ers-ten Weltkriegs formulierte. Und er ging davon aus, dass sie wohl zu seinen Lebzeiten nicht mehr angehen würden. In der Tat wurde die Geschichte Europas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts viel-fach als Geschichte eines „dunklen Kontinents“ erzählt. Es war die Geschichte einer zerstörerischen Moderne, wie sie grausamer kaum sein könnte. Zu ihr gehören die Gräuel der Weltkriege ebenso wie Genozide, besonders die systematische Ermordung der europäischen Juden, ethnische Säuberungen, Seuchen und Hungerkatastrophen.
Die Erinnerung an die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs hat-te in Deutschland die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg überdeckt. Der musste erst wiederentdeckt werden. Dabei standen die Bücher von Christopher Clark und Herfried Münkler im Vordergrund, bei-des erzählerische Meisterwerke. Sie nähern sich dem Ersten Welt-krieg vor allem aus dem Blickwinkel der Diplomatiegeschichte und der Geschichte der „großen Männer“ – mit einem Geschichtsbild, das, karikaturhaft überzeichnet, davon ausgeht, dass Krieg droht, wenn Reichskanzler Bethmann Hollweg eine Depression bekommt. Als Sozial- und Kulturhistoriker kann man das nur bedauern.
Welche Lehren wurden aus dem Krieg gezogen? Sowohl Clark als auch Münkler argumentieren nicht nur gegen die angeblich do-minante These von der Alleinschuld Deutschlands am Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Mehr noch bekommt man den Eindruck, dass die Serben, die Österreicher und die Russen allesamt „schuldiger“ am Kriegsausbruch waren als die Deutschen.
Daraus zogen wiederum andere Historiker den Schluss: War Deutschland nicht schuldig am Ersten Weltkrieg, so müsse man nun auch den Vertrag von Versailles und seine Folgen – einschließlich des Nationalsozialismus – einer Neubewertung unterziehen, und das Projekt der Europäischen Union werde damit für die Deutschen nicht mehr zur notwendigen Schlussfolgerung aus der deutschen Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Man sollte solchen revisionistischen Thesen mit Vorsicht begeg-nen. Dass aus dieser steilen These kein neuer Historikerstreit her-vorgegangen ist, verwundert. Meine Antwort darauf ist ein dezi-diertes Nein. Die deutschen Eliten hätten es im Sommer 1914 in der Hand gehabt, durch eine umsichtigere Politik den Krieg zu verhin-dern. Dass sie es nicht taten, lastet ihnen eine erhebliche Schuld am Kriegsausbruch an, auch wenn es in anderen Staaten auch Verant-wortliche gegeben hat, die deeskalierend hätten wirken können.
Der Erste Weltkrieg ist und bleibt die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, sie begründet eine Spirale der Gewalt, die im Genozid an den Armeniern, dem Zweiten Weltkrieg, in ethnischen Säube-rungen und in der Shoah gipfelt. Die oftmals über Jahrhunderte bestehende Feindschaft der europäischen Nationalstaaten war ein wichtiger Faktor, der Europa in der ersten Jahrhunderthälfte zum dunklen Kontinent werden ließ. Darüber hinaus waren es auch die tiefen sozialen Verwerfungen, die antidemokratische Bewegungen beförderten, den Bolschewismus wie den Faschismus stark werden ließen und damit der parlamentarischen Demokratie in der Zwi-schenkriegszeit ihre stärkste Krise bescherten.
„Die deutschen Gewerkschaften als starke Stütze des europäischen Gedankens ziehen die richtige
Lehre aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts.“
ZUR sAchE
Stefan Berger über die Lehren aus zwei Weltkriegen
Foto
: RU
B
Stefan Berger ist Historiker und Direktor des Instituts für Soziale Bewegungen, Ruhr-Uni Bochum.
58 Mitbestimmung 11/2014
Jutta Höhne freut sich über den jüngsten Zuwachs auf den Webseiten des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts: Der WSI-Verteilungsmo-nitor, den sie grafisch fürs Netz umgesetzt hat, ist jetzt online. Seit eineinhalb Jahren optimiert Höhne die Internetpräsenz des WSI. Sie strukturiert entlang der fünf Forschungsbereiche, renoviert und internationalisiert die Seiten – auf Englisch und mit einem neuen Europabereich. Und weil ihre Wissen-schaftler-Kollegen permanent produzieren, stehen auch ständig Projekte Schlange, die von ihr fürs Netz aufbereitet werden. Daneben setzt die Berli-nerin, die zuvor am WZB war, ihre eigenen Forschungen zur Arbeitsmarkt-integration von Migranten fort, wobei sie bei der Datenanalyse „am liebsten mit komplexen statistischen Modellen“ arbeitet. ■
wIr – DIe HanS-BÖCKler-STIfTung
Foto
: Kar
sten
Sch
öne
Auch 2014 ist richtig, was nach 1945 richtig war: Aus dieser europäischen Geschichte den Schluss zu ziehen, ein gemeinsames, friedliches und so-ziales Europa bauen, das tief sitzende nationale Feindschaften überwindet und dazu beiträgt, dass sich die europäischen Gesellschaften ein-ander annähern – mit dem Ziel, ihre Gesell-schaften sozial zu gestalten und das Trennende zu überwinden.
Selbst wenn das europäische Projekt nach wie vor stark nationalstaatlich geprägt ist, auch wenn es an Konstruktionsmängeln leidet – die deutschen Gewerkschaften als eine starke Stüt-ze des europäischen Gedankens ziehen für mei-ne Begriffe damit die richtige Lehre aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts. ■
InTerneTpräSenz IM wSI
Jutta Höhne, Telefon: 02 11/77 78-582, [email protected]
Die Online-Frau vom WSI
„eIn SozIaleS europa IST DaS zIel“ heißt die Konferenz am 20./21. November 2014 in Düsseldorf, die die Hans-Böckler- Stiftung mit dem DGB und dem Institut für soziale Bewegungen der Ruhr-Universität Bochum veranstaltet. Mehr Infos unter: www.boeckler.de
MeHr InforMaTIonen
59Mitbestimmung 11/2014
AUs DER sTIfTUNG
Foto
s: R
olf
Sch
ulte
n
Dass standardisierte Arbeitszeiten zu manchen Lebensphasen besser und zu anderen schlechter passen, bemängeln Wissenschaftler seit Langem. Vorschläge, die Arbeit anders auf eine Lebensspanne zu verteilen, gibt es viele. Doch das Thema gilt als kompliziert, da es in Fragen der gesundheitlichen Prävention ebenso eingreift wie in die Familien- und Arbeitspolitik. Gleich zwei Veranstaltungen be-fassten sich daher Mitte Oktober mit dem konfliktträchtigen Ver-hältnis von Arbeit und Leben. „Wer schneller lebt, ist früher fertig“ lautet der Titel einer arbeitszeitpolitischen Tagung, die die Hans-Böckler-Stiftung zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) organisierte. Dort waren familienorientierte Arbeitszeiten, lebens-langes Lernen und Altersübergänge das Thema. Fast parallel fand in Berlin eine Tagung des DGB statt. Unter dem Titel „Lebenspha-senorientierte Arbeitszeiten“ widmete auch sie sich der Frage, was gebraucht wird, um Männern und Frauen „eine selbstbestimmte Erwerbsbiografie“ zu ermöglichen – und welchen Beitrag individu-elle und kollektive Vereinbarungen in den Betrieben leisten.
Zur ersten Tagung war Bundesarbeitsministerin Nahles angereist, um in einem Grußwort von eigenen, manchmal frustierenden Kita-
Erfahrungen zu berichten. Es gehe ihr nicht darum, den Achtstun-dentag infrage zu stellen, sondern um „lebensbegleitende Arbeitszei-ten“, die es Frauen wie Männern ermöglichen, Auszeiten für die Kindererziehung zu nehmen, freigestellt zu werden, wenn ein Pflege-bedürftiges Familienmitglied dies erfordert, wenn sie sich weiterbilden oder für einen gewissen Zeitraum stärker ehrenamtlich engagieren wollen. „Flexibilität“, so Nahles, „fand bisher selten zugunsten der Beschäftigten statt.“ Taktgeber sei das „betriebliche Interesse“ gewe-sen. Doch das müsse sich ändern: „Wir brauchen eine neue Flexibi-lität im Interesse der Beschäftigten.“ Die Mehrheit der Beschäftigten unterstützt solche Ideen – wenn die finanziellen Einbußen nicht so groß werden. Bei der letzten großen Beschäftigtenumfrage der IG Metall etwa kam heraus, dass rund 60 Prozent aller Elternpaare ger-ne beide ihre Arbeitszeit reduzieren würden, um Zeit für den Nach-wuchs zu haben. Tatsächlich aber gelingt dies nur 14 Prozent der Eltern, wie Michael Neumann, Doktorand am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), berichtete.
Für solche Befunde seien auch widersprüchliche Anreize verant-wortlich, die die Politik setze, erklärte Claudia Bogedan, Leiterin
arBeITSzeITpolITIK Wie können Arbeitszeiten menschlicher werden, um die Vereinbarkeit mit Familienaufgaben oder Weiterbildung zu verbessern? Letztlich müsse die Politik für alle den Rahmen setzen, so das Fazit von zwei Tagungen von Böckler-Stiftung, FES und DGB.
flexibilität für die Beschäftigten
60 Mitbestimmung 11/2014
der Abteilung Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung, auf der gemeinsam mit dem DGB veranstalteten Tagung. So habe sich beispielsweise das gutgemeinte Recht auf Teilzeitarbeit in der Rea-lität als Teilzeitfalle erwiesen, und müsse dringend um ein Rück-kehrrecht auf Vollzeit ergänzt werden. „Recht muss sich weiterent-wickeln, um passförmige Antworten auf gesellschaftliche Problemlagen zu geben“, sagte sie. „Dewegen brauchen wir heute ein Recht auf eine selbstbestimmte Erwerbsbiografie.“
reCHT auf SelBSTBeSTIMMTe erwerBSBIografIe_ Die Politik nähert sich diesem Vorschlag nur zögerlich. Das Teilzeit- und Be-fristungsgesetz soll reformiert werden, um das Rückkehrrecht aus der Teilzeit zu verankern. Im nächsten Jahr kommt außerdem das ElterngeldPlus, das mehr Partnermonate für Männer vorsieht. Und gleichzeitig hat Familienministerin Manuela Schwesig dafür gesorgt, dass Beschäftigte für die Pflege über längere Zeit freigestellt werden können. Nur finanzieren müssen sie die Zeit selber. Ginge es nach der Familienministerin, würde sie gerne noch eine „Familienarbeits-zeit“ einführen. Die Idee: Elternpaare sollen nach der Elternzeit drei Jahre lang finanzielle Unterstützung bekommen, wenn beide Partner ihre Arbeitszeit reduzieren und jeweils 32 Stunden arbeiten. Micha-el Neumann vom DIW ist jedoch der Meinung, dass nur wenige das Angebot annehmen würden. Bisher reduziert nur ein Prozent aller Elternpaare gemeinsam die Arbeitszeit, um zusammen mehr Zeit
für die Kinder zu haben. Dieser Prozentsatz, so die DIW-Prognose, würde mit der Familienarbeitszeit allenfalls auf knapp zwei Prozent steigen. Neumann gibt zu: „Wir hatten größere Effekte erwartet.“
Svenja Pfahl, Geschäftsführerin des Instituts für Sozialwissen-schaftlichen Transfer (SowiTra), hält das Modell ohnehin für zu eng: „Da, wo Frauen arbeiten, gibt es die 32-Stunden-Woche oft gar nicht.“ Denn zwei Drittel aller Frauen arbeiten Teilzeit, häufig mit niedrigem Stundenkontingent. Pfahl und ihr Institut haben sich die pflegesensiblen Arbeitszeiten näher angeschaut. Immerhin werden in weniger als 20 Jahren in Deutschland mehr Pflegebedürftige leben als Kinder unter sechs Jahren. „Pflegesensibel ist die Arbeitszeit, wenn sie sich der Pflege anpassen kann“, sagte Pfahl. Denn der Bedarf an Zeit variiert. Zu Beginn benötigen viele eine Auszeit, um das Pflegenetzwerk zu organisieren. Während der Pflege, die Jahre dauern kann, brauchen die meisten Pflegenden einen pflegegerechten Vollzeitarbeitsplatz, der auch mal kürzere Arbeitszeiten zulässt. Und in der Phase der Sterbebegleitung ist erneut eine Auszeit vom Job nötig. Was Pfahl kritisiert: „Die Finanzierung dieser Phasen ist bis-her nicht geregelt. Sie bleibt an den Pflegenden hängen.“ Ihr Fazit: „Pflege ist als gesellschaftliche Arbeit noch immer nicht anerkannt.“
rÜCKKeHrreCHT fÜr alle_ Ob dagegen Kindererziehung als ge-sellschaftliche Aufgabe ausreichend anerkannt ist, ließen beide Ver-anstaltungen offen. Christina Klenner, Referatsleiterin für Gender-forschung am WSI in der Hans-Böckler-Stiftung, untersucht zurzeit, wie Arbeitszeitoptionen im Betrieb genutzt werden. In rund einem Viertel aller Betriebe existiert erst gar nicht die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten. Denn das Recht auf Teilzeit gilt nur in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten. „Häufig nehmen Beschäftigte Optionen gar nicht wahr, weil sie sich nicht wirklich berechtigt fühlen“, sag-te Klenner. Wichtig sei auch die Unternehmenskultur. „Vieles, was zunächst unmöglich scheint, ist in Wirklichkeit einfach eine arbeits-organisatorische Frage.“ Trotzdem überlegen es sich viele Frauen sehr genau, ob sie von einem Vollzeitjob in Teilzeit gehen sollen. Immerhin bedeutet das für die Kollegen häufig Mehrarbeit. Dieje-nigen, die dann in Teilzeit gehen, werden nicht selten abgewertet, fand Klenner heraus.
Wie Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen versuchen, solche Lücken wenigstens teilweise zu schließen, schilderten Christina Klen-ner und ihre Böckler-Kollegin Manuela Maschke, Leiterin des Ar-chivs Betriebliche Vereinbarungen der Hans-Böckler-Stiftung. So ist in Betriebsvereinbarungen häufig das Rückkehrrecht auf Vollzeit festgeschrieben. Im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wird Teilzeit in der Regel befristet. In der Chemieindustrie können Be-schäftigte, die einen Angehörigen pflegen wollen, die Arbeitszeit um die Hälfte reduzieren und bekommen 65 Prozent ihres Gehalts. „Schwierig wird es immer dort“, so Maschke, „wo kein Betriebsrat existiert.“ Und das trifft auf gut die Hälfte aller Beschäftigten zu. ■
Von KarIn floTHMann, Journalistin in Berlin
BunDeSarBeITSMInISTerIn
naHleS; rounD-TaBle von feS-
unD BÖCKler-STIfTung; MITver-
anSTalTerIn BogeDan: Recht auf Teilzeit, Rückkehrrecht auf Vollzeit
61Mitbestimmung 11/2014
AUs DER sTIfTUNG
Drei Prozent und mehr – für viele Beschäftigte brachten die Tarif-runden in diesem Jahr erfreuliche Ergebnisse. „Der Trend ist posi-tiv“, gab WSI-Direktorin Brigitte Unger bei der Tarifpolitischen Tagung ihres Instituts die Grundstimmung wieder. Rund 60 Teil-nehmer aus Gewerkschaft, Wissenschaft und Politik waren nach Düsseldorf gekommen, um diese Ergebnisse zu diskutieren. Mitun-ter gingen den Verbesserungen Streiks voraus, so im öffentlichen Dienst. „Es gab großen Nachholbedarf, da war schnell klar, dass es nicht ohne Konflikte gehen wird“, erläuterte ver.di-Vorstand Achim Meerkamp. Anderswo verlief es weniger konfliktreich. „Wir sind im Ergebnis ebenso erfolgreich wie andere Gewerkschaften, weil wir ein partnerschaftliches Verständnis von Tarifpolitik haben“, spielte IG-BCE-Vorstand Peter Hausmann auf die bevorzugte Ton-lage seiner Gewerkschaft an.
Und auch der Mindestlohn hat geholfen. Ab 2015 wird er ein-geführt, schon in der aktuellen Tarifrunde jedoch habe er sich auf die Abschlüsse ausgewirkt, stellte DGB-Vorstand Stefan Körzell fest. „Auch im Hinblick auf die Stärkung der Tarifautonomie hatte er sichtbare Auswirkungen“, sagte Körzell. So gelangen in diesem Jahr Tarifabschlüsse in Branchen, die sich bislang bundesweiten Rege-lungen verweigert hatten, wie im Friseurhandwerk, in der Land- und Forstwirtschaft, im Gartenbau und in der Fleischindustrie.
Der Mindestlohn beschert Gewerkschaftern jedoch auch neue Handlungsfelder. Zwar habe man sich in vielen Punkten durchsetzen können: So ist etwa die Generalunternehmerhaftung mit ins Gesetz aufgenommen, zudem wird der Mindestlohn nicht, wie ursprünglich vorgesehen, erst 2018, sondern bereits 2017 zum ersten Mal ange-passt. „Der Mindestlohn ist der größte sozialpolitische Erfolg des DGB. Für rund vier Millionen Menschen wird er die Lebensqualität verbessern“, lobte Körzell. Doch gebe es auch „Sündenfälle“.Unverständlich sei etwa, dass Jugendliche unter 18 Jahren generell vom Mindestlohn ausgenommen seien. Das Argument, sie würden durch den Mindestlohn von der Berufsausbildung abgehalten, lässt Körzell nicht gelten. „Bereits in der Vergangenheit waren die Ent-gelte für Ungelernte meist höher als die Ausbildungsentgelte“, so Körzell. Auch mit Blick auf den verfassungsrechtlichen Gleichbe-handlungsgrundsatz sei diese Regelung höchst bedenklich. Ebenfalls nicht akzeptabel sei, Langzeitarbeitslose für sechs Monate vom Mindestlohn auszunehmen, Zeitungszustellern bis zum Jahr 2018 einen Abschlag zuzumuten und auch Saisonarbeiter mit Sonderre-
TarIfpolITIK Die Tarifrunde 2014 verlief sehr zufriedenstellend – auch wegen des Mindestlohns. Die Einführung der gesetzlichen Lohnuntergrenze stabilisierte auch die Tarifautonomie.
Erfolge verstetigen
gelungen zu belasten. Bei Letzteren können Arbeitgeber Kosten für Unterkunft und Verpflegung auf die 8,50 Euro anrechnen. Wie hoch diese Kosten sein dürfen, ist unklar. Ebenfalls nicht geregelt ist, welche Branchen überhaupt Saisonarbeiter beschäftigen können. „Die zahlreichen Ausnahmen erschweren die Kontrolle“, konsta-tierte der Gewerkschafter. Die zuständige Stelle, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS), müsste für hinreichende Prüfungen massiv Personal aufstocken. „Wir werden den Mindestlohn weiter aktiv begleiten“, so Stefan Körzell. ■
Von DIrK SCHäfer, Journalist in Dortmund
wSI-DIreKTorIn unger IM geSpräCH MIT Ig-BCe-vorSTanD
HauSMann (o.), DgB-vorSTanD KÖrzell (M.) MIT TagungS-
TeIlneHMern: „Mindestlohn weiter aktiv begleiten“
Die Vorträge der tarifpolitischen Tagung des WSI zum Download unter www.boeckler.de/28733_47305.htm
MeHr InforMaTIonen
Foto
s: U
lric
h B
aatz
62 Mitbestimmung 11/2014
TIppS & TerMIne
* Weitere Veranstaltungstipps unter www.boeckler.de und Fachtagungen für Aufsichtsräte unter www.boeckler.de/29843.htm
wSI-HerBSTforuM 2014Wie sehen die „Arbeitszeiten der Zukunft“ aus, damit sie selbstbe-stimmt, geschlechtergerecht und nachhaltig ist? Das WSI stellt auf dem diesjährigen Herbstforum neue Forschungen vor.
Hans-Böckler-StiftungNadine ZeibigTelefon: 02 11/77 [email protected]
veranSTalTung voM
27. BIS 28. noveMBer
In BerlIn
MITarBeITerKapITalBeTeIlIgungDie Veranstaltung geht der Frage nach, wie Mitarbeiterkapitalbetei-ligung so gestaltet werden kann, dass sie den Beschäftigten zugu-tekommt und die Zukunft des Unternehmens sichert. Mit Beispielen aus dem europäischen Ausland.
17. ColloQuIuM arBeITS- unD SozIalreCHTDas WSI lädt den wissenschaftlichen Nachwuchs zur rechtspoliti-schen Diskussion ein. Daneben gibt es Gelegenheit zu weiterem Austausch und Sichkennenlernen.
arBeITSDIreKToren-Konferenz ver.DIHans-Böckler-Stiftung und ver.di laden Arbeitsdirektoren zum Erfah-rungs- und Gedankenaustausch ein. Unter anderem referiert die Staatssekretärin Annette Kramme, BMAS, über das „Quotengesetz“.
Hans-Böckler-StiftungJennifer BüsenTelefon: 02 11/77 [email protected]
Tagung
voM 28. BIS 29. januar
In DuISBurg
Hans-Böckler-StiftungMichaela KuhnhenneTelefon: 02 11/77 [email protected]
perSpeKTIven von BeruflICHKeITDie Hans-Böckler-Stiftung will zusammen mit IG Metall und ver.di Kernfragen zur Zukunft der Arbeitsgesellschaft diskutieren, um Per-spektiven für qualifizierte Arbeit und Sicherung von Beschäftigung und Einkommen zu schaffen.
aufSICHTSräTeKonferenzDie Hans-Böckler-Stiftung lädt zusammen mit dem DGB Aufsichts-räte ein, über die strategische Ressource Personal, über gute Unter-nehmensführung durch Mitbestimmung zu diskutieren.
Hans-Böckler-StiftungLasse PützTelefon: 02 11/77 [email protected]
Hans-Böckler-StiftungEva JacobsTelefon: 02 11/77 [email protected]
Hans-Böckler-StiftungStefan LückingTelefon: 02 11/77 [email protected]
Tagung
voM 22. BIS 23. januar
In franKfurT/MaIn
Tagung
voM 10. BIS 11. feBruar
In BerlIn
Tagung
voM 5. BIS 6. feBruar
In erfurT
Konferenz
voM 4. BIS 5. DezeMBer
In BerlIn
63Mitbestimmung 11/2014
AUs DER sTIfTUNG
Dank an Wolfgang streeckEMERITIERUNG
Foto
s: H
ardy
Wel
sch,
Chr
isto
ph S
eelb
ach,
San
dra
Stei
ns
Streeck bei seiner Abschiedsvorlesung (l.); Fest-redner und DGB-Chef Hoffmann; 2006 bei der übergabe des Mit bestimmungsberichts an Merkel
Wenn uns jemand klargemacht hat, was das deutsche Produktionsmodell überhaupt ist und dass diese Wohl-standsmaschine nicht zu haben ist ohne Facharbeit, Be-rufsbildung und auch nicht ohne Mitbestimmung und Gewerkschaften, dann ist das Wolfgang Streeck. Der jetzt emeritierte Soziologe hatte in den 70er Jahren statt der „Klassenkämpfe in Westeuropa“ forschend die Institutio-nen des Korporatismus analysiert. In den USA „wurden diese Beiträge über die diversifizierte Qualitätsproduktion für eine ganze Wissenschaftlergeneration prägend“, erin-nerte sich Kathleen Thelen, heute Professorin am MIT in Boston, bei der Emeritierungsfeier am 31. Oktober.
1995 kehrte Streeck aus den USA nach Deutschland zurück als Direktor am Max-Planck-Institut für Gesell-schaftsforschung in Köln und begann auch eine rege Ko-operation mit der Hans-Böckler-Stiftung. Er gab als wis-senschaftlicher Leiter der Mitbestimmungskommission von Hans-Böckler- und Bertelsmann-Stiftung Dutzende Forschungsprojekte in Auftrag und dirigierte 50 Hearings, um herauszufinden, was das Kerngeschäft der Betriebs- und Aufsichtsräte ist – in einem neuen, globalen Koordi-natensystem. Dabei fand er heraus, dass sie als Produkti-
vitätsmanager die Unternehmen im Strukturwandel voranbrachten – 1998 eine unerhörte Erkenntnis. Als Streeck sich ein Jahr später (mit Ex-WSI-Direk-torin Heide Pfarr) im Bündnis für Arbeit an die Arbeitsmarktreformen wagte, brachte ihm das im DGB nicht nur Freunde ein. Er war bis 2004 im wissen-schaftlichen Beirat und im Kuratorium der Hans-Böckler-Stiftung aktiv.
Sein Wissen um die Mitbestimmung als Teil des deutschen Produktionsmo-dells brachte der Soziologe noch einmal fulminant ein, als die Bundesvereini-gung der Arbeitgeberverbände sich daranmachte, die Aufsichtsratsmitbestim-mung von 1976 an den drittelbeteiligten Katzentisch zu verweisen. Es waren nicht zuletzt die wissenschaftliche Reputation von Wolfgang Streeck und die politische von Kurt Biedenkopf, die die Kanzlerin überzeugten: Nicht mit mir! Die Arbeit dieser Kommission zur Modernisierung der Unternehmensmitbe-stimmung von 2006 „ist für uns wichtiges Orientierungswissen, wenn wir jetzt mit der Mitbestimmung in die Offensive gehen“, sagte DGB-Vorsitzen-der Reiner Hoffmann bei der Emeritierungsfeier für Wolfgang Streeck, dem er dankte, seinen wissenschaftlichen Nachwuchs mit Fragestellungen gefordert zu haben, die für die Gewerkschaften wichtig sind.
Streeck ist nun frei für seine Forschungen. Etwa über den Kapitalismus, dem er weniger denn je über den Weg traut, wie man in seinem Buch „Ge-kaufte Zeit“ nachlesen kann. Mit zunehmender Erfahrung, nun, im Alter von 68, hat er Freude daran, „größere Problemstellungen anzugehen und auch ein Publikum außerhalb der akademischen Leserschaft zu finden“. ■
64 Mitbestimmung 11/2014
Mehr Informationen über „Maximum Fungi“ unter www.scobytec.com
Der Böckler-Stipendiat Karl Ludwig Kunze ist der Schöpfer von „Maximum Fungi“ – einer Motorradweste wie aus einem Science-Fiction-Film. Das Unikat aus bakterieller Zellulose sieht aus wie speckiges Leder. Der Clou ist aber, dass hier ein nachhaltiges Material mit Mikroelektronik verbunden wurde. Ausge-stattet mit LED-Lampen und Glasfaserkabeln, kann die Weste Emotionen des Fahrers und Verkehrsdaten an andere Verkehrsteilnehmer kommunizieren. Zwei mit dem Internet verbundene Mikrocomputer realisieren den Datenaus-tausch. Entwickelt hat der Multimediadesign-Student das Material als Semes-terarbeit an der Burg Giebichenstein/Kunsthochschule Halle. Beim diesjähri-gen Wettbewerb der Industrial Fabrics Association International (IFAI) belegte er damit den zweiten Platz; zudem wurde er mit dem Publikumspreis beim „Scidea Ideenwettbewerb“ in Sachsen- Anhalt ausgezeichnet. „Ich liebe
technischen Fortschritt, leider spielt Nachhaltigkeit dabei bisher keine große Rolle“, sagt er. ■
Ein kompaktes Faltblatt zur schnellen Informa-tion über die Unternehmensmitbestimmung in Deutschland liegt jetzt vor. Nach den neuesten Zahlen sind 2200 Unternehmen in Deutschland mitbestimmt und übernehmen 7500 Frauen und Männer in den Aufsichtsräten der Unter-nehmen Mitverantwortung. Mit Grafiken stellt das Faltblatt die drei Formen vor: die Montan-mitbestimmung von 1951, die Mitbestimmung nach dem Gesetz von 1976, die für Unterneh-men über 2000 Beschäftigte gilt, und die Drit-telbeteiligung bei Unternehmen ab 500 Be-schäftigten. Plus neuesten Zahlen zur SE, der Europäischen Aktiengesellschaft. Man erfährt außerdem etwas zu den historischen Etappen der betrieblichen und der Unternehmensmitbe-stimmung seit 1946. Auch die Ansprechpartner in der Abteilung Mitbestimmungsförderung stellen sich vor, und es gibt Links zu Aufsichts-ratsthemen auf der Böckler-Website. ■
Wichtig! Das Infoblatt gibt es auch auf Englisch. Bestel-lungen an: [email protected], Abtei-lung Mitbestimmungsförderung, Hans-Böckler-Stiftung. Der Flyer im Netz unter: http://bit.ly/11dy7vB
Intelligente motorradweste
IMK
STUDIENFÖRDERUNG MITBESTIMMUNGSFÖRDERUNG
Seit April 2014 leitet Thomas Theobald, 33, das Refe-rat „Finanzmärkte und Konjunktur“ des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung; jetzt hat er seine Disserta-tion an der FU Berlin abgeschlossen. Die englischspra-chige Arbeit, deren Titel mit „Essays zu Konjunktur-prognosen und zur Bankenregulierung“ übersetzt werden kann, besteht aus drei Teilen, von denen zwei zuvor als IMK Working Papers erschienen sind. Finanz-marktkrisen werden in der Regel von tiefen Rezessio-nen begleitet. So behandelt der erste Teil der Arbeit, den Theobald gemeinsam mit dem Ökonomen Chris-
tian Proaño verfasst hat, die möglichst frühe und zu-verlässige Rezessionserkennung. In den beiden weiteren Teilen der Arbeit wird das Thema der Banken-regulierung behandelt, da deren Unterregu lierung als eine der Ursachen der jüngsten Finanzmarktkrise gilt. Theobald, der mit einem Stipendium der Stiftung pro-movierte, beschäftigt sich mit der Frage, ob agenten-basierte Modelle, bei denen am Computer Entschei-dungen oder Handlungsmöglichkeiten vieler einzelner Akteure (Agenten) simuliert werden, im Interesse des Gemeinwohls zur Bankenregulierung eingesetzt wer-den können. ■
fakten zur mitbestimmung
mathe gegen finanzjongleure
Foto
: Ulr
ich
Baa
tz
Thomas Theobald
Karl Ludwig Kunze mit Motorradweste, die er aus dem Glibber (r.) entwickelt hat.
Foto
s: S
coby
Tec
65Mitbestimmung 11/2014
AUs DER sTIfTUNG
Von SuSanne KaIlITz, Journalistin in Dresden
Der Furchtlose
Sein Büro hat er in einer etwas verlebten Gegend von Rostock im ersten Stock eines verwinkelten Mehrzweckbaus, mit Kin-dergarten eine Etage tiefer und Spielplatz vor dem Fenster. Ros-tock steht bis heute wie kaum eine zweite deutsche Stadt dafür, wie die Begegnung fremder Kulturen beinah in der Katastrophe endet. Unvergessen sind die Bilder aus dem Stadtteil Lichtenha-gen, wo im Sommer 1992 ein ausländerfeindlicher Mob zusam-menfand und ein Wohnheim vietnamesischer Asylbewerber in Brand steckte. Dieses Image ist die Stadt nie so ganz losgewor-den, trotz aller Anstrengungen Hugos und seiner Mitstreiter. Die Auseinandersetzung mit Rechtsextremisten führt er furchtlos und mit Verve. Das mag auch daran liegen, dass der Sozialpäd-agoge aus eigener Erfahrung nur zu gut weiß, wie es ist, nicht wirklich dazuzugehören und ausgegrenzt zu werden. Denn sei-ne Lebensgeschichte ist so bunt wie nur wenige – und mit ihm darüber zu sprechen ist ein Erlebnis.
Michael Hugo wurde in Chemnitz geboren, das damals noch Karl-Marx-Stadt hieß, als Sohn eines Vaters, der 1933 ins Exil nach Singapur gegangen war und 1960 in die DDR übersiedel-te. Was sein Vater in all den dazwischenliegenden Jahren getan
Es ist unmöglich, sich mit Michael Hugo auf einen schnellen Kaffee zu treffen. Denn ein Gespräch mit dem 52-Jährigen verwandelt sich innerhalb kurzer Zeit in ein Bad in Geschichten und Anekdoten, in ein Ein-
tauchen in Gegenwart und Vergangenheit, bei dem nach und nach ganz wie von selbst alle Themen der Welt behandelt wer-den. Die DDR-Vergangenheit. Die mysteriöse Geschichte seines Vaters. Und Hugos Arbeit mit Zugewanderten, ihren unter-schiedlichen Kulturen und Traditionen. „Es geht nicht darum, dass man einander lieben muss“, sagt er, „aber darum, respekt-voll miteinander umzugehen.“ Hugo arbeitet als Projektleiter beim Integrationsfachdienst Migration, der sich um die berufli-che und sprachliche Qualifizierung von Ausländern und Spät-aussiedlern kümmert; zugleich ist er ehrenamtlicher Geschäfts-führer des Vereins migra e.V., der im Jahr 2007 gegründet wurde und der im Auftrag des Landes Mecklenburg-Vorpom-mern diesen Fachdienst anbietet.
hat, versucht Hugo seit geraumer Zeit zu ergründen. Allein das, was er schon weiß, ist Stoff für einen Abenteuerroman. Das Scheckbuch einer Bank aus Hongkong gehört zum Nachlass des Vaters sowie „sieben Lebensläufe, die er alle selbst geschrieben hat“. Und ein umfangreicher Schriftverkehr, der darauf hindeu-tet, dass sein Vater in Kontakt mit mehreren westlichen Geheim-diensten stand. Michael Hugo stürzt sich mit großer Lust in dieses Familiengeheimnis, wenn er darüber sinniert, wer dieser Ernst Karl Oskar Hugo gewesen sein mag.
Ein angepasster Mensch kann er nicht gewesen sein. Seine Eltern hätten ihre Hochzeitsreise in der Schweiz verbracht, als die Mauer gebaut wurde, erzählt Hugo, und die Abschottung der DDR erst für Satire gehalten. Als klar wurde, dass dem nicht so ist, sei sein Vater mit größter Selbstverständlichkeit in den sozialistischen deutschen Staat zurückgekehrt, in dem er als frei-beruflicher Übersetzer gearbeitet habe. Und das, obwohl er „nicht nur strikter Antifaschist, sondern auch strikter Antikom-munist war“. Immer wieder wurde sein Vater verhaftet, über-wacht sowieso. Auch er, der Sohn, kannte keine Angst und rieb sich immer wieder an dem System. Am letzten Tag seiner Aus-bildung zum Koch kündigte er und bekam als Wehrdiensttotal-verweigerer ein Berufsverbot. In der DDR schlug Hugo sich danach als Küster und Koch bei der Caritas durch, engagierte sich während der friedlichen Revolution im Neuen Forum und in Kirchenkreisen.
Die Wende brachte Michael Hugo dann die Befreiung – und die Anerkennung, die man ihm in der DDR versagt hatte: Aus dem Koch mit Berufsverbot wurde 1990 der Weimarer Auslän-derbeauftragte und zwei Jahre später der Landessprecher der Thüringer Ausländerbeauftragten. Lange nach der Wende holte er auch nach, was ihm in der DDR verwehrt gewesen war: ein Studium der Sozialpädagogik – als Stipendiat der Hans-Böckler-Stiftung. In den 90er Jahren ging Hugo nach Brandenburg, ent-wickelte Antidiskriminierungskonzepte und Projekte zur beruf-lichen Integration von Zugewanderten. Noch heute kann er plastisch davon erzählen, wie schwer es Anfang der 90er Jahre war, multikulturelle Fußballturniere in Weimar abzuhalten, weil die Angst vor den ansässigen Neonazis in Polizei und Stadtver-waltung so groß gewesen sei. „Es gab eine Übergangszeit, da hatte die Polizei kein Konzept, um Menschen zu schützen.“
Hugo hatte keine Angst, verhandelte kurzerhand selbst mit dem Rechtsextremisten Thomas Dienel – und stellte dabei fest, „dass es letztlich nicht darum geht, Ressentiments oder Befind-lichkeiten zu negieren, sondern sich zu zügeln“. Er sucht das Gespräch – bis heute. Als er neulich im Fußballstadion war und hörte, wie Erfurt-Anhänger antisemitische Sprüche grölten, ging der große Mann mit den breiten Schultern hin und fragte ganz freundlich, was das solle. Er habe dann länger mit einem Jura-studenten über dessen Ansichten über den Gaza-Konflikt ge-sprochen, erzählt Hugo lächelnd. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. ■
porTräT Michael Hugo engagiert sich in Rostock für die Integration von Ausländern und Spätaussiedlern. In seiner Freizeit erforscht er das abenteuerliche Leben seines Vaters.
66 Mitbestimmung 11/2014
AUs DER sTIfTUNG
alTSTIpenDIaTen Der STIfTungalTSTIpenDIaTen Der STIfTung
InTegraTIonS-faCHMann
MICHael Hugo: Was soll das antisemitische Gegröle?
Foto
: Ro
lf S
chul
ten
67Mitbestimmung 11/2014
AUs DER sTIfTUNGalTSTIpenDIaTen Der STIfTung
einander vertrauen. Die zweite Konstellation, das Beispiel ist Ford, entsteht, wo die Arbeit des Euro-betriebsrates von der starken Mitbestimmung der deutschen Zentrale profitiert. Diese „subsidiäre Mitbestimmung“ führt dazu, dass die Eurobe-triebsräte weniger autonom, aber effizient arbeiten.
Beim dritten Typ prägen aus Südeuropa stam-mende Kulturen den Geist des Eurobetriebsrats. Während das Management den Dialog mit den Arbeitnehmern eher meidet, organisiert das Gre-mium konfrontative Protestformen. Solidarität wird hier aus der „Protestsolidarität“ hergestellt. Leider erfährt der Leser hier nicht den Namen der untersuchten Firma; er wurde anonymisiert.
Als vierte, letztlich wenig überzeugende Varian-te fanden die Wissenschaftler – bei Sanofi – einen Eurobetriebsrat vor, dessen Aktivitäten darauf ge-richtet waren, vom Management Informationen zu erhalten und diese exzessiv zu analysieren. Teilwei-se, so die Autoren, ist dies eine Ersatzhandlung, bei der die Interessen der Arbeitnehmer nicht wirksam vertreten werden. Die Mitglieder des Eurobetriebs-rates, fraktioniert in Deutsche und Franzosen, ze-lebrieren „Gesten der Solidarität“, statt an einem Strang zu ziehen. Teilweise herrscht Misstrauen.
Ob die Autoren eine allgemeine Typologie ge-schaffen haben, lässt sich schwer beurteilen. Wenn bei fünf untersuchten Unternehmen vier analyti-sche Kategorien herauskommen, wie viele mögen es dann bei 20 Unternehmen sein? Auch wenn die Autoren sichtlich bemüht waren, positive Beispiele auszuwählen, siegt der Pragmatismus über den Idealismus, jedenfalls im Alltag. Die Idee, dass ein stärkeres europäisches Bewusstsein und Solidarität
„von der die Basis genährt wird und von dort, von den Graswurzeln, emporwächst“, schreiben die Autoren, sei nach ihrer Erkenntnis „überwiegend eine Illusion“. Eurobetriebsräte brauchen harte Arbeit und europäische Pioniere. ■
Labore der Zusammenarbeit MITBeSTIMMung Eurobetriebsräte sind keine Betriebsräte nach deutschem Recht – aber Labore transnationaler Zusammenarbeit. Zwei Forscher haben sich aufgemacht, die Geheim nisse guter Praxis zu erkunden.
Von Kay MeInerS, Redakteur des Magazins Mitbestimmung
Über Gruppenbildungsprozesse von Betriebsräten hat man schon einiges gelesen, manchmal lesen müssen. Die von der Hans-Böckler-Stiftung geför-derte Studie, die Hermann Kotthoff und Michael Whittal in englischer Sprache publiziert haben, widmet sich den Eurobetriebsräten, die ebenso kri-tisch wie hoffnungsvoll beäugt wurden, seit 1994 eine EU-Richtlinie einen Rechtsrahmen für sie schuf. Kritisch, weil sie keine Betriebsräte im deut-sche Sinne sind und ihre verbrieften Rechte nur Information und Anhörung umfassen, hoffnungs-voll, weil man in ihnen den Kern einer transnatio-nalen Mitbestimmungskultur erblickte.
Hermann Kotthoff, Professor für Soziologie an der TU Darmstadt und Autor vieler einschlägiger Publikationen, ist der Verfasser des Buches. Sein Kollege Michael Whittall, wissenschaftlicher Mit-arbeiter an der TU München, steuert ein Kapitel zum Verhältnis zwischen Gewerkschaften und Euro betriebsräten bei. Den idealistischen Gedan-ken europaweiter Zusammenarbeit konfrontieren die Forscher mit der profanen Realität, die das Gesetz schafft. In den Gremien treffen Menschen aufeinander, die sich erst einmal fremd sind. Dabei entsteht, wie frühere Studien ergeben haben, mit-nichten in allen Fällen eine schlagkräftige Reprä-sentanz. Deshalb gehen die Autoren auf die Suche: Unter welchen Bedingungen entsteht aus einem bunten Haufen ein Team? Wie entsteht Solidarität?
Zu diesem Zweck haben sie fünf Unternehmen studiert, die, was Eurobetriebsräte angeht, eine Positivauswahl darstellen, und vier Typen mehr oder weniger solidarischer Zusammenarbeit gefun-den. Beim ersten Typ, repräsentiert durch die Fir-men Kraft und Unilever, verhandelt der Eurobe-triebsrat als Vertretung einer „Bürgerschaft im Betrieb“ konstruktiv mit dem Management. Dies gelingt, wenn die Gremienmitglieder eine transna-tionale Perspektive einnehmen und die Kernakteure
Hermann Kotthoff/Michael Whit-tall: paTHS To TranSnaTIonal
SolIDarITy. Identity-Building Processes in European Works Councils. Bern, Peter Lang Verlag 2014. 275 Seiten, 57,80 Euro
68 Mitbestimmung 11/2014
DreI fragen an …
enDlICH glauBTen wIr, alS verBrauCHer polITISCH
aKTIv zu SeIn. nun KoMMen SIe unD Sagen: oTTo Mo-
ralverBrauCHer reICHT nICHT! MÜSSen wIr zurÜCK
auf parTeITage, In fenSTerloSe Hallen? Wenn Sie mehr verändern wollen: Ja. Zu glauben, ich protestiere mit meinem Konsum, boykottiere dieses, kaufe jenes und errei-che eine gerechtere Welt, stößt bald an Grenzen.
waruM eIgenTlICH? Erstens wird es schnell kompliziert. Sie können fair gehandelten Kaffee kaufen und tun Gutes. Aber schon beim Boykott von FCKW sah man: Sie können das Haarspray wechseln, aber ohne die Politik bringen Sie die Hersteller nicht davon ab, FCKW für viele andere Produkte zu nutzen. Die Weltwirtschaft ist zu großen Teilen vom Ge-schäft zwischen Unternehmen geprägt; Verbraucher sind da machtlos. Vor allem aber: Ich möchte eigentlich einfach kau-fen, was mir schmeckt und gefällt – und sichergestellt wissen, dass es vernünftig hergestellt ist. In einer Demokratie und Marktwirtschaft ist das eine sinnvolle Arbeitsteilung.
nur geHT DaS MaHlen DeMoKraTISCHer MÜHlen So
vIel langSaMer alS Der Kauf von KorreKTeM Kaf-
fee. Mag sein. Aber Politik findet nicht nur auf Parteitagen statt; modernere Partizipationsmöglichkeiten gibt es und wird es vermehrt geben. Und: Stellen Sie sich vor, Sie hätten sich von Beginn für das einst völlig aussichtslos scheinende Projekt Finanztransaktionssteuer eingesetzt. Nun kommt sie. Das war langwierig. Aber es hat gewirkt.
Die Fragen stellte jeanneTTe goDDar.
„Verschwendung, Ungerechtigkeit und Entfremdung entspringen kei-nem Naturgesetz. Sie sind das Er-gebnis bestimmter sozialer Regeln, derer des Kapitalismus!“ So lässt Giacomo Corneo in seinem Buch ein junges Mädchen unser Wirt-schaftssystem sehen – und er lässt es über Alternativen zu diesem System nachdenken: „Aber wie der Kapitalismus entstanden ist, so kann er auch fallen und durch ein besseres Regelwerk ersetzt wer-den. Es liegt in unserer Hand, denn
Menschen können sich entscheiden, den Kapitalismus zu be-kämpfen, damit eine bessere Welt entstehen kann.“
Der Goldegg-Verlag, der das Buch herausgibt, lässt erklären, die Zahl der Menschen wachse, die sich nach einem gerechteren und effizienteren Wirtschaftssystem sehnten. Wie andere Autoren vor ihm und nach ihm reitet auch Corneo auf dieser Welle. Aber Kritiker wie Verehrer des Kapitalismus haben ein gemeinsames Problem: Weder Gegner noch Befürworter bringen jene gemein-same Menge kluger Einsichten zustande, die die Welt dauerhaft stabilisieren könnte. Sie produzieren vielmehr Dissens, Konfu sion und Unüberschaubarkeit. Das Gegenteil dessen, was eine Gesell-schaft retten könnte.
Dieses intellektuelle Drama steht nicht im Zentrum von Cor-neos Überlegungen, bestimmt aber seinen Blick auf die konfuse Lage: Bloß keine allzu weiten Reformüberlegungen, dafür ando-cken an existierende Ideen, Vorsicht und Rücksichtnahme. Das ist eine Entscheidung, die durch und durch reformistisch ist, begründbar und vertretbar einerseits. Eine Entscheidung, die ihre Gegner für unwichtig, kümmerlich oder gar feige halten könnten andererseits. Mit politischer Wucht, die eine fundamentale Än-derung einleiten könnte, ist sie nicht aufgeladen. Weil das so ist, kann man hoffnungsvoll alles ausprobieren: bedingungsloses Grundeinkommen, eine bessere Armutsbekämpfung, die Sozial-erbschaft. Eine Marktwirtschaft mit Wohlfahrtsstaat ist das Ge-neralziel. Corneo fragt, wie man den Kapitalismus besser machen, nicht, wie man ihn überwinden kann. Die Lektüre lohnt sich ihrer umfassenden historischen Bezüge wegen: Plato, Thomas Morus, Peter Kropotkin – und, ein wenig untergewichtig, Mar-xismus und Sozialismus, aber egal. ■
Von HerBerT HÖnIgSBerger, Wien
ReformgedankenGiacomo Corneo: BeSSere welT. Hat der Kapitalismus ausgedient? Eine Reise durch alternative Wirtschaftssysteme. Berlin, Goldegg Verlag 2014. 368 Seiten, 24,90 Euro (gebunden) oder 9,99 Euro (Kindle Edition)
… CaSpar DoHMen, Wirtschaftsjournalist und Autor eines Buches über unsere Konsumgewohnheiten
Foto
: Die
Hof
foto
graf
en G
mb
H B
erlin
69Mitbestimmung 11/2014
mEDIEN
Wer kennt das Phänomen nicht: Kaum ist die Garantiezeit des schicken Handys abgelaufen, quittiert es den Dienst. Pech, sagt der Hersteller und empfiehlt den Neukauf. Ab-sicht, sagt dagegen Stefan Schridde, Diplom-Betriebswirt aus Berlin, der im Februar 2012 das Weblog „Murks? Nein danke“ initiierte. Schridde ärgerte das schnelle Aus auch vermeintlich hochwertiger Konsumgüter. Er sieht in der „geplanten Ob-soleszenz“ eine absichtliche Strategie der Unternehmen zu-lasten der Umwelt. Aus der Idee, für eine nachhaltigere Pro-duktqualität zu kämpfen, ist inzwischen eine von Bürgern getragene Verbraucherorganisation geworden, die auf Face-book mehr als 20 000 Follower hat. Obwohl einige Experten (Umweltbundesamt, Stiftung Warentest) den geplanten vor-schnellen Produkttod für nicht belegbar halten, lohnt der Blick auf das Blog, wo der Versuch unternommen wird, Be-lege zusammenzutragen. Auf der Webseite können Verbrau-cher ihrerseits den schnellen Produkttod melden oder recher-chieren, ob Produkte „auffällig“ sind, was auf jeden Fall den Druck auf die Hersteller erhöht.
fazit: Lesenswerte Adresse für verbraucher, auch wenn klare Beweise strittig sind. Die IG metall unterstützt die Debatte, sieht auch Ingenieure in der verantwortung.
wIr TeSTen …
www.murks-nein-danke.de
InTerneT
Von gunTraM DoelfS
Maren Bullermann, selbst Be-triebsrätin, hat einen Ratgeber im besten Sinne des Wortes geschrie-ben. Wer Betriebsratsarbeit erfolg-reich organisieren will, findet in dem Buch der Bauingenieurin und IG-BAU-Gewerkschafterin jede Menge nützlicher Tipps, denen man die eigene Erfahrung an-merkt. Was das Buch besonders macht, ist die Art, wie verschiede-ne Perspektiven und Wissensberei-
che verbunden werden. Hier werden neben den unverzichtbaren Kerninhalten des Betriebsverfassungsgesetzes auch Methoden aus dem Projektmanagement und Erkenntnisse aus den Kommu-nikationswissenschaften nutzbar gemacht.
So wird unter der Kapitelüberschrift „Menschen verstehen: Kommunikation ist keine Glückssache“ das sogenannte „Nach-richtenquadrat“ des Kommunikationsexperten Friedemann Schulz von Thun vorgestellt. Demnach lässt sich jede Art der Mitteilung in vier Aspekte – Sachebene, Beziehungsebene, Appell und Selbstoffenbarung – aufgliedern und analysieren. Mit diesem einfachen Modell wird deutlich, wie vielschichtig eine Nachricht ist und wie leicht es zu einem „Nicht-Verstehen“ zwischen Sen-der und Empfänger kommen kann.
In den anderen Kapiteln finden sich unter anderen Ausfüh-rungen zur Gestaltung der Betriebsratssprechstunde und Vor-schläge zur Vorgehensweise beim gesetzlich vorgeschriebenen Monatsgespräch mit dem Arbeitgeber. Der Mehrwert, den die Beschäftigung mit den Grundlagen der Kommunikationspsycho-logie für Betriebsräte haben kann, wird hier überdeutlich. Auch bei der Darstellung der Betriebsratsrechte in sozialen Angelegen-heiten lässt die Autorin keinen Zweifel daran, dass es neben fundierten Rechtskenntnissen bei der Arbeit noch auf weitere Kompetenzen ankommt. Gerade hier hängt es von der Analyse-fähigkeit und dem strategischen Vermögen der Betriebsräte ab, ob Verhandlungen mit dem Arbeitgeber zu einem Erfolg werden. Das Buch wird abgerundet durch einen Anhang mit kommen-tierter Literaturliste sowie einem Glossar zu schwierigen Begrif-fen aus dem Arbeitsrecht. Insgesamt weist diese gelungene Ver-öffentlichung einen hohen Gebrauchswert für die betriebsrätliche Praxis auf. ■
Von DIrK ManTen, Bildungsreferent in Bielefeld
Echt nützlichMaren Bullermann: Der BeTrIeBSraTSCoaCH. Unterstützung für erfolg-reiche Arbeit. Hamburg, tredition Verlag 2014. 336 Seiten, 19,80 Euro
70 Mitbestimmung 11/2014
BuCHTIppS
Veröffentlichungen mit Bestellnummer sind nicht im Buchhandel erhältlich, sondern ausschließlich über SeTzKaSTen gMBH, Düsseldorf, Telefon: 02 11/408 00 90-0, Fax: 02 11/408 00 90-40, [email protected], oder über www.boeckler.de. Hier sind auch alle Arbeitspapiere der Böckler-Stiftung kostenlos herunterzuladen.
BWL-handlungshilfe Die Auto-rin ist Sachverständige für nationale und internationale Rechnungslegung und beschreibt umfassend das Holding-Kon-zept von der Definition bis zu den Be-sonderheiten und Grenzen des Jahres-abschlusses.
Der jaHreSaBSCHluSS Der HolDIng. Von Christiane Kohs. Edition der Hans-Böckler-Stif-tung, Nr. 287. Bestellnummer 13287, 74 Sei-ten, 12 Euro
TTIP-studie Die von Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie analysiert TTIP mit Blick auf die Industriesektoren Automobilwirtschaft, Chemie, Pharma, Informations-/Kommunikationstechno-logie und Maschinenbau und will die Debatte mit neuen Akzenten bereichern.
TTIp – HanDelS-, waCHSTuMS- unD In-
DuSTrIelle BeSCHäfTIgungSDynaMIK In
DeuTSCHlanD, Den uSa unD europa. Von Paul J.J. Welfens, Arthur Korus und Tony Irawan. Reihe Europäische Integration und Di-gitale Weltwirtschaft, Band 8. Stuttgart, Lucius & Lucius 2014. 124 Seiten, 36 Euro
historie In Interviews mit Betriebsrä-ten und Gewerkschaftern, die Zeugen wie auch aktive Gestalter ihrer Zeit wa-ren, kommt der Autor zu dem Schluss, dass in der Rekonstruktion der eigenen Biographie die Erfolge gegenüber den Krisenerfahrungen dominieren.
TrIuMpHerzäHlungen. wIe gewerK-
SCHafTer ÜBer IHre erInnerungen
SpreCHen. Von Knut Andresen. Institut für soziale Bewegungen. Schriftenreihe A: Band 57. Essen, Klartext Verlag 2014. 240 Seiten, 24,95 Euro
Immer wieder warnen Forscher vor dem starken Anstieg psychi-scher Belastungen im Beruf. Um-gekehrt tragen funktionierende soziale Beziehungen, Kollegialität und ein entspannter Kontakt mit den Vorgesetzten wesentlich zum Gesundheitsschutz bei. Klaus Kock und Edelgard Kutzner, beide Soziologen an der Sozialfor-schungsstelle der TU Dortmund, wählen den Begriff „Betriebskli-
ma“, um die Qualität der Zusammenarbeit in Unternehmen zu beschreiben. In diesem Wort verdichtet sich ihre These, dass „Arbeit nicht auf einen ökonomischen Tauschakt Leistung gegen Lohn reduziert werden kann“.
Ihr Buch enthält sechs Fallstudien aus der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Dienst, die von der Hans-Böckler-Stiftung finanziell gefördert wurden. Kock und Kutzner betonen die Rezi-prozität im Zusammenspiel der Akteure, „die ihr Handeln auf-einander abstimmen und an gegenseitigen Erwartungen ausrich-ten“. Das Spannungsverhältnis von Geben und Nehmen, so schreiben die Autoren, beruhe auf einem „psychologischen Ver-trag“ und sei die Grundvoraussetzung für ein gutes Betriebsklima. Denn Beschäftigte betrachten ihren Arbeitsalltag „immer auch als zwischenmenschlichen Austausch von Verständnis, Anerken-nung und Unterstützung, bei dem es gerecht und solidarisch zugehen soll“.
In diesem Kontext würdigt das Forscherteam auch die be-triebliche Mitbestimmung. Es mache einen wichtigen Unter-schied, ob der Betriebsrat „als anerkannter Verhandlungspartner des Arbeitgebers einbezogen“ oder ob er übergangen werde. Der Band ist in einer wissenschaftlichen Sprache geschrieben, den-noch nicht nur für Arbeitssoziologen interessant. Vor allem in der Detailauswertung der Gespräche mit den Beschäftigten ver-anschaulichen Fallgeschichten das Thema. Die Dokumentation der Gruppendiskussionen in den beteiligten Unternehmen ist detailliert, manchmal langatmig.
Hilfreich für die Praxis ist vor allem das „Glossar zum Be-triebsklima“, das zentrale Aspekte wie Autorität, Beteiligung, Fairness, Führung, Kollegialität, Kommunikation, Kompetenz, Leistung, Macht, Vertrauen und Wertschätzung beschreibt. ■
Von THoMaS geSTerKaMp, Journalist in Köln
„Klima“-studieKlaus Kock/Edelgard Kutzner: DaS IST eIn geBen unD neHMen. Untersuchung über Betriebsklima, Reziprozität und gute Arbeit. HBS- Forschung, Band 162. Berlin, edition sigma 2014. 344 Seiten, 24,90 Euro
71Mitbestimmung 11/2014
mEDIEN
räTSelfragen
■ Wer war seit 1963 Vorsitzender der Neuen Heimat und bekleidete diese Position 19 Jahre lang, bis er 1982 wegen des Neue-Heimat-Skandals abgesetzt wurde?
■ In welchem Jahr geriet das ZDF in die Kritik, weil für eine Fernsehsendung über Großstadtghettos mit Jugendlichen vom Mümmelmannsberg gegen Geld Gewaltszenen nachgestellt worden waren?
■ Immer wieder engagierte die Neue Heimat namhafte Architekten – unter anderem einen Frankfurter, der 1955 das Hochhaus am Hamburger Habichtsplatz baute. Wie lautet sein Name?
Alle richtigen Einsendungen, die bis zum 4. Dezember 2014 bei uns eingehen, nehmen an einer Auslosung teil.
preISe
1. Preis: Gutschein der Büchergilde Gutenberg, Wert 50 Euro, 2.– 4. Preis: Gutschein der Büchergilde Guten-berg, Wert 30 Euro
SCHICKen SIe unS DIe lÖSung
Redaktion Mitbestimmung, Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf, E-Mail: [email protected]: 0211/77 78-225
Bickendorf/Vogelsang – 1955 – Melaten-FriedhofDen 1. Preis hat Maria Scholz aus Riesa gewonnen. Je einen 30-Euro-Gutschein erhalten Siegfried Goldmann aus Schwerin, Serena Müller aus Münster und Hartmut Eisermann aus Frankfurt am Main.
auflÖSung Der räTSelfragen 10/2014
Die Betonburg, die zwischen 1970 und 1979 in Hamburg-Billstedt entsteht, hat offiziell den Namen Mümmelmannsberg. Doch die Hamburger fin-den für den Koloss bald neue, kürzere Namen: Bunny-Hill, M-Town oder Müm-mel. Bauherr ist die Neue Heimat, ein Wohnungsbauunternehmen, das dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) gehört und seinen Hauptsitz in Hamburg hat. Der Großsiedlungsbau, der neue Trabantenstädte schafft, wird besonders in den 1960er und 1970er Jahren propagiert; seine Protagonisten sehen sich in der Tradition der klassischen Moderne, in der Tradition der Bauhaus-Avantgarde und als Nachfolger von Architekten wie Le Corbusier, der seit 1925 die Idee einer Wohmaschine verfolgt – eines Hochhaustyps, der durch Verdichtung und eine serielle Produktion der Bauteile effizienten Wohnungsbau ermöglicht.
Die Neue Heimat reklamiert für sich, zeitgemäße Komplettlösungen für gan-ze Stadtteile anzubieten – zu einem günstigen Preis. Seit Ende der 60er Jahre die Baukosten rapide steigen, setzt man auch hier auf ökonomische Fertigteile. Doch blüht zu dem Zeitpunkt, als der Mümmelsmannsberg gebaut wird, bereits die Vetternwirtschaft. Es handelt sich um eine der letzten Großsiedlungen, die die Neue Heimat bauen wird – schon bald werden die Nachteile solcher Siedlungen offenbar: die Anonymität, die Uniformität, die mangelhafte Infrastruktur. Auch die Ersparnis bei den Baukosten hält sich in Grenzen. Doch was einmal gebaut ist, steht erst einmal da, wird benutzt. Heute leben in den 7300 Wohnungen des Mümmelmannsberges 18 500 Menschen. Der Ausländeranteil in der Siedlung beträgt über 20 Prozent; auch der Anteil an Hartz-IV-Beziehern ist höher als anderswo.
Initiativen und Vereine sind entstanden, die die Lebensqualität im Viertel erhöhen sollen und wollen. Seit 1990 gibt es einen U-Bahn-Anschluss. Eine Web-site organisiert das öffentliche Leben im Viertel. Aber die Bausubstanz erscheint nach 40 Jahren eher als eine Hypothek, die die ganze Kreativität der Stadtplaner herausfordert. ■
Kay MeInerS
Foto
: ulls
tein
bild
72 Mitbestimmung 11/2014
RäTsELhAfTEs fUNDsTücK
TITELTHEMA 12/2014
Crowdworking-Plattformen sind die Vorboten einer neuen Art, Arbeit weltumspannend zu organisieren. Die Abwärtsspirale des Outsourcings bedroht und verändert das Normalarbeitsverhältnis. Gleichzeitig macht das Silicon Valley der deutschen Industrie Konkurrenz – in der Heizungs- und Medizintechnik wie bei der Automo-bilentwicklung. Wird in der vierten industriellen Revo-lution die Fabrik neu erfunden? Stellt die Digitalisierung dann mit dem industriellen Kern das gesamte deutsche Wirtschaftsmodell auf den Kopf – inklusive Sozialpart-nerschaft und Mitbestimmung?
Diesen Wandel im Sinne von selbstbestimmter Arbeit zu gestalten steht ganz oben auf der Agenda von Ge-werkschaften und Betriebsräten. Wir stellen Leitlinien eines gewerkschaftlichen Projektes zur Humanisierung guter digitaler Arbeit vor; wir gehen neuen Arbeitszeit-modellen durch Apps und mobile Arbeit nach und zei-gen Gestaltungsmöglichkeiten beim Arbeitnehmerdaten-schutz und für Skill-Datenbanken.
Digitale Wirtschaft braucht …
IMpreSSuM
printed byOFFSET COMPANY
SCC-13
HerauSgeBer: Hans-Böckler-Stiftung, Mitbestimmungs-,
Forschungs- und Studienförderungswerk des DGB,
Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf
veranTworTlICHer geSCHäfTSfÜHrer: Wolfgang Jäger
reDaKTIon:
Cornelia Girndt, Telefon: 0211/77 78-149
Margarete Hasel (verantwortlich), Telefon: 0211/77 78-192
Kay Meiners, Telefon: 02 11/77 78-139
KonzepTIon DeS TITelTHeMaS: Margarete Hasel
Co-reDaKTIon DIeSer auSgaBe: Girndt/Meiners
reDaKTIonSaSSISTenz: Astrid Grunewald
Telefon: 0211/77 78-147
fax: 0211/77 78-225
e-MaIl: [email protected]
MITglIeDer DeS reDaKTIonSBeIraTS: Jens Becker, Melanie
Diermann, Wolfgang Jäger, Rainer Jung, Birgit Kraemer, Manuela Maschke,
Sabine Nemitz, Susanne Schedel, Sebastian Sick
projeKTManageMenT/layouT/proDuKTIon/arTDIreCTIon:
SIGNUM communication Werbeagentur GmbH, Mannheim,
Nicole Ellmann, Roger Münzenmayer, Jörg Volz
TITelgeSTalTung:
SIGNUM communication Werbeagentur GmbH, Mannheim, Jörg Volz
DruCK: Offset Company, Wuppertal
verlag: Bund-Verlag GmbH, Postfach, 60424 Frankfurt/Main
anzeIgen: Bund-Verlag GmbH, Peter Beuther (verantwortlich)
Thorsten Kauf
Telefon: 069/79 50 10-602
e-MaIl: [email protected]
aBonnenTenServICe unD BeSTellungen:
Bund-Verlag GmbH
Telefon: 069/79 50 10-96
fax: 069/79 50 10-12
e-MaIl: [email protected]
preISe: Jahresabonnement 50 Euro inkl. Porto, Einzelpreis 5 Euro.
Der Bezugspreis ist durch den Fördererbeitrag abgegolten.
Abbestellungen mit einer Frist von sechs Wochen zum Jahresende
Für Spenden und sonstige Förderbeiträge an die Stiftung:
SEB AG Düsseldorf
IBAN: DE81 30010111 1000291500, BIC: ESSEDE5F300
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion. Dies gilt auch
für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und Newsletter.
ISSn 0723 5984
02 11/77 [email protected]
Der HeISSe DraHT zur reDaKTIon
Gibt es in Ihrem Betrieb etwas, über das wir unbedingt einmal berichten sollten? Etwas, das richtig gut läuft, oder etwas, über das Sie sich ärgern? Vermissen Sie ein Thema im Magazin? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.
… gute Arbeit
73Mitbestimmung 11/2014
vORschAU
ulrICH fey, 57, arbeitet seit 16 Jahren als professioneller Clown in Alten- und Pflegeheimen. Meist besucht er Senioren mit Demenz. Der gelernte Gymnasiallehrer war zuvor Sportredakteur der FAZ.
Text: anja SCHeve
Foto: prIvaT
Frankfurt, Arndtstraße 38. „Sobald ich geschminkt, mit roter Nase, den zu großen Schuhen, der bunten Schleife und der karierten Schlägermütze im Altenheim unterwegs bin, verändert sich die Atmosphäre im Cronstettenstift im Frankfurter Westend, in dem ich einmal in der Woche als Clown Albert arbeite. Mit manchen Leuten singe ich, mit anderen unterhalte ich mich, ich lache, manch-mal weine ich auch mit ihnen. Oder ich halte nur ihre Hand, und wir schweigen. Als Clown kenne ich weder Regeln noch Angst. Als Clown bin ich durch und durch emotional, eigenwillig, direkt und lebe nur im Augenblick – wie die meisten Menschen mit Demenz auch. Neben dem Cronstettenstift besuche ich regelmäßig drei andere Pflegeheime. Früher bin ich als Clown-Doktor Dr. Sören Schlau-Schlau zu kranken Kindern in die Frankfurter Uniklinik gegangen. Doch das ist eine völlig andere Arbeit als mit alten Menschen, denn Kinder wollen Aktionen mit Slapstick, Lärm und Unsinn.
Begonnen hat alles Anfang der 90er Jahre, als ich bei der Spiel- und Theaterwerkstatt Frankfurt einen Clown-Workshop belegt habe. Weitere folgten, zudem habe ich mit einer freien Theatergruppe ein Stück auf die Bühne gebracht. Vier Jahre lief dies parallel zu meiner Arbeit als Sportredakteur bei der „FAZ“. Dann war die Zeit reif für eine Entscheidung: Mit 39 Jahren habe ich gekündigt und eine Ausbildung an einer Clown-Schule gemacht. Hier wird die Verbindung zur eigenen kindlichen Kreati-vität und Spielfreude wieder hergestellt. Man muss auch damit umgehen lernen, dass über einen Clown gelacht wird. Dass man mit roter Nase dumm dasteht. Doch es hat sich gelohnt. Die ehrliche und un-mittelbare Freude, die ich bei alten Menschen erlebe, berührt mich sehr. Wer kann schon von sich be-haupten, dass er meist frohgemut zur Arbeit fährt und oft beglückter wieder nach Hause?“ ■
74 Mitbestimmung 11/2014
mEIN ARBEITsPLATZ
Postfach60424 Frankfurt am Main
Infotelefon:0 69 / 79 50 10-20
Fax:0 69 / 79 50 10-11
Internet: www.bund-verlag.de
E-Mail: [email protected] beziehen über den gut sortierten Fachbuchhandel oder direkt beim Verlag unter: [email protected]
Ganz nah dran. Bund-Verlag
Darf der Chef E-Mails der Mitarbeiter lesen? Darf er Videokameras installieren? Dürfen rechtswidrig erlangte Kenntnisse vor Gericht gegen die Beschäftigten verwendet werden? Wie verhalten sich Datenschutz und Compliance zueinander? Was ist beim Abschluss einer Betriebsverein-barung zu beachten?
Diese und viele andere Praxisfragen zum Datenschutz im Betrieb behandelt Wolfgang Däubler in seinem umfassenden Handbuch. Gerichtliche Entscheidungen aller Instanzen bis hin zum EuGH-Urteil gegen Google sind vollständig aus-gewertet, Rechtsprechung und Literatur bis September 2014 verarbeitet.
Die wichtigsten Themen: • Big Data und Cloud Services• Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung• Fragerecht gegenüber Bewerbern, Recherche im Internet• BEM und Pflicht zur ärztlichen Untersuchung• Ortungssysteme und Erstellung von Bewegungsprofilen• RFID im Betrieb• Benutzung biometrischer Merkmale• Einsatz von Privatdetektiven• Übermittlung von Daten in Drittstaaten (vor allem USA)• Kontrolle durch Datenschutzbeauftragten und die
Aufsichtsbehörde• Mitwirkung von Betriebsräten und Personalräten• Sicherheitsüberprüfung und AEO-Zertifikat
Der Autor:Dr. Wolfgang Däubler, Professor für Deutsches und Euro-päisches Arbeitsrecht, Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht an der Universität Bremen. Eines seiner Spezialgebiete ist der Arbeitnehmerdatenschutz.
Gegen Überwachung und Kontrolle im Betrieb
Wolfgang DäublerGläserne BelegschaftenDas Handbuch zum Arbeitnehmerdatenschutz6., überarbeitete Auflage2014. 730 Seiten, gebunden€ 59,90ISBN 978-3-7663-6086-1
Beachten Sie auch:
Däubler / Klebe / Wedde WeichertBundesdatenschutzgesetzKompaktkommentar zum BDSG4., überarbeitete Auflage2014. 902 Seiten, gebunden€ 89,90ISBN 978-3-7663-6097-7
MIT1114254_EAZ_6086_6097_1-1_U2_4c.indd 1 10.10.14 14:37
Ganz nah dran. Bund-Verlag
Zu beziehen über den gut sortierten Fachbuchhandel oder direkt beim Verlag unter: [email protected]
Fundiert und verständlich erläutert der Kommentar die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX). Die Autoren – anerkannte Experten mit umfassender Praxiserfahrung – geben einen vollständigen Überblick über die neueste Rechtsprechung des Bundessozial gerichts und der Instanzgerichte sowie über den Stand der Fachdiskuss ion. Für Fragen, die noch nicht gerichtlich entschieden sind, entwi-ckeln sie eigenständige Lösungen. Diese haben vor allem eine faire Beachtung der Rechte (schwer-)behinderter Menschen im Blick. Die Neuauflage berücksichtigt Gesetzgebung und Rechtsprechung bis einschließlich Juni 2014.
Die Schwerpunkte:• Rechtsprechung zur Gleichstellung behinderter Menschen,
zum Anspruch auf Zusatzurlaub, zum Betrieblichen Ein-gliederungsmanagement und zu Kündigungsfragen
• Die stufenweise Wiedereingliederung• Gesetz zur Änderung personenbeförderungsrechtlicher
Vorschriften
Die Herausgeber:Werner Feldes, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz der IG Metall-Vorstandsverwaltung, Frankfurt/M.Dr. Wolfhard Kohte, Professor für Bürgerliches Recht, Deutsches und Europäisches Arbeits-, Unternehmens- und Sozialrecht an der Universität Halle.Eckart Stevens-Bartol, Jurist, zuvor langjähriger Vorsitzender Richter am Landessozialgericht München.
Teilhabe durchsetzen
Die Autorinnen und
Autoren:
Postfach60424 Frankfurt am Main
Infotelefon: 069 / 79 50 10-20
Fax: 069 / 79 50 10-11
E-Mail: [email protected]
www.bund-verlag.de/6244
Werner Feldes / Wolfhard Kohte Eckart Stevens-Bartol (Hrsg.)SGB IX – Sozialgesetzbuch Neuntes BuchRehabilitation und Teilhabe behinderter MenschenKommentar für die Praxis3., überarbeitete Auflage2015. Ca. 1.250 Seiten, gebundenSubskriptionspreis bis drei Monate nach Erscheinen:ca. € 89,–Danach: ca. € 109,–ISBN 978-3-7663-6292-6Erscheint Dezember 2014Jetzt vorbestellen
Dr. Dörte Busch,Dr. Ulrich Faber, Bettina Fraunhoffer, Eberhard Kiesche, Daniele Kopp-Schönherr, Joachim Maaßen, Prof. Dr. Katja Nebe, Ingo Nürnberger, Peter Schmitz, Stefan Soost, Dr. Hans Günther Ritz
MIT1114255_EAZ_6292_1-1_U3_4c.indd 1 10.10.14 10:51
Im RampenlichtWarum Betriebsräte Medienkompetenz brauchen
Durchstarten nach der Wahl: Seminare für Einsteiger und „alte Hasen“
BEtriEBSratSqualifiziErung
Wir vermitteln HandlungskompetenzSystematisch. Praxisorientiert. Auf dem neuesten Stand.
I Einstieg in die Betriebsratsarbeit
I Betriebsverfassungsrecht und Arbeitsrecht
I Wirtschaft und Unternehmensentwicklung
I Gesundheit und Arbeit
I Sozialrecht und Sozialpolitik
I Methoden- und Sozialkompetenz
I EDV-Einsatz und web 2.0 in der Betriebsratsarbeit
I Ausbildungen
I Individuell zugeschnittene Gremienschulungen
Programmheft anfordern
Tel. 0211/4301-234 oder
Programm-Download
und Seminarinfos:
www.betriebsratsqualifizierung.de
DGB Bildungswerk BUND
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
www.dgb-bildungswerk.de
www.betriebsratsqualifizierung.de
DGB Bildungswerk BUND
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
www.dgb-bildungswerk.de
Seminare für Einsteiger und „alte Hasen“
www.betriebsratsqualifizierung.de
DGB Bildungswerk BUND
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
www.dgb-bildungswerk.de
MitbestimmungDAS MAGAZIN DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG · WWW.MAGAZIN-MITBESTIMMUNG.DE
Mit
best
imm
ung
11/2
014
5,00
€
56.
JAH
RG
AN
G
BU
ND
-VER
LAG
IM R
AM
pEN
LIC
HT
· War
um B
etri
ebsr
äte
Med
ienk
ompe
tenz
bra
uche
n5,
00€
60
. JA
HR
GA
NG
B
UN
D-V
ERLA
G
NoVEMBER 11/2014
SpITZENGESpRÄCH · US-Arbeitsminister interessiert an erfolgreicher BetriebsratspraxisFoToREpoRTAGE · Bei den Haus- und Landbesetzern von SevillaZEITZEUGEN · Ehemalige Spitzengewerkschafter reflektieren ihre Rolle
PostvertriebsstückD 8507Entgelt bezahlt