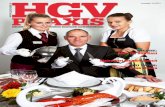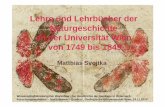stadtkino_500.pdf - Stadtkino Wien
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of stadtkino_500.pdf - Stadtkino Wien
Meisterlich ruhig und klar: Christian Petzolds Film „Barbara“ fragt,worauf ein Mensch sich verlassen kann. ELISABETH VON THADDEN
Dieser Knoten, zu dem die Frau ihre blonden Haare verschlingt und im Nacken aufsteckt, könnte ein Grund für ein Minimum an Zuversicht sein. Denn
vor der Widerspenstigkeit dieses Haarknotens muss sogar die Stasi-Offizierin kapitulieren: Sie, die vor keiner Körper-öffnung zu viel Scheu hat, um auch das Innere des Körpers auf staatsfeindliches Material zu durchsuchen, müht sich ver-geblich, den Knoten zu öffnen, um mit der Untersuchung der Republikfeindin fortfahren zu können. „Lösen Sie Ihre Haare“, fordert sie schließlich Barbara auf. Der Knoten, ein wie leichthin geschlungenes Gebilde, das aber sogar beim Radfahren auf Pflastersteinwegen dem Sturm an der Ostsee-küste standhält, scheint etwas Unverfügbares an sich zu haben, an dem sich von Staats wegen gar nichts ändern lässt. Nina Hoss als Barbara dreht dem Betrachter in Christian Petzolds Film Barbara immer wieder den Rücken zu, sodass man statt in ihre Augen in diesen Haarknoten sieht. Sie dreht sich um,
als gelte es, sich immer wieder von den Augen der anderen unabhängig zu machen. Auch um sich selbst zu schonen. Sol-len die anderen doch in den Knoten gucken.
Barbara erzählt von einer ostdeutschen Ärztin im Jahr 1980, die einen Ausreiseantrag gestellt hat und daraufhin zur Strafe von der Berliner Charité in die Provinz, an ein kleinstädtisches Krankenhaus unweit der mecklenburgischen Ostseeküste ver-setzt wird. Von dessen Fenster aus sieht ihr künftiger Oberarzt André ihrer Ankunft zu, neben ihm sitzt ein Mann von der Sta-si. Misstrauen, Abstand, Beobachtung: Die Unsicherheit, wer in dieser stillen Provinz-Szenerie wen observiert, wer was der Be-hörde berichtet, was überhaupt zu melden ist und was nicht, was im Schweigen versandet oder Widerspruch hervorrufen muss, bildet den dichten sozialen Nebel, durch den sich ein Vertrauen unter den Kollegen in diesem Krankenhaus einen Weg tasten
InhaltFarben der DDRChristian Petzold im Gesprächüber „Barbara“. 3
Kino-DienstageDie Programmeder kommenden Wochen. 4/5
Weiters läuft...Stadtkino-Hitsim Filmhaus Kino. 6
Zulassungsnummer GZ 02Z031555Verlagspostamt 1150 Wien / P.b.b.
Wer bleibt
Fortsetzung auf Seite 2 »
Das Kommunale Kino Wiens, Schwarzenbergplatz 7-8, 1030 Wien März 12 | #500
Christian Petzold, „Barbara“, ab 16. März 2012 im Stadtkino„FALTER Kino-Dienstag“, jede Woche im Filmhaus Kino
Sixpack-Schau: „Breaking Ground – 60 Jahre experimentelles Kino aus Österreich“,noch bis 27. März 2012 jeden Dienstag im Filmhaus Kino
muss. Unterdessen bereitet Barbaras Geliebter im Westen ihre Flucht vor, über die Ostsee. Am voraussichtlichen Fluchttag wird Barbara Dienst haben, auch sie also sieht man lügen, zumindest ein Mal. Nina Hoss kann meister-lich lügen, denn ihren Augen merkt man an, wie schwer Lügen ist.
In diesem Film ist man darauf angewiesen, den Menschen in die Augen zu sehen. Woran sonst sollte man erkennen, wer gerade lügt? Worauf man sich verlassen kann? Worin sonst könnte das andauernd hellwache Misstrauen gegenüber den Mitmenschen eine Überprü-fungsinstanz finden? Die Worte sind selten und vieldeutig, auch die Berührungen. Dass aber im menschlichen Auge die äußere Welt eine Entsprechung findet, dass durch das Auge der Weg zur Erkenntnis verbürgt ist, ist die alte philosophische Idee des Neuplatonismus, die hier von Christian Petzold auf die Probe ge-stellt wird, und vielleicht nimmt einen dieser Film auch deshalb so mit, weil man bis zuletzt hoffen will, dass den Augen von Menschen zu trauen ist, hier und da.
Ein Film über die DDR, der ohne Kaderdeutsch auskommtWer bleibt und wer gehen wird, das steht nie fest. Christian Petzold ist selbst ein Flüchtlings-kind, hat im Übergangslager gelebt, er kennt die Menschen, die gehen. Am Schauplatz eines Krankenhauses und am Beispiel der Ärzte, deren vieltausendfache Abwanderung in den Westen ein spürbares Trauma der DDR war, lässt er die existenzielle Frage austragen, wo-rauf ein schwacher Mensch sich verlassen darf. Und schwach sind ja alle. Liebe, Freundschaft, Kollegialität, Solidarität, ärztlicher Beistand, Nachbarschaft: Es geht um dieses Orchester menschlicher Qualitäten (ein Film mal ohne Mutterliebe, Vatermord, Ehetragödie, das sollte extra prämiert werden).
Weil die Kulisse auf die tatsächlich heute noch existierende, abgeblätterte Architektur der ostdeutschen zwanziger Jahre beschränkt ist, prägt nicht sozialistischer Plattenbaudunst die Atmosphäre. Die Akteure gewinnen ihre Energie eher aus einer sozialen Vorkriegs-
StadtkinoZeitung02 Christian Petzold, „Barbara“
» Fortsetzung von Seite 1 Zivilität, gebaut aus rotem Klinker oder als Eisenbahnersiedlung oder als Stadthaus mit Garten. Diese Szenerie kommt ohne Partei-abzeichen und Kaderdeutsch aus. Präsent ist der Staat gleichwohl. Als ein Jugendlicher ein-geliefert wird, der sich aus dem dritten Stock gestürzt hat, dreht sich das Gespräch der Ärzte um die Verletzung des Schädels, „wir müssen das melden“, sagt da beiläufig eine Ärztin über den Suizidversuch, vielleicht sagt sie es nur pro forma, „gib ihm noch ein paar Tage“, sagt leise der Oberarzt André, vielleicht sagt er es nur
zur Tarnung. Als ein Mädchen, ein verzwei-feltes Heimkind, mit einer Hirnhautentzün-dung schreiend von Polizisten in die Klinik gebracht wird, liegt bald zwischen den Ärzten die Frage in der Luft, ob man verhindern kann, dass sie ins Heim zurückmuss. Barbara nimmt das widerspenstige Mädchen in den Arm, be-vor es ins Auto der Vopos gezwungen wird. Die Vertrauensfrage, die damit gestellt wird, ist der Einsatz, um den gespielt wird, bis in die allerletzte Minute des Films.
Alles scheint davon abzuhängen, ob ein Mensch innerlich frei ist, die Würde zu wah-ren, die eigene, die der anderen. Barbaras ge-rade Körperhaltung, ihre verschränkten Arme teilen von Anfang an mit, dass man sie ohne ihre Unabhängigkeit nicht denken kann. Eine ärztliche Diagnose überzeugt sie nur, wenn sie selbst sie geprüft hat, den Fahrradreifen flickt sie mit eigenen Händen, das Westgeld versteckt sie noch beim Klingeln der Stasi im Ofenrohr, im Wald fürchtet sie nichts außer die Geheim-polizei, und ihr Augen-Make-up stammt so zweifelsfrei aus dem West-Schminkkoffer, wie die West-Zigaretten die Präsente ihres Lieb-habers sind. Sie versteckt sie nicht. Sie provo-ziert auch nicht damit. Es ist, wie es ist. Dies ist nicht nur ein Film über die letzten Jahre der DDR, sein Thema ist im viel weiteren Sinne
Christian PetzoldBarbara(Deutschland 2012)
Regie und Drehbuch Christian PetzoldDarsteller Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Christina Hecke, Claudia Geisler, Jasna Fritzi Bauer, Barbara Petzold, Deniz PetzoldKamera Hans FrommSchnitt Bettina BöhlerMusik Stefan WillTon Andreas Mücke-NiesytkaProduktion Schramm Film, ZDF, ArteVerleih StadtkinoFilmverleihLänge 105 Min.Technik 35mm / Farbe / DCPFassung deutsche OVAuszeichnung Christian Petzold wurde mit dem silbernen Bären für die beste Regie bei der Berlinale 2012 ausgezeichnet.
Ab 16. März 2012 im Stadtkinoam Schwarzenbergplatz
In diesem Film ist man darauf angewiesen, den Menschen in die Augen zu sehen.
jene Unabhängigkeit einiger Menschen, an der wahrscheinlich nie und nirgends auf der Welt je ein Staat etwas ändern kann.
Als sei nichts gewiss außereiner alles umfassendenIllusionslosigkeitAuf diese Qualität läuft die Wette, und der ru-hige, wortkarge Film schafft dafür auch visu-ellen Raum. Die weiten Küstenlandschaften, die rumpelnde städtische Straßenbahn (wo hat Petzold die bloß noch aufgetrieben?), das Re-
gionalbähnchen, das über Land fährt, die Wald-wege, vieles scheint offenzustehen, man ist un-terwegs: Transit, irgendwoanders hin. Ausreise ist überall: Als André davon berichtet, er habe ein Serum selbst hergestellt, will Barbara das Labor sehen, er wirft ihr dort die Bemerkung hin, er führe gern nach Den Haag, wegen Rembrandt, sie sagt trocken: „Antrag stellen“, soll er’s doch der Firma berichten, falls er es tut. Tut er es?
Nina Hoss, diese schöne Frau aus Augen und Haltung, ist eine Barbara, die sich einprägt, wie ein Hinweis: So eine sollte ein Mensch in sei-ner Lebenszeit einmal getroffen haben, es wäre mehr Gelassenheit in der Welt. Aber nicht we-niger stark wirkt die männliche Hauptfigur: Die weiche, immer etwas zauselige Figur des André, den Ronald Zehrfeld spielt wie einer, der in den Erinnerungswelten seiner realen ostdeutschen Kindheit schon für diese künf-tige Filmrolle täglich geprobt hat, ist allein ein Grund, diesen Film wieder und wieder sehen zu wollen.
Die Kompromisse, die dieser Arzt vielleicht, wer weiß, gemacht hat, um zwischen der Lei-denschaft für die kaum mögliche Forschung, dem Ethos des Heilens und dem aufrechten Gang einen Weg zu finden, führen in Andrés Augen ihr Schauspiel auf. Wenn er neben Bar-bara auf dem Rad durch den Wald radelt, ver-
schwimmen in ihrem Gespräch die Grenzen zwischen unmerklichem Verhör und Zuge-wandtheit bis ins Unkenntliche. Zehrfeld kann in einem Moment ganz aus Sehnsucht beste-hen, dann augenblicks wieder nur aus Verant-wortung, und dann sind die Augen leer, reglos, als sei nichts gewiss außer einer alles umfas-senden Illusionslosigkeit.
Dieser Film wird für den historischen Realis-mus des Schnarrens der Türklingel, der Abend-lichtschattierungen, von Kantinenatmosphäre, Krankenhausflurpatina und Interhotelfrivolität gepriesen, zu Recht. Es ist, als sei dies bis in die durchgebrannte Steckdose die Wirklichkeit der späten DDR, und nicht mal der Sturm in den betörend schlichten Küstenlandschaften Vor-pommerns ist romantisch, sondern realistisch zu sehen. Aber wäre dieser Film wirklich re-alistisch, so wäre das nicht trivial: Dann würde die Kunst, deren Kamera das Land in so klarem Licht liegen sieht, erkennen, dass es eine andere Möglichkeit gibt. •
Der Artikel erschien in der deutschenWochenzeitung „Die Zeit“.
Alles scheint davon abzuhängen, ob ein Mensch innerlich frei ist, die Würde zu bewahren: „Barbara“ mit Nina Hoss.
DVDEdition
DVDEdition
„Ein Meilenstein des Kinos.“
JETZT IM HANDEL UND AN UNSEREN KINOKASSEN • 14,99
© 2009/2010 IMAGINE FILM DISTRIBUTION · The content of this video device is for private home use only. Any authorized use including but not limited to copying,
editing, lending, exchanging, renting, hiring, exhibiting, public performance, radio or télé broadcasting or any other diffusion or otherwise dealing with this video
device or any part thereof is strictly prohibited. The DVD logo is a registered trademark of DVD Format/Logo Licensing Corp.
THE NETHERLANDS - BELGIUM IMA907
IMA907
Audio Subtitles
PALOriginal version English, Dutch, French, German
EPISODE III
ENJOY POVERTYa �lm by Renzo Martens
Episode III - ‘Enjoy Poverty’ investigates the value of Africa’s most
lucrative export: filmed poverty.
Episode III, also known as ‘Enjoy Poverty’, after the neon sculpture that plays a seminal
role in the film, is the registration of Renzo Martens’ activities in the Congo. In an
epic journey through Congo’s swamps, institutions and battlefieds, the Dutch artist
launches an emancipation program. This program should help the local population to
embrace their biggest capital: their poverty. As the endeavor fails, the film is no more
than an accurate representation of a status quo filled with such failures.
Episode III - ‘Enjoy Poverty’ examine la valeur de l’exportation la
plus lucrative d’Afrique: la pauvreté filmée.
Episode III, aussi connue comme ‘Enjoy Poverty’, d’après la sculpture de néon qui joue
une part essentielle dans le film, est l’enregistrement des activités de Renzo Martens
au Congo. Au cours d’un périple épique à travers les marais, les institutions et champs
de bataille du Congo, l’artiste hollandais entreprend de monter un tout nouveau
programme d’émancipation. Ce programme vise à conscientiser la population locale
de leur capital principal: leur propre pauvreté. Alors que l’entreprise échoue, le film
devient la représentation réaliste d’un status quo semé d’échecs similaires.
Episode III - ‘Enjoy Poverty’ peilt naar de waarde van Afrika’s
meest lucratieve exportartikel: gefilmde armoede.
Epiosde III, ook bekend als ‘Enjoy Poverty’, naar de neonsculptuur die een belangrijke
rol speelt in de film, is de registratie van Renzo Martens’ activiteiten in Congo. In een
epische reis doorheen Congo’s wouden, slagvelden en instituten start de kunstenaar
een emancipatieprogramma op. Dit programma helpt de lokale bevolking hun voor-
naamste kapitaal te omarmen: hun armoede. Het programma faalt jammerlijk, en de
film blijkt een realistisch verslag van een status quo gevuld met zulke mislukkingen.
Episode III - ‘Enjoy Poverty’ untersucht den Wert von Afrikas
lukrativstem Exportmittel : die gefilmte Armut.
Mitten im Kongo, Fragen über Fragen: Wie kommt es, dass das ins Land geflossene
Geld mit Gewinn wieder in die Taschen der Geldgeber zurückfließt? Weshalb sind
Hochzeitsfotos wertlos und Bilder des Elends und des Krieges begehrt? Und wem gehört
die Armut? Renzo Martens rät den Einheimischen als advocatus diaboli, sich den Markt der
aufgeregten Bilder zu erobern und den Status quo als Chance zu betrachten. Sarkastische
Rollenspiele rund um die Frage, wann die Lethargie begonnen hat und die Geduld endet.
VIEWING COPY FOR PRIVATE USE ONLY
a film by Renzo Martens produced by Renzo Martens Menselijke Activiteiten & Peter Krüger/Inti Films
The Netherlands / Belgium 2009 90 min Film format: 1:85 Video format: 16/9 BONUS: interviewEPISODE III - ‘ENJOY POVERTY’
IMA907
9789058498762
Written, directed and filmed by Renzo Martens - Producers Renzo Martens Menselijke Activiteiten (The Netherlands) - Peter Krüger,
Inti Films (Belgium) - Editor Jan De Coster - Editing consultant Eric Vander Borght - On-line facilities Condor - Sound editor Raf Enckels
Sound mixing Federik Van de Moortel - A co-production Renzo Martens Menselijke Activiteiten, Inti Films, VPRO, Lichtpunt - Produced
with the support of The Netherlands Film Fund, The Flanders Audiovisual Fund, Nationale Commissie voor Internationale Betrekkingen
en Duurzame Ontwikkeling, The Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture, Prins Bernard Cultuur Fonds, VPRO,
Lichtpunt, YLE, TSR, ORF.
The piece was screened and exhibited, to wide critical
acclaim, at the Berlin Biennal, The Stedelijk Museum
in Amsterdam, Kunsthaus Graz in Graz, Tate Modern
in London, IDFA in Amsterdam, the Centre Pompidou
in Paris, and many other places. The film is the third in
a series of three films that try to deal with the role of
the camera in a filmed world. The first in that series,
Episode I, was the registration of Renzo Martens’
activities in Chechnya. It was first shown in 2003. For
Episode II, no date is known.
L’œuvre a été projeté et exposé avec grand succès à la
Biennale de Berlin, le Stedelijk Museum d’Amsterdam,
le Kunsthaus Graz, la Tate Modern à Londres, l’IDFA à
Amsterdam, le Centre Pompidou à Paris et nombreux
autres lieux. Le film est le troisième dans une série de
trois films qui tentent de questionner leur propre rôle
dans un monde filmé. Episode I représentait les activités
de Renzo Martens en Tchétchénie et a eu sa première
en 2003. Aucune date de sortie n’est annoncée pour
Episode II.
Het werk is vertoond en tentoongesteld, met veel
reactie als gevolg, op de Berlijn Biennale, het Stedelijk
museum in Amsterdam, Kunsthaus Graz, Tate Modern,
IDFA in Amsterdam, en het Centre Pompidou in Parijs.
Episode III is de derde in een serie van drie films
die de rol van de camera in een gefilmde wereld te
onderzoeken. Episode I, de registratie van Martens’
activiteiten in Tstetsjenie, kwam uit in 2003. Voor
Episode II is geen releasedatum bekend.
Das Werk wurde mit grossem Erfolg aufgeführt und
ausgestellt unter anderem auf der Biennale in Berlin,
dem Stedelijk Museum in Amsterdam, dem Kunsthaus
Graz, der Tate Modern in London, der IDFA in
Amsterdam, dem Centre Pompidou in Paris. Der Film ist
der dritte in einer Reihe von drei Filmen, die ihre eigene
Rolle in einer gefilmten Welt zu hinterfragen versuchen.
Episode I war die Aufzeichnung der Aktivitäten von
Renzo Martens in Tschetschenien und hatte 2003 seine
Premiere. Für Episode II ist noch kein Datum bekannt.
www.enjoypoverty.com
ENJO
Y P
OV
ERT
Y
ABENDLANDein film von NikoLAus gEyrhALtEr
StadtkinoZeitung 03Christian Petzold, „Barbara“
Herr Petzold, „Barbara“ handelt von einer Ärztin in der DDR, die einen Ausreiseantrag gestellt hat und deshalb in ein Provinzkrankenhaus versetzt wurde. Wie sind Sie auf diesen Stoff gekommen?Fast zehn Jahre ist es her, dass ich zum ersten Mal mit dem Gedanken gespielt habe. Ein Buch von Hermann Broch hat mir sehr ge-fallen, eine Novelle namens Barbara, da geht‘s um eine kommunistische Widerstandskämp-ferin, die in einem Krankenhaus arbeitet, sich in einen Arzt verliebt und der sich in sie, aber sie muss weiterziehen und stirbt. Die Zeit, die Broch beschreibt, das war Ende der zwanziger Jahre, es gab also schon SA-Horden, es gab im deutschen Justiz- und Exekutivapparat schon Kommunistenjäger, es gab schon Morde. Doch dieses Milieu konnte ich mir filmisch nicht vorstellen. Ich hatte keine Bilder dazu im Kopf.
Und wie kommt es, dass Sie die Geschichte in die DDR und ins Jahr 1980 verlegt haben?2006 habe ich einen Arzt aus Fürstenwal-de kennengelernt, der erzählte mir von den Ausreiseanträgen, die einige seiner Kolle-gen gestellt hatten. Die Männer wurden in Erziehungsmaßnahmen gesteckt, um sie zu demütigen, und später mussten sie als Militärärzte arbeiten. Die Frauen wurden in Provinzkrankenhäuser versetzt, in eine Art Exil. Und da kam mir die Barbara-Geschichte wieder in den Sinn, zumal mich der Osten immer interessiert hat, meine Eltern stammen von dort. Das tiefste Gefühl meiner Eltern war Heimweh nach dem Osten.
Ihre Eltern stammen aus der Gegend in Mecklen-burg-Vorpommern, in der der Film spielt?Nein, das nicht, das hätte ich nicht geschafft, das wäre zu nah gewesen. Als ich zur Filma-kademie kam, wollte ich, dass mein allererster Film an den Sehnsuchtsorten meiner Jugend spielt, an den Originalorten, am Stromkasten, an der Autobahnraststätte, an der Autobahn-brücke, am Park, in der Stadtbücherei. Doch diese Orte hatten ihren Zauber verloren, sobald ich dort mit der Kamera stand. Erin-nerungsorte kann man nicht filmen. Und die Erinnerungsorte meiner Eltern sind natürlich auch meine eigenen, weil wir immer wieder in die DDR gefahren sind. Ich kenne diese
Orte in- und auswendig. Ich war als Junge auch in DDR-Krankenhäusern, wenn ich mich mal verletzt hatte.
Ein Krankenhaus ist ein Ort gesteigerter Intensität, weil es um Fragen von Leben und Tod geht. In Arztserien wie „Emergency Room“ wird das wie-der und wieder durchgespielt. Hat Sie das gereizt?Ja, natürlich. Meine Kinder haben immer Doctor‘s Diary geschaut, die Serie fand ich auch ziemlich lustig. Emergency Room kenne ich auch, aber die Mutter aller Krankenhaus-serien ist Das Krankenhaus am Rande der Stadt, eine tschechische Serie, die auch im Westen populär war. Von der haben sich die Amerika-ner alles abgeguckt. Da geht‘s meistens darum, dass über offenen Bauchdecken irgendwelche Dates gemacht werden. Das wollte ich nicht. Außerdem hatten die DDR-Krankenhäuser - anders als die Westkrankenhäuser - nicht diesen brutalen Druck. Es gab Bibliotheken, Lesekreise, Fußballmannschaften, Segelvereine. Es war viel ruhiger. Die Krankenschwestern, die uns beraten haben, hatten Tränen in den
Augen, als sie sich an diese Zeit erinnerten. Man kriegt das Gefühl, dort hatte man Zeit, gesund zu werden. Bei uns ist es eher eine Fabrik.
Ich hatte den Eindruck, dass Sie in „Barbara“ mit dem Zeit- und dem Lokalkolorit recht sparsam umgehen.Wir sind bis in den letzten Millimeter präzise, jeder Minigegenstand ist richtig, die Rönt-genbilder sind richtig, die Stoffe sind richtig. Aber wir dürfen die Arbeit, die wir gelei-stet haben, nicht ausstellen. Man sieht zum Beispiel keine Karawanen von Oldtimern, das hasse ich wie die Pest. Ich will Lebensräume haben, das heißt, die Sachen müssen angefasst worden sein. Kade Gruber, der Szenenbildner, und seine Gruppe bauen das zwei Monate vor Drehbeginn fertig, damit die Schauspieler die Räume und Gegenstände zu ihren eige-nen machen können. Aus diesem Glas haben sie wirklich getrunken, in dem Fotoapparat, da ist wirklich ein Film drin, und das Auto, das fahren sie wirklich alleine.
Sie haben im Sommer gedreht, wie schon oft zuvor. Warum?Weil ich wollte, dass die DDR Farben hat. Ich war jedes Jahr in der DDR, ich habe Erinnerungen an ein farbiges Land. Ich wollte unbedingt Mitte August anfangen und bis Oktober drehen, weil in diesem Zeitraum die Farbigkeit des beginnenden Herbstes da ist, mit den leichten Brauntönen. Und nachdem ich beim letzten Film mit digitalem Material gearbeitet hatte, habe ich mich jetzt wieder für Kodak und 35 Millimeter entschieden. Die Farbpalette ist so menschlich.
Einmal geht Barbara in einen Wald, um ihren Geliebten aus Westdeutschland zu treffen. Nina Hoss trägt in dieser Sequenz einen unglaublich blauen Lidschatten. Ist sie da nicht ein bisschen zu glamourös?Nein. Wenn sie zu diesem Typ rausfährt, will sie - so sagt sich Nina das - aussehen, „als ob ich zum Tangotanzen fahre“. Deswegen wur-de gekloppt mit dem Make-up. Wenn sie auf ihre Frisur, auf ihr Make-up und ihre langen Wimpern verzichtet hätte, wäre das für die Figur eine Niederlage angesichts des Systems gewesen.
Mit ihrer Anmutung wehrt sie sich gegen die Zu-mutung des DDR-Systems?Genau. Die Assistenzärztin, die von Christina Hecke gespielt wird, die hat das alles nicht. Sie ist eine sehr schöne Frau, aber sie sagt: „Das ist doch alles diese Westscheiße, diese Tussikacke.“ Im protestantischen und preu-ßischen Osten wehrte man sich gegen Luxus und Verschwendung, und dagegen wehrt sich Barbara - mit Dunhill-Zigaretten und Seidenunterwäsche …
… die sie von ihrem Geliebten aus dem Westen be-kommt. Es ist nichts Neues, dass in Ihren Filmen die Gefühle und materiellen Vorteile ineinander verschränkt werden. Es gibt keine Gefühle, die nicht zu verwerten wären.Ja, aber sie dürfen auch verschwendet werden! Barbara glaubt, dass sie in Westdeutschland die tiefen und wahren und leichten Gefühle findet, dass sie sich dort verschwenden kann. Denn der Osten ist für sie zu vernünftig. Wie Biermann singt: „Bei uns ist Ordnung groß, wie bei den sieben Zwergen.“ Barbara will tanzen, sie will Seide, Schweiß, Verschwen-dung, das ist für sie der Westen. Und dann sagt ihr Geliebter zu ihr: „Wenn du im We-sten bist, kannst du ausschlafen. Du brauchst nicht mehr arbeiten.“ Sie hört diesen Satz im Hotelbett, nach dem Schnitt sitzt sie in einem Schienenbus und guckt aus dem Fenster. Und in ihrem Gesicht arbeitet irgendwas, wir wissen nicht, was es ist.
Dieses Interview erschien in der „taz“.Abdruck mit freundlicher Genehmigung.
„Ich wollte, dass dieDDR Farben hat“Christian Petzold über Heimweh, Krankenhäuser in der DDRund die Bedeutung von Make-up in „Barbara“. crISTINA NOrD
Nina Hoss: „Barbara“ ist ihr fünfter Film mit Christian Petzold.
Ernst Schmidt, jr.BERühmtE WIEnERIEnnEn nAcKt: DIE GESchIchtE DES PIP-UPS(1983 / 16mm / col / stumm / 9 min)Peter WeibeltV + Vt WoRKS(1969-72 / video / sw / 17:30 min)Billy RoiszcloSE YoUR EYES(2009 / video / col / 13 min)VAlIE EXPoRtmAnn & FRAU & AnImAl(1970-73 / 16mm / col / 10 min)Kurt Kren22/69 hAPPY EnD(1969 / 16mm / sw / stumm / 4 min)
Dienstag, 20. märz 201221.00 Uhr
Programm 8Passing time Zeitlicher Abstand und eine gewisse Distanz waren für die visuellen Künstler hierzulande wahrscheinlich nötig, um überhaupt damit be-ginnen zu können, die Nachwehen der Na-zizeit zu reflektieren. Dieses Programm ent-hält selten gezeigte Arbeiten, die sich mit der jüngeren Geschichte Österreichs auseinander setzen. Sie zogen klarerweise heftige gesell-schaftspolitische und künstlerische Reaktionen nach sich – das galt für die Wiener Aktionisten ebenso, wie auch für die Studentenproteste im Mai 1968. Die Aufarbeitung der „dunklen Seite“ bezieht sich in diesem Programm da-rüber hinaus auch auf die Auseinandersetzung mit der Transformation von Städten oder der (politischen) Geschichte benachbarter Länder – all das mittels sorgfältig gewähltem Found Footage.
linda christanellnS tRIloGIE PARt II:GEFühl KAzEt(1997 / 16mm / col / 14 min)Elke GroennIGhtStIll (2007 / 35mm / col / 9 min)Ernst Schmidt jr.KUnSt & REVolUtIon(1968 / 16mm / sw, col / stumm / 2 min)
Schulen des Lebens und des KinosDIe aktuellen HIgHlIgHts In DeR belIebten ReIHe „FalteR kIno-DIenstag“ Im FIlmHaus kIno
„BREAKING GROUND“ – Im Rahmen der Reihe „FALTER Kino-Dienstag“ wird die große SIXPACK-Retrospektive zum Thema „Österreichischer Avantgarde-Film“ fortgesetzt und bis 27. März abgeschlossen. Weiters in unserem Programm für Stadtkino-Freunde und andere Cineasten: Eine Preview von Othmar Schmiderers neuem Dokumen-tarfilm Stoff der Heimat, eine Wiederbegegnung mit Christian Petzolds erstem Meisterwerk Die innere Sicherheit und eine Vorpremiere von Doris Kittlers Schul-Film 1 + 1 = 100. Viel Vergnügen!
Dienstag, 20. märz 201219.00 Uhr
Programm 7In AweDas Programm versammelt Arbeiten, die die Einbahnkommunikation des Kinos und seiner herkömmlichen Codes zum Thema haben: jenes Spektakel auf der Leinwand, das den Zuseher zum naiven Bewunderer macht.Radikale Auseinandersetzungen mit dem Fernsehen in seiner damals noch jungen Entwicklung oder dem sexuellen Begehren – explizit im Close-Up oder bloß imagi-niert – gehören zu dieser Frage ebenso wie das ehrfurchtsvolle Staunen beim (Wieder)sehen von Klassikern des Genres. All das sind Meilensteine in der Geschichte der ös-terreichischen Filmavantgarde. Wenn wir unsere Iris auf Berühmte Wienerinnen richten verschließen wir unsere Augen nicht für das Happy-End. Können wir unseren voyeuris-tischen Blick bis zum Ende durchhalten?
Siegfried A. FruhaufEXPoSED (2001 / 16mm / sw / 9 min)Peter KubelkaADEBAR (1957-58 / 35mm / col / 1:30 min)SchWEchAtER(1957-58 / 35mm / col / 1 min)maria lassnigIRIS (1971 / 16mm / col / 10 min)Friedl vom GröllerlE BARomEtRE(2001 / 35mm / sw / stumm / 3 min)
Gustav Deutsch55/95 (1994 / 16mm / sw / 1 min)Alfred KaiserEIn DRIttES REIch(1975 / 16mm / sw / 29 min)Elke GroentIto-mAtERIAl(1998 / 16mm / col / 5 min)michaela Grill & martin StiewertcItYScAPES (2007 / 35mm / sw /16 min)Kurt Kren20/68 SchAtzI(1968 / 16mm / sw / stumm / 2:30 min)
Dienstag, 20. märz 201222.30 Uhr
Billy Roisz, Michaela Grill und Siegfried A. Fruhauf im Gespräch mit Gerald Weber.
Dienstag, 27. märz 201219.00 Uhr
Programm 9Whose Reality?Diese vier „choreografierten“ Dokumentar-filme bewegen sich zwischen dem Innen und dem Außen, dem Öffentlichen und Privaten, dem Sichtbaren und Unsichtbaren, zwischen dem Kontrollierten und dem Unkontrollierten: Hier wird unterschiedlichen Aspekten der po-litischen Arena auf den Grund gegangen. Vom Essay über den Status von Flüchtlingen und illegalen Migrantinnen der „Festung Europa“ bis hin zu einer aktionistischen Performance, werden Überwachung, öffentlicher Raum und hyperreale Sozialbauten hinterfragt oder klas-sische Familienmodelle in Frage untergraben.
Kurt Kren6/64 mAmA UnD PAPA(1964 / 16mm / col / stumm / 4 min)michael Palm, Willi DornerBoDY tRAIl (2008 / video / sw / 8 min)Ascan Breuer, Ursula hansbauer,Wolfgang KonradFoRSt (2005 / video / col / 50 min)Ella RaidelSomEWhERE, lAtE AFtERnoon (2007 / video / col / 11 min)
Dienstag, 27. märz 201221.00 Uhr
Programm 10Visiting our neighboursGeografisch kleine oder isolierte Länder ha-ben oft auch ein überproportionales Inte-resse an der Welt außerhalb ihrer Grenzen. Der Schlüssel der hier versammelten Ar-beiten liegt in der Analyse der Betrachtung von „exotischen“ Bildern, der Montage und Bearbeitung von Material aus Vergangenheit und Gegenwart. Narrative Annäherungen, dokumentarisches Material sowie Found-Footage-Rekonstruktionen hinterfragen dabei unter anderen familiäre Verhältnisse in ländlichen Gemeinschaften in den 1950ern, moralische und visuelle Konnotationen des Kolonialismus und des Blicks auf die Frem-de oder kollektive Erfahrungen von Flucht und Migration. Auf formaler Ebene arbeiten sie dabei mit Verschiebungen von Bildern und Tönen, auf inhaltlicher Ebene mit De-platzierungen von Individuen und Commu-nities.
herbert VeselyAn DIESEn ABEnDEn(1952 / 35mm / sw / 23 min)Dietmar BrehmoStAFRIKA (1993 / 16mm / col / 6 min)Ferry RadaxSonnE hAlt!(1959-60 / 35mm / sw / 25 minthomas AigelsreiterKEY WESt (2002 / video / sw / 5 min)Gustav DeutschFIlm ISt. 9 – ERoBERUnG(2002 / 35mm / sw / 18 min)lisl PongerPASSAGEn (1996 / 35mm / col / 11 min)Peter KubelkaUnSERE AFRIKAREISE(1961-66 / 16mm / col / 12:30 min)
Dienstag, 27. märz 201222.30 Uhr
Lisl Ponger und Peter Kubelka im Gespräch mit Claus Philipp.
Trachtenmode, Tradition und Identität: „Stoff der Heimat“ von Othmar Schmiderer im Stadtkino Filmverleih.
StadtkinoZeitung04 „FALTER Kino-Dienstag“ im Filmhaus Kino
StadtkinoZeitung 05„FALTER Kino-Dienstag“ im Filmhaus Kino
Dienstag, 3. April 201221.00 Uhr
PREVIEW:StoFF DER hEImAtDirndl, Lederhose, Janker, Wadlstrümpf – an der Tracht scheiden sich die Geister. Doch Identität stiftet sie allen und allen bietet sie Heimat: der Modedesignerin, die englische Vorhangstoffe verarbeitet; der Künstlerin, die die Dirndl-Moschee erfindet; den Schuhplatt-lern und den Schützenvereinen. Zu Beginn entdeckt Othmar Schmiderer die Bekenntnis-kleidung in der Ecke der konservativen Politik, die sie zu niederen manipulativen Zwecken einsetzt. Dort holt er sie sodann heraus und setzt zum Streifzug an. Quer durch die Milie-us, quer durch die Geschichte, quer durch die Regionen. Vergnüglich, aufschlussreich und schön anzusehen. Viennale Katalog 2011
Der Stoff der Heimat - Wie ist dieser Stoff be-schaffen? Das Phänomen der Tracht - Kultur, Politik und nationaler Mythos - in ihrer Viel-falt von den Anfängen bis heute – exempla-risch betrachtet in Österreich, Bayern, Schweiz, Südtirol. Der Fokus richtet sich auf den je-weiligen Habitus und Kleidercode einzelner ProtagonistInnen oder Gruppen, auf Rituale und Lebenshaltungen in ihrer politischen Be-deutung, ihrem gesellschaftlichen Stellenwert und dem überbordenden Symbolcharakter. Stoff der Heimat zeigt den Umgang mit Tra-ditionen im Spannungsfeld der Moderne, die Konstruktion von Identität und Heimat.
Vorführung in Anwesenheit des Regisseurs Othmar Schmiderer. Im Anschluss daran: Schmiderer im Gespräch mit Claus Philipp.
Dienstag, 10. April 201221.00 Uhr
REVISItED:„DIE InnERE SIchERhEIt“Einst wollten sie mit Gewalt die Welt verbes-sern, nun frisst Angst ihre Seele auf: Clara und Hans gehörten zur RAF und flüchten seit Jahren durch die deutschen Touristenburgen Portugals. Eine perfekte Tarnung ist alles, die unauffälligen Grautöne. Doch „How to hang on to a dream“? Fragend säuselt Tim Hardins Lied aus einer Musikbox und wird zum Motto eines intensiven, stillen Films über anachroni-stische Ideale und die grenzenlose Verlorenheit eines Teenagers.
Die Innere Sicherheit hieß 2000 das Kinodebüt des damals 40-jährigen Christian Petzold und passt wunderbar zur immer noch gegenwär-tigen Gesinnungsschnüffelei unter führenden Politikern. Ausgerechnet eine Terroristentoch-ter hat sie losgetreten, die Tochter von Ulrike Meinhof. Was trieb Bettina Röhl zu ihrer verqueren Revanche? Verratene Ideale? Zu wenig Liebe? Eine geopferte Jugend? Daran denkt man, während Christian Petzold seine Geschichte erzählt, ohne sich um Biographien zu kümmern oder um Stimmungsbilder einer bleiernen Zeit.
Seine Filmheldin ist 15, heißt Jeanne und ist von Schuldzuweisungen noch meilenweit ent-fernt. Blass und verloren nippt sie an ihrer Cola auf einer zugigen Terrasse im winterlichen Sü-den, als sich plötzlich Heinrich zu ihr setzt, ein Wellenreiter aus reichem Haus. Jeannes Un-sicherheit beim Small Talk, seine wachsende Neugier an dem seltsamen Mädchen - schon fliegen die Funken der ersten Liebe, da naht Hans, der misstrauische Vater, um alles zu un-terbinden, was außer Kontrolle gerät.
Ein folgenschwerer Zufall treibt die Fami-lie zur Flucht in ein verändertes Deutschland, zu ehemaligen Genossen, die sich längst mit dem System arrangierten. Sie sind vermögend geworden oder Alkoholiker. Die alten Idea-le haben ihren Wert verloren wie die Geld-scheine, die noch in einigen Verstecken mo-dern. Clara und Hans sind Störenfriede, deren 68er-Vokabular keiner mehr spricht - Geister einer verblichenen Zeit. Nur in ihrer selbst-gerechten Weltverbesserungspose sind die bei-den wirklich stark. Sie wollen nach Brasilien und endlich Sicherheit. Aber wie, ohne Geld? Angst wächst sich zur Paranoia aus: Wenn Hans vor der roten Ampel an einer menschenleeren Kreuzung hält, sich dunkle Wagen bedrohlich nähern und der Film in Hans Kopf realer wird, als die Wirklichkeit. Momente einer enormen
liter
atur
22
Auto
ren
2 W
erke
1 Ge
sprä
ch
16. April 2012
Franzobel Ernst Molden
23. April 2012
Friedrich Achleitner Franz Schuh
6. Mai 2012
Konrad Paul Liessmann Michael Köhlmaier
30. März 2012 Lesung zum 100. Todestag von Karl May
Vom Wunsch Indianer zu werdenvon Peter Henisch mit Silvia Meisterle, Erwin Steinhauer und Florian Teichtmeister
Kammerspielewww.josefstadt.org
Infos unter: T 01-42-700-300
Spannung, die beredter sind als alle Phrasen vom Klassenkampf.
Und Jeanne? Sie liebt ihre Eltern, niemand sonst wohnt in ihrer engen Welt. Stoisch er-trägt sie elende Klamotten, fügt sich ins strik-te Reglement, das Kontakte und Freunde verbietet und jede Art von Kommunikation. Leider sehen Clara und Hans Jeannes Op-fer nicht. Sie vermögen nicht in den Blicken ihrer Tochter zu lesen, die vom Leiden spre-chen an der unverdienten Isolation, an den Lebensentwürfen, die nicht die ihren sind. Und vom Verzicht auf all den wichtigen Tee-nagerkram, der das Erwachsenwerden so an-genehm versüßt.
Doch Jeanne will endlich sichtbar wer-den, sie will eine eigene Identität, und jetzt bekommt sie die Chance dazu. Stolz präsen-tiert sie einen sicheren Unterschlupf, den ihr der Surfer verriet. Sie übernimmt die Besor-gungen und spioniert sogar Banken für den geplanten Überfall aus. Und sie trifft Heinrich wieder, der in Wirklichkeit Heizungen mon-tiert. Mit ihm kehrt die Wucht der Gefühle wieder, die Jeanne ersticken muss, will sie die Eltern nicht gefährden. Aber die Sehnsucht nach Liebe ist stärker und führt unausweich-lich zur Katastrophe.
Der blutige Banküberfall, Flucht, Unfall und Tod - am Ende steht Jeanne alleine da. Stumm blutend - aber nicht neugeboren. In ihrer Rolle hat das Nachwuchstalent Julia Hummer Großartiges geleistet. Sie zeigt ohne viele Worte den ganzen Ansturm sich wider-sprechender Gefühle. Barbara Auer und Richy Müller hingegen sind durchdrungen vom Eifer derer, die besessen auf die Fast-Forward-Taste der Geschichte drücken und nur sich selber le-ben. Ein beeindruckendes Ensemble in einem großartigen Roadmovie mit leisen, sensiblen Bildern. (DER SPIEGEL, Januar 2001)
Dienstag, 17. April 201221.00 Uhr
VoRPREmIERE„1 + 1 = 100“Leon hält es in der Volksschule nicht mehr aus und beschließt, an eine Klasse in der Periphe-rie Wiens zu wechseln. Dort fühlt er sich wie ein neuer Mensch: Er wird respektiert, darf spielerisch seinen Träumen nachgehen und leben lernen. Seit Jahren wird dieser Schul-versuch einer Mehrstufen-Integrationsklasse von engagierten Lehrerinnen geführt, die aus diversen Lehrmethoden ihren ganz eigenen Stil kreiert haben. Was von allen Seiten, ja so-gar schon von der Wirtschaft gefordert wird, ist hier längst Realität: Kinder erleben Schule lustvoll und wachsen zu selbstbestimmten und kreativen Menschen heran.
In Doris Kittlers Film 1 + 1 = 100 erleben wir Kinder in all ihrer Weisheit, feurig disku-
tierend, auf Sesseln turnend und am Boden lümmelnd. Ihr Schulalltag ist anders, als die meisten von uns ihn aus ihrer eigenen Kind-heit kennen: Ohne Druck vor Notengebung und ohne Zeitstress haben sie genug Muße, Dinge für sich zu entdecken und lieben zu lernen. Buchstäblich mit Haut und Haar wer-den abstrakte Lehrinhalte spielerisch begrif-fen und verinnerlicht, wenn etwa das „B“ aus echtem Teig gebacken, die Stadt Wien à Mi-niatur gebaut oder ein Kilo Reiskörner akri-bisch gezählt werden. Beschämt stellen wir
fest, dass Kinder einander gegenseitig Lehre-rInnen sind: Ältere helfen Jüngeren, während Kinder mit besonderen Bedürfnissen ganz natürlich in der Gemeinschaft agieren und respektiert werden. – Eine Schulklasse als Bei-spiel für die Welt.
Vorführung in Anwesenheit der Regisseurin Doris Kittler, die im Anschluss auch für ein Publikumsgespräch zur Verfügung steht. 1 + 1 = 100 läuft ab 20. April 2012 regulär im Film-haus Kino am Spittelberg.
Lernen fürs Leben: „1 + 1 = 100“, ein Dokumentarfilm von Doris Kittler.
StadtkinoZeitung06 Hits aus dem Stadtkino-Filmverleih
Impressum Telefonische Reservierungen Kino 712 62 76 (Während der Kas-saöffnungszeiten) Büro 522 48 14 (Mo. bis Do. 8.30–17.00 Uhr Fr. 8.30–14.00 Uhr) 1070 Wien, Spittelberggasse 3 www.stadtkinowien.at / [email protected] Stadtkino 1030 Wien, Schwarzenbergplatz 7–8, Tel. 712 62 76 Herausgeber, Medieninhaber Stadt-kino Filmverleih und Kinobetriebsgesellschaft m.b.H., 1070 Wien, Spittelberggasse 3 Graphisches Konzept Markus raffetseder Redaktion claus Philipp Druck Goldmann Druck, 3430 Tulln, Königstetter Straße 132 Offenlegung gemäß Mediengesetz 1. Jänner 1982 Nach § 25 (2) Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs-gesellschaft m.b.H. Unternehmungsgegenstand Kino, Verleih, Videothek Nach § 25 (4) Ver-mittlung von Informationen auf dem Sektor Film und Kino-Kultur. Ankündigung von Veranstal-tungen des Stadtkinos. Preis pro Nummer 7 Cent / Zulassungsnummer GZ 02Z031555 Verlagspostamt 1150 Wien / P.b.b.
Weiterhin in den kinos...
Wer das Meer regiert, ruiniert die Welt: „The Forgotten Space“ von Allan Sekula und Noel Burch, jetzt im Filmhaus Kino.
Brilliant: „Anfang 80“ mit Karl Merkatz und Christine Ostermayer. Läuft und läuft und läuft: Aki Kaurismäkis „Le Havre“.
Überraschungshit: „Meek‘s Cutoff“ von Kelly Reichardt.
Silberner Bär 2011: „Schlafkrankheit“ von Ulrich Köhler.
Roman BerkaChristoph Schlingen-siefs AnimatographZum Raum wirdhier die ZeitGra� sche Konzeption
Richard Ferkl
2011, ISBN 978-3-7091-
0489-7, Erscheinungstermin: Juni 2011
Karl WuttAfghanistanvon innen und außenWelten des HindukuschGra� sche Konzeption
Werner Korn
2010, ISBN 978-3-211-
99153-4, € 39,95
„Afghanistan: Ein Land gegen die Zeit. Karl Wutt, Ethnologe und Architekt, drang seit 1971 in Gegenden vor, die selbst für afghanische Verhältnisse als abgeschieden gelten, ließ sich in Gebirgstälern einschneien und wurde dabei zum Chronisten abseits der massenmedialen Logik, die sich für Afghanistan ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des bewa� neten Kon� ikts interessiert.“ Martin Staudinger, pro� l, Wien
Cathrin Pichler,Roman Berka (Hg.)TransActTransnational Activities in the Cultural Field / Interventionen zur Lage in Österreich museum in progress
Gra� sche Konzeption Ecke Bonk, Richard Ferkl
2010, ISBN 978-3-211-99800-7, € 39,95
Zeugnisse zivilen Ungehorsams gegen Schwarz-Blau. – Ein wertvolles Dokument zur Zeitge-schichte.“
Gregor Auenhammer, Der Standard, Wien
Graue Donau, Schwarzes Meer
WienSulinaOdessaJaltaIstanbul
Herausgegeben von Christian Reder und Erich Klein
Christian Reder, Erich Klein (Hg.)Graue Donau, Schwarzes MeerWien Sulina OdessaJalta IstanbulGra� sche Konzeption
Stefan Fuhrer
2008, ISBN 978-3-211-75482-5, € 39,95
„Ein in seiner Materialfülle und gedanklichen Weite beeindruckendes Buch, das jetzt schon als Standardwerk zum � ema bezeichnet wer-den muss.“ Erwin Riess, Die Presse, Wien„Die Vermessung von Zwischeneuropa … ist einem produktiven Methodensynkretismus verp� ichtet, der sich durch vorurteilslose Of-fenheit auszeichnet.“ Christoph Winder, Der Standard, Wien
Irini AthanassakisDie Aktie als BildZur Kulturgeschichte von WertpapierenGra� sche Konzeption
Helga Aichmaier,
Kasimir Reimann
2008,
ISBN 978-3-211-75489-4, € 41,04
„Die Autorin untersucht 400 Jahre Aktienge-schichte und analysiert Eckpunkte der Kultur- und Finanzgeschichte vom frühen Bankwesen der Medici bis hin zur elektronischen Demate-rialisierung des heutigen Aktienhandels – einesozialkritische Auseinandersetzung mit den Werten des globalen Kapitalismus unter Be-rücksichtigung gestalterischer Zugänge.“ Michael Hausenblas, Der Standard, Wien
Ernst StrouhalUmweg nach BuckowBildunterschriftenGra� sche Konzeption
Werner Korn
2009, ISBN 978-3-211-
75731-4, € 39,95
„Übungen in Eleganz und Diskretion. Die Es-says von Ernst Strouhal in der ‚Edition Trans-fer’ zitieren Wunderdinge aus vielen Zeiten und Orten herbei. – Als einer der elegantes-ten und klügsten Essayschreiber des Landes …re� ektiert er über das Leben in einer Welt, die alle Utopien eingebüßt hat …“ Christoph Winder, Der Standard, Wien
Christian Reder (Hg.)Lesebuch ProjekteVorgriffe, Ausbrüchein die FerneGra� sche Konzeption
Werner Korn
2006, ISBN 978-3-211-
28587-9, € 33,87
„Romantiker der Tat. Christian Reder stellt Pro-jektdenker von heute vor, von Alexander Kluge über Christoph Schlingensief und Anselm Kie-fer bis zu Zaha Hadid, die das Phänomen des Projektes von unterschiedlichen Perspektiven beleuchten …“ Philipp Blom, Der Standard, Wien
Daniel DefoeEin Essayüber ProjekteLondon 1697Herausgegeben und kom-mentiert vonChristian RederGra� sche Konzeption Werner
Korn, 2006, ISBN 978-3-211-29564-9, € 27,71
„Defoes ‚Essay über Projekte’ richtet sich gegen jene – Politiker, Geschäftsleute, Künstler – die die Allgemeinheit be- und ausnützen, statt ihr mit Wissen und Phantasie zu dienen …“ Stefana Sabin, Neue Zürcher Zeitung, Zürich„Eine faszinierende Geschichte des Denkens in Projekten in der Moderne und in der frühen Neuzeit.“ Heinz Schelle, ProjektMANAGEMENT aktuell, Nürnberg
Alexander KlugeMagazin des GlücksHerausgegeben von Sebastian Huber und Claus PhilippGra� sche Konzeption
Werner Korn 2007, ISBN 978-3-211-48648-1
€ 33,87 mit DVD
Der Band enthält Konzentrate aus dem „Maga-zin des Glücks“, das Alexander Kluge im Rah-men der Salzburger Festspiele 2006 als „Salon zur Erforschung des Komischen“ veranstaltet hat.
Christian RederForschende Denk-weisenEssays zukünstlerischem ArbeitenGra� sche Konzeption
Walter Pichler, 2004, ISBN
978-3-211-20523-5, € 27,71
„Nahezu allein steht ein Buch zu künstleri-schem Forschen mit künstlerischen Mitteln: Christian Reders Forschende Denkweisen. Es-says zu künstlerischem Arbeiten.“ Burghart Schmidt, Wespennest, Wien
Richard Reichensperger(rire)Literaturkritik | KulturkritikHerausgegeben von Claus Philipp und Christiane ZinzenGra� sche Konzeption
Werner Korn, 2005, ISBN 978-3-
211-22260-7, € 15,00
„So werde ich, glaub ich, an Richard Reichen-sperger denken: Einer, der alles eingefangen hat, indem er es nicht behalten wollte, sondern weitergeben.“ Elfriede Jelinek in ihrem Vorwort„Seine Kritiken und Aufsätze waren voller Wis-sen. Das hat ihnen ermöglicht, selbst in der Kürze weite gedankliche Strecken zurückzule-gen, erhellende Analogien zu � nden …“ Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung, Zürich
SpringerWienNewYork EditionTransfer Herausgegeben von Christian Reder Zentrum für Kunst- und Wissenstransfer | Universität für angewandte Kunst Wien
Essayistisches ForschenDie Edition Transfer ist auf forschende Zugänge ausgerichtet, in denen textliche, essay istische und visuelle Ebenen miteinander korrespondieren,um verschiedene Aspekte von Transfers – zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Disziplinen, Denkzonen, Kulturen – in analytisch-fragender Weisezu behandeln und mit Zusammenhänge herstellender Projektarbeit zu verbinden.
Preisänderungen vorbehalten
Hans Ulrich ReckDas Bild zeigt das Bild selber als AbwesendesZu den Spannungen zwi-schen Kunst, Medien und visueller KulturGra� sche Konzeption
Werner Korn
2007, ISBN 978-3-211-48960-4, € 34,95
… zur gegenwärtigen Lage der Bilder …
Christian RederAfghanistan,fragmentarischGra� sche Konzeption
Lo Breier, 2004, ISBN 978-3-
211-20428, € 25.-
„In gut recherchierten Rückblicken stellt Reder dar, dass es in der Entwicklung des Landes wäh-rend des Ost-West-Kon� ikts durchaus andere Möglichkeiten gegeben hätte als systematisch auf Radikalisierung zu setzen.“ Janet Kursawe, DAVO-Nachrichten, Mainz
Christian Reder,El� e Semotan (Hg.)SaharaText und BildessaysGra� sche Konzeption
St. Fuhrer, T. van Duyne
2004, ISBN 978-3-211-
21078-9, € 39,95
„Ein wahrer Prachtband … nicht für Teetisch-chen sondern ein handfestes Lesebuch.“ Claus Phiilipp, Der Standard, Wien„Die Wüste lebt in diesem erstaunlichen Buch – das mit seinem Reichtum an Perspektiven in Staunen versetzt.“ Christoph Winder, Wespennest, Wien
Manfred FaßlerErdachte WeltenDie mediale Evolutionglobaler Kulturen2005, ISBN 978-3-211-
23826-4, € 29.-
… über die mediale Selbstbefähigung des Menschen …
Christian Reder, Simonetta Ferfoglia (Hg.)Transfer Projekt Damaskusurban orient-ation2003, deutsch
arabisch,
ISBN 978-3-211.00460-9, € 34.-
„ … Vorstellungen von Orient und Moderne, Urbanität und Migration …“ Susanne Mayer, Die Zeit, Hamburg„� is project and its outcome have a signi� cant importance at this point in time …“ Syria Times, Damaskus
Stoff der Heimat-----------------------------------------------------
Ein Film von Othmar SchmidererNach einer Idee von Elsbeth Wallnöfer Regie & Kamera Othmar Schmiderer Konzept Othmar Schmiderer & Elsbeth Wallnöfer Montage Daniel Pöhacker Ton Georg Misch Musik Wolfgang Mitterer
2. Kamera Daniel Pöhacker Sounddesign Nils Kirchho� Aufnahmeleitung, Interviews Elsbeth Wallnöfer Dramaturgische Beratung Angela Summereder, Michael Palm Produzent Othmar Schmiderer Colorgrading Klaus Pamminger – Mischief Films Tonstudio BASISberlin Tonmischung Ansgar Frerich Kopierwerk Listo Film&Video Produktion o. schmiderer � lm-produktion
AB 13. APRIL IM GARTENBAU KINO